
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
neben dem dramatischen – bis zur Berufung als Direktor der Staatsoper in Wien, Herbst 1919.
Mit der ersten Bearbeitung der Ariadne endet jene lückenlose Zeit von Straußens Opernschaffen, die eine so beispiellose innere und äußere Ausbreitung seiner künstlerischen Persönlichkeit mit sich brachte. Der folgende, die Jahre 1912 bis einschließlich 1919 umfassende Abschnitt seiner schöpferischen Tätigkeit bringt deren ältere Formen wieder zu Ehren. Die reine Orchestermusik im Festlichen Präludium, die nach Programm gestaltende in der Alpensymphonie, die unbegleitete Chorlyrik in der Deutschen Motette, endlich auch wieder die Liedkunst, ja, in dem Klavierkonzertstück, das die Begleitung von Opus 68, 6, Lied der Frauen, vorstellt, sogar wieder die echt Straußische Pianistik. Dazwischen steht, schon bald nach Anfang dieses Zeitraums, erstmalig die selbständig abgeschlossene Gestaltung einer die stumme Handlung begleitenden (mimodramatischen) Musik in der Joseph-Legende.
Den hochgeschwungenen Eingang dieses neuen Zeitraums bildet das in echt Straußischer Erhebung und Weichheit der Melodik breit hinströmende Festliche Präludium für großes Orchester und Orgel, Opus 61, zur Einweihung des Wiener Konzerthauses am 19. Oktober 1913, beendet am 11. Mai in Garmisch. Man hat diesen großangelegten Orchestersatz häufig als Gelegenheitsarbeit kurz abtun wollen, und die Spielfolgen unserer großen Orchestervereinigungen sind dieser Anschauung so ziemlich gefolgt. Jedenfalls vermied man damit bequem die Bereitstellung der außerordentlichen Mittel. Bei einem Feststück, das durchaus auf planvolle Anordnung dieser Mittel zur Schlußsteigerung hin angelegt ist, kann man natürlich nicht, wie es gelegentlich auch geschah, die räumlich über das Orchester gestellten krönenden Extratrompeten einfach weglassen, ohne dem Aufbau die Spitze abzubrechen. Man wird zugeben, daß außer dieser äußeren Anordnung, der Verteilung zwischen Orgel, Orchester, und dem Zusammenwirken beider, wie dem Hervortreten, Mit- und Gegeneinandergehn der einzelnen Instrumentengruppen, auch die Gliederung nach Seite der Taktarten, Rhythmen, Zeitmaße und Stärkegrade hin, in hohem Maße klar und wohlgelungen ist, daß innerhalb des gegebenen Festredentones von großem Stil eine scharf umrissene, empfindungsstark vornehme und geistvolle Persönlichkeit des Redners in dem thematischen Stoffe mit seiner fließend zu Höhepunkten führenden Verarbeitung deutlichst zur Geltung kommt und besonders die Pianostellen diese Linie in gewinnender Weise zeigen. Auch wird, wie bei nahezu jedem Werke von Strauß, Klavierlieder ausgenommen, kaum jemand die oft viel zu wenig beachtete Hauptfrage bejahen können, ob uns irgendeine Feder, außer eben der seinen, das betreffende Werk hätte schenken können.
Wenige Wochen nach dem Festlichen Präludium, am 22. Juni 1913, beendete Strauß, gleichfalls noch in Garmisch, die Deutsche Motette, nach Worten von Friedrich Rückert, für vier Solostimmen und sechzehnstimmigen gemischten Chor a cappella, Opus 62, Professor Hugo Rüdel und dem ausgezeichneten Hoftheatersingchor in Berlin gewidmet. In diesem ergreifend feierlich gestimmten Abendgebet Rückerts greift Strauß auf den Dichter der Vorlage zu seinem Opus 34 für die annähernd gleiche Besetzung zurück. Den Singstimmen, die oft genug mit instrumental wirkender Tonmalerei behandelt sind, zwingt er den Umfang von vier Oktaven auf, vom großen cis des Basses, der sogar gelegentlich Kontra-H und -B anzusetzen hat, bis zum dreigestrichenen cis des Soprans, so daß man manchmal versucht wäre, das Wort »Stimme« hier im weitesten, unbestimmten Sinne alter Musik zu verstehen, und einzelne an der Grenze des Umfangs gelegene Stellen oben mit Flöte oder Violine, unten mit Violoncell oder Baß zu besetzen. Jedenfalls wäre eine, auch vom Standpunkt der Tonreinheit ersprießliche, versteckte Stützung des Vokalkörpers durch Instrumente hier wünschenswerter, als die völlige Vernachlässigung des zu hoher Wirkung berufenen Werkes.
Jene tiefsten Stellen sind meist ohne Absicht so gesetzt, daß die gute Wirkung nicht verlorengeht, auch wenn sie nahezu unhörbar bleiben. Das »sechzehnstimmig« des Chors bedeutet natürlich nicht dasselbe wie ebensoviel reale Stimmen im Sinne etwa der alten Niederländer. Der Tonsetzer gibt damit nur die Besetzung seiner Palette an, der außer dem gemischten Soloquartett noch vier solche mehrfach besetzt, von jeder der vier Stimmgattungen zu Gebote stehn, ein Reichtum, den er kaum in einem Takte vollständig benützt.
Den breitesten Raum nimmt die fugenartige Durchführung des gesangvollen, zu Engführungen sehr geeigneten Themas ein:
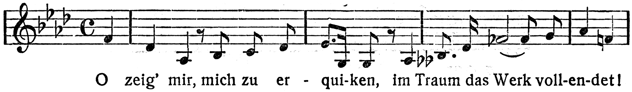
Dadurch, daß die mit dieser Form wechselnde »Antwort« darauf mit dem Quartenschritt, statt mit der Terz beginnt,

erscheint der Anfang als Umkehrung des gleich im Beginn des Werkes aufgetretenen ersten Hauptthemas:
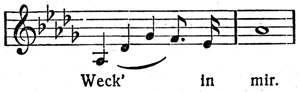
mit dem es alsbald kontrapunktiert wird. Der Schluß bringt ein wundersam ineinander verwobenes Anklingen dieser und der sonstigen Hauptmotive, wie der stimmungschaffenden Anfangstakte des Ganzen:

des malenden Motivs der niederhangenden Lebensfrüchte,

eingeleitet durch das neu eingeführte wiegende Schlußmotiv »In deinem Schoße will ich schlummern«.

Die Uraufführung in der Berliner Philharmonie am 2. Dezember 1913 durch den Hoftheatersingchor unter Rüdels Leitung erregte tiefen Eindruck, ebenso die gleichzeitig aufgeführten Chöre Opus 34, deren Bewältigung im Vergleich mit jener des neuen Werks fast leicht erschien.
Eine zur vorigen stark gegensätzliche Frucht des schaffensreichen Jahres 1913 ist auch die Ballettpantomime »Eine Josef-Legende«, nach der Dichtung von Graf Harry Keßler und Hugo von Hofmannsthal. Der Knabe Josef wird, nachdem er vor Frau Potiphar und ihren Gästen getanzt, des Nachts von der durch Nervenreize aller Art verwöhnten Dame besucht, weist sie aber zurück; sie klagt ihn bei dem herzugekommenen Gatten eines Überfalls auf sie an; er wird gefesselt, aber ein Erzengel schwebt hernieder und befreit ihn. Um diese Fabel Hofmannsthals ist in der Dichtung selbst und noch viel mehr in der Einführung Keßlers dazu, ein hysterisch überhitzter, in den meisten Dingen abstoßend oder erheiternd bühnenfremder, polypenarmiger Wortschwall ausgegossen, der weniger schöpferisch veranlagten Menschen als Strauß nur Übelbefinden erregt hätte. Wenn es in irgendeiner Ulkparodie heißt: »Man sieht den Helden an ein dunkelblondes sehr schönes Mädchen namens Elsa denken, während hinter der Szene sein blauer Frack mit weißem Seidenfutter ausgebürstet wird«, so ist dies noch einfach und sachlich im Vergleich mit dem, was nach der Meinung des Verfassers alles durch den Tanz ausgedrückt und empfunden werden soll. Josefs Gottsucher-Tanz ist noch nicht das Gewagteste dabei. Die Darstellungen des Russischen Balletts in Deutschland, mit Nijinski, der eigentlich den Josef geben sollte, fielen in die Zeit, da Strauß mit dieser Tondichtung beschäftigt war, und regte ihn dermaßen an, daß er sie der Körperschaft zunächst für ein Jahr überließ. Bei der Uraufführung in der Pariser Großen Oper am 14. Mai 1914 gab Mijasin die Titelrolle, die schöne Sängerin Kusnietzoff die Potiphar. Die Ausstattung war dort mehr allgemein malerisch-phantastisch als in dem gewünschten Stil venetianischer Spät-Renaissance gehalten.
Von dem ganzen Bühnenspiel erzählte bei uns die stark verbreitete Abbildung Mijasins, ein höchst einnehmendes Kostümbild Josefs. Sonst ist die Joseflegende dem deutschen Hörer lange genug unbekannt geblieben. Eine Konzertaufführung wurde nicht beabsichtigt; als Bühnenwerk war sie 1920 in Deutschland noch unaufgeführt. Und dies ist nur zu bedauern; denn es ist echtester Strauß, den man auf diese Weise seinen Landsleuten vorenthält; durchtränkt von dem ganzen, freilich scheinbar oft wahllosen, aber dafür um so ehrlicheren Ernst Straußischer Vertonung, mit ihrem bezwingenden Willen zur motivischen und instrumentalfarbigen Charakteristik und dem beispiellos scharfen Sinn für Ethisches im zunächst nur Sinnlichen. Mit größter Eindringlichkeit sind diese Gegensätze hingestellt, wie in der glühenden Verliebtheit des Tanzes der Sulamith und den Anklängen christlicher Mystik in den Tönen, mit welchen Frau Potiphar zuerst den reinen Zauber der herben Jünglingsgestalt auf sich wirken läßt – eine eigentlich in das Licht höheren Anteils der Geistigkeit emporgehobene Begegnung zwischen Salome und Johannes. Dabei ist durch den Wegfall des größten Teils der sonstigen symphonischen Kontrapunktik Straußens in dieser sofort klar verständlichen Ballettmusik eine womöglich noch höhere orchestrale Wirkung erreicht. Wie so oft bei ihm, scheint alles auf die großen Maße der Schlußsteigerung hin angelegt; – selbst das bei solchen Gelegenheiten erwartete Fis-dur-Largo fehlt nicht, während das Finale als Ganzes, die Entrückung Josefs durch den Erzengel, in hellem G steht. Eine starke Konzertwirkung des größten Teiles dieser Musik steht außer Frage.
Der fünfzigste Geburtstag, am 11. Juni 1914, brachte Strauß reiche Ehrungen. Seine Vaterstadt München benannte eine Straße nach ihm; die Universität Oxford machte ihn zum Ehrendoktor; Nicolas Manskopf in Frankfurt begründete ein Richard-Strauß-Archiv. Eine Auszeichnung sonderlicher Art erwies ihm die Stuttgarter Neue Musik-Zeitung aus der gewiß beachtlichen Feder Oswald Kühns. Daß die Erwähnung dieses Geburtstags gerade in die Gluck-Nummer fiel, begrüßte Kühn, indem ihm »Gluck als Schöpfer des spezifisch musikalischen Dramas, Strauß als sein Vollender nach der Erkenntnis von heute« erschien. Aus Anlaß des Geburtstages wurde in Berlin festgestellt, daß an der dortigen Hofoper die Feuersnot zwanzig, Salome achtundneunzig, Elektra vierzig, Rosenkavalier neunundachtzig, Ariadne achtunddreißig Vorstellungen erlebt hatte.
Am 8. Februar 1915 beendete Strauß nach genau hundert Tagen seine Partitur: »Eine Alpensymphonie« für großes Orchester und Orgel, Opus 64, zu der Skizzen bis in das Jahr 1911 zurückgehn. Die Uraufführung des fast einstündigen einsätzigen Werkes leitete er am 28. Oktober in der Berliner Philharmonie mit der Dresdener Hofkapelle; dazu gab man Guntram-Vorspiel und Eulenspiegel. Zwei Dinge waren dabei von vornherein auch hier wieder klar: einmal, daß kein zweiter Lebender dieses Werk hätte schreiben können, und dann, daß der volle Eindruck nur jenem Hörer zuteil wurde, der die Einzelheiten der zahlreichen, schon in der Partitur vermerkten Programmerläuterungen nicht kannte, oder dem es gelang, sie beim Anhören zu vergessen. Auch hier wiederholte sich, wie bei fast allen Straußischen Orchesterdichtungen, der Fehler, daß zu viel verraten und dadurch dem inneren Schauen des Zuhörers, das diese Musik im höchsten Maß anregen könnte, eine Fessel angelegt wird. Niemand, der das Werk etwa mit dem bloßen Hinweis: »Ein Tag in den Alpen« anhörte, würde sich seiner Großartigkeit entziehen können. Auch keine irrige Deutung in bezug etwa auf das Nachtdunkel, Sonnenaufgang, Anblick der Bergwelt, Gewitter, Trübung des Tageslichts, Sonnenuntergang und Zurücksinken in die Nacht, keine irrige Auffassung in bezug auf den geistigen Hauptinhalt, die Gefühle des Wandernden, wäre denkbar. Das leichte Gefährden der Stimmung durch kleine spielende Malereien, wie das Getriebe auf der Alm oder die, doch nur in der Vorstellungsverbindung des Wanderers möglichen Jagdhörner im Walde, wird ja auch durch das genaue »Programm« nicht vermieden.
Es versteht sich, daß nicht die äußeren, sondern die inneren Vorgänge, der Wechsel der Naturgefühle, die Vorlage bilden, daß die thematische Verarbeitung und Verschlingung der einfach genug gewählten Themen das eigentliche künstlerische Vorkommnis des Werkes sind. Ebenso, daß in der Kunst der Orchestrierung wieder Unnachahmliches geleistet ist, das an einzelnen tonmalerischen Stellen, wie dem Wasserfall und den Gestalten, die der Wanderer in dessen Staubschleier erblickt, seinen Höhepunkt erreicht. Nicht ganz die Versprechungen des Partitureindrucks halten die Klangbilder des Zusammenwirkens von Orgel und Blechinstrumenten, sowie einiger überhoher Trompetenmelodien, die sich prachtvoll lesen, aber in den äußersten Tönen doch den eigentlichen unvergleichlich malenden Trompetencharakter verlieren und an das flachtonigere alte »Clarinblasen«, an den norddeutschen Ausdruck Blechpfeifer, für Trompeter, erinnern. Selten sind die nicht ihrem rein musikalischen Werte nach sofort verständlichen Stellen, wie das seltsam stockende, von hohem Violintremolo begleitete Oboensolo, als Ausdruck des ersten atemhemmenden Weitgefühls nach der Erreichung der Gipfelaussicht. Höchst geeignet zur Umbildung, Kontrapunktierung und sonstiger motivischer Verarbeitung ist gleich das Hauptthema.


Auch mit dem melodisch starken Gegenthema in der Oberstimme versehen:

Das dem zweiten Symphoniesatz entsprechende Element vertritt das zuerst in 3/4 auftretende, ruhige:

später durch breiteres Zeitmaß, Vergrößerung der Intervalle usw. gesteigert:

Klanglich mit seinen strahlenden Trompetenharmonien unmittelbar bestechend wirkt das Thema des Sonnenaufgangs:

Ohne stark persönlich gestaltet zu sein, wie es ja der elementare Sinneseindruck der blendenden Sonnenscheibe auch nicht ist, vollständig an seinem Platze, trotz der Ähnlichkeit mit dem Mittelthema des ersten Satzes von Tschaikowskys Pathetischer Symphonie, wirkt dieses Motiv als Tonmalerei inmitten des kontrapunktischen Tonsatzes. Dann selber in motivische Abwandlungen hineingezogen, paßt es sich mehr als anfangs dem Allgemeincharakter des Werkes an, wie ja auch in der Wirklichkeit das zuerst jeden anderen Gesichtseindruck niederwerfende Sonnenlicht ein Bestandteil des Landschaftsbildes wird.
In der Folge wandte sich Strauß einer Umgestaltung seiner Ariadne zu, welche durch die starken Fehler der Gesamtform eine solche gebieterisch verlangte, mit Trennung des unglücklich übertragenen Schauspiels und der Ariadne-Oper in zwei völlig geschiedene Bühnenwerke. Hofmannsthals eigene köstliche Verbindungsszene zwischen beiden, der Dialog, die Verschmelzung von Drama und burleskem Intermezzo betreffend, wurde von ihm zum musikalischen Lustspiel, als erstem Teil der Oper, erweitert und von Strauß mit neuer Ouvertüre durchkomponiert. Die Partie des Komponisten ward dadurch zur jugendlich-dramatischen Jünglingsrolle für eine erste Sängerin; die Personen des früheren Opernaktes konnten sich nun vor ihren Partien in Ariadnedrama und Harlekinade schon in der Garderobe vorstellen und ihre privaten Persönlichkeiten in ergötzlicher Weise zum Ausdruck bringen. Um dies gleich zu sagen, diese ganze Aufmachung wunderhübscher Einfälle fand lange nicht den Grad von Zustimmung, den man erwarten durfte. Als Finale, das es dem Sinne nach einzig sein konnte, blieb die Ariadne-Oper, trotz musikalisch schwer schädigender Kürzungen des Buffoteils noch immer viel zu lang; eine Einheit war nicht zu erzielen, da die Person des geistigen Urhebers der ganzen Verschmelzung als eigentlicher Gegenspieler, der Wiener Graf, der an die Stelle Jourdains kam, überhaupt nicht mehr auftrat, sein Gegner, der Komponist, aber, mit dem ersten, kürzeren Teil des Ganzen, verschwand. Die einzige ungetrübte künstlerische Lösung wäre die, das Ariadne-Spiel, ohne jede Kürzung auch der Buffopartien, allein zu geben, etwa mit dem Titel: Ariadne auf Naxos, Musikdrama, mit Intermezzis einer Buffotruppe nach Art der alten commedia dell' arte. Die nunmehr selbständig gewordene, unter anderem durch das große Türken-Finale ergänzte Musik zu Molières Bürger als Edelmann fand noch viel sprödere Aufnahme. Die Komödie Molières hätte einzig dadurch neues Leben gewinnen können, daß man sie nach Ort und Zeit in nächste Nähe verlegte. Nur dürfte es einer solchen Umarbeitung schwer fallen, die Straußische Musik dazu zu begründen. Diese allein führte man seit 1920 konzertmäßig auf; zunächst Strauß in Wien, Meyrowitz in Berlin.
Die Uraufführung der neuen Ariadne erfolgte an der Wiener Hofoper am 4. Oktober 1916, dem Namenstag des Kaisers Franz Joseph, mit Lotte Lehmann in der Partie des Komponisten, dem trefflichen Tenor Környey und Frau Jeritza als Bacchus und Ariadne. In Berlin baute man im November des Jahres eigens ein Laubenproszenium hinter dem wirklichen ein, um das »Theater auf dem Theater« glaubhaft zu machen. Dort sang Lola Artôt den Komponisten.
Erst nach dem Ende der Gegenwehr im Vernichtungskrieg gegen Deutschland erschien das schon in den Jahren 1914-15 geschriebene Werk Die Frau ohne Schatten, Oper in drei Akten, nach Hugo von Hofmannsthal, op. 65. Wenn hier auf die Dichtung näher eingegangen wird, so ist der Grund, daß die immer weniger günstige Wirkung der Verbindung mit Hofmannsthal allmählich ein bedeutungsvoller Punkt für Straußens musikdramatisches Schaffen wurde. Gerade die Treue seines Charakters, die er ja auch Roller und Reinhardt hielt, zeitigte hier wie dort neben förderndem im einzelnen auch schädigenden Einfluß auf das Gesamtkunstwerk. Damit hängt freilich auch Straußens eigener schaffensfreudiger Vertonungshunger zusammen, der nicht warten mochte, bis der textliche Untergrund vollständig und einwandfrei fertiggestellt vorlag. Mit tiefem Bedauern sagt man sich zuletzt, daß er mit genau dem gleichen Aufwand künstlerischer Arbeit uns um ein Gesamtkunstwerk im eigentlichen Sinne hätte bereichern können, wo uns jetzt nur fragwürdige, an Wert höchst ungleiche Teile eines solchen beschert sind.
Seine Natur mit ihrem großzügigen, menschlich sozialen Denken mußte diese Gedankendichtung reizen. Ihr Nerv und Ziel ist die am Schlusse in breiter Hymnik ausklingende Verherrlichung der weiblichen Fruchtbarkeit als menschenbeglückenden und menschheitserhaltenden Sinnes unseres Erdenlebens. In seinem Dienst ist alles heilig und wird dementsprechend mit der Weihe offener Gegenständlichkeit erwähnt. Der junge, schöne Kaiser eines südöstlichen Inselreiches hat auf der Jagd durch die Tüchtigkeit seines Falken die Tochter des Geisterkönigs Keikobad erbeutet, die zu ihrer Lust als Gazelle den Wald durchsprengte und zur Rettung ihres Lebens alsbald die Gestalt eines blühenden jungen Weibes annehmen muß. Da sie seine Liebe erwidert, macht er sie zu seiner Frau, und hat sie nun schon ein Jahr lang jede Nacht begehrt, während er am Tage der Jagd obliegt. Ihre dämonische alte Amme, eine der untergeordneten Dienerinnen Keikobads, ist zum ständigen Schutz ihrer Einsamkeit bestellt. Daß diese Vorgeschichte durch den jungen Kaiser der Amme erzählt wird, die sie längst kennen muß, gibt uns schon im zweiten Auftritt das Gefühl des bloß epischen Kunstwerks, des Buchdramas. Nach den Gesetzen des Geisterreichs kann nun der im Stück unsichtbar bleibende Vater Keikobad die Ehe nicht hindern. Wirft die junge Frau aber nach Verlauf eines Jahres keinen Schatten, das heißt, fühlt sie sich nicht Mutter, so wird nach seinem Spruch der Kaiser in Stein verwandelt. Dies Ergebnis, das ihm die Tochter zurückgeben würde, scheint Keikobad einerseits herbeizusehnen, da er der Amme in diesem Sinne Befehle erteilt, anderseits stellt er der Tochter später selbst die Wahl hiezu frei. Mit jedem neuen Mond, wie es zu Anfang dichterisch ungenau heißt, wenn der Kaiser die Gattin zu ausgedehnterem Jagdausfluge verläßt, fragt Keikobad durch seinen Geisterboten bei der Amme an, ob das Zeichen des zu erwartenden Schattens noch nicht eingetreten sei.
Mit dem entscheidenden zwölften dieser Botenbesuche im Palast beginnt die Handlung. Während der Kaiser vorläufig noch ganz ahnungslos zum letzten jener dreitägigen Jagdausflüge zieht, verrät sein Falke der Kaiserin das Geheimnis des sein Leben bedrohenden Geisterspruchs. Sie beschwört nun die Amme, ihr zum Schatten zu verhelfen und damit den Kaiser vor der drohenden Versteinerung zu retten. Den Schatten hofft die Amme, die das Menschengetriebe soweit kennt und verachtet, dadurch zu gewinnen, daß sie einem Menschenweibe den ihrigen abkauft. Die junge Frau des Färbers Barak, die ihren herzensguten unbefriedigt kinderlieben Mann geringschätzt, scheint der geeignete Gegenstand. Kaiserin und Amme kommen verkleidet als Dienerinnen zu ihr, und die Amme verheißt ihr durch ihre Zauberkunst alle sinnlichen Genüsse des Leichtsinns als Entgelt für die Hergabe des Schattens. Die Frau gibt diesen Gedanken, mit dem sie nur gespielt, dem Manne gegenüber, um ihm ihre Verachtung zu zeigen, als vollzogene Tatsache aus. Der ewig Gutmütige, der ihre bösen Launen hoffnungsfreudig als die Stimmungsseltsamkeiten der beginnenden Schwangerschaft deutete, wächst da mit einem Male zum Richter empor und will die vermeintliche Treulose töten, als es durch das Eingreifen von Übermächten Nacht wird und alles versinkt. Die Frau, von ihm getrennt, empfindet nun liebend seine einfache Größe und will künftig Mutter seiner ersehnten Kinder werden; Geisterhände im Dienste Keikobads halten beide noch in unterirdischen Klüften voneinander getrennt.
Eigentümlich ist es mit dem Wasser des Lebens bestellt, an dessen emporflutenden Goldquell Keikobad seine Tochter indes beschieden hat. Ein Trunk daraus soll ihr den Schatten, das heißt Mutterschaft, geben, aber nur auf dem schuldhaften Umweg, daß diese Wohltat der Genossin im Weibtum, der zur Reue und Kindessehnsucht geläuterten Färbersfrau, dafür entzogen wird. In dieser Doppelheit der Beweggründe siegen Rechtsgefühl und Mitleid mit dem zeugungsfrohen ehrlichen Färber. Nach furchtbarem Kampfe erfolgt der Verzicht der Kaiserin auf ihr eigenes Glück als Gattin und Mutter; sie ist bereit, das Leben des Kaisers, der ja nun zu Stein werden soll, zu opfern. Aber diesem ist, während die Erfüllung jenes Spruches, die Versteinerung, beginnt, die Entscheidung aus Keikobads Reiche schon verkündet: gerade diese Entsagung der Kaiserin darf sie und ihn erretten und ihr den ersehnten Schatten verleihen. Dem sittlichen Gedanken also beugt sich das Geisterreich; beide Frauen werfen am Schlusse sichtbar ihre Schatten, und in einem Quartett der zukunftsfroh vereinten Paare mit dem Chor der des Lichtes harrenden Ungebornen schließt das ethische Märchen. Die Amme, die ihre Stelle im Plane Keikobads nicht verstanden und sich aus ihrem verachtenden Menschenhaß nicht zum liebenden Verständnis des Willens zur Vermehrung durchgerungen hat, wird aus dem Geisterreich gestoßen, um unter dem Menschenvolk dienend zu sühnen.
Undramatisch ist dabei unter anderem die Überfülle der sich kreuzenden Motive. Die Amme, in verzehrender Angst vor der Strafe des Geisterkönigs, setzt doch, unter dem Banne des Blicks seiner gleich ihm zu den Höheren, Gebietenden gehörenden Tochter, alles daran, dieser zu dem gewünschten Schatten und damit zum Fortbesitz des bloß menschlichen Gatten zu verhelfen. Das seelische Gazellendasein der Kaiserin, eine Fortsetzung des leiblichen, wird durch das Mitfühlen menschlichen Kämpfens und Leidens, in das die Amme sie hineinzieht, zum Menschenweibtum, dem Sehnen nach Mutterschaft, emporgehoben, während der schattenhaft gezeichnete Kaiser aus seiner menschenfern stolzen Einsamkeit, der seelischen Versteinerung heraus, der die körperliche als eine Art sittliche Folge oder Strafe nachkommen soll, am letzten Ende gleichfalls durch das Vorgefühl der Elternfreude zum Vertrauten und Bruder der ganzen Menschheit, des einfach bürgerlichen Daseins wird. Bei der wiederum ganz im Sinne des orientalischen Märchens vorausgesetzten Allgegenwart mächtig wirkender dienender Geister folgt eine tatsächliche Überraschung der Mitspielenden und eine szenische der Zuschauer der anderen. Die erst mephistophelisch zaubergewaltige Amme unterliegt diesen Mächten so gut wie die bloß menschlichen Figuren; »Übermächte sind im Spiel!« ruft sie dann, wenn alles darunter und darüber geht, und setzt ihre eigene Kraft gegen die überlegene unbekannte ein.
Die Einteilung dieses Stoffes in drei Aufzüge ist fragwürdig. Im ersten herrscht in der Aufrollung von Spiel und Gegenspiel noch leidliche Geschlossenheit: der Spruch der Geisterwelt wird bekanntgegeben, die Kaiserin handelt ihm gemäß und läßt sich zu den Menschen führen; die Amme leitet den Handel um den Schatten der Färberin ein, zeigt ihre Zauberkünste; der Färber Barak, vom Ehebett vertrieben, bleibt als der Leidtragende zurück. Im zweiten Aufzug wird die fortschreitende Loslösung der Färberin von ihrem Manne in drei getrennte Szenen zerlegt, durch zwei Bilder aus dem Schicksal des Kaiserpaares unterbrochen. Zuerst bemerkt der Kaiser die nächtliche Abwesenheit und späte Rückkehr von Frau und Amme, doch wird dieses Motiv seiner schmerzlichen Eifersucht nicht weiter verfolgt. Im zweiten Zwischenbild sieht ihn der Wahrtraum der Kaiserin in das Grabgemach treten, wo er nach dem Spruche versteinern soll. Zugleich aber fühlt sie »sich Barak schuldig«, dem Mann, der ihr reines Menschentum gezeigt hat und an dessen geplanter Beraubung um sein Glück sie mitschuldig ist. Mit dem Schluß dieses Aktes im Färberhaus ist die innere Wandlung bei der Färberin, die Barak im heiligen Zorn gesehen und ihn nun liebt, schon vollzogen, ebenso im zweiten Zwischenbild die der Kaiserin. Der dritte Aufzug bringt nun in etwas wirrer Folge, zum Teil von den befehlenden und erklärenden Geisterstimmen weitergeführt, kein neues seelisches Motiv mehr; äußerlich nur noch die Verstoßung der bis dahin zaubermächtigen Amme, die Erklärung der Kaiserin, auch angesichts der fast schon vollendeten Versteinerung des Kaisers auf die Gewinnung des rettenden Schattens zu verzichten, endlich den neuen Geisterspruch, eine Milderung des ersten: Schon durch solchen Verzicht soll der Schatten erworben und damit der Fluch von der Verbindung zwischen Kaiser und Geisterkönigstochter genommen sein. Barak und seine Frau gelangen gleichzeitig aus der Trennung durch Geisterhand und Dunkel zur Vereinigung im Licht. Hier ist es vollständig der Musik überlassen, die Zaubervorgänge mit dem anteilsicheren Inhalt innerlicher Erhebung zu erfüllen. Die Form des Ganzen ist echtes Lesedrama, eine feinsinnige Abdämpfung aus dem Schrifttum verschiedenster Art. In die Geisterfülle der Märchen aus Tausendundeiner Nacht spielt aus der Stimmung von Grimms Märchen und Raimunds Zauberstücken heraus der formelhafte Schicksalsreim des sprechenden treuen Falken und andere Züge; die Frau des Färbers ergeht sich bei ihren Anklagen im Stil des alten Testaments; vieles, wie fast der ganze Schlußakt, atmet die kraftvolle Anschaulichkeit und das zuweilen sorglos andeutende Reimspiel des zweiten Faust-Finale, – Goethestudien einer zwingend beeinflußten schöpferischen Veranlagung. Manche Besprechungen sind noch viel näher auf die viel verzweigte geistige Herkunft des einzelnen eingegangen; es gibt kaum ein Literaturvolk und eine Dichtungsart, die nicht irgendwie dabei vertreten ist.
Bei der »Frau ohne Schatten« spielten Strauß zwei seiner bemerkenswertesten Eigenschaften künstlerisch einen schlimmen Streich. Zunächst jene stark sittliche Veranlagung (»ethische Orientierung« klingt unempfindlichen Ohren besser), die den Jüngling einst beim Gestalten des Guntramstoffes um den Erfolg betrog. Aber die einzige gute und dabei im eigentlichen Sinne moralische Oper des Spielplans ist bisher Gounods Margarete, die bei guter Darstellung die Folgen der Verführung wirklich erschütternd vor Augen stellt. Im allgemeinen sind für diese Kunstgattung andere Dinge ausschlaggebend. Der Stoff zur Frau ohne Schatten, den Hofmannsthal seinem musikalischen Verbündeten gelegentlich erzählte, reizte diesen nicht nur durch das orientalisch Märchenhafte, sondern eben durch den hohen sittlichen Grundgehalt, das Betonen der Pflicht zum Fortleben im Kinde und die Verherrlichung der Fruchtbarkeit, entgegen dem selbstsüchtigen Ichtum. Aber neben der Unklarheit, Unfertigkeit und mangelnden Bühnenanschauung beim Gestalten hat gerade diese an einen Propagandavortrag erinnernde Absicht den dramatischen Todeskeim in die Dichtung gelegt. Wenn schon die beiden vorhergehenden Straußischen Opern aufgeführt wurden, ehe eine künstlerisch fertige Einrichtung vorlag, so ging die Sache in diesem Falle so weit, daß man von einem zweifelhaften Entwurfe, anstatt von einem zur Vertonung fertigen Buche sprechen kann. Der zweite Aufzug muß durch seine Zerrissenheit, der dritte durch Unklarheit, Überhäufung und die mangelnde Bewältigung des Stoffes für durchaus ungeeignet gelten. Hier kam bei Strauß die zweite der angedeuteten großen Eigenschaften zur Geltung, der ungeheure Trieb, nur rasch alles in Musik zu verwandeln, gleichviel ob hinreichend vorbearbeitet oder nicht. Seit dem Rosenkavalier war es so: was der Freund ihm zuschickte, wenn auch äußerlich und innerlich noch Bruchstück, vertonte er. Es schien fast, als habe er den schädlichen Einfluß Ritters in bezug auf die Kritik des Bühnenmäßigen nie ganz überwunden.
Ein Weiteres läßt sich nicht übersehen. Während äußerlich die zauberkundige Amme die Handlung gebietend beherrscht und erst gegen den Schluß durch ihre Verstoßung aus dem Geisterreich daraus verschwindet, ist die Hauptfigur der Dichtung im Grunde der Färber Barak. Seine einfach menschliche Herzensgüte, seine am rechten Ort verzeihende und zürnende Männlichkeit, bringt beide Gegenspielerinnen, seine Frau und die Kaiserin, zuletzt auf seine Seite, und damit beide, die jede auf ihre Art, mit dem Tauschgeschäft zu schwerem Unrecht bereit waren, wieder auf den vom Geisterreich gewünschten rechten Weg. Wer Strauß kennt, wird leicht geneigt sein, in dieser Gestalt Baraks eine dichterische Wiedergabe seiner menschlichen Persönlichkeit zu erkennen. Die, welche ihm früher ganz willkürlich vorhielten, daß er sich selbst wiederholt in Musik setze, können dies jetzt mit einem Schein von Recht.
Seine Midas-Natur, alles was er berührt, cum grano salis verstanden, ohne Unterschied zu Gold, nämlich zu wertvoller Musik, zu machen, erkennt man in dem Werk selber, an dem ungeheuren Ernst, mit dem auch die literarisch spielerischen, novellistischen Züge der Buchdichtung in Musik übersetzt sind. Hier liegt in Einem seine Stärke und Schwäche.
Bei mangelnder Fühlung mit dem Bühnenmöglichen ist der Gehalt der Dichtung als solcher, von hohem geistigen und sittlichen Schwung, in dieser Form der Verarbeitung szenisch nicht zu retten. Hat der Zuschauer das Buch gelesen, so merkt er, daß das meiste auf der Bühne ganz anders kommt und kommen muß als darin steht; hat er es nicht gelesen, so werden ihm die meisten Zaubervorgänge überhaupt nicht klar. Es gibt kaum etwas Bühnen-Ungeschickteres als das Liebesduo des seelisch einig gewordenen Färberpaares im dritten Akt, von jedem der beiden allein in seinem unterirdischen Steinkämmerchen gesungen, getrennt durch die von einer dicken Felsenwand symbolisch angedeuteten Verschiedenheit ihrer Naturen. Im Dunkel erklingen dann einzelne Male so viele unsichtbare Stimmen dieses Ehepaares und der Geisterbefehle dicht nacheinander, daß eine klare, völlig ernsthafte Wirkung unmöglich ist. Da mit den notwendig praktikablen Gegenständen nicht offen verwandelt werden kann, fallen einige Hauptsteigerungen der Musik mit Dunkel oder dem grauen Schleiervorhang zusammen und wirken bloß symphonisch. Die Ausstattung nach Rollers Entwürfen konnte das vom Dichter nicht mit Theaterblick Geschaute nicht bühnenmöglich machen. Die Bilder sind wohl malerisch, doch stört manche allzusehr betonte nicht zur Sache gehörende Einzelheit, die weit von dem im Textbuch Geforderten abweicht und den geistigen Blick von der Hauptsache ablenkt.
Straußens Midas-Natur kann man auch in der harmonischen und thematischen Behandlung der Leitmotive erkennen. Auch die nach Art wie Herkunft ziemlich belanglosen hat er mit dem vollen Einsatz tonsetzerischer Persönlichkeit verarbeitet. Den Baustein bildet das in erhöhtem Maße prägsame, durchsichtige Thema, meist aus wenigen Noten, das erst die einzig dem Ausdruck dienende Harmonik und Instrumentation mit unerhörtem Farbenreichtum überschüttet. Das Orchester als Hauptträger des künstlerischen Urheberwillens bringt neben dem überzeugenden Anschlagen der Grundfarben unnahbarer Strenge des Geisterreichs, kleinbürgerlich bedrückender Umwelt, sinnbetörender üppiger Ausmalung der Liebeszaubereien und tonlich gewaltig unheimlicher Naturereignisse auch die eigentliche Durchwärmung ausgedehnterer seelischer Aussprachen, neben der vielfach vorherrschenden zerrissenen thematischen Unterstreichung der gesungenen Deklamation.
Die Singstimmen sind durch einen Grundfehler des Textes, die Seltenheit von unmittelbar musikalisch umsetzbarem, scharfen Wort-Rhythmus, gehemmt. Wo sich ein solcher findet, geht Strauß oft auf ihn ein, aber leider mit der noch immer deutlichen Spur einer gewissen Fremdheit im dramatischen Gesang, nicht selten entweder in jener höchsten Lage, die fast nur noch instrumental wirkt und eine deutliche Aussprache unmöglich macht, oder in zu tiefer, die sich dem Orchester gegenüber nicht mit kräftiger Betonung durchzusetzen vermag. Der Mezzo der Amme wird fast ganz zum hohen Sopran, wodurch der klangliche Gegensatz wegfällt. Den musikalischen Höhepunkt bildet der thematisch und klanglich großartig gesteigerte Schluß-Hymnus der beiden Ehepaare und des Chores ihrer ungeborenen Kinder, der nach Beendigung der Handlung oratorienmäßig fünfundzwanzig Seiten des Klavierauszuges in Anspruch nimmt und nach herrlichen Umformungen der einfachen Motive im zartesten Pianissimo ausklingt.
Dies das Rhythmogramm des Namens Keikobad,

das im Orchester hörbar wird, sobald die Vorgänge auf den Willen dieses unsichtbar bleibenden Geisterkönigs zurückführen; welche Rolle könnte dies plastische Motiv in einer deutlichen, klaren Bühnenhandlung spielen! Im übrigen erscheint die Aufführung von Notenbeispielen zwecklos, sie können von der Gesamtwirkung gerade bei diesem Werk nicht die geringste Vorstellung geben. Lyrische Glanzpunkte des Orchesterparts sind: das stumme Gebet Baraks, als er aus dem Gebahren seiner Frau deren Schwangerschaft schließt und die Begleitung zu dem Solo der märchentraumhaften Stadtwächter, die das nächtliche Liebeswerk der Ehegatten im Hinblick auf die aus ihm emporblühenden Geschlechter als heilig besingen. Diese beiden wonnigen kleinen Stücke über das gleiche Motiv lassen sich durch ein paar Noten auch nicht im Keime andeuten. (S. 71 und 132 des Auszugs:)

Die Uraufführung der Frau ohne Schatten durch die Staatsoper in Wien am 10. Oktober 1919 brachte eine wundervolle Wiedergabe unter Franz Schalks Leitung mit den Damen Jeritza, Lotte Lehmann und Weidt als Kaiserin, Färberin und Amme, dem echt lyrisch schönstimmigen Agaard-Oestwig als Kaiser und Richard Mayr, dessen herrlicher Baß den Baritonhöhen Baraks nichts schuldig blieb. Am 22. gleichen Monats folgte Dresden unter Fritz Reiner mit dem Ehepaar Friedrich und Eva Plaschke als Färber und Färberin, Fritz Vogelstrom und Elisabeth Rethberg als Kaiserpaar, Ottilie Metzger-Lattermann, Amme; Robert Burg als, statt des Unisons der drei Stimmen, die herrliche Melodie allein hinter der Szene vortragender Wächter, zugleich als Geisterbote.
Ganz unerwartet erblühte 1919 nach etwa vierzehnjähriger Pause des lyrischen Schaffens ein neuer Liederfrühling, äußerlich durch sonderbare Umstände veranlaßt. Strauß hatte seinerzeit bei Überlassung der Domestica dem Verlag Bote und Bock zugleich sein nächstes Liederheft zugesagt. Die Mißhelligkeiten auf dem Gebiet der Organisation (Bote und Bock gehörten der »Gema«, der Verbindung gegen die Genossenschaft deutscher Tonsetzer, an), auf die hier nicht weiter eingegangen werden soll, nachdem er vergeblich um Lösung der Vereinbarung gebeten, veranlaßten Strauß, eine Dichtung Alfred Kerrs »Der Krämerspiegel« behufs Einlösung der eingegangenen Verbindlichkeit zu wählen. Nachdem diese Kompositionen des Textes wegen gemäß gerichtlicher Entscheidung als nicht zur Erfüllung des Vertrages geeignet erkannt waren, schrieb er als Ersatz sein Opus 67, sechs einfach und knapp gehaltene Lieder für eine hohe Singstimme, drei Lieder der Ophelia aus Shakespeares Hamlet und drei aus den Büchern des Unmuts des Rendsch Nameh, diese reinen Sinngedichte, die schon als solche nicht zur Entfaltung besonderer musikalischer Werte geeignet waren.
Bald darauf folgte die überraschend reiche Liederreihe Opus 68. Sechs Lieder. Strauß geht hier, wie vor der großen Pause, auf echt lyrische Vertonung deutscher Romantik zurück, einfache, herzliche Gedichte Clemens Brentanos. Eine Fülle sangbarer wohliger Melodik erinnert zuweilen an einschmeichelnde Stellen aus Rosenkavalier und Ariadne. Auch die Singstimme ist meist ganz Anmut und Lieblichkeit, der frühere Widerstreit zwischen Deklamation und Melodie größtenteils verschwunden. Die Begleitung, im vierten stark an Mendelssohns Klaviersatz mahnend, wirkt bei allem feinsten Klangreiz einfach und deckt nicht die Stimme. In ihren Anforderungen an diese sind die Lieder sehr verschieden. Das fünfte, Amor, ist nur für ganz schwindelfreie Koloraturgrößen im Stile der Ivogün oder Hempel; auch das vierte, Als mir dein Lied erklang, fordert leichteste Ansprache der Höhe; ebenso das liebliche dritte, Säusle, liebe Myrthe! Bescheidener gibt sich das von Anfang an am meisten gesungene zweite: Ich wollt' ein Sträußlein binden. Der Zyklus beginnt mit dem hymnenartigen An die Nacht, einem großlinigen, augenscheinlich mindestens im Unterbewußtsein schon mit Orchester gedachten Stücke, das den fülligen Vortrag eines kraftvollen Mezzo mit Höhe oder eines vollen tiefen Sopranes erheischt. Den Beschluß macht das mehr balladenmäßige Lied der Frauen, dessen Dichtung etwas bilderbogenartig die Gefühle zu Hause harrender Gattinnen der durch verschiedene Berufsarten gefährdeten Männer vorführt. Im dritten und vierten Vers singt man entschieden besser »harrt« und »bangt« statt des zweimaligen unhandlichen: »sitzt des Bergmanns und des Kriegers Weib zu Haus«. Die Vertonung faßt das Ganze zu einem musikalisch weit einheitlicheren Aufbau zusammen, einem fabelhaft klaviermäßig gesetzten Gewitter mit nachfolgender verklärter Ruhe der Naturstimmung, wie nur Strauß es schreiben und außer ihm nur ein allererster Begleiter spielen kann.
Auch das folgende Heft » Fünf kleine Lieder« Opus 69 geht auf die Lyrik der Romantiker, diesmal auf Achim von Arnim und Heinrich Heine zurück. Die drei des erstgenannten sind nur lebhaft gehobene Stimmungsentladungen mit knappster Andeutung des Anlasses, eben dadurch zu Liedtexten sehr geeignet, zumal zu ausgesprochen melodisch bewegten Gesängen für hohe Stimmlage. Ohne streng innerhalb der Charakteristik seines sonstigen Stils zu bleiben, gibt Strauß hier, wie schon früher, in einzelnen Liedern einfache, zum Teil schwungvolle Sangbarkeit mit zierlich klingender Begleitung. Ganz anders muten die beiden Heineschen Nummern an, Waldesfahrt und Schlechtes Wetter, mit ihrem wieder echt Straußisch tonmalendem Klavierfeuerwerk. Köstlich musikalisch rückschauend ist das Motiv der Klavierschilderung von dem Töchterlein mit dem süßen Gesicht und den goldenen Locken, das später noch die Singstimme aufnimmt:

Indes fiel der Blick der maßgebenden Persönlichkeiten in Wien nach den seit Mahlers Abgang gemachten trüben Erfahrungen immer bestimmter auf Strauß. Der Wiener Generalintendant Leopold Andrian hatte schon im Juli 1918 in Ischl eine Unterredung mit ihm, die nächste Ende September in Garmisch führte zum Abschluß. In Wien waren einschließlich des Kaisers alle Maßgebenden über die Notwendigkeit des Schrittes einig. In Berlin ließ man Strauß auch nach der Revolution zwar nicht ohne weiteres ziehen, bot ihm sogar, nach mancherlei wenig belangreichem Hin und Her, mit dem Oberspielleiter Dröscher zusammen die Leitung der Staatsoper an, hatte aber nichts dagegen einzuwenden, daß er für sieben Monate jedes Jahres anstatt hier an der Spree, unten an der Donau zu wirken hatte. Dort erkannte auch der Staatsnotar der Übergangsregierung Dr. Sylvester den Vertrag an, und nachdem Gegenströmungen im Personal der Staatsoper, vorzüglich gegen die Vereinigung der künstlerischen und kaufmännischen Leitung, durch eine Trennung beider Ämter beruhigt waren, entschied man sich am 1. Mai 1919 endgültig für die Bestätigung. Strauß trat sein Amt als »künstlerischer Oberleiter« der Staatsoper alsbald mit der Leitung seiner Ariadne an; als Kapellmeister wurde ihm Franz Schalk mit seiner Zustimmung gleichgeordnet. Gleich an die Verpflichtung eines dritten Kapellmeisters, Alwin aus Hamburg, des Gatten der Soubrette Elisabeth Schumann, die Strauß als erste an die Staatsoper brachte, schloß sich echter, kleiner Wiener »Foyer-Plausch«; wem es um die Einzelheiten zu tun ist, der findet sie in den Nummern der Wiener Wochenschrift Musikalischer Kurier vom Ende November und Anfang Dezember ergötzlich verzeichnet. Während diese Seiten zum Druck gehn, liest man von offenen Kundgebungen gegen den Tenor Ziegler, welchem Strauß, an Stelle des vergötterten, alternden Erik Schmedes, den Lohengrin gab, und von einer Strömung gegen den russischen Ballettmeister Kjakscht, den er verpflichtete, um mit ihm die Josef-Legende herauszubringen. Die Wiener Gemütlichkeit, soweit sie das Theater betrifft, macht sich leise auch dem neuen Herrn bemerkbar.