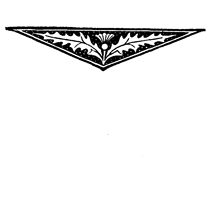|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Eine Blyenbeeker Geschichte.
![]()
» Coelum peto.«
Von dem Städtchen Goch führt der Weg durch fruchtbare Felder westwärts nach der holländischen Grenze. In einem kleinen Stündchen kann man bequem das alte Augustinerstift Gaesdonk erreichen, welches Bischof Johann Georg von Münster zu einer Studienanstalt umbaute, deren stolzer Hauptflügel mit dem zu astronomischen Beobachtungen bestimmten Thurme weithin die ebene Landschaft beherrscht. Gleich hinter Gaesdonk bildet ein Bach die Grenze zwischen Preußen und Holland. Wir haben denselben auch noch keine tausend Schritte zurückgelegt, so hört der fruchtbare Boden auf und verwandelt sich rasch in ödes Weideland. Nur arme Besenbinder haben hin und wieder zwischen den verkrüppelten Föhrenständen und sumpfigen Bruchwiesen, auf denen armseliges Vieh ein wenig saures Gras abweidet, die eine oder andere Hufe zu einem Kartoffelfelde umgebrochen oder mit etwas Roggen angesäet. Aber auch diese kleinen Heimwesen bleiben bald zurück, und dann dehnt sich, hier und dort von Sanddünen und Sümpfen unterbrochen, fast zwei Stunden breit bis an die niedern Ufer der Maas die Heide aus.
Ungefähr in der Mitte dieses öden Landstriches steht das Schloß Blyenbeek, ein echtes niederländisches Castell, von breiten Wassergräben umschlossen, die in alten Zeiten seine Stärke bildeten. In seiner unmittelbaren Nähe hat menschlicher Fleiß dem kargen Boden einige Felder abgerungen; schöne Eichenalleen bilden schattige Gänge nach den nahen Laubholzbüschen und Föhrenwaldungen, welche dem Auge die kahle Heide verbergen. Der Schloßgarten selbst, der seine dunkeln Taxuswände und frischgrünen Laubengänge, seine schattigen Linden und Roßkastanien in der breiten Wasserfläche des Grabens spiegelt, ist viel schöner, als ihn der Wanderer nach dem ermüdenden Gange durch die Heide erwarten sollte. Das alte Burghaus mit den verwetterten Ziegelmauern, dem riesigen Schieferdache und dem viereckigen Mittelthurme, der in zwei sich verjüngenden Absätzen den goldenen Wappenlöwen der Wetterfahne über diese Oase der Heide emporreckt, hat noch immer sein herrschaftliches Ansehen bewahrt, wenn auch der Bau weder durch Größe noch Alter oder architektonische Zier eine Merkwürdigkeit bildet. Nur von der Südseite führt eine breite steinerne Brücke über den fast teichartigen äußern Wassergraben. Oberhalb des Thorbogens, durch den man den äußern Schloßhof betritt, stecken heute noch Kanonenkugeln, welche die Spanier unter Marquis Varambon im Sommer 1589 hineingeschossen haben. Der äußere Schloßhof ist heute auf drei Seiten von der Rentei, einer Pächterwohnung und einigen Oekonomiegebäuden umgeben, während der Burgbau die vierte Seite einnimmt. Diesen, das Herrenhaus, umschließt abermals ein breiter Graben, der aber heute trocken liegt und theilweise mit Blumen und Ziersträuchern bepflanzt ist. Ueber ihn führt zum Schloßportal eine zweite Brücke, deren eine Hälfte, wohl zur Erinnerung an die frühere Zugbrücke, aus Holz besteht. Der Burgbau bildet ein massives Viereck mit einem engen, von Arkaden umgebenen innern Hofraum, aus dem der Thurm, halb in den nördlichen Hauptflügel hineingebaut, sich zu mäßiger Höhe über die wuchtigen Dächer erhebt.
Das also ist das Schloß Blyenbeek. Das Wappen, der aufrecht schreitende goldene Löwe im schwarzen Felde, das von der Marquisenkrone bedeckt und von einem silbernen Löwen und silbernen Greif gehalten in dem Giebelfelde des Renaissance-Portals eingemeißelt ist, bekundet, daß der Bau vor Zeiten den Schenk von Nydeggen gehörte, und in der That eignete das herrschaftliche Gut jahrhundertelang diesem alten Vasallengeschlechte der Herzoge von Jülich, bis dasselbe vor bald zweihundert Jahren durch Ereignisse, welche wir gleich erzählen werden, in den Besitz der Marquis von und zu Hoensbroech kam, deren Eigenthum es noch heute ist. Seit mehr als einem Dutzend Jahren bewohnen aber die alte Burg aus der Heimat verbannte Jesuiten. Der selige Marquis öffnete den Verbannten in diesem Schlosse auf holländischem Boden eine Zufluchtsstätte, als der Reichstag im Jahre 1872 die Gesellschaft Jesu aus Deutschland vertrieb, und das gleiche Werk christlicher Barmherzigkeit, das der Vater an uns übte, setzt auch dessen edler Sohn, sein Nachfolger, mit dem gleichen Edelmuthe fort.
So ist es gekommen, daß ich jetzt schon im sechsten Jahre auf dem einsamen Heideschlosse wohne, und es ist mir lieb geworden mit seiner friedlichen Umgebung, was man aber liebt, das möchte man auch kennen, und so suchte ich mich in freien Stunden über die Vergangenheit des Schlosses und seine alten Bewohner zu unterrichten, wie oft betrachtete ich das Mauerwerk, das von manchen Veränderungen und Umbauten erzählt, und fragte mich, wer wohl die alten Bogenfenster, die jetzt noch kenntlich sind, und die schmalen, unregelmäßig vertheilten Luken zumauern ließ, um an ihrer Stelle in regelmäßigen Abständen die großen französischen Fenster zu brechen. Dann schauten mich von den Wänden einige alte Familienbilder an, kirchliche Würdenträger aus dem vorigen Jahrhundert, Perückenköpfe aus der Zeit Ludwigs XIV., ein schönes Frauenbild im Goldbrocatkleide als Diana, mit Pfeil und Bogen, ein blühender Knabe in Lebensgröße, mit einem alten Steinschloßgewehre in seiner Hand. Am bedeutendsten, aber wahrlich nicht am ansprechendsten, sind die großen Bilder des Kriegsobersten Martin Schenk von Nydeggen und seiner Gemahlin Maria von Gelre. Düster steht der finster blickende Mann in seinem ledernen Reiterwams da, über das sich eine breite seidene Schärpe und ein reich verziertes Schwertgehänge legt, die Rechte, die in einem schweren Reiterhandschuh steckt, auf den Tisch gestützt, welcher den mit wallendem Federbusche geschmückten Helm trägt, während sich die Linke herausfordernd in die Hüfte stemmt. Das Bild der schwarz gekleideten Frau mit dem kräftigen Kopfe auf dem steifen Tellerkragen paßt nicht übel zu dem verwegenen Reitersmanne, und trotz Bibel oder Gebetbuch, das sie vor sich auf dem Tische zur Schau stellt, möchte man ihr doch nicht zu viel christliche Liebe zuschreiben. Ohne Zweifel hat Blyenbeek unter diesem Paare die bewegtesten und historisch denkwürdigsten Tage verlebt. Allein der ebenso berüchtigte als berühmte Haudegen, der bald in spanischen Diensten unter Parma, bald als Oberst der Generalstaaten, bald unter Leicester im Dienste Elisabeths von England, bald als Feldmarschall des abgefallenen und geächteten Erzbischofs Truchseß von Köln, bald auf eigene Faust sengend und brennend das Land durchzog, der nie gelacht haben soll und im Rausche seine kühnsten Siege erfocht, der, wie es ihm Vortheil brachte, seinen Kriegsherrn verrieth und den Glauben seiner Väter abschwor, der endlich bei einem mißlungenen Handstreiche gegen Nymwegen im August 1589 einen elenden Tod in den Wellen der Waal fand und dessen Leichnam vom Henker geviertheilt wurde, ist mehr geeignet, Schauder als liebevolle Theilnahme zu erwecken.
Wie ganz anders schaut das Bild an seiner Seite, der fröhlich lachende Knabe mit der Büchse, aus dem morschen Rahmen herab! Die blonden Locken, die unter dem Federhute hervorquellen, die blauen Augensterne, die so lebensfrisch unter der reinen Stirne hervorleuchten, der lächelnde rothe Mund, der zu fragen scheint: »Bin ich mit Wams und Waidtasche und hohen Stülpstiefeln nicht ein rechter Jägersmann?« – das ist ein Bild, das mir die Frage auf die Lippen drängte: »Wie mag es diesem Kinde ergangen sein, dessen fröhliche Stimme vor bald zweihundert Jahren die alten Räume des Schlosses belebte?« Als ich nun das Knabenbild mit dem Kopfe der Diana im Goldbrocatkleide verglich, konnte ich in dem freundlich lächelnden Angesichte die Mutter nicht verkennen; das war derselbe schön geformte Mund, derselbe kindlich reine Ausdruck der Züge. Nur die schwarzen Locken der edlen Dame, welche glänzend und weich auf die Schultern herabfallen, und das warme, dunkle Auge paßten nicht zu den blonden Haaren und blauen Augen des Knaben. Die mochte er von seinem Vater haben, den wir in dem freundlichen Bilde vermuthen, welches einen noch jungen Mann von seltener Schönheit, mit milden, hellen Augen darstellt. Die einfach gescheitelte hellbraune Perrücke, welche noch nichts von den überladenen Schnörkeleien der Zopf- und Puderzeit an sich hat und fast wie natürliches Lockenhaar auf die Schultern herabwallt, umrahmt ein feines, ansprechendes Gesicht; ein blaues Atlaswams mit weißen Seidenlitzen an den bauschigen Schulterärmeln, eine Halsschleife aus Brabanter Spitzen kleiden die jugendliche Erscheinung zugleich geschmackvoll und vornehm.
Diese edle Frau, dieser freundliche Mann und der fröhliche Knabe in ihrer Mitte fesselten in hohem Grade meine Theilnahme. Ihren Namen, ihren Schicksalen forschte ich nach. Die Namen konnte man mir sagen: es ist der letzte Schenk von Nydeggen, Arnold, Marquis zu Hillenrath, Herr zu Blyenbeek u. s. w., sein eheliches Gemahl, Maria Katharina, Gräfin von und zu Hoensbroech, und ihr Sohn Christoffel Arnold Adrian. Ueber die Schicksale ist nicht so viel aufgezeichnet, als ich wohl gewünscht hätte. Einiges beruht auch auf mündlicher Ueberlieferung. Aber was ich hörte und las und mit den noch erhaltenen Denkzeichen aus ihren Tagen zusammenhielt, genügt zu einem schlichten Bilde ihres Lebens, das sich nach Gottes Rathschluß und Zulassung nicht so dornenlos abspielte, wie die Portraits wohl ahnen ließen. Sie scheinen gemalt zu sein, bevor die Wogen der Trübsal, welche diese edeln Kerzen in Bitterkeit tauchen, aber auch läutern und verklären sollten, ganz unerwartet hereinbrachen.
Diese Schicksale und Heimsuchungen nun soll uns der alte Meister erzählen, der ihre Bilder malte und der, wie viele Spuren seiner Thätigkeit beweisen, jahrelang in Blyenbeek verweilt haben muß. Die treuherzige, alte Sprache soll dabei in ihren Rechten nicht ganz verkürzt werden; die zahllosen Fremdwörter jedoch, in denen sich das Deutsch jener Zeit gefiel, werden wir nach Möglichkeit zu vermeiden trachten.
*
Ich, Meister Jan Thyssen, meines Zeichens Maler und Holzschnitzler, habe mir vorgenommen, zur Ehre Gottes, seiner lobwürdigen Mutter und zu meiner eigenen christlichen Auferbauung und Andenken, in dieses Büchlein aufzuschreiben, was sich allhier auf dem Schlosse Blyenbeek mit meinem viellieben jungen Herren und Schüler, dem edeln Junker Christoffel, begeben und zugetragen hat.
Bevor ich aber von dem herzguten Knaben schreibe, muß ich erzählen, wie und wann ich nach dem Schlosse Blyenbeek kam. Mein erstes Altarblatt malte ich nach vollendeter Lehrzeit, so meiner großen Armut wegen freilich nicht gar zu lange dauerte, zu Brüssel für die Väter Jesuiten, und da es ordentlich ausfiel, auch recht billig war, haben mich dieselben dem Feldmarschall Kaspar Schenk von Nydeggen, einem hochangesehenen Manne in hispanischen Diensten, der damals in Brüssel lebte, gnädiglich empfohlen. Es war dieser Herr Deutschordensritter und in seinen alten Tagen ein überaus frommer, gottseliger und wohlthätiger Mann; war auch von Frater Reginaldus Groningensis, dem Provincial der Kapuziner, aller Verdienste und Gnaden des ehrwürdigen Kapuzinerordens theilhaftig gemacht und hat vielen Kirchen und Klöstern Gutes gethan, wofür ihm der Herr die ewige Krone verleihen möge. Amen. Selbiger Feldmarschall ließ nun durch mich ein Altarbild für die Kirche zu Swalmen malen, welches ich anno Domini 1686 zu seiner Zufriedenheit vollendet, auch selbst an Ort und Stelle gebracht und aufgestellt habe. Und da er hörte – wie ich vermuthe, durch die Patres Societatis Jesu –, daß ich in Brüssel in großer Gefahr schwebe, mit andern jungen Malern ein leichtfertiges Leben zu beginnen, sagte er zu mir, als er mir die fünfundvierzig Goldgulden für das Altarblatt bezahlte: »Meister Jan, Ihr seid annoch jung und unerfahren und wißt nicht, wie leicht die liebe Unschuld, so Euch aus den blauen Augen leuchtet, in einer Stadt wie Brüssel und fürnehmlich hinter denen Weinkannen der Malerschenken verloren geht. Seht meine weißen Haare an und erlaubt mir einen guten Rath. Verlasset Eure Brüsseler Kumpanen; es geht sonst schwerlich gut!«
Nun muß ich gestehen, daß ich dasselbe mir selbst schon wiederholt gesagt, auch von meinem Beichtvater den gleichen Rath empfangen hatte. Aber du lieber Himmel! Was will ein Maler anfangen? In denen Wüsten der Thebais kann ein ehrlicher Maler sein Brod nimmer verdienen, auch nicht bei denen Bauern auf dem platten Lande, woraus denn folgt, daß er sich in Gottes Namen an den Höfen und in den Städten, allwo die Musen und Grazien wohnen, will sagen die schönen Künste in Gunst und Ansehen sind, mit merklicher Gefahr seiner armen Seele den täglichen Unterhalt erwerben muß. Solches sagte ich denn auch dem Herrn Feldmarschall. Der strich sich den weißen Schnurrbart und fragte, ob ich bereit wäre, in eine Thebais zu gehen, wenn er mir Arbeit auf viele Jahre verschaffe, und da ich dessen zufrieden war, wurden wir handelseinig.
Sandte mich also mein Mäcenas mit einem Briefe an seinen Neffen Arnold Schenk von Nydeggen nach dem Schlosse Blyenbeek, das der alte Feldmarschall damals auf eigene Kosten umbauen ließ. Der Bau war im rohen fertig; er mußte nun ausgeschmückt und eingerichtet werden, und dazu sollte ich mit Rath und That helfen. Auf sothane Weise kam ich also nach Blyenbeek und habe auf dem einsamen Schlosse, das mitten in einer Heide als in einer rechten Thebais liegt, anfangs fast Heimweh nach den Fleischtöpfen Aegyptens, verstehe nach dem lustigen Leben in Brüssel, empfunden. Aber die Arbeit, so ich in Hülle und Fülle fand, vertrieb meine Grillen. Das erste Werk, das ich in Angriff nahm und vollendete, sind die Schnitzereien des neuen, eichenen Schloßthores, und brachte ich darauf in der Bogenfüllung auf einem von Blattwerk umgebenen Schilde die Jahreszahl 1688 an, während ich die beiden Thorflügel mit dem von Lorbeerzweigen umrankten Wappenlöwen der Schenk verzierte. Den Lorbeer habe ich beigefügt, anerwogen der Schloßherr kurz vorher aus den Türkenkriegen ruhmreich heimgekehrt war, und hat mir selbiger eine besondere Gunst und ein Geschenk von zwanzig Albis oder Weißpfennigen eingetragen.
Leider bedeutet die Jahreszahl, welche ich einschnitzte, nicht nur die Vollendung des Baues, sondern auch das Todesjahr des edeln Feldmarschalls, meines hochverehrten Gönners, der ihn ausführen ließ. Wir hatten kaum das Thor eingesetzt, als von Brüssel ein Bote in den Schloßhof ritt und die Todesnachricht brachte, zugleich mit der Kunde, daß der Leichnam nach des Verstorbenen Willen gen Afferden gebracht werde, damit er dort ruhe, wo seine Seele durch die heilige Taufe für Gott wiedergeboren worden. Wirklich kam am achten Tage auf einem sechsspännigen Wagen der liebe Todte mit großem Gepräng, von zwei Vätern Jesuiten begleitet, auf Blyenbeek an, und da ihn ein Hofmedicus gar kunstreich einbalsamirt hatte, konnten wir den Sarg öffnen. Hatte somit den Trost, meinen liebwerthen Wohlthäter noch einmal zu schauen. Der liebe Abgeschiedene sah gar ruhig und friedlich aus in seinen weißen Haaren und in dem weißen Ordensmantel mit dem schwarzen Kreuze. Lieber, es sind mir die Zähren merklich in die Augen geschossen, als ich ihn so daliegen sah, und in meinem Herzen ertönten die Worte wieder, welche er einst zu Brüssel meinem jugendlichen Leichtsinne zugerufen hatte: »Du weißt nicht, wie leicht die liebe Unschuld verloren geht; verlasse deine Kumpanen, es geht sonst schwerlich gut!« Auch hielt der eine Jesuit eine gar bewegliche Predigt vor all den vielen Adeligen, welche zum Begräbnisse gekommen waren, über die Worte: » Sic transit gloria mundi!« – »So vergehet der Welt Herrlichkeit!« – daß sich ein Weinen und Schluchzen erhob und es einen Stein hätte erbarmen mögen.
Kniete also gänzlich zerknirscht an dem Sarge nieder und gelobte Gott, in Abgeschiedenheit ihm zu dienen und in einen heiligen Ordensstand einzutreten, wenn es mein Beichtvater für rathsam halte. Als ich nun den Jesuiten in der Beicht darüber fragte, wollte derselbe von einem Gelübde jetzo noch nichts wissen (hielt mich wahrscheinlich für zu wankelmüthig) und meinte, es sei genug, wenn ich in meiner Stellung zu Blyenbeek verharre, anerwogen das Schloß so einsam und verlassen liege wie Sanct Pauli Kloster in der Thebais. Und so habe ich damals den festen Entschluß gefaßt, auf der Heide zu verbleiben, es sei denn, daß mich Gott zu einem andern Lebensstande offenkundig berufen würde; bin auch seither mit der Gnade Gottes auf Blyenbeek verblieben, jetzt schon im sechzehnten Jahr. Glaube jedoch schwerlich, daß ich es allhier so lange ausgehalten hätte, wenn nicht durch des Schloßherrn Vermählung und meines lieben Junkers Geburt etwas mehr Leben in das stille Haus gekommen wäre.
Die Vermählung des hochedeln Herrn Arnold Schenk zu Nydeggen mit der edeln Gräfin Katharina von und zu Hoensbroech, Tochter des hochberühmten Erbmarschalls von Geldern, wurde freilich in aller Stille begangen, worüber ich mich damals schier gewundert habe. Es geschah anno Domini 1694, und habe ich mich in jenem Jahre über die Maßen plagen müssen, um das Prunkgemach rechtzeitig fertig zu malen. Selbiges sollte eine Art irdisches Paradies vorstellen und wurde deshalb auch das Paradies genannt. Der Saal besteht aus einem Mittelraume und zwei Seitenkammern, die doch zusammen gleichsam ein Ganzes fürstellen, und sollte ich in den mittlern Raum die vier Jahreszeiten, in die eine Nebenkammer die vier Welttheile und in die andere die vier Himmelsgegenden malen. Fing also in Gottes Namen mit den vier Welttheilen an und malte in vier Kreise, so sie jetzt Medaillons oder Schaumünzen heißen, je einen Kopf grau auf rothem Grunde. Für Europa, als der Herrin der andern Welttheile, nahm ich mit Fug und Recht Ihro Majestät die Kaiserin; für Asia den Großtürken mit einem mächtigen Türkenbund; für Afrika einen Mohrenkönig und für Amerika einen Kaziken oder Indianerhäuptling mit einer schönen Federkrone. Das alles umgab ich mit zierlichem güldenem und silbernem Blattwerk, mit Ranken von Weinlaub, Epheu, Eichenblättern und Lorbeer, malte auch zwei große Porphyrvasen dazwischen, wie sie jetzt Mode sind, dazu Muscheln und Schneckengewinde, daß es männiglich wohlgefiel.
Am meisten Freude hatte aber der Schloßherr über das Mittelstück der Decke. Da ließ ich durch eine Marmorbalustrade den lieben blauen Himmel hereinschauen, und mitten darüber trug ein großer Adler mit ausgebreiteten Schwingen das Wappen der Schenk von Nydeggen zusamt einem lustig flatternden Spruchbande in seinen Fängen. Es ist aber das Wappen der Schenk ein aufrecht schreitender güldener Leu in schwarzem Felde, ganz so, wie ihn die Herzoge von Brabant führten, weshalb die Schenk der Meinung sind, sie seien ein Nebensproß jenes uralten herzoglichen Hauses. Auf das Band setzte ich den Spruch meines Herrn Arnold: Coelum peto, und die Jahreszahl A° o 1694, ganz wie er es haben wollte. Und ich hörte auch, wie der Herr seiner jungen Gemahlin das Wappen und den Spruch erklärte, sagend: die Jahreszahl ihrer Vermählung werde ihn immerdar erinnern, daß ihre Verbindung ihn aus einer traurigen Welt gleichsam in einen irdischen Himmel eingeführet habe.
Der mittlere Raum mit den vier Jahreszeiten war noch nicht vollendet, als das neuvermählte Paar einzog. Ich hatte nämlich die Jahreszeiten als lebensgroße Figuren, so die Baukünstler Karyatides heißen, zuerst zwar in Lehm gemodelt, dann aber in Eichenholz geschnitzt, was mich unsägliche Zeit kostete. Konnte also die Deckenmalerei erst im darauffolgenden Jahre vollenden, zu deren nicht geringem Nutzen und Vortheil, anerwogen sowohl die gnädige Frau Katharina als auch das edele Fräulein Angelina, des Schloßherrn Schwester, mir bei den großen Blumen- und Fruchtkränzen, welche in den vier Zwickeln um das Mittelbild den Statuen der Jahreszeiten und deren Gaben entsprechen, durch Rath und That behilflich waren. Das Mittelbild mußte eine Darstellung aus dem Paradiese enthalten; so wollte es der Herr, wiewohl es zum Plane der vier Jahreszeiten mit nichten recht passen wollte, da ich nimmermehr glaube, daß es im Paradiese jemals Winter gewesen sei. Aber da konnte der Meister Maler lange reden; der Herr sagte, er wolle damit andeuten, daß er Blyenbeek seiner Frau zu einem Paradiese einzurichten wünsche, und dabei blieb es. Auch die vier Himmelsgegenden, wozu ich vier Landschaften schon auf den Carton gezeichnet hatte, wurden nicht gemalt: mußte statt dessen den dritten Raum fein marmoriren, soviel ich mich dagegen sperrte; habe aber gar keinen schlechten Serpentin und Lapislazuli auf die Eichenbohlen gekleckst.
Da bin ich nun wieder schön in meinen alten Fehler gefallen und rede von mir und meiner Malerei, anstatt von dem lieben Junker Christoffel: will also alles andere beiseite schieben und gleich von ihm anheben. Derselbe wurde geboren anno 1695, wenn ich mich recht besinne im heiligen Christmonat, kann den Tag aber nicht mehr finden. Das Knäblein war bei seiner Geburt so schwach, daß es schier schien, es wolle seines Vaters Wappenspruch gleich ausführen und gen Himmel fliegen, weshalb ich herbeigerufen wurde und dem Kindlein die Nothtaufe spendete, wobei es die alte Margreth in den Armen hielt, mit Thränen sagend: »Nur geschwind, es stirbt!« Allein es starb damals nicht, hat sich vielmehr ganz gut erholt und ist schon nach den ersten Monaten ein kräftiger Knabe geworden. Als nun der Winter vorbei war und Mutter und Kind sich stark und gesund fühlten, beschloß der Herr Arnold, dem Wunsche seines Herrn Schwiegervaters zu entsprechen und mit Söhnlein und Gemahlin gen Geldern zu reiten, allwo in der Kapellen auf dem Schlosse Haag die feierlichen Taufceremonien nachgeholt, auch dem Knäblein der Name gegeben werden sollte. Ende Mai ritten sie also fort, und Fräulein Angelina, welche des Knaben Pathin sein sollte, mit ihnen, und es wurde das Fest auf dem besagten Schlosse Haag am sechsten Brachmonat 1696 über die Maßen feierlich begangen. In währender Zeit benützte ich die ruhigen Tage, da ich mit dem alten Matthias, dem Kastellan und Verwalter, und etlichen Dienern allein auf dem Schlosse blieb, um die Frucht- und Blumenkränze in die Zwickel zu malen, und dachte damit den beiden edeln Frauen, welche mir bei der Zeichnung geholfen hatten, etwelche Freude zu machen, wenn sie das Werk bei ihrer Rückkunft vollendet fänden, auch mir eine rechte Ehre bei den Herrschaften einzulegen. Und ist mir nie in meinem Leben ein Bild also gut gelungen, wie sothane Kränze, und als ich eben die letzten Striche an dem dürren Eichenlaube malte, das den Kranz der Winterfrüchte umschlinget, trat Matthias in den Saal, rufend: »Sie kommen übermorgen!«
»Es ist gut,« sagte ich, »die Kränze sind fertig!«
»Ja, Eure gemalten,« antwortete er und schob sich eine Prise in die spitze Nase; »und sie sind recht zierlich und gut gemacht. Wollte nur, wir hätten die saftigen Pfirsiche, Aprikosen, Aepfel, Pflaumen und Trauben, welche Ihr da an die Decke gehängt habt, für das Festessen übermorgen Abend. Leider wachsen solche Dinge hier auf der Heide nur in Eurem Gehirn! Allein die andern Kränze – das wird eine liebe Noth geben; denn ich habe die Herrschaften noch lange nicht zurück erwartet. Der Herr hat mir aber beim Fortgehen aufgetragen, daß das Schloß bei der Heimkehr hübsch fein geziert sein solle; sintemalen er bei dieser Gelegenheit das Fest nachzuholen gedenke, das er bei seiner Vermählung nicht öffentlich habe feiern können.«
Da ich solche Worte meines Kastellans vernahm, sprang ich gar hurtig vom Malergerüste herunter, ihn scheltend, daß er mir solches erst im letzten Augenblicke vermelde: versprach ihm aber, das Menschenmögliche zu thun, daß alles nach Wunsch fein und zierlich werde. So hieß ich ihn gleich die Knechte und Mägde in den Busch schicken, daß sie einige Dutzend Körbe Eichenlaub und Heidelbeerkraut zu Kränzen holten, auch an die fünfzig Stück schöne Tännchen brächten; dann solle er gen Afferden reiten und den Magister zusamt den Schulkindern herbringen, daß alle helfen möchten, die Kränze zu winden. Es ist nämlich der Magister von Afferden und die ganze Schule von der hochseligen Mutter unseres Herrn Arnold gestiftet und aufgerichtet, und war mithin nur billig und recht, daß dieselben zu solcher Frohne herangezogen wurden. Auch schickte ich einen reitenden Knecht an den Prior der Augustinerchorherren von Gaesdonk mit der Bitte, er möge mir einen passenden Vers oder Chronistikon zu solcher Gelegenheit für eine Inschrift verfassen und spätestens bis am folgenden Morgen nach Blyenbeek senden. Richtete in währender Zeit Stangen und Stäbe zu zwei Ehrenpforten, die eine zwar am Eingange der äußern Schloßbrücke, die andere aber zur Verzierung des Portals, und lehrte die Bauernmädchen solche mit Tannenzweigen und Eichenlaub zierlich umwinden, verfertigte einige kleinere Inschriften, malte auf kleine hölzerne Schilde die Wappen der Agnaten der edeln Schenk und Hoensbroech, wobei mir der alte Matthias die Farben und Wappenzeichen getreulich angab, wie er denn in Heraldicis nicht wenig erfahren ist. Dabei lag mir die Mariann, die Köchin, beständig in den Ohren, daß ich ihr ein prächtiges Schaugericht herstelle. Weiß nicht, wer ihr verrathen hat, daß ich in Brüssel auch in solchen Dingen einigen Unterricht und Uebung genoß. Bin dennoch mit Gottes Hilfe zurecht gekommen; mußte mich aber nicht übel sputen, zumeist mit dem Chronistikon von Gaesdonk, das erst zu Mittag ankam, daß ich mich redlich plagen mußte, es mit rothen und güldenen Buchstaben fertig zu malen. Habe es doch zu stande gebracht, und als ich es oberhalb des Portalgiebels anbrachte, der mit dem Schenkenwappen geschmückt ist, war das Ding so groß, daß es schier bis an das mittlere Fenster darüber reichte. Aus selbigem Fenster ließ ich die große Schenkenfahne mit dem güldenen Leu auf die Inschrift niederwallen, welche von einem Kranze aus Eichenlaub umschlossen war, und befestigte in den Laubsäulen des Portals die bunten Wappenschilde, daß sie gar lustig aus dem hellen Grün hervorschauten. Ach, wie ganz anders habe ich später dieselbigen Wappen gesehen und hatte damals keine Ahnung, wozu sie nach Gottes abgründigem Urtheil noch gebraucht werden sollten!
Summa: alles ist rechtzeitig fertig geworden, und mein alter Matthias rieb sich schier vergnügt die Hände, da er mit mir noch einmal den ganzen Schmuck von dem Triumphbogen der äußern Brücke bis zum Portal des Burghauses betrachtete und zwischen den mit Kränzen verbundenen und mit lustigen Fähnchen gezierten Tannen quer durch den Schloßhof auf und ab ging.
»Ihr seid ein Hexenmeister,« sagte er schmunzelnd; »solches hat man auf Blyenbeek nicht gesehen seit Menschengedenken. Ist aber auch ein schönes Fest! Ihr wißt nicht alles, Meister Jan; anerwogen es noch vor wenigen Jahren den Anschein hatte, als sollte das alte Geschlecht der Schenk von Nydeggen gänzlich abdorren und zu Grunde gehen. Es war auch so etwas von einem Barfüßer prophezeit als Strafe für die Frevelthaten des Kriegsobersten Martin, dessen Bild in der Halle hängt.«
»Ich kenne es wohl,« redete ich dazwischen, »und hat mich das bleiche, grimmige Angesicht des Mannes jederzeit fast erschreckt.«
»Um so mehr sei nun Gottes grundlose Barmherzigkeit gepriesen, der alles so liebreich gewendet und gefüget hat,« fuhr mein alter Matthias fort. »Seht, Meister Jan, da unser Herr Arnold die Tochter des hochangesehenen Erbmarschalls von Geldern, des Marquis von und zu Hoensbroech, gefreit hat, sind die beiden reichsten Geschlechter in ganz Gelderland ehelich verbunden. Da hat sich der Spruch erfüllet: Geld zu Geld und Ehr zu Ehr, und ist sothane glückselige Verbindung der Brunnquell einer neuen Glückszeit für Blyenbeek geworden. Auch unser allergnädigster Landesherr, der König von Hispanien, hat in Ansehung der großen Verdienste des Herrn Erbmarschalls dessen Schwiegersohn zum Marquis oder Markgrafen erhoben. Und nun erst das Segenskind, so sie heute vom Schlosse Haag herüberbringen – ich sage Euch, Meister Jan, weinen könnte ich alter Gesell vor Freude nach all dem Trüben und Traurigen, das ich in den letzten sechzehn Jahren nach dem Tode des hochseligen Herrn Christoffel erlebt habe!«
Noch nie hatte ich meinen alten Matthias, so ansonst eher ein stiller und verschwiegener Gesell ist, also redselig und mittheilsam gefunden. Fragte ihn daher, wie es denn gekommen sei, daß man die Vermählung unserer Herrschaft so still und heimlich begangen habe. Da wollte er doch nicht gleich mit der Sprache heraus, sondern schickte mich in den Schloßthurm, daß ich die Fähnlein, welche in den Dachluken aufgesteckt waren, anders vertheile. »Rechts das Schenkenfähnlein,« sagte er, »links das Hoensbroechsche mit dem gekrönten, doppeltgeschwänzten schwarzen Leu in weiß und roth getheiltem Felde, und nach den beiden andern Seiten die gelderischen und hispanischen Farben. Item seid auch so gut, oben selbst Ausschau zu halten, anerwogen Ihr mit Euern scharfen Augen mehr sehet als ich mit den neuen Gläsern, welche mir meine Alte auf dem Clever Markt gekauft hat. Sobald Ihr den Zug aus dem Weezener Walde auf die Heide kommen seht, gebt Ihr dem Knechte Grates das Zeichen, daß er die erste Karthaune löse. Dann kommt herab, daß wir die Herrschaften gebührendermaßen begrüßen.«
Stieg also auf den Thurm und machte den Wart. Es war aber ein gar schöner Sommerabend. Die liebe Sonne senkte sich langsam und übergoß die gelben Sanddünen, die braune Heide und die dunkeln Kieferbüsche mit einem güldenen Glanze, daß sogar die öde, einförmige Landschaft, von ihrem Farbenzauber überhaucht, schön und gleichsam verklärt wurde. Hätte gar gerne versucht, das liebliche Bild etwa auf die Leinwand zu bringen, wiewohl kein Maler mit Pinsel und Farbe malen kann, wie es der allmächtige Gott mit etlichen Strahlen seiner lieben Sonne für das Auge des Menschen in Pracht und Lieblichkeit hinstellt, während über der Heide die warme Luft noch zitterte, erhob sich von der Maas her ein erquickender Wind, spielte lustig mit den Fahnen und wehte mir Kühlung zu. Darüber kam ich ins Träumen und hätte beinahe den rechten Augenblick verpaßt; denn die Reiterschar hatte schon eine gute Strecke zwischen dem Weezener Walde und dem nächsten Busche zurückgelegt, als ich sie erblickte, winkte also rasch dem Grates mit dem Tüchlein. Der war nicht faul, schüttete frisches Kraut auf das Zündloch, schwenkte die Lunte und – pardautz! krachte der Schuß über die Heide, worauf ich alsbald die Leiter und die steilen Thurmtreppen hinabkletterte und in den Schloßhof zu meinem Matthias hinaustrat.
In selbigem wimmelte und wogte es jetzund von fröhlichen Menschen. Nicht nur alle Hörigen unseres Herrn, sondern viele Neugierige aus den umliegenden Dörfchen, ja sogar von Goch, waren gekommen, um den feierlichen Einzug des kleinen Schenk in sein Stammschloß zu sehen. Mein alter Matthias hatte genug zu thun, die Leute in Reih und Glied hinter den Tännchen und Kränzen aufzustellen. Als endlich etwelche Ordnung geschaffen war und rechts vor dem äußern Triumphbogen der Magister von Afferden mit seinen Chorknaben, links drei Fiedler, ein Hackbrettspieler und ein Hornbläser standen, riefen die Kinder auch schon: »Sie kommen!« und alsbald hoben die Musikanten ihr Spiel an und schrieen die Leute, mit den Hüten schwenkend, wie der Kastellan sie gelehrt hatte, ein kräftiges Vivat.
Wirklich kamen die edeln Herrschaften längs der Blye über die Wiese. Noch heute sehe ich sie ganz lebhaft vor meinen Augen, daß ich mir wohl getraute, sie zu malen. An der Spitze des Zuges ritten die beiden Herren Marquis Arnold Schenk von Nydeggen und dessen Schwiegervater, der Erbmarschall von Geldern, Marquis von und zu Hoensbroech. Das war das erste Mal, daß ich diesen Herrn sah, und hat selbiger ein ernstes, feines Gesicht, welches ich gerne gemalt hätte. Die gewaltige Staatsperücke – grand in folio genannt –, der reiche, mit Goldstickereien und weiten Aermelaufschlägen verzierte Rock aus dunkelrothem Sammet gab der gebietenden Gestalt fast fürstliches Aussehen, und man merkte wohl, daß der Herr mit der feinen Hofsitte vertraut sei, wie er denn auch als Diplomat und hispanisch-gelderischer Rath ein großes Ansehen genießt. Auch unser Herr Arnold war recht stattlich gekleidet im dunkeln Sammet. Den beiden Herren folgten die Marquise und das Edelfräulein Angelina, und schwer war zu sagen, welche der beiden Damen holdseliger sei. Die Schloßherrin trug ein blaues Seidenkleid, das kurze, mit Spitzenbauschen verzierte Aermel hatte. Die schwarzen Locken fielen in feinen Ringeln auf die Schultern nieder, und das schöne, liebliche Gesicht mit dem dunkeln Auge glühte von dem Ritte über die Heide. Angelina hatte blonde Haare und helle, blaue Augen; sie schien mir immer, wie ihr Name andeutet, ein halber Engel zu sein. Jetzt trug sie als Pathin das in ein Seidenkissen eingewickelte Kind, und so waren aller Augen auf sie gerichtet. Dahinter ritten mit großem Prunk noch andere adelige Herren und Damen, Verwandte und Benachbarte, worunter ich nur die von Arcen, von Well, von Wyssen und von Geystern namhaft machen will.
Als die Cavalcade die breitästigen Linden vor der äußern Schloßbrücke erreicht hatte, machte sie Halt und wartete, bis die Musikanten ihr Stück geendet und der Magister von Afferden ein artiges Liedlein eigener Composition mit seinen Knaben gesungen hatte. Dann trat mein alter Matthias den Herrschaften entgegen, sagte unter tiefer Verbeugung seinen Willkomm und brachte, wiewohl mit einigem Kniegeschlotter, einen gar nicht übel gesetzten Spruch aus auf den jungen Herrn, der nach seinen beiden Großvätern in der heiligen Taufe den Namen Arnold Adrian Christoffel erhalten hatte, wozu die Bauern, wie er sie gelehrt und eingeschult, mit den Leuten und Zipfelmützen, schwenkend, dreimal »Hoch!« schrieen. Dieselben schonten dabei ihre Lungen so wenig, daß die Reitgäule ihre Ohren spitzten und schier durchgegangen wären. Dazu spielten und bliesen die Musikanten, und der Magister von Afferden setzte mit seinen Knaben nochmals ein, und vom Walle erdröhnten die Viertelskarthaunen, und auf dem Schloßthurme wapperten lustig die Fähnlein im Abendwinde – Summa: es war schier ein Jubel, als ob ein Königssohn geboren wäre. Bei all dem Schießen und Schreien erhob denn auch mein kleiner Junker Christoffel sein Stimmlein und begann so laut zu greinen und zu weinen, daß ihn die Pathin Angelina durch kein Schütteln und Wiegen beruhigen konnte. Da nahm ihn die Mutter lächelnd in die Arme, schmiegte ihn an die Brust und scherzte: »Kind, alles lacht, und du weinest beim Einzuge in dein Schloß?«
»Er ist das Schießen noch nicht gewöhnt,« sagte lachend sein Vater. »Laß ihn nur erst so groß werden, daß er eine Büchse heben kann; da sollst du sehen, welche Freude der Knabe am Schießen hat, so wahr er ein echter Schenk ist.«
Seine Pathin Angelina aber sagte: »Möge es ihm nie Unheil bringen,« und ist mir in den letzten Tagen sothanes Wort der reinen Jungfrau oft eingefallen, will sie nächstens doch fragen, ob sie etwa dabei ein Vorgefühl empfunden habe.
So ritt nun der Zug unter währendem Hochrufen der Leute durch den Thorweg und die doppelte Reihe von Tännchen bis an die innere Brücke, allwo sich die Herren aus dem Sattel schwangen und den Damen beim Absteigen behilflich waren. Dabei hatte ich die große Freude, das Knäblein, so ich getauft hatte, einen Augenblick in meinen Armen zu halten; aber Fräulein Angelina nahm es mir gleich wieder ab.
Herr Arnold dankte hierauf den Leuten für den schönen Empfang, den man seinem lieben Söhnlein, seinem trauten Ehegemahl, seinem hochedeln Herrn Schwiegervater, ihm selbst und allen Gästen bereitet hatte. Dabei belobte er in Sonderheit den lieben getreuen Kastellan Matthias und mich, den er seinen »geschickten Meister Thyssen« nannte, dessen Kunst der schöne Portalschmuck wohl verrathe. Auch fragte er, wer das feine Poëma und Chronistikon verfaßt habe, und gebot dem Kastellan, am nächsten Morgen den ehrwürdigen Augustinern nach Gaesdonk fünf Malter Korn und eine Bütte Bier zu bringen zum Danke für ihre freundnachbarliche Liebe und sie zu bitten, eine heilige Messe für den kleinen Christoffel zu lesen. Endlich sagte der Herr den Bauern und dem Gesinde, sie möchten sich an Bier und Brod, Schnaps und Schinken zu Ehren des jungen Schenk gütlich thun und könnten auch auf der Tenne in Ehren einen Tanz aufführen, wozu ihnen die Spielleute fiedeln und blasen sollten. Da erhob sich ein großer Jubel, und während die Herrschaften unter vielen Complimenten und tiefen Bücklingen über die Brücke durch das Portal des Burghauses eintraten, stimmten die Musikanten schon den ersten Hopser an, wozu alsbald die Zöpfe der Mädchen und die weißen Flügelhauben der Weiber im Rundtanze lustig flogen, derweil die Holzschuhe der Bauernburschen einen kräftigen Takt polterten.
Also wurde anno 1696 gar freudig der Einzug meines lieben Christoffels in Blyenbeek auf den Abend von Sanct Antonius von Padua Tag gefeiert, und dieses ist das schönste Fest, das ich auf dem einsamen Heideschloß verlebt habe.
*
Die Festtafel hatte mein alter Matthias in dem mittlern Raum des »Paradieses« zwischen den vier Standbildern der Jahreszeiten gar reich und zierlich decken lassen. Nun geschah es, wie ich nachher von Grates, dem Knecht, hörte, daß männiglich über den Schmuck dieses Saales in großes Erstaunen gerieth, da sie selbigen nach vollendeter Bemalung zum erstenmal erblickten und dergleichen Prunk auf dem einsamen Schlosse inmitten der Heide mit nichten erwartet hatten. Selbst der Herr Erbmarschall belobte erstlich den Plan und zum andern die Ausführung, in Sonderheit der geschnitzten Figuren und Karyatides. Ueber die Maßen erfreut ob der Frucht- und Blumenkränze, die gar lustig und frisch aus den Zwickeln herabschauten, seien aber fürnehmlich die gnädige Herrin und das edle Fräulein Angelina gewesen; hätten auch sofort dem Herrn Marquis in den Ohren gelegen, daß man mich zur Tafel ziehe. So gebot denn der Schloßherr, daß für den alten Matthias und mich im Nebenraume ein Tischlein gedeckt werde, nicht in dem mit den vier Weltteilen, sondern in dem marmorirten. In jenem stand nämlich gerade unter dem Adler, der mit dem Schenkenwappen und dem Coelum peto gen Himmel fliegt, eine kostbare Prunkwiege, so ich heimlich geschnitzt, gemalt und vergüldet hatte. Darein haben sie meinen lieben Junker gelegt, als sie ihn am Ende des Mahls zu den Gästen brachten, wie ich alsbald erzählen will.
Sintemalen der Grates nicht einer von den Findigsten ist, fand er auch mich lange nicht; hätte sich doch denken können, daß ich auf der Tenne beim Tanze war! Die Herrschaften hatten den Rehbraten schon auf dem Tische, als ich in meinem besten rostbraunen Sammetkoller, mit dem feinen flandrischen Spitzentüchlein um den Hals, so mir die gnädige Frau zu Sanct Niklausen Tag geschenkt hatte, in den Saal trat und mich gebührendermaßen verneigend neben dem alten Matthias niederließ.
An dem Herrentisch ging es hoch her und wurde von lauterem Silber gegessen, was dazumal wohl nicht in manchem adeligen Hause Gelderns möglich war, anerwogen die schrecklichen Kriegszeiten und vielen Brandschatzungen das Silberzeug über die Maßen rar gemacht hatten. Die Herren redeten auch vom Kriege, wobei ich die klugen und wohlgesetzten Worte des Herrn Erbmarschalls, so seither meistens eingetroffen sind, gar sehr bewunderte. Als aber die Herren den Weinkannen etwas mehreres zugesprochen, auch der Nachtisch aufgetragen war, ging es merklich lustiger zu. Da neckte der alte Herr von Loë unsere gnädige Frau gar anmuthig, daß sie die schönsten Aprikosen, Pfirsiche und Trauben, so er im Leben gesehen, an die Decke hänge, anstatt auf die Tafel lege und also den Gästen die Qualen des alten Tantalus bereite; denn nimmermehr wolle er glauben, daß die Dinge da droben gemalt seien. Aber unsere edle Frau Katharina wußte ihm recht wohl zu antworten. Der alte Tantalus, sagte sie, sei ihres Wissens also gestraft worden, weil er an der Göttertafel eine lose Zunge geführt, und müsse sich also der Herr Graf vielleicht eines ähnlichen Fehlers schuldig wissen, sintemalen er dessen Qual empfinde. Sie aber sei eines barmherzigen Sinnes und wolle ihm in seiner Noth mildreich beispringen. Damit goß sie ihm aus der silbernen Kanne goldperlenden Rheinwein in den Becher, ob welcher fröhlichen Antwort männiglich der edeln Frau Beifall zollte.
Hernach wurde das Schauessen aufgetragen, das ich mit großer Mühe in währender letzter Nacht hergerichtet hatte. Selbiges stellte eine mehr als schuhlange Wiege für und war außen schön bemalt und mit den Wappen der Schenk und Hoensbroech verziert, inwendig aber voll von Printen, Waffeln und Marzipan. Auf den Kissen der Wiege ruhte der schlafende Gott Amor, ganz aus Zucker; hatte ihm auch mit Johannisbeersaft die Backen und das Mäulchen fein roth bemalt und ihm sein Gewaffen, will sagen Bogen und Köcher, aus goldgelbem Zuckerkandis, zur Seite gelegt. Hei, Lieber, erhob sich da ein großer Jubel an der Tafel und brachten die Junker allerlei zierliche Sprüche über den alten Amor vor, wie es ja in jetzigen Zeiten Mode ist, in Mythologicis wohl bewandert zu sein, sintemal sogar einige Prediger solche Geschichten auf die Kanzel bringen, was mir nie recht munden wollte. Ein junger Herr von Geystern, der schon lange, wiewohl umsonst, der schönen Schwester des Schloßherrn den Hof macht, meinte sogar, wenn ihm also süße Zuckerpfeile zur Verfügung ständen, wie dem Amor in der Wiege, so würde ihm vielleicht die edle Angelina minder grausam sein.
»Nehmt sie Euch alle,« versetzte lachend mein Fräulein; »nehmt sie samt Köcher und Bogen und versüßt damit die Bitterkeit Eures Grames, an den niemand glauben mag.« Und mit sothaner Antwort hatte sie die Lacher auf ihrer Seite.
Mein Junker aber, den der Bacheracher gar beredt machte, rief mit lauter Stimme und beweglicher Gebärde: »Wache auf, o schlafender Amor! Strafe die Grausame, du, der Freuden verspricht und bittere Leiden verleihet!« Derweil er aber bei solchen Worten seine Hand auf den Köcher des Gottes legte, berührte er die Feder, welche die Seiten der Wiege öffnete, so daß dieselben (wupp dich!) aufsprangen und ihren süßen Inhalt, verstehe Printen und Marzipan, über die Tafel ausschütteten. Nun will ich nicht sagen, wie sie darob männiglich jubilirten, sintemal sich das jeder leichtlich fürstellen kann.
So sprach unsere gnädige Frau Katharina: »Seht, Junker, wie Amor Euer Wort in verwunderlicher Weis Lügen straft! Ihr sollt ihn mir nicht lästern. Mir hat er Glück und Freude gebracht und auch nicht eine bittere Stunde, anerwogen er mir meinen lieben Mann gab und den herzsüßen Christoffel. Schauet, ihr Herren, was er mir in diesem Schloß zu Blyenbeek für ein Paradies herzauberte, dessen Abbild und Gleichniß Meister Thyssen an Wand und Decken gar kunstfertig dargestellt hat. Seht da die vier Jahreszeiten, welche mich der Reihe nach mit immer neuen Gaben beschenken, mit Blumen und Früchten! Und jetzo kommen auch die lieben Engel ins Paradies – wie denn der erste, verstehe unsern kleinen Christoffel Arnold Adrian, allbereits eingezogen, so daß ich mit Dank gegen Gott erachte, es gebe keinen glücklicheren Menschen als meinen Mann und mich!«
Solche Worte hatte meine gnädige Frau in ihres Herzens Glück also begeistert gesprochen, daß ihr edles Antlitz strahlte, und ihre dunkeln Augen leuchteten nicht anders als die liebe Sonne an einem anmuthigen Maientag. Dabei reichte sie, gleichwie zum Danke für das Glück, welches seine Liebe ihr schenkte, dem Gemahl über den Tisch die Hand, so dieser mit bebenden Lippen küßte, während ein freudiges Roth seine ansonst bleichen Züge überflog. Da nun auf einen Wink der glückseligen Mutter die Amme in währender Zeit das Knäblein flugs herbeigebracht hatte, erhoben sich alle Gäste, um auf das Glück des edeln Paares zu trinken. Mir ging es schier wie dem alten Matthias, der sich eine Thräne der Freude aus den Augen wischte. Als nun die Mutter den lieben Christoffel meinem gnädigen Herrn in seine väterlichen Arme gelegt hatte, erhoben alle Gäste Humpen und Becher, und auch die Frauen stießen mit ihren zierlichen venetianischen Gläschen hell klingend an und tranken, daß solches Eheglück festiglich bestehe, das liebe Kind wachse und gedeihe und der edle Stamm der Schenk von Nydeggen in Ehr und Ansehen auch fürderhin grüne und sprosse.
Da nun solche Trinksprüche ohne eingehaltene Etiquette oder Hofsitte also stürmisch durcheinander wirbelten, schüttelte mein Erbmarschall seine große Staatsperücke, hob auch den Finger und sagte lächelnder Miene zu seiner Tochter: »Kind, du hast mir mein ganzes Concept verdorben, alldieweil der erste Trinkspruch sonder Zweifel Seiner Heiligkeit Innocentio XII., unserem glorreich regierenden Papste, und Seiner kaiserlichen und apostolischen Majestät Leopoldo I. gebührt; der zweite aber unserem allergnädigsten Landesherrn, Seiner katholischen Majestät Carolo II. von Hispanien. Dann mag immer noch Platz sein für einen Trinkspruch auf unsern kleinen Schenk, auf dein und deines Mannes, meines viellieben Schwiegersohnes Glück und Wohlfahrt, wie nicht minder auf die Blüthe eures Hauses, was nun das Blyenbeeker Paradies angeht, welches ihr euch gar schön und kunstreich eingerichtet, wünsche ich von Herzen, daß es in guten und in bösen Tagen Bestand habe, und solches wird denn auch nicht ausbleiben, wenn der rechte Amor bei euch Einkehr nimmt; nicht jener der blinden Heiden, sondern jener, den das Kindlein von Bethlehem auf diese Erde brachte. Der kommt vom Himmel, hat den Himmel bei sich und führt gen Himmel. Lieber Sohn, du hast dir da unter dein Wappen, das ein Adler stolz gen Himmel trägt, den schönen Spruch malen lassen: Coelum peto – Zum Himmel strebe ich – und dazu die Jahreszahl deiner Vermählung mit meiner guten Katharina anno 1094. Denket an sothanen Spruch und lehret ihn euern Knaben und leget denselben vom christlichen Himmel aus und nicht nur vom Parnassus der Poeten, verstehe den Himmel irdischen Ruhmes und irdischer Größe. Unsere Ahnherren haben gemeiniglich fromme Sprüche unter ihre Wappen gesetzt, wie auch unser Spruch ein gar frommer ist und Soli Deo – Nur für Gott! – lautet. Ich bin jetzt ein betagter Mann und darf wohl sagen, daß ich etwelches zum Besten unseres Gelderlandes, des Erzhauses Oesterreich, welches Gott schützen möge, und Seiner katholischen Majestät gethan habe – hoffentlich auch ein weniges für Gott, ansonst wäre es gar traurig; anerwogen es allen Schein hat, daß Geldern bald unter einem andern Herrscherhause stehen wird. Bauet also euer Glück nicht auf diese Erde, wo alles wechselt wie ein leidiges Aprilwetter, sondern auf den Grund, der allein ewigen Bestand hat. ›Strebet zum Himmel!‹ Und möge der grundgütige Gott geben, daß er dieses jetzt und in der heiligen Taufe zum Himmelserben angenommene Kind ewig mit uns allen in seinem wahren Paradiese glücklich mache, dessen Bildniß und Conterfei ihr euch vor Augen habt malen lassen! Unser junger Christoffel Arnold Adrian lebe also dermaßen, daß er ewiglich lebe!«
Also hat der Herr Erbmarschall einen gar ernsten und bedeutsamen Trinkspruch gethan, daß ich wahrhaftig bekennen muß, nie in meinem Leben einen ähnlichen gehört zu haben, hatten auch alle die Thränen in den Augen; denn der alte Herr redete so warm und eindringlich, daß es auch dem Jüngsten und Muntersten zu Herzen ging. Seine letzten Worte aber: » Vive, ut vivas«, habe ich in das mittlere Feld an die Decke der Kammer gemalt, welche neben dem »Paradies« gelegen ist, daß sie auch künftigen Zeiten überliefert würden.
Nach sothanem christlichen Trinkspruch hatte die Mahlzeit ein Ende, und es begaben sich die Frauen mit dem Kinde in die Familienstube, wo für sie noch süßes Gebäck und in zierlichen chinesischen Täßchen Thee dargereicht wurde, ein zur Zeit gar köstliches Getränk, das wir von einem Kaufherrn in Rotterdam die Maas herauf beziehen. Die Herren aber setzten sich in die Halle und sprachen dem edeln Safte der Rüdesheimer Trauben in großer Munterkeit zu.
Nun lud mich mein alter Matthias zu einem Gange durch den Garten ein, wozu ich gerne bereit war; gingen also selbander Arm in Arm die Treppe hinab und traten auf den Schloßhof hinaus, allwo wir einen Augenblick den Tänzern zuschauten, die noch immer mit den schweren Holzschuhen die Tenne stampften.
»Der Freudentag ist ihnen wohl zu gönnen nach den langen trüben Kriegszeiten,« sagte der wackere Matthias; »und wer weiß, was uns Schweres bevorsteht!«
»Auch der Herr Erbmarschall scheint düstere Ahnungen zu haben,« entgegnete ich. »Er glaubt wohl, daß nach dem Tode unseres kinderlosen Königs ein neuer greulicher Kriegsbrand ob der hispanischen Erbschaft ausbrechen werde; möge Gott solches gnädiglich abwenden! Ein überaus kluger, frommer und fürsichtiger Herr, dieser Marquis Hoensbroech! Hat aber einen gar ernsten und eindringlichen Trinkspruch ausgebracht, wie ich in meinem Leben keinen hörte!«
»Ja, der Erbmarschall ist ein hochweiser und herzensguter Herr, und wir dürfen ihn mit Fug meines Herrn andern Vater nennen, anerwogen er ihm viel mehr Gutes gethan als Ihr nur ahnen könnet. Ihr habt mich heute gefragt, weshalb die Vermählung vor zwei Jahren so in aller Stille geschlossen wurde, will Euch nunmehr solches erzählen, und alles, was damit zusammenhängt, woraus Ihr dann leichtlich den Herrn Erbmarschall noch besser erkennen möget. Auch müßt Ihr so wie so früher oder später eine leidige Geschichte erfahren, von der ich immer fürchte, sie werde noch einen Schatten auf das Glück unserer gnädigen Herrschaft werfen, weiß, daß Ihr es gut mit unserer edeln Frau meinet, und so werdet Ihr mir wachen und wehren helfen.«
Auf solche Worte meines Matthias, so mich schier erschreckten, gab ich zur Antwort: »Mit meinem Leben, wenn es sein muß.«
»Ich glaube es gern,« sagte er. »Seht, der Mond scheint hell, und die Luft ist anjetzt nach dem heißen Sommertage milde, wir wollen selbander in den Wallgang gehen. Dort kann ich Euch ungestört alles erzählen.«
Der alte Mann, den ich sonst immer schweigsam gefunden hatte, war an jenem Abende gar mittheilend; ob solches etwan der Bacheracher gethan, oder ob die Freude sein Herz erschlossen, oder ob eine Ahnung ihn bewegte, das lasse ich in seinen Würden. Er erzählte mir von dem alten seligen Herrn Christoffel, dem Vater unseres Herrn Arnold, so bei vielen guten Eigenschaften ein heftiger und manchmal schier streitsüchtiger Herr war. Selbiger hatte auch mit dem Erbmarschall Hoensbroech einen Streit, sintemalen er ihm das Recht bestritt, in der Versammlung der gelderischen Stände den Vorsitz zu führen. Den Proceß, der mit nicht geringen Kosten an Geld und Gut hin und her gebeutelt wurde, haben die Herren vom Kammergericht schließlich also geschlichtet, daß dem Erbmarschall allerdings dieser Vorsitz gebühre, daß aber hinwiederum in seiner Abwesenheit die Schenk als Herren von Hillenrath den ersten Platz einnehmen sollten. Item hätte deshalb damals niemand gedacht, daß die beiden verfeindeten Familien sich ehelich verbinden würden.
»Dennoch war der Erbmarschall derjenige, der seines Gegners Sohn nicht nur aus einem großen Unheil befreite, sondern demselben sogar sein jetziges großes Glück zugewendet hat,« fuhr der Kastellan fort. »Und das kam also. Der Herr Christoffel starb, als unser Herr Arnold erst siebenzehn Jahre alt war. In so jungen Jahren sein eigener Herr und der Herr so großer Güter sein, thut aber selten gut; Ihr werdet Euch derowegen nicht verwundern, daß der edle, herzensgute Jüngling sich in seiner Unerfahrenheit in einen bösen Handel verwickelte. Solches geschah denn leider anno 1682, als er ins Jülicherland ritt, wo er bei verwandten Besuche machte. Ich war bei ihm und hätte meine Augen rechtzeitig offen halten sollen. Unser Herr war damals ein bildschöner Jüngling; kennt Ihr doch sein Conterfei, das in der Halle hängt; dasselbige ist in damaliger Zeit von einem Meister gemalet worden, der nicht so flunkerte, wie ihr Maler es ansonst gewöhnet seid.«
Merkte zwar den Stich, den mir Matthias versetzen wollte, that aber nicht dergleichen, sondern erwiderte freundlich: »Wohl kenne ich das schöne Abbild mit dem blauen Atlaswamse und den weißen Seidenlitzen! – Es ist sehr schön, wacker gemalt; aber, so es nicht geschmeichelt, hat sich der Herr seit dazumal gar ungewöhnlich verändert; das Antlitz ist jetzt so blaß, die Wangen eingesunken und von frühzeitigen Furchen durchzogen, daß ich wohl erachte, er habe seit jenen Tagen Schweres erduldet.«
»Wohl hat er Bitteres verkostet! Höret nur: Im Jülicherlande traf er mit einer Französin zusammen, so eine verwittwete Gräfin de Bruay zu sein vorgab. Ein schönes, aber gar gefährliches Weib! Will ihres liederlichen Lebens nicht weiter gedenken. Ich habe sie immer für eine rechte Hexe gehalten und glaube bestimmt, daß sie das Herz des jungen Arnold mit höllischem Zauber umstrickte und zugleich meine Augen verblendete: hätte ansonst die Netze sehen müssen, welche sie seiner Unerfahrenheit stellte, nicht anders als ein Vogelfänger den Finken. Als ich es endlich merkte, war es leider Gottes zu spät. Summa: Sie hatte ihn zu einer heimlichen Ehe verleitet, und nun vermeinte der Kuckucksvogel sicher im warmen Neste zu sitzen. Jetzt kam es heraus, wer die vermeintliche Gräfin de Bruay war; die Tochter eines Quacksalbers aus dem Lande Artois, welche sich in den französischen Heerlagern umhergetrieben hatte; mehr will ich nicht sagen: möge unsere gnädige Frau nie etwas von der Unseligen erfahren!«
»Selbiges Weibsbild ist natürlich schon lange todt?« fragte ich über die Maßen erschrocken.
»Leider lebt sie meines Wissens; gäbe meinen kleinen Finger von der Hand, wenn ich das Unglücksweib damit bannen könnte! Die Ehe war freilich aus mehr als einem Grunde, so ich hier nicht anführen will, von Anfang an null und nichtig. Doch hatte ich gar nicht den Muth, meinem Herrn Arnold, der, wie Ihr mir trauen dürft, in gutem Glauben gehandelt hatte, die Augen zu öffnen. Da hörte ich, daß der Erbmarschall auf einem benachbarten Gute verweile, und anerwogen ich denselben immer für einen gar klugen Edelmann gehalten, faßte ich einen Muth, ritt heimlich zu ihm und sagte ihm alles. Habe mich in dem rechtschaffenen christlichen Herrn auch mit nichten getäuscht. Er hat der alten Feindschaft zwischen ihm und dem Schenk nicht weiter gedacht, sondern ist ohne Säumniß zu meinem Herrn gekommen. Ich war im Vorzimmer, als er dem armen Junker seine Lage eröffnete; es dauerte lange. Endlich ging die Thür auf, und die beiden traten heraus. Junker Arnold war bleich wie der Tod, und seine Augen standen voll Thränen; er konnte nicht reden; schluchzend ergriff er die Hand des Erbmarschalls und küßte sie. Der tröstete ihn und sagte: ›Alles kann wieder gut werden, handelt jetzt wie ein Christ und wie ein Edelmann und seid überzeugt, daß ich Euch in allem nach besten Kräften helfen werde, wie ein Vater seinem Sohne.‹ – ›Ja,‹ sagte mein Herr Arnold, ›Ihr seid wahrlich wie ein Vater zu mir gekommen – aber zu helfen wird mir nicht mehr sein, dieweil diese Betrügerin und mein Leichtsinn mein Lebensglück geknickt haben.‹ – ›Doch, doch,‹ tröstete ihn der Erbmarschall, ›mit Gottes Gnade wird die Wunde wohl wieder verharschen. Zeiget den Leuten, daß Eure Unerfahrenheit getäuscht wurde, so wird man solches Eurer Jugend leicht verzeihen.‹
»So mit väterlichem Wort ihn mahnend und tröstend, ritt der Erbmarschall von dannen. Da befahl mir mein junger Herr, unsere Siebensachen rasch zu packen und die Pferde zu satteln. Eine Stunde später ritten wir ohne Abschied fort, und seither hat Herr Arnold die Emerentiana Dausque – das ist der wahre Name jener erlogenen Gräfin de Bruay – mit keinem Auge mehr gesehen.«
»Das war doch aller Ehren werth gehandelt,« warf ich dazwischen.
»Gewiß. Am selben Tage noch, es war der siebente Christmonat anno 82, erließ er vom Hause Dilborn aus eine feierliche Verwahrung gegen seine Verbindung mit der Betrügerin und machte den Proceß beim geistlichen Gerichte in Jülich anhängig. Aber seit jenem Tage ist der arme Herr Arnold ein gebrochener Mann. An bösen Zungen hat es leider niemals Mangel, und so fehlte es nicht an Stichelreden und Ohrengebläse. Das that ihm bitter weh, und vermeinend, er habe seinem edeln Namen einen groben Schimpf angethan, schämte er sich also vor seinen Standesgenossen, daß er allen Umgang vermied und gar menschenscheu, ja fast schwermüthig wurde. Als das nächste Jahr die große Türkennoth brachte, da der Kara Mustafa Wien belagerte, machte er sein Testament mit dem Entschlusse, sein von Nöthen bedrängtes Leben dem Kampfe gegen den Erbfeind der Christenheit zu weihen. Ich und einige Diener, darunter der Grates, begleiteten ihn. Zur glorreichen Schlacht vor Wien kamen wir leider zu spät, indem die Stadt schon befreit, der Türk aber auf der Flucht war. Allein es gab im Feld noch genug zu thun. Wir folgten den Fahnen des Herzogs von Lothringen die Donau hinab, vor Pest pflückte unser Herr schöne Lorbeeren, was ihm wieder etwelchen Lebensmuth in seine Brust gab. Aber bald war es auch damit zu Ende, sintemal andere Edelleute, die weit weniger gethan haben als unser Herr, vom Kaiser höchlich ausgezeichnet wurden, während um seine glorreichen Thaten kein Hahn krähete. Suchte ihn zu getrösten, anerwogen solches geschehen, weil ihre kaiserliche Majestät auf der Hofburg säße und nicht alles wisse, was im Feldlager geschähe; redete aber zu tauben Ohren. Ja es setzte sich in seinem Herzen der Gedanke fest, der Kaiser wisse etwan um die unglückselige Geschichte mit der Emerentiana, und solches sei der Grund, weshalb er seine Verdienste nicht anerkenne.
»Um dieselbe Zeit kam auch ein Brief aus Geldern, in welchem der Erbmarschall schrieb, das geistliche Gericht von Jülich habe die Ungiltigkeit der Ehe zwar anerkannt, die leidige Dausque aber dagegen Berufung nach Rom eingelegt, und es sei daher nöthig, daß Herr Arnold zurückkomme. Ritten also selbander nach Hause. Jetzo fing der heillose Rechtshandel erst recht von vorne an, sintemal nicht nur das verlogene Schandweib alles that, um dem heiligen Vater ein X für ein U zu machen, sondern auch die Herren Fürsprecher und Rechtsanwält es meisterlich verstehen, eine solche Sache in die Länge zu ziehen und Lügen auf Lügen zu häufen! Mein Herr mußte nach Rom, und endlich wurde das Urtheil in letzter Instanz gesprochen: die Ehe sei null und nichtig, die Dausque habe die Kosten zu tragen. Als er zurückkam, war er noch menschenscheuer als früher und wollte sich in eines seiner Schlösser vergraben. Da half nun mein Bitten und Betteln wenig, er möge freien, anerwogen er solches seinem Geschlechte schulde; seine Widerrede war immer dieselbe, indem er mich fragte: ›welches edle Fräulein wird einem Menschen, der also das Landesgespräch war, wie ich, seine Hand bieten?‹«
»Aber man wußte doch, wie alles gekommen war?« fragte ich.
»Seht, Meister Jan, die Leute glauben immer leichter Böses als Gutes vom Nebenmenschen. Dieweil nun zur Zeit des Processes gar viele Verleumdungen ausgestreut wurden, vermeinten manche, die Dausque sei nur verstoßen, weil sie nicht von Adel sei, und wäre die Ehe mit ihr dennoch giltig. Ich glaube, es wäre meinem jungen Herrn wahrlich schwer geworden, eine passende Verbindung einzugehen, und hatte mich dazumal bereits in den Gedanken ergeben, daß der alte Stamm der Schenk von Nydeggen also ruhmlos verdorren werde. Da half der edle Erbmarschall wiederum. Er lud ihn so freundlich auf sein Schloß Haag, daß dieser seine Einladung nicht, wie er es sonst gewohnt war, zurückweisen konnte. Dort lernte mein Herr dessen Tochter Katharina kennen, die reine Unschuld und den heitern Frohsinn selbst. Der edle Graf hatte seinem Kinde viel von den Heldenthaten unseres Herrn Arnold im Türkenkriege erzählt, daher es nicht zu verwundern war, daß das fröhliche Mädchen den bleichen ernsten Gast, den der Vater so hoch schätzte, gar sehr ehrte und bewunderte. Nun ist aber von der Bewunderung zur Liebe nur ein kleiner Schritt. Summa: Die beiden Herzen entbrannten in kurzer Zeit zu einander, was der Herr Vater nicht ungern sah, indem er vielmehr meinen Herren zur offenen Werbung ermuthigte.
»Aber Herr Arnold wollte lange nicht an sein Glück glauben, und als er endlich an der Liebe Katharinas kaum mehr zweifeln konnte, wäre er uns beinahe erst recht kopfscheu geworden. Er hatte bald heraus, daß auch kein Sterbenswörtchen des leidigen Klatsches, der sich an seinen Namen geheftet hatte, an das Ohr dieses unschuldigen Kindes gedrungen war. So sagte er eines Tages zu mir: ›Wie kann ich diesen Engel an mein in den Augen der Menschen beflecktes Los fesseln?‹ – ›Sagt ihr alles,‹ rieth ich ihm, ›und Ihr werdet sehen, daß sie Euch dennoch die Hand bietet.‹ – ›Niemals werde ich dazu den Muth haben,‹ entgegnete er traurig; ›item, wie sich der Vogel das Nest baut, so ruht er, und werde ich wohl die bittere Frucht meiner Thorheit bis an mein Lebensende verkosten müssen.‹
»Da verleitete mich die Liebe zu meinem Herren zu einer List, so mir Gott verzeihen möge. Beredete also meinen Herren, daß er mir als einem alten erfahrenen Mann und getreuen Diener die Sache überlasse, und solle es ihm ein Zeichen sein, daß Fräulein Katharina nichtsdestoweniger ihm hold und ergeben sei, wenn sie bei Tische eine von den Spätastern trage, so annoch im Garten blüheten. Hütete mich aber wohl, dem Edelfräulein von der leidigen Geschichte zu reden, und wußte es anderweitig so einzurichten, daß das Fräulein die Blume trug.
»Half also meinem Herren durch sothane List über den Graben, und derselbe warb noch am gleichen Tag beim Erbmarschall um die Hand seiner Tochter. Die Werbung wurde angenommen, und da man aus Gründen, die auf der Hand liegen, eine feierliche Hochzeit vermeiden wollte, benützte der Erbmarschall die geschlossene Zeit des gnadenreichen Advents, in welcher wir gerade waren, um den heiligen Ehebund in aller Stille schließen zu lassen. So kam auf Sanct Nicolaustag 1694 Frater Ambrosius, der Pastor von Geldern, auf das Schloß Haag; mit ihm Frater Marcellus vom heiligen Peter. Und hatten wir zwei, nämlich dieser Frater Marcellus und ich, Johann Matthias von Afferden, die sondere Ehre, unsere Namen als rechtschaffene Zeugen unter das rechtskräftige Document der Ehe zu setzen, welche von Frater Ambrosius eingesegnet wurde. Schon am Tage darauf hielt das junge Paar seinen stillen Einzug in Blyenbeek, wie Ihr Euch dessen noch erinnern werdet.«
Solche Reden meines alten Matthias kamen mir sehr verwunderlich vor und machten mich schier hinterdenklich. Redete auch eine gute Weile nicht; endlich aber fragte ich ihn fast vorwurfsvoll: »Und Ihr habt der edeln Frau Katharina nichts von jener Emerentiana Dausque gesagt?«
»Keine Silbe! Was sollte ich auch das unschuldige Herz mit der düstern Geschichte ängstigen und vielleicht gar die Verbindung unmöglich machen, welche das Lebensglück meines jungen Herren und die Zukunft seines edeln Geschlechtes gefährdet hätte? Ihr Herr Vater wußte ja alles; mochte er seiner Tochter von dem Jugendleben meines Herren mittheilen, was er entweder für nothwendig oder für ersprießlich hielt! Der kluge und fürsichtige Mann hat es aber offenbar für besser erachtet, dem ganz unschuldigen Kinde nichts davon zu sagen, anerwogen ihm die Ehe mit dem hochedeln und, wie er sich überzeuget hatte, trotz sothanen Jugendfehlers durchaus braven und ehrenfesten Herrn Arnold sehr am Herzen lag, er auch gegründete Hoffnung hatte, es werde die leidige Geschichte seiner Tochter niemals zu Ohren kommen. Es wurde nämlich damals der Tod der Emerentiana glaublich berichtet.«
»Wohl, wohl! Ich entschuldige Euer Thun, ob ich es gleich nicht billigen kann. Möge es niemals schlimme Folgen haben! Was würde wohl geschehen, wenn unsere gnädige Frau jetzo die Wahrheit erführe oder, was schlimmer, den Klatsch, die Verleumdung? oder wenn nun jene Emerentiana ihr eines Tages unter die Augen träte?«
»Schweigt, schweigt! An so etwas Schreckliches wollen wir gar nicht denken!« entgegnete der alte Mann mit einem schweren Seufzer. »Solches ängstiget mich manchmal in meinen Träumen, ja hat mich heute mitten im Jubel des Festes verfolgt. Als der Erbmarschall sagte: ›Bauet Euer Glück nicht auf diese Erde, wo alles wechselt wie ein leidiges Aprilenwetter!‹ ist es mir wie eine Zentnerlast aufs Herz gefallen, daß auch das Glück dieser Ehe ein Traum sein könnte. Deshalb habe ich Euch das alles erzählt, daß Ihr mir wachen helfet. Auf unsere Dienstboten können wir uns verlassen; Verwandte, welche einzig auf dieses einsame Schloß zum Besuche kommen, werden nicht von dem unseligen Weibe reden. Es hat bisher alles so gut gegangen!«
»Dennoch wäre es vielleicht besser,« rieth ich, »Ihr würdet dem Herrn Eure List gestehen. Herr Arnold könnte seiner Gattin die Sache jetzt in einer Weise beibringen, daß es gewiß keine schlimme Folge hätte, wohingegen es gar traurig wäre, wenn die gnädige Frau unvorbereitet und unrichtig über das leidige Begebniß unterrichtet würde.«
Aber mein Kastellan wollte sich dazu um keinen Preis verstehen, so sehr ich ihn bat und drängte, und da es in währender Zeit schon spät geworden, nahm ich mir vor, etwan ein andermal ihn zu offenem Reden zu bringen. Verließen also den Garten und gingen auf den Schloßhof, wo sie noch lustig fidelten und tanzten. Der Kastellan gab jetzt aber das Zeichen zum Ende des Festes. So stellten sich die Leute unter den Fenstern des Schlosses auf und riefen dem jungen Schenk und dessen Eltern ein letztes Vivat; dann zogen sie singend und jauchzend über die Schloßbrücke fort, sich hierhin und dorthin über die Heide zerstreuend, welche der liebe Mond schier taghell erleuchtete. Ich bot dem alten Matthias gute Nacht und versprach ihm, mitzuwachen, daß das Glück des Hauses nicht gestöret werde, weiß Gott, ich habe es ehrlich und treu gemeint!
Als ich in meinem Kämmerlein war, setzte ich mich ans Fenster und schaute noch lange schlummerlos in die stille Nacht hinaus. Im Schlosse war der Lärm des Festes allbereits auch verhallt; schweigsam lag es in der öden Landschaft. Von den nahen Sümpfen und Brüchen stieg ein feiner Nebel auf; in den Schloßgräben spiegelte sich der Mond, und die leise wogenden und wiegenden Kronen der Linden schienen dem Nachtigallenliede zu lauschen, so aus den Büschen des Blyenbaches bald klagend bald freudig schmetternd zu mir empordrang. Lange blickte ich in Gedanken verloren in die friedliche Nachtlandschaft. Endlich nahm ich mir vor, am nächsten Morgen noch einmal in den alten Matthias zu dringen, daß die ganze Sache rechtzeitig aufgeklärt werde, bevor aus der wohlgemeinten Verheimlichung Unheil entstehe. Dann betete ich und legte mich zur Ruhe.
In selbiger Nacht quälete mich aber ein böser Traum. Es schien mir, der alte Kriegsoberst Martin Schenk stehe in seinem Lederkoller vor der Wiege des kleinen Christoffel und suche ihn grimmig lachend mit seinen großen Stulphandschuhen aus den Windeln zu reißen, was meine gnädige Frau mit lautem Geschrei zu verhindern trachtete. Ich nun wollte ihr helfen und faßte den alten Schenk an seinem Koller; da war es aber nicht mehr der Kriegsoberst, sondern ein Weib, und der böse Schenk stand jetzt hinter mir und kicherte mir ins Ohr: »Hi, hi, das ist sie, die Emerentiana Dausque!«
Das Wort tönte noch in meinen Ohren, als ich aus dem Schlafe auffuhr und mich in Angstschweiß gebadet fand, derweil die ersten Lichter des Morgengrauens durchs Fenster hereinfielen.
*
Dieweil ich nicht mehr einschlummern konnte, stand ich auf, packte mein Malergeräthe zusammen und begab mich nach der Rehwiese, um in dem frühen Morgenlicht an einem Landschaftsbilde zu malen. Hatte nämlich dazumal eine große Freude an diesem Fache der Malerei und vermeinte, es stecke ein halber Wouverman in mir, wie ich denn nicht ohne Glück in der einen oder andern meiner Schildereien das Helldunkel nachzuahmen versucht, welches dieser große Meister über seine Landschaftsbilder auszubreiten verstand. Der Schloßherr gab mir gerne freie Zeit für meine eigenen Malereien. Schritt also mit meinen Siebensachen über die Schloßbrücke und hatte bald meinen kaum zweitausend Schritte entfernten Platz erreicht, allwo ich die Staffelei zurechtstellte und ein halbfertiges Bild daraufsetzte. Dann trug ich die Farben auf die Palette und begann still und emsig zu malen.
Das Bild war allbereits gänzlich grundirt und der klare Morgenhimmel mit hellen Rosawölkchen mir so gut gelungen wie noch nie. Auf der Moorwiese zitterte ein feiner grauer Nebel, so einen zarten, durchsichtigen Schleier über den dunkeln Kiefernwald im Hintergrunde wob, während den Vordergrund eine schöne Baumgruppe mit der kräftigen Laubkrone einer Eiche und schwankem Buchengezweig zierte. Der Baumschlag war mir immer noch ein gar schwieriges Stück Arbeit; aber diese Gruppe schien doch nicht schlecht gerathen. So malte ich zunächst an einem Reh, das sich trinkend zum Bache neigte, während der Bock hinter ihm wachsam witternd den Kopf in die Luft hob, und wartete auf den ersten Strahl, den die liebe Sonne der Baumgruppe vor mir zusenden würde. Sothane Lichtwirkung wollte ich dann versuchen auf die Leinwand zu bringen. Mochte so etwan eine halbe Stunde emsig gemalt haben und war ganz in meine Arbeit vertieft, als der erste Sonnenstrahl über die weißen Buchenäste zuckte und auf dem grünen Laubwerk zitterte. Rasch hatte ich den Pinsel gewechselt und setzte das Schlaglicht kräftig auf das Gezweig; da bot mir eine Stimme hinter meinem Rücken einen freundlichen Morgengruß.
Kann sich nun männiglich denken, wie unlieb mir solche Störung war, und rief daher gar ungeduldig, ohne umzuschauen: »Nicht jetzt! Raubt mir diesen kostbaren Augenblick nicht; nur fünf Vaterunser laßt mich ungestört!«
Hernach suchte ich unter Herzklopfen, welches mich immer erfaßt, wenn ein Bild gerade die entscheidenden Pinselstriche erhalten soll, das Lichtspiel auf den knorrigen Eichenästen weiter zu malen. Aber es ging nicht mehr: ich war gestört, ich fühlte es in der Hand, am Blicke; die plötzliche Unterbrechung hatte mir die rechte Stimmung geraubt. Da ich solches vermerkte, sprang ich in hellem Zorne auf, wandte mich um und war im Begriffe, dem Weib, das mich angeredet hatte, die Palette an den Kopf zu werfen. Hätte ich es nur gethan! Als ich aber ganz unerwartet eine fremde Frau vor mir erblickte, war ich so verwirrt, daß Pinsel und Malerstock beinahe meiner Hand entfallen wären; hatte nämlich gemeint, es habe mir eine von den Bauerndirnen, so mich manchmal durch ihren Fürwitz beim Malen stören, einen guten Tag geboten. Die Fremde war aber eine Frau von gar stolzer Gestalt, mit einem blassen Angesichte, aus dem große, glänzende Augen hervorleuchteten, und hatte selbige über Kopf und Schultern ein Spitzentuch geworfen, aus dem einige Strähnen schwarzen Haares hervorquollen.
Stotterte also eine Entschuldigung her; aber die Dame sagte mit einem Lächeln in ordentlichem Deutsch, wiewohl mit fremdländischem Ton: »Nicht Ihr, sondern ich habe um Verzeihung zu bitten; maßen ich leider sehe, daß meine Störung den Genius verscheucht hat, welcher hier eben den Pinsel führte.« Mit welchem freundlichen Worte sie näher zur Staffelei trat und das Landschaftsbild betrachtend sagte: »Bei dem göttlichen Apollo! Ein fürtreffliches Gemälde! Die Eiche ist gar prächtig ausgeführt! Der Hintergrund aber, so man wie durch einen Schleier gewahr nimmt, ist ein Meisterwerk! Der Herr ist bei den Niederländern in die Schule gegangen?«
Ei, Lieber, wirst mir glauben, daß mein Herz vor Freuden hüpfte! So war ich noch nie gelobt worden, und ich hielt in meiner Einfalt das alles für eitel Wahrheit, die Fremde aber für eine große Kennerin. Antwortete demnach, ich hätte allerdings eine kurze Zeit bei Wouverman gelernt, nicht bei dem berühmten Philipp, sondern bei dessen jüngerem Bruder Peter. Aber leider nicht lange genug.
»O, der Herr hat viel gelernt!« schmeichelte mein falsches Kätzchen. »Der helldunkle Hintergrund ist ganz Wouverman, wohingegen die Eiche freilich an Claude Lorrain erinnert. Die Landschaftsmalerei ist des Herren eigentliches Fach?«
Mit jeglichem Lobspruch lockte sie mich eiteln Gimpel näher an die Schlinge, wovon ich aber weniger ahnete als ein Kindlein in der Wiege; war vielmehr geschäftig, den Weihrauch aufzusaugen, den sie mir hinstreute, wie ein Vogler den Finken Hanfsamen. Sagte also, ich könne mich leider nur in freien Stunden der Landschaftsmalerei widmen, anerwogen ich nicht die Mittel hätte, nach meinem Genius zu arbeiten. Ich sei auf dem Schlosse angestellt und müsse die Zimmer mit passenden Schildereien versehen. Blumen- und Fruchtstücke seien mein Fach. Nebenbei sei ich auch an der Schnitzbank thätig und werde noch lange zu schnitzen haben, bis alle Zimmer und Säle mit Kaminverzierungen versehen seien, welche der jetzigen Mode entsprächen.
»Wenn der Herr Blumen und Früchte noch besser zu malen verstehet als Landschaften,« fuhr jetzt die Fremde in gar einschmeichelndem Tone fort, »so müssen das große Kunstwerke sein; anerwogen schon Eure Landschaft ein wahres Meisterwerk ist. Wie würde ich mich freuen, wenn ich selbige bewundern könnte! Wäre es nicht möglich, daß Ihr mir solche zeigtet?«
»Solches wird keine Schwierigkeit haben. Ich will Euch beim Herrn Marquis anmelden,« antwortete ich, von ihren süßen Reden gänzlich gefangen.
»Ich möchte mich doch nicht gerne anmelden lassen,« sagte die Fremde. »Ich bin auf einem Pilgergange zu Unserer Lieben Frau nach Kevelaer, habe mich gestern Abend auf der Heide verirrt und mußte die Nacht da drüben bei der Windmühle in einer Hütte zubringen. So ist mein Anzug, wie der Herr wohl bemerken kann, nicht also beschaffen, daß ich den Herrschaften darin vorgestellt werden möchte; habe überdies gelobet, meinen Bittgang incognito zu vollenden und meinen Namen niemanden zu nennen. Aber, lieber Meister, es ist ja jetzo kaum morgens fünf Uhr, und die Herrschaften werden nach dem gestrigen Feste noch wenigstens etliche Stunden schlafen. Da ist es ja leicht, daß Ihr mich ungesehen hineinführet und mir Eure fürtrefflichen Malereien zeiget.«
Erst jetzt bemerkte ich, daß die Kleidung der Dame, so kostbar der schwere, dunkelgrüne Damaststoff auch war, sich allerdings für eine Vorstellung nicht eignete. Das Spitzentuch war nicht rein, das freilich modisch spitz zulaufende Leibchen hatte schadhafte Stellen; der Saum des Kleides aber schleifte nicht nur thaunaß, sondern auch an vielen Stellen zerfetzt am Boden hin. Das alles hätten für mich Gründe genug sein müssen, hinterdenklich zu werden. Aber das süße Lob, das sie meiner Malerei gespendet hatte, raubte mir einfältigem Gecken jede Besinnung; vermeinte also, es werde eine gar vornehme Dame sein, so in solchen Kleidern, wie sie es fürgab, der Mutter Gottes von Kevelaer einen Bittgang gelobet habe, und dachte sogar durch sie etwan einen Namen als Maler zu gewinnen, war also in meiner Dummheit gleich bereit, sie heimlich in das »Paradies« zu geleiten.
So schritten wir selbander stracks auf das Schloß zu. Unterwegs stellte mir die Fremde etwelche Fragen über die Schloßbewohner, und ich erzählte von dem großen Glück des edeln Paares und von ihrem Jubel über das neugeborene Knäblein.
»Man führt also ein zufriedenes Leben auf dem einsamen Heideschlosse?« fragte die Fremde, als wir just über die äußere Brücke gingen.
»Ein Leben wie im Paradiese!« antwortete ich. »Der Herr ließ mich deshalb auch das Prunkgemach, in welches ich Euch führe, als eine Art Paradies malen.«
Ein absonderliches Lachen spielte um die Lippen der Frau, das mich stutzig hätte machen müssen, wäre ich nicht gänzlich verblendet gewesen. Aber sie machte mir auch kein schlechtes Angebot auf mein Landschaftsbild, um mich in meiner Verblendung noch mehr zu befestigen, derweil wir über die innere Brücke schritten. Traten also in das »Paradies«, ohne daß mir im Traume eingefallen, welches Unheil ich eitler Geck hiermit vollbrachte.
»Ah!« rief die Fremde. »Wer hätte eine solche Pracht in dem einsamen Schlosse vermuthet! Und Ihr habt diesen herrlichen Plan entworfen?«
»Der Plan ist eigentlich mehr das Werk des gnädigen Herren, so wohl im Lande Italien Aehnliches gesehen haben mag. Allein die Figuren habe ich modelliret und geschnitzt; auch die Schildereien an der Decke gezeichnet und gemalet.«
Worauf sie noch einen stärkeren Weihrauchdampf entzündete und mit glatten Worten zu rühmen fortfuhr: »Meister, Ihr habet ebenmäßig so viel Talent für die Sculptur als für die Malerei. Freilich, die prachtvollen Frucht- und Blumenguirlanden übertreffen alles und sind selbige in Wahrheit eines Seghers würdig!«
Ich einfältiger Geselle war überglücklich, maßen meine Pinseleien so noch nie gelobt worden waren. Vergaß denn auch alles und konnte mich nicht satt reden und hören. Jede Blume, jede Frucht wurde von ihr insonderheit betrachtet, besprochen, bewundert. Bald schienen ihr die Vergißmeinnicht, bald die Tulipanen, bald die Rosen oder Aurikel am besten gelungen; bald pries sie die Aprikosen, die Kirschen und so voran bis zu den Erdfrüchten und Tannzapfen des Winterkranzes. In währender Zeit wurde es aber im Schlosse lebendiger. Endlich, als schon zum drittenmal die Anna, welche die Tafel für das Frühstück bereiten wollte, die Thüre geöffnet hatte, kam mir denn doch der Gedanke, daß es hohe Zeit sei, die Fremde aus dem Schlosse zu führen.
Aber die Dame wollte meine Worte nicht verstehen. Sie setzte sich auf einen der hochlehnigen Stühle und belobete in immer zierlicheren Worten die Guirlande des Sommers. Das Ding wurde mir unbehaglich, obgleich mir noch keine Ahnung von dem Unheil kam, das meine verwünschte Eitelkeit angerichtet hatte. Nahm mir also schließlich ein Herz und bat die Fremde mit deutlichen Worten, zu gehen. Aber sie machte keine Miene, meiner Bitte zu entsprechen, ersuchte mich vielmehr um ein Stück Papier und einen Zeichenstift, sintemal sie sich zum mindesten für eine Stickerei die gar zu fürtrefflich gelungene Anordnung der Sommerguirlande merken müsse. Lieber, kannst dir denken, daß ich auf glühenden Kohlen stand, anerwogen es mir jetzt doch auf die Seele fiel, ohne Fürwissen meines gnädigen Herren diese Fremde in das Schloß heimlich eingeführt zu haben, wiederholte also, es sei hohe Zeit, die Tafel für das Frühstück zu bereiten, da die Herrschaften gewohnt seien, früh aufzustehen. Aber die Person blieb ruhig sitzen und fragte, wo ich das Modell zu den prächtigen, güldenen, rothwangigen Frühäpfeln aufgetrieben habe. In meinen Nöthen versprach ich ihr eine Zeichnung sämtlicher vier Guirlanden; nur möge sie jetzt um des Himmels willen gehen.
Als sie nun zu meiner inständigen Bitt nur lachte, riß mein Geduldfaden, und fuhr sie in hellem Zorne an: »Ihr seid keine vornehme Dame, wofür ich Euch in meiner Dummheit hielt. Ihr seid eine Landstreicherin, und wenn Ihr Euch nicht augenblicklich Eures Weges trollet, werde ich den Kastellan oder den Herrn Marquis rufen, und dieser ...«
»Ruft ihn doch!« unterbrach mich das freche Weibsbild mit unverschämtem Hohn.
Da auf einmal blitzte durch mein Gehirn ein Gedanke, der mich so erschreckte, daß ich mich an einem Stuhle aufrecht halten mußte. Preßte endlich mit Mühe die Frage heraus: »Wer seid Ihr? Ihr seid doch nicht ...«
»Wer ich bin, werdet Ihr sonder Zweifel erfahren, sobald der Schloßherr mich sieht – ruft ihn!« erwiderte die Fremde und setzte sich auf das Lotterbett. Mir aber tanzten vor heller Angst und Zorn die vier Jahreszeiten vor den Augen; stürzte also, meiner selbst kaum mächtig, auf die Thüre zu, um den Marquis, den Kastellan, wußte selbst nicht wen, zu rufen; prallte aber, da ich justement die Klinke faßte, mit dem alten Matthias zusammen, der in der Thüre erschien. Es hatten ihn nämlich die Mägde, so das laute Gespräch gehört hatten, herbeigerufen.
»Was geht denn hier vor? Wer ist denn hier eingedrungen?« – fragte der alte Mann eintretend. Als er aber die Frau auf dem Lotterbett erblickte, öffneten sich seine Augen weit, und die Farbe wich aus seinem Angesichte, daß ich schier meinte, es habe ihn der Schlag gerührt.
»Ihr hier, Madame!« brachte er endlich, zum Tode erschrocken, über seine bebenden Lippen.
»Wie Ihr seht,« antwortete sie frech. »Der Meister Maler ist so freundlich gewesen, mich in dieses Haus zu führen, das von Rechts wegen mein Schloß ist, und da Ihr mich kennt, werdet Ihr auch die Güte haben, mich bei meinem Gemahl zu melden.«
»Bei Eurem Gemahl!« rief der Kastellan. »Ihr wißt sonder Zweifel ganz gut, daß Ihr keinerlei Fug oder Recht auf solche Benennung habet. Frau Dausque, ich bitte und beschwöre Euch, gehet aus diesem Schlosse und störet den Frieden nicht, welcher allhier herrschet.«
»Freilich, freilich! Sehe ja wohl, daß ich in einem Paradiese bin,« höhnte sie frech lachend. »Ei, das ist ein Grund mehr, mich nicht so leichter Hand fortweisen zu lassen. Soll ich etwan obdachlos auf der Landstraße irren, während mein Mann in solchen Prachtzimmern tafelt? Nein, ich will und werde bleiben.«
»Euer Trotz wird Euch wenig nützen,« entgegnete Matthias, so sich wieder gefaßt hatte. »Die Knechte werden Euch mit Gewalt über die Brücke führen. Geschwind, Meister Thyssen, bringt den Kurt und den Grates her!«
»Der Herr Maler wird das bleiben lassen,« sagte Frau Dausque, nicht so fast mit Ruhe als mit Ausgeschämtheit. »Sintemal das Haus meines Wissens voll von Gästen ist, möchte es meinem Manne nicht lieb sein, einen ärgerlichen Auftritt zu erleben, wenn man mich aber mit einem Finger anrührt, werde ich so schreien, daß das ganze Haus zusammenläuft – verlaßt Euch drauf!«
»Da habt Ihr uns eine saubere Bescherung bereitet, Meister Jan!« sagte mein alter Matthias. Ich aber raufte mir in heller Verzweiflung mein Haar, sagend: »Den kleinen Finger wollte ich geben, ich hätte es nicht gethan!«
»Verzeih Euch Gott Eure Thorheit!« entgegnete er. »Geht jetzo in Gottes Namen und schauet, wie Ihr den gnädigen Herren ohne Aufsehen in das anstoßende Zimmer bittet.«
»Nein, hier will ich ihn sprechen,« sagte die Fremde gar trutzig. »Wenn jemand ein Recht hat, in diesem Prunkzimmer zu verweilen, so steht solches Recht mir zu.«
Wohl sah mein Kastellan, daß Gewalt bei dem ebenso frechen als heftigen Weibsbild die Sache nur verschlimmern würde, und ging deshalb, wiewohl schweren Herzens, den Schloßherren von dem leidigen Fürfall zu benachrichtigen, indem er mich beauftragte, die Fremde so lange nicht aus den Augen zu lassen.
Es verging eine gute Viertelstunde. Frau Dausque wurde unruhig und schritt im Zimmer auf und ab. Dann öffnete sich die Thüre, und herein trat mein Herr Arnold mit seinem Schwiegervater. Sobald sie meines gnädigen Herren ansichtig wurde, wollte sich die Emerentiana selbigem an den Hals werfen mit lautem Rufen: »Arnold, mein Arnold!« wobei sie sich nunmehr der französischen Sprache bediente. Als aber dieser sie tieferröthend und gar unwillig mit der Hand zurückwies, stürzte sie ihm zu Füßen, umklammerte ihn gewaltsam und flehte: »Arnold, du mußt mich hören, du darfst mich nicht ungehört von dir stoßen; man hat dein Herz von dem meinigen gerissen!« und was dergleichen Worte mehr waren. Mein gnädiger Herr aber ließ sich von ihren süßen Worten mit nichten fangen, sondern entgegnete streng: »Madame, lasset das gut sein, stehet auf, sofort; ich würde sonst gezwungen sein, mich Euren Händen mit Gewalt zu entringen!«
Worauf die Emerentiana erwiderte: »Arnold, Arnold, so redest du zu mir?«
Da trat mein Herr Erbmarschall vor und sagte: »Madame, ich bewundere Euer Mienenspiel, Eure tragische Gebärde! Gerade so spielt man auf der französischen Bühne, der Ihr anjetzt vielleicht angehöret.«
Solche Worte trafen die Fremde wie ein Pfeil. Sie schnellte vom Boden auf und blickte bleich vor Zorn den Erbmarschall an und rief: »Wer ist der Mann, so sich zwischen meinen Gemahl und mich drängen will? Arnold, sage dem Herren, er solle sich entfernen, dieweil ich mit dir allein zu sprechen habe.«
»Mein Herr Schwiegervater wird die Güte haben zu bleiben,« antwortete der Marquis mit fester Stimme. »Und nun, Madame, muß ich zuvörderst bitten, mich nicht mehr ›Arnold‹ zu nennen; anerwogen Ihr zu einer solchen Sprache kein Recht habet.«
»Darf die Frau ihren Ehegemahl nicht also nennen?« fragte das Weib.
»Ihr wisset recht wohl, daß Ihr nie meine Gemahlin waret,« entgegnete mein gnädiger Herr, die Augenbrauen gar finster zusammenziehend. »Ihr mußtet schon dazumal wissen, daß ich nie Euer Gemahl werden konnte, als Ihr mich durch List und Trug, was Euch Gott verzeihen möge, zu dem Schritte verlocktet, der mein Lebensglück auf viele Jahre zerstörte. Jetzt wenigstens müsset Ihr es wissen, da der heilige Vater unsere vorgebliche Ehe für null und nichtig erkannt hat.«
»Was kümmere ich mich um das römische Urtheil, das durch Pfaffenränke erschlichen wurde!« schrie die Freche, »was Gott verbunden hat, soll der Mensch nicht lösen.«
»Elender Betrug hatte uns verbunden und nicht Gott!« rief Herr Arnold, wobei ich wohl gewahrte, wie seine Stirnader anschwoll. That sich aber Gewalt an und fügte bei: »Kein Wort weiter! Wenn Ihr das Urtheil des Stellvertreters Christi auf Erden nicht achtet, so werdet Ihr natürlich auf mein Wort noch weniger geben. – Habet Ihr sonst einen Wunsch?«
Da fuhr die Emerentiana auf: »Ha, du meinst wohl, ich sei als Bettlerin gekommen? Du willst mich etwan gar wie eine Bettlerin mit einem Stück Brod abspeisen oder vielleicht von deinen Knechten vom Hofe peitschen lassen? Wage es!«
»Das ist heller Wahnsinn,« sagte der Schloßherr. »Herr Vater, redet Ihr mit der Dame«; damit drehte er sich um und wollte gehen. Aber das Weibsbild gebärdete sich jetzo nicht anders als eine leidige Furie: »Wahnsinn? Ja, es ist vielleicht Wahnsinn, aber der Wahnsinn der Liebe! O Arnold, dich habe ich geliebt, dich liebe ich noch. Verwandle meine Liebe nicht in Haß; du würdest es eines Tages bereuen! Dazumalen bist du von mir gegangen, ohne auch nur meine Vertheidigung zu hören. Lasse mich anjetzt wenigstens die elenden Verleumder entlarven, so durch schändliche Ränke mir dein Herz geraubt haben. Arnold, schau, gestern habe ich dich durch Geldern reiten sehen; da hat mir die Liebe keine Ruhe gelassen. Den ganzen Tag, die ganze Nacht hindurch bin ich dir nachgelaufen, durch die Wälder, über die Felder, durch Sümpfe und über die Heide und über Stock und Stein – sieh hier mein Kleid, wie es zerfetzet ist. – Arnold, ach stoße deine treue Emerentiana nicht von dir!«
Sie redete also beweglich, daß ich an dem Weib schier irre wurde, obgleich ich bei ruhigem Denken erkannte, es sei eitel Komödie und die Dausque bezwecke nichts anderes, als den edeln Herren, wenn solches ihrer Stimm und Gebärde gelänge, auf ein neues in ihre Fesseln zu verstricken, Wollte ihn also bereden, welche Liebe annoch in ihrem Herzen lodere, und sich auch mit Gewalt wieder an den Herrn Arnold drängen, ja ihn mit ihren Armen umschlingen. Dieser aber sagte nur mehr das eine Wort: »Schlange!« und stieß sie so unsanft zurück, daß sie schier gefallen wäre. Dann verließ er das Zimmer. Da verdrehte sie ihre Augen und sank mit einem Wuthschrei auf einen Stuhl, indem sie stöhnte: »Jetzo ist alles aus!«
So trat nun der Erbmarschall vor sie hin und sagte: »Bin gänzlich derselben Meinung, und da alles aus und vorbei ist, bitte ich Euch höflich, mir zu folgen, anerwogen ich Euch persönlich vor das Schloß zu geleiten gedenke.«
Nochmals flammte ihr Zorn auf. »Eure Ränke haben mich unglücklich gemacht; ich werde mich rächen an Eurer Tochter, an Eurem Enkel! Meinet Ihr, daß ich mir nach allem, was Ihr mir zufügtet, auch noch Euren Hohn gefallen lasse? Ich gehe nicht, jetzt erst recht nicht!«
Der Herr war aber so ruhig, daß ihm kein Nerv in seinem Antlitz eine Muskel bewegte, und antwortete ihr kalt und gelassen: »Madame, man würde vielleicht gezwungen sein, Euch in den Schloßthurm zu bringen, und derselbe ist nicht sehr wohnlich, obschon Ihr vielleicht in Eurem vielbewegten Leben die Bekanntschaft ähnlicher Herbergen schon gemacht habet. Ich fordere Euch jetzt zum letztenmal auf, das Schloß augenblicklich zu verlassen.«
Diese zwar mit Ruhe, wiewohl mit großem Nachdruck gesprochenen Worte des Erbmarschalls wirkten. Madame Dausque erhob sich mit einem Blick voll Gift und Galle und wollte gehen. Aber der Erbmarschall, so ein gar fürsichtiger Herr ist, sagte, er wolle selber dafür sorgen, daß sie ohne weiteres Unheil aus dem Schlosse komme, winkte uns also zu folgen, während er voranschritt. Hätten sie auch ohne Federlesens hinausgeschafft, wenn nicht ein unseliger Zufall, oder sage ich lieber Gottes Fügung, es anders gestaltet.
Als nämlich mein Herr Erbmarschall eben die Thüre des »Paradieses« öffnen wollte, höreten wir, wie einige von den Gästen laut redend über den Corridor kamen; erkannte deutlich darunter die Stimme des jungen Herren von Geystern. Kann sich also männiglich denken, daß ein Zusammentreffen dieser Herren mit der Dausque dem Erbmarschall mit nichten genehm war. Solches zu vermeiden, schritt er den Herrschaften eilig entgegen, indem er uns bedeutete, das Weib heimlich die nahe Seitentreppe hinabzuführen, und zog auch die Gäste glücklich mit sich in die große Halle und durch dieselbe in das dahinter liegende Jagdzimmer, dessen Fenster nicht auf den Schloßhof, sondern nach dem Garten zu den Ausblick gewähren, wir nun hielten derweilen die Emerentiana, die schier Miene machte, ein Geschrei zu erheben, unter Bedräuung, sie ins Burgverließ zu stoßen, so sie einen Laut von sich gebe, im »Paradiese« fest, bis wir den Herrn Erbmarschall die Thüre der Halle schließen hörten. Dann brachten wir sie flugs die paar Schritte über den Corridor in den kleinen dunkeln Seitengang, so zur Nebentreppe führet, und zogen auch da die Thüre, welche den genannten Seitengang mit dem Hauptgange verbindet, fürsichtig ins Schloß.
Allbereits fühlte ich mich nicht wenig erleichtert, dieweil ich gänzlich vermeinte, das größte Unheil sei nun glücklich abgewendet; da trat uns nach Gottes gerechter Zulassung aus einer der beiden Kammern gerade diejenige entgegen, welche wir zumeist zu vermeiden wünschten, verstehe meine gnädige Frau Katharina! Weiß nicht, was sie alldort gesucht hat, anerwogen ihre Gemächer ganz auf der andern Seite des Schlosses liegen. Ich meinte, der Blitz rühre mich, als ich sie im hellen Morgenstrahle, so aus der geöffneten Kammerthüre in den dunkeln Gang fiel, also plötzlich vor uns stehen sah. Noch mehr war der alte Matthias erschrocken, daß ihm die Kniee schlotterten und er sich an der Wand festhalten mußte. Die edle Frau Katharina hatte ihr Knäblein auf den Armen und leuchtete vor lauter Glück und Frohsinn nicht anders als die liebe Sonne im Maien.
Da sie eine Fremde zu also ungewohnter Zeit erblickte, schaute sie uns schier verwundert an, bemerkte auch gleich unsere große Verlegenheit, ja unsern Todesschrecken und wollte eine Frage an uns richten. Aber schon stürzte sich die Dausque mit Augen, welche funkelten wie der Blick der Natter, die auf den Wanderer loszischet, auf meine liebe gnädige Frau. Kann sich männiglich denken, daß ich das rasende Weibsbild zurückhalten wollte; riß sich aber los und schrie: »Madame, ich muß Euch sprechen! Um des Kindes willen, das Ihr an Eurer Brust traget, höret mich an!«
»Schweiget, Unglückliche!« unterbrach sie mein Kastellan. »Gnädige Frau –«
»Nein, ich will reden, ich muß reden! Höret mich; bei allem, was Euch heilig und theuer ist!« rief die Französin, auf ihre Kniee niederfallend.
»Wer ist die Fremde?« fragte die gnädige Frau, und vor Schrecken ob des heftigen Wesens der Emerentiana wich ihr das frische Roth aus den Wangen.
»Höret nicht auf ihr Gerede, maßen es eine Wahnsinnige ist!« rief der alte Matthias, »Wo sind die Knechte?«
»Es ist jedenfalls eine Unglückliche – ich will sie anhören,« sagte die edle Frau Katharina; übergab also ihr Kind der Anna und winkte uns, der Fremden in die Kammer zu folgen. Umsonst sperrte sich der Kastellan und versuchte abermalen, jedes weitere Gespräch mit der Versicherung abzuschneiden, die Fremde sei gänzlich wahnsinnig.
»Wahnsinnig?« höhnete Frau Dausque, »Vielleicht daß ich es annoch werde, und ein Wunder wäre solches wahrlich nicht, nachdem mich mein Ehegemahl also behandelte.« Dann sich gegen meine arme gnädige Frau wendend, begann sie alsbald ihr Natterngift in deren reines Herz zu träufeln: »Ach, mein gnädiges Fräulein, es drückt mir schier das Herz ab, daß ich Eure Augen öffnen muß; schulde es aber Euch und mir. – Kennet Ihr diesen Ring?« Damit zog das Weib einen güldenen Siegelring, so an einem Seidenbande befestigt war, aus seinem Busen.
»Es ist das Wappen meines Gatten,« erwiderte die gnädige Frau, die noch immer nicht ahnete, wer die Fremde sei und was das alles bedeute.
»Sie hat ihn gestohlen!« rief der Kastellan.
»Gestohlen!« lachte die Emerentiana. »Ihr wißt recht wohl, daß Ihr jetzt eine Lüge ausgesprochen habt. Müßt Ihr doch selber bezeugen, daß ich diesen Ring vor vierzehn Jahren aus der Hand Arnolds Schenk von Nydeggen empfing!« Dann wandte sie sich gar ernst an meine gnädige Frau, sagend: »Ja, mein gnädiges Fräulein, Ihr seid betrogen, Ihr seid schmählich hintergangen! Der Mann, welcher sich Euer Gemahl nennt, hatte kein Recht, Hand und Herz an Euch zu vergeben, anerwogen selbiger seit vierzehn Jahren mein Gatte ist.«
Kann sich männiglich denken, daß eine solche Rede auf meine gnädige Frau nicht anders als ein Donnerkeil herabfiel. Alsbald schoß ihr das Blut ins Angesicht, und sie rief: »Wer seid Ihr, daß Ihr es waget, mich und meinen Gemahl unter unserem eigenen Dache also zu beschimpfen?«
»Daß ich solches wage,« entgegnete das Schandweib, »muß Euch etwan den Gedanken eingeben, ich habe ein Recht dazu. Ich bin die verwittwete Gräfin de Bruay und die eheliche Frau von Arnold Schenk von Nydeggen, dahingegen Ihr, mein gnädiges Fräulein, hier den Platz einnehmet, der nach Recht und Gerechtigkeit mir gebühret.«
Ein sothanes über die Maßen freches Benehmen verwirrte meine gute Frau Katharina gänzlich. »De Bruay?« stammelte sie. »Nie in meinem Leben habe ich diesen Namen gehört. – Matthias, redet Ihr! Ihr kennt ja meinen Arnold von seiner Kindheit an, maßen Ihr demselbigen von seinem sterbenden Vater als ein getreuer Diener und fürsichtiger Mentor übergeben wurdet. So redet und zeuget jetzo wider dieses Weib und deren ungeheuerliche Worte! – Wehe, was stehet Ihr also verwirret und erschrocken? Was ist es mit jener Gräfin de Bruay?«
So suchte sich nun mein Matthias zu fassen, was ihm jedoch schlecht gelingen wollte, und schrie, außer sich vor Angst und Zorn: »Glaubt keine Silbe, gnädige Frau! Der helle Wahnsinn redete aus der Landstreicherin; seht nur, wie sie die Augen verdrehet.«
Dahingegen wiederholte die Emerentiana ihre alte Rede: »Hier steht jene Gräfin de Bruay, welche dieser Mann da wohl kennt und von deren Ehe mit seinem Herren er genaue Kunde hat. Er möge es läugnen, wenn er die Stirne dazu hat!« Sie drehte sich mit diesen Worten dem alten Manne zu, dessen Verwirrung Frau Katharina nicht entgehen konnte. Dann fuhr sie fort: »So wahr ich lebe, man hat Euch betrogen! Ich bin die eheliche Frau des Schenk von Nydeggen und fordere mein Recht auf die Hand des Mannes zurück, den elende Ränkeschmiede zum Treubruch gegen mich und zum Betruge gegen Euch verleitet haben.«
Noch heute vermeine ich, die Reden der Dausque zu hören; glaube auch, der leidige Satan habe ihr die Worte eingeblasen, sintemalen selbige wie höllisches Feuer glühend aus ihrem Munde herfürschossen und das unschuldige Herz der guten Frau Katharina mit übermenschlicher Galle und Wermuth erfüllten. Sie schaute uns wehklagend an, und da sie unsere Verwirrung gewahrte, schien solches die schreckliche Anklage zu bestätigen. Ich sah es kommen – es schwindelte ihr, und sie wäre mit einem leisen Weherufe bewußtlos zu Boden gestürzet, wenn ich sie nicht rechtzeitig gestützt hätte. Sie stöhnte, daß es einen Stein hätte erbarmen mögen: »Mein Kind, mein Kind!« Dann schwanden ihr die Sinne. Eilends holte der Kastellan seine Frau, die Margreth, herbei, welche mit lautem Jammern die Hände über dem Kopfe zusammenschlug, als sie ihre Herrin bleich wie ein Leinlaken erblickte.
»Die Wahnsinnige da hat sie erschrecket,« sagte mein alter Matthias. Da aber die Dausque bei sothanen Worten und bei dem jammervollen Anblick der armen Frau Katharina nur höhnisch lachte, brach er in hellen Zorn aus und fuhr das Weib mit den Worten an: »Giftige Schlange, so das Jugendglück meines armen Herren zernichtete und nun auch in das arglose Herz meiner edeln Herrin den Geifer ihres Giftes spritzete: schere dich von hinnen!« Und da nun ob des lauten Redens auch ein Diener die kleine Treppe heraufkam, rief er ihn herbei und sagte: »Grates, nimm diese Landstreicherin, so sich hehlings ins Schloß einschlich; jage sie, peitsche sie meinethalben vom Hofe, und wenn sie nicht gehen will, so hetze die Hunde auf sie!«
»Ich gehe schon,« sagte jetzo die Emerentiana, als der Grates sie derb am Arme faßte. »Aber bei meinem Leben, ich werde ein andermal wieder kommen, und mögen mir meine Glieder bei lebendigem Leibe verrotten und verfaulen, wenn ich ruhe und raste, ehe bevor das Blyenbeeker ›Paradies‹ meine Rache fühlet!«
Sonach ließ sie sich von dem Grates ohne fürderes Sperren die Nebentreppe hinabführen, und gingen wir zwei hinter ihr drein bis über die äußere Schloßbrücke, allwo der Kastellan sie abermals mit den Hunden bedrohte, auch in ihrer Gegenwart dem Thorwart gebot, das Weib unter keinen Umständen oder Vorwänden jemalen wieder einzulassen.
Blieben noch auf der Brücke stehen, bis das Unglücksweib durch die Eichenallee den Blyenbeeker Busch erreichet hatte und unsern Augen entschwunden war, und will ich hier mit nichten aufschreiben, was der Matthias mir für eine Rede hielt von wegen meiner unglaublichen Thorheit, und daß alle Maler, Musikanten und Poeten einen Strich hätten. Standen so noch zusammen, als auch schon mein Herr Erbmarschall eiligen Schrittes über den Schloßhof kam und sich bei dem Kastellan erkundigte, ob die Person ohne weitern Unfall aus dem Hause geschaffet sei. So antwortete ihm mein Matthias, das Mensch sei glücklich von hinnen gejagt, und es habe selbiges keiner der Gäste gesehen, werde auch wohl sich nicht getrauen, ein andermal zu kommen, anerwogen der Thorwart Befehl erhalten, ohne Federlesens die Hunde auf sie zu hetzen. Solche Meldung schien den Erbmarschall merklich zu beruhigen; er athmete auf und sagte: »So sei Gott gedankt, daß sothanes Abenteuer ohne Skandal verlaufen! Will doch heute noch nach Geldern zurück und mit dem Commandanten ein Wort reden, daß dieser Person das Handwerk gelegt und sie mit einem Laufpaß aus dem Gelderischen verwiesen werde.«
Merkte nun freilich, daß mein Matthias nach seiner leidigen Gewohnheit die Hauptsache, verstehe das Zusammentreffen der Dausque mit der gnädigen Frau Katharina, verschwiegen habe, maßen er nun immer mit etwas hinter dem Berge halten muß. Gedachte also dem Herren darüber offenherzig zu berichten; da aber selbiger, als ich just meinen Mund öffnen wollte, den Kastellan fragte, wie denn das Unglücksmensch überhaupt ins Schloß hinein gekommen sei, wurde ich also verdattert und verwirret, daß ich die Ohren hangen ließ und mich stille beiseite schlich. War auch so traurig, daß ich laut hätte weinen mögen, wenn ich des Jammerbildes meiner edeln gnädigen Frau gedachte, und machte, daß ich allen Leuten aus den Augen kam, indem ich mich in meine Malerwerkstatt flüchtete.
Erst am Nachmittage ging ich wieder in den Hof hinab; denn der Portalschmuck sollte weggeräumt werden. Du lieber Gott, wie ganz anders war es mir jetzo ums Herz als vor vierundzwanzig Stunden, da ich die Kränze aufhängte! Wie hatte sich aller Jubel in Traurigkeit verwandelt, und war das Wort des Erbmarschalls in Erfüllung gegangen, als ja auch das Sprichwort sagt:
»Glück und Glas,
Wie bald bricht das!«
Will anhier einschalten, was ich später über die unselige Emerentiana und deren so unerwartetes als unheilvolles Erscheinen in Blyenbeek in Erfahrung brachte. Was sie mir von ihrem Bittgang zu Unserer Lieben Frau von Kevelaer gesagt, war eitel Geflunker; dahingegen ihr Zusammentreffen mit dem Herren Arnold und dessen adeliger Begleitung zu Geldern wenigstens so weit stattgefunden hat, daß sie denselbigen erkannt, selber aber von ihm nicht gesehen worden war. Es weilte nämlich dazumal in Geldern eine Truppe französischer Komödianten, so die Stücke eines sichern Molière aufführten. Solchem herumziehenden Pack hatte sich die Emerentiana beigesellt, wie der Herr Erbmarschall richtig gerathen, und war mit selbigem aus dem Lande Artois durch Belgien ins Gelderische gekommen, etwan auch in der Hoffnung, einiges von dem Herren Arnold zu erfahren. Wie sie nun denselbigen zufällig in also glänzendem Aufzug und Geleit durch Geldern reiten sah, entbrannte in ihrem Herzen, wie ich glaube, die alte heftige Neigung zu ihm, anerwogen man mir glaubwürdig versichert hat, sie habe eine solche zu dem jungen Arnold gehabt, als sie ihn, wiewohl durch Lug und Trug, an sich zu fesseln versuchte. War auch gleich wieder Feuer und Flammen und lief ihm spornstreichs den weiten Weg über Kevelaer und Weeze durch Sumpf und Heide nach. Was sie damit bezweckte, weiß der liebe Gott, dem es allein möglich ist, die Herzen und Nieren auch der Weiber zu durchforschen. Sie wollte ihren Arnold sehen und um jeglichen Preis mit ihm reden; hat etwan gar geglaubt, ihn seiner heiligen Pflicht abspänstig zu machen und auf ein neues an sich zu fesseln, ob sie nun solches durch sich oder aber durch Hilfe des leidigen Satan und mit einem sympathischen Pülverlein hat bewirken wollen, wie mein alter Matthias steif und fest vermeinte. Summa: Sie ist durch meine Thorheit und ihre Frechheit, wie gemeldet, in das Schloß gedrungen, jedoch über die Maßen schnöde abgefertigt worden und derohalber voll Haß und Rache von dannen gefahren.
Muß nun leider Gottes von den jämmerlichen Folgen reden, so das Unglücksweib in dem Gemüthe meiner lieben Frau Katharina verursacht hat. Habe das große Herzeleid nur zu gut sehen können, auch später sowohl von dem Edelfräulein Angelina als von meiner gnädigen Frau selber manches gehört, was mich dessen Bitterkeit erkennen ließ.
Am selbigen Morgen sind die Gäste zu guter Stunde fortgeritten und haben nichts von dem traurigen Vorfall erfahren. Angelina hat sie verabschiedet; die gnädige Frau müsse noch der Ruhe pflegen, sagte man den Fremden, anerwogen der gestrige Ritt sie über die Maßen ermüdet habe. Nachmittag ließen auch mein gnädiger Herr und dessen Schwiegervater satteln und ritten selbander gen Geldern, gänzlich der Ueberzeugung, Frau Katharina habe auch nicht die allerleiseste Ahnung von dem leidigen Besuche, so das Schloß in der frühen Morgenstunde gehabt, und des festen Willens, sofort miteinander bei einer gestrengen gelderischen Obrigkeit die geeigneten Schritte zu thun, um die Landstreicherin entweder einzuthürmen oder aber des Landes zu verweisen. Habe auch wirklich später gehört, sie sei vom Büttel gegriffen und über die Grenze gejaget worden, sobald sie sich am folgenden Tage in Geldern gezeigt, und dachte mir, sie werde niemalen mehr kommen, anerwogen sie der Vogt, so sie ein zweites Mal betroffen werde, mit Stocken und Steupen bedrohete.
Kannst dir aber selber denken, daß weder der Gemahl noch der Herr Schwiegervater fortgeritten wären, wofern der alte Matthias und dessen Weib ihnen reinen Wein eingeschenket. Da sie sich von der Frau Katharina verabschieden wollten, sagte ihnen die alte Margreth, dieselbe sei justement eingeschlummert, worauf die Herren befahlen, man solle sie ruhen lassen. Doch brachte sie ihnen das Knäblein heraus, dem der Vater und der Großvater das heilige Kreuzzeichen machten und sich darnach in den Sattel schwangen, ohne zu ahnen, daß die leidige Emerentiana die gnädige Frau gesehen und ihr großes Herzeleid bereitet habe.
In währender Zeit blieb Frau Katharina mit ihrem Knäblein und ihrem Kummer allein in ihrem Gemache. Als die alte Margreth sie aus ihrer Ohnmacht wieder zu vernünftigen Sinnen gebracht hatte, soll sie nur ein weniges geweint haben, dafür aber stundenlang bleich wie der Tod dagesessen oder in der Kammer hin und her gegangen sein. Endlich aber habe sie, wie mir die Margreth erzählte, das Knäblein auf die Arme genommen, mit feuchten Augen geherzet und geküßt und dabei gesagt: »Mein herzsüßer Christoffel, du wenigstens bist mir geblieben!«
Machte mir meine Gedanken ob sothanem Bericht der Margreth und konnte mir an den Fingern abzählen, wie jammervoll ihre Seelenruhe gestöret sei. Was und wie viel sie von den Reden der Emerentiana glaubte, wußte ich nicht; aber daß sie ihr einiges glaubte und das Weib durchaus nicht für eine Wahnsinnige hielt, wie mich der alte Matthias bereden wollte, war nur zu gewiß. Ihr Mann erschien ihr also nicht mehr als das makellose Tugendbild, das er in ihren Augen bis dato gewesen war, dieweil seinem frühem Leben offenbar ein dunkler Fleck anklebte, welchen er vor ihren Blicken verheimlicht und verborgen hatte. Nichts schmerzet aber ein Herz mehr, so in reiner Liebe zu einem Mitmenschen erglühete, als wenn der Gegenstand sothaner Verehrung urplötzlich der Achtung unwerth erscheinet, indem er statt in Reinheit und Würde zu strahlen, von irgend einer Makel bestecket wird, und bedarf es da mit nichten eines gar großen Fehltrittes, um die Liebe in Kälte oder gar in unverhohlene Abneigung zu verwandeln. Frau Katharina mochte zwar an das Ehebündniß dieses Weibes mit Arnold nicht glauben; aber der Siegelring mußte sie doch stutzig machen. Jedenfalls hatte sein Herz, wenn auch nicht seine Hand, einmal dieser Unwürdigen gehört! Und er hatte es gewagt, ihr, dem arglosen Kinde, das entweihte Herz anzubieten! Er hatte sie getäuscht, da doch die Ehrenhaftigkeit ihm hätte gebieten sollen, den Makel seiner Jugendzeit zu offenbaren. Wie mochte sie ihn jetzt noch achten oder lieben?
In ihres Herzens Bitterkeit schlug sie den Gedanken aus, zu Arnold zu gehen und von ihm ihre Zweifel lösen zu lassen. Würde er sie nicht abermals täuschen? Und weshalb kam er nicht selbst, um sich zu rechtfertigen oder um Verzeihung zu bitten? Weshalb ritt er gerade jetzt mit dem Vater fort, ohne auch nur, wie er sonst pflegte, ihr ein Wort zum Abschiede zu bieten? Jagte ihn etwa das Bewußtsein seiner Schuld von hinnen?
Solches mögen die Gedanken gewesen sein, so an jenem Tage bitter wie Wermuth ihr Herz erfüllten. Ach, Lieber, wache über deine Seele und laß kein Mißtrauen in selbige einziehen! Wenn auch nur ein Schatten davon in ein Menschenherz Zutritt findet, so erfasset die Phantasie das dunkle Ding und recket und strecket es zu einem erschrecklichen Gespenst.
Habe damals die gnädige Frau erst spät am Abende gesehen, als ich mit dem alten Matthias den Triumphbogen wegräumte. Nahm eben die Wappenschilder aus den Guirlanden herab, als sie mit Angelina durch das Schloßthor heraustrat, um einen Gang durch den blühenden Garten zu machen. Die beiden Frauen blieben einen Augenblick stehen und warfen einen Blick über die zerblätterten Bogen und über die Blumen, die streuens hin und her auf der Brücke lagen. Fräulein Angelina sagte: »Seht, Schwester, so geht es mit den Freuden dieses Lebens! Die Blumen sind dahin, und nur die Wappenschilde, mit denen sie uns dereinst den Sarg verzieren, werden sorglich zur Seite gestellt.« Frau Katharina aber redete kein Sterbenswörtlein dagegen, hob nur eine Rose auf, zerpflückte sie und warf die schönen weißen Blätter über das Geländer in das dunkle Wasser des Grabens.
»Du arme Seele!« dachte ich, »so also ist dir zu Muth!« und gänzlich überzeugt, daß jetzt nur mehr ein offenes Wort ihr den Frieden wiedergeben könne, drang ich allen Ernstes in Matthias, er möge jetzund der guten Frau reinen Wein einschenken und ihr seine zwar gut gemeinte List unverhüllet bekennen. Dagegen sträubte er sich gewaltig, und als ich ihm drohte, der gnädigen Frau selber alles getreulich zu vermelden, bat er mich gar beweglich, solches doch ja nicht zu thun, anerwogen ihn das bei der Herrschaft in große Ungnade bringen könnte. Möge ihm nur drei Tage Frist geben; wenn binnen dieser Zeit die gnädige Frau nicht gänzlich der Ueberzeugung werde, die Emerentiana sei entweder eine Wahnsinnige oder eine Betrügerin, so wolle er ihr in Gottes Namen gestehen, auf welche listige Art er den Herrn Arnold hintergangen habe. Dessen war ich zufrieden und gewährte ihm auf sein heftiges Bitten die besagte Frist.
*
Lügen ziehen allzeit neue Lügen nach sich, nicht anders als die vordern Ringe einer Schlange deren hintere Ringe nachschleifen. So sagte mir der alte Kastellan, nachdem die drei Tage verflossen waren, es sei jetzt alles in bester Ordnung, und seine Frau, die Margreth, bestätigte mir dasselbe. Er habe der guten Frau Katharina seine wohlgemeinte List gebeichtet und alles erzählt; die gnädige Frau sei zwar noch etwas traurig, weil ihr Gemahl kein rechtes Vertrauen zu ihr gehabt, im übrigen aber ruhig, und werde sich ehelang gänzlich getrösten.
Glaubte also das alles dem alten Matthias; allein der arme Mann hatte nicht den Muth gehabt, der Herrin reinen Wein einzuschenken, wie ich später erfuhr. Längere Zeit meinte ich wirklich, das Andenken an die unselige Dausque sei ihrem Geiste entschwunden; aber als der Schatten von ihrem Antlitze, das ehedem so heiter war wie der unbewölkte Himmel, nicht weichen wollte, ja sogar die Rosen auf ihren Wangen merklich abblaßten, wurde ich hinterdenklich. Sie weilte jetzt viel auf ihrem Zimmer; nur selten hörte ich bei der Arbeit vom Garten herauf ihre Stimme, und solche schien mir nicht mehr so klar zu klingen wie früher; ihr Lachen aber, das früher wie ein Glöcklein getönt, war gar nicht mehr zu hören. Früher war sie fleißig auf die Reiherbeize geritten und hatte Freude am Waidwerk gehabt, weshalb ich sie auch als Diana mit Pfeil und Bogen gemalt habe; jetzt war der kleine Christoffel ihre einzige Sorge und Freude. Einmal glaubte sie sich allein. Da sah ich, wie sie das Knäblein in den Armen wiegend sich die hellen Zähren aus den Augen wischte und dazu sagte: »Armes Kind!«
Also verflossen Tage auf Tage und Wochen auf Wochen, ohne daß auf dem einsamen Heideschlosse etwas Absonderliches fürgefallen wäre. Herr Arnold war just in selbigem Sommer gar selten auf Blyenbeek, dieweil sein Schwiegervater ihn mehr und mehr in das öffentliche Leben hineinzuziehen suchte. Auch gab ihm die Verwaltung seiner Güter Hillenrath und Swalmen bei Roermond, welche in den Kriegsläuften schwer gelitten hatten, viel Mühe und Arbeit. Selbst wenn er etwan auf einige Tage nach Blyenbeek kam, hatte er den Kopf voll Sorgen und Kümmerniß, woher es denn leicht zu begreifen, daß er gegen die gute Frau Katharina nicht mehr so holdselig war wie in frühern Zeiten, als sie und ihre Liebe seine einzige Sorge ausmachten. Wie leicht konnte sich da Frau Katharina einreden, ganz andere Gründe halten ihren Mann von ihr fern und hätten sein Herz verwandelt!
Mehr als einmal wollte ich mit ihr reden; aber ich fand das rechte Wort nicht. Malte damals das Bild Angelinas, und wenn mir das Edelfräulein saß, leistete ihr Frau Katharina gewöhnlich Gesellschaft. Einmal schien die gute Dame ganz besonders leidmüthig gestimmt, und war selbst das frohe Geplauder Angelinas nicht im stande, die dunkeln Wolken von ihrer Stirne und aus ihrer Seele zu verscheuchen. Da traf es sich, daß sie von einer Dienerin abgerufen wurde; nahm also die Gelegenheit wahr und fragte mein Edelfräulein, ob ihre Schwägerin krank sei, maßen selbige seit längerer Zeit gar so ernst und niedergeschlagen scheine.
»Ist solches Euch auch aufgefallen, Meister Thyssen?« sagte sie. »Ich weiß nicht, was ihr ist! Seit dem Morgen nach dem Wiegenfeste ist sie nicht mehr die alte heitere Katharina. Habe sie wohl hundertmal gefragt; sie will aber mit der Antwort nicht heraus. Auch von der alten Margreth und dem Matthias konnte ich nichts erfragen als die sonderbare Kunde, eine Wahnsinnige habe sie an selbigem Morgen erschreckt.«
Merkte also wohl, daß das Edelfräulein den Kummer nicht kenne, der die arme Frau bedrückte; auch wußte Angelina nichts von der leidigen Dausque, dieweil sie noch ein Kind war, als Herr Arnold in den Türkenkrieg zog. Und da ich ein merkliches Bedenken hatte, der unschuldigen Seele ein Wort davon zu sagen, ging ich mit mir zu Rath, ob ich an den Erbmarschall oder an Herrn Arnold schreiben solle; konnte nämlich das Herzeleid der edeln Frau nicht mehr länger mit meinen Augen ansehen.
Da kam mir eine unerwartete Gelegenheit zu Hilfe.
Item, stand an einem der folgenden Tage an der Schnitzbank und schnitzte an der Kamineinfassung, so für das »Paradies« bestimmt war. Die eine der Seitenfiguren, eine Diana mit dem Köcher über der Schulter, sollte nach dem Wunsche des gnädigen Herren die Züge seiner Gemahlin tragen. Hatte den Kopf, welcher der Frau Katharina nicht übel gleicht, allbereits fertig; der untere Theil der Figur verlief in eine flache Säule oder Herme, und mir war bei der Arbeit der Gedanke gekommen, eine Schlange um selbige Herme zu ringeln. Schnitzte justement an dieser Schlange und dachte dabei an die Emerentiana, so sich wie ein giftiger Wurm an meine Diana herangeschlichen hatte, als die Thüre aufging und Frau Katharina mit dem Knäblein auf ihren Armen zu mir hereintrat.
Sie betrachtete aufmerksam meine Schnitzerei. Dann sagte sie: »Die Diana soll wohl mich vorstellen; ja, ich habe in meiner Jugend die Jagd sehr geliebt.«
»In Eurer Jugend, gnädige Frau! Und Ihr zählt kaum zwanzig Jahre!« rief ich.
»O man kann auch in jungen Jahren alt werden,« entgegnete sie mit einem also bitteren Zuge um die Lippen, daß er mir das Herz zusammenschnürte. »Ueber Nacht kann man alt werden. – Aber was schnitzt Ihr da eine Schlange um das Fußgestell? Der Gefährte Dianas ist doch der treue Hund und nicht die falsche Natter.«
Solche plötzliche Frage verwirrte mich; ich suchte nach einer Ausrede. Allein ihr klares Auge ruhte so durchdringend auf mir, daß ich beschämt verstummte.
»Wie, Meister Thyssen,« sagte sie dann, »ich habe immer geglaubt, daß Ihr mir treu ergeben seiet. Und nun wollt auch Ihr mich betrügen? Ihr habt Eure eigenen Gedanken, weshalb Ihr diese Schlange meinem Bilde beifüget, und ich errathe selbige!«
»Gnädige Frau,« sagte ich, »es ist mir nie eingefallen, Euch zu betrügen. Und da Ihr es wünschet, will ich offen reden. Die trüben Gedanken, welche sich in Euer Herz eingeschlichen haben, glaube ich zu kennen, hoffe auch zu Gott, selbige verbannen zu können.«
»Redet,« preßte sie mühsam hervor. »Aber glaubet nicht, daß ich meinen Gemahl einer gemeinen That fähig erachte.«
»Gott sei dafür gepriesen!« rief ich. »So ist der Schlange, welche ich hier schnitze, nicht geglückt, Eurem Herzen einen tödtlichen Stich beizubringen; es wird wieder genesen und die alte Liebe darin auf ein neues fröhlich erblühen.«
»Kann wohl Liebe leben,« seufzte sie, »wo kein Vertrauen herrscht?« bei welchen Worten eine Thräne in ihren Augen glänzte.
»Das Vertrauen hoffe ich wieder begründen zu können. Ihr habt recht gerathen. Die Schlange, so ich hier schnitze, ist jenes unselige Weib, das durch elenden Betrug die Jugend Eures Gatten mit Galle und Wermuth gewürzet hat, und das jetzt aus Rache Eure Liebe gar gerne vergiften möchte.« Erzählte darauf mit wenigen schonenden Worten von der Jugend ihres Gatten, schilderte sein edles, christliches Benehmen, das er bewiesen hatte, sobald er seinen Irrthum erkannte, seinen Eifer, mit dem er den Fehler gut zu machen bestrebt war – seine große Liebe, mit der er sie auf seinen Händen trage und ihr Blyenbeek zu einem Paradiese umgestaltete, wie sie selbst am Abende jenes Festes so schön gesagt hatte.
Derweil ich solche Worte zu ihr redete, wurde sie sichtlich bewegt. Zu der leidigen Geschichte von der Emerentiana sagte sie zwar keine Silbe, konnte aber wohl merken, daß der Unmuth um ihre Lippen zuckte. Als ich aber erzählte, wie der heilige Vater den unglücklichen Bund für null und nichtig erklärte, athmete sie auf, und da ich die Reue und Liebe ihres Gemahles also schilderte, wie der heilige Schutzengel es mir eingab, füllten sich ihre Augen mit Zähren. Jedennoch erwiderte sie keine Silbe, als ich aufhörete, sondern ging eine lange Weile, das Knäblein auf dem Arme schaukelnd, schweigsam auf und ab.
Endlich aber sagte sie: »Das ist alles schön und recht. Aber weshalb hat er mir nie ein Wort von all dem anvertraut? Weshalb hat er mir nicht alles erzählt, als er um meine Hand warb? Weshalb hat er nicht gesagt: ›Schau, Liebe, so bin ich betrogen worden; aber der Heilige Vater hat das Band, in das mich jenes Weib verstricken wollte, als null und nichtig anerkannt?‹ weshalb muß ich das in gegenwärtiger Stunde von einem Fremden erfahren? Nein, Meister Thyssen, er hatte kein Vertrauen in mich, und wo kein Vertrauen wohnt, da kann auch keine Liebe wohnen.«
»Doch, gnädige Frau, anerwogen die Liebe selbst der Grund sein kann, welcher die Wahrheit verhüllet. Könnt Ihr Euch nicht denken, daß Herr Arnold schwieg, just weil er Euch liebte? weil er Euern Frieden nicht trüben wollte, vielleicht auch weil er Eure Liebe zu verscherzen fürchtete?«
»Ihr seid ein guter Sachwalt, Meister Thyssen,« sagte sie mit einem gar freundlichen Blicke. »Aber war es nicht seine Pflicht, mir die Wahrheit zu sagen, als er um meine Hand warb?«
Ich hatte mir vorgenommen, den alten Kastellan wenn immer möglich zu schonen. Begnügte mich daher mit der Antwort: »Durfte er nicht annehmen, der Herr Vater habe Euch alles eröffnet, was er etwan zum Frieden Eurer Seele nöthig oder dienlich erachte? Dennoch glaube ich Euch versichern zu können, daß er noch mehr that und in Wahrheit einem, so aber nicht zu reden wagete, den Auftrag gab, Euch alles offen und ehrlich zu sagen.«
Da entgegnete sie: »Meister Thyssen, ich danke Euch von Herzen! Ihr habt mir eine Sache, welche mich schwer ängstigte, wie Ihr mit Recht errathen habt, in einem viel hellern Lichte gezeigt; will anjetzt versuchen, sie in diesem Lichte zu beschauen und alles düstere Gewölk, will sagen jeglichen Zweifel, so sich etwan wieder zusammenziehen will, tapfer von hinnen treiben. Ihr Maler gebt nicht umsonst so viel auf die Beleuchtung,« fügte sie mit leuchtenden Augen scherzend bei; »die Eurige ist jedenfalls sehr freundlich.«
»Und ganz richtig, gnädige Frau!« sagte ich, tief bewegt die Hand küssend, welche sie mir freundlich darbot. »Ich bürge mit meiner Seele dafür.«
»Und du, kleiner Christoffel, gib dem guten Meister Thyssen auch dein Händchen und danke ihm schön, daß er das Herz deiner armen Mutter von einer Centnerlast erleichterte.«
Der Kleine streckte seine Aermchen nach mir aus und schaute mich aus seinen großen blauen Augen gar holdselig an. Da konnte ich vor lauter Rührung die Thränen kaum zurückhalten und rief: »Du kleiner Engel, du mußt deiner Mutter das Paradies hüten, daß die böse Schlange nie mehr ihren Weg in dasselbige finde, wir wollen jetzt auch ihr Abbild von dieser Herme entfernen, dieweilen der giftige Wurm in unser Paradies inskünftig weder Weg noch Steg jemalen mehr finden soll.«
Wohingegen sie solches verredete, sagend: »Nein, laßt die Schlange! Sie soll mich an das Wort meines Vaters erinnern, daß nur die Liebe, welche vom Himmel kommt, den Himmel bei sich hat, während Erdenliebe kein sicheres Paradies gründen kann. Wißt Ihr noch, wie eindringlich er an jenem Abende uns den Spruch Coelum peto ans Herz legte? Ich denke, der liebe Gott hat das alles gefügt, daß ich inmitten meines irdischen Paradieses des himmlischen nicht vergesse.«
Mit solchen Reden ging sie von dannen. Stand also wieder allein in der Werkstatt und fühlte eine Freude in meinem Herzen, wie seit vielen Wochen nicht mehr. Die Mutter Gottes von Kevelaer war mir hilfreich beigesprungen. Wisse, daß ich ihr eine Wallfahrt versprochen, wenn sie mir gnädiglich beistehe, meine arme gnädige Herrin zu trösten; anerwogen man sie mit dem lieblichen Titel »Trösterin der Betrübten« begrüßet. Als ich nun am Abende der gnädigen Frau meinen Wunsch aussprach, des nächsten Morgens nach dem nahen Wallfahrtsorte zu pilgern, sagte sie: »Ich glaube zu errathen, weshalb Ihr zur Mutter Gottes von Kevelaer wollt, und denke, mindestens einen ebenso wichtigen Grund zu sothaner Wallfahrt zu haben, wenn es Euch recht ist, so werden Angelina und ich Euch begleiten.«
So ritt ich am folgenden Tage, einem freundlichen Herbstmorgen, in Begleitung der beiden Frauen erst über die blühende Heide, dann aber durch Wald und Wiesen Kevelaer zu. Es wurde auf dem Hinwege wenig gesprochen. Wir beteten zusammen den heiligen Rosenkranz und bereiteten uns auf den Empfang der heiligen Sacramente vor. Als wir aus dem letzten Walde hervortauchten und den Wallfahrtsort vor uns liegen sahen, hob Fräulein Angelina mit ihrer glockenhellen Stimme ein schlichtes Marienlied an. Frau Katharina begleitete mit ihrem sanften Alt, und auch ich suchte meinen Baß darunter zu legen, daß es ein freundlicher Gruß an unsere gnadenreiche Mutter war. Sie sang aber ein altes Lied, das sie dennoch ein weniges umgewandelt hat, also:
Sagt an, wer ist doch diese,
So überm Paradiese
Als Morgenröthe steht?
Es krönet sie der Sterne Kranz,
Es kleidet sie der Sonnen Glanz,
Und klarste Unschuld ist sie ganz,
Die Braut von Nazareth!
Das ist die Makellose,
Das ist die Gnadenrose,
Des ewigen Wortes Zelt;
Das ist die Blum' aus Jesses Stamm,
Die uns gebracht das Gotteslamm,
So unsre Sünden auf sich nahm,
Die Königin der Welt!
O du, vieledle Fraue,
In Gnaden auf uns schaue
Und heile allen Harm!
O du, der Traurigen Trösterin,
O du, der Seligen Königin,
Führ uns zur ewigen Heimat hin,
Bitt, daß sich Gott erbarm'!
Bald knieten wir vor der Gnadenkapelle unter den Lindenbäumen und dann vor den Beichtstühlen und empfingen schließlich den Urheber und Spender allen Trostes. Was war es da zu wundern, daß Frau Katharina wie neu geboren die »Trösterin der Betrübten« in Kevelaer verließ? Angelina kannte sie kaum mehr; ein über das andere Mal rief sie: »Aber Katharina, was ist dir nur? Du hast auf einmal dein altes fröhliches Herz wiedergefunden, welches ich seit Monaten gar schmerzlich bei dir vermißte!«
»Ja,« sagte die edle Frau, »es ist mir, als ob eine schwere Wetterwolke über meine Seele hingegangen wäre, und jetzo scheint die liebe Sonne wieder, und an jedem Halm und Blatt funkeln die Tropfen. – Meister Thyssen, Ihr müßt mir eine schöne Ex-Voto-Tafel für Kevelaer malen – das Schloß Blyenbeek und im blauen Himmel darüber die Mutter Gottes mit ihrem lieben Jesuskindlein, selbiges segnend und schützend. Vor dem Schlosse aber knie ich mit meinem Christoffel und mein Arnold und Angelina. Vergesset dabei auch nicht, den schönen Spruch Coelum peto in güldenen Buchstaben darauf zu setzen.«
Also ritten wir theils in ernsten theils in fröhlichen Gesprächen über die blühende Heide zurück, welche die Strahlen der sinkenden Sonne vergüldeten. Die ansonst öde Landschaft stand in ihrem Lichte wie verklärt. Rother Abendschein hatte die kahlen Sanddünen überhaucht, und soweit man sehen konnte, dehnte sich das Heidekraut mit seinen Tausenden und abermal Tausenden bald blassen bald hellrothen Blümlein. Darüber wogete ein Summen und Duften ob der weiten Fläche, und viele hundert fleißige Immen waren noch geschäftig, die letzte süße Tracht zu sammeln und nach ihrem kunstreichen Baue zu tragen. Ringsum Ruhe und süßer Frieden, und der süßeste in unsern Kerzen, und als nun das Ave-Glöcklein in Sanct Augustin den »Engel des Herren« läutete, knieten wir in das Heidekraut nieder und grüßten die Königin des himmlischen Friedens mit dem Gruße des Engels:
Ave Maria!
Friede und Glück war abermals in das Blyenbeeker »Paradies« eingekehrt, dieweil Glaube und Liebe das Natterngift des Zweifels ausgetrieben hatten, so die Rache eines Weibes in die arglose Seele meiner gnädigen Frau Katharina geträufelt. Gott und die heilige Jungfrau seien ewiglich dafür gepriesen, anerwogen ich nur mit Schaudern daran denken mag, was für eine traurige Saat aus solchem giftigem Samen hätte ersprießen können. Dachte auch darüber nach, ob es nicht gerathen, das letzte Würzelchen, so etwan noch zurückgeblieben sein mochte, fürsichtig auszureuten, verstehe meinem Herrn Arnold darüber zu berichten, daß sein Ehegemahl in Kenntniß der leidigen Geschichte mit der Emerentiana gekommen sei und ihm gänzlich verzeihe. Habe also Frau Katharina gefragt, welche gleichwohl der Meinung war, daß von der Sache am besten gar nicht mehr geredet werde, und daß Herr Arnold in der Ueberzeugung verbleibe, sie wisse nichts von dem Unglücksweib. Solches schien dann auch mir das Weiseste, namentlich weil mein gnädiger Herr eines leicht zu verwirrenden Gemüthes war, und beschloß also, nicht weiter davon zu reden, vielmehr alles dem gnadenreichen Schutze Gottes zu befehlen, der aus jeglichem Fürfall und Verhältniß Nutz und Frommen für das ewige Heil seiner Lieben zu ziehen weiß.
*
Nun kamen gar ruhige und glückselige Tage für das Blyenbeeker »Paradies«. Ich zähle sie zu den freudenreichsten meines Lebens. Die beiden Frauen behandelten mich viel eher als einen lieben Freund denn als einen Diener; auch mein gnädiger Herr Arnold erwies mir gar großes Vertrauen, maßen er mich an Stelle des alten Matthias, den er nicht gar lang nach dem leidigen Besuch der Emerentiana als Kastellan und Verwalter nach Hillenrath geschickt hatte, zum Verwalter und Verweser von Blyenbeek machte, mit der Bedingung jedoch, daß ich darob die Malerei und Schnitzerei nicht gänzlich bei Seiten setze. Habe denn auch gerade in selbigem Winter an der Schnitzbank wacker gearbeitet; an den langen Abenden aber riefen mich die beiden Frauen zumeist in die Wohnstube, wo sie mit den Mägden am Spinnrocken saßen und die Rädchen im Tacte schnurren ließen, während die Buchen- und Föhrenscheite im Kamine loderten und knisterten, draußen aber der Nordost die Schneeflocken über die Heide und um den Schloßthurm trieb.
Da mußte ich ihnen vorlesen und habe manches gute und auferbauliche Buch zu Nutz und Frommen meiner Seele in selbigem und in den darauffolgenden Wintern zu Ende gebracht, anerwogen weder meine gnädige Frau noch viel weniger das liebe Edelfräulein an den leichtfertigen Komödien und Liebesaventüren einen Gefallen fand, welche dazumal von Paris kamen und sonst auf den Schlössern des Adels mehr gelesen wurden, als für Zucht und Sitte ersprießlich war. Lasen vielmehr, was uns der Prior von Sanct Augustin schickte, namentlich Legendenbücher und Briefe der frommen Priester und Glaubensboten, so unter den fremden heidnischen Völkern mit augenscheinlicher grausamer Todesgefahr das Evangelium verkünden, und waren solche Briefe eine nicht nur erbauliche, sondern auch gar liebliche Lesung, maßen sie viel Neues über die Sitten und Bräuche solcher fremder Länder und Leute erzählen. So sind mir fürnehmlich die Briefe der Glaubensboten bei den Huronen im Gedächtniß geblieben, während dem Edelfräulein die Sendschreiben der Ursulinernönnchen, so mit der ehrwürdigen Mutter Maria von der Menschwerdung über Meer gen Canada zogen, nicht aus dem Sinne gekommen.
Mein gnädiger Herr Arnold war auch selbigen Winter selten zu Haus, maßen er jetzt schier eine so große Lust zu den politischen Geschäften verspürte, als ihn früher Menschenscheu zu einem Einsiedler gemacht. Jetzo zog es ihn immer wieder nach Geldern oder nach Venlo und Roermond zum hispanischen Statthalter, zu dem und jenem Adeligen oder Staatsmann, so daß seine Frau sich wohl hätte beklagen mögen, das »Paradies« sei nunmehr gar zu still und einsam geworden, wenn nicht der kleine Christoffel, so kräftig heranwuchs und allbereits gehen konnte, dem Mutterherzen ein tagtäglicher freudenreicher Trost gewesen wäre. Man konnte aber auch das liebe Engelsköpflein mit den gelben krausen Haaren und den großen blauen Augen nicht ansehen ohne wonnesame Freude, und habe es sowohl für die Mutter und Angelina als auch für den Vater und Großvater des öftern gezeichnet, auch in Wasser- und Oelfarbe gemalt und hier und dort in Schnitzerei angebracht, was mir von allen Seiten große Gunst eingetragen hat.
Waren schon tief im Sommer anno 1698 und hatten nun schier zwei Jahre von der Emerentiana kein Sterbenswörtlein mehr gehört, als dieses Schandweib sich eines Tages wiederum sehen ließ. Da ich eines Morgens zu annoch früher Stunde in den Schloßhof herabkam, meldete mir der Jäger Kurt, er habe in dem Föhrenbusch an der Blye zwei Männer gesehen, so ihm marodirende Soldaten oder Wilddiebe zu sein schienen, welche mit einem Weibsbild, das er schon einmal gesehen zu haben vermeine, über einen verdächtigen Anschlag geredet hätten. Er sei nämlich vorsichtig nahe an sie heran gepirscht und habe, durch einen Brombeerenstrauch versteckt, das Gespräch zwar wohl gehört, jedoch nur zum geringsten Theile verstanden, anerwogen die Schälke französisch geredet hätten, welcher Sprache er nur wenig mächtig sei; vermeine dennoch, sie hätten es auf den Junker Christoffel abgesehen, glaube auch, das Weib sei dasselbe, welches wir vor Jahr und Tag aus dem Schlosse gejagt, maßen Größe und Gestalt zutreffe; das Gesicht aber habe er nicht sehen können, da sie ihm den Rücken zugedreht habe. Kann sich nun männiglich denken, daß ich nicht wenig erschrocken bin, anerwogen die beiden gnädigen Frauen mit meinem lieben Christoffel vor einer kurzen Frist, nur von dem Trikes, einem nicht halbgewachsenen Stallburschen gefolgt, aus dem Schlosse geritten waren!
»Heilige Mutter Gottes!« schrie ich also; »sie sind zur Messe nach Sanct Augustin;« denn solches war die gnädige Frau an allen schönen Tagen gewohnt. »Grates, geschwind die Gäule aus dem Stall und gesattelt! Kurt, Eure Muskete und ein geladenes Handrohr und ihnen nach, so lieb euch eurer Seelen Seligkeit ist!« Gürteten in der Eile jeder ein Schwert oder einen Sabel um und schwangen uns also selbdritt auf die Rosse, ohne auch nur die Zeit zu nehmen, ordentlich zu satteln, und sprengten auf Tod und Leben den Reitpfad hinunter, der nahe an dem Föhrenbusche vorüber, in welchem Kurt die saubern Gesellen gesehen hatte, nach Sanct Augustin führt, versprach in meines Herzens Angst eine zweipfündige Kerze der Mutter Gottes von Kevelaer, wenn wir nicht etwan, was ich schier fürchtete, zu spät kämen. Hei, so bin ich all mein Lebtag nicht geritten!
Waren auch noch keine zehn Minuten unterwegs, so vernahm ich vor mir von einem Platze aus, wo der Pfad durch Wachholdergesträuch und halbgewachsene Föhren gehet, ein markdurchdringendes Geschrei der beiden Edelfrauen. Da hab ich meinen Wallach, maßen ich keine Sporen trug, mit der Degenspitze gekitzelt, daß er die paar hundert Schritte wie im Fluge zurücklegte und weder Grates noch Kurt mir folgen konnten. Kam so mit Gottes Gnade noch just zur rechten Zeit, wofür Unserer Lieben Frau von Kevelaer gedankt sei; anerwogen es zwei Vaterunser später vielleicht schon zu spät gewesen wäre.
Summa: Als ich zur Stelle kam, hatten die elendigen Galgenvögel, deren ich drei gewahrte, allbereits den Trikes jämmerlich vom Gaule gerissen, daß er seiner Sinne nicht mächtig und mit Blut überronnen am Boden lag. Auch die beiden Frauen waren von den Zeltern zur Erde gezogen worden und rangen mit den Mordbuben, so ihnen bereits den Mund mit Tüchern verstopfet hatten, daß sie nicht mehr um Hilfe rufen könnten, die Hände und Füße aber elendiglich knebelten. Weiß nicht, was sie mit den Frauen vorhatten, und ob sie dieselben rauben oder gar ermorden wollten. Es wehrte sich aber namentlich die edle Frau Katharina schier wie eine Leuin. Ich nun fuhr wie ein Wetterstrahl dazwischen und versetzte dem einen Strolche, der gerade meiner gnädigen Frau die Arme auf den Rücken binden wollte, einen solchen Hieb über den Schädel, daß er rücklings hinschlug und mit greulich verdrehten Augen seine arme Seele ausspie. Bevor ich aber zu einem neuen Schlage ausholen konnte, waren seine beiden Gesellen, gänzlich entschlossen, ihn zu rächen, mir hart auf dem Nacken. Der eine drückte mir unter der Nasen sein Handrohr ab, und weiß ich heutigen Tages noch nicht, wie die Kugel meinen Kopf fehlen konnte; der andere aber schlug mit seinem Sabel nach mir und verwundete mich am linken Arm, was ich gleichwohl in der Hitze des Gefechtes nicht achtete, ja nicht einmal verspürte. Hatte aber doch gegen die beiden Mordbrüder einen schweren Stand und schrie aus Leibeskräften dem Kurt und Grates zu, daß sie sich sputen möchten, maßen die zwei verzweifelten Bösewichter mich sonst allerwegen überwältigt hätten.
Als aber meine Gesellen auf dem Kampfplatze erschienen, wandte sich das Blättchen, indem der Kurt zwar den einen, so mich schon verwundet hatte und allbereits zum zweiten und, wie ich nicht zweifle, tödtlichen Hiebe ausholte, pardautz über den Haufen schoß, der Grales aber den andern Galgenvogel, so jetzt statt mit dem Handrohr mit dem Sabel auf mich einstürmte, zu Boden schlug. Dankte also meinem Schöpfer für solche rechtzeitige Hilf und sprang vom Roß, um den beiden Frauen zu helfen, so mit Stricken gebunden elendiglich auf dem Heidekraut lagen.
Zuvörderst zog ich der gnädigen Frau Katharina das Tuch aus dem Munde, welches die Schnapphähne ihr also tief hineingestopfet hatten, daß sie sonder Zweifel in kurzer Zeit ersticket wäre, maßen sie im Gesicht schon roth und blau war, auch die Augen merklich aus den Höhlen hervortraten. Hatte das Tuch kaum fortgerissen, so rief sie: »Mein Kind! Christoffel!« und deutete dabei mit den Augen, und sobald ich mit meinem Degen den Strick durchschnitten, auch mit ihren Händen nach dem Busche, abermalen schreiend: »Christoffel!«
Da erst gewahrte ich, daß von den drei Rossen der Schimmel fehlte, so die gnädige Frau geritten, und da ich auch meinen lieben Junker weder hörte noch sah, konnte ich mir das Ding gleich reimen und dachte: »O weh! Das Weib ist mit dem Knäblein entwischt.« Hui, war ich wieder auf meinem Wallachen und jagte durch den Föhrenbusch in der Richtung, so mir die gnädige Frau mit Winken und Worten angedeutet, den beiden andern zuschreiend, sie sollten bei den Frauen verbleiben.
Nach einigen hundert Schritten gewann ich die offene Heide, so nach jener Seite hin sich wohl zwei Stunden weit zwischen dem Blyenbeeker Busch und dem Weezener Wald bis nach Bergen an die Maas hinstreckt. Erschaute dann auch bald den Schimmel und auf selbigem ein Weibsbild, das mit verhängtem Zügel quer über die Ebene dahinsprengte; ob sie aber das Knäblein in den Armen trage, konnte ich nicht sehen, maßen sie schier eine Viertelstunde Vorsprung hatte, verzweifelte beinahe, sie mit meinem Wallachen einzuholen, dieweil der Schimmel ein gar flinkes Thier ist; setzte aber doch alles daran und trieb meinen Gaul mit Rufen und Schlagen zur Eile, so daß er wacker ausgriff. Nach einer Weile bemerkte ich mit Freuden, daß ich dem Schimmel näher komme; auch das Weib merkte es und änderte nun die Richtung, indem es, mehr nach Westen abbiegend, offenbar den Weezener Wald zu gewinnen suchte.
Das gab mir einen Vorsprung, dieweil ich jetzt den Winkel abschneiden konnte, so sie machen mußte. Hielt also scharf auf die Eckelt zu – ist ein sumpfiger Waldwinkel mit einem Eichenbusch, der in die Heide vorspringt – und hoffte sie dort zwischen dem Bach und dem Sumpf in die Enge zu treiben. Jetzt war ich schon so nahe, daß ich wohl unterscheiden konnte, sie trage das Knäblein im Arme; schrie ihr auch zu, sie solle halten, wenn ihr das Leben lieb sei, und mir den Junker übergeben; dafür wolle ich sie laufen lassen. Sie aber riß den Schimmel abermals herum und suchte nach der Maas zu entrinnen, sei es nun, daß sie meinen Worten nicht traute, oder daß sie noch immer zu entwischen verhoffte. Hatte auch einmal schier den Anschein, daß ihr solches gelänge, da mein Wallach in dem Heidekraut zu mehreren Malen strauchelte und bei einem Haar zusamt mir elendiglich gestürzet wäre; riß ihn aber doch jedesmal auf und trieb ihn zu erneuter Eile an.
So kam ich der Kindsräuberin in der Gegend des obern Blyebaches also nahe, daß ich das Weinen des Knäbleins allbereits hören konnte; dachte auch schon, sie werde den Sprung über den Bach nicht wagen und sich gefangen geben. Das Gesicht des Weibes konnte ich nicht sehen, dieweil sie es mit einem schwarzen Schleiertuche verhängt hatte; zweifelte aber nicht im mindesten, daß es die unglückselige Dausque sei. Rief sie auch bei Namen und forderte sie unter heftiger Bedräuung ein letztes Mal auf, mir den Junker zu übergeben. Da sie nun den Bach erreichte und gänzlich verzweifelte, mir auf andere Weise zu entrinnen, schrie sie mir zu: »Da holt Euch den Balg selbst!« und warf meinen lieben Christoffel weit von sich in den Bach, derweil sie auf dem Schimmel über denselben setzte.
Ach, was hab ich da vor Herzensangst geschrieen, als ich das Wasser aufspritzen hörte, während ich noch immer meine hundert Schritt vom Bache entfernt war! Es kamen mir die wenigen Augenblicke, in denen der Gaul das Ufer erreicht, fast wie eine Ewigkeit vor, und als ich nun endlich am Bache zur Erde sprang, konnte ich zuerst das Knäblein nicht erblicken. Obschon nämlich das Wasser in der Sommerzeit nur seicht ist, kann man dennoch unmöglich den Boden des Bettes sehen, maßen darin so viel Brunnenkresse und Löffelkraut wächst. Was hab ich da die Hände gerungen und zur lieben Mutter Gottes von Kevelaer geschrieen! Sprang dann in den Bach und begann mit meinen Händen durch die Wasserpflanzen nach dem Knäblein zu tasten, und fügte es der grundgütige Gott, daß ich selbiges bald an einem Aermchen erwischte und aus dem Wasser zog. Nun kann sich männiglich meine Freude denken, da ich bemerkte, daß es noch zappele, und da ihm das Wasser aus dem Mündchen geflossen, ich dasselbe auch eine Weile mit meinen wollenen Rockschößen gerieben, fing es wieder merklich an zu athmen und öffnete seine liebe Aeuglein. Fuhr also fort zu reiben, wobei ich noch immer mit den Füßen im Bache stand, das Kind aber vor mir auf dem trockenen Heidekraut liegen hatte. Da erst gewahrte ich, daß mein linker Arm verwundet sei, indem das Blut, das aus meinem Aermel hervortropfte, das Knäblein beim Reiben mit rothen Strichen zeichnete, war während des Gefechts, der Jagd über die Heide und namentlich während der letzten angstvollen Augenblicke so sehr in Aufregung, daß ich weder den Schmerz noch das Blut bemerket hatte. Gott sei herzinnigst dafür gedankt, anerwogen ich sonst wohl kaum den Muth gehabt hätte, dem Schandweib also nachzusprengen und das Leben meines lieben Christoffels zu retten!
Jetzt aber, da die Angst vorüber, fing ich an, eine große Schwäche zu verspüren; stieg also aus dem Bache und suchte mit meinem Junker in dem gesunden Arm auf den Wallachen zu kommen, was ich gleichwohl nicht zu stande brachte. An eine Verfolgung der Emerentiana war natürlich nicht mehr zu denken; sah auch auf der weiten Heide keinen Schimmel mehr, ob sie nun durch die Dünenhügel meinem Auge entrückt war oder aber den Weezener Wald gewonnen hatte. Ergriff also meinen Gaul am Zügel und wollte zu Fuß nach dem Busche zurück, wo ich die beiden Edelfrauen mit Kurt und Grates gelassen hatte. Solches wäre mir aber schwerlich geglückt; denn die Heide fing an, sich vor meinen Augen erst langsam, dann schneller zu drehen, und in meinen Ohren hörte ich ein so mächtiges Läuten und Brummen, daß ich schier meinte, es seien die Glocken von Sanct Gudula, welche ich vor Jahr und Tag zu Brüssel oftmals gehört hatte. Dieweil ich aber nunmehr auch in meinen Knien ein merkliches Zittern verspürte, setzete ich mich in das Heidekraut und rief dem Kurt und Grates; vermeine auch, ich hätte sie mit den beiden gnädigen Frauen von weitem über die Heide kommen sehen. Doch ist mir das nicht ganz ausgemacht, nämlich ob ich es wirklich sah oder träumte, maßen sie alle zu tanzen schienen.
Was hernach geschehen, kann ich nur vom Hörensagen niederschreiben. Wie mir der Kurt und Grates erzähleten, hat mein lieber Christoffel ruhig in meinem Arm geschlafen, als sie mit den gnädigen Frauen herangekommen waren, und sei sowohl die Freude ob der Rettung des Knäbleins bei der Mutter und Angelina, wie man sich leichtiglich vorstellen kann, als auch die Sorge um mich über die Maßen groß gewesen. Habe auch gleich einer nach Cleve zum Feldscherer reiten müssen. Wie sie mich nach dem Schlosse brachten, weiß ich nicht zu sagen.
Summa: Als ich wieder zu mir kam, lag ich in meinem Bett, und waren wohl vierzehn Tage seit dem vermeldeten Abenteuer verflossen. Hatte die ganze Zeit im Fieber gelegen und in meinen Träumen bald der Emerentiana nachgejagt, so ich gleichwohl niemals greifen konnte, bald im Bach nach dem kleinen Christoffel gesucht, den ich ganz deutlich tief unter dem Wasser zappeln sah; wenn ich ihn aber fassen wollte, war es ein Aal, der mir entwischte. Auch an jenem Morgen, da ich zum erstenmal wußte, wo ich sei, und zu meinem nicht geringen Erstaunen das liebe Edelfräulein, so mir kalte Umschläge auf die Schläfen legte, an meinem Bette sitzen sah, fragte ich gleich nach dem Knäblein, und ob es mir wirklich gelungen sei, dasselbige lebendig aus dem Bache zu ziehen. Worauf Angelina holdselig lächelnd mir versicherte, der Christoffel sei ganz wohl, und wenn ich fein ruhig sei und noch ein wenig schlafe, wie es der Feldscherer wolle, werde sie mir später das Knäblein an mein Bett bringen. Hat auch redlich Wort gehalten, indem sie und meine gnädige Frau am selbigen Nachmittag den lieben Junker in meine Kammer brachten, ja auf meine Kissen setzten, daß er mir mit seinem Händchen meine Backen patschen konnte.
Seitdem war es mit mir bei huldreichster Pflege von Tag zu Tag besser geworden, so daß ich nach einer Woche mich allbereits erheben und in den großen Armsessel des Herrn Arnold setzen konnte, so mir die Frauen fürsorglich auf meine Kammer tragen ließen. Und will ich nun hier nicht des weitern berichten, wie nicht nur die Frauen, sondern auch mein gnädiger Herr mich in Wort und That mit Dankesbezeigung überhäuften. Habe von Stund an schier zur Familie gezählet, so daß ich immer mit der Herrschaft speisen mußte.
Den Arm hatte ich freilich noch lange in der Schlinge zu tragen; ist mir auch etwas steif geblieben, was ich aber wenig achte, da es der linke ist und mich solches weder beim Schnitzen noch beim Malen sonderlich behindert. Die Wunde war an sich niemals gefährlich gewesen, wohl aber der große Blutverlust, anerwogen der Feldscherer meinte, ich hätte wohl eine Maß von dem köstlichen Lebenssaft verloren, so daß er anfangs wähnte, ich werde ins Gras beißen. Aber eine Maß Blut kann ein junger hitziger Maler wohl missen, schier besser als eine Maß Bier in der heißen Sommerzeit.
Ja, Lieber, es wäre etwan besser gewesen, ich hätte noch eine Halbe verloren, sintemal der Teufel ein Schelm ist und mir in selbigen Tagen fast eine schlimmere Wunde ins Herz schlug als der Schnapphahn in meinen Arm!
Will nur gleich gestehen, wie das Ding gewachsen ist. Das Umhersitzen mit den edeln Frauen taugte mir mit nichten, anerwogen ich schon lange eine wachsende Liebe und Neigung zu dem holdseligen, engelschönen Fräulein Angelina verspüret hatte. Habe ehrlich dagegen gestritten, maßen eine solche Liebe zwischen einem armen Maler und der hochedeln Schwester des Schenk von Nydeggen wohl zu großem Schmerz und Unheil, jedoch zu nichts Vernünftigem führen konnte. Jetzo aber nach dem Abenteuer und der glücklichen Errettung sowohl der Frauen als des Junkers erzeigte mir der Herr Arnold so große Liebe und Dankbarkeit, daß mir der Gedanke kam, er werde mir vielleicht dennoch die Angelina zum ehelichen Gemahle geben, falls auch selbige den gleichen Wunsch und Willen hege. So ging der Kampf in meinem Herzen von neuem los, und war ich bald entschlossen, ein offenes Wort mit Angelina zu reden, bald aber gedachte ich hinwiederum, es sei heller Wahnwitz und allerwegen gerathener, daß ich je eher desto besser Blyenbeek den Rücken kehre und mit dem Wanderstabe in die weite Welt hinaus walle.
Da geschah es an einem lieblichen Herbstnachmittag, daß die beiden Edelfrauen mich zu einem Spaziergang nach dem nahen Hügel einluden, der gen Hassum hin aus der Ebene aufragt und von dem man mehr als zwei Dutzend Kirchthürme erblicken kann. Meine gnädige Frau Katharina wurde am Fuße des Hügels von einem armen Taglöhner, so dort seine elende Hütte hat und dessen Weib krank daniederlag, eine Weile zurückgehalten. Sie winkte uns also fürbaß zu gehen, und so wandelten wir zwei, verstehe Angelina und ich, den kleinen Christoffel an den Händchen zwischen uns führend, in vertraulichen Gesprächen den Hügel hinan. Als wir die Höhe erstiegen hatten, erfreuten wir uns zuerst der Fernsicht und zeigten dem Knaben das Schloß, das mit seinen Gräben und Gärten mitten in der Heide als wie eine Oasis in der Wüste gelegen ist. Dann nannten wir ihm all die Kirchthürme, so längs der Maas und jenseits der Föhrenwälder auf der deutschen Seite emporragen, namentlich aber die Thürme von Cleve, und wußte Angelina gar anmuthig mit dem Knäblein zu plaudern, das allbereits etwelche Worte reden konnte, hernach setzten wir uns, und während der Kleine zu unsern Füßen mit Blümlein spielte, so wir ihm brachen, suchte ich nach einem Worte, um dem Edelfräulein mein Herz zu eröffnen.
Aber Angelina kam mir mit einer gar unerwarteten Zeitung zuvor, indem sie sagte: »Lieber Meister Jan, das wird wohl das letzte Mal sein, daß ich mein trauliches Blyenbeek von hier aus betrachte, anerwogen ich gänzlich gesonnen bin, mit nächstem mein Vaterhaus zu verlassen und mit Gottes Gnade eine Klosterfrau zu werden.«
Da vermeinte ich, es werde mir schwarz vor den Augen, und vermochte nur mit Mühe einen Wehruf zu unterdrücken. Sie aber fuhr ganz ruhig fort: »Wollte Euch schon lange diesen meinen festen Entschluß mittheilen. Allein es ist Eure Krankheit dazwischen gekommen; auch wollten mein Bruder und meine vielliebe Schwester, Frau Katharina, nicht einwilligen. Jetzt aber sind sie es zufrieden, und gestern ist auch der Brief der ehrwürdigen Mutter der Ursulinen zu Roermond angelangt, so mir schreibt, ich möge nunmehr kommen, wenn ich auf Mariä Opferung den Novizenschleier nehmen wolle. Seht, lieber Meister, solches war von Jugend an mein Wunsch, und würde ihn schon früher erfüllt haben, wenn ich nicht der guten Katharina auf diesem einsamen Schloß eine Gefährtin hätte sein wollen, bis der kleine Christoffel da ihr die Einsamkeit versüßen könne. Jetzo ist er groß genug dazu und fängt schon an zu plaudern und wird der Mutter alle Tage größere Freude machen. Gelt, kleiner Knirps?« Damit zog sie das Knäblein an sich und herzete es. Dann fügte sie noch bei: »Auch seid ja Ihr da, Meister Jan, und möget ihr die lange Weile mit Euern muntern Gesprächen wohl verkürzen.«
Ich nun suchte ihr solche Absicht allerwegen zu verreden: sie könne ja auch in dem einsamen Blyenbeek als wie in einem Kloster Gott dienen; ein gute christliche Base möge in einer Familie schier mehr Gutes thun als unter den Klosterfrauen, so eines guten Beispiels nicht also benöthigten wie die Weltleut u. s. w. Fragte sie schließlich in meiner Dummheit gar, ob sie sich etwan nicht genugsam geliebet fühle; es könne sich ja leichtlich ein Mann finden, der sie als sein liebes Weib auf seinen Händen durch das Leben tragen würde.
Angelina aber lächelte nur und entgegnete: Daran fehle es nicht, anerwogen ihr von allen Seiten nur Liebe und Güte zu theil geworden sei; aber ihr Sinnen sei nun einmal auf das Kloster und den himmlischen Bräutigam gerichtet. Dann erzählte sie mir die Geschichte von der guten Lysbeth von Graevendael. Dieselbige war ein Edelfräulein aus dem Geschlechte der Schenk und hatte im Jahre 1443 bei ihrem Eintritte in das Kloster Graevendael oder Grafenthal, so kaum zwei Stunden von Blyenbeek entfernt liegt, ein gar rührendes Vermächtniß gemacht. Sie hat nämlich aus Liebe zu unserem Herrn Jesus Christus, der dreiunddreißig Jahre auf Erden wandelte, dreiunddreißig Paar Schuhe an arme Leute gestiftet, und diese mußte der Prior von Gaesdonk alle Jahre auf Sanct Martini Tag, wann es anhebt zu schneien, getreulich vertheilen, und zwar elf Paar an arme Männer, elf Paar an arme Frauen und elf Paar an arme Kinder.
Darauf fragte sie mich, ob ich nicht glaube, daß solche gute Werke und ein also tugendreiches Leben Gottes Segen auf eine Familie herabzögen, was ich nicht verneinen konnte. So entgegnete sie gar ernst, das Haus der Schenk habe besondere Fürbitte sehr nöthig; oder ob ich nie von dem Kriegsobersten Martin Schenk gehöret, der seinen heiligen Glauben verläugnet, Kirchen und Klöster zerstört und ausgebrannt habe und endlich nach einem wüsten Leben voll Greuel eines jähen und, wie man wohl fürchten müsse, unglückseligen Todes aus dieser Zeit abgefahren sei. Seither sei ihr Haus von großem Unheil heimgesucht worden, wohl zur Strafe für sothane Frevel, und es bestehe sogar eine Prophezeiung, daß es gänzlich absterben solle. Jetzo freilich sei Hoffnung, daß in dem lieben Christoffel etwan ein neuer und besserer Zweig erblühe, wiewohl der neuliche Fürfall und dessen große Todesgefahr sie schier hinterdenklich gemacht habe, anerwogen es eine Warnung vor künftigem Unglück sein könnte. Wolle also durch ihr Gebet im Kloster den Himmel bestürmen, daß er entweder eine solche Heimsuchung gnädiglich abwende oder wenigstens, falls seine Gerechtigkeit eine Sühne für die Frevel ihres Geschlechtes fordere, alles so füge und leite, daß es zum ewigen Seelenheil ihres Bruders, ihrer lieben Schwester Katharina und des gegenwärtigen kleinen Christoffel gereiche.
Solches sagte sie alles dermaßen liebreich, in heiliger Einfalt und Demuth, daß ich mich der Thränen nicht erwehren konnte, obschon ich ihr immer noch, was mir Gott verzeihen möge, solch heilige Gedanken und Entschlüsse auszureden versuchte. So schüttelte sie nur mit dem Kopfe und sagte:
»Denkt doch an unsern Wappenspruch, den Ihr im ›Paradies‹ so schön an die Decke gemalet. Coelum peto – nach dem Himmel streb' ich! Mein Bruder hat ihn auf Erden, verstehe in irdischer Lieb und irdischer Ehre gesucht und denkt auch jetzt noch gar zu viel, sich etwan durch seine Politica beim Statthalter und Landesherren Lob und Titel zu gewinnen; meine liebe Schwieger Katharina suchte ihren Himmel in dem Blyenbeeker Paradies, will sagen in süßem und ungestörtem Zusammenleben mit Mann und Kind zu finden. Allein sie mag wohl schon empfunden haben, daß alles, was irdisch ist, wankt und wechselt, und daß nur die überirdische Liebe besteht. So will ich denn in dieser meinen Himmel suchen und unsern Wappenspruch nach meiner Art auslegen.«
Diese und ähnliche Worte redete die herzgute Angelina, und sie steht mir noch gar lebendig vor Augen, wie sie von der Höhe aus mit Blick und Gebärde voll Liebe Abschied nahm von der stillen Heide und dem einsamen Vaterhaus. Am selbigen Abende habe ich noch lange mit meinem Schmerze gerungen; bin endlich doch ruhiger geworden, als ich es über mich brachte, auch von meiner Seite die Trennung von diesem huldreichen Wesen dem Herren als ein Opfer darzubieten. Habe dabei mir vorgenommen, den Spruch Coelum peto auch so wie Angelina zu deuten, und bin schließlich unter allerlei Gedanken, wie sündhafte Liebe die Emerentiana zu einem Teufelsweib, himmlische Liebe aber mein Edelfräulein zu einem Engel gemacht, eingeschlummert.
Da hat mir geträumt, ich gehe just wie am selbigen Tage mit Angelina, und wir führten den kleinen Christoffel zwischen uns. Es war aber nicht eine Heide, durch die wir wandelten, sondern ein wunderlieblicher Garten mit Lilienbeeten und Rosensträuchen, so einen unaussprechlich süßen Ruch ausströmeten. Was aber weiter geschah, weiß ich nicht zu melden, und hoffe nur, daß sich der Traum ganz erfülle und wir dereinst im himmlischen Lustgarten ewiglich zusammen sein mögen, was Gott nach diesem elenden Erdenleben uns gnädig verleihe. Amen.
*
Schon in der darauffolgenden Woche verließ Angelina Blyenbeek und trat in das Kloster der Ursulinen zu Roermond. »Jetzt geht's ins wahre Paradies!« hatte sie zu mir gesagt, als sie mir zum Abschied für ein Bildchen dankte, so ich für sie recht sauber auf Pergament gemalet hatte, und stellte dasselbe einen Strauß dar von Rosen und Ilgen, so von einem himmelblauen Bande gehalten wurden; auf der einen Seite der Schleife stand das Wort Coelum, auf der andern aber peto, wozu ich eine neue Übersetzung schrieb: »Ich bete um den Himmel.«
Nach Angelinas Abreise ist mir das Heideschloß ganz vereinsamt vorgekommen und hätte bei einem Haar ebenfalls mein Ränzchen geschnürt und zum Wanderstab gegriffen. Frau Katharina bat mich aber mit beweglichen Worten zu bleiben, und nach und nach ist meine Herzenswunde genesen, wofür ich zumeist dem himmlischen Arzte Dank sage, wiewohl Zeit und Arbeit auch zur Heilung mitgeholfen haben. In jenem Winter schnitzte und malte ich an einem Altare, anerwogen es Frau Katharinas innigster Wunsch gewesen wäre, einen Hauskaplan und damit das Glück der täglichen Messe zu gewinnen. Auch an einem großen Crucifixe schnitzete ich, welches die gnädige Frau an dem Reitweg nach Sanct Augustin aufrichten wollte, zu dankbarer Erinnerung an die Errettung aus der gemeldeten Gefahr, und daß der Wanderer etwan ein Vaterunser für die Seelen der armen Sünder bete, so alldort vielleicht doch nicht ohne Reu aus diesem Leben schieden.
Muß hier noch melden, daß man am selbigen Tage, da ich schon wundkrank im Schlosse lag, alle Bauern von Afferden aufgeboten und mit denselben die ganze Heide und den Wald abgesucht hat, ohne eine Spur von der Emerentiana zu finden, woraus die Leute geschlossen haben, es sei dies Weib eine wahrhaftige Hexe und müsse mit teuflischen Künsten durch die Luft davongeritten sein, wie sie denn auch in den Föhrenwipfeln ein absonderliches Brausen wollen gehört haben. Doch laß ich das in seinen Würden. Der Schimmel aber kam in der folgenden Nacht, man weiß nicht wie, an das Schloßthor und bat durch Wiehern um Einlaß; ging am rechten Hinterbeine lahm und war greulich mit Koth bespritzet.
Der kleine Christoffel kam jetzt in das Alter, in welchem die Kinder gar lieb und unterhaltlich sind. Da zeigte es sich, daß er einen geweckten Kopf und ein fürtreffliches Herz vom lieben Gott empfangen hatte, was seinen Eltern und vorab der Mutter über die Maßen große Freude machte. Er hat uns im selbigen Winter schon durch sein munteres Plaudern und drolliges Fragen die Zeit wunderbar verkürzet. Dieweil nun die edle Frau Katharina wohl wußte, wie viel es darauf ankömmt, daß gleich zu Anfang die Kinderherzen mit Gottesfurcht und Frömmigkeit erfüllt werden, lehrte sie ihn beten, sobald er nur lallen konnte. Wenn ich das Knäblein beim Morgen- und Abendgebet die Händchen fromm falten sah, wobei es mit den großen Kinderaugen gar ernst auf die betende Mutter blickte und deren Worte nachstammelte, sind mir oftmals beweglichere Gedanken gekommen als bei der besten Predigt, und meine ich, solche Worte aus dem Munde der lieben Unschuld seien den Engeln eine Freude und dem himmlischen Vater ein Loblied, auch wenn das Kind sie noch nicht versteht. Muß hier den einen oder andern Fürfall erwähnen, so sich in dieser Zeit zutrug und geeignet ist, sowohl Mutter als Kind besser kennen zu lernen.
So erinnere ich mich, wie sie ihm auf einen Tag die Bildnisse und Malereien im »Paradies« erklärte, und er konnte recht bald die vier Jahreszeiten und die vier Welttheile mit seinen Händchen zeigen, wenn man ihn fragte: Wo ist der Frühling? oder: Wo ist der Mohr? So zeigte sie ihm auch den Adler im mittlern Felde, der mit dem Wappenschilde gen Himmel fliegt, und deutete ihm den Spruch. Da war mein kleiner Christoffel eine Weile still und betrachtete mit seinen großen Augen die Schilderei; dann aber fragte er: »Aber Mutter, weshalb hat Meister Jan den großen Vogel mit den garstigen Klauen gemalt und nicht viel lieber den heiligen Schutzengel? Der kann auch fliegen und weiß den Weg zum Himmel besser als ein Adler.« Ob welcher Rede des kleinen Knäbleins wir uns billig verwunderten.
Noch erbaulicher war ein anderer Fall, der also beschaffen ist: Einmal hatte Frau Katharina den Frater Edmund von Boksmaere, der in hiesiger Gegend die Bruderschaft vom Skapuliere einführte und gar viele Exempel und Geschichten so auferbaulichen als ergötzlichen Inhaltes zu berichten weiß, in der Predigt erzählen hören, wie der heilige Blutzeuge Leonidas seinem Knäblein Origenes, so später ein hochgelahrter Kirchenlehrer geworden, als selbiges noch in der Wiege lag, gar andächtig die Brust zu küssen pflegte. Da man nun den heiligen Gottesmann gefragt, weshalb er solches thue, habe er zur Antwort gegeben: »Dieweil das Herz seines Kindes der wahrhaftige Tempel des heiligen Geistes sei.« Solches Beispiel hatte meiner gnädigen Frau so baß gefallen, daß sie den kleinen Christoffel auf sein Herzchen zeigen lehrte, so oft man ihn fragte: »Wo wohnt der liebe Gott im kleinen Christoffel, wenn dieser brav ist?« Auch pflegte sie ihm zu einem christlichen Gedächtniß sothaner trostreicher Wahrheit das heilige Kreuzzeichen mit sonderlichem Ernste auf Stirne, Mund und Brust zu machen.
Da geschah es nun eines Tages, daß der Vater und viele Gäste auf dem Schlosse anwesend waren. So hatte die Mutter nur wenig Zeit, mit dem kleinen Christoffel das Abendgebet zu verrichten. Sie überwies ihn also der Anna, daß sie ihn zur Ruhe bringe, und sagte ihm, er solle sein Gebetchen allein beten, anerwogen sie bei den Gästen sein müsse. Der kleine Christoffel sagte also vor seinem Bettchen knieend mit gefalteten Händen alle Gebetlein her, welche er wußte; dann legte er sich nieder und wollte einschlafen. Es fiel ihm aber ein, daß ihm die Mutter das heilige Kreuzzeichen noch nicht gemacht habe; da stand er sofort auf und trippelte barfuß in seinem Nachtkleidchen die Treppe hinab, die Mutter zu suchen.
Selbige saß inmitten ihrer Gäste, so sich baß verwunderten, das Knäblein also im Saale zu erblicken. Christoffel ging aber ruhig auf die Mutter zu, zupfte sie am Kleide und sagte: »Wohnt der liebe Gott nicht mehr in meinem Herzen, daß du mich nicht mit dem heiligen Kreuze bezeichnet? Was habe ich Böses gethan, daß er fortgegangen ist?« – Da hob ihn die Mutter auf den Schoß, küßte ihn und sagte: »Er ist nicht fortgegangen, Kind. Bleibe nur immer so brav, und er wird niemals aus deiner Seele weichen.« Griff alsbald nach dem Weihbrunnen und machte ihm gar andächtig das heilige Kreuz, worauf das Knäblein gänzlich getröstet nach seiner Schlafkammer ging. Kannst dir denken, daß der Herr Arnold fragte, was seines Söhnchens Worte bedeuten; Frau Katharina erklärte also in aller Einfalt zur größten Erbauung der Gäste, was Frater Edmund geprediget habe und wie sie durch sothanes Kreuz das liebe Kind erinnern wolle, daß es sein Herz als Gottes Wohnung hüten müsse.
Aber Herr Arnold war mit der großen Frömmigkeit seiner Frau, welche ihm für eine adelige Dame schier unpassend und übertrieben erschien, nicht ganz einverstanden. Habe solches noch deutlicher bemerket, als ich etliche Tage später auf Wunsch und in Gegenwart seiner Frau ihm den Grund- und Aufriß einer Schloßkapelle vorgelegt habe, sintemal er nichts davon wissen wollte und sich mit den bösen Zeiten entschuldigete, sagend, sein Beutel vertrage jetzo keinen neuen Bau und annoch viel weniger die Bestallung eines Schloßpfaffen. Da half es wenig, daß meine gnädige Frau gar beweglich von dem großen Glücke einer täglichen heiligen Messe redete, und wie solches einen Segen auf das Haus herabzöge.
Mein Herr Arnold blieb bei seiner Meinung und entgegnete halb im Scherze, halb im Ernste: »Es ist gut, daß Angelina ins Kloster ging, anerwogen sie dich ansonst noch zur halben Nonne gemacht hätte. Nur nicht gar so fromm, liebe Katharina, und daß du mir meinen Christoffel nicht zu einem Betbruder erziehest! Er ist unser einziges Kind und unseres edeln Geschlechtes Stammhalter, und soll als solcher also erzogen werden, daß er als Krieger oder Staatsmann dem Namen der Schenk von Nydeggen Ehre mache.«
Darauf erwiderte die edle Frau Katharina: »Nimm dich in acht, Arnold, daß der liebe Gott, dem unser Knabe doch zuerst gehört, nicht etwan das Kartenhaus von stolzen Plänen, so du auf unser Kind zu bauen scheinest, über Nacht elendiglich über den Haufen blase! Denke an den Wahlspruch der Schenk und an die schöne Auslegung, so mein Vater bei Christoffels erstem Wiegenfeste von sothanem Spruche gab!«
Da ist mein Herr Arnold schier ärgerlich geworden, hat etwas gebrummt, daß die Weiber immer das letzte Wort haben müßten, und hat schließlich gesagt: »Er soll ja auch für den Himmel sein, wie wir alle. Aber zunächst doch hoffentlich eine gute Reihe von Jahren für diese Erde.«
Die edle Frau Katharina aber verbesserte solche Rede mit dem Bemerken: » Auf dieser Erde willst du sagen, nicht für diese Erde!«
Werde sothanes Gespräch zeitlebens nicht vergessen, anerwogen es mir später gar bedeutsam schien.
Nun muß aber niemand meinen, der Junker Christoffel sei als ein kleiner Augenverdreher und Duckmäuser erzogen worden, indem nicht leicht ein Mensch mehr derlei Vögel verabscheute als Frau Katharina, so von Natur frohen Sinnes und heiterer Gemüthsart war. Der Knabe spielte gar fröhlich im Garten und auf dem Schloßhofe, streifte bald mit der Mutter, bald mit mir oder dem alten Kurt durch die Wälder und über die Heide, haschte nach Schmetterlingen und goldglänzenden Käfern, freute sich an den vielen Singvögeln in den Büschen und an den Fischlein im Blyenbache.
Als er größer wurde, regete sich frühzeitig das Jägerblut in ihm, bezeigte eine große Freude an den Rehen, so in zahlreichen Rudeln auf den nahen Waldwiesen äseten, und lernte sie auch über die Maßen geschickt unter dem Winde beschleichen. Auch spürte er den Nestern der grauen Seemöven nach, so in großen Scharen in den ausgedehnten Sümpfen zwischen dem Schlosse und der Maas nisten; lauschte auf den Schrei der Kiebitze und suchte deren Eier, welche der Großvater liebte. Die Sumpfschnepfen, die Regenpfeifer, die wilden Enten, die Holztauben, die Feldhühner und fast alle Sumpf- und Waldvögel kannte der Knabe, bevor er sechs Jahre alt war, und wußte ihre Standorte und Zeiten. Das lernte er alles von dem alten Kurt, der ihn zu einem rechten Jäger erziehen wollte. Auch im Schießen übte sich der Knabe fleißig, zuerst mit dem flandrischen Bogen, dann mit der Armbrust, so ich ihm verfertiget hatte und wozu ich kaum Pfeile genug schnitzen konnte. Bald fehlte nur selten mehr ein Schuß das Schwarze der Scheibe, und seine Geschicklichkeit freute den Vater so sehr, daß er ihm ein kleines Handfeuerrohr versprach, sobald er sein siebentes Jahr erreicht habe.
Damals war Herr Arnold fleißiger auf Blyenbeek, dieweil Geldernland sich nach dem Frieden von Ryswijk einer vierjährigen Ruhe erfreute. Der Herr Vater unterwies meinen lieben Junker also selbst im Reiten, wozu der Großvater ihm einen schönen milchweißen Pony verehrt hatte. Kaum konnte sich der kleine Christoffel von dem lieben Thiere trennen, das also zahm und gesellig war, daß es auf seinen Ruf froh wiehernd herbeilief, auch ihm das Futter aus der Hand fraß. Kannst dir denken, daß Christoffel jetzo für sein Leben gern ritt und den Vater auf seinem Pony durch Hag und Heide begleitete. Herr Arnold lehrte ihn auch im Galopp vorbeisprengend mit dem kleinen Säbel nach dem Türkenkopfe hauen, so ich für meinen Liebling geschnitzet und mit bunten Farben bemalt hatte.
Konnte ihm auch nicht genug von Kriegszügen und Heldenthaten vermelden! Wenn er an Regentagen bei mir neben der Schnitzbank saß, mußte ich ihm von Cyrus und Alexander, von Hannibal und Cäsar, von Karl dem Großen und Roland, von den Kreuzrittern und Saracenen erzählen, wohingegen auch er mit leuchtenden Augen mir berichtete, was sein Vater und seine Mutter ihm von dem Ahnherrn Christian erzählt hatten, der als Schenk der Grafen von Jülich ins Heilige Land gezogen war, und von den Herzögen von Brabant, von denen die Schenk herstammen sollen, wie ja auch ihr Wappen dasjenige der Herzöge von Brabant ist. Noch von vielen andern Rittern und Herren aus seinem Geschlechte wußte er frühzeitig Bescheid und wie sie zu Aachen bei der Krönung der Kaiser tournirten und Ehre und Ruhm gewannen. Nur von dem Kriegsobersten Martin Schenk mochte er nichts hören, obschon der alte Kurt von seinem Großvater, so als Reuter unter jenem gedienet hatte und bei einem Haar mit selbigem in der Waal bei Nymwegen ertrunken wäre, gar viel von den tollen Streichen und großem Kriegsruhm desselben zu berichten wußte.
»Die Mutter hat mir gesagt, das sei ein böser, böser Mann gewesen,« pflegte mein lieber Junker zu sagen. »Es grauset mir vor ihm, wenn ich sein Bild anschaue. Und weißt du was?« sagte er leise, »die Anna hat mir erzählt, er habe keine Ruhe und müsse todt in den dunkeln Winternächten, wenn es stürmt und schneit, über die Heide reiten mit seinen wüsten Kriegsgesellen, so ihm Kirchen und Klöster niederbrennen halfen. Sie selbst hat ihn schon gehört. Dreimal reitet er rund um den Schloßgraben und will hinein; aber sein Gaul scheut vor dem Kreuze auf dem Schloßthor und trägt ihn durch die Lüfte über den Kiefernwald weg, allwo er sich endlich dort drüben jenseits der Dünen laut wehklagend in die großen Sümpfe hineinstürzet.«
Gar wenig zufrieden war mein Christoffel mit den kurzen und einsilbigen Berichten, welche er aus dem Vater über dessen Erlebnisse im Türkenkriege durch viele Fragen herauspreßte. Da erzählte ihm schon mehr der Grates, der als Reitknecht mit Herrn Arnold nach der Donau gezogen war. Bei dem zählten die eigenhändig gespaltenen Türkenköpfe schon nach Tausenden. Einmal sollen sogar, wie dieser Kriegsheld männiglich, so es glauben will, berichtet, drei türkische Batterien zwei Stunden lang auf ihn allein geschossen haben, wobei ihm die Kettenkugeln und Bomben nur so wie im Sommer die Blyenbeeker Mücken um die Ohren herumflogen. Solche Heldenthaten erschienen aber selbst meinem kleinen Junker unglaublich, befragte also seinen Herren Vater darüber und erhielt von selbigem die Antwort: »Merke dir, mein Kind: die Helden, welche bei den Erzählungen ihrer Abenteuer den Mund am weitesten aufreißen, reißen gemeiniglich auch vor dem Feinde am weitesten aus! Du aber mußt mir ein Held nicht in Worten, sondern in Thaten werden!«
»Das will ich, Vater!« redete dagegen gar eifrig mein lieber Christoffel. »Ach, wenn ich nur schon groß wäre! Und was meinst du wohl, daß ich dann thun soll? Soll ich gegen die Türken ziehen, wie du? Dem Türkenkopf haue ich jetzt jedesmal übers Ohr, wenn ich auch noch so blitzschnell vorübersprenge. Oder soll ich gegen die Franzosen fechten, welche da oben am Rhein mit Sengen und Brennen schier greulicher gehauset als die ungläubigen Türken, wie mir der Kurt erzählet? Oder soll ich mit Tante Angelina übers Meer fahren zu den wilden Indianern in Neufrankreich, von denen mir die Mutter gar viel vermeldete, und die christlichen Huronen gegen die bösen Irokesen vertheidigen, welche schier so grausam sind als die leidigen Teufel?«
»Ich denke, du wirst nicht so weit in den Krieg ziehen müssen,« redete mein Herr Marquis dagegen; »anerwogen es wohl den Schein gewinnt, daß wir gar bald hier in unserem Gelderland wieder Kriegslärm haben werden.«
Da rief der Christoffel: »Hurrah! Dann darf ich mit dir ziehen, gelt, Vater? Sitze ja fest im Sattel und treffe mit dem Pfeil den Vogel im Fluge. Weiß auch ein schönes gelderisches Kriegsliedchen, das mich der Kurt gelehrt hat. Höre nur!« Und er sang mit glockenheller Stimme:
»Klein ist mein Gut,
Groß ist mein Muth,
Und das Schwert in der Hand,
Das ist das Wappen von Gelderland!
Hurrah, Hurrah!
Das Schwert in der Hand,
Das ist das Wappen von Gelderland!«
»Schon gut, mein kleiner Kriegsheld,« sagte Herr Arnold. »Wie alt bist du denn eigentlich?«
Christoffel antwortete: »O, bald sieben Jahre!«
Worauf der Herr Vater meinte: »Nun, dann ist es hohe Zeit, daß du den Krieg mit den Buchstaben eröffnest. Diesen Winter soll dir die Mutter das Lesen und Meister Jan das Schreiben beibringen, und wenn ich das nächste Mal gen Roermond reite, will ich mit dem Pater Rector des Jesuitencollegii reden, daß du alldort die Schule besuchen kannst.«
Da zog mein Junker schier einen schiefen Mund und meinete: »O weh, mit den Buchstaben kriegen! So fürchte ich, solches werde viel langweiliger sein als ein Zug gegen den Großtürk oder die Indianer.«
Als die Heide abgeblüht war und die ersten rauhen Nebeltage kamen, wurde sothaner Buchstabenkrieg wirklich eröffnet. Christoffel zeigte auch hierbei ein über die Maßen rasches und glückliches Talent, so daß er binnen wenigen Wochen alle Buchstaben des deutschen und lateinischen Alphabets auf seine Schiefertafel malen erlernte. Als der Tag des heiligen Manns Sanct Nikolaus herankam, schrieb er ihm den ersten Brief, wobei ich ein weniges nachgeholfen, was ich mit nichten abläugne, und bat in selbigem Brief, er solle ihm ein schönes, nicht gar zu schweres Feuerrohr bringen, eines mit den neuen Feuersteinschlössern, und eine Jagdtasche voll Rosinen und Printen und Marzipan.
Der gute Christoffel war in selbigem Winter fast beständig in meiner Werkstätte. Wenn er nicht auf seine Schiefertafel schrieb, so schaute er mir bei der Arbeit zu; denn auch für die Kunst zeigte er eine gar seltene Anlage, daß ich mich des öftern baß verwunderte ob der drolligen Figuren, so er bald mit dem Griffel zeichnete, bald aus dem Thone formte. War nämlich dazumalen mit einer Arbeit beschäftigt, welche dem »Paradies« die letzte Zier und Vollendung geben sollte. Der neue Kamin mit der Schlange um das Fußgestell der Diana war schon längst fertig und aufgestellt. Nun wollte aber das mit schönen Weinranken und Engeln verzierte Fries desselbigen nicht recht zu den wuchtigen Eichenbalken passen, so die Frucht- und Blumenkörbchen der vier Karyatiden viel zu schwer belasteten. Hatte also dem Herrn Arnold vorgeredet, er möge mich die dicken Balken abschrägen und das Hauptfries mit breitem Blattwerk und zierlichen Figuren ausschmücken lassen, was er gerne zufrieden war.
Zu solchem Werke formte ich in Lehm das Modell, und dabei half mir der kleine Christoffel mehr als dem Vater lieb. Er nannte mir die Thiere, so den Jahreszeiten entsprechen, und ich bildete dieselben in das üppige Blattwerk hinein: Kaninchen, Hasen, Reiher, Rohrdommeln. Die Hauptarbeit fiel aber auf Herbst und Winter, anerwogen da eine ganze Hirschjagd und Sauhatze in das Blattwerk hineingeschnitzet werden sollte. Zu der Hirschjagd beschrieb mir Christoffel selbst den Plan also: er mußte auf seinem Pony sitzen und mit erhobenem Jagdspieß einen Vierzehnender verfolgen, so der Teckel zwar von vorn ankläffte, der Nero aber von hinten ansprang. Konnte ihm den Nero nicht groß, den Pony aber nicht klein genug formen, und so fiel der Rüe schier größer aus als das Roß. Sothane Gruppe machte dem Vater und der Mutter so großen Spaß, daß ich den Auftrag erhielt, Christoffels Hirschjagd etwas zu verbessern, im übrigen aber gerade so in das Fries hineinzuschnitzen. Und so wird mein guter Christoffel auf seinem winzigen Pony im »Paradies« sitzen, solange das Schloß Blyenbeek stehen bleibt.
Solche Schnitzerei wurde bis Sanct Nikolausen Tag fertig. Und da haben wir noch einmal ein schönes Fest im »Paradies« mit Lust und Freuden begangen. Herr Arnold und Frau Katharina feierten den Jahrestag ihrer Vermählung, wozu auch der alte Herr Erbmarschall vom Schloß Haag herübergekommen war und die Geschenke mitgebracht hatte, um welche der Brief Christoffels den heiligen Mann gebeten. Sie lagen gar zierlich geordnet auf einem Tische unter dem Adler mit dem Schenkenwappen und Wahlspruch – ein ganzer Jagdanzug, gelbe Stulpstiefel, ein Pulverhörnchen aus Elfenbein, das mit einer kunstreichen Klappe versehen war, welche bei jedem Drucke just für einen Schuß von dem gefährlichen Kraute durchließ; ein Jägerhut mit grünen Bändern und wallenden Federn; eine Waidtasche voll kostbarer Zuckerhasen, Hirschen, Sauen, Rebhühner, Fasanen und allem möglichen Gethiere, und endlich die kleine Büchse mit dem blanken Lauf, dem neuesten Steinschloß und dem zierlich geschnitzten Kolben.
Kann sich männiglich denken, welchen Jubel mein Christoffel erhob, als er zwischen Großvater und Mutter vor den Tisch mit den Geschenken trat. Gleich mußte die Jagdkleidung angelegt und die Büchse probirt werden. Ich weiß nicht, wie es kam; aber als ich die Büchse das erste Mal knallen hörte, gab es mir einen Stoß ins Herz hinein. Doch vertrieb das muntere Lachen Christoffels die schlimme Ahnung, und das Fest war über die Maßen fröhlich. Auch der alte Herr Erbmarschall war lange nicht so ernst wie bei dem ersten Wiegenfest und brachte einen recht muntern Trinkspruch aus auf die ewige Fortdauer des Blyenbeeker Paradieses.
Du lieber Gott, das hatte nun seine schönen Tage bald alle gesehen!
*
Als man nach Christi gnadenreicher Geburt 1700 Jahre zählete, brachen zugleich mit dem neuen Jahrhundert gar schwere Zeiten über Geldernland, ja über die ganze liebe Christenheit herein. Karl der Andere von Hispanien war kinderlos gestorben, und so entbrannte der entsetzliche Krieg um sein Erbe zwischen dem Hause Bourbon und dem Hause Habsburg, der zur Stunde annoch dauert und von dem man nicht sagen kann, wie viel Blut er noch kosten oder wie viel Elend er noch bringen werde. Es hatte nämlich der sterbende König sein Testament und letzten Willen also verändert, daß er den Philipp von Anjou zum Erben seiner Kron und aller hispanischen Länder einsetzete, wiewohl frühere Verträge solches ihm verboten hatten. Und war Karl II. kaum zu seinen Vätern versammelt, so haben sie zu Madrid in Wahrheit auch schon den Philipp zum König gekrönt, ehebevor die Herren in Wien, so allezeit etwas langsam sind, solches verhindern konnten. Auch unser Gelderland mußte den Bourbonen huldigen, und hat Ludwig XIV. solches allsobald für seinen Enkel ohne Federlesens mit starker Truppenmacht besetzet. Kannst dir denken, daß sothaner Wandel weder dem Erbmarschall noch meinem Herrn Arnold, so allezeit für das Haus Habsburg eingestanden, sonderlich angenehm gewesen. Aber sie mußten sich fügen und ritten nach Roermond zur Huldigung.
Auch ich begleitete sie dorthin, anerwogen ich dem Pater Rector des Jesuitencollegii Bericht erstatten sollte über den kleinen Christoffel und von demselben vernehmen, was ich ihm des weitern noch beibringen müsse, damit er im darauffolgenden Jahre in die untere Grammatika eintreten könne. So kam ich nach Roermond zur Huldigung, welche auf offenem Marktplatze am 19. Hornung 1702 stattfand. Sie hatten dazu an der Vorderseite des Rathhauses eine mit rothem Tuche zierlich verbrämte Empore angebracht. Unter einem Thronhimmel hing das Bildniß des Königs und dessen Wappenschild mit der Umschrift: Philippus rex Hispaniae inauguratur dux Sicambriae, und zu beiden Seiten prangte das gelderische Wappen mit dem Verse:
Concordis animis sit Geldria laeta monarcha.
Du grundgütiger Himmel! Ja wohl, »einmüthigen Sinnes« und eine »fröhliche Herrin«! Und im Hintergrunde konnte man ohne sonderliche Prophetengabe die Kriegsfackel brennen sehen, während das rothe Tuch, womit alles drapiret war, mich an die Ströme von Blut gemahnte, so in Italien allbereits zu fließen begannen.
In solchen Gedanken stand ich am Fenster des gegenüberliegenden Weinhauses zur güldenen Lilie und sah der Huldigungsfeier zu. Die beiden ersten Adeligen, so auf die Empore traten und in die Hand des Grafen von Horn dem neuen Könige Treue gelobeten, waren der Erbmarschall und dessen Schwiegersohn, mein lieber Herr Arnold. Als sie sich wendeten und selbander die Treppe hinabstiegen, hörte ich ein Weib, so hinter mich getreten war, einen greulichen Fluch in französischer Sprache ausstoßen, und dieweil ich mit heftigem Erschrecken ihre Stimme zu erkennen vermeinete, schaute ich mich um und sah mich Auge in Auge mit der unseligen Emerentiana Dausque.
Habe sie auf den ersten Blick erkannt, so sehr auch die letzten Jahre und mehr noch ein wüstes Leben sie entstellt hatten, anerwogen sie sich jetzt offenbar auch dem Trunke ergeben, wie ihr aufgedunsenes Gesicht, ihre von wimperlosen, schweren Lidern halb verdeckten trüben Augen laut bezeugten. Jedennoch konnte man in der stolzen Gestalt noch etwelche Spuren früherer Schönheit nicht gänzlich verkennen; auch hatte sie sich gar bunt und frech gekleidet, dieweil sie, wie ich nachher hörte, nunmehr als eine Art Marketenderin mit einem französischen Sergeanten umherzog und mit den Besatzungstruppen Ludwigs XIV. nach Gelderland zurückgekommen war.
Kann sich männiglich denken, daß ich mich voll Zorn und Ekel von dem Weib abwenden wollte, was aber schon zu spät war, maßen sie mich allbereits erkannt hatte und laut lachend flugs mit den Worten anredete: »Siehe da, mein Wouverman von Blyenbeek! Wie geht's im ›Paradiese‹ zwischen den hölzernen Jahreszeiten und den gemalten Blumenkränzen und Fruchtstücken? Wie, nicht einmal einer Antwort würdigt mich der Herr? O wie unhöflich diese Deutschen sind; es ist gut, daß unser großer König sich dieses Landes erbarmet, um unter seinem Scepter dessen Bewohnern etwas mehr Schliff beizubringen. Grüße wird mir der Herr in Blyenbeek doch bestellen? Sintemal ich offen gestehe, daß die Sehnsucht, dem ›Paradiese‹ wieder einmal einen Besuch abzustatten, mich bewogen hat, den französischen Fahnen in das Land Geldern zu folgen.«
Verließ die Weinstube so rasch als mir bei dem großen Gedränge möglich, und überlegte, was ich zu Nutz und Frommen meiner lieben Herrschaft etwan thun könne. Wohl kam mir der Gedanke, das Schandweib einthürmen zu lassen; aber unter was für einem Vorwande? War freilich für meine Person völlig überzeugt, daß die Landstreicherin, so vor vier Jahren meinen lieben Christoffel rauben wollte, keine andere sei als eben diese unselige Emerentiana Dausque. Aber Beweise hatte ich nicht, anerwogen ich nicht einmal mit einem körperlichen Eide hätte betheuern können, daß ich in der verschleierten Hexe mit voller Sicherheit die gegenwärtige Dausque erkannt habe. Auch war es kein leichtes Stück, ein französisches Soldatenweib unter sothanen Umständen festzunehmen.
Wie ich so in Gedanken über die Straße ging, begegnete ich meinem alten Matthias, den ich nur wenige Male mehr gesehen hatte, seit er Verwalter von dem nahe bei Roermond belegenen Hillenrath geworden. Erzählte ihm natürlich von dem Zusammentreffen mit der leidigen Emerentiana und wie dieselbe auf ein neues Blyenbeek mit irgend einem teuflischen Plane bedrohe. Redeten also über die Sache hin und her. Matthias wollte nichts von einer Verhaftung wissen, fragte mich aber genau, wo und wie ich sie gesehen habe, wie sie gekleidet sei und dergleichen, woraus ich schloß, er wolle sie aufsuchen und etwan durch ein Stück Geld beschwichtigen, was ich ihm widerrieth und ihn warnete, sich in keinerlei böse Händel einzulassen.
»Laßt mich nur sorgen,« sagte er; »wenn es geht, wie ich plane, so soll ihr kein Haar gekrümmt werden, und wir werden doch der ewigen Furcht vor diesem Unglücksweibe ledig.«
Hatte leider keine Zeit, mit dem wackern Manne länger über die Sache zu reden, maßen just die Stunde schlug, da mich mein gnädiger Herr an die Klosterpforten der Ursulinen entboten. Gab also dem alten Matthias die Hand, ihn abermalen bittend, er möge sich ja in keine schlimmen Händel mit der französischen Soldatesca einlassen, und eilte zu den Ursulinen. Dort sah ich nicht ohne Herzklopfen hinter dem Gitter des Sprechsaals Angelina, welche jetzt im Kloster Mutter Maria von den heiligen Engeln heißt. Habe nie ein lebendes Antlitz gesehen, welches den Engelbildern des Predigerbruders Fra Angelo mehr ähnlich sah als ihr Angesicht, dessen Huld und Anmuth durch den Klosterschleier nur gewonnen hatte. Habe nachher oft versucht, es zu malen, ist mir aber nie gelungen. Sie redete fast nur mit ihrem Bruder und sagte kaum ein paar Worte zu mir, aber mit solcher Liebe, daß ich voll himmlischen Trostes mit Herrn Arnold aus Roermond schied und gen Blyenbeek ritt.
Es kamen jetzt gar traurige und stürmische Tage. Anfang Mai (1702) erklärten die Verbündeten den Franzosen den Krieg. Der Marschall Boufflers, so unter dem Herzoge von Bourgogne das französische Heer befehligte, lagerte mit einer großen Heeresmacht, sage mit vierundfünfzig Bataillonen und einhundertvier Schwadronen, bei Xanten, während die Armee der Generalstaaten unter dem Grafen Athlone bei Cleve stand, keine vier Stunden von Blyenbeek. Kannst dir denken, daß wir auf unserem Schloß, welches Herr Arnold gegen die umherziehenden Banden zur Vertheidigung eingerichtet, gar unruhige Stunden verlebten. Bald zogen sich die Holländer vor den überlegenen Franzosen auf Nymwegen zurück. So wurde die zum Schlosse gehörige Herrschaft Afferden der Reihe nach von beiden Armeen überschwemmt. Am schlimmsten erging es den armen Leuten, als die Franzosen vor dem berühmten Engländer Marlborough, welcher das Commando der Verbündeten übernommen hatte, in aller Eile längs der Maas auf Venlo und Roermond abmarschirten. Da standen wir eines Abends droben im Schloßthurme und schauten mit Thränen in den Augen nach Afferden, wo der Reihe nach fast sämtliche einzeln stehende Höfe in Flammen aufgingen. Die ganze Nacht hindurch war der Himmel vom Brande geröthet.
»Die armen Leute!« klagte die edle Frau Katharina.
»Wir wollen ihnen die Häuser wieder aufbauen, Mutter,« sagte der gute Junker Christoffel. »Aber, Papa, weshalb thun uns das die bösen Franzosen, welche doch behaupten, daß sie unsere Freunde seien und im Auftrage des neuen Königs von Hispanien kämpfen?«
»Sie wollen den Holländern und Preußen eine Wüste hinterlassen,« antwortete Herr Arnold seinem Sohne.
»Das Brennen,« sagte Grates, der just mit einer Botschaft die Treppe heraufkam, »soll namentlich von einem Sergeanten und einer Marketenderin herrühren, welche laut verkündeten, sie wollten dem Herren von Blyenbeek seine Herrlichkeit verderben. Eben kommt ein Bauer gelaufen und sagt, die beiden seien mit einer Mordbande unterwegs nach dem Schlosse, um auch dieses einzuäschern.«
Liefen also spornstreichs die Treppen hinab. Der Bote war der Vater des Trikes, ein gar treuer Mann, doch sonst nicht der Flinkste; dasselbige Mal aber war er gelaufen wie ein Has, daß er mit Staub und Schweiß bedeckt im Schloßhofe stand. Er berichtete von der erschrecklichen Wuth der Franzosen, welche das ganze Dorf plünderten, ja den Leuten die Kleider vom Leibe rissen.
»Und es ist eine Bande nach dem Schlosse unterwegs?« fragte der Herr Arnold.
»Ja, ein Sergeant und sein Weib mit einem Dutzend seiner Leute, den Schlimmsten von allen. Die Mordbrenner haben mir das Haus über meinem Kopfe angezündet und den Trikes gezwungen, sie nach Blyenbeek zu führen. Mein Bub hat sie aber, wie ich ihm bedeutet, rechts ab in die Sümpfe geleitet, derweil ich Zeit fand, vorauszulaufen und Euch zu warnen.«
»Eine Marketenderin, sagt Ihr? Wie sieht sie aus, jung oder alt?« fragte Herr Arnold.
»Nicht jung, aber groß und stark. Ich meine, daß ich sie Tok oder Dogge habe anreden hören.«
Auf solche Worte erbleichte mein Herr Arnold merklich, sammelte sich aber allsobald, gab dem Bauer einen Brabanter Thaler für seinen treuen Dienst und befahl, daß die Schloßbrücke aufgezogen und das Thor verrammelt werde, alle Knechte und Bedienten aber sich waffneten. »Sie sollen uns nicht so leichten Kaufes den feurigen Hahn aufs Dach stecken,« sagte er, und der kleine Christoffel rief: »Hurrah! ich hole meine Büchse!«
Wachten also die ganze Nacht. Aber wiewohl im Westen und Süden zahllose Brandstätten den Himmel erleuchteten, auch von der Maas her fernes Schießen gehört wurde, so dämmerte der frühe Sommermorgen doch herauf, ohne daß sich ein Feind vor dem Schlosse gezeiget hätte. So schickte der Herr Marquis Kundschafter nach Afferden, und diese brachten bald die Meldung, die Franzosen seien während der Dunkelheit in der Richtung auf Venlo abmarschirt, und jenseits der Maas ständen bereits Truppen der Generalstaaten.
Der grundgütige Gott hatte also sothane Gefahr gnädiglich abgewendet, und ich gab mich der Hoffnung hin, die Emerentiana Dausque sei ein für allemal mitsamt den Franzosen aus dem Lande gejagt, anerwogen der Marschall Marlborough den Boufflers zusamt seinem Herzog von Bourgogne wie die Hasen vor sich her trieb. Venlo, Stevenswerth, Roermond wurden der Reihe nach genommen, und nur mehr die beiden starken Festungen Rheinberg und Geldern waren in der Gewalt des französischen Heeres. Afferden war übrigens nicht die einzige Herrschaft, welche unserem Herren verheert wurde; auch Asselt theilte dasselbe Los, und das Dorf Swalmen, so zur Herrschaft Hillenrath gehöret, wurde am 28. Juli gänzlich niedergebrannt, und sollen sich, wie ich nachher hörte, auch dort ein Sergeant und ein Soldatenweib unter den Mordbrennern ingrimmig hervorgethan haben.
Kann sich männiglich denken, daß sothane Einbußen eine gar empfindliche Heimsuchung für meinen lieben Herrn Arnold waren, anerwogen sie nicht nur einen großen Theil seines Vermögens vernichteten, sondern auch seine Hörigen an den Bettelstab brachten, daß sie auf viele Jahre nicht im stande waren, ihre Zehnten und Zinsen zu entrichten. Dazu kamen schier unerschwingliche Kriegscontributionen, so mein Herr zuerst an die Franzosen, dann an die Generalstaaten und schließlich an die Preußen entrichten mußte. Auch seine öffentliche Stellung und politische Thätigkeit hatte der Krieg vernichtet, so daß es nicht zu verwundern, wenn der edle Herr gar ernst und von Kummer gebeugt umherging, als das grausame Kriegsjahr sich zu Ende neigte. Aber die treue Gemahlin tröstete ihn mildreich mit solchen und ähnlichen Worten: »Und wenn wir noch mehr irdisches Gut verlören, würde ich keine Thräne darum weinen. Nur die Noth und das Elend der armen Leute, welche von uns Hilfe erwarten, thut mir bitterlich weh. Daß du den leidigen Sorgen des Staatsraths für etliche Zeit enthoben bist, sehe ich eigentlich nicht ungern, anerwogen du also etwelche Muße findest, bei uns zu bleiben. Bist ja auf Blyenbeek in den letzten Jahren schier ein Fremdling geworden! Und schau, den größten Schatz auf Erden, so unser Paradies hienieden ausmacht, hat uns der grundgütige Gott annoch gelassen, verstehe unsere treue Liebe und unser liebes Kind.«
Da fassete mein Herr Arnold die edle Frau Katharina bei der Hand und sagte, derweil ihm das Wasser in die Augen schoß: »Ja, ich wüßte nicht, was ich thäte, wenn uns der Christoffel entrissen würde! Du hast recht, Frau; wir wollen den Muth nicht sinken lassen und gegen Gott nicht undankbar sein, der uns in dem Knaben ein also großes Gut anvertraut hat.«
Der Winter, welcher jetzt mit starkem Frost und heftigem Schneefall hereinbrach, steigerte Noth und Elend unter den armen Leuten über die Maßen. Da ließ die gnädige Frau alles Korn, so man auftreiben konnte, zu Brod backen und versetzte sogar ihr Geschmeide und edles Gestein beim Juden Joël, um also Nahrung, wärmende Decken und Arzneien für die vielen Kranken und Schwachen zu beschaffen. Herr Arnold hatte ihr früher eine wunderherrliche Kommode zum Namensfeste geschenkt, so entweder der berühmte Charles Boule in Paris selbst gefertigt hat, oder die doch wenigstens mit großer Kunst nach seiner Manier gemacht wurde. Die ganze Vorderseite ist mit vergüldetem Silberblech und Schildpatt so bedeckt, daß bald das kunstreich gravirte Metall, bald das Schildpatt abwechselnd das eine die Zeichnung, das andere aber den Hintergrund der überaus zierlichen Renaissancemuster bildet. Dazu kommen getriebene Knäufe und Knöpfe und sowohl an den geschwungenen Thierfüßen als oben zur Krönung so schönes Schnitzwerk in kostbarem Holz, daß sich meine Arbeit dagegen nicht darf sehen lassen.
Da ließ mich nun in jenem bittern Winter Frau Katharina auf einen Tag in ihre Kammer rufen, wo sothaner Prachtschrank stand, und fragte mich, ob man das Gold- und Silberblech nicht aus der schönen Boule-Arbeit der Kommode herauslösen könne. Ich schlug die Hände über dem Kopfe zusammen und sagte, sie werde mich nie dazu bringen, das herrliche Kunstwerk zu zerstören. »Wir werden es später wieder einsetzen,« sagte sie; »der Jude Joël wird mir hundert Brabanter Gulden darauf vorstrecken, womit wir leicht ein paar arme Leute vor dem Hungertode retten können. Wenn Ihr mir nicht helfen wollt, so werde ich selbst die Metallstücke herauslösen.« Wirklich begann sie mit einem Messer vor meinen Augen ein Stück des schön gravirten Metallbeschlages abzubiegen und machte mit der ausgleitenden Klinge einen Kritz über die schöne Zeichnung. Nahm ihr also in Gottes Namen das Messer aus der Hand und begann die winzigen Schrauben loszudrehen, welche das Metall am Holze festhielten.
In währender Zeit machte mein Junker Christoffel in selbigem Winter und dem darauffolgenden Frühjahr im Lesen, Schreiben und Rechnen so gute Fortschritte, daß es eine Freude war, seine Schreibhefte zu sehen. Auch sein gutes Herz erschloß sich immer schöner wie eine Blume im lieblichen Lenze. Davon können die Armen und Kranken von Afferden und in den einsamen Heidehütten, zu denen er die Mutter begleitete, ein Liedlein singen. Wenn er dann von solchen fast täglichen Besuchen heimkehrte und mir von der Freude und Dankbarkeit der armen Leute erzählete, dann leuchteten seine Augen vor heiliger Lust.
So verging Frühjahr und Sommer des Jahres 1703. Die Preußen belagerten unter dem Grafen von Lottum mit großer Macht die Festung Geldern, welche von dem Spanier Don Domingo de Betis auf das tapferste vertheidigt wurde, während das ganze übrige Gelderland im Besitze der Verbündeten war. Blyenbeek wurde noch immer von Streifpartien der Preußen und Holländer heimgesucht, so Lebensmittel und Pferdefutter für die Belagerer herbeiholten und die Bauern dermaßen zu Schanzarbeiten zwangen, daß sie kaum an eine Aussaat denken konnten. Solches mag den Marquis mitbestimmt haben, den guten Junker Christoffel nun wirklich nach Roermond zu den Jesuiten zu senden, allwo er in größerer Ruhe und Sicherheit die für einen Edelmann geziemende Schule und Bildung gewinnen könne. Er wäre auch selber gerne nach Hillenrath übergesiedelt; aber seine Gemahlin war nicht zu vermögen, die armen Leute um Blyenbeek in gegenwärtiger Noth hilflos zu verlassen, und wollte lieber, wiewohl schweren Herzens, in eine Trennung von ihrem lieben Kinde einwilligen.
Damit die gute Frau Katharina ihren Sohn nicht ganz aus den Augen verliere, malte ich den Christoffel in Lebensgröße mit dem Federhute auf dem Kopfe und der Steinschloßbüchse in der Hand, und ich muß sagen, daß der Kopf des Knaben mir so gut gelang, wie vielleicht noch kein Portrait. Die blauen Augen schauen einen gar mild und freundlich an, und die blonden Locken, so leicht gekräuselt auf die Schultern hinabfallen, umrahmen ein engelgleiches Gesicht, aus dem die liebe Unschuld und Herzensgüte hervorschauet, derweil der frische Mund ein freundliches und fröhliches Wort zu reden scheinet. Das Beiwerk hatte ich keine Zeit mehr fertig zu bringen, und war solches nur untermalet, als der Abschiedstag herankam. Doch machte das Bild der Mutter eine große Freude, und es war gewiß eine besondere göttliche Fügung, anerwogen ich den lieben Knaben später nicht mehr so hätte malen können.
Zu Anfang des Herbstmonats machte ich mich mit dem Junker und dem Marquis auf den Weg nach Roermond. Im »Paradiese« war vorher ein kleines Fest, doch ohne allen Pomp, gefeiert worden. Die Mutter zeigte dem Knaben noch einmal den Wappenspruch, küßte ihn mit Thränen in den Augen und bezeichnete ihn mit dem Zeichen des heiligen Kreuzes auf der Stirne.
»Mache es mir auch auf Mund und Brust, Mutter, wie du es thatest, da ich noch klein war,« bat Christoffel. »Oder glaubst du vielleicht, der liebe Gott wohne nicht mehr in meinem Herzen?«
»Doch, mein Kind, das glaube ich zuversichtlich; denn du bist immer fromm und brav und gehorsam gewesen und hast den Armen Gutes gethan, weil sie Christi Brüder sind!« Und so griff sie nach dem Weihbrunnen und machte dem Knaben gar feierlich das heilige Kreuzzeichen zugleich mit Freude und Schmerz, daß ich mich der Zähren nicht erwehren konnte.
Dann ritten wir fort. Die gnädige Frau gab uns das Geleite bis zur Maasfähre in Afferden, und als das Schiff um die nächste Biegung des Flusses steuerte, sah Christoffel noch einmal seine Mutter am Ufer stehen und mit dem Tuche winken. Da schwenkte er seinen Federhut, rief mit lauter Stimme: »Ade, Mutter!« und wischte sich heimlich mit dem Tüchlein über die Augen.
Die Reise, so wir der hin- und herziehenden Truppen wegen ganz auf der Maas zurücklegten, verlief ohne Unfall. Auf Sanct Moritzen Tag langten wir in Roermond an und gingen gleich zu den Jesuiten, wo Christoffel nicht nur durch seine Kenntnisse im Schreiben, Lesen und Rechnen, sondern ebensosehr durch sein holdseliges, bescheidenes und dennoch kindlich frohes Wesen den ehrwürdigen Pater Rector und alle andern Patres für sich gewann, so daß sie ihn mit Freuden in die Grammatika aufnahmen. Pater Rector fragte ihn auch noch besonders über seine Kenntnisse in der christlichen Religion, und da er den Canisius, den ihm die Mutter selbst erläutert, ganz am Schnürchen hatte, schenkte er ihm ein schönes, auf Pergament gemaltes Bild der lieben Mutter Gottes und seines Namenspatrons, des hl. Christophorus, was den Knaben über die Maßen freute.
Da das Schuljahr erst nach vierzehn Tagen beginnen sollte, hatten wir in dem nahen Schlosse Hillenrath noch ein weniges Ferienzeit. Der gnädige Herr blieb mehrere Tage bei uns; denn er wollte die Güter und Höfe und Wälder besichtigen, so durch den Krieg grausam verheeret worden, um zu sehen, wo und wie zu helfen sei. Auch seine Schwester Angelina besuchte er mit dem Knaben in ihrem Klösterchen, während ich bei einer andern Gelegenheit dort vorzusprechen gedachte. Der liebe Junker kam voll Freude nach Hillenrath zurück und hatte die Taschen voll süßes Gebäck, brachte auch mir einen schönen Gruß und einen zierlichen Rosenkranz aus Olivenkernen, so aus dem Oelgarten Gethsemani von einem frommen Pilger gebracht worden sind. Weiß nicht, ob die heilige Seele etwan eine Ahnung gehabt, daß die Zeit des bittern Leidens auch für mich jetzt gar bald anheben werde.
Auf den 20. Herbstmonat ritt Herr Arnold von Hillenrath fort, um seinem Schwiegervater, so gichtkrank auf seinem Schlosse Hoensbroech, nicht weit vom Flecken Heerlen, daniederlag, einen Besuch abzustatten und von dort nach Blyenbeek heimzukehren. Der Herr Erbmarschall hatte nämlich das Schloß Haag den Preußen räumen müssen, welche Geldern belagerten. Als Herr Arnold fortritt, band er mir und dem Matthias die Sorge für den lieben Christoffel auf die Seele.
»Ich habe in diesen zwei Jahren durch die traurigen Kriegsläufte mehr als die Hälfte meiner Habe verloren,« sagte er; »doch achte ich dieses wenig, wenn nur dem Knaben kein Unheil widerfährt. Wüßte nicht, wie ich ein solches ertragen könnte.«
So sagten wir ihm, er solle ruhig sein, dieweil wir den lieben Junker wie unsern Augapfel hüten wollten. Der Knabe aber rief ihm zu, als er schon über die Schloßbrücke trabte: »Grüß mir lieb Mütterchen und sag ihr, ich werde schön brav und fleißig sein und jeden Morgen und Abend beten, wie sie es mich gelehret hat!«
*
Wir wollen ihn wie unsern Augapfel hüten!«
Weiß Gott, daß ich es ehrlich meinte, und auch der alte Matthias hat gewiß nur das Beste beabsichtigt, wenn er nur nicht die Sucht gehabt hätte, seine Pläne zu verheimlichen und mit allem hinter dem Berge zu halten. Hätte ich nämlich geahnt, wer mit uns unter demselben Dache weile, so wäre ich keine Stunde mit dem lieben Christoffel in Hillenrath geblieben oder hätte wenigstens ganz andere Vorsichtsmaßregeln getroffen. Muß freilich zu seiner Entschuldigung anführen, daß ich vor Jahr und Tag sein Vertrauen wenig verdiente, als ich durch meine Thorheit die Emerentiana in das Blyenbeeker Paradies eingeführt habe. Aber dem Herrn Arnold hätte er sein Unterfangen doch offenbaren sollen.
Summa: Er hatte dieselbige Emerentiana Dausque heimlich eingefangen und im Schlosse Hillenrath eingethürmt. Schon damals bei der Huldigung in Roermond hatte er diesen Plan gefaßt und beinahe ausgeführt. Es wäre ihm auch nicht so schwer geworden, das trunkene Weibsbild mit Hilfe von zwei vertrauten Bauern auf einem Wägelchen nach Hillenrath zu bringen, wenn dieselben nicht die Franzosen gefürchtet hätten, so die Stadtthore von Roermond besetzt hielten. Mußte sie also damals mit ihrem Sergeanten ziehen lassen. Als aber die Franzosen auf dem Rückmarsch sengend und brennend die Maas aufwärts zogen und das Dorf Swalmen anzündeten, so zur Herrschaft Hillenrath gehört, erkannte einer von jenen Bauern das Marketenderweib, das der alte Matthias in Roermond gerne dingfest gemacht hätte. Es gelang ihm, selbiges in einen Hinterhalt zu locken und in der darauffolgenden Nacht, während die Franzosen sich eilig vor den anrückenden Preußen zurückzogen, unbemerkt nach Hillenrath zu schaffen, wo der alte Matthias, so derweilen von dem Fang benachrichtigt worden, sie ganz heimlich in Empfang nahm und sonder Federlesens in ein festes Gelaß einthürmte.
Mein Matthias dachte dabei, auf solche Art dieser Unholdin ein für allemal ledig zu werden, maßen er schon dafür sorgen wolle, daß sie nie mehr entwische. Hat sie also auf eigene Faust zu lebenslänglichem Kerker verurtheilt und meinte damit gegen die Emerentiana gar mildiglich zu verfahren, anerwogen selbe von Rechts wegen Galgen und Rad oder aber den Scheiterhaufen verdient hätte. Item, er strich seinen grauen Bart, als er den Schlüssel ihres Kerkers hinter der Gefangenen abdrehte, und sagte: »Nach dir soll kein Hahn mehr krähen! Deine Rachepläne sind jetzo begraben, und dein Name wird vor keinem Gerichte zur Schande meines gnädigen Herrn mehr genannt werden.«
In solcher Weise lag also die Emerentiana schon länger als ein Jahr zu Hillenrath in dermaßen strengem Gewahrsam, daß selbst das Hausgesinde nichts um sie wußte. Der alte Matthias selber brachte ihr heimlich Wasser und Brod, und alles schien nach Wunsch zu gehen, anerwogen in Wahrheit kein Hahn nach ihr krähte und sie lebendig begraben schien. Aber leider Gottes hatte der gute Mann, der nur als getreuer Diener zu handeln vermeinte, gerade durch sothane eigenmächtige That die blutdürstige Wölfin mit dem unschuldigen Lämmlein zusammengebracht, was ihm der Barmherzige gnädiglich verzeihen möge!
Doch will ich mit nichten alle Schuld auf ihn wälzen, anerwogen auch ich die Augen besser hätte brauchen müssen, nun aber in Gottes Namen das traurige Ereigniß erzählen, wie es nach dem Rathschlusse der ewigen Weisheit sich zugetragen hat. Ach, daß ich solches Elend erleben mußte!
Es war der 28. Herbstmonat anno Domini 1703 – werde den Tag nicht vergessen und wenn ich hundert Jahre alt würde. Mein alter Matthias hatte mir am Vorabende gesagt, er müsse in aller Frühe mit dem Jäger Ruprecht einen Gang in den Wald bei Vlodrop machen, hoffe aber vor Abend wieder in Hillenrath zu sein, wir sollten uns recht erlustigen, und könne der liebe Junker mit mir oder einem der Knechte den Strich im Swalmener Busch abgehen, allwo der Jäger Dohnen für die Krammetsvögel gestellt habe; sie seien schon tüchtig am Ziehen, und möchten wir leicht einen Korb voll zum Abendessen nach Hause bringen. Auch füllte er das elfenbeinerne Pulverhörnlein Christoffels mit frischem Kraut, daß er etwan einen Schuß auf eine Kette von Rebhühnern thun könne, die gerade in selbigem Herbste unmäßig zahlreich waren. Summa: Sollten uns den wonnigen Herbsttag in Wald und Feld recht zu nutze machen, da jetzt bald die Zeit komme, wo der liebe Junker in die Schulstuben eingesperrt würde, maßen es nur mehr wenige Tage bis zu Sanct Lucas des Zwölfboten Fest sei, von dem es im Spruche heiße: »Lucas macht den Buben die Augen naß,« dieweil an ihm die Schulen anfangen.
Ach, Lieber, ein viel näherer Tag sollte uns die Augen naß machen!
Der Unglückstag brach so schön und freundlich an, als ob er nur Liebes und Gutes bringen wollte. Da wir in der Frühe nach Swalmen zur heiligen Messe gingen, funkelte die Sonne so fröhlich am blauen Himmel, daß ein Buchfink sich ganz im Kalender verthat und sein munteres Frühlingsliedlein vom Aste herab schmetterte. Meinen Christoffel aber drückte eine böse Ahnung. Er redete mir von den großen Greuelthaten und den schweren Freveln, so der Kriegsoberst Schenk gegen Kirchen und Klöster begangen habe, und wie ihm die Mutter einst gesagt, derlei Thaten würden oft an späten Enkeln noch gerächt.
»Wie kommst du an einem also schönen Morgen auf dermaßen schwarze Gedanken?« fragte ich ihn. »Schau doch, wie fröhlich der Wald gelb und roth und braun in der Sonne steht!«
»Ja, er ist immer am schönsten, bevor er sein Laub fallen läßt,« erwiderte er. »Aber du hast recht; es ist heute ein gar liebliches Wetter. Du gehst doch nachher mit mir in den Dohnenstrich? Ich habe die Büchse schon geladen und hoffe entweder ein Rebhuhn oder ein Häschen zu erlegen. – Weshalb ich auf den alten Kriegsobersten Martin Schenk komme, fragest du? Ich habe heute Nacht von ihm geträumt und ganz sonderbar. Es schien mir, ich sei in Blyenbeek und stehe auf der Spitze der Sanddünen, von der aus man auf das Schloß herabblickt und weit über die Heide nach dem großen Cleverwalde und der Maas und ringsum die vierundzwanzig Kirchthürme sehen kann. Und da war auf einmal aller Sonnenschein weg, derweilen ich in Nacht und dunkeln Nebelwolken auf der einsamen Höhe stand. So fürchtete ich mich baß und rief der Mutter und deinen Namen, daß ihr mir helfen möchtet; aber niemand von euch hörte mich. Da kam es auf einmal von den Sümpfen her mit Gebraus und Geheul durch die Luft geritten; ich wollte fliehen und konnte nicht. Es war der alte Martin Schenk, gerade so, wie er zu Hause in der Halle gemalt hängt, mit dem gelben Lederkoller und den großen Stulphandschuhen, und seine Feldbinde flog im Nebel. Er schaute mich aus dem bleichen Gesicht so ingrimmig an, daß ich seinen Blick wie einen Stich im Herzen spürte. Und auf einmal hatte er meine Büchse in seiner Hand und zielte auf mich und drückte los, und obschon die Kugel sonderbarerweise ganz langsam geflogen kam, konnte ich auch nicht ein Haar breit zur Seite weichen, und ich fühlte, wie das heiße Blei mir Zoll für Zoll durch den Leib ging. Dann erst krachte der Schuß; der böse Schenk aber verschwand in die Lüfte. Was dann im Traume folgte, dessen kann ich mich nicht entsinnen. Aber schließlich schien es mir, ich liege in meinem Bettchen zwischen Rosen und Heideblumen im Paradieszimmer, und wenn ich die Augen aufschlug, sah ich über mir an der Decke nicht den Adler mit dem Wappen, so du gemalt hast, sondern einen viel schönern, wunderherrlichen Vogel mit rothen und blauen und violetten und purpurnen, goldschillernden Fittichen, wie ich noch keinen gesehen habe, und durch die Zimmerdecke schaute der Himmel wirklich herein, nicht nur gemalt, und neben mir stand die Mutter und sang: Coelum peto! Darüber bin ich aufgewacht und hörte draußen die Morgenlerche singen. – Sieh, lieber Meister Thyssen, dieser absonderliche Traum, so mir annoch durch den Kopf geht, hat mir etwas den fröhlichen Morgen verderbt. Er wird doch nichts zu bedeuten haben?«
»Was sollte er bedeuten, lieber Christoffel? Dein Blut war etwas erhitzt, und da ist dir im Schlafe vorgekommen, was die Anna von dem Martin Schenk gefabelt hat, so nicht einmal dein rechter Vorfahr ist. Daß du aber oftmals und sogar im Traume an das Coelum peto denkest, welches dir die Mutter ans Herz legte, ist recht gut. Nur muß es dich stets gemahnen, dein Herz rein zu bewahren, daß du jeden Tag zur Himmelfahrt bereit seiest.«
»Ja, du hast recht, und das hat mir auch der Pater Edmund gesagt, bei dem ich neulich meine erste Beicht gemacht habe; maßen man nie wissen kann, ob man den Abend erlebt, und er hat mir von einem Knaben in meinem Alter erzählt, so plötzlich, in währendem fröhlichem Spiel, zu Boden fiel und eines jähen Todes verschied.«
Nach einer Weile fügte Christoffel bei: »Wenn ich jetzt sterben müßte, thäte mir nur eines leid, daß ich den Vater nicht bat, meinen Pony zu verkaufen und das Geld der Mutter zu geben, damit sie den armen Leuten dafür Brod kaufe. Der heilige Schutzengel hat mir letztes Frühjahr einmal diesen Gedanken eingegeben; aber ich habe selbigen aus dem Kopfe geschlagen, anerwogen mir der Pony zu lieb war, und das war recht bös von mir. Morgen will ich dem Vater schreiben, daß er den Pony verkaufe.«
Unter solchen Gesprächen hatten wir die Kirche erreicht, und da gerade kein Altarknabe zugegen, diente der Junker Christoffel dem Priester die heilige Messe. Sehe ihn noch vor mir mit dem goldlockigen Engelskopfe, wie er so andächtig betete und tiefgebeugt zur heiligen Wandlung schellte. Es beschlich mich dabei ein eigenthümliches Gefühl, als ob der Knabe für diese böse Welt viel zu gut, für den Himmel aber reif sei. Auch sein Traum wollte mir nicht aus dem Kopfe, und ich erinnerte mich an einen ähnlichen, so ich früher einmal gehabt hatte, in dem der alte Kriegsoberst und die Emerentiana Dausque dem kleinen Christoffel ein Leids zufügen wollten. Ob all dieser Gedanken war ich, was mir Gott verzeihe, bei der ganzen Messe so zerstreut, daß ich meinen Rosenkranz nicht einmal zur Hälfte fertig brachte.
Nach der Messe gingen wir zusammen mit dem frommen Pfarrherren, so ein gar gelahrter und kunstsinniger Mann ist, aber leider bei dem Brande von Swalmen nicht nur seine Bücher, sondern, was schier bedauerlicher, eine erlesene Sammlung von Kupfern verloren hat, ins Schloß zurück, allwo wir miteinander das Frühstück einnahmen. Derweilen sind wir zwei in ein Gespräch über die Kunst und insonderheit über die Malerei gekommen; dauerte auch nicht lang, so waren wir mit nichten einerlei Meinung über die niederländischen Maler, auf welche er schlecht zu sprechen, wohingegen er die alten Kölner Meister nicht genug herausstreichen konnte. Da ich nun aber die Niederländer, bei welchen ich in die Schule gegangen, hitzig vertheidigte, sind wir in einen so heftigen als langen Disput gerathen.
Solches behagte dem lieben Christoffel gar wenig, anerwogen er nach den Krammetsvögeln sehen wollte. Holte also seine Büchse herbei und fragte mich, ob er etwan allein in den Swalmener Busch gehen dürfe. Das habe ich ihm zwar nicht verstattet, sagte vielmehr, ich käme; schritten also hinter dem Knaben, der etliche Schritte voraufging, durch den Garten, blieben aber, was mir der barmherzige Gott verzeihen möge, unter der großen Linde noch einmal stehen und verführten über den Rubens ein solches Geschrei, daß sowohl der Gärtner als etliche Mägde, so unsern Wortstreit gewahrten, halb verwundert und halb geärgert die Köpfe zusammensteckten. Weiß nicht, wie lange sothaner Disput gedauert, war leider Gottes also darin gänzlich vertiefet, daß ich nicht bemerkte, wie der herzliebe Christoffel, dem die Zeit zu lang geworden, mit seiner Büchse in den kaum hundert Schritt entfernten Buchenbusch gegangen, meinen Augen aber, so ihn hätten behüten sollen, entschwunden war.
Da auf einmal wurde sothaner friedlicher Kunststreit gräßlich unterbrochen. Ein Schuß krachte in dem nahen Wäldchen; ein Weheruf ertönte. Der Gärtner stürmte an uns vorbei, den Bäumen zu, indem er mir zurief: »Ich fürchte, es ist dem Junker, so ich vor einiger Zeit mit seiner Büchse da hinein gehen sah, etwan ein Unheil zugestoßen.«
Kann sich männiglich denken, daß ich dem Gärtner nachlief, so rasch mich meine Füße trugen. Ach, du lieber Himmel! Wir brauchten nicht weit zu gehen. Da im grünen Moose unter einer Eiche lag der liebe Knabe bewußtlos wimmernd in seinem Blute. Neben ihm stand mit wild verzerrtem Gesichte ein Weib, so ich auf den ersten Blick erkannte, trotzdem ihre Haare im Kerker ergraut waren. Es war die unselige Dausque.
»Haltet sie, greift sie, die Mörderin!« rief ich dem Gärtner zu.
Aber das Weib stieß den alten Mann von sich und rief: »Sorgt um Euern Paradiesvogel, Meister Maler, und lästert nicht, bevor Ihr untersucht habt. Wie Ihr leicht sehen könnt, ist ihm die Büchse geplatzt; er wird sie überladen haben. Den Alten gönne ich es und Euch nicht minder!«
So rief die Furie und entsprang in die Büsche, ehebevor wir sie fassen konnten. Du lieber Himmel, wir hatten anderes zu thun als ihr nachzulaufen! Da lag der gute Christoffel und wimmerte und stöhnte, daß es einen Stein hätte erbarmen mögen. Meinte zuerst, es sei etwan nur die rechte Hand, so elendiglich zerrissen war. Als ich aber niederkniete, gewahrte ich auch rothes Blut zwischen seinen gelben Haaren hervorquellen, und da ich ihm die blutigen Locken aus der Stirne strich, sah ich oberhalb der Schläfe eine klaffende Wunde, in welcher annoch ein Splitter des Büchsenlaufes steckte. Erkannte also auf den ersten Blick, daß mein lieber Christoffel, so das Bewußtsein gänzlich verloren hatte, gar gefährlich verwundet sei. Ich suchte den Splitter zu entfernen, das strömende Blut zu stillen; ich rief nach Wasser, nach Binden. Schon eilten mehrere Mägde und Knechte herbei, die alle laut klagten und jammerten. Hoben ihn also sanft auf und trugen ihn zum Schloß zurück. Sofort sprengte ein Reitknecht nach Roermond hinein, um den Doctor zu rufen.
In währender Zeit fuhr ich fort, die Kopfwunde mit nassen Tüchern zu kühlen, was auch eine so gute Wirkung hatte, daß der liebe Knabe endlich nicht nur die Augen aufschlug, sondern sogar mich erkannte. Hat mir auch mit schmerzlich zuckenden Lippen, so er zu einem Lächeln zwingen wollte, die linke Hand gereicht und geflüstert: »Verzeihe –«, dann sah er sich um, und da er den Pfarrherren von Swalmen erblickte, dem er am Morgen die heilige Messe gedient hatte, winkte er ihn an seine Seite.
Wir zogen uns einige Augenblicke zurück; dann trat der geistliche Herr mit Thränen in den Augen zu uns heraus und sagte: »Ich fürchte, der liebe Engel stirbt uns; so will ich ihm den Heiland zur heiligen Wegzehrung holen.«
Als ich wieder an das Bett des Verwundeten trat, lag er mit geschlossenen Augen da; nur die bleichen Lippen bewegten sich in halblautem Gebete. Ich kniete nieder und betete unter heißen Thränen mit ihm. Nach einer Weile hielt er inne und sagte: »Guter Meister Thyssen, bring mich rasch, rasch nach Blyenbeek! O die Mutter, die Mutter! Und du mußt dem Vater sagen, daß ich kein Körnchen Pulver mehr in die Büchse that, als er mir erlaubte. Das Weib, so mich im Busche traf und nach meinem Namen fragte, muß etwas an der Büchse verderbt haben, und ich fügte ihm doch niemals ein Leides zu!«
»Die Mordbrennerin, man wird sie einfangen und rädern lassen!« sagte ich außer mir vor Schmerz.
Da hob der Knabe mühsam das Haupt ein wenig und sagte: »Nicht meinetwegen! Ich verzeihe ihr. Wir wollen ein Ave Maria für sie beten.« Und er hob mit schwacher Stimme an und betete das »Gegrüßet seist du, Maria«, und die Worte: »In der Stunde unseres Todes. Amen« sagte er zweimal, das zweite Mal ganz leise, und die Augenlider fielen ihm wieder zu.
In währender Zeit kam der Doctor und untersuchte die Wunden. An der Hand mußte er eine Ader unterbinden, was dem Knaben so große Schmerzen machte, daß er abermals die Besinnung verlor. Als dann der Arzt die Kopfwunde untersuchte, zuckte er bedeutsam mit den Achseln und sagte leise zu uns: »Da ist wenig Hoffnung! Auf die Nacht wird ein hitzig Fieber kommen; anerwogen die Hirnhaut verletzet ist und so sich die Entzündung, wie schier sicher, den tiefer liegenden Geweben mittheilet, wird solches leider zum Tode führen.«
Fragte ihn, ob ich den Knaben noch lebend zu Schiffe nach Afferden bringen könne. Solches bejahte er und war gänzlich der Meinung, die Flußfahrt werde sogar zur Beruhigung des Kranken beitragen, der in seinem Fieberwahne voraussichtlich heftig nach der Mutter verlangen werde. Gab also gleich Befehl, ein leichtes Maasschiff mit guten Rudern und allem Nöthigen für diese traurige Fahrt auszurüsten.
Langsam erwachte der Knabe, dem der Doctor etliche Tropfen eines gar kräftigen Wässerleins einträufelte, aus seiner Ohnmacht, als der Priester mit dem lieben Heilande kam. O da ist von allen, so den guten Christoffel sahen, kein Auge trocken geblieben; selbst der Doctor, der ansonst ein harter Mann scheint, hat heimlich mit der Hand über sein Gesicht gewischt, und es war ein Schluchzen und Jammern, daß man kaum den Gebeten des Priesters folgen konnte. Nur der Kranke war ruhig und lächelte holdselig, als er Jesum Christum zum ersten- und letztenmal in sein Herz aufnahm.
»Jetzt ist alles gut,« sagte er dann; »jetzt tröstet nur Vater und Mutter,« und als ich ihm bemerkte: »Morgen werden wir in Blyenbeek sein,« drückte er mir die Hand und flüsterte: »Fort, fort, zur Mutter, zur lieben Mutter!« Dann sank er müde zurück und schloß die Augen.
Auf eine Bahre gebettet trugen wir den Knaben am Nachmittage zur Maas hinab und legten ihn sanft auf weiche Polster in den Kahn hinein. Dann begann die Fahrt flußabwärts. Die Strömung faßte das leichte Fahrzeug und trug es leicht schaukelnd rasch Venlo zu, als hätte der Fluß Mitleid mit dem schlummernden Kranken. Die Thürme der Stadt und Festung zeigten sich bald am goldenen Abendhimmel. Ich schickte eine Botschaft nach dem Annunciatenkloster Trans-Cedron, das mein gnädiger Herr noch unlängst mit einer reichen Stiftung bedacht hatte, daß sie sowohl des Knaben als seiner Eltern in ihrem Gebete gedächten. Dann ging die Fahrt weiter. Die Nacht brach ein. Der Kranke wurde unruhiger. Er kannte mich nicht mehr, und ich hatte alle Mühe, ihn auf seinem Lager festzuhalten, dieweil er sich in seinen Fieberphantasien bald von dem geharnischten Martin Schenk, bald von einem Weibe verfolgt sah. Dann rief er: »Da ist sie wieder! Da hat sie meine Büchse in der Hand und stopft etwas in den Lauf und legt sie mir wieder auf der Rasenbank zurecht.«
Durch Fragen erfuhr ich sogar von dem im Fieberwahne redenden Knaben, wie das Unglück geschehen. Habe es mir wenigstens also zusammengereimt: die Dausque war in selbiger Nacht, wie mir nachher der alte Matthias gestand, aus ihrem Kerker ausgebrochen; es fand sich nämlich, daß sie in monatelanger Arbeit wohl zwanzig Ziegelsteine aus der Mauer gebröckelt hatte, und halte ich das Loch für groß genug, daß sie durch selbiges entweichen konnte, wiewohl andere der Meinung sind, der leidige Satan habe sie befreit, um durch sie das liebe Gottesbäumchen, verstehe meinen Junker, also elendiglich zu knicken. Summa: Das Weib hat sich nahe am Schloß im Gebüsch verkrochen, entweder um die folgende Nacht zur Flucht zu brauchen oder, was mir wahrscheinlicher, um an dem Matthias eine rechte Rache zu üben. Und da mußte denn mein lieber Christoffel dem Drachen in den Weg laufen. Sie wird ihn gleich erkannt haben und fragte zur Vorsicht auch nach seinem Namen. Dann wird sie ihm nachgeschlichen sein, und als der Knabe an der Rasenbank, wo er mich erwarten wollte, die Büchse auf einige Augenblicke unbewacht gelassen, mag sie auf irgend eine Weise, etwan durch Hineinstopfen von Rasen in den Gewehrlauf, das Unheil veranlaßt haben. Was später aus der Dausque geworden ist, habe ich nie mit Sicherheit erfahren; nur daß der Ruprecht aussagte, der Teufel habe ihr den Hals umgedreht, anerwogen er nach etlichen Wochen ein greulich entstelltes todtes Weibsbild im Swalmener Busch gefunden habe, das wohl dieselbige Dausque gewesen sein mag. Doch lasse ich solches in seinen Würden.
Wir nun fuhren derweilen die Maas hinab und hörten schon seit Venlo die Kanonade der Preußen vor Geldern, anerwogen der Graf von Lottum gerade damals durch den Obersten Schlund die Stadt und Festung furchtbar beschießen ließ. Als wir nun näher kamen und bei Arcen, nur etwan zwei Stunden von Geldern, anlangten, sahen wir den ganzen Himmel über der Festung in Gluthen und konnten die feurigen Bogen wohl unterscheiden, so die Bomben und Brandkugeln beschrieben. Auch der gute Christoffel bemerkte das schreckliche Donnern der Kanonen, und wurde in seinen Phantasien in eine Schlacht versetzt. Da warf er sich ruhelos auf seinem Lager hin und her. »Meister Thyssen, Meister Thyssen,« rief er, »hilf mir doch! Siehst du denn nicht, wie der böse Martin Schenk immer auf mich zielt und immer auf mich schießen will? So nimm ihm doch die Büchse! Ha, jetzt drückt er los, und langsam, langsam kommt die Kugel und bohrt sich in mein Gehirn hinein – o wie das brennt!«
Gegen Morgen wurde Christoffel ruhiger. Als wir an Well vorbeifuhren, läutete es zur Frühmesse. Da betete er halblaut seine Gebetchen, daß die Knechte unwillkürlich die Ruder beiseite legten und mitbeteten, wobei mehr als einer sich mit der rauhen Hand über die Augen fuhr. Von Bergen aus, wo wir eine kurze Weile rasteten, schickte ich einen Eilboten nach Blyenbeek mit der Trauerkunde dessen, was geschehen war, und mit der Bitte, rasch eine gute Bahre nach Afferden zu bringen. Hatte das alles während der Nacht mit vielen Seufzern und Zähren, so mir auf das Papier niederrannen, auf einen Zettel geschrieben, und ist mir all mein Leben niemalen ein Brief so sauer geworden wie jene wenigen Zeilen. Es wollte mir schier das Herz abdrücken, wenn ich des Jammers der Eltern bei sothaner Zeitung gedachte; war auch mehr als einmal schier entschlossen, auf und davon zu gehen, anerwogen ich kaum den Muth fand, mit dem sterbenden einzigen Kinde, so ich wie meinen Augapfel zu hüten versprochen hatte, vor meinen gnädigen Herren und die liebe Frau Katharina hinzutreten. O daß doch viel tausendmal lieber der bittere Tod mich getroffen! Es hat mich aber die Liebe bei meinem todtwunden Christoffel festgehalten, und habe ich mir selbst die Qual, so mir die Begegnung mit dessen Eltern sein mußte, als eine geringe Sühne auferlegt für meine Nachlässigkeit, so dieses Elend mitverschuldet. Als ich dachte, der Bote werde das Schloß erreicht haben, fuhren wir langsam weiter und vollbrachten mit schwerem Herzen das letzte Stück der Flußfahrt. Brauchten auch an der Fähre von Afferden nicht lange zu warten, bis die Leute von Blyenbeek kamen – allen voran der gnädige Herr Arnold und die arme edle Frau Katharina.
Ach Lieber, den Jammer, so ich jetzt erlebte, will und kann ich nicht beschreiben! Der Herr Marquis wollte zuerst gar nicht glauben, daß es so schlimm sei; als er aber aus den irren Worten des Knaben, welcher ihn nicht einmal kannte, den gefährlichen Zustand entnahm, wurde er sprachlos vor Schmerz. Die Mutter hatte sich niedergekniet und flüsterte dem Kinde alle Schmeichelworte zu, so Liebe und Schmerz ersinnen können. Und es war, als ob die Stimme der Mutter den wandernden Geist des Knaben auf Augenblicke zurückriefe, da er bei ihrem Klange nicht nur die Augen aufschlug, sondern auch gar traulich sagte: »Mutter!« Und dann flüsterte er, wieder in seinem Fiebertraum untersinkend: »Siehst du den wunderschönen Vogel? O verscheuche ihn nicht! Er fliegt immer näher und näher! Schau, wie seine güldenen Federn in der Sonne glitzern! Meister Thyssen, du mußt ihn malen, wenn der Vater die neue Kapelle in Blyenbeek baut, um welche ihn die Mutter gebeten hat.« Dann legte er den Finger der linken Hand auf die Lippen und sagte: »Stille, stille! Da ist er ganz nahe. Mutter, er setzt sich auf deine Schulter und singt so süß und lieblich. Hörst du ihn denn nicht? Er singt: Coelum peto! coelum peto! – Zum Himmel! zum Himmel! Ja, ich komme, ich komme: Vater, Mutter, Meister Thyssen, lebet wohl. Ade, ade!«
Solches waren die letzten Worte, so ich von den Lippen des lieben Knaben hörte. Er sank auf sein Lager zurück und schloß die Augen. Man bettete ihn nun auf die Tragbahre und trug ihn über die Heide, den Blyenbach entlang, ins Schloß. Auf dem ganzen Wege begleiteten uns die jammernden und weinenden Leute von Afferden, denen der holde Knabe mit seiner Mutter so manches Gute erwiesen hatte.
Da ist mir klar geworden, daß der liebe Gott nicht lohnt, wie Menschen lohnen, so nur eine kurze Spanne Zeit auf dieser Erde weilen, sondern wie es sich für den Ewigen geziemt. Nach menschlichem Maße hätte der Knabe wie dessen Eltern ein langes Leben und viel Glück und Segen auf dieser Erde verdient. Der Herr aber, in dessen Augen alles irdische Glück nur eine eitel schimmernde Seifenblase ist, nahm ihn in den Tagen der Unschuld zu sich, um selbst sein ewiger Lohn zu sein.
Am Abende verschied der Knabe, und wir bahrten ihn gar schön und lieblich im »Paradies« auf, gerade unter dem Adler mit dem Wappen und dem Spruche Coelum peto, wie er es im Traume vorhergeschaut. Die Standbilder der vier Jahreszeiten und die Wände des Saales waren mit schwarzem Tuch verhüllt. Aber mitten zwischen den düstern Farben des sonst so fröhlichen Saales lag der Knabe, in Blumen gebettet, selbst die allerschönste, ach leider geknickte Blume, so der Stamm der Schenk von Nydeggen getrieben hat. Ihm zu Füßen stand die Wappentafel mit allen Titeln und mit sechzehn Schildern seiner Ahnfrauen, rechts und links die Wappen der Agnaten, dieselbigen, die einst so fröhlich aus den grünen Guirlanden am Schloßportale hervorschauten, als wir den kleinen Christoffel festlich empfingen. Er ruhte gar schön und holdselig auf der Bahre; die Mutter hatte ihm über die Stirnwunde die goldgelben Locken gestrählt und die letzten Herbstrosen dareingeflochten, daß ich ihn noch einmal zu malen versuchte. Aber es ging mir nicht, anerwogen meine Hand zitterte, und mein Auge so oft von Thränen verdunkelt wurde, daß mir das Bild des lieben Todten mit nichten gelingen wollte.
Also wurde der Junker Christoffel begraben, und lange dauerte es, bis der erste heftige Schmerz einer mildern Trauer wich. Die edle Fran Katharina fand zuerst in Gott Ruhe und Ergebung wieder. Viel trug ein gar lieber und trostreicher Brief Angelinas dazu bei. Auf das Anrathen der frommen Klosterjungfrau machte sie mit mir eine Wallfahrt zur Trösterin der Betrübten nach Kevelaer, allwo sie auch dieses Mal Kraft und Stärke empfing.
Da wir über die Heide heimritten, faßte ich mir ein Herz und begann sie mit heißen Thränen zu bitten, daß sie mir den Mangel an Wachsamkeit, so ich doch gelobet hatte und so den Tod des lieben Knaben mitverschuldet, um Gottes Barmherzigkeit willen nachsehe, auch bei ihrem Gemahl ein gnädiges Fürwort um Verzeihung für mich einlege. So ließ sie mich aber in ihrer Herzensgüte gar nicht zu Worten kommen, hat mich statt dessen sofort gar mildiglich getröstet und gesagt: »Solches war Gottes Wille und Fügung! Es geht eben nicht, wenn man sich auf Erden ein Paradies einrichten will. Der liebe Gott sorgt dafür, daß es zerstört wird, damit wir Menschen fühlen, wo das Thal der Thränen und wo die ewige Heimat sei.«
Frau Katharina widmete sich hinfüro noch ernster den Werken der Nächstenliebe und den Uebungen der Frömmigkeit. Dabei suchte sie den tiefen Schmerz ihres Gemahls zu lindern. Aber die Wunde wollte in seinem Herzen nie mehr ganz verharschen. Wochenlang streifte er auf der winterlichen Heide, in den abgelegensten Dickichten der Föhrenwälder umher, vorgeblich auf der Jagd, in Wahrheit aber, wie ich wohl bemerkte, um sich ungestöret dem Leidmuthe zu überlassen, so sich seiner Brust bemächtiget hatte. Als er vernahm, der Tod des lieben Knaben sei eine Rachethat der unseligen Dausque gewesen, schrieb er sich selbst die traurige Schuld zu. »All das Unheil fließt aus der vergifteten Quelle meines Jugendleichtsinnes!« meinte er, als ich ihm einmal ein Trostwort sagte.
Es dauerte lange, bis sich sein Schmerz auch nur ein geringes legte, daß ich wohl fürchtete, er werde auf ein neues in seine frühere Menschenscheu und Schwermuth zurückfallen. Aber nach und nach wird etwan, wie ich hoffe, die Liebe und Milde seiner Gemahlin den düstern Feind besiegen. Doch geht er zur Stunde noch umher wie ein Schatten an der Wand; zweifle auch, ob er jemalen den furchtbaren Schlag gänzlich überwinden werde.
»Meister Thyssen,« sagte er mir neulich, »bewahret die Wappentafel, so Ihr für den Katafalk des seligen Christoffel gemalt habt, dieweil es der liebe Gott etwan füget, daß selbige bald auch an meiner Leich aufgestellet werde. Ich bin der letzte meines Stammes; Ihr habt nur den Namen zu ändern.« Und als ich ihm derlei Gedanken ausreden und Hoffnung machen wollte, daß er wohl noch andere Leibeserben haben und der Stamm der Schenk neu erblühen werde, anerwogen sowohl er wie seine edle Gemahlin annoch in der Blüthe und Kraft der Jahre ständen, schüttelte er traurig das Haupt und sagte: »Mit mir geht's zu Ende. Im Himmel hoffe ich glücklich zu werden, hienieden nicht mehr. Das Kartenhaus, so ich hier auf Erden bauen wollte, ist mir gründlich zusammengestürzt, wie meine Frau solches vorhergesagt hat.«
Im Frühjahr ließ er, obschon es mitten in den schweren Kriegszeiten mit großen Opfern und Unkosten verbunden war, die Schloßkapelle bauen, um welche ihn seine Gemahlin einst gebeten, und von welcher der sterbende Christoffel geredet hatte. Eine große Steintafel, welche die beiden Wappen der Schenk und Hoensbroech und die Jahreszahl trägt, wurde an der Außenseite eingemauert. Zwischen beiden Wappen mahnt ein geflügelter Engelskopf an den seligen Christoffel. Die Zeichnung zu dieser Tafel habe ich entworfen; aber der unerfahrene Steinmetz hat sie in dem harten Stein gar schlecht ausgeführt. Sobald der Kalkbewurf des Gewölbes hergestellt wurde, gab ich mich daran, dasselbige al fresco zu bemalen: eine Marmorbalustrade, mit Teppichen und Fruchtguirlanden verziert, im Hintergrunde ein roth verglühender Abendhimmel, darüber klares Blau und fortziehende, schwarze, goldgeränderte Wetterwolken, aus denen liebe Engelein mit Blumen und Fruchtgewinden herniederschweben. Das alles sollte sowohl an das überstandene Leid als an die Hoffnung eines ruhigen Lebensabends und reicher himmlischer Belohnung gemahnen. Ganz in der Nähe des Altares aber malte ich auf dem Rande der Balustrade den Wundervogel, von dem der selige Christoffel in der Nacht vor dem Unglücke geträumt hatte und den er bei seinem Tode zu sehen vermeinte.
Und nachdem ich ihn so schön als möglich gemalet, warf ich Pinsel und Palette ins Feuer, griff zum Wanderstabe und verließ das liebe Heideschloß Blyenbeek und die gute edle Frau Katharina und den tiefgebeugten Herrn Arnold, welche mich mit vieler Liebe bei sich zurückhalten wollten. Als ich ihnen aber sagte, wohin es mich ziehe, und daß ich im heiligen Orden vom Berge Karmel Aufnahme gefunden, da ließen sie mich in Frieden ziehen und wünschten mir alles Glück für Zeit und Ewigkeit, und die gute Frau Katharina sagte:
»Meister Thyssen, jetzt geht Ihr ins irdische Paradies!«
»Und im himmlischen Paradiese hoffen wir uns alle wieder zu finden,« antwortete ich. »O betet, gute Frau, daß einst der Wundervogel des seligen Christoffel uns alle dorthin rufe!«
Und so schied ich von dem Schlosse Blyenbeek am Tage von Pauli Gedächtniß im Jahre des Heils 1704.
Lieber Leser, der du die Geschichte vom »Paradies« liesest, bete ein Ave Maria für den Schreiber!
*
So weit reicht die Erzählung des Meisters Thyssen. Wir haben ihr nur wenige Worte beizufügen. Der Marquis scheint sich wirklich von dem harten Schlage, welcher ihn durch den Tod seines einzigen Sohnes betroffen hatte, nicht mehr ganz erholt zu haben. Er starb zu Blyenbeek am 31. August 1709. Die Wappentafel, welche an seinem Katafalke aufgestellt war, habe ich sehr gut erhalten auf dem Söller gefunden. Ebenso die ganz ähnlich gemalte Wappentafel seiner edeln Gemahlin Katharina, geborene Gräfin Hoensbroech. Dieselbe scheint noch sehr viel Gutes auf Erden gewirkt zu haben; denn in Anerkennung ihrer Verdienste wurde sie im Jahre 1717 von der Kaiserin Eleonora Magdalena Theresia mit dem Sternkreuzorden geschmückt. Sie starb im Jahre 1736. Durch sie kam die Erbschaft der Schenk von Nydeggen, namentlich die Schlösser Blyenbeek und Hillenrath, an die Familie Hoensbroech.
Das Paradieszimmer auf Blyenbeek ist noch recht gut erhalten, namentlich die Schnitzereien am Fries mit der Hirschjagd des kleinen Christoffel und die Kaminverzierungen mit der Schlange um die Herme der Diana. Sehr frisch sind die Deckenmalereien geblieben: die Köpfe der vier Welttheile, der Adler mit dem Wappen und dem Spruchbande, ganz besonders aber die Frucht- und Blumenkränze. Es scheint fast, daß dieselben, und zwar von geschickter Hand, in diesem Jahrhunderte aufgefrischt wurden; denn die Farben sind so kräftig, daß man meinen könnte, sie seien erst vor kurzem aufgetragen. Das Mittelgemälde ist dagegen nicht mehr kenntlich und die Standbilder der vier Jahreszeiten sind entfernt worden, weil sie bei der gegenwärtigen Benützung des Saales zu viel Raum wegnahmen. Sie stehen aber wohl erhalten auf dem Söller und können zu jeder Stunde wieder aufgestellt werden, und dann würde das Paradieszimmer, mit den alten Gobelins an Stelle der neuen Papiertapeten, heute noch gerade so aussehen, wie in den Tagen, da der Junker Christoffel als Kind hineingetragen wurde, als Knabe darin spielte und im Tode unter dem Wappenadler als letzter Sprosse der Schenk von Nydeggen geruht.