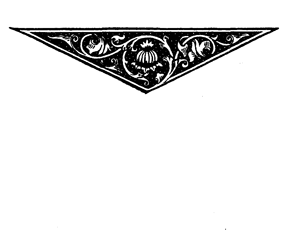|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Eine Geschichte aus dem Stockacher Narrenbuch.
(1878.)
![]()
Stockach, das freundliche Städtchen, war ehemals der Hauptort der Landgrafschaft Nellenburg und zählt noch heutigen Tages zu den vornehmem Ortschaften des badischen Seekreises. Es hat seine Merkwürdigkeiten und historischen Erinnerungen, und darunter nimmt nicht die letzte Stelle das sogenannte »Narrengericht« ein, welches daselbst seit uralter Zeit alljährlich um die Fastnacht abgehalten wird Die Notizen über Geschichte und Gebräuche des Stockacher Narrengerichtes sind einem Aufsatze über »Sitten und Gebräuche am Bodensee« entnommen, der im 5. Hefte der »Vereinsschrift für Geschichte des Bodensees« S. 147 ff. enthalten ist.. Mit diesem sonderbaren Brauch und Herkommen hat es aber folgende Bewandtniß.
Im Jahre 1315 hielt Herzog Leopold von Oesterreich auf dem Stein zu Baden mit vielen Herren und Rittern einen Kriegsrath, wie er am besten in das Land Schwyz kommen und das widerspänstige Hirtenvolk zu Paaren treiben könne. Da wurde nach vielem Hin- und Herreden beschlossen, nach dem Städtchen Zug zu ziehen, als ob man willens wäre, die Schwyzer an ihrer Grenze bei Sanct Adrian anzugreifen, statt dessen aber bei Aegeri den Feind zu umgehen und unversehens im Rücken zu fassen. So riethen und planten die Herren. Und da man scherzhafterweise Hansen Kühne (Kuony), des Herzogs Leopold Hofnarren, auch um seine Meinung fragte, gab der Schalk zur Antwort: »Euer Rath g'fallt mir nit; Ihr rathet, wie Ihr wollet in das Land Schwyz hineinkommen, und rathet nit, wie Ihr wollet wieder herauskommen.« Da lachten die Herren und Ritter, meinend, das wäre ein rechter Narrenspruch, und wenn sie nur erst im Lande drin wären, wollten sie auch schon wieder herauskommen.
Als aber der Herzog Leopold an Sanct Othmars-Tage (16. November 1315) mit seinem Heere den Paß zwischen dem Aegeri-See und dem Morgarten durchziehen wollte, griffen ihn die Eidgenossen aus einem Hinterhalte an und schlugen ihn völlig. Viele seiner Reisigen fanden unter den Morgensternen der Hirten, noch viel mehr in den Wellen des Sees ihren Tod; der Herzog selbst verdankte nur der Schnelligkeit seines Pferdes das Leben und rettete sich mit Mühe nach Winterthur. Daselbst erinnerte er sich der klugen Rede seines Hofnarren, und wie es besser gewesen wäre, man hätte auf seinen schalkhaften Rath gehört. So forderte er ihn auf, er möge sich eine Gnade erbitten. Das that Hans Kühne; er erbat sich das Privilegium, in seiner Vaterstadt Stockach eine Narrenzunft stiften und alljährlich ein Narrengericht halten zu dürfen, auf daß es seinen lieben Landsleuten nie an Männern fehle, die ihnen wenigstens einmal im Jahre ungescheut im Schalksnarrenkittel ihre Thorheiten vorhalten dürften. Und darum muß man Hansen Kühne loben; denn er kannte zweifelsohne seine Mitbürger. Herzog Leopold gewährte gerne das verlangte Privilegium, und dasselbe wurde in der Folge von dessen Bruder Herzog Albrecht dem Weisen, sowie von dem Landgrafen von Nellenburg bestätigt und verbrieft. Die Stiftungsurkunde, auch Narrenbrief genannt, datirt aus dem Jahre 1351; sie wurde feierlich in die Brunnensäule des mittlern oder Marktbrunnens zu Stockach niedergelegt.
Seither sind über 500 Jahre verflossen und manche Geschlechter der Menschen ausgestorben. Die Zeiten haben sich geändert; sie sind viel »aufgeklärter« geworden und haben mit den alten Sitten und Bräuchen gründlich aufgeräumt. Aber die von Hans Kühne gestiftete Narrenzunft besteht doch noch, und bis auf unsere Tage hat sich das grobgünstige Narrengericht von Stockach, wie es von jeher genannt ward, in Kraft und Würden erhalten. Ein Brauch freilich hat sich verloren, vermuthlich weil er mit der Zeit zu lästig wurde, nämlich alle thörichten Streiche und Geschichten, welche im Laufe des Jahres in der Umgegend vorkamen, in das Narrenbuch einzuschreiben und daraus an der Fastnacht einem ehrsamen Bürger zu Freud und Nutzen vorzulesen. Auch sind leider die alten Bände mit ihrer sonderbaren Stadt- und Landchronika abhanden gekommen; doch hat sich noch viele Stunden im Umkreise die Sage von dieser Weisheitssammlung erhalten, und so oft sich einer nach dem Dafürhalten seiner gescheiten Mitmenschen nicht ganz so klug benimmt, als es dort zu Lande sonst gang und gäbe sein soll, sagt männiglich: »Der kommt ins Stockacher Narrenbuch!«
Wir aber wollen hier eine Geschichte erzählen, welche, wie man uns glaubwürdig versichert, in einem der verlorenen Bände des Stockacher Narrenbuches wirklich zu lesen ist.
*
Es mag etwa ein halbes Dutzend Menschenalter her sein – das genaue Datum ist natürlich in dem mehrfach erwähnten Narrenbuche zu lesen –, da genas in Stockach Sibilla, die ehrsame Hausfrau des Nikodemus Kühne, eines Nachkommen des großen Erznarren Hans Kühne, ihres achten Söhnleins. Dasselbe erhielt in der Taufe den Namen Peter, und wie der kugelrunde Bube mit der Zeit in die Höhe wuchs und sich mit seinen Altersgenossen in den Gassen und Gärtchen des Städtchens umhertrieb, nannten ihn alle nur den »Narren-Peter«. Diesen Namen erhielt er aber keineswegs, weil sein Verstand nicht recht ausreichte; im Gegentheile, wenn irgendwo ein loser Streich zu ersinnen und durchzuführen war, fiel er dem kleinen Peter ganz gewiß ein. Einzig und allein um seiner glorwürdigen Abstammung von dem hochberühmten Stifter des Narrengerichtes willen, den jedes echte Stockacher Kind, wie billig, in Ehren hält, wurde er also genannt.
Nur in der Schule hatte der Junge kein Glück, und wie gerne seine Frau Mutter, der inzwischen nach ihres Nikodemus seligem Tode das Regiment des Hauses allein oblag, einen hochgelahrten Herrn aus ihm gemacht hätte, es wollte trotz aller Prügel, die der Schulmeister zur Anregung des jugendlichen Genies anwendete, herzlich wenig fruchten. Nachdem man sich also gegenseitig genug geärgert hatte, wurde der vierzehnjährige, kräftig gewachsene Bursche zu beiderseitiger Befriedigung der Schule ledig gesprochen. Aber was nun mit demselben anfangen?
Der hochweise Familienrath, den Frau Sibilla in dieser wichtigen Frage einberief, trank erst unterschiedliche Tassen Kaffee, um das richtige Verständniß in dieser Frage zu gewinnen, und schließlich einigte man sich, da es schon spät wurde und die verschiedenen Frau Basen nach Hause mußten, nach einer gewaltigen Redeschlacht dahin, daß es unter den obwaltenden Umständen das beste sei, man gebe den kleinen Peter dem alten Weidenbauer auf den Hof. Der könne ihn zu einem rechtschaffenen Bauersmann heranziehen, und wiewohl der Kleine so nicht im Städtchen verbleibe, auch wenig Aussicht habe, dereinst Kirchenpfleger oder Säckelmeister oder Rathsherr zu werden, ja gewissermaßen als Bauer einen geringern Stand einnehme denn als Städter, sei das doch um so mehr allem andern vorzuziehen, als er auf diese Weise Aussicht habe, den Weidenbauer dereinst zu beerben.
Dessen gab sich Frau Sibilla nach etlichen Seufzern und Widerreden zufrieden, und auch der kleine Peter war damit einverstanden; dem war alles recht, wenn es ihn nur von der Schulbank befreite.
Der alte Weidenbauer war ein Oheim der guten Frau Sibilla, ein steinreicher Mann, der sein gutes Stück Acker- und Wiesenland nebst Wald und Weide hatte. Doch pflegten seine Nachbarn zu sagen: »Für jeden Gulden im Beutel sitzt ihm eine Grille im Kopfe«, und meinten, es sei auch ganz gut, daß der Weidenhofer nicht geheiratet habe; denn bei dem wunderlichen Kauz hätte doch jedes Weib das Fegfeuer auf Erden gehabt. So schlimm, wie die Leute ihn machten, war nun freilich der alte Bauer nicht; doch mochte er immerhin etwas knauserig und zu Zeiten, wenn ihn das Zipperlein plagte, auch recht griesgrämig sein.
Die Bitte seiner Stockacher Nichte gewährte er gerne; denn er hätte schon lange einen Handbuben dingen sollen, und das Geld konnte er sich nun an dem kleinen Stockacher Vetter sparen. So erledigte sich die Sache zu beiderseitiger Befriedigung.
Bei dem alten Junggesellen gedieh der Narren-Peter – der Name war ihm aus der Stadt auf das Land hinaus gefolgt – ganz vortrefflich, und in den zehn Jahren, die er auf dem Weidenhofe verlebte, wuchs der Knabe zu dem schmucksten und gewandtesten Burschen auf eine Meile im Umkreise heran. Keiner verstand es wie er, die Sense zu führen, und wenn man ihn mit dem Pfluge so leicht und gewandt die schnurgeraden, ebenmäßig tiefen Furchen ziehen sah, sagten die Bauern: »Wie der Narren-Peter kann's halt keiner – es ist nur schade, daß er für den alten Grillenfänger pflügt.«
Allgemein meinten die Leute, nur die Aussicht auf die künftige Erbschaft halte den Burschen auf dem Weidenhofe bei dem Sonderling von Vetter fest. So meinten die Leute; den rechten Grund aber wußte Peter besser, und vielleicht ahnte ihn auch Verena, des Nachbars ebenso schönes als sittsames Töchterlein.
Verena war des Rainbauers einzig Kind, und da zudem sein Hof an Größe und Güte sogar dem Besitze des alten Weidenbauers um ein Erkleckliches überlegen war, durfte er unter den Burschen der Gegend bei der Wahl eines Schwiegersohnes schon etwas schwierig sein. Gleichwohl glaubte Peter sich keineswegs aller Hoffnung bar, um so weniger, da ihm das Mädchen nicht abhold schien und auch dessen Mutter den freundlichen Burschen wohl leiden konnte. Wenigstens erwiderte sie, seitdem er ihr einmal auf der Heimfahrt vom Ueberlinger Markte das scheue Pferd gezügelt hatte, jedesmal ganz leutselig seinen Gruß, und das that die reiche Rainbäuerin nicht jedermann im Kirchspiele.
Mithin beschloß Peter, freilich klopfenden Herzens, solange seine Aspecten leidlich ständen und ehe ihm ein anderer zuvorkäme, sein Glück bei dem Rainbauer zu versuchen. Er warf sich also eines Sonntag-Nachmittags in seinen besten Staat und machte sich auf den Weg nach dem Rainhofe hinüber. Die Ernte war gerade zu Ende und trefflich ausgefallen; dann sind die Bauern zwar guter Laune, tragen aber auch den Kopf doppelt so hoch als gewöhnlich. Auf dem sauern Gange überlegte der Freier noch einmal das Für und Wider seiner Hoffnungen, und dabei schob er seinen nagelneuen Dreispitz bald kühn in den Nacken zurück, bald zog er ihn, an seinem guten Sterne zweifelnd, tief in die Stirne, daß derselbe fast aussah wie ein Schiff auf dem sturmbewegten Bodensee, dessen Bug unter der anschwellenden Woge steigt, um alsbald wieder in die Tiefe zu sinken.
Eines beunruhigte ihn vor allem. Sein Vetter, der Weidenbauer, zählte in der ganzen Gemeinde keinen besondern Freund; aber niemand konnte den alten Mann weniger ausstehen als gerade sein nächster Nachbar, Verenas Vater. Das hatte außer den gewöhnlichen Nörgeleien, welche in dem Verkehre mit Nachbarn wohl mit unterlaufen, noch einen ganz besondern Grund. Der Weidenbauer war nämlich ein klein wenig knauserig, und infolge davon hatte sich bei ihm die schlimme Gewohnheit festgesetzt, daß er sein Gesinde, manchmal ohne Noth, am heiligen Sonntag zu dieser oder jener Arbeit anhielt. Während des Gottesdienstes freilich und während der Nachmittagsandacht, darauf sah er, mußten Knecht und Magd in der Kirche sein; dann aber, glaubte er, müsse unser Herrgott ein Auge zudrücken, wenn er noch in aller Eile etwas »Nothwendiges« besorgen ließ. Er hatte darüber manchen Spahn mit dem Pfarrer, der in Güte und Ernst diesem ärgerlichen Wesen steuern wollte; allein es half nichts, und seitdem der Kaplan wirklich einmal recht eindringlich über die Sonntagsheiligung gepredigt und sich, dabei die Köpfe aller Bauern, wie an einem Schnürchen, nach dem alten Knauser hingedreht hatten, war die Sache erst recht verfahren. Jetzt erwachte auch noch der Eigensinn des Bauern, und er sagte: »Und wenn sie sich alle auf die Köpfe stellen, will ich doch sehen, wer auf meinem Hofe Herr und Meister ist.«
Ueber dieses heillose Arbeiten an Sonn- und Feiertagen ärgerte sich nun kein Mensch mehr als der Rainbauer, und aus den vielen Sticheleien, die hieraus hervorgingen, war nach und nach eine ganz gründliche Abneigung entstanden, so daß die Nachbarn sich schon Jahr und Tag nicht mehr grüßten. Der Narren-Peter hatte also allen Grund zu der Befürchtung, der Groll wider den alten Vetter möchte sich auch auf ihn erstrecken.
Bei dieser trübseligen Erwägung war die Spitze seines Dreimasters wieder sehr tief gesunken, und Peter bemerkte kaum, daß er vor dem Hofthore des Rainbauers angelangt sei.
Da weckte ihn ganz unerwartet eine helle Stimme aus seinen Träumen: »I du meine Güte, Peter, was macht Ihr für ein Leichenbitter-Gesicht!« lachte es fröhlich über die Gartenhecke. »Ist Euch der alte Vetter gestorben?«
»Seid Ihr es, Verena – ich wünsche einen schönen guten Abend,« und der Dreispitz wurde gebührendermaßen gerückt. »Das ist gut, daß ich Euch treffe – nein, es ist mir niemand gestorben; ich danke für die Nachfrage, und wenn ich ein ernsthafteres Gesicht mache als gewöhnlich, so hat das seine Gründe – und davon möchte ich gerade mit Euch reden.«
»Mit mir? Dann macht es kurz; die Mutter wartet in der Küche auf den Schnittlauch, und es will sich nicht recht schicken, daß ich so über den Gartenzaun hinweg mit fremden Leuten verhandle.«
»Mit fremden Leuten? Ich bin Euch doch hoffentlich nicht ganz fremd?«
»Nun, ich wollte nur sagen, Ihr gehört doch nicht zum Hofe und auch nicht zur Verwandtschaft.«
»Was nicht ist, kann noch werden; wir könnten ja zum Beispiel bald – Bräutigam und Braut sein,« platzte Peter heraus und schaute dabei treuherzig in Verenas Antlitz. Das Mädchen that einen forschenden Blick in Peters Auge; dann wurde es über und über roth und sagte, sich abwendend: »Ich muß in die Küche.«
»So bleibt doch noch einen Augenblick; es ist mir heiliger Ernst, und ich komme ja gerade, um mit dem Vater zu reden.«
»Gut, der Vater ist in der Stube.«
»Aber so sagt mir doch wenigstens ein ermuthigendes Wort!«
»Nicht, bevor Ihr mit dem Vater geredet habt.«
»Verena!«
Aber Peter rief umsonst; das Mädchen war schon in der Hausthüre verschwunden. So mußte er denn wohl oder übel ohne das directe Jawort der Tochter sich an den Vater wenden. Er strich sein braunes Kraushaar bescheidentlich in die Stirne, sammelte sich noch einen Augenblick und schritt dann fast feierlich quer über den Hofraum auf die Hausthüre zu. Unter derselben angelangt, warf er einen raschen Blick in die offen stehende Küche; doch gewahrte er die Tochter des Hauses nicht, wohl aber trat ihm die Bäuerin entgegen. Peter grüßte auf das freundlichste und fragte, ob der Rainbauer zu Hause sei.
»Ei ja, mein Mann ist in der Stube,« sagte die Bäuerin; »habt Ihr Geschäfte?«
»Keine Geheimnisse, Frau Armenpflegerin; es geht Euch alles gerade so viel an wie Euern Mann.«
»So so, das müssen ja sonderbare Anliegen sein,« schmunzelte die behäbige Bäuerin und öffnete die Stubenthüre mit den Worten: »Michel, der Peter vom Weidenhofe hat was mit uns zu verhandeln.«
»Der Narren-Peter?« tönte es aus der Stube, und gleichzeitig wurde eine wohlbeleibte Gestalt sichtbar, die sich in dem Lederstuhle, offenbar in einem gemüthlichen Nachmittagsschläfchen gestört, geräuschvoll dehnte und reckte.
»Ei ja, der Peter Kühne – du könntest auch etwas manierlicher sein und die Leute beim rechten Namen nennen,« mahnte die Bäuerin.
»Nun, nun, er wird mir's nicht übel nehmen; es nennt ihn ja alle Welt so,« sagte der Bauer, strich sich die feuerrothe Weste mit den Silberknöpfen glatt und streckte dem Eintretenden lachend die derbe Hand entgegen.
Peter ergriff sie und sagte: »Gewiß darf ich das nicht übel nehmen; man nennt mich so wegen meines Altvordern, der das Stockacher Narrengericht stiftete.«
»Weiß schon, weiß schon, daß Ihr von dem Erznarren abstammt – doch der tausend, sagt mir einmal, wie könnt Ihr heute Nachmittag vom Weidenhofe abkommen? Es ist ja ein leibhaftiger heiliger Sonntag, und Euer Vetter hat noch ein anderthalb Fuder Hafer drüben am Mückenbühl liegen.«
»Wenn mein Vetter den Hafer hereinfahren will, so kann er das selber thun, ich werde am Sonntag keinen Finger mehr für ihn regen,« sagte Peter, und das Blut schoß ihm jäh ins Antlitz.
»So – seid Ihr so selbständig geworden?« fragte der Bauer gedehnt und richtete dabei das klare Auge fest auf den verwirrten Burschen. »Nun, freuen sollte es mich; ich habe bis jetzt gemeint, Ihr thätet alles und jedes – um der zu erhoffenden Erbschaft willen. Werdet nur nicht böse – ich bin nun einmal nicht gewohnt, ein Blatt vor den Mund zu nehmen.«
»Aber Michel,« fuhr die Bäuerin vermittelnd dazwischen, »ist das auch eine Art und ein Anstand, einen Fremden zu empfangen? Du kapitelst ja den Peter herunter, als wäre er dein eigener Bube! – Nehmt es ihm nicht übel, Nachbar; er redet immer frisch von der Leber weg, und wenn es auch etwas rauh klingt, gut gemeint ist's doch. Setzt Euch an den Tisch und trinkt ein Krüglein Bier mit meinem Mann, so wird sich Euer Geschäft besser verhandeln lassen.«
Peter war über den Empfang so verwirrt, daß er sich an den schweren Eichentisch dem Bauern gegenüber hinsetzte, fast ohne zu wissen, was er that. Erst als auf der Mutter Ruf Verena eintrat und die umfangreichen Steingutkrüge mit den blank gescheuerten Zinndeckeln vor den Bauern und seinen Gast hinsetzte, wagte er einen flüchtigen Blick auf das Mädchen. Doch das zuckte mit keiner Wimper, legte Brod und Käse zurecht und huschte pfeilschnell aus der Stube fort.
Der Bauer hatte das alles gesehen und verstand den Wink vollkommen, den ihm seine Frau zuwarf, nahm sich aber im selben Moment vor, dem Freier keinen Schritt entgegenzukommen. Nicht, daß er dem Burschen besonders abgeneigt gewesen wäre, aber er kannte dessen Charakter noch viel zu wenig und war fest entschlossen, seine Tochter nur einem Burschen zur Frau zu geben, der Kopf und Herz auf dem rechten Flecke habe. Von Peter wußte er nun nicht viel mehr, als daß er drüben auf dem Weidenhofe bei seinem Vetter rüstig arbeite; er beschloß also, ihn erst zu prüfen. Vorläufig wollte er ihm demnach keine Silbe der sauern Anfrage schenken, und dann erst sollte er die Antwort vernehmen, welche jetzt schon unabänderlich in seinem Kopfe fix und fertig war.
So fing er ganz kühl über die Ernte zu reden an, und wie sie im Unterlande und im Bayerischen doch nicht so gut ausgefallen sei als bei ihnen. Dann fragte er nach den neuesten Kornpreisen von Ueberlingen und Lindau und Schaffhausen, obschon er sie alle recht wohl wußte, und meinte endlich, bedächtig in der Pfeife stochernd und den verlegenen Burschen, der nur sehr einsilbig auf all das Red' und Antwort gab, mit einem halb spöttischen Blicke messend, er wolle mit dem Kornverkaufe noch zuwarten und nach Neujahr, wenn die Preise stiegen, einmal auf die Schranne nach Zürich fahren.
Dann trat eine Pause ein, und die Bäuerin, welche etwas ungeduldig wurde, sagte: »Peter wird wohl kaum des Kornhandels wegen gekommen sein.«
»Nein,« sagte dieser und räusperte sich. »Es war etwas anderes; aber es will mir schier scheinen, ich käme besser ein anderes Mal. Es liegt mir sehr am Herzen und ich weiß nicht, ob ich heute –«
»Nun, da Ihr einmal da seid, so sagt nur frisch, was es ist; ich hab' Euch schon gesagt, mein Mann ist nicht halb so schlimm, als er auf den ersten Blick scheint. Was ist es? Betrifft es Euch oder Euern Vetter?«
»Es beträfe mich und Eure Tochter.« Der Stein war im Rollen!
»Aha,« sagte der Bauer, »es ist in vierzehn Tagen Kirmeß in Winterspüren, und da wollt Ihr wohl Vreneli zum Tanze bitten? Offen gestanden, ich habe mir ein für allemal vorgenommen, meine Tochter nur mit einem solchen Burschen zum Tanze gehen zu lassen, der allenfalls auch mein Schwiegersohn werden könnte.«
»Und weshalb könnte ich denn nicht Euer Schwiegersohn werden?«
»Ihr, Peter?« rief der Bauer und klopfte lachend seine Pfeife aus.
»Ja, ich – nicht um Verena zum Tanze zu bitten, sondern geradezu um anzufragen, ob Ihr mir Eure Tochter nicht zum ehelichen Weibe geben wollt, bin ich herübergekommen. Ich bin ehrlicher Leute Kind, nicht ohne Vermögen, gesunden und geraden Leibes, ein arbeitsames und ehrliches Blut. Zudem stoßen die Höfe meines Vetters und Euer Hof zusammen und würden vereinigt das stattlichste Gut auf drei Meilen im Umkreise ausmachen, und so glaube ich, daß Verena und ich ganz gut zusammenpassen und wir mit Gottes Gnade wohl das Zeug hätten, einen christlichen Ehestand zu gründen, so daß Ihr in Euern alten Tagen Freud' und Trost an uns erleben könntet.«
»Ei, ei, den Spruch habt Ihr gar so übel nicht hergesagt; das habt Ihr Euch alles wohl zusammengereimt,« sagte der Bauer, stopfte die neue Pfeife fertig, schlug bedächtig Feuer, drückte den Schwamm fest und paffte die ersten blauen Wolken vor sich hin. Dann hub er ruhig an: »Ihr seid ehrlicher Leute Kind – nicht wahr, damit hat's angefangen? Nun, da kann man nichts dagegen sagen; etwas närrisch freilich ist Eure Sippe, das habt Ihr von Eurem Ahnherrn, dem Schalksnarren; auch seid Ihr ein geborener Städter – ein eigentlicher Bauernsohn wäre mir schon lieber. Doch das ist keine eigentliche Schwierigkeit. Ihr versteht zu pflügen trotz den geborenen Bauern; was wahr ist, will ich Euch nicht abstreiten. Jetzt kommen wir aber auf ein anderes Kapitel; mein Hof und der Hof Eures Vetters stoßen zusammen, ganz richtig! Aber gehört Euch denn der Hof Eures Vetters schon?«
»Noch nicht, aber er wird mir doch wohl dereinst gehören,« sagte Peter etwas kleinlaut.
»Das ist möglich – der alte Weidenbauer kann aber noch lange leben, wenigstens zehn Jahre, die morschen Bäume stehen gewöhnlich am längsten. Und meint Ihr, wenn Ihr ihm heute kommt und sagt: ›Vetter, ich will nächstens des Rainbauers Verena heiraten,‹ er würde euch jungen Leuten so willig Platz machen?«
Peter rückte unruhig auf seinem Stuhle hin und her.
»Das glaubt Ihr selber nicht,« fuhr der Rainbauer fort, »und wenn er es thäte, meint Ihr, ich ließe es zu, daß mein leiblich Kind in das Haus des alten Filz hinüberzöge, welcher alle Sonn- und Festtage, die uns der Herrgott gibt, zum Aergerniß der ganzen Gemeinde durch Schaffen und Werken entheiligen läßt? Da sei Gott vor!«
»Es ist gut,« rief Peter, der alles verloren glaubte, sprang vom Stuhle auf und griff hastig nach seinem Hute. »Es ist gut, Rainbauer, ich sehe, solange mein Vetter lebt, habe ich keine Hoffnung auf die Hand Verenas!«
»Wenigstens solange er den Sonntag schändet, möchte ich ihn nicht in der Sippe haben, wißt Ihr was? Bekehrt ihn von diesem Laster, Peter, und dann wollen wir weiter von der Sache reden,« lachte der Bauer.
»Ich den alten Vetter in dem Punkte bekehren? Ihr stellt unmögliche Bedingungen!«
» Versucht es zum mindesten ehrlich, und zum allermindesten werdet dem Vetter gegenüber etwas selbständiger. Es ist ja nicht mit anzusehen, wie Ihr in allen Stücken nach des Alten Pfeife tanzt! Nun, Peter, gebt mir Eure Hand, wenn ich es schlimm mit Euch meinte, so hätte ich nicht halb so viele Worte an Euch hingeredet. Was Euer Anliegen angeht, so hat es damit keine Eile; Vreneli wird auf Konradi-Tag erst zwanzig, und übers Jahr könnt Ihr Euch ja wieder einmal erkundigen. Hiermit Gott befohlen für diesmal!«
Peter wußte nachher nicht, wie er aus der Stube und aus dem Hause gekommen war; er erinnerte sich nur noch, daß ihm die Bäuerin unter der Thüre etwas Ermuthigendes gesagt hatte; aber was es gewesen, dessen konnte er sich nicht entsinnen.
Als Peter fort war, hatte der Rainbauer eine Standrede seiner Ehewirtin anzuhören. Das that er mit aller Ruhe; dann sagte er: »Soll ich denn dem Burschen meine Tochter und meinen Hof an den Kopf werfen seines glatten Gesichtes und seines manierlichen Aeußern willen? Ich muß doch erst wissen, aus was für einem Stoffe er gemacht ist, und das wird sich, wie ich denke, bald herausstellen. Meinst du denn, es sei mir wirklich Ernst damit, daß der Bursche den alten Weidenbauer bekehren soll? Gewiß nicht! Aber versuchen soll er's, und gerade in dem Punkte soll er Front gegen ihn machen; hierbei wird sich zeigen, was wir an ihm haben. Laß mich nur machen, Frau. Wenn er meiner Tochter werth ist, soll er sie haben; wenn er aber nur augendienerisch auf die Erbschaft des alten Knausers lauert und nebenbei auch noch auf meinen Hof speculirt, so soll es ihm nicht gelingen, den Rainbauer zu fangen.«
*
Man kann nicht gerade sagen, daß Peter in der besten Laune nach dem Weidenhofe zurückkam, und was er da zuerst erblickte, war keineswegs danach angethan, ihn in eine bessere Stimmung zu versetzen. Ein Leiterwagen stand vor dem Scheunenthore, und der Meisterknecht spannte soeben die Rosse vor.
»Was soll's, Jerg, was spannst du ein?« rief der Bursche.
»Das könnt Ihr Euch doch denken! Das anderthalb Fuder Hafer, das wir gestern Abend nicht mehr zwingen konnten, muß eingefahren werden.«
»Bei dem herrlichen Wetter! Da soll doch –«
»Ei ja, und wenn es noch zehntausendmal schöner wäre, und der Erzengel Gabriel stiege vom Himmel herab und verkündete dem Bauer, daß in sechs Jahren kein Tropfen Regen mehr fallen werde: er jagte uns doch hinaus, just weil's heiliger Sonntag ist. – Herum, du alter Sattelgaul, oder ich schlage dir deine steifen Knochen windelweich! Gelt, du stündest auch lieber im Stalle; aber stell dich nur nicht so eigensinnig; ich muß auch, was ich nicht will!« und damit knallte er den Pferden über die Köpfe weg, und hinaus polterte der Wagen in den Hofraum.
»Das Knallen kannst du bleiben lassen, Jerg!« tönte es jetzt von der Thüre des Wohnhauses her, in welcher der alte Weidenbauer in Hemdärmeln und eine Gabel in der Hand erschien. »Es ist doch Sonntag, und wir wollen das bißchen nöthige Arbeit so still als möglich abthun.«
»So, Sonntag ist's?« kam es zurück. »Es ist nur gut, daß man's weiß; ich habe gemeint, es sei Mittwoch oder Donnerstag, man vergißt das hier auf dem Hofe manchmal.«
»Jerg,« rief der alte Bauer, »wenn du mir noch einmal drein redest, so kannst du dein Bündel schnüren – verstanden?«
Der Knecht biß die Zähne aufeinander, hieb den Rossen eines darüber und fuhr durch das Hofthor, sagte aber nichts; denn es fiel ihm ein, daß die Erntezeit vorbei und somit der Bauer wohl im stande wäre, sein Wort zu halten. Statt seiner wandte sich Peter an den alten Vetter.
»Es ist und bleibt doch eine Schande vor Gott und den Menschen, wie man es hier treibt auf dem Weidenhofe,« brach er in seinem Aerger los. »Das ganze Kirchspiel zeigt mit Fingern auf uns; eben noch mußte ich's vom Rainbauern hören!«
»Was geht mich der Rainbauer an! Was zahlt mir der Rainbauer, wenn es über Nacht meinen Hafer verregnet! Und was hast du, Grünschnabel, deinem alten Vetter vor Knecht und Magd den Text zu lesen? Wenn es dir auf dem Weidenhofe nicht gefällt, so geh nach Stockach hinein zu deiner Narrensippe!«
»Bei einem Wetter wie heute, wo ein Kind sehen kann, daß in den nächsten Tagen kein Regentröpflein fallen wird, die paar Halme Hafer heimholen – es ist ja haarsträubend! Thut, was Ihr wollt, ich werde keinen Finger rühren!«
»Was verstehst du vom Wetter? Und wenn ich den Knechten Feierabend gebe, was thun sie dann als sich ins Bierhaus setzen? Ist das etwa eine christliche Sonntagsheiligung? Endlich vertändeln sie mir morgen mit dem elenden Hafer den ganzen Vormittag, anstatt gleich entschieden sich daran zu machen, das Feld umzubrechen. Also zieh nur rasch dein feines Sonntagswams aus und hilf uns ein Stündchen.«
»Ich nicht, Vetter, und daß Ihr es nur wißt, ich werde nie mehr am Sonntag für Euch auch nur so viel schaffen.«
»Wer hat dir denn diese Mücke hinter das Ohr gesetzt – der Rainbauer oder sein Mädchen? Ja, schau nur so blitzwild drein – meinst du, ich hätte meine Augen nicht im Kopfe? Aber das sage ich dir: an dem Tage, wo du um das Ding freist, sind wir geschiedene Leute, und wenn du nach meinem Tode auch nur eine Hufe Land von mir erbst, so will ich Hans heißen. Jetzt geh deiner Wege und überleg es dir, ob du bei mir aushalten und einst meinen Hof erben willst, oder ob du vorziehst, bei dem Rainbauer, den ich in der Seele nicht ausstehen kann, ums Gnadenbrod zu betteln!«
Hiermit nahm der Alte die Gabel auf seine Schulter und schritt durchs Hofthor hinaus dem Wagen nach. Peter schaute ihm einen Augenblick nach; dann drehte er sich auf dem Absatze um und sagte: »So – entweder soll ich dich lassen oder Verena – da wird mir die Wahl wahrhaftig nicht schwer! Du bist doch allein schuld, daß mich der Rainbauer so leichthin abfertigte. Und beim Himmel, er hat recht! Was bin ich auch für ein Narr, daß ich dem alten Sonderling diene wie der letzte Knecht, ohne einen Pfennig, ja ohne ein freundliches Wort von ihm zu bekommen! Aber es soll anders werden, so wahr ich Peter Kühne heiße!«
Dieses Selbstgespräch hielt Peter, während er den Weg zum Dorfe einschlug. Als er über den kleinen Hügel stieg, welcher den Rainhof und den Weidenhof von dem unbedeutenden Weiler trennt, und von der Höhe aus drüben im Felde den Bauern mit Knecht und Magd das Fuder Garben laden sah, brummte er unwillkürlich vor sich hin: »Ich wollte, alle Hexen des Schwarzwaldes ritten den Wagen durch die Lüfte davon, daß der alte Sonntagsschänder einmal einen Denkzettel hätte!«
So brummte der Bursche in seinem Aerger und schritt rasch den Hang hinab zum Dorfe. Da auf einmal fuhr ihm ein Blitzgedanke durch den Kopf. Er blieb stehen und sagte: »Und wenn es die Hexen nicht thun, so könnte ich es ja probieren – so – nein, das geht nicht, aber so – etwas gewagt ist es; aber ein Kapitalspaß wäre es, wenn es ginge! Und warum sollte es nicht gehen, wenn mir ein paar Burschen helfen? Probirt muß es werden, und wenn es glückt, so will ich zehn gegen eins wetten, der Herr Vetter meint, der Leibhaftige habe ihm zur Strafe für seine Sonntagsschändereien den Streich gespielt! Der Narren-Peter lachte hell auf und schritt, ganz mit seinem Plane beschäftigt, dem Wirtshause zur »Goldenen Gans« zu, wo er einige seiner Kameraden zu finden hoffte.
Peter täuschte sich nicht. Man war eben daran, die letzte Kegelpartie abzuschließen, als er in den Garten trat. Er stellte sich hin und sah, wie die Kegel fielen; dabei winkte er dem einen und dem andern, er habe noch etwas mit ihnen zu verhandeln, und nach einer halben Stunde saß er mit einem Dutzend Altersgenossen in der hintern Wirtsstube bei einem Kruge Bier. Der muntere Peter war allgemein beliebt. Keiner wußte so viele Schnurren und lustige Streiche zu erzählen wie er, und diesen Abend schien es, als wolle er sich selber überbieten. Die Burschen lachten laut und schlugen ein über das andere Mal auf den Tisch, betheuernd, man merke wohl, daß der Narren-Peter von dem Erznarren herstamme und der Apfel nicht weit vom Baume gefallen sei. Als er sie dann in der rechten Laune hatte, lenkte er das Gespräch auf die Sonntagsarbeiten seines Vetters. Alle meinten einstimmig, das sei ein öffentliches Aergerniß.
»Das wohl verdiente, daß man dem alten Knauser einen Kapitalstreich dafür spielte,« fügte Peter rasch bei. »Es ist mir so ein Plan gekommen, und wenn ihr mir helfen wollt, so werdet ihr einen Spaß erleben, daß eure Kinder und Kindeskinder noch davon reden sollen.«
»Laß hören, Peter! Wenn das Ding nur halbwegs geht, so bin ich dabei!« tönte es von allen Seiten.
»Natürlich geht es,« rief dieser und hub an, seinen Plan mit gedämpfter Stimme darzulegen. Anfangs gab es bedenkliche Gesichter und gewaltiges Kopfschütteln; aber Peter wußte allen Einwürfen zu begegnen, und nach einer Viertelstunde reichten sich die Burschen lachend die Hand, tranken noch auf »Gut Gelingen« ein Glas Schaffhausener und gingen einstweilen ihrer Wege.
»Nach Mitternacht also, sobald der Mond aufgeht!« sagte Peter, und: »Verlaß dich drauf, es wird keiner fehlen,« antworteten die andern.
Im Weidenhofe war alles ruhig. Peter hatte sich, wie gewöhnlich, mit den andern zum Nachtessen eingefunden, welches diesen Abend infolge des Streites, den der Bursche mit seinem Vetter gehabt, einsilbig genug verlief. Dann gingen die Knechte noch einmal in die Ställe, um nach dem Vieh zu sehen, und auch der alte Bauer machte die gewohnte Runde. Müde eilten die Knechte bald nach ihrer Schlafkammer. Dann verschloß der Bauer sorgfältig die Hausthüre und zog sich in seine Schlafstube zurück, bei sich überlegend, daß er morgen doch lieber mit dem Stockacher Vetter Frieden schließen wolle; denn dem alten, einsamen Mann war der flinke und willige Bursche nicht halb so gleichgiltig, als es den Anschein hatte. Endlich legte er sich nieder und schlief bald ein, und alles war ruhig auf dem Weidenhofe.
Nur Peter und der Meisterknecht wachten noch. Kurz bevor der Bauer die Hausthüre abgeschlossen hatte, war Peter, den großen Hofhund am Halsbande führend, hineingeschlüpft und hatte das kluge, wachsame Thier dem Meisterknechte auf die Kammer gebracht, wenige Worte wurden gewispert, aus denen dem letztern klar wurde, es handle sich um einen Kapitalstreich gegen den Bauern, und er habe dafür zu sorgen, daß der Hofhund die Sache nicht durch sein wüthendes Gebell verrathe.
Der Meisterknecht zerbrach sich den Kopf, worin dieser Kapitalstreich bestehen könnte, und setzte sich erwartungsvoll an das Kammerfenster, das den Ausblick auf den Hofraum und die Scheune bot. Es war 11 Uhr vorbei und ging schon stark auf Mitternacht, noch immer harrte Jerg, von Zeit zu Zeit gewaltsam sich aus dem Schlummer aufraffend, der ihn allmählich beschlich. Zu seinen Füßen lag Bäri, den großen Kopf auf den Vorderpfoten, und schlief. Schon dachte der Mann daran, der Peter halte ihn zum Narren, und wollte sich ärgerlich zu Bette legen. Da – waren das nicht Schritte unten im Hofe? Ja, Bäri hatte es auch gehört, knurrend hob er seinen Kopf, aber der Knecht legte rasch seine Hand auf ihn und beruhigte das Thier mit einem leisen: »Still, Bäri.« Der Hund gehorchte und blinzelte mit halbem Auge nach dem Manne, der seine Stirne fest an die runden, halb erblindeten Fensterscheiben preßte und mit seinem Blicke die Dunkelheit zu durchbohren suchte. Allein er sah nichts und hörte auch weiter nichts: schon glaubte er, sich getäuscht zu haben.
Doch nein! jetzt vernahm er es ganz deutlich. Das waren Schritte drunten im Hofe! man schleifte irgend etwas über den Boden. Nun wurde es auch heller; der Mond mußte eben aufgehen, denn die Scheune und fast der ganze Hofraum traten klar hervor, während diese Seite des Hauses und auch die Stelle, von welcher das Geräusch heraufdrang, im tiefen Schatten lag. Doch konnte er bald einige Gestalten unterscheiden; sie waren geschäftig, eine Leiter aufzurichten und wider Peters Kammerfenster zu lehnen. Der Meisterknecht hörte, wie sich dieses öffnete, und sah den Burschen flink die Sprossen hinabsteigen. Unten angekommen, redete er eine Weile mit den Gesellen, deutete rechts und links und trug dann die schwere Leiter in freier Hand quer über den mondbeschienenen Hof zur Scheune hin. Die Burschen folgten ihm; Jerg konnte sie nun zählen und erkennen. »Das sind die Rechten,« murmelte er, »was sie nur wollen mögen?«
Peter lehnte inzwischen die Leiter an die vordere Giebelwand der Scheune; allein sie reichte bei Klafterlänge nicht bis zur Höhe. Das schien den Leuten nicht nach der Mütze; sie hielten Rath, und bald entfernten sich vier in der Richtung nach dem Dorfe. Die übrigen traten mit Peter in die Tenne, wo der unselige Wagen stand, der gestern Abend das letzte Fuder Hafer hereingebracht hatte. Was sie da thaten, konnte Jerg nicht sehen; sie arbeiteten offenbar stille und hurtig beim Scheine einer Laterne; denn diese zeichnete die sonderbarsten Schattenbilder an das halb offene Tennenthor. Nach etwa einer Viertelstunde trat Peter wieder auf den Hof heraus, jedoch, was trug er nur in seinen Händen? War das nicht ein Wagenrad? Und hinter ihm erschien alsbald ein anderer mit dem zweiten Rade; das dritte und vierte folgte; dann kamen die Achsen, die Deichsel, die Leitern, die Stangen, Stück für Stück der ganze Wagen, und das legten sie alles in guter Ordnung auf den Boden hin. Endlich trugen sie Stricke herbei, knoteten dieselben zusammen und setzten sich dann ruhig plaudernd der Scheune gegenüber auf eine Bank.
Die Neugierde des Meisterknechtes war aufs höchste gestiegen; denn er konnte sich auch gar nicht denken, wo hinaus diese sonderbaren Maßnahmen zielten. Zuerst war ihm der Gedanke gekommen, Peter wolle die eingefahrenen Garben wieder auf den Acker hinausbringen und er habe den Wagen nur auseinander genommen, um ihn jenseits des Hofthores wieder zusammenzusetzen, damit so das Gerassel auf dem gepflasterten Hofe vermieden werde, und dabei hatte er gedacht: »Wie ungeschickt die Burschen sind! Warum umwickeln sie nicht einfach die Radfelgen mit Stroh?« Allein jetzt sah er, daß sie etwas anderes vorhatten, nur konnte er sich gar nicht denken, was.
Wohl eine Viertelstunde wurde seine Neugierde noch auf die Folter gespannt; dann wurde sie befriedigt.
Die vier Gesellen, welche sich gleich anfangs in der Richtung nach dem Dorfe entfernt hatten, kehrten zurück, mühsam eine riesige Leiter auf ihren Schultern schleppend.
»Um Gotteswillen,« sagte Jerg, »das ist ja die große Feuerleiter von der Kirchhofmauer; die wird ihnen schwer genug geworden sein. Wie sie den Schweiß sich von der Stirne wischen! Da – jetzt stellen sie das Ding auf und lehnen es an den Scheunengiebel; der Peter klettert hinauf und setzt sich auf den First; – sie werden doch nicht – wahrhaftig, die tollen Buben geben sich daran, den Wagen auf das Dach hinauf zu schaffen!«
Wirklich, das war die Absicht Peters und seiner Gesellen. Wie ein Eichkätzchen hatte der gewandte Bursche mit noch zwei andern die Höhe des gewaltigen Schaubdaches erstiegen; dann ließen sie den Strick hinab und hißten an demselben Stück für Stück des zerlegten Wagens empor. Erst kam die Achse des Hinterwagens und die dazu gehörigen Räder; die fügten sie flink zusammen. Es folgte die Vorderachse mit ihrem Räderpaare, und binnen wenigen Minuten waren Vorder- und Hinterwagen in der Weise miteinander verbunden, daß die Achsen quer auf dem Firstbalken ruhten, die Räder aber rechts und links auf die steilen Dachflächen reichten, wo man ihnen durch Bretter und Keile eine festere Unterlage bereitete. Jetzt setzten sie die Deichsel ein, daß sie weit über den Giebel in die Luft hinausragte, und nachdem auch die Wagenleitern aufgestellt waren, stand das ganze Fuhrwerk fix und fertig rittlings auf dem Dachfirste. – »Wie hinaufgehext,« sagte Jerg, der seinen Augen kaum glauben wollte, und fügte bei: »Gott sei Dank, daß keiner der Waghälse das Genick brach!«
Allein die Beruhigung, die sich in diesen letzten Worten aussprach, dauerte nicht lange; denn der zweite und bei weitem gefährlichere Theil des Abenteuers begann nun. Die Burschen bildeten jetzt eine Kette aus der Tenne zur Leiter und die Leiter aufwärts zum Wagen, und rasch, wie bei einem Brande die Eimer, flogen die Hafergarben von Hand zu Band zum Firste hinauf. Der Narren-Peter nahm sie in Empfang und schichtete sie regelrecht, bis der Wagen vollständig geladen war und man den Wiesbaum darüber festzog, gerade wie vor wenigen Stunden draußen auf dem Acker.
Jerg mußte sein Auge abwenden; es schwindelte ihm, wenn er den tollkühnen Burschen in dieser Höhe auf dem geladenen Fuhrwerke sah. Doch nun war Peter fertig und glitt an dem Bindseil hinunter auf die Deichsel, wo er die Feuerleiter fassen konnte und so rasch den sichern Grund erreichte. Gleich wurde diese Leiter zu Boden gelassen, flink die hin und her verstreuten Halme aufgelesen und alle Merkmale des nächtlichen Abenteuers weggeräumt. Dann stieg Peter durch das Fenster in seine Kammer, die Burschen griffen die große Brandleiter auf und verließen in aller Stille den Hof. Es war alles wie ein Traum, und Jerg glaubte selber schier, er habe geträumt – aber da thronte unzweifelhaft im klaren Mondscheine der hochbeladene Wagen auf dem Dachfirste!
Es mochte gegen 3 Uhr sein; die Hähne krähten den Morgen an. Eine Stunde später wurde es lebendig im Hofe. Der alte Weidenbauer rief den Knechten, und diese polterten die Treppe hinab, um das Tagewerk zu beginnen. An der Hausthüre trafen sie den Bauern. Er schien nicht in der besten Laune; denn er hatte die Zipfelmütze bis an die Augen in die Stirne hineingezogen, ein sicheres Zeichen, daß nicht alles geheuer sei, und statt den Knechten den »Guten Morgen« zu erwidern, schalt er: »Schläft man so in den hellen Tag hinein? Geschwind in den Stall, die Rosse gefüttert, die Pflüge hinaus!« Da öffnete er die Thüre; sein erster Blick fiel auf den hochgeladenen Erntewagen, der in der Morgendämmerung wie ein Spukbild vom Dachfirste herabsah, und das Wort erstarb ihm auf den Lippen. Er taumelte förmlich zurück und lallte, sich an den Thürpfosten haltend: »Herr des Himmels, was ist denn das?«
»Was habt Ihr, Meister?« riefen die Knechte erschrocken.
»Da – seht Ihr's denn nicht, oder bin ich über Nacht verrückt geworden – auf dem Scheunendache!«
»Gerechter Gott – das ist ja der leibhaftige Erntewagen, den wir gestern Abend hereinführen mußten!«
»Es ist der Wagen mitsamt dem Hafer – das ging nicht mit rechten Dingen zu,« stotterte der Martin und schlug ein großes Kreuz.
»Das ist eine Strafe für Euer Sonntagsschänden, Bauer; den hat der leidige Satan durch die Lüfte da hinaufgeritten – das ist keines Menschen Werk, verlaßt Euch darauf!« riefen die Knechte durcheinander.
Jetzt kamen auch Peter und Jerg die Treppe herab, und wenn die andern wirklich an ein übernatürliches Strafgericht glaubten, so stellten diese sich wenigstens, als seien sie derselben Ueberzeugung.
Der alte Weidenbauer zitterte wie Espenlaub; in seiner Angst kam es ihm gar nicht so unwahrscheinlich vor, daß hier zur Strafe für seine Verstocktheit übernatürliche Mächte eingegriffen, war doch damals der Glaube an Hexerei noch allgemein verbreitet. Mühsam rang er nach Fassung und sagte endlich: »Wie der Wagen hinaufkam, kann ich mir freilich nicht erklären; es ist aber vielleicht doch nur ein toller Streich von losen Buben, und jedenfalls müssen wir ihn herunterholen, bevor das ganze Kirchspiel zusammenläuft und die heillose Geschichte ruchbar wird.«
Allein der alte Mann hatte gut befehlen; keiner der Knechte wollte den Teufelswagen mit einem Finger berühren, bevor er allermindestens vom Pfarrer benedicirt sei. Ebenso fruchtlos verlegte der Bauer sich aufs Bitten; ja endlich ging er so weit, daß er Belohnungen darauf bot und jedem Knechte einen Gulden versprach, der ihm helfen werde, den Wagen vom Dache herabzuholen. Alles umsonst!
»Und wenn Ihr mir hundert Gulden baar gezählt da auf die Bank hinleget,« meinte einer, »glaubt Ihr, ich wollte mir dafür den Hals brechen?«
»Der Hans hat recht,« sagte ein anderer; »es liegt ja auf der Hand, daß der Leibhaftige mit seinen höllischen Gäulen den Wagen da hinaufpracticirte, und so ein Ding rührt man nicht so leichter Hand wieder an – ich will laufen und den Herrn Pfarrer holen.«
So redeten die Knechte, und Peter und Jerg waren ganz derselben Ansicht. Jetzt kamen aber auch die Mägde aus dem Hause, und als diese das Wunder schauten, ging es erst recht an ein Gezeter, das sei das offenbarste und wohlverdienteste Strafgericht, und wenn der Bauer nicht augenblicklich den Pfarrer kommen lasse, daß er den Spuk banne, so wollten sie auf dem Hofe, der ja augenscheinlich zur Sühne für den Sonntagsfrevel den höllischen Mächten überantwortet sei, keine Stunde länger zubringen.
Der Weidenbauer wußte inmitten dieses Geschreies nicht mehr, wo ihm der Kopf stand. Nochmals forderte er Peter auf, ihm zu helfen, und da dieser, wie alle andern, sich weigerte, schleppte er eigenhändig die Leiter herbei und lehnte sie an die Giebelwand der Scheune. Natürlich reichte sie jetzt ebensowenig als in der Nacht, und das wurde allseitig als ein neuer Beweis aufgefaßt, daß der Wagen nicht mit rechten Dingen auf das hohe Dach hinaufgebracht worden. Jetzt verließ den alten Bauern der letzte Rest der Fassung; laut jammernd gestand er seine Schuld und gab seine Einwilligung, daß man den Pfarrer hole.
Bis dieser kam, vergingen natürlich ein paar Stunden, und inzwischen verbreitete sich der Ruf des Ereignisses mit Windeseile durch die Gemeinde, was Beine hatte, lief herbei, um das Wunder zu sehen. Die Burschen, welche in der Nacht Peter geholfen hatten, waren selbstverständlich nicht die letzten auf dem Platze. Auch der Rainbauer kam mit Weib und Kind auf den Hof, und während die Bäuerin in hellem Staunen die Hände über dem Kopf zusammenschlug, schmunzelte Michel. Als er dann mit Peter zusammentraf, sagte er heimlich: »Ich meine, ich kenne das Gespenst!«
»Meint Ihr?« gab dieser zurück.
»Aber wie habt Ihr das Ding hinaufgebracht?«
»Ihr werdet ja gleich sehen, wie wir es herunterholen!«
Der Weidenbauer hatte inzwischen ein paar recht saure Stunden mitten unter dem Spotte und den Vorwürfen der versammelten Gemeinde zu verleben. Endlich kam der Pfarrer; da wurde es still. Der würdige Geistliche schaute sich den Wagen auf dem Dache ruhig an und nahm bedächtig eine Prise aus der silbernen Dose, »Habt Ihr wirklich gestern Nachmittag am heiligen Sonntag und bei dem herrlichen Wetter das Fuder Hafer da droben hereingeführt, Weidenbauer?« fragte er dann mit großem Ernste.
»Ja, Herr Pfarrer,« kam es recht kleinlaut zurück.
»Schämt Euch vor der ganzen Gemeinde! Und um das Aergerniß gut zu machen, so gebt nun vor allen hier versammelten das Versprechen, daß Ihr nie mehr weder Knecht noch Magd zur Entheiligung des Sonntags anhalten wollt!«
»Ich verspreche es,« sagte der Weidenbauer.
»So, die ganze Gemeinde hat es gehört, und ich will hoffen, daß Ihr Euer Wort auch halten werdet. – Einer Beschwörung bedarf es übrigens nicht,« fügte der Pfarrer hinzu, schaute sich im Kreise herum den einen und den andern Burschen an und sagte: »Ich denke, du, Peter Kühne, und du, Ambros Kästle, und noch so der eine oder andere, welche da herumstehen, werden auch ohnedem sich getrauen, den Wagen von dem Dache herabzuholen.«
»Der Pfarrer kennt seine Leute,« lachte der Rainbauer, und als man nun die Feuerleiter herbeischleppte und vor den Augen der versammelten Gemeinde Garbe um Garbe und Stück um Stück den Wagen herabließ, dämmerte es in den Köpfen der Zuschauer, daß wohl auch in ähnlicher Weise das Fuder Hafer stückweise auf das Scheunendach hinaufgewandert sei – und alles löste sich in ein schallendes Gelächter auf.
Beim Weidenbauer aber verwandelte sich stufenweise Angst und Scham in Aerger und Zorn, und als Peter Kühne hinter dem letzten Wagenrade her die große Leiter herabgestiegen war, trat der Alte zu ihm hin und sagte: »So, Bube, hast du mir, deinem leiblichen Vetter, den Schimpf angethan? Augenblicklich nimm deine Siebensachen zusammen und trolle dich vom Hofe, und heute noch lasse ich in Stockach ein Testament machen, daß dir kein rother Heller zukommt!«
Peter war doch etwas erschrocken, wenn er auch äußerlich nicht dergleichen that; denn er dachte: »Jetzt bin ich vom Regen in die Traufe gekommen! Wollte der Rainbauer mich nicht zum Schwiegersohne nehmen, weil mein Vetter den Sonntag entheiligte, so wird er mir doch noch viel weniger seine Tochter geben, nachdem ich auf den Weidenhof keine Hoffnung mehr habe.«
Noch am selben Tage zog Peter nach Stockach. Es war ihm freilich der Gedanke gekommen, den Rainbauern beim Worte zu nehmen; denn er hatte ja den alten Vetter so zu sagen »bekehrt«. Aber der junge Mann war viel zu stolz, den künftigen Schwiegervater gewissermaßen ums Gnadenbrod zu bitten, und beschloß, vor jedem andern Schritte sich irgendwie eine selbständige Lage zu verschaffen.
Der Rainbauer aber sagte zu sich: » Eines hat der Bursche gezeigt, daß er den Kopf auf dem rechten Flecke hat; wenn ich nun wüßte, daß es mit seinem Herzen ebenso bestellt wäre, so wollte ich ihn heute noch zum Schwiegersohne annehmen.«
*
Seit dem Abenteuer, welches zu Ende der Erntezeit das ganze Kirchspiel auf dem Weidenhofe versammelt hatte, waren Monate vergangen. Der Aerger des alten Bauern über den tollen Streich seines Großneffen war verraucht. Gerne hätte er den rüstigen Burschen wieder um sich gehabt; denn mit ihm schien aller Friede und Segen von dem Hofe gewichen zu sein. Die Knechte, welche vordem viel mehr durch das Beispiel und den stets fröhlichen Muth Peters als durch die Befehle des grämlichen Alten zur Arbeit angetrieben wurden, zeigten sich nun lässig, und wenn sie auch pflügten und die Wintersaat bestellten, so war das trotz alles Scheltens nicht mit der Art und Weise zu vergleichen, wie zu Peters Zeiten die Felder besorgt wurden. Der Winter, der dann mit Schneegestöber und großem Froste hereinbrach, so daß der nahe Bodensee fast ganz zufror, brachte dem alten Manne der Reihe nach verschiedenes Siechthum, und endlich fesselte ihn das Zipperlein bleibend an die warme Stube und den gewaltigen Kachelofen.
Da saß er nun den lieben langen Tag, ohne daß es ihm möglich gewesen wäre, das Treiben der Knechte und Mägde in Feld und Stall zu überwachen, und hatte Zeit genug, darüber nachzudenken, wie sehr es ihm zu statten käme, wenn der Peter noch auf dem Hofe wäre. Mehr als einmal murmelte er vor sich hin: »Es wäre doch einer aus der Verwandtschaft, und er ist mir eigentlich stets ergeben gewesen und hat den schlimmen Streich wohl nicht so böse gemeint.«
Doch konnte der Alte es nicht über sich bringen, dem Peter auch nur eine Silbe von seinem Siechthume nach Stockach hinein zu melden. »Das hieße ihn ja bitten, er möge so gnädig sein und wieder kommen,« sagte er auf eine ähnliche Vorstellung des Pfarrers, »und ich denke, der erste Schritt wäre doch des Jungen Sache.«
Allein Siechthum und das Gefühl der Verlassenheit machen auf die Dauer auch viel starrere Herzen mürbe als das des Weidenbauers, und da eines Sonntag-Nachmittags im Jänner der Rainbauer nach vielen Jahren zum erstenmal die Schwelle des Weidenhofes überschritt, um dem kranken Nachbar einen christlichen Besuch abzustatten, lief dem alten Manne das Herz über, und er klagte dem Besucher seine Verlassenheit.
»Hm, wenn der Peter noch da wäre«, meinte der Rainbauer, dem die Stimmung des Kranken ganz erwünscht kam.
»Ja, wenn,« jammerte der Alte.
»Na, Nachbar, Ihr hättet ihn den letzten Herbst auch nicht fortjagen sollen.«
»Freilich, freilich! Aber ärgert Euch so, wie ich mich an jenem Morgen ärgerte, und bleibt noch vernünftig!«
»Ja, ja, es war ein toller Streich; aber ich glaube nicht, daß der Junge es so schlimm meinte, und dann – Ihr wißt, ich rede immer frisch von der Leber weg – hattet Ihr auch eine kleine Lection verdient.«
»Sie war stark, sie war gesalzen, Nachbar; aber freilich, böse gemeint war sie nicht, und ich wollte, der Bursche wäre noch da. Wo ist er? Was treibt er? Ich habe kein Wort mehr von ihm gehört, seit er den Hof verließ. Ihr wißt wohl Näheres von ihm; ich glaube, er freit um Eure Tochter – nicht?«
»Wohl möglich, daß ihm derlei Gedanken kamen,« meinte der Rainbauer lachend; »aber seitdem er vom Hofe fort ist, haben wir weiter nichts von ihm gehört, als: er wolle sich erst eine selbständige Lage schaffen, bevor er an eine Heirat denke. Soviel ich weiß, ist er in Stockach bei einem seiner Brüder und lernt das Brauen.«
»Das Brauen – er, ein so tüchtiger Bauer!«
»Ich werde die nächste Woche nach Stockach hinein auf den Kornmarkt fahren – möglich, daß ich ihn da sehe. Soll ich ihm sagen, Ihr wünschtet ihn wieder auf dem Weidenhofe zu haben?«
»Nein, nicht so; das sähe ja aus, als wollte ich ihn um Verzeihung bitten, und das ist doch eigentlich seine Schuldigkeit, wie ich meine.«
»So soll ich ihn wenigstens von Euch grüßen?«
»Grüßen – das wäre schier dasselbe; aber wißt Ihr was? Erzählt ihm einfach, wie elend es um seinen alten Vetter stehe und wie einsam er lebe. Ich denke, so wird es ihm schon nahe genug gehen, und er wird von selber auf den Gedanken kommen, mir in meiner Noth beizuspringen.«
»Topp! Und wenn er daraufhin wirklich zu Euch herauszieht, so habe auch ich dem Burschen eine fröhliche Botschaft zu melden«, sagte der Rainbauer, und die Nachbarn schieden.
Peter weilte inzwischen wirklich in Stockach und tummelte sich rüstig in der Brauerei seines ältesten Bruders. Anstellig und geschickt, wie er war, hatte er sich in den wenigen Monaten zu einem recht brauchbaren Gehilfen herangebildet, und noch weit größere Dienste als in der Brauerei leistete sein Witz in der Wirtschaft, welche mit dem Braugeschäfte verbunden war. Seit Peter im »Schwarzen Bären« weilte, wurde derselbe doppelt so stark besucht; denn jedem Gaste wußte der fröhliche Bursche eine lustige Geschichte zu erzählen oder doch einen treffenden Spruch zu sagen. Es ist daher nicht zu wundern, daß der Narren-Peter zu den Vorberathungen der Fastnachtsspiele gezogen wurde, als sich die Mitglieder der Narrenzunft nach altherkömmlicher Sitte am ersten Sonntag nach Dreikönig im Narrenwirtshause versammelten.
Die Narrenzunft von Stockach hat nämlich von alten Zeiten her eine eigene Lade, welche den Narrenschatz mit den Urkunden des Narrengerichtes enthält; es ist dieselbe eine eichene, mit Schnitzereien verzierte Kiste. Diese wird alljährlich, am Aschermittwoch Abend, in ein anderes Brauhaus übertragen, welches nun für das nächste Jahr das Narrenwirtshaus ist und in welchem sich die Glieder der Narrenzunft zu ihren Berathungen zu versammeln haben. In jenem Jahre aber war der »Schwarze Bär« das Narrenwirtshaus.
»Und närrischer,« sagten die Leute, »sei es seit Jahren bei den Narrensitzungen in Stockach nicht hergegangen, als da ihnen der Narren-Peter beiwohnte.« Es dauerte auch gar nicht lange, so war er trotz des altbewährten Narrenvaters die Hauptperson. Auf seinen Vorschlag hin beschloß man, dieses Jahr das National-Epos von den sieben Schwaben mit dem Spieße zu Nutz und Frommen eines lachlustigen Publikums dramatisch aufzuführen. Er selbst übernahm dabei die Hauptrolle und machte bei den Proben den sechs übrigen Helden ihre Partien so lange vor, bis die Einzelnen wußten, was sie zu thun und zu sagen hatten; denn an eine schriftliche Ausarbeitung dieser Fastnachtsspiele dachte dazumal niemand.
Um so nothwendiger war es natürlich, daß keiner der einmal eingeübten Spieler und am allerwenigsten der Hauptdarsteller von der einmal angenommenen Rolle zurücktrat, und daher mußten sich die Betreffenden verpflichten, vor Beendigung der Fastnachtsspiele Stockach nicht zu verlassen.
Diesen Umstand hatten der kranke Weidenbauer und sein Nachbar nicht in Erwägung gezogen, als sie an jenem Sonntag-Nachmittag über die Art und Weise verhandelten, wie Peter wieder zu seinem alten Oheim zurückzubringen sei. Als daher letzterer wirklich am nächsten Markttage mit dem Burschen zusammentraf und demselben von der Krankheit und Verlassenheit des alten Mannes erzählte, schien der Bursche zwar recht sehr von dem Leide seines Verwandten bewegt, erklärte aber sofort die Unmöglichkeit, demselben vor dem Aschermittwoch beizuspringen.
»Sobald die Fastnacht vorbei ist, will ich recht gerne wieder auf den Weidenhof,« sagte er; »aber bis dahin ist es mir rein unmöglich. Ich würde meinem Bruder einen zu empfindlichen Schaden zufügen und habe überdies mein Wort verpfändet, Stockach nicht früher zu verlassen. Seid also so gut und vertröstet meinen lieben Vetter für diese drei Wochen.«
»Hm,« meinte der Rainbauer, »ich verstehe; hätte übrigens doch nicht geglaubt, daß Euch an den Stockacher Narren und ihrem Firlefanz mehr gelegen wäre als an Eurem alten Vetter. Aber thut, was Ihr wollt; ich will es dem kranken Manne melden.«
Damit drehte der Rainbauer dem Burschen fast verächtlich den Rücken. Es war Peter augenblicklich klar, daß seine Antwort dem Bauern sehr mißfallen habe. Aber was wollte er thun? Umsonst versuchte er demselben seine Gründe klar zu machen; er mochte sagen, was er wollte, so lautete die Antwort doch nur: »Es ist schon gut – ich kann mir ja denken, daß es hier im ›Schwarzen Bären‹ in Stockach lustiger zugeht als draußen auf dem einsamen Weidenhofe bei dem kranken und wunderlichen Vetter.«
So trennten sich die beiden, und Peter hatte dabei das Gefühl, daß er dem Ziele seiner Wünsche ferner stehe als jemals.
Inzwischen nahte der Fasching. Am Sonntag Sexagesimä wurde in gewohnter Weise das künftige Fastnachtsspiel feierlich verkündet. Dabei zogen nach der Vesper sämtliche Laufnarren und Gerichtsnarren der Zunft in feierlichem Umzuge zu Roß und Wagen durch die Gassen des Städtchens, und endlich verkündete der Narrenvater unter dem Jubel der lieben Stadtjugend und zur Freude der ehrsamen Bürgerschaft, daß die »Große Komödie von den sieben Schwaben mit ihrem Spieß« gespielt werden solle. Am darauffolgenden Mittwoch fällten sie dann den »Narrenbaum«, eine hohe Tanne, deren Aeste bis an den höchsten Wipfel abgeschnitten werden, und am nächsten Morgen, dem »fetten« oder »schmutzigen« Donnerstag, zogen die Kinder dieses Abzeichen der ewig blühenden Narrenzunft von Stockach auf den Marktplatz zu dem Mittlern Marktbrunnen, in dessen Säule vormals der alte »Narrenbrief«, das Diplom von 1351, aufbewahrt wurde. Dem Zuge voraus schritt der Narrenbüttel mit Britsche und Schellenkappe; dann folgte die Stadtmusik und endlich in feierlichem Schritte der Narrenvater mit allen Gerichts- und Laufnarren. An der Tanne befestigten sie eine Tafel mit der Inschrift: »Stammbaum aller Narren«, und schließlich wurden bei einem guten Trunke im »Schwarzen Bären« alle Gerichtsnarren für die kommenden Sitzungen in Amt und Pflicht genommen. Auch das Seelenamt, das für den Fastnacht-Montag nach frommer Väter Sitte zu Gunsten der verstorbenen Mitglieder der Narrenzunft von alters her gestiftet war, wurde geziemend gefeiert, und so brach der Hauptnarrentag, der Fastnacht-Dienstag, an, der von jung und alt in der Stadt Stockach schon lange herbeigesehnte Tag der tollen Fastnachtsspiele.
Aber nicht nur in der Stadt, viele Stunden im Umkreise rüsteten sich die Leute zur jährlichen Fahrt zu dem Stockacher Narrengerichte. Die strenge Kälte des Jänner hatte sich gebrochen, und ausnahmsweise brachte der Hornung schöne Tage und mildes Wetter. So wimmelten alle Straßen nach Stockach von Fußgängern und Fuhrwerken.
Auch der Reinbauer spannte sein Bernerwägelchen ein. Er hatte dabei seine eigenen Absichten. »Wenn mein Weib und Verena sehen,« dachte er, »was für ein leichtfertiger Hanswurst der Peter geworden ist, so wird sie das eher von ihrer Liebe zu dem Burschen bekehren als zwei Dutzend Predigten, welche sie von meinen Lippen nur mit halbem Ohre anhören.« Der Mann ging bei dieser Schlußfolgerung von der falschen Voraussetzung aus, daß sein Weib und sein Töchterlein einen ebenso großen Abscheu vor allem Komödiantenthum hegten wie er selber.
Uebrigens waren die Bäuerin und Verena mit dem Plane einer Faschingsfahrt nach Stockach von Herzen einverstanden. Dem Mädchen fiel auch noch ein, der alte Weidenhofer, welchen die gute Witterung von seinem Zipperlein erlöst, werde vielleicht die Fahrt gerne mitmachen. Schlau hatte sie in diesem Freundschaftsbeweise gegen den kränklichen Nachbarn das Mittel entdeckt, den Vater zur Einkehr im »Schwarzen Bären« zu bestimmen, und der Rainbauer, der mit dem alten Weidenbauer nun recht gut Freund war, ging gerne auf den Vorschlag Verenas ein. So trabte der Lieblingsschimmel mit seinem Doppelpaare durch die Thore Stockachs und hielt kurz vor 11 Uhr beim »Schwarzen Bären«.
Peter war gerade dem Wirtshause gegenüber an der großen Schaubühne beschäftigt, wo die letzten Planken befestigt und lustige grüne Tannenkränze um die Stangen und Bogen geschlungen wurden, als das Fuhrwerk des Rainbauern über das Pflaster daherrollte. Kaum sah der Bursche die neuen Ankömmlinge, so warf er den Hammer von sich und war in einem Satze an dem Wagen, den alten Vetter und den Rainbauern, namentlich aber die Bäuerin und ihre Tochter auf das herzlichste begrüßend. Man kann nicht sagen, daß seine Grüße allseitig mit der gleichen Freundlichkeit beantwortet wurden. Während die Bäuerin recht leutselig dankte und Verena den Händedruck des Burschen mit unverhohlener Wärme erwiderte, zeigte sich ihr Vater sehr kühl und sagte spöttisch, er habe es sich nicht versagen können, den Narren-Peter in seinem eigentlichsten Berufe als Hanswurst den Seinigen zu zeigen. Auch der alte Vetter, dem Peter freundlich vom Wagen half, konnte die Erinnerung an den tollen Streich von der letzten Erntezeit nicht ganz verwinden, und obschon der Bursche seinen Fehler eingestand und darum bat, den alten Mann wieder auf den Weidenhof begleiten zu dürfen, so wollte das doch alles nicht die rechte Stimmung erzielen. Peter tröstete sich mit der Hoffnung, das Fest mit seinen lustigen Spielen würde auf den Abend bei seinen Freunden von selbst eine bessere Laune hervorrufen. So führte er die lieben Gäste durch das Gedränge des Hausflurs in eine saubere Kammer des obern Stockes, wo sie sich, ungestört von dem Lärme der großen Wirtsstube, gemüthlich niederlassen konnten.
»So,« sagte er, »hier vom Fenster aus könnt ihr euch den ganzen Fastnachtszug mit aller Bequemlichkeit anschauen und jedes Wort des Narrengerichtes und der Spiele vernehmen. Gerade gegenüber steht ja die Bühne, und was die Bedienung angeht, laßt nur mich sorgen. Bis 1 Uhr, da ich mit dem Zuge aufziehen muß, will ich selber den Wirt machen.«
Peter deckte flugs den Tisch und schleppte aus der Küche ein gutes Mittagsmahl herbei, wenn die Männer das kühle Bier und die saftigen Bratenstücke loben mußten, so thaten die Frauen dem süßen Fastnachtsgebäcke alle Ehre an. Als dann zum Schlusse der feurige Affenthaler in den Gläsern perlte und ein trefflicher Kaffee, dazumal noch kein so gewöhnliches Getränke, in mächtigen, mit zierlichen Sprüchen bemalten Schalen vor den Frauen dampfte, schien die Stimmung schon eine bedeutend günstigere zu werden. Das Hoffnungsbarometer unseres Narren-Peter stieg zusehends mit jedem Glase, welches der Rainbauer leerte.
Da mit einemmal trat ein Zwischenfall ein, der seine Wünsche aufs neue in Frage stellte.
Peter war eben freudestrahlend in die untere Gaststube getreten, als einer seiner Freunde, der gleichfalls an den Faschingsspielen betheiligt war, ihn mit der Frage beiseite zog: »Man sagt, der alte Bauer, der vorhin ankam, sei dein Vetter, dem du letzten Herbst den Erntewagen so meisterhaft aufs Scheunendach hextest?«
»Ja, was soll's?« entgegnete Peter.
»Ha, ha, ha, trefflich, herrlich – das gibt einen Kapitalspaß, – das hast du prächtig gemacht, daß du den Alten auf heute nach Stockach hereinlocktest. Die Geschichte ist zehnmal mehr werth als alle sieben Schwaben zusammen!« lachte der Bursche.
»Ums Himmels willen! Ihr werdet doch nicht –«, entgegnete Peter, dem wie ein Blitz aus heiterem Himmel der Gedanke durch den Kopf fuhr, seine Kameraden könnten in ihrem Fastnachtsübermuthe dem alten Manne einen neuen tollen Streich spielen.
»Und ob wir werden! Meinst du, du allein könntest eine Komödie erfinden und einfädeln? Schon lange haben wir untereinander ausgemacht, daß gleich nach den ›Sieben Schwaben‹ die Kapitalgeschichte von dem Haferfuder gespielt werden müsse, und nun hast du es so herrlich eingerichtet, daß der alte Narr zu uns hereinkam. Gleich werde ich Anzeige machen, daß die Laufnarren den Bauern vor das grobgünstige Gericht laden. Daß sein Wagen auf das Dach des ›Schwarzen Bären‹ hinaufgeschafft wird, versteht sich von selber.«
»Und ich sage dir, weder das eine noch das andere geschieht, oder ich – so höre doch! Umsonst, da läuft er weg. Und keine Seele wird mir glauben, ich sei an der heillosen Geschichte unschuldig, und der Rainbauer am allerwenigsten! Aber wenn es auch nicht Verenas wegen wäre; ich mag um keinen Preis dem alten Manne diesen neuen Aerger anthun lassen. Er muß fort, augenblicklich!«
Hiermit sprang Peter in eiligen Sätzen die Treppe hinauf und theilte in wenigen Worten mit, was von der Narrenzunft gegen den alten Weidenbauer geplant werde. Man kann sich denken, wie unangenehm die Botschaft in die fröhliche Stimmung des kleinen Tischkreises hineinklang.
»Da siehst du, was dein toller Streich für Folgen hat,« rief der alte Vetter. Die Frauen jammerten, daß sie, wenn sie jetzt fort müßten, um den besten Theil der Faschingsfreude kämen, und der Rainbauer beobachtete halb ärgerlich, halb doch wieder befriedigt den Schrecken des jungen Burschen und dachte bei sich: »Sollte das nur Komödie sein und sollte es dem Peter wirklich leid thun, oder stellt er sich nur so und spielt mit unter der Decke?«
Bevor man zu einem Entschlusse kommen konnte, polterte eine lachende und schreiende Schar die Treppe herauf; es waren die Laufnarren, den Narrenbüttel an ihrer Spitze, die mit Britsche und Schellenkappe in die Kammer traten, um den Weidenbauer im Namen des grobgünstigen Gerichtes zu verhaften. Ihnen nach drängte Kopf an Kopf die jubelnde Menge.
Der Narrenbüttel fragte: »Wer von den beiden ist der Weidenhofer Bauer?«
»Der bin ich,« sagte dieser, »was soll's?«
»So verhafte ich Euch im Namen des grobgünstigen Narrengerichtes von Stockach und lade Euch auf heute Nachmittag 2 Uhr vor seine Schranken.«
»Ich bin kein Stockacher – was geht mich Eure Narrenzunft an?«
»Als ob das einen Unterschied machte! Steht es nicht im Narrenbriefe von 1351 und in der neuen Satzung von 1687, daß von Mariä Lichtmeß bis zum Sonntag Lätare jedermann, so keine obrigkeitliche Verrichtung hat, dem grobgünstigen Narrengerichte Gehorsam schulde? Entweder fügt Ihr Euch willig, oder wir werden Euch nach altem Brauche und Herkommen mit strohenen Ketten binden, im Fastnachtszuge mitführen und gewaltsam vor die Schranken des grobgünstigen Narrengerichtes stellen.«
»Halt, halt, Gevatter Narrenbüttel,« fiel hier Peter ein, »er kann statt seiner einen Bürgen stellen, welcher sich für ihn dem grobgünstigen Gerichte überantwortet.«
»Das kann er, meiner Treu'! Aber wo wird sich der Narr finden, der für den alten Bauern eintritt und sich gegebenen Falles für ihn britschen oder in den Brunnen werfen läßt, wenn das dem hohen Gerichte das rechte, grobgünstige Urtheil scheint?«
»Der Mann ist gefunden; ich selber trete für ihn ein und will ihn, so gut ich es vermag, gegen die Folgen meines eigenen tollen Streiches vertheidigen.«
»Ist das Euer Ernst, Narren-Peter?«
»Mein voller Ernst.«
»Nun denn, wie Ihr wollt; es wird so vielleicht auch noch lustiger – sollen wir Euch mit den Strohketten binden oder folgt Ihr uns freiwillig?«
»Freiwillig – ich muß ja so wie so im Zuge mitreiten. Sagt nur dem Narrenvater, daß er meinen Fall zuerst verhandle.« Dann fügte er, zu dem alten Manne gewendet, bei: »Es ist das einzige, was ich im Augenblicke für Euch thun kann, und ich will mit den Burschen besser fertig werden, als das Euch gelingen würde.«
Dann verließ er mit dem Narrenbüttel die Kammer.
»Es sitzt doch mehr Herz in dem Burschen, als ich gemeint hatte«, sagte der Rainbauer nicht ohne Befriedigung, als die Thüre sich hinter Peter geschlossen hatte. »Schaut nicht so bestürzt drein, Nachbar. Euer Vetter wird sich besser als Ihr aus der Geschichte zu ziehen wissen, dafür stehe ich, und wenn er nicht etwa einen neuen Schalksstreich mit uns vorhat, so will ich ihm seine freiwillige Bürgschaft hoch anrechnen.«
Mit diesen Worten hatte der Rainbauer eine Saite angeschlagen, deren Klang bei seiner Frau und seinem Töchterlein gar gerne gehört wurde, und freudig stimmten sie in das Lob des wackern Burschen ein, dem natürlich der alte Weidenbauer, eingedenk des Schreckens, aus dem ihn Peter soeben befreit hatte, kräftig beistimmte. In seiner Rührung schenkte er sich und seinem Nachbar die Gläser aufs neue voll und trank sogar auf das Wohl Peters.
Da tönten lustige Fanfaren unten von der Straße her und lockten nicht nur die Frauen, sondern auch die beiden Alten an das Fenster. Kopf an Kopf drängte und wogte die Menge auf dem Platze und in den anstoßenden Gassen. Die Laufnarren, welche sich nun in großer Zahl in ihrem althergebrachten Kostüme, dem sogenannten »Narrenhäs«, eingefunden, gaben sich zum großen Jubel der Jugend alle Mühe, dem Zuge den nöthigen Raum zu schaffen. Allein wie sie auch die Schellen schüttelten und mit Narrenkolben und an Peitschenstielen befestigten Blasen klatschend auf das vordrängende Volk schlugen: es wollte nicht viel helfen. Erst als die Pferde der Musikbande nahten, öffnete sich von selbst die nöthige Gasse. Der Stadtmusik folgten in gemessenen Zwischenräumen der Reihe nach sieben mit Kränzen und Fahnen geschmückte Wagen, welche in bunten Bildern die sieben verschiedenen Gaue, die Heimat der sieben großen Heroen des Schwabenlandes, darstellten. Am meisten gefielen die Wagen der »Gelbfüßler« und der »Knöpfleschwaben«; denn während jene vor aller Augen geschäftig waren, das berühmte Faß voll Eier mit ihren Füßen einzustampfen, wurden von den letztern unaufhörlich riesige Knödel aus der brodelnden Pfanne gefischt und unter das jubelnde Volk geworfen. Hei, wie sich da ein Dutzend Arme reckten, um die nationale Bombe zu haschen, und welch schallendes Gelächter sich erhob, wenn der leckere Esser durch die einladende Teighülle in eitel Sägspäne oder Häcksel biß!
Als Schluß des historischen Zuges kamen auf reichverzierten Wagen die sieben Helden selbst, malerisch an dem großen Spieße in Schlachtordnung gruppirt. Die beiden letzten Wagen waren seit alter Zeit ständige Figuren im Stockacher Zuge und durften niemals fehlen. Der eine trug die »Narrenmutter«, eine uralte, monströse weibliche Figur, welche eine Zunge von rothem Tuche herausstreckt. Aus ihren weiten Kleidern schlüpfen oft zwanzig Paare junger Narren und belustigen das Volk mit ihren Sprüngen und Späßen. Der andere trug den Narrenvater mit dem komisch-ernsten Collegium der zwanzig Beisitzer des grobgünstigen Gerichtes. Mächtige Perücken deckten die Schädel der Richter, und riesige Brillen lasteten auf ihren Nasen.
Von dem Fenster, an welchem die beiden Bauern mit den Frauen standen, nahm sich der bunte, fröhliche Zug mit seinen wechselnden Bildern ganz prächtig aus, und noch war er nicht zur Hälfte vorübergezogen, so hatte der allgemeine Jubel und die laute Fastnachtslustigkeit den letzten Rest des Unmuthes aus der Brust der beiden Nachbarn verscheucht. Denn fröhliches Lachen ist ebenso ansteckend wie Trübsal und Trauer. Als die Knöpfleschwaben vorüberzogen, war der Rainbauer so glücklich, eines der emporgeworfenen Knöpfle aufzufangen. Natürlich reichte er es seiner Gertrud, und da diese tapfer in die Sägspäne biß, kam der wohlbeleibte Mann in ein so unbändiges Lachen, daß ihm die hellen Thränen über die Backen hinabrollten. Erst als der letzte Wagen vorbei war, kam er wieder etwas zu Athem und trank ein Glas auf die Gesundheit aller ehrlichen Schwaben.
Das Ende des Zuges war kaum vorüber, so nahten sich von der andern Seite auch schon wieder die ersten Laufnarren mit der Musikbande. Unter den Fenstern des »Schwarzen Bären« reihten sich nun die Wagen auf, während die Gerichtsnarren in feierlichem Zuge das gegenüberstehende Gerüste beschritten und sich rechts und links vom Narrenvater auf ihre Stühle hinter dem grünen Tische niederließen.
Unsere beiden Bauern spitzten die Ohren, als nun der Narrenvater anhub und in wohlgesetzter Rede das Gericht für eröffnet erklärte. Dann rief der Narrenschreiber den Namen Peter Kühnes, zubenannt »der Narren-Peter«, und der Narrenbüttel erhob sich und führte mit den üblichen Verneigungen den Vorgeforderten vor das grobgünstige Gericht.
»Jetzt paßt auf!« sagte der Rainbauer und stieß seinen Nachbarn mit dem Ellenbogen an.
»Ihr steht in Vertretung Eures Oheims hier«, begann der Narrenvater. »Der ist angeklagt, ein gar närrisches Ding veranlaßt zu haben, daß man ihm den Erntewagen, mit welchem er am Sonntag einfuhr, aufs Scheunendach setzte.«
»Ei, was kann er dafür; ich denke, es war ihm leid genug. Klaget lieber die losen Burschen an, die dem ehrlichen Manne den Schalksstreich spielten. Und damit Ihr nicht gar zu lange nach den Schuldigen fahnden müßt, wohlan, ich war der Rädelsführer!«
»Der Blitzjunge!« sagte der Rainbauer. »Er dreht ihnen den Spieß um!«
»Hm, da muß ich erst die gestrengen Herren vom grobgünstigen Gerichte hören, was meint Ihr, verdient der Junge angeklagt zu werden oder der Alte?«
»Da wir den Jungen einmal haben, so wollen wir einstweilen über ihn urtheilen,« meinte der Obmann, und die Schöffen fanden den Grund närrisch genug, daß sie ihm ohne weiteres beipflichteten.
So wurde denn unter großem Jubel des Volkes der Fall verhandelt und endlich beschlossen: 1. er sei würdig, zum ewigen Andenken ins Narrenbuch eingetragen zu werden; 2. Peter Kühne dürfe zu der von seinem Ahnherrn ererbten Narrenkappe auch noch den Erntewagen auf dem Scheunendache im Wappen führen.
Peter erklärte, er müsse sich zwar dem Spruche fügen, habe nun aber auch seinerseits Klage vor dem grobgünstigen Gerichte zu führen. Dann setzte er auseinander, wie einige Glieder der Narrenzunft insgeheim neben dem in öffentlicher Sitzung bestimmten noch ein neues Fastnachtsspiel aufzuführen beschlossen hätten; das sei aber gegen die alten Bräuche der Zunft, welche stets gemeinschaftlich am Sonntag nach Dreikönig die Fastnachtsspiele ausmache und keine andern daneben dulde. Er trage also darauf an, daß man bei dem alten Herkommen verbleibe und auch dieses Jahr nur die gemeinsam beschlossenen aufführe.
»Das wird er nicht durchsetzen,« meinte der Rainbauer. »Nachbar, Ihr werdet Euern Wagen noch einmal auf dem Dachfirste sehen.«
Wirklich war das grobgünstige Gericht nur zu geneigt, dem schaulustigen Publikum über die alten Bräuche hinaus ein Zugeständniß zu machen. Aber Peter hielt fest und sagte: »Thut, was ihr wollt! Entweder ihr gebt euer Wort, daß nichts weiter gespielt wird, oder ihr könnt ›Die sieben Schwaben‹ ohne mich aufführen!«
»Oho,« sagte der Narrenvater, »in jedem Falle habt Ihr Euch dem Spruche des grobgünstigen Gerichtes zu fügen –«
»Oder ich muß mich britschen lassen – so steht's in der Ordnung von 1687,« ergänzte Peter.
»Britschen und in den Brunnen werfen,« sagte der Narrenvater.
»Meinetwegen britscht mich und werft mich in den Brunnen; aber ›Die sieben Schwaben‹ werden nicht gespielt, wenn auch nur ein Rad von dem Wagen auf das Dach hinauf soll!«
»Prächtig, herrlich!« rief der Rainbauer, der, wie alle an seinem Fenster, diesem Vorgange mit der größten Spannung gefolgt war. »Bei meinem Leben, das hätte ich hinter dem Burschen nicht gesucht!« Dann strengte er seine Stimme an und schrie: »Auf ein Wort, grobgünstiges Stockacher Narrengericht! So ich recht berichtet bin, könnte man sich vom Britschen und Brunnenwerfen allenfalls loskaufen?«
»Mit einem halben Eimer Wein,« lautete die Antwort.
»Gut, ich zahle euch einen ganzen; da ihr seit anno 1743, wo die Stadt die Reben verkaufte, den Eimer aus dem Stadtkeller nicht mehr bekommt, wird euch der Wein lieber sein als der Wagenspektakel.«
»Einverstanden, einverstanden!« schrieen die Gerichtsnarren und die Laufnarren und alle durstigen Glieder der Narrenzunft.
»Und noch eines,« rief der Rainbauer, dem der Affenthaler und die allgemeine Freude die Zunge löste, »ich lade die ganze edle Narrengilde von Stockach auf den dritten Sonntag nach Ostern auf meinen Hof zur Hochzeit des Narren-Peter mit meiner Tochter, und bringt euer Narrenbuch mit! Wir wollen dann die wahren Beweggründe und die ganze Geschichte der Wagenhexerei nachtragen; ich weiß sie, und ihr würdet sie doch nie herauskriegen – und nun spielt ›Die sieben Schwaben‹!«
»Hurrah, es lebe der Narren-Peter und seine Braut!« scholl es aus hundert fröhlichen Kehlen, daß des Rainbauers Verena glühend roth sich hinter dem breiten Rücken ihrer Mutter versteckte.
Und man spielte »Die sieben Schwaben« mit großem Applaus. So gut aufgelegt, wie an diesem Tage, war der Narren-Peter bei keiner Probe gewesen, und das Lachen der guten Stockacher wollte kein Ende nehmen. Von dem Spektakel mit dem Wagen aber war keine Rede mehr.
Am dritten Sonntag nach Ostern führte Peter wirklich seine Braut heim auf den Weidenhof, den er von seinem alten Vetter inzwischen zu billigen Bedingungen gepachtet hatte, und der Rainbauer sagte:
»Ich denke, es wird gut gehen; der Bursche hat beides auf dem rechten Flecke – Kopf und Herz.«
So weit die Geschichte des Narren-Peter aus den verlorenen Bänden des Stockacher Narrenbuches.