
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Kurz nachdem Ilse ihr Sprachlehrerinnenexamen bestanden hatte, zog sich ihr Vater, mit dem Titel »Justizrat«, von der Praxis zurück.
Es folgten nun heitere Tage, denn im Hause Lutzners liebte man die Geselligkeit.
Eines Tages traf eine Einladung des Korps Arminia für den Justizrat nebst Familie ein, das ihren alten Herrn aufforderte, zur Jubelfeier der Leipziger Universität zu kommen.
»Nun, Ilse, was meinst du dazu?« fragte der Justizrat schmunzelnd, »wie wäre es, wenn wir eine Reise nach Leipzig unternähmen?«
»Ach, Papa, ich würde mich riesig freuen.«
»Nun, wir wollen hören, was die Mama sagt,« damit erhob sich der Justizrat und suchte seine Gemahlin auf.
Die Justizrätin war sehr entzückt von dem Gedanken und sagte sogleich zu.
Nachmittags war sie bereits mit Ilse auf dem Wege zur Schneiderin.
Ilse mußte unbedingt ein Ballkleid haben; ein weiteres zu den Kommersen, und sie selbst, die Frau Justizrätin, eine Gesellschaftstoilette.
»Wenn doch Lilli hier wäre,« sagte Ilse, »die würde mir am besten raten, was ich wählen sollte. Sie hat so viel Geschmack, und trifft immer das Richtige.«
»Wir werden auch das Richtige treffen,« erwiderte etwas scharf ihre Mama, die es peinlich empfand, daß ihre Tochter sich stets auf die ferne Freundin berief, während ihr die Mama doch gewiß maßgebender sein sollte. –
Die Schneiderin legte allerlei Journale vor, und endlich ward man einig, daß Ilse zum Ball ein weißes Tüllkleid auf rosa Untergrund erhalten sollte, und zu den Kommersen ein hellblaues Chiffonkleid auf weißem Grund.
Frau Justizrat wählte sich eine schwarze Empirerobe aus Chiffon, besät mit Jet und Steinen. Als einzig Farbiges schlug die Schneiderin einen Tuff Blumen oder eine volle Samtrosette vor, in welcher man eine Diamantagraffe befestigen könnte.
»Darüber könne man ja noch bei der Anprobe sprechen,« meinte sie. –
Sehr befriedigt gingen Mutter und Tochter heim.
Nun fanden täglich große Beratungen der Reise wegen statt.
Der Justizrat bestellte schon jetzt vorsorglicherweise zwei Zimmer in einem Hotel der inneren Stadt, denn schon meldeten alle Zeitungen, daß der Andrang der Fremden in Leipzig ein enormer sein würde.
Zu seiner Freude schrieb ihm ein Leipziger Kollege, daß er dem »alten Herrn« mit Gemahlin und Tochter in seiner Wohnung ein Fenster zur Verfügung stelle, von wo aus der Festzug bestens zu sehen sei.
Ilse erzählte bei Doktor Flatows, wie glücklich sie sei, die schönen Festtage mitmachen zu dürfen.
»Wir haben auch eine Einladung erhalten, mein Mann ist ja auch »alter Herr« im Korps Saxonia; wenn Lilli in Deutschland wäre, wären wir auch gefahren,« entgegnete Frau Doktor, »aber so – man wird bequem, wenn man älter ist, und liebt vor allem die Ruhe. Aber Ihnen, liebe Ilse, wünsche ich recht viel Vergnügen. Wenn die große Anprobe bei der Schneiderin sein wird, dann holen Sie mich nur ab, ich möchte meine Ilse im Staate gern sehen.«
»Mit Vergnügen, Frau Doktor, ich freue mich furchtbar auf meine schönen Kleider; das blaue kleidet mich am besten. Die erste Anprobe ist schon vorüber.
Der Mutter steht ihre Robe auch vorzüglich, der weiche, schwarze Chiffon nimmt sich zu ihrem blonden Haar ganz prächtig aus. Sie selbst werden es gewiß auch finden.
Aber nun, Adieu, und viele tausend Grüße an meine liebe Lilli, ich werde ihr recht schöne Festkarten von Leipzig aus schicken, damit sie wenigstens im Bilde am Feste teilnimmt. Nochmals adieu, liebe Frau Doktor!« –
An einem lachenden Julitag fuhr die Familie Lutzner in einem überfüllten Zug auf dem Dresdener Bahnhof in Leipzig ein.
Auf dem Perron schon drängte sich eine Menschenmasse, wie sie Ilse nie beisammen gesehen hatte.
Auf der Fahrt nach dem Hotel wogte und wallte es. Herren und Damen, Kinder und Studenten, Volk und Aristokraten, Uniformen und exotische Trachten, alles schob sich durcheinander, bildete ein unvergleichliches Straßenbild.
Die Häuser waren mit Girlanden und Teppichen geschmückt.
Fertige und halbfertige Tribünen sah man allenthalben, überall wurde gebaut, geschmückt und dieses oder jenes ausprobiert. Hohe Fahnenstangen und buntgestrichene Sockel reckten sich, noch halbfertig, empor. Arbeiter waren beschäftigt, die Tribünen, die zur Aufnahme der königlichen Familie und sonstigen hohen Herrschaften dienen sollten, mit rotem Tuch auszulegen. Ueberall klang das Hämmern und Pochen von Bauleuten, ein geschäftiges Hin und Her von Tausend und abermals Tausenden. –
Kaum waren Lutzners ein paar Stunden in Leipzig, hatten sich umgekleidet, gespeist und etwas geruht, als sich auch schon Rechtsanwalt Wenzel mit seinen beiden Töchtern, zwei allerliebsten Backfischen, zur Begrüßung der Familie einfanden.
Während der Justizrat mit seinem früheren Studiengenossen ein Lokal aufsuchte, in welchem man weitere Kollegen zu finden hoffte, führten die jungen Mädchen Frau Justizrat und Ilse zu ihrer Mutter, welche die Damen zum Kaffee erwartete.
Eine herzliche Begrüßung fand statt, und bald saß man in dem behaglich eingerichteten Wohnzimmer. Die Justizrätin und Ilse fühlten sich sofort wohl in dem gemütlichen Raum, der mit einem breiten Smyrnateppich bedeckt war.
Hohe gepolsterte Lehnstühle und Sofa mit persischen Bezügen gaben dem Ganzen etwas Trautes. Das Klavier füllte eine Ecke des Zimmers, in welcher sich eine Gruppe von Blattpflanzen erhob.
Auf einer geschnitzten Staffelei stand das wohlgelungene Bild des Hausherrn.
Geöffnete Flügeltüren führten zum Herrenzimmer. Ilse fiel sofort die umfangreiche Bibliothek ins Auge. Ein mächtiger Schreibtisch stand am Fenster. Ein bequemer Diwan, riesige englische Ledersessel luden zum Sitzen ein.
Von den dunklen Möbeln hoben sich die weißen Statuetten der Venus von Milo und des Apoll von Belvedere wirkungsvoll ab.
Einige gute Stahlstiche bedeckten die Wände. Die roten Tapeten, die roten Vorhänge, durch die goldige Sonnenstrahlen leuchteten – all dies war überaus wohlig und wirkte anheimelnd.
»Hier muß es sich gut arbeiten lassen,« dachte Ilse; das Zimmer gefiel ihr ungemein. –
Nun saß man um den zierlich gedeckten Kaffeetisch und plauderte von allem möglichen miteinander.
Ilse brannte darauf, etwas von der Stadt zu sehen, und war nun froh, als Else Wenzel, die älteste Tochter des Hauses, sie fragte, ob es ihr recht sei, ein wenig durch die Straßen zu bummeln. –
Schnell schlüpfte man in die Umhänge, setzte die Hüte auf und hinab ging es.
Die Justizrätin, die sich von der Reise angegriffen fühlte, beobachtete vom Fenster aus interessiert die sich schon bemerkbar machende Festfreude.
Währenddessen wandelten die jungen Mädchen durch die Straßen dem Augustusplatz zu.
»Sehen Sie, Fräulein Lutzner,« erklärte Anny, »dort ist die Universität mit der herrlichen Pauliner-Kirche. Hier das Museum, dort drüben das neue Theater, in der eine Festvorstellung stattfinden wird. Seitwärts das große Gebäude ist die Hauptpost. Und nun schauen Sie sich unseren großartigen Augustusplatz an, auf den wir Leipziger stolz sind.«
Auf dem Mendebrunnen spielten die Wasser, aus Nereiden, Puten, Delphinen, kamen sie heraus, stiegen hoch und fielen in feinen Strahlen in das riesige Bassin zurück.
»Ja, es ist hier wunderhübsch,« sagte Ilse.
»Weiter, weiter,« drängte Else, »wir können hier nicht stehen bleiben, kommen Sie, wir wollen Ihnen die große Halle auf dem Meßplatz zeigen, in der der große Kommers abgehalten werden wird. Sie sieht riesig imposant aus.«
»Denken Sie, Fräulein,« fiel Anny ein, »die Errichtung derselben kostet 80 000 Mark, und in der Zeitung steht, daß sie nach dem Fest wieder abgebrochen werden soll.«
»Aber weshalb denn?« fragte Ilse.
»Weil man den Platz wieder braucht. Dort findet unsere Detailmesse statt. Zur Messe müßten Sie einmal herkommen, Fräulein, da ist es zu lustig. Da gibt es Luftballons, Schaukeln, alle Arten Karussells, Schaubuden, Schnellphotographen, Ausrufer, über die man sich krank lachen könnte.
Und zu kaufen gibt es allerhand Erdenkliches unglaublich billig. Porzellan, Glaswaren, Bekleidungssachen, und alle möglichen Nichtigkeiten, die zu erwerben einem ungeheuren Spaß machen.«
»Mama meint,« fiel Else ein, »man dürfe gar nicht so oft auf die Messe gehen, weil man sich durch die billigen Preise verleiten läßt, allerlei unnütze Gegenstände zu kaufen.«
»Sehen Sie dort hinab,« unterbrach ungeduldig Anny. »Dort geht der Weg nach Lindenau. Berühmt durch das wunderschöne Lied:
»Wir gehn nach Lindenau,
Da ist der Himmel blau.«
»Ja,« lachte Ilse, »das schöne Lied kenne ich auch, das hat die Runde gemacht.«
»Und dort drüben,« fuhr die andere fort, »liegt der Palmengarten, wo das große Festessen, an dem der König teilnimmt, stattfinden wird.«
»Doch, dort kommt unsere Elektrische, wollen wir zur Stadt zurückfahren.«
*
Am 31. Juli erreichte die Feststimmung ihren Höhepunkt.
Justizrats gingen bereits um 1 Uhr zu ihren Freunden auf dem Grimmaischen Steinweg, und doch hatten sie Mühe, durch die Menschenmenge hindurchzukommen. Man mußte allerlei Umwege machen, um zu seinem Ziele zu gelangen.
Endlich hatte man seine Fensterplätze eingenommen. Ilse saß mit den Töchtern des Hauses. Die Backfischchen hatten kleine Sträußchen gewunden, und vor ihnen in einem Körbchen lagen lose Blumen, die sie den Vorübergehenden zuzuwerfen gedachten.
Im Festzug wären Bekannte von ihnen, mit denen sie zur Tanzstunde gegangen waren, erzählten sie eifrig.
»Mein Bekannter,« sagte Anny, »reitet unter den Prager Studenten.«
»Und mein Tanzstundenherr,« meinte stolz die Jüngere, »ist unter den Jagdgästen des Herzogs August.« –
»Es sieht nach Regen aus,« ertönte es von dem Fenster her, an dem die Herren standen.
Und wirklich drohten finstere Wolken, das herrliche Fest zu stören.
Während die Herren bereits ungeduldig nach der Uhr sahen, – vorausgesehen war die dritte Nachmittagsstunde, zu welcher der Zug vorüberkommen sollte, – plauderten die Backfischchen lustig, und erzählten von ihrem Kränzchen und von dem letzten Tanzstundenball, den sie mitgemacht hatten.
Amüsiert hörte Ilse ihnen zu. Der sächsische Dialekt, in dem sie sprachen, gefiel ihr. Das Geplauder erinnerte sie an ihre eigene Backfischzeit, an die gute Edith, die nun auch schon so viele Sorgen kennen gelernt hatte. An das gute Seelchen, die goldene Lilli und an Herta.
Sie sah sich nach ihrer Mutter um, diese stand jetzt mit den Herren und der Hausfrau auf dem Balkon.
Eines der Backfische wurde abgerufen, um dem Zimmermädchen ein Tablett mit Wein und Kuchen abzunehmen, das sie nun herumreichte.
»Es wird voraussichtlich noch lange dauern, bis der Zug hier ist; mein Freund telephoniert mir soeben, daß er erst jetzt die Karl-Tauchnitz-Brücke passiert hat,« sagte der Hausherr, und die Dame des Hauses bat ihre Gäste, einen Imbiß einzunehmen.
Aber am Tisch zu sitzen, hatte man die Ruhe nicht, alle waren voller Erwartung.
Auf den Straßen drängte sich die Menschenmenge. Für Fuhrwerke waren die Feststraßen bereits Stunden zuvor gesperrt worden.
Schutzleute liefen hin und her, Tausende und Abertausende von Zuschauern suchten und fanden auch Platz.
Die Trottoire waren von dichten Mengen besetzt, und doch ging alles ruhig und wohlgeordnet von statten.
Hin und wieder sah man Samariter, das rote Kreuz am Arm, hin und her gehen, aber von Unfällen schien alles verschont zu bleiben.
»O weh,« sagte plötzlich Ilse, »dort drüben, der alten Frau scheint unwohl zu werden.«
»Weshalb steht sie auch in ihrem Alter so lange eingekeilt.«
»Wenn nur schnell Hilfe zur Hand ist.«
»Herunter kann man nicht, wir würden nicht durchdringen,« so sprach es durcheinander.
Da nahte schon die Sanitätswache. Man trug die Ohnmächtige in ein Haus.
Zu ihrer Freude konstatierte Ilse, daß das alte Weiblein nach einer halben Stunde wieder vor der betreffenden Haustür stand.
»Könnten wir ihr hier nicht ein Plätzchen einräumen,« bat sie die Hausfrau.
»Unmöglich, niemand käme mehr über die Straße,« hieß es.
Die Frau Justizrat, der das Großstadtleben schon in Vergessenheit gekommen war, konnte sich gar nicht satt sehen an den langen, langen Straßen, die vom Balkon aus weithin zu überschauen waren.
Von hüben und drüben wurden Zurufe laut, erwartungsvolle und ungeduldige.
Auf den Dächern standen Leute, ein paar Jungens kletterten auf die Schornsteine und setzten sich dort fest.
Die Backfische kreischten vor Lachen, als die Jungens ihnen von ihren hohen Sitzen herab mit Taschentüchern zuwinkten.
»Wißt ihr, was wir –?« platzte jetzt Anny heraus, ward blutrot, verbeugte sich vor Ilse und sagte: »Pardon, ich meinte nur meine Schwester –«
»Nun, sagen Sie nur, was wir wissen sollen.«
»Wir suchen schnell alle in Staniol gewickelten Konfektstücke aus den Bonbonnieren und werfen sie den Vorbeiziehenden zu, die müssen ja riesigen Hunger bekommen von dem langen Herumziehen.«
»Ja, ja,« rief Else und sprang auf. »Machen wir, wird gemacht!«
Aber auch die Erwachsenen fanden die Idee gut, und schnell ward Verschiedentliches zusammengesucht.
»Ich höre von weitem Musik,« rief jetzt die Hausfrau.
Sofort nahm ein jeder seinen Platz ein.
Nein, es war ein Irrtum.
Aber zu regnen begann es. Zum Glück aber nur huschweise. Doch Regenpfützen machten Plätze und Straßen für den Zug nicht besonders einladend.
Wieder sah man nach der Uhr ... jetzt – jetzt – sprengten Schutzleute heran.
Schnell das Programm zur Hand.
»Es werden nur lose Szenen in raschem Wechsel sein,« erklärt jemand. Aber niemand hört auf das Weitere, sehen will man, sehen!
Ein Musikchor naht!

Jetzt kommen sie wirklich! Die Backfische jauchzen und streuen ihre ersten Blumen auf die Köpfe der sechzehn Wappenherolde, die den Zug der Prager Studenten anführen. Sie symbolisieren vier Nationen: die sächsische, bayerische, meißnische und polnische. Ein Heroldsführer in spanischer Tracht führt eine Schar mönchisch gekleideter Studenten, wie sie im Sommer des Jahres 1409 in Leipzig einzogen.
Ihre Gewänder sind von bunter Farbe; ihre langhaarigen Köpfe mit Käppchen bedeckt. Ihnen folgen Scholaren, und zu Pferd in Eisen gekleidete Gestalten.
Hinter ihnen eine Musikgruppe von Querpfeifern und Dudelsackbläsern, Eseln mit Gepäck, und dann kommt der Professorwagen, der von lanzentragenden, bewaffneten Studenten umgeben ist.
Professoren zu Fuß, Magister und Baccalaureaten sind darunter.
»Wie verstaubt und müde sie alle erscheinen, so ganz getreu der damaligen Wirklichkeit,« sagt der Justizrat.
»Ich finde den Gedanken der Szenerie wundervoll, das Vergangene zieht lebend an uns vorüber.«
»Väterchen,« fragt Anny, und drängt sich zum nächsten Fenster hinüber, »weißt du, weshalb die Prager Studenten in Leipzig Einzug hielten?«
»Gewiß, mein Kind. Gerade auch wie in der Jetztzeit wütete 1409 im Böhmerlande zwischen Tschechen und Deutschen eine heftige Fehde. Der letzte deutsche Rektor, Hennig Boldenhagen, legte die Insignien der Universität und sein Amt nieder, weil König Wenzel zum Gespött der Herren seinen Küchenmeister zum Rektor der berühmten Schule ernannt hatte. Die Deutschen wanderten hierob aus Böhmen aus. 46 Professoren und Magister, 2000 Baccalaureen und Studierende sollen es gewesen sein. Ihr Ziel war Leipzig, wo sie die Gründung einer Universität erwarteten. Aber jetzt, Kind, laß uns schauen, da kommt das Ende der Gruppe.
Sieh, den Marketenderwagen, umringt von den lustigen Studenten in mittelalterlichen Kostümen mit kurzgeschlitztem Wams und enganliegenden Hosen. Das ist die Tracht des sechzehnten Jahrhunderts.«
»Else, dort kommt noch ein Wagen mit Ochsen bespannt, die bewaffneten Reiter hinter diesem sollen auch Blumen haben!«
In weitem Bogen flogen die Kinder Floras herab und wurden dankend und grüßend quittiert.
»Jetzt gebt ganz besonders acht, Kinder!« ermahnte der Hausherr seine Töchter. »Die zweite Gruppe stellt die Gründung der Universität Leipzig durch Markgraf Friedrich den Streitbaren dar. Ihr werdet den Einzug des Landesfürsten in die Stadt zu sehen bekommen.«
Man sah Markgraf Friedrich den Streitbaren nebst seinem Bruder Wilhelm, wie sie seinerzeit die Fremdlinge, an ihrer Spitze Hennig Boldenhagen, Johann Hofmann, Otto von Münsterberg willkommen hießen.
»Hollah!« Die Damen warfen den singenden Schülern, den Dominikaner- und Franziskaner-Mönchen aus den Leipziger Klöstern Konfekt zu.
»Ich fürchte, wir waren an eine falsche Adresse gekommen, das Aufheben des Konfektes stört die Würde der Gruppe,« sagte die Hausfrau.
Hinter den blumentragenden Knaben erscheint, von Bürgersöhnen gehalten, der purpurne Baldachin, unter welchem drei Bischöfe schreiten.
Ernst, würdig, fast düster ist diese Szene.
Feierlich, in gemessenen Schritten und schwarzer Kleidung naht der Bürgermeister von Leipzig.
Zwölf buntgekleidete Ratsherren beleben das Bild.
Sechsunddreißig weißgekleidete Mädchen mit Kränzen im Haar erhöhen den Reiz.
Sie halten ein Madonnenbild und ziehen einer Gruppe Bürgerfrauen voran, die im Kostüm des sechzehnten Jahrhunderts gekleidet sind.
Ihnen folgt der Festwagen der Universität.
Schnell liest man im Programm nach, was die plastischen Figuren, womit der Universitätswagen geschmückt ist, darstellen.
Der Wagen selbst stellt das alte Universitätssiegel dar.
Die Figuren geben die sieben Künste. Alle tragen ihre Attribute:
Die Grammatik – ein Buch.
Die Arithmetik – die Rechentafel.
Die Astronomie – den Himmelsglobus.
Die Geometrie – Zirkel und Zeichenrolle.
Die Rhetorik – Spiegel und Schwert.
Die Dialektik – das Buch.
Die Musik – die Leier und die Harfe. –
In Bewegung setzen den Wagen sechs prachtvoll eingeschirrte Rosse, überhangen mit goldgelben Decken, und gelenkt wird er von violett gekleideten Rosselenkern.
Farbenprächtig und mit Gold bemalt, leuchtet der Aufbau und stimmt mit den gotischen Kostümen der Damen, welche die Allegorien der Künste darstellen, überein.
Wiederum schreitet nebenher eine Gruppe girlandentragender Mädchen. –
Auf isabellfarbigem Pferde kommt ein stolzer Herold heran.
Er kündet die Ankunft des Rektors und neunzehn Professoren an.
Sechs Trompeter und Heerespauker und ein Troß glänzend bewaffneter Ritter und Knechte folgen. Hinter ihnen reiten Ritter in schwerer Rüstung auf gepanzerten Pferden, solche zu Fuß folgen, gerüstet mit Panzer und Schwert, mit geschlossenen Helmen.
Jetzt nahen die Edelleute in prunkvollem Gewand und rahmen farbenprächtig das letzte Bild dieser Gruppe ein.
Markgraf Friedrich der Streitbare reitet mit dem Herzog Heinrich auf weißen, reich mit Gold beschirrten Rossen daher.
Zwei weißgekleidete Pagen und vier Edelknappen umgeben die Landesherren und tragen deren Wappen.
Den Schluß bilden Edelleute und gepanzerte Reiter, Volk. –
Der Zug stockt etwas, die Beschauer haben Zeit, sich ein wenig zu ruhen.
Die jungen Mädchen schwatzen und grüßen überall hin.
Die anderen lassen das Gesehene auf sich wirken, man nimmt eine Erfrischung und jetzt heißt es wieder schauen.
Ein anderes Jahrhundert bricht an!
Der Einzug der Wittenberger Professoren und Studenten zu der Leipziger Disputation im Jahre 1519 gibt das Bild.
Der Gruppe liegt die Darstellung von den christlichen Verbindungen und den wissenschaftlichen Vereinen zugrunde.
»Seht, seht,« schrie Else, »da sitzt im Bauernwagen Martin Luther, der ist aber mager!«
»Der neben ihm sitzt, ist Philipp Melanchthon. Zweihundert Wittenberger, bewaffnete Studenten folgen.«
Jetzt kamen die feschen Jäger in roten Gewändern.
»Die meisten Blumen sollen sie haben. Das sind bildhübsche Burschen. – Fräulein Lutzner, der dort drüben auf dem Fuchs reitet, ist der Bruder meiner Kränzchenschwester – Richard Wolfsky.«
Der grüßte auch schon herauf, fing eine Nelke auf und steckte sie in den Mund.
Ein Blumenregen ergoß sich auch von den anderen Fenstern aus über die schmucken Jäger, und Kußhände nach allen Seiten hin werfend, sich verbeugend und grüßend ritten und schritten sie vorüber.
Inmitten dieser Gruppe ritt der eifrigste Förderer der Universität, Kurfürst Moritz.
Er war es, der dieser 1543 die großartigsten Besitzungen und Bücherschätze überwies.
Edelherren und Edeldamen zu Pferd folgten ihm, und als Schluß der Gruppe kam die Jagdbeute auf einem von vier Pferden gezogenen Jagdwagen.
Jäger mit Waldhörnern. Waldhüter, Falkoniere mit dem Jagdfalken – nichts fehlte dem Bilde versunkener Zeiten. –
Jetzt naht die Kurfürstin, umgeben von ihrem Hofstaat. Weiter geht der Zug, auf prunkvollem Pferde naht Herzog August.
Eine glänzende Kavalkade von Jagdgästen, Herren und Damen sind sein Gefolge.
Ein Trupp Reiter und eine Schar Treiber führen in ihrer Mitte einen gefesselten Wilddieb.
In einem Wagen sitzt der Kurfürst Moritz, neben ihm Rektor Kaspar Börner und dessen Räte, Cunnstadt und Carlowitz. Achtzehn Landsknechte in bunter spanischer Tracht bilden die Bedeckung.
Die Gruppe schließt mit Professoren und Studenten aus dem Zeitalter der Reformation.
»Die fünfte Gruppe, lieber Freund,« wandte sich Rechtsanwalt Wenzel an den Justizrat, »wird dich besonders interessieren. Das Programm meldet die Zeit des dreißigjährigen Krieges.«
Da kamen sie auch schon daher, sechzig Pappenheimer, geharnischte Ritter, in der Mitte Tilly und abgesandte Professoren. –
»Jetzt kommt bereits das achtzehnte Jahrhundert,« erklärt die Hausfrau, »schon von weitem sieht man die Allongeperücken.«
Nun nahten sie: die Herren mit engen Hosen, den Dreispitz auf dem Kopf, Jabots und Spitzenbesatz am Wams. Also gekleidet war die älteste Korporation der Universität im Jahre 1716.
»Schaut,« sagt die Hausfrau zu ihren Töchtern gewendet. »Da habt ihr Gottfried Wilhelm Leibniz, den großen Gelehrten. Und dort auf dem Bock des Schauspielerwagens der Neuberin sitzt Lessing, dessen »Nathan der Weise« ihr kürzlich im Alten Theater gesehen.«
Schauspieler und Schauspielerinnen begleiten den Wagen.
Plötzlich steht der Zug, und zum Entzücken der Menge, die ihnen zujubelt, steigen »Aktricen« aus dem Wagen der Schauspieler, und es folgt ein flottes Tänzchen auf offener Straße. Nicht lange, aber gerade genug, um einen sehr freundlichen Eindruck zu hinterlassen.
»Sieh doch, Mama, die Dame im weißen Atlaskleid läßt ihre Schleppe durch eine Regenpfütze gehen,« eiferte Anny, aber niemand hörte auf sie.
»Achtung, Kinder, Achtung, jetzt kommt Goethe,« ermahnte der Vater.
»Ich bin begierig, wie man diese Gruppe darstellen wird,« warf jemand ein.
»Sie wird als Spaziergang auf der Leipziger Promenade gedacht, und es spazieren Personen auf, die uns durch Goethe lieb und bekannt geworden sind.
Schauen Sie, da kommen schon die Roccocogestalten, dort drüben im Mittelpunkt ist Goethe. Da haben Sie Gellert, ah, und da naht Kätchen Schönkopf in Schnebbentaille und Paniers, und die Familie Oeser. Die anderen Gestalten sind mir nicht bekannt.«
Die Mädchen warfen Konfekt herab, Kätchen Schönkopf nickt herauf, die Herren grüßen, Goethe spendet ein holdseliges Lächeln – ein Jubel herrscht.
Jetzt kommt die Faust-Szene aus Auerbachs Keller.
Alles zieht langsam, wirkungsvoll vorüber.
»Du, du,« Anny stößt die Schwester an, »jetzt müssen wir acht geben, ob wir Fritz herausfinden, meine letzten Blumen soll er haben, die Lützower nahen!«
»Donnerwetter, das sieht prächtig aus,« ertönte es vom Nebenfenster.
Pferdegetrapp, Hörnerklang – die wilde, verwegene Jagd zieht zum Befreiungskriege aus.
»Hurra, Hurra!« erbrauste es, ein Grüßen, Blumenauffangen, und dann zieht es stolz dahin, ein Bild, von Kraft und Jugend strotzend.
»Nunmehr ist die älteste Epoche abgetan,« erklärte der Hausherr, »jetzt kommen die Chargierten des Korps in vollem Wichs.«
»Sie sind ebenso gekleidet wie beim vierhundertjährigen Jubiläum unserer Universität, das im Jahre 1809 stattfand,« sagte der Justizrat.
Mit der alten Universitätsfahne ziehen die schmucken Kommilitonen heran, ihnen folgen die Burschenschaftler. Das Ganze stellt die Rückkehr des Korps von einer Kneipe, und die der Landsmannschaften von einer Mensur dar. Eine Kneipe im Karzer wird auf einem Wagen mitgeführt, was allgemeine Heiterkeit hervorruft.
Nun kommt ein Bild, das die Erinnerung auffrischt an ein Fest auf der Wartburg, das 1817 dort gefeiert wurde.
Es galt der 300jährigen Jubelfeier der Reformation, das die Burschenschaftler ganz Deutschlands in Eisenach versammelt hatte. Den »heiligen Zug«, wie er in der Geschichte verzeichnet ist, ließ man nun wiedererstehen.
Die Fahne ist eine treue Kopie des Vermächtnisses der alten Burschenschaft und befindet sich noch heute im Besitz der Jenaer Burschenschaften. Ihre Farben sind rot – schwarz – rot mit goldenem Eichenzweig und der Inschrift:
»Von den Frauen und Jungfrauen zu Jena am 31. März 1816.«
Die Festtracht der Burschenschaftler aus jener Zeit ist der schwarze, altdeutsche Rock mit rotgoldener oder roter Schärpe, das Barett und das Burschenschwert.
Und hübsch sahen unsere Studenten darin aus. Anny und Else bedauerten, alle Blumen bereits verausgabt zu haben, um so mehr, als auch ohne diese Spende die kecken Studenten heraufwinkten. –
Währenddessen sagte die Hausfrau zur Justizrätin: »Ich bin froh, daß jetzt die letzte Gruppe kommt, so prächtig das Ganze war, mir wird es zuviel, ich kann gar nicht mehr schauen.«
»Es geht mir ebenso,« gab die andere lächelnd zurück.
Die letzte Gruppe zog schnell vorüber. Man führte die Revolutionszeit 1830 vorbei: die Studenten sind bewaffnet, um der Bürgergarde zur Herstellung der Ruhe in der Stadt zu dienen. Es zeigt sich eine Studentenwache – ein Bücherwagen mit Nachtwächtern, welche das Begräbnis der Wissenschaft bedeuten sollen. Zuletzt kommen berittene Chargierte aller Verbindungen Leipzigs mit ihren Fahnen und schließen somit den historischen Festzug der Universität Leipzig.
Ganz erschöpft vom Schauen, lehnt sich die Justizrätin zurück, die Herren kommen vom Balkon, die jungen Mädchen sind voll des Entzückens und schwatzen alles durcheinander.
»Hast du Artur Lehnhardt gesehen? – Er ritt als Chargierter in der ersten Reihe der Arioner. Fein sah er aus, was?«
»Ach, alle, alle waren bildschön,« war die schwärmerische Antwort der Schwester. –
Am Abend fand der große Kommers in der gewaltigen Festhalle statt.
Zwölftausend Personen füllten den Raum.
Ein seltenes Bild bot das studentische Leben in allen seinen Couleuren. Aber nicht nur die buntfarbigen Mützen und Zerevise der jungen Häupter huschten hin und her, sie saßen auch auf den Häuptern der ergrauten, »alten Herren«.
Ilse mochte ihren Vater gar nicht ansehen, so komisch sah er aus.
Vor dem Portal bildeten Chargierte in vollem Wichs Spalier. Ihnen war die Ehre zugefallen, die fürstlichen Gäste zu empfangen.
Fanfaren schmetterten durch den imposanten Raum, die Chargierten eskortierten einzeln die Fürstlichkeiten.
Die Großherzöge, Prinz Johann Georg, und jetzt, von schmetternden Fanfaren angekündigt, erscheint zuletzt der König von Sachsen.
Zwölftausend Kehlen entbraust das Hurra, und geführt von dem Präsidenten, den Ministern und Exzellenzen sowie den Chargierten, mit gezogenen Schlägern, nahm der König auf der Fürstenestrade Platz.
Nach den üblichen Anreden kam, worauf Ilse sich schon lange gefreut hatte, ein Salamander auf den Landesherrn, der tadellos klappte.
Donnernd polterten die Bierseidel auf den Tischen, und das Hurra kräftiger Kehlen erfüllte die Luft.
Ein Jubel herrschte ohnegleichen.
Ilse sah in ihrem blauen Kleide allerliebst aus; sie unterhielt sich ganz vorzüglich mit einem jungen Herrn der Verbindung, und es stellte sich zu ihrem Vergnügen heraus, daß dieser ein Freund vom Referendar Hielscher, ihres Bruders Intimus, war.
Am folgenden Tage erbat er sich die Erlaubnis, ihr Leipzig zeigen zu dürfen, und mit Wonne willigte Ilse ein. Else und Anny Wenzel schlossen sich an. –
Es war wunderschönes Wetter. Die Sonne goß ihr gleißendes Licht über die Stadt.
Die mächtige Kuppel des Reichsgerichts, die Zimmer des Gebäudes der Universitäts-Bibliothek, des gegenüberliegenden Gewandhauses und das Mendelssohn-Denkmal davor – alles ward vom Scheine der hochstehenden Sonne beleuchtet.
»Sehen Sie,« erklärte der liebenswürdige Referendar, »hier beginnt das sogenannte Konzertviertel.«
Und weiter und weiter führt er die jungen Mädchen. Ilse sah die Rennbahn, das Connewitzer Gehölz, die Kettenbrücke, den Albertpark. Alles prangte in saftigem Grün und erhöhte die gute Stimmung der Spaziergänger. –
Else sah nach der Uhr.
»Wenn wir Fräulein Lutzner noch das Völkerschlachtdenkmal zeigen wollen, müssen wir umkehren. Wir haben nicht mehr viel Zeit!«
»Und gerade dieses historische Fleckchen Erde möchte ich zu sehen nicht versäumen,« entgegnete Ilse. –
»Wir können ja fahren,« schlug Anny vor. Aber noch war keine Elektrische erreichbar.
Ueberall auf den Straßen schwirrten festlich gekleidete Menschen umher, die Omnibusse und Straßenbahnen konnten kaum alle Fahrgäste befördern, die Automobile sausten, mit schrillen Tönen die Bahn freimachend, daher, Equipagen und die mit vier Pferden bespannte Mail-coach waren dicht gefüllt mit heiteren Gästen.
»In der Mail-coach scheinen lauter Engländer zu sein,« sagte Else.
» Speak you english?« persiflierte Anny und schnitt ein Gesicht.
»Da kommt die 2,« sagte der Referendar, »die führt zum Völkerschlachtdenkmal, vielleicht erreichen wir sie noch.«
Dies gelang. Aufzusteigen war nun freilich ein Kunststück; der Andrang war enorm. Zunächst sprangen die Backfische auf. Der Referendar half Ilse in den Wagen und schwang sich dann selbst hinauf. Er fand auf dem Perron Platz, die jungen Mädchen standen ein Weilchen im Wagen.
»Bald sind wir da,« sagte Anny.
»Sie müssen sich auch den Napoleonstein ansehen,« riet Else.
»Ja, gern,« erwiderte Ilse, »ich liebe alles, was Napoleon betrifft. Schon als Schulkind hatte ich die größte Bewunderung für den großen Korsen, den man als Kulturträger ansehen könnte.«
»Aber er hatte doch kein Herz,« grollte Anny mit altkluger Miene und sah sich um, welchen Eindruck dieser Satz gemacht.
»Endstation!« rief der Schaffner.
Man stieg aus.
Nur wenige Schritte, und der historische Boden war erreicht.
»Wie mag es hier wohl 1813 ausgesehen haben?« sagte, ganz ergriffen von der Erinnerung, die sie bestürmte, Ilse. Sie hatte ein patriotisches Herz und Geschichte war ein Feld, das sie ganz erfüllte.
»Der Ort, wo du stehst, ist ein heiliges Land«.
Diese Worte fielen ihr ein.
»Hier standen am 16. Oktober 1813 dreihundert französische Geschütze, dichter Pulverdampf, Siegesblut und Stöhnen der Verwundeten erfüllte die Luft.«
»Der Boden dröhnte unter dem Hufschlag der Rosse,« bemerkte der Referendar.
»Drüben liegt Probstheida. Von dort heißt es, habe man alles was an Lehm, Mauern und Zäunen zu haben war, zu Bollwerk und Barrikaden genommen.
Russen und Preußen drangen ins Dorf, aber die Franzosen warfen sie zurück.
Dieses große Feld, wohin Ihr Auge blickt – durchtränkt war es mit Blut. Die Völker Europas traten zum gewaltigen Waffengang an! – Dort drüben auf dem Hügel stand eine Tabaksmühle, hier soll Napoleon in seinem grauen Mantel mit den roten Aufschlägen gesessen haben – übrigens ist ein prachtvolles Bild von ihm in unserem Museum, das müssen Sie sich auch ansehen! – Und um den Kaiser herum,« fuhr der junge Referendar fort, »stehen seine Generale. Mit gefurchter Stirn, bleich und erschüttert, blickt der oberste Feldherr auf die Toten, die in Massen herumliegen, hört das Wimmern und Stöhnen der Verwundeten ...«
»Wie schauerlich Sie schildern,« unterbricht Else. »Man vergißt, daß man jetzt auf blühender Flur steht, daß es Festtage sind, die wir durchleben.«
»Freuen wir uns dessen,« gab der Referendar zurück, »aber lassen Sie mich weiter deren gedenken, die für ein fernes Geschlecht kämpften.
Hier herum, die Dörfer, Fräulein Lutzner, wie lodernde Feuersäulen gingen sie in Flammen auf und beleuchteten mit ihrem Schein das Schlachtfeld – die Verstümmelten – die Sieger und Besiegten.
Am heftigsten wütete der Kampf am 18. Oktober. Ein grausiges Gemetzel war es, dem die Nacht ein Ziel setzte.
Auf der Höhe von Meusdorf standen der König Friedrich Wilhelm, Kaiser Alexander und Kaiser Franz und sandten, wie es hieß, entblößten Hauptes Dankgebete gen Himmel – die Schlacht war gewonnen, Deutschland war gerettet! Und dieses noch jetzt unfertige Völkerschlachtdenkmal wird noch Tausenden von Geschlechtern künden von dem durch Blut getränkten Boden.«
Der junge Herr sah, wie ergriffen Ilse war und schlug nun einen heitern Ton an.
»Bitte, meine Damen, nun etwas mehr rechts, wir gehen hier gleich hinüber zum Napoleonstein.«
Sie setzten sich auf eine Bank und hielten Rast.
»Komisch,« meinte Ilse, »ein solches Denkmal hätte ich mir eigentlich anders gedacht!«
»Großartiger?« fragte Else.
»Das nicht grade, aber aparter!«
»Ich meine, in seiner Einfachheit – mit dem efeuumwachsenen Hügel, umgittert und von Cypressen umstellt – wirkt das kleine Monument sehr eindrucksvoll.«
»Sehen Sie, Fräulein Lutzner,« machte Anny aufmerksam, »hier oben liegen Hut und Degen Napoleons auf einem Kissen.«
»Und wie lautet die Inschrift?« Ilse kniff, von der Sonne geblendet, die Augen ein und las:
Hier weilte Napoleon am 18. Oktober 1813,
Die Kämpfe der Völkerschlacht beobachtend.
Und auf der anderen Seite stand:
Der Herr ist der rechte Kriegsmann, Herr ist sein Name.
Einigemal ging sie um die Gitter herum.
»Wenn Sie aber noch weiter Patriotismus in sich aufnehmen wollen, gnädiges Fräulein, so werden wir nicht zur rechten Zeit der Gesellschaft beiwohnen können! Die Damen werden doch erst einen Imbiß einnehmen wollen, und mit der Toilette sind sie auch nicht so bald fertig, nicht, kleines Fräulein?« wandte der Referendar sich Anny Wenzel zu, der man es ansah, daß sie sich mit besonderer Sorgfalt zu kleiden pflegte.
»Gewiß, gewiß, nur schnell zur Straßenbahn,« drängten die jungen Mädchen, und schon fuhr man wieder der Stadt zu – –
Noch zwei weitere unvergeßliche Tage verlebte Ilse mit ihren Eltern in Leipzig.
Im Museum war es Klingers Beethoven, Kassandra und Salome, die Ilse ganz gefangen nahmen.
Wie Andacht überkam es sie – am liebsten hätte sie ihre ganze Zeit im Klingersaal verbracht, aber ihr Vater drängte zur Eile. Waren doch noch mehr große Meister zu besichtigen! Von den Leipziger Künstlern, Seffner, in seinen lebenswarmen Porträtbüsten, Greiner und Magr, »dessen Schicksal« sie packte. – Von den alten Meistern grub sich Thorwaldsens Büste des Schwedenkönigs in seiner ruhigen Schönheit ihrem Gedächtnis ein. –
Im Bildersaal machte Lechners »Verlassen« einen unbeschreiblichen Eindruck auf das gemütvolle junge Mädchen.
»Mutter,« sagte sie ganz ergriffen, und erfaßte deren Hand, »dieses Bild gibt die Tragödie des Weibes!«
»Wer Söhne hat,« gab Frau Justizrat zurück, »sollte sie vor dieses Bild führen, es würde sie vor Gewissenlosigkeiten schützen.«
Das wandgroße Gemälde zeigt ein Bauerngemach. Ein junges, bleiches Mädchen hält sich wankend am Türpfosten fest; ihre schlaff herabhängende Hand halt einen Brief, den ein anderes Mädchen, das neugierig durch die Türspalte guckt, ihr gebracht zu haben schien. Der Abschiedsbrief eines Treulosen. Der Gesichtsausdruck ist herzzerreißend; ihre gebrochene Gestalt drückt die Verzweiflung ihrer Seele aus.
»Den Söhnen sollte eine Mutter vor diesem Bilde sagen: »Seht, so wirkt ein Treubruch,« und den Töchtern: »Laßt euch nicht betören!« sagte Ilses Mutter.
Weiter ging es!
Man schritt durch eine unabsehbare Reihe von Sälen, bewunderte die Kunstwerke alter und neuer Meister und stand endlich wieder auf dem Augustusplatz.
Spät am Abend, begleitet von der Familie Wenzel, fuhr man zur Bahn.
Der Andrang zu den Billettschaltern war noch kolossal. Nach dem verklungenen Fest suchte ein jeder die heimatlichen Penaten wieder auf.
Im Coupé öffnete Ilse ein Paketchen, das ihr die Backfischchen als »Bahnhofsgabe« überreicht hatten.
Darin befand sich ein allerliebstes rundgeflochtenes Körbchen, gefüllt mit feinstem Konfekt, von Else.
Und von Anny war ein Päckchen Ansichtspostkarten mit Szenen aus dem Festzuge beigefügt. – –
Am Konfekt knabbernd, der verrauschten schönen Stunden gedenkend, ward Ilse nach und nach müde durch das eintönige Gerassel des Zuges, der die finstere Nacht durcheilte. Sie machte es wie ihre Eltern, lehnte sich in die Polster des Wagens zurück und schlief, bis der Zug in ihrer Vaterstadt einlief. –
Gleich am andern Tage besuchte sie zunächst Frau Dr. Flatow, der sie, wenn Lilli auf Reisen war, Gesellschaft zu leisten pflegte. Und auch zu Frau Major Wittner ging sie, denn ihr übervolles Herz machte mitteilsam. Und vorzüglich verstand sie, das Geschaute wiederzugeben. –
Am meisten freuten sich Ilsens Schülerinnen, daß ihre verehrte Lehrerin wieder da war. Sie pflegte ihre Kenntnisse bestens damit zu verwerten, daß sie jungen Mädchen aus guter Familie unentgeltlich Unterricht gab. Dadurch verhalf sie manch einer zu einer Ausbildung, die diese andernfalls nicht hätte haben können.
*
Eines Tages, als Frau Major Wittner die Justizrätin besuchen wollte, hörte sie zu ihrem großen Bedauern von einer schweren Erkrankung derselben.
»Kann ich Fräulein Lutzner sprechen?« fragte sie besorgt.
»Ich werde fragen,« antwortete das Stubenmädchen und öffnete die Tür zum Salon.
Nicht lange und Ilse trat, übernächtigt und verweint aussehend, ins Zimmer.
»O, meine arme, arme Mama,« klagte sie und weinte herzbrechend.
»Ich bin sehr erschrocken,« begann Frau Wittner teilnehmend, »wie ist es denn nur so schnell gekommen? – Aber nicht so trostlos sein, liebes Kind, es wird schon wieder besser werden!« Und sie schloß das schluchzende Mädchen liebevoll in die Arme.
»Was fehlt denn der Mama? ist es denn etwas Gefährliches?«
»Mutter hat ja ein Herzleiden, wie Sie wissen, gnädige Frau, nun ist eine schwere Influenza hinzugekommen, und bei schwachem Herzen –«
»Influenza?« wiederholte bestürzt die Majorin, »das ist freilich tieftraurig, aber Gott befohlen, Kind, und Adieu, ich will Sie nicht aufhalten, Adieu, recht gute Besserung!« und eilig verließ sie das Zimmer, um sich keiner Ansteckungsgefahr auszusetzen.
Wieder saß Ilse am Krankenbette der Mutter und sah nach der Uhr, ob es Zeit sei, Medizin einzugeben. Nein, noch war es zu früh.
Wie blaß die Kranke ausschaute, und der gräßliche Husten, der sie quälte.
»Mama, süßes Muttchen, komm, ich richte dich auf. So, jetzt die Kissen höher legen. Ist es so gut?«
»Kind, du reibst dich auf. Ich will eine Schwester haben, sie soll mich pflegen.«
Ilses Herz krampfte sich zusammen.
»Ich mache wohl alles falsch, mein Muttchen? Willst du dein Kind nicht lieber um dich haben?«
»Alles machst du gut, Liebling, es geht aber über deine Kräfte.«
»Nein, nein, ich bin stark, ich pflege dich selbst, keine Fremde soll an dich herankommen, ich könnte es nicht sehen –«
»Mein Kind, meine gute Ilse, wenn ich nur bei euch bleiben könnte ...«
Ilse warf sich vor dem Bette auf die Knie. »O Gott, Mutter, sprich nicht so, ich kann mir ein Weiterleben ohne dich nicht denken. Und nun, bitte, nicht aufregen, hübsch beruhigt in die Zukunft blicken ... und jetzt ist es Zeit zur Medizin.«
Behutsam tropfte Ilse diese ab, und mit einem Segensspruch auf den Lippen, schob sie den Löffel Arznei der Kranken in den Mund.
Der Justizrat öffnete behutsam das Zimmer, Ilse winkte ab, die Patientin war eingeschlummert.
Was war das für ein unruhiger Schlaf! Nur schwer hob sich die atmende Brust, und Schweißperlen bildeten sich auf der bleichen Stirn.
Ilse stand vor dem breiten, von weißen Gardinen beschatteten Fenster und schaute in den Garten, wo das Laub zu fallen begann.
Oede und trostlos lag alles da.
Eine heiße Verzweiflung packte das junge Mädchen, ein Gedanke haschte den andern. Jetzt fiel ihr Blick auf einen Wandspruch, den sie selbst gestickt hatte:
»Ich bin bei Euch alle Tage.«
stand dort.
Ein zitternder Laut kam von ihren Lippen. »Bist du bei mir?« bangte ihre Seele. Dann sank sie in die Knie und betete aus Herzensgrund, daß der liebe Gott ihr die Mutter erhalte. Wieder öffnete sich leise die Tür, Ilses Vater erschien im Rahmen der Tür und reichte ihr stillschweigend ein Telegramm.
Ilse las:
»Komme 9 Uhr 10
Herbert.«
Armer, armer Bruder, die ganze Nacht mußte er in der Sorge um die Mutter herunterfahren; er kam von einer Erholungsreise, und was würde morgen sein? Der Arzt hatte eine so ausweichende Antwort gegeben, und sie selbst hatte so gräßliche Angst vor der Nacht!
»Ilse!«
»Muttchen, möchtest du etwas?«
»Bitte, trinken.«
Mit zitternder Hand hielt Ilse das Glas an den Mund der Kranken. Durch ihren Sinn huschte eine Strophe:
»Wenn dich das streitige Leben zaust,
Straffe die Schulter, balle die Faust.«
Die Mutter merkte nichts von der Angst ihres Kindes; fest und zuversichtlich sprach Ilse zu ihr.
Die Nacht war über alles Erwarten gut.
Am andern Tage kam Herbert.
»Na, na,« tröstete er seinen Vater, »wer wird gleich den Mut verlieren, wird schon werden. Darf ich die Mutter sehen?«
»Da muß ich erst Ilse fragen,« antwortete der Justizrat.
Von nun an teilten sich die Geschwister in die Nachtwache; trotzdem wurde auf Herberts Bestehen eine barmherzige Schwester zur Hilfe genommen.
Hertas Mutter ließ sich alle Tage nach dem Befinden der Kranken erkundigen, schickte auch Blumen und Früchte, aber selbst kam sie nicht, und das war der Ilse auch recht.
Einmal, als die Geschwister zusammen im Krankenzimmer saßen, fragte Herbert:
»Was hörst du von Lilli, du schriebst mir doch, sie sei bei ihrer Tante Hanna; kommt sie bald heim?«
Die Schwester schüttelte den Kopf, wie konnte man jetzt andere Gedanken haben, als die der Mutter galten?! –
Bange Tage und Wochen gingen dahin, schon hatte der Todesengel im Hause Lutzner seine Schwingen ausgebreitet, nur noch Stunden, nur noch Minuten – dann war das Schreckliche geschehen, bleich und starr lag sie da, die so schwer gelitten. –
Ilses Verzweiflung war unbegrenzt, sie konnte es sich gar nicht vorstellen, ohne die Mutter, die sie stets mit Zärtlichkeiten überhäuft hatte, weiterleben zu sollen.
Trostlos und verödet schien das Haus, dem die Krone fehlte, um so mehr als auch Herrn Lutzner der Tod seiner Gemahlin allen Lebensmut geraubt hatte. Er vermochte sich nicht aufzuraffen, Ilsens gesunder Sinn sagte sich hingegen, daß sie nicht nur ihrer Trauer leben dürfe, sondern die Pflicht habe, den Vater aufzurichten, dem Haushalte die Repräsentantin zu ersetzen. –
Dem Bruder war sie eine treue Kameradin, vor der er kein Geheimnis hatte. Innigst freute sie sich des Bruders Liebe zu Lilli, die mit den Jahren sich mehr vertieft hatte und sein ganzes Sinnen und Trachten ausfüllte. Wenigstens war es doch eine liebe Freundin, die einstmals in ihr Haus einziehen würde! Und doch – manchmal konnte sie es nicht hindern, daß es durch ihren Sinn zog, wie vom Schicksal bevorzugt die beiden Kränzchenschwestern, Lilli und Herta, waren. Herta flatterte sorglos ins Leben hinein und haschte, wie ein Kind, nach allen Sternen, und Lillis Leben floß gleichmäßig und von Liebe umgeben, dahin.
In Ilses Zimmer hing ein Kabinettbild von Lilli. Sie blieb davor stehen und betrachtete es liebevoll. »Bleibe glücklich, du Gute, und bringe Segen in unser Haus!« sprach sie andächtig. –
Am Abend war es traut und behaglich im Wohnzimmer. Die rotbeschattete Lampe spendete ein magisches Licht.
Ilse saß, mit einer Handarbeit beschäftigt, am Tisch, dem Bruder gegenüber, während heute der Herr Justizrat den Abend auswärts verbrachte.
Ilses feines, bleiches Gesicht hatte einen so zufriedenen Ausdruck, wie man ihn seit der Mutter Tode nicht mehr bei ihr gesehen.
»Nun, woran denkst du, liebe Ilse, du siehst so eigenartig feierlich aus,« begann Herbert.
»Ich dachte an dich und Lilli. Weshalb zögerst du eigentlich, dich ihr zu erklären?«
»Es war noch immer nicht die rechte Stimmung dazu. Und weißt du, manchmal fühle ich mich auch ihrer gar nicht sicher. Sie ist so lange fortgewesen, wer weiß, ob sich nicht ein anderer in ihr Herz geschlichen hat.«
»Keine Sorge, ich besitze Lillis Reiseberichte, da ist von keinem die Rede, der ihr näher getreten sein könnte.«
»Ihre Reiseberichte?« Erregt sprang Herbert auf, »und das erfahre ich erst jetzt? Konntest du dir nicht denken, daß diese mich über alles interessieren? O, du treuloser Kamerad, wie konntest du mir so etwas vorenthalten! Ich brenne darauf, sie kennen zu lernen. Schnell, gute Ilse, hole sie.«
Ilse erhob sich und kehrte mit einer Mappe zurück. Hastig entnahm Herbert die losen Blätter und er las:
Griechenland.
»Wie seltsam, zum erstenmal in einem andern Lande zu sein, fremde Laute um sich zu hören und das eigenartige Leben und Treiben anderer zu beobachten!
In den engen Straßen von Verona herrscht trotz der frühen Morgenstunde reges Leben.
Italienische Hausfrauen, Mantilles über dem schwarzen Haar, gehen einkaufen. Mönche, mit spitzen Hüten, wallen vorüber. An den Säulen-Brunnen, auf Treppenstufen, lehnen und hocken sonderbare Männergestalten mit runden, großen Mänteln und Spitzhüten. Was mögen Sie wohl treiben? –
Mitten in der Stadt liegt die große Arena – zu gern möchte ich sie besuchen, aber unmöglich, bald geht der Zug weiter nach Bologna. Tante Hanna hat den goldenen Morgen verschlafen, ich bin ihr entschlüpft, um Entdeckungsreisen auf eigene Hand zu machen. Helle, freundliche Häuser hat Verona, und man hat einen herrlichen Blick auf die Etsch, die breit und majestätisch hindurchfließt. – –
Wieder sitzen wir im Zug, fahren durch eine ziemlich reizlose Gegend und sind endlich in Bologna. Hier sehen wir uns Kirchen mit herrlichen Altar-Gemälden an, die schiefen Türme usw. Die Häuser haben alle Kolonnaden, die Schutz gegen die Sonne bieten sollen. Aber leider scheint sie nicht, im Gegenteil, es ist kalt.
Weiter geht es, aber die nächtlichen Fahrten durch Italien gehören wahrlich nicht zu den Annehmlichkeiten der Reise. Erstens sind die Coupés schmutzig – obgleich wir 1. Klasse fahren – und es ist so kalt darin, daß den Reisenden von Zeit zu Zeit mit heißem Wasser gefüllte Kübeln unter die Füße geschoben werden.
Und diese Bummelei!
An jeder kleinen Station hält der sogenannte Schnellzug, bei meiner Ungeduld eine harte Nuß!
Tante macht ein Nickerchen. Ich luge durch die beschlagenen Fensterscheiben nach dem Meere aus.
Endlich! Bei Barletta erscheint im Morgengrauen, ein grünlicher Streifen!
Das ist also das Adriatische Meer!
Merkwürdig, es sieht gar nicht so großartig aus, wie ich es mir gedacht hatte.
Immer an Küsten entlang geht die Fahrt. An Gärten und Olivenbäumen, deren knorrige Stämme die sonderbarsten Figuren bilden. An unabsehbaren Feldern, aus denen die Weinstöcke ragen, Pfirsichbäumchen blühen usw. Und je weiter wir gen Süden kommen, je fremdartiger wird die Vegetation. Riesige Aloes und Feigenkakteen erscheinen, blühende Laurustinsbäume. Aber, o weh! kalt und kälter wird es, und in Brindisi, wo wir gegen Mittag todmüde, mit zerschlagenen Gliedern landen, weht es eisig vom Meere her. Brindisi bietet keine Augenweide, im Gegenteil, die Stadt ist schmutzig, hat holperiges Pflaster, und wir schauen sehnsüchtig nach den großen Dampfern, die auf dem Meere schaukeln. Unser Schiff, das uns nach Korfu bringen soll – der »Saluto« – liegt an der Mole. Die Anker werden sie erst in den 12. Abendstunde lichten. So müssen wir zu unserem Entsetzen den ganzen Nachmittag hier zubringen.
Im Hotel ist es ungemütlich, das Essen miserabel, im Speisesaal kalt, auf dem Marmorfußboden frieren unsere Füße. Ein Spaziergang will Tante des Windes halber nicht wagen.
Wir lösen Billetts, unsere Pässe werden revidiert, denn endlich ist es Zeit, aufs Schiff zu gehen. Hier sind schon eine Menge Menschen beisammen. Ein Esel von Italiener weist uns nach dem Ende des Schiffes, aber wir können trotz allen Suchens unsere Kabine nicht entdecken. Kein Wunder, er hat uns in die zweite Kajüte geführt. Endlich finden wir unser Nest auf der anderen Seite des Schiffes. Ich danke, eng und dumpfig ist so eine Kabine. Tante will sich gar nicht in das Bett legen, sie benutzt den Diwan als Ruhestätte.
Das Schiff nimmt noch Ladung ein. Die Winden und Ketten machen einen Höllenlärm. Auch Passagiere kommen noch. Ich höre in allen Sprachen reden.
Gegen Mitternacht löst der »Saluto« die Anker, und trotz anfänglicher Schaukelei, Lärm und Getrampel über mir, schlafe ich wie in Abrahams Schoß und wache erst am hellen, lichten Morgen auf. Nun schnell Toilette gemacht und dann hinauf aufs Deck.
Nie werde ich den Anblick vergessen!
Schimmernd, tiefblau breitet sich das weite Meer vor mir aus, im Osten begrenzt von der Dalmatinischen Küste mit ihren beschneiten Bergen. O wie wunderschön ist die Welt!
Frisch und herrlich weht die Luft und kräuselt die Wellen, weiße Möwen umflattern das Schiff und gaukeln gleich Schmetterlingen über der blauen Flut.
Die Reisegesellschaft, die sich zum Dejeuner zusammenfindet, ist ganz international. Alle Sprachen schwirren durcheinander. Eigentlich ärgert es mich, daß man so wenig Notiz von uns nimmt. Aber Tante meint, hier habe jeder mit sich selbst zu tun. Auch wisse man, daß man sich in ein paar Stunden schon wieder trennt.
Oben auf Deck verteilt man sich und lugt über die blaue Fläche nach Korfu aus. Gegen Mittag erscheint es am Horizont, traumhaft und verschwommen. Nach und nach heben sich die Umrisse der Insel, die Zitadelle mit ihren Basteien, den dunklen Cypressen, die sie schmückt, vom tiefblauen Himmel ab.
Um 1 Uhr ankert das Schiff im freien Meer, und eine Menge Boote kommen angeschwirrt. Wie Katzen klettern die braunen Kerle an Bord, preisen ihre Fahrzeuge an und schlagen sich um Passagiere.
»Gib auf dein Gepäck acht!« ruft mir die Tante zu. An der Mole drängen sich eine Menge Menschen.
Bald sind wir mit dem Boote angelangt, und ich staune über das Leben und Treiben der Stadt.
Wir logieren in einem Hotel garni an der Volta, an einem großen, freien Platz gelegen. Von der Zitadelle, die wir am Nachmittag in Begleitung eines liebenswürdigen, griechischen Offiziers, der sich meiner Tante vorgestellt hatte, und der einen für meine Zunge unaussprechlichen Namen führte, besuchten, hatten wir eine unbeschreibliche Aussicht auf das Meer und der gegenüberliegenden albanischen Küste.
Am anderen Tage machten wir bei wundervollem Wetter eine Wagenfahrt durch die blühende Insel nach Kanone, einem Kloster. Von hier aus schaut man über die Bucht, in der die kleine Insel Ponticonissi, die Mausinsel, liegt (viele sagen, diese wäre das Motiv zu Böcklins Toteninsel) hinüber nach Gasturi, wo der Marmorpalast der verstorbenen Kaiserin von Oesterreich hinüberleuchtet – das Achilleion. Leider kann man nicht hineingelangen. So begnügen wir uns mit dem Anblick, wandeln am Meeresstrand umher und suchen Muscheln. Blühende Veilchen gibt es hier an den Hecken und Anemonen in leuchtender Farbenpracht.
Der nächste Tag bricht kalt und windig an. Am Abend soll uns ein griechischer Dampfer nach Patros, unserem Reiseziel, bringen. Der Tante graut es vor dem bewegten Meer, und es wird eine stürmische Fahrt geben.
Wir bummeln noch ein wenig in der Stadt herum; sie macht einen armseligen Eindruck, aber überall herrscht reges Leben. Männer in Fez, in weiten Faltenröcken, meist schöne Gestalten, Jüdinnen in ärmlichen Gewändern, bewaffnete Albanesen, schwarzäugige Kinder, Orangenverkäufer, alles drängt durcheinander, schreit und gestikuliert, Hunde und Katzen, von allen Sorten, laufen einem vor den Füßen herum. Hochbepackte Esel bringen ihre Waren zum Markt. Aus den Kaffeehäusern und offenen Läden erschallt Gesang und Lärm.
In engen Gäßchen, in die man beim Wandern hineinblickt, flattert Wäsche vor den Fenstern und auf den Dächern. Ungekämmte Weiber lugen aus den Haustüren. Bei einem Geldwechsler, der mitten auf der Straße seinen Stand hat, wechselt Tante ihr schönes, französisches Goldgeld in einen Haufen ekliges, schmutziges Papiergeld um. Nun lösen wir Billetts für die »Thrake«, die weit draußen auf dem Meere liegt und heute abend ihre Anker lichtet.
Die »Thrake« ist ein wahres Puppenkästchen, neu und sauber, Salon und Kabine, alles weiß mit Gold. Die letzteren sind groß und luftig, mit englischen Metallbettstellen neben-, nicht übereinander. Außer einem griechischen Offizier mit Gattin und uns sind keine Passagiere an Bord. An Nachtruhe ist vorläufig nicht zu denken. Das Schiff nimmt bis zwei Uhr morgens Ladung ein, und die Winde verursachen einen entsetzlichen Spektakel. Es stürmt und regnet, und das Schiff fängt an zu schaukeln, toller und immer toller. Neben mir höre ich den Offizier stöhnen und räsonieren.
Am Morgen geht das Elend bei uns los. Wir haben kaum eine Tasse Kaffee – halb Satz, halb Zucker, heruntergeschluckt, da müssen wir uns fix wieder legen. Die Kameriera hängt uns mit schelmischem Lächeln den bewußten Napf an das Bett, und nun stöhnen wir mit dem griechischen Ehepaar um die Wette.
Ein anmutiges Quartett!!
Ab und zu schaut die Kameriera herein und fragt, ob wir etwas Wünschen. Nichts! Außer daß das vermaledeite Schaukeln aufhöre. – Sie zeigt mir die Insel Santa Maura, an der wir vorbeifahren; ich habe keinen Blick für diese, es ist mir alles gleichgültig, bin sterbenselend.
Gegen Abend lullt der Wind ein, und die Insel Zante kommt in Sicht. Unser Schiff wirft Anker und legt Güter aus. Da rappele ich mich auf und gehe auf Deck.
Merkwürdig, ich fühle mich ganz gesund und verzehre mit bestem Appetit ein Hühnchen. Im Abendsonnenschein liegt die Insel da, die vor einigen Jahren das Erdbeben verheert hat. Noch liegt die Hälfte der Stadt in Trümmern. Der Berg, an dem dieselbe amphitheatralisch gebaut, ist halb eingestürzt, und noch hängen die zerstörten Gebäude über den Abgrund.
In der Abenddämmerung fahren wir weiter. Wieder geht die Schaukelei von neuem los und mit ihr das Elend.
Gegen Morgen kommen wir in Cephalonia an. Ich fühle mich aber zu matt, um auf Deck zu gehen und lasse Insel Insel sein. –
Ein schöner, sonniger Tag bricht an; das Schiff schaukelt jetzt weniger. Gegen acht Uhr morgens kommen die Berge des Peloponnes in Sicht, und wir fahren hinein in den kleinen Golf von Paras. Nun winkt das Reiseziel endlich, endlich! Noch zwei Stunden, und wir sind im Hafen.
Wunderbar schön liegt die Stadt da; an einem niedrigen Bergzug emporsteigend, den eine altersgraue Festung krönt. Dahinter erhebt sich ein hohes Gebirge, auf dem noch dichter Schnee lagert. Eine Menge Kähne umschwirren unser Schiff. Die Tante schaut besorgt nach den lieben Freunden aus, denen sie unsere Ankunft von Korfu gemeldet. Ein Kommissionär tritt auf uns zu und zeigt auf ein fernes Boot: » Voilà madame le consul!« Tücher winken uns entgegen: es sind die lieben Freunde. In Tantens Augen kommen Tränen. Nach so vielen Jahren sehen sie sich in fremden Zonen wieder!
Das Boot legt an, sie kommen näher und näher, besteigen unser Schiff, nun halten sich die alten Freundinnen umschlungen, während der Konsul und seine Tochter mir ein Willkommen entbieten.
Endlich im Hafen! Ich setze den Fuß auf den Boden Griechenlands. Gott sei Dank, die weite Reise ist überstanden. – Meine Gedanken eilen über Meer und Land zurück zur Heimat, zu den lieben, lieben Eltern, zu den Kränzchenschwestern und senden ihnen innige Grüße.
*
Heute will ich Euch zunächst unsere lieben Gastgeber beschreiben.
Vorerst den Hausherrn. Ein echter Türke. Groß, schlank, blaß, wodurch seine wunderschönen schwarzen Augen hell hervorleuchten. Ein kecker Schnurrbart verleiht seinem Aeußern noch etwas Jugendliches. Dazu tragen auch die schnellen Bewegungen bei und der etwas hastige Gang.
Ich habe ihn sehr gern, diesen liebenswürdigen Herrn; er ist ganz reizend zu uns und erschöpft sich in Aufmerksamkeiten gegen Tante Johanna.
Letztere solltet Ihr sehen, sie ist ganz jung geworden, neben ihrer Freundin und ehemaligen Kränzchenschwester, von deren Eleganz auch etwas auf sie übergegangen ist.
Eine imposante Schönheit ist madame le consul, die hier wie eine Königin verehrt wird. Ein entzückender Gegensatz ist diese blonde Deutsche zu dem türkischen Gatten.
In Berlin, wo der Konsul bei der Gesandtschaft einstens attachiert war, hat er sich die schöne Gattin erobert.
Ueberhaupt die Liebesgeschichte – Frau Konsul hat sie uns kürzlich erzählt – ist zu romantisch. Das wäre so etwas für Ilse, solch ein Idyll, das über Land und Meer spielt. Wenn ich heimkomme, und wir am langen Winterabend traulich beisammensitzen werden, erzähle ich Euch diesen schönen Roman. –
Die älteste Tochter heißt Matra. Sie ist von undefinierbarem Reiz umflossen. Den rosigen Teint hat sie von der Mutter, die kühngeschwungene Nase und die mandelförmigen Augen der Griechinnen. Auch die stolze Haltung derselben. Ich schwärme sie an und bin glücklich, daß sie mich liebt. Bildhauerin will sie werden, was so recht für sie paßt.
Gestern sind wir im Palmenhain gewesen. Ich bat Matra, den Monolog aus Iphigenie zu deklamieren. Wundervoll hatte ich mir dies auf griechischem Boden gedacht.
Aber dann – trotz aller Weihe – mußte ich mir das Lachen verbeißen. Matra spricht nämlich das Deutsche direkt polternd aus und rollt das R so spaßig. Dabei bildet sie sich viel auf ihr »gutes Deutsch« ein und meint, man werde ihr, wenn sie zu uns käme, die Ausländerin nicht anmerken. Goldig, was? –
Die jüngeren Geschwister, Weros und Aga, sind entzückende Kinder; ganz eigenartige kleine Menschlein.
Die kleine Achtjährige hatte kürzlich einen wohlverdienten Klaps von ihrem Papa bekommen. Da hättet Ihr hören sollen, wie das Fräulein aufgemuckt hat.
»Solch einen Papa! Mama müsse doch tief beschämt sein, ihr einen Papa gegeben zu haben, der gar schlägt!« Wenn sie, Aga, Kinder hätte, die ließ sie gewiß nicht schlagen, usw. Dabei sprühten die dunklen Augen und die kleinen Fäustchen hatten sich geballt.
Tante Hanna geriet in Extase über diese kleine Kröte und sprach eine Abhandlung über Pädagogik. Aber Tanta Alma – die Konsulin – lachte.
»Hier zu Lande,« sprach sie, »läßt man die Gemüter sich austoben, bei groß und klein, man muß dem Temperament Rechnung tragen.«
Nun sollt Ihr noch den kleinen Jungen kennen lernen, der ist einfach zum Aufessen.
»Errr wil Sotate werrrden,« und übt sich im Dreinschlagen.
Uebrigens ist der Verkehr zwischen Kindern und Erwachsenen hier sehr abweichend von unseren Sitten. Sie sprechen mit und sind bei allen Gesellschaften anwesend. –
»Wissen Sie, wo die Trisonia-Inseln liegen?« fragte mich heute der Konsul und lächelte schalkhaft.
Einen Augenblick spazierten meine Gedanken durch den Stielerschen Atlas – vergeblich! Die Trisonia-Inseln sind nicht zu finden.
Beschämt gestehe ich meine Unkenntnis ein.
»Glaub's wohl,« meint der Konsul, »Sie werden die kleinen im Golfe von Korinth gelegenen Eilande kaum auf einer Karte verzeichnet finden. Morgen früh sechs Uhr geht es dorthin mit der »Marigo« – den Segler kennen Sie von unserem kürzlichen Ausflug her.« –
Im Wohnzimmer finde ich die Tante mit der Hausfrau in ernster Beratung. Gasthäuser, in denen man etwas bestellen könnte, gibt es in Griechenland nicht, also muß man ausreichende Lebensmittel mit auf die Reise nehmen.
Eine recht umständliche und nicht gerade amüsante Sache. Allein man ist es hierzulande schon gewöhnt, Tante Konsul hat bereits Geschirr, Tafelzeug, Bestecks usw. zusammengesetzt, und stellt nun mit Tante Hanna das Menü zusammen.
Eine Stunde später richtet der treue Diener und »Schlachtherr« Thodori ein Blutbad an. Truthühner, Enten und was weiß ich alles, werden hingerichtet, denn es findet eine Art Picknick statt, und man muß sich auf große Gesellschaft einrichten. So war es ein arbeitsreicher Tag für alle, und wir gingen bereits sehr früh zur Ruhe, denn morgen hieß es auch früh auf sein.
Aber die Tante hatte doch etwas zu lange geruht; als wir herabkamen, waren alle schon gerüstet, die Kinder lachten uns aus und neckten die Langschläfer.
Nun ging es zur Mole. Hier fanden wir bereits eine größere Gesellschaft vor. Dr. Andruge, ein jovialer Arzt, Adsopoulos, ein junger Maler, Herr und Frau Schulze (auch in Griechenland ist dieser schöne Name vertreten), deren Kinder, und noch zwei Ehepaare mit unaussprechlichen Namen. Dann noch eine hübsche Athenerin und deren Freundin, und also wir, inklusive der Dienstboten. Eine Hauptperson darf nicht vergessen werden – der alte Fischer, mit einer unendlich langen, und wie es schien unentwirrbaren Schnur, an welcher sich 1100 Angeln befunden haben sollen.
»Wir wollen nämlich heute nachmittag einen großartigen Fischzug machen,« erklärt unser Gastgeber. Ein anderer Herr schnalzt mit der Zunge, in Vorahnung dessen, was kommen wird, und fügt hinzu, es gäbe bei den Inseln die herrlichsten Fische.
» Avanti!« ertönt es, und wir steigen über ein schwankendes Boot auf das schmucke Schiffchen, dessen weiße Segel sich im Winde blähen.
Ein kleiner Dampfer keucht schnaubend und pustend heran, er soll Vorspanndienste tun, damit wir bald ans Ziel gelangen, und uns bei etwa konträrem Wind am Abend wieder heimbringen. –
Der Anker hebt sich – wir gleiten hinaus aus dem Hafen, an großen Dampfern und einer Anzahl Segelschiffen vorbei. Die indigoblauen Fluten des Ionischen Meeres zeigen hier und da leichte Schaumkronen, und die frische Morgenluft bläht die Segel. Möwen umkreisen das Schiff und tauchen hernieder zur Flut, von der sie sich Augenblicke lang tragen lassen. –
Wir biegen in den Golf von Korinth ein. Der Maler und Tante Konsul entwerfen Skizzen. Die Kinder tollen umher, sie jagen eine Katze, die dem Kapitän gehört. Im Winkel sitzt der alte Fischer und entwickelt seine Leinen.
Höher steigt die Sonne und brennt auf das Zeltdach. Weiter und weiter schießt das Schiff durch die Flut.
An den Ufern erscheinen zwei Festungen, Rion und Antirion; im Wechsel folgen kahle, spärlich bewaldete Bergzüge.
Still und einsam ist es auf den rauschenden, blauen Wogen, kein Dampfer begegnet uns, nur dann und wann ziehen ein Segelschiff oder einige Fischerboote vorüber.
Im Sonnennebel taucht eine Stadt auf – Vostitza. Der Maler schaut durch das Fernglas.
»Es ist meine Vaterstadt,« sagt er. »Und sehen Sie, dort, wo sich das Meer so ausbuchtet, da liegt das alte Algion im Meeresgrunde begraben. Es verschwand bei einem Erdbeben. Auch die jetzige Stadt liegt auf vulkanischem Boden, und Erderschütterungen sind sehr häufig.« –
Voll Interesse blicken wir durch das Glas, niemand ahnt, daß wir gerade diese Stadt noch heute näher kennen lernen sollten. –
Gegen zwölf Uhr mittags taucht die erste der Trisonia-Inseln auf. Aber erst nach einer Stunde haben wir dieses kleine Eiland, mit nur wenigen Bäumen und Gesträuchen bewachsen, dicht vor Augen.
Wir fahren in einen engen Kanal, und haben die paar winzigen Häuschen, in denen die aus einigen zwanzig Köpfen bestehende Einwohnerschaft kampiert, vor uns. Arme Fischer und Hirten sind es, die in dieser Weltabgeschiedenheit hausen.
In einer stillen Bucht gehen wir vor Anker.
Der Fischer fährt mit der Jolle ab, um die Angeln ins Meer zu senken.
Dis Dienerschaft macht sich flugs daran, das Mittagsmahl zu bereiten.
Einladend sieht der improvisierte Tisch aus! In der Mitte prangt der Truthahn; dann gibt es noch weitere delikate Gerichte, marinierte Barbunia – das sind zarte Fischlein – kalten Hammel, Makkaroni, Früchte und Käse.
Die Seeluft hat uns allen Appetit gemacht, mit wahrem Heißhunger verzehren wir die wohlschmeckenden Gerichte.
Der Doktor hält mit krähender Stimme einen launigen Toast, von dem ich leider nur hin und wieder ein Wort verstehe.
Nach dem Essen folgt der griechische Kaffee, an den sich die deutsche Zunge auch erst gewöhnen muß.
O, Ihr lieben Kränzchenschwestern daheim, Ihr würdet an den kleinen Mokkatäßchen keinen Gefallen finden. –
Das Boot bringt uns nun ans Ufer, an dem sich die Einwohnerschaft versammelt hat.
Mit großen Augen schauen braune Fischerkinder uns an. Grüßend nahen Männer und Weiber und lassen sich mit mehreren aus unserem Kreis in ein Gespräch ein.
Ein altes Mütterchen humpelt auf mich zu und drückt mir einen Zweig mit grünen Früchten in die Hand – es sind frische Mandeln, die ich zum ersten Male sehe und genieße. –
Während sich die andern schwatzend zerstreuen, wandle ich einsam am Meeresstrande. Es liegt mir heute wie Heimweh in den Gliedern, und auch Tante Hanna scheint mir nicht so animiert wie bisher.
Ich klimme einen grasigen Abhang hinan. Märchenhafte Blumen wachsen hier, großer leuchtender roter und gelber Mohn, Anemonen und blaue Blumen.
Ganz einsam ist es um mich her ... Da von einem fernen Hügel ertönt ein wehmütiges Lied, ein Ziegenhirt bläst auf seiner Schalmei.
Da muß ich weinen. Die Welt ist so schön, wohl dem, der sie sich ansehen kann – und doch, ich bin so fern von der Heimat, von meinen Lieben ...
»Hallo!« tönt es vom Strande her, »alle Mann an Bord!! Es geht auf den Fischfang.«
Gleich trockne ich meine Tränen. Niemand soll sie sehen; man würde mich ja auch für undankbar halten, wo uns so vieles geboten wird.
Von allen Seiten kommen die Ausflügler wieder zusammen. Wir steigen in eine Barke, der kleine Doktor klettert zum Fischer ins Boot, um die Beute einheimsen zu helfen.
Kreuz und quer fahren sie, der Fischer holt die Leine ein. Da zappelt schon ein Fischlein, dort wieder eins, und wird von den geschickten Fingern des Doktors gelöst und in einen bereitstehenden Korb geworfen.
Meist sind es rötlich schimmernde Barbunia, die, auf dem Rost gebraten, ein delikates Gericht geben.
Jetzt erschallt ein Freudenruf – ein Lawraki – ein mehrere Pfund schwerer Bursche hat angebissen, und es gibt einen tüchtigen Kampf, denn er schlägt wie toll um sich. Und wieder ein Dutzend kleine, ein großer und so fort.
Wir lassen jetzt die Fischer den Rest ihrer Beute einnehmen und rudern nach dem Schiff zurück. Es geht schon auf vier Uhr und der Wind fängt an zu blasen.
Der Konsul macht ein besorgtes Gesicht und hält heimliche Zwiesprache mit dem Kapitän.
»Es ist das beste,« meinte er dann, »wir brechen auf, ehe der Wind, den wir gegen uns haben, stärker wird.«
»Bah!« lacht Herr Schulze, »wir haben doch den Schleppdampfer.«
Der Konsul zuckt die Achsel. »Hoffen wir, daß dieser Kohlen genug hat, um Wind und Wellen entgegen zu arbeiten. Ich fürchte, wir werden kaum vor Einbruch der Nacht nach Hause gelangen. – Aber da kommt der Fischer, sehen wir die Beute an.«
Zwei Körbe voll bringen sie an Bord. Wohl über achtzig Fische sind es, die gebührend gelobt und bewundert werden. Der Fischer setzt sich in einen Winkel, um die arg verpfitzten Leinen zu entwirren. Eine Arbeit, die große Geduld und Geschicklichkeit erfordert.
Der Dampfer pufft schwarze Rauchwolken in die Luft. Er zieht an, und fort geht es aus der stillen Bucht hinaus in den Kanal.
Die Inselbewohner stehen am Ufer, wehen mit Tüchern und rufen uns Abschiedsworte zu. –
Die friedlichen Häuschen entschwinden unseren Blicken. – Auf Nimmerwiedersehen! –
Im Kanal gibt es schon große Wellen – das Schiff fängt an, Verbeugungen zu machen. Um hinaus in den Golf zu gelangen, was am Morgen in kaum zehn Minuten geschah, brauchen wir jetzt eine volle Stunde.
Hier pfeift es in einer anderen Tonart, hohe dunkle Wogen kommen uns entgegen. Die Sonne steht bereits ziemlich lief am Horizonte und vergoldet mit ihrem Schein die Inselgruppe, in deren Nähe wir wie durch unsichtbare Macht gebannt bleiben.
Der Dampfer pustet und schnaubt – er bringt uns nicht vorwärts. Alle Segel sind gerefft, der Kapitän und die Matrosen lehnen untätig da und harren mit Gleichmut der Dinge, die da kommen werden.
Eine Stunde vergeht nach der andern. Unsere Gesellschaft, die erst voller Humor gewesen, wird schweigsam, es macht sich eine Unruhe bemerkbar.
Tante Hanna ruft mich zu sich.
»Kind,« meint sie verängstigt, »vielleicht müssen wir noch eine kalte, stürmische Nacht auf dem Schiffdeck verbringen! Wer weiß, was noch passiert, und ich bin für dich verantwortlich.«
Ich tröste sie, so gut es geht, blicke aber selbst recht besorgt nach dem Himmel.
Längst ist der glutrote Sonnenball hinter eine im Westen drohend aufsteigende Wolkenwand verschwunden, und wir liegen noch immer wie festgenagelt am selben Platze. Delphine spielen um das Schiff, sie tauchen auf und verschwinden blitzschnell in der nächsten Welle.
Wir schauen fröstelnd auf das dunkle Wasser, und auf die von violettem Dust umhüllten Berge.
»So kann es nicht bleiben,« nimmt jetzt der Konsul das Wort, »ich habe soeben mit dem Kapitän beraten. Seine Meinung ist, die Segel zu setzen und hinüber nach Vostitzi zu kreuzen. Die Kohlen des Dampfers sind nämlich zu Ende. – Ironie des Schicksals, jetzt müssen wir diesen noch ins Schlepptau nehmen. Vielleicht erreichen wir in Vostitzi den Athener Zug noch und sind dann abends rechtzeitig zu Haus.«
Durch diese Aussicht wurden Männlein und Weiblein sogleich wieder fidel. Die Tante hüllt sich in ein Umschlagetuch, schiebt ihren Arm in den meinen, und findet mit einem Male diese verpfuschte Wasserpartie »ganz interessant«. –
Der Maler rühmt die Vorzüge seiner Vaterstadt, wo wir, falls der Zug nicht mehr zu erreichen wäre, ein gutes Unterkommen für die Nacht in einem Hotel finden würden. –
Die Segel sind entfaltet, der Wind bläht sie mächtig auf, das Schiff legt sich tief auf die Seite – ein Krach, ein Stoß, und fort schießt es über die Wogen, pfeilschnell geht es nun dahin.
Nun gilt es, einen festen Platz zu suchen, denn das Schiff schwankt fürchterlich. Bald berührt die eine, bald die andere Seitenwand beinahe das Wasser, und die Wellen schlagen über Bord. Die Kinder fangen an zu weinen. Die Großen werden stiller und blasser – das Gespenst der Seekrankheit schleicht heran. Die Unterhaltung hat längst aufgehört, ein jeder kämpft mit der aufsteigenden Uebelkeit. Man ruft nach Wasser, aber kein Dienstbote erscheint, kein »Oriste« erschallt.
Kein Wunder, sie liegen alle und stöhnen. Endlich kommt ein kleiner Schiffsjunge und bringt das Labsal. Er grinst über das ganze Gesicht und will sich innerlich halb totlachen über die marode Gesellschaft. Er freilich ist auf dem Wasser zu Haus und hat ganz andere Stürme erlebt.
Mir tut die arme Tante leid, die Gute ist in kläglicher Verfassung. Ich halte sie im Arm, aber auch mir ist es entsetzlich zu Mute. Wer hätte gedacht, daß die Fahrt nach den Trisonia-Inseln, auf die wir uns so gefreut, so enden würde! –
Der Abend bricht herein. Es wird empfindlich kalt. Alles drängt sich aneinander und wickelt sich, so gut es geht, ein. Aus zerrissenem Gewölk lugt der bleiche Vollmond herab auf die noch bleichere Gesellschaft.
Will denn die Fahrt kein Ende nehmen ...? Da tauchen die Lichter an der Küste auf, sie blinken uns hoffnungsfreudig entgegen.
Endlich! Der Hafen ist erreicht, das Schiff ankert und wir steigen ins Boot, das auf den Wellen wie eine Nußschale tanzt. Nein, das war keine schöne Fahrt, sie wird jedem in unangenehmer Erinnerung bleiben.
Und nun hieß es, so ermattet man auch war, geschwind nach der Bahnstation, vielleicht ist der Zug noch da. Die Station ist nicht weit, bald ist sie erreicht. Aber – öde, finster und gar verschlossen liegen die Räume da.
Man ruft, pocht, keine Menschenseele läßt sich sehen.
Endlich erscheint ein verschlafen aussehender Bahnbeamter, und schließt brummend den Wartesaal auf, aus dem eine dumpfe Luft uns entgegendringt.
Man fragt nach dem Athener Zug. – Vor zwei Stunden schon hat er die Station verlassen.
»O weh!« In allen Tonarten entschlüpft dieser Wehlaut den Lippen der Anwesenden.
»Gibt es ein gutes Hotel in der Stadt?« fragt der Konsul.
Der Mann kratzt sich hinter dem Ohre.
»Es hat eins gegeben, aber der Wirt hat seine Bude zugemacht.«
»So?« fragt der Maler kleinlaut, der seine Vaterstadt so gerühmt, »seit wann denn?«
Eine Handbewegung des Mannes sagt: seit langem.
»Machen Sie vor allen Dingen Licht,« befiehlt der Konsul.
Der Mann verschwindet und kommt mit einer Art Stalllaterne und einer Trittleiter wieder, um die inmitten des Wartesaales hängende Lampe anzuzünden.
Aller Augen folgen seinem Beginnen.
Der Docht erglimmt, raucht und verbreitet einen entsetzlichen Geruch.
Der Mann kratzt sich abermals hinter dem Ohr – »es ist kein Petroleum drin,« erklärt er. Wahrscheinlich ist dies seit Menschengedenken der Fall, und zu beschaffen ist auch keins.
Der Maler erbietet sich mit dem Stationschef zu reden. – Der Beamte meint, »das ginge nicht.«
»Weshalb denn?«
»Der Stationsvorsteher liegt nebenan am Typhus.« – –
Entsetzen erfaßt uns alle.
»Das wird ja immer besser hier, unser Ausflug scheint ja von allem Guten gesegnet zu sein,« ruft Frau Schulze, und sie ergreift, ihren Mann mit sich fortziehend, die Flucht.
Die ganze Gesellschaft von Grauen erfaßt, Wand an Wand mit einem Typhuskranken zu sein, folgt ihnen.
Nun stehen sie alle im Finstern frierend und – hungernd.
Einige Herren erbieten sich, die Stadt zu erklimmen – Vostitzi liegt auf einem Berge – und auf die Suche nach einer Unterkunft zu gehen, der Maler als Pfadfinder an der Spitze.
Wir »Hinterbliebenen« gruppieren uns, wo gerade Bänke zu finden sind. Die Kinder sind eingeschlafen. So duselt man eine Weile hin. –
Plötzlich erschallt ein Triumphgeschrei! Die Herren sind zurückgekehrt, ein Asyl für die Nacht ist gefunden.
»Wie, wo?« fragt alles durcheinander.
Natürlich war es der ortskundige Maler, der einen Bekannten getroffen, der in Vostitza eine Villa besitzt. Er heißt Brazzafoli, ist Deputierter und nebenbei Millionär.
Gepriesen sei er, denn er hat die ganze verschlagene Kompagnie zu sich ins Haus geladen. In eigener Person kam er noch dazu, um seine Einladung anzubringen.
Zweiundzwanzig Personen zu beherbergen – das ist keine Kleinigkeit – man überlegt, ob man dieses großmütige Anerbieten annehmen kann ... Aber Hunger und Mattigkeit lassen alle Bedenken schwinden.
Die Kinder werden geweckt, und der ganze Zug, die Dienstleute und der Fischer mit den gefüllten Körben hinterdrein, setzt sich in Bewegung.
Die Tante hängt sich an meinen Arm. Wir steigen einen steilen Pfad, der sich im Zickzack windet, zur Stadt empor.
Auch der Aufstieg ist überstanden.
Oben, in der Stadt, ist noch reges Leben. Die Läden mit lockenden Früchten des Südens sind hell erleuchtet, und aus einem Kaffeehaus tönt Gesang und Gelächter. Herr Brazzafoli führt uns durch stillere, abgelegene Straßen nach seiner wundervollen Villa, die inmitten eines herrlichen Gartens, vom Mondlicht umflossen, daliegt.
Es ist wie im Märchen, und ich fürchte, daß im nächsten Augenblick alles versinken könnte in Nacht und Grausen.
Aber nein, an der Tür empfängt uns eine hohe, liebliche Frauengestalt und entbietet ein herzliches Willkommen. Sie hat Worte des Bedauerns über unser Mißgeschick und führt uns in einen glänzend erleuchteten Salon.
Unsere müden Glieder lassen sich auf weiche Sessel und Stühle nieder, ein Glas Wein stärkt die Lebensgeister. Währenddessen gibt unsere liebenswürdige Wirtin Befehl, alles was Küche und Keller bietet, aufzutragen, und die Fische, die wir mitgebracht haben, zu bereiten.
Und wie schmeckte das Mahl nach den ausgestandenen Strapazen!
Delikat sind die Fische; der unvermeidliche Hammelbraten, die Früchte und Süßigkeiten finden reißenden Absatz.
Gesättigt ist nun alles, aber müde, müde, müde zum Umfallen sind wir alle, ohne Ausnahme.
Trotzdem ist es bereits tief in der Nacht, als die Wirtin die Tafel aufhebt, und uns Damen in die Schlafzimmer geleitet.
Mit großer Umsicht ist alles geordnet – für alle sind Betten vorhanden, und nicht der kleinste Toilettengegenstand fehlt. –
Mollig ruht es sich auf dem weichen Lager, aber an Schlaf ist nicht zu denken, es ist, als schwebe man noch und sinke in unabsehbare Tiefen. –
Draußen rieselt der Regen hernieder, und der Wind rauscht in den Bäumen vor dem Fenster, ich lausche, bis sich mildtätig der Schlaf herabsenkt.
Der Morgen bricht kalt und regnerisch an. Es gilt, sich beizeiten fertig zu machen, damit wir den Frühzug erreichen.
Unsere gütigen Gastgeber erwarten uns bereits am Teetisch. Nach hastig eingenommenem Frühstück verabschieden wir uns unter heißen Danksagungen von der gastfreien Familie, die bescheiden abwehrt.
Unter strömendem Regen glitschen wir auf aufgeweichten Wegen den Berg hinab zum Bahnhof, der bei Tagesbeleuchtung einen wesentlich besseren Eindruck macht.
Der Zug läßt nicht lange auf sich warten. Im Coupé hat man Muße, die Ereignisse des gestrigen Tages eingehend zu besprechen und das Lob unserer freundlichen Wirte in allen Tonarten zu singen.
Die Bahn fährt am Meeresgestade entlang, und wir haben das Vergnügen, unseren Segler zu erschauen, der auf den hochgehenden Wellen hin und her kreuzt, um lange nach unserer Ankunft, im Palraser Hafen einzulaufen.
Gegen Mittag sind wir endlich daheim und werden von den Zurückgebliebenen, die uns vom Meere verschlungen geglaubt, am Bahnhof mit Jubel empfangen.
»Nie wieder einen Ausflug,« beschwörend sagt es Tante Hanna. »Nie wieder beteiligen wir uns daran – .« Aber acht Tage später kleidet sie sich in bester Stimmung zu einer Partie nach Kloster Omlos an.
*
Kloster Omlos.
Früh sechs Uhr!
Ein dunstiger Morgen! Der Himmel ist mißfarbig grau. Das Meer ebenfalls, welches sich in großen Wellen am Ufer bricht. Die fernen Berge von Missolumphi drüben über dem Golf, sind in Nebeldunst gehüllt, und auf der Gebirgskette hinter der Stadt, deren Schneerinnen noch gestern im Sonnenschein glitzerten, lagern dichte Wolken.
Vielversprechend ist das Wetter nicht zum Ritt nach dem weltfernen Kloster da droben in der Bergeinsamkeit. Doch wer wird deshalb den Mut verlieren. Wir wagen es!
Schon steht der Wagen, der uns bis zum Chani (Wirtshaus), etwa eine Stunde vor der Stadt, bringen soll, vor der Tür, und der Kutscher knallt ungeduldig mit der Peitsche.
Thodori bringt den bekannten, wohlgefüllten runden Korb, der unser Mittagsmahl enthält. Außerdem eine Anzahl Schals, Mäntel und Schirme.
Diesmal sind wir nur unserer vier. Aron, der Konsul, Alma, seine Gattin, die Tante und meine Wenigkeit.
Fort donnert der Wagen, durch die Straßen von Patras, dessen Einwohner noch im süßen Morgenschlummer liegen. Nur ein paar Kolnriverkäufer karren ihre Waren aus, und hie und da wird ein Laden geöffnet.
Vor dem italienischen Konsulat hält ebenfalls ein Wagen. Die schöne Signora Osioni, sonst die erste, wenn es einen Ausflug zu machen gilt, scheint es heute verschlafen zu haben. Auch aus dem unfern gelegenen Hause des deutschen Konsuls werden eben erst die Effekten in den bereitstehenden Wagen getragen. Stolz schwillt unsere Brust, daß wir heute die ersten am Platze sind. Als Rendezvous ist der Chani, wo uns die Pferde erwarten sollen, bestimmt.
Durch die langgestreckten, modernen Straßen der Stadt fahren wir; dann bergan, am Zigeunerviertel vorüber. Kleine Häuschen, von deren Dächern fragwürdige Wäschegegenstände flattern, kleben hier dicht aneinander und übereinander am Berge. Braune und wirrköpfige Weiber und Kinder lugen aus Fenstern und hinter den Haustüren dem vorübersausenden Wagen nach.
Ziegen, Hühner und Hunde, die mitten auf der Straße im Staube ein beschauliches Dasein führen, laufen meckernd, gackernd und bellend zur Seite.
Wir fahren an einer mit schönen, blauen Kuppeln geschmückten Kirche vorbei. Dann biegen wir scharf um eine Ecke, und eine weiße Landstraße nimmt uns auf.
An einer unabsehbaren Reihe von Korinthengärten geht es vorüber. Die Zäune und Hecken sind überwuchert von Tausend und Abertausend blühenden, duftenden Rosen, die vom reinsten Weiß bis ins dunkelste Rosa variieren.
Ein zauberhaft schöner Anblick! Wie müssen sich da unsere bescheidenen deutschen Heckenröschen gegen diese ihre üppigen südlichen Schwestern verstecken! –
Die Weinstöcke haben schon zarte grüne Schößlinge getrieben, die Oliven- und Feigenbäume sind auch ziemlich belaubt.
Dann und wann begegnen uns Landleute, auf Esel oder Pferden zur Stadt ziehend.
Wir nähern uns den Bergen, und vor uns liegt ein steiniges, leeres Flußbett, in welchem Oleanderstauden und gelbblühende hohe Gewächse aufgeschossen sind. Hier hört die Straße plötzlich auf. Der vom Gebirge herabkommende Fluß – jetzt nur ein dünnes Gerinsel – der beim Frühlingsanfang, bei der Schneeschmelze als wildes Wasser herabtost, hat sein altes Flußbett verlassend, sich einen anderen Weg gebahnt. Er kümmert sich nicht um die Brücke, die etwa 500 Schritt weiter hin ihr verstecktes Dasein betrauert, dazu auch noch von diebischen Händen ihres Geländers und aller Holzteile beraubt worden ist.
Wir fahren deshalb unter entsetzlichem Stuckern und Stoßen durch das Flußbett und atmen auf, als jenseits der Straße der Chani im Schmucke seiner violettblühenden Judasbäume sichtbar wird.
Hier harren unserer bereits die kleinen Pferde, malerisch mit türkischen Decken behängen. Die dazu gehörigen Führer, meist schöne, schlanke Burschen, mit langem Haar und blitzenden Schwarzaugen, sind ausnahmslos bewaffnet. Die einsam gelegenen Gegenden des Peloponnes sind, wie männiglich bekannt, durchaus nicht sicher vor umherlungernden Räuberbanden, und kürzlich erst hatte man wieder von einem Ueberfall gehört.
Der Wirt vom Chani erscheint mit einigen Gläschen Mastikaschnaps und Kolnri, einem kuchenartigen Gebäck, und uns mundete der kleine Imbiß vortrefflich. Ein paar unsagbar dürre Hunde, die sich herrenlos umhertrieben, gesellten sich zu uns, vom Geruch unseres Eßkorbes angelockt. Einer derselben hat sich bis dahin vergeblich bemüht, einen alten Schuh, den er wo aufgelesen, zu fressen. Almas Herz schmilzt bei diesem Anblick in Mitleid, sie wirft den Hunden sämtliche Kolnri hin, die im Nu verschlungen sind.
Inzwischen sind die Wagen angekommen. Madame Asconi im feschen Lodenkostüm entsteigt dem einen, Konsul Gramburg nebst Gattin und Fräulein Nagafolie dem andern Gefährt.
Allgemeines Begrüßen und das Austauschen der Befürchtung wegen eines etwaigen Regengusses.
Doch sind alle bereit, dem Unbill des Wetters Trotz zu bieten, und es entwickelt sich ein lebhaftes Bild.
Die Burschen führen ihre Gäule vor und preisen zungengewandt deren Vorzüge, und ein jeder sucht sich das geeignetste Tier aus.
Die Italienerin schwingt sich keck auf das mutigste Rößlein, wir andern, die wir alle keine Amazonen sind, nehmen mit den friedfertigsten Gäulen fürlieb.
Die Sättel sind freilich recht unbequem und müssen erst durch Decken und Mäntel weicher gemacht werden. Steigbügel gibt es auch nicht, dafür eine Art Fußbänkchen, die wir der Fürsorge des deutschen Konsuls danken.
Außer unserer mehr oder weniger süßen Last, haben die kleinen Pferde auch die schweren Proviantkörbe zu schleppen.
»Ist es gut so?« fragt mein Führer auf griechisch.
»Sehr gut!« radebreche ich in derselben Sprache.
» En avant!« ruft der Konsul, und der Zug setzt sich in Bewegung, treulich gefolgt von den beiden armseligen, ruppigen Kötern.
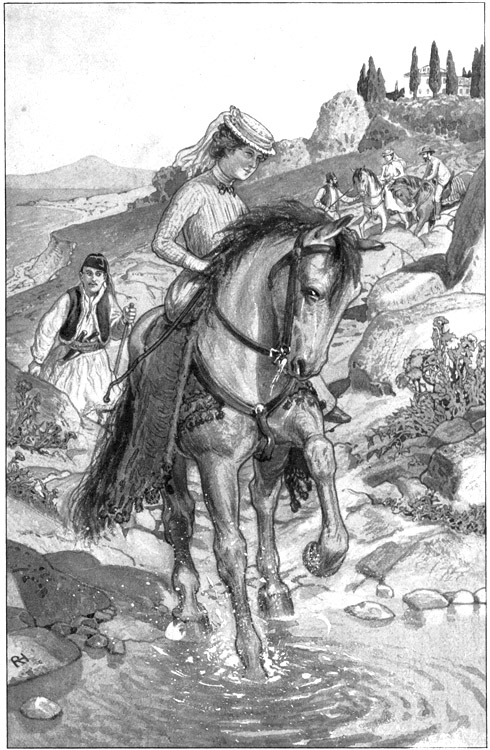
Eine Weile geht es die staubige, weiße Landstraße entlang, dann durch ein ausgetrocknetes Flußbett in eine Talschlucht hinein. Der Weg ist voller Geröll, kurzes, stachliges Gestrüpp bedeckt den felsigen Boden, und kein Baum, kein Strauch zu sehen. Im Zickzack führt der schmale Pfad in die Höhe, und mühsam klimmen die Pferde über große Steine, die als Treppen stufenartig übereinander liegen. Mit welcher Sicherheit diese Tiere gehen, ist wirklich bewunderungswürdig. Die Gesellschaft kommt ein wenig auseinander, je nach der Leistungsfähigkeit der Tiere und der zu tragenden Lasten.
Von der Höhe gesehen, gewährt unsere Kavalkade einen höchst malerischen Anblick.
Mein falbes Rößlein ist ein sehr ehrgeiziges Tier, es überholt sämtliche Vorausreitende, kaum, daß Panaiates, der Bursche, folgen kann.
Der Nebel hat sich gehoben, und die Sonne bricht hervor. Es fängt an, recht heiß zu werden. Trotzdem wir auf bedeutender Höhe angelangt sind, rührt sich kein Lüftchen.
Ich wende den Blick zurück. – Da liegt, wie aus einer Spielzeugschachtel aufgebaut, tief unter mir auf einer Anhöhe Gutland, wo sich die Achai, die größte Weinküferei Griechenlands befindet. Tausende von Fässern mit dem edlen Rebenblut lagern hier, um in alle Welt versandt zu werden. Weiter zurück die Stadt und das weißglänzende Meer. – Die Berge über dem Golf sind unsichtbar, im Nebel versunken.
An einer Quelle hält mein Roß, um in langen Zügen seinen Durst zu stillen.
Im Schatten eines alten Pinienbaumes lagern einige Männer in weißen Fustanellaröcken. Sie sind auf Maultieren vom Berge herabgekommen. In ernstem Schweigen schauen sie unserer Kavalkade nach, die nach kurzer Rast weiterzieht.
Wieder trabt mein Falber, der offenbar die leichteste Last trägt, voran.
Vier Stunden dauert schon der Ritt, und noch immer ist der Gipfel des 3500 Fuß hohen Berges nicht erreicht. Ich schaue mich ängstlich nach der Tante um. Sie nickt mir zu und scheint nicht besonders ermüdet zu sein.
Ein Wäldchen von uralten Platanen, Feigen- und Lorbeerbäumen nimmt uns auf. Der Weg wird ebener. Eine Wendung – und das Kloster liegt vor uns.
Zu meinem großen Schrecken setzt sich plötzlich mein Gaul in Galopp, und ich bin mitten in einer Gruppe Mönche, die sich arglos vergnügten, und nun beim Anblick des Weltkindes eiligst im Kloster verschwinden.
Ich muß herzlich über den Schreck lachen, den meine harmlose Person verursacht, und springe aus dem Sattel, um das Kloster näher anzusehen. Es ist ein großes Gebäude aus Backsteinen, das die Zellen der Mönche enthält. Daneben steht ein schlichtes Kirchlein.
Seitwärts schließen sich ein großer Gemüsegarten und mehrere Wirtschaftsgebäude an.
Das Kloster liegt inmitten üppigen Grüns. Gleichsam in einer Oase, weltabgeschieden auf steiler Höhe. Selten wohl verirrt sich ein Mensch in diese Einsamkeit. Ob wohl diejenigen, welche hier in ihrer selbstgewählten Abgeschiedenheit ein beschauliches und frommes Dasein führen, glücklich sind – ist es richtiger, den Kampf mit der Welt aufzunehmen und auszufechten oder zu fliehen und sich hinter Klostermauern lebendig zu begraben.
Wer gibt Antwort? Das Kloster liegt schweigend da.
Lachend und schwatzend nahen meine Gefährten. Man steigt ab.
Die Pferde bekommen einen Schlag mit der Gerte und eilen davon, ihr Futter zu suchen. Ueberall sprießt üppiges Gras und winzige Kräuter.
Unter einer uralten, dickstämmigen Platane machen wir Rast, dicht nebeneinander murmelnde Quelle, deren herrlich kühles Wasser Mensch und Tier erquickt und belebt. Ein frisches Lüftchen säuselt im Laube, und die Sonnenstrahlen schlüpfen durchs Gezweig und spielen auf den türkischen Teppichen, die die Pferdejungen für uns zum Lagern auf die Erde gebreitet haben, und auf dem weißen Tischtuch, das sich unter den geschäftigen Händen sämtlicher Damen mit Geschirr und allerlei appetitlichen Dingen bedeckt.
Lachs, Salat, Eier, gebratene Hühnchen, Lammbraten, Früchte und Käse gibt es.
Es mundet herrlich in der frischen Bergluft nach dem strapaziösen Ritt.
Unsere Leute, die in ehrerbietiger Entfernung sich ebenfalls gelagert haben und mit beredten Blicken auf unser leckeres Mahl sehen, bekommen einen reichlichen Anteil.
Unsere vierbeinigen Begleiter verschlingen gierig die hingeworfenen Fleischstücke und Knochen und sind schier unersättlich.
»Arme Tiere!« sagt Alma, »hierzulande kümmert sich kein Mensch um sie. Niemand denkt daran, diesen klugen, treuen Geschöpfen Schutz und Pflege angedeihen zu lassen. Hunde und Katzen treiben sich zu Hunderten herrenlos und verwildert umher. Sie nähren sich vom Abfall, den sie finden, und vom Aas, das ebenfalls in Straßengräben und am Meeresufer herumliegt und oft einen pestilenzartigen Geruch verbreitet.«
»Als eine Wohltat ist es zu begrüßen,« fällt der deutsche Konsul ein, »daß die Polizei alljährlich in den heißen Monaten sämtliche herrenlose Hunde und Katzen vergiften läßt, denn das Viehzeug vermehrt sich unglaublich, trotz Hunger und Elend.«
Während wir noch unter heiterem Gespräch unser Mahl einnehmen, siehe, da naht sich ein alter Mönch in einem dunkelblauen Gewande, einen Lederriemen um den Leib. Lang herab wallt ihm ein grauer Bart, und seine dunklen Augen schauen freundlich ernst auf uns Kinder der Welt. Er heißt uns im Namen seiner Mitbrüder willkommen und überreicht uns einen großen, antik geformten Krug, gefüllt mit Wein.
Er wechselt einige Worte mit den Herren und neigt bejahend das Haupt, als man ihn fragt, ob es der Gesellschaft gestattet sei, die Klosterkirche in Augenschein zu nehmen. Dann verschwindet er wieder, langsamen Schrittes, wie er gekommen.
Der Wein erweist sich als recht sauer und wird den Dienern überwiesen, die ihm auch die größte Ehre angedeihen lassen, denn bald erschallt läute Fröhlichkeit aus deren Mitte.
Nach dem Essen zerstreut sich alles. Die meisten gedenken im Schatten eines Baumes ein Schläfchen zu machen.
Tante, Alma und ich, die wir keine Müdigkeit empfinden, lenken unsere Schritte einer waldigen Anhöhe zu.
Hier empfängt uns kühle, schattige Waldeinsamkeit. Wunderbare Blumen blühen im Gebüsch. Lilien von violetter und hellgrüner Farbe, Orchideen und eine Menge köstlich duftender Blauveilchen.
Ich pflücke Blumen, und Tante wandelt Hand in Hand mit ihrer Freundin, wie sie es vor langen Jahren getan, in ihrer Kinderzeit, im Thüringer Lande.
»Sieh,« sagt die Konsulin stehen bleibend, »welch wunderbarer Anblick! Die Felsen treten auseinander, und über eine üppig bewaldete Schlucht schweift der Blick zu dem tief, tief unter uns gelegenen blauen Meer und den fernen wolkenbildenden gleichen Bergen. Farben wirken hier zusammen, wie sie die Phantasie des Malers nicht hervorzubringen vermag. Und über der ganzen Landschaft liegt der leuchtende, grelle Schein der südlichen Sonne. Man kann sich nicht satt sehen an diesem Bilde und begreift es jetzt, wie man sich hierher flüchten kann aus dem Getriebe der Welt, in diese zauberische Berg- und Waldeinsamkeit.«
Lange, lange sitzen wir hier unter einem hohen Lorbeerbaum. Dabei schweifen die Gedanken in die ferne Heimat, zu unseren Lieben zurück. Die Tante und ihre Freundin sind weich gestimmt und unterhalten sich von ihren goldenen Kindertagen.
Schritte ertönen, Panaiote erscheint, uns zurück zu eskortieren, denn das Klosterkirchlein soll besichtigt werden.
Das Klostertor ist weit geöffnet. Aus einer Gruppe junger Mönche, alle im blauen Leinengewand, den Ledergut um den Leib tritt der uns bekannte Alte hervor. Er schließt die Pforte der Kirche auf, aus der uns eine Grabesluft entgegenweht.
Huh! Schaurig, öde und kahl sieht es hier aus. Nur ein Heiligenbild in goldenem Rahmen schmückt die Wand. Nichts zeugt von dem großen Reichtum des Klosters.
»Hinweg, hier erdrücken mich die Wände,« flüstert die Konsulin, »hier finde ich keine guten und frommen Gedanken wie draußen in der freien Gottesnatur, die mein ganzes Sein durchbebten und erhoben.«
Es scheint den andern ebenfalls hier unheimlich zu werden, und die Gesellschaft verläßt bald die Stätte, nicht ohne dem Kloster eine ansehnliche Summe zu stiften.
Die Führer haben inzwischen die Pferde zusammengetrieben und bereit gemacht. Alle haben vom reichlichen Weingenuß rote Köpfe und bedenklich wackelige Beine.
Jonio, der Aelteste, stimmt laut mit näselnder Stimme ein Loblied auf seine Dame, die schöne Italienerin, an, von welcher Ehre dieselbe, des Griechischen nicht mächtig, keine Ahnung hat. Er hilft ihr in den Sattel und will den Zug eröffnen, als abermals mein Falber ihn um mehrere Nasenlängen schlägt. Darob große Wut von Jonio, Panaiote schimpft, die andern mischen sich hinein, und es kommt beinahe zu Tätlichkeiten. Durch des Konsuls Dazwischentreten beruhigen sie sich, und murrend fügen sich die Führer.
Es geht bergab. Meine Wenigkeit an der Spitze.
War der Aufstieg schon beschwerlich, der Abstieg ist es noch viel, viel mehr. Vorsichtig, die großen Steine vermeidend, und doch oft in Geröll ausgleitend – wobei einem der Schreck bis in die Fingerspitzen zuckt, so klimmen die Rößlein den Berg hinab. Fest sitzen muß man, denn bei jedem Schritt rutscht man nach vorn, wobei sich die Finger krampfhaft am Sattel anklammern. Schwindelfrei muß man auch sein, denn vor uns liegt die ganze zu durchmessende Tiefe. Heiß drückt die Sonne durch den Nebelschleier, der sich von neuem über die Gegend zu breiten beginnt und Meer und Berge mit fahlem Grau einhüllt.
Je tiefer wir zu Tal kommen, desto schwerer und drückender wird die Atmosphäre, und von Mensch und Tier rinnt der Schweiß.
Die Tante, die Konsulin und ein paar andere Damen sind abgestiegen, teils um den armen Tieren, die wie aus dem Wasser gezogen aussehen, die Last zu erleichtern, teils dem Stoßen und Stuckern zu entgehen. Aber sie müssen bald wieder aufsteigen. Der Weg ist entsetzlich und nicht für Damenschuhe eingerichtet.
Endlich nach vier Stunden sind wir unten, und die Pferdchen, die mühsam dahingeschlichen sind, raffen sich, da sie den Stall wittern, zu einer letzten Kraftanstrengung auf. Die Kavalkade sprengt im Galopp auf den Chani zu, wo unsere Wagen bereit stehen.
Halb zerschlagen klettern wir von den Gäulen und ruhen die müden Glieder in den weichen Polstern des Wagens aus. Die Burschen werden entlohnt und ziehen vergnügten Antlitzes mit ihren Tieren von dannen. Die zwei armseligen Köter, die uns treulich geleitet haben und nun im Zweifel sind, ob sie uns auch ferner folgen sollen, werden vom Wirt verjagt, und suchen mit eingekniffenen Schwänzen das Weite.
Es dunkelt bereits, als wir von Matra und den Hindern herzlich begrüßt, in Patras ankommen. Alles klagt über die entsetzliche Schwüle, die hier den ganzen Tag geherrscht habe.
Wir eilen in unsere Zimmer, um den Staub und Schweiß abzuwaschen, da – was ist das?
Ein seltsames Knistern und Knattern ertönt rings um uns. Der Fußboden schwankt wie in einem Schiff hin und her, und Tür- und Fensterflügel bewegen sich unheimlich.
»Seismos! Erdbeben!« schreit es auf der Straße.
»Seismos!« schreit auch die Kinderfrau und reißt die Fenster des Luftdruckes wegen auf.
Sie lehnt betend und sich bekreuzigend, zitternd in der tiefen Mauernische.
Todori, der eben mit Geschirr aus der Küche kommt, läßt es mit entsetzlichem Gepolter fallen, steht an allen Gliedern schlotternd da und betet laut.
Matra hat die Kinder aus den Betten gerissen und eilt in den Garten hinab, wo wir uns alle schreckensbleich zusammenfinden.
Wir fürchten, im nächsten Augenblick wird das Haus zusammenstürzen, und die paar Sekunden, die das Erdbeben dauert, dünken uns eine Ewigkeit.
Endlich, endlich wird es wieder still. Nur die Hängelampen schwingen noch eine Weile hin und her. Endlich beginnt auch die Spannung und der Schreck vor dem Unbekannten, Gräßlichen, dem der Mensch so machtlos gegenübersteht, nachzulassen, und wir kehren wieder ins Haus zurück,, um noch lange beisammen zu sitzen, und unsere Gedanken über ein Ereignis, das hier in Griechenland eben nicht zu den Seltenheiten gehört, auszutauschen. Das ist ein unheimlicher Abschluß unserer hübschen Partie!
Angstvoll geht man zu Bett.
Gegen vier Uhr morgens ein zweiter Stoß, und abermaliges Klirren, Knattern und Schwanken.
– – In dieser Nacht schliefen wir nicht mehr.
Im Laufe des Tages kommen dann die Berichte über das große Unheil, das das Erdbeben in Atalonti, Theben und Umgegend angerichtet hat.
Wir sind alle wehmütig gestimmt. »Daheim im Norden,« sagt die Tante, »kann man sich mit größerer Seelenruhe ins Bett legen als hier, wo man nie vor derartigen Ueberraschungen gesichert ist. Ueberhaupt mein Heimatland, um nichts möchte ich es eintauschen!«
»Ja, ja, daheim!« durchzittert es auch meine Seele.
*
In Zante.
Heute abend haben wir deutsche Volkslieder gesungen. Es war eine größere Gesellschaft bei uns. Erst ging es ganz heiter zu, und plötzlich ward uns Ausländerinnen ganz eigen zu Mute. Ich sang:
»Da draußen vor dem Tore,
Da steht ein Lindenbaum,«
und sah, daß große Tränen in die schönen Augen Tante Almas traten, und als wäre sie weit, weit fort von hier, sprach sie wie im Traume nach:
»Du fändest Ruhe dort.«
Ihr Mann trat zu ihr und küßte ihre weißen Hände, es zuckte über sein Gesicht, es war, als fühlte er, daß sie hier noch nicht ganz Wurzel gefaßt hatte. –
Vom Balkon aus erscholl helles Lachen. Matra und Doktor Toringo neckten sich wie immer. Dann erschien dieser auf der Schwelle und erzählte einen Witz, der lebhaft belacht wurde.
Die Konsulin verläßt das Zimmer, Tante Hanna folgt ihr. Zu ihren Stimmungen paßte keine Heiterkeit.
»Nun, kleines Fräulein,« redete mich der Doktor an, der Vorsitzender des Zantiotenvereins ist, »werden Sie unser schönes Fest mitmachen?«
Und er sah mir so tief in die Augen, daß ich errötete.
»Welch ein Fest?« fragte ich etwas verwirrt.
»Unser Verein hat einen großen Passagierdampfer gemietet,« erklärt er gewichtig, »fünfhundert Personen haben bereits Billetts bestellt, die Vergnügungsfahrt geht nach Zante,« und mit südländischem Feuer weiß er ein glänzendes Programm zu entwerfen.
Die ganze Gesellschaft findet sich bereit mitzutun.
Ein paar Tage später waren wir auf dem Wege dorthin.
Sehr zeitig haben wir uns wecken lassen müssen, denn das Schiff wollte schon um fünf Uhr die Anker lichten. Der innere Hafen wimmelt von Barken, gefüllt mit Ausflüglern, die sich gleich uns nach dem draußen im Meere liegenden Schiffe hinausrudern lassen.
Ein großes Musikchor, das dicht hinter uns fährt, läßt seine lustigen Weisen erschallen.
Lautes Stimmgewirr schallt bereits vom Pelops herab, der übertrieben mit Wimpel und Fähnchen geschmückt, einen festlichen Anblick gewährt.
Wohl oder übel muß man, über Barken steigend, zum Schiffe gelangen; es ist wahrlich kein kleines Kunststück, bei dem frischen Morgenwinde, der sich in Kleidern und Hüten verfängt, mit Würde und Grazie die schwebende Schiffstreppe hinanzuklimmen. Dazu die Hunderte von neugierigen Augen, die jeden Ankommenden mustern.
Oben quirlt und drängt eine sonntäglich geputzte Menge durcheinander. Und spät gekommen, würde es wohl kaum gelingen, einen Platz zu erobern, wenn nicht der gute Doktor für unsere Gesellschaft ein gemütliches Plätzchen, geschützt vor Wind und Sonnenbrand, reserviert hätte. Hier, dicht bei einer der großen Radschaufeln, die sich eben langsam in Bewegung setzen, lassen wir uns nieder.
Die Musik intoniert die griechische Nationalhymne, und bei diesen Klängen geht es an Wellenbrechern vorbei, hinaus ins Meer.
Kein Wölkchen trübt des Horizontes durchsichtige Bläue. Die Sonne lacht herab, und die frische Morgenluft rötet die Wangen der Ausflügler. Aus allen Schichten der Bevölkerung rekrutieren sich diese. Ein paar Popen sind auch darunter. Vom kleinen Kinde bis zum Greise, sind alle Altersstufen vertreten, und merkwürdig, wie wenig schöne Gesichter man doch sieht; vom berühmten, griechischen Typus, mit klassischem Profil, ist nichts zu sehen, dagegen oft wirklich kolossale Häßlichkeiten. Bewunderungswürdig ist nur, wie geschmackvoll und schick sich die Griechinnen zu kleiden und mit welcher Anmut sie die einfachsten Kleider zu tragen verstehen.
Auf dem Pelops ist außer Café und Wein nicht viel zu bekommen, und wer sein Frühstück noch nicht vor Tagesgrauen eingenommen hat, packt die mitgenommene Esserei aus.
Wir gleiten an der mazedonischen Küste entlang. An den Bergen von Missalonphi vorüber, die ich vom Balkon zu Hause so oft in wechselnder Beleuchtung bewundert habe. In der Nähe, beim hellen Sonnenschein, sehen sie kahl und uninteressant aus.
Nun sind wir im offenen Meer, und große, indigoblaue Wogen kommen angezogen. Der Dampfer, der keinen Ballast mit sich führt, fängt an zu schaukeln; anfangs ganz sachte, dann immer mehr und heftiger. Unsere kleine Gesellschaft hält sich tapfer, während von den übrigen Passagieren mancher verschwindet oder sich über Bord lehnen muß.
Die Kapelle spielt unverdrossen ein Stück nach dem andern. Unbekümmert darum singen junge Leute am Ende des Schiffes mit näselnder Stimme ein Lied, das unendlich viele Verse hat.
Gegen neun Uhr taucht die Insel Cephalonia auf, die wir in ziemlicher Entfernung zur Rechten liegen lassen. Die hohen Bergzüge dieser sehr vulkanischen Insel haben denselben Charakter wie die vom Festlande – sind kahl und tragen noch Schnee in ihren Rinnen. Durch das Fernrohr erblicken wir einige kleine Ortschaften, die Hauptstadt liegt auf der anderen Seite der Insel.
Nach etwa einer Stunde erscheint dann unser Reiseziel, die Insel Zante, in nebelhaft zerflossenen Konturen am Horizonte.
Nach und nach treten diese deutlicher hervor, und gegen Mittag sind wir im Hafen.
Großer Gott, welche Zerstörung bietet sich den Blicken dar! Wie gräßlich hat das Erdbeben hier gehaust! Wohin das Auge blickt, Ruinen und Trümmerhaufen. Der hohe Berg, an dessen Fluß die Stadt Zante sich ausbreitet, ist stellenweise in sich zusammengestürzt.
Im Vordergrund, dicht an der Mole, erhebt sich eine buntfarbige Barackenstadt, zwischendurch eine Menge Zelte, in denen diejenigen hausen, deren Besitz vernichtet oder unbewohnbar geworden ist.
Das Theater am Hafen, ein schönes Gebäude, liegt halb in Trümmern. Dicht daneben erhebt sich schlank und unversehrt, vom Boden aufragend, ein venezianischer Glockenturm. Sein festgefügtes Gemäuer hat der Vernichtung Trotz geboten. Die dazu gehörige Kapelle ist zerstört.
Je näher man kommt, je grauenhafter werden die Einzelheiten, und das Herz krampft sich zusammen bei der Vorstellung von all dem Jammer und Elend, die das Erdbeben angerichtet. Und über dem traurigen Bilde wölbt sich ein südlicher Himmel in seiner ganzen Pracht, lacht die Sonne herab auf die mit Fähnchen und Girlanden geschmückten, renovierten Gebäude und auf eine tausendköpfige Menge, die sich auf den Molen drängt und in Barken dem Schiff entgegenrudernd, Tücher schwenkend und Zito rufend.
Ein weiß gekleidetes Musikchor spielt die Zantioten-Hymne, und während unser Schiff langsam beidreht und Anker wirft, läuten die Glocken der Stadt, und die von sämtlichen Kapellen und Kapellchen bimmeln darein.
Wahrlich, ein erhebendes Gefühl, so feierlich empfangen zu werden! – Und welche Ueberraschungen harren noch unser! Barken schießen heran, die uns im Nu nach der Mole bringen, wo mehrere Notabilitäten Doktor Toringo und unsere Freunde, die Konsuln der fremden Mächte empfangen.
Die Menge bildet eine Gasse, durch die wir im Gänsemarsch ziehen, was mir sehr belustigend vorkommt. Jede Dame erhält einen Rosenstrauß, und wahre Blumenregen fallen aus den Fenstern der Häuser auf uns herab.
Wir wandeln auf Grün dahin, denn des herrschenden Staubes wegen hat man die Straße mit frischen Zweigen bestreut.
Die beiden Musikchöre voran, zieht die Menge nach einer entfernten Kapelle, wo ein feierlicher Gottesdienst abgehalten wird.
Eine riesenhafte Staubwolke wirbelt hinter ihnen her.
Unsere kleine Gesellschaft wird von den Vorständen der politischen Vereine eingeladen, ihre Lokale mit ihrer Gegenwart zu beehren. So werden wir nacheinander in drei Gebäude geführt, die noch deutliche Spuren von kürzlicher Reparatur aufweisen. In jeder derselben erwarten uns Begrüßungsreden, und durch ganze Berge von Eis und Gebackenem müssen wir uns durchessen. Eine vierte Einladung wird standhaft ausgeschlagen, dagegen der Aufforderung einer dem Doktor befreundeten Familie, uns in ihrer am Meer gelegenen Baracke von den Strapazen der Seefahrt und des Empfanges auszuruhen, gern Folge geleistet.
Ein kühler, luftiger Holzbau empfängt uns, frisch weht die Seeluft herein, doppelt wohltuend nach dem Sonnenbrand und Straßenstaub.
Die Familie, die bei der Katastrophe ihren Besitz und sämtliches Mobiliar eingebüßt hat, hat sich, während ihr Haus wieder aufgebaut wird, hier ein sicheres und behagliches Heim geschaffen.
Kaum hat man sich ein wenig erholt, so geht es zu neuen Taten weiter. Ein Mittagmahl erwartet uns bei einer anderen, gastfreien Familie, die nicht weit entfernt von der Stadt wohnt.
An dem eingestürzten Theater gehen wir vorüber, an ruinenhaften Häusern und Häuschen, die teils verlassen, teils mit Balken gestützt und mit Brettern vernagelt von armen Leuten wieder belohnt werden.
Die Zantioten sind ein leichtlebiges Völkchen – die Katastrophe ist vorbei, und alles ist vergessen. Niemand gedenkt der kommenden Tage, die neue Schrecknisse bringen können. Ueberall herrscht Frohsinn und Lust.
Das Haus, in welchem man uns zum Mittagmahl erwartet, liegt inmitten der Ruinen. Eine unheimlich neue Treppe hinan, führte man uns in ein mit Blumen geschmücktes Gemach, in dessen Mitte ein gedeckter Tisch beinahe unter der Last von Gerichten bricht.
In animierter Stimmung wird das Mahl eingenommen. Zwar etwas hastig, denn das Programm des Tages verspricht neue Genüsse. Nach einer kurzen Rast ertönt Peitschengeknall – sechs elegante Zweispänner halten vor der Tür, zu einer Spazierfahrt einladend.
Die Sonne versteckt sich ab und zu in den Wolken. Die fernen Bergzüge der Insel liegen aber im goldenen Schein.
In schlankem Trabe fahren wir den Berg hinan und lassen die Stadt und das blaue Meer tief, tief unter uns. Durch Olivenhaine und an üppigen Weingärten von Rosenhecken umzäunt, vorbei, geht die Fahrt. Wie schön ist hier die Natur. Ueberall saftiges Grün, duftende Kräuter – und überall zerstörte Hütten und Mauern!
Pfeilschnell jagen wir hinab in die Campagna, die ebenfalls mit Trümmern von Landhäusern und Kapellen bedeckt ist, einem fernen Dörfchen zu, wo heute Kirchweih gefeiert wird. Eine festlich geputzte Menge zieht dorthin, zu Fuß und auf Maultieren. Die Männer sind große, kräftige Gestalten, die Frauen fast durchweg bildschön. –
»Es sind,« erklärt der Konsul, »die Nachkommen der eingewanderten Venezianer.« Ein weißes Kopftuch deckt das dunkle Haar der Frauen, das in einer großen Welle über die Stirn gelegt wird. –
Einen Wagen voll singender blitzäugiger, junger Burschen überholen wir, und so manch Rößlein, das Mutter und Kinder trägt, während der Vater würdevoll zur Seite schreitet.
Nach und nach wird das Landschaftsbild freundlicher. Wir nahen uns dem westlichen, vom Erdbeben verschonten Teil der Insel. In den hohen Bergzügen liegen reizende Dörfchen, weiße Häuschen und schlanke Türme lauschen aus dem Grün der Oliven- und Granatenbäume hervor. –
Nun sind wir am Ziel und entsteigen den Wagen. Es wimmelt von Landbewohnern in originellen und teilweise kostbaren Trachten, die sich um die Herrlichkeiten der aufgestellten Buden drängen.
Ein ohrenbetäubender Lärm schallt uns entgegen. Kolnri, Wasser- und Orangenverkäufer schreien, und Musik tönt aus einem offenen Tanzlokal, wo sich die Jugend im Tanze dreht. Hier braten Lämmer an Spieße, und der brenzlige Duft mischt sich mit anderen undefinierbaren Gerüchen.
Die Menge drängt und stößt, schreit und gestikuliert, aber überall macht man den Fremden ehrerbietig Platz, und mit neugierigen Blicken werden wir betrachtet.
Wir treten in eine Kapelle, vor deren goldstrotzenden Heiligenbildern sich die Leute drängen. In der Mitte der Kapelle befindet sich das dem heiligen Dionysios, dem Schutzpatron der Insel, geweihte, mit Glas bedeckte Bild, das ein jeder der Anwesenden gläubig küßt.
Schon neigt sich die Sonne dem Untergang zu, als wir das Dörflein verlassen, um durch das vom goldigen Abendschein beleuchtete Land einer einsamen, auf einem Hügel stehenden Kapelle zuzufahren. Ein junger, blasser Priester empfängt die Gäste und geleitet uns zu einer mit Blumen geschmückten Tafel. Bis in die Nacht hinein wird gegessen, getrunken und werden Toaste gehalten, bis es dunkel wird und hier und da ein Sternlein am Himmel aufblitzt. Düster hebt sich die Kapelle von diesem ab, die Cypressen, die sie umstehen, erscheinen schwarz und gespenstig. Wieder umspinnt einen der Märchenzauber, bis Peitschengeknall uns daraus erweckt und das phantastische Bild in der Nacht versinkt.
Und wieder geht es in toller Fahrt der Stadt zu, deren heller Lichterglanz zu uns hinaufblitzt. Musikchöre ziehen durch die von Menschen wimmelnden Straßen, dem freien Platze vor dem Theater zu. Die öffentlichen Gebäude haben illuminiert, Leuchtkugeln und Raketen steigen in die Luft. Bengalische Flammen beleuchten die Ruinen mit grauenhafter Klarheit. Hier herrschendes Leben, dort Spuren von Tod und Vernichtung, die überall unsichtbar lauern und im nächsten Augenblick schon über diese lachenden Menschen hereinbrechen kann.
»Sie haben recht,« sagt Dr. Toringer, »sich des Augenblicks zu freuen, wer weiß, wie kurz es währt.«
Wir sind todmüde, lassen all den Lärm und das Getöse hinter uns und begeben uns in das am Meer gelegene Hotel.
Zur Heimfahrt am andern Morgen finden sich alle Ausflügler, übernächtig aussehend, wieder zusammen.
Tücher schwenkend, Zito rufend, und ein jeder wirft nach altem Brauch sein Taschentuch ins Meer, dann geht es fort.
»Gott sei Dank,« ruft die Tante und zitiert Goethes Worte:
»Nichts ist schwerer zu ertragen
Als eine Reihe von guten Tagen.«
Dann sagte sie wie jedesmal: »Nie wieder einen Ausflug machen, so schön es auch gewesen, die Strapazen wiegt es nicht auf.« Und dieses Mal hält sie wirklich Wort! Als wir heimkommen, liegt ein Brief für uns dort. Zu unserem großen Erstaunen melden uns Berliner Freunde ihre Anwesenheit in Athen und bitten uns, sie dort aufzusuchen.
»Auf keinen Fall,« sagt die Tante, »ich bin ganz kaputt von dem vielen Herumfahren und werde froh sein, wenn ich die Rückfahrt gut überstehe.«
Der gute Konsul sieht es mir an, wie verlockend »Athen« für mich gewesen.
»Lassen Sie Lilli allein reisen,« schlägt er vor. »Matra darf sie begleiten.«
Matra sagt einfach: »Nein, ich habe keine Lust dazu.« Wie ich sie kenne, nützt kein Bitten. Man berät, wer mein Schutzengel sein könnte, aber ich bin mutig und setze es durch, daß Tante mich allein reisen läßt.
An einem frühen Morgen wanderte ich neben Theodori, der mein Köfferlein trug, der nahen Station zu, um nach Athen abzudampfen.
Ganz so wohl ist mir bei dem Gedanken, neun Stunden allein reisen zu sollen, jetzt nicht.
Mit der Schmalspurbahn geht es am Meere entlang.
An dem Fenster meines Coupés, worin ich einsam hause, erscheint der Schaffner. Er redet auf mich ein, aber so sehr ich auch in meinem Sprachschätze suche, ich verstehe nichts von jenem, mit vielen Gestikulationen begleiteten Worten, und eine große Angst beschleicht mich. Ich zucke die Achseln und damit basta.
Weiter geht's in Bummelzuggeschwindigkeit. Jetzt rasselt der Zug über eine Brücke. – Da wird plötzlich die Coupétür aufgerissen und herein schwingt sich ein Mann.
Im ersten Augenblick denke ich an Briganten, die mit Dolch und Pistolen auf Raub ausgehen, aber ein Blick auf den Eindringling, der höflich den Hut zieht, befreit mich von aller Furcht. Es ist der den Zug begleitende Ingenieur, der vom Schaffner auf eine nicht Griechisch sprechende Dame aufmerksam gemacht worden, seine Dienste anbietet.
Wie froh bin ich, eine teilnehmende Seele gefunden zu haben. Der Ingenieur hatte mehrere Jahre in Deutschland die Schule besucht und erklärte mir mit größter Liebenswürdigkeit in unserer Muttersprache die Gegend.
»Schon winkt auf hohem Bergesrücken
Akro Korinth des Wandrers Blicken.«
Aber nach Poseidons Fichtenhain halten meine Blicke vergeblich Umschau. Kein Baum, kein Strauch ist zu sehen. Hinter dem Dorfe Colamaki beginnt der Kanal, über den die Eisenbahnbrücke führt, die unser Zug passiert. Eng und schmal sieht er aus. Seine Tiefe ist acht Meter, man sollte kaum meinen, daß die großen Schiffe hindurch können. –
Wir haben den Peloponnes verlassen und sind in Attika. Die Gegend bekommt einen anderen Charakter, sie wird anmutig, während sie vordem wild und zerklüftet war. Das Aegäische Meer hat hier eine lichtblaue Farbe, durchsichtig wie Glas.
Die Bahn führt immer in halber Berghohe am Gestade hin, und bei der Kakoskala, wo gewöhnlich Erdrutschungen stattfinden, kriecht der Zug wie eine Schnecke. Vor jeder Brücke klettert der Ingenieur hinaus und untersucht diese.
Nun kommen wir durch eine kahle Ebene, mit dem reizlosen Eleusis mit seinem Zeustempel. Die Gegend ist uninteressant.
Endlich taucht Athen auf, von der Akropolis überragt.
Ich hatte mir doch den Eindruck großartiger gedacht; ich finde es von hier aus nur anmutig im Grün liegend.
Am Bahnhof stehen unsere Freunde; sie sind erstaunt, mich allein zu sehen und bewundern meine Tapferkeit. Wir fuhren durch den modern aussehenden Stadtteil, nach dem Hotel, das dem königlichen Schloß gegenüberliegt.
Herr und Frau Thiersch sind entzückend lieb zu mir. Recht lange sollte ich mich ausschlafen; mein Zimmer ist gleich neben den ihrigen, und alle Augenblicke kommt Frau Thiersch nach mir sehen.
Aber ich bin frisch und fröhlich und brenne vor Ungeduld, die Stadt kennen zu lernen, die schon in der Schule Sehnsucht in uns erweckt hatte.
Am nächsten Tage weht ein fürchterlicher Scirocco; die ganze Luft ist mit glühenden Staubatomen erfüllt. Im Hotel werden Türen und Fenster dicht verschlossen, und dennoch wagen wir uns hinaus, um dem Museum einen Besuch abzustatten.
Kühle Marmorhallen empfangen uns, und vielgestaltig sind die Schätze, die hier aufgestapelt sind – leider weiß ich sie nicht zu benennen.
Nach Tisch führte uns der Zug nach dem Seebad Phaleron, welches, reizend gelegen, ein Zusammenflußort der großen Welt Athens ist. Heitere Musik ertönt von dem ins Meer hinausgebauten Orchester, geputzte Menschen kommen angeströmt, und Badende plätschern im kühlen Naß umher. Hell und freundlich lacht die Sonne, der Scirocco hat nachgelassen.
Der Abend dämmert. Wir fahren, um einen Zirkus zu besuchen, nach der Stadt zurück.
Eine offene Arena, über die sich der sternbesäte Himmel wölbt, nimmt uns auf. Heiß weht die Luft und schüttet uns ab und zu Staub in die Augen.
Eine italienische Truppe, ein wenig ärmlich, macht die altbekannten Kunststücke. Ein Mann balanziert eine lange Stange bald auf dem Kopf, bald auf den Schultern, oben auf einem Brett steht ein Weib und macht seine Kunststücke mit Kugeln und Reifen – plötzlich ein Schrei – die Stange ist von des Mannes Schultern abgeglitten – er fängt sie noch mit den Händen auf – das Weib fliegt im großen Bogen ins Publikum, das entsetzt aufschreit. Es ist ein Moment, daß der Herzschlag stockt. Glücklicherweise hat der Frau dieser Salto mortale nichts geschadet; sie tritt zwar augenblicklich ab, kommt aber bei der nächsten Produktion wieder zum Vorschein.
Am nächsten Morgen ist an ein Ausgehen leider nicht zu denken. Der Scirocco weht entsetzlich, und die Luft ist erstickend heiß, bei 28 Grad im Schatten. Erst am Nachmittag, wo der Wind sich legt, durchfahren wir eine Straße, mit wehenden Pfefferbäumen, zu einer Schule, die unter dem Protektorat der Königin steht. Hier werden Teppiche und luftige Seidenstoffe auf Webestühlen gewebt, und junge Mädchen bilden sich in allen Handarbeiten aus. In der Mitte eines Saales lag ein großer, wertvoller Teppich aus dem königlichen Schloß, in welchen kunstvoll neue Stücke eingesetzt werden. –
Draußen vor der Stadt steht der Jupitertempel, von dem nur etwa vierzehn Säulen gen Himmel ragen. Kürzlich stürzte eine um und liegt nun in Trümmern am Boden.
Am Tore des Hadrian und an einer ausgegrabenen Arena aus der Römerzeit vorbei, führt der Weg hinauf zur Akropolis.
Wir verlassen den Wagen und klimmen den mit Marmortrümmern besäten Weg hinan. Den Zugang verschließt ein eisernes Tor, von Soldaten bewacht.
Mit ganz eigenen Gefühlen steigt man die Marmortreppe hinan – es ist, als umwehe einen der Geist der Vergangenheit. Die Propyläen, das Parthenon! Was ist über sie gesagt und gesungen worden, und wie wenigen ist es vergönnt, diese klassische Stätte zu betreten. Weiße Marmorsäulen ragen in die Luft, die meisten zerstört und geschwärzt, zeugen vom Vandalismus der einstigen Belagerung von Türken und Venezianern. Die schönen Friese am Parthenon haben die Engländer abgelöst und mit fortgeführt, und an der Stelle, wo die große Statue der Pallas Athene stand, die über die Burg hinwegragte, gähnt ein viereckiger Schlund. Nur der Nike-Tempel ist noch gut erhalten. Auch von den Karyatiden sind nur zwei noch vollständig, sonst Zerstörung und Trümmer überall. Und doch wie großartig noch im Verfall, wie wundervoll und erhaben!
Leise verglimmt das Abendrot am Himmel am Aroopopus, dem Gefängnis des Sokrates, schleichen violette Schatten hin, und der Venustempel blickt weiß herauf durch die Dämmerung. Die Nacht bricht an und tausend Lichter leuchten in der Stadt und vom Meere her, und das Leben und Tosen dringt zu uns in diese wundersame Einsamkeit.
Der Vollmond zieht herauf und wirft seinen Schein über die stillen, hehren Säulenhallen auf das weite Trümmerfeld.
Uns ist ganz eigen zumute, niemand spricht ein Wort.
*
Zwei Tage sind schnell verrauscht – schon befinde ich mich wieder auf der Heimreise – Athen und die Akropolis entschwinden meinen Blicken. Wieder spielen die saphirblauen Wellen des Aegäischen Meeres ans Ufer, wieder rasselt der Zug über den Kanal von Korinth. Alles Orte, die ich im Leben wohl nie wiedersehen werde, grüßt mein scheidender Blick.
Spät in der Nacht lande ich müde, heiß und staubig und tüchtig durchrüttelt, in Patras, im Innern aber erhoben und erfreut, den geweihten Boden gesehen zu haben. –
*
Einmal, als wir im Palmenhain spazieren gingen, fragte ich Matra, ob sie unsere schönen, deutschen Sagen und Märchen kenne, und ob man hier zu Lande solche habe.
»Ei,« sprach sie, »ich will dir doch gleich ein Märchen erzählen. Komm, setzen wir uns hier auf den Felsen unter die Fächerpalmen, lege deinen Kopf in meinen Schoß, sieh mich mit deinen hellen Augen an und höre mir zu:
»Es war einmal eine liebliche Waldmaid; sie war die Tochter eines Bergkönigs und war mit des Meerkönigs Sohn heimlich verlobt.
Jeden Abend lag er ihr zu Füßen. Oft sang er von seiner Kraft und Gewalt, bald ließ er seine dröhnende Stimme ertönen und erzählte ihr von den Wundern des Meeres, von den Schönheiten, die unter ihm wohnten, und dergleichen mehr. –
Hin und wieder warf er ihr Perlen zu, und die Wellen, die den Berg umspülten, brachten ihr tagsüber seine Grüße.
Der Bergkönig liebte ihn aber nicht und warnte seine Tochter vor des Meerkönigs Tücke.
»Nimm dich in acht,« mahnte er sein Kind, »ich sehe, des Meerkönigs Sohn will dich verlocken, bald mit seiner spiegelglatten Fläche, bald mit seiner Wellen Schaum. Aber wehe, wenn du dich betören läßt!
Komm, ich will dir eine Geschichte erzählen: »Vor Jahren stand hier drüben ein wunderbarer Berg. Seine Spitze ragte weit hinaus, und um ihn herum war ein herrlicher Hofstaat gebildet. –
Die Leibwache hielten Kakteen, Aloen und Cypressen vom höchsten Adel.
Einmal sagte eine Waldlilie: »Und wenn sie auch alle Wache halten, ich weiß doch, was ich weiß – des Bergkönigs Tochter liebt des Meerkönigs Sohn. Und eines Tages wird er sie holen und ins Verderben stürzen.«
»Woraus schließst du dies?« fragte ihre Nachbarin.
»Paß auf – vom Tau läßt sie sich Perlen über ihr grünes Kleid schütten. Den Saum schmückt sie mit bunten Blumen, und am Abend nimmt sie einen Nebelschleier um und lugt hinaus auf das Meer.
Dann kommt des Meerkönigs Sohn angerollt und küßt das Bergjungfräulein. Und sie breitet ihren Mantel aus und jubelt laut: »Da ist er, da ist er!«
Auch er hat seinen flatternden Mantel angetan. Blau sieht er aus, und es funkelt wie Diamanten darauf.
Und näher und näher rollt und spült er sich an sie heran ... dann läßt sie den Nebelmantel fallen, und er schaut sie in ihrer grünenden Pracht, und die Palmen neigen sich, die Farnkräuter, Gräser, Moose breiten einen kostbaren Teppich aus, über welche sich die Wellen leise hinüberwiegen ...
Einmal sprach die Olive zur Fichte:
»Paß auf, bald gibt es Hochzeit; des Meerkönigs Sohn wird sich mit der Bergprinzessin vermählen.«
»Hörst du, wie es knattert?«
Und es schauten erschrocken die Bäume auf das Meer, denn in tiefster Wurzel fühlten sie sich erschüttert ...
Da kam er herangerollt in flatterndem Mantel, schwarz wie die Nacht. Wie wallende Locken brachen sich die Wolken, und ein Rollen und Brausen ward hörbar.
»Komm, komm, komm,« dröhnte es durch die Luft, und die dröhnende Stimme verlockte die betörte Bergjungfrau.
»Ich komme,« rief sie und breitete ihre Arme aus.
Aber plötzlich zögerte sie – Schrecken war über sie gekommen, da sich die turmhohen Wogen näher und näher an sie heranspülten und auf sie zukamen mit brausendem Getöse, daß der Gischt hoch aufspritzte.
Da erfaßt sie Entsetzen! »Vater!« ruft sie, »Vater, Vater!«
Aber zu spät – er, der sie gewarnt, der treue Vater, vermochte sie nicht mehr zu retten.
Näher und näher kommen die Wogen, immer brausender werden sie, berauben sie ihres Mantels, reißen ihr die Krone vom Haupte ... und nun kam wutschäumend der Meerprinz angefahren.
»Weshalb sträubst du dich, die Meine zu sein?« ruft er mit Donnergebrüll, und seine gewaltige Hand erfaßt die Bergprinzessin und reißt sie in die Tiefe ...
Am andern Morgen, als die Dorfleute, wie immer, über ihren schönen Berg zur Stadt gehen wollten, war dieser von der Erde verschwunden, fortgefegt, als sei er nie gewesen.
Der Meerjüngling aber, der falsche Geselle, lag ruhig und friedlich da, als hätte seine Flut niemals eine Seele getrübt, und er lachte über die gefangene Prinzessin.
»Und so –«, sprach der Bergkönig, »wird es dir ergehen, wenn du mein Gebot nicht beachtest und dich anlocken läßt.«
Da weinte das Bergfräulein heiße Tränen. Sie rollten hinab in das Meer. Und nun wußte des Meerkönigs Sohn, daß sie ihn nicht mehr möge, und er sandte seine Wellengrüße jetzt dem andern Ufer zu.
Dort wohnte die Waldhexe, die Freude am Bösen hatte.
»Kommt, kommt, kommt,« lockte sie allnächtlich, wenn alles in tiefster Ruhe lag, die Wellen.
»Kommt, kommt, kommt, holt euch Schätze in euer Korallenschloß. Wollt ihr tanzen? – lustig sein? – holt euch die grünenden Felder, die saftigen Wiesen, die blühenden Wälder, kommt, kommt, kommt!« – Und sie liefen ihr nach die gekräuselten Wellen, immer weiter und weiter ... und der Wasserprinz hielt Ausschau nach einer andern Braut.
»Dort, dort,« rief er, »dort drüben wohnt noch eine Bergprinzessin, holt sie mir, tanzen will ich, tanzen!« Und von der Waldhexe geführt, rollten die Wellen höher und höher bergan.
Zischende Laute ertönten – brausend und rollend jagte des Meerkönigs wilder Sohn daher ... nur ein paar Sekunden, und er verschlang Felder, Wiesen, Höhen und Wälder ...
Als die Waldmaid davon hörte, erstarrte vor Grauen ihr Blut, grau ward ihr Waldkleid, und ihre Getreuen, die Kakteen, Aloen und Cypressen verdorrten.
Rauhes Gestrüpp nur war zu sehen. – – – – – –
Nach vielen Jahren erzählten, wenn sie vorübergingen, alte Leute den jungen:
»Hier hat einmal eine wunderbare Waldmaid gewohnt.« Und sie bekreuzten sich.
*
Ganz eigen ward mir, als Matra geendet. Ist das Volkspoesie? dachte ich mir; die herrlichen Märchen unseres Landes tauchten vor mir auf, und es überkam mich wie Mitleid.
Die Vermählung des Bergs mit dem Meere werden wohl Anspielungen auf die Erdbeben sein, die so arge Verwüstungen herbeiführen.
»Ist das nicht hübsch?« fragte Matra, aber ich konnte ihr nicht antworten, weiß nicht mal, ob es wirklich hübsch war.
»Komm,« sprach sie, »erheben wir uns, die Schatten fallen länger, die Sonne wird bald untergehen.«
Sie brach einen Zweig weißer Blüten, und Hand in Hand gingen wir heim.
*
Heute herrscht trübselige Stimmung bei uns. Selbst Matra, die Kühle, hat verweinte Augen. Sie küßt mich wiederholt, fest umschlungen halten wir uns. Zum letzten Male sind wir im Palmenhain. Zum letzten Male noch grüßen meine Augen all die Schönheiten Patras. Unsere Sachen sind gepackt, morgen geht es heimwärts.
Tante Hanna und Tante Alma sind heute allein auf ihrem Zimmer geblieben.
Der Abschied wird ihnen bitterschwer.
»Nein, man sollte nie für immer so weit von der Heimat fortgehen,« sagte mir Tante Hanne, als wir allein waren. »Sie muß nun hier bleiben, und in fremder Erde einmal begraben werden, die arme Alma, und doch weiß ich, daß ihr Herz sie heimwärts zieht.«
»Ich möchte auch nie, nie fort aus meinem geliebten Heimatland, nie so weit von den Eltern entfernt sein.« –
Den Abschied will ich nicht beschreiben, nein, ich will nicht sentimental sein, deshalb gleich weiter, weiter bis Venedig.
*
Venedig.
Das Schiff lag still, als wir erwachten. Ein fahler Morgenschein ruht auf dem Wasser. Die Uhr zeigt die vierte Stunde. Ich stecke den Kopf aus der Luke und erblicke eine schmale, grüne Insel und noch mehrere Gebäude, die frei aus dem Meer aufzusteigen scheinen. Wir liegen weit draußen vor Venedig und müssen auf die Sanitätspolizei warten. Nach einer Stunde setzt sich das Schiff wieder in Bewegung. Wir eilen aufs Verdeck, um den Anblick der Lagunenstadt zu genießen, worauf ich mich solange gefreut.
Aus der von Morgensonnengold beleuchteten Flut, die sich in klaren Wellen kräuselt, taucht sie auf, die Märchenstadt, die stolze Venezia.
Noch liegt der Frühnebel über dem Häusergewirr, noch ruht Stille auf dem Canale Grande, in den wir hineinfahren. An der mit einer Kuppel geschmückten Kirche Maria della salute, am Dogenpalast, mit seinen Marmorsäulen, gleiten wir vorüber. Der Campanile und die Piazetta mit ihren Säulen grüßen uns. An das königliche Palais reihen sich stolze Gebäude der Vergangenheit, der Palazza Vendra, und wie sie alle heißen, und über allem diesem liegt der Zauber der frühen Morgenstunde eines schönen Sommertages.
Der Zollhafen ist weit draußen, voll von Dampfern und Segelbarken. Es dauert nicht lange, und die Beamten kommen aufs Schiff, und ein Durchsuchen der Reiseeffekten beginnt.
Wir überkreuzen den Canale grande und fahren durch ein Gewirr von Wasserstraßen unter einer Anzahl Brücken und Brückchen hindurch, an alten, halbzerfallenen Palästen vorbei, hinein in das Innere Venedigs.
Am Nachmittag sind wir bereits auf dem Markusplatze, unter den schattigen Säulengängen der Prokuratien. Welch eine Fülle von reizenden Gegenständen in den Läden, diese wundervollen Glassachen und diese Schmuckgegenstände! Jetzt führt uns der Weg über den Platz, der von Tauben wimmelt, an dem schönen, freiaufstrebenden Campanile, mit der zierlichen Coggetta, vorbei, zur Markuskirche. Dieser wunderbare, kuppelgeschmückte Bau mit seinen herrlichen Glas-Mosaiken mutet uns an wie ein Märchen aus Tausend und einer Nacht.
Ueber die Piazetta schreiten wir an den beiden Säulen vorüber zu den marmornen Säulenhallen des Dogenpalastes. Vor uns liegt die Adria, deren Wellen eine leichte Brise kräuselt.
Eine Menge Gondeln gleiten dahin. Die Führer in weißen Anzügen und hellen Strohhüten, von denen blaue Bänder lustig im Winde flattern.
Ab und zu hastet ein kleiner Dampfer, der Omnibus, wie er genannt wird, vorüber. Wir fahren nach der Markuskirche; hier gesellt sich ein Fremdenführer zu uns und bietet seine Dienste an.
Seine Beredsamkeit verlockt uns, eine Glasausstellung anzusehen. Er führt uns durch ein Gäßchen in ein Haus, wo in einem düsteren Gemach ein Mann sitzt und mittels eines kleinen Röhrchens über einer Flamme sogenannte venezianische Perlen bläst.
Schön vergoldet, in ein Kistchen getan, erhalte ich solche von Tante Johanna zum Geschenk. Wir betreten einen anderen Raum, wo die reizendsten Glasgegenstände aufgespeichert sind. Kelche und Gläser in allen Gestalten und Farben. Antik und modern, und die Preise sind nach unseren Begriffen gar nicht hoch. Die schönsten Gemmen und Mosaiken entzücken mich und locken zum Kauf. Natürlich denke ich auch an meine lieben Kränzchenschwestern und suche für eine jede was Hübsches aus. –
Nachmittag sehen wir wieder den Dogenpalast an; über die Marmortreppen geht es hinauf in den großen Saal, wo die Bilder der Dogen hängen. Von den Fenstern eine unbegrenzte Aussicht aufs Meer, das im Sonnenglanze daliegt und dessen blaue Wogen schon heranspielten, ehe all die alten Dogen hier lebten und webten.
An dem Löwenrachen vorbei, steigt man hinab in die unterirdischen Gefängnisse, wo manch ein Unschuldiger schmachtet, nachdem er den Weg über die Seufzerbrücke gegangen war.
Ich atme auf, als ich wieder das Tageslicht sehe und auf die sonnenbeleuchtete Piazetta hinaustrete! –
Von hier aus fahren wir mit dem Dampfer nach giardino publico. O, wie schön ist es hier, wie entzücken mich die grünen Wimpel, die schattigen Alleen. An Palmengruppen und seltsam blühenden Bäumen und Lorbeergebüschen wandeln wir vorbei. Still und einsam ist es hier; stundenlang möchte man hier verweilen und aus dem schattigen Grün hinaus auf das glitzernde Meer blicken.
Abends kehren wir durch glänzend erleuchtete Straßen in unser Hotel zurück. –
Am nächsten Tage sehen wir die Meisterwerke von Tintoretto und anderen großen Geistern an, dann geht es nach der Kirche Deifrari, um das Grabmal des Canova anzusehen. Gibt es etwas Schöneres, Edleres und Imposanteres? Wohl eine halbe Stunde stehen wir davor; kein Mensch ist außer uns in der stillen Kirche, und wir sehen entzückt auf die edle Gestalt, die dem geheimnisvollen Tore zuschreitet, vor dem der Löwe ruht.
Am andern Tag machten wir bei einer Dame Besuch, mit welcher wir von Triest nach Venedig gefahren waren. Es war eine sehr distinguierte Reisegesellschaft an Bord: die Gräfin Zdrin mit ihren Kindern und deren Gouvernante, die unterhaltendste. Wir haben während der Fahrt viel miteinander musiziert.
In Venedig, wo sie von ihrem Gatten und Anverwandten erwartet wurde, lud sie uns zu sich ein.
Als wir heute vor ihrer Behausung, dem Palozzo des Commando de Präsidio, vorfuhren, stand die Schildwache stramm.
Ein erhebendes Gefühl!
Ich lächelte die Tante an; wir taten, als sei es selbstverständlich, daß man vor uns präsentiere und schlüpften in den Palazzo. Durch die säulengetragenen Gänge, in denen unsere Schritte widerhallten, ging es über einen mit Mosaik ausgelegten Hof. Hier führte eine steinerne Treppe zu den Wohnräumen, in welchen uns die Gräfin herzlich begrüßte. –
Es waren noch andere Gäste bei ihr. Nachdem wir ein wenig geplaudert, Schokolade getrunken und musiziert hatten – sie spielte Wagner – bot mir ihr Schwager, ein junger, sehr galanter Herr, seine Begleitung durch Venedig an.
»Man kann auch zu Fuß die Märchenstadt durchwandern,« meinte er.
Tante erlaubte mir, dieses Anerbieten anzunehmen, und bald wandelte ich an seiner Seite durch die Säulengänge der Prokuratien und staunte die wunderbaren Schmucksachen an, welche zum Verkauf ausliegen.
Wir plauderten heiter und vertraut, wie Leute es zu tun pflegen, die sich auf der Reise treffen und genau wissen, daß sie sich bald trennen und nicht wiedersehen werden, und schritten weiter und weiter. Ich, in Schauen versunken, und doch ist meine Seele nicht mehr hier, eine Unrast hält mich befangen, nach Hause, nach Hause, tönt es in mir.
Ich bin erstaunt, als die Stimme meines Begleiters schließlich sagt: »Die paar Stunden, die ich das Glück hatte, mit Ihnen zu verleben, werden mir stets in Erinnerung bleiben.«
Ich weiß nicht, was ich geantwortet hatte; es wird wohl etwas recht Dummes gewesen sein, denn meine Gedanken sind schon weit von hier fort. –
*
Die traute Stimmung in Ilses Zimmer unterbrach die große Standuhr, die mit gewichtigen Schlägen die zwölfte Stunde verkündete.
Betroffen schaute Ilse auf.
»Schon so spät? – Dann laß es für heute genug sein, Herbert, morgen mußt du früh hinaus; aber morgen abend können wir weiter lesen.«
Die Geschwister sagten einander »Gute Nacht!« und eine Stunde später gaukelte der Traumgott Herbert rosige Bilder vor. Hand in Hand wandelte er mit Lilli unter Italiens blauem Himmel, und vor ihm schritt Gott Amor und streute Rosen. –