
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Innsbruck, den 2. Januar 1897.
Vielen würde es nichts nützen, wenn sie auch die ganze Welt bereisten. Sie sehen in Italien doch nichts anderes als den Stiefel.
Den Sylvesterabend verbrachte ich noch in München in Loris Kreis. Ich kam als erster zu ihr und ließ mich hinreißen, allen aufgespeicherten Unmut über sie loszulassen. Es ist vielleicht gut, daß ich ihr nocheinmal alles gesagt habe, wie sie das Beste in sich tötet und eine Art weibliche Geckerei in sich entwickelt. Sie hat eine unbezwingliche Neigung, sich mit mittelmäßigen Menschen zu umgeben. Trotz dieser Szene verbrachten wir in großer Gesellschaft einen recht lustigen Abend in einem Weinrestaurant, woran sich noch ein letzter Besuch im Café Luitpold anschloß. Der Ton war sehr frei. In München herrscht die Sitte, um 12 Uhr in der Neujahrsnacht in allen Restaurants die Lichter zu löschen. Die paar Minuten der Dunkelheit werden allgemein mit Küssen ausgefüllt. Jeder stürzt sich auf seine Nachbarinnen. Das ist charakteristisch für München. Ich saß zwischen Frau Jordan und einer anderen Frau. Anna Maria war von einer für ihre Verhältnisse sehr großen Zärtlichkeit. Die Hände der anderen Frau zu küssen hatte ich mir längst gewünscht. Trotzdem fühle ich nicht einen Augenblick die Versuchung, noch länger in München zu bleiben.
Am Neujahrstag verließ ich München um ½ 2 Uhr. Der Zug fuhr durch schneeiges Hügelland, dann kamen die großen weißen Tiroler Bauernhäuser und Hochgebirg. Mir kamen diese Linien unschön und aufdringlich vor, wie noch nie, wenn ich an die Linienschönheit des deutschen Mittelgebirges, z. B. des Taunus dachte. Hier in Innsbruck bitter kalt. Abend verbrachte ich in einer anti-spiritistischen Vorstellung. Heute früh Rundgang durch die Stadt, Goldnes Dachl, Hofkirche. Stattliche hohe Häuser in engen schneegepolsterten Straßen, dazwischen fast lautlos ein lebhafter Morgenverkehr. Bisweilen ragt hinter den Häusern ein kolossales Stück beschneiten Berges auf.
Riva, Sonntag, den 3. Januar.
Gestern durch die verschneiten Alpentäler bei heller Sonne und wolkenlosem Himmel nach Trient. Ich litt furchtbar unter der Kälte. Am Abend führte mich in Trient ein Subjekt durch die ziemlich kläglichen Lupanare. Trient ist eine herrliche Stadt mit durchaus italienischem Duft. Heute morgen sah ich den schönen romanischen Dom, die Paläste der Stadt und irrte zwischen den Vignen auf den umliegenden Höhen umher. Die Farben durchaus südlich, die Kälte furchtbar. Die Bergformen wundervoll. Nachmittags Abreise. Die Täler zwischen Trient und Riva von unbeschreiblicher Schönheit. Braune, laublose Höhenzüge, auf den Gipfeln sonniger Schnee, tiefer bisweilen die schwarzen Flecken immergrüner Pflanzen um weiße kleine Häuser, dazwischen die blaue Etsch. Auf dem Wege von Mori nach Riva gibt es eine fast norwegische Landschaft, ein See, in dem sich die schroffen, kahlen Felsen spiegeln, weiße sonnige Firnen. Hier ist alles frühlingsmäßig, viel Grün, viel Sonne, doch in den Häusern sehr kalt. Sonst wie bei uns in Mitteldeutschland schöne Märztage. Das italienische Milieu macht mich schwermütig. Ich glaube, unbewußt spielen Reminiszenzen an meine früheren italienischen Reisen mit. Ich machte heute nachmittag einen Spaziergang am Westufer des Gardasees, die Einsamkeit zwischen den starren Bergformen, der stille See griffen mich derart an, daß mich ein plötzlich erscheinendes Vorgebirge von wilden Formen fast in Schrecken versetzte. Als ich das Rauschen des Ponalfalles vernahm, mußte ich umkehren, da es mir zuviel wurde. Auf dem Rückweg trat ich in ein Haus, das ich für eine Weinschenke hielt. Eine nicht mehr junge, aber keineswegs reizlose italienische Schweizerin kredenzte mir den Wein mit sonderbarer Liebenswürdigkeit. Bald erkannte ich den Charakter des Hauses. Die Zimmer waren groß und ungeheizt. Ich war der einzige Gast in dem öden Saal, der an eine Osteria di campagna erinnerte. In einem Nebenzimmer waren ein paar Soldaten, die ein Harmonikaspieler belustigte.
Arco, Dienstag, den 5. Januar.
Ich habe nun wieder meine alten Gewohnheiten aufgenommen. Heute nachmittag konnte ich mir wieder in meinem gemütlichen Arbeitszimmer einen Tee bereiten. Der gestrige Tag ging mit dem Suchen nach einer Wohnung hin, die ich schließlich hier fand. Hier ist man auf nordische Lebensgewohnheiten einigermaßen eingerichtet. Ich bin sehr zufrieden. Die Temperatur gestattet am frühen Nachmittag das Sitzen im Freien. Schon seit 3 Wochen herrscht der sprichwörtliche ewig blaue Himmel. Die Landschaft ungemein reizvoll: ein weites Tal, das sich bis zum See erstreckt, von vielen Dörfern und Gehöften belebt, rings ein Kranz kupferbrauner Berge, deren Gipfel dicht beschneit, davor mit Oliven bewaldete Hügel. In den Kuranlagen ist alles grün. Zedern, Palmen, Magnolien, Zypressen, Oleander usw. Es gibt viele Schwindsüchtige hier, die Spucknäpfe neben sich haben, und Kranke, die in Stühlen gefahren werden. Alles dies in der zauberischen Landschaft hat einen sehr traurigen Reiz. Ich gehe allein zwischen all dem umher. Niemand kennt mich, ich kenne niemand. Ich bin zufrieden so. Mitten in diese Ruhe kam mir die Nachricht, daß der Tod meiner Mutter in den nächsten Wochen, resp. in Monaten zu erwarten stehe. Ich war auf diese Nachricht vorbereitet, ja, ein baldiger Tod wäre eine Erlösung für sie. Die Nachrichten von Hause, so traurig sie sein mögen, bekommen ihre wahre Macht erst dann über mich, wenn ich mein Elternhaus betrete. Die Nachricht vom Tod meines Vaters, die ich im Januar 95 in München erhielt, machte mich anfangs nur innerlich starr, in der Eisenbahn war ich sogar zum Lesen fähig, während der bloße Anblick meiner Mutter bei der Leiche geradezu Weinkrämpfe hervorrief. Jedenfalls werde ich Mama lebend, wenigstens bei vollen Sinnen, nicht wiedersehen. Ich träume fast jede Nacht von Papa; seltsamerweise immer von einem Streit, den ich mit ihm habe über unsere verschiedenartige Lebensauffassung, bei dem ich aber nie zürne. Ich bin überzeugt, wenn er noch lebte, hätte ich mich in diesen 2 Jahren nicht so weit entwickeln können. Er hätte mich entweder zu allerlei Konzessionen in der Berufswahl, oder wider meinen Willen zu einem zeitweiligen Lossagen von ihm gezwungen. In letzterem Falle hätte ich auf Gelderwerb sinnen müssen. In beiden Fällen hätte ich meine beste Zeit äußeren Dingen geopfert. Käme Papa eines Tages zurück und sähe die Beweise meiner Begabung und hörte die Gründe meiner reiferen Weltauffassung, wir würden zweifelsohne die besten Freunde sein. Er hatte ja nie bornierte, konventionelle Vorurteile. Er wollte nur das Glück seiner Kinder, und da mußte ihm ein Sohn mit meinen Extravaganzen ohne die mindesten Beweise einer wirklichen Begabung viel Sorgen machen. Heute stehe ich meinem Bruder Richard ähnlich gegenüber, wie Papa einst mir. Richard will das Studium der Architektur aufgeben und zum Kunstgewerbe übergehen. Wer bürgt mir für seine Begabung? Scheut er das mühsame Technische der Architektur aus Faulheit oder aus einer selbständigen Veranlagung, die mehr inspiratorisch als methodisch ist? Vorläufig konnte ich nichts tun, als bei einem Maler, bei dem er zeichnet, anfragen, welchen Eindruck ihm Richards Begabung macht. Und was beweist schließlich dessen Urteil? Er soll jedenfalls eine Zeitlang sich versuchen auf dem neuen Gebiet, schlimmstenfalls verliert er ein paar Jahre und kehrt dann zu einem praktischen Beruf zurück.
Mittwoch, den 6. Januar.
Ich arbeite an »Mela«. Ein Gedanke, den ich als zu deiktisch ausscheiden muß aus der Novelle, aber bewahren möchte: die Logik des Mannes ähnelt den feinausgeklügelten Finten des Säbelfechters, doch das Weib lacht über die Künste mit der Brutalität des Pistolenschützen. Manche werden behaupten, es sei gerade umgekehrt.
Donnerstag, den 7. Januar.
Ob die Italiener ein Wissen davon haben, wieviel Schönheit in ihrem Tun ist? Am Sonntag früh sah ich bei meinem Spaziergang außerhalb Trients auf einem Felsen über der Stadt 3 Jungen gelagert, die Karten spielten: ein Murillo. Dabei schauten sie mich so listig lächelnd an, als wüßten sie von der Schönheit, die sie entfalten.
In dem Leben der deutschen Frau, die zwar im allgemeinen auch sinnlich ist, spielt meist die Liebe nicht die alles andere verdrängende erste Rolle, wie in dem Leben der Italienerin. Gerade, weil sie die Liebe nicht so ernst nimmt, knüpft das unbewachte deutsche Mädchen leichtsinniger, aus bloßer Sinnlichkeit, ohne Leidenschaft, ein Liebesverhältnis an. Andererseits macht die geringere Leidenschaftlichkeit – Sinnlichkeit allein ist nicht stark genug, alles aufs Spiel zu setzen – die deutsche Frau zu einer verhältnismäßig treuen Gattin. Das italienische Mädchen ist, auch in den niederen Ständen, meist viel zu gut bewacht, um leichtsinnige Verhältnisse anzuknüpfen. Die Prostitution hat damit nichts zu tun. Sie wird nicht aus Schwäche des Fleisches, sondern aus reiner Berechnung und Gewinnsucht einer Frau zum Schicksal. Dagegen ist die wahre, ernste Leidenschaftlichkeit der italienischen Frau so groß, daß sie keine Bande respektiert. Liebesverhältnisse mit Mädchen der niederen Stände, wie sie in Deutschland jeder Student gehabt hat, kennt man gar nicht oder nur ausnahmsweise in Italien. Ist aber erst einmal die soziale Position begründet, dann kennt die Italienerin viel weniger Schranken, als die Deutsche. Die bloße Sinnlichkeit beherrscht sie viel besser, als die Deutsche, die indessen zum Durchbrechen großer Schranken meist nicht stark genug ist. Auch dadurch ist das italienische Mädchen sehr geschützt, daß der Verführer der Rache der Verwandten anheimfallen würde. In Deutschland dürfte wohl jede Prostituierte eine Zeit gehabt haben, in welcher sie freie Verhältnisse aus Sinnlichkeit unterhalten hat. In Italien durchaus nicht. Die meisten kommen dort mit vollem Bewußtsein durch einen einmaligen Schritt zu ihrem Gewerbe, oft unter den Auspizien der Mutter, wenn sie einsehen, daß die Aussichten auf eine materiell und sozial befriedigende Ehe gering sind. Die Italienerin sinkt nicht langsam, wie die schwächere und naivere Deutsche, die einen langen Kampf mit dem Gemüt und dem Idealismus durchmacht, ehe sie sich prostituiert.
Ein seltsamer, etwas kindischer Zug, der durch die deutsche Romantik geht, der mir jetzt wieder bei der Lektüre von E. T. A. Hoffmann »Elixiere des Teufels« auffällt, ist der: der geheimnisvolle Reiz, mit dem das prunkvolle Leben vornehmer Frauen und routinierter Lebemänner ausgestattet wird, überhaupt das Mystische der großen Welt, gepaart mit ziemlicher Unkenntnis dieser Kreise. (Tieck, William Lovell, der Roman eines Lebemanns, geschrieben von einem fast keuschen Jüngling; die schönen vornehmen Frauen bei Novalis, Immermann, ja noch bei Spielhagen, die meist Puppen sind und ihren Ursprung aus der Phantasie junger weltfremder, heißblütiger Teutonen verraten.)
Nur wo eine große einheitliche Linie durch eine Persönlichkeit geht, fallen Begriffe, wie Laster und Perversität fort. Nur solche Menschen stehen jenseits von Gut und Böse, weil sie ihr Maß in sich haben.
Der Grad der Unvertretbarkeit der Arbeit des Menschen bestimmt das Maß, was ihm die bürgerliche Gesellschaft an moralischer Freiheit gestattet, und darin hat sie Recht. Offizieren und Beamten ist ein sklavischer, teils ungeschriebener Sittenkodex auferlegt, dem Künstler und dem großen Forscher dagegen ist fast alles gestattet, weil ihre Werke von gar keinem anderen geleistet werden können, kurz, weil sie Einzelindividuen von Wert sind, nicht nur gut rollende Räder einer Maschine, die jederzeit durch andere ersetzt werden können.
Freitag, den 8. Januar.
Am Tag der Heiligen Drei Könige saß ich abends lange in einer einfachen Osteria und trank ziemlich viel Wein. Eine hübsche Person, eine Verwandte des Wirtes, forderte mich auf, nach Schluß des Lokals mit in ein Tanzlokal zu gehen, wo die deutsche Bevölkerung von Arco (die niederen Stände) das Fest begingen. Ich beobachtete dort von meinem Tische aus einige der deutschen Kellner, die hier in den ersten Hotels angestellt sind, und wunderte mich über die erlebnisreiche Buntheit ihres Daseins. Überall kommen sie hin, machen neue Bekanntschaften, die ihr Leben in wenigen Tagen von Grund aus umgestalten können. Ihr Beruf ist nur Gelegenheit, Neues zu erleben. Es ist begreiflich, daß auf viele Menschen ihrer Klasse dieser Beruf eine so große Faszination ausübt. Welche Verbindungen eröffnen sich ihnen mit dem anderen Geschlecht! Der Beruf ist ihnen natürlich nur Vorwand für ihre Erlebnisse. Das im Beruf aufgehen, kennen sie nicht. Dort bemerkte ich auch an einem Nebentisch ein sehr sonderbares Paar, einen älteren und einen jüngeren Menschen, die mir manchesmal wie zwei geheime Verbrecher vorkamen. Der ältere sprach mit mir. Er ließ durchblicken, daß er als verarmter Adliger beim diskreten Bettel in hohen Häusern viel Glück habe, ließ aber plötzlich das Gespräch fallen und ging zu Bett, offenbar in der Angst, daß ihn der Wein zu noch mehr Äußerungen verleiten würde. Der jüngere Begleiter warf mir oft Blicke zu mit etwas verächtlichem Ausdruck gegen den anderen. Der Junge steht im Fremdenbuch als Friseur, ein anderer Begleiter, der schon früh zu Bette gegangen war, als Kellner. Eine höchst sonderbare Gesellschaft.
Arco, Freitag, 8. Januar 1897.
Von großer Schönheit sind in dieser Gegend die an den Hügeln hinziehenden Olivenwälder, in denen ich viel herumstreife. Die Wege sind rauh von Geröll und Felsen, dazwischen die phantastischen Formen der silbergrünen Oliven. Seit einigen Tagen ist der Himmel bewölkt; der graue Ton, der über allem ruht, erhöht die Schwermut der Landschaft, dabei herrscht eine laue Wärme, die das Blut in Unruhe bringt. – Vormittags arbeite ich an meinen Novellen oder ich lese. Nach Tisch gehe ich spazieren, zwischen 4 und 5 komme ich zurück und verbringe die Zeit bis zum Nachtessen wie Vormittags. Abends sitze ich beim Wein. Ich habe einige oberflächliche Bekanntschaften mit Alltagsmenschen gemacht, deren Gesellschaft ich nicht zu oft haben möchte, bisweilen sind sie mir jedoch lieb zur Unterbrechung meiner Einsamkeit, zumal sie mich nicht in meinem Innenleben stören, von dem ich ihnen nicht viel mitteile.
Samstag, 9. Januar.
Ein furchtbarer Tag. Zu dem schwülen bedeckten Himmel kommt nun anhaltender Regen; die Eingeborenen meinen, daß damit der Winter vorbei sei. Kein Spaziergang möglich, den ganzen Tag im trüben Zimmer. Ich warte seit Tagen auf Geld. Jedes Klingeln an der Haustür läßt mich erschrecken, da ich stündlich schlechte Nachrichten von Zuhause über Mama's Befinden erwarte. Ich lag einige Stunden im Halbschlaf auf dem Bett, dann Thee. Lektüre von alten Aufsätzen von Hermann Bahr. Das rüttelt etwas an den Nerven. Es ist etwas Suggestives, von Person zu Person wirkendes, in diesem so viel angegriffenen Stil. Nun ist mir besser. Draußen liegt die Sarca-Brücke in einem milden blauen Dämmerlicht.
Gestern Abend lernte ich beim Wein in einer einfachen Trattoria einen blonden Deutschen von etwa 40 Jahren kennen. Wir kamen in Unterhaltung. Er verriet vielseitige Halbbildung, Verstand der nach Erkenntnis strebt, offene Sinne doch große Befangenheit. Er reist mit einem 20jährigen, der mich mit den Blicken fast verschlang. Bald erriet ich ein eigentümliches Verhältnis zwischen den Beiden und er merkte, daß ich etwas merkte, ohne mich zu entrüsten. Er wurde vertraulicher und so erfuhr ich, daß er angeblich alten Adels sei (von Senden) und sein großes Vermögen verloren habe. Er reise in der ganzen Welt herum; wo er Geschäfte mache, halte er sich auf, dann gehe er weiter. Über die Geschäfte machte er geheimnisvolle Andeutungen, verlangte plötzlich von mir, ihm zu sagen, was ich von ihm hielte, worauf ich erwiderte: Sie haben Ihr Vermögen verloren und Ihren Verstand bewahrt, der Ihnen nun mehr als ein Vermögen ist und Ihnen erlaubt, die Verhältnisse auszunützen. Da schüttelte er mir höchst geschmeichelt die Hand und nun sprachen wir über andere Dinge.
Donnerstag, 14. Januar.
Gestern endlich wieder ein schöner Tag. Ich benutze ihn zu einem Ausflug nach dem Varone-Wasserfall und den Ponal-Fällen. Frühlingswärme.
Frankfurt a. Main, 22. Januar 1897.
In Arco bekam ich eines Morgens ein Telegramm, das mir den Tod meiner Mutter mitteilte. Eine Verkehrsstörung hinderte die sofortige Abreise, sodaß ich den ganzen Sonntag bis um 5 Uhr in Arco bleiben mußte.
Am Nachmittag Abschiedsgang durch Arco: Zwischen Palmen und Cedern ächzte die Kurkapelle, italienische Opernmusik. Eine hölzerne Wandelbahn. An den Wänden sitzen die Kranken. In der Mitte gehen Menschen auf und nieder mit dampfenden Regenschirmen. Graues Licht.
Die Straße der Magnolien: eine lange Allee von Magnolien und Lorbeer, die sich ablösen, dahinter die immergrünen Palmenbosquets. Dahinter die niedrigen einfachen Kurbauten, dahinter die olivenbedeckten Bergwände, die oben schneebedeckt sind.
Der Marktplatz: ganz italienisch. Eine Barockkirche, rundum alte Arkaden, Lauben, wie man in Österreich sagt. Den ganzen Sonntagnachmittag steht italienisches Volk umher, die Hüte im Nacken, die Hände in den Hosentaschen.
Indessen schlichen die graublauen nebligen Nachmittagsstunden dahin, bis die gelben Gasflammen angezündet wurden.
Auf der Bahnfahrt fiel mir ein Gedicht ein: »Gäb' es ein Leben, hell und still und kalt«.
Am Montag Nachmittag hier angekommen. Mein Bruder an der Bahn. Ich kam in dem Gefühl nach Hause, nun, nach Mamas Tod in meiner Familie wenig Widerhall zu finden, doch war bei dem Anblick meiner mir in Trauerkleidern entgegenkommenden Schwestern die alte Zärtlichkeit wieder vorhanden. Hedwig führte mich in das Zimmer, wo Mama zwischen Blumen aufgebahrt war. Ich brach zum ersten Mal in Tränen aus. Mama war garnicht verändert. Sie hatte die letzten 14 Tage in der Wahnvorstellung verlebt, Papa sei zurückgekehrt, und das hat sie glücklich gemacht. Ihr Gesicht trug den Ausdruck von Ernst, fast von Selbstbewußtsein, ein Ausdruck, den sie im Leben nur selten hatte und der ihr bei längerem Anschauen etwas Fremdes gab. Von wunderbarer Schönheit waren die Hände. Sie trug ein schwarzes Kleid, dasselbe, in dem sie mit Papa die letzte Festlichkeit erlebt hatte. So war es ihr Wunsch gewesen, auch hat ihr Hedwig eine Photographie von Papa zugesteckt, wie sie gewünscht hatte, da sie selbst Papa ihr eigenes Bild mit in's Grab gegeben hat. Auch mit meinem Schwager Otto scheint mich dieser Trauerfall wieder näher gebracht zu haben. Er ist zwar ein vollständiger Alltagsmensch, aber ohne jede Bosheit. Trotzdem empört sich, trotz seinem guten Willen, manchmal etwas in ihm gegen mich. Richard ist ganz verworren. Arrogant und ungeschliffen. Aber wie's scheint, entwickeln sich Gaben in ihm. Er befindet sich in einem Zustand der Revolte gegen alles. Ob er aus dieser Gärung als Reifer hervorgeht, ist unmöglich zu sagen. Ich war in seinem Alter ähnlich. Doch scheint mir, daß es ungünstig mit ihm steht. Tilly ist ein verliebter Backfisch. Es macht mir Sorge, daß sie so leicht in Flammen gesetzt wird. Bis jetzt fast immer von unbedeutenden Männern. Vielleicht ist auch dies nur die Verwirrung der Pubertät, vielleicht aber auch mehr.
Großmama finde ich sehr ruhig und für ihre 73 Jahre ungeheuer rüstig. Durch Papas Voreingenommenheit, die sich auf Mama und leider auch lange auf uns Kinder übertrug, wurde sie viel verkannt, ja undankbar behandelt. Sie hat halbfranzösisches Blut, liebt den Bombast, aber ist dennoch eine gute Natur, unendlich generös, doch hat sie wenig Gemüt, viel Lebensklugheit, Energie, wenig Kunstverständnis, sodaß sie nicht imstande ist, meine Interessen zu teilen. Im ganzen fühle ich mich hier in Frankfurt wohl. Ich habe eine eigene Wohnung gemietet und denke morgen wieder zu arbeiten.
Samstag, 23. Januar.
Gestern erschien ein junger Mann, der um Tilly's Hand warb. Sie hat ihn in Bensheim, wo sie sich in den letzten zwei Monaten in einer Pension befand, kennen gelernt. Er ist ein 26jähriger Fabrikbesitzer aus früher adligem Haus, nennt sich aber nicht mehr »von«. Distinguierte, schmächtige, fast knabenhafte Erscheinung, wohlerzogen, offenbar ziemlich zartfühlend und in alldem Otto weit überlegen. Indessen gänzlich unbedeutend, wenig Verstand, wenig Welterfahrung, aber bon garçon. Tilly liebt ihn angeblich. Der Entschluß der Familie, ich eingeschlossen, geht dahin, daß beiden durch Korrespondenz und zeitweiligen Besuch seinerseits Gelegenheit gegeben werden soll, ihr Gefühl zu erproben. Zeigt es sich bei Tilly als nachhaltig – bei ihm ist es zweifellos so – so wäre sie wohl für mich verloren. Sie käme in ein Alltagsmilieu, für welches mir das Verständnis fehlt. Er geht ganz in seinem Beruf auf und in den ängstlichen Vorstellungen der kleinstädtischen haute volée. Ich sagte Tilly das heute alles ziemlich offen, als sie zum Thee bei mir war. Ich hielt ihr vor, auf was sie alles verzichten wolle, auf jeden geistigen Lebensinhalt, und daß sie noch so jung sei und viel interessantere Männer kennen lernen könne. Daß er ihr sogar in vieler Hinsicht unterlegen sei. Er hält sie für einen Engel und dabei ist sie sich mit ihren 17 Jahren klar darüber, daß er sie überschätzt. Ich erinnerte sie an das viele Gemeinsame, was immer zwischen uns beiden gewesen ist. Ich halte das ganze bei ihr für einen sinnlichen Rausch, denn dieser Georg Alewyn ist für den Geschmack mancher Frauen sicher ein sogenannter süßer Kerl, wovon er indessen bisher wenig Gebrauch gemacht zu haben scheint.
Dienstag, 26. Januar.
Gestern kam Mathilde. Es war ein sehr glückliches Wiedersehen. Wir verbrachten einen schönen Abend in alten Erinnerungen mit vielen »weißt Du noch«. Sie versucht unser Verhältnis zu einem Freundschaftsverhältnis zu machen. Ich gehe scheinbar darauf ein, und so erlebe ich noch einmal die Schauer einer ersten erobernden Liebe. Allzulange scheint ihre Standhaftigkeit nicht zu dauern, denn ich habe sie bereits wieder mehr als freundschaftlich geküßt. Ich habe im letzten Sommer an unserem Verhältnis viel verdorben, indem ich mich zu sehr um ihre etwas verworrenen Lebensverhältnisse kümmerte. Sie ist nun einmal leichtsinnig und schlampig. Das gab viel überflüssigen Streit. Ich werde mich nun um diese Dinge nicht mehr kümmern, solange ich nicht allzusehr unter ihrer Unpünktlichkeit zu leiden habe.
Mittwoch, 27. Januar.
Ich werde meinen Aufenthalt hier möglichst abkürzen. Das Klima gestattete heute zum ersten Mal einen kleinen Spaziergang zwischen den dichtbeschneiten Feldern vor der Stadt. Leben giebt es hier nicht, geistige Menschen gar nicht. Durch die Familie fehlt es mir an der notwendigen Einsamkeit.
Mein Schwager Otto ist mir unerträglich, nicht wegen seiner Meinungsverschiedenheit, sondern der unsagbaren Trivialität seiner Formen und Äußerungen. Wäre seine Lebensauffassung doch wenigstens jener echt konsequente altpreußische Konservatismus mit dem Königtum von Gottes Gnaden und der christlichen Moral. Darin wäre Einheitlichkeit. Aber bei aller Preußentümelei ist er, ohne es zu ahnen, von utilitaristischem Demokratismus erfüllt. Auch hiergegen hätte ich wieder nichts, wenn er dann nicht wieder jene sittliche Entrüstung vor meinen Meinungen hätte, die er unmoralisch nennt.
Großmama ist sehr unglücklich und das mitanzusehen ist furchtbar. Sie ist nun ganz allein. Es waren stets häßliche Verhältnisse. Mit Mama hatte sie garnichts gemeinsam. Darum blieb Mamas beste Seite, ihr Gemüt und eine gewisse Kindlichkeit, vor ihrer Ehe unberücksichtigt. Papa verstand Großmama nicht, umso besser verstand er aber Mama. In ihr keimte ein unerklärlicher Haß gegen Großmama auf. Sie behauptete oft, von ihr als Kind schlecht behandelt und schlechter erzogen worden zu sein, als in Großmamas Kräften stand. Das war offenbar ein Irrtum, denn was Großmama zu geben hatte, war nichts für Mamas Natur. So wurde Großmama beständig verkannt, zumal die Meinung von ihrer Bösartigkeit auch lange Zeit auf uns Kinder übertragen wurde. In Wirklichkeit hatte sie bloß eine gewisse kaufmännische Nüchternheit, manchmal wohl auch Mangel an Zartgefühl. Indessen ist alles, was ich aus eigener Erfahrung von ihr weiß, eine Kette von Aufopferung, Generosität und Güte gewesen. Mama hat ihren Irrtum während ihrer Krankheit eingesehen und ihn bei Großmama und auch bei Hedwig eingestanden. Ich begann schon zu Papas Lebzeiten selbständig über diese Verhältnisse zu denken. Übrigens hat sie etwas zweideutig doppelsinniges, was man auf die Dauer schwer erträgt. Möglich, daß sie an ihren Enkeln gutmachen wollte, was sie gegen die eigene Tochter versäumt hat und daß ich dadurch so gern an ihre Güte glaube.
Montag, 1. Februar.
Es war unausbleiblich, daß das alte Liebesverhältnis mit Mathilde sich wieder herstellte. Nicht aus Leidenschaft, vielmehr waren wir eines Abends in meiner Wohnung zusammen und kamen uns in Gesprächen sehr nahe. Wir lagen Arm in Arm auf der Chaiselongue. Da war nun der Gedanke, sich an diesem Abend zu trennen, noch hinauszugehen in die Winternacht, unerträglich und so wurde es wieder wie früher. Gestern waren wir dann wieder ganz freundschaftlich zusammen. Ich begehre sie nicht mehr so stark wie früher, aber sie ist mir fast lieber und wertvoller geworden. Ich glaube, dieser Zustand ist in einer guten Ehe das gewöhnliche. Mathilde allein macht mir Frankfurt augenblicklich erträglich. Eine Feinfühligkeit von ihr: Gestern versagte sie sich mir aus anfangs unerklärlichen Gründen, die ich natürlich schweigend respektierte. Beim Weggehen gestand sie mir ihre Geldverlegenheit. Nun begriff ich ihre Zurückhaltung. Wenn sie umfassender gebildet wäre, wäre sie überhaupt das für mich geschaffene Weib. So zwar begreift sie instinktiv sehr vieles, wenn ich es ihr erkläre, ist aber nicht imstande, allein ein ernsteres Buch zu lesen.
Mit Tilly viel ärger. Sie mag nun tun, was sie will. Im Sommer habe ich mich täglich eine Stunde mit ihren Studien befaßt und, soweit es bei ihrem Alter möglich war, in ihr künstlerisches Verständnis zu erwecken gesucht. Nun hat sie in meiner Abwesenheit, wie sie mir gesteht, eine Schwenkung zu den »praktischeren Anschauungen« Otto's gemacht. In ihrem Benehmen gegen Großmama, bei der zu wohnen sie sich weigert, zeigt sie sich sehr hart. Mit ihrer Verlobung scheint es nun doch vorbei zu sein, da sich Alewyn's pekuniäre Lage als unbefriedigend erwiesen hat, d. h. die Familie, nicht sie selbst, erkennt diesen Grund als triftig an. Es besteht augenblicklich eine Parteiung: Otto, Hedwig und Tilly einerseits, die zusammen wohnen, Großmama, Richard und ich andererseits. Die Verhältnisse sind, besonders Großmamas drohende Verlassenheit, unerträglich. Ich zähle die Tage, bis ich hier fortkomme, lese viel Schopenhauer.
Gestern mit Oscar Priester zusammen, ein früherer Mitschüler, jetzt Referendar, unzufrieden, oberflächliches Bedürfnis nach Freiheit, ohne besondere Begabung und Kraft. Er pfuscht ohne Talent in den Künsten herum. Ihm gegenüber muß ich mich als unendlich vom Glück begünstigt fühlen.
Neulich bei Georg Fuchs in Darmstadt. Seit Herbst sitzt er dort ohne Anregung bei der Arbeit. Er ist ganz Gefühls- und Triebmensch, ohne viel Denkbegabung, sodaß wir uns nicht so viel zu sagen haben, wie etwa ich mit Gutmann und Philips, die er wieder gering schätzt. Man kommt ihm nicht nahe. Er besitzt, scheint es, eine gewisse Keuschheit, die ihn hindert, sein Inneres zu zeigen. Eine Mischung von Verschlagenheit und Kindlichkeit. Ich habe keine Ahnung, warum er eigentlich den Verkehr mit mir aufrecht erhält, ob ich ihm lieb bin, ob er von mir etwas hält oder sonst irgend etwas erwartet. Wir treffen uns im Hause Hoby. Dort eine ungleiche Ehe. Er ein unbedeutender Alltagsmensch, sie soll, wie Wohlfskehl sagt, von antiker Größe der Lebensauffassung sein. Aus äußeren Gründen kann die Ehe nicht geschieden werden, doch lassen sie sich beide volle Freiheit. Frau Hoby hat eine gewisse Neigung zu mir, die sogar einmal eine sinnliche Form annahm. Im Sommer war ich oft bei ihr in Darmstadt, wo wir manche Nacht bis 3 Uhr zusammen saßen. Ich las ihr aus meinen Novellen vor, da traf es sich einmal, daß sie mir um den Hals fiel und mich küßte. Sie ist vielleicht einmal hübsch gewesen, doch jetzt schon 40. Ich entzog mich ihr leise und flüsterte ihr ins Ohr: »morgen werden wir uns gegenübertreten, ohne ein Wort davon zu reden, als wäre nichts vorgefallen. Auch wenn wir allein sind, werden wir nie darüber reden.« Sie antwortete mit einem wie erlöst klingenden »Ja«. Am Morgen beim Frühstück traten wir uns ohne Befangenheit entgegen und das freundschaftliche Verhältnis ist in keiner Weise beeinträchtigt. Ihr Verhältnis zu Fuchs ist mir nicht klar, es war sicher einmal sinnlicher Art. Wie es heute ist, weiß ich nicht. Alle ihre Liebesangelegenheiten sind so naiver Art, daß Wolfskehl sie wohl aus diesem Grunde antik nennt. Ihre Tochter Louisa, die mit Tilly befreundet ist, ist ein merkwürdiges Mädchen mit tiefen Augen. Sie hält Tilly für etwas oberflächlich.
Wieder eine Scene zu Hause mit Großmama. Sie nötigt einen, irgend einen Gefallen von ihr anzunehmen und beklagt sich dann bei anderen, wie man sie inkommodiert. Diese Doppelsinnigkeit trotz aller sonstigen Güte hat ihr ewig Feindschaft mit Papa und Mama verschuldet. Ich habe es ihr offen und gründlich gesagt. Nun ist wieder Friede.
Strenge Erziehung ist darum wertvoll, weil der Starke erst durch seine Emancipation von gewissen Vorurteilen eine Kraftprobe abzulegen hat. Keiner dürfte von Anfang an ganz frei sein, nur wenige haben das Recht auf Freiheit, welches sie dadurch erweisen, daß sie sie erringen.
Freitag, 5. Februar.
Obwohl Tillys Verlobung nun rückgängig gemacht ist, ist sie doch durchaus vergnügt. Sie ist doch ziemlich oberflächlich.
Mit Absicht gehe ich nun Mathildens Umarmungen aus dem Wege, obwohl ich den persönlichen Verkehr mit ihr nicht missen möchte.
Bisweilen treffe ich mit Prange und Luhde zusammen, beide Schriftsteller, wie mir scheint, ohne eigentliche Produktivität, aber mit vielen anderen Gaben. Prange war früher Schauspieler, hat viel erlebt, Luhde Redakteur des Frankfurter Journals, hat für mich etwas körperlich Widerwärtiges, ich reiche ihm ungern die Hand. Da beide recht viel künstlerisches Empfinden haben, ist mir der Verkehr mit ihnen hier in Frankfurt doch erwünscht.
Der Opernsänger Candidus hat ein großes, altes Bild, welches er für einen Tizian im Wert von einer Million Mark ausgibt. Auf mein wiederholtes Fragen gab ich ihm meine Ansicht darüber kund, daß ich mich dieser Ansicht nicht anschließen könne. Er fragte mich, ob ich ihm das schriftlich geben wolle und ich konnte es ihm nicht verweigern. Ich schrieb ihm auf, daß ich das Bild für die Arbeit eines Bologneser Eklektikers vom Ende des 16. Jahrhunderts halte. Nun hat mich dieser Tor zum Zweck einer künstlerischen Konferenz mit dem Restaurator des Bildes zu sich gebeten, benützte aber die Gelegenheit, mich sofort mit Grobheiten zu überfallen. Ich empfahl mich umgehend, er aber gab durch Öffnen der Tür meinem Weggehen vor dem Personal des Hotels den Schein des unfreiwilligen. Ich schrieb ihm daher ebenso offen auf einer Postkarte: »An den Sänger Candidus, Ihr völliger Mangel an Wissen und Erziehung hindert mich auf Ihr kindisches Betragen so zu antworten, wie ich es bei meinesgleichen tun würde.« Darauf ist keine Antwort erfolgt.
Samstag, 6. Februar.
Mein Aufsatz über die Münchener Ausstellung im Glaspalast 1896 ist dieser Tage erschienen. Viel Raum habe ich Hans Thoma gewidmet, dem ich die Arbeit zusandte. Ich erhielt einen sehr liebenswürdigen Brief von ihm, mit der Aufforderung, ihn zu besuchen.
Prange ist in gewisser Beziehung mein Gegenpol: wenig Psycholog, hat er viel in den Tag hinein gelebt, und kommt jetzt zur Besinnung, wird fleißig. Ich habe nie in dem Maße gebummelt wie er. Zwischen allen Genüssen immer Arbeit, gehe aber jetzt nach Paris, in der Absicht, mich einmal ganz vom Schicksal treiben zu lassen, keine ausgedehnten Arbeiten oder Studien zu beginnen, nur herumgehen, sehen, beobachten, genießen. Daheim einige Gedichtsbücher etc., in die man sich einmal eine halbe Stunde vertiefen kann, ohne sich lang daran fesseln zu müssen. Prange hat nun die Neigung, gerade Männer zu schildern, die sich selbst psychologisch unter die Lupe nehmen, während ich in meinen Dichtungen die psychologische Analyse möglichst vermeide. Er gibt immer die Gedanken seiner Menschen über sich selbst wieder, ich suche nur Empfindungen zu geben, so strebt jeder nach dem, was ihm nicht selbstverständlich ist.
Dienstag, 9. Februar.
Am Samstag Besuch bei Thoma: ein kleiner, liebenswürdiger Mann, mit sehr klugem und hellem Gesicht, schönem weißen Vollbart; seine letzten Arbeiten sind technisch aber doch zu unzulänglich, er hält sich für einen bedeutenden Techniker und freut sich darüber, daß man nicht weiß, ob er raffiniert oder naiv ist. Er weiß es selbst nicht, spricht ausgesprochen schwäbischen Dialekt.
Die letzten Woche eifrig mit Schopenhauer beschäftigt. Ich zolle ihm viele Bewunderung, nur nicht seiner Ethik. Er überschätzt mir das Mitleid zu sehr, das dem tief Erkennenden unbedingt eigen sei. Es erhebe das Individuum über sich selbst. Das halte ich für falsch, gerade der Mitleidige ist dem Individualismus ganz besonders unterworfen. Was liegt denn am Einzelnen? Auch die absolute Verurteilung der Begierden kann ich nicht teilen, der Kampf gegen sie nimmt Zeit und Ruhe zur Erkenntnis, die Auseinandersetzung mit ihnen aber fördert die Erkenntnis. Vielmehr suche man wenig zeit- und kraftraubende Formen, die Begierde zu befriedigen und finde sich ruhigen Blutes dann im Tempel der Schönheit ein. Auch ich strebe nach der klassischen Ruhe, die allein im Schauen aufgeht, aber die können wir nur erreichen, nachdem wir die Wertlosigkeit des Sinnenrausches am eigenen Leib erfahren. Wir müssen den Lockungskünsten der Sirene nachgegeben haben, um sie zu durchschauen und nicht immer von Neugier nach ihr ergriffen zu werden. Auf die Befriedigung folgt Ruhe, gesetzt, daß sie mit Bewußtsein gesucht wurde und nicht eine moralische Niederlage bedeutet.
Obwohl sich mein theoretischer Egoismus immer mehr festigt, soll ich liebevoller, teilnehmender, offener geworden sein. Mathilde meint, aus einem Tyrann wäre ein Lamm geworden. Prange und Luhde haben dieselbe Veränderung konstatiert, desgleichen schon im Winter Philips und Gutmann, die sogar bisweilen schon im vorigen Sommer ähnliches beobachteten. Auch äußerlich bin ich einnehmender geworden, wie alle Welt versichert, seitdem ich meinen Spitzbart abgenommen habe. Ich bin ruhiger geworden und habe die Einsamkeit nicht nur lieben, sondern bedürfen gelernt. Auch meine Nervosität hat abgenommen.
Gestern ein selten schöner Abend in meiner Wohnung mit Prange und Luhde, die ich als Menschen immer mehr schätze. Ich las ihnen Eos vor, sie hielten es für klassisch. Vom »Liebesgarten« dagegen hält Prange wenig. Wir tranken herrliche alte Weine aus Mamas Keller und saßen bis 3½ Uhr.
Otto fühlt sich persönlich verletzt durch den Aufsatz über Thoma, sowie über die »Arroganz« des Aufsatzes »Kultur« in den neuen literarischen Blättern. Offenbar fühlt er sich durch den Passus vom mittelmäßigen Mann persönlich verletzt. Er ist unendlich klein und scheint bereits Rücksicht auf seine Kleinheit zu verlangen. Wenn er anfängt, bescheiden zu werden, müßte man sie ja nehmen, aber er ist es nicht.
Dienstag, 16. Februar.
Neulich Besuch von Hans Weidenbusch aus Paris, sehr anregend. Er strebt sich zum harmonischen Menschen zu bilden, ist aber völlig unproduktiv, sieht die Kultur zu sehr in den Nebensachen, die ja gewiß auch dazu gehören, wie Essen, Kleidung u.s.w., ist zu stark vom Geld abhängig. Wir schafften uns in der Nacht einige orientalisch polygame Freuden, wobei ich jedoch ziemlich kalt blieb, als wir alle zusammen waren, während sich die Sache vollkommen änderte als ich allein mit einer Frau im Nebenzimmer war. Weidenbusch ist kein bedeutender Mensch, doch sehr klug, beobachtend und gewandt, gar nicht philosophisch und wie mir scheint, ungeheuer egoistisch. Er hört beim Sprechen nicht zu, redet aber selbst ungeheuer viel. Ich habe indessen nie mehr Stil und Sicherheit im äußeren Auftreten gesehen.
Mit Mathilde zusammen gewesen. Ich habe meine Gefühle zu ihr doch überschätzt. Der Intimität gehe ich geradezu aus dem Weg. Ich glaube, daß ich die Abreise nach Paris zum Abbruch unserer Beziehungen benutzen werde, sie ist doch zu halbgebildet.
Prange hat seinen Roman »Blut« vorgelesen, entschiedenes Talent, Anschaulichkeit, aber doch völlig stillos, Überwuchern eines ganz unkünstlerischen Psychologismus.
Erinnerung an eine Münchener Kaffehausscene. Nacht, man sitzt, geistig ausgeschöpft, beisammen, äußeres Leben gibt es nicht; der Mensch, der Schlag 10 Uhr kommt, zwei Eierpunsche holt und um 12 Uhr nachts die leeren Gläser zurück bringt. Gespräch: über die nächtlichen Felder vor der Stadt, dunkle Wagen ziehen dazwischen, ob sie ein Ziel haben? ob sie alle Nacht so weiter fahren, ohne Ziel? Wer kann das ermessen? Solche Gespräche mit Gutmann.
Ich beabsichtige Samstag nach Paris zu fahren, in diesen Wochen habe ich wenig gearbeitet. Meine Novellen sind alle fertig, kein angefangener Stoff mehr im Schreibtisch, sehr nervös. Es gab einige sehr schöne Vorfrühlingstage mit roten Nachmittagen. Wie sehne ich mich danach, in einer fremden Stadt mit viel Leben unbekannt, ziellos herumzuschweifen. Diese Sehnsucht ist erst in letzter Zeit entstanden, wie ich überhaupt erst seit diesem Winter die Einsamkeit lieben lernte. Ich habe nun gerade ein Jahr intensiver künstlerischer Tätigkeit hinter mir. Ich will nun absichtlich einige Wochen, vielleicht Monate nichts arbeiten, ich brauche Erholung, Leben. Ich bin in diesem Jahr gefestigter geworden, ich glaube, es ist mein entwicklungsreichstes gewesen. Mir scheint, daß nun eine neue Lebensperiode beginnen soll, ich lasse mich nicht mehr von außen beeinflussen, so sehr ich auch gegenüber Anderen Augen und Ohren öffne. Ich bin minder pedantisch geworden, besonders in Bezug auf Zeit und Geld. Ich schreibe das alles allein dem Umstand zu, daß ich Arbeit habe, die ich wirklich als Mittelpunkt meines Daseins empfinde, während ich als Student eine unfreiwillige Beschäftigung hatte, die meine Hauptkräfte nicht in Anspruch nahm, sodaß ich sie in Allotria verpuffte. Künstlerisch habe ich viel gelernt in diesem Jahr. Philips und Gutmann haben im Juli meine Novellen von den naturalistischen Schlacken befreit und mir urplötzlich das Gefühl für Stil eröffnet. Ich kam dann auf einen etwas übertriebenen phantastischen Stil (Herrn Josephs Liebesgarten, Um Rosenkränze). Meine letzte Arbeit »Thea« ist nun auch davon frei. Die Sprache ist gewählt, doch sehr einfach. Philosophisch habe ich mich der Mystik genähert. Schon im vorigen Herbst. Angeregt durch Wolfskehls Fassung des Begriffes »Pan«, teils durch Frau Hoby angeregt. Die erste Spur davon befindet sich in der kleinen Novelle Eos. Dazu kam nun in diesen Wochen Schopenhauer. Dadurch bin ich dem Christentum wieder näher gekommen, d. h. dem Katholizismus. Dabei vertrage ich mich vortrefflich mit Nietzsche, da ich das Wollen keineswegs verdamme, vielmehr nur da ein tiefes Schauen für möglich halte, wo ein Wollen war und allmählich sich ausgewollt hat, denn was anderes wir geschaut, als die Welt als Wille, wozu das eigene Individuum selbst gehört und das ein umso ausgebauterer Mikrokosmos ist, je mehr Wille und Ursprung in ihm war. Überhaupt soll und kann das Schauen ein starkes Wollen garnicht lähmen, im Gegenteil ist die Synthese beider das Wünschenswerte: der Künstlermensch Goethe.
Donnerstag, 18. Februar.
Schopenhauer sagt, in der Metaphysik der Geschlechtsliebe, daß der Intellekt von der Mutter, der Charakter und der Wille vom Vater stamme. Bei mir stimmt das. Willenskraft verbunden mit Beschränktheit hat vielleicht bei vielen seinen Grund daher, daß die Mutter eine dumme Gans war, der Vater aber ein rechter Mann.
Über Tilly bin ich nun ganz klar: oberflächlich und lieblos.
Gestern und vorgestern auf Reisen. Kehre körperlich sehr unwohl zurück. Dienstag bei Frau Hoby in Darmstadt. Sie eröffnete mir folgendes über ihr Verhältnis zu Fuchs: Erst seit einem Jahr haben sie sich ganz gefunden. Wenn Fuchs in günstige Verhältnisse kommen wird, will sie mit ihren Kindern zu ihm ziehen; die Ehe mit ihrem Mann ist auf gegenseitiges Übereinkommen schon jetzt innerlich aufgehoben, besteht nur noch nach außen, angeblich, um den Credit des Geschäftes zu erhalten und wegen der Kinder. Sie hat in meinen Augen doch sehr an Größe eingebüßt, dadurch, daß sie garnicht einsieht, daß sie nur der Schwachheit ihres Mannes zu verdanken hat, daß sie noch im Haus bleiben kann. Gegen das Fuchs'sche Verhältnis würde ich ja nichts einwenden, doch daß sie sich noch von dem Gatten ernähren läßt, ist doch merkwürdig. Sie gibt selbst zu, daß sie das Verhältnis minder ernst nimmt, als Fuchs. Als sie mich im vorigen Sommer plötzlich küßte, war Fuchs gerade auf einige Wochen abwesend, während sie es durchaus für zweifellos hält, daß Fuchs ihr treu ist. Auch ich glaube es. Früher hatte sie mit Hallwachs ein Liebesverhältnis, sie hat es aufgegeben, möchte aber seine Freundschaft behalten, aber er könne nicht bei ihr sein, ohne sie zu begehren. Ich begreife es nicht, denn trotz des gutgeformten Gesichts hat sie bereits graues Haar und einen schweren matronenhaften Körper. Übrigens legte sie es vorgestern, wie mir schien, auf eine neue Annäherung an. Ich spielte ein wenig mit ihr, ging aber der Sache dann energisch aus dem Wege. Während ich dies niederschreibe, empfinde ich großen Unwillen gegen die Frau. All' das scheint mir unschön und keineswegs groß, wie ich mir unter Wolfskehls Einfluß ihre Persönlichkeit dachte.
Gestern bei Weidenbusch in Wiesbaden. Besichtigung seiner prachtvollen Kunstsammlungen. Ich las ihm allerlei von mir vor, was er lobte. Abends mit seiner Geliebten zusammen, einer eleganten Pariserin. Sie steht unglaublich unter seiner Suggestion und während ich ihr anfangs sympathisch zu sein schien, war sie auf einmal empört, als ich seine Unfehlbarkeit in irgend etwas anzweifelte. Ich war ein wenig gereizt durch seine unverkennbare Absicht, mich vor ihr in Verlegenheit zu setzen, eine schlechte Gewohnheit von ihm, die zwar ganz gutartiger Natur ist und mit Humor verbunden, die er aber stets in Anwendung bringt, wenn Dritte dabei sind. Ich antwortete ihm stets in scherzhafter Art; er ist von maßloser Eitelkeit, was ich ihm übrigens andeutete. Indessen hat er ein ganz ausgesprochenes Kunstgefühl, instinktiv oft recht gute Ansichten und ist sehr unterhaltend, aber ohne sein Geld und seine große Gewandtheit und Sicherheit wäre er wenig. Übrigens hat sich zwischen ihm und mir Frauen gegenüber eine seltene Geschmackübereinstimmung gezeigt. Das erlebe ich zum ersten Mal mit jemand.
Auch Hallwachs habe ich in Darmstadt besucht: der kleine Mensch mit dem großen Talent, Künstler und Philister zugleich. Scheint in dem Darmstädter Krähwinkel ganz zu verbürgern, ist ganz ohne Energie und Initiative, um sich durchzusetzen. Er und Prange sind die einzigen meiner Bekannten, die Mathilde sympathisch sind. Sie hält Gutmann für sehr unbedeutend. Tilly gefiel wiederum Gutmann. Sonnecks Nichtigkeit erkannte Mathilde sofort, gleichfalls Priesters. Indessen gefiel ihr Philips besser, aber sie gefiel Philips und Gutmann nicht.
Paris 1. März 1897.
Seit 8 Tagen bin ich hier. Meine Nervosität machte mir die letzten Frankfurter Tage unerträglich. Reise über Cöln. Mathilde war in Frankfurt an der Bahn. Ich verfehlte sie aber, da ich einen anderen Zug nehmen mußte. Ein Brief von ihr wurde mir hierher nachgeschickt, voll von Liebesbeteuerungen, ich weiß nicht, ob ich daran glauben darf. Ich antwortete ihr, jedoch glaube ich, es ist aus. Es geht nun einmal nicht anders. Auch Großmamas Abschiedstränen hatten etwas künstliches. In den letzten Tagen habe ich sie veranlaßt, ein Codizill zu machen, daß ihre Kunstgegenstände und Altertümer, natürlich gegen Entschädigung an die Schwestern, auf Richard und mich vererbt werden; es wäre jammervoll, wenn sie in Ottos Hände kämen, der allerdings gern damit prunken würde. Ich bin mir moralisch vollkommen klar, was ich tue, ich fühle mich durchaus im Recht.
Der Abschied von Otto und Hedwig war äußerst kühl, gleichfalls von Tilly, deren heimliche Verlobung doch nicht aufgehoben zu sein scheint und Ottos Billigung findet. Mögen sie tun, was sie wollen.
Diese 4 Wochen in Frankfurt brachten mich zur Einsicht, daß mit dem Tode meiner Eltern alle Bande mit meiner Familie geschwunden sind, am meisten fühle ich noch für Hedwig, gegen Tilly habe ich eine vollkommene Fremdheit. Zu Großmama stehe ich in einem kühlen Verhältnis mit dem Bewußtsein, Pflichten gegenüber ihrer Freigebigkeit zu haben.
Fastnachtsdienstag, 2. März.
Wohnungsuchen, Besorgungen, Straßenleben, Restaurants, Cabarets. Ich habe schon viel Oberfläche gesehen. Morgen oder übermorgen werde ich beginnen, die Stadt mit Baedeker zu durchstreifen. Am Abend lasse ich mich vom Zufall leiten. In den nächsten 4 Wochen soll dieser mein einziger Führer sein. Erst dann werde ich von meinen Empfehlungen und Verbindungen Gebrauch machen. Es hat einen unendlichen Reiz, mitten in diesem rauschenden Leben allein zu sein, mitten in der Buntheit des Carnevals besonders, der in diesen Tagen eine unglaubliche Ausgelassenheit in den Straßen hervorrief. Die Hauptlust besteht in dem Werfen von Confetti und Serpentinen. Die ersteren bedecken die Trottoirs der Boulevards fast fußhoch. Allen Vorübergehenden hängen die bunten kleinen Papierstückchen in Haaren und Kleidern. In die Restaurants, auf die Treppen der Häuser, in die Zimmer, überall hin werden sie geschleppt. Die Serpentinen hängen sich fest an die Bäume, von denen sie in tausend bunten Streifen herabhängen. Dazu kommt die wunderbare Nachmittagsbeleuchtung der blau und roten Februartage, das Gewühl der Menschen, die zahllosen Masken, ein prachtvoller Maskenzug aus künstlerisch ausgestatteten Karren voll hübscher Frauen bestehend, die Confetti werfen und durch die Hauptstraßen ziehen. Musik in den Caféhäusern, wo man, ohne unter Kälte zu leiden, bis um 2 Uhr nachts auf den Straßen sitzt. Überall sieht man Frauen auf den Straßen, in den Restaurants, meistens Kokotten, die aber kein Hindernis sind, daß sich andere Damen im selben Raum aufhalten. Alle zeigen eine große Mannigfaltigkeit des Äußeren. Diese Frauen könnten in Deutschland nicht über die Straße gehen, ohne angegafft zu werden. Man würde sie alle für große Kokotten oder Schauspielerinnen halten, denn sie haben fast alle etwas Besonderes in Kleidung und Ausdruck. In Deutschland würde man sagen, sie sind nicht schön, aber interessant. Der Demimonde hat hier Kultur, vor allem hat die Geldgier ein sehr starkes Äquivalent in der Vergnügungssucht. Diese Mädchen sind lustig, witzig, und wenn man sich in einem ihrer Caféhäuser befindet, hat man keineswegs das Gefühl, sich wegzuwerfen, wie in den Berliner Kokotten-Caféhäusern. Man behandelt die Kokotten hier vielmehr als Frauen, als Geliebte, macht ihnen nicht nur kurze Besuche, wie in Deutschland, sondern genießt erst ein wenig ihre Gesellschaft, besucht ein Restaurant oder Caféhaus mit ihnen. In Deutschland würde ihr Kulturniveau das unmöglich machen.
Ich unterscheide bereits die 2 ganz verschiedenen Seiten von Paris: das mondaine Paris und das Zigeuner-Paris. Zwischen diesen beiden Polen bewegte sich ja meine Natur von jeher. Ich werde mich niemals für eines der beiden allein entscheiden, und habe mir daher eine doppelte Garnitur der Toilette verschafft. In dem eleganten Paris werde ich mehr beobachten und im Zigeuner-Paris wahrscheinlich mehr erleben. Meine Wohnung habe ich so gewählt, daß ich dem Quartier Latin mit dem Boulevard St. Michel nahe bin, aber doch nicht mitten darin wohne. Meine Neigung zieht mich zunächst mehr dorthin. Aber dennoch will ich nicht auf die Gesellschaft verzichten. Dazu kommt immer wieder die leise Hoffnung, doch in ihr nur das Erlebnis finden zu können, welches meiner Unruhe und Abenteuerlust ein Ende macht, sie wenigstens mindert. Sehr anziehend sind die sogenannten Cabarets, kleine Restaurants, wo Dichter und Komponisten, meistens Volkssänger, ihre oft ausgezeichneten Werke zum Vortrag bringen. Die ernsten Sachen sind mir zu süßlich, andere sehr sozialistisch. Dagegen die komischen sind häufig ersten Ranges. Viel kommt auf Rechnung einer sehr eigenartigen Vortragsweise, die sich hier entwickelt hat, die hauptsächlich darin besteht, die Pointen gewissermaßen zu ignorieren, sie im Ton der Selbstverständlichkeit vorzubringen. Dazu eine große Mäßigkeit der Geste. Es liegt etwas ungeheuer Diskretes darin, welches dem Bild durchaus widerspricht, das man sich von der französischen Art macht, nämlich der Vorliebe für dröhnendes Pathos. Das größte dieser Cabarets ist der Chat Noir, den die beste Gesellschaft besucht, der aber keineswegs das Beste leistet. Die Sachen sind meist sehr aktuell, knüpfen an Tagesereignisse an. Selten sind sie reine Kunstwerke, sondern eher dem Kunstgewerbe nahe. Sie sind viel zu praktisch, nämlich tendenziös, aber von artistischem Geiste durchdrungen. Äußerungen hoher Kultur und der Verwandtschaft mit der Antike. Bei diesen Vorträgen, die weniger Kunstverständnis, als Gefühl für Grazie, Geist, Bizzarerie voraussetzen, verbringt die studentische Jugend ihre Abende. Die kleinen Frauen und die Kokotten finden sich zahlreich ein. Und da jeder Amateur zum Vortrag zugelassen wird, finden sich Leute aus verschiedenen Berufen ein. Alles dies, nämlich das allgemeine Gefühl für das Künstlerische, welches hier das ganze Leben beherrscht, setzt eine feinkultivierte Rasse voraus. In allen diesen Cabarets sitzt man sehr unbequem, die Consommations sind mittelmäßig. In Deutschland würden sehr gewöhnliche Leute solche Lokale nicht vornehm genug finden. Von Theatern habe ich bis jetzt nur die Große Oper besucht, um dem Maskenball beizuwohnen, der ein berauschendes Farbenspiel bot, im allgemeinen aber nichts anderes als eine Konzentration des Straßenlebens auf einen Raum. Confetti, Serpentins, doch viel mehr Masken. Dann war ich in der Comedie-Française, wo ich eine vorzügliche Aufführung der Fourberies de Scapin, sowie des Malade imaginaire mit dem älteren Coquelin sah. Die Abende bringe ich oft im Quartier zu, wo ich ein liebenswürdiges Abenteur mit einer kleinen Couturière, namens Blanche Fort hatte. Ein pikantes Geschöpfchen mit Geist und Sinnen. Sie hat mich in vieles Pariserische eingeweiht. Sie lebt en ménage mit einem russischen Studenten, wie sie erzählt, der momentan auf Reisen ist. Ich lernte sie in einem Restaurant kennen, wo sich viele solcher Mädchen zum Diner einfinden.
Einer Scheußlichkeit muß ich noch Erwähnung tun, die mir neulich nachts gegen 1 Uhr auf dem Boulevard Sébastopol passierte. Eine etwa siebzigjährige, sehr ordentlich aussehende, doch offenbar arme Frau redete mich an und fragte mich, ob ich nicht »de petites cochonneries« wünsche. Sie versprach, »très cochonne« zu sein, und als ich im ersten Augenblick verblüfft »Non, non« ausrief, fragte sie traurig, fast wie ein Kind: »Vous ne voulez pas Monsieur?«
Mittwoch, den 3. März.
Ein schlimmer Tag. Die Nacht unruhige Träume, gegen Morgen träumte ich von Mama, bis ich weinend aus meinem Halbschlummer erwachte. Den ganzen Tag verstimmt. Dazu ein quälender Westwind von ungeheurer Kraft. Ich machte nachmittags einen Spaziergang durch die Champs-Elysées, Marsfeld u. s.w., und unterschätzte die Entfernungen, sodaß ich ganz gebrochen zuhause ankam. Eine Stunde des Nachmittags im Louvre in den Antikensälen. Meine Freude an der Sculptur bedeutend gestiegen seit meiner italienischen Reise, vor allem das Verständnis für die Linie der menschlichen Gestalt.
Meine Natur vereint alle Pole in sich: bald jugendliche Kraft, bald die Mattigkeit und Kraftlosigkeit eines alten Menschen; bald verwöhnteste Gourmandise, bald die Fähigkeit, mich mit dem Schlechtesten zu begnügen; bald vollkommene Verachtung des Urteils anderer und dann wieder Eitelkeit; bald Sicherheit bis zur Frechheit, bald Schüchternheit, Erröten beim geringsten Anlaß; bald bin ich der feurigste Liebhaber, der jederzeit und unter den unbequemsten Verhältnissen bereit ist, und auch keine Einschränkung der Zahl kennt, bald bedarf ich der Bedingungen, von denen Mantegazza spricht, des caldo, carezza, und comodità, und auch das völlige Versagen kommt vor. Alles dies ist nicht einmal abhängig von dem Objekt.
Donnerstag, den 4. März.
Heute das bisher tiefste Erlebnis meines Pariser Aufenthalts: die Venus von Milo gesehen. Anfangs stand ich kalt davor und sagte mir: nun stehe ich vor vielleicht dem bedeutendsten Kunstwerk aller Zeiten; hier hat Heine geweint und mancher Andere bewundernd gestanden. Doch allmählich kam ein wunderbares Gefühl über mich, nicht ein Strahl, der mich durchzuckte, oder ein Schauer über den Rücken, wie vor manchem anderen Kunstwerk, sondern eine beseligende Ruhe voll Zärtlichkeit ohne eine Spur von sinnlicher Erregung. Als mich der Custode darauf aufmerksam machte, daß geschlossen wurde, war mir, als nehme ich von einer lieben Freundin Abschied. Eine Traurigkeit erfüllte mich, als ich durch die lange Flucht der Säle ging, stets mich rückwärts wendend, wo sich die weiße Gestalt auf dunklem Hintergrund abzeichnete. Sonst freute ich mich besonders über einige Antinousköpfe, ein von mir schon in Rom besonders geliebter Typus, besonders über den Kolossalkopf des Antinous als Osiris. Meine Freude und Aufnahmefähigkeit für Plastik war nie so groß, wie jetzt. Unter den Büsten der römischen Kaiser fiel mir folgendes auf: mit Tiberius beginnt ein Zug, den ich nicht anders, als »Canaille« nennen kann, in den Gesichtern der Julier hervorzutreten um die dünnen eingekniffenen Lippen. Man müßte die Portraits der Gemahlinnen des Augustus, der selbst diesen Zug garnicht hat, auf diesen Zug hin prüfen. Ein überraschend fremdes Element, welches wohl durch die weibliche Linie eingeschlichen ist.
Freitag, den 5. März.
Der gestrige Abend plein d'ennuis. Ich ärgerte mich, das kleine Abenteuer mit Blanche so kurz abgebrochen zu haben, irrte im Quartier mißmutig herum, kam schließlich in das Café d'Harcourt, traf dort ein Mädchen, welches aussah, als wäre es ohne Mund geboren und als habe man später mit einem dünnen Messer eine kleine kurze Spalte in das Fleisch geritzt. Sie hatte keine Lippen, nur einen dünnen, roten Strich. Es war grauenvoll. Ich ging dann mit einer anderen, wie von einer fremden Macht dazu gezwungen, denn ich versprach mir gleich wenig von ihr. Sie war faul und temperamentlos und suchte durch ein abscheuliches Krähen ihre Teilnahme an der Situation auszudrücken. Sie blieb die Nacht bei mir, und nun wollte es das Unglück, daß es gegen 9 Uhr früh an meine Tür klopft: Blanche war da. Ich mußte sie auf dem Korridor empfangen und konnte ihr die Situation nicht verschleiern. Sie war ganz ruhig, als ich ihr sagte, daß ich eine consolation pour mes ennuis de solitude gesucht hätte. Sie hatte sich so sehr gefreut, mit mir die Morgenschokolade zu trinken. Ich werde sie nun aber nicht sobald wieder loslassen, denn nach dem Abenteuer mit ihr schienen mir gestern Abend alle diese Kokotten, die mich anfangs so sehr blendeten, ziemlich reizlos.
Heute wieder im Louvre. Ich habe die Physiognomik der Julier weiter verfolgt. Jener Zug, von dem ich sprach, befindet sich bereits bei Livia, der Gemahlin des Augustus. Ich weiß aber nicht, ob sie die Stammutter der späteren Julier ist; ferner bei Germanicus, Drusus, dem Sohn des Tiberius, auch bei Claudius. Dagegen sind die infamen Lippen des Nero auf seine Mutter Agrippina, die jüngere, zurückzuführen. Indessen entwickelt sich dieser Zug erst später bei ihm. Als Jüngling ist er dem Typus Tiberius, Drusus noch ähnlich. Ebenso wenig wie Augustus hat dessen Schwester Octavia etwas von jenem Zug. In hoher Ausprägung hat ihn Caligula trotz der hoheitsvollen Schönheit seiner Mutter, Agrippina, der älteren.
Aphrodite und Artemis: die beiden Pole der Weiblichkeit. Artemis hat immer etwas, worüber sie zürnt, kennt nicht die Hingebung des Weibes. Mir scheint, daß die moderne Amerikanerin etwas von ihr hat. Diese Unterscheidung ist ein Gegenstück zu Dionysos und Apollo. Welche Scheußlichkeit offenbart Artemis in der Sage des Aktäon, den sie in einen Hirsch verwandelt, nur, weil er ihre Nacktheit geschaut. Liegt wirklich soviel an der Keuschheit eines Weibes, daß dafür ein Mann vernichtet werden darf? Der Masochismus scheint sich gerade zu dem artemisischen Weibe hingezogen zu fühlen. Gesünder scheint mir, Aphrodite, Hera oder die kindliche Psyche zu lieben.
Samstag, den 6. März.
Gestern das zweite starke, künstlerische Ereignis meines Pariser Aufenthalts: Madame Réjane als Hélène in der »Douloureuse« gesehen. Ein neues sehr viel, zu viel gelobtes Stück von Maurice Donnay. Es ist eigentlich keine Komödie, sondern es sind 4 Akte voll vortrefflicher Dinge. Die Réjane hat jene große schlanke Eleganz der Formen, wie die Nymphe von Fontainebleau des Benvenuto Cellini. Und der großen lebendigen Geschmeidigkeit dieser Formen verdankt ihr Spiel vielen Reiz. Sie trägt, wie jetzt augenblicklich viele Frauen, kein Korsett, was alle die Schauspielerinnen nachahmen sollten, welche wissen, daß man nicht nur mit den Armen, sondern mit dem ganzen Leibe Gebärdensprache haben kann. In dem Gesicht der Réjane fällt der Mund auf: ein großer, starklippiger Mund, der von vielen Erregungsmöglichkeiten der Seele spricht, und so sieht man ihn im ersten Akt voll frivolen Lächelns, obgleich voll Verachtung und Ekel gegenüber jener Finanzgesellschaft, im zweiten Akt voll Zärtlichkeit und im dritten voll Reue, Verzweiflung und Angst. Besonders die Stadien des Schmerzes, des Weinens, im dritten Akt sind wundervoll. Leider sah man infolge des neumodischen Kostüms wenig von den Händen.
Sonntag, den 7. März.
Gestern Abend mit Blanche im Odéon. Man gab Richepins Drama Le Chemineau. Heute in der Ausstellung des Goncourt'schen Nachlasses im Hôtel Drouot und der Maison Bing. Meist japanische Sachen, auf die ich durch die Weidenbusch'sche Sammlung in Wiesbaden bereits vorbereitet war. Nachmittags im Concert Lamoureux, Fünfte Symphonie von Beethoven. Mir schienen die beiden letzten Sätze dadurch ganz verdorben, daß Lamoureux zu viel Ruhe bewahrte, herrliche Details. Nur im Adagio zeigte er sich auf der Höhe.
Blanche war gestern im Theater köstlich. Sie fing mit einer entzückenden Ungeniertheit an, mit einem Ehepaar in der benachbarten Loge eine Unterhaltung zu führen, als ob sie meine Frau wäre und wir Verkehr suchten. Ihre Unbefangenheit hinreißend.
Montag, den 8. März.
Heute in der Ausstellung der von Sâr Joséphin Péladan begründeten Rosenkreuzer. Diese Maler haben nichts gemein, als den Namen und ein heftiges Suchen. Viele haben religiöse Stoffe, alle Techniken sind vertreten. Die prärafaelitische Linie bis zum impressionistischen Nebel, die Stile aller Zeiten werden nachgeahmt.
Dienstag, den 9. März.
Im Salon Carré. Rembrandt, hervorragend der Gang nach Emmaus. Es liegt darüber eine mir wohlbekannte Stimmung, die in mir besonders an trüben schwermütigen März- und Apriltagen wach wird und durch folgende Associationen genährt ist: Passionswoche, Italien, besonders Rom, Klöster, halberleuchtete hallenartige Räume. Es ist ein sehnendes Erwarten darin, das vielleicht in der Natur liegt und im Mythos der Auferstehung ausgedrückt ist. Ich kann es nicht definieren, aber es liegt deutlich über diesem Bild. Für mich ist es mit großer Sehnsucht nach Rom begleitet. Vor der Mona Lisa: es ist neben der Venus von Milo das Kunstwerk des Louvre, das mir den tiefsten Eindruck gemacht hat. Dieses mystische Lächeln wirkt bei längerem Hinschauen fast unheimlich. Ihr Blick durchschaut einen und sagt: Ich kenne dich. Darum das seltsame Lächeln, das an die Sphinx erinnert.
Mittwoch, den 10. März.
Gestern Abend in den Folies-Bergères, das größte Café-concert von Paris. La belle Otero, die gefeierte Schönheit. Sie trat auf in spanischen Liedern und Tänzen, aber man merkte, daß das Carmenhafte ihr nicht liegt, es fehlte das Temperament. Ihre Stimme steht wohl über dem Niveau gewöhnlicher Chansonettensängerinnen, desgleichen die auserlesenen Farben ihres Kostüms, während ihr Gesicht, für mich wenigstens, keinen Reiz hat, am wenigsten der abscheuliche herzförmige, stets offene Mund, der mich an die französische Plastik Louis Seize erinnert, die ich auch nicht mag. Ich stehe immer wieder vor einem Rätsel, wenn ich solche Frauen sehe, die doch die Sinne aller Männer zu berauschen scheinen. Nur die meinen nicht.
Donnerstag, den 11. März.
Ich komme eben aus der Vorstellung von Racine's Phèdre, dargestellt durch Sarah Bernhardt. Bei der Lektüre hat mich dieses Stück nicht berührt infolge der kalten Pedanterie der Sprache, die mich geradezu irreführte. So habe ich bis zum letzten Akt die Liebe der Aricia zu Hippolyt, die doch echt genug ist, für Verstellung gehalten. Dagegen ist die Psychologie der Phädra vortrefflich. Das Ensemble war erstaunlich gut. Und Sarah Bernhardt? Sie war für mich kein Ereignis, wie die Réjane, vielmehr eine Enttäuschung. Sehr viele vortreffliche Einzelheiten. Hier ist einmal viel echtes Gefühl gewesen, aber dieses verwöhnteste Kind der Pariser geht fast ganz auf in brillantem Virtuosentum, ja in Affektiertheit. Bisweilen ein wahrer Naturton, dann wieder ein hohles Pathos, wechselnd mit übertriebenem Naturalismus, besonders beim Weinen. Dann kommt wieder einmal ein Stück antike Stilisierung. Nach der Vorstellung traten 2 junge Dichter auf die Bühne, welche mit großem Pathos recht mittelmäßige Gedichte vorlasen, um für die augenblicklich von den Türken bedrohte griechische Freiheit zu begeistern. Die ganze Pariser Jugend, besonders die Künstler und Studenten und auch Sarah Bernhardt agitieren seit einigen Wochen für Griechenland, welches in diesen Tagen den Frieden Europas erschüttert. Diese Begeisterung für ein ehemaliges Kulturvolk, das von seinen großen Ahnen nichts mehr im Blute hat, nur noch den gleichen Namen trägt, ist zwar kindisch, doch nicht unschön, während die Haltung des Kaisers Wilhelm II. barbarisch ist, der die strengste Maßregelung Griechenlands vorausgesagt hat, selbst auf die Gefahr hin, die momentan herrschende Übereinstimmung der Mächte zu zerreißen. Der Dichter sprach daher mit Abscheu und Verachtung von jenem peuple ridicule et barbare und das ganze Haus dröhnte von dem stürmischen Beifall. In diesem Augenblick fühlte ich etwas von dem Schmerz, den schon mancher kultivierte Deutsche gefühlt hat in dem Bewußtsein, daß sich sein Volk beständig kompromittiert und daß das Ausland nicht immer unrecht hat, wenn es lacht und tadelt. Und alles das muß ein Volk erleiden, das seit der Antike die meisten großen Einzelpersönlichkeiten hervorgebracht hat, das trotzdem das unantikste aller Kulturvölker ist. Ist daran das Preußentum schuld? Es scheint mir, unserer alten deutschen Kultur durchaus fremd zu sein. Dennoch ist es nicht möglich, zu wünschen, daß Preußen wieder von Süddeutschland abgetrennt wird. Ein unlösbares Kulturdilemma.
Montag, den 15. März.
Vorgestern mit Blanche in der Komischen Oper. Man gab Orphée, die wundervolle Oper von Gluck. Hervorragend Marie Delna als Orpheus, eine prachtvolle warme Altstimme. Gestern allein in dem Cabaret oder schon mehr Theater La Roulotte. Chansonniers, kleine Pantomimen, Revuen u.s.w. von verschiedenem Wert, aber das meiste originell. Ein sehr schöner Abend. Vor dem Opernhaus die Gruppe »Der Tanz« von Carpeaux besichtigt, das Beste, was ich von moderner Plastik kenne.
Immer klarer wird mir, daß die Deutschen keine eigentliche Kultur, sondern nur hervorragende Einzelpersönlichkeiten gehabt haben. Das gilt sogar von der Musik. Kein Volk hat hier annähernd das aufzuweisen, was wir von Bach bis Wagner hervorgebracht haben. Dennoch gibt es bei uns unendlich viele Leute ohne alles musikalische Gehör und Melodiengedächtnis, während bei den romanischen Völkern absolut unmusikalische Leute kaum vorkommen. Und es ist bekannt, daß in Italien am folgenden Tag nach einer Opernpremière bereits die Schuhputzer die Hauptmelodien auf den Straßen pfeifen.
Das schöpferisch Große kommt von den Germanen, während nur die Romanen das Leben zu gestalten wissen. Sie legen daher garnicht den Wert auf Originalität, wie wir, und damit haben sie recht. Zum Beispiel die meisten öffentlichen Gebäude und Lokale in Paris sind nicht originell, überhaupt eigentlich stumm, nichts sagen-wollend. Einfache Räume mit Spiegeln und ruhigen diskreten Tapeten, während man bei uns alle möglichen Stile versucht und ein schreiend buntes Durcheinander gibt. Tapeten, wie in deutschen Chambres garnies, Möbel wie in deutschen Caféhäusern würde man sich hier nicht gefallen lassen. Aber in diesem unoriginellen Rahmen flutet das Leben viel bunter und im Ganzen dennoch origineller, als bei uns.
Die Prostitution ist darum so verwerflich, weil sie die Rasse verdirbt. Anstatt, daß das Individuum in seinen Handlungen seinen Rassetrieben folgt, tut es etwas diesen entgegengesetztes, dem bürgerlich berechnenden utilitaristischen Verstand folgend. Jede Erziehung, die das Rassige im Individuum bekämpft, führt zur Prostitution. Die Dirnen sind nur die, bei welchen diese Tendenz am sichtbarsten zu Tage tritt. Im gleichen Grade, nur verborgener, lebt sie in jedem Menschen, der etwas für Geld tut. Bei allen moralischen Reflexionen komme ich immer wieder auf denselben Gegensatz zurück: auf der einen Seite Rasse, Zwecke scheuen, uninteressiertes Tun und Betrachten, Kunst, auf der anderen Seite Vernunft, Utilitarismus, Materialismus, Alltagsmenschentum.
Weidenbusch ist hier. Neulich mit ihm folgende Frage besprochen: Vor 4 Jahren war in meinen literarischen Versuchen noch nicht ein geringer Ansatz von Talent zu entdecken, und heute, so unfertig alles noch sein mag, ist doch Talent und Eigenart zweifellos vorhanden. Weidenbusch bringt dies mit der Entwickelung der Sexualität zusammen. Er mag recht haben, denn verständnislose Philister haben immer eine sehr schwache oder sehr grobe Sexualität, während da, wo dieselbe entwickelt ist, auch meistens andere Werte vorhanden sind. Die Sexualität ein Correlat.
Ich bin nun seit 3 Wochen hier. Noch völlig Fremder, Reisender. Ich habe noch keine Besuche gemacht und werde es nicht eher tun, bis ich die Hauptsachen gesehen und den Baedeker aus der Hand gelegt habe. Ich stehe meist erst gegen Mittag auf, was ja hier allgemein Sitte ist. Bis 5, 6 Uhr bin ich in Museen oder an sonstigen Orten, wo es etwas zu sehen gibt. Die Zeit bis zum Diner ist dem Tagebuch und der Korrespondenz gewidmet. Die Abende sind oft sehr traurig gewesen. Ich habe das Bedürfnis nach Menschen. Über einige Abende hat mir Blanche hinweggeholfen. Sie ist wirklich ein liebes Geschöpfchen. Trotzdem fesselt sie mich nicht völlig, und ich bin immer wieder dazu verdammt, zu suchen, zu suchen. Die alte Geschichte. Bisweilen fühlte ich mich ein wenig wie ein Ausgestoßener in dem großen Leben um mich herum, denn immerhin ist mir die Sprache nicht so geläufig, wie die deutsche, und man ist hier garnicht liebenswürdig gegen Fremde. Doch nimmt meine Sicherheit von Tag zu Tag zu.
Das pariser Argot kann mir bis jetzt noch nicht sehr imponieren, da die Bilder und Metaphern doch oft so weit hergeholt sind, daß man sie garnicht versteht. Zum Beispiel poser un lapin, das heißt jemanden bei einem Rendezvous sitzen lassen, la pièce de dix sous bedeutet den Körperteil, auf welchem man sitzt, le maquereau der Zuhälter u.s.w. Vortrefflich ist dagegen la marmite, von welcher sich der Maquereau nährt. Ebenso sind auch in Deutschland viele derartige Worte eigentlich sinnlos, z. B. Moos und Draht für Geld, oder auch der Name eines gewissen Vogels für eine Dirne.
Gestern las ich in Sainte-Beuve's Roman »Volupté«, wie sich die Anlage zu dieser Eigenschaft im Helden schon als Knaben durch eine krankhaft übertriebene Schamhaftigkeit zeigte. Ich kann hierzu Beispiele aus meiner Kindheit anführen. Ich habe um mein sechzehntes Jahr aus Angst, zu erröten, bisweilen den Konfirmationsunterricht versäumt, was nicht ohne Schwierigkeiten war, wenn ich wußte, daß ein Bibelspruch vorkam, der etwa Worte, wie Keuschheit, Beschneidung oder dergleichen enthielt. Bei einem Mittagessen erzählte ein junger Arzt, daß es sehr schwer sei, männliche von weiblichen Skeletten mit Sicherheit zu unterscheiden, was mich in die furchtbarste Verlegenheit brachte, da mich der Unterschied der Geschlechter in dieser Zeit innerlich außerordentlich beschäftigte und meine Phantasie erfüllte. Noch heute habe ich mir das Erröten nicht ganz abgewöhnt, während ich auf der anderen Seite bisweilen imstande bin, mit der größten Sicherheit die heikelsten Dinge, auch mit Frauen, zu besprechen.
Samstag, den 20. März.
Gestern und heute im Luxembourg Plastik gesehen. Es scheint, je näher eine Kunst der wirklichen Gestalt kommt, umsomehr ist sie auf den Ausdruck der Ruhe angewiesen. Die höchste Leidenschaft ist in der unwirklichen Musik möglich, dann in dem gesprochenen Drama. Schon in der Malerei ist sie viel schwieriger auszudrücken, weshalb die meisten Historienbilder unerfreulich und starr wirken. Viel mehr kann sich wieder die Schwarz- und Weißkunst erlauben, die sich durch den Verzicht auf die Farbe von der Wirklichkeit entfernt, weswegen auch die gewagtesten Szenen vorzugsweise in dieser dargestellt werden. Man denke sich Félicien Rops farbig. Am gebundensten ist die Skulptur, weil sie der Wirklichkeit der Gestalt am nächsten kommt. Daher ist Bernini so furchtbar, während Rubens in der Malerei bewundernswert ist. Aus diesem Grunde ist auch vielleicht die Skulptur in unserer von dem Naturalismus so beeinflußten Zeit zurückgeblieben.
In der Salle Caillebotte. Sammlung modernster französischer Malerei. Anfangs war ich erschreckt durch die Kälte, die überall in diesen Bildern liegt. Die Landschaften drücken Sensationen aus, die der Großstädter hat, wenn er hinaus kommt, nicht die Liebe des in jener Umgebung aufgewachsenen Menschen, d. h. es ist etwas Intellektuelles in ihnen. Alle diese Bilder sind von wunderbarer Farbenharmonie und wirken aus der Ferne zugleich äußerst dekorativ. Doch alle kühl wie die Gedichte der Parnassiens.
Sonntag, den 21. März.
Wenn man das Pariser Leben in den Theatern und auf der Straße beobachtet, die Feuilletons und Berichte aus der Gesellschaft verfolgt, sowie einige Blicke in die moderne Literatur wirft, so muß einem der übermäßige Kultus der Frau auffallen. Es ist nicht das Widerliche, wie in Amerika, wo das Weib als höheres Wesen gilt und sich nach eigenem Gutdünken immer mehr entweibt und dadurch zu einem kraftlosen Hermaphroditismus gelangt, den die ungebildeten Männer, und das sind fast alle Amerikaner, sich gefallen lassen. Es ist immerhin etwas Weibliches, was hier im Weib verehrt wird, wenn auch meist nur das Äußere des Weibes. Schöne Körperformen, elegante Toiletten, Esprit und dergleichen. Dieser Kultus hat nun eine Wesensform gezeitigt, und ich glaube, daß das die typische Erscheinung der Pariserin ist, die in nichts, als in kleinen Eitelkeiten, Wünschen und Freuden aufgeht, ein Wesen, das ganz Puppe ist und hohl. Ich habe diesen Typus in der Hauptgestalt meiner Novelle Mela im Voraus geahnt, nur daß diese leere Koketterie bei ihr fast bewußt und dadurch beinahe ein raffiniertes Laster ist. Die Pariserin dagegen ist ganz naiv in ihrer Leerheit. Sie kennt garnicht einmal die eigentliche Freude an ihrer Herrschaft über die Männer, denn sie ist für sie zu selbstverständlich. Die Galanterie erreicht hier ein ganz unerhörtes Maß. Die Pariserin ist beleidigt, wenn man in ihrer Gegenwart andere Frauen hübsch findet. Auch mit Blanche bin ich im Augenblick etwas brouillé. Die Ursache ist offenbar, daß ich in diesem Punkte nicht französisch genug bin. Blanche habe ich bisher für eine schöne Ausnahme gehalten.
Vorgestern Abend in der Oper: Lohengrin. Ich war wenig aufnahmefähig, doch konstatierte ich, daß alles, was Geld und guter Wille erreichen können, hier erreicht wird: ein treffliches Orchester von wunderbarer Klangfarbe, hervorragend geschulte, stimmbegabte Künstler. Aber von dem, was Lohengrin und Elsa von einem harmlosen italienischen Opernliebespaar unterscheidet, wissen sie nichts. Lächerlich ist teilweise die Übersetzung von Nuitter, z. B. »et Lohengrin, son chevalier – c'est moi«, am Ende der Gralserzählung.
Gestern Abend in der Scala. Yvette Guilbert gehört, die Sarah Bernhardt des Café-concert. Auch hier fand ich zunächst viel kalte Routine. Ich habe auf dem Gebiet des leichten Chansons in den Cabarets manches Vortreffliche gehört, das mir viel besser gefiel, z. B. Mademoiselle Miette in der Roulotte, der es nicht möglich ist, durchzudringen, weil sie dem allgemeinen Geschmack nicht entspricht. Einen Winter lang hat sie allabendlich in einem kleinen Faubourgconcert gesungen, dabei ist jedes Wort von ihr Geist und Empfindung. In der Scala wurde außerdem gestern eine Revue aufgeführt, in welcher die Ereignisse des letzten Jahres persifliert auf die Bühne gebracht wurden. Es geschah etwas, was eine antike aristophanische Seite des Pariser Lebens offenbarte. Unter anderem amüsierte man sich über eine Prinzessin Chimay, die sich in den Kapellmeister einer Zigeunerkapelle derartig verliebt hat, sodaß sie ihren Mann verließ, um mit jenem zu leben. Seit kurzem ist das Paar, die Prinzessin Chimay und der Primas Rigo, in Paris. Gestern Abend erschienen beide nun in einer Loge und sahen zu, wie man ihre Geschichte darstellte. Es entstand die größte Bewegung im Publikum, welches gespannt das Paar bei jedem Bonmot, oft sehr derber Art, beobachtete.
Montag, den 22. März.
Ich lese im 9. Band des Tagebuches der Goncourts und wundere mich über die geringe philosophische Kultur des Kreises um Goncourt und Daudet. Es ist die Rede davon, daß man die Freude an den Romanen darum verlöre, weil sie nicht wahr seien, nur noch wirkliche Dokumente könnten interessieren. Man vergißt dabei, daß ein gutes Kunstwerk wahrer ist, als die Wirklichkeit. Überhaupt ist der ganze Band ziemlich inhaltslos.
Der Engländer ißt, um sich zu nähren, der Franzose aus Vergnügen am Essen, der Deutsche, um das Gefühl des Hungers los zu werden, d. h. er verdirbt sich den Appetit.
In der Ecole de Pharmacie die Besnard'schen Fresken gesehen. Ich kann darin nicht mehr sehen, als ein tastendes Suchen bei nur seltenem Gelingen. Vor allem eine maßlose Stillosigkeit.
Ein Frauentypus, den ich sehr liebe: der Mund drückt beständig Scham aus über die Leidenschaft, welche die Augen aussprechen.
In keinem Jahr war meine Sehnsucht nach dem Sommer so groß, wie heuer. Täglich beobachte ich, wie weit die Blätter an den Bäumen der Boulevards sind. Seit 2 Tagen erfüllt mich nun das Frühlingswetter mit Glück. Morgen, Mittfasten, will ich aufs Land gehen, da man hier in Paris eine Wiederholung des Mardi gras mit Confetti und Geschrei veranstaltet.
Ich erhielt eine Karte von Gutmann, der am Gardasee ist. Manchmal beschleicht mich eine gewisse Sehnsucht nach dem tiefgeistigen Verkehr, dessen uns schließlich in München zu viel geworden ist. Wir waren so weit auf unsere gegenseitigen Denkformen eingerichtet, daß wir alle Erscheinungen unter 3 Kategorien brachten, welche sich durch Gutmann, Philips und mich bezeichnen ließen, je nachdem der Rhythmus einer Erscheinung einem dieser drei Individuen gemäßer war. Wir waren sogar oft gegenseitig auf Associationen eingestellt, die sonst an der Schwelle des Bewußtseins bleiben und von den Hauptgedanken unterdrückt werden. Eine Fortsetzung eines solchen geistigen Verkehrs könnte zu Ideenflucht führen. So sind wir immer zur Einsamkeit verdammt. Wolfskehl, Philips und Gutmann haben mich nun geistig so sehr verwöhnt, daß ich so leicht nie mehr als einen oberflächlichen Verkehr finden werde. Ich habe hier einige Besuche gemacht, befürchte aber, daß mir dies zu nicht mehr als bisweiligen Zerstreuungen verhelfen wird. Im Grunde bin ich einsam. Ich denke oft an meine toten Eltern. Ich habe nichts anderes von den Menschen, als bisweilen einmal ein kurzes Beisammensein mit den drei genannten Freunden. Aber diese Zusammenkünfte dürfen einige Wochen nicht überschreiten, da wir uns gegenseitig aushöhlen und uns schließlich in ewigen Analysen zersplittern. Meine Hoffnung ist immer wieder, bald eine Frau zu finden, mit welcher ich in völliger Gemeinschaft leben kann. Gutmann beobachtet übrigens ganz anders, als ich, individueller, realistischer, ich typischer, wenn man will, metaphysischer. Er beobachtet zum Beispiel besser als ich, ob sich in einer Gesellschaft ein heimliches Liebespaar befindet. Ich sehe mehr die ganze Idee, die in dieser Gesellschaft zum Ausdruck kommt.
In Italien verschwinden die Individualitäten mehr im Typus der Rasse. Fast alle Leute sehen »südländisch« aus. Auch der Geist der Bevölkerung hat etwas Unindividuelles. Die Bauern sprechen von dem Fluß, dem Berg, dem Baum, der Blume, ohne sich nur um ihre einzelnen Namen zu kümmern. So konnten sie in einer Vigne bei Rom nie mich von dem ca. 45 Jahre zählenden Bildhauer Volckmann unterscheiden. Wir waren beide »der« Fremde.
Heute im Museum und der Fabrik der Gobelins. In dieser Technik darf man nicht versuchen, mit der Malerei zu rivalisieren, wie überhaupt in schwierigen Techniken. Die Schwierigkeit der Technik darf nie als Hindernis dienen, sodaß man etwa sagt: für einen Gobelin sehr gut, sondern sie darf überhaupt nicht bemerkt werden. Ein Vergleich mit der Malerei darf gar nicht aufkommen. Die schwierige Technik muß, wie überall, zur Konzentration, zum Einfachen, Wesentlichen, Typischen führen, wie in der Poesie Sonett oder Terzine etwas ganz anderes wollen, als Prosa.
Während wir bei einer Madonna garnicht daran denken, daß wir diesen Stoff schon so oft gesehen haben, während kein Mensch bei Memling oder Bellini sich fragt, welcher von beiden die Madonna besser ausgedrückt hat, weil hier kein Mensch an den Stoff denkt, ist dies ganz anders bei Historienbildern. Da braucht nur Herr Hinz zu kommen und zu sagen: ich war selbst dabei und habe gesehen, daß es anders war, als der Maler es zeigt.
Donnerstag, den 25. März.
Ich habe gestern ein originelles Geschöpf in einer Maison de tolérance gefunden. Das ist doch der einzige Notbehelf, hier verhüllt sich das Laster nicht. Es ist sogar echt, und darum nicht ohne einen vorübergehenden Reiz, putain, im Gegensatz zur grande cocotte.
Unter den geringsten Dirnen der äußeren Boulevards gibt es nicht wenige, die, wenn sie gewaschen und in Seide gehüllt, sich in nichts, aber auch garnichts, von der Belle Otero unterscheiden würden. Man sollte daher bei bezahlten Liebesfreuden in Bezug auf das Exterieur nicht mehr als auf Reinlichkeit und eine gewisse Bequemlichkeit sehen. Das meiste Übrige ist Suggestion; wieder ein Beweis, daß zu einem sich nichts versagenden Leben zwar Geld, aber keineswegs Reichtum gehört, vorausgesetzt, daß man tatsächlich nur für sich und nur das, was einem wirklich Genuß bringt, genießen will.
Heute im Musée Carnavalet. Schöne alte Ansichten und Sittenbilder aus dem alten Paris. Rührend ist der Inhalt eines Glaskastens: die Trophäen der italienischen Diva Alboni aus der Mitte dieses Jahrhunderts. Kränze, Seidenschleifen, Stickereien, Gedichte ihrer Bewunderer; dies ist alles, was ein Bühnenkünstler übrig läßt.
Heute einige schreckliche Stunden: Seit einigen Tagen besucht mich der Dämon wieder. Glücklicherweise geringe Gelegenheit hier in Paris. Heute zufällig hineingeraten. Herausgerissen hat mich die Neugier, andere Wesen zu beobachten, die ähnliches suchten. Ich folgte ihnen, ohne aber viel Neues zu sehen. So hat mich der analysierende Verstand einmal gerettet.
Sonntag, den 28. März.
Gestern im Musée de Cluny Beobachtungen gemacht, als Bestätigung des neulich über die Gobelins Gesagten. Nur dann hat in der Kunst die Gebundenheit Wert, wenn sie produktiv wird, d. h. gewisse Vereinfachungen gebietet, die gerade eine besondere Schönheit bewirken können, die bei größerer Freiheit nicht möglich wäre, so wie sich die Tastnerven eines Blinden unendlich entwickeln. Aus der Beschränktheit wird ein Reichtum. Dies ist zugleich eine Widerlegung des Naturalismus, der etwas sagen will in der Kunst.
Ich habe nun bereits mehrere Besuche gemacht. Vorgestern Abend Diner bei Meier-Graefe, dem Kunstkritiker. Obwohl er schwarz ist, hat er etwas typisch Germanisches, fast Schönes und besitzt eine gewisse Art norddeutschen Humors, der sich mit großer Gutmütigkeit zu paaren scheint. Dieser Mann kann, glaube ich, obwohl er offenbar Energie besitzt, dem Weibe gegenüber ein Kind sein an Zutraulichkeit, Hingebung und Aufmerksamkeit. Er lebt mit einem Mädchen zusammen, die still ist und angenehm in den Bewegungen. Er soll sie aus dem Sumpf hervorgezogen haben. Jedenfalls merkt man nichts mehr von ihrer Vergangenheit. Das Interieur verrät viel Kultur. Sehr einfache Räume in Unitapeten mit modernen Bildern in sehr zarten pastellartigen Tönen, mit schönen stilvollen Möbeln. Allerdings ist eine gewisse Kühle nicht zu leugnen. Die Tischgeräte alle ausnahmslos von schöner Form und feinem Dessin. Viele Blumen einzeln in Gläsern. Auch die Speisen waren mit Liebe gekocht, alles verriet persönlichen Geschmack, nicht einfache Befolgung der Gesetze des Kochbuches. Es waren mehrere Journalisten da, gute Sorte, doch Leute, die ganz Beamte geworden sind. Ferner der Zeichner Vallotton, ein sehr stiller Mensch, dann die beiden Kritiker Henri Albert und Dr. Gensel, sowie ein Musiker Oscar Fried. Mit diesen dreien habe ich Verabredungen getroffen, um sie näher kennen zu lernen. Von Fried muß ich nun sagen, daß ich ihn anfangs für einen leeren Renommisten hielt, doch scheint dies nur durch schlechte Gewohnheiten von ihm zu kommen. Er muß viel gelitten haben. Er ist erst 23 Jahre alt. Bisweilen hat seine Stimme etwas ausgesprochen Schmerzliches. Er lebt in sehr beschränkten Verhältnissen. Meier-Graefe bietet ihm einen dauernden Platz an seinem Tisch.
Montag, den 29. März.
Gestern Abend bei dem Dr. Gensel, Kunstkritiker, zum Diner. Ein kleines Interieur. Auch er sucht modernen Stil, doch ist auch hier eine gewisse Kälte in der Einrichtung nicht zu leugnen. Er selbst ist, wie es scheint, ein ziemlich unbedeutender Mensch. Die Frau, – seit einem Jahre ist er verheiratet, – macht den Eindruck eines großen verständigen Mädchens. Sie scheint ein stilles angenehmes Wesen zu sein. Man merkt ihr etwas den dänischen Ursprung an. Nach Tisch spielten wir etwas Mozart, er Violine. Dann heftige Debatte über die Idee in der Kunst. Er kennt nicht den Unterschied zwischen dem, was man gemeinhin Idee oder Vorwurf nennt, und der platonischen Idee. Die Debatte wurde sehr hitzig. Er schien sich sehr dafür zu interessieren und ließ mich kaum los, denn er schien zu fühlen, daß ich Recht hatte, indem ich das, was er Idee nannte, als belanglos empfand. Trotzdem gab er mir mein Recht nicht zu und schien persönlich verletzt zu sein, obwohl er es auf meine Frage leugnete. Dennoch wollte er die Gelegenheit, zu lernen, zu profitieren, nicht verlieren. Er scheint ein kleinlicher, sogar mißgünstiger Mensch zu sein. Die Frau hörte gespannt und still zu.
Dienstag, den 30. März.
Gestern Abend mit Fried zusammen. Er spielte mir einige seiner Lieder vor, die ein ganz hervorragendes Talent bekunden, zugleich großes Können und stilistische Durchbildung. Ich hatte also recht, etwas hinter seiner blague zu vermuten. Da er erst 23 Jahre alt ist, nahm ich Gelegenheit, ihm offen zu sagen, wie er sich dadurch schadet, daß er beständig mit seinen berühmten Bekanntschaften renommiert usw. Er nahm das als wohlgemeinten Rat hin. Überhaupt scheint er ein vortrefflicher, neidloser Mensch zu sein. Pekuniär ist es ihm oft sehr schlecht gegangen, und momentan lebt er von den Vorschüssen, die ihm der Verleger auf eine Oper gibt, die er noch in der Arbeit hat, nach einem Text von Otto Julius Bierbaum. Diese Verhältnisse haben ihm eine gewisse sozialistische Hochschätzung der Arbeit beigebracht, die mit einem völligen Mangel an Verständnis verbunden ist für die Berechtigung des rein betrachtenden Menschen, der in seinem Sinne nichts tut. Manchmal hat man den Eindruck, als ob er vom Leben noch nichts wüßte, obwohl er soviel darin herumgeworfen wurde.
Mittwoch, den 31. März.
Hoffentlich sind nun die Tage vorbei, in denen mich der Dämon quälte. Heute habe ich zum letzten Male nachgegeben. Es ist der 31. Daß ich diese Pedanterie nicht los werde. Nun werde ich ihm wahrscheinlich wieder lange Zeit widerstehen, vom 1. April ab gerechnet. Eine Klippe ist der 16. April, mein Geburtstag, der wiederum einen Einschnitt bildet und Gelegenheit gibt, in dieser pedantischen Weise zu datieren. Glücklicherweise ist die Gelegenheit zum Nachgeben hier in Paris gering.
Ich lese Sainte-Beuve's »Volupté«. Eine durchaus christliche Art, den Stoff zu betrachten, die Wollust als Laster, als Verbotenes, eine Nuance, die das Christentum erst brachte, viel tiefer und problemreicher, als die antike Betrachtung, welche die Wollust nur als schöne erlaubte Freude kennt und persönlicher, als unsere moderne Art objektiv, ohne jede metaphysische Nuance zu analysieren. Durch das Christentum erst das Vampyrhafte, die Force majeure der Wollust, das Dämonische Thatsache geworden. Aber dieser Nuance verdanken wir vielleicht die interessanteste Literatur. So wird bereits die gewöhnliche Cohabitation eine Art Satanismus, wenn auch in geringem Grade, insofern der Leib ein Tempel der Seele, das heißt Gottes ist. Dazu kommt nun nach langen Skrupeln und Gewissensängsten das Sich-dem-Bösenverschreiben, an den man aber glauben muß, um sich ihm verschreiben zu können, die Freude an der Befleckung, an der Schändung. Hierzu muß man aber Christ genug sein, um das alles für Befleckung, Schändung zu halten. Dies führt zu der Wollust, der Besudelung, der Selbsterniedrigung, welche durch die verschiedenen Formen des Lasters symbolisiert wird. Diese Sensationen sind christlicher Herkunft. Es handelt sich nicht darum, die Sinnlichkeit durch neue Reizungen zu kitzeln, was auch die Heiden thaten, sondern das Laster zum Symbol der Selbsterniedrigung zu machen.
Freitag, den 2. April.
Merkwürdig, wie wenig mich die raffinierten Versprechungen der Kokotten reizen. Ich suche dort nur schnelle natürliche Befriedigung. Außer dieser kenne ich nur wirkliche Liebesnächte mit Frauen, zu denen man zärtlich sein kann. Mit einer Frau, bei welcher Geldentschädigung eine gewisse Rolle spielt, kann ich nicht länger zusammen sein, als die Sinne erregt sind. Hier in Paris denkt man entgegengesetzt. Man verkehrt mit den Kokotten, wie mit Geliebten. Viele Liebesverhältnisse werden mit ehemaligen Kokotten angeknüpft, die nach der Auflösung wieder auf ihr altes Handwerk verfallen. Ich lernte gestern bei Bullier im Quartier Latin den norwegischen Maler Munch kennen. Wir kamen auf dieses Thema. Er sieht in dieser galanteren Art, die Kokotte zu behandeln, die höhere Kultur des Landes. Dies war ja auch mein erster Eindruck, als ich nach Paris kam. Aber meine Seele kommt nicht mit. Er verhält sich hier nur schauend und lebt mit seinen Landsmänninnen. Ich dagegen habe versucht, mich in dieses Leben einzumischen und sehe in dieser Galanterie etwas mir fremdes, eine Überschätzung der Frau als Fleisch. Geschähe dies wenigstens orientalisch. Dabei aber beherrscht dieses Fleisch die Gesellschaft. Ich glaube, der Orientale würde sich totlachen. Auch er sucht ja in der Frau nur das Fleisch, deshalb weist er ihr aber auch die untergeordnete Stellung einer Sklavin an. Wenn der Germane dem Weib eine höhere Stellung gibt, so ist es, weil er etwas höheres in ihm sucht. Hier merke ich, daß ich doch germanischer empfinde, als ich glaubte.
Ich kann den ganzen Tag einsam sein, ja, ich bin oft ungehalten, wenn man mich stört, wie heute Fried, der mich zum Déjeuner abholte. Ich will den Tag über entweder arbeiten oder allein umhergehen. Abends aber überkommt mich immer die Sehnsucht nach einem anderen Wesen, mit dem ich nicht durch intellektuelle Bande verknüpft bin. Das brauche ich ja nicht, dazu bin ich mir selbst genug, und die mannigfachen Anregungen des Tages erfüllen mich hinreichend. Ein Wesen, das ich liebe, und das mich versteht. Ich bin in diesem Sinn vielleicht mehr sentimental, als sinnlich, und das ist viel gefährlicher, da es den ganzen Charakter beeinflußt. Die Sinnlichkeit hingegen empfinde ich als eine geringere Regung und beherrsche sie dadurch, daß ich sie gelegentlich befriedige. Oft empfinde ich sie sogar als niedrig und dämonisch. Ich schalte sie aus meinem ganzen übrigen Leben aus, während ich die sentimentale Liebe gern mit allen anderen Werten des Lebens in Verbindung bringe. Natürlich ist es notwendig, daß ich auch die sentimental Geliebte körperlich besitzen muß. Schon, damit die unbefriedigte Sinnlichkeit nicht ihre eigenen Wege geht. Alles dies macht für mich die französische Kokotte mehr oder weniger unmöglich. Entweder Geliebte oder putain, das sind meine Pole.
Der Verstand ist das, was in mir die vielen Widersprüche zeitigt. Mein eigentliches Wollen ist ganz einfach. Plötzlich aber legt der Verstand Zügel an, und nun scheine ich eine Zeitlang ganz umgewandelt. Ich bin mitleidig und dann wieder hart. Verstand und Wollen liegen bei mir in ewigem Konflikt. Und da beides stark ist, wird keines von beiden endgiltig unterworfen, sondern der Kampf geht immer wieder von neuem los, zwischen dem Impulsmenschen, dem Künstler, und dem pedantischen Philister, der nach Verstandeskategorien urteilt.
Gestern Abend mit Henri Albert zusammen. Er hatte seine Geliebte Madeleine bei sich, eine liebenswürdige, doch kindische Person, die sehr hübsch ist. Wir waren bei Bullier und trafen dort Munch. Albert scheint ziemlich unbedeutend zu sein, indeß ein sehr liebenswürdiger Mensch von angenehmen Formen. Über Gensel hat man allgemein die Ansicht, daß er ein Duckmäuser sei und wenig befähigt. Weidenbusch betrachten sie hier als einen begabten Blagueur. Besonders seine Geliebte hat überall mißfallen, sie sei dumm und verwöhnt. Sie vergöttert ihn bis zur Blindheit gegen alle anderen. Madeleine nennt sie »une grue arrivée«.
Samstag, den 3. April.
Gestern nach dem Diner begegnete ich auf den Boulevards Gustav Richter, meinem Münchener Bekannten, dem Maler, der sich schon seit einigen Monaten hier aufhält und die Akademie besucht. Freudiges Erstaunen über unser plötzliches Wiedersehen. Er lebt ziemlich einsam, arbeitet viel, bummelt gegen Abend durch die Straßen, knüpft hie und da eine Liebelei an, freut sich über die schönen Straßenbilder u.s.w. Er unterhält einen regen Briefwechsel mit seinem kleinen Münchener Mädel, mit der er sich nicht entschließen kann, zu brechen. Wir brachten die Nacht in mehreren Lokalen zu. Als wir gegen Morgen nach Hause gehen wollten, lag ein so wunderbarer tiefblauer Himmel über der Stadt, daß wir beschlossen, nicht zu Bett zu gehen. Wir gingen, während die Dämmerung eintrat, nach Notre-Dame. Die Blicke von der Seine aus sind von wunderbarer Schönheit. Er führte mich in das Quartier du Marais, jetzt eines der ärmsten Viertel, unter Louis XIV. der Mittelpunkt von Paris. Noch sehr viele herrliche alte Hotels dieser Zeit von prachtvollen architektonischen Formen. Wir frühstückten in einer kleinen Crèmerie, wo einige Arbeiter hinkamen, die an ihr Tagewerk gingen. Rings herum standen Körbe, in denen Hühner schliefen. Man saß um den Herd. Als wir hinaustraten, fiel feiner Regen, die Straßen waren schon belebt. Gegen 7 Uhr früh kam ich nach Hause.
Montag, den 5. April.
Was mich von der Kokotte zurückhält, ist auch dies: Meine innerste Überzeugung ist, daß nur der Mann ein Recht an einem Weibe hat, den das Weib aus Instinkt als Mann begehrt. Ich komme mir daher kläglich vor, wenn ich gewissermaßen das, was der Mann in mir nicht fertig bringt, nämlich das Weib zu erobern, in dem betreffenden Falle durch ein Surrogat, nämlich das Geld, erzwingen würde. Ich fühle mich überhaupt nur bei dem Weibe völlig als Mann, von welchem ich die Empfindung habe, daß sie mich begehrt, wie ich sie.
Im Caféhaus habe ich einen gewissen Dr. Graf kennen gelernt, Schriftsteller aus Wien. Wir kamen auf Goethe zu sprechen. Tasso, das einzige Werk, in welchem die Nervosität in klassischer, das heißt nicht nervöser Form dargestellt ist. Tasso ist nicht Goethe, sondern nur eine Seite Goethes, wie Werther eine Episode Goethes ist, d. h. er steht über seinen Stoffen. Die modernen Darsteller der Nervosität hingegen stellen nur sich dar, und zwar sich ganz, nicht einen Teil von sich. So stehen sie im Stoff. Ihre Werke bleiben Bekenntnisse eines nervösen Menschen in nervöser Formlosigkeit, sie bleiben subjektiv, werden nicht Symbol.
Auch unsere Ansichten, d. h. die scheinbaren Resultate unserer Verstandestätigkeit stammen aus Instinkten. Würde mein Instinkt die Kokotte begehren, so hätte gewiß mein Verstand ein vortreffliches System bereit, daß die Kokotte überhaupt die einzig berechtigte Weibform wäre.
Heute in der Ausstellung der Indépendants auf dem Marsfeld. Hauptinteresse die neuen Impressionisten, unter ihnen besonders der hochbegabte Munch. Heute Nachmittag lange mit ihm zusammen. Er verdirbt sich vieles in seinen Bildern durch das vorwiegende Gedankliche.
Donnerstag, den 8. April.
Weiter Besuche gemacht. Madame Haeck, deutsche Jüdin, aber ganz französiert, sehr sympathisch im Äußeren und in den Bewegungen. Literarische Interessen. Vierzehnjähriges Töchterchen, spricht kein Deutsch mehr, frühreif, schon zu damenhaft. Dann beim deutschen Generalconsul, von der Frau empfangen. Glacial. Typus der norddeutschen, allerdings eleganten Beamtenfrau. Als ich im Gespräch bemerkte, daß die Kinder nur englisch und kein Deutsch reden, war ich doch etwas erstaunt. Dann bei Frau Alice Straßburger, geborene Löwenstein, gewissermaßen eine Schulfreundin von mir. Sehr liebenswürdiger Empfang. Auch ihr Kind spricht nur französisch.
In der Galerie Durand-Ruel. In Monet muß ich nun wirklich doch den Maler ersten Ranges anerkennen. Er vereinigt die souveräne Technik Renoirs mit einer noch tiefer malerischen Seele. Meist trifft er das Typische, das tiefste Symbol. Dabei eine unglaubliche Vielseitigkeit seiner Visionen. Dann in der Ausstellung der Pastellistes français. Überraschend, wie hoch hier das Durchschnittsniveau ist. In der Maison Bing. So bewundernswert und reich die modernen Dessins und Gefäße sind, so unabhängig und neu im Stil, so unvollkommen sind noch die Möbel. überall eine gewisse steife dünnbeinige Eckigkeit, die bald an Louis XVI, bald an Japan und bald einfach an Gartenmöbel erinnert. Sehr geeignet für Gartensäle, Vorräume, aber im Salon zu kalt und unbehaglich.
Ich habe nun mit Ausnahme einiger Kunsthandlungen, die ich noch morgen besuchen will, alles gesehen, was ich hier in Paris auf dem Programm habe. Auch habe ich meine bis jetzt eingetroffenen Empfehlungen alle abgegeben. Angefangene literarische Arbeiten liegen keine mehr da. Ich bin nun also endlich soweit, wohin ich mich lange wünschte. Ich kann mich nun eine Zeitlang dem Zufall in die Arme werfen, und wie bedarf ich dessen! – Ich fühle mich abgestoßen von der eigenen analysierenden und registrierenden Art, wie ich oft zwischen den Dingen umhergehe. Aber ich habe nun meine Angst, etwas zu versäumen, doch wohl beruhigt, indem ich alles das gesehen habe, was man aufsuchen kann. Was noch übrig bleibt, und das ist wohl das Beste, ja das Einzige, kann nur der Zufall bringen. Ich werde nun eine Zeitlang ganz planlos leben, nichts nachlaufen, aber alles an mich herankommen lassen, dadurch mehr mit mir allein sein. Denn so oft ich in den letzten Monaten allein war – ich war es fast immer – so ausgefüllt war ich von Gedanken, die stets meine Hirntätigkeit überwach hielten, so daß ich nicht dazu kam, den wesentlichen Stimmen zu lauschen, die erst dann aus den Abgründen heraufflüstern, wenn der Intellekt nicht zu ausgefüllt ist. Auf die Anregungen der Außenwelt kann ich zwar nicht verzichten, aber es ist ein Anderes, diesen Anregungen nachzulaufen, alles gesehen haben wollen, oder sich ihnen hinzugeben. Hoffentlich wird mir diese Art des Lebens gelingen.
Ich komme immer mehr zu der Überzeugung, wie verfehlt ich bis jetzt gelebt habe, wie ich immer mit dem Verstand genossen habe, ja oft in meinen Dichtungen der Verstand noch zu viel mitspricht. Eigentlich sollte ich sie verbrennen darum, aber die Eitelkeit, die ich auch noch nicht überwunden habe! Ich muß nun ganz anders leben, weniger sehen, weniger lesen, weniger denken, weniger arbeiten, mehr lauschen. Die Entwickelung aus meinem Zustand heraus, nämlich dem Denkzustand, zur Mystik versuchen, von der ich so genau weiß, was sie ist und von der ich so unglaublich weit bin.
Gutmann schreibt aus Florenz, daß er sich von den Münchener Verstandesorgien dort befreie und ein reines Gefühls- und Phantasieleben zwischen Kunst und Natur führe.
Mittwoch, den 14. April.
Der Verkehr mit den Frauen hält unseren Idealismus wach. Nicht, weil die Frauen so ideale Wesen wären, sondern weil es ideal ist, etwas um seiner selbst willen zu begehren, und wäre es auch an sich nicht wertvoll.
Meine Liebe zur Nacht nimmt ab. Ich möchte mir angewöhnen, früh aufzustehen, den ganzen Tag draußen zu sein, Menschen und Dinge zu sehen und nur in regnerischen oder dunkeln Stunden zu lesen oder zu schreiben, die Abende möglichst abzukürzen.
Ein Brief von Richard, der mich aufrichtig freut. Er schreibt von einer Liaison, die er mit einer Erzieherin in Frankfurt angefangen hat. Dieses Erlebnis wird gewiß dazu beitragen, daß er sein entstelltes Gesicht weniger unglücklich empfindet. Er will nun Maler werden und teilt es mir in so verständig klarer Weise mit, daß ich ihm nicht widersprechen kann. Ferner ein Brief von Gutmann aus Florenz, der dort so lebt, wie ich hier leben möchte, vom Zufall geleitet und glücklich. Wie mich sein Brief wieder mit dem alten Heimweh nach Italien erfüllt. Hier in Paris werde ich doch immer fremd bleiben. Man ist hier viel mehr auf die Menschen angewiesen und beurteilt sie daher strenger, als in Italien, wo einem Natur und Kunst viel mehr erlauben, sich von ihnen zurückzuziehen.
Böcklins Söhne sollen zum Teil verrückt sein, einer dagegen ist Zahnarzt. Das hat mir fast einen noch traurigeren Eindruck gemacht.
Stefan George und Paul Gérardy sind seit einigen Tagen hier auf der Durchreise. Gérardy ist doch ein ausgesprochener Literat. Er beobachtet einzelnes Treffliche, hat gute Einfälle, aber welche Kälte! Er wundert sich, daß ich allein einen Ausflug aufs Land unternehme. Ich war sehr viel mit ihm zusammen, gehe ihm aber nun etwas aus dem Weg, da er mich ermüdet. Er bringt die Hälfte seines Lebens im Caféhause zu. Stefan George ist dagegen wundervoll. Er lebt meist allein und kommt nur bisweilen zum Besuch in die großen Städte. Er sprach von der Veränderung des Wohnsitzes und meint, daß wir Deutsche uns doch draußen immer fremd fühlen müßten. Wir können viel lernen in Paris, aber wir brauchen die Landschaft, in der wir groß geworden sind. Ja, unsere Naturen haben nötig, einen heftigen Winter durchzumachen, und nur ausnahmsweise dürfen wir nach dem Süden flüchten. Gerade jetzt, wo sich in Deutschland ein Umschwung vorbereite, dürfe man nicht flüchten. Er spricht sehr ungehalten über Wien. Es sei dort eine Art Miß-Kultur, die nicht aus dem Weg zu schaffen und darum aller wahren Kultur feindlich sei. Ein wirkliches Talent selbst müsse daran zu Grunde gehen, und bald würden wir dieses traurige Schauspiel an Hofmannsthal erleben. Merkwürdig finde ich seine Einseitigkeit, die Peter Altenberg alles Talent abspricht. Auch Waclaw Lieder habe ich kennen gelernt, einen polnischen Edelmann, der hier in Paris lebt. Seine Verse haben einen tiefen biblischen Zug. Er selbst erinnert etwas an einen alten jüdischen orientalistischen Sprachgelehrten.
Gestern Reception bei Madame und Monsieur Vallette, Redakteur des Mercure de France. Frau Vallette, die unter dem Namen Rachilde schreibt, eine fast vierzigjährige Frau von schöner Körperlinie, großer Lebhaftigkeit und geistreichelnder Pose. Sie hat mir ihr Buch »Les Hors-Nature« dediziert. Ferner war eine sehr lebhafte Blondine da, welche alle Welt Fanny nannte, Schauspielerin. Sehr oberflächlich und amüsant, früher Modell, Maitresse des Journalredakteurs. Außerdem war Lord Douglas da, der berühmte Freund des englischen Dichters Oscar Wilde. Douglas scheint im Äußeren nicht über die Banalität des jungen Engländers hinauszugehen, schlank, blond, bartlos, mädchenhafte Züge, kleiner fragender Mund. Doch hat seine Stimme einen traurig verschleierten Ton. Ich fragte ihn über das englische Leben und meinte: »La vie anglaise est bien triste n'est-ce pas?« Er antwortete ohne Pose: »La vie est triste partout.« Seine Gedichte, die die Schönheit des Südens, der Antike, der griechischen Liebe besingen, sind nicht ohne Talent.
Samstag, den 17. April.
Man versucht jetzt hier, gegen das Tragen von Hüten der Damen im Theater vorzugehen. Aber der Feldzug wird mit einer Niederlage enden. In allen anderen Ländern ist es selbstverständlich, daß eine Frau nicht das Recht hat, durch den Hut oder die Frisur die Zuschauer zu stören. Hier hat man eine Enquete veranstaltet. Eine der ersten Kokotten antwortete ungefähr so: C'est si rarement que je vais au parterre, et si j'y suis allée, on ne s'est jamais plaint de mon voisinage. Viele Frauen stehen hier auf dem Standpunkt, daß man nur faute de mieux auf die Bühne blickt, wenn man keine pikante Nachbarschaft hat.
Weidenbusch sagte neulich zu mir: Ich könnte nie in mittelmäßigen Verhältnissen leben, wie Sie, entweder reich oder ganz arm. In Ihren Verhältnissen würde ich mein Vermögen durchbringen, um einmal alles zu genießen, und dann als Bohémien weiter zu leben.
Wie sich bei Stefan George doch die Pose verloren hat. Es scheint, daß wir alle einmal pour épater le bourgeois eine Zeitlang posieren, allmählich aber werden wir immer einfacher.
Gestern war mein Geburtstag, zugleich Charfreitag. Den Nachmittag war ich in einem Kirchenkonzert, am Abend mit Blanche zusammen, deren einfache Anspruchslosigkeit und Diskretion in allem, was sie spricht und tut, wirklich vorteilhaft von allem absticht, was ich sonst in Paris sehe. Ich verbrachte den Tag zu meinem Staunen ohne jede Sentimentalität. Am Tage vorher war der Dämon da, d. h. ich rief ihn absichtlich, um mit meinem Geburtstag einen neuen Abschnitt zu beginnen. Von Tilly ein Geburtstagsbrief, in dem sie mir schreibt, daß sie die Verlobung mit Alewyn nicht auflöst und bald zu heiraten gedenkt. Sie macht meinen Einfluß für ihre früheren Dummheiten verantwortlich.
Soeben erfahre ich durch Gérardy, daß Richard Perls in Paris ist, und zwar in einem Zustand völliger Hinfälligkeit. Obwohl wir eigentlich wenig zusammen passen, habe ich immer eine gewisse Neigung zu ihm gehabt, und es ergreift mich eine unendliche Lust ihm in seinem Zustand zu helfen. Er ist ein Mensch von ungewöhnlicher Verfeinerung und Begabung, aber es ist, als ob sich alles bis zur völligen Auflösung in ihm spaltet. Keine Spur von Kraft mehr in ihm. Seine Gedichte sind von großer Zartheit. Er ist erst 24 Jahre und völlig dem Morphium verfallen.
Ostermontag, den 19. April.
Am Samstag Abend Diner mit George, Gérardy, Lieder, Klein und Perls, letzterer in wahrhaft schrecklichem Zustand, kann kaum gehen, macht alle Viertelstunde eine Morphiumeinspritzung. Seine alte Pose hat er jedoch beibehalten.
Gestern Brief von Gutmann aus Florenz. Er schickt ein Gedicht, das wieder recht schwach ist, zu viele geprägte Ausdrücke. Wir planen ein Zusammentreffen im Sommer. Brief von Richard, der ganz in seiner Liebe aufgeht und dadurch einen Eindruck der Reife macht, die ich bei ihm nicht kannte.
Gestern allein Ausflug nach Sceaux, von da zu Fuß nach Versailles. Eine entzückende Gegend, besonders die lachenden Dörfer mit ihren blühenden Kastanien und Flieder. Unterwegs fielen mir zwei Gedichte ein an Blanche: »Ich liebe dich wie eine weiße Blume« und »Das lichte Birkengrün an Sonnentagen«. Um die Dämmerung in Versailles. Ich betrat den Park, das Abendrot lag auf den Gewässern wie glühendes Kupfer. In der Dämmerung schienen die regelmäßig geschnittenen Taxushecken von seltsamer Phantastik.
Heute jour du Vernissage in den Champs-Elysées. Ich habe nie so viel Schlechtes beisammen gesehen. Doch wunderbar das Leben, das sich dort entfaltet und die schönsten und bestgekleideten Frauen von Paris zusammenruft. Ich traf die Löwensteins und Straßburgers und begrüßte sie natürlich deutsch, worauf sie mich ziemlich kühl behandelten. Als ich sie zum zweiten Mal sah, fingen sie gleich französisch zu sprechen an, und als sie merkten, daß ich die Sprache beherrsche, waren sie von größter Liebenswürdigkeit. Dabei waren wir alle Deutsche ohne Ausnahme.
Dienstag, den 20. April.
Heute Empfang bei Madame Rachilde. In dieser Woche habe ich ihr Buch gelesen »Les Hors-Nature«. Von ganz erstaunlicher Beobachtung, wenn auch zu breit und fast ohne eigentliche dichterische Qualitäten. Sie selbst erschien mir heute weit liebenswürdiger. In diesen Kreisen ist man theoretisch von der Oberflächlichkeit, die in Paris herrscht, und die mich so abstößt, überzeugt, und ich war es, der diesen französischen Schriftstellern gegenüber sogar die französische Kultur in Schutz nahm. Trotzdem aber bestand auch hier die Unterhaltung fast nur aus Literaturklatsch.
Donnerstag, den 22. April.
Ich finde in Sainte-Beuve's Volupté eine Stelle, die mich grausam an mich selbst erinnert. Auch er kennt diese Daten, bis zu welchen er den Dämon noch empfangen will, von welchen ab nicht mehr.
Freitag, den 23. April.
Gestern und die letzten Tage graubedeckter Himmel, dazu das Hellgrün der Kastanienbäume, die schon in Blüte stehen und die braunen, erst halb erblühten Fliederstauden in den Champs-Elysées. Zwischen diesen Farben scheint eine bläuliche Atmosphäre zu liegen. Gestern Nachmittag in den Champs-Elysées. Ich las dort Edgar Poe's Novelle »La chute de la maison Usher«, das Beste, was ich von ihm kenne.
Samstag, den 24. April.
Interessant ist, zu beobachten, wie Fried mit den Frauen steht. Er hat nie etwas besonderes erlebt, scheint sogar im Allgemeinen Unglück zu haben, was ihn aber wenig rührt. Hier in Paris ist er völlig verwandelt. Er spricht kaum ein Wort französisch, behandelt die Mädchen, d. h. die Kokotten grob, benimmt sich kindisch, wie ein Affe, und hat in einem fort Frauen, die sich ihm ohne Entgelt hingeben, während sie sonst von Berufswegen ein Geschäft daraus machen. Er meint, das würde noch viel besser, wenn er erst die Sprache kann. Ich glaube das Gegenteil. Im Augenblick, wo er zivilisiert sein wird, hört das auf. Die Mädchen halten ihn für einen Halbwilden, vor dem sie sich nicht genieren. Er rechnet garnicht als Monsieur oder als Miché; sie sind zu ihm so wie eine Weltdame einem hübschen Bauernburschen gegenüber sein könnte. Wie falsch wäre es, nun zu schließen: wenn der Bauer aber erst elegant gekleidet wäre, wie groß würden dann erst seine Chancen sein! Etwas ähnliches in der Geschichte von dem goldenen Esel bei Apulejus, als der Junius die Liebe der Witwe erringt. Gestern sah ich einen dicken braunen Menschen, der wie ein in Amerika heraufgekommener Pflanzer aussah. Er trug die merkwürdigsten Dinge, zum Beispiel Manschetten, die von schwarzen, dicken Linien karriert waren. Aber das alles paßte so völlig zu ihm, so wie das Haus zur Schnecke sich aus Stilinstinkt selbst bildet.
Ich bin mir ganz klar darüber: das Einzige, was mich immer wieder an die Großstadt fesselt, ist die Frau. Ohne dies Bedürfnis würde ich längst in der Einsamkeit auf dem Lande leben.
Eigentlich sind alle Typen unangenehm, der Deutsche so gut, wie der Franzose, der Großstädter, wie der Kleinstädter, der Fromme, wie der Gotteslästerer. Ganz falsch wäre nun, zu schließen, der Mittelweg wäre das Beste. Er ist das allerwiderlichste. Vielmehr ist nur das Individuum wertvoll, welches aus dem Typus heraustritt.
Fried legt einen ungeheuren Wert auf das Geld, wahrscheinlich, weil er es nicht hat. Darum ist eigentlich kein Gespräch mit ihm möglich, weil das immer bei ihm das A und O von allem ist.
Montag, den 26. April.
Gestern und heute bin ich auf das Land gegangen. Diese lachende Natur um Paris zieht mich sehr an. Es sind sanfte Linien, aber nicht so nachdenklich, wie in meiner Heimat. C'est joyeux, riant. Auch keine Größe. Sanfte Hügel, hellgrüne Buchenwälder, Kastanienhaine, Landhäuser und saubere Dörfer, die schon fast Landstädtchen sind. Dazwischen die langsam fließende gewundene Seine. Hier konnten die maîtres galants des 18. Jahrhunderts, aber auch Corot reifen, und die zarten französischen Chansons, die sentimental sind, ohne vulgär zu sein. Ich glaube, in Ville-d'Avray eine Sommerfrische gefunden zu haben. Heute war der erste wahre Frühlingstag. Erst ein Gewitter, dann ist lauer Regen gefallen. Bisher war die längst schon aufgeblühte Landschaft ohne jene berauschenden Düfte des Frühlings. Heute sind sie gekommen, und mit ihnen tausend Erinnerungen, nicht etwa an andere Frühlinge nur, überhaupt an mein früheres Leben. Als ob man im Winter nicht auch lebte! Diese Düfte riefen mir meine Kindheit zurück, Frankfurt, meine Eltern. Die Goethe'schen Gedichte, die ich bei mir hatte, verstärkten nur diese Stimmung. Unterwegs entstanden die Verse: »Duftlos war das Laub gesprossen ...«
Früher interessierten mich auf Reisen besonders die Menschen, und ich gewann eine gewisse Routine, Bekanntschaften zu machen. Heute das Gegenteil. Selbst wenn mir jemand interessant erscheint, weiche ich ihm oft aus, weil ich meine Einsamkeit nicht stören will. Fried möchte gern meine Landausflüge mitmachen. Aber ich kann mich nicht dazu entschließen, nicht einmal ein Mädchen mitzunehmen. Früher konnte ich nicht einsam sein. Darum genieße ich auch jetzt zum ersten Mal wahrhaft die Natur. Welcher tiefe Genuß, als ich heute aus der Manufacture de Sèvres in den Park hinaustrat. Der Regen war vorbei, und alles in feuchtem Hauch, der über den Wiesen eine dünne, durchsichtige, zarte, bläuliche Schicht bildete. In diesem Augenblick war es Frühling geworden.
Man sollte die Kinder nicht zum Gehorchen, sondern zum Befehlen erziehen, was heute fast nur die Adligen können. Ich vermeide es, mit Untergebenen viel zu reden, da ich mich im Befehlen nicht immer sicher fühle, andererseits aber auch weder grob sein noch brüllen will, denn das wäre ja das Gegenteil jenes selbstbewußten adligen Befehlens, das nicht verletzt, weil es dem so Befehlenden durchaus ansteht. Es ist selbstverständlich, daß ein solcher herrscht, und der Sklave findet es natürlich.
Donnerstag, den 29. April.
Es gibt Menschen, denen die Beschaffung dessen, was zur Befriedigung der täglichen Bedürfnisse dient, wie Wohnungssuchen, Berechnung des Etats u.s.w. an sich ein solches Vergnügen macht, daß dadurch ihre ganze freie Zeit ausgefüllt wird. Das sind die glücklichsten Menschen. Zum Beispiel mein Schwager Otto, der mit innigstem Behagen schon jetzt berechnet, was er mit der nächsten Gehaltszulage anfangen wird. Es ist wohl dasselbe, was man den echten Bürgersinn nennt.
Es ist nun völlig Frühling seit mehreren Tagen, und mein Bedürfnis nach einem geliebten Wesen wird bisweilen qualvoll. Paris war meine letzte Verstandesneugier. Ich werde mich nun ungestört einem Gefühl hingeben ohne Egoismus. Ich entsinne mich manchmal einer kanadischen Dame, Mademoiselle Burassa, die ich flüchtig in München kannte. Sie ist sehr geistig und muß ihrem Äußeren nach auch körperlich einst meinen Gefühlen entsprochen haben, doch nun altert sie bereits. An Gutmann hat sie geschrieben, sie fühle sich mit mir »un peu de la même race«. Wir haben immer nur die gleichgiltigsten Dinge gesprochen, da wir nur in größerer Gesellschaft zusammen waren. Es war also ein geistiges Erraten. Gestern schrieb ich ihr mit der Bitte, bisweilen etwas von ihr zu hören.
In einem Journal fand ich unter dem, was man hier Heiratsannoncen nennt, einige Zeilen, die mich interessierten, sie waren, wie an mich gerichtet.
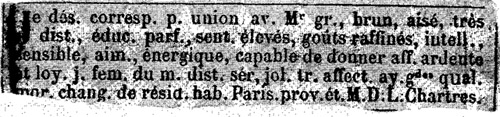
Es hat sich daraus eine Korrespondenz entwickelt, die viel verspricht. Auf Samstag bin ich nach Chartres eingeladen. Vorläufig habe ich die Empfindung, daß sie ein aufrichtiges, feingebildetes Wesen ist. Das Einzige, was abzuwarten steht, ist, ob wir uns äußerlich gegenseitig anziehen. Geistig scheint alles zu stimmen. Ihre Briefe geben mir die froheste Hoffnung. Ich denke an nichts anderes, während ich in den frühlingsgrünen Straßen umhergehe.
Wollte man mir in meinen Nöten, da ich die Wertlosigkeit des Verstandes einsehe, das Christentum empfehlen, so hieße das nur, mich zurückkehren heißen, um auf einem anderen Weg dasselbe Ziel zu erstreben. Auch das Christentum könnte für mich nur ein Weg sein. Es ist eine der mehreren Vorhallen, die zum Tempel der mystischen Erkenntnis führen. Ich befinde mich in einer anderen Vorhalle, in der des Lebens. Aber ich sehe den Tempel bereits im Lichte glänzen. Ich muß mit der Zeit hingelangen, auch auf meinem Weg, der mir gemäßer ist, als das Christentum. Der Weg geht steil bergan, und ehe ich wieder ein Plateau erreicht habe, wie im vorigen Jahre in Frankfurt, werde ich wohl nicht die Ruhe zur Arbeit finden. Ich muß noch ein Stück weiter leben vorher. Im vorigen Jahr erreichte ich dieses Plateau, als ich die symbolische Bedeutung der Kunst erfaßt hatte, überhaupt den Begriff Symbol.
Wenn sich meine Hoffnungen mit der Dame in Chartres verwirklichen, werde ich sofort Paris verlassen und irgendwo in der Umgegend dieser Frau und der Natur leben, bis sich wieder die Lust zum künstlerischen Schaffen einstellt, d. h. zum Ausruhen vom Leben.
Ich lese Bourget »Physiologie de l'amour moderne«. Trefflich ist die Unterscheidung des »véritable amant«, der weiß, warum er ein bestimmtes Weib liebt und geliebt wird (und dieses Weib weiß es auch), und dem Amant temporaire (dem homme gentil), der immer nette Geliebte hat, aber immer zufällig, weil er hübsch, liebenswürdig, amüsant ist, ohne die Frauen zu kennen, und dem Exclus. Was bin ich? Jedenfalls nicht der homme gentil, sondern bald véritable amant, bald Exclus. Von Temperament das erste, durch den Intellekt aber häufig in die Rolle des letzteren geschoben.
Freitag, den 30. April.
Gestern Richter getroffen. Was ich voraussah, ist gekommen. Er konnte nicht ohne seine kleine Emmy leben, nun ist sie in Paris.
Fried's ewiges Jammern über materielle Nöte, das ewige Reden vom Geld ist mir doch unangenehm. Dabei geht es ihm garnicht so schlecht. Vor allem hat er schon mit 24 Jahren einen Verleger, der ihm Vorschuß gibt und bei Ablieferung der Partitur Mk. 10000.– bar.
Gestern mit Albert, Münch und Fried bei Bullier. Es wurde eine deutsche Literaturgröße herumgeführt, Willy Pastor. Ein stupider schwerfälliger Mensch, der allerlei Dummheiten aussprach. George sei phantasiearm und künstlerisch gering. Claude Monet fabriziere Konditorware. Berlin sei darum eine so künstlerische Stadt geworden, weil dort technisch so viel gearbeitet würde. Er ziehe die Goethesche Iphigenie in Prosa der Versbearbeitung vor.
Sonntag, den 2. Mai.
Gestern abend mit Richter und seiner kleinen Emmy zusammen. Interessant dieses einfache unbedeutende Mädchen im Quartier Latin, wo sie vor dem Kokottenwirrwarr einen direkt physischen Abscheu empfand.
Mit Fried werde ich doch die Intimität aufgeben. Er ist ein unnobler Mensch. Er gibt es ruhig zu, keinen Stolz zu besitzen und führt als Entschuldigung an, daß die widrigen Verhältnisse alles Ehrgefühl in ihm getötet hätten. Ich gestehe jedem das Recht zu, wenn er Hunger und kein Geld hat, auch oberflächliche Bekannte um eine Mahlzeit zu bitten, nicht aber, was Fried tut, der einer Dame, bei der er verkehrt, nahe legte, ihm einen neuen Hut zu kaufen, den er auch annahm. Dabei hat er im letzten Monat ungefähr 250 Frs. ausgegeben. Er spricht immer von Geld.
Der Ausflug nach Chartres verschoben. Ich treffe Mary morgen in Versailles.
Dienstag, den 4. Mai.
Also gestern in Versailles Mary getroffen. Auf den ersten Blick war mir klar, daß sie nicht die Frau ist, die ich suche. Ihr Gesicht hat wenig ausgeprägte Züge, aber auch ohne irgend einen ausgesprochen unangenehmen Zug zu haben. Sie ist groß, blond, aber dieses unangenehme farblose Blond. Entschieden älter, als 24 Jahre, wie sie angab. Vom Bahnhof nach dem Restaurant bemerkte ich bisweilen einen lieblichen Ausdruck in ihrem Gesicht, der mich wieder einen Augenblick hoffen ließ. Aber dann war ich völlig klar. Übrigens hat sie eine entfernte Ähnlichkeit mit meiner Mutter, was mich auch stört. Sie ist von ihrem Mann, einem Advokaten, getrennt. Ich glaubte, daß auch sie sofort unsere Unzusammengehörigkeit bemerkt habe und vermutete selbst, daß die Einsicht, die bei mir der Intellekt milderte, bei ihr brutaler, nämlich als direkte Antipathie zum Vorschein kommen würde. Ich schlug ihr nach dem Déjeuner einen Spaziergang durch den Park vor und sagte ihr einfach, daß ich ihre Gefühle errate. Ich hatte mich indessen getäuscht, sie hatte für mich Sympathie gefaßt. Eine furchtbar peinliche Lage, und ich dachte an die Lehre, die ich im Sommer 1895 aus meiner Beziehung mit jener Malerin Marie St. gezogen habe, die mir nur sympathisch war, mich aber liebte und dadurch in ein intimes Verhältnis verwickelte, das für mich qualvoll wurde. Jenes Verhältnis endigte damals mit einer schrecklichen Nacht in einem Hotel in Sternberg, wo ich sogar bei körperlicher Bereitschaft einen psychischen Ekel gegen diese Frau faßte. Dies zu wiederholen empfinde ich natürlich keine Lust. Es gab eine sehr peinliche Stunde. Mary war offenbar sehr enttäuscht und behauptete, mich nicht zu verstehen. Es tat mir fast wohl, als sie schließlich sagte, daß ich ihr durch mein Raisonnement nun antipathisch geworden wäre. Leider durchschaute ich jedoch, daß eher das Gegenteil der Fall war. Ich hatte direkt Mitleid mit ihr und fand die Lage fürchterlich. Sie ist am Abend nach Chartres gereist, wo sie, wie sie sagt, allein, ohne Bekannte lebt. Ich glaubte, daß diese Enttäuschung auch mich mehr angreifen würde, da ich die ganze letzte Woche in großer Erregung war und meine ganzen Lebenspläne umgeformt hatte. Aber so sehr ich mich vor einem Erlebnis aufregen kann, so leicht tröste ich mich, wenn die Hoffnung zunichte wird. Am Abend traf ich auf dem Boulevard eine kleine Freundin, mit der ich schon früher einmal zusammengewesen war und die in der Nacht das fabelhafte Wort dort ausrief »Ah que c'est beau la nature«.
Brief von Gutmann aus Rom, der dort nachts im Weinrausch zwischen den fließenden Springbrunnen durch die Gassen zieht.
Freitag, den 7. Mai.
Gestern zufällig die Bekanntschaft der Witwe Herwegh's gemacht. Sie wohnt in demselben Hotel, wie ich. Eine achtzigjährige noch sehr rüstige kleine Frau mit sehr scharfen Zügen. Sie hat etwas Hexenhaftes dem Anschein nach, was sich aber bei ihrer äußerst liebenswürdigen Konversation verliert. Sie bewohnt ein einsames Hotelzimmer, sehr altmodisch, dunkelbraun mit weißen Lambris, voll von altmodischen Bildern Herweghs, darunter ein lebensgroßes Ölbild in der Ary Scheffer-Manier. Durch sie wurde ich in ein reizendes französisches Interieur der Mme Vivier und Tochter eingeführt. Sehr gebildete Damen, die mir bei der Abfassung meiner französischen Broschüre über die deutsche Kultur stilistisch an die Hand gehen wollen. Gestern Abend zum Tee bei ihnen. Die Tochter, ca. 40 Jahre, etwas gelehrt, und die Mutter ihr gegenüber wie einem Manne, den sie bewundert. Sie gibt zu, keine eigenen Ideen zu haben, aber in Gegenwart ihrer Tochter die Ideen dieser öfters zu wecken. Trotzdem ist etwas ganz deutsches in diesem Interieur. Außerdem ein robuster Junge, noch sehr Kind, doch schon Leutnant bei der Handelsmarine, ferner eine junge hübsche Tochter, sehr germanischer Typus. Der Großvater war Deutscher. Die Tochter lebte meist in Schottland und hat sich auch einige englische Formen angewöhnt. Dieses große blonde Mädchen mit dem gesunden, aber nicht unangenehmen gesunden Äußeren hat mir zu meinem Erstaunen sehr gut gefallen, da mich früher eigentlich sonst das Mädchenhafte kalt gelassen hat. Während meine Neugier der Frau gegenüber schwindet, kommt wohl mein eigentlicher natürlicher Geschmack heraus, der viel mehr, als zu der schwarzen sogenannten interessanten Frau für die blonde, gesunde Frau inkliniert. Ich empfinde geradezu einen Umschwung in meiner erotischen Neigung, und ich halte ihn für gesund, da ich jetzt nicht mehr das mir ähnliche, raffinierte, sondern das mich ergänzende und mir wohltuende Unkomplizierte bei der Frau will. Ich kann, wie schon in München, meinen augenblicklichen Zustand wiederum nur einer zweiten Pubertät vergleichen.
Hier hat in mancher Beziehung der Begriff pariserisch den Begriff menschlich ersetzt. Ein Drama, sagt man, hat viele Vorzüge, besonders aber ist es très parisien; oder »Sie können diesen Roman nicht beurteilen, dazu muß man Pariser sein, c'est tout ce qu'il y a de plus parisien«.
Mittwoch, den 12. Mai.
Ich komme immer mehr dazu, zu glauben, daß, um sich ganz rein an Charakter zu erhalten, ohne sich zu prostituieren, um ohne jene erniedrigende Überschätzung der materiellen Güter zu bleiben, eine gewisse Vermögenshöhe, wenn nicht erforderlich, so doch sehr förderlich ist. Ich denke dabei an Fried. Auch an Überschätzung des Geldes, die ich oft selbst aus dem Munde aufrichtiger Bohemiens gehört habe.
Die französische Kultur ist so tief in die Begriffe und Anschauungen des Volkes eingedrungen, daß ganz gut eine Zeitlang diese Kultur fortbestehen könnte, ohne daß wirklich bedeutende produktive Talente da wären. Heute ist es vielleicht so. Es ist, als wenn in einem Land der König gestorben wäre, der eine ungeheure Suggestion auf das Volk hatte. Aber den Ministern gelingt es Jahre hindurch, diesen Tod zu verheimlichen, und das Volk lebt weiter unter dem Geiste seines Königs, der längst tot ist.
Ich habe nun selbst einmal eine Annonce im Journal veröffentlicht: Jeune homme du monde, littérateur, grand, brun, cherche connaissance d'une jeune jolie femme, affectueuse, bien élevée, pour union sérieuse. Ich habe 22 Antworten erhalten, die ich alle beantwortet habe, außer 2. Ich habe also diese Woche ca. 20 Rendezvous.
Das Berliner Philharmonische Orchester unter Arthur Nikisch's Leitung ist hier und spielt unter begeistertem Applaus des Publikums. Fried, der früher dazu gehörte, führt nun seine früheren Kollegen in der Stadt herum. Es war sehr interessant, diese Typen zu beobachten. Alles treffliche Musiker, die nur durch ihr Können in dies Orchester gekommen sind. Wie sie hinter den Frauen her sind! Dabei sind sie nicht mehr jung und verheiratet. Das Leben der Fremden in Paris ist meist »une continuelle débauche«. In einem Bordell letzten Ranges waren diese Männer entzückt, teilweise aber auch moralisch entrüstet. Dabei haben sie eine Niedrigkeit des Ausdrucks, die mich erstaunt. Äußerlich unterscheiden sie sich garnicht vom gewöhnlichen Bourgeois, nur sind sie gutmütiger. Unter ihnen ein jüngerer Mensch, Lebemann geringer Sorte, ewig geschlechtskrank und dabei von einer Rohheit des Geschmacks und Mangel an jeder Verfeinerung im Genuß, wie ich sie noch nie gefunden habe. Ein anderer ist Millionär, nur zum Vergnügen mitgekommen. Cotelettebart, glatt rasiertes Kinn, immer den photographischen Apparat in der Hand. Er ist der unangenehmste von allen. Als Führer diente ihnen ein junger Deutscher, der seit 2 Jahren in Paris ist, der richtige Typus des Fremden, der den Pariser spielt, dabei nicht einmal gut französisch spricht: klein, dünn, blond, Spitzbart, langer Gehrock, Sammtkragen, großer Cylinder, trockenes, meckerndes Organ, ewig blaguierend, renommierend. Und dabei ohne jeden Humor oder Wärme.
Heute im Quartier mit einem französischen Dichter zusammen, Jean Dayros. 30 Jahre alt, über die Illusionen hinaus, lebt einfach im Quartier, veröffentlicht ironische Verse, scherzt mit Kokotten, redet von der Zeit, als er noch die Abenteuer liebte. Jetzt hat er, wie er erzählt, folgendes System: er empfindet von Zeit zu Zeit das Bedürfnis »de s'encanailler«, d. h. er betrinkt sich mit einer möglichst gemeinen Dirne und schickt sie dann fort, ohne sie körperlich berührt zu haben. Seine physischen Bedürfnisse befriedigt er in einer gut eingerichteten Maison de passe. Er redet mit halb ironischem Ernst über dieses System, wie über eine zu patentierende Erfindung. Bisweilen berauscht er sich an Haschisch und an feinen Parfüms. Dabei hat er gesunde Meinungen über die Welt ohne alle Verbitterung, wenigstens scheint es so. Er ist immer gut gelaunt und sehr höflich. Klein, blonder Vollbart, ziemlich kräftige Gestalt.
Brief von Richard. Er ist fest entschlossen, das Mädchen, womöglich gleich, zu heiraten. So sehr ich diese Liebe an sich begünstige, so sehr setze ich mich vorläufig einer Heirat entgegen, obwohl ich bei seiner spätreifen, aber entschlossenen Art wohl an die Dauer seiner Gefühle glauben möchte. Die Novelle seiner Braut ist freilich völlig nachempfunden, Lesefrüchte. Aber sie verrät eine vortreffliche Natur und auch ein feines Empfinden.
Freitag, den 14. Mai.
Nun beginnt hoffentlich eine neue Zeit für mich. Ich habe eine Frau kennen gelernt, die hoffentlich die gesuchte ist, und der ich mich ganz hinzugeben imstande bin. Zwar bin ich nicht von dem sogenannten »heiligen Götterstrahl« getroffen, dazu müßte ich vielleicht unerfahrener und unenttäuschter sein. Sollte meine Hoffnung zunichte werden, so fühle ich, ich würde es jetzt noch verschmerzen können. Aber ich glaube, daß mir diese Frau in kurzer Zeit das Teuerste werden kann, was ich besitze. Äußerlich schien mir Marie Louise Conty anfangs zu hübsch, um mich nicht mißtrauisch zu machen, denn ich suche nicht die ausgesprochen schönen Frauen. Sie schien mir zu pariserisch. Als ich ihr das erste Mal bei Tisch in einem Restaurant gegenübersaß, sah ich, wie sich ihre Züge oft eigentümlich belebten. Sie erzählte mir, wie sie dies Paris haßt, in welchem ihr alles falsch erscheint. Erstaunlich bei einer schönen jungen Frau, die doch alles besitzt, um hier eine Rolle zu spielen. Daß sie bei so viel Schönheit, Anmut der Unterhaltung, verfeinerter Bildung und trotz ihres Verkehrs in dem literarischen Zentrum des jungen Paris so einfach und echt geblieben ist, läßt mich glauben, daß sie der Mittelpunkt aller meiner so vielfältigen Wünsche werden kann, daß sie mir die ersehnte Einheit geben wird. Ihre Gefühle mir gegenüber errate ich nicht. Zwar hat sie mehrmals im Tone, in der Bewegung eine gewisse Weichheit geäußert, die die Frauen nur einem ihnen sympathischen Manne zeigen. Sie ist vorläufig mißtrauisch gegen meine Jugend. Sie ist ein Jahr älter als ich und glaubt mich nicht ernst genug. Sie hält es für erstaunlich, daß man nach 3 Monaten schon so kühl geworden sein kann gegen die vielgepriesenen Pariser Reize. Sie meint, mit 24 Jahren müßte man noch noceur sein.
Gestern fiel mir ein merkwürdiger Augenblick meines früheren Lebens ein: Berliner Winter 1893/94. Ein nebliger Spätnachmittag auf der Spreebrücke, dunkle Silhouetten der Häuser, Zeit des Lichtanzündens. Ich war in der Periode meiner ersten ganz unglücklichen literarischen Versuche unter Löwenherz's verkehrten Prinzipien stehend, von keinem anerkannt, abgestoßen von dem althergebrachten bürgerlichen Leben, mit dem ich gebrochen, ohne irgend einen neuen Boden zu fühlen. Die Kunst schien das einzige, doch wußte ich nicht das mindeste über mein Talent. Ich ging ganz entmutigt über die Spreebrücke. Da empfand ich plötzlich diese Großstadtlandschaft so tief, daß ich in dem Augenblick fühlte, ich sei ein Dichter. Ich wußte es in diesem Augenblick ganz bestimmt, und die Erinnerung daran hat mich oft gekräftigt. Ich erzählte Löwenherz davon, aber weder er, noch ich selbst wußten damals, daß dies ein wichtiger Augenblick in meinem Leben war. Ich begreife heute nicht, wie ich damals diesen Zustand ertrug, ohne mich eigentlich allzu unglücklich zu fühlen. Ebenso werde ich wohl später nicht begreifen, wie ich diese letzten Pariser Monate ertragen konnte bei dem steten Bewußtsein vollkommener Verlassenheit.
Es ist die intellektuelle Freude am Leben, die mich stets hinderte, mir selbst genug zuzuhören, die mir manche Tiefe verschloß, in der vielleicht viel Reichtum, aber auch sehr viel Trauer verborgen ist. Ich werde nun meinem Glücke besser zuhören, meinem gehofften Glück.
Ich glaube, daß ich doch Herz habe, und ich fasse es als Vorzug auf. Ich werde ganz und gar aufhören, diesen lächerlichen Skeptizismus, der meine ganze Umgebung erfüllt, mitzumachen. Die Korrespondenz mit Richard hat eine gewisse Herzlichkeit in unsere Beziehungen gebracht, die ich immer erhofft habe. Ich erwarte viel von unserem nächsten Zusammentreffen.
Es ist sonderbar: in der letzten Stunde, bevor ich Marie Louise kennen lernte, hat mich der Dämon noch einmal besucht. Sie könnte mich vielleicht auch davon heilen, ebenso wie von meiner Cerebralität.
Sonntag, den 16. Mai.
Gestern mit Marie Louise zusammen. Es quält mich der Verdacht, daß sie eine kalte Natur sei, die mehr geliebt werden, als lieben will. Wenn das wahr ist, wird sie mir nie etwas sein können. Ich bin mit Absicht selbst noch sehr zurückhaltend, um nichts zu überstürzen. Sie erzählt, daß sie sich tagsüber maßlos langweilt, sie ist mir noch rätselhaft.
Vorgestern mit Weidenbusch zusammen, der seit einigen Tagen wieder hier ist. Er suchte ein Dirnenabenteuer und brauchte meine französischen Sprachkenntnisse dazu. Wir fanden ein ganz junges blondes Geschöpf, dumm und stumpf. Sie spielt mit Puppen. Die Verbindung von Naivität und Laster ist hier wirklich interessant.
Dienstag, den 18. Mai.
Es ist ein Mensch in mein Leben getreten, den ich fast schon Freund nennen kann, der Maler Paul Hermann. Zum ersten Mal wieder jemand, der seit München mir geistig näher kommt, indem er hinter die Dinge sieht. Er ist viel älter als ich, aber dennoch haben wir uns gut verstanden und erkannt. Er sah in mir sofort den Instinktmenschen, der zulange die Intellektualität hat reden lassen. Auch er ist ein Bewußter, wie könnte ich mich sonst mit ihm verstehen? Aber er lebt in einer Atmosphäre, die er sich selbst geschaffen, die er sorgsam hütet, indem er nichts liest, niemanden empfängt, der ihn stören könnte. Wie zerfahren und zerrissen dagegen war mein Dasein in den letzten Monaten! Aber nun wird es anders werden. Auch mit Marie Louise bin ich einig geworden. Wir gehen demnächst hinaus aufs Land und dort werde ich in einem kleinen sorgsam erwählten Kreise von Menschen, Dingen, Gedanken mit ihr leben. Eigentlich weiß ich garnichts über Marie Louise. Sie ist ein stummes Rätsel, ohne Initiative, aber nicht von jener kraftlosen Passivität, die man bisweilen in Deutschland findet, dazu ist sie zu intelligent, aber sie will zu allem gezwungen werden. Gestern waren wir zusammen in Varennes; in einem Gebüsch am Marne-Ufer habe ich sie geküßt, wahrhaftig nicht ganz sicher, ob sie es dulden würde. Ich bin niemals bei einer Frau so ohne alles Verständnis ihrer Natur gewesen. Sie äußert nichts von selbst, aber unter meinen Küssen schwand der Zweifel, sie sei kalt. Ich weiß trotzdem nicht, ob sie mich liebt. Die fremde Sprache, die ich so gut zu beherrschen glaube, hindert mich in solchen Situationen doch, mich ganz zu geben. Ich könnte nicht sagen, daß ich sie in dem ganz tiefen Sinne liebe. Dazu ist sie mir fast zu fremd. Da aber garnichts Hemmendes im Wege steht, mich nichts an ihr stört, ist es möglich, daß die große Liebe daraus wird, wenn sich unsere Atmosphären ganz verbunden haben. Bei meiner vorwiegenden Cerebralität kann ich fürs erste überhaupt wohl kaum eine tiefere Empfindung verlangen, als ich sie jetzt habe.
Alle die Männer, welche ich hier kenne, teils durch den Mercure de France, bedeuten wohl eine höhere Kulturstufe, als jenes deutsche Publikum der Literaten- und Künstlerkreise. Aber sie haben alle eine Physiognomie. Sie erlebten einmal den Bruch der Tradition, Übergang in das moderne Lager, welches fertig existierte. Wie ganz anders ist unsere germanische Entwickelung, die wir, wenn wir mit der bürgerlichen Tradition brechen, keinen Boden unter den Füßen haben; Einsamkeit, Suchen, Irrtümer, Zweifel an sich selbst, vielleicht zeitweilige Rückkehr zu den alten Göttern, Reisen, Leiden, das Weib, nicht die Weiber. Das ist unser Schicksal. Das ist es, was uns so viel vielseitiger und tiefer macht. Aber der Durchschnitt ist in Paris viel, viel höher. Die Deutschen sind origineller und kantiger. Welche Mannigfaltigkeit in Menschen, wie Löwenherz, Philips, Gutmann, Wolfskehl, George, Paul Hermann, Perls, Weidenbusch und mir. Jeder ist anderer Herkunft. Jeder nahm eine andere Entwickelung und hat andere Ziele. Hier ist der Stil aller gleich. Sie stammen alle aus derselben Schicht und wollen alle »arriver«. Und einer lebt, wie der andere. Empfang in literarischen Salons, Verkehr im Caféhaus, auf den öffentlichen Bällen des Quartier Latin und Montmartre. Anderes kennen sie nicht. Gereist sind sie nicht, aber stark belesen, jedoch nur französisch. Sie sind völlig durchtränkt mit einer immerhin großen Kultur. Das Leben ist für sie zu leicht, zu amüsant. Sie haben alle zu wenig gelitten.
Donnerstag, den 20. Mai.
Wieviel schneller tritt man doch einem Manne nahe (Paul Hermann), als einer Frau (Marie Louise). Der Intellekt des Mannes erleichtert so sehr das Verständnis. Bei der Frau dagegen müssen die beiden Leben zusammenwachsen. Gestern mit Louise im Bois de Boulogne; sie ist die zarteste Frau, die ich je in meiner Nähe hatte. Sie hat sich mir versprochen, aber sie zögert noch. Sie fühlt, daß wir noch nicht genug eins sind. Anfangs machte ich ihr leise Vorwürfe, doch vorsichtig genug, um nicht mit meiner brutalen, alles verstehen und wissen wollenden Intellektualität an eine zarte Gefühlsregung zu stoßen. Dennoch quälte ich sie damit. Sie ist nicht fähig, über Gefühle zu reden, und um so schöner ist es, wenn sie sich durch eine schüchterne, kosende Gebärde ausdrückt. Ich liebe ihr stilles, rätselhaftes Wesen, denn gerade dies ist vielleicht in seiner Unübersehbarkeit geeignet, mich aus meinem jetzigen Zustand zu retten.
Gestern ein Gespräch mit Hermanns feinkultiviertem Freund Paul Contard über Mystik. Folgendes klärte sich in mir: das Tier besitzt eine abgerundetere Vollkommenheit, als der durch seinen Intellekt getrübte Mensch, sowie der mit einfachem Werkzeug arbeitende Handwerker vollkommener ist, als der, welcher eine komplizierte Maschine besitzt, sie aber noch nicht recht begreift. Hat er sie aber erst begriffen, dann ist er einer Vollkommenheit fähig, die dem anderen immer unerreichbar bleibt. Die Aufgabe des Menschen ist, den Intellekt zu über-winden. Er darf nicht unsere Animalität töten, das Höchste, das uns mit dem Ursein verbindet, vernichten, wie es die moderne Erziehung will. Er soll vielmehr das Animalische zum Bewußtsein erheben und es bändigen. Der Frau ist eine geringere Aufgabe gestellt, weil sie einen geringeren Intellekt besitzt, den sie zu verarbeiten hat. Darum löst sie ihre Aufgabe leichter, ist viel öfters harmonisch und ist dem Durchschnittsmanne, der mit seinem Intellekt nicht fertig wird, häufig überlegen, während der wirklich mit dem Intellekt die Natur bändigende Mann eine Höhe erreichen kann, die ihr nicht zugänglich ist. Darum kann auch der Durchschnittsbürger unsereinem an Klarheit überlegen sein, weil er seinen kleinen Instinkt mit seinem kleinen Intellekt leichter ins Gleichgewicht setzen kann, als wir, die wir geistig in großen Verhältnissen leben.
Sonntag, den 23. Mai.
Louise seit einigen Tagen krank. Ein ungefährliches, zeitweise schmerzhaftes Leiden. Wir sind nun ganz einig, und nur diese Krankheit hat bis jetzt ihre völlige Hingabe verhindert. Sie hat mir schon mehrere Male die Worte »Je t'aime« ins Ohr geflüstert und Vorwürfe gemacht, als ich sie neulich einmal nicht besuchte. Dann hat sie eine reizende Art, wenn ich etwas sage, das ihr gefällt, eine liebkosende Bewegung zu machen, ohne ein Wort zu verlieren. Sie spricht nicht von ihren Gefühlen und fragt nicht nach den meinigen. Wenn wir sprechen, reden wir fast nie über uns, sondern tauschen Meinungen oder erzählen Erlebnisse.
Samstag, den 29. Mai.
Ich will mir nichts vorlügen. Louise ist mir sehr sympathisch, aber ich liebe sie nicht. Ich habe dies in den letzten Tagen gemerkt, die ich in Marlotte zubrachte, in Gesellschaft von Stuart Merill und Point und deren Frauen. Diese Frauen haben mich heftig gefesselt, daß ich kaum an Louise dachte, womit ich natürlich nicht sage, daß ich mich in sie verliebt habe. Ich fühlte nur von ihnen einen Reiz ausgehen, den Louise nicht besitzt. Soeben zurückgekehrt, finde ich einen Brief von ihr voll Unruhe, daß ich gestern nicht zu ihr kam. Randbemerkung vom 4. Mai 1898, London: Welche schönen freudigen Tage in Marlotte. Auch Hermann und Contard waren dabei. Ich sehe auf sie heute wie auf eine Oase zurück in jener Zeit voll Selbstbetrug.
Die Neugier nach dem Leben ist die Eigenschaft, die uns verführt, uns Dingen und Personen zu nähern, eventuell unter ihren Einfluß zu geraten, mit denen unsere wahre Natur nichts zu schaffen hat. Ich habe dieser Neugier zu lange nachgegeben und soviel Fremdes in mich aufgenommen, daß ich oft nicht weiß, was eigen in mir und was fremd ist. Da sind diese ganz unbewußten Naturen, wie Munch, viel abgeschlossener. Hermann sagt, er sei früher in demselben Zustand gewesen, habe sich aber herausgearbeitet.
Dienstag, den 2. Juni.
Das Leben hier wird immer unerträglicher. Diese ewige Zerstreuung. Ich bedarf unendlich der Sammlung, die ich hier nicht finde. Louise wieder krank. Dadurch die letzte Intimität immer noch verzögert. Vielleicht ist es gut, daß ich sie nicht eigentlich liebe, sonst würde sie mir doch wieder nur Unruhe bringen. Sie ist so still und diskret. Sowie sie gesund ist, reisen wir ab.
Mit Weidenbusch eine wilde Auseinandersetzung. Dieser Mensch hat einen ganz unheimlichen Einfluß auf mich. Sobald er erscheint, verliere ich das Gleichgewicht, die Sicherheit. Ich vermute in ihm viel heimliche Bosheit und Mißgunst gegen mich, seitdem ich ihm, seit sich mein Talent entfaltet hat, nicht mehr unterlegen bin. Er sucht mich überall durch eine geheime Ironie und niederträchtige Anspielungen lächerlich zu machen, und zwar dadurch, daß er Fehler berührt, die ich ihm in der Tat aus einer gewissen Vertrauensseligkeit offenbart habe. Hermann sagt, ich sei selbst daran schuld durch meine Unvorsichtigkeit, andere Menschen zu leicht zu ernst zu nehmen und zu Vertrauten zu machen, worin viele eine freiwillige Unterordnung erblicken. Er hat recht. Nicht jeder ist groß genug, um nicht das Szepter zu mißbrauchen, das man ihm für eine Stunde reicht. Ich bin außerordentlich nervös. Selbst Marie Louises Küsse langweilen mich bisweilen. Aber was soll ich tun? Ich muß fort von hier aufs Land. Aber die Einsamkeit kann ich jetzt weder physisch, noch psychisch ertragen. Ich brauche die Frau dazu. Louise ist mir sehr sympathisch. Ich bin es ihr auch. Möglicherweise liebt sie mich sogar ein wenig. Es ist nichts an ihr, was mich stört. Auch körperlich ist sie mir angenehm, doch bringt mich der Gedanke, sie zu umarmen, nicht gerade in zitternde Erregung. Manchesmal wünsche ich, ich hätte die Geschichte nicht angefangen. Und dann scheint sie mir wieder die einzige Rettung. Sehr quält mich ihr Unwohlsein, welches diesen Zustand in die Länge zieht und unerträglich macht.
Mittwoch, den 10. Juni.
Immer noch hier, da Louise immer noch krank ist. Mein einziger Trost der Verkehr mit Hermann und Contard, mit denen ich fast alle Nächte verbringe, teilweise auf interessanten Excursionen in die abgelegensten Viertel, wo wir besonders das Leben der untersten Volksklasse beobachten. Wenn ich nachhause komme, ist der Himmel immer schon hell. Wie traurig dieser anbrechende Tag, und doch das Gefühl: jetzt gehört die Stadt noch uns, nach einer Stunde erwacht die Menschheit. Einer meiner bleibendsten Pariser Eindrücke: das Erwachen der Stadt, besonders der rege Verkehr an den Hallen. Ich schlafe meist bis 1 Uhr, arbeite fast nichts, genieße fast nichts. Gegen 5 Uhr gehe ich zu Louise, an deren Bett ich 1 bis 2 Stunden verbringe. Abends zumeist mit Contard und Hermann. Der Arzt hat mich über die Harmlosigkeit von Louisens Krankheit beruhigt. Meine Nervosität immer stärker. Der beständige Kontakt mit dem Leben ist fast schmerzhaft, besonders der Verkehr mit Postbeamten, Kellnern und dergl. Dazu hat mich eine Woche lang wieder der Dämon besucht. Vergeblicher Versuch, ihn nicht so pathetisch zu nehmen, ihm ruhig nachzugeben, wenn er kommt. Aber er kommt zu oft, weil die Gelegenheit doch auch hier zu groß ist. Und wenn ich ihm nicht völlig entsage, packt es mich völlig, so daß ich zu keinem Alleinsein in der Stadt fähig bin, ohne ihm zu verfallen.
Wo ich bis jetzt lebte, auch wo ich mich wohlfühlte, wie in München und Rom, ertrug ich das Leben nur, weil mir der jeweilige Zustand als ein vorübergehender erschien, und ich beklagte die Menschen, die immer so leben. Hier dasselbe, besonders Contard gegenüber. Er ist guter Abkunft und wohlhabend, begabt, aber ohne eigene Produktivität, hat Paris in jeder Hinsicht raffiniert genossen. Ein tiefes Liebesereignis erfüllte zwei Jahre seines Lebens. Nun aber flieht er alle Gefühlserregungen, alles Sentimentale, animische, wie er es nennt, um bewußt ganz cerebral zu leben. Aus diesem Grunde allein hat er seine Geliebte verlassen, zu der er immer noch eine Rückkehr befürchtet, da er sich nicht stark genug glaubt. Nun verbringt er seine Zeit mit Lektüre, Nachdenken, Verkehr mit einigen Freunden, hier und da mit Kokotten, die ihn mehr oder weniger lieben, während er sich innerlich von ihnen nicht allzu sehr berühren läßt. Niemals bezahlt er eine Frau. So fein das alles ausgeklügelt ist, so ist das doch immer dasselbe Milieu, dasselbe Paris. In jeder Hinsicht das Gegenteil von mir, der ich gerade aus dem Cerebralen herauswill. Hermann stimmt ihm theoretisch in allem bei, dadurch aber, daß er schaffender Künstler ist und vermögenslos, ist er beständig ins Leben hineingeworfen und kann sich ihm daher nicht entfremden. Ich würde Contard besser begreifen, wenn er sich überhaupt zurückzöge vom Leben. Entweder Tätigkeit oder mystisches Betrachten. Aber dazu ist ja Paris der ungeeignetste Ort. Ich träume von einer Einsamkeit in Deutschland. Sobald ich mein Vermögen in Händen habe, werde ich mir im Taunus oder in Oberbayern ein Bauernhaus einrichten und dort den größten Teil des Jahres, vielleicht mit Louise, leben und nur zum Besuch bisweilen in große Städte gehen.
Seit ich in dem Kreis um Contard bin, betrachte ich die Kokotten doch noch von einer anderen Seite. In diesem Kreise sehen die Mädchen die Männer als gute Kameraden an, keiner zahlt ihnen bar. Wenn sie aber in Geldverlegenheit sind, hilft man ihnen, wie einem Freund. Man ist »copain« miteinander. Lädt sie einer eines Abends zum Essen ein und sie haben gerade keine Zeit, so sagen sie ganz offen »Il faut que je fasse un miché aujourd'hui«, d. h. heute muß ich einen suchen, der mir Geld gibt, ich bin geschäftlich abgehalten. Neulich war eine unter uns in dieser Lage, konnte sich aber nicht entschließen, unseren Tisch, an dem es sehr lustig zuging, zu verlassen, um an ihr Geschäft zu gehen. Den Miché verachten sie.
Dienstag, den 16. Juni.
Ich habe nun einige gute Tage gehabt, der Dämon hat mich verlassen. Ich bin viel in der Umgegend herumgeschweift und habe einiges geschaffen. Marie Louise geht es viel besser.
Am Mittwoch Abend war Empfang bei Davray. Wir haben Haschisch geraucht. Anfangs war ich grenzenlos ausgelassen. Louise Davray wurde immer stiller, ich verschwand, von dem Haschisch offenbar etwas benebelt, mit ihr in einem Nebenzimmer. Sie löschte das Licht aus und sank in einen Sessel, wo sie plötzlich unter meinen Küssen wie schlafend lag. Sie ist zart und schlank und sehr jung. Dann waren wir wieder unter den anderen. Ich spielte stundenlang Klavier, besser als je. Um zwei verließen wir Davray und schweiften bis zum Morgen in seltsamen Gegenden umher.
Am Samstag in Versailles. Das 18. Jahrhundert ward mir so lebendig, als ich mich allein in dem kleinen Boskett der Marie Antoinette befand, daß in mir das geschah, was ich in den folgenden Tagen zu einem Gedichte »Maia« verarbeitete: »Dies ist der Traum der lauen Sternennacht«, doch mit dem Unterschied, daß an Stelle des 18. Jahrhunderts die Antike trat.
Mit Contard viel über Magie gesprochen. In seiner Vergötterung der Intellektualität scheint er mir auf ganz falschem Wege zu sein. Er will nicht zugeben, daß auch die Kunst hauptsächlich auf Instinkt beruht, daher seine Überschätzung von Flaubert, La tentation de St. Antoine.
Mittwoch, den 17. Juni.
Gestern die Duse im Renaissancetheater. Zuerst D'Annunzio, Sogno di una notte di primavera. Sie war in ihrem grünen zeitlosen Gewand, wie die letzte Tochter jener sterbenden Rasse der Italiener, in der sich noch einmal die ganze Schönheit der einstigen Blüte zeigt. Renaissance, aber vermengt mit dem Leiden der Décadence: Rossetti, Burne-Jones. Dann Goldoni La Locandiera. Hier ganz die Italienerin aus dem Volk in ihrer etwas derben Koketterie, ähnlich wie die Bellincioni als Carmen. Goldoni auf der Bühne sehr reizvoll, als Lektüre dagegen langweilig. Schon in Rom habe ich diese Beobachtung gemacht. Die Duse scheint mir vielleicht die größte Schauspielerin zu sein, die ich kenne, aber sie ist auch nicht frei von Pose und Affektation. Die Bühne ist doch eine inferiore Kunst, welche den Menschen ruiniert, eine ganz offenbare Prostitution der Gefühle, die durch den unmittelbar folgenden Applaus für eine geäußerte Empfindung noch unerträglicher wird.
Donnerstag, den 18. Juni.
Der Intellekt ist in unserem Seelenleben das Register, welches das Buch nicht wertvoller, aber handlicher und nützlicher macht. Wer nur oder vorzugsweise im Intellekt lebt, gleicht dem Bibliophilen, der in Katalogen herumschnüffelt, Bücher sammelt, sich an ihrer Atmosphäre freut, ohne sie zu lesen, oder dem, der lieber Kritiken, als die Bücher selbst liest, oder die Zeitschriften, worin über Bücher gesprochen wird. Ein neugieriges Tasten, das beinahe Laster ist.
Samstag, den 20. Juni.
Ich weiß, daß mich Louise nicht so liebt, wie mich Mathilde geliebt hat. Ich bin auch eigentlich zu jung für sie. Auch meine Gefühle zu ihr erreichen nicht die zu Mathilde, obwohl ich sie als Mensch bedeutend höher stellen muß.
Die mystischen Fragen beschäftigen mich momentan sehr stark, besonders der Zweifel: ist die Liebe Krischna oder Ardschuna gehörig.
Montag, den 21. Juni.
Ich lese in den Novellen Alfred de Mussets und finde sie ganz reizend. Es ist gewiß keine tiefe Poesie, keine künstlerische Ausgestaltung der Szenen, einfach charmante Erzählung. Sehr oft, meist sogar, redet er nur über die Dinge, statt sie zu schaffen. Aber das ist alles so graziös und stilvoll. Meine hiesigen Freunde finden ihn natürlich idiotisch und abgeschmackt, weil er immerhin diesem leichten, französischen, aus dem 18. Jahrhundert übernommenen Genre angehört, das der verfeinerte Franzose heute gern verleugnet. Aber sie schütten das Kind mit dem Bad aus, indem sie das wirklich Reizende in den besten Produktionen dieser Art verkennen, ebenso, wie die modernen Wagnerianer den Reiz der italienischen Oper, sodaß sie selbst von Rossini nichts wissen wollen.
Louise ist ganz romantisch. Sie träumt von fernen Ländern, Indien, Südamerika. Sie will nur Sonne, ein weißes Haus auf dem Lande mitten zwischen Arabern, und ich will Dämmerung. Dennoch verspreche ich mir einen wundervollen Winter an ihrer Seite. Ich denke sie mir still durch das Haus gehend, nie ganz glücklich, ihre Blicke immer nach unsichtbaren Horizonten gewandt.
Dienstag, den 22. Juni.
Mein Leben gestaltet sich jetzt glücklicher. Ich stehe nachmittags um 2 Uhr auf, trinke eine Schokolade. Bis 7 Uhr arbeite und lese ich. Abends bei Louise, die nun fast ganz hergestellt ist, dann auf dem Montmartre mit Hermann und Contard. Bisweilen einige Mädchen aus ihrem Kreise bei uns. Gegen 4 Uhr gehe ich zu Bett und lese noch vor dem Einschlafen.
Louise bat mich, ihr von dem Fest von Neuilly, einer großen Messe, einige »tartes de fruits« mitzubringen, »qui sentent la vieille graisse«. Das gibt ihr die Sensation dieses Festes, welches sie jährlich mit Interesse besucht hat.
Louise, die früher mit ihrem Mann in Algier gelebt hat, erzählt, daß die Mädchen dort in gewissen Häusern weiße Kränze tragen, die sie dem Mann zu Erinnerung an ihre Umarmung lassen.
Ich lese Hermann bisweilen vor in seinem riesengroßen, fast leeren Atelier, von dem aus man über ganz Paris blickt. Er hält viel von meiner Lyrik, meine Novelle Klara käme ihr fast gleich, Eos scheint ihm durchaus mittelmäßig (und war die einzige gute von allen, die ich heute 1924 noch gelten lasse).
Mittwoch, den 23. Juni.
Ich lese in Contards Bibel, dem Werk »Axèl« von Villiers de L'Isle-Adam. Dabei ist mir manches klar, geworden. Unterstützt übrigens durch die gestrige Aufführung von Ibsens Komödie der Liebe im Théâtre de l'OEuvre. Nicht das Kreuz, die Entsagung genügt, sondern das Kreuz, aus dem die Rose erblüht, als Symbol des lebendig gewordenen Glaubens. Leben bis zum höchst möglichen Moment und sofort danach aufhören, um nicht die Idee, die in diesem Moment Leben erkannt wurde, herabzuziehen in das Materielle. Ein Weib so sehr lieben, daß ihre körperliche Nähe nicht mehr nötig ist, daß diese Liebe ihren Tod selbst überlebt. Die Idee ist die Wahrheit, die wir zwar nur aus der materiellen Welt erkennen, durch welche sie bisweilen durchschimmert, von der sie aber auch gleichzeitig getrübt wird. Haben wir sie einmal ganz geschaut, so ist weiteres Verweilen, vor dem Schleier der Maja, d. h. sich wieder mit dem bloßen Durchschimmern begnügen, eine unnütze Qual. Dann Einsamkeit und Weiterleben im Erinnern der einmal geschauten höchsten Idee, die für jedes Individuum freilich verschieden ist. Auf dieser Basis stimme ich heute zum ersten Mal mit Contard überein, der nun auch mit mir in dem Intellekt bloß ein Werkzeug, in dem Schauen das Wesentliche sieht, im Schauen des Göttlichen. Ich betrachte diesen Tag mit seiner großen Offenbarung für mich als einen meiner besten.
Ich begreife ein wenig das Mysterium gewisser Talismane, besonders der Zaubermäntel. An manchen Orten gibt mir eine gewisse Lässigkeit Aplomb, bisweilen auch Papas Brillantring an meiner Hand. Meist aber ziehe ich vor, ihn in der Tasche zu tragen, da seine Wirkung häufig stören würde.
Donnerstag, den 24. Juni.
Wie im physischen Leben, so gibt es auch im geistigen eine doppelte Art der Potenz. Es kann jemand die Kraft zur Umarmung besitzen, aber nicht die, Kinder zu zeugen. So ist Contard z. B. Künstler im Leben und im Schauen, ohne daß er selbst Werke hervorbringt.
Gestern fand ich das Dasein und das Schauen so schön, daß ich kaum schlief. Die letzte Nacht ging ich überhaupt nicht zu Bett. Gegen Morgen in Notre Dame, und las Akédysséril von Villiers de L'Isle-Adam. So hat sich mein Leben geändert, daß ich auch heute früh aufstand, vormittag spazieren ging, in St. Severin und im Jardin des Plantes länger Rast machend mit einem Buch in der Hand. Dann Frühstück in einem Restaurant, wohin mich der Zufall schleuderte. Eine Stunde Siesta, ein Genuß, den meine frühere Lebensart unmöglich machte. Nachmittags, wie vormittags, oder auch gelegentlich Arbeit, abends bei Louise, gegen Mitternacht zu Bett. Erst jetzt genieße ich Paris.
Freitag, den 2. Juli.
Ich lese Barbey d'Aurevilly, La vieille maitresse, das französischste Buch, welches ich kenne, kühl, keine eigentliche Stimmung, aber von unnennbarer Grazie, Feinheit und Esprit. Diese französischen Eigenschaften erscheinen hier mit einer unerhörten Präzision und ohne in ihre lächerlichen Übertreibungen oder Verzerrungen zu verfallen. Das französischste Buch im guten Sinne. Es ist auf den Trümmern des 18. Jahrhunderts aufgebaut, dessen ganzer Geist noch darin lebt, aber gereinigt durch die Erinnerung eines schon modernen Menschen.
Eine merkwürdige Sensation: wenn irgend ein Mensch, besonders eine Frau in einer schmutzigen Affaire plötzlich gezwungen wird, einem Schutzmann die Namen anzugeben, die Vornamen der Eltern besonders, den Geburtsort, und die ganze Menge steht herum. Man weiß, daß diese Namen dem Betreffenden viele Associationen wecken, die nur er kennt, vielleicht sein Heiligstes, und dies wird nun in den Schmutz der Öffentlichkeit gezogen. Dies geschah heute Nacht in einem Café.
Heute wieder vor der Venus von Milo im Louvre und die alten Erinnerungen aufgefrischt.
Mit Contard verbinden mich immer mehr Fäden, während ich mich Hermann etwas entfremde. Ich habe ihn in jeder Hinsicht überschätzt. Außer seinem künstlerischen Talent, dem zuliebe ich viel verzeihe, hat er doch viel Inferiores. Seine Intellektualität, auf die er sich soviel zugute tut, ist verwirrt, dabei hat er die Prätention, ein Denker zu sein und will nicht begreifen, daß er etwas viel besseres ist, nämlich ein Visionär. Sein Charakter ist gleichfalls ziellos, ohne gebändigte Energie. Seine Gleichgültigkeit wird zur unverzeihlichen Rücksichtslosigkeit, wenn er irgend etwas, einen anderen betreffendes zu tun hat. Dabei beansprucht er starke Rücksichten von seinen Freunden. Dazu kommt eine beispiellose Unerzogenheit im Verkehr. Trotzdem er aus altem Patrizierhause stammt, ist er, auch physisch, im Körperbau z. B., von einer gewissen Proletarierhaftigkeit; seine stets schmutzigen Raubtierhände und die unangenehmen Hautausdünstungen. Dazu kommt auch eine Rohheit in der Ausdrucksweise, die mich abstößt. Er spricht z. B. sehr schlecht französisch, bedient sich jedoch beständig der gröbsten Argot-Ausdrücke, die er oft genug falsch anwendet und schlecht ausspricht. Seine Freunde finden das so amüsant, daß sie ihn gewähren lassen und ihn verwöhnen. Er ist hier der deutsche Bär.
In den letzten Junitagen war der Dämon wieder da; eines abends bei Louise. Ich war froh, daß sie launisch war, das hielt uns in gewisser Entfernung. Ich hätte an diesem Abend ihre Zärtlichkeit nicht ertragen.
Sie hat zwei Seiten, die feinfühlige intelligente, auch hingebende, dann die verwöhnte, launische, pariserische.
Mit Contard über Weihnachten gesprochen. Da er nicht die Intimität der Familie haben kann, so betrinkt er sich in dieser Nacht mit Weibern des Quartier Latin. Lieber wäre ich dann noch ganz allein.
Montag, den 5. Juli.
Ich entwickele mich durch den Antagonismus. In Paris, wie schon in Rom, werden in mir gerade die germanischen Eigenschaften geweckt. Hier gegenüber dem intellektuellen Contard kristallisiert sich mein Gefühlsleben, während in München, gegenüber Philips und Gutmann, gerade der Verstand sich entwickelt hat. Hermann gegenüber preise ich eine gewisse Beherrschung der Instinkte, dem Bourgeois gegenüber gerade die Befreiung des Instinktlebens.
Es gibt im Mittelalter gewisse Worte von mystischer Leuchtkraft zwischen dem gothischen Grau, besonders bei den Mystikern, wo ein Stück elementares, sonniges, südliches, antikes Leben plötzlich in die Zelle des nordischen Klosters fällt. Ich glaube, Goethe hat das im Faust gefühlt. Überhaupt ist es reizvoll, die Dinge durch ein komplementär gefärbtes Glas zu sehen, z. B. die Antike durch die Augen des Mittelalters, Frau Venusinne durch das Christentum, Deutschland durch die französische Romantik, oder durch die Augen Mallarmé's, z. B. in »Frisson d'hiver«, »le vieux almanach allemand«. Bei Gerardy wird dies freilich zur Pose.
Dienstag, den 6. Juli.
Ich gehe von einem Krankenlager zum anderen, zu Louise, dann zu Fried, der an einer schweren Entzündung und ohne Pflege in seinem Hotel liegt. Richters Geliebte sieht einer Fehlgeburt entgegen. Es freut mich, ein wenig helfen und durch kleine Geschenke erfreuen zu können. Es hat mich gerührt, zu sehen, wie Richters Freundin sich nach einem Kind sehnt, während hier in Paris die Frauen die Mutterschaft für das größte Übel halten. Gestern Abend mit Contard darüber gesprochen, der darin ganz französisch ist. Sein Skeptizismus wirkt manchmal wie Schwefelsäure auf mein Gefühl. In dem Fall Richter hat er nur den Verdacht, daß die Frau sich darum nach einem Kind sehnt, um den Mann um so fester zu fesseln, was ja oft genug der Fall sein mag. Ich kann Contards Verachtung des Weibes verstehen, wenn ich die Frauen sehe, die ihn umgeben. Diese aus dem intimen Leben völlig auszuschließen, ist nur zu berechtigt, und sie nur als Gefäß überflüssiger Säfte zu betrachten.
Donnerstag, den 8. Juli.
Ich lese im Bhagavad Ghita. Immer wieder beschäftigen mich Zweifel über den Wert des Instinktes, den ich nun einmal nicht verdammen kann. Ist er nicht das Correlativ fast aller großen Begabungen? Sollte ein instinktarmer Philister Goethe überlegen sein, sind es nicht grade unsere Instinkte, die uns über die Enge der Bourgeoisgesellschaft erheben, macht nicht der Instinkt den Künstler? Es ist gut, wenn die Instinkte später beherrschbarer werden, aber dann wird es gewiß wertvoll sein, starke Instinkte, viele Wünsche gehabt und befriedigt zu haben, aber nun, nachdem man gelebt und gesündigt, darüber erhaben zu sein. Die Instinkte dürfen nicht unterdrückt, sie müssen erlebt werden. Sie vergeistigen sich dann immer mehr, bis man zur olympischen Heiterkeit Goethes gelangt. Sie sind eine Brücke, die zwischen Gott und dem Menschen steht, zugleich aber der einzige Weg zu Gott in der Welt zu gelangen. Ich erkenne immer mehr den Abgrund zwischen mir und Louise. Sie wird nie an meinem Innenleben teilnehmen. Manchmal kommt sie mir geradezu nichtig vor, und es reizt mich, sie das fühlen zu lassen.
Ob wir wirklich eine so viel höhere Entwickelungsstufe sind, als der bourgeoise Mensch, oder ob vor dem Ewigen dieser Unterschied kaum besteht?
Münch hat zweimal in seinen Bildern vorahnend die Gesichter von Menschen gemalt, die er erst später sehen sollte. Die Eifersucht ist wie ein Portrait Hermanns, die Madonna wie ein Portrait des Modells Julia.
So wie in jeder physischen Monade eine spirituelle eingeschlossen ist, so ist in jeder sinnlichen Wahrnehmung die Möglichkeit einer geistigen eingeschlossen, sodaß wir zwar nur mittels der Sinne wirklich erkennen können, aber nicht in jenem materiellen sensuellen Sinn der englischen Philosophie.
Contard und Chaillet bestreben sich, das Gefühl des Ekels in sich zu überwinden, sich zu dem, was ihnen ekelhaft ist, zu zwingen, während ich diese Instinkte gerade kultiviere, welche mich dazu treiben, das mir Widerwärtige abzulehnen. Übrigens bin ich schon aus dem Grunde gegen Contards und Chaillets Theorie, weil sie doch nicht die letzte Konsequenz ziehen können, nämlich Unrat zu essen. Das Ende wäre, überhaupt immer das Gegenteil von dem zu tun, was man begehrt.
Montag, den 12. Juli.
Das Publikum ist im Theater der Ballast, der das physikalische Gleichgewicht erhält.
Da man nicht immer zarte schlanke aristokratische Hände findet, ziehe ich immer noch die verarbeiteten Hände des Arbeiters jenen fetten weißen Fleischklumpen vor, die sich wie nackte Kälber auf den feisten Schenkeln sattgegessener Leute ausruhen.
Mit Louise eine Auseinandersetzung. Sie hat Recht, ich bin zu hart und autoritativ gegen sie. Seitdem ich mich zusammennehme, bildet sich wieder jene sanfte Atmosphäre, die anfangs zwischen uns war. Louise ist nun fast hergestellt. In 8 bis 14 Tagen denken wir, an die See zu gehen.
Dienstag, den 13. Juli.
Paris ist die Stadt, wo es am wenigsten Überraschungen, »imprévu« gibt. Die Frau ist entweder femme honnête oder cocotte, eines so langweilig und konventionell, wie das andere. In jedem Fall ist sie berechnend. Dieser mystische Reiz der abendlichen Straßen, wo jeder sein verschiedenes Los trägt, existiert hier nicht in dem Grade, wie bei uns. Gestern Abend trank ich meinen Café in einem Pavillon der Champs-Elysées. Es gingen dort in der Nähe viele einzelne Damen spazieren, die nicht direkt Demimondainen waren. In einem anderen Lande hätte ich mich gewiß der einen oder anderen genähert. Hier interessierten sie mich kaum, denn ich wußte im Hirn einer jeden derselbe Gedanke: werde ich heute einen Miché machen, und wieviel wird er bezahlen? – Ich erinnerte mich mit etwas Heimweh an jene uninteressierten Frauen aller Stände, die man in Deutschland und Österreich auf allen Plätzen der Theater und Konzerte, in den Promenaden trifft, die weder rechts noch links blicken und nur selten auf eine Ansprache reagieren, außer, wenn man ihnen Vertrauen und Interesse einflößt. Das ist lange nicht so eintönig, wie hier.
Eine der vielen Schwächen des Protestantismus ist die Aufhebung des Fegefeuers und damit der Graduierung des Karma.
Es ist zu viel Lärm in unseren Seelen, zu viel gedankliche Zerstreuung. Gewiß würden wir sonst viel mehr Seelisches wahrnehmen, leise Stimmen, die sich nur im tiefsten Schweigen hörbar machen, clairvoyance. Münch kennt wohl dieses Schweigen der Gedanken. Bisweilen, wenn er unter uns saß, schien er wie ein Fakir in Benares, dessen Körper dort eingegraben ist, während sein Astralleib bisweilen in der Abenddämmerung von den Tempelhütern in Delhi zwischen den Säulen gesehen wird.
Louise erzählte mir schon mehrmals, daß sie sich, wenn ich abwesend bin, bisweilen dabei überrascht, daß sie meinen Akzent annimmt. Mir ist ähnliches mit Papa, Dr. Primer, Lori etc. passiert.
Wir kommen nicht um die drei Klassen herum, die durch ihr Verhalten zur Geldfrage immer wieder in jedem Gemeinwesen hervortreten müssen: erstens Aristokratie, die sich überhaupt nicht um Materielles kümmert, der Besitz ist einfach da und selbstverständlich, zweitens die Bourgeoisie, welche gegen ein bestimmtes Geldäquivalent ehrliche Arbeit verrichtet, drittens der Pöbel, nimmt Trinkgelder an. Natürlich verschieben sich diese hier im Prinzip gegebenen Zustände fortwährend.
Ich glaube, jetzt dadurch von der Sexualität immer mehr loszukommen, daß es für mich entweder Monogamie gibt oder einfach die physische Geschlechtsbefriedigung ohne innere Anteilnahme. Ich habe hier einer kleinen Kokotte Renée inzwischen den Hof gemacht, teils weil sie mich reizte, teils um zu sehen, ob ich dazu gelangen würde, sie uninteressiert zu besitzen. Ich bin bis zu ihrer Einwilligung gelangt, habe aber dann keinen Gebrauch davon gemacht. Plötzlich interessierte sie mich nicht mehr. Was sie zu geben hatte, habe ich empfangen, das andere wäre überflüssig gewesen. Auch wäre das Motiv ihrer Hingabe wohl im Wesentlichen Nonchalance gewesen. Sie brauchte diesen Abend kein Geld, ich schlug ihr vor, bei ihr zu schlafen. Warum nicht? dachte sie wohl. Warum? dachte ich dann. Ich glaube, ich werde nun weniger nach Frauen suchen, nur noch große Ereignisse, die entweder garnicht oder von selbst kommen, können mich reizen; im übrigen werde ich nur dafür sorgen, daß mich meine Sinnlichkeit nicht stört, indem ich sie zweckmäßig befriedige.
Gestern fand ich im Bhagavad Ghita die Lösung meiner Zweifel. In den drei Lebensformen: Sattwa, Beschauung, Goethe; Raja, Tat, Napoleon; Tama, Stumpfsinn, Alltagsmensch. Es ist klar, worin der Unterschied zwischen der Wunschlosigkeit von eins und drei besteht. Wessen Auge stets nach Sattwa gerichtet ist, kann sich ruhig in Raja ausleben. Er überwindet z. B. die Eitelkeit am besten, wenn er sie befriedigt. Nur für den ist die Eitelkeit gefährlich, der entweder zu leer ist, um Grund dafür zu haben, sie also aus Armut nicht befriedigen kann, oder bei dem sie unersättlich ist, oder bei dem nach ihrer Befriedigung gar nichts anderes übrig bleibt.
Auch der Wert der Einsamkeit wird mir problematisch. Die beiden Schacher waren einsam, Christus starb, von der Mutter, der Geliebten und den Freunden begleitet.
Ich bin nachmittags oft im Louvre. Die Sommernachmittage dort geben mir italienische Sensationen.
Donnerstag [Mittwoch], den 14. Juli.
Fête nationale.
Für mich gibt es nur zwei große Übel, vor denen ich verzweifeln würde, dauernder körperlicher Schmerz, der mich dadurch immer wieder in die Materialität verstrickt, und Gefangenschaft, denn ich finde Gott immer noch mehr in der Natur, als in mir selbst.
Louise langweilt sich immer. Schon als Kind fragte sie beständig: Maman, qu'est-ce que je pourrais bien faire, je m'ennuie, je m'agace, je m'embête. Was soll da auf unserer Reise mit ihr werden? Sie ist doch durch Paris verdorben, aber nicht méchant & rosse genug, um dadurch ihre leeren Stunden auszufüllen.
Alles ist gut, denn alles kommt von Gott. Man muß ihn nur erkennen. Dazu aber gehört Übung und Selbsterziehung. Ich verstehe nun den Spruch: Der Herr hats gegeben u.s.w.
Wie mich die immer wachsende Demokratie anwidert. Heute ist Gratisvorstellung in allen Theatern. Die Comédie-Française mit ihrer vornehmen Tradition vom Pöbel erfüllt, der sich auf den Sammtfauteuils der Logen wälzt; den Kellner, der mich zum Déjeuner bedient, heute mit seiner Frau oder Maîtresse auf den Boulevards gesehen. Sie kleidet sich in demselben Stil, wie meine Maîtresse. Der Hut voll Federn und Blumen, Spitzenmanschetten, die über die Hände fallen, die allerdings ungepflegt sind. Alles unecht und plump. Wie lächerlich, ein Dienstmädchen mit Federhut, wie schön die eigentlichen Volkstrachten, die das jedem Stande Gemäße ausdrücken.
Donnerstag, den 15. Juli.
Das einzig Schöne dieses Nationalfestes waren die nächtlichen Bälle an den Kreuzwegen der Stadt.
Ich lese Musset, Confession d'un enfant du siècle. Nie ist dieses Jahrhundert wieder so gut beurteilt worden, als in dem ersten Kapitel; dann später sogar Goethesche Feinheiten der Schilderung.
Sonntag, den 18. Juli.
Brief von Philips und Richard, beide des Inhalts, daß er einen nervösen Zusammenbruch gehabt hat.
»Hör auf, zu strömen und Wellen zu schlagen«, sprach Gott zum Fluß, »werde ein stummer klarer See.« »Wie ich«, sagte der Sumpf.
Heute mit Louise eine Szene, wohl die letzte. Ich warf ihr ihren oft unangenehmen Ton vor, der ihre Stimme so hohl erklingen läßt, daß es mir direkt weh tut, und ging soweit, dabei die ganze Misère unseres Verhältnisses zum ersten Mal auszusprechen und auch mir klarzumachen. Wir haben immer eine Leere auszufüllen und müssen über Themata reden. Ich wollte sie zwingen, wenn ein Funke Gefühl in ihr ist, ihn jetzt zu zeigen, statt dessen logische Rechtfertigungen und Raisonnements. Was mich an sie fesselte, war die Hoffnung auf eine geschmackvolle intelligente Gefährtin, die mir ein Heim schaffen würde. Aber sie versteht mich nicht und hemmt nur meine Freiheit. Wir sind so gut, wie getrennt, doch habe ich ihr die Möglichkeit einer Antwort offen gelassen. Vielleicht werde ich nun wieder einer großen sentimentalen Krise entgegengehen, da ich beabsichtige, zwei Monate allein in der Normandie und Bretagne zu verbringen. Sie hat eingestanden, daß sie ohne joie und ohne regret gereist wäre, daß sie an Glück garnicht denkt, nur an Ruhe. Meine damalige Annonce war die Folge der entsetzlichen Einsamkeit, unter der ich litt. Louise hat mich wenigstens gehindert, bei Frauen in diesen 6 Wochen etwas anderes zu suchen, als bloße Befriedigung der Sinne. Das hat mir eine Fülle reicher Stunden gegeben (ohne sie).
Rouen, den 20. Juli.
Louise wünschte, mich noch einmal zu sprechen. Ihre Worte waren wieder kalte klügelnde Logik. Ich habe ein gewisses Unrecht ihr gegenüber begangen, aber es ist rein äußerer Art. Ich kann mein Versprechen nicht halten, mit ihr an die See zu gehen, das ist wahr. Aber warum? Es ist kein Funke Gefühl für mich in ihr. Ich habe die Gelegenheit, es zu äußern, reichlich gegeben. Sie hatte den Egoismus, zu verlangen, daß ich trotzdem die Reise mit ihr machen müsse. Ihre letzten Worte waren vollkommen geeignet, jede Reue in mir zu vertilgen. Als ich mich schon verabschiedet hatte, rief sie mir nach: »Pour ça il est venu en France; il aurait bien pu rester en son pays.« Alles in ihr war Berechnung, wohl nicht in jenem ganz gemeinen Sinne, sondern wie die bürgerliche Frau berechnend ist, versorgt sein will, im übrigen aber ihre ehelichen Pflichten kennt und nicht verletzt. Louise hätte mich gewiß nie getäuscht, solange sich ihr nicht eine bessere Lebensperspektive gezeigt hätte. Sie hatte sogar eine gewisse laue vernünftige Anhänglichkeit an mich bekommen. Aber ich vertrug diesen hohlen, metallisch kalten Ton nicht, der oft schneidend wirkte. Ich hätte vielleicht darüber lächeln müssen. Sie sagt selbst sehr richtig, ich hätte sie mehr wie ein Kind behandeln müssen. Dazu hätte ich aber selbst älter sein müssen. Der Besuch bei ihr war mir zuletzt oft ein brutaler Einschnitt in einen sonst harmonisch verlebten Tag. Immerhin ist sie das Opfer meines Irrtums und kommt nun diesen Sommer nicht an die See, wie sie gehofft hat.
Gestern abend mit Contard in Rouen angekommen. Nächtliche Gänge durch die alten gothischen Gassen, die von modernen Industriestraßen unterbrochen sind. Die Luft feucht und nebelig, bisweilen von Sonne durchdrungen. Dunkle, in Duft gehüllte, auf dem Fluß schwimmende Inseln, weite Ebenen. Am Nachmittag in Croisset, Flauberts ehemaligem Wohnsitz, dessen Diener heute eine Weinwirtschaft hält. Er erzählte uns von Flaubert und seiner Mutter, Maupassant, Turgenjeff, Taine, George Sand. Nachts mit Contard in den Dirnengassen. Alte, seit einem Jahrzehnt in demselben Haus lebende Dirnen, deren Niedrigkeit in dem Gesichtsausdruck wie erstarrt erscheint. Sie scheinen alle einen momentanen Ausdruck spontaner Gemeinheit unbeweglich festzuhalten.
Heute allein die Stadt durchstreift, deren Eintönigkeit mich unsäglich deprimiert. Bemerkenswert dennoch die vielen guten gothischen Bauwerke, aber alle in jenem gothischen Barock vom Ende des 15. Jahrhunderts. Im Museum 2 schöne Corots und treffliche Fresken von Puvis de Chavannes.
Durch Contard, der gestern abend abgereist ist, habe ich ein merkwürdiges Cabaret kennen gelernt, wo ich heute fast en famille speiste. Dort eine junge Frau, die mich vorübergehend fesselte. Heute abend erwartet sie mich vor dem Schlafengehen, und aller Reiz ist verschwunden. Das scheint überhaupt jetzt der regelmäßige Ausgang meiner Abenteuer zu werden.
Carteret, Montag, den 26. Juli.
Von Rouen reiste ich die Küste von Calvados entlang, von Honfleur bis Trouville, Houlgate, Cabourg und fand überall Paris. Dann in Caen, eine alte Stadt. Während der Abenddämmerung tiefe Eindrücke, besonders in den Kirchen, darunter zwei romanische aus der Normannenzeit. In Trouville am Abend auf der Jetée ein sonderbares Erlebnis durch den Dämon, welches ich nicht zu verzeichnen brauche. Von Caen über Bayeux hierher.
Carteret ist der erste Punkt, wo ich mich etwas wohl fühle. In einem stillen englischen Hotel, keine Spur von dem Lärm der Sommerfrischen. Fast gar keine Fremden. Ein Dorf von uralten grauen Bauernhäusern, von begrünten Sanddünen unterbrochen. Wege, die von Ulmenwänden begrenzt sind. Jenseits der Dünen die Küste. Dort nichts als Meer, Sandflächen, von schwarzen Felsen umgrenzt. Nichts Menschliches, als einige Badekabinen, die von weitem wie eine in die Felsen gemauerte Stadt aussehen. Ich irre seit gestern teils in dieser Wildnis, teils in der lieblichen Ulmen- und Dünenlandschaft umher. Ich empfinde bedeutend weniger intensiv, als in den letzten Pariser Wochen. Aber ich beginne, mich wohl zu fühlen und werde darum einige Tage hierbleiben. Mein Bedürfnis nach Menschen ist sehr gering, im Gegensatz zu früheren Reisen, wo ich stets Bekanntschaften zu machen suchte. Nachts träume ich oft von Papas und Mamas Tod, den ich dann heftiger, als in Wirklichkeit empfinde. Die beiden Tage habe ich in einem Bauernwirtshaus beschlossen, welches bereits beginnt, mir lieb zu werden. Auch habe ich heute eine Arbeit begonnen.
Saint Heliers auf Jersey, Freitag, 30. Juli 1897.
Ich bin vorgestern von Carteret abgereist und litt unterwegs außerordentlich an Seekrankheit. Am Abend in Gorey. Ein stummes englisches Hotel mit stillen bescheidenen Dienstboten, die Clary und Fennimore hießen. Kate Greenawaytapeten, auf denen kleine Mädchen Reifen spielen, in den Zimmern. Gestern Tour in's Innere der Insel. Vollkommen englische Impression. Wiesen mit weidenden Pferden und Kühen, grüne Hohlwege, offenstehende Parktore, aus denen blonde Kinder mit Ponnys treten. Kleine und gepflegte Farmen und Landsitze mit gothischen Dächern und Tudorfenstern, die an Holland erinnern. Ich war sehr entzückt davon. Am Abend in St. Heliers. Das englische Leben der Stadt bedrückt mich bereits. Diese furchtbar häßlichen temperamentlosen Menschen an der Table d'hôte, die ihre Abende an den Straßenecken stehend verbringen, eine Pfeife im Mund und die Hände in den Hosentaschen. Die schweren überkräftigen Speisen, die breiigen Biere, die brennenden Saucen, die bitteren Kompotts, der Mangel an Frauen. Am Abend eine mittelmäßige Aufführung des Mikado. Die Titelrolle indeß glänzend gegeben, der Schauspieler gab mit tiefer grotesker Komik den Sadismus eines orientalischen Herrschers, der geradezu unheimlich wirkte. Das Leben drückte auf mir gestern Abend im Theater, daß ich etwas, wie Wahnsinn in der Luft fühlte. Starkes Heimweh nach Paris und Blanche. Heute morgen völlig abgestumpft, über der Stadt liegt ein Londoner Nebel.
Das einzige Gute, daß ich Louise nicht hier habe. Täglich sehe ich ihre Leerheit mehr ein.
St. Heliers, Samstag, den 31. Juli.
Gestern abend einen tieferen Einblick in das nächtliche Jersey getan. Sie hieß Edith, war dünn, wie eine Birke, hatte eine weiße Bluse an, wie ein Herrenhemd, und einen Bubenstrohhut, sowie eine schwarze Herrenkravatte. Sie war häßlich, hatte aber einen schönen Teint. Sie führte mich in ein sehr ehrbar aussehendes Haus, verstand aber ihr Handwerk garnicht. Diese kleinen englischen Dirnen unterscheiden sich äußerlich gar nicht von dem gewöhnlichen Typus des englischen jungen Mädchens, so keusch sehen sie aus. Man meint, man begeht eine Schändung. Das scheint aber gerade dem Engländer zu gefallen.
Ich fühle mich hier so fremd, daß mir ein französischer Kellner aus der Touraine, der mich in einige Intima des hiesigen Lebens einweihte, fast wie ein Landsmann vorkam gegenüber dem Engländertum. Ähnlich ist es mir seinerzeit in Sizilien gegangen, als ich einige Florentiner dort traf.
Mittwoch, den 4. August 1897.
Ich habe in einer mehrtägigen Tour die ganze Insel durchwandert und komme sehr befriedigt zurück. Ich habe zwar noch nicht jene Klarheit wieder erreicht, in welcher ich in den letzten Pariser Wochen war. Die Weg durch die alten gepflegten Dörfer, zwischen dunklen Parks und von Heidekraut violett strahlenden Hügeln und zwischen dunkellockigen Farren, jene großen leeren Hotels, wo ich immer der einzige Gast war und wie ein Schloßherr die ganze Dienerschaft zur Verfügung hatte; die selbstgewählten englischen Puddings und Kuchen, die mir seit meiner Kindheit vertraut sind, die Speisen, die in verdeckten Schüsseln hereingebracht werden, die Abendspaziergänge am Meer, das ich unter allen Stimmungen belauschte, die arbeiterfüllten Vormittage im Freien und dann die Poesie des Wanderns zu Fuß mit dem Ranzen auf dem Rücken, besonders am Sonntag abend, als ich ziemlich spät zu den Gasthäusern der Greve de Lecq hinabstieg, wo man mir in dem einen, vermutlich, weil ich zu Fuß kam, ein Zimmer verweigerte, als ich zufällig die Bekanntschaft der Tochter des anderen machte, wo ich 2 schöne Tage verbrachte, alles dies ließ mich gestern abend, als ich zurückkam, die Stadt in anderem Lichte sehen. Diese kleinen englischen Mädchen schienen mir sogar reizend, zumal ich in eine ihrer Eifersuchtsszenen mit den Französinnen geriet. Ich beschloß den Abend in demselben Haus, in welches mich neulich Edith geführt und beschäftigte mich mit einer ihrer Freundinnen, während sie selbst in Gesellschaft eines Engländers war. Diese Mädchen sind mit Ausnahme der Röcke durchaus männlich gekleidet. Sie tragen sogar teilweise kleine Stöcke auf der Straße.
St. Malo, den 10. August.
Seit einigen Tagen streife ich durch die alten bretonischen Städte. Mont St. Michel, St. Malo, Dinard u.s.w., wo noch völlig mittelalterliche Viertel, alte Stadtwälle u.s.w. bestehen. Und dennoch hat mein Zustand einen Rückfall erlitten. Unempfindlich ging ich zwischen diesen Schönheiten hindurch. Gestern indeß eine vollkommene Gesundung auf dem Wege nach Cancale, die sich in unaufhaltsamer Produktivität äußerte, dem sichersten Zeichen für meinen Seelenzustand. Unter anderem entstand die Ballade des Ewig Wandernden. Der Dämon kommt bisweilen wieder, aber ich versuche, ihn harmloser zu betrachten, vor allem die Pedanterie der Datierung abzuschaffen.
Paimpole, Sonntag, den 15. August.
Brief von Contard, der an der Küste der Normandie ein seliges vegetatives Dasein führt und mich auffordert, ihn, wenn meine Reise zu Ende ist, dort zu besuchen. Wie ich ihn um seine animalisch-vegetative Ruhe beneide. Ich bin nun einsam und dennoch ohne Frieden. Zwei Dinge stellen sich beständig meiner Sammlung in den Weg: meine künstlerischen Ziele und meine Studien, die mich doch immer wieder treiben, keine Zeit zu verlieren, und dann meine Sinnlichkeit. Meine Astralatmosphäre ist derartig getrübt, daß ich außer durch Lektüre oder Arbeit kein Mittel finde, der Dämonialität zu entfliehen. Beschaulichkeit, wonach ich solange strebe, ist mir trotz meiner Einsamkeit völlig unmöglich. Die bretonische Landschaft reizt mich ungemein. Der nördliche Gewitterhimmel, unter welchem der Golfstrom stellenweise eine südliche Vegetation hervorbringt. Die Lektüre ist meine einzige Zuflucht. Die Einsamkeit ohne Buch ist vorläufig unmöglich. Ich sehne mich dennoch nicht so intensiv nach einem Weib. Ich begehre die Frau häufig zu einmaliger Umarmung, versuche aber nicht den langen Weg des Eroberns. Soviel ist mir das Erlebnis nicht wert. Und ferner möchte ich nach der einmaligen Umarmung sofort wieder allein sein. So ist mir eine tiefere Beziehung zur Frau im Augenblick ganz unmöglich.
Ich habe auf einer Wanderung in Kerity ein Kreuz an einem Brunnen gesehen, auf der einen Seite Christus, auf der anderen Seite Maria. Kleine zwerghafte Körper mit riesenhaften Köpfen, wie Fötusse.
Das monarchisch christliche Deutschland ist so bürgerlich protestantisch geworden, daß es fast verzeihlich, zum mindesten verständlich ist, wenn unsere Besten unmonarchisch und unchristlich werden. Hier in Frankreich erkennt man immer mehr die geistige Nichtigkeit jenes dritten Standes, der zwar als ein Sturmbock gerade gut war zum Umstürzen eines morschen Gemäuers, von dem aber für die Kultur nun nicht länger mehr die Rede sein kann. Die Verachtung des modernen französischen Künstlers für den Bourgeois ist maßlos, von den Romantikern an – Musset, Gautier, Baudelaire, Flaubert, d'Aurevilly, Villiers. In allen diesen der unsterbliche, aristokratische, unbürgerliche Geist.
Wir werden in Deutschland nie eine kultivierte, aristokratische Gesellschaft im romanischen Sinne haben. Andererseits ist dem materialistischen dritten Stand de facto bei uns nie dieser große Raum gegeben worden, wie in Frankreich. Die Profanation des Heiligen wurde nie so systematisch betrieben, wie hier, wo die republikanischen Schulen dem Bourgeoissohn von Kindheit an den Weihrauch seiner Souveränität zu riechen geben. Bei uns ist die Bourgeoisie lange nicht so unverschämt, ja, sie hat bisweilen aus unserem 18. Jahrhundert einen Funken Idealismus herübergerettet. Der Adel hat sich dagegen bei uns selbst negiert, indem er die Laster des Bürgertums mehr oder weniger annimmt. Freilich sind die Endpole der deutschen Gesellschaft von heute verknöcherter Idealismus auf der einen und dummdreiste Blasphemie auf der anderen Seite. Dazwischen aber wohl noch Spuren jener Gesellschaft, aus welcher Goethe stammte.
Während die Französin, in eine bürgerliche Ehe gespannt, sich leichter in Ehebrüchen vergnügt, trägt die Deutsche ihre Last noch stumm, bis sie eines Tages totmüde zusammenbricht. Für den Künstler ist sie fast interessanter, als jene beständigen Vitriolattentate in den lateinischen Ländern. Wenn wir auch keine kultivierte Gesellschaft haben, so ist in der Finsternis unseres sehr provinzialen Lebens eine Fülle entsagungsvoller Tragik. Unsere Frauen sind noch eher darum imstande, einmal echte Künstler zu gebären, während die Französinnen immer nur wieder künstlerische Menschen hervorbringen.
Roscoff, den 21. August, Samstag.
Sehr interessant hier die alten schwerfälligen Kirchen mit Holzdächern, sodaß man bisweilen in einem Zimmer zu sein glaubt, in welchem die massiven Steinwände um so eigentümlicher wirken.
Ich bin beständig von metaphysischen, religiösen Zweifeln verfolgt. Der ewige Zwiespalt zwischen Wollen und Intellekt. Heute viel stärker, als in früheren Zeiten, da eine falsche Kultur den Intellekt selbst vergiftet hat. Das Einzige, was ich zu meinem Heil tun kann, ist, intellektuell immer klarer zu werden. Ob dann der Wille von selbst folgen wird? Es gibt heilige Naturen, die von vornherein mit der Übereinstimmung von Wille und Intellekt geboren sind. Andere ganz unbewußte, deren Wille halb gut, halb schlecht ist, oft Künstler. Aber sie sind keines Fortschrittes im Geistigen fähig, und sie kennen meine Konflikte nicht.
Huelgoat, Montag, den 23. August.
Hier einen Ort gefunden, dessen Landschaft mir entspricht. Wie wenig sagt mir im Verhältnis zu diesen Wäldern, Tälern, Ebenen und Bergen das nordische Meer. Durch die palmenartigen Farren, zwischen denen das violette Heidekraut leuchtet, die reichen Moosflächen, der stete Wechsel zwischen hellem Laub und dunklen Nadeln, die oft von Epheu völlig umhüllten Stämme geben der Landschaft eine fast exotische Leuchtkraft. Ich bin auch oft an meine Heimat erinnert. Dennoch ist auch hier meines Bleibens nicht. Diese von Touristen mit Fahrrädern überfüllten Hotels, die ewigen Tables d'hôte lassen mich nicht verweilen. Ich denke nun schon weiter zu reisen bis Tours, eine Stadt, die von Erinnerungen und Traditionen voll ist und groß genug, um ein unabhängiges Leben zu gestatten. Wie oft denke ich an die wundervolle Reise am Anfang dieses Jahres, Riva, Arco u. s. w.
Ich kann das Christentum doch nur ganz sinnbildlich akzeptieren, besonders das Dogma von der Reue ist mir unmöglich. Ich kann keine Sünde bereuen, denn wenn ich sie auch vielleicht nicht wieder tun möchte, so hat sie das eine Mal mein Wissen und Erleben bereichert. Ich bewundere nur die Reinheit, die durch alle Sünden hindurchgegangen ist, betrachte also die Sünde nicht als das Schlechte, sondern als das Notwendige in der Welt. Je reiner aber unsere Erkenntnis wird, d. h. je mehr unsere Seele aus der Materie befreit ist, umsomehr bleibt übrig nach dem Tode der Materie.
Concarneau, den 30. August.
Von Huelgoat aus bin ich nach dem Cap Finistère gereist und habe die wildeste Gegend der mir bisher allzu zahm erscheinenden Bretagne besucht. In St. Guénéule traf ich zu meiner größten Überraschung Henri Alberts Geliebte Madeleine. Ich habe in ungemein intensiver Weise den Typus der femme rosse genossen. Der skeptische Albert scheint der sentimentale Seladon zu sein vor diesem geradezu niederträchtigen Wesen, welches ihn, trotzdem er ihr 400 Franc's monatlich fest gibt, noch in der schrecklichsten Weise ausbeutet. Sie weiß, daß er lungenleidend ist, und zwingt ihn, seine Nächte durchzuarbeiten, um ihre Launen bezahlen zu können. Er scheint es wohl nicht besser zu verdienen, weil er kein größeres Vergnügen kennt, als seine Geliebte in eleganten Toiletten seinen Freunden vorzuführen. Alles dies natürlich nach ihrer Aussage. Sehr interessant dieses weiße Stück Fleisch von den groben Bauern hier hofiert. Besonders scheint eine kleine Dienstmagd eine Art lesbischer Neigung zu ihr gefaßt zu haben. Auch zwischen ihr und mir mußte natürlich die Frage des Zusammenschlafens gelöst werden. Doch verzichtete ich sofort, als ich ihre petits airs bemerkte, mit denen sie mich zu umgarnen suchte. Ich bin dann plötzlich und unvorbereitet abgereist. Sie fand mich ungemein bizarr, weil ich auf ihre kleinen Künste nicht recht eingegangen bin. Psychologisch ist es mir unfaßbar, wie man Sklave einer solchen Kreatur werden kann. Das Gute ist doch in meiner Anlage, daß ich nur eine Frau lieben könnte, die mich auch durch Geist und Charakter fesselt. Madeleine gestand mir, daß sie bis zu ihrem 22. Jahr vollkommen kalt und gleichgiltig war, jetzt aber findet sie Freude an diversen Komplikationen des Natürlichen. Sie ist weder leidenschaftlich, noch sinnlich, nur lasterhaft.
Ich bin dieses Umherziehens gründlich satt. Niemals mehr werde ich eine solche Touristenreise unternehmen. Nur längerer Aufenthalt an einem Ort, höchstens einmal eine Woche wirkliches Reisen. Man kommt zu keiner Sammlung. Die Stimmung kann sich nicht konzentrieren. Und diese fortgesetzte Abhängigkeit vom Wetter und allen möglichen anderen, äußeren Verhältnissen.
Tours, den 4. September.
Seit St. Guéneulé ist mein Zustand wesentlich besser geworden, ohne vollkommen zu sein. Ich bin über Pont-Aven gereist, wo ich eine in Paris Medizin studierende Russin kennen lernte. Freigeist, anarchistisch etc. Ich habe mit ihr einen Vormittagsausflug zu Schiff gemacht unter allerlei Gesprächen. Wie glücklich hätte mich diese Bekanntschaft vor ein bis zwei Jahren gemacht. Und heute, welcher Abgrund zwischen mir und dieser Welt, in der ich ja in Berlin selbst kurze Zeit gelebt habe. Dann zu den interessanten keltischen Überresten Carnacs, Locmariaquers und über Nantes und Anger hierher. Ich lese Salammbô von Flaubert und es langweilt mich. Flaubert hat recht, wenn er sagt, der Sockel sei zu groß für die Statue geworden. Die Statue existiert ja kaum. Was haben diese kleinen Einzelschilderungen mit Salammbô zu tun. Dennoch außerordentlich bedeutende Episoden.
Maeterlinck erinnert mich bisweilen in seiner gewollten Einfachheit an die Sätze in der Grammatik: Ich möchte anderswohin gehen. Wohin könnte man gehen? Sind die Zimmer der oberen Stockwerke geheizt? Nein, sie werden seit vielen Jahren nicht mehr geheizt. Wir könnten vielleicht in den Garten gehen? u. s. w. u. s. w.
Les Grandes Dalles, Montag, den 13. September.
Hier habe ich nun Ruhe gefunden. Contard, der seit 8 Wochen hier ist, hat mich eingeladen, die Zeit bis zur Rückkehr nach Paris mit ihm zu verbringen. Seit Donnerstag Abend in diesem reizenden Ort an der Küste. Wir streifen Tag und Nacht umher unter mannigfachen Gesprächen. Vor meinen Zimmern eine weiße Terrasse die fast von den Wellen bespült wird. Zur Rechten und Linken steile Felswände, die in dem Kupferrot der Sonnenuntergänge sizilianische Erinnerungen wachrufen. Das Land besteht aus grünen, von Ulmenwänden begrenzten Tälern, weiten Feldern, von Bauernhöfen unterbrochen. Die Mondscheinnächte haben wir auf den Felsen verbracht und sahen die vagen Wolkenschatten über dem Meer, die wie leichte Dämpfe schienen. Auf dem Wege zum Lupanar rede ich mit Contard über die Unsterblichkeit der Seele. Unsere tiefsten esoterischen Unterhaltungen unterbrochen durch Experimente mit den beiden Bonnen des Hotels, deren Neugier und Einbildungskraft wir mit raffinierten Vorstellungen ausfüllen.
Ein sinkender Mensch kann immer noch höher stehen, als ein steigender, der erst eine geringe Stufe erklommen hat, während der sinkende noch nicht tief hinabgeraten ist.
Paris, den 10. Oktober.
Sehr zufrieden habe ich am 30. September Les Grandes Dalles verlassen. Am letzten Tage mit Contard eine merkwürdige Auseinandersetzung. Ich war etwas verletzt, daß er den letzten Abend, den wir ausdrücklich zu einem Zusammensein bestimmten, aus bloßer Gedankenlosigkeit mit dieser ewigen Familie Chevalier-Gilet verbrachte. Er ist in seiner Galanterie und Rücksicht beständig dem Zufall unterworfen. Er kann sich nicht von einem kleinen Frauchen losmachen. Diese Chevaliers sind oft in unsere tiefsten Unterhaltungen hineingeschneit und haben alles zerstört. Ich gebe mich zu sehr hin, muß gleichgiltiger werden selbst gegen die besten Freunde, wie Contard, der meine Vorwürfe kaum verstand. Hier in Paris war ich anfangs voll Begeisterung für die Stadt. Man muß fern gewesen sein, Heimweh nach Paris gefühlt haben und dann zurückkommen. Welche einzige Stadt! Ich habe einige Frauenerlebnisse gehabt, die mich aber dann wieder gründlich für längere Zeit geheilt haben durch diese hier epidemische Habgier und Kälte. Die Tage verbringe ich nun in der Bibliothèque Nationale mit dem Studium der Magie. Das Geheimnis der heiligen Zahlen als Grundrhythmen alles psychisch-spirituellen Seins wird mir etwas klarer. Ich freue mich, wenn ich Paris, meine magischen Anfangsstudien und französische Literatur hinter mir haben werde. Für das nächste Jahr ist England geplant. Dann bin ich frei, dann muß ich nichts mehr gesehen haben, dann kann ich vielleicht wirklich dem Zufall leben. Ob ich es wirklich kann, ob ich mir nicht wieder ein neues »Muß« schaffe?
Montag, den 18. Oktober.
Es herrscht ein so mildes Herbstwetter, daß ich noch einmal auf das Land zu gehen beabsichtige. Ich habe meine Tage zum großen Teil mit Studien von Eliphas Levi in der Bibliotheque Nationale zugebracht. Mit Hermann stehe ich wieder trefflich, seitdem wir alles Materielle sorgsam aus unserem Verkehr eliminieren. Ich habe jetzt viele französische Bekannte. Meine Neugier gegenüber der »putain de café« ist gestillt, seitdem ich erkenne, daß das materielle Elend an der Art ihrer weiblichen Entwickelung schuld ist. Die Gemeinheit der Männer hat eine vollkommene Gefühllosigkeit oder niedriges Mißtrauen gegen den Mann erzeugt. Ihre Sinnlichkeit ist rein peripherisch. Person oder Geschlecht sogar sind ihnen gleichgiltig. In Betracht kommt nur eine geschickte Technik des Cunnilingus, die sich häufiger beim eigenen Geschlecht findet, dabei sind sie durchaus nicht ausgesprochen homosexuell. Diese Erkenntnis hat mich wohl von der quälenden Neugier befreit, die stets zu Versuchen bereit war. Ich bin ruhiger geworden. Vielleicht ist auch das Studium der Magie eine Ursache davon, sie bringt mir wirklich Trost und führt mich dem Katholizismus in die Arme.
Montag, den 15. November.
Ein Aphorismus Contards: La femme qui jouit de son sexe en écoutant Tristan et Iseult se masturbe avec le doigt de Dieu.
Das Studium der Eliphas Levi'schen Bücher hat mich derart ausgefüllt, daß ich seit 8 Tagen zu jeder sonstigen Aufnahme unfähig bin. Ich schreibe dagegen an meiner Novelle »Die Geliebte des Teufels«. Mein Zustand sehr verschieden. Zuweilen eine furchtbare Verstimmung gegen Paris. Ich leide darunter, die Wirkung meiner in Deutschland erscheinenden Arbeiten nicht beobachten zu können, und daß unter meinen hiesigen Freunden keiner daran teilnehmen kann. Nur Hermann, dessen lebhafte Anerkennung mich bisweilen entschädigt. Paris hat mich doch wohl gereift. Übrigens hat mir Blanche wieder geschrieben. Sie will mich Donnerstag wiedersehen. Das Bedürfnis, mich in weiterem Kreise zu realisieren, wird doch wieder größer. Ich ertrage dies obscure Studentendasein nicht länger. Ich glaube, Contard und Chaillet, die beide ganz unproduktiv sind, müssen auch darunter leiden, immer étudiants en médecine zu sein. Sie wagen sich wohl darum kaum in die Gesellschaft. Chaillet ist ganz passiv. Sie nennen ihn hier eine männliche Hure, la grande blonde. Er spielt mit sich und seinen Empfindungen. Absolut Je-m'enfoutiste. Das alles ist eigentlich ein fauler Quietismus, unter dem sie aber selbst leiden. Mich hingegen verzehren immer wieder Zukunftshoffnungen, Ehrgeiz, die Möglichkeit, Einfluß auszuüben. Sobald ich ihn aber haben werde, werde ich wahrscheinlich gleichgiltig dagegen sein, da ich wohl niemals ganz in der Gesellschaft und weltlichem Treiben aufgehen werde. Im Gegenteil, ich werde es fliehen, wenn es mir entgegengebracht worden ist.
Die Prinzessin Cantacuzène hat mir lebhaft für meine Kritik gedankt. Ein zweites Buch von ihr ist angekommen. Sie lädt mich ein, auf ihrem Gut einen russischen Winter zu verbringen. Auch Richter ist wieder hier. Auch ein Quietist, aber Deutscher, der bei aller Feinfühligkeit und Aufrichtigkeit mit bourgeoisen Idealen liebäugelt, negiert absolut das spezielle Schicksal des intellektuellen Menschen dieser Zeit. Dann ist ein sehr feiner, gemütvoller Deutscher hier, der Maler Max Vogt, eine deutsche Natur im guten Sinn, wie es scheint auch ein erfreuliches Talent. Aber ohne jede Initiative. Er leidet stark unter Paris, in dem er sich garnicht zurechtfindet.
Obwohl ich zwar keineswegs Pariser geworden bin, vielmehr das deutsche Element gerade hier in mir herausgearbeitet habe, zweifele ich, ob ich mich wieder in diese deutsche beschränkte Selbstgenügsamkeit eingewöhnen werde. In Deutschland fehlt heute eine einheitliche Lebensanschauung, wie sie nur eine große Philosophie oder der Katholizismus geben kann.
Samstag, den 27. November.
Ich schließe mich wieder mehr Hermann an, dem ich vielleicht Richard schicken werde, während ich die Sterilität und Schwäche von Contard und Chaillet immer heftiger empfinde. Hermann hat mich mit Strindberg bekannt gemacht, eine gewaltige Persönlichkeit, vor welcher unsere französischen Freunde eine wahrhafte Angst empfinden. Ich fühle in ihm zugleich einen Schatz von Liebe und Gefühl, den aber heftige Leiden, verursacht durch den Mißbrauch anderer, in Mißtrauen gehüllt zu haben scheinen. Er ist bereits ganz ergraut. Vielleicht der erste Mensch, den ich kenne, vor dem ich mich beugen kann, ohne daß es auf Kosten meines Selbstgefühls geschieht.
Blanche besucht mich wieder. Dieses gute Geschöpf, welches den Anfang und das Ende meines hiesigen Aufenthalts begleitet, ist doch das einzige wirkliche Weib, das ich in Paris kannte und liebte.
Sonntag, den 12. Dezember.
Mitten in den Vorbereitungen zur Abreise begriffen, und ich reise mit Freude. Der Umgang mit meinen französischen Freunden ist mir von Woche zu Woche reizloser geworden. Das Scheinleben, Lügen gegen sich selbst, sogar bei so intellektuellen Menschen, wie Chaillet und Contard, wird mir immer klarer. Ich glaube, sie merken, wie ich mich ihnen entfremde. Mit Richter öfters zusammengewesen. Er besitzt gutes Urteil und feine Kultur, ist dabei dennoch ein vollkommen deutscher Bourgeois. Wie wohltuend seine Aufrichtigkeit, aber wie erschreckend der Abgrund, der ihn von meiner und Hermanns Kunst trennt. Als Maler macht er mir doch Zweifel an Hermanns technischen Qualitäten, der vielleicht durch seinen rein literarischen Umgang verdorben wird.
Den 17. Dezember.
Morgen Abreise. Gestern noch ein ereignisreicher Abend. Seit einiger Zeit bin ich Mitglied der faculté des sciences occultes. Gestern Abend erhielt ich feierlich die Weihen des ersten Grades des Martinistenordens. Die Zeremonie, verbundene Augen, dann schwarze Maske, ringsum alles in Masken, die Schwerter in der Hand, die breiten Seidenschärpen auf der Brust, die 3 brennenden Kerzen, der wallende Mantel, in den ich gehüllt wurde, setzten mich in starke Erregung, die mich aber innerlich so stärkte, daß ich dann vortrefflich einem Angriff standzuhalten vermochte, dem ich plötzlich um Mitternacht in einem Caféhaus ausgesetzt war. Ich traf dort einen flüchtigen Bekannten mit seinen Freunden, einen beredten Ignoranten, namens Tiercelin, der sich mit seiner Unwissenheit brüstet und dann doch alles zu wissen glaubt, der Paris für die Synthese der Welt hält, von der übrigen Welt aber nie etwas gesehen hat und dem seine fehlenden Sprachkenntnisse, irgend etwas Fremdes zu verstehen, verbieten, selbst die antike Kultur zu kennen. Die Situation war für mich doppelt schwierig, da ich einem sehr beredten Menschen in einer mir doch fremden Sprache zu antworten hatte, und da die Debatte so laut wurde, daß sich ein großes Publikum bildete. Er wollte die Lage ausbeuten, indem er sich auf den Rassenhaß der Menge gegen den Deutschen zu stützen beabsichtigte. Aber es gelang mir plötzlich, das Publikum, das schon etwas drohend aussah, für mich zu gewinnen, indem ich rief: »Je connais et j'admire trop votre nation pour ne pas savoir que vous n'êtes qu'une ridicule exception comme chaque nation en produit.« Inzwischen kamen auch noch einige Bekannte von mir herein, die mir applaudierten, während Tiercelin aus dem Höllenlärm, der sich erhoben hatte, verschwand.
Frankfurt a/M., Samstag, den 25. Dezember.
Über Reims und Nancy, wo ich nocheinmal die französische Provinz in ihrer ganzen Ödigkeit erlebte, kam ich nach Straßburg. Dort mit Richard einen Abend in einem deutschen Weinhaus gesessen. Er ist sehr gereift, aber doch noch wirr und unklar. Am folgenden Tage mit ihm in Karlsruhe. Seine Freunde sind tüchtige Maler, die auch ihm originelle Ideen zutrauen. Er kann aber noch nicht zeichnen. Hermanns Arbeiten, von denen ich einiges bei mir hatte, machten unter diesen Leuten wenig Eindruck. Hermann ist doch zu literarisch. Es scheint, daß ihn die Literaten über-, die Maler unterschätzen.
Es ist doch noch viel Fremdes zwischen Richard und mir. Vielleicht ist es nur der Altersunterschied und seine häufig ungehobelte Art.
In Frankfurt von Großmama natürlich sehr herzlich empfangen. Die ganze Familie lebt untereinander in heimlicher Feindschaft, voll Mißtrauen. Genau das Gegenteil, wie es einst war. Otto anfangs sehr kühl. Mein Ehrgeiz wird sein, ihn langsam zu gewinnen. Gestern habe ich bei ihm vielleicht sogar schon Fortschritte gemacht. Hedwig scheint furchtbar zu leiden. Tilly hat dumme Streiche gemacht. Sie ist in Pension. Der Weihnachtsabend furchtbar, weil er wie jeder andere Abend war. Gründlers kamen zum Tee. Ich habe schon etwas versöhnlich gewirkt. Auch in Richards finanzielle Unordnung habe ich etwas eingegriffen. Er hat mich freiwillig zum Verwalter seines Vermögens ernannt. Es befriedigt mich überaus, hier Gutes wirken zu können. Für Hermann habe ich inzwischen durch Weidenbusch ein paar Bestellungen veranlaßt, die ihm vielleicht eine sichere Rente schaffen werden. Auch habe ich über ihn selbst im »Pan« und in der »L'Ermitage« geschrieben.
Ich lasse hier die Menschen im Glauben, daß ich bereits Katholik geworden bin, um mich durch den Courant dieser Gemeinschaft tragen zu lassen und gegen Angriffe zu schützen. Ich hätte ja diese Form schnell vollziehen lassen können, aber ich will es später tun, wenn ich die Zeit finde, mich würdig vorzubereiten, vielleicht einige Monate in einem Kloster.
Vor meinen Gedichten, selbst den ganz einfachen, steht Otto ratlos. Er versteht sie nicht. Merkwürdig dieser grundverschiedene Denkformalismus. Selbst Chrysanthemum und die Weise kann er nicht begreifen. Übrigens schreibt ein Kritiker in den Grenzboten über meinen Artikel über Dichtung im Pan, er sei unverständlich.
Überall fühlt man in Deutschland Aufschwung. Welche Bequemlichkeit des Reisens gegen Frankreich, welche Erzogenheit der unteren Stände, wie Kellner, Schaffner u.s.w. Und überall reges künstlerisches Leben.
Freitag, den 31. Dezember.
Alle materiellen Angelegenheiten glücklich erledigt. Ich kann nun beginnen mit dem, weswegen ich überhaupt hergekommen bin, englisch zu treiben, um mich auf meine Reise vorzubereiten. Viele Freunde wieder gesehen. Es scheint, daß ich in Berlin und München überall bekannt bin und gelesen werde. Wolfskehl sucht Einwände gegen den Katholizismus vom wissenschaftlichen Standpunkt aus. Ich hätte ihn nie dem Materialismus und Protestantismus so nahe geglaubt. Er sieht nicht, daß bei diesen Voraussetzungen sein Symbolismus durchaus in der Luft schwebt, und daß ich nur eine letzte Konsequenz ziehe.
Mit Richard eine gelungene spiritistische Sitzung gehabt, eine sogenannte Intelligenz erschien, warnte uns beide durch Tischklopfen vor der libido, riet mir, bald in ein Kloster zu gehen, behauptete aber dennoch, das Christentum sei für mich nicht die Wahrheit und erklärte am Schluß, sie moquiere sich über uns, da wir unwürdig seien. Sie gab sich übrigens für unseren Großvater aus.