
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Man muß seine »Bekümmernisse auf den Herrn werfen« und »ein' feste Burg ist unser Gott.«
Von der Wahrheit dieser beiden Sätze bin ich innig durchdrungen, und es ist die Frage, ob je ein Büßer diesen Vorschriften so treu nachlebte – oder, nachdem er sich davon entfernt hatte, mit so bußfertiger Beharrlichkeit dazu zurückkehrte – wie ich.
Als Buße für das ungezogene Umherirren in Afrika – ach, meine Absicht war nicht schlecht, ich wollte nur auf meine Weise andeuten, daß die Millionen, die wir suchen, da nicht zu finden sind, – lege ich mir selber die Verpflichtung auf, dem Leser einen guten Rat zu geben.
Wir alle sind mehr oder minder verrückt. Wie man in der reichsten, schönsten Hauptstadt Viertel findet, in dem sich die Armut in absichtlicher Weise zeigt, ebenso würden wir bei fleißigem Suchen in unseren Hirnen einen ungesunden Fleck finden und vielleicht mehr als einen. Man kann gewiß sein, daß solch ein Fehler in unserem Organismus herrschsüchtig ist und nach Ausbreitung strebt. Es ist unsere Pflicht, ihn kennen zu lernen und uns gegen Überrumpelung zur Wehr zu sehen. Die Hilfe Gottes ist dazu nötig. Ohne ihn sind wir nichts, wissen wir nichts, können wir nichts. Wer den wunden Fleck in seinem Denkvermögen weiterfressen läßt, – und das wird sicher der Fall sein, wenn wir Gottes Hilfe verschmähen – macht sich des Selbstmordes schuldig. Genau genommen ist jeder Verrückte gottlos. Er diente seinem Gott nicht.
Dieser Gott heißt Logos, die Vernunft. Er ist weise, gütig, ewig, allmächtig, treu. Sein Dasein beruht auf der Wahrheit der Tatsachen. Er ist die Wahrheit.
Wie dienen wir ihm? Dadurch, daß wir ihn – d. h. die Wahrheit – suchen. Wie beleidigen wir ihn? Wenn wir die Wahrheit verschmähen. Wenn wir die Mittel, die uns gegeben sind, um der Wahrheit nahe zu kommen, verderben. Welcher Ritus ist der beste, um den religiösen Sinn lebendig zu halten? Denken, Nachdenken, Schlüsse ziehen. Wer denkt, dient der Vernunft, und die Vernunft »wird euch frei machen.«
Als Gegenstand des Denkens wähle man mit Vorliebe ... einfache Grundwahrheiten. In der Majestät symmetrischer Logik stehen sie auf gleicher Stufe mit den verwickeltsten Fragen, die stets aus solchen einfachen Voraussetzungen zusammengesetzt sind. Die Gnomen hatten recht: zweimal zwei ist vier. Wer sich bereit macht, den Glauben daran und die Anwendung davon auf alles, was besteht, im Auge zu halten, der kann nicht verloren gehen.
Weiter Leser, wenn du betrübt bist, wenn du ein Abnehmen deiner sittlichen Kraft fürchtest, wenn du unter Sorgen gebückt gehst: denke! Und kannst du es nicht, lerne denken! Wähle zur Übung Gegenstände, die am augenfälligsten die Macht der Logik offenbaren: das Verhältnis von Zahlen und Linien, den elementaren Katechismus des Seins. Zwinge dich selbst zu der Exaktheit des Zweimalzwei und du wirst bald erkennen, daß Gott sich denen, die ihm dienen im Geist und in der Wahrheit, nicht unbezeugt läßt.
Was mich betrifft, so fühle ich innige Reue über die unschöne Art, wie ich nach dem Kursaal stürmte, als ich im Wahne war, daß dieser Hans den Millionen näher war als ich. Was sollte der Lümmel mit so viel Geld? Und ich, so intelligent! Ich, der so genau wußte, wo es in der menschlichen Gesellschaft haperte! Nun ja, aber ich suchte die Ursachen jener sechs Nullen, wo sie nicht gefunden werden konnten.
In der Eile, mit der ich meine berühmte Nummer 32 im Gasthaus verlassen hatte, versäumte ich, mehr als einen Thaler einzustecken. Ich hatte an dem Tage noch andere Gründe, kein großes Kapital zu riskieren, aber die übergehe ich jetzt.
Ich war wütend. Es war nicht das erste Mal, daß Schlüngel mich überholten, aber diesmal schien die Sache mir ganz und gar unerträglich, weil ich mich gerade so über meine Intelligenz gefreut hatte.
Es regnete den Tag. Das, oder auch das Gegenteil, kommt öfter vor. Auch schönes Wetter kann uns ärgern, und wir empfinden es dann als Hohn. Dumm genug, fassen wir alles, was die Natur uns bietet, auf, als wäre es um unsertwillen gemacht, und wir gleichen hierin immer noch den Schreibern von Genesissen.
Nun also, es regnete. Ich gab meinen Regenschirm ab und bekam eine Pappmarke ...
Nummer 32!
O heilige Morfondaria, wie deutlich sprichst du zu deinen Auserkorenen. Mein Zimmer im Gasthaus war eins unter fünfzig. Von diesen Pappkärtchen hatte der Türhüter Hunderte! Zweiunddreißig antwortete auf Zweiunddreißig.
»Tröste dich, liebe Morfon,« sprach ich in meinem Innersten, »über den Abfall jenes anderen Jünglings, der gewiß sich nicht in der Kunst geübt hatte, dich so zu verstehen wie ich. Tröste dich! Sieh hier einen neuen Verehrer, der gewiß soviel wert ist wie der andere. Ich werde dich ehren und preisen ...«
So fiel ich von dem guten Logus ab und setzte meinen Thaler auf 32.
Der scharfsinnige Leser kann sich denken, daß eine andere Nummer herauskam.
So? Kann er es sich denken? Schön, dann mag er sich zusammenreißen und seine Intelligenz auf das Spiel konzentrieren. Wenn man überzeugt ist, daß Gasthofszimmer, Regenschirm-Marken und Heilige falsche Nummern angeben, dann kann man schon schlechte Tips ausschließen, und der Gewinn ist sicher.
Wie ich heim kam, nahm ich meine Zuflucht zu Kamillenthee und einer stillen Schachpartie. Aber auch – und das ist besser – zu Zahlen!
»Wenn ich einmal ganz genau die Roulette beschriebe und die Chancen berechnete!« dachte ich.
Gewiß, das könnte mich retten. Und manche Leser auch. Ich weiß, diejenigen, die in die Geheimnisse des grünen Tisches uneingeweiht sind, werden immer weniger, und für die meisten ist also die Beschreibung überflüssig. Aber hie und da findet man doch noch einen, dessen Erziehung zu wünschen übrig läßt, und für solche Leute gab ich im vorigen Kapitel eine Beschreibung der einfachen Vorrichtung, die soviel Folgen hat, die gar nicht einfach sind.
Genau derselbe Grund treibt auch mich, zu Nutz und Frommen der wenigen in der Kultur Zurückgebliebenen mit meiner Beschreibung fortzufahren: Zu ebener Erde!
Sei gegrüßt, Logos voller Wahrheit!
Das hölzerne Gefäß, innerhalb dessen die einigermaßen beschriebene Drehscheibe sitzt, befindet sich inmitten einer langen Tafel, die mit grünen: Tuch bekleidet ist, und auf der sich zweimal – nämlich an beiden Seiten der Maschinerie – das sogenannte Tableau zeigt. Und das sieht so aus – wie hier in der Zeichnung ganz genau zu sehen ist.
*
Man kann nun auf verschiedene Arten setzen.
Auf eine Nummer, und zwar kann dabei sowohl die Null wie eine der anderen Zahlen gewählt worden. Diese Art des Spiels nennt man en plein (»voll«), und die Aussicht auf Gewinn ist 1/37. Kommt die besetzte Nummer heraus, so wird der Einsatz fünfunddreißig mal bezahlt.
Auf zwei Nummern, Das nennt man à cheval (»reitend«). Man setzt den Einsatz auf den Strich zwischen zwei Nummern, z. B. zwischen 17 und 20. Die Gewinn-Aussicht ist demnach 2/37. Der Einsatz wird im Fall des Gewinns siebzehnmal ausgezahlt.
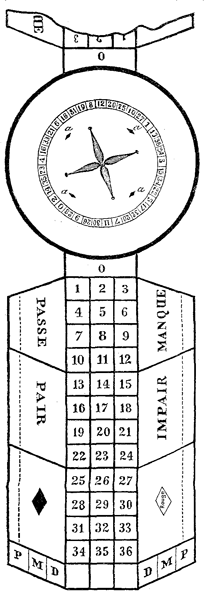
Fig. 1
Auf drei Nummern: transversale pleine (»einfache Querreihe«). Man setzt den Einsatz auf eine der äußersten Linien einer Querreihe, z. B. auf den Rand neben 4 oder neben 6 und gibt dadurch zu verstehen, daß man auf eine der drei Ziffern dieser Reihe wettet. Die Aussicht ist also 3/37 und die Bezahlung elffach.
Auf vier Nummern. Man setzt sein Geld auf das Kreuz zwischen vier Ziffern, in der Spielersprache carré (Viereck) genannt. Dasselbe bedeutet es, wenn man auf einen der Winkel bei 1 oder 3 setzt, wodurch die vier ersten Ziffern 0 1, 2, 3 bezeichnet werden, was also auf dasselbe hinaus will. Diese Art zu setzen gibt 4/37 Hoffnung auf Gewinn. Kommt eine dieser Nummern heraus, wird der Einsatz achtmal ausgezahlt.
Auf sechs Nummern: transversale (»Querlinie«). Man setzt den Einsatz an den Rand, auf einen Punkt, wo der Rand an einer Querlinie getroffen wird. Man erklärt dadurch, man will auf eine der sechs Nummern wetten, die zu beiden Seiten dieser Querlinie liegen. Im Gewinnfall – die Chance ist 6/37 – wird der Gewinn fünfmal ausgezahlt.
Auf zwölf Nummern: das Spiel auf colonnes (»Säulen«) oder douzaines (»Dutzende«). Die Säulen sind die langen Reihen von 1 bis 34, von 2 bis 35, von 3 bis 36. Man setzt den Einsatz in eins der leeren Fächer unter 34, 35, 36 und wettet damit auf eine der in dieser Längsreihe vorkommenden Nummern. Oder (bei douzaines) man wählt die besonderen Fächer, die mit P, M und D bezeichnet sind. P bedeutet Première (»erstes Drittel«), d. h. die Zahlen von 1 bis 12, M ist Milieu (»Mitte«), die Zahlen von 13 bis 24, und D ist Dernière (»letztes Drittel«) von 25 bis 36. Die Null gehört selbstverständlich nicht zu diesen Reihen, und wenn sie herauskommt, macht sie jeden Satz auf colonnes oder douzaines zum verlierenden. Das ist zwar auch bei anderen kombinierten Nummersätzen der Fall – außer dem Satz quatre-premiers, (»die vier Ersten«) von 0 bis 4, oder bei den à cheval-Sätzen 0 und 1, 0 und 3; – aber ich führe es ausdrücklich an, um vorzubeugen, damit man nicht annehme, daß die Null z. B. zur mittleren Kolonne gehöre, die ja dann widerrechtlich dreizehn Nummern hätte. Die Aussicht auf Gewinn beim colonne- oder douzaine-Spiel ist 12/37. Kommt eine der Nummern der Kolonne oder des Dutzends heraus, wird der Einsatz zweifach bezahlt.
Auf vierundzwanzig Nummern. Das ist das douzaine- oder colonne-Spiel à cheval. Man setzt auf die Linie, die P von M oder M von D trennt, oder – wenn man die Längsreihen wählt – auf die Linie zwischen zwei der leeren Fächer und erklärt dadurch, den Einsatz auf vierundzwanzig Nummern zugleich zu setzen. Die Gewinn-Aussicht steigt dadurch auf 24/37, aber die Bezahlung sinkt auf die Hälfte des Einsatzes.
Was nun die verschiedenen Einsatzarten betrifft, so fällt ins Auge, daß die Bezahlung im umgekehrten Verhältnis steht zu der Aussicht auf Gewinn. Arithmetisch genau ist das nicht ausgedrückt. Der en-plein-Satz z. B. gewinnt fünfunddreißig, und der carré-Satz achtmal. Im ersten Fall hat man nur eine Chance gegen vier beim Carré. Da nun eins zu vier nicht in dem Verhältnis steht wie fünfunddreißig zu acht und umgekehrt – und gleiche Unterschiede bemerken wir auch in den übrigen Verhältnissen – so scheint in dem allen eine Unregelmäßigkeit vorzuliegen.
Das ist jedoch nicht so. Bei allen bisher genannten Arten des Einsatzes wird das entsprechende Verhältnis des Gewinnes genau beobachtet. Bis auf eine Ausnahme, die man simple chance (»einfache Chance«) nennt, und die ich später anführen werde, ist der Spieltarif nirgends im Widerspruch mit sich selbst, weil alles von derselben Grundidee ausgeht: die Gewinnaussicht der Bank verhält sich zu der des Spielers wie 19 zu 18. Dieses Verhältnis entsteht aus der Ungleichheit zwischen der Zahl der Chancen und der Bezahlung, wenn man gewinnt. Es würde zusammenfallen, wenn die Bank den Einsatz, der auf einer gewinnenden Nummer steht, sechsunddreißigmal ausbezahlte statt fünfunddreißigmal. Der Einfluß dieses Unterschieds ist bei allen der angeführten Arten genau derselbe.
Angenommen, es besetzte einer alle Nummern en plein mit gleichem Einsatz, so müßte er auf eine dieser Nummern fünfunddreißig Einsätze gewinnen. Gleichzeitig fallen aber alle die übrigen sechsunddreißig verlierenden Nummern an die Bank, und diese gewinnt also als Überschuß einen der siebenunddreißig Einsätze, oder 1/37 vom Ganzen, oder, was dasselbe ist, 2 26/37 Prozent alles Geldes, das auf die Nummern gesetzt ist.
Die Dummheit, auf diese Weise, durch gleichzeitiges Besetzen aller Nummern bei jedem Spiel, 1/37 der Summe der Bank zu schenken, fällt ins Auge. Kein Mensch begeht diese Dummheit in einem und demselben Augenblick. Aber wenn er durchspielt, darf er sich keinen anderen Erfolg versprechen. Und das ganze Spielpublikum zusammen liefert im Nummernspiel unaufhörlich diese fatalen 2 26/37 Prozent.
Es ist weniger überflüssig als manche denken, diese Wahrheit recht klar hinzustellen. Unter den Stammgästen des grünen Tisches sind viele, denen es noch an Übung im Rechnen fehlt. Ich kann dem Leser versichern, ich habe mehrfach sogenannte ernsthafte Erörterungen angehört, ob das Carré-Spiel mehr Aussichten böte als die Colonnes? ob Transversales vorteilhafter wären als die Nummern en plein u. dgl. m.
Ich will also nun die verschiedenen Chancen, stets im Verhältnis zur Bezahlung, genau durchführen.
Ich sagte, das Verhältnis ist 18 : 19, oder der Spieler gewinnt bei siebenunddreißig Möglichkeiten auf die Dauer nur achtzehnmal und neunzehnmal verliert er.
Derselbe Spieler, der begriff, daß er durch gleichzeitiges Setzen auf alle Nummern den Betrag eines Einsatzes auf eine der siebenunddreißig Nummer verlieren muß, sieht oft nicht ein, daß er sich derselben Gewißheit zu verlieren aussetzt, wenn er siebenunddreißigmal hintereinander nur eine Nummer besetzt. Es macht keinen Unterschied, ob er zu den siebenunddreißig Einsätzen immer dieselbe Nummer wählt, oder manchmal oder immer wechselt. Immer bleibt die Wahrheit bestehen, daß auf siebenunddreißig En-plein-Sätze ein Einsatz verloren geht.
Diese Wahrheit ist das Palladium der Bank, soweit es arithmetische Verhältnisse angeht, denn es spielen noch ganz andere Ursachen mit. Sie offenbart sich bei den anderen Sätzen auf folgende Weise:
Setzt man einen Einsatz à cheval auf zwei Nummern, so wird angenommen, daß die Hälfte des Einsatzes auf jeder dieser Nummern steht. Im Gewinnfalle müßte also die gewinnende Nummer fünfunddreißig halbe Einsätze bringen, also 17 ½ Einsätze. Nun ist aber der andere halbe Einsatz, der auf der Nummer daneben stand, verloren, und dieser muß abgezogen werden: es ergibt sich die siebzehnfache Bezahlung des ganzen Einsatzes.
Eine gewinnende Transversale pleine verliert auf den zwei nicht herauskommenden Nummern ⅔ des Einsatzes. Die gewinnende Nummer, auf der ⅓ des Einsatzes stand, würde empfangen 35 X ⅓ Einsatz = 11⅔. Davon geht das Verlorene ab, macht elf Einsätze.
Beim Carré ist die Rechnung so: 35 X ¼ Einsatz = 8¾ Einsatz. Hiervon abgezogen die drei verlorenen Vierteleinsätze, bleibt die achtmalige Auszahlung des Einsatzes.
Die Transversale von sechs Nummern hat Anspruch auf 35 X 1/6 – 5/6 = 5, d. h. den fünffachen Einsatz.
Beim Colonne-Spiel wird angenommen, daß man jede Nummer der betreffenden Kolonne mit 1/12 des Einsatzes besetzt hat. Für die gewinnende Nummer hat also der Spieler 35 X 1/12 = 2 11/12 Einsätze zu fordern. Dagegen verfallen der Bank die 11/12, die auf die übrigen Nummern kommen, und der Rest ist die zweifache Bezahlung.
Wer sein Geld à cheval auf zwei Colonnes setzt, hat, wenn eine dieser vierundzwanzig Nummern herauskommt, zu bekommen 35 X 1/24 = 1 11/24 Einsatz. Er hat aber auch dreiundzwanzig Nummern besetzt, die verloren haben, diese 23/24 verfallen also der Bank, die dementsprechend bloß 1 11/24 – 23/24 = 12/24 oder die Hälfte des Einsatzes ausbezahlt.
Man sieht, bis jetzt ist die Bezahlung nirgends mit sich selbst im Widerspruch. Überall herrscht das Verhältnis 18 : 19, oder ein Verlierer mehr in siebenunddreißig Sätzen als auf Seiten der Bank.
Selbstverständlich braucht man, um z. B. sechs Nummern zu besetzen, nicht gerade eine Transversale zu nehmen. Wer etwa den Zahlen 1, 8, 19, 21, 28, 33 den Vorzug gibt vor einer arithmetischen Reihe, kann das auch in einem Satz ausdrücken. Er muß dazu jede dieser Zahlen mit einem besonderen Einsatz bedecken; aber der Erfolg ist derselbe. Hat er, sagen wir, auf jede dieser Nummern einen Gulden gesetzt und eine der Nummern kommt heraus, so bekommt er auf diese Nummer fünfunddreißig Gulden ausbezahlt. Aber der Einsatz der übrigen fünf Nummern wird eingestrichen, so daß der Netto-Gewinn nur dreißig Gulden beträgt, fünfmal den ganzen Einsatz von sechs Gulden, wie es ja auch bei der Bezahlung einer Transversale ist.
Die gleiche Berechnung kann man auf alle kombinierten Nummernsätze anwenden.
Da wir nun gesehen haben, daß man mit einem einzigen Einsatz auf zwei, drei, vier, sechs, zwölf, vierundzwanzig Nummern zugleich wetten kann, erscheint es sonderbar, daß sehr viele Spieler diese bequeme Art verschmähen und beispielsweise, anstatt zwölf Einheiten einer Geldsorte auf eine Kolonne zu setzen, gerade zwölf besondere Nummern wählen und diese einzeln besetzen. Was bewegt den Mann, der eher eine der Nummern 0, 1, 3, 7, 8, 13, 17, 25, 26, 31, 32, 36 erwartet, als eine der Nummern aus der Reihe von 1 bis 12? oder eine der zwölf Zahlen, die durch drei teilbar sind, nämlich die dritte Kolonne?
Ich werde das später untersuchen, wenn ich von den nichtarithmetischen Elementen der Sache spreche.
Das ist gewiß, daß viele Spieler – es gibt welche, die beinahe alle Nummern des Tableaus besetzen – sich unendlich mehr Mühe geben, als von einem rechnerischen Standpunkte aus nötig wäre. Manche machen aus dem Spiel eine so ermüdende Arbeit, daß ihnen der Schweiß die Schläfe entlang läuft.
Die Roulette arbeitet nämlich sehr schnell. Die einzelnen Coups (»Spiele«) folgen so schnell aufeinander, daß manchmal Anstrengung nötig ist, um davon Notiz zu nehmen, was die Fachleute – nicht zu verwechseln mit denen, die sich durch Leidenschaften hinreißen lassen – stets tun.
Zu dieser Buchführung ist der Nummernspieler nicht imstande, und es scheint für sein »System« auch nicht nötig zu sein. Was ihn in der Wahl der Nummern leitet, weiß ich nur zum Teil. Vielleicht ist es ihm selber auch unbekannt, in welchem Falle man ihn nur beklagen kann wegen der unnützen Mühe, die er sich gibt, um sein Geld zu verlieren. Das Besetzen von zwanzig, dreißig Nummern en plein, von einigen Transversalen und Carrés, und vor allem das Achtgeben auf die Geldstücke alle, die man gesetzt hat, das Verteidigen seines Eigentums gegen andere, die auch auf Nummern spielen, und die – oft in gutem Glauben – meinen, daß ein bestimmter einem anderen gehöriger gewinnender Einsatz der ihre ist, das Empfangen und Nachrechnen des empfangenen Gewinns – es versteht sich, daß man bei dieser Manier des Spiels beinahe immer etwas empfängt, wenn es auch auf die Dauer etwas weniger ist als die Summe der verlorenen Einsätze, die die Bank einstreicht – das alles erfordert eine gespannte Aufmerksamkeit, von der man sich keine Vorstellung machen kann, wenn man es nicht gesehen hat.
Und wer sich das nach Bücherschilderungen von »dem Spiel als Gegenstand dramatischer Leidenschaft« vorzustellen denkt, ist auf dem falschen Wege, wie jeder, der seine Eindrücke von etwas anderem nehmen will als der Wirklichkeit.
Ich will so gut wie möglich »zu ebener Erde« zeigen, was ein Nummerspieler – wohl zu unterscheiden von den Spielern im allgemeinen, den ich bei der Simple chance behandeln will – alles zu tun hat. Man denke sich hier alle Gefühle feinerer Art weg, man betrachte ihn lediglich als einen Arbeiter und sein Geschäft als ein Handwerk. Ich übergehe also alle psychologischen Betrachtungen und spreche nicht vom Gemüt, sondern nur von Händen, Nerven, Augen und Lenden. Diese letzteren Körperteile müssen ausdrücklich genannt werden, weil solch Nummerspieler, wenn er sich seinem Fache richtig widmet, nicht sitzen kann. Sein Liebhaberei-Handwerk nötigt ihn, fortgesetzt das ganze Tableau zu übersehen und jeden Fleck darauf erreichen zu können, was oft schwer genug ist.
Nehmen wir einstweilen an, daß er nur eine Geldsorte verwendet, den geringsten zulässigen Einsatz: einen Gulden. Das vereinfacht seine Arbeit und die meine beim Nachrechnen einigermaßen. Sein Spielkapital liegt vor ihm auf dem Tisch, der neben und hinter ihm von einer drei- und vierfachen Reihe von Spielern umgeben ist. Dutzende von Händen langen neben ihm und über ihn hinweg. Der eine trachtet, seinen Arm um ihn herumzubeugen, der andere streckt die Hand über seine Schulter aus. Viele suchen eine nördliche Durchfahrt zwischen seinem Leib und seinem Arm, d. h. sie streifen an der Summe entlang, die vor ihm liegt und also bewacht werden muß.
Da klingt es:
»Messieurs, faites le jeu!« (»Meine Herren, machen Sie Ihr Spiel!«)
Unser Freund nimmt eine Handvoll Gulden und setzt beispielsweise auf jede der Nummern 0, 6, 3, 32, 17, 19, 12, 11, 3, 9, 12, 23, 2, 11, 18, 0, 2, 26, 20, 36, 11, alles en plein.
Absichtlich vernachlässigte ich hier jede Reihenfolge. Ich ahme dem Spieler nach, um recht natürlich zu sein. Auch darin, daß ich mehr als einmal dieselbe Nummer besetze. Was ihn bewegt, nachdem er einmal auf die 0, auf 2, 3, 8, 11 und 12 gesetzt hat, später noch einmal Einsätze dazu zu fügen, auf die 11 sogar noch öfter, das verantwortete die heilige Morfondaria. Ich beschränke mich auf das Berichten.
Aber mein Bericht ist noch nicht vollständig. Und ungenau war er auch. Ich beobachtete noch eine gewisse Reihenfolge, indem ich erst alle En-plein-Sätze nannte und also die Sätze nach ihrer Art ordnete. So geht unser Spieler nicht zu Werke.
Seine Hand schweift und schwärmt schnell und unregelmäßig in nervösem Zucken über den Tisch, sodaß nicht nur der Zuschauer kaum folgen kann, sondern er selbst unmöglich mit Sicherheit wissen kann, wohin er sein Geld ... gestreut hat.
Nehmen wir an, daß zwischen die En-plein-Sätze noch folgende andere Sätze zu stehen kommen:
A cheval auf 0 und 3, 3 und 6, 8 und 11, 36 und 35, 22 und 23, 14 und 17, 25 und 28, 16 und 19, 22 und 19, 11 und 12, 12 und 9, 10 und 11, 11 und 12, 11 und 14; – auf die Transversales pleines auf 7–9, 31–33, 16–18, 12–10, 34–36, 10–12, 12–10, 10–12, 12–10 ...
Findest du, daß dieses öftere Zurückkommen auf die eine Querlinie sonderbar ist, Leser, ich kann nichts dafür. Ich zeichne nach Modell und verantworte mich, die Sache ist richtig. Daß ich die eine selbe Querreihe einmal 10–12 und einmal 12–10 nenne, ist wieder ganz korrekt, so unkorrekt es auch sein mag. Unser Spieler setzt seinen Einsatz einmal auf den Rand neben 12, und ein anderes Mal neben 10. Er wird seine Gründe dafür haben, und wenn sie sich meiner Wahrnehmung entziehen, so will ich doch lieber für dumm als für unwahr gehalten werden.
Aber wir sind noch nicht fertig. Es werden noch – oder zwischendurch Einsätze geleistet: auf die Carrés 5 zu 9, 28 zu 32, 11 zu 15, 25 zu 29, 26 zu 30, 7 zu 11, 31 zu 35, 8 zu 12, 10 zu 14; –
auf die Transversalen 28 zu 33, 25 zu 30, 1 zu 6, 10 zu 15, 19 zu 24, 7 zu 12; –
auf das erste Dutzend, –
auf die dritte Colonne, – ...
Was nun dieser unglückliche Gulden auf zwölf Chancen bedeuten soll – 8½ Kreuzer auf eine Nummer! – das verstehe ich wieder nicht. Man kann daraus lernen, daß nicht gerade eine Reise unter die Erde nötig ist, um auf Geheimnisse zu stoßen. Die Ungereimtheit eines solchen Satzes, der in keinem Verhältnis zu den übrigen steht, fällt jedem ins Auge, nur dem Nummernmann selber nicht. Aber es ist unvorsichtig, die Ursachen, die ihn etwa bewegten, allzu nachdrücklich aufzuspüren. Ich will es später tun, da ich mir doch einmal vorgenommen habe, alles zu wissen ...
Da haben wir so einen Satz auf colonne von mir selbst!
Unvorsichtig nannte ich es, nach der Ursache dieser siebzehn halben Kreuzer auf solch einer Kolonne zu suchen; denn es wird dadurch der Schein erweckt, als wüßten wir etwas von dem ursächlichen Zusammenhang, der die anderen Einsätze beherrscht, und als könnten wir den verschiedenen Arten des Nichtwissens einen Rangunterschied zuerkennen. Wir müssen uns genügen lassen, daß der Spieler, um nicht in den Verdacht des Wahnsinns zu kommen, gewisse geheime Anlässe hatte, deren Begründung wir vorläufig nicht beurteilen können. Vielleicht zeigt sich später etwas davon.
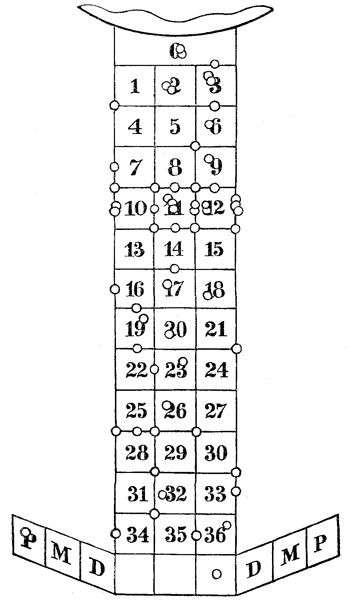
Fig. 2.
Wenn nun unser Nummernsetzer seine Arbeit fertig hat, sieht das Tableau, soweit es sich um die Einsätze dieses einen Spielers handelt, so aus wie Seite 134 hier im Bilde zu sehen ist.
Man bedenke indessen, daß auch die anderen Spieler während derselben Zeit ihre Einsätze gemacht haben, und daß also eine ermüdende Aufmerksamkeit dazu gehört, ich sage nicht, die Vaterschaft aller dieser Einsätze auseinander zu halten, – das ist unmöglich – sondern das fortdauernd zu versuchen.
Hierüber entsteht denn auch manchmal Streit.
Aber nicht so oft, als der Uneingeweihte denken sollte.
Daß einer und derselbe Einsatz sehr oft von mehr als einer Person als der eigene angesehen wird, kommt wohl vor. Aber diese Meinungsverschiedenheit zeigt sich lediglich, wenn der strittige Einsatz auf einer gewinnenden Stelle steht; denn das verlorene Geld fällt ja alles an die Bank, und in diesem Falle hat niemand ein Interesse daran, zu wissen, wer es verloren hat.
Auch muß hierbei bemerkt werden, daß von der eigenartigen Sorte von Spielern, die ich Nummernsetzer nannte, gewöhnlich nur einer am Tische ist. Viele Mitglieder des Spielpublikums – ich rede noch immer nicht von den Liebhabern der simple chance: der Hauptsache! – besetzen auf Nummern nur einige Chancen. Der eine spielt zwei, drei Nummern en plein, der andere ein Paar carrés u. s. w. Alle diese Sätze zusammen aber machen kaum so viel aus wie die hier angeführten Nummernsätze jenes einen Spielers. Freilich, es kommt wohl manchmal vor, daß zwei oder drei von dieser Sorte, in der Hochsaison, einmal einander auf demselben Jagdgebiet begegnen. Dann steht das Tableau buchstäblich voll.
Man muß anerkennen, daß die Croupiers Das Wort soll von croupe kommen, dem Rechen, mit dem das Geld hingeschoben und eingestrichen wird. Dies Instrument heißt aber stets râteau. Die Croupiers selbst nehmen diese Bezeichnung übel; wer für höflich gelten will, sagt: Messieurs les employés de la Banque – »Angestellte der Bank.« Warum nicht? (Anm. d. Verf.) sehr aufmerksam sind und auf die Interessen der Spieler mehr acht geben, als man eigentlich von ihnen verlangen kann.
In den Reglements nämlich ist ausdrücklich vorgeschrieben, daß die Bank sich in Streitigkeiten der Spieler nicht einzulassen braucht. Die Angestellten der Bank sind aber öfter in der Lage, eine Art Entscheidung zu treffen, sei es durch die Bezahlung selbst, oder dadurch, daß sie ruhig geschehen lassen, daß der Nächstsitzende oder Unverschämteste sich durch schnelles Zufassen in Besitz der »Masse« – Spielausdruck – setzt. Wer das auf eine Gewinnnummer ausbezahlte Geld einstreicht, hat vor dem Reklamanten, der die strittige Summe nicht im Besitz hat, viel voraus, denn es ist viel einfacher, etwas zu behalten, als es zu bekommen – eine einfache Wahrheit, auf der jener allbekannte Rechtsgrundsatz zu beruhen scheint.
Die Bank bezahlt den Gewinn eigentlich nicht an eine Person aus, sondern an die gewinnende Nummer oder an die gewinnende Farbe. Sie tut, als hätte sie mit dem Spieler nichts zu tun, und betrachtet die gewinnende Stelle des Tableaus als den Wohnsitz des Gläubigers, an dem sie sich ihrer Verpflichtung gesetzlich entledigen kann. Es ist ihr gleich, wer da behaupten mag, an diesem Wohnsitz vertreten zu sein. Das ist Prinzip und Regel.
Aber es kommt vor, daß die Bank eine bereits eingestrichene Gewinn-»Masse« noch einmal an einen anderen Spieler auszahlt. Was sie zu dieser Großmut veranlaßt – sie weiß, was sie tut! – will ich später behandeln; aber ich bemerke schon jetzt, daß hieraus zu schließen ist, wie die Gewinn-Chancen nicht allein – oder besser: nicht hauptsächlich – auf arithmetischen Gründen beruhen, weil alle für die Bank günstigen Zahlenverhältnisse – die 2 26/37 Prozente! – durch eine so großmütige Ausnahme von der Regel umgestoßen werden. Ich stehe dem Gedanken nicht fern, daß die Bank auch ohne die 2 26/37 Prozent gute Geschäfte machen würde, d. h. wenn sie den Einsatz gewinnender Nummern sechsunddreißigmal auszahlte.
Indessen, wer das Spiel ergründen will, muß zunächst vom mathematischen Standpunkte ausgehen, und auch später, bei den verwickelteren Verhältnissen, Umständen und Empfindungen, die das Spiel beherrschen, bleibt stets eine gewisse mathematische Betrachtung nötig. Nicht minder als sonstwo wird auf dem Gebiete der menschlichen Schwächen, Tugenden und Leidenschaften – zweimal zwei vier sein. Die Betrachtung mag mehr Anstrengung erfordern und mehr Gefahr bieten, in Irrtum zu verfallen, als die untrüglichen, offenherzigen, treuen Zahlen: Wahrheit ist stets Wahrheit.
Und – wie überall – das eine erklärt das andere. Meine Gnomen waren so unverständig nicht. Sie ...
Nein, erst unser Nummernwüster! Wir sahen, daß er, um einundsechzig Gulden an verschiedene Chancen zu wagen – er packte ja das Glück auf hundertzweiundsiebzig Stellen zugleich an! – ebenso viel mal den Arm ausstreckte. Die Zahl der Bewegungen wird durch Zweifel in der Wahl noch erhöht. Nur wenige Gulden wurden einem vorbedachten Plan gemäß gesetzt und mit etwas Mut der Überzeugung. Die Hand des Spielers irrt von 36 zu 0, von den douzaines nach der Mitte, wieder nach der Null, zum Rande zurück, wieder in die Mitte ... nein, Null ist besser, oder ... doch nicht, elf ist gut ... nein, lieber eine Querreihe oder ... sonst etwas. Das andere – er weiß nicht was – ist immer besser ... er weiß nicht warum. Endlich findet das Stück seinen Platz – es mußte wohl! Zwischen all den übrigen Sätzen wird es erst rechts und links verschoben, zwei-, dreimal, schnell in ein anderes Fach, schnell vom Carré zum Plein befördert oder von einer vollen Querreihe zu einer von sechsen degradiert.
Dies Wühlen, Arbeiten, Mühen dauert, bis das Kügelchen auf die Messingplatte springt.
In diesem Augenblicke ruft der Croupier:
»Rien ne va plus!« (»Jetzt gilt nichts mehr.«)
Noch möchte der Spieler gern in der Eile dem Schicksal eine bessere Chance abschmeicheln. Er hatte gern das Carré von 5 zu 9 vertauscht mit ... mit ...
Es ist zu spät! Schade, wie? Er hätte so gern den einen Gulden nach 4 zu 8 verschoben oder auf ein anderes Carré, das natürlich besser ist als 5 zu 9. Er muß ihn nun in Gottes Namen stehen lassen, aber es ist hart. Warum er den enormen Unterschied der Chancen eines anderen Carrés so spät einsah, weiß ich nicht, auch nicht, warum er denn nicht all sein Geld auf das bevorrechtete Kreuz setzte.
Mit noch mehr Grund könnte man fragen, warum er die Nummer elf so häufig besetzte. Er scheint eben Vorliebe für sie zu haben. Er setzt auf sie, noch einmal, neben sie, um sie herum. Er bekränzt sie ordentlich mit Einsätzen. Er hat Vertrauen zu dieser Nummer ...
Vertrauen ... ja – Vertrauen ... nein. So sehr fest ist es nicht. Na ja, er vertraut schon, aber er weiß sein Vertrauen in Schranken zu halten. Er vertraut mit Maß. Er vertraut ... mit Vorsicht, mit Verstand, mit Vorbehalt, das heißt, wohl betrachtet, mit einem bißchen Mißtrauen. Er bekennt seinen Glauben, seinen festen Glauben an die Nummer Elf zwanzigmal. Dreimal setzt er plein, fünfmal à cheval, fünfmal transversale pleine, viermal carré, zweimal transversale zu sechs, einmal auf das erste Dutzend – zusammen der Betrag von 3–5/2 + 5/3 + 4/4 + 2/6 + 1/12 Gulden, macht acht Gulden und achtundfünfzig und ein drittel Kreuzer, etwa den siebenten Teil seines ganzen Einsatzes, den er im übrigen auf 152 andere Chancen verteilt – aber es scheint doch etwas Faules in dem Glauben zu sein.
Wenn ich die Elf wäre, ich käme nicht heraus!
Man kann keinen 152 Chancen dienen. Glaube an mich, und bete an, was du sonst willst, aber verlange nicht, daß ich mich in fünfunddreißigfacher Gewinnkraft offenbaren soll, so lange du dich noch mit 10, 12 u. s. w. einläßt ...
Alle diese Arbeit verrichtet er nun siebzigmal in der Stunde, denn so oft kommt durchschnittlich ein Coup auf der Roulette zustande. Und das hält er eine ganze Saison lang – in Homburg das ganze Jahr hindurch – sechs bis acht Stunden täglich aus. Deswegen sprach ich von Lenden ...
Während all dieser Zeit ertrug er das Drängen, Stoßen, Schubsen seiner Umgebung. Und noch viele andere Sachen ertrug er, die ich übergehen will, da ich keine Aussicht sehe, die vielerlei Arten von Hitze zu beschreiben, die oftmals in so einem Saale herrschen.
Die meisten dieser Spieler sind ... Frauen. Frauen, d. h. Damen, Gräfinnen, Prinzessinnen.
Um das wahre Ziel, die richtige Gliederverrenkung, vollkommen zu erreichen, ist eine gewisse Zeit nötig, eine Zeit, die durch das verfügbare Kapital ziemlich genau bestimmt wird.
Der arme Teufel, der nur wenige hundert Gulden zu verlieren hat, läuft allerdings Gefahr, den Spieltisch verlassen zu müssen, ehe er gehörig gerädert ist.
Aber das braucht den minder Bemittelten nicht gleich mutlos zu machen. Für eine normal gebaute Person, die die Saison bis zur Erschöpfung durchstehen will, sind nicht die Schätze nötig, die z. B. die Gräfin Kisseleff dieser Turnübung gewidmet hat. Die Lenden dieser Dame wetteifern an Zähigkeit mit ihrer Kasse. Man versichert, daß sie, ohne umzufallen, alle diese beschriebenen Kitzel, und die nicht beschriebenen dazu, viele Millionen Gulden lang ausgehalten hat. Wie ich höre, spielt sie noch immer durch, aber infolge einer grausamen Beschränkung ihrer Mittel – man munkelt von Kuratel – kann sie sich jetzt jährlich nur noch für ein paar Hunderttausende von Rubeln Kreuzschmerzen verschaffen. Wenn diese Summe hin ist, zieht sie sich auf das eine oder andere Schloß zurück und wartet dann murrend auf das nächste Jahr. »Die Kisseleff ist eben abgereist,« heißt so viel wie: es ist der so und sovielste. Allerdings hat sich einmal einer, der seine Uhr danach stellen wollte, um drei Minuten und einige Sekunden geirrt. Sie hatte fünf Spiele verpaßt, eine Lücke, die ihre Nerven denn auch ungeheuer angegriffen hat.
Wenn ich den Namen der Gräfin nenne, begehe ich keine Indiskretion. Jeder weiß es, und sie macht auch kein Geheimnis daraus. Sie soll auch gegen den Ruf eines Spielmatadors nicht gleichgültig sein. Ich kenne sie nicht persönlich und weiß also nicht, ob ich sie habe spielen sehen, aber oftmals habe ich die Heldentaten ihrer Geistesverwandten studiert.
Eine andere Dame hat denselben Geistesflug. Das ist Prinzeß***; ich hielt sie erst für eine Ungarin und taufte sie Buda. Sie gibt der Kisseleff an Lenden und Vermögen nichts nach. Den Sommer über ist sie in Wiesbaden, und immer am grünen Tisch. Im Winter flüchtet sie nach Homburg, wo der Spielsaal – bekanntlich jetzt, 1872, zum letzten Male – das ganze Jahr in Betrieb ist. Nach Zeitungsmeldungen ist Aussicht, daß derartige Einrichtungen jetzt in Frankreich wieder ins Leben treten werden. Dann werden also die Kisseleffs und Budas ihre Jagd nach Ermüdung und Millionen in diesem Lande fortsetzen müssen.
Ich will nun einmal untersuchen, welches die finanziellen Folgen aller der Einsätze sind, die ich unseren Nummernspieler mit einem Male wagen ließ.
Es versteht sich von selber, daß er durch seine Spielweise sich im wahren Sinne selbst entgegenarbeitet. Wir sahen das schon, als wir den sehr gegründeten Jeremiaden der Elf lauschten. Jeder neue Einsatz ist ja eine Wette gegen den vorigen, und wer alle Nummern besetzte, um die Aussicht auf Verlust auszumerzen, würde – von dem sicheren Verlust von 2 26/37 Prozent rede ich jetzt gar nicht – sich schon dadurch alle Hoffnung auf Gewinn abschneiden.
In dem Spielen so vieler Nummern zugleich liegt also etwas Kindisches, Naives, etwas – die Kisseleff und Buda lesen kein Holländisch – etwas Idiotenhaftes.
Man will gewinnen, wagt aber nicht zu verlieren, und um die Verlustmöglichkeit auszuschließen, versichert man sich so dagegen, daß schließlich zum Schlusse der ganze Zweck – der Gewinn nämlich – ausgeschlossen ist. Das kann manchmal, wenn gerade eine überladene Nummer herauskommt, anders aussehen; auf die Dauer aber ergibt sich, daß man sich große Mühe gegeben hat für einen geringen Umsatz, und daß man, – wenn man es, außer auf die Kreuzschmerzen, auch auf einen gewissen Kitzel des Hoffens und Fürchtens abgesehen hatte – eine andere Spielmethode hätte wählen müssen. Ergebnis: Nummernsetzer sind die wahren Spieler nicht.
Man rechne sich einmal die Möglichkeiten aus, die die angegebenen einundsechzig Sätze unseres betriebsamen Idioten treffen können.
Dabei ist aber noch zu bedenken, daß ich mein Schema in gewissem Sinne noch zu günstig eingerichtet habe, weil das Überladen einiger Nummern doch eine bestimmte Spannung hervorruft. Ein wenig gleichmäßigere Verteilung – und es wird beinahe gleichgültig, wie das Kügelchen fällt. Man schwebt dann nicht mehr zwischen Furcht und Hoffen, sondern beschäftigt sich lediglich gutmütig damit, seine 2 26/37 Prozent der Bank zu liefern, d. h. von jedesmal siebenunddreißig Gulden einen.
Unser Spieler hat die Null zweimal »voll« besetzt und einmal »à cheval.« Kommt die Null heraus, so gewinnt er also 2 X 5 (auf die vollen Sätze) und 1 X 17 (à cheval), macht 87. Dafür verliert er alle übrigen 58 Einsätze, bleibt Gewinn: 29.
Die Eins hat er mit einer »Transversale« und einer »Douzaine« besetzt. Kommt die Eins heraus, so gewinnt er 1 X 5 und 1 X 2 = 7; verloren hat er die übrigen 59. Also Verlust: 52.
Die Zwei hat er zweimal »en plein«, einmal mit einer »Transversale« und einmal mit einer »Douzaine« besetzt. Das ergibt im Gewinnfalle 2 35 + 1 X 5 + 1 X 2 = 77, wovon die übrigen 57 Sätze als verloren abgehen. Gewinn: 20.
Rechnet man so weiter alle übrigen Nummern durch, Dekker führt diese Berechnung, die naturgemäß eine lange Tabelle ergibt, in der Tat durch. Wir beschränken uns hier auf die abgekürzte Wiedergabe. so ergibt sich, wenn man schließlich alles summiert, auf die 61 Einsätze ein Verlust von 61 Gulden. Es sind also die üblichen 2 26/37 Prozent regelrecht verloren. Was zu beweisen war.
Nur von sehr oberflächlichen Beurteilern – z. B. von Buda – erwarte ich den Einwurf, daß die Berechnung unrichtig ist, weil die siebenunddreißig Chancen sich nie in ebenso vielen Spielen herausstellen, und daß also die Möglichkeit vorliegt, daß eine Nummer, sagen wir die Elf, auf Kosten der übrigen Nummern öfter als einmal, ja oft herauskommen könnte; in diesem Falle würde ja unser Spieler nicht nur die Steuer von 2 26/37 Prozent wett machen und selbst mit Überschuß abschließen können. Gewiß, wenn eine schwer besetzte Nummer öfter herauskommt, als die Norm ist, ist er im Gewinn. In diesem Falle ist es aber immer schade, diese Einnahme durch unnütze Ausgabe für die anderen Chancen zu beschweren. Indessen, man bedenke, daß im Ganzen ebenso viel Aussicht auf das Herauskommen einer nicht oder schwach besetzten Nummer vorhanden ist, und daß hierdurch das zeitweise Vorherrschen einer vorteilhaften Nummer neutralisiert wird. Gegen die Behauptung, daß unser Spieler-Modell gewonnen hätte, wenn die meistbesetzte Nummer mehr gewonnen hätte, als sie eigentlich an der Reihe war, steht wieder der größere Verlust, wenn diese Nummer einmal plötzlich ausbleibt. Das eine kommt so oft vor wie das andere, und diese Chancen gleichen sich schließlich in der Unendlichkeit vollkommen aus, d. h. ohne Gewinn oder Verlust zu liefern. Selbst das Verfolgen dieses Ausgleiches aber kann wieder nur auf Kosten der Steuer von 1/37 geschehen, die bei allen Einsätzen mitspricht.
Wie kommt es nur, daß die Spieler an dem Aufbringen dieser Steuer ihre Befriedigung finden?
Der Mensch ist in seiner Verirrung ein sonderbares Problem!
Angenommen, zwei Individuen oder Gesellschaften, die dieses Spiel auf siebenunddreißig Nummern gegen einander spielten, wären durch gewisse Umstände genötigt, den Gewinn sich gegenseitig durch eine dritte Person überbringen zu lassen. Dann würde es doch sehr unangenehm sein, dauernd weniger zu empfangen, als nach mathematischer Berechnung der wirkliche Gewinn betragen müßte, nicht wahr? Es würde sich auch keine Partei mit Geldstücken befriedigt erklären, an denen die Mittelsperson bei jedem Transport 1/37 abgeknipst hätte. An der Spielbank aber scheint man gegen diesen Löwenanteil des Unterhändlers kein Bedenken zu haben.
Die Untersuchung der Ursache dieser Großmut gehört jedoch unter die Rubrik »Menschkunde«, und wir haben es jetzt noch mit Zahlen zu tun.
Die Berechnung der Anzahl von Nummern, die in jedesmal siebenunddreißig Spielen herauskommt – in Zusammenhang natürlich mit der Anzahl von Wiederholungen einzelner Nummern in einer solchen Gruppe von Spielen Anm. d. Verf. Wenn eine Nummer gekommen ist, steht die Aussicht, daß sie noch einmal kommen wird, zu der, daß eine andere folgt, wie 1 : 36, oder wie 1/37 : 36/37. Nehmen wir nun an, daß die zweite Nummer eine andere war, so ändert sich beim drittenmal das Verhältnis der Chancen bereits dagewesener und neuer Nummern in 2/37 : 35/37. Und so nimmt der erste Bruch stets zu, der zweite stets ab. Nach dem neunzehnten Satz ist die Aussicht, daß eine bereits dagewesene Nummer wiederkommt, – falls noch keine Wiederholung stattgefunden hat – schon größer als die Hoffnung, daß eine neue Nummer kommt. Und nach vier-, fünf-, sechsunddreißig Sätzen wird die Aussicht auf Wiederholung schon dagewesener Nummern beinahe zur Gewißheit. Man sagt, daß manchmal eine Nummer in mehr als tausend Spielen nicht gekommen ist. Das ist möglich, die unregelmäßige Wiederkehr anderer Nummern beweist es. Wo einer zu viel bekommt, muß der andere darben. Das ist überall so. Aber in der Wahrscheinlichkeitsrechnung gleichen sich solche Ausnahmen später wieder aus. Ob das überall so geht? Zweifel ist erlaubt. – würde mich weiter führen, als ich gehen will. Es ist auch unnütz, weil die mittlere Norm nur in der Verrechnung unendlicher Möglichkeiten existiert und sich nie in der Tat zeigt.
Über diesen Unterschied zwischen Wirklichkeit und mathematischer Theorie will ich das eine und andere sagen, wenn ich von den »simples chances« spreche; bei diesen läßt die größere Einfachheit angenehmere Berechnung zu. Wir sahen schon einmal, wie viel Zahlen nötig sind, um die Chance von sechs aufeinanderfolgenden Zahlen zu bestimmen. Hierin suche ich die Erklärung, warum so viele Damen und auch Herren, die noch schlechter rechnen, als die Spieler anderer Chancen gewohnt sind, gerade das Nummernspiel zum Gebiet ihrer unergründlichen Spekulationen wählen. Man fühlt, daß einem das Verständnis für die launenhafte Nummernfolge fehlt, und unbewußt leitet man von seiner eigenen Unwissenheit eine Art von Hoffnung ab, daß auch die gute Natur ebenso verwirrt sein könnte und sich etwa durch allerlei Kunstgriffe irritieren ließe. Mit einem Worte, man will das Schicksal foppen.
Weil man selbst ein schlechter Buchhalter ist, erwartet man das auch von der Natur der Dinge, die gewiß aus so einem vollgesetzten Tableau nicht klug werden wird, und dann könnte sie wohl einmal aus Versehen so ein paar Elfen zugeben. So kann ich mir einigermaßen erklären, was ich bisher als Torheit bezeichnete, wenn ich auch nicht behaupten will, daß diese Erklärung mein Urteil berichtigt.
Ich will aber als mildernden Umstand anführen, daß wir dieselbe Erscheinung überall finden. Diejenigen, die die unabänderliche Natur der Dinge zu einer Person machen, zu einem Wesen, das Willen hat zum Wählen – Willkür! – sind fortwährend dabei, dieses Wesen auf allerlei Weisen zu beschwindeln. Man schmeichelt ihm, kitzelt seine Eigenliebe, verspricht ihm Angenehmes, beruft sich auf geleistete Dienste, auf Parteinahme gegen seine Feinde, auf das Vernachlässigen des eigenen Urteils, um alles seinem gnädigen Ratschluß zu überlassen, d. h. man hofft, daß diese Person, durch soviel Verleugnung der Wissenschaft, soviel Vergewaltigung der eigenen Würde gerührt, ab und zu einmal eine günstige Elf zulegen wird. Da haben wir die Religion!
Ob diese Schicksals-Umschmeichlung nun für die Unglücklichen, die nicht auf so eine Nummer Elf gesetzt haben, sehr erfreulich ist? Aber die schmeicheln, bitten, belügen auch ...
Der Menschenfreund mag sich beruhigen. Die Vernunft läßt sich nicht foppen, die Spielbanken auch nicht. Die Elf und die Nichtelf kommen genau so oft, als es mit den Erfordernissen der Gerechtigkeit – und dem Interesse der Aktionäre – übereinstimmt. Jede zeitliche Abweichung wird wieder ausgeglichen, und selbst in diesen Abweichungen ist eine bestimmte Regel zu beobachten, die dem Denker Ehrfurcht einflößt – da haben wir die wahre Religiosität! – Ehrfurcht vor der majestätischen Wahrhaftigkeit von allem, was ist. Auch diese Regel hat wieder ihre Ausnahmen, die ihrerseits wieder durch die Gesetze einer imposanten Symmetrie beherrscht werden. Mit erstaunlicher Präzision sehen wir das Zweimalzwei sich zu einer unendlichen Reihe von Vernunftschlüssen ausbreiten, die stets aufeinander folgen und stets zusammenstimmen, stets einen Weg gehen und stets auf das eine harmonische Ende auslaufen: Einheit, Ordnung, Wahrheit!
Da fällt kein Kügelchen von Elfenbein in ein einziges Nummernfach, ohne den Willen des Logos, der von Anbeginn an alle Serien und Intermittenzen gezählt hat und nicht will, daß eine Nummer verloren gehe. Er läßt seine Chancen aufgehen über Fünfen und Sechsen, zeigt sich auf dem rechten Quadrat und der linken Seite, auf hoch und auf niedrig. Er schenkt seine Gunst einer jeden nach mathematisch bescheidenem Anteil. Was schief aussieht, ist richtig. Was unregelmäßig schien, ist genaue Gesetzmäßigkeit. Logos errichtet Übereinstimmung aus endlosen Abweichungen und schafft aus der gegenseitigen Vernichtung der Abirrungen ein Ergebnis von Harmonie.
Unser Gedanke schweift ins Wilde. Wir suchen in afrikanischen Büschen nach der Ursache eines mangelhaft beobachteten Faktums. Und vergebens sind unsere Versuche, die Ewigkeiten heraufzubeschwören, um aus dem Vorausgegangenen und über das, was uns geheimnisvoll scheint, Rechenschaft abzulegen. Nicht aber irrt die Vernunft, die aus einer Kette von Vernunft besteht. Sie, Logos, die Logik, das Sein, der tatsächliche Ausdruck der Folgen von allem, was war, und deshalb von allem, was ist, irrt sich nicht. Sie muß wissen, wo das Kügelchen fällt, weil das eine notwendige Folge von allem ist, was vorausging.
Wissen? Nein! Das Bedürfnis, zu wissen – die herrliche Unvollkommenheit, die uns zur Vervollkommnung reizt – ist, wie Hunger und Schmerz und fortwährende Auflösung, eine menschliche Eigenschaft und also eine Grundbedingung unserer Existenz. Logos braucht kein Wissen: er drückt aus. Seine Resultate werden in Tatsachen verkündigt.
Und wenn nun auch ein gewisser Spott über unsere Unkenntnis in der launigen Art liege, in der ich jenen sechs Nullen nachjagte – man hat gesehen, schon bei der ersten wußte ich keinen Rat – die Turbulenz eines so unsinnigen Trachtens kann doch zu einer Art von Ermutigung führen.
Ich hoffe, bei jener Elefanten-Geschichte wird der Leser ausgerufen haben: so kann man sich viel austüfteln, träumen, phantasieren ... da gibt es kein Ende!
Richtig: da gibt es kein Ende! Es gibt wirklich kein Ende unseres Nichtwissens. Und das wollte ich auf meine Weise andeuten.
Aber ist es nicht traurig, so überzeugt zu werden, daß unserem Streben nach Wissen – der Vorbedingung unserer Existenz, unserem Beruf, unserem Glück – nie Genüge getan werden kann? Sind wir dadurch nicht zu einer Tantalusqual verdammt? Ist nicht unser ganzes Leben dann eine Enttäuschung?
Wahrhaftig nicht.
Im Gegenteil. Die Schwierigkeit der Untersuchung, die Unmöglichkeit, bis zu einer ersten Ursache durchzudringen, macht unsere Aufgabe zu einer unendlichen Quelle des Genusses. Solch eine erste Ursache gibt es nicht. Zu unserem Glücke – d. h. notwendigerweise – geht ihr stets noch eine andere erste, eine allererste voraus, die ihrerseits wieder eine sehr gehorsame Folge von etwas Früherem ist ...
Wer kann uns sagen, wo
Aus Multatuli (Dekker), Fürstenschule. Schauspiel in fünf Akten. Halle a. S., Verlag von Otto Hendel.
Ein Anfang ist? Welch Punkt auf dem Äquator
Kann rühmen: ich, ich war's, ich hab' zuerst
Die Sonn' gesehen ... bei mir begann der Tag?
Was ist Beginnen? Was ist Enden? Nichts!
Stets wird bewegen sich, was sich einst bewegte.
Bewegen, weitergehn – nicht immer vorwärts! – ist
Bedingung und Bestimmung alles Seins.
Bestehen ist: anders werden. Jede Terz
Jeder Sekunde trägt die Nabelmarke,
Wie wir. Wer's leugnet, sprech: ich hatte keine Mutter!
Ach, es wäre schmerzlich, wenn es anders wäre! Schmerzlich? Ja, nein ... es wäre ja dann nichts ... also auch kein Schmerz über so viel Totheit.
Eine erste Ursache ist schon an sich eine unlogische Erscheinung. Es besteht kein Grund, warum die Nachkommen sich logischer betragen sollten als so eine unbegründete Stammmutter. Zweimal zwei würde sich bald erlauben, drei oder fünf zu sein, etwas anderes als vier. Das tut diese liebe ehrliche Rechnung nicht! Überall und immer läuft sie in eine unumstößliche Vier von Arbeit, Streben, Kämpfen aus.
Unser Nichtwissen, zusammen mit der Lust zu wissen, und vor allem mit dem Bedürfnis zu wissen, das ist der Triumph der Menschheit. Darin liegt ja der Unterschied zwischen uns und anderen Wesen von dem Stoff, daß wir zum Bewußtsein unserer Unkenntnis durchdringen können, und daß wir diese dann in geistigen Turnieren bekämpfen dürfen und müssen.
Welchen Reiz hätte es, unseren Einsatz in die Fächer des großen Welttableaus zu setzen, wenn wir darauf mit sicherem Gewinn spielten? Oder besser – und das beweist wieder das Nichtsein, wenn etwas anders wäre als es ist – wäre nicht sofort das ganze Spiel eine Unmöglichkeit, wenn die Chancen vorher bekannt wären? Wäre etwas zu gewinnen, wenn jeder gewänne? Würden nicht alle machtlos durch die Stärke eines jeden? Jeder töricht, wenn die Weisheit Gemeingut wäre? Wären nicht alle arm, wenn Reichtum aller Eigenschaft wäre? Ständen nicht die Schicksale der menschlichen Gesellschaft auf einmal still wie ein Uhrwerk, dem man die Feder oder das Gewicht genommen hätte?
Mache die Probe, Leser, mit einem Hausroulettchen. In allen civilisierten Ländern kann man solch ein Ding kaufen. Entschlage dich des fruchtlosen Suchens nach unbekannten Kügelchen in ebenso unbekannten Stoßzähnen unbekannter Elefanten, sei gleichgültig gegen die Einnahme von Konstantinopel, und setze deinen Einsatz auf eine Nummer, nachdem du in deine Drehscheibe eine Rille geschnitten hast, die das Kügelchen zwingt, stets auf jener Nummer zur Ruhe zu kommen. Oder lasse die Kugel gleich auf der Nummer liegen, und bezahle dir Schlag auf Schlag den Gewinn aus. Sehr bald wirst du finden, wie ein Alleswisser inwendig aussieht, und bald entfährt dir der Seufzer: Heilige Morfondaria, gib mir meine Unwissenheit wieder!
Ich habe dabei noch gar nicht auf die vorausgesetzte Bankkasse hingewiesen, die gegen ein so anhaltendes Ebben nicht standhalten kann.
Doch auch ohne diese Schwierigkeit, und stände diese Kasse auch unter dem speziellen Schutz des 1772er Gottes von Niederland – es ist dem Menschen nicht um Gewinn allein zu tun. Er will den Gewinn mit Mühe erobern. Er will Kampf. Er will Gehirn und Lenden anstrengen ...
Da sind wir wieder bei unseren Freundinnen Kisseleff und Buda angelangt.
Nun, wenn Unwissenheit Glück gibt, dann sind diese Prinzessinnen selig. Ich bin überzeugt, selbst im Traume nicht denken sie daran, wie ich mich hier anstrenge, ein anständiges Schriftstellerhonorar aus dem Einsatz zu gewinnen, den ich auf ihre Naivetät setze. Aus den Ergebnissen ihrer angestrengten Lenden werde ich mir nachher einen Sommerrock kaufen.
Das ist an und für sich eine gute Sache, aber es ärgert mich doch, daß die beiden Spielschwestern mich aus dem ernsthaften Ton herausgebracht haben, den ich vorher anschlug. Auch hierin wissen sie nicht, was sie tun. Ich verzeihe ihnen.
Mit gleichem Edelmut vergebe ich dem Leser, daß er es etwas sonderbar fand, eine Art von religiöser Verzückung in der Erörterung von Spielchancen zu finden. Wenn ich auch keinen Unterschied zwischen hoch und niedrig mache, so erinnere ich mich doch, daß solcher Unterschied in der Welt wohl beachtet wird, und daß man da gewöhnlich seine Begeisterung für Tagesfragen, Kirche, Tragödie, Empfehlung von Kandidaten für die Kammer u. s. w. spart. Mir war es immer schwer, meine Gefühle so genau zu trennen. Der »Herr« bläst in meinem Gemüt nach seinem Willen, und manchmal bläst er auch ganz und gar heraus. Aber gerade deshalb mag ich die geringste Brise nicht verschmähen: vielleicht ist morgen ganz Windstille. Und darum predigte ich so innig – kein Scherz, ich versichere es euch! – als ich auf die Betrachtung der Schönheit tatsächlicher Wahrheit kam.
Begeisterung bei der Behandlung so trivialer Sachen, wie Hazardspiel, bei so dürren Dingen, wie Nummern und Chancen sind, mag seltsam scheinen – ich verpflichte mich, die Feder nicht niederzulegen, ehe ich mich über dies Gefühl verantwortet habe.
Die alles beherrschende Vernunft offenbart sich – wie überall! – auf ehrfurchtgebietende Weise in der Wahrscheinlichkeitsrechnung.