
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

An den Wiener Hof wurde die Nachricht gebracht, daß der schwedische König mit einem Heere auf der Insel Rügen gelandet sei und daß er gedächte, den Protestanten Hilfe zu bringen. Da lachte der Kaiser Ferdinand und sagte so leichthin: »Da haben wir halt ein kleines Feinderl mehr«, und der ganze Hof freute sich, daß die Laune des Kaisers so gut war, und sie bekümmerten sich nicht weiter um den Schweden, der da oben in Pommern mit ein paar Soldaten den Krieg von neuem anfangen wollte. Denn der große Religionskrieg war beinahe zu Ende, damals im Jahre 1630. Der Kaiser hatte alle Angriffe der Protestanten niedergeschlagen, er hatte das Restitutionsedikt erlassen, wodurch den Protestanten alle mühsam erkämpften Rechte wieder verlorengingen. Das ganze Land lag schwer darnieder von den Kämpfen von zwölf Jahren, bedrückt durch die Söldnerheere des Kaisers, die brannten und plünderten, weil es ja nicht ihre Heimat war, für die sie kämpften, weil alle diese zusammengewürfelten Gesellen aus aller Herren Länder kamen, das Land, in dem sie hausten, nichts anderes war, als willkommene Beute. Und der Kaiser fühlte sich als Sieger, und er hatte alles Recht, über Gustav Adolf zu spotten, denn seine Heere waren groß, er hatte sogar den widerspenstigen Feldherrn Wallenstein entlassen, und was dort oben an der Ostsee vorging, das kümmerte ihn wenig: ihm hatte ja nicht einmal der König von Dänemark mit seiner Heeresmacht etwas anhaben können, wie sollte es da dieses kleine Häufchen Schweden, das seinen Proviant während eines Sturmes auf dem Meere verloren hatte, vermögen. Ja, auch wir müssen uns fragen, warum Gustav Adolf diesen verzweifelten Kampf aufnahm, gerade als der Feind gesiegt hatte, und wir müssen fragen, warum er überhaupt nach Deutschland zog. Und da müssen wir die Vorgeschichte zu diesem Feldzug erzählen. Die protestantischen Fürsten in Deutschland, oder wenigstens manche von ihnen, hatten sich seit langen Jahren in ihrer Not an den schwedischen König gewandt und hatten ihn um Hilfe gegen den Kaiser gebeten. Und sie hatten immer wieder darauf hingewiesen, daß der fromme König doch seinen Glaubensbrüdern zu Hilfe kommen solle. Aber darüber hinaus hatten sie gesagt, daß, wenn der Kaiser einmal den Protestantismus in Deutschland niedergeschlagen haben würde, daß er dann auch versuchen würde, den Glauben in Schweden auszurotten. Sie hatten immer wieder gesagt, daß Schweden bedroht sei, wenn der Kaiser der Herr der Ostsee wäre. Denn in Deutschland ging damals der Streit zwischen den Fürsten und dem Kaiser um die Macht. Langsam verbluteten sich alle Parteien in diesem Streit. Gustav Adolf sah ein, daß er in der Ostsee gebieten müsse, daß seine Schiffe mit dem Erz und dem Kupfer frei fahren mußten, wenn sein Land seinen Wohlstand behalten wollte. Und Gustav Adolf wußte es auch, daß der Kaiser, wenn er erst einmal Pommern und Mecklenburg besaß, wenn er dort mehr zu sagen hätte als die Fürsten, daß der Kaiser dann die Macht des ketzerischen Königs in Schweden beschränken würde. Und darum durfte Gustav Adolf mit dem Kriege nicht warten, bis der Kaiser Sieger war. So beschloß der König den Krieg trotz aller Ungunst der Zeiten: Es war der letzte Zeitpunkt, um Schweden zu retten. Wäre erst ganz Deutschland dem Kaiser und dem katholischen Glauben verfallen gewesen, so hätte das kleine Land Schweden für sich allein nicht mehr lange widerstanden. Nun gibt es ja auch Leute, die glauben, daß noch ein anderer Grund mitgespielt hätte. Dem Adel nämlich behagte es nicht, daß seine Macht durch Gustav Adolf beschränkt war. Solange der König im Lande war und durch seine helle und bezwingend einfache Persönlichkeit die Gegensätze darniederhielt, solange war an einen Widerstand nicht zu denken. Aber der Gedanke, daß der König mit der besten Mannschaft des Volkes das Land verlassen könnte, und daß die mächtigen Adelsfamilien die eingebüßte Macht wiedererlangten, der hat wohl manche gelockt, denn der Adel, konnte sich der Kriegspflicht leichter entziehen, als der Bauer und die Abwesenheit des Königs ausnutzen. Vielleicht ist da Axel Oxenstierna, der Kanzler, des Königs böser Geist gewesen, der Mann, der ihn weiter nach Deutschland hineingetrieben hat, um den zurückgebliebenen, großen Herren die Macht zuzuschanzen. Eines ist aber ganz sicher, daß Gustav Adolf, der bislang immer vor klaren und vor ganz eindeutigen Fragen gestanden hatte, der gewohnt war, Schwierigkeiten mit einem Schwertschlage zu durchhauen, daß dieser sichere und einfache Mensch die Wirren und die Ränke des deutschen Krieges nicht begriff. Der große Held, der fromme Gläubige, der mutige Krieger und der geniale Staatsmann, er versagte vor den häßlichen feingesponnenen Fäden der Geheimdiplomatie, vor den Ränken der europäischen Höfe. Freilich, als Gustav Adolf in den Krieg eingriff, da übersah er die politische Lage noch ganz genau. Er wußte, warum er gerade diesen Zeitpunkt (das Jahr 1629) wählte, um seine Rüstungen zu betreiben, er war sich ganz klar darüber, an welcher Stelle er eingreifen und wie er vorgehen mußte. Und wirklich haben die Vorbereitungen zum Kriege in einer hervorragenden Weise bewiesen, daß Gustav Adolf aus seinem Lande ein starkes, einiges und leistungsfähiges Reich gemacht hatte. Aber dennoch begann der Krieg nicht unter den glücklichsten Umständen. Ein Sturm hinderte die Flotte lange Zeit an der Ausfahrt. Und als es endlich doch zu einer Fahrt kam, da erzwangen widrige Winde eine Rückkehr, eine erneute Sammlung. Auf einer allzu langen Seereise gingen die Lebensmittel aus, und das Heer lichtete sich bereits ein wenig; es gab Kranke und Deserteure, bevor der Kampf begonnen. Dennoch wurden sie zusammengehalten durch ihren großen und geliebten König, durch die Wucht der Worte, die er seinem Volke zum Abschied gesagt hatte, als er seine sechsjährige Tochter Christine zur Nachfolgerin im Falle seines Todes einsetzte: »Da wohl mancher sich imaginieren und einbilden mag, daß wir diesen Krieg ohne gegebene Ursache uns aufbürden, so nehme ich Gott, den Allerhöchsten, zum Zeugen, in dessen Angesicht ich hier sitze, daß ich solches nicht aus eigenem Gefallen oder Kriegslust vornehme, sondern auffallend seit mehreren Jahren Ursache habe, meist darum, daß unsere unterdrückten Religionsgenossen mögen von dem päpstlichen Joche befreit werden, was wir auch mit Gottes Gnade hoffen ausführen zu können. – Und weil gewöhnlich zu geschehen pflegt, daß der Krug solange zum Brunnen geht, bis er bricht, so wird auch mit mir ergehen, daß ich, der bei so manchen Gelegenheiten und Gefahren für Schwedens Wohlfahrt mein Blut vergossen und gleichwohl bis jetzt unter Gottes gnädigem Schutz heil mit dem Leben davongekommen, zuletzt doch lassen muß; deshalb will ich vor meiner Abreise dieses Mal auch sämtliche Schweden, gegenwärtige und abwesende Stände, Gott, dem Allerhöchsten, anbefohlen haben, wünschend, daß wir nach diesem elenden und beschwerlichen Leben, nach Gottes Wohlgefallen, uns treffen und finden mögen in einem himmlischen und unvergänglichen.«
Es war ein Entschluß, der von langer Hand vorbereitet war. Im eigenen Lande war alles geordnet worden, man war auf alles vorbereitet. Schließlich wußte man ja schon seit zwei oder drei Jahren, daß dieser Krieg einmal kommen würde. Aber der König hatte doch harte Widerstände überwinden müssen. Oxenstierna, der im Kriege den König immer mehr in das Unglück hineingejagt haben mag, war mit den Plänen seines Herrn zuerst gar nicht einverstanden, und mit dem ehrlichen Johannes Skytte, dem ehemaligen Lehrer Gustav Adolfs und dem Führer der Bürger und Bauern, kam es zu erregter Auseinandersetzung. Skytte hielt den ganzen Krieg für ein Unrecht. Er glaubte, daß Gustav Adolf sein Land groß und reich machen solle und sich nicht um die auswärtigen Händel kümmern dürfe. Da trat er vor den König und sagte ihm ernst und ehrlich, daß er alle Kriegsvorbereitungen für falsch halte. Der König sagte, noch viel schöner werde ihm das Land scheinen, wenn er es einmal wiedersehen würde. »Aber dazu bin ich zu alt«, sagte Skytte. Der König wollte dem alten Lehrer beweisen, daß er den Krieg ja nicht für sich, sondern für seine Untertanen gewinnen möchte. Er sagte es ihm, wie leid es ihm tue, daß die Schweden, diese herrlichen und von ihm so sehr geliebten Menschen, unter der Ungunst des Bodens leiden müßten, daß sie, fern von der Welt abgelegen, im Norden ihr Brot verdienen müßten und daß sie nun in Gefahr stünden, das Letzte, die freie Ostsee, zu verlieren. Aber Skytte ließ sich nicht überzeugen. Er mag es geahnt oder gar gewußt haben, daß mit des Königs Auszug nach Süden der alte Zwist zwischen Königshaus, Adel und Volk wieder entbrennen würde, und er schalt den König kurzweg einen wirklichen Abenteurer. Wenn der König in Deutschland sein würde, meinte er, dann hätte der Adel leichtes Spiel, wieder einen Teil des Landes katholisch zu machen, dann wäre alle Arbeit der letzten Jahre vergeblich gewesen, dann wäre Gustav Adolf ein gleich schlechter Fürst wie seine beiden Oheime Erich und Johann. Er redete ihm gütig und ernst zu als sein alter Lehrer, und er legte ihm die Hände auf die Schulter und bat ihn, sich nicht in ein unnützes Abenteuer zu stürzen. Da brach der Jähzorn aus dem König, wie so oft, hervor, und er rief: »Willst du deinem König Gewalt antun?« Da sagte Skytte ruhig:, »Willst du deinen alten Lehrer schlagen?« »Der ganze Krieg«, sagte er dann, »entspringt nur deiner ungestümen Kraft und deinem ungezähmten Tatendrang, auch der Krieg wird dir keine Ruhe bringen.« Da sagte Gustav Adolf schwermütig und leise: »Ruhe werde ich wohl nur in der Ewigkeit finden.« Und Skytte antwortete ihm: »Eher kann man das Meer aufhalten oder den Sturm der Zeit als dein Ungestüm.« So wird erzählt.
Es waren deutsche Fürsten bei ihm gewesen, die hatten ihn um Hilfe angefleht, und sein frommer Sinn entsetzte sich bei den Schilderungen von den Greueltaten der Katholiken in Deutschland. Und zugleich wußte er, wie notwendig für sein Land der Krieg war, er wußte sich auserwählt, er hielt sich für ein Werkzeug Gottes, und sein Siegeswille und seine Zuversicht ließ das ganze Volk jubelnd hinter ihn treten. Gustav Adolf begann den Krieg als einen Volkskrieg: Hinter ihm standen die Schweden.
Sie landeten nach langer Fahrt auf Rügen, und Gustav Adolf, der als erster ans Land sprang, soll ein langes Gebet gesprochen haben, ein demütiges und zugleich siegessicheres Bekennen. Es ist ein trotziges Gebet gewesen, das uns überliefert wird, ein Pochen darauf, daß Gott, der ihn nun einmal über das Meer geschickt habe, ihm nun auch weiterhelfen müsse. Und in dieser Gesinnung – ob nun das Gebet wirklich gesprochen worden ist oder nicht –, in dieser Gesinnung griff er Pommern an und verjagte die wenigen kaiserlichen Truppen, die dort oben ihr Wesen trieben. Der König hatte leichtes Spiel, denn der General Torquato Conti, der die Truppen des Kaisers befehligte, wußte wenig Widerstand zu leisten, zumal ihm jeder Oberbefehl mangelte. Denn gerade, als Gustav Adolf in den Krieg eingriff, gerade da war Wallenstein, des Kaisers Generalissimus, entlassen worden und zog sich grollend zurück. So siegessicher war man am Hofe in Wien, daß man, gleichgültig um Gustav Adolfs Pläne, den größten Feldherrn und den bedeutendsten Staatsmann der Zeit verjagte.
Gustav Adolf, dem sich ein paar pommersche Städte sofort ergaben, rückte direkt nach Stettin. Dort herrschte der letzte Pommernherzog Bogislaus, ein schwacher, kränklicher, kinderloser Fürst. Der wußte überhaupt nicht, was er machen sollte. Er hatte Angst vor Gustav Adolf, und zugleich mochte er es nicht mit dem Kaiser verderben. So sandte er immer abwechselnd Bittschreiben und Drohungen an den Schwedenkönig, er solle das pommersche Land verschonen. Es ging aber damals nicht mehr an, neutral zu sein, es war ein Streit für oder wider, Protestanten gegen Katholiken, wie man früher immer gesagt hat, Norden gegen Süden, wie es vielleicht richtiger ist. Denn nicht vornehmlich um religiöse Güter ist es im Dreißigjährigen Kriege gegangen, das war nur der Anlaß zu dem furchtbaren Ringen, es ging vielmehr darum, wieweit die Macht des Hauses Habsburg sei und wieweit die Fürsten über ihre Länder selbst gebieten durften. Bogislaus wollte von alledem nichts wissen. Er sah nur, daß plötzlich ein Feind des Kaisers in sein Land einfiel und von ihm verlangte, er solle sich von seinem Herrn lossagen. Und während er noch beriet und immer wieder um Aufschub bat, brach Gustav Adolf plötzlich in Stettin ein und bemächtigte sich, noch kaum daß die Pommern etwas tun konnten, der Stadt. Und kaum hatte er diesen ersten sichtbaren Erfolg, kaum hatte er in Pommern festen Fuß gefaßt, geradeheraus und wie selbstverständlich, da fielen ihm auch schon die Deutschen zu. Sie schlossen heimliche Bündnisse, sie nannten ihn den Befreier, und sie bildeten Regimenter, die des Königs Heere beitraten. Gustav Adolf wunderte sich gar nicht darüber. Ihm schien es selbstverständlich, daß alle Protestanten ihn als einen Befreier begrüßten. Er sah nur Freunde auf der einen, Feinde auf der anderen Seite, und wer dem protestantischen Glauben zugehörte, der, meinte er, müsse es mit ihm halten. So hatten ihm die Fürsten gesagt, die ihn nach Deutschland gerufen hatten. Überall würde er als der endliche Retter aufgenommen werden, überall würde man ihm zujubeln. Das stimmte ja nun für die deutschen Bürger. Die sahen, daß hier ein Heer ihre Städte besetzte, in dem strenge Manneszucht und ernsthafter Wille zu ehrlichem Kampf herrschte. Sie merkten, daß die Schweden ruhige, stille Menschen waren; noch nicht verzweifelt und ermüdet von langem Streite kamen sie gesund und kräftig an, waren nicht vom langen Kriegführen verroht und standen im Banne eines Königs, den sie den Lichtritter nannten, der jung und kräftig war, alle Beschwerden mit den Soldaten zusammen erduldete, der ihnen zudem Gottvertrauen und Gottesfurcht durch sein Beispiel und seine Lebensweise lehrte. Die kaiserlichen Truppen aber, die zu ihnen gekommen waren und die gemeint hatten, sie seien die Retter und Befreier, waren mürbe und gequälte Kämpfer gewesen, hatten nur den Wunsch, zu rauben und für sich zu nehmen, was sie mochten, und ihre Generale hatten keine Gewalt über sie, die aus allen Teilen Europas zusammengewürfelte Söldner und Mietlinge waren. Die Schweden waren noch unverbraucht und froh, sie sangen abwechselnd fromme und kriegerische Lieder und taten niemand etwas zuleide. Das war den armen, gequälten und zermürbten Bürgern eine Freude, und so gingen sie unbedenklich zu den Schweden über. Und da erfanden sie sich selbst Gedichte und Marschlieder, ähnlich den schwedischen Soldaten, gingen in sein Heer und kämpften froh mit Gustav Adolf und sangen mit den Schweden:
Der Schwede führt ein praven Krieg
Er tut richtig auszahlen,
Daß ihm ein jeder Soldat gut Zeugnis gibt
Er hat ihm Lust zu dienen.
Gott sandte ihm über das wilde Meer
Ihn und seine Kriegs Knechte
Daß er zu Hilf käm der evangelischen Lehr
Dieselbe mit dem Schwerdte verfechte.
Gott verleih dem König Sieg und Glück
Ihm und seinen Soldaten
Daß sie die Feinde schlagen zurück
Daß ihn keiner darf erwarten.
Die Lappländer seyndt tapfere Leut
Sie tun auch immer fragen
Wie weit sie noch auf Rom haben
Den Vater Bapst sie wollen rausschlagen.
Der König ist ein praver Held
Er tut wohl mit sich führen
Viel Fürsten, Grafen, Hauptleute gut
Dazu viel prave Cavalier.
Oder auch, sie dichteten sich die Kirchenlieder um und sangen sie dem König zu Ehren:
Mit Tillys Macht ist nichts getan
Er hat die Schlacht verloren,
Es streit für uns ein ander Mann
Den Gott hierzu erkoren.
Fragstu wer er ist
Den uns Jesus Christ
Zu Hilf hat bestellt:
Es ist der Schwedisch Held
Das Feld hat er behalten.
Auch die deutschen Dichter waren froh über die neue Wendung der Dinge, und sie sangen Loblieder auf den Schwedenkönig, der in letzter Stunde gekommen war, um das Land vor den plündernden Kaiserlichen zu retten. Paul Fleming und Johann Rist und der fromme Martin Rinkhardt schrieben dem König fröhliche Empfangsrufe. Fleming vor allem huldigte ihm mit einem Vierzeiler, den er unter ein Bild des Königs schrieb:
Schau diesen König an, doch nur im halben Bilde
Der, Deutscher, gegen dich mit Hilfe war so milde,
Ihn hat der schmale Raum nur halb hier dargestellt,
Willst du ihn sehen ganz, so schaue durch die Welt.
Und sogar der wackere Rektor Micraelius, der bei den Kindern so gefürchtete Schuldirektor, wurde poetisch und schrieb Theaterstücke über Agathander, den großen Helden aus dem Norden, Stücke, die dann seine Schulkinder aufführen mußten. Nur manche sahen das Unglück, das mit diesem neuen Aufleben des Krieges unvermeidlich war. Der Kaiser hatte gesiegt und die katholische Religion, aber manche waren so mutlos und so niedergedrückt von dem Unglück der letzten Jahre, daß sie das harte Regiment geduldet hätten, wenn es nur Frieden gegeben hätte. Die sahen ein, daß Gustav Adolf neues Unglück nach Deutschland brachte, daß wieder der harte Streit von neuem beginnen würde, daß mit dem Schwedenkönig all das Ungemach wiederkehrte: Besetzung und Kriegslasten, Niedertreten der Saaten, Verbrennen der Häuser, und sie sahen, daß ihre Söhne noch einmal in den Krieg mußten, daß noch eine große Menge junger Menschen, anstatt das Land wieder aufzubauen, in nutzlosem Ringen würde das Leben lassen müssen. Die riefen Wehe über Deutschland, und sie fragten wohl gar, wie dieser fremde Fürst dazu käme, sich Gewalt und Recht in Deutschland anzumaßen. Aber sie wurden übertönt von den anderen, die nicht weiter dachten als bis dahin: Es ist uns schlecht gegangen, jede Änderung, wie sie auch sei, muß eine Besserung bringen, schlechter kann es in keinem Falle werden. Und diese Stimmen wurden unterstützt durch manche Schriften aus dem Kreise der Rosenkreutzer und derer, die an schwarze Kunst und Magie glaubten. Es hatte da vor vielen Jahren der große Paracelsus geweissagt, daß aus Mitternacht ein Löwe kommen würde, der würde dem Adler die Flügel stutzen. Und nun bezogen sie diese Weissagung auf Gustav Adolf. Und der junge König, dessen Wappen ja der »Güldne Löw im blauen Feld« war, hieß ihnen von jetzt ab der Leu von Mitternacht. Da bekamen die Druckerpressen zu tun und es wurden Flugblätter über Flugblätter gedruckt, in denen immer wieder der Retter aus dem Norden gepriesen wurde. Man nahm Weissagungen auf, man war religiös und kriegerisch. Der König hieß ihnen allen der Retter. Auch das war Gustav Adolf nicht sonderbar. Er fühlte sich berufen, Retter zu sein, er glaubte es selbst. Wer auf Gott vertraut und sein Schwert, der brauche keine Diplomatie, so meinte er. Und da war er dann sehr bestürzt und im tiefsten verletzt, als die Fürsten anders dachten, als der Kurfürst von Sachsen und sein Schwager, der Kurfürst von Brandenburg, wenig von ihm wissen wollten. Er sah es nicht ein, wie schwer es für diese Männer war, sich eindeutig zu dem Schweden zu bekennen. Freilich, sie waren gute Protestanten, und sie waren in ihrem Fürstenbunde geeint, alle diese protestantischen Fürsten, aber es war doch noch eine deutsche Angelegenheit, und wenn sie auch mit vielem, was ihr Kaiser tat, nicht einverstanden waren, sie waren ihm doch noch untertan. Daß sie nun plötzlich vom Kaiser abfallen sollten, das war ihnen schwer. Zudem wußten sie es, daß der Krieg in ihr Gebiet verlegt werden würde, daß sie schwer zu leiden haben würden, wenn sie als Feinde des Reichs mit dem fremden Eroberer zusammen kämpften. Und so leugneten sie zuerst, daß sie Gustav Adolf ins Land gerufen hätten. Der König pochte darauf, daß ja deutsche Fürsten ihn um Hilfe gebeten hätten. Aber da stellte sich heraus, daß das Fürsten ohne Land gewesen waren, unbedeutende, die im Rate keine Stimme hatten. Und nun merkte Gustav Adolf, daß es doch nicht ein Krieg aller Protestanten gegen alle Katholiken war, sondern daß politische Gründe eine große Rolle spielten, und daß es sehr schwer war zu unterscheiden, wer Freund und wer Feind sei. Und hier beginnt sein Leidensweg, hier beginnen seine Irrtümer und seine Zweifel und mit dem Zweifel sein Untergang. Denn ein Mensch wie Gustav Adolf durfte nicht zweifeln, er mußte immer vertrauend und ganz selbstverständlich seiner Sache sicher sein. Er mußte wissen, worum es ging, er durfte nicht vor schwierige und kaum lösbare Fragen gestellt sein. Da begann es nun, daß er sich in Widersprüche verwickelte, daß er zugleich an den Kaiser schrieb, er sei in das Land gekommen, um die deutschen protestantischen Fürsten zu retten, und daß er zugleich eben diesen Fürsten schrieb, er würde ihr Land besetzen, wenn sie ihm nicht gutwillig folgten. Und hier beginnt es, daß ihm selbst wohl der Gedanke zu keimen begann, politische Vorteile aus dem Kriege zu ziehen, hier beginnt es, daß aus den frommen und gottesfürchtigen Gedanken ganz weltliche Erobererpläne werden. Der König war gerade damals beschäftigt, von Stettin rückwärts zur Küste zu gehen und die noch nicht eingenommenen Städte den Kaiserlichen zu entreißen. Er plante einen Einfall nach Mecklenburg, zugleich eine Aufstellung von vier Heeren. Er verhandelte zu gleicher Zeit mit dem Kaiser, sagte aber, daß er sich auf eine Verhandlung nur einlassen werde, wenn der Kaiser einen großen Religionsfrieden über ganz Deutschland billigen würde. Und während er noch mitten in all diesen Plänen stand, erschien der französische Gesandte bei ihm und bot ihm ein Bündnis an. Nach mannigfachem Schwanken, nach vielen Überlegungen kam der Vertrag zustande und in Bärwalde wurde der Bund geschlossen. Der König erhielt von den Franzosen große Summen Geldes, um den Krieg weiterzuführen und verpflichtete sich dafür, ein Heer in Deutschland zu unterhalten und zu führen, das gegen den Kaiser, aber nicht gegen die katholische Religion kämpfen sollte, daß er die Fürsten, die in der katholischen Liga zusammengeschlossen waren, wenn sie es nicht wollten, nicht angriffe und sich lediglich gegen den Kaiser wende. Damit war der Krieg nicht mehr religiös, damit war er politisch. Gustav Adolf kämpfte nicht mehr für den Protestantismus, sondern um den Schutz Schwedens, er kämpfte um die Freiheit der Ostsee und kämpfte darum, daß zwischen seinem Lande und dem katholischen Habsburg protestantische Fürsten, die dem Kaiser feindlich waren, lebten. Diese ganze Schwierigkeit, daß hier der Feind plötzlich ein ganz anderer geworden war, diese sonderbare Verschiebung, diese seltsame Änderung in den Plänen hat Gustav Adolf wohl kaum begriffen und verstanden. Er war persönlich immer weiter davon überzeugt, einen Glaubenskrieg zu führen, es kam ihm gar nicht der Gedanke, daß er ganz andere Dinge trieb als er sich vorgenommen hatte und ohne zu überlegen, was er tat, verweigerte er den aus Frankreich vertriebenen evangelischen Glaubensbrüdern seine Hilfe zu gleicher Zeit, als er mit der katholischen Regierung des Landes ein Bündnis schloß. Dennoch fühlte er sich weiterhin als der Helfer und Retter der Protestanten und als solcher hieß sein erstes Ziel: Magdeburg. Denn diese Stadt litt schwer, sie bekannte Luthers Lehre und hatte sich gegen alle Versuche des Kaisers, gegen alle Werbungen seines Generals Tilly behauptet. In Deutschland ging der Kampf zwischen dem mächtigen Maximilian von Bayern und dem Kaiser auf der einen Seite, zugleich zwischen den katholischen und den protestantischen Fürsten, und das war ein harter Kampf zwischen dem General der katholischen Liga Tilly und den evangelischen Kurfürsten von Brandenburg und von Sachsen. Sachsens Stützpunkt war Magdeburg, und die Magdeburger sandten Gustav Adolf bewegliche Hilferufe. Nun aber konnte Gustav Adolf dieser Stadt nicht helfen, wenn er nicht den protestantischen Kurfürsten befreundet war, und diese beiden Fürsten zögerten, sich dem Verbündeten Frankreichs und dem Feinde des Kaisers, diesem landfremden Fürsten, anzuschließen. In Leipzig hatten die Fürsten einen Konvent gehalten und hatten einander gefragt, wie man sich denn zu diesem fremden König stellen solle, und es hatte sich nur einer ihm unbedenklich angeschlossen, Bernhard von Sachsen-Weimar, der junge, schöne und tapfere Fürst, der Mann, der Gustav Adolf verstand und der klaren und der eindeutig großartigen Art des Schweden gleichgesinnt war. Die anderen wollten sich nicht für oder wider entscheiden. Sie glaubten besonders diplomatisch zu sein, wenn sie mit beiden Parteien verhandelten, wenn sie es mit niemanden verdürben, und der Kurfürst von Sachsen, der dicke, gemütliche Herr, der so gerne Bier trank, daß sie ihn den »Bierkönig« nannten, der war direkt beleidigt, daß Gustav Adolf glaubte, er würde nicht allein mit dem Kaiser fertig werden, wenn der Kampf überhaupt nötig sei. Aber während die Fürsten noch verhandelten und als sie beschlossen, ihre Heere unter Waffen zu halten, um sich vor den kämpfenden Heeren, von welcher Seite sie auch kämen, zu hüten, als sie aber auch zugleich beschlossen, weiterhin getreue Untertanen des Kaisers zu bleiben, währenddessen ging der Hauptstützpunkt, ging Magdeburg fast verloren. Der General Tilly nahm ein Bollwerk nach dem anderen, beinahe lag schon die innere Stadt bloß. Da riefen die Bürger in ihrer Not, und weil die protestantischen Fürsten nichts für sie taten, noch einmal nach Gustav Adolf. Und der Schwede beschloß den Zug zu der bedrohten Stadt. So mußte er also durch Brandenburg, mußte nach Berlin, und mit seinem Schwager beinahe als Feind verhandeln. Das hielt ihn lange auf, und die beiden hatten einen erbitterten Streit miteinander. Der Brandenburger wollte sich dem Reichsfeinde nicht anschließen. Der Mann seiner Schwester, der da plötzlich über das Meer gefahren kam mit einem kleinen Heer, mit dem Gelde Frankreichs und mit Soldaten, die ihm aus Deutschland zugelaufen waren, der war ihm ein Abenteurer, und es widerstrebte ihm aufs tiefste, die Feinde des Reiches zu unterstützen. Da fuhr Gustav Adolf Kanonen auf und sagte, er könne Magdeburg nicht helfen, wenn sich die Brandenburger nicht unbedingt anschlössen. Er wußte, daß er in seinem Rücken nicht einen halben Feind stehen lassen durfte, er wußte, daß in den brandenburgischen Festungen, daß in Küstrin vor allen Dingen und in Spandau seine Soldaten stehen mußten, wenn die Rettung der Stadt gelingen sollte. Georg Wilhelm von Brandenburg antwortete immer zögernd und zweideutig, er versprach jedem der Botschafter der Schweden etwas, er versprach immer ein bißchen mehr und zögerte die Verhandlungen unendlich weit hinaus. Schließlich zwang ihn der König zu einer persönlichen Zusammenkunft. Bei dieser Verhandlung endlich gelang es Gustav Adolf, den Kurfürsten ganz auf seine Seite zu ziehen und ihn dazu zu bringen, die Festungen zu öffnen, offen mit ihm zu kämpfen. »Ich will Magdeburg retten,« sagte er zu ihm, »wenn mir niemand beistehen will und ich keine Hilfe finde, gehe ich gleich nach Stockholm zurück. Aber am jüngsten Tage werdet ihr Evangelischen dann verklagt werden, daß ihr nichts für Gottes Sache habt tun wollen und auch hier schon auf der Erde wird es euch vergolten werden, denn wenn Magdeburg verlorengeht, ziehe ich mich zurück und ihr könnt sehen, wie es geht.« So setzte er durch, daß der Kurfürst ihm helfen mußte und freilich, als der Schwede durchgesetzt hatte, was er wollte, da sagte er: »Ich kann dem Kurfürsten seine Traurigkeit nicht verdenken, denn daß ich gefährliche Sachen verlange, das weiß ich wohl, aber es ist ja schließlich nicht zu meinem Vorteile, sondern zum Besten des Kurfürsten, zum Besten seines Landes und zum Besten der Christenheit.«
Widerstrebend und ängstlich öffnete der Brandenburger seinem Schwager die großen Festungen, und Gustav Adolf zog in Küstrin und vor allem in Spandau mit seinem Heere ein. Und nun geschah, was allen Lutheranern der damaligen Zeit unverständlich blieb, was immer wieder zu schweren Angriffen auf Gustav Adolf geführt hat, und was sicherlich die Schuld der Staatskunst gewesen ist: Gustav Adolf blieb in der Mark Brandenburg und kam der bedrängten Stadt Magdeburg nicht zu Hilfe. Das machte, der sächsische Kurfürst wollte sich nicht mit ihm verbünden. Den Brandenburger hatte er für sich gewinnen können, den Sachsen nicht. Der Kurfürst lehnte alle Vorschläge rundweg ab, er wollte keine schwedischen Soldaten in seinem Gebiete sehen. Er weigerte sich rund heraus, irgendwelche Verbindung mit Schweden einzugehen. Seine Gründe dafür waren zum Teil recht eigennützig: Er wollte aus eigener Kraft Magdeburg befreien, damit sein Sohn August Bischof werden könne. Und während nun zwischen Gustav Adolf und Johann Georg von Sachsen fruchtlos hin und her verhandelt wurde, während Brief über Brief gewechselt wurde, geschah das Unglück und Tilly brach in Magdeburg ein. Schon längere Zeit hatten die Kaiserlichen die Außenwerke eingenommen, und die Ratsherren waren in großer Not und Sorge. Ihr letzter Bote hatte freilich von Gustav Adolf die Nachricht gebracht, daß der König der bedrängten Stadt zu Hilfe kommen wolle, aber dazwischen hörte man immer wieder, daß das schwedische Heer in Brandenburg stehen blieb und keine Anstalten machte, gegen die Kaiserlichen zu ziehen. Und nun kam gar ein Brief von Tilly an Marschall Falkenberg, der das Heer in der Stadt kommandierte, und an den Koadjutor, den Fürsten Christian Wilhelm. Noch ein letztes Mal bot er ihnen einen Vergleich an, wenn sie zum Kaiser übertreten und das Restitutionsedikt anerkennen wollten. Das hieß, den alten Glauben aufzugeben, das hieß, die ganze Arbeit und alles Wirken der letzten Jahre umsonst gemacht zu haben. Christian Wilhelm war ein schwacher Mann. Er dachte, wenn er vom Kaiser wieder in alte Rechte eingesetzt würde, so könne er wohl den Verrat wagen. Aber er war zu feige und schwankte hin und her und wußte nicht, was er tun sollte. Die Seele der Bürger war der Marschall Falkenberg. Der wollte nichts von Übergabe hören. Er war ein harter Kriegsmann und wollte bis zum Letzten kämpfen; und er hat bis zum Letzten gekämpft. Das Volk war verängstigt und verstört, man sagte, daß es bald zum Sturm kommen würde, und man sagte, daß Gustav Adolf noch weit wäre. Aber einen Kern in der Bürgerschaft gab es, der um keinen Fall von seinem Glauben lassen wollte, harte und fromme Menschen, denen es ernst war mit dem lutherischen Glauben, und die um keinen Preis sich dem Tilly ergeben mochten. Es war alles in Aufregung und Angst. Man sorgte sich darum, daß der Feind bald die Mühlen zerstören könnte, daß es kein Brot und kein Pulver mehr geben würde, und man ahnte, daß ein trauriges Ende nahe sei. Es gab schon in der Stadt Unruhe und Krawalle, viele waren für Übergabe, und in all diesen Wirrwarr und in all diese Not kam eine letzte Nachricht von Tilly, wenn man die Stadt nicht sofort übergäbe, dann würde er stürmen und plündern. Da gab es eine traurige Sitzung des Rates, und als Falkenberg in die Stube trat, sagte ihm der Bürgermeister, daß man beschlossen hätte, die Stadt zu übergeben. Falkenberg schlug auf den Tisch, das sei eine Feigheit und man solle nicht alles zu früh verloren geben. Und während sie noch disputierten und stritten, kam schreckensbleich ein Bote herangelaufen und rief, daß die Feinde im Anmarsch seien. Falkenberg lief auf die Straße hinunter und wollte zu den Wällen. Aber es war schon zu spät. Die Wachen, die müde waren und vom Dienst erschöpft, waren überrumpelt: Tilly war in der Stadt. Es ist eine der grausigsten Begebenheiten in der Geschichte Deutschlands, wie die Anhänger des Kaisers in Wien und die Anhänger des lutherischen Glaubens einander zerfleischten. Der ganze Dreißigjährige Krieg ist mit das Furchtbarste, was unser Vaterland je erlebt hat, weil er ein Bürgerkrieg war, ein Krieg, in dem niemand mehr wußte, wer Feind, wer Freund war. Ein besinnungsloses Morden und vielleicht der schlimmste Tag des dreißigjährigen Ringens war der Untergang von Magdeburg. Tillys Soldaten waren von der langen Belagerung erregt. Sie verlangten ihr Recht, und der General wußte, was er tun mußte, wollte er nicht die Macht über sein Heer verlieren: er erlaubte zu plündern. Und die Truppen Tillys mordeten und raubten in grauenhafter Weise, und während noch Tilly überlegte, wie er dem Morden Einhalt gebieten könne, während er versuchte, das Heer wieder zur Ordnung und zur Zucht zurückzuführen, da begann es plötzlich an vielen Ecken der Stadt zu brennen und zu prasseln, es krachten die Gebälke der Häuser: die Stadt war angezündet worden! An allen Ecken und Enden brannte es. Und in das Geschrei der gehetzten und getriebenen Bürger, in den Ruf der kaiserlichen Soldaten mischte sich das furchtbare Wimmern der Verbrennenden und Halbtoten. Eines versuchte Tilly noch: die elternlosen Kinder, die ganz Kleinen, die auf den Straßen lagen, zu retten. Er versuchte es noch, hier und da Ordnung zu schaffen und Einhalt zu gebieten, aber es war wenig mehr zu helfen. Der kaiserliche General hatte keine Stadt erobert, sondern einen Aschenhaufen.

Magdeburg
In der Geschichte hat man immer wieder dem General den Vorwurf gemacht, er hätte die Stadt zerstört. Lange Zeit hat man es geglaubt, daß Tilly den Befehl zur Feuersbrunst gegeben habe (denn ein angelegtes Feuer ist es gewesen). Aber wir glauben es jetzt nicht mehr. Denn der alte Tilly war kein Brandstifter, dem es Vergnügen gemacht hätte, die Stadt zu zerstören, ihm lag nur daran, seinem Kaiser treu zu dienen, seine Pflicht zu erfüllen. Und er mußte die Soldaten plündern lassen, sonst wären sie ihm weggelaufen, denn das Plündern war damals das Vorrecht des siegreichen Söldners. Aber an unnützem Gemetzel hat der brave Offizier nie seine Freude gehabt. Zudem war es gar nicht sein Vorteil, wenn die Stadt ganz vernichtet würde, sein Sieg wurde dadurch zunichte. So glauben wir es jetzt, daß Otto von Falkenberg die Stadt verbrennen ließ. Der fanatische Marschall konnte es nicht sehen, daß alle seine Arbeit vergebens gewesen war, er konnte es nicht fassen, daß man ihn besiegt hatte, und er mochte vor allen Dingen nicht dulden, daß des Kaisers General nun seine Stadt besetze, lieber sollte er nur Trümmer finden. Noch lange rauchten die Trümmer der vernichteten Stadt. Magdeburg hatte aufgehört überhaupt dazusein. Als die Kunde vom Falle Magdeburgs weiterdrang, da war allenthalben große Verzweiflung und ein großes Wehklagen in Deutschland. Am wenigsten trauerte der sächsische Kurfürst, der sagte, es täte ihm ja sehr leid und es sei traurig, aber es seien doch immerhin Aufrührer gewesen, die da untergegangen seien. Gustav Adolf aber geriet in große Wut und wurde so zornig, wie es ihn manchmal überkam: Wenn er es gewußt hätte, daß die deutschen Fürsten solche Verräter seien, dann wäre er nie nach Deutschland gekommen. Es mag sein, daß Gustav Adolf ein bißchen seine Schuld gefühlt hat, daß er es gespürt hat, daß er vielleicht habe Magdeburg retten können, und daß er ein Versehen schlimmer Art begangen hätte. Jedenfalls war er barsch und schimpfte so hart, wie es die Schweden von ihrem freundlichen und gottesfürchtigen Könige nicht gekannt hatten. Am anderen Tage setzte er sich nieder und schrieb eine lange ausführliche Verteidigungsschrift, warum er die Stadt nicht habe entsetzen können und warum es ihm unmöglich gewesen wäre, zu helfen. Am dritten Tage aber sagte er, daß er eine Rache für Magdeburg nehmen werde, an die am jüngsten Tage noch gedacht werden würde. Das war am letzten April gewesen. Und nun kam ein Sommer, in dem sich die Heere fast kampflos gegenüberstanden, ein Sommer, in dem kein entscheidender Kampf gefochten wurde. Tilly lag in Hessen, während Gustav Adolf wieder an die Ostsee zurückging. Er nahm die letzten Plätze, die die Kaiserlichen dort noch besaßen, Greifswald vor allen Dingen, und er bemühte sich, seine Freunde, die Herzöge von Mecklenburg, die vom Kaiser abgesetzt worden waren, wieder in ihre Rechte zurückzuführen und dem Herzog von Mecklenburg, Wallenstein, sein Herzogtum zu nehmen. Aber ein Bedeutsames geschah noch. Zwischen dem Kurfürsten von Brandenburg und Gustav Adolf kam es zur Versöhnung. Der Kurfürst mußte seinem Schwager nun doch folgen, da Magdeburg, das südliche Bollwerk für sein Land, gefallen war und das kaiserliche Heer frei in die Mark ziehen konnte. Gustav Adolf hat dem Schwager sehr drückende Bedingungen diktiert, denn wo es um die Macht ging, da war der freundliche Schwedenkönig immer hart und unerbittlich. Da war es ihm ganz gleich, ob er mit dem Verwandten oder mit dem Feinde sprach, er verlangte, was ihm nötig schien. Die Geschichtschreiber erzählen, daß Gustav Adolf seinem Schwager versprochen habe, er wolle die Reiche Schweden und Brandenburg eng verbinden. Er soll ihm seine Tochter Christine zur Gemahlin für den brandenburgischen Kronprinzen angetragen haben, und es ist sehr sonderbar, daran zu denken, was geschehen wäre, wenn die Königin Christine von Schweden wirklich die Gemahlin unseres Großen Kurfürsten geworden wäre. Jedenfalls, es kam damals zu keinen großen Kämpfen. Die ganze Zeit war von Verhandlungen ausgefüllt. Auch Tilly hatte ganz darauf verzichtet, den König anzugreifen. Es wurde verhandelt und gestritten. Aber weil beide Parteien nicht recht ehrlich zu Werke gingen, kam es zu keinem Ergebnis. Zudem kam die unglückliche Zwietracht im Kleinen und Kleinsten wieder zum Vorschein. Tilly trat mit seinem Unterfeldherrn Pappenheim vor den Kaiser, weil der tapfere Soldat Pappenheim, der die Eroberung vollzogen hatte, meinte, von seinem Oberfeldherrn ungerecht behandelt zu werden. Gustav Adolf hatte kein Geld damals, und er befand sich mit seinem Heere in großen Schwierigkeiten. Und wie immer, wenn dem König nicht alles so von der Hand ging, wie er wollte, gab es Zwist. Der siegesgewohnte und siegesfreudige Held ertrug es nicht, daß es ihm schlecht ging, und das mußten seine Offiziere büßen. Mit vielen hat er sich damals unnütz verfeindet, seiner besten Freunde hat er sich beraubt, und er verstrickte sich immer tiefer in die ungewohnten Zweifel und die sonderbaren Schwierigkeiten, die er nicht geahnt hatte. Immer weniger wußte er, was er eigentlich in Deutschland wollte und erstrebte, und immer tiefer geriet er in die Schlingen der Staatsmänner, kam er auf die falschen und krummen Wege. Vorerst lag er mit seinem Heere, nachdem er Pommern ganz und gar erobert hatte, im festen Lager bei Werben. Ein kleines Gefecht brachte beiden Parteien viel Leid und wenig Glück. Es waren die unglücklichsten Tage des Krieges, die Gustav Adolf dort verlebte. Ohne Geld, ohne Bundesgenossen und ohne Freude stand er müßig und untätig mit seinem Heere mitten in Deutschland, unfähig, etwas zu unternehmen, unfähig, irgendwelche festen Entschlüsse zu fassen. Endlich kam Geld für ihn, und zwar von verschiedenen Seiten. Die Niederlande und Frankreich erklärten sich bereit, den König zu unterstützen, und die Engländer sandten Truppen zur Verstärkung seines Heeres. Aber kaum war das Geld in seinem Lager, so meldeten sich protestantische deutsche Fürsten, die ihren Anteil an der Summe haben wollten, und Gustav Adolf schloß den ersten Vertrag mit einem deutschen Reichsfürsten, die erste dieser vielen Übereinkünfte, die alle so gleich klangen und alle die deutschen Fürsten beinahe zu Dienern Schwedens machten. In dem ersten derartigen Vertrage verpflichtete sich der König, den Landgrafen von Hessen zu schützen und ihm gegen jeden Feind zu helfen. Dafür verlangte er aber den Oberbefehl und die »Direktionsgewalt« in den Gebieten des Bundesgenossen, verlangte, daß der Landgraf ständig ein Heer zu des Königs Verfügung halte, und forderte großen Einfluß auf die Verwaltung des Landes. Zur gleichen Zeit ging der junge Herzog Bernhard von Sachsen-Weimar offen zu Gustav Adolf über, kurz, durch Vertrag und Verhandlungen festigte sich die Macht des Schwedenkönigs immer mehr. Aber noch war es Gustav Adolf nicht möglich, sich mit Tilly zu messen, denn die kaiserlichen Heere waren viel größer und verfügten über viel mehr Hilfsmittel. Gustav Adolf mußte die Sachsen gewinnen. Es blieb ihm nichts anderes übrig, als immer Versuche zu machen, sich dem Kurfürsten, der schon so oft unzuverlässig und tückisch gewesen war, immer wieder zu nähern. Und dann geschah das Entscheidende: daß nämlich der Kaiser dem Schwedenkönig zu Hilfe kam. Auch am Hofe von Wien nämlich war man unzufrieden mit dem sächsischen Kurfürsten und mit seinem ewigen Schwanken. Es war damals nötig, sich für oder wider zu entscheiden. Man mußte bekennen, wohin man gehörte. Und da befahl der Kaiser, um die Neutralität der Sachsen endlich zu brechen, daß Tilly nach Sachsen marschieren sollte. Nun war der Kurfürst gezwungen, entweder alle seine Freunde zu verlassen und sich dem Kaiser anzuschließen, oder er mußte Gustav Adolf um ein Bündnis bitten, daß Tilly sein Land verschone. Der Kurfürst mußte nun demütig um den Vertrag bitten, den ihm Gustav Adolf so oft angeboten und den er immer wieder zurückgewiesen hatte. Und nun verlangte Gustav Adolf viel. Er machte dem Kurfürsten Bedingungen, als ob er ihn in der Schlacht besiegt hätte, und dem Kurfürsten blieb nichts anderes übrig, als anzunehmen, was Gustav Adolf ihm gebot. »Nicht nur Wittenberg – die Festung, die Gustav Adolf verlangt hatte – sondern auch Torgau,« so rief er aus, »sondern ganz Sachsen soll dem Schwedenkönig offenstehen. Ich will meine ganze Familie als Geisel stellen, wenn ersteres noch nicht genügt. Der König mag die Verräter (die in Sachsen gegen Gustav Adolf Ränke spannen) nur nennen, ich will sie ausliefern, ich will den verlangten Sold bezahlen und Gut und Blut der Sache opfern.« Als Gustav Adolf von diesem Notschrei hörte, sagte er dem Boten, daß er auf die Bedingungen zum größten Teil verzichte, und daß er sie nur gestellt habe, weil der Kurfürst früher immer unzuverlässig gewesen sei. Und gleich darauf kam das Bündnis zustande, und Gustav Adolf war nicht nur der Freund und mächtige Beschützer des Landgrafen von Hessen und des Herzogs von Sachsen-Weimar, sondern auch zweier mächtiger Kurfürsten, des Brandenburger und des Sachsen. Und nun war Gustav Adolf stark genug, um Tilly anzugreifen. Zur Schlacht selbst kam es beinahe durch Zufall, jedenfalls gegen den Willen Tillys.
Es waren im kaiserlichen Lager immer noch große Gegensätze, weil der mächtige Herzog von Bayern, Maximilian, andere Ziele verfolgte als der Kaiser selbst, und im Heere war Tilly des Bayern Oberfeldherr. Dem lag nichts an der Entscheidungsschlacht, dem lag an einem Hinauszögern und einem Verschleppen des Krieges. Pappenheim aber, der junge, der blut- und schlachtgierige Reiterführer, der wildeste unter den kaiserlichen Generalen, war ein Freund des Kaisers, er haßte seinen General Tilly, und er wagte sich vorwitzig mit 2000 Reitern in die Nähe des schwedischen Heeres. Als dann der Kampf tobte, ließ er Tilly sagen, er könne sich nicht mehr zurückziehen, er brauche Verstärkung. Tilly schickte ihm wieder Reiter mit dem strengen Befehl, sie nur dazu zu benutzen, daß er sich wieder zurückzöge. Aber es war schon zu spät. Die Feinde hatten sich ineinander verbissen, und Breitenfeld wurde der Ort, an dem das entscheidende Ringen stattfand. Auf eine Kanonade folgte die Schlacht, die zunächst unentschieden verlief, bis es den Schweden gelang, den einen Flügel des Tillyschen Heeres gänzlich aufzureiben. Die Sachsen allerdings, die auf dem anderen Flügel der schwedischen Schlachtreihe standen, wurden vollständig geschlagen und flohen. Allen voran ihr braver Kurfürst, der »Bierkönig«. Trotz dessen gelang es dem König, durch einen meisterhaften Angriffsplan und durch die straffe Ordnung seines Heeres, dem vor allem auch moderne Feuerwaffen und die berühmten leichten Ledergeschütze zur Seite standen, den Feind vollständig zu schlagen. Die Kaiserlichen mußten sich überall zurückziehen. Tilly und Pappenheim entkamen nur mit großer Mühe.
In dieser Schlacht hatte sich Gustav Adolf als der große Feldherr bewährt, er hatte gezeigt, daß die neuen Erfindungen in der Kriegskunst und in der Rüstungstechnik bedeutsam waren; er verfügte über ein Heer, das in allen Künsten eines modernen Feldzuges geübt war, ein Heer, das zudem treu zu seinem Feldherrn stand, das ein Werkzeug in seiner Hand war. Tilly dagegen befehligte einen zusammengewürfelten Söldnerhaufen. Der alte General war ein treuer und braver Diener seines Kaisers, er war mutig und sicher einer der anständigsten und ehrlichsten Menschen, kein Diplomat, sondern ein braver Soldat, der seine Pflicht tat. Aber er vermochte es nicht, seine Truppen zu begeistern, er mußte stets schwer um seine Autorität ringen, er war der »brave Korporal«, nicht der geniale Heerführer. Pappenheim zudem, sein Unterfeldherr, hatte ihn wider Willen zu der Schlacht gezwungen, dieser Pappenheim, der ein tollkühner, ein verbissener und brutaler Reitergeneral war, ein Landsknecht, ein Mann, für den es Schonung oder Milde nicht gab, der kräftig und grob zuschlug ohne Bedenken. Diesen beiden war der König gewachsen. Es waren keine vollwertigen Gegner für ihn. Die Schlacht bei Breitenfeld zeigte, daß er von anderem Schlage war, daß man wirklich einen ganz Großen brauchte, der sich ihm messen konnte. Und darum rief der Kaiser, der jetzt einsah, welcher Feind in sein Land eingebrochen war, nach Wallenstein.
Gustav Adolf konnte die Schlacht bei Breitenfeld mit dem Glanz durchkämpfen, weil es wieder eines von den Geschehnissen war, wo man siegesfreudig, ohne Zweifel und ohne Qual ein Begonnenes wieder durchführen konnte. Es war eine Handlung, wo es ein eindeutiges Hier und Dort, ein ganz klares Für und Wider gab, man wußte, auf wen man sich verlassen konnte, und wer der Feind war: Solche Arbeit verstand der junge Schwedenkönig.
Als der König vor der Breitenfelder Schlacht eine Ansprache an seine Offiziere und Soldaten gehalten hatte, da hatte er die bedeutsamen Worte gesprochen: Selig könnt ihr bei mir werden, aber nicht reich. In der Freude und der Erregung der beginnenden Schlacht, im Bewußtsein der Aufgabe, da glaubte er wieder an die Mission, da fühlte er sich als ein freudiger, als ein Religionskämpfer für Gottes Sache. Aber nach der Schlacht wurde es anders. Da konnten Gustav Adolfs Soldaten reich werden, aber nicht mehr selig. Vorerst freilich merkte man noch nicht viel von dem neuen, bösen Geiste, der ins Heer eingezogen war. Es begann ein unglaublicher Siegeszug von Sachsen bis an den Main, eine Stadt nach der anderen fiel Gustav Adolf in die Hände. Manche gutwillig, manche erst nach Verhandlungen. Und in Würzburg kam es gar zu einem erschrecklichen Gemetzel. Endlich aber zog der König in Frankfurt ein. Wir können dem Kriegszuge nicht genau folgen. Gustav Adolf spaltete sein Heer in viele kleine Abteilungen, und überall gab es Scharmützel und kleine Kämpfe. Wir wollen einzig kurz den König selbst mit seiner Heeresgruppe begleiten und dabei sehen, wie sich auf dem Gipfel der Macht der König, wie sich sein Heer veränderte.
Der König schickte zunächst Gesandte nach Süddeutschland, vornehmlich nach Nürnberg und trug ihnen auf, diese Städte ja für seine Sache zu gewinnen. Und da gebrauchte er eine diplomatische List. Er gab seinen Gesandten zwei Briefe mit. Einen, in dem er in liebenswürdiger und freundlicher Weise den Städten riet, sich mit ihm zu verbinden, indem er ihnen schrieb, er sei nur nach Deutschland gekommen, um die Fürsten gegen den Kaiser zu schützen und um die Religion zu sichern. Und zugleich sandte er einen zweiten Brief mit, den der Gesandte vorlegen mußte, wenn die Städte sich weigerten, ein Bündnis mit Schweden einzugehen. Der war in harten Worten gehalten und drohte mit Plünderung und Besetzung. Der widerrief beinahe alles, was in dem ersten Briefe stand. Und wenn man diese Briefe liest, dann spürt man mit Trauer, daß der König sein eigentliches Ziel vergessen hat, daß er als Eroberer und weltlicher Kämpfer in das Land einbrach. An die Nürnberger schrieb er so: »Weil die Stadt sich trotz aller Abmachungen keines besseren besinne, sondern fortwährend von ihrer Untertänigkeit gegen den Kaiser oder gar von Neutralität spreche, weil ferner der König von keiner Neutralität fürder etwas wissen wolle, sondern alle Protestanten, die in Zukunft hinter solche Zweideutigkeiten sich versteckten, als seine Feinde zu behandeln entschlossen sei: so werde Ihre Königliche Majestät von Schweden auch die Stadt Nürnberg, dafern sie nicht bessere Gesinnungen an den Tag lege, als offene Gegnerin behandeln, sie und ihre Untertanen mit Schwert, Mord und Brand als die ärgsten Feinde verfolgen und alle und jeden Bürger und Pflichtigen der Stadt und deren Güter, wo der König dieselben in seinem eigenen oder der verbündeten Länder antreffe, niederwerfen, mit Beschlag belegen, wegnehmen und vernichten.« Und in dieselbe Zeit fällt es, daß der König immer unsicherer, für seine Freunde immer unzugänglicher und mit allen Maßnahmen in Deutschland wie in Schweden immer unzufriedener wurde. Die Heeresgruppe, mit der er nach Süden zog, um nachher den Rhein zu gewinnen, war schwach. Tilly hatte sich aber indes mit dem Herzog von Bayern und verschiedenen kaiserlichen Generalen vereint und zog von neuem gestärkt aus Hessen heran. Und außerdem hatte Gustav Adolf kein Geld mehr. Seine deutschen Bundesgenossen waren arm und die schwedischen Hilfsmittel nicht allzu groß. Es gab damals sogar in Schweden eine Verringerung des Geldwertes, eine sogenannte »Reduktion der Münze«, und der König mußte verschiedene Mittel anwenden, um sein Kupfergeld im alten Werte zu erhalten. »Wir müssen die Sache dahin bringen,« schrieb er, »daß fürder in Schweden keine andere Münze gelten solle, als Reichsthaler und Kupfermünze. Wir verlangen deshalb, daß der Reichsrat alle Münzen, Kupfergeld und Reichsthaler ausgenommen, in allen uns gehörigen Provinzen öffentlich abverkünden soll, wodurch wir vermuten, daß die Kupfermünze begehrlich und wieder aus Holland zurückgesucht und dadurch das Kupfer zu Wert kommen werde.« Es muß die Zeit gewesen sein, in der der König spürte, daß irgend etwas in seiner Kriegführung nicht mehr richtig war. Die äußeren Ereignisse freilich waren alle günstig. Nürnberg erklärte sich für den König, so daß er einen Stützpunkt im Süden hatte, und alle die großen Orte zwischen Frankfurt am Main und Breitenfeld, das ja bei Leipzig liegt, ergaben sich bald. Zuerst Erfurt, wo der Magistrat sich gegen eine Besetzung wehrte, bis der König ganz allein mit seiner Kutsche vor das Stadttor fuhr und Einlaß begehrte und dann, da man ihm den Eingang als einem einzelnen großen Herren schwerlich verweigern konnte, seinen Wagen so geschickt unter dem Torbogen halten ließ, daß ein Reiterregiment, das bisher verborgen gewesen war, rasch in die Stadt stürmen konnte. Die nächste ernsthafte Streitigkeit gab es vor Würzburg. Die Stadt ergab sich rasch. Aber das Schloß Marienberg, das fest auf einem Felsen oberhalb der Stadt liegt, wehrte sich wacker. Hier hatte sich die Manneszucht in Gustav Adolfs Heer schon recht gelockert. Einige Soldaten betranken sich an gestohlenem Frankenwein so, daß sie aus Unachtsamkeit ein paar Häuser anzündeten, und die Erregung darüber war groß, denn die Würzburger fürchteten, der König wolle die ganze Stabt einäschern, weil sich ihm die Burg nicht ergab. Und als es dann zum Sturm auf die Festung kam, und als die Schweden siegreich in die inneren Höfe eindrangen, da erhob sich ein furchtbares Gemetzel und eine Plünderung, der Gustav Adolf nicht Einhalt tun konnte. Seine Soldaten mordeten mit dem Rufe: »Magdeburgisch Quartier« alle Verteidiger. Und der General Torstenson sagte ruhig, er würde der Metzelei erst dann Halt gebieten, wenn man ihm die verborgenen Schätze des Schlosses ausgeliefert haben würde. Es knüpfen sich mancherlei Legenden gerade an diese Würzburger Tage. Man hat es wohl empfunden, daß sich hier die Wendung in Gustav Adolfs Geschick vollzog, daß er sich hier endgültig zu seinen Erobererzielen bekannte. An die Würzburger Tage knüpft sich die Geschichte von dem eisernen Ring, der Gustav Adolf kugelfest gemacht haben soll, die Geschichte von jenem fanatischen Mädchen zugleich, das Gustav Adolf in den verschiedensten Gestalten sich genähert habe, um ihm diesen Ring zu entwenden. Drei Tage vor der Schlacht bei Lützen soll sie ihn genommen haben. Manche Dichter erzählen auch, daß dieses Mädchen dieselbe Frau sei, die sich unter dem Namen des Leibknechtes Leubelfingen in das Vertrauen des Königs geschlichen habe. Als Gustav Adolf in Würzburg über den Schloßhof ritt, fand er unter den Toten, die dort von dem Gemetzel herumlagen, viele, deren Gesichter merkwürdig gesund und lebendig aussahen. Da rief er, sie sollten aufstehen, er würde ihnen nichts tun. Da erhob sich bleich und zähneklappernd eine große Anzahl von katholischen Priestern, die mitgekämpft und sich durch ihren Scheintod aus dem schrecklichen Nahkampfe gerettet hatten.
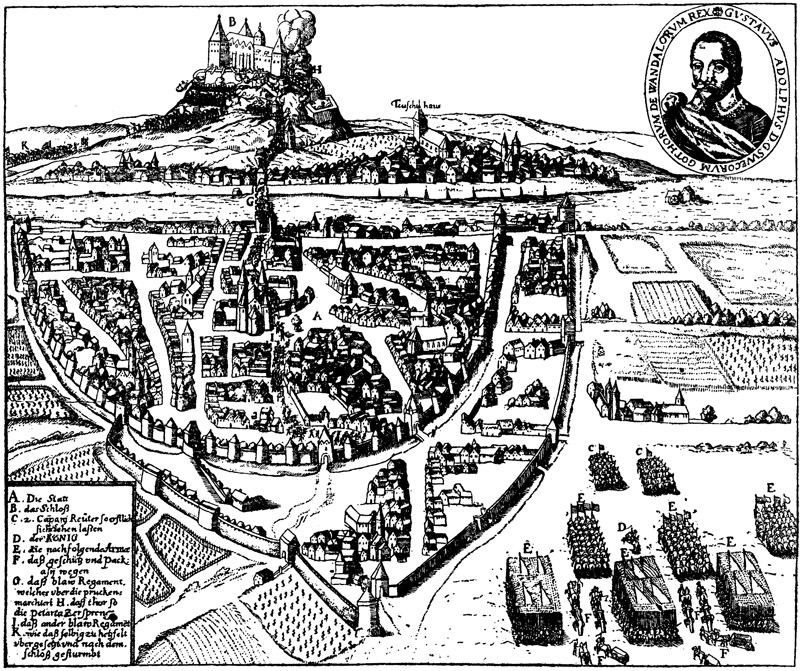
Belagerung von Würzburg durch die Schweden 1631. Kpfr.
Und dann zog Gustav Adolf weiter, überwand die Widerstände der Frankfurter und rückte plötzlich mit großem Gefolge in Mainz ein: Der anerkannte Herr der protestantischen Länder. Nun kamen sie alle die deutschen Fürsten und versuchten von Gustav Adolf möglichst gute Bedingungen zu erhalten, daß sie mit dem Schweden nicht verfeindet und doch zugleich dem Kaiser untertan blieben. Nur ganz wenige haben sich rückhaltlos an den Schweden angeschlossen. Manche, wie Trier, begaben sich in den Schutz der Franzosen, und wieder andere schlossen sich eng an den Kaiser an. Da war es der große diplomatische Fehler Gustav Adolfs, daß er es nicht verhindert hat, daß der Kurfürst Maximilian von Bayern, der den Kaiser sehr haßte, sich mit ihm zusammentat, so daß im Süden zwischen Wien und München eine starke feindliche Macht gegen den Schweden feststand. Gustav Adolf hat das gesehen, und er hat immer wieder versucht, gegen diese fest zusammenhaltende Macht ein einiges Reich in Deutschland zu errichten. Aber die deutschen Fürsten mochten nicht; es lag ihnen nicht daran, ein protestantisches Reich in Norddeutschland zu errichten, es lag ihnen einzig am Frieden, und darüber hat sich Gustav Adolf sehr grämen müssen. Er hatte ganz vergessen, daß er nach Deutschland gekommen war, nur um die protestantischen Fürsten aus der Gewalt des Kaisers zu retten. Er verlangte jetzt, daß sich die Fürsten alle zusammenschlössen und mit ihm zusammen den Frieden diktierten. Und dieser Friede, wie er ihn haben wollte, war hart für den Kaiser. Gustav Adolf kränkte es sehr, daß die Fürsten zumeist bereit gewesen wären, unter ganz anderen Bedingungen Frieden zu schließen. Und er schimpfte sehr auf diese Männer, die ihn nach Deutschland gelockt hätten unter falschen Versprechungen und mit falscher Darstellung der Verhältnisse. Wenn er es gewußt hätte, wie falsch, wie feige und wie kampfunlustig alle diese deutschen protestantischen Herren seien, dann wäre er nie über das Meer gekommen. Gustav Adolf wollte viel vom Kaiser verlangen, und es ist uns ein Schriftstück aufbewahrt, und auch die Geschichtschreiber berichten uns von den Bedingungen, die er gegenüber dem Unterhändler des Kaisers, dem Kurfürsten von Mainz, gemacht habe. Das Restitutionsedikt, hieß es dort, sollte null und nichtig sein, und beide Religionen, die katholische und die evangelische, sollten nebeneinander gleichberechtigt geduldet werden. Dann sollten Böhmen, Mähren und Schlesien wieder in ihren vorigen Stand eingesetzt werden und alle Verbannten auf ihre Güter zurückkehren. Der Kurfürst Friedrich V. von der Pfalz sollte seine verlorenen Städte wiederbekommen und zudem den Kurhut, den jetzt der Bayernherzog besaß. Dann sollten die Freiheiten für die Stadt Augsburg von neuem bewilligt werden. Alle Jesuiten sollten aus dem Reich verbannt werden, weil sie die Urheber der gegenwärtigen Unruhen seien. Und dann kamen neben manchen anderen Bestimmungen noch die ganz entscheidende und bedeutsame: Aus Dankbarkeit für die Rettung des Deutschen Reiches soll Ihre Königliche Majestät von Schweden zum römischen Kaiser gewählt werden. Und wenn nun wirklich diese Bestimmung wahr ist, wenn Gustav Adolf es wirklich geschrieben hat, daß er römischer Kaiser, also zukünftiges Haupt des ganzen Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation werden wollte, dann kann allerdings gar nicht mehr davon die Rede sein, daß der Schwede religiöse Ziele verfolgte. Wenn es wahr ist, daß Gustav Adolf diesen seinen ursprünglichen Plänen so untreu geworden wäre, dann hatten allerdings alle die recht, die den fremden Eroberer bekämpften, und auch die, die heute von seinem verderblichen Wirken in Deutschland sprechen. Aber vielleicht ist der entscheidende Paragraph der Friedensverträge in einer falschen Form zu uns gekommen. Vielleicht hat Gustav Adolf es nicht selbst geplant, sondern nur einer seiner deutschen Freunde hat davon geträumt, daß der große Schwede die Habsburger ablösen solle. Denn daß ihm manche Deutsche gesagt haben, er solle doch den Kaiserthron an sich reißen, das ist sicher. Die Frankfurter Ratsherren, die die Besetzung von ihrer Stadt abwenden wollten, hatten dem König damals geschmeichelt, und in Nürnberg war viel davon die Rede gewesen, als der schwedische Gesandte dort war, um die Stadt für Schweden zu gewinnen. Auch dem Landgrafen von Hessen mag daran gelegen gewesen sein, daß sein mächtiger Beschützer lange in Deutschland blieb. Aber ob Gustav Adolf selbst in ganz klarer und eindeutiger Weise eine Absicht auf den Kaiserthron ausgesprochen hat, das wissen wir nicht.
Es scheint uns viel wahrscheinlicher, daß dem König alle diese Pläne von seiten der Reichsfürsten, allenfalls von seiten Oxenstiernas geraten wurden, und es scheint uns auch wahrscheinlich, daß sie den König nachdenklich machten. Aber ob er so mit voller Klarheit auf den deutschen Kaiserthron zustrebte, das werde doch nicht entschieden. Eines nur ist ganz sicher, daß Gustav Adolf nicht nach Schweden zurückkehren wollte, ohne die Macht des Kaisers verringert zu haben. Es ist ganz sicher, daß ihm das Wichtigste war, die Ostsee für Schweden freizuhalten. Und es ist ganz sicher, daß er darum die nördlichen Teile Deutschlands von Habsburg lösen wollte. Gegen das katholische Südreich sollte ein protestantisches Nordreich gestellt werden. Gegen diese deutsche Nation, die sich mit romanischen Völkerschaften zum Heiligen Römischen Reiche zusammengefunden hatte, sollte ein Deutsches Reich ohne den Einfluß der südlichen Herren geschaffen werden. Nicht ohne Grund hatte sich Gustav Adolf von allen den deutschen Fürsten, die sich mit ihm verbündet hatten, die »absolute Direktion« und einen Einfluß auf die Verwaltung des Landes versprechen lassen. Er wollte sich die Möglichkeit nicht nehmen, alle diese seine Kriegsfreunde einmal friedlich zu einen. Er wollte Brandenburg, Sachsen, Mecklenburg und Hessen, vielleicht kann man überhaupt sagen Deutschland nördlich der Mainlinie, zusammenschließen zu einem Nordreich. »Wer der Herr dieses Reiches ist,« so sagte er einmal zum hessischen Kurfürsten, »das ist mir gleichgültig, aber das Reich muß bestehen. Dann ist meine Aufgabe erfüllt, wenn ein einheitliches protestantisches Deutschland unabhängig vom Kaiser besteht.« Der Kurfürst von Hessen lachte ihn aus, wer denn der Herr dieses Reiches sein solle, wenn nicht Gustav Adolf selbst, fragte er. Und der König wird es sich wohl gesagt haben, daß das sein künftiger Posten sei, Herr der Ostsee, Herrscher in Schweden, in Finnland und in Norddeutschland zu sein. Darum, weil er sein Leben lang in Deutschland herrschen wollte, mag ihm wohl so viel an der Heirat seiner Tochter mit dem brandenburgischen Kurprinzen gelegen haben. Und darum, weil er in den deutschen Fürsten seine späteren Vasallen gesehen haben mag, darum war ihm wohl die unentschiedene und immer noch zum Kaiser hinneigende Haltung dieser Fürsten so verhaßt. Gustav Adolf wußte jedenfalls seit Mainz um das letzte Ziel. Ob es die Herrschaft über ganz Deutschland oder nur über den protestantischen Norden war, das können wir nicht entscheiden. Aber so klar ihm das Ziel war, so unsicher lag der Weg vor ihm, und hier folgte er nur der inneren Stimme, die ihn nach Bayern trieb. Er soll sich damals in Mainz mit Marie Eleonore lange unterhalten haben, und die Königin soll ihn sehr gebeten haben, nach Schweden zurückzukehren: denn ihr war es schmerzlich, daß ihr Gemahl vor dem Schloß des Bruders in Berlin Kanonen aufgefahren hatte. Und sie, die aus Schweden kam, sah wohl auch, wie das Land, das unter dem König geblüht hatte, unter den Lasten des Krieges wieder arm wurde und fast zusammenbrach. Oxenstierna aber hat damals dem Könige seinen großen Fehler vorgehalten, daß er hart gegen die deutschen Fürsten wäre. Die beriefen sich immer auf die Neutralität und auf den Vertrag der Franzosen mit dem Schweden, daß der Krieg ja dem Kaiser gelte, aber nicht den Fürsten der katholischen Liga. Und da hat Gustav Adolf einmal ausgerufen: »Ich weiß nicht, was das für ein Ding ist, Neutralität. Es ist nicht kalt, nicht warm, nicht weiß, nicht schwarz, nicht gut, nicht böse, ein unaufrichtiger, unbrauchbarer Zwitter. Damit mag ich mich nicht abgeben.« Oxenstierna aber war anderer Ansicht. Er meinte, man müßte die Fürsten nach Möglichkeit schonen, und man müsse geraden Wegs nach Wien gegen den Kaiser ziehen. Oxenstierna mag wohl sicher gewünscht haben, daß der König von Schweden deutscher Kaiser geworden wäre. Denn dann wäre er sein Leben lang in die deutschen Händel verwickelt gewesen, und die großen Herren in Schweden hätten wieder ein Adelsregiment einrichten können. So können wir es uns erklären, daß Marie Eleonore den König nach Schweden zurückhaben wollte, daß aber Oxenstierna auf den Zug nach Wien drang. Der König aber tat keines von beiden. Er wollte nach Bayern. Man stellte ihm vor, daß es falsch sei, daß er die Franzosen verärgere, wenn er das Land des Bayernherzogs besetze. Aber er blieb dabei und sagte: »Ich gehe nach Bayern. Dorthin weist mich der Zeiger in meiner Brust.« Da ließen die Königin und Oxenstierna traurig von ihm ab: Gustav Adolf hatte auf keinen Rat hören wollen. Er gab sein Schweden auf, indem er in Deutschland kämpfte, und er gewann auch Deutschland nicht, wenn er gegen die Fürsten kämpfte statt gegen den Kaiser.
Und jetzt beginnt der letzte Abschnitt des Krieges. Von dem wissen die meisten Geschichtschreiber nicht viel zu berichten, denn es war eine traurige Zeit. Nicht mehr, daß gottesfürchtige und mutige protestantische Streiter frohgemut in den Kampf zogen, sondern ein aus abgekämpften Schweden und kriegsmüden Deutschen zusammengewürfeltes Heer kämpfte gegen die Truppen des Kaisers, nicht mehr um des Glaubens willen, zusammengehalten nur durch den Willen eines Führers, ohne das Bewußtsein für irgendein Gut, das ihnen teuer wäre, zu fechten. Und in dieser Zeit ist es auch Gustav Adolf nicht mehr gut gegangen. Er zweifelte. Warum hat Gustav Adolf nach seinem großen Siege bei Breitenfeld nicht Friede gemacht? Er hätte die Fürsten, die ihn gerufen, zufriedenstellen und den Krieg beenden können. Er hätte ohne Schwierigkeiten Deutschland als Sieger verlassen und alle befriedigt, er hätte den Krieg beendigen und Deutschland und Schweden retten können, wenn er dem Kaiser nicht allzu schwere Bedingungen gemacht hätte. Statt dessen setzte er den Krieg fort, machte sich die Fürsten, von denen er zuviel verlangte, zu Feinden und führte doch keinen vernichtenden Schlag gegen den Kaiser.
Des Königs Glaube und seine Sicherheit war im Tiefsten erschüttert, als er keine große religiöse Aufgabe mehr vor sich hatte. Er hatte sich zuerst alles so leicht gedacht: hie Protestant, hie Katholik, und etwas Drittes gibt es nicht. Und nun sah Gustav Adolf, daß in dem Heere des Kaisers viele Protestanten waren, und er selbst hatte ein Bündnis mit dem katholischen Frankreich geschlossen, und alles ging durcheinander und war unverständlich. Der König kam von seinem Ziele immer weiter ab. Aber zu gleicher Zeit in seinem Zweifel und in seinem Unglück und in seinem Mißverstehen wurde er doch immer weiser. Als er nach Deutschland kam, da hatte er Katholiken, die in seine Hände fielen, schlecht behandelt, manche soll er sogar ohne Grund um ihres Glaubens willen haben rädern lassen. Und als er jetzt in Bayern einrückte, da erlaubte er den Städten den katholischen Gottesdienst, und als seine Soldaten solchen Gottesdienst störten, da ließ er sie hängen. So hatte er sich gewandelt, so war er in Schwierigkeiten und ihm selbst unverständliche Konflikte gestürzt, die ihm seine Ruhe und seinen klaren Blick nahmen. Was mag der König wohl gesucht haben in seinem unverständlichen und seinem beinahe planlosen deutschen Feldzuge nach der Schlacht bei Breitenfeld, was mag der Weiser in seiner Brust wohl gewesen sein, der ihn nicht nach Schweden zurückkehren ließ, dieser Weiser, der ihn nach Bayern trieb, und der alle seine oft so sonderbaren Befehle bewirkt hat? Vielleicht war es, dem König selbst unbewußt, Wallenstein, der ihn trieb. Vielleicht war es der Drang, diesen anderen großen Mann der Zeit treffen zu müssen, vielleicht war es ein innerer Zwang, sich dem einzigen wirklichen Feinde zu stellen, und vielleicht hat es den König zu der Gefahr und zu dem Entscheidungskampfe gezogen, vielleicht ahnte er es, daß sich seine Kraft und seine Größe nur an dem anderen bewähren könne. Vielleicht hat er es gespürt, daß ein Zusammentreffen zwischen ihm und Wallenstein einen Zusammenprall von Licht und Finsternis, von klarem Glauben und Siegesgewißheit, mit düsterer grübelnder Untergangsstimmung bedeute, vielleicht haben ihn die gleichen Kräfte immer wieder in den Bereich des großen Feindes gezogen, die den düsteren Wallenstein veranlaßt haben, immer wieder das Horoskop seines Gegners zu stellen, immer wieder sich mit Gustav Adolf zu beschäftigen. Wallenstein war einige Zeit vor Gustav Adolfs Feldzuge abgesetzt worden. Er war dem Kaiser zu mächtig, und nun saß der machtlose Feldherr grübelnd in seinem Schlosse in Böhmen und beschäftigte sich mit seinen astrologischen Studien. Immer wieder hat er die Stellung der Sterne untersucht und immer war das Ergebnis das gleiche geblieben: Aus Gustav Adolfs Sternbild ließ sich die sanguinische Komplexion, die Freude, Leutseligkeit und Zutraulichkeit herauslesen; dann sah man seine Waghalsigkeit und sein Streben nach hohen Dingen. Und das Schlimmste für Wallenstein war, daß die Kurve des königlichen Lebens steil nach oben ging, daß sein Glanz im Leben alles überstrahlte, und daß da zu lesen war, Gustav Adolf sei unbesiegbar, und nur durch sich selbst könne er fallen. Im Jahre 1631 werde der Planet Venus an der Sonne vorbeigehen, das bedeute unbestreitbar den Sieg des Schweden. Und nun lebte Wallenstein in der schweren Sorge, es zog ihn zu dem einzigen Gegner, den er hatte, und doch wußte er, daß es nicht sein Glück sein werde.
Wie oft mag Wallenstein sein eigenes Horoskop neben das Gustav Adolfs gehalten haben, und wie mag ihm dabei zumute gewesen sein, wenn er dann neben dem Bilde des starken Glaubenshelden sein eigenes Wesen sah, dieses sonderbare Bild eines Mannes, in dem sich leidenschaftlicher Ehrgeiz mit stärkster denkerischer Bändigung verband, dieses sonderbare Bild eines Abenteurers, der der klügste und gewandteste, zugleich der ungezügeltste und wildeste war, des Mannes, der durch Zweifel, Unentschlossenheit und mangelndes Selbstvertrauen zu Taten getrieben wurde, dieser sonderbare Mensch, düster und verschlossen, ständig mit sich selbst im Kampfe und doch zugleich bewußt, daß er der Größte seiner Zeit sei. Dieser Mann saß nun in seinem Schlosse und dachte des einzigen Gegners. Er hatte die Macht in Händen gehabt. Den Kaiser hatte er zu allem gezwungen, was er wollte. Seine Macht war unbeschränkt gewesen. Er war der eigentliche Herr in Mitteleuropa. Und selbst als sie ihn abgesetzt hatten, da sah er bald, daß es nicht für lange sein konnte, da sah er, daß sein Stern über lang oder kurz wieder steigen würde, da wußte er, auch ohne Heer als vergrämter und kranker Schloßherr in Friedland war er immer noch der Mächtigste. Den Kaiser verachtete er. Sein an Paracelsus geschulter magischer Glaube, den er Erkenntnis hieß, ließ ihn über die schale Frömmigkeit des Wiener Hofes lachen. Er wußte, daß der Kaiser in der Hand der Kirchenfürsten war, die ihre geistliche Macht zu weltlichem Nutzen mißbrauchten. Und die Generale des Kaisers, vor allem seinen Nachfolger Tilly, schätzte er richtig ein: zum Teil waren es geld- und beutegierige Söldner, zum Teil ehrsüchtige Höflinge, Männer wie Pappenheim oder Holk nichts als undisziplinierte Soldaten, solche wie Arnim nur unzuverlässige Fürstendiener und selbst die besten, wie Tilly, waren nur biedere Männer, die wohl ein Heer zu führen verstanden, die das richtige Verhältnis zwischen sich und dem Heere herstellen konnten, aber alles nur Untergeordnete, geeignet, Befehle auszuführen, unfähig, selbständig Großes zu erdenken. Wallenstein wußte, daß einzig er der Mann war, Europa umzugestalten, er wußte, daß keiner in Deutschland solchen Blick hatte wie er. Und das Zentrum dieses Mannes, was ihn aufrecht hielt und was ihn bei aller Schwäche, bei aller seelischen Hemmung auf der Höhe hielt, das war sein ganz starker und unbedingter Glaube an die Sterne. Dieser Mann spürte es nun, daß ein anderer auf die Szene trat, der auch bei aller Untüchtigkeit im Durchfechten diplomatischer Kämpfe gläubig bis ins Tiefste war. Glaube stand gegen Glaube: Wallenstein hatte seinen Gegner gefunden, den ersten, gegen den zu siegen sich lohnte: die beiden Großen der Zeit konnten einander gegenübertreten. Das mögen sie beide geahnt haben, das mag ihrer beider Entschließungen beeinflußt haben, das Bewußtsein, daß zwei gleichwertige Männer in Deutschland standen, für die beide zusammen kein Platz war. Diese denkwürdige und fast einzigartige Lage, um die sie beide wußten, mag für das Geschick Europas in diesen Tagen ausschlaggebend gewesen sein.
Wallenstein wies die Gesandten schroff ab, die ihm der Kaiser schickte. Er war abgesetzt worden, sein Stolz erlaubte ihm nicht, noch einmal für diesen Kaiser zu arbeiten. Immer wieder sagte er, er sei krank, er sei unfähig, ein Heer zu führen. Freilich wußte er es, daß dieses Sträuben nur Taktik war, er wußte um sein Geschick, daß er dem unbesiegbaren Gegner gegenübertreten müsse, und er wußte, daß sich durch dieses Zusammentreffen beider Männer Schicksal erfüllen würde. Und so schob er die Entscheidung und die Übernahme des Oberbefehls nur hinaus, einmal, weil seine Bedingungen so günstiger werden mußten, und zum anderen, weil die Zeit ruhig verloren werden konnte: Je länger Gustav Adolf in Deutschland blieb, desto schwächer wurde er. Aber dann kam es doch so weit. Wallenstein übernahm, zunächst allerdings nur für drei Monate, den Oberbefehl über die Heere des Kaisers und ließ sich mit einer wahrhaft erschreckenden Macht ausstatten. Der Kaiser hatte nicht einmal mehr das Recht, irgendeinem Offizier einen Befehl zu erteilen. Als einziges Reservat blieb es ihm, den Generalissimus wieder absetzen zu dürfen, wie es ihm beliebte. Bis dahin war Wallenstein Alleinherrscher. Es stand in den Bedingungen, die der Feldherr machte, unter anderem geschrieben: Wallenstein müsse in unbeschränkter Vollmacht des Kaisers, des ganzen Erzhauses und der Krone Spaniens oberster Feldherr sein. Nie dürfe sich der Kaiser beim Heer einfinden oder gar ein Kommando verlangen, der Feldherr habe das Recht allein, alle eroberten Gebiete als Lehen zu vergeben, jedes Gebiet in Österreich müsse ihm für die Feldzüge offenstehen und ebenso müsse ihm alles Geld, das er verlange, bewilligt werden. Außerdem ließ sich Wallenstein noch mancherlei Besitztümer für sich persönlich schenken. – An dem Tage, an dem der Herzog von Friedland den Oberbefehl übernahm, an dem Tage, an dem sich der Kaiser und sein General wieder versöhnten, als der Feldherr seinem Monarchen das erstemal wieder gegenübertrat, da war die Entscheidung gefallen, der Krieg in sein entscheidendes Stadium getreten. Niemand gab mehr vor, um religiöse Dinge zu kämpfen, zwei Machthaber rangen um Leben und Tod. Es war eine ganz schwere Entscheidung, noch schwerer darum, weil Wallenstein davon überzeugt war, daß der Kampf für ihn nicht glücklich ausgehen könnte. Aber der Verstand hatte bei ihm über den Glauben gesiegt, umgekehrt wie bei Gustav Adolf, wo am entscheidenden Tage in Mainz der Weiser in der Brust mehr gegolten hatte, als die Entscheidung der Klugheit.
Es war für Wallenstein sicherer, mit seinem Kaiser gegen den Eindringling zu fechten, als plötzlich wieder Abenteurer zu werden und zusammen mit dem fremden König und seinen Anhängern, in Sachsen, Hessen und Brandenburg, den Habsburgern die Macht zu entreißen. Geplant hatte er es freilich kurze Zeit, besonders darum, weil die Böhmen ihm die seit Friedrich V. Sturz verwaiste Krone heimlich angeboten hatten. Aber der Unterhändler der Sachsen, Arnim, war Wallenstein nicht sicher, und er mag gespürt haben, daß dieser Verrat am Kaiser für ihn Verhängnis gewesen wäre, denn dann hätte sich ja Gustav Adolf, sein einziger wirklicher Feind, auf des Kaisers Thron setzen können. So zerschlug er eines Tages entschlossen alle Bedenken und trat offen zum Kaiser, als Feind jedes Versuches, den Norden Deutschlands vom Süden zu trennen, als Helfer und Retter der katholischen habsburgischen Monarchie des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation.
Gustav Adolf verhandelte und verhandelte. Immer unsicherer wurde es, wer Freund und wer Feind sei. Die Franzosen, mit denen er ein Bündnis geschlossen hatte, bedrängten ihn hart und sandten ihm einen Unterhändler nach dem anderen: In dem Vertrage stünde geschrieben, daß der Schwedenkönig gegen den Kaiser zu Felde ziehe, da solle er endlich die katholischen deutschen Fürsten in Ruhe lassen. Und Gustav Adolf war doch mehr und mehr davon überzeugt, daß sein nächster Feind der Bayernherzog sei, und daß es jetzt einzig darum ginge, die bayerischen Städte zu gewinnen. Und zu gleicher Zeit kamen alle die deutschen Fürsten und verlangten einen Anteil an der Beute. Sie sagten, sie hätten ihre Soldaten dem Schweden zur Verfügung gestellt, sie hätten mit ihrem Kaiser gebrochen und wären um des Schweden willen Aufrührer gegen ihren Herrn geworden; da wollten sie Entschädigungen. Und Gustav Adolf versprach ihnen alles, was sie wollten. Er verteilte Länder, Grafschaften und Fürstentümer, und gab jedem, was er begehrte. Er hatte dabei gar nicht die Absicht, die Versprechen jemals zu halten. So vergab er manches Land doppelt und dreifach. So verschenkte er das Frankenland an den Kurprinzen von Brandenburg, und zugleich gab er es an die beiden Brüder Bernhard und Wilhelm von Weimar. Er dachte natürlich nicht daran, sein Versprechen irgendwie einzulösen, aber er erreichte dadurch sein Ziel: die beiden Brüder buhlten desto mehr um des Königs Gunst, jeder hoffte auf das Land, und so hatte er immer getreue Vasallen. Und wenn Gustav Adolf einmal ein Versprechen hielt, wenn er besetzte Gebiete wirklich verschenkte, dann tat er es nicht ohne Hintergedanken. Er stellte schwere Bedingungen, die neuen Herren mußten ihm den Lehnseid leisten, und immer wußte er es so einzurichten, daß sich die Deutschen untereinander verfeindeten, und daß sie sich gegenseitig nicht vereinen konnten. Und der Schwedenkönig war Herr über viele Fürsten und Städte, die einander haßten und nie einig werden konnten. Aber eines Tages waren alle Verhandlungen aus. Der König brach alle die Unterhandlungen zwischen den Franzosen und den deutschen Reichsfürsten ab. Er sagte schroff, daß sich für ihn erklären müsse, wer nicht sein Feind sei, und er marschierte zu Beginn des Jahres 1632 nach Bayern. Er mag es vielleicht geahnt haben, daß es sein letzter Feldzug sein würde, und er mag es wohl auch gewußt haben, daß jetzt der schwerste und der ruhmloseste Teil des deutschen Krieges, überhaupt die traurigste Zeit seines Lebens beginnen sollte. Zuerst ließ sich alles noch sehr gut an. Der Feldmarschall Horn nahm rasch die Stadt Höchstedt ein, und als es dem General doch schlecht zu gehen drohte, als Tilly mit seiner ganzen Macht ihm gegenüberstand, da rückte ihm Gustav Adolf mit dem gesamten Heere zu Hilfe, daß der bayerische General umdrehte und die Schlacht vermied. Und dann zog er sobald in Nürnberg ein. Die Stadt Nürnberg war evangelisch und sie begrüßte ihren Retter jubelnd. Hier hat Gustav Adolf noch einmal empfunden, daß er eine religiöse Mission habe, hier hat er noch einmal von der Einfachheit seines Kampfes geträumt, noch einmal daran gedacht, wie klar und eindeutig seine Aufgabe vor ihm lag. Und darum knüpfen sich an diese Tage von Nürnberg viele Anekdoten, darum sprechen die Dichter immer gern von diesen letzten glücklichen Tagen des Königs. Es ist seltsam, daß sich da besonders eine Geschichte bis auf unsere Tage erhalten hat, eine Geschichte, die von den verschiedensten Dichtern immer wieder und immer anders erzählt wird. In Nürnberg soll Gustav Adolf ein Mädchen getroffen haben, das sich dann seinem Heere angeschlossen hat, ein Mädchen, das dann als Leibpage des Königs mit in die Schlacht gezogen ist und in Lützen neben ihm den Tod gefunden hat, ohne daß der König wußte, wer um ihn war. Conrad Ferdinand Meyer hat uns davon erzählt, wie Gustav Adolf zu dem Ratsherrn Leubelfing gekommen sei und gesagt habe: »Euren Sohn möchte ich zum Leibpagen.« Aber der Sohn war ein Feigling, und er jammerte: »Dem vorigen Leibpagen haben sie ja ein Bein abgeschossen und einen anderen, den haben die Holkschen Reiter gefangen genommen und elend aufgehängt, ich werde sicher auch ganz jämmerlich zugrunde gehen.« Aber in dem Hause der Leubelfings lebte die Base des feigen Sohnes, die war die Tochter eines wilden Reiterführers. Und sie zog die Kleider des Vetters an und ging in Gustav Adolfs Heer.
Heinrich Laube erzählt etwas anderes. Er meint, das Töchterchen des Bürgermeisters hätte sich in den Schwedenkönig verliebt, und sie wäre ihm auf das Schlachtfeld von Lützen nachgeritten, weil der böse Herzog von Lauenburg, der sie entführen wollte, ihr falsche Botschaft gebracht und gesagt, der König hätte nach ihr verlangt. Und dann erzählt ein anderer Dichter, daß Ebba Brahe, die der König in seiner Jugend so geliebt hatte, verkleidet ins Feld gezogen wäre, und wieder andere erzählen eine düstere Geschichte von einem Mädchen, das in Männerkleidung flüchtig durch die Länder gezogen sei, um den kranken Vater zu suchen. Und dieses Mädchen soll Gustav Adolf den Tod vorausgesagt haben. Wir wissen nicht, ob an allen diesen Geschichten etwas Wahres ist, aber sie meinen bestimmt alle das gleiche: daß nämlich Gustav Adolf einsam geworden war und daß er Menschen brauchte, denen er vertraute. Denn er hatte alle seine alten Freunde fortgeschickt. Manche waren auch gestorben, mit vielen hatte er sich verfeindet, und die wenigen Getreuen brauchte er auf anderen Posten ferne von sich. Das war in Nürnberg, kurz bevor Gustav Adolf hörte, daß Wallenstein wieder der General des Kaisers geworden und daß er bereits Böhmen wieder erobert hatte. Indessen rückte der große Gegner Wallenstein immer näher. Darum verlegen auch die Dichter die Geschichten von den Vorbedeutungen und den Vorahnungen des Todes gern in die Zeit des bayerischen Feldzuges. Schon in Frankfurt, so wird erzählt, hätte die Königin einmal einen schrecklichen Traum gehabt: Es habe eine schwarze Katze die Königskrone von Schweden umgeworfen. Und in Bayern, da soll dem Könige der eiserne Ring, den er stets am Finger trug, zerbrochen sein. Und ein anderer Dichter erzählt von dem alten Manne, der Gustav Adolf sein Ende geweissagt habe, und August Strindberg läßt den König in Bayern klagen, daß das Vergangene wieder aufstünde und ihn quäle, die Blutschuld des Vaters, der in Linköping so viele der Besten Schwedens hingerichtet habe, und er zeigt uns, wie die Vergangenheit der Wasas in Gustav Adolf wieder lebendig wird, und wie da der König immer unsicherer und immer unentschiedener in seinen Entschließungen ist. »Mir ist es wie ein Traum, daß ich jetzt in Bayern bin, und ich weiß nicht mehr um die Wurzeln dieses unglückseligen Krieges« hat er gesagt. Und Johan Banér, sein bester General, ist vor ihn getreten und hat ihn an den alten Streit der Stures und des Wasas erinnert und hat ihm gesagt, daß er ein Sture sei. Da waren ihm alle die so lang begrabenen schwedischen Händel wieder wach. Und dann ist der junge Brahe im Heere gewesen, der dieselben Augen hatte wie seine Schwester, und diese Ähnlichkeit hat in Gustav Adolf auch wieder die Vergangenheit zurückgerufen. Und aus Wittenberg kam ein junger Student, Gustav Gustavson, das war der Sohn der Margarete Cabeljau, und so drängte sich alles im Leben des Königs wieder zusammen, was er vergangen glaubte, und er wußte nicht mehr, wohin er gehörte. Das erzählen uns die Dichter. Und es soll sogar ein Murmeln herumgegangen sein im Heere, daß der König katholisch geworden wäre. Das war ja sicher nicht der Fall, aber er hat es wohl erkannt, daß der Kampf nicht ein Kampf der Katholiken gegen die Protestanten war, sondern ein Kampf zwischen Nord und Süd. Und als die Tochter Gustav Adolfs die Königin Christine viele Jahre nach der Zeit des Krieges zum katholischen Glauben übergetreten war, da soll sie gerufen haben: »Sagt mir nicht, daß ich das Werk meines Vaters zerstöre. Er hat nicht für den evangelischen Glauben gekämpft, sondern darum, daß jedes Bekenntnis geduldet werde.«
Und bald darauf kam es nach mancherlei Hin- und Herziehen am Lech zur entscheidenden Schlacht mit dem allen Tilly. Bei dem Städtchen Rain waren die Kaiserlichen stark verschanzt und alle Brücken abgebrochen. Und nun standen sich auf den beiden Ufern die Feinde gegenüber. Gustav Adolf wagte, obwohl der Feind in fester Stellung war, den Übergang. Es kam ihm zugute, daß er die besseren Kanonen hatte, die berühmten schwedischen Lederkanonen, die ziemlich leicht waren, und die man hin und herbefördern konnte, während Tilly mit seinen alten und schwer zu transportierenden Geschützen im Nachteil war. Gustav Adolf eröffnete eine furchtbare Kanonade und dann versuchte er eine Brücke über den reißenden Fluß zu bauen. Und als sie fertig war, versprach er einem Hanfen tollkühner Finnen große Belohnungen, wenn sie auf die andere Seite des Flusses hinüber liefen und dort eine Befestigung bauten. Ehe Tilly es verhindern konnte, hatten die Schweden sich einen Brückenkopf geschaffen und drangen in das kaiserliche Heer ein. Der alte Tilly mochte es nicht überleben, zum zweiten Male besiegt zu werden. Vielleicht hat er den Tod gesucht, vielleicht hat er sich auch im Verzweiflungskampfe zu weit hinausgewagt, jedenfalls fiel der ehrliche, brave Soldat auf seinem Posten: eine schwedische Kanonenkugel zerschmetterte ihm ein Bein, und nach qualvollem Leiden starb er. Nach des Führers schwerer Verwundung mußte sein Heer bald den Rückzug antreten. Gustav Adolf verfolgte die Kaiserlichen nicht ganz bis nach Ingolstadt, wo sie sich wieder sammelten. Und es dauerte nicht lange, da zog der schwedische König unter Glockenläuten und von der Bevölkerung froh begrüßt im protestantischen Augsburg ein, im freudigen Bewußtsein, die Stadt, in der das evangelische Bekenntnis zum ersten Male festgelegt worden war, gewonnen zu haben. Doch die frommen Gedanken verflogen rasch; bald darauf suchte der König die Reste des bayerisch-kaiserlichen Heeres wieder. Das hatte sich in Ingolstadt unter dem Befehl des Kurfürsten von Bayern wieder gesammelt, und dort hat es einen kleinen Kampf gegeben, bei dem Gustav Adolf beinahe ums Leben gekommen wäre. Er stürzte zu Boden und wurde ohnmächtig. Aber bald stand er wieder auf und sagte: »Der Apfel ist noch nicht reif.« Vielleicht ist es ihm doch eine Warnung gewesen, und alle die vielen, die damals an Vorbedeutungen glaubten und an die sonderbaren Weissagungen, alle die mögen erschrocken gewesen sein, daß der König doch nicht ganz kugelfest war, wie sie meinten. Doch vorläufig war der äußere Verlauf des Krieges noch günstig für die Schweden. Einen festen Platz nach dem anderen haben sie erobert. Sie zogen siegreich in München ein, und der Kurfürst von Bayern mußte ganz im Süden in einem Zipfel seines Landes, in Regensburg, ausharren, bis ihm Hilfe kam. Und diese Hilfe kam von Wallenstein. Doch bevor Gustav Adolf in den Entscheidungskampf gerissen wurde, bevor der große Gegner ihm endgültig gegenüberstand, hatte er noch einen schweren Kampf zu durchfechten: es gab Revolten im eigenen Heer. Die Soldaten, denen er oft den Sold schuldig geblieben war, machten ein paarmal Versuche zu Aufständen, und der König konnte sie nur zurückhalten, indem er ihnen manchmal das Plündern gestattete. Und noch schlimmer war, daß die deutschen Fürsten sich gegen den König empörten, daß sie ihren Lohn verlangten, weil sie merkten, daß Gustav Adolf sie ausnützte. Und hier berichten uns die Geschichtschreiber von einigen drohenden und großen Reden des Königs, in denen er die Fürsten wieder zu sich bekehrt habe. Der König soll damals so zornig gewesen sein, wie ihn noch niemand vorher gesehen hatte. Er hat erst schwere Angriffe gegen die gerichtet, die ihn zuerst nach Deutschland gerufen hätten, um ihn jetzt zu verlassen. Und das machte auf die deutschen Fürsten Eindruck, obwohl die meisten von ihnen ihn ja gar nicht gerufen hatten. Und zum Schluß sprach der König wieder von der Reinheit seiner Absichten, und er sprach mit solcher Überzeugung und mit solcher Ehrlichkeit, daß sich ihm alle beugten. »Mir ist zwar wohlbekannt, daß das Glück meiner Waffen viele Neider erweckt hat, die meinen Ruhm schmälern und die Einfältigen zu bereden suchen, daß ich diesen Krieg nicht zur Rettung Deutschlands führe, sondern um mich selbst zu bereichern. Allein, ich rufe Gott zum Zeugen an, daß dem nicht so ist. Die früher vertriebenen Fürsten, welche ich ohne Eigennutz wieder eingesetzt, der Stand meiner königlichen Kammer, aus der ich schon viele Tonnen Goldes zu diesem Kriege hergeschossen, meine Gläubiger zu Frankfurt und anderen Orten, von denen ich große Summen Geldes entlehnt habe, mögen davon sprechen, ob ich in diesem Kriege meinen eigenen Vorteil oder nicht vielmehr die Wohlfahrt des deutschen Reiches gesucht habe – In keiner anderen Absicht verließ ich mein Reich und alles, was mir lieb ist, als einzig und allein, um, nächst meiner eigenen Sicherheit, der Tyrannei des Hauses Österreich Einhalt zu tun.« Und dann wandte er sich wieder gegen die Fürsten und rief: »Ihr helft ja euer eigenes Land zerstören. Mein Herz erbittert sich, da ich jetzt die Klage höre, daß schwedische Soldaten für unverschämter gehalten werden als selbst jene des Feindes. Aber es sind keine Schweden, es sind die Deutschen selbst, die sich mit solchen Ausschweifungen beflecken. Hätte ich euch gekannt ihr Deutschen, hätte ich gewußt, daß ihr so wenig Liebe und Treue zu eurem eigenen Lande zeigt, hätte ich kein Pferd für euch gesattelt, geschweige denn Krone und Leben eingesetzt.« Und dieser große Wutausbruch des Königs, diese furchtbare Anklage gegen die Fürsten hat einen großen Eindruck gemacht. Es unterwarfen sich wieder alle dem Willen des Königs und, ohne Bedingungen zu machen, waren sie wieder dem König ergebene Untertanen.

Einzug der Schweden in München am 7. Mai 1632.
Kpfr. von Matthäus Merian
Unterdessen war Wallenstein angekommen. Er war durch Böhmen gegangen, hatte in einem unglaublich schnellen Zuge das Land erobert und stand jetzt seinem Feinde gegenüber. Gustav Adolf mußte sofort wieder einen Teil Bayerns aufgeben und sich vor Nürnberg zurückziehen. Und hier bei Nürnberg, dachte er, würde es wohl zur Entscheidungsschlacht kommen. Aber es zeigte sich, daß Gustav Adolf anders und schwerer zu kämpfen hatte als jemals zuvor. So einfach wie Tilly machte es der Herzog von Friedland seinem Gegner nicht. Die beiden Feinde standen sich vor Nürnberg gegenüber. Keiner begann den Kampf. Jeder lauerte auf die Bewegungen des anderen. Wallenstein soll damals gesagt haben: »Ich werde jetzt dem Schwedenkönige eine neue Art der Kriegführung zeigen.« Es gab kein flinkes Streifen, kein »fröhliches Jagen« mehr, man konnte nicht mehr seine Truppen verzetteln, keine kleinen Eroberungen machen und den Gegner irreführen, sondern ganz entschlossen und ganz fest standen sich zwei große Heere im Stellungskriege gegenüber. Und beide Heere wurden endlich von einem großen Gegner besiegt, vom Hunger und von der Seuche. Zu Anfang gab es noch kleine Plänkeleien. Da nahm Wallenstein einmal ein paar Offiziere Gustav Adolfs in einem kleinen Gefecht gefangen und schickte sie großmütig wieder zurück. Oder es gab auch einmal kleine Kanonaden zwischen den Heeren. Aber dann wurde es immer stiller und trüber, und in immer unsicherer und düsterer Stimmung warteten die Heere auf die Bewegungen der Feinde. Plötzlich wagte Gustav Adolf, der zahlenmäßig der Stärkere war, einen Sturm. Wallenstein hatte sein Lager hinter der »alten Veste« aufgeschlagen, einem steilen Hügel, auf dessen Spitze eine kleine Schloßruine steht: nicht ungefährlich zum Aufstieg und Angriffsfläche nur für eine geringe Menge von Soldaten. Und diesen Berg hatte Wallenstein befestigt und mit allen Feinheiten der neuen Kriegskunst den Zugang erschwert. Mit unglaublichem Mut wagte Gustav Adolf den Angriff. Immer 500 Mann sandte der König vom Fuße des Berges aus, und nach kurzer Zeit flüchteten die wenigen, die von dieser Truppe übriggeblieben waren, neue 500 rückten an, und unter furchtbaren Opfern und Verlusten versuchte der Schwedenkönig bis zum Abend die Höhe zu nehmen. Es mißlang. Einzig war es dem Herzog Bernhard möglich, einen benachbarten Hügel, von dem aus Wallensteins Hauptstützpunkt beschossen werden konnte, zu besetzen. Doch es erwies sich als ganz unmöglich, auf diesen Hügel Kanonen zu tragen. Und so rief Gustav Adolf den Herzog von Weimar am nächsten Tage wieder von seinem Posten, den er mit unglaublichem Mute verteidigt hatte, zurück. Er gab den Sturm auf und ging auf Fürth bei Nürnberg zurück. Wallenstein verfolgte ihn nicht. Es muß eine ganz furchtbare Schlacht gewesen sein, mit eine der schrecklichsten des Krieges, und es war die Schlacht, in der dem Schwedenkönig äußerlich gezeigt wurde, was er wohl schon bei dem ganzen unglücklichen bayerischen Feldzuge gespürt haben mochte, daß es jetzt anders um ihn stand als bei seinem Zuge durch Pommern bis nach Breitenfeld hin. Gustav Adolf blieb noch vierzehn Tage in seinem Lager. Wieder vergingen zwei Wochen des aufreibenden Wartens, wieder belauerten die Gegner einander, und sie wußten, der, der zuerst das Lager räumt, der würde sich wohl als der Besiegte fühlen. Als aber Gustav Adolf als erster die Stellung aufgab, als er sein von Verlusten, von Hunger und Krankheit geschwächtes Heer aufbrechen hieß, um es in eine Gegend zu führen, die nicht so ausgesogen und nicht vom Kriege heimgesucht war, in eine Gegend, wo er seinen Soldaten wieder zu essen versprechen konnte, da war auch Wallenstein besiegt. Triumphierend blieben Krankheit und Tod auf dem Schlachtfelde, auf dem Stück Erde, das alles, aber auch alles hatte hergeben müssen für eine unerhört große Menschenansammlung, auf einem jetzt ganz niedergetretenen Stück Land, auf dem nichts mehr wuchs, wo nur Zerstörung und Trümmer herrschten. Zwei Lager wurden abgebrochen und zerstört, in denen ungesunde, halb verhungerte Männer verzweifelt ausgeharrt hatten. Beide Feldherren waren besiegt.
Gustav Adolf hatte eigentlich gedacht, daß Wallenstein nach dem Abbruch des schwedischen Lagers die Stadt Nürnberg angreifen würde, und er war deshalb in der Nähe geblieben und hatte die Bewegungen des Gegners beobachtet. Aber Wallenstein hatte gemerkt, was Gustav Adolf mit ihm vorhatte, und er brach nach anderer Richtung hin auf. Kaum war das geschehen, als Gustav Adolf sein Heer teilte. Die kleinere Gruppe ließ er zurück. Das Frankenland und Nürnberg mußten weiter geschützt werden. Er selbst zog wieder nach dem Süden, ging wieder zum Lech, wo er vor kurzem den großen Sieg über Tilly erfochten. Und dort traf den einsamen Mann ein neuer Schlag, er mußte hart zu seiner Gemahlin werden. Er hatte die Festung Rain am Lech, die er damals so mühsam erobert, einem Offizier zur Bewachung übergeben, und der hatte unnütz schmählich kapituliert. Gustav Adolf verurteilte ihn kurzerhand zum Tode, und da trat Marie Eleonore für den Verurteilten ein. Sie bedrängte ihren Mann hart, er möchte doch das herbe Urteil mildern, er möchte sich nicht so aller seiner Diener berauben. Gustav Adolf aber schnitt ihr kurz das Wort ab und sagte ihr, es sei nicht ihre Aufgabe, sich mißbrauchen zu lassen, was Kriegsrecht sei, das wisse nur er, und er verbot ihr, weiter von der Sache zu reden. Er schloß sich immer mehr ab. Immer weniger verstanden ihn die wenigen Freunde, die ihm geblieben waren, immer seltsamer wurden seine Befehle und seine Anordnungen. Und auch der Kriegsplan mißglückte. Gustav Adolf wollte nämlich in raschem Fluge Bayern von neuem erobern und wollte nach dem Süden ziehen, in das Land ob der Enns, und von dort aus wollte er den Kaiser direkt bedrohen, dann hätte Wallenstein zurückgemußt und hätte sich ihm im Süden gestellt. Aber der kaiserliche Feldmarschall war rascher. Er bedrängte Sachsen schon hart, ehe Gustav Adolf seinen Plan hatte durchführen können. Und da mußte der König zurück und mußte seinen Feind im Norden treffen. Gustav Adolf machte wieder den Weg rückwärts nach Norden. Er kam wieder nach Franken, und er zog durch Thüringen, um seinen norddeutschen Verbündeten zu helfen, um Sachsen zu retten, Brandenburg, Pommern und Mecklenburg, die Länder, die Wallenstein besetzen wollte, wenn er Mitteldeutschland dem Kaiser erobert hätte. Ein Erfolg schien Gustav Adolf auf dem Rückweg noch beschieden: ein süddeutscher Fürstenbund kam zustande. Noch nicht der große Bund der deutschen Fürsten, die sich gegen Habsburg wandten, noch nicht der Bund, den Gustav Adolf ersehnt hatte, denn die Norddeutschen waren noch nicht zu bewegen, sich daran zu beteiligen. Aber es war immerhin der erste Anfang, es waren die ersten Erfolge einer Politik, die Gustav Adolf und die sicherlich vor allem Oxenstierna seit der Schlacht bei Breitenfeld tatkräftig und bewußt betrieben hatte. Jetzt in Thüringen sahen sich Gustav Adolf und sein Kanzler zum letzten Male. Oxenstierna ging nach Frankfurt, der König zog weiter nach Nordosten, Wallenstein nach. In Arnstadt traf er den Herzog Bernhard von Sachsen-Weimar, den er mit einer Heeresgruppe in Schlesien gelassen hatte und dem er in der letzten Zeit oft hatte verbieten müssen, auf eigene Faust Kämpfe zu wagen. Da verlor Gustav Adolf seinen letzten wirklich begeisterten Anhänger. Bernhard konnte es nicht verwinden, daß der König ihm verboten hatte zu kämpfen. Er legte sein Kommando in des Königs Hände zurück. Doch Gustav Adolf hat es wieder vermocht, den Herzog für sich zu gewinnen. Der Macht seiner großen Persönlichkeit konnte sich der Fürst nicht entziehen, und er kämpfte weiter als Gustav Adolfs treuester Bundesgenosse. Doch daß es auch mit diesem seinem treuesten Freunde unter den Deutschen einen Bruch gegeben hatte, das mag den König bedrückt haben. Wallensteins Heer kam immer näher, und der König bereitete sich immer mehr auf die Schlacht vor. Er musterte sein Heer und organisierte es neu, er schuf wieder gleiche Gruppen und machte seine Soldaten so kampffähig als irgendmöglich. Dabei nahm er innerlich schon immer mehr Abschied von der Welt, dabei sah er alles schon mit den Augen des Mannes, der den Kämpfen eigentlich entrückt ist, der weiß, daß es ihn nicht mehr lange auf der Erde halten wird. In Erfurt sah er Marie Eleonore wieder. Kaum daß er Zeit hatte, die arme, von Todesahnungen gequälte Frau zu trösten. Er arbeitete eine Nacht an den Befehlen für sein Heer und zog am nächsten Morgen weiter. Und in Naumburg geschah es ihm das letztemal, daß Bürger vor ihm niederfielen und ihn jubelnd als den Retter begrüßten. Sie küßten seine Steigbügel, sie versuchten seine Hände zu greifen, und der König spürte zum letzten Male die Größe der Macht und die Größe seiner Aufgabe. »Ihr ehrt mich ja wie einen Gott«, sagte er traurig und bewegt, »aber wißt, daß ich nur ein sehr sündiger Mensch bin«. Hier in den letzten Tagen seines Lebens hatte er wieder alle Erobererpläne vergessen. Es ging ihm nicht mehr um einen Protestantenbund, und der Schutz Schwedens war eine Sache, die man dem Kanzler überantwortete. Jetzt von dem Gefühl überwältigt, endgültig dem einzigen großen Gegner gegenüber zu stehen, zugleich im Gedanken des nahen Todes, war er wieder der fromme Lichtritter, der ausgezogen war, um die Glaubensgenossen zu retten. Alle die Dichter erzählen es, seinen eigenen Leichenzug wollte er gesehen haben, und auch die Königin hat ein Gesicht gehabt, wie sie hinter der Bahre des Gatten herschritt, viele Tage vor dem Tode des Königs, und der Leibpage Leubelfing sah einen schwarzen Raubvogel, der aus der Luft herniedergestoßen kam, gerade auf das Zelt des Königs zu. Und der König selbst hat von seinem Zelt aus gerade auf einen Hügel mit drei Mühlen gesehen, deren Flügel standen so, daß sie wie die Kreuze von Golgatha ausgesehen haben sollen. Sie haben ein Lager aufgeschlagen. Da sah man auf der einen Seite den Ort Breitenfeld, wo der König seine glücklichste Schlacht geschlagen hatte, wo er gezeigt hatte, daß er zu den Ersten des Erdkreises gehörte, und auf der andern Seite, da lag der Ort Lützen, wo Wallenstein auf die Verstärkung wartete, und dazwischen stand der König, der wußte, daß jetzt die Entscheidung kommen würde.
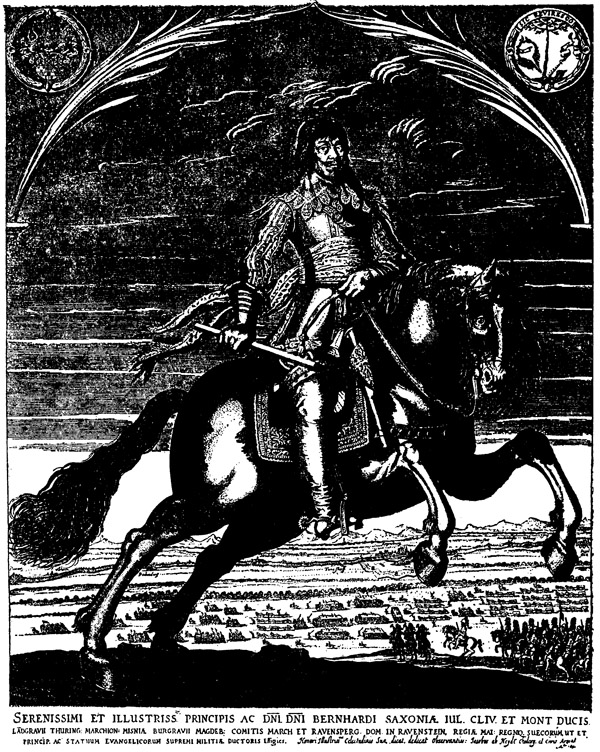
Herzog Bernhard von Sachsen-Weimar
Kpfr. »on Jacob von Heyden
Wallenstein war von der Schnelligkeit, mit der der König ihn getroffen hatte, überrascht. Er hatte noch versuchen wollen, Naumburg zu nehmen, aber Gustav Adolf war ihm zuvorgekommen. So blieb er in seinem Lager dem König gegenüber und wartete auf die Bewegungen und Pläne des Königs. Doch da entstand ihm eine ungeahnte Schwierigkeit. Der General Pappenheim wurde wieder einmal widersetzlich. Pappenheim war der Unterführer Tillys gewesen, und er hatte sich mit dem Bayern verzankt und um seine Entlassung gebeten. Denn Tilly hatte immer den Vorteil des katholischen Fürstenbundes, der Liga, im Auge, er war ein treuer Diener seines Herrn, des Herzogs Maximilian von Bayern, gewesen, und Pappenheim war kaiserlich. Und noch viel mehr als diese Differenz war es, daß Pappenheim Soldat und nichts als Soldat war, einer, der nur die Freude am Losschlagen kannte, einer, der immer, gleichgültig, ob es günstig oder nicht günstig war, in derben Reiterhändeln und in Landsknechtstreifen sein Glück machen wollte. So hatte er von dem bedenklichen und vorsichtigen Tilly den Abschied erhalten. Wallenstein aber hatte sich den General wieder geholt, denn er schätzte seine Wucht und sein tapferes Draufgängertum. Zugleich glaubte er sich stark genug, den Ungebärdigen zu zügeln. Nun wollte Pappenheim fort. Eine von den Sondergruppen, die Gustav Adolf im Westen zurückgelassen hatte, bedrängte Köln hart, und Pappenheim hatte sich in den Kopf gesetzt, diese Stadt zu entsetzen. Weniger, weil ihm an Köln gelegen war, als hauptsächlich darum, weil er es nicht ertrug, im Lager unter dem Befehl eines Oberen auszuharren. Wallenstein tat so, als ob er Pappenheims Vorhaben sehr ungern billigte. Er berief einen Kriegsrat, in dem er sich der Stimme enthielt und in dem Pappenheim von den Obersten Beifall erhielt, als er seinen Plan, das Heer zu teilen, entwickelte. Der König von Schweden wollte jetzt keine Schlacht wagen, so sagte er, es sei also falsch, noch einmal den Fehler zu machen wie bei Nürnberg und ein großes Heer unnütz auf einem Flecke warten zu lassen. Wallenstein ließ den ungebärdigen General gern gehen. Er gab ihm sogar eine größere Heeresmacht mit, als Pappenheim gehofft hatte, und er schickte auch andere Gruppen mit Sonderaufträgen fort. Er selbst rüstete sich, um nach Norden, nach Merseburg und nach Halle, zu ziehen. Denn Wallenstein benutzte den General in Wahrheit für seine eigenen Pläne. Er ließ ihn gehen und teilte das gesamte Heer, weil er so dem König den Weg nach Dresden freigab. Wallensteins Heer sollte im Norden bei Halle stehen, andere Abteilungen im Süden an der böhmischen Grenze. Dazwischen sollte in der Gegend von Naumburg und Lützen ein kleiner Landstrich freibleiben, ein schmaler Paß, gerade groß genug, um Gustav Adolf unbesorgt nach Dresden ziehen zu lassen. Dort hätte sich der König leicht mit dem Kurfürsten von Sachsen verbinden können, und diese lockende Aussicht wollte Wallenstein dem König bieten. Wäre der König in diese Falle gegangen, so hätte der Feldherr des Kaisers seine Truppen von Süden und Norden her gegen den getäuschten König schicken können und hätte ihn während des Zuges zur Schlacht gezwungen, die dann wohl schwerlich für Gustav Adolf günstig abgelaufen wäre. Gustav Adolf aber handelte anders. Er ging nicht in Wallensteins Falle, und er zeigte zum letzten Male vor der Entscheidung, daß er groß genug war, den größten Diplomaten und Feldherrn seiner Zeit zu durchschauen.
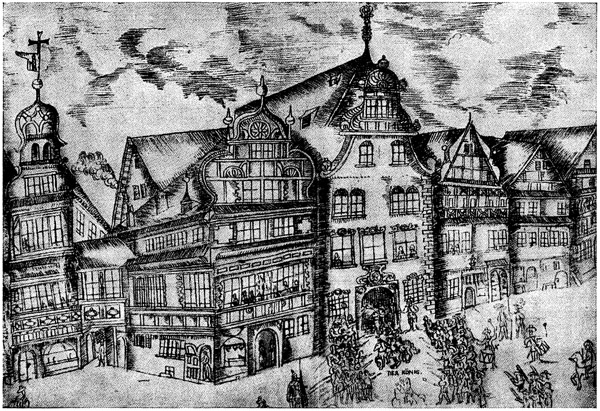
Empfang Gustav Adolfs vor der hohen Lilie in Erfurt am 2. Oktober 1631
Gleichzeitige Handzeichnung von Samuel Fritze
Noch einmal kehrte dem König das alte Siegesbewußtsein zurück, als ihm die Kundschafter meldeten, daß Wallenstein sein Heer geteilt habe, daß Pappenheim nach Halle abgezogen sei und die zurückgebliebene Truppe des Heeres in der Gegend von Lützen sorglos verteilt läge. »Ich glaube jetzt beinahe, daß Gott den Feind in meine Hände gegeben hat«, rief er aus und gab den Befehl zum Aufbruch aus Naumburg. Und er hatte zum letzten Male eine Rede gehalten und zu seinen Offizieren gesprochen, so ehrlich und so groß wie noch nie, eine Rede, von der uns Conrad Ferdinand Meyer in wundervoll schöner Weise erzählt, wenn er sie vielleicht auch als Dichter ein wenig verändert hat. Der König, heißt es dort, hatte jetzt seine letzten Befehle gegeben und war in der wunderbarsten Stimmung. Er erhob sich langsam und wendete sich gegen die Anwesenden, lauter Deutsche, unter ihnen mehr als einer von denjenigen, welche er im Lager bei Nürnberg mit so harten Worten gezüchtigt hatte. Ob ihn schon die Wahrheit und die Barmherzigkeit jenes Reiches berührte, dem er sich nahe glaubte? Er winkte mit der Hand und sprach leise, fast wie träumend, mehr mit den geisterhaften Augen als mit dem kaum bewegten Munde: »Herren und Freunde, heute kommt wohl mein Stündlein. So möcht' ich Euch mein Testament hinterlassen. Nicht für den Krieg sorgend – da mögen die Lebenden zusehen. Sondern – neben meiner Seligkeit – für mein Gedächtnis unter Euch! – Ich bin übers Meer gekommen mit allerhand Gedanken, aber alle überwog, ungeheuchelt, die Sorge um das reine Wort. Nach der Viktorie von Breitenfeld konnte ich dem Kaiser einen läßlichen Frieden vorschreiben und nach gesichertem Evangelium mit meiner Beute mich wie ein Raubtier zwischen meine schwedischen Klippen zurückziehen. Aber ich bedachte die deutschen Dinge. Nicht ohne ein Gelüst nach Eurer Krone, Herren! Doch, ungeheuchelt, meinen Ehrgeiz überwog die Sorge um das Reich! Dem Habsburger darf es unmöglich länger gehören, denn es ist ein evangelisches Reich. Doch Ihr denket und sprechet: ein fremder König herrsche nicht über uns! Und Ihr habt recht. Denn es steht geschrieben: der Fremdling soll das Reich nicht erben. Ich aber dachte letztlich an die Hand meines Kindes und an einen Dreizehnjährigen …« Sein leises Reden wurde überwältigt von dem stürmischen Gesange eines thüringischen Reiterregimentes, das, vor dem Quartier des Königs vorbeiziehend, mit Begeisterung die Worte betonte:
»Er wird durch einen Gideon,
Den er wohl weiß, dir helfen schon …«
Der König lauschte und ohne seine Rede zu beendigen, sagte er: »Es ist genug, alles ist in Ordnung«, und entließ die Herren. Dann sank er auf das Knie und betete.
Aber am nächsten Morgen, am Schlachttage, da hatte sich ein Oktobernebel über die Ebene gesenkt, und der König war ängstlich und zweifelte. Alle die furchtbaren Gesichte und Stimmungen der letzten Wochen und Monate kamen wieder über ihn, er sah das nahe Ende, und er sah alle die Fäden, in die er sich verstrickt hatte. Nur der Tod auf dem Schlachtfelde konnte all die furchtbaren Schwierigkeiten lösen, alle die Wege, die miteinander nicht zu vereinen waren, verbinden. Er mußte daran denken, daß er ausgezogen war, sein Schweden zu schützen, und daß er es vergessen hatte um der deutschen Macht willen, er dachte, wie unvereinbar seine evangelische Sendung war mit dem Befehl, den katholischen Gottesdienst zu schützen, er dachte daran, wie er Duldsamkeit als das oberste Ziel erkannt hatte, und daß das Blut der geräderten Katholiken dagegen zeugte, er gedachte seines Bündnisses mit den Franzosen und seiner Härte gegen die aus Frankreich vertriebenen Protestanten. Er gedachte an den jungen Rålamb, den er um eines harten Wortes willen vertrieben, und an Marie Eleonore, die er um ihrer Bitte für einen schuldigen Offizier hart gescholten. Er dachte daran, daß er gegen seine Freunde zu Felde gezogen, mit seinen Feinden paktiert habe, und er dachte daran, wie er, ein junger siegessicherer Held, von Freunden und Getreuen umgeben, nach drei Kriegen sicher und strahlend in den vierten gezogen war. Und er sah an sich herunter und sah einen untersetzten und während des Feldzuges dick gewordenen Menschen, er sah, daß die Falten des Zornes, die früher von dem stets freudigen Lächeln überdeckt waren, immer stärker hervortraten, und er spürte seine tiefe Einsamkeit. An Ebba Brahe mag er auch gedacht haben, die einzige Frau, die er wirklich geliebt hatte, und dann dachte er wieder an die Zukunft und an das große Reich, das von Bayern bis hinauf nach Finnland reichen sollte, glücklich und stark regiert von Christine und dem Brandenburger Kurprinzen, von Friedrich Wilhelm, in dem er den »großen Kurfürsten« schon gesehen haben mochte. Und vielleicht hat er manches von der Zukunft trübe geahnt, daß Christine nach einem verfehlten Regentenleben, das Stockholm zu einem Zentrum der Künste und Wissenschaften, das Land Schweden aber zu einem kleinen Staate machte, katholisch werden und der Krone entsagen würde, oder daß Friedrich Wilhelm bei Fehrbellin gegen die Schweden ziehen würde, deren Herr er doch hätte sein sollen. Den Panzer lehnte er ab, als der junge Page Leubelfing, der einzige, an den er noch glaubte, ihn brachte. »Die Kugel, die für mich bereitet ist, fliegt schon wieder einmal in der Luft,« sagte er, »da nutzt mir der Panzer nicht, er ist mir ohnehin zu schwer, seit ich so dick geworden bin.« Und der Hufschmied, der seine Pferde beschlug, das streitbare weiße und den brennenden Fuchs, der hat Verse aus der Offenbarung Johannis gesprochen: »Und ich sah und siehe ein weiß Pferd, und der darauf saß, hatte einen Bogen, und ihm ward gegeben eine Krone, und er zog aus, siegend um zu siegen.« Und das andere Insiegel: »Und es ging heraus ein ander Pferd, das war rot, und dem, der darauf saß, ward gegeben, den Glauben zu nehmen auf der Erde, auf daß sie einander schlachteten …«
Und dann kam die Schlacht. Der König rückte an seinem rechten Flügel selbst an der Spitze der Truppe vor. Er ließ das Lied singen: »Verzage nicht, du Häuflein klein«, von dem die Soldaten sagten, er hätte es selbst gedichtet. Und dann gab er den Befehl zum Angriff. Es ging zuerst alles gut. Aber während Gustav Adolf noch im heftigen Handgemenge beschäftigt war, hörte er, daß beim Fußvolk in der Mitte der Kampflinie die Schlacht schlecht stehe. Er eilte rasch hinüber, stellte sich an die Spitze eines Regimentes und begann von neuem ganz scharf anzugreifen. Der Nebel, der sich vormittags um 11 Uhr kurze Zeit gelichtet hatte, wurde wieder schwerer, der König, in der Erregung der Schlacht, setzte zu rasch über die Gräben, seine Småländer Soldaten konnten ihm nicht rasch genug folgen, und plötzlich war er mitten in einem Haufen feindlicher Kürassiere, sein Pferd stürzte getroffen zusammen, zu gleicher Zeit wurde ihm selbst das linke Armbein zerschmettert. Er bat im Sturze den Herzog Albrecht von Lauenburg, den Vetter, der ihm stets nur widerwillig gefolgt war, ihn aus der Schlacht zu tragen. Aber im selben Augenblick fiel ein zweiter Schuß: der König wurde im Rücken getroffen, neben ihm sein letzter Getreuer, der Page Leubelfing. Lauenburg und die wenigen anderen seiner Umgebung mußten fliehen. Unterdessen hatte Wallenstein Pappenheim aus Halle zurückgerufen und, wäre der kaiserliche General etwas schneller zurückgekehrt, so hätte es für die Schweden, die durch das Gerücht von dem Tode des Königs erschreckt waren, übel auslaufen können. So aber sammelte Herzog Bernhard mit erstaunlicher Schnelle das Heer von neuem, und es gelang ihm, Wallenstein auf der ganzen Linie zurückzudrängen. Die Schlacht als solche war von den Schweden gewonnen worden.

Tod Gustav Adolfs in der Schlacht von Lützen am 16. November 1632
Kpfr. von Matthäus Merian
Die Schlacht war gewonnen, aber das Spiel war verloren. Der König war tot, und Wallenstein konnte sein Heer ungestört sammeln und nach Leipzig führen. Norddeutschland stand dem kaiserlichen Feldherrn offen – so konnte er seinen Plan trotz der Niederlage ausführen. Und jeder der beiden großen Gegner hatte einen Teil des Sieges für sich: Gustav Adolf war der Herr des Schlachtfeldes gewesen, Wallenstein wurde der strategische Erfolg zuteil. Gustav Adolf fiel im Bewußtsein, unbesiegt zu sein, auch Wallenstein hatte es gewußt, daß er ihn nicht schlagen konnte, stand doch in den Sternen zu lesen: nur durch sich selbst wird der Schwedenkönig fallen. Gustav Adolfs Untergang war ein Soldatentod; tollkühn und unvorsichtig, mitreißend und selbst mitgerissen, war er vorwärts gestürmt, war durch sein eigenes Verschulden in den Tod gejagt. Kühnes Heldentum schlug bei Lützen die kühle Feldherrnüberlegung – doch nach der Schlacht schlug das heiße Herz nicht mehr, und der harte Verstand hatte den Erfolg für sich.
Als ob alles ehrliche Kriegertum bei Lützen hätte untergehen sollen: auch Pappenheim war nicht mehr. Schlachtgierig war er aus Halle angekommen, hatte nur gefragt, auf welchem Flügel der König kämpfe und hatte sich, ohne zu überlegen, mitten in die Schlacht gestürzt, da hatten ihn zwei Pistolenschüsse getroffen, und seine Getreuen hatten ihn vom Schlachtfelde wegführen müssen. Tieftraurig über die Niederlage Wallensteins lag der Schwerverwundete noch kurz in Leipzig, dann starb er froh: er hatte noch erfahren, daß auch der Feind dahin sei. Sonderbares Schicksal, daß die beiden kühnsten und draufgängerischsten Feldherren, die beide im gleichen Jahre geboren waren, fast am gleichen Tage auf die gleiche Weise ihr Leben enden mußten. Mit Gustav Adolfs Tode endet nicht nur das ehrliche Kriegertum, es endet zugleich der Gedanke des Religionskrieges. Nun war niemand mehr da, der noch fest an ideelle Ziele in diesem Kriege glaubte. Jetzt wußten sie alle, daß es nur noch um Länder und um Dynastien ging. Die tapferen Soldaten lebten nicht mehr. Übrig blieb der kalte, der berechnende große Wallenstein, übrig blieb der geschickte Unterhändler Arnim und übrig blieb auch der Vetter des Schwedenkönigs, Franz Albrecht von Sachsen-Lauenburg. Und daß kurz nach der Schlacht bei Lützen dieser Verbündete und Freund des toten Königs aus dem schwedischen Lager in das kaiserliche überging und seinen Vetter noch im Tode verriet, das ist ein deutliches Zeichen für die Umwandlung und den neuen Geist, der jetzt im schwedischen Heere herrschend wurde. Franz Albrecht ist ein Überläufer gewesen, und man hat gesagt, daß er den König ermordet hätte. Ein Reitknecht, der in des Königs unmittelbarer Nähe gewesen war, hatte ihn der schweren Tat bezichtigt. Es häuften sich ja auch alle Kennzeichen: er war dicht hinter dem König gewesen – da hatte der König einen Schuß in den Rücken bekommen. Dann hatte Franz Albrecht den verwundeten König allein gelassen, war im Nebel geflohen und war bald darauf im Lager der Feinde. Aber wir glauben nicht, daß der Vetter die schwere Tat begangen hat. Er war ein Diplomat, einer, der es immer mit den Siegern halten mochte, aber kein Bösewicht. Dazu haben ihn erst die Dichter gemacht, die gesagt haben, er hätte die schöne Ebba Brahe geliebt, und er hätte es nicht verziehen, daß sie ihn verstoßen hätte, um den König anzuhören. Aber die Flucht Franz Albrechts war ein deutliches Zeichen, war ein Sinnbild für die Wandlung im Kriege. Jetzt gab es kein gottbegeistertes Schwedenheer mehr, es gab Zwietracht und Uneinigkeit. Oxenstierna geriet in Händel mit Herzog Bernhard von Weimar, der das Heer jetzt führen wollte. Es ist ein häßliches Kapitel, wie aus den Schweden, die als Retter nach Deutschland gekommen waren, plötzlich Feinde und gefürchtete Räuber wurden, und es ist sehr traurig zu sehen, daß Gustav Adolfs Andenken von diesen Soldaten geschändet wurde. Das haben auch die deutschen Dichter gesehen, und Karl Fleming, der den König so begeistert begrüßt hatte, der ihm zugejubelt hatte, schrieb nun angesichts der Verwüstungen, die die schwedischen Heere anrichteten: Gustav Adolf war unser Feind, der Ausgang des Streites lehrt, daß er nicht als Freund zu uns kam. So hat man den Schwedenkönig bald vergessen, und es hat langer, langer Jahre bedurft, bis die Wunden, die die schwedischen Generale nach des Königs Tode geschlagen, vergessen waren und bis man wieder wirklich und ruhig das Verdienst des Schwedenkönigs sehen konnte, bis man wieder von ihm sprechen konnte: leidenschaftslos, von einer geschichtlichen Persönlichkeit, nicht von einem Feinde.
Die Freunde des Königs aber führten nach der Schlacht ihren toten König traurig nach der Heimat. Sie hatten es ja schon vorher gewußt, wie es kommen mußte, die in der Heimat hatten am Schlachttage Gesichte gehabt, und der ganze Kampf von Lützen war in den Lüften an ihnen vorbeigezogen.
Ein kleiner, trauriger Zug ging durch Deutschland, als sie die Leiche nach Wolgast brachten. Dort sprach der Hofprediger Jakob Fabricius tröstende Worte zu der weinenden Königin, und dann fuhren sie über die Ostsee nach Stockholm. In der Riddarsholmskirche haben sie ihrem König ein Grabmal gesetzt, im Herzen Stockholms, wo man auf der einen Seite den Mälarsee rauschen hört und auf der anderen Seite weit in das Schärenmeer hinaussieht, im Herzen Schwedens, wo der Mälar auf das innere Land hinzeigt, auf die Heimat, und die Schären nach Süden weisen, nach Deutschland, dort, wo es die Lorbeeren zu holen gab. In der Riddarsholmskirche haben sie ihm auf das Denkmal die Zeilen geschrieben:
Schweres nahm er auf sich,
Geknechtete befreite er,
Noch sterbend war er Sieger.
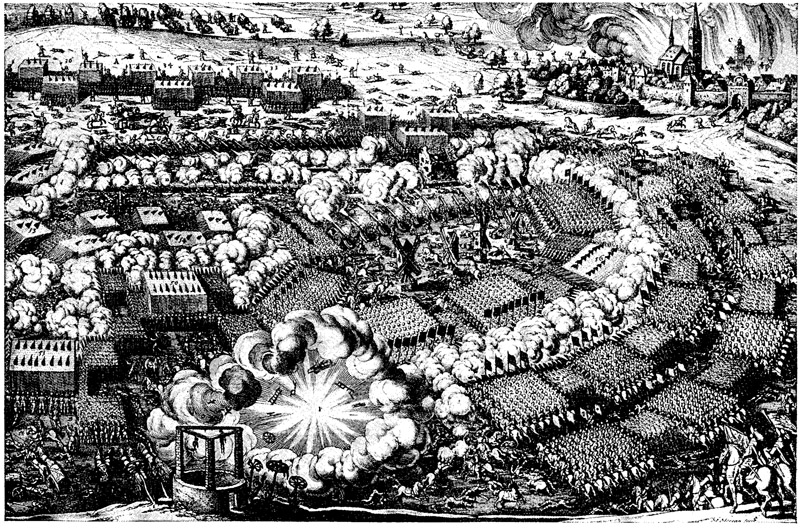
Schlacht bei Lützen 1632.
Kupfer von M. Merian. Ausschnitt
Lange schon lag Gustav Adolf in seinem Grabe, und man wußte wenig von ihm. Die Deutschen mochten von dem Schweden nichts mehr wissen und in der Heimat gab es unter Christine, gab es unter Karl XII. so Hartes zu bestehen, daß man nicht mehr der Vergangenheit gedachte. Aber dann hat Gustav III. von Schweden, ein Neffe von Friedrich dem Großen und ein Bewunderer des Preußenkönigs, das Andenken seines großen Ahnen wieder zu Ehren gebracht. Gustav III. war einer der ersten, der uns wieder gezeigt hat, wie bedeutsam, wie großartig, wie gradlinig und ehrlich das Wirken Gustav Adolfs gewesen ist. Und seit seiner Zeit wissen wir, wer Gustav Adolf war. Es hat in der letzten Zeit Männer gegeben, die den König zu einem Heiligen machen wollten, der für nichts als für Luthers Religion gewirkt hat. Das ist nicht wahr. Der König hat seine Pläne als Staatsmann und als Herr seines Landes gehabt, er war ein Kämpfer für Gradheit, für Ehrlichkeit, er war der »Lichtritter«, wie ihn so viele Dichter genannt haben. Aber er war so klar, so einfach und so innerlich aufrichtig, daß er an den Ränken der Staatsmänner zerbrach. Er hat immer für das Helle, das Schlichte und das Grade gekämpft, und darum konnte Ernst Moritz Arndt von ihm singen:
Solange Sterne kreisend geh'n
Wird, Gustav, dein Gedächtnis sein.
Denn nicht wie finstre Höllenmächte,
Die Tod und Flammen um sich spei'n,
Zog das gewalt'ge Schwert die Rechte,
Du fielest für der Menschheit Rechte,
Drum sollst du Menschen heilig sein.