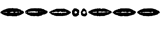|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Wer kennt nicht das Sehnen, das einen manchmal überfällt mitten im Hasten und Lärmen des Tags, nach irgendeinem stillen, verschollenen Winkel. Irgendwo, irgendwann war da ein Fleckchen Erde, auf dem sich aller Friede zusammenzudrängen schien. Die Seele sucht danach, die Sinne weben an einem Bild. Da ist der Schatten unter schweren Obstbaumzweigen, ein weißer Gartenweg, von scharlachroten Phloxstauden eingesäumt, ein wildüberwachsener Zaun, über dem in der Sonne des Nachmittags Schmetterlinge sich haschen. Irgendwo, irgendwann – die Erinnerung will keine bestimmte Antwort geben auf deine Frage. Vielleicht war der heimliche Winkel nie Wirklichkeit, ist nur im Traum. Aber die Seele bleibt doch auf der Suche. Und so laut die Welt werden mag, so groß und heldenhaft die Ereignisse sind, mit denen ein Tag den vorigen überdröhnt – das Sehnen beschleicht dich doch wieder, ja erst recht, denn die Seele hat ihre Weise für sich, ihr Gesetz, ihr Maß, ihre Geschichte, und die mächtigste Zeitlichkeit kann sie nicht zwingen …
Ich hatte schon alle Hoffnung aufgegeben, in diesem Kriegsjahr wie sonst ein paar Sommerwochen von der Großstadt auszuruhen. Dann war es doch anders gekommen. Familienangelegenheiten hatten mich über Nacht in meine Heimat entführt. Einmal im Lande, wollte ich mich noch da und dort umsehen, noch mit dem und jenem sein Sorgen und Hoffen teilen, wie es einem jeden der Krieg zugemessen hat. Meine letzte Rast hielt ich in der kleinen Oberamtsstadt am Fuß des Gebirgs, in der mein Vetter Oberamtmann war: in früheren Jahren hatte ich manche Woche bei ihm zugebracht; bergwärts und talwärts war mir die Umgegend vertraut, Menschen und Landschaft, und auch heuer streifte ich sie rechtschaffen ab – meist allein, denn der Herr Oberamtmann war vollauf beschäftigt, und ich hatte mir's von vornherein so ausbedungen.
Von einer tüchtigen Bergwanderung kam ich eines späten Nachmittags in das Dorf Brambach, das schon in der Ebene liegt, eine kleine Stunde von der Oberamtsstadt entfernt. Ich schlenderte gemächlichen Schritts die Straße hin. Die Halbwüchsigen und die Alten waren auf dem Feld. Nur ein paar Kinder teilten sich mit leise glucksenden Hennen und einem bellenden Spitz in die ruhige Gasse zwischen den sauberen Häusern. Das Wirtshaus »Zum Pfauen« war mir für einen guten Tropfen bekannt. Als ich das übergoldete Pfauenschild vor mir auftauchen sah, hatte ich nicht übel Lust, einen Schoppen zu versuchen. Aber unter der Linde beim Haus spielte gerade die Sonne herein und durch die offenen Fenster drang dem Näherkommenden das nicht eben lärmende, aber doch vernehmliche Geräusch einer größeren Tischgesellschaft entgegen. Drei ausgespannte Wagen und ein Laubgewinde über der Haustür ließen unschwer auf eine Hochzeit raten. Ich ging vorüber. Der Weg führte mich an der Kirche hin. Weiter zurück lag das Pfarrhaus. Es war hinter zwei breitästigen Ahornbäumen fast verborgen. Die Tür stand offen. Durch die Tür ging der Blick in einen halbdunklen Flur; dahinter in die grüne Dämmerung eines Obstgartens, aus einen weißen Weg mit blühenden Phloxstauden, einen fernen Zaun. Unwillkürlich war ich stehen geblieben. Ich wußte zuerst selbst nicht warum. Erst allmählich wurde mir bewußt: es war ein Bild, ganz so friedlich und versonnen, wie es mir schon immer vorgeschwebt hatte. Wie ich es irgendwo, irgendwann gesehen haben wollte. Es konnte kaum hier, konnte kaum dieses gewesen sein. Aber es zog mich an, unwiderstehlich, und war mir, als müßte ich über die Schwelle treten, müßte Blick und Seele näher, inniger in diesem stillen Winkel ausruhen lassen … Ein-, zweimal hatte ich vor geraumer Zeit den Pfarrer von Brambach, einen betagten Herrn, bei meinem Vetter getroffen, dem er näher bekannt war. Wie sollte er sich meiner entsinnen? Wie sollte er gar den Besuch eines Halbfremden aufnehmen und den Wunsch, in seinen Garten treten zu dürfen?
Doch mein Verlangen war stärker als alle Bedenken. Unversehens fand ich mich unter der Tür, und in dem halbdunklen Flur. Niemand schien um den Weg zu sein. Nur seitwärts, in einer Küche wie ich vermutete, rührte es sich von einer scheuernden Frauenhand. Schon war ich vorgedrungen an den jenseitigen Ausgang und schaute in den Garten. An der hinteren Hauswand, die über und über mit Reblaub bewachsen war, lehnte eine Bank. In meiner traumhaft-benommenen Keckheit lockte es mich, dort zu sitzen, von dort in den stillen Garten hinauszublicken. Und ich tat so. Und ich kostete in argloser Selbstvergessenheit den Schatten der obstschweren Baumzweige, das scharlachne Leuchten der Blumen, die sonnenüberrieselte Zaunhecke mit trunkenen Blicken. Leise summten die Bienen. Mir war es wie ein Singen im Singen meiner befriedeten Seele …
Tritte, die seitwärts von dem Gartenweg knirschten, ließen mich unsanft aufschrecken. Gleich darauf bog bei den Phloxstauden eine schwarzgekleidete Gestalt ein. Dichte silberne Haare umfielen einen ausdrucksvollen, barhäuptigen Kopf. Der Schlapphut hing in der rechten Hand. Kein Zweifel – es war der Pfarrer Vaihinger, wie er sich mir auch bei flüchtigem Bekanntsein eingeprägt hatte. Er schien, von einem Gang zurückkehrend, durch eine Außenpforte in den Garten eingetreten zu sein und kam nun gerade auf mich zu. Noch bemerkte er mich nicht; er war tief in Gedanken versunken, die nach einer leichten Wolke auf der Stirn, einem Bewegen der Lippen ernsten Wesens sein mußten.
So leichtsinnig ich bisher gewesen war – ich wurde mir jetzt meiner peinlichen Lage vollauf bewußt. Ich erhob mich, aber ehe ich noch einigermaßen gesammelt war, sah der Pfarrherr nach mir her, deckte die freie Hand über die Augen und suchte den Eindringling zu erkennen. Als es ihm nicht gelang, kam er rüstig näher, erwiderte meinen verlegenen Gruß mit fragender Freundlichkeit.
Ich nannte meinen Namen, fügte den meines Vetters hinzu, erinnerte an eine frühere, kurze Begegnung.
Der alte Herr gab mir die Hand. Es war ihm jedoch anzusehen, daß er sich auf mich – nur zu begreiflicherweise – nicht besann. Zerstreut, auch seinerseits etwas verlegen, wartete er sichtlich darauf, Bestimmteres über den Zweck meines Besuchs zu erfahren. Seine blauen, klugen Augen gingen an mir hin.
Es war mir unmöglich, meine Anwesenheit, mein Vordringen in seinen Garten nur mit Redensarten zu erklären. Daß ich im Vorbeiwandern das Bedürfnis empfunden habe, ihn wiederzusehen, zu begrüßen – all das war so nichtig, kam mir so unaufrichtig und läppisch vor. Ich faßte mir also ein Herz: mit möglichst einfachen Worten beschrieb ich die Stimmung, die über mich gekommen war, mich beinahe zwanghaft ins Haus und auf seine Bank, in den Schatten seiner Obstbäume geführt hatte.
Der Pfarrer war aufmerksamer geworden. Wie auf Menschen, die selber wahrhaftig sind, wirkte die Wahrheit, auch wenn sie ihm seltsam vorkommen mochte, unmittelbar auf ihn. »Schön, wenn's mein Garten Ihnen so angetan hat!« meinte er mit einem gütigen, verständnisvollen Lächeln, das meinem Bekenntnis das letzte Peinliche nahm. »Nun sollen Sie sich aber auch nicht vertreiben lassen!« Trotz meines Einspruchs nötigte er mich, wieder auf der Bank Platz zu nehmen, und setzte sich neben mich. »Wenn Sie sich satt gesehen haben, zeig' ich Ihnen noch das eine und andere Eckchen, das nicht schlechter ist!«
Wir plauderten eine Weile. Von der Umgegend, von meinem Vetter, von andern gemeinsamen Bekannten. Doch so herzlich mein Gastgeber gegenüber dem unberufenen Gast sich gab – daß es ihm einige Mühe kostete, sich zu unterhalten, konnte mir nicht entgehen. Der Ausdruck einer gewissen traurigen Zerstreutheit kehrte in seiner Miene oft und öfter wieder. Ich wollte aufstehen, wollte mich dankbar verabschieden. »Nein! Nein!« wehrte er lebhaft. »So oft habe ich nicht Gelegenheit, einen Stadtbesuch bei mir zu haben, daß Sie gleich Grüß Gott und Behüt' Gott in einem sagen dürften!« Er fuhr sich über die Stirn, stand auf, machte ein paar Schritte in den Garten hinein, kam wieder zu mir zurück. »Jetzt werden wohl Sie sich über mich wundern, wie ich mich vorhin im ersten Sehen über Sie!« sagte er, wieder mit seinem feinen, guten Lächeln. »Sie merken's mir an, daß ich bloß halb bei der Sache bin. Den ganzen Tag schon will mir das Herz nicht so froh werden, wie ich's meinem Herrgott schuldig bin. Und doch komm' ich geradenwegs von einem Hochzeitsessen!«
»Es ist gewiß in jetziger Zeit nicht immer leicht, mit den Fröhlichen fröhlich zu sein,« gab ich zurück.
»Warum nicht?« erwiderte er. »Leben und Tod sind noch näher aneinander wie sonst – gewiß. Aber das ist mir allerwege das Schönste an meinem Beruf, so recht zwischen beiden zu sein und in beiden. – 's ist ein besonderer Fall, daß es mir diesmal so recht nicht hat glücken wollen. Ein besonderer Fall,« wiederholte er halblaut, während er sich wieder bei mir niederließ. »Vielleicht ist's gut,« fuhr er, wie sich zusammenholend, fort, »wenn ich's nicht so allein in mir herumdrücke. Der, dem's gilt, hat just mit dem Herumdrücken kein gut Teil erwählt. Und Sie haben mich auch einen Blick in Ihr Inneres tun lassen, als Sie mir sagten, wie Sie's so merkwürdig in meinen Pfarrgarten gezogen hat!« Er sah mich von der Seite, prüfend und schalkhaft zugleich, an. »Sie werden ja von mir nicht denken, daß mich bloß das Alter geschwätzig macht?«
»Das werd' ich wahrhaftig nicht, Herr Pfarrer!«
»Also … Das heißt, Sie dürfen nicht einen spannenden Roman von mir erwarten. 's ist eine kurze, recht einfache Geschichte, die mich umtreibt … Mitunter, nicht gerade oft, aber auch nicht bloß ausnahmsweise, denkt von den etlichen achtzig Brambachern, die da draußen im Weltkrieg stehen – so an die zwanzig sind allbereits gefallen oder invalid oder gefangen – mitunter, sag' ich, denkt auch einer an seinen alten Pfarrer, läßt ihm einen Gruß ausrichten oder schreibt ihm gar selber eine Karte mit der Feldpost. Daß aber einer mit einem richtigen Brief zu mir herdenkt, ist nicht zu erwarten, und so hat's mich denn ziemlich erstaunt, wie mir vor Wochen der Briefbot' unter der Haustür einen regelrechten Feldpostbrief an meine Adresse aushändigt, und ich hernach an der Unterschrift seh', daß er von einem Pfarrkind ist, das als Landwehrmann im hintersten Polen am Feind steht. Der Schreiber war ein Handwerker, ein Seiler seines Berufs, und allgemein der ›Bachseiler‹ geheißen, denn sein Haus und Geschirr ist drüben am Bach, und vorzeiten, als noch der Großvater das Gewerbe trieb, soll ein zweiter Seiler, der ›Kirchseiler‹, sein Konkurrent gewesen sein, obschon ein einziger, wenigstens heutzutage, in Brambach und Umgebung kaum mehr das Auskommen hat. Besagter Bachseiler, muß ich vorausschicken, war ein Mann anfangs der dreißig. Drei Jahre können's her sein, daß ich ihm sein Weib begraben hab', die kränkelte seit ich weiß oder doch gewiß, seit sie ein einziges totes Kind zur Welt gebracht hatte. Er selber war ein fleißiger, aber auffallend zugeschlossener, unumgänglicher Mensch, und im Dorf wenig gut angeschrieben, obwohl er keinem was angetan hat: dem einen war er hoffärtig, dem andern ein leidiger Druckser, dem dritten beides und ein einfältiger Tropf dazu. Für meine Person nahm ich an, seine grämliche Häuslichkeit sei hauptschuldig an seinem leutfremden, verdrückten Wesen, gab ihm manchmal ein tröstlich Wort, aber ohne daß es sonderlich hätte anschlagen wollen. Als er dann Witwer wurde und die Trauerzeit um war, da meinten die gleichen Leute, die zuvor kein gut Haar an ihm gelassen, es wär' doch eine Schande, wenn einer, so jung wie er, nicht wieder aufs Freien denken wollte, und wie er immer keine Anstalten dazu machte, war's erst recht um sein Ansehen geschehen. Überdem kam der Krieg und der Bachseiler mußte unter den ersten mit hinaus.
Und jetzt also schrieb er mir. Und es wurde mir eigen zumut, je länger ich an seinen vermalten Buchstaben herumrätselte und je mehr ich dem Mann in sein Herz sah, das mir und einem jeden bislang fremd geblieben war und das er da im Angesicht von Schlacht und Tod aufbrach vor mir wie vor seinem Beichtiger.«
Der alte Herr stockte einen Augenblick wie in Überlegung. Dann griff er in seine Brusttasche. »Was soll ich versuchen, das Geschriebene nachzuerzählen! Ich trag's bei mir, und noch vorhin am Hochzeitstisch hat's mich dann und wann wie Feuer brennen wollen, obschon ich mir nichts vorwerfen darf und alles gekommen ist, wie es hat kommen sollen.« Er löste bedächtig das Band, das die Wachstuchbrieftasche zusammenhielt, zog den Brief nach kurzem Suchen hervor und begann, ihn weit vom Auge haltend, zu lesen.
»C... in Polen, im Juni.
Werter Herr Pfarrer!
Erschrecken Sie nicht, daß ich an Ihnen schreibe. Wir sind seit einer Woche aus dem Schützengraben, wo mein Regiment, ich weiß nicht wie lang, gelegen ist und viel Feuer ausgehalten hat, im Quartier hinter der Front. Da ist viel Zeit zum Nachdenken, und ist mir schließlich so davon geworden, daß ich mich einem anvertrauen muß. Und ich bitte, hören Sie mich, Herr Pfarrer. Was ich Ihnen sag', weiß bis heut keiner außer mir, wie mir halt überhaupt von kleinauf das Schwätzen schwer geworden ist und ich darum ungut angesehen bin gewesen und hab's doch nicht ändern können. Aber jetzt muß ich. – Eh' ich mich verheiratet hab' mit meiner nachmaligen Frau, hab' ich eine große Lieb' in mir herumgetragen für eine, die mich, glaub' ich, auch nicht ungern gesehen hat, für die Rosine, dem Friedrich Alt seine Tochter, der früher Wirt im »Lamm« war und umgeworfen hat und drauf bald gestorben ist. Sagen hab' ich's aber der Rosine nicht können; das letzte Wort ist mir alleweil nicht vom Mund gegangen. Mein Vater aber, der mich gekannt hat, wie ich war, hat für mich geredet. Aber nicht bei der Rosine, sondern beim Schreiner Ruthard seiner Ältesten, von dem er Geld auf seinem Haus gehabt hat, und so ist die Marie Ruthard, die fünf Jahr älter war wie ich und hat eine schiefe Schulter gehabt und war die gesündeste nicht, mein Weib geworden. Sie hat mich wohl schon immer gern gemocht und ich hab' sie nicht schlecht gehalten im Anfang, aber mein Herz hat halt nicht an ihr gehangen, sondern an der Rosine. Und sie hat's gemerkt, daß ich was in mir verdrück', und hernach, wie unser Kind totgeboren war, da hat sie's rausgeheult und mir die Schuld gegeben und geschrien, die Straf' wär's und der Bub wär tot, weil er von mir keine Lieb' nicht gehabt hätt', wie auch sie keine nicht. Seither ist Unfried im Haus gewesen und noch auf ihrem Totenbett hat sie gesagt, ich hätt' sie auf dem Gewissen und unser Kind. – Ich hab' in Gedanken von der Rosine nicht lassen können, und wie die Trauer um war und sie allerweil noch ledig – wie gern hätt' ich's ihr gesagt! Aber da war's, als wär' meine Lieb' noch mehr in mich reingekrochen und läg ein Stein davor, und drauf steht der Unsegen von der Marie, meiner Frau, und unser totes Kind. Und ich hab' mich der Rosine angenähert und alsmal mit ihr geredet, wenn wir uns begegnet sind, und gemerkt, daß ich ihr nicht leid war, und doch wieder und wieder ein letztes Wort nicht finden können. Danach bin ich in den Krieg. – Da aber ist mir's seltsam gegangen, Herr Pfarrer. Je länger ich draußen bin und je mehr um mich her gefallen sind und ich bin noch verschont geblieben, um so lauter ist die Lieb' in mir geworden, und das Leben, das mir nie vorher viel golten hat, mir lieb geworden. Aber bloß, wenn ich an die Rosine denk', und daß sie hätt' mein werden können und daß sie mein werden könnt' noch immer. Und ist eine Angst in mir, daß ich reden müßt', und hätt' mich der Herrgott am Leben gelassen, daß ich red' und ihr sag', wie lieb sie mir ist. Und wieder ist der Stein da, und was die Marie, meine Frau, mir Schuld gegeben hat, und weiß ich nicht aus und ein. Da schreib' ich an Ihnen, Herr Pfarrer, um Rat, und ob Sie meinen, daß ich reden dürft' oder nicht. – Es geht die Rede, daß wir bald wieder vor ins Feuer kommen. Schreiben Sie mir bald, was so Ihre Meinung ist.«
Über dem Lesen war dem alten Herrn der Atem etwas schwer geworden. Langsam steckte er den Brief des Bachseilers wieder in seine Brieftasche zurück.
»Nun hätte ja alles so einfach sein und doch noch recht werden können!« hub er nach einer Weile wieder an. »Von vornherein war ich mit mir einig: du sprichst mit der Rosine über den Brief. Was drin steht, gilt ja eigentlich gar nicht dir, sondern ihr, und verstreicht noch viel Zeit und fängt erst ein lang Hin- und Herschreiben an, wer weiß, ob der schwersinnige Mensch in seinem Polen sich nicht noch wieder umbesinnt. Wär' er wie andre gewesen, so hätt' er gleich statt an mich an das Mädle geschrieben … Ich geh also auf meinem nächsten Weg an dem Haus vorbei, in dem die Frau Alt Witwe mit ihrer Tochter wohnt und sich die zwei mit Nähen und Flicken durchhelfen. Ich treff' bloß die Mutter daheim. Da mir dran liegt, mit der Tochter und vorderhand nur mit der zu reden, will ich meinen Stecken weitersetzen. Aber die Altin ist eine geschwätzige Frau und läßt mich so schnell nicht los. Nach allerhand drum und dran fragt sie mich, ob ich denn noch nicht von dem Glück gehört hätte, was ihrer Rosine widerfahren sei. Ich horch' verdutzt auf und sag' nein. Ja, die Rosine wär' schon immer eine brave Tochter gewesen, das müßte sie sagen. Bloß daß sie, ein so stattlich Mädle, wie sie doch sei, immer nicht hätt' heiraten wollen, und manchen achtbaren Freier ausgeschlagen hätte, wär ein rechtes Kreuz gewesen. Sie, die Mutter, hätt' immer dafür gehalten, daß ihr von lang her ein Mannsbild im Kopf stecke und dadrum bis ins Fünfundzwanzigste keiner der Rechte gewesen sei. Aber jetzt – jetzt sei sie doch endlich zur Einsicht gekommen! Es sei da ein Werkmeister drüben in der Stadt, ein Herr Betz – zwar nicht einer von den Jüngsten mehr und ein Witwer mit drei Kindern – aber wohlsituiert und ein ganzer Mann – und kurz und gut, mit dem hab' sich die Rosine vergangene Woche versprochen, und es werde nicht lange dauern, so kämen die beiden zu mir, ihr Aufgebot bei mir zu bestellen.
Ich muß ein ziemlich betroffen Gesicht gemacht haben, denn die Brautmutter sah mich merkwürdig an, als ich mich schnell fortmachte und in der Eile sogar das Glückwünschen versah.
Die Botschaft, die ich vernommen, hatte mich aber auch gar zu bös getroffen. Hin und her hat sie mich im Kopf getrieben.
Was tun und was lassen? Da war dem Bachseiler sein Geständnis, das er sich zwischen Tod und Leben so schwer und heiß von der Seele hatte gerungen. Wodran er sich abgelitten und gezagt all die traurigen Jahre her und wodrauf er jetzt seine ganze Seligkeit setzen wollte! Und da war die Rosine, die des Wartens und seines Schweigens müd geworden war, und sich einem andern angelobt hat, der es wohl auch ehrlich meint und ihr ein erträglich, wenn auch kein überschwenglich Los zu bereiten vermag. Darf ich mich dazwischen legen? Soll ich dem Mädle erzählen, was ich weiß: daß der, auf den sie gewartet hat, und an dem auch sie wohl noch hängt, sie nicht vergessen und das Wort zu guter Letzt doch noch gefunden hat, das ihn und sie zusammenführen kann und ein echt Glück in wirklicher Herzensliebe zu schaffen mächtig ist? Soll ich den Werkmeister damit, wie's wahrscheinlich ist, um sein Hoffen und Glücklichsein bringen, und die Rosine um eine gesicherte Zukunft, während der Bachseiler vielleicht morgen schon im Feld bleiben kann und ihr nichts übrig läßt als ein fruchtlos Nachtrauern und Verblühen? Was schreib' ich dem Bachseiler? Daß er verzichten muß und es zu allem Reden zu spät ist? … Wer gibt mir ein Recht, dem einen zu nehmen und dem andern zu geben? Was tun und was lassen?
Tag vergeht um Tag und, was sonst mein Fehler nicht ist, ich komm' nicht ins reine mit mir. Und am Sonntag drauf, nach der Kirch', klopft's bei mir an: ein Brautpaar meldet sich, der Werkmeister und die Rosine Alt. Er, vollblütig, laut, ein Spaßmacher, aber kein unrechter Mann; sie ernst, ein wenig blaß, wie mir scheinen will, zwei dunkeltiefe Augen unter dem schwarzbraunen Scheitel, zwei Augen, die ein Verzichten fertig hinter sich haben und ein gutwillig Sichzufriedengeben vor sich. Mir ist's, als wär' der Bachseiler mit in die Stube getreten, und ich seh sein Gesicht vor mir wie nie: die querfaltige Stirn, den eingekniffenen Mund, der fast keine Lippen hat, und den fremden, hintersinnigen Blick. Doch ich tu, was meines Amts ist, schreib mir dies und das in mein Buch und sag' ein paar Worte, wie's üblich ist, vielleicht nicht ganz so sicher wie sonst, aber den beiden zum Genügen.
Mir war nachher nicht wohler wie vorher. Immer und immer wieder gärte es in mir: wenn du nicht gezaudert hätt'st und der Rosine von dem Brief gesprochen, wie's noch Zeit war – wär's nicht anders geworden und besser gewesen? Ein groß Menschenglück war da vielleicht in deiner Hand und du hast's fahren lassen. Ich fand und fand die Antwort nicht, die mich ganz mit mir und meinem Tun hätte zufrieden machen können.
Aber das Menschenglück, das ich wähnte, war längst nimmer in meiner Hand, und die Antwort, die ich nicht finden konnte, hat der Herrgott gegeben. Noch eh' ich dem Bachseiler zurückschreiben konnte. Auf dem Schultheißenamt kam die Nachricht ein, daß einer von Brambach im fernen Osten gefallen sei: der Jonathan Uhrig, Seiler allhier. Und am gleichen Sonntag, wo ich die Rosine Alt und den Werkmeister von der Kanzel aufgeboten hab', mußt' ich vor meiner Gemeinde des Gefallenen mit Namen gedenken … Und heut, wo ich die zwei getraut habe, und vorhin, wo ich eine Stunde mit ihnen am Hochzeitstisch gesessen bin – da mußt' ich seiner erst recht wieder gedenken. Bei mir in der Stille. Und daß von der großen Liebe, die er in sich verborgen hat, keiner was hat erfahren sollen außer mir …«
Der alte Pfarrer legte mir leicht die Hand aufs Knie. »Sie werden jetzt schon verstehen, warum ich Sie zerstreuter empfangen hab', als sonst meine Art ist. Jetzt ist mir leichter. Und ist mir, als hätt' ich, wenigstens noch vor einem, Zeugnis abgelegt für den Mann, der jetzt weit da draußen unter der Erde liegt und sich um das rechte Wort nicht mehr zu quälen braucht!«
Es leuchtete klar und heiter in den Augen des Greises, während er mir zunickte. Ich konnte ihm nur mit stummem Verstehen widernicken. Verstanden hatte ich auch, was er vorhin geredet – von der Schönheit so recht zwischen Leben und Tod. Der Schatten unter den Obstbaumzweigen war tiefer geworden. Aber der Gartenweg leuchtete fast noch heller als die Phloxblüten dunkelrot, und über dem verwachsenen Zaun lag der volle, scheidende Sonnenschein …
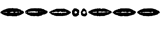
So warm unter Tags die Sonne geschienen hatte – mit Anbruch der Dämmerung wehte es kühl und kühler von den Bergen herüber, und die fünf, sechs Herren, die seitwärts vom Wirtshaus »Zum Pfauen« unter der breitästigen Linde saßen, mußten sich zu ihrem Leidwesen gestehen, daß der wunderschöne Monat Mai wieder einmal in der Wirklichkeit nicht so arglos war wie im Lied. Vielleicht wären sie schon eher zu dieser Einsicht gekommen, wenn sie nicht gewartet hätten – gewartet just auf die heutige Hauptperson! Es handelte sich um nichts Geringeres, als daß der Oberförster den ganzen Montagsstammtisch der Oberamtsstadt zu seinem Junggesellenabschied heraus nach Brambach in den »Pfauen« eingeladen hatte und, obschon selber der Gastgeber, weit und breit nirgends zu sehen war! Man hatte sogar seinen Durst noch gezügelt, weil der Pfauenwirt, sooft er tröstend um die Linde und die gute Kundschaft herumschwänzelte, geheimnisvoll andeutete, alle Zutaten für ein würdiges Feiergetränk seien bestellt und bereit. Kein Wunder also, daß die Herren, in ihrem Vertrauen auf die Witterung und auf die Pünktlichkeit des Einladers getäuscht, in ihren trockenen Kehlen gereizt, beim nächsten Windstoß den Marsch vom Freien in die Gaststube in verdrießlicher Stimmung antraten …
Man war denn auch kaum um den runden Tisch auf etlichen Stühlen und einem plattgesessenen Lederkanapee verteilt, so machte sich der versteckte Ärger Luft.
»Gestohlen kann der Riedmüller mir werden!« rief mit seiner bärbeißigen Stimme der Medizinalrat und schlug aus die Tischplatte, daß Senftopf und Salzfaß aufklirrten. »Einen Schoppen Remstäler, Pfauenwirt!«
»Mir auch! Licht machen! Mir einen Schiller! Mir auch!« klang es in der Runde.
Der Pfauenwirt, der schon mit einem Streichholz von der Wirtschaft her unterwegs war, schnaufte auf seinen kurzen, gebogenen Beinen wie ein Dampfzug herein, brachte die Hängelampe zu einem matten, tranigen Licht und sammelte mit dienstfertig wackelnden Henkelohren die Aufträge der Stadtherren. Doch noch ehe die Stube sich notdürftig aufhellte und die gewünschten Schoppenflaschen, roten und schillernden Landweins voll, auf dem Tisch standen, regnete es, nachdem erst einmal der Anfang gemacht war, Vorwürfe und Späße auf den unverläßlichen Oberförster. Einig war man sich darüber, daß niemand anders als die Braut an seiner Unpünktlichkeit oder Vergeßlichkeit schuld sei. Aber der Amtsrichter, ein wohlassortierter Junggeselle, der sich gern auf den Schwerenöter hinausspielte, witzelte herausfordernd über den Pantoffel im allgemeinen, und als der Medizinalrat, der gleichfalls ledige, immer streitbare Graukopf, saftig in die nämliche Kerbe hieb, setzten sich die Verheirateten am Tisch zur Wehr.
»Der Medizinalrat schwätzt wie der Fuchs von den sauren Trauben!« murrte der hagere Oberreallehrer Klingler – ein gallsüchtiger Herr und seit vier Wochen zum drittenmal wieder verehelicht.
»Und ob!« lachte der Notar mit den rosigen Backen und den immer vergnügten Schalksaugen. »Er und der Amtsrichter sind bloß so falsch, weil der Oberförster ihnen doch noch aus der Junggesellengilde ausgebrochen ist!«
Der Medizinalrat Habermaß tat einen gründlichen Schluck, wie einer, der sich auf den Angriff stärkt.
»Ich hab' nie ein Hehl draus gemacht,« knirschte er dann ingrimmig hinter seinem Schnauzbart vor, »daß mir's höllisch leid tut um den Riedmüller! Da hat ihn glücklich seine Mutter, eine grundg'scheite Frau, die ihre Weibsschwestern kennt, vierundzwanzig Jahr' vor dem Ehejoch behütet, und im fünfundvierzigsten läßt sich der Sackermenter doch noch von einem Schurzbendel einfangen!«
»Besser, als daß er zeitlebens der Mutter am Schurzbendel hängt!« replizierte giftig der Oberreallehrer.
»Er beweist bloß, daß er ein Mann ist!« bestätigte auch der Notar.
»Und läßt uns sitzen!« schürte der Amtsrichter boshaft zwinkernd.
»Was der beste Beweis ist,« knurrte Habermaß, »daß grad' Männlichkeit und Freundschaft und Zuverlässigkeit, wie oft genug, schon im Brautstand zum Teufel gehen! Und nachmals, in der Eh' –«
»Ich muß auch sagen,« legte sich jetzt der Oberamtmann ins Mittel, der bisher vom Kanapee aus nur immer mächtigere Rauchsäulen über sich hinaufgeblasen hatte, »dem Oberförster kann man gratulieren, daß er noch zum Heiraten den Mut gefunden hat! Und der alten Frau Riedmüller, seiner Mutter, rechn' ich's auch an, daß sie ihm nichts in den Weg legt! Manch einer hat's bitter bereut, daß er immer ein ›Mammenkind‹ geblieben ist!«
»Papperlapapp!« ereiferte sich der Medizinalrat noch lauter. »An seiner Mutter ist noch keiner zugrund gegangen! Ein Narr ist, wer die sichere Häuslichkeit mit seiner alten Mutter dran gibt – für ein Lotterielos! – Hab' ich recht oder nicht, Herr Pfarrer? Immer heran an unsern Tisch und den Handel geschieden!«
Die letzten Worte, bedeutend friedlicher gesprochen, ließen die Köpfe rund um den Tisch sich nach der Tür wenden: in ihrem Rahmen war ein freundliches altes Gesicht unter langen weißen Haaren aufgetaucht, dessen stille, kluge Augen mit einem schelmischen Ausdruck über die erhitzten Stadtherren hinschweiften.
Diese erhoben sich, einer um den andern, um den ehrwürdigen Pfarrherrn von Brambach zu begrüßen, der ein- oder zweimal im Jahr für ein Stündchen hinüber an den Montagsstammtisch in der Oberamtsstadt kam und es sich heute nicht nehmen lassen wollte, die Herren in seinem Dorf zu begrüßen, zumal er von dem Oberförster noch ganz besonders geladen worden war. Die Art, wie man ihn willkommen hieß, bewies, daß er bei der Tafelrunde in hohem Ansehen stand. Der Reihe um wechselte er mit jedem ein herzliches Wort oder einen Händedruck.
»Sie sehen schon, Herr Pfarrer, daß der Oberförster, unser Einberufer, uns bis jetzt im Stich gelassen hat!« erklärte der Oberamtmann, während er den Ankömmling neben sich aufs Kanapee einlud.
»Und Sie werden mir recht geben, Herr Pfarrer Vaihinger,« rief der Medizinalrat, »daß sein Benehmen wieder einmal beweist, was die sogenannte ›Liebe‹ zum andern Geschlecht aus einem zuverlässigen Mann und Freund macht!«
»An dem unbedingten Rechtgeben zweifl' ich,« meinte der Oberamtmann.
»Ich auch!« stimmten der Oberreallehrer und der Notar zu.
»Abwarten! Abwarten!« Der heißblütige Medizinalrat verfocht von neuem mit mehr Feuer als Sachlichkeit seine Meinung. Zwischenrufe und Gegenreden blieben nicht aus, und da der flotte Amtsrichter durch allerhand Witzeleien hetzte, steigerte sich der Zank zu einem Heidenlärm, den der Oberamtmann, im Gefühl seiner staatserhaltenden Stellung allem Übermaß abhold, vergebens zu beschwören suchte.
Der Wirt hatte sich beeilt, einen Schoppen Roten mit einem besonders ehrfürchtigen »Wohlbekomm's« vor dem alten Pfarrer aufzustellen. Als höre er nichts von dem zunehmenden Spektakel, goß sich Vaihinger den Wein ins Glas und schlürfte davon in kleinen, behaglichen Schlücken, die den Kenner eines guten Tropfens nicht verleugneten.
»Aber so helfen Sie mir doch, Herr Vaihinger!« wandte sich der Oberamtmann schließlich an den gelassen in sich und seinen Trank vertieften Greis. »Der Medizinalrat bildet sich sonst wahrhaftig ein, Sie wären mit von seiner Partei!«
»Die hohe Obrigkeit braucht wieder einmal die ehrsame Geistlichkeit zum Schildhalter,« spottete der Amtsrichter.
»Weil sie allein mit dem beschränkten Untertanenverstand nicht fertig wird!« wetterte Habermaß. »Dazu werden Sie sich nicht hergeben, Herr Pfarrer! Sie halten's mit uns!«
Langsam blickte Vaihinger von seinem Glas auf, und seine blauen Augen unter den silbernen Brauen gingen freundlich von einem zum andern.
»Ehrlich gesagt – 's ist eine üble Gewohnheit von mir,« begann er bedächtig, »vielleicht auch eine Alterserscheinung: wenn ich ein paar so recht miteinander streiten höre, weiß ich immer in kurzem nicht mehr, von wo sie ausgegangen sind und wo sie eigentlich hinwollen! Die Herren mögen's mir verzeihen – aber mir ist, seit ich in die Tür getreten bin, bloß ein Wort im Gedächtnis geblieben. Da hört' ich nämlich unsern Medizinalrat rufen: ›An seiner Mutter ist noch keiner zugrund gegangen!‹«
»Stimmt!« versicherte der Zitierte bereitwillig.
»Wenn ich recht versteh', soll das heißen, daß wohl schon mancher an der ehelichen, aber kaum je einer an der Liebe seiner Mutter Schiffbruch gelitten hat?«
»Ganz richtig!« beteuerte der trutzige Medizinalrat.
»Dabei ist mir jemand in den Sinn gekommen, der das Gegenteil grundbitter an sich hat erfahren müssen!«
»Den Fall möcht' ich kennen!« erwiderte ungläubig der Doktor.
»Erzählen, Herr Pfarrer!« munterte der Notar auf, der die lustigen Augen schon ganz neugierig aus dem Kopf drängte.
Auch die andern legten sich mit Bitten drein. Der Pfarrer Vaihinger war dafür bekannt, daß er etwas vom Leben wußte und verstand, mehr als mancher seines Amtes, und wenn er, selten genug, sich bewegen ließ, eine Erfahrung zum besten zu geben, hatte er aller Augen und Ohren für sich. Zudem kam man so am besten über das unliebsame Warten auf den Oberförster fort, von dem noch immer nichts zu sehen und zu hören war. Als auch der Oberamtmann bei dem alten Vaihinger ein Bittwort sprach, ließ sich der Pfarrherr zu einem zustimmenden Nicken bewegen. Nachdem der Pfauenwirt, soweit's nottat, die Schoppen nachgefüllt hatte und die Pfeifen und Zigarren in gehörigen Qualm versetzt waren, hob er nach einigem Besinnen an:
»Manche von den Herren erinnern sich vielleicht noch an einen schwachsinnigen Menschen, dem drüben in der Stadt die Gassenbuben und oftmals auch die Erwachsenen ungut mitgespielt haben. Es mögen so zehn Jahr' her sein, daß er als ›der Apothekerle‹ eine ziemlich stadtbekannte Figur war.«
»Der ›Apothekerle‹ – natürlich!« nickte der Oberamtmann. »Nicht schlecht hat der Stadt und Oberamt vexiert! Mit all dem Unfug, den andre mit ihm angestellt haben, und den Eingaben, die er gemacht hat – immer eine verrückter wie die andere!«
»Bis ich ihm schwarz auf weiß attestiert habe, daß er ein ungefährlicher, aber ausgiebiger Narr sei,« ergänzte der Medizinalrat, »und er in eine Anstalt abgeschoben werden konnte.«
»Ich seh' schon, die Herren wissen Bescheid,« nahm Vaihinger wieder das Wort. »Wie aber der ›Apothekerle‹ zu einer solchen Spottfigur hat werden können – das ist wohl keinem von Ihnen bekannt, weil's weiter zurückliegt und auch mir bloß als einem weitläufigen Verwandten seines Vaters bekannt geworden ist. Der alte Steiglehner, sein Vater nämlich, der die Engelapotheke am Markt hatte, und meine Mutter waren Geschwisterkind, und so hab' ich an dem Mattheis, seinem einzigen Buben, von Anbeginn an ein gewisses vetterliches, nicht bloß menschliches Interesse gehabt. Besagter Mattheis war von kleinauf ein schwachbegabtes Kind. Mit Ach und Krach ist's seinem Vater gelungen, den jungen Menschen – nach mühseliger Schul- und Lehrzeit – beim dritten Anlauf durchs Examen zu bringen und in sein Geschäft einzustellen. Kaum war's soweit, so verstarb der brave Steiglehner. Der Mattheis war anfangs zwanzig damals. Seine Mutter verkaufte bei nächster sich bietender Gelegenheit das schöne Geschäft am Markt und zog mit ihrem Sohn in die obere Heugasse, in ihr elterliches Haus.
Die Katharine Steiglehner, Gott hab' sie selig, war ihr Lebtag eine eigene Frau. Als Mädle mag sie eine Schönheit gewesen sein, und auch späterhin war sie ein stattliches Weib – hoch- und vollgewachsen, mit ein paar Glutaugen unter der Stirn, die einem unheimlich werden konnten, und mächtig vielen schwarzen Haaren. Herb und selbstgerecht lag's um den Mund, und herrisch war ihre Stimm' und ihr ganzes Sichhaben und -halten. Sie gehörte zu den Frommen im Land, zu den Überfrommen sogar, die keinen Sonntag die Kirche versäumen und mit dem lieben Gott ein besonderes Duzverhältnis haben – viel bastanter und intimer, als es manchem von uns Seelenhirten beim besten Willen gelingen will. Trotzdem – oder vielleicht grad' deshalb – war sie unleidlich mit ihren Mitmenschen, und auch ihrem Mann, dem Apotheker, der seelengut und freundlich zu jedem war, machte sie's nicht immer leicht: wo und wie sie konnte, ließ sie ihn ihre vermeintliche Überlegenheit in irdischen und himmlischen Dingen fühlen.
Die an Leib und Seele starke ›Base Steiglehner‹, wie ich sie nannte, hatte nur eine einzige Schwäche: die war ihr Mattheis, der ›Apothekerle‹. Was überhaupt von zarteren Gefühlen in der eigenwilligen Frau war, gehörte dem schwächlichen Buben – von seiner Geburt an. Mag sein, daß die Sorge, die sie in den ersten Jahren um das kränkliche Kind auszustehen hatte, ihre schrankenlose Liebe von vornherein so üppig ins Kraut schießen ließ. Jedenfalls war sie in der Folgezeit taub und blind für alles, was der Bub tat und ließ, konnte und nicht konnte. Gegen die Lehrer, die ihre liebe Not mit seiner geistigen Armut hatten, gegen den Vater, der sich, nachsichtig genug, bald mit Festigkeit, bald mit Geduld ehrlich abrackerte, einen halbwegs brauchbaren Menschen aus ihm zu machen, nahm sie immer bald heimlich. bald offen Partei für ihren Mattheis. Keiner verstand ihn wie sie, keiner hatte die rechte Art, auf ihn einzugehen und mit ihm umzugehen – bloß sie allein. Ihre Art aber war ein Verwöhnen ohne Maß und Halt, eine Affenliebe, die von Mitleid und Honigsüße troff, für die es kein Versagen gab …
Scheel genug hatte die Base dazu gesehen, daß ihr ›Herzblatt‹ und ›Allereinziger‹ oder, wie sie ihn bis ans Lebensende am liebsten hieß, ihr ›Büble‹, so lang geplagt wurde, bis er in der Apotheke unterschlüpfen konnte. Als ihr Mann die Augen zutat, war's für sie ausgemacht, daß der Mattheis sich nicht unnötig sollte abquälen müssen. Weil er ein gar so fein und kostbar Pflänzlein in ihren Augen war, nahm sie ihn am besten aus aller Pflicht und Arbeit. Geld war genug da, warum sollte sie sich und dem ›Büble‹ nicht jetzt den rechten Himmel auf Erden bescheren? Wenn der und jener Verwandte oder Bekannte den Kopf dazu schüttelte, daß ein junger Mensch in den Zwanzigern schon privatisieren sollte, das war bloß ein Beweis mehr, daß eben der und jener nichts verstand!
Hätte der junge Steiglehner bösartige oder leichtsinnige Anlagen gehabt, er hätte bei solcher mütterlichen Obhut und Afterliebe ein grundverderbter Schlingel werden müssen. Aber er war die Gutmütigkeit selber. Man sah es ihm an den verwässerten Augen schon an, die schläfrig in dem zerlassenen Gesicht saßen, was für ein Geist oder vielmehr Ungeist in dem viel zu großen Kopf wohnte, den ein hellblondes, fast weißes Haar oben umstöberte und an Kinn und Lippen umsproßte. Mit dem Lachen und Heulen war er gleich schnell bei der Hand. Einen Mann von Schrot und Korn hätte auch die sorgfältigste väterliche Anleitung, und wenn sie zwanzig Jahre länger gedauert hätte, nicht aus ihm machen können. Aber eine Sünde war's doch, daß jetzt, nach des Vaters Tod, auch der letzte Rest von Willen in ihm verwirtschaftet wurde. Ums ›Büble‹ drehte sich alles in dem alten Haus in der oberen Heugasse, das bis unters Dach so dick mit Efeu und Rebenlaub verwachsen war, daß kaum Licht und Luft zu den Fenstern hereinkonnte. Die Base und eine betagte Magd – die Antoinett' hieß sie und hing wie ein treuer Hund an der frommen, angebeteten Steiglehnerin –, die beiden verpimpelten und versimpelten den Mattheis tagaus, tagein nach Herzenslust. Man ließ ihn schlafen, bis die Sonne hoch am Himmel stand; man kochte ihm seine sämtlichen ›Leibessener‹, daß er auseinanderging wie ein Schwamm; man steckte ihn, sowie er bloß ein Räuspern oder Riesen oder Hüsteln hören ließ, ins Bett bis an die Nase und kochte ihm Fliedertee und Kernlestee und Lindenblütentee, daß er schwitzte und dampfte. Sie hätten's ärger – zimperlicher und närrischer – mit keiner Seidendogge und keinem Schoßhund treiben können wie mit dem ›Büble‹!
Für einen, der mit sechsundzwanzig und achtundzwanzig Jahren auf Gottes weiter Welt nichts zu tun und zu sorgen hat, bleiben trotz Schlafen und Essen und Kranksein noch etliche Stunden am Tag übrig. Der Mattheis verdöste und verbastelte sie im Obstgarten hinterm Haus, oder er zottelte in der Landschaft herum. Wenn er sich fürs letztere entschied, machte er meist, daß er so schnell wie möglich die Stadt in den Rücken bekam. Dort hatte der verzärtelte Bursch von klein aus Spott und Schabernack auszustehen, und schon dazumal, freilich in bescheidenerem Maß, hänselten und foppten sie den ›Apothekerle‹, wo sie ihn erwischen konnten. Draußen aber, vor der Stadt, da konnte er ungeniert und ungequält durch die Felder stolpern, im Wald herumkriechen und den Wolken nachgaffen, die so wunderlich über die wunderliche Welt flogen. Anfänglich hatte die Mutter versucht, ihn zu begleiten; aber mit den Jahren fesselte sie eine leidige Fußgicht mehr und mehr ans Haus; die Antoinett' war zum Mitlaufen auch schon zu wacklig; ganz einsperren konnt' sie ihn nicht, und so mußte sie ihn in Gottes Namen – unter Sorge und Angst, nach tausend guten Vermahnungen – allem ziehen lassen. Um bei der Wahrheit zu bleiben: eine Beschäftigung trieb der Mattheis aus seinen Wanderschaften. Er sammelte. Wahllos – was immer ihm in Hand und Augen fiel. Würmer und Schmetterlinge, Molche und Kräuter, Steine, die seltsam geformt waren oder einen Glimmerglanz hatten, Grashupfer, Rindenstücke, Frösche und wessen er sonst habhaft werden konnte. Kam er von einer solchen Sammelfahrt heim, den Strohhut schräg über dem dicken Schädel, die Botanisiertrommel um die Schulter, gespickt mit Salamandern und Grünzeug, einen Blumenbuschen im Arm – so gab es jedesmal ein Umhalsen und Willkommschreien und Abschmatzen von seiten der Mutter Steiglehner, daß die ganze Nachbarschaft wußte, der ›Apothekerle‹ sei heimgekommen …
Eine schöne Reihe von Jahren dauerte die Milchsuppenwirtschaft in der Heugasse, ohne daß sich etwas von Belang dran verändert hätte – außer daß die Base allmählich alterte, ihre Gicht zunahm und manchmal Herzbeschwerden sich einstellten. Inzwischen war ich aus meiner Schwarzwaldpfarre auf meinen Wunsch nach Brambach versetzt worden. Ich hatte die Steiglehnerin und den Mattheis, ihren Gutedel, lang nicht gesehen. Jetzt machte ich ihr gelegentlich eine Anstandsvisit ', bei der sich mir alles, was ich aus früherer Zeit und vom Hörensagen in der Verwandtschaft über sie und ihr ›Büble‹ wußte, vollauf bestätigte. Ihr überhandnehmendes Leiden hatte sie noch unfreundlicher und hochmütiger gemacht als ehbevor. Stocksteif saß sie in ihrem Stuhl, bombardierte und regulierte mich mit Sprüchlein biblischer und eigener Weisheit und ließ ihre schwarzbrennenden Augen unruhig dazu hin und her laufen. Erst als es vor der Tür polterte und dann der Mattheis hereindöste, wurden die Loderaugen ruhiger und sogen sich an dem unbeholfenen, aufgeschwemmten jungen Menschen fest – bald wie trunken von Glück und Zufriedenheit, bald angstvoll durch und durch forschend, bald wie zwei Raubvogelaugen, die ihre Beute bewachen und verteidigen wollen. Mir war's ungut zumut. Der Mattheis, der kaum einen vernünftigen Satz daherstotterte, tat mir leid in all seiner unmännlichen Verkommenheit, und die Base war mir unheimlich und widerwärtig in ihrer überhitzten und ungesunden Mutterliebe. Ich war froh, als ich mich empfehlen konnte, und nahm mir vor, es bei dem einen Besuch in der Heugass' bewenden zu lassen …
Die Steiglehnerin sah ich denn auch nicht so bald wieder. Dafür lief mir der Mattheis hier auf dem Dorf mitunter über den Weg. Aus seinen Spazier- und Sammelgängen schien er des öfteren durch unser Brambach zu kommen. Wenn wir uns von ungefähr begegneten, drückte er sich gewöhnlich mit einem scheuen, grinsenden Gruß an mir vorbei. Nachdem ich ein paarmal vergeblich versucht hatte, ein Gespräch mit ihm anzuknüpfen, wobei er rot wurde und ein Gesicht zwischen Lachen und Weinen schnitt, gab ich's auf.
An einem Abend im Herbst führte mich ein Krankengang hinüber nach dem Weickertshof, der als letztes Anwesen – Denkersdorf zu – meinem Sprengel zugehört. Ich war schon, rüstig ausschreitend, bei den letzten Brambacher Häusern, als ich seitwärts vor einem kleinen, sauberen Haus einer Gestalt ansichtig wurde, die mir bekannt vorkam. Der breite Buckel und der hellflaumige Kopf, dessen ich hälftig gewahr werden konnte, gehörte dem Mattheis Steiglehner. Er war über den Zaun gebeugt, die Ellenbogen aufstützend, und in dem Vorgärtlein mit seinen roten und gelben Sternblumen saß wer, den ich zufällig, trotz meiner noch jungen Gemeindekenntnis, doch schon kannte: die Tochter des Schreiners Rotgerber, dem ich ein Vierteljahr vorher die Frau begraben hatte. Die zwei hatten auf mich nicht acht, und ich wollt' sie nicht stören. Ich strebte vorbei und dachte bloß bei mir: wär's möglich, daß der blöde, unselbständige Bursch, der Mattheis, nicht bloß zufällig wieder und wieder durch Brambach streift? Ihn so an einem Zaun zu treffen, dessen hätt' ich mich nie und nimmer versehen, und dem Schreinersmädle, so wenig schön sie geraten war, hätt' ich nie und nimmer zugetraut, daß sie sich mit so einem abgeben möchte … Gleich darauf hatt' ich aber auch schon wieder vergessen, was mir der Zufall da für ein merkwürdiges Pärlein vorgeführt hatte …
Ich sollte wieder dran denken!
Eine Woche später mocht's sein, daß von der Base Steiglehner ein Brief aus der Stadt kam, der mich zu meinem Verwundern in artigen, dringlichen Worten um einen Besuch in der Heugasse bat. Eine so nachhaltige Bitte durfte ich nicht abschlagen.
Als ich am Tag drauf bei ihr eintrete, ist sie viel zutunlicher wie das erstemal, und die Antoinett' muß mir einen behaglichen Sessel neben den ihrigen setzen. Nach einer kurzen Einleitung von Gottes Ratschluß und schwerer Prüfung, die der Himmel über Gerechte so gut wie über Ungerechte verhänge, kommt die herbe Frau mit ihrem Anliegen heraus: nichts anderes berichtet sie mir, als daß sie – nach langem Forschen und Spüren – dahinter gekommen sei, ihr ›Büble‹ habe sich mit einem Mädle in Brambach, einer ordinären Handwerkerstochter, eingelassen. Sie, die Base, habe ihm auf den Zahn gefühlt: da hab' er denn auch richtig zugegeben, daß es wahr sei, und unter Tränen herausgewürgt: er habe die Karlin Rotgerber halt so gern, und sie und keine andere wolle er heiraten …
›Der Herr Vetter kann sich denken,‹ fährt die Steiglehnerin fort, ›wie mir das Gered' von dem Büble ins Herz geschnitten hat und wie ich seitdem keine ruhige Stund' mehr hab'! Natürlich ist mein Mattheis in seiner Grundgutmütigkeit von der gemeinen Person eingefangen worden! Der und heiraten! Und dazu die nächstbeste, hergelaufene Dingere! Sein Unglück wär's und mein Tod – auf der Stell'!‹ Weitläufiger, als sie's sonst in der Gewohnheit hat, erklärt sie mir, daß ein Mensch wie ihr Mattheis viel zu weich und brav und arglos sei, um überhaupt je eine Frau nehmen zu dürfen. Er habe ihr in die Hand versprechen müssen, jetzt und nie wieder nach Brambach und zu dem nichtsnutzigen Mädle zu laufen. Aber so herzenslieb ihr Einziger sei und so gehorsam ihr gegenüber in jedem Stück – sie fürchte, er möge doch wieder schwach werden. Und drum wär's ihr eine große Beruhigung, wenn ich ein Äug' drauf haben wollte und ihr vermelden, wenn er drüben im Dorf wieder herumstriche, und wenn ich, als Seelsorger, mit der Karlin vom Rotgerber ein Wort reden würde, daß sie von dem ›Büble‹ ablassen solle! –
Ich hörte mir den Erguß der Base ohne Zwischenrede an. Es war kein kleines, und es brannte mir auf der Zung', ihr meine Meinung kräftig zu sagen, aber ich hielt mich doch zurück. Ich ließ sie bloß wissen, daß ich eine Aufsicht über ihren Mattheis unter keinen Umständen übernehmen könne; daß ich aber, auch ungern genug, um meinen verwandtschaftlichen guten Willen zu zeigen, mit der Karlin Rotgerber reden wolle – die mir übrigens nicht als eine ›gemeine Person und hergelaufene Dingere‹ bekannt sei, sondern als anständiger Leute Kind. Den Duck war ich ihrem Hochmut schuldig. Ich merkte, wie ich ging, daß sie nicht halb so freundlich mehr war, als wie ich kam.
Die Weickertshofbäuerin, bei der ich in schwerer Krankheit vorgesprochen hatte, war auf dem Weg der Besserung. Trotzdem ging ich noch einmal zu ihr hinaus und benutzte die Gelegenheit, ohne Aufsehen mit der Karlin Rotgerber zu reden. Sie war ein schmächtiges Mädle mit einem spitzigen, sommersprossigen Gesicht, aber mit ein paar ehrlichen Augen, die brav in die Welt sahen und wußten, wohin sie wollten. Sie wich mir auch gar nicht aus, als ich auf ihre Bekanntschaft mit dem Mattheis Steiglehner kam. Im Wald, unweit Brambach, hatte sie ihn eines Nachmittags in großem Heulen und Jammern gefunden: irgendein Tier hatte ihn gestochen, und er war der Einbildung, eine Schlange müßt's gewesen sein, und ließ sich erst durch ihr Zureden beruhigen. Seither datierte die Freundschaft und die zähe Anhänglichkeit von seiner Seite … Ich sagte ihr kecklich, daß sie doch längst merken müsse, er sein ein schwacher, beinah schwachsinniger Mensch, und es wäre nicht recht, wenn sie Mißbrauch mit ihm triebe. Auch wie ungut seine Mutter, die Apothekerin, zu der Sache sähe, verhehlte ich nicht. Ich sah ihr's an, daß sie bloß die Wahrheit sagte, als sie mir – noch um einen Schein blässer, und ein warmes Licht in den Augen – erwiderte: sie dächte nicht dran, mit dem Mattheis Mißbrauch zu treiben. Sie wüßte auch wohl, was er sei und was er nicht sei. Aber sie hätt' ihn nicht ungern – trotzdem oder grad' deswegen, denn er daure sie, und wenn ihn wer recht zu nehmen und anzuleiten wisse, täte der kein undankbares Werk. Alles brachte sie einfach und gar nicht widerspellig vor. Nur zum Schluß kam ein Schuß Blut in ihre Backen und ein Zittern um ihre Mundwinkel: die Frau Apotheker Steiglehner brauche nichts von ihr zu fürchten; es sei ihres Vaters Wunsch, daß sie nächsten Monat in die Hauptstadt in Stellung gehe, und der Mattheis habe sie zum längsten getroffen.
Ich schämte mich fast vor dem Mädle und gab ihr ohne weiteres Dreinreden die Hand und ging meiner Wege. Bei mir dacht' ich, die Steiglehnerin mit all ihrer hochmütigen Gottseligkeit und Mutterangst hätte froh sein dürfen, daß ein braves Ding wie die Karlin Rotgerber ihrem ›Büble‹ zugetan sei – trotz seiner Schwachköpfigkeit und Unmännlichkeit, und es möcht' sein Glück und nicht sein Unglück sein, wenn ihn so eine nähme … Aber die Gedanken behielt ich für mich und schrieb nächster Tage nur in die Stadt, kurz und ohne Zutaten, der Mattheis hätte fürder von der Schreinerstochter nichts mehr zu befürchten, dafür stünd' ich! …
Der Seitensprung ihres Herzblattes mag der Base Steiglehner trotz meiner beruhigenden Nachrichten nicht gut bekommen sein.
Ihr bis dahin langsames Siechtum ging mehr und mehr in ein eilendes über, und sie konnte sich nicht mehr verbergen, daß ihre Tage gezählt waren.
Je fester einer am irdischen Gut hängt und je selbstsicherer er sich in seinem irdischen Menschen mit seinen Unarten und Fehlern und Läßlichkeiten eingerichtet hat, um so weniger leicht und gern will er die Zeitlichkeit mit der Ewigkeit vertauschen. Auch die Katharine Steiglehner klammerte sich mit der ganzen Inbrunst ihrer glutigen Augen an ihr Erdendasein und an das eine, worein sie dessen höchsten und ausschließlichen Wert gelegt hatte – an ihren Mattheis. Alle christliche Ergebung, wie sie sie oft in Sprüchlein und Verslein im Mund geführt hatte, sich zur Erhöhung und andern zur Verwarnung und Demütigung, hinderte nicht, daß sie mit ihrem Herrgott haderte und zerfte, weil sie so zur Unzeit sterben sollte. Am liebsten hätt' sie ihr ›Büble‹, ihren Abgott, mit sich genommen – nicht bloß, wie sie sagte, weil er zu gut für unsere Welt war und ohne sie übel beraten –, sondern auch und vielmehr, weil er ihr Eigentum war wie nichts sonst, und sie ihn keinem gönnte als sich bloß, nur sich allein. Stundenlang, bei Nacht und bei Tag, mußte der Mattheis neben ihr am Bett sitzen, und sie hielt seine Hand krampfhaft zwischen ihren Fingern. Er hatte ihr keinen Anlaß gegeben, wieder mit ihm unzufrieden zu sein oder gar an seiner Unterwerfung unter, ihren Willen zu zweifeln. Und doch quälte sie eine heimliche Unruhe, er möchte in einer Ecke seines trägen, schläfrigen Kopfes, in einem Winkel seines weichen, haltlosen Herzens neben ihrem Bild noch das der Karlin Rotgerber, der verhaßten Schreinerstochter, aufbewahren. Je schwächer sie sich fühlte, je näher der Tod an ihr Herz griff, um so unerträglicher wurde ihr die Qual dieses Mißtrauens. Als sie wieder einen Schwächeanfall hinter sich hatte, der dem jungen Mann die dicken Tränen in die Augen trieb, richtete sie sich mit jäher Kraft auf, redete ihm mit erd- und himmelbewegenden Worten ins Gewissen, bis er ganz und gar in Wehmut und Schwäche zerfloß, und dann ließ sie sich in die Hand von ihm versprechen – weil sie sonst nicht ruhig sterben könne –, daß er nie und nimmermehr dran dächte, die Schreinerskarlin von Brambach zu heiraten oder auch nur wieder mit ihr umzugehen, nachdem die Mutter die Augen zugetan. Der eingeängstigte Mattheis, dem der Angstschweiß auf der Stirn stand, sprach ihr nach, was sie wollte – ein feierlich und unwandelbar Gelöbnis …
Damit war die herrschwillige Frau beruhigt. Wenigstens schien es so. Es war spät in der Nacht. Von gewissenloser Vergewaltigung zu besorgtem Mitleid übergehend, schickte sie ihr erschöpftes ›Büble‹ ins Bett, nachdem er zur Ablösung die Magd, die Antoinett', hatte rufen müssen. Mit der tuschelte die Base noch lang, ließ sich von ihr Schreibzeug bringen und schrieb mit sinkender Kraft widerspenstige Buchstaben aufs Papier, bis ihr die Feder aus der Hand fiel. Eine neue Herzschwäche nahm ihr das Bewußtsein. Die Antoinett' lief nach dem Doktor, weckte den Mattheis. Eh' der eine wie der andere am Krankenbett sich sehen ließ, war der Katharine Steiglehner ihr barsches, hoffärtiges Herz stillgestanden …
Bei der Beerdigung sah ich den Mattheis und sagte auch ein Trostwort zu ihm. Er war aufgelöst in seinem Schmerz, aber ganz konnt' ich mich des Eindrucks nicht erwehren, daß er, von der Verstorbenen aus gemessen, noch aufgelöster und niedergeschlagener hätte sein können – so abgöttisch wie sie an ihm gehangen hatte …
Ein halb Jahr und mehr verging, ohne daß ich dann von dem jetzt verwaisten Hätschelbüble der abgeschiedenen Base was hörte und sah. Der Mattheis hauste wie vor dem Tod seiner Mutter mit der alten Antoinett' zusammen in der oberen Heugasse und trieb's nicht besser und nicht schlechter als zuvor.
Amts- und Haussorgen brachten mir den jungen Menschen aus dem Sinn, und ich war nicht gering verwundert, als mir eines Tags, wie ich von einem Ausgang heimkomm', gemeldet wird, der Mattheis Steiglehner sei in meiner Studierstube und wolle mit mir reden.
Wie ich eintrete, steht da wahrhaftig der ›Apothekerle‹ von einem Stuhl auf und gibt mir mit einem verlegenen Grinsen die Hand. In seinem schwarzen Trauerhabit, das da zu eng und dort zu weit über dem plumpen Leib sitzt, sieht er womöglich noch unbeholfener aus, als er mir in der Erinnerung war, und mit dem Hut beschreibt er Bögen um den weißwolligen Kopf und seitwärts und unter sich, als hätt' er die Sprach' vollends verloren. Ich frag ihn, wie's ihm geht und was sein Begehr ist. Wie immer und immer nichts Gescheites aus ihm herauszukriegen ist, will ich schon fast ungeduldig werden. Da nimmt er einen verzweifelten Anlauf.
›Ich komm wegen der Karlin Rotgerber!‹ schießt er plötzlich wie aus der Pistol'.
›Der Karlin Rotgerber?‹ wiederhol' ich erstaunt. ›Ich denk', mit der ist's aus, Mattheis?‹
›Net aus!‹ stößt er in seiner abgebrochenen Redeweis' vor.
Und wie ich mich aufmunternd nach dem Wieso und Warum erkundige, rückt er allmählich heraus. Er erzählt mir, was ich oben schon berichtet habe, wie seine Mutter ihm auf dem Totenbett das Versprechen abgenommen, sich nie wieder mit der Schreinerstochter einzulassen. Wie ihn das Gelöbnis jetzt quäle; wie er immer und immer ans Ratgerbers Karlin denken müsse und nicht leben könne ohne sie und dach auch nicht wieder mit ihr anbinden dürfe.
Wie ich sein Geständnis hörte, meint' ich erst, ich könnt' ihm durch gutes Zureden die Sache aus dem Sinn schlagen, aber bald mußte ich merken, daß sich unter all der Verschrobenheit seines Kopfes und der Zerlassenheit seines Herzens ein Gerades und Festes angesetzt und ausgebildet hatte – eine Zuneigung, treu und herzlich wie nur eine. Die Verlegenheit war jetzt bei mir. Zwischen dem Versprechen, das er am Sterbebett seiner Mutter gegeben hatte, und dem Herzensgefühl, das er für die Karlin empfand, zum Rechten zu raten, war keine geringe Verantwortung. Ich sah's ihm an den ohnmächtigen Augen an: die Not, in der er eingeklemmt war zwischen seinem Versprechen und seiner Liebe, – die ging über seine Kraft und würd' ihn, wenn nicht ums Leben, so vollends um sein bißle Verstand bringen. Ich mußt' ihm helfen, wirklich helfen – so oder so. Was mir alles durch die Seele ging, wie's mich eine gute Weile hin und her riß – ich mag's und kann's heut nicht wiederholen. Mir war's wie ein Kampf zwischen einer Toten, der herrschsüchtigen, gestrengen Steiglehnerbase, und einem Lebendigen, dem armen schwachen Tropfen, dem Mattheis, mit seiner Zuneigung für die Karlin. Nein – nicht so! Zwischen der Steiglehnerin und mir um ihr ›Büble‹, das sie mit ihrer selbstischen Mutterliebe übers Grab hinaus festbinden und niederwürgen wollte. Und mich überkam's, je länger ich den Mattheis ansah, als ein heiliger Zorn: ein so gewalttätig abgedrungenes, so eigensüchtig ausgepreßtes Gelöbnis, und war's tausendmal in der Sterbestund' genommen und gegeben – ein Verbrechen war's! Das konnte Gottes Wille nicht sein, daß ein Weib wie die Katharine Steiglehner sich und ihrer Affenliebe ihr Kind und sein mögliches Glück hinopferte! Mein Amt aber war's, wenn irgendeines, das hilfsbedürftige Geschöpf, den Mattheis, von einem grausamen und widernatürlichen Bann loszusprechen! Dazu hörte ich, je länger je lauter, den Ruf in mir und fühlte die Kraft dazu … Behutsam ging ich ans Werk, aber ich merkte bald, daß ich den jungen Menschen überschätzt hatte, wenn ich meinte, es bedürfe besonderer Kunst und Sorgfalt, um sein bedrängtes Gewissen der Bangnis und des Zwiespalts zu entledigen. Er war und blieb ein Kind, und kaum merkte er, daß der, dem er sich mit seinem Kummer an den Hals geworfen hatte, ihm die Last zu erleichtern gedachte, so lud er sie ganz ab und wurde zusehends guter Dinge. Noch hatte ich kaum einen rechten Anfang damit gemacht, zu sagen, was ich sagen wollte: daß es seine Mutter doch nur gut mit ihm vorgehabt und nicht gewollt habe, er solle unglücklich werden; daß, wenn er's wirklich ernst mit seiner Liebe für die Karlin meine und sie ihm auch gut sei, der liebe Gott ihm vielleicht ein Gelöbnis erlassen werde, das die Mutter ihm in der Angst des Todes und kaum bei voller Besinnung auferlegt habe – Zusprüche, wie sie nur den Eingang zu ernsterem Bereden einer so heiklen Gewissenssache bilden sollten – noch, sag' ich, hatte ich kaum damit angefangen, da sprang ihm schon der Kopf, der ärgsten Sorge ledig, nach Kinderart auf und davon: er bat mich, ich solle ausmitteln, wo die Karlin derzeit sei, solle mit dem Vater Rotgerber ein Wörtlein reden und ihn durch Fürsprache bei beiden unterstützen …
So ein schneller Umschlag war mir nun wider den Strich. Ich wurde fast ärgerlich über ihn, und mehr noch über mich, und machte mir Vorwürfe, daß ich so schnell und unüberlegt mich in einen verantwortlichen Handel eingelassen habe. Auch zum Brautwerber spürt' ich keinen Beruf. Aber ich war damals jünger als heut und schneller bei der Hand, in Fügung und Schicksal mit einzugreifen, als vielleicht nachmals. Zurück wollt' ich nicht und dachte des Heilandswortes, des tröstlichen: ›Selig sind die Armen am Geist,‹ das gewiß auch dem Mattheis und seiner leichtmütigen Einfalt zugut kommen sollte – und ging vorwärts, in Gottes Namen.
Ich will nicht noch weitschweifig erzählen, wie ich mit dem Schreiner Rotgerber, der ein einfacher und grodsinniger Mann war, und mit seiner Karlin, die kurze Zeit drauf aus der Fremde zurückkehrte, zurecht kam. Nur soviel will ich sagen: als es dann soweit war, als die zwei Menschenkinder, das kreuzbrave Mädle und der Mattheis, miteinander in meiner Studierstube standen und ihr Aufgebot bestellten, als ich in dem jungen Steiglehner seinen Augen eine Zuversicht und einen Frohmut und ein Wachsein aufglänzen sah, wie es in seinem verschlafenen Blick wohl keiner vorher und nachher wieder gewahr wurde – da hat mich mein kühn und heikel Wagnis nicht gereut, und ich hab' geglaubt, den Segen Gottes zu spüren über meinem Werk und dem ihren …«
Zum ersten und einzigen Mal machte der alte Vaihinger eine längere Pause und sah mit einem wehmütigen Blick ins Weite. Keiner von den Zuhörern, die ihm mit Teilnahme gefolgt waren, traute sich, ihn zum Fortfahren zu ermutigen, sondern sie tranken einen stillen Schluck oder bliesen den Rauch von sich oder sahen gedankenvoll vor sich hin, bis der Alte von selber wieder anhub:
»Es war dem Mattheis nicht bestimmt, daß die Zuversicht in seinen blöden Augen recht behalten sollte, und mir nicht, im Kampf mit einer Toten den Sieg zu behalten.
Die Hochzeit war bestellt. Don allen, die es anging oder nicht, die die Neuigkeit lobten oder tadelten, nach ihrem Verstehen, war die Antoinett', der Steiglehnerin ihre alte Magd, von den letzten eine, die erfuhr, was das ›Büble‹, das sie in dem laubüberwachsenen Haus in der Heugasse betreute, vorhatte. Um selber was zu merken, war sie an Leib und Seele wohl schon zu kurzsichtig, und da sie zudem kaum mehr etwas hörte und fast nicht aus dem Haus ging, nahm sich kein guter Freund die Zeit, es ihr zuzuschreien. Sei's aus einer gewissen Scheu oder aus Vergeßlichkeit, – der Mattheis selber tat's ihr erst kund, als die Hochzeit vor der Tür stand. Er war grad' im Begriff, heraus nach Brambach zu gehen, zu seiner Braut, als er ihr die Nachricht obenhin zu wissen gab, und, eilig wie er's hatte, wartete er nicht ab, wie sie sich damit abfand.
Nach einem vergnügten Abend mit der Karlin bei den Rotgerberschen kam er ziemlich spät in der Nacht zurück in die Stadt und in sein Haus in der Heugasse. Er war verwundert, daß in der Wohnstube noch Licht war; noch verwunderter, als ihm dort die Antoinett' feierlich und schweigsam entgegenkam, ihm ohne ein Wort einen versiegelten Brief überreichte und wieder feierlich hinausging.
Er besah die Aufschrift und taumelte zurück. Die Adresse war von seiner Mutter Hand.
Es dauerte eine Weile, ehe er das Schreiben aufmachte. Dann war's eine Weile still – totenstill im Haus, bis ein wilder, wie irrsinniger Schrei bis hinaus auf die Gasse gellte und hallte.
Eh' die Antoinett' wieder in der Stube war, war der Mattheis draußen und rannte wie ein Besessener über die Treppen – durch die Haustür – hinaus in Nacht und Dunkelheit …
Den Zettel fand ich später, auf der nämlichen Stelle, wohin er aus des Mattheis' Hand gefallen war, in der Steiglehnerschen Wohnstube.
Die Worte, die drauf standen, von einer Mutter Hand geschrieben, haben sich mir ins Gedächtnis eingegraben. Sie lauteten:
›Im Namen des Vaters und des Sohnes und des heiligen Geistes! Mattheis – sei verflucht, wenn du dein Versprechen, das du mir in der Todesstunde getan hast, brechen willst!
Deine Mutter.‹
Es waren die nämlichen Zeilen, die die Steiglehnerin vor ihrem Sterben, nachdem sie dem Sohn das Gelöbnis abgenommen hatte, mit wackeliger Hand hingeschrieben und der Antoinett' in Verwahrung gegeben hatte. Auf das schwächliche Menschenkind, den Mattheis, wirkten sie wie ein Gespensterwort aus dem Grab herauf und vom Jenseits herüber. Vielleicht hätten sie auch einen Stärkeren als ihn aus dem Gleis geworfen …
Erst nach langem Suchen fand man den jungen Steiglehner, der tagelang in der Landschaft umhergeirrt war, auf dem Stroh in einer Bauernscheuer, in totenähnlichem Schlaf. Ganz aufgewacht ist er nie mehr, sondern er war und blieb von da an der Halbnarr und Trottel, des die Herren – der eine oder andere – sich noch erinnern. Erst vor drei Jahren wurde mir aus der Anstalt, in der er endlich untergebracht worden war, sein Ableben mitgeteilt. Der Rotgerber und seine Karlin sind bald nach dem trostlosen Ausgang der Brautschaft ins Unterland verzogen.
So ist der ›Apothekerle‹ an der sündhaften Liebe seiner Mutter verdorben und gestorben. Mög's der Allbarmherzige ihr verzeihen!«
In der Gaststube in Brambach war es, als der alte Vaihinger geendet hatte, so still geworden, daß man die Linde, unter der die Herren zuvor gesessen und gewartet hatten, von draußen ans Fenster klopfen hörte. Eh' man mit dem Vernommenen in sich zurecht kam, klang von der Straße vor dem »Pfauen« Peitschenknall.
»Der Herr Oberförster! Der Herr Oberförster!« schrie der Wirt vom Flur aus. Und schon war der Angekündigte an ihm vorbei und stürmte in die Gaststube – die Backen im frischen Vollbartgesicht gerötet von Eile und Wind.
»Ich bitt' um Verzeihung, ihr Herren!« rief er außer Atem den Freunden zu, die ihm entgegendrängten. »Drüben im Heidenhofer Gewand war ein Waldbrand ausgebrochen – und Pflicht geht vor Vergnügen! Längst wär' ich sonst hier!«
»Geschimpft haben wir sattsam, Riedmüller!« lachte der Notar.
»Kann mir's denken! Auf mich und meine Braut, die mich nicht losgegeben hätt'! Ist's so? Und der Medizinalrat am ärgsten! Ich seh's ihm an!«
»Erraten!« gab der hitzige Habermaß bedächtiger als sonst zu und klopfte dem Oberförster auf die Schulter. »Aber eine Lektion hab' ich dafür bezogen, von unserem Herrn Pfarrer« – er wies hinter sich – »der werd' ich alter Stoßbock gedenken!«
»'s war so bös nicht gemeint!« sagte der alte Vaihinger mit einem schelmischen Lächeln, während er als letzter mit dem Ankömmling einen Händedruck tauschte.
»Die Bowle, Pfauenwirt! Fix die Bowle!« kommandierte der Oberförster. »Und den ersten Schluck trinken wir auf meinen alten, ehrwürdigen Freund Vaihinger!«
»Den zweiten,« rief der Medizinalrat, auf den Tisch donnernd, »den zweiten, meinen Grundsätzen zum Trutz und einmal und nicht wieder, auf deine Braut, Riedmüller, und auf dein Glück in der Ehe!«
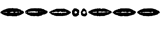
Tief und brünstig leuchtete das wilde Reblaub von Zäunen und Häusern. Die Laube im Pfarrgarten glühte in purpurner Röte, und die Rückwand des alten Hauses hatte ihre brüchige Tünche so flammend bekränzt, daß sie jung aussah und trunken, wie der ganze Garten mit seinen sternblütigen, bunten Dahlien, seinen summenden Bienen, seinen fruchtschweren, rosenwangigen Apfelbäumen. Trunkenheit, süße, reife, seligversonnene, lag in der zitternden, klaren Luft und Trunkenheit im dunkelgoldigen Sonnenschein, der kosend im Gras lag, in den Spinnweben glitzerte, Blätter und Blüten umfunkte und überrieselte. Sogar der ehrliche, biedere deutsche Himmel schien angesteckt und lachte in unheiliger Lebensfreude zwischen den Bergen herein. Wie ein Traum vom Hymettos, vom götterverklärten Olymp umfing es die Erde, und das Ohr lauschte, als müßte in ferner Waldschlucht die schäumende Lust eines Bacchenzugs verhallen. Ein letzter Septembertag war es, schwelgend im letzten Taumel lebendiger Reife, herbstlich in feiner Fülle und herbstlich in seiner Wehmut …
Seltsam und fremd bewegten sich auf so erdsattem Grund die Gestalten, die in der Laube saßen oder davor standen: sechs, acht Pfarrherren in ihren steifen, altväterischen Gehröcken, die düster vom roten Weinlaub und der dunkelgoldenen Sonne sich abhoben. Wenn aber auch nichts von griechischer Weltheiterkeit und Anmut in diesen Gottesmännern war – bis vor kurzem hatte doch eine ungezwungen echte und frische Fröhlichkeit die alten und jungen Gesichter verklärt. Man war ja doch auch nicht beisammen, um vom Amt zu reden, von den Erfahrungen der Seelsorge, den Verordnungen des Kirchenblatts, von theoretischem und praktischem Christentum, sondern um den »Neuen« zu versuchen – des Hausherrn neuen Wein nämlich, der süß und duftig die Gläser füllte. Der junge Wein des alten Pfarrer Vaihinger war berühmt, und wenn jahraus jahrein Ende September oder Anfang Oktober die Einladung zum ersten Tropfen in die benachbarten Pfarrhäuser ging, blieb keiner, dem sie galt, gern daheim, sondern schaffte sich beizeiten für ein paar Stunden die Arbeit vom Hals, um über Land in den gastfreien Garten zu kommen.
Und es hatte sich gelohnt wie immer! Der »Neue«, zeitiger als sonst, machte seinem Ziehherrn alle Ehre: es war Geist in dem trüben, ungegorenen Trank, hüpfender, prickelnder, unverfälschter Geist. Geist und Tücke! Der Kobold saß dem »Neuen« am Grund. Hatte er in der ersten halben Stunde sich fein versteckt und die echte, christliche Brüderlichkeit gewirkt, in der zweiten halben Stunde fuhr er heraus. Dem jüngsten in der Runde der Gäste, einem weichen, blonden Gottesmann mit üppigen Locken und einem krausen Christusbart, setzte er sich in den Nacken. Und eh' man sich dessen versah, gab es Unheil. Aus der Sphäre friedlicher Gleichgültigkeit schoß der junge Kollege plötzlich hervor und – ein rechtes enfant terrible – mitten hinein in das schlimmste Wespennest. In Norddeutschland hätten sie den bekannten Pfarrer soundso wegen Irrlehre aus der Landeskirche ausgeschlossen. Was man davon dächte? Ob so etwas im besseren Süden auch möglich wäre? Wie man sich dazu stellen sollte und ob man Genaueres wüßte?
Der erste, an den der sanft-beredte Frager sich wandte, war glücklicherweise schwerhörig – ein gebrechliches Männlein, das in einen Schal eingewickelt ging und ihm statt der Antwort freundlich zutrank. Der zweite, ein gutmütiger, struppiger Genießer mit roten Hängebacken lenkte versöhnlich ab. Der dritte aber war ein Eiferer, einer von jenen Unglücklichen, die sich verloren und hilflos vorkommen, wie ein Fisch am Land, wenn sie nicht ihre allein richtige Meinung von sich geben können. Im Handumdrehen platzte eine Ansicht heraus und eine andere dagegen. Vergeblich rief man zum Burgfrieden, der noch immer bei Vaihingers »Neuem« gegolten hatte. Vergeblich mahnte des Hausherrn versöhnliche Stimme, man solle die Gläser füllen und seinen Wein nicht entehren. Die Streitaxt war ausgegraben, und die Losungen ›hie Liberalismus, hie Orthodoxie‹ stürmten gegeneinander. Gleich schwarzen Unholden fielen die harten Schlagworte in den herbstsonnigen, rebenglühenden, daseinsfrohen Garten. Von der Freiheit des Gewissens redeten die einen, mit der der Protestantismus stehe und falle. Kein veraltetes Bekenntnis dürfe die freie Überzeugung des einzelnen vergewaltigen, und wer die Entwicklung der Wahrheit aufhalte, das helle Licht der Vernunft verdunkle, der greife an das Prinzip der evangelischen Konfession. Von der Gegenseite bliesen sie Sturm gegen den öden, gemütslosen Rationalismus. Wo kein Bekenntnis sei, sei keine Einheit möglich. Die Freiheit, von der man drüben rede, sei Anarchie; sie führe zur Selbstauslösung des Protestantismus, weil es keine Gemeinschaft gebe, die zu nichts verpflichte. Und ein Christentum, in dem es nichts mehr zu glauben gebe – keine Heilswahrheit – nicht Erlösung – nicht persönliche Gottheit – nicht Auferstehung des Leibes – sei keine Religion. So sauste Hieb wider Hieb. Die weinbefeuerten Köpfe erhitzten sich. Die dunklen Gestalten umdrängten sich mit herben, eckigen Gebärden. Sogar das gebrechliche Männlein im Schal, so schwerhörig es war, krähte wie ein junger Hahn, und der Epikureer mit den roten Hängebacken, der am längsten Ruhe gehalten, begann mit dem Glas drohend ums Haupt zu fuchteln.
Zuhinterst in der Laube saß der gute Pfarrer Vaihinger mit dem großen, irdenen Krug, aus dem er seinen Gästen kredenzte. Seine Beschwörungen hatten nichts gefruchtet. Jetzt blickte er wehmütig bald auf seinen Krug mit dem köstlichen »Neuen«, dem solch ein Tort geschah, bald auf die lärmenden Brüder in Christo, die seinen stillen, heiteren Garten zum Tummelplatz ihres Zankes machten. Mitunter zitterte es wie Unwillen oder Mitleid in den tausend Fältchen des feinen, bartlosen Gesichts, das so klar und sicher unter den langen, weißen Haaren lag, Zug um Zug ein Abbild erkämpften Friedens. Dann tauchten die Augen, über denen die Brauen in dichten Büscheln sich sträubten, mit sehnender Innigkeit in die satte Röte des Weinlaubs an der Rückwand des Hauses, in die goldene Fülle des Sonnenscheins draußen über Baum und Gras, in die wohlige Bläue des Septemberhimmels. Und in seiner Seele war ein Klingen, lauter und reiner als all die Worte, die ihn umschwirrten, und übertönte den hohlen, nichtigen Streit …
Der junge Pfarrer mit den vielen blonden Locken und dem Christusbart, der durch sein tapsiges Fragen die Ursache zu diesem plötzlichen Hader geworden, war durch den Erfolg im Bewußtsein seiner Wichtigkeit nicht eingeschüchtert, sondern gehoben. Sobald er im Drang des Gefechts etwas Luft bekam, erspähte er den Hausherrn, der so unberührt von der Parteien Gunst oder Ungunst beim Krug in der Laube saß. Einen Augenblick der Ermattung, in dem die feindlichen Gottesmänner sich verschnauften, benutzte er, um sich dem verlassenen Tisch zu nähern.
»Und Sie, Herr Amtsbruder,« wandte er sich geschmeidig an den alten Vaihinger, »Sie lassen uns Ihre Ansicht gar nicht hören!«
»Meine Ansicht?« Der Gefragte zuckte zerstreut zusammen. »Ach so, was ich über euern Zank denke?« fuhr er launig fort. »Daß mein ›Neuer‹ sauer wird, wenn er noch lange zuhören muß. Ich bitt' um die Gläser, ihr Herren, für einen Friedensschluck!«
Lachend ließen sich die erhitzten Gäste die kleine Zurechtweisung gefallen; mehr oder minder schuldbewußt kehrten sie in die Laube zurück, um sich die leergetrunkenen Gläser nachfüllen zu lassen. Im Grund waren die meisten froh, daß sie des Gezänks ledig werden sollten. Der einzige, der's nicht zufrieden war, war der Eiferer, der zuerst losgebrochen.
»Spaß beiseite,« erklärte er mit erregter Wichtigkeit, als die Reihe an ihm war, von dem alten Herrn kredenzt zu bekommen. »Sie, Kollege Vaihinger, sollten mit Ihrer Meinung auch nicht hinter dem Berg halten. Heutzutage, wo sich die Geister scheiden, muß jeder Schwarz oder Weiß bekennen. Mit der bekannten Goetheschen Abgeklärtheit geht's nicht mehr!« Säuerlich lächelnd hob er sein volles Glas gegen den greisen Pfarrer, als hätte er ein Gefühl dafür, daß er im Ton fehlgriff.
»Lassen Sie mir nur die Goethesche Abgeklärtheit, wie Sie's heißen,« erklärte Vaihinger, ohne seinen Humor zu verlieren. »In der Schule hatt' ich einen Freund, der ein mächtiger Schweiger war. Die Lehrer dachten dann immer, er wär' seiner Sache so sicher, daß sich's ihm nicht verlohnte, sich zu melden, und hielten ihn für besonders gescheit, weil er so klug schweigen konnte. In Wahrheit wußt' er nicht mehr als die andern – eher weniger. Vielleicht ist's heute mit mir auch so! Ich halt' mit meiner Meinung hinter dem Berg, und warum? Weil ich am Ende gar keine hab', bei der sich's verlohnt, sie ›vor dem Berg‹ zu halten!«
»Da dran möcht' ich doch zweifeln,« meinte verbindlich der junge Pfarrer mit dem Christuskopf.
Der Eiferer aber, der sich nicht gern auf feine Manier abwinken ließ, gab nicht locker. »Das Schweigen in solchen Fragen, mein' ich, ist ein zweideutig Ding. Lieber will ich ein Wort zu viel reden, als daß einer denken könnte, ich hätte den Mut nicht, für meinen Glauben oder Unglauben zu zeugen!«
Unwillige Blicke trafen von allen Seiten den wenig taktvollen Sprecher.
Der alte Vaihinger schaute ihm mit seinen klugen Augen frei ins Gesicht und schüttelte leise den Kopf.
»Mut und Mut ist auch zweierlei,« erwiderte er bedächtig und ohne jede Gereiztheit. »Als ich jünger war, so in Ihren Jahren, hatt' ich ihn auch, den Mut zu reden. Aber ich mußte lernen, daß der Mut zu schweigen oft nicht geringer zu achten ist. Daß er sogar vielleicht der größere ist!« Ein Schatten huschte über das sonst so offene, helle Antlitz. »Bitter genug mußt' ich's lernen,« setzte er mit leiser Wehmut hinzu. –
Die rücksichtslose Vordringlichkeit des Eiferers, die ernsten Worte Vaihingers hatten ein verlegenes, drückendes Schweigen hervorgerufen, von dem keiner recht loskommen konnte.
Der Hausherr, der die Stimmung am leidigsten empfand, fühlte, daß, nun er sich selber zu einer Äußerung hatte verlocken lassen, es auch an ihm sei, über den toten Punkt fortzuhelfen. Mit einem Scherzwort lieh sich über die Leere, die entstanden war, nicht weggleiten. Die Fröhlichkeit war nun einmal gestört und es war besser, dem Ernst zu geben, was dem Ernst gebührte, und danach wieder den Rückweg zur Gemütlichkeit zu finden.
»Ich will den Herren eine Geschichte erzählen,« begann er in seiner so gar nicht eiligen, breitbehaglichen Weise, »damit Sie nicht meinen, ich sei gleichgültig oder gar furchtsam in den höchsten Dingen. – Was ich berichte, steht aber nicht zur Diskussion, sondern mag für heut das Schlußwort im Glaubensstreit sein, auf daß hernach mein ›Neuer‹ wieder zu seinem Recht komme! Einverstanden?«
Die streitmatten Gotteskämpen nickten fast einmütig Beifall. Die Mehrzahl hatte sich's wieder in der Laube um den Tisch bequem gemacht. Die andern standen horchend vor dem Eingang.
»Den Mut zu reden,« hob Vaihinger an, »von dem ich vorhin gesprochen, hab' ich in meinen jungen Jahren so ausgiebig besessen, wie irgendeiner von Ihnen. Als blutjunger Mensch – mein Examensjahrgang traf's gerade besonders gut – kam ich auf meine erste Pfarre im Schwarzwald. Das Dörflein, das ich in Seelsorge bekam, war eins von denen, die, wollt' man sie nach Grund und Boden messen, es mit der größten Stadt aufnehmen könnten. Mußte man vom ersten Hof, der unten in der Talmulde lag, bis zum letzten Häuslein wandern, das oben unter einem Berggipfel hing, so durfte man seinen guten Vormittag drauf gehen lassen. Und doch waren's in dem ganzen Zwischenraum, gradaus und rechts und links vom holperigen Feldweg, bestenfalls drei- bis vierhundert Seelen – zwei und ein halber Großbauer, viele armselige Bäuerlein, die mehr Steine als Schollen pflügten, Uhrmachersleute, ein paar Handwerker, der Schulmeister und der Bärenwirt. Mein Vorgänger, aus Bequemlichkeit oder was sonst, hatte sich das Amt nicht sauer werden lassen. Er war selber mehr Bauer als Pfarrer, kümmerte sich nicht groß ums einzelne Glied in der Gemeinde und hielt's für zureichend, daß er jeden Sonntag den Leuten eine Donnerpredigt mit Sündenpfuhl, Höllenstrafen und Jüngstem Gericht hielt, an der sie sich sechs Tage heben konnten. Die Leutlein, des ewigen Wetterns müd, taten und ließen, was sie mochten: die Alten schwänzten den Gottesdienst, die Jungen die Kinderlehre. Und neben der Lauheit und Gleichgültigkeit gab's Aberglauben und da und dort ein muckeriges, hoffärtiges Sektenunwesen. Da hieß es gewaltig jäten und bauen. Das heißt, was ich so damals unter jäten und bauen verstand. Was ich meiner neuen Gemeinde mitbrachte, war das genaue Gegenstück von dem, was mein Vorgänger für gut und richtig gehalten. War sein Christentum Bitterwasser gewesen – das meinige war das aufgelegte, prächtigste Honigwasser. Erlebt hatte ich noch nichts, weder äußerlich noch innerlich, was der Rede wert war. Dafür war mein Kopf gebläht voll mit Wissenschaft und Vernünftigkeit. Ich war so frei, als nur irgend heut einer sein kann. Da war im ganzen Christenglauben keine Nuß, die ich nicht hätte knacken und ihren Kern in einen moralischen oder ethisch-sozialen oder rationalen Gemeinplatz hätte verwandeln können. Der Honig, den ich in mein Wasser tat, war meine Beredsamkeit. Ich kann sagen, was mich zum Pfarrer befähigte, war eigentlich bloß mein Mundwerk. Das troff nur so von Gleichnis und Bildwerk, und wo mir der Grund und die Tiefe abging, schaffte ich's mit Feuer und Schwung und schönster Poesie. Der Erfolg blieb denn auch nicht aus. Es war unterhaltsam, mich zu hören, und Leute, die längst den Kirchgang hatten fahren lassen, ließen sich bei mir wieder in der Predigt sehen. Im gewöhnlichen Leben, bei den Festen und bei den Trauerfeiern, verstand ich's auch, mit meinen Bauern umzugehen: ich trat keinem zu nah, ging auf ihre Sorgen ein, sparte nicht mit Rat und Zuspruch, wenn auch beide noch so billig waren. Die Jungen gewann ich mit meiner Zutraulichkeit noch schneller als die Alten. Und mit der Zeit hatt' ich mit meiner Lindigkeit sogar bei den Sektierern Glück, so daß ich den einen oder andern zu mir herüberzog. Ich durfte bei den Pfarrkonferenzen mit Selbstgefühl das ›blühende kirchliche Leben‹ in meiner Gemeinde rühmen.
Unter den wenigen, die sich trotz meiner Bemühungen von mir fernhielten, war einer, dessen Halsstarrigkeit mich ärgerte. Es war ein Uhrmacher, der Löchnerjakob geheißen, der in einem der fernsten und verstecktesten Häuser meines Sprengels wohnte. Sein kleines Anwesen stand hoch oben am Bergwald. Man sah sein Strohdach erst, wenn man fast davorstand, so tief steckte es in der steilen Talspalte, aus der der Wildbach entfloß. Der Mann war still, bescheiden, fast scheu, und fromm, wirklich herzensfromm. Er hatte viel Unglück im Leben gehabt. Ein stattliches Gehöft, auf dem er gewirtschaftet hatte, war ihm niedergebrannt. Er war nicht versichert. Sein kindlicher Glaube war überzeugt, daß er bei Gott am besten versichert sei. Als er dann Hab und Gut verloren, nahm er die Schickung geduldig an: er lernte, schon kein ganz Junger mehr, die Uhrmacherei und konnte bald für eine Fabrik in der Stadt Hausarbeit leisten. Seine Frau erbte das Häuslein oben am Berg, in dem er jetzt wohnte. Es war eine kränkliche Frau, an der er mit Leib und Seele hing. Drei Kinder hatte sie ihm geschenkt. Zwei nahm ihm kurz hintereinander ein hitziges Fieber. Das zweite war grad' gestorben, eh' ich meine Gemeinde antrat. Als ich ihn besuchte, wie jedes Pfarrkind, war er sehr einsilbig. Er saß bei der Arbeit. Die Heilige Schrift lag aufgeschlagen neben ihm. Er war mir schon als ein besonderer Heiliger und unermüdlicher Bibelleser geschildert worden. Ich glaubte, wir würden leicht miteinander ins reine kommen, denn ein Sektenbruder war er nicht, nur eben ein Eigenbrödler. Mein gut geöltes Mundwerk mußte da schon den rechten Ton finden. Aber es wurde doch nichts aus unserer Freundschaft. Er blieb zurückhaltend, beinah feindselig. Sein kahler Kopf, um dessen spitzen Turmschädel nur ein schmales, schwarzes Haarkränzlein saß, blieb beharrlich gesenkt, und die Lippen hielt er herb eingekniffen. Nur beim Abschied traf mich ein scheuer Blick aus zwei eigensinnigen, seltsam brennenden Augen.
Hatte mich schon mein erster, ungewöhnlicher Mißerfolg gekränkt, so verstimmte mich's noch mehr, daß der Löchnerjakob nie bei mir in der Kirche zu sehen war. Der Weg war ja weit. Aber andere, wie der Hochwiesenbauer und der Nagelanton, die noch weiter wohnten, kamen trotzdem. Ich wußte, daß er den stundenlangen Weg in die Stadt zu seinem Fabrikanten zweimal die Woche auch nicht scheute. Dann wurd' ihm die Frau sterbenselend. Eines Nachts schellte mich sein einziger, noch lebender Bub heraus und holte mich, daß ich der Mutter sollte das Abendmahl bringen, denn sie läge auf den Tod. Sonderlich erbaut war ich nicht, und während ich mit dem schüchternen Büblein durch die Nacht bergauf und -ab stolperte, hatte ich keine christlichen Gedanken gegen den Löchnerjakob.
Als wir droben ankamen, war die Frau schon gestorben. Er saß bei einem Talglicht neben ihr, hatte die Hände ineinandergepreßt und sah der Toten starr und stumm ins weiße, verlittene Angesicht. Auf meine Trostworte bekam ich keine Antwort. Ich sprach ein Gebet. Er rührte sich nicht aus seiner Stellung. Erst als ich ging, stand er auf und folgte mir unter die Tür.
Ich war, wie gesagt, alles eher als ein Dogmenchrist. Aber die Gelegenheit war günstig, dem Mann eins auszuwischen, und das konnte sich mein beleidigtes Selbstgefühl nicht verbeißen.
›Ihr hättet mich können eher rufen lassen, Löchner,‹ sagte ich vorwurfsvoll, ›Euer Weib hätt' dann den letzten Trost nicht entbehren müssen!‹
Es traf mich einer von den seltenen Blicken aus seinen eigensinnigen Augen.
›Wie's ans letzte gangen ist, eh' Ihr kommen seid,‹ erwiderte er mit seiner farblosen Flüsterstimme, ›hab' ich ihr selber Beicht' abg'nommen und Ab'lution geben.‹
Ich verschluckte ein bitteres Wort über die Eigenmächtigkeit, die ich darin fand, und ging mit einem schroffen ›B'hüt Gott‹ davon.
Zwei Tage drauf brachte er den Sarg mit der Toten auf seinem Leiterwagen herunter. Den Buben hatte er an der Hand. Nachher begruben wir sie. Ich hielt eine Rede, die mir sehr gefiel und der Gemeinde auch, denn die Tücher fuhren aus vielen Taschen. Von Gott und der Ewigkeit sprach ich wenig, denn das war meine schwache Seite. Um so mehr von zerstörter Gattenliebe, von unerforschlichen Ratschlüssen und vom Sterben in der Natur, denn es war Herbst, um den Anfang November, und das fallende Laub, der Wind über den Stoppeläckern, die ziehenden Wolken gaben treffliches Schmuckwerk.
Der Löchnerjakob stand mit gesenktem Kopf dabei, ohne daß es in seinen gelben, nachtwachenverhärmten Zügen sich bewegte. Nur das Kind an seiner Seite weinte still in dicken Tropfen. Als wir fertig waren, gab er mir flüchtig die Hand. Ein halbes Wort zu Dank. Dann stieg er mit dem Büblein in den leeren Wagen und fuhr wieder bergan. Er und sein Gott machten alles allein unter sich aus. Ich hatte das Nachsehen. Enttäuscht und verdrossen gab ich ihn auf …
Monate vergingen, ohne daß ich etwas von dem Löchnerjakob hörte.
Dann im März kam er wieder mit seinem Wagen aus den Bergen herunter. Diesmal stand ein Kindersarg drauf. Sein letzter Bub war ihm auch genommen worden. Er brachte ihn zu seinem Weib und den beiden anderen auf den Friedhof.
Ich hätt' kein Mensch sein müssen, wenn mir das Unheil, das Schlag auf Schlag über den armen Mann niederbrach, nicht hätt' ins Herz schneiden müssen. Aber ich hätt' auch ein besserer Christ sein müssen, als ich war, wenn ich mich ihm hätte ›nachwerfen‹ sollen. Und für nachwerfen hätt' ich's gehalten, wenn ich mehr mit ihm geredet und für ihn getan hätte, als meines Amts war. So machte ich's diesmal auch mit der Grabrede kurz, und nach dem Segen war ich's, der ihn mit einem stummen Händedruck stehen ließ. Und doch war mir's nachher in der Erinnerung manchmal, als hätt' er mich jenen Abend anders angesehen als sonst; auch als wär' er älter, gramvoller, weniger gesoßt und mit sich einig gewesen.
Ostern kam.
Ich bestieg meine Kanzel über der gefüllten Kirche mit dem Siegerbewußtsein, das mich an solchen Festen immer besonders trug.
Wie ich um mich blicke und den Mund zum ersten Wort öffne, seh' ich in einer der vordersten Bankreihen eine mir dort fremde, in sich zusammengekauerte Gestalt. Als ich zum Gebet aufrufe, und sich alle erheben, wen erkenn' ich? Den Löchnerjatob!
Das war eine Überraschung und Genugtuung, die mir nicht übel in den Kopf fuhr. Und sie kam meiner Sieghaftigkeit doppelt zugut. Wie eine Fanfare schmetterte ich meine Osterpredigt in die volle Kirche hinein! Die poetischen Bilder und die moralischen Sprüchlein flogen mir nur so an. Die Auferstehung, um die sich's drehte, deutete ich in einem wundervollen Hymnus auf die gesamte Natur, die im ewigen Wechsel des Werdens immer wieder auferstehe. Kurz und gut – ich machte für meine Bauern im unverfälschtesten Pantheismus, der immer herhalten muß, wenn's faul steht um die Religion im Christentum. Und als ich das letzte Amen sagte, konnte ich von der Kanzel steigen mit der Gewißheit, daß ich selten schön und erbaulich gesprochen …
Ich lasse mir eben in der Sakristei vom Mesner ein Kompliment machen, wie gar so erwecklich ich geredet, und dabei den Talar abnehmen.
Da klopft's.
Der Mesner geht an die Tür und öffnet.
Draußen steht, verdrückt und scheu – der Löchnerjakob.
›Immer herein, wenn Ihr was auf dem Herzen habt, Löchner!‹ ruf' ich ihm entgegen, strahlend von Befriedigung und Herablassung. Das war ja ein Erfolg, unerwartet und ungewöhnlich, wie ich ihn nicht hatte hoffen dürfen.
Wie er sich nicht recht hereintraut, hole ich meinen Mann selber von der Tür und setz ihn auf einen Stuhl mir gegenüber. Mit vielem Geschick, so bild' ich mir ein, und mit lauter Freundlichkeit beginn' ich dem Uhrmacherlöchner sein Anliegen abzupressen.
Und wie stand's um ihn?
Über den Mann, der ohne Murren, mit stiller, gläubiger Ergebung alles getragen hatte, was ihn getroffen, den Verlust von Hab und Gut, von zwei Kindern und einem geliebten Weib – über den war beim Tod seines letzten Buben die Anfechtung gekommen. Die Einigkeit zwischen ihm und seinem Gott, die so festgefügt und eigenstark war, daß sie jede Mitteilung von Dritten oder an ein Drittes ausschloß, hatte einen Riß bekommen. Vielleicht für Stunden nur, oder für einen Tag – aber sie war gestört, und der kindliche Glaube, in dem dieser Seele ihre Sehnsucht und Kraft offenbar wurde, war im Wanken. Darum war er in die Kirche gekommen. Aber statt daß meine wunderschöne Predigt ihm Halt und Trost gegeben, war sein Zweifel zur Verzweiflung geworden. Die Auferstehung, von der ich nur so im großen geredet – die Auferstehung des Leibes und ein ewiges Leben, die mußte er für gewiß haben! Von der hatte ich ihm zu viel und zu wenig gesagt. Nichts von dem, was er brauchte und selber bisher für recht gehalten. Darum mußte er mich unter vier Augen sprechen, wie's sich damit verhielte …
Und was tu ich?
Ich höre dem Mann sein unbeholfenes Beben und Stammeln sanftmütig und duldsam an. Daß ihm geholfen werden muß, daß ich und kein anderer ihm helfen kann, ist mir eine ausgemachte Sache. Er muß los, los von seinem Buchstabenglauben, der die Zwangsjacke ist, in der er zugrund geht! Er muß befreit, muß aufgeklärt werden, damit er wieder tüchtig fürs Leben wird! Und im Vollgefühl meiner Kraft und meiner Berufenheit gieß' ich denn auch den ganzen Aufkläricht über ihn aus und halte ihm eine zweite Predigt, daß wir dem Leben zu leben schuldig sind, daß die Toten in unserer Erinnerung unsterblich sind und daß man sich nicht im Wortsinn der Bibel verrennen darf, sondern drüber hinaus zu eigenem Verständnis emporwachsen muß.
Der Löchnerjakob hört mir zu – mit gesenktem Kopf, wie er's immer tat. Wie ich fertig bin, gibt's eine lange Pause. Der Atem stößt in seiner Brust. Der Schweiß steht auf seiner spitzen Stirn und auf dem kahlen Schädel, den die paar schwarzen Haare so eigen umkränzen. Endlich sieht er auf. Die Augen, die so eigensinnig sind und so unheimlich brennen können, richten sich in weher Qual auf die meinen.
›Also – ob ich mein Weib und meine Kinder wiederseh', mein' ich!‹ stammelt er langsam.
Ich stutze einen Augenblick über diese stiere Beharrlichkeit, die mit Nichtachtung all meiner schönen Worte nur auf den Kern losstößt, den der Löchnerjakob erfaßt hat. Im nächsten Augenblick ist's mir klar: so peinlich diese Stierheit ist, hier ist der Mut zu reden – Gewissenspflicht. Gewissenspflicht und Freiheit des Gewissens waren von allen meinen theologischen Begriffen die festesten und unumstößlichsten. Und so mach' ich mich denn kühn und vorurteilslos, aber doch, wie ich glaube, schonend daran, den gequälten Mann von seiner Illusion zu befreien und an Stelle seiner rohen und unvernünftigen Köhlerauffassung die vernünftigere vom ewigen Werden und ewigen Vergehen zu setzen, in der wir alle, wenigstens in der Poesie, unsterblich sind.
Wieder sitzt der Löchner mit gesenktem Kopf.
Diesmal hebt er ihn aber auch zur Antwort nicht.
›Wenn ich se net wiederseh – wie se waren – Weib und Kind – hat's keinen Sinn – alles, mein Leben und ihr's und alles – alles –‹ flüstert er kaum verständlich.
Ich meine, daß es jetzt Zeit ist, stärkere Töne anzuschlagen. Ich will den Löchnerjokob bei seinem Mannestum fassen, das kein so schwächliches Aufgeben und Fahrenlassen dulden darf. Aber wie ich im besten Zug bin, steht er auf. Ich will ihn wieder zum Sitzen bringen. Er scheint gar nicht zu hören und zu verstehen, was ich sage, und geht wie ein Nachtwandler, ohne mich noch einmal anzusehen, aus der Sakristei.
Ein sonderbarer Mensch bleibt er, der Löchnerjakob, denk' ich. Aber er muß das Neue, Höhere erst hinter seiner engen Stirn verarbeiten. Fürs erste kann ich zufrieden sein. Mit dieser Erwägung tret' ich den Heimweg ins Pfarrhaus an.
Zwei Tage später kommt der Schultheiß mit dem Landjäger zu mir; beide melden mir, der erstere entrüstet, der andere dienstlich-kühl, daß der Löchnerjokob nichts mehr ›verarbeitet‹ …
Er hatte sich, anscheinend noch am Ostersonntag, droben in seinem Haus am Bergwald an einem Dachsparren – aufgehängt.«
Der alte Pfarrer machte eine Pause. Seine Worte waren hastiger und bewegter geworden als sonst. Er atmete tief auf und strich sich eine silberne Strähne aus der Stirn. Die Erinnerung an das Erlebte, so viele Jahre auch vergangen waren, hatte eine schmerzliche Erregung in das so beherrschte und friedsame Gesicht gebracht. Mit greifbarer Lebendigkeit stand das traurige Geschehnis vor ihm, so daß er seine Umgebung fast vergessen zu haben schien. Dann lenkte er zu ruhigerer Erzählung zurück.
»Als ich die Nachricht erfuhr, daß der Löchnerjakob selber Hand an sich gelegt hätte, meint' ich, ich bekäm' aus heiterem Himmel einen Gewalthieb über den Kopf. Das Warum und Wie und Woher begriff ich noch nicht. Lange noch nicht. Aber die unselige Tat des armen Mannes fiel doch mit dumpfer Schwere in meine siegesbewußte Jugendlichkeit und unerfahrene Leerheit. Der ursächliche Zusammenhang zwischen meiner Aufklärungsarbeit und dem Zusammenbruch des einsamen Sinnierers war nicht wegzubuchstabieren. Wohl suchte ich Trost bei meiner vermeintlichen Gewissenspflicht, bei dem Gedanken an die eigensinnige, enge Starrheit des Toten. Aber die Schuld, daß ich ihn vollends hinuntergestoßen, statt heraufgezogen hatte, wühlte doch in mir. Noch empfand ich sie mehr als eine Peinlichkeit. ›Ach, wie dumm von dem Löchner,‹ hätt' ich mögen sagen, im Hinblick auf seine Verbohrtheit und auf meine Aufgeklärtheit, die er nicht hatte verkraften können. Ich redete nach wie vor im alten, pompösen Stil. Aber manchmal, wenn ich an die Grundfragen des Glaubens kam, über die ich sonst so rationell weggesprungen war, scheute ich doch zurück und ging einen vorsichtigeren Gang.
Als sich eine Gelegenheit bot, aus dem Schwarzwalddorf, dem ich ein so blühendes kirchliches Leben gebracht hatte, fortzukommen, ergriff ich sie: es war mir oft eigen unheimlich, seit der Löchner auf dem Friedhof lag, neben meinem Pfarrhaus. Und daß man ihn abseits und nicht hatte zu den Seinen legen müssen, um nicht die Gemeinde vor den Kopf zu stoßen, gab mir auch so ein bitteres Gefühl …
Dann, wie ich fort war, nahm mich das Leben erst eigentlich zwischen seine Fäuste. Und es hat mir's nicht sänftiglich gemacht. Um und um hat's mich gedrillt und gestoßen. Ich hatte einen Hausstand gegründet. Aus dem nahm es mir erst das einzige Kind und dann mein Weib, an dem mein Herz hing über alles Sagen und Verstehen. An dem Abend, wie ich zuerst allein war, ganz allein mit meinem Jammer und meiner Verzweiflung, da hab' ich erst bis auf den Grund verstanden, wie ich mich an dem Löchnerjakob dereinst vergriffen und versündigt mit meinem gottvergessenen Mut zu reden. Der Glaube, nach dem ich jetzt selber schrie und rang, der war ja eine Gnade, eine Leidenschaft, eine Kraft wider Leid und Tod! Und ob sich dieser Glaube in Enge und Beschränktheit und Eigensinn verkleidete, oder ob er weit und frei in alle Höhen und Tiefen des Gottes- und Weltgeheimnisses leuchtete – der, der ihn hatte, war der Stärkere, und der, der ihn nicht hatte – ob er schon so klug war wie der Klügste, vernünftig wie ein Viereck, und klar wie durchsichtiges Glas, und beredt wie die Plätscherwelle im Bach – der war der Schwache. Weh' über ihn und Fluch, wenn er an die Seele des Starken mit seiner Schwachheit tapste! Weh', wenn er sie in einer Stunde der Anfechtung zu sich niederriß und in Stücke brach! Wie viele aber konnten mir noch begegnen, konnten zu meinen Füßen sitzen oder in meine Pfarrstube treten, die ein unvorsichtig-plumpes Wort um ihre Seligkeit betrog? Vielleicht wär' ich mit meinem Unglauben am besten ganz aus dem Amt gegangen. Aber ich wußte nicht wohin und mußte leben und hielt's auch für die Last, die mir zu Recht auferlegt war. Deshalb versucht' ich's mit dem Mut zu schweigen. Hart und blutsauer kam es mich an – mich den Aufgeklärten und Ungläubigen – und kostete freudlose Tage und zerknirschte Nächte jahraus und jahrein. Bis es besser und noch besser gelang. Und jetzt, wo's gelungen ist, da spür' ich manchmal in stillen Stunden auch in mir ein leises Regen und Wachsen, bescheiden und zaghaft: und es wird Kraft daraus und Glaube und Freudigkeit und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft!«
Draußen wollte es Abend werden. Satter leuchtete das wilde Weinlaub an der Hauswand und um die Laube, leuchteten die sternblütigen Dahlien im Garten. Zarter schien die sich neigende Sonne, und der Himmel strahlte in tieferem Blau, als wäre noch ein letztes Geheimnis hinter der lebensfreudigen Bläue. Der alte Vaihinger schwieg, und die um ihn saßen und standen, taten's auch – sogar der Eiferer und der junge, christusköpfige Pfarrer, so manches sie auch hätten fragen und dawider sprechen mögen. Sie ließen des greisen Hausherrn Geschichte ausklingen in ihren Seelen. Dann war er der erste, der wieder lächelte und nach dem Kruge griff.
»Jetzt hab' ich auch mein Scherflein bezahlt zum Glaubensstreit, denk' ich. Jetzt gehört wieder meinem ›Neuen‹ die Ehre!«