
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Mit Gas gefüllte Kinderballons steigen langsam zur hohen Decke des Tanzsaales auf. Am Ende des einen Ballons hat ein geschickter Spaßvogel einen angezündeten Papierstreifen befestigt. Der Ballon stößt an die Decke. Die Flamme berührt seine Haut, und eine laute Detonation knallt in die schmetternde Musik der Jazzkapelle.
Weiber kreischen. Männer rufen: »Zamechatalno!« »Großartig!« Alles kauft Ballons. Eine Detonation folgt auf die andere. In die dumpfen Explosionsgeräusche mischt sich das scharfe Knallen von Sektkorken.
Auf der Bühne tanzt eine junge Person in einem geschlitzten Kleid einen aufreizenden Tanz, und ihr laut gesungenes Lied löst brüllenden Beifall an den überfüllten Tischen aus.
Auf der Tanzfläche gerät plötzlich alles in Bewegung, und lautes Gelächter ist zu hören. Wasser spritzt. Ein junger Mann kippt langsam in den Springbrunnen, seine Gefährten ziehen ihn heraus und schreien: »Bravo! Bis, bis!«
Das ist im Rußland von heute. Es ist nicht in dem alten Restaurant »Jar«, wo der schwarze Mönch Rasputin seine Zechgelage inszenierte. Es ist im Tanzsaal des Hotel Metropole, hier in Moskau, in der Hauptstadt der ersten Arbeiter- und Bauernrepublik.
Es ist in dem Lande, in dem die Diktatur des Proletariats versprochen hat, durch Abschaffung des Profitsystems und durch geplante Volkswirtschaft die kapitalistischen Nationen »einzuholen und zu übertreffen«. Hier wird das Schicksal des Kommunismus entschieden werden, vielleicht auch das Schicksal des Kapitalismus, und beider Schicksal wird entschieden werden von dem Lebensstandard, den die Sowjetunion ihren Bürgern zu geben imstande ist.
Wie sieht dieser Lebensstandard heute aus, was verspricht er morgen zu werden, und wie fällt ein Vergleich zwischen ihm und unserem Standard aus?
Diese Tanzsaalszene wiederholt sich allnächtlich in Moskau, der Hauptstadt der ältesten unter allen Diktaturen Europas. Dies ist das Land, in dem die Diktatur vom Typus der modernen Massenpartei erfunden wurde und in dem das Prinzip der Regierung durch Autorität weiter getragen worden ist als in allen anderen Ländern der Welt.
Hier, so wird gesagt, regiert der Arbeiter, in seinem Namen wird die Diktatur des Proletariats ausgeführt. Diese Regierung war die erste, die jemals im Namen nicht bloß des gemeinen Mannes, sondern des gemeinsten Mannes, des Unterdrückten, des Arbeiters und des ärmsten Bauern begründet wurde.
Wie ergeht es dem gemeinsten Mann heute nach siebzehn Jahren der in seinem Namen ausgeübten Diktatur? Wie ist es anderen Russen ergangen? Was haben die 168 000 000 Russen im Verlauf dieser siebzehn Jahre erduldet, und was haben sie heute gewonnen?
Was kann der amerikanische Arbeiter von der Erfahrung seiner Kollegen in der Sowjetunion lernen? Würde er gern mit einem Sowjet-Arbeiter tauschen? Oder wäre ihm ein Sowjet-Amerika lieb?
Die Antwort auf diese Fragen ist nicht im Metropol-Hotel zu finden ... Die Antwort ist zu finden in den Fabriken und auf den Landwirtschaften, in den Nahrungsmittelläden, den Geschäften und den Restaurants, vor allem jedoch in den Arbeiterheimen und Bauernhäusern.
Aber der Tanzsaal des Metropol ist ein überraschender Empfang in der Sowjetunion für einen Reisenden, der unter jenem berühmten Bogen an der Grenze mit der roten Herausforderung »Arbeiter der Welt, vereinigt euch« hindurchgeschritten ist.
Hier in diesem Tanzsaal repräsentiert jede Explosion eines Kinderballons fünf Stundenlöhne eines Sowjet-Arbeiters. Jeder Kinderballon nämlich kostet fünf Rubel, und im Durchschnitt wird in der Sowjetunion ein Rubel für die Stunde bezahlt.
Jeder Teilnehmer an den nächtlichen Vergnügungen im Hotel Metropol gibt für seine Abendunterhaltung das Äquivalent des Wochenlohnes eines Sowjet-Arbeiters aus. Fünfunddreißig Rubel beträgt die Durchschnittsbezahlung eines Proletariers unter der Diktatur des Proletariats, und fünfunddreißig Rubel sind ungefähr die niedrigste Zahl auf einer Rechnung für Sowjetwein und -champagner im Metropol.
Vor acht Jahren, unter der NEP, betrieb die Regierung eine Zeitlang offizielle Spielhöllen. Die Gewinne kamen dem Kommissariat für Volkserziehung zugute. In einem düsteren Raum in der Nähe des Zirkus hier standen um zwei Baccarat- und vier Bouletische Männer in Lederjacken, die auf einmal Banknotenbündel bis zu einer Höhe von zehntausend Rubel setzten.
Es waren NEP-Leute. Sie kauften und verkauften und machten Profite. Die Regierung brauchte sie, sie duldete sie einige Jahre lang voll Verachtung und schickte sie dann in die Verbannung oder ins Gefängnis. Das Leben, das sie führten, war voll Gefahr, und während sie spielten, stand ihnen der Angstschweiß auf der Stirn.
Diese Gäste im Metropol haben keine Angst. Aber wer sind die Leute, die das Geld ausgeben? Sind es Menschen, denen Sekt und angezündete Ballons gegeben worden sind, weil sie sie brauchen und weil der Kommunismus verspricht: »Von jedem entsprechend seiner Fähigkeit, und jedem entsprechend seinen Bedürfnissen?« Oder sind es einfach Menschen, die, wie in kapitalistischen Ländern, ein so großes Einkommen haben, daß sie an einem Abend die Wocheneinkünfte eines Arbeiters ausgeben können?
Das erste sind sie nicht, weil es in Rußland keinen Kommunismus gibt, und diejenigen, die das am eifrigsten beteuern, sind die Kommunisten selbst. Sie sind in der Tat das zweite. Es sind »reiche« Russen, »reich« im Sowjetsinne, verhältnismäßig »reich«, und sie verjubeln ihren Reichtum in diesem seltsamen neuen Moskau von heute.
Moskau ist heute nämlich funkelnagelneu. Es handelt sich nicht um eine neue NEP. Es ist die Aera: »Sozialisten werden reich.« Niemand kann heute mit dem Vergeben von Arbeit Geld verdienen. Niemand kann damit Geld verdienen, daß er billig einkauft und teuer verkauft. Aber jedermann ist berechtigt, seine eigene Arbeitskraft so teuer zu verkaufen, wie er nur kann, und die natürliche Ungleichheit der Menschen hat heute in der Sowjetunion eine Ungleichheit der Einkommen herbeigeführt, die sich nicht sehr von der Ungleichheit unter dem Privatkapitalismus unterscheidet.
Das ist das Moskau der »sozialistischen Ungleichheit«. Es gleicht in nichts dem zerlumpten Moskau von 1930, dem zweiten Jahr des ersten Fünfjahresplanes. Es gleicht nicht der Stadt in den blühenden Jahren der NEP. Noch gleicht es dem verhungerten Moskau des militärischen Kommunismus, auch nicht dem Moskau des Zaren aller Reußen.
Es ist das Moskau des zweiten Jahres des zweiten Fünfjahrplanes, und dieses Moskau ist so neu, daß es noch einmal ganz geschildert werden muß. Die Sowjet-Propagandisten sind stolz auf die Leistungen der Nation, sie sprechen selten von ihren Fehlschlägen, sie schweigen sich über die Hungersnöte aus und beschäftigen sich am liebsten mit der Zukunft. Das beste, was ein unparteiischer Beobachter tun kann, ist, zu berichten, was er in dem Moskau von heute sieht; das erste, was ihm vor die Augen kommt, ist das Metropol, und das erste, was er sich, voll Erinnerungen an die traurige Stadt von vor vier Jahren fragt, ist: »Kann dies Sowjet-Rußland sein?«
Freilich ist es Sowjet-Rußland, denn in der Frau, die da mit dem schlanken jungen Mann tanzt, erkennt der Botschaftsrat einer Großmacht die Köchin einer skandinavischen Gesandtschaft. »Eine gute Köchin übrigens«, sagt er.
Sie und der Botschaftsrat sind nur zwei von vielen Ausländern. Es sind immer viele Fremde da. Aber es kommt auf die Russen an. Dieser junge Kavallerieoffizier der roten Armee versucht den Foxtrott zu erlernen, aber er hopst auf und nieder, als säße er noch immer auf einem Pferd. Ein schwerfälliger Mann vergnügt sich, aber nicht seine Partnerin, indem er den alten Charleston tanzt.
Die Manieren sind ganz formlos. Man kann drängeln oder gedrängelt werden, und in beiden Fällen ist es höflich, den Vorgang zu ignorieren. Ein Gefühl für Zeit existiert nicht. Um acht Uhr früh ist die Bar noch immer voll trinklustiger Gäste, und gerade in dem Augenblick, in dem die Winterdämmerung den Arbeitern auf ihrem Weg zur Arbeitsstätte leuchtet, bringt der Barmann eine neue Runde.
Draußen fegt ein schneidend scharfer Wind über den Teatralny-Platz. Schwarze Gestalten eilen in stets größer werdenden Scharen über die schmutzigen Bürgersteige. In den Schacht, der zum Tunnel der neuen Untergrundbahn hinunterführt, strömt eine Unzahl von Mädchen in Overalls. Diese waren sicherlich nicht im Metropol gewesen.
Aus der Schwingtür des Hotels dringt ein Strom kalten Tabakrauches, der sich in der frostigen Luft auflöst. Aus dem Nirgends taucht ein Bettlerkind auf.
Einige Kritiker der Sowjetunion behaupten, sie habe keine Fortschritte gemacht. Aber dieses Bettlerkind ist heute allein, während es vor vier Jahren noch ein Dutzend Gefährten hatte. Sie gingen damals barfuß durch den Schnee, und unter ihren Lumpen waren die nackten Bäuche zu sehen.
Dieses da hat Stiefel an, und sein Mantel ist dick.
Es winselt: »Bruder, haben Sie einen Groschen übrig?«
»Daitie Valuta!« bettelt das Kind, und das heißt: »Geben Sie mir ausländisches Geld.«
Die Bolschewisten behaupten, das kapitalistische Amerika breche zusammen, aber die Moskauer Bettler bitten noch immer um amerikanisches Geld.
Rußland
Tausend ehrfürchtig Lauschende standen im Konzertsaal des »Udarnik«, des größten Moskauer Kinos. Der Dirigent hob den Taktstock. Die russische Zuhörerschaft war auf das äußerste gespannt, und in seine Ehrfurcht mischte sich geradezu religiöse Scheu, als die Musik losdonnerte.
»Jubelgeschrei« war die Melodie.
Das rote Rußland hat zwei Revolutionen gemacht. Heute macht es Jubelgeschrei. Für Sowjet-Russen bedeutet dieses Jubelgeschrei eine warme Mahlzeit mit Fleisch einmal im Tag, einen warmen Mantel und die Möglichkeit, »Die Hochzeit der gemalten Puppe« zu hören. Einem Amerikaner scheint das, worüber sie jubeln, gerade eine Stufe über dem Elend zu liegen, aber für die Bewohner des Landes des Fünfjahrplanes ist es Reichtum.
Die Musik ihrer Jazzkapellen ist fünf Jahre alt. Aber für sie ist sie neu. Ihr Tanzen ist grotesk, aber es ist das erstemal, daß sie tanzen.
Ihr Fleisch ist zäh, aber es ist besser als gar keines. Ihre Kleider sind armselig, aber sie sind zum erstenmal warm.
Die zweite rote Revolution machte wenig Aufsehen im Vergleich zur ersten. Es gab keine »zehn Tage, die die Welt erschütterten«.
Es gab fünf Jahre, die die Welt langweilten. Aber diese Jahre des Fünfjahrplanes von 1929 bis 1933 waren wichtiger als die zehn Tage des Oktober 1917.
Millionen von Opfern lagen in der russischen Erde, als die erste rote Revolution, die zur Machtergreifung, 1921 ihr Ende fand. Millionen mehr waren zu den Toten gekommen, als die zweite rote Revolution, die zur Zerstörung der letzten Überreste des Privatkapitalismus und zur Sozialisierung Rußlands, sich im vergangenen Jahr ihrem Ende näherte.
Wie existierten die Überlebenden heute? Und wer sind sie?
Die erste Revolution von 1917 vernichtete den Zaren mit seiner Familie, rottete den Hochadel und den Landadel aus, dezimierte die akademischen Kreise, unterjochte den Mittelstand und legte die gesamte Macht in die Hände der Bolschewisten, der Führer des Proletariats.
Sie schlugen die Interventionen fremder Länder ab, führten einen Bürgerkrieg mit den Weißgardisten und gewannen ihn unter furchtbaren Verlusten. Sie hatten 1921 eine Hungersnot, die Millionen von Menschen dahinraffte, und überlebten sie. 1922 nahmen sie sich Zeit zum Ausruhen und ließen sich sechs Jahre lang von ein wenig privatem Unternehmungsgeist dabei helfen, das, was sie gewonnen hatten, auszubauen und zu befestigen.
Die zweite Revolution, die im Oktober 1928 mit der Einführung des ersten Fünfjahrplanes begann, schlug einen Weg ein, der in merkwürdiger Weise dem der ersten Revolution glich. Die Bolschewisten machten sich daran, Rußland über Nacht zu industrialisieren, es militärisch gegen die Umwelt zu sichern und wirtschaftlich von ihr unabhängig zu machen, und die Bauern zu kollektivisieren.
Sie wurden der Gefahr des Außenkrieges mit Japan Herr, führten einen Bürgerkrieg gegen die Bauern und gewannen ihn unter furchtbaren Verlusten. Sie hatten 1932/33 eine Hungersnot, die Millionen von Menschen dahinraffte, und überlebten sie. 1933 gönnten sie sich ein Jahr Ruhe, um zu inventarisieren.
Seit der Verwüstung, die Deutschland im Dreißigjährigen Krieg über sich ergehen lassen mußte, hat kein Land eine solche Periode des Elends durchgemacht wie Rußland in den letzten siebzehn Jahren. Nur die Stärksten blieben am Leben. Aber seine Bevölkerung wuchs im Lauf dieser siebzehn Jahre um 25 Millionen. Rußland gehört heute der Jugend.
Heute leben die Jugend und die wenigen von der älteren Generation, die nicht umgekommen sind, wie die Russen seit siebzehn Jahren gelebt haben, unter der strengsten Diktatur, die die moderne Geschichte kennt. Ihr Geschick liegt in einem viel engeren Sinne in den Händen ihrer Beherrscher als jemals das Geschick eines Volkes in der ganzen Geschichte. Andere Diktatoren machen Gesetze, die einen Teil der menschlichen Handlungen ihrer Untertanen betreffen. Diese Diktatur macht Gesetze, die jede erdenkliche Seite des Lebens der Russen betreffen.
Sie nimmt Leben und gibt Leben. Sie zerstört die Kirche und sorgt für Erziehung. Sie wandelt Moralbegriffe und ändert den Sinn der Gerechtigkeit. Sie belohnt Kinder, die ihre Eltern denunzieren, und gibt Säuglingen Kinderbewahranstalten.
Sie lehrt Millionen lesen und schreiben und kündigt öffentlich an, daß sie die unschuldigen Familien entflohener Übeltäter als Geiseln ergreifen und nach Sibirien schicken werde. Sie verdammt ganze Schichten der Bevölkerung zum Hungertod und begeistert andere zu heroischen Leistungen.
Ihre Grausamkeit gegen ihre Feinde und ihre Ergebenheit für ihre Freunde sind grenzenlos. Sie verbreitet sowohl Entsetzen wie Begeisterung. Sie richtet Ungläubige mit weniger Zeremonien hin, als andere Regierungen Verbrecher. Sie verspricht das Reich Marxens und all seine Herrlichkeit allen jenen, die an sein Evangelium glauben.
Welchen Teil dieses Reiches, das, wie die Bolschewisten glauben, eines Tages die ganze Erde umfassen wird, haben sie bereits zur Wirklichkeit gemacht?
Die Bolschewisten haben das zweitgrößte Reich, das es jemals gegeben hat, geerbt. Die Sowjetunion mit ihren 168 000 000 Einwohnern auf einem Gebiet von 8 000 000 Quadratmeilen wird an Größe nur von dem britischen Weltreich mit seinen 485 000 000 weißen, schwarzen und gelben Einwohnern auf 13 000 000 Quadratmeilen übertroffen. Viel weiter hinten erst kommen die Vereinigten Staaten mit ihren 125 000 000 Menschen auf 3 780 000 Quadratmeilen, einem Gebiet, das nicht einmal halb so groß ist wie das Riesenareal der Sowjetunion.
Die Russen wollen jetzt nicht mehr Land. Sie wollen die Früchte des Landes, das sie schon besitzen. Ihre Herren, die Bolschewisten glauben, eine Methode gefunden zu haben, mit der sie mehr Früchte bekommen können als die kapitalistische Welt.
Sie nennen diese Methode, die Sowjet-Methode, »Sozialismus« und sagen, sie sei der Weg zu dem letzten, weit entfernten Ziel »Kommunismus«, da jeder seinem Bedürfnisse gemäß bekommen, jeder entsprechend seinen Fähigkeiten arbeiten, und alle reich und glücklich sein werden.
Heute aber ist die Sowjet-Methode weitaus leichter zu verstehen, wenn man sich einen mächtigen Kapitalisten vorstellt, einen einzelnen Mann, dem das ganze Reich gehört, jeder Fußbreit Landes, jede Fabrik, jede Grube und jedes Werk. Für diesen Mann, diesen Superkapitalisten, muß jedes Menschenwesen im Lande arbeiten, oder es muß verhungern, es muß ihm gehorchen oder in Verbannung, Gefängnis oder Tod gehen. Sie alle sind nicht nur seine Arbeitnehmer, sondern auch seine absoluten Untertanen.
Dieser mächtige Kapitalist behauptet, seine Produktion werde nicht bloß die Summe aller Produkte sein, die seine Untertanen herstellen würden, wenn die Unternehmen ihr Privateigentum wären, sondern seine Produktion werde viel größer sein. Erstens, so glaubt er, weil er im Gegensatz zu allen anderen Arbeitgebern keinen Profit, sondern nur ein Geschäftsführergehalt für sich selbst in Anspruch nehme, einen Teil der Profite wieder der Industrie zuführe und den Rest in Löhnen verteile.
Zweitens, so behauptet er, indem er das tue und mittels seines Fünfjahrplanes könne er die Löhne der Erzeugung so angleichen, daß der Verbrauch stets der Erzeugung gleichkomme und es infolgedessen niemals Depressionen oder Krisen geben werde.
Drittens, so glaubt er, werden die Arbeiter lieber für ihn arbeiten als für ihre alten Arbeitgeber und darum auch tüchtiger arbeiten.
Der mächtige Kapitalist in der Sowjetunion ist der Staat. Alle drei von diesen Behauptungen finden Widerspruch bei vielen Nationalökonomen, und die Erfahrung hat bis heute noch keine von ihnen bewiesen. Aber es ist sehr wohl der Aufmerksamkeit wert, wie diese Erfahrung aussieht. Der Sowjet-Staat nimmt wohl Profite, aber er behält sie nicht. In den letzten fünf Jahren hat der Staat solche Profite eingeheimst, daß das Volk nahezu zusammenbrach, und während dieser fünf Jahre gab der Staat seinen Arbeitnehmern, der ganzen Bevölkerung, niedrigere Löhne, als sie bei den selbstsüchtigsten Privatkapitalisten bekommen hätten.
Während dieser Jahre steckte der Staat alle Profite wieder in die Industrie. Heute läßt er seine Arbeiter zum erstenmal etwas von den Profiten kosten. Der Staat investiert noch immer den größten Teil der Gewinne, fühlt sich aber jetzt stark genug, um einen Teil davon dem Verbrauch der Menschen zuzuführen.
Bis jetzt haben diese 168 000 000 Russen, Arbeitnehmer des mächtigsten Kapitalisten der Welt, nach der Melodie der Zukunftsmusik gelebt, und kein Mensch weiß, welche Gewinne sie schließlich benutzen werden.
Was immer sie genießen, liegt bei der Entscheidung eines Mannes.
Es wäre falsch, sich in diesem Bild der Sowjetunion Joseph Stalin als den »mächtigen Kapitalisten« zu denken, aber Stalin ist, wenn auch nicht der Staat in dem Sinne, wie Ludwig XIV. es mit seinem Wort meinte, dennoch der oberste Herrscher, der Quell des Glaubens, das allmächtige Oberhaupt der Staatsreligion, nämlich des Kommunismus, und der bewaffneten Kräfte des Staates, der Herr der Politik und der Generaldirektor des mächtigsten Wirtschaftsbetriebes, den man sich nur denken kann.
Er wird jetzt »der Große« genannt. Der letzte Zar, der diesen Titel trug, war Peter. Alle anderen Zarennamen mußten von den Straßenbildern Moskaus verschwinden, aber Stalin der Große hat gestattet, daß die Petrowka den Namen des einzigen Zaren der russischen Geschichte behalte, der am stärksten an den roten Diktator erinnert.
Die Petrowka ist die Fifth Avenue der Hauptstadt des zweitgrößten Reiches auf der Erde. In der Petrowka kann man beobachten, wie ein winziger Bruchteil der russischen Bevölkerung die ersten Dividenden siebenjähriger Arbeit für den Staat einzukassieren sucht.
Rußland
In der bedeutendsten Straße der bedeutendsten Stadt des zweitgrößten Reiches der Welt gehen die Menschen heute nicht barfuß. Die Geschäfte der Petrowka sind nicht leer. Ihre Lebensmittelläden sind nicht kahl. Ihre Restaurants sind keine Schweineställe. Die Fifth Avenue Moskaus ist sauberer als die Fifth Avenue New Yorks.
Dies macht Moskau heute zur erstaunlichsten Stadt Europas. Denn noch keine Stadt der Welt hat eine solche Veränderung zum Besseren in ihrer wirtschaftlichen Erscheinung durchgemacht wie Moskau in den letzten vier Jahren. Aber auch noch keine Stadt unserer Zeit hat jemals so tief unten angefangen.
Vor vier Jahren war Moskau die entsetzlichste Stadt Europas. Durch die Petrowka, die Tverskaya entlang, auf dem Kuznetzki Most schlurfte die müdeste, hungrigste, am elendsten gekleidete Bevölkerung, die irgendwo an einem Zentralpunkt weißer Menschen auf dieser Erde zu finden war.
Sie schlurften an Ladenfenstern vorüber, die grau von Schmutz waren und keine Waren hatten. Staubbedeckte Leninbüsten und zerschossene rote Fahnen schmückten die Fenster und nahmen die Stelle der Waren ein. An den Ladentüren standen die Menschen manchmal zu Hunderten mit müdem Rücken an, um eventuell ein Meter schlechten Stoffes, einen getrockneten Fisch oder einen Kohlkopf kaufen zu können.
Das war gegen Ende des zweiten Jahres des ersten Fünfjahrplanes. Dieser Plan nahm der Bevölkerung Nahrung, Kleidung und Obdach und legte die Ersparnisse in Maschinen an. Er machte sich buchstäblich daran, »Rußland groß zu hungern«.
Rußland wurde groß in Maschinen. Es brauchte Maschinen, um Maschinen erzeugen zu können. Heute hat es so viel davon, daß es, sollte es notwendig sein, den Industrialisierungsprozeß ohne Hilfe vom Ausland fortsetzen könnte. In diesem Punkt, seinem Hauptzweck, war der erste Fünfjahrplan erfolgreich.
Der Erfolg wurde möglich dadurch, daß der Bevölkerung ihre Ersparnisse auf dem Zwangswege abgenommen wurden. Keine Bevölkerung unter einer Demokratie hätte dies erduldet. Nur die rigoroseste Diktatur konnte es durchsetzen. Und die Leiden waren so groß, daß selbst diese Diktatur, die in ihrer Rationalität und Erbarmungslosigkeit einzig dasteht, begriff, daß der Punkt erreicht war, an dem die Verzweiflung einsetzen mußte.
Heute ist der zweite Fünfjahrplan im Gange. Das Ende des zweiten Jahres des zweiten Fünfjahrplanes ist erreicht. Auch der zweite Fünfjahrplan fordert mehr Selbstaufopferung von der Bevölkerung, als jedes andere Volk ertragen würde, aber der zweite Fünfjahrplan verspricht nun zum erstenmal der Bevölkerung einen Lohn.
Er verspricht dem Verbraucher, die Nahrungsmittelmenge zu verdoppeln, und Kleidung und andere Güter mehr als zu verdoppeln. Dieses Versprechen ist noch sehr weit von der Erfüllung entfernt, aber zu Anfang des dritten Planjahres bietet der Anblick Moskaus und der Moskowiten einen guten Gradmesser für den gemachten Fortschritt.
Vor vier Jahren gaben die Moskowiten einem Beobachter, der sie mit anderen Bevölkerungen vergleichen wollte, kein Problem zu lösen auf. Auf die Frage: »Ist die Bevölkerung Moskaus schlechter gekleidet, als die ärmste Schicht der Bevölkerung Amerikas?« konnte es nur eine einstimmige Antwort geben: »Ja, viel schlechter.«
Heute ist das nicht mehr richtig. Man sehe sich diese Menschen in der Petrowka an. Von fünf Männern haben vier neue Wintermäntel an, die nicht mit Schaffellen, sondern mit anderen Pelzwerk gefüttert sind. Ein Schaffell, den billigsten und auch unbedingt notwendigsten Schutz gegen die russische Kälte, hat natürlich jeder Russe, auch die Bauern nicht ausgenommen.
Auch von fünf Frauen haben vier pelzgefütterte Tuchmäntel an. Die wichtigste Änderung an ihrem Aussehen ist die Kopfbedeckung. Sie tragen nicht mehr die unansehnlichen roten Tücher um den Kopf gebunden, die zur Zeit des ersten Planes in Moskau die Mode waren. Heute haben die meisten Mädchen, auch die ärmsten, Mützen auf, und der Unterschied, den das macht, ist erstaunlich.
Gestern noch – in Jahren gesprochen – war es ein Ding der Unmöglichkeit, in Moskau eine hübsche Russin zu finden. Sie alle sahen in der Uniform der Arbeitstiere traurig aus, waren nicht voneinander zu unterscheiden. Heute stößt man in den Straßen Moskaus auf Beispiele überraschender Frauenschönheit, und der Charme der Russinnen, der in den Büchern Turgeniews und Tolstoys begraben zu sein schien, ist im Rahmen »bürgerlicher Kleidung« wieder an das Tageslicht gekommen.
»Burschui« ist das russische Wort für »Bourgeois«, und »Burschui!« war die verachtungsvollste Schmähung, welche das schlechtgekleidete klassenbewußte russische Proletariat immer wieder gut angezogenen Fremden in den Straßen entgegenschleuderte. Heute kommt so etwas nicht mehr vor.
Heute wird eine Amerikanerin in den Straßen Moskaus nicht von verachtungsvollen, sondern von bewundernden Blicken verfolgt, und der Eifer der russischen Mädchen, den Stil des Westens zu lernen, ist geradezu rührend. Eine Besucherin, die gerade aus Paris eingetroffen war, kam in ihr Hotelzimmer zurück und machte die Entdeckung, daß alle Mädchen auf dem Fußboden lagen und auf einem großen Bogen Papier die Kleider, aus denen die Garderobe der Dame bestand, abzeichneten.
»Wir müssen kultiviert werden«, das ist das Schlagwort des zweiten Planes, und die Bekleidungskultur wird in dem Rußland von heute entschieden bürgerlich. Aus der unglaublichen Anzahl von Büchern, die im Lande herausgebracht werden, sind die interessantesten die beiden mit den Titeln »Männermodelle« und »Frauenmodelle 1934/35«.
Die »Männermodelle« hätten Nikolai Lenin sicherlich nicht nur dazu gebracht, die Stirn zu runzeln. Auf Seite achtundzwanzig der zweiunddreißig Seiten ist ein Modell zu sehen, das eine Verurteilung durch die Tscheka gerechtfertigt hätte. Der darauf abgebildete Herr trägt eine dunkle einreihige Jacke mit Weste, gestreifte graue Hosen, einen schmucken Hut und stützt sich nonchalant auf einen Spazierstock!
Die Mantelmoden haben etwas entschieden Vornehmes. An der Art, wie sich die Sowjet-Herren die Handschuhe über die Finger streifen, eine Zigarette halten oder vor einer Dame den Hut ziehen, ist etwas ausgesprochen Aristokratisches. Die jungen Herren im Tennisdreß könnten aus dem Mittelstand sein, aber der Kavalier, der die weiße Hose und die blaue Marinejacke anhat, kann nur der obersten Schicht angehören.
Für die Damen gibt es dreißig Seiten mit Vormittags-, Nachmittags- und Abendkleidern, Schuhen und Hüten und einem Teil für die Kinder. Ganz in der Nähe der Petrowka liegt eines der größten Warenhäuser Moskaus, und dessen Hauptausstellungsstück ist ein Knabenanzug aus blauem Samt, der eine genaue Kopie des kleinen Lord Fauntleroy darstellt.
Der Kuznetzki Most zeichnet sich durch ein »Atelier« aus, in dem die Kunst der Sowjet-Modekünstler ihren Höhepunkt erreicht. Dort kann man ein Abendkleid für tausend Rubel kaufen und einen Nachmittagsanzug für sechshundert, das entspricht sieben, bzw. vier Monaten Lohn eines Sowjet-Arbeiters.
Wer die acht vergangenen Jahre des Sowjet-Lebens kennt, muß zu dem Urteil kommen, daß die Sowjet-Bevölkerung heute besser gekleidet ist als jemals. Die bestbezahlte Schicht der Bevölkerung in Moskau ist sehr viel besser gekleidet als die ärmste Schicht der Bevölkerung in Amerika. Der durchschnittliche Sowjet-Arbeiter, der 148 Rubel im Monat verdient, ist noch nicht so gut gekleidet wie der durchschnittliche amerikanische Arbeitslose.
Was man der Sowjet-Statistik entnehmen kann, bestätigt dieses Urteil. Was zum Beispiel Fußbekleidung betrifft, so haben die Sowjet-Fabriken 1927 23 Millionen Paar Schuhe erzeugt. Das ist ein Paar Schuhe für jeden Siebenten der Bevölkerung, bzw. jedes siebente Jahr ein Paar Schuhe für alle.
1933 aber gab es ein neues Paar Schuhe für jeden zweiten der Bevölkerung, bzw. jedes zweite Jahr ein neues Paar für alle. Die Produktion betrug in diesem Jahr nahezu 82 Millionen Paar. Das ist natürlich noch immer viel zu wenig, aber es ist das Vierfache des früheren. Im Jahre 1937 werden die Sowjet-Fabriken, wenn der zweite Plan durchgeführt ist, 180 Millionen Paar Schuhe herstellen, mehr als ein Paar alljährlich für jeden.
Wenn man sich die eigene Textilerzeugungsstatistik der Sowjets ansieht, erscheint es einem als ein Wunder, daß die Russen während des ersten Planes überhaupt etwas hatten, womit sie ihre Blößen bedecken konnten, denn wenn auch der Plan eine Erzeugung von 1½ Metern Wollstoff auf den Kopf der Bevölkerung forderte, wurde in Wirklichkeit nur ungefähr ½ Meter auf den Kopf erzeugt. Dieser zweite Plan will in aller Bescheidenheit den Bürgern schließlich die ursprünglich vorgesehenen 1½ Meter liefern.
In diesem Jahr und noch einige Zeit länger werden die Russen mit Kleidern auskommen müssen, die zum größten Teil aus Baumwolle gemacht sind. Als der erste Plan zu Ende ging, gab es etwa 16 Meter Baumwollstoff auf den Kopf im Jahr. Plangemäß hätten es 28 Meter sein sollen, und der zweite Plan verspricht 31 Meter für jeden einzelnen, also doppelt so viel, wie die Leute jetzt haben.
Ein Paar Schuhe in zwei Jahren, ein halbes Meter Wollstoff und sechzehn Meter Baumwollstoff im Jahr: das liefert selbst für einen Russen eine armselige Bekleidung. Die versprochenen eineinhalb Meter Wollstoff, einunddreißig Meter Baumwollstoff und ein Paar Schuhe im Jahr würden den Russen, was die Bekleidung betrifft, keinen Vorsprung vor den Amerikanern geben, aber wenn sie nur so viel bekommen, werden sie das Gefühl haben, gekleidet zu sein wie fürstliche Proletarier.
Die Bekleidung ist in diesem kalten Lande wichtiger als in anderen Gegenden. Aber die erste Stelle unter den Lebensnotwendigkeiten nimmt noch immer die Ernährung ein. Wie essen die Russen im Jahre 1935?
Rußland
Vierzig Mann standen an, um in das Gasthaus zu kommen. Sie warteten darauf, durch Abfall zu einem schmutzigen Tisch zu waten und dort einen ohne eine jede Spur von Fett gekochten Kohlkopf zu essen, eine graue Masse Kleie ohne jede Butter oder Margarine und einen Hering, der so hart getrocknet war, daß man damit einen Nagel in die Wand hätte schlagen können. Dazu wurden große Stücke schwarzen Brotes gegessen. Zum Schluß bekam man noch ein kleines puddingähnliches Gebilde aus geradezu unsagbarem Sirup.
So sah eine Mahlzeit aus, die ich 1930 hier in Moskau aß. Dieses Bild bot sich vor vier Jahren in jedem Gasthaus für Moskowiten. Besseres Essen als das konnte sich außer Ausländern niemand kaufen. So aß damals Moskau.
Heute spielt in demselben Gasthaus eine achtköpfige Kapelle, die mit Zigeunersängern alterniert. Auf der Speisekarte stehen Rind, Hammel- und Schweinefleisch, Salm und Stör, Gemüse und Salate.
Am Tisch neben uns war ein junger Russe – offenbar ein »Stoßbrigade-Arbeiter«, der sein Extraverdienst ausgeben wollte – damit beschäftigt, Essen in sich zu stopfen. Als Sakuska wählte er eine große Portion von Salat aus den Krebsen des Ochotsk-Sees, die ein Gegenstand des Streites zwischen japanischen und sowjet-russischen Fischern sind.
Dann lauschte er Liedern, die der Zigeunerchor sang, und bestellte sich ein Brathuhn. Er erledigte in aller Gemächlichkeit den Vogel und bestellte einen Schmorbraten.
Während er darauf wartete, verlangte er noch rasch eine Portion Salm und spülte sie mit Hilfe seiner zweiten Flasche Wein hinunter. Er half seiner Verdauung nach, indem er aufstand und dem tanzenden Zigeunermädchen den Takt schlug, so daß er, als sein Braten kam, dafür ganz bereit war.
Sowie er mit dem Braten fertig war, bestellte er einen Obstsalat, putzte den weg und machte sich dann an etliche schwere Kuchen. Als wir gingen, aß er noch immer; er schaukelte über seinem Teller vorwärts und rückwärts und taktierte vergnügt mit seiner Gabel zur Musik.
Dieser junge Arbeiter war offensichtlich keine typische Erscheinung. Er mochte vielleicht eine schöne Prämie bei der Auslosung seiner Regierungsanleihe gewonnen haben. Gewöhnliche Arbeiter mit ihrem Durchschnittseinkommen von fünfunddreißig Rubeln in der Woche hätten seine Rechnung entschieden nicht bezahlen können.
Auch dieses Restaurant steht heute über dem Durchschnitt, aber alle Moskauer Restaurants haben ein Dampfbad durchgemacht, sich die Haare schneiden und maniküren lassen. Sie sind sauberer, als sie jemals unter dem Sowjet-Regime waren, und führen ausnahmslos einen reichen Vorrat der verschiedensten Nahrungsmittel.
Heute kann ein Fremder, der nicht geradezu überempfindlich ist, in jedes Moskauer Restaurant gehen und dort essen, ohne daß ihm übel wird. Vor vier Jahren war das keineswegs möglich.
Es ist außerordentlich schwer, klar zu machen, wie sensationell die Beobachtung wirkt, daß es in Moskau Essen, viel Essen und verhältnismäßig gutes Essen gibt. Für Amerikaner sind Essen, Restaurants und Kaffeehäuser mehr oder minder etwas Selbstverständliches.
Man stelle sich jedoch einen Polarforscher vor, der plötzlich auf eine in den arktischen Wüsteneien wachsende Palme stößt. Seine Empfindungen könnten denen gleichen, die ich hatte, als ich eine Tür in der Straße des Künstlertheaters öffnete und ein Kaffeehaus vor mir sah.
Es hätte in jeder westeuropäischen Stadt sein können. Die Tische waren blank geputzt, die Stühle in modernen geraden Reihen aufgestellt, die Gäste gut angezogen. Niemand steckte die Nase in seinen Tee. Das Radio spielte angenehm leise. Die Kellnerinnen hatten Seidenblusen und nette blaue Röcke an und waren ausnahmslos hübsch.
Es wurden acht Arten Kaffee geboten, ohne alles, mit Milch, mit Schlagsahne, Warschauer, Wiener, türkischer, mit Rum oder mit Kognak; Tee, ohne etwas dazu oder mit Jam; Kakao und Schokolade; acht verschiedene alkohollose Getränke; sechserlei Gebäck; zwei Arten von Gefrorenem; sieben verschiedene belegte Brote; Eier mit Schinken; Käse und Würstchen.
Die Preise gingen von fünfzig Kopeken für ein Glas Tee bis zu fünf Rubel fünfzig für Schinken und Eier. Das heißt, eine Portion Schinken und Eier hätte einen Arbeiter fast einen ganzen Tageslohn gekostet. Arbeiter konnten hier nicht essen, aber es gab eine ganze Menge Sowjet-Bürger, die es sich leisten konnten.
So gute Cafés sind in Moskau nicht die Regel, aber die Zahl der weniger eleganten Lokale ist sehr groß, und es ist zum erstenmal seit der Inauguration des Planes, daß es den Russen möglich gemacht ist, sich Üppigkeiten, wie sie diese Speisekarte bietet, in allem Behagen zu leisten. An vielen Ecken stehen Buden, in denen Bier, belegte Brote und Kuchen verkauft werden. Vor jeder solchen Bude hätten vor vier Jahren lange Reihen angestanden.
Viel wichtiger für die Ernährung Moskaus ist die Tatsache, daß annähernd drei Millionen Portionen täglich in öffentlichen Speiselokalen von öffentlichen Zentralküchen geliefert werden. Draußen an der Leningrader Chaussee liegt eine von Moskaus fünfundzwanzig »Fabrikküchen«. Sie beliefert täglich 30 000 Arbeiter und kocht überdies 50 000 warme Frühstücke für Schulkinder.
Wir gingen durch alle vier Stockwerke und kamen an gewaltigen Kesseln mit Suppe, Bergen von Fisch und Unmengen von Fleisch vorbei. Die Kuchenbäckerei roch höchst appetitanregend. Die Entleerung eines Suppenkessels in einem wahren Niagara siedender Flüssigkeit war imposant. Noch imposanter war die Tatsache, daß die Küche, die täglich ununterbrochen vierundzwanzig Stunden arbeitet, dennoch so sauber war, wie man es nur verlangen kann. Den ganzen Tag und die ganze Nacht ist eine Gruppe von Frauen damit beschäftigt, die Fußböden zu scheuern.
Aber all dies betrifft nur das zubereitete Essen. Wie steht es mit den Rohstoffen der Ernährung, den Nahrungsmitteln, die die Hausfrau kaufen muß? Dafür gibt es vier Quellen in Moskau. Über sie wird später gesprochen werden. Im Augenblick ist das Lebensmittelgeschäft, das am instruktivsten für den Beobachter ist, »Gastronom Nummer eins« in der Gorkistraße, der ehemaligen Twerskaya.
Unter dem Zaren hieß dieser Laden »Jelisaieff«, und von hier ließen die Großfürsten und die millionenschweren Industriellen ihre Tische mit einer Menge und Vielfalt von Lebensmitteln beliefern, die in der ganzen Welt nicht ihresgleichen hatten.
Wenn die große Kuppel von Jelisaieff sprechen könnte, wäre sie imstande, aus der russischen Geschichte zu erzählen. In den Tagen des militärischen Kommunismus blickte sie auf krasses Elend hinunter. Dann beherbergte sie von 1923 bis Ende 1929, in den Zeiten der NEP, stets wachsende Mengen von Lebensmitteln, bis die Zeit kam, in der nahezu ebensoviel da war, wie vor dem Krieg.
Diese Fülle schrumpfte rasch zusammen, als der Fünfjahrplan in Erscheinung trat, als die Bauern zu streiken begannen und die Regierung alles auf Rationierungskarten setzte. Bald war Jelisaieff für alle außer Diplomaten und einige andere Ausländer, die in der Stadt wohnten, geschlossen. Nirgends sonst in Moskau gab es Fleisch, Eier oder Butter, und auch bei Jelisaieff war herzlich wenig davon da. Die Diplomaten schickten ihre Mädchen zur Hintertür und ließen sie die Vorräte heimlich holen, um die hungrige Menschenmenge, die an der Vorderseite auf und ab ging, nicht aufzureizen.
Heute kann wieder jedermann bei Jelisaieff kaufen, und die Auswahl ist überaus groß. In den Schaufenstern schimmern Stapel von Äpfeln und Birnen und Mandarinen. In der Fleischabteilung gibt es Rind und Hammel und Schwein.
Haselhühner und Rebhühner, Hasen und Enten hängen in der Wildabteilung. Ein großer Tank im Hintergrund enthält hundert oder mehr lebendige Fische und leider auch eine beträchtliche Anzahl toter. Gleich daneben liegen auf den Ladentischen gefrorener und gesalzener Lachs, Hausen und Stör, und hinter den Theken stehen Fässer mit Heringen.
Viererlei Kaviar, siebzehn Arten von Würsten, sechserlei Käse, vier Sorten Butter, Margarine, Speck, Tee, Kaffee, Konfekt und Kuchen, Obst und Gemüse werden unter der großen Kuppel verkauft. In der Brotabteilung wetteifern französische Weißbrote und große Laibe braunen und schwarzen Brotes mit Pasteten um die Gunst einer Menge, die unaufhörlich kauft, stößt und glotzt.
Jeder kann heute bei Jelisaieff kaufen. Jeder kann in den vielen Lebensmittelgeschäften ganz Moskaus kaufen. Aber nur die können es tun, die imstande sind, die geforderten Preise zu bezahlen. Auf was läuft diese ganze Information über die in Moskau zu sehenden Lebensmittel hinaus, wenn man sich überlegt, was der Durchschnittsmensch unter der Diktatur des Proletariats zu essen bekommt?
Wie sind die Preise, und wie viele Moskowiten können sie bezahlen?
Russland
Nach siebzehn Jahren der Diktatur des Proletariats muß der Sowjet-Arbeiter, für den die Sowjetregierung gegründet wurde und für den die Regierung alles tut, was in ihren Kräften steht, mehr als sechzehn Stunden arbeiten, um dieselbe Menge Lebensmittel zu bekommen, für deren Erlangung der amerikanische Arbeiter höchstens vier Stunden arbeiten muß.
Der Sowjet-Arbeiter muß – so zu seinen Gunsten gerechnet, daß jeder Zweifel ausgeschlossen ist – mehr als viermal so lang arbeiten wie der amerikanische Arbeiter, um zur selben Menge Essen zu kommen.
Dieser Vergleich zwischen der Entlohnung des Sowjet-Arbeiters und der des Amerikaners und zwischen der Kaufkraft der beiden bezieht sich lediglich auf die Lebensmittel. Die Kosten für Miete, für Kleidung und andere Notwendigkeiten sind eine Sache für sich, und was zum Beispiel die absoluten Kosten der Miete betrifft, zahlt der Sowjet-Arbeiter bedeutend weniger als der Amerikaner.
Auch die Sozialversicherung und andere Vorteile, die nichts mit dem Budget zu tun haben, spielen eine Rolle für den Sowjet-Arbeiter, und all dies wird berücksichtigt werden. Für den Augenblick aber ist es eine wichtige Tatsache, daß er, um gerade so viel zu essen, daß er einigermaßen ernährt ist, mehr als viermal so viel Arbeit liefern muß wie sein amerikanischer Kollege.
Diese Schätzung, die sich auf die tatsächlichen in den Moskauer Lebensmittelgeschäften für Arbeiter ausgeschriebenen Preise stützt, auf offizielle Lohnstatistiken der Regierung und auf bei vielen Arbeitern eingezogene Erkundigungen, ist überdies vorsichtshalber so angestellt, daß sie mehr zugunsten als zuungunsten des Sowjet-Arbeiters ungenau ist.
Schätzungen dieser Art für die Sowjetunion sind von Nationalökonomen vermieden worden, weil die vielfältigen Wirtschaftssysteme in der Sowjetunion es so schwierig machen, einen statistischen Durchschnitt festzustellen. Das internationale Arbeitsamt hat für dreiundzwanzig Länder statistisches Material gesammelt, das die Kosten eines typischen Lebensmittelkorbes und das Lohnniveau in jedem dieser Länder zeigt, aber es ist ihm nicht gelungen, dabei auch die Sowjetunion einzubeziehen. Einen statistischen Preisdurchschnitt für die Sowjetunion festzustellen, ist in der Tat unmöglich, aber man kann sehr wohl auf den Durchschnitt verzichten und untersuchen, wie die Lage des Sowjet-Arbeiters aussieht, wenn man berücksichtigt, wie viele Arbeitsstunden er unter den erdenklich günstigsten Umständen an seine Ernährung zu wenden hat. Das ist die Methode, die bei dieser Untersuchung befolgt wurde.
Die Lage hinsichtlich der Lebensmittelpreise in der Sowjetunion ist die, daß es, ganz primitiv gesprochen, fünf Bezugsmöglichkeiten für Lebensmittel gibt. Die erste bilden die sogenannten »Torgsin«-Läden, in denen reichliche Vorräte von allem gegen ausländische Valuta oder Gold oder Silber gekauft werden können. Diese Läden, vor einigen Jahren gegründet zu dem Zwecke, den letzten geringen Besitz an verstecktem Schmuck und versteckten Devisen aus der Bevölkerung herauszulocken und auch so viel wie möglich von ansässigen und vorübergehend anwesenden Ausländern herauszuholen, haben so ziemlich ihren Dienst getan und werden früher oder später abgeschafft werden. Jedenfalls spielen sie keine Rolle im Leben des Sowjet-Arbeiters.
Die zweite Quelle sind die Fabrikküchen, welche die Arbeiter mit warmen Mahlzeiten beliefern. Über sie wird später noch gesprochen werden.
An dritter Stelle kommen die sogenannten Handelsläden, von der Regierung oder von Kooperativen geführt, in denen man für Papierrubel kaufen kann. Diese Läden gleichen ganz unseren Lebensmittelgeschäften, nur unterstehen sie der Regierung und haben Preise, die gemäß dem Plan festgesetzt sind.
Die vierte Möglichkeit bilden die Bazare oder öffentlichen Märkte, auf welche die Bauern von den Kollektivgütern kommen, um zu verkaufen, was ihnen noch geblieben ist, nachdem sie ihre Steuern in Naturalien an die Regierung abgeführt haben. Die Preise auf diesen Bazaren schließen sich eng an die in den Handelsläden an.
Das Fünfte und noch immer Wichtigste für den Sowjet-Arbeiter sind die sogenannten »geschlossenen Kooperativen«, die nur in beschränkten Mengen verkaufen, und zwar an die in den Fabriken oder anderen Unternehmen, von denen die »geschlossenen Kooperativen« betrieben werden, beschäftigten Arbeiter und ihre Familien.
Die Vorzugspreise, die den Arbeitern in den geschlossenen Kooperativen gewährt werden, stellen eine Art Bezahlung in Naturalien dar, deren Zweck es ist, dem Papierrubel der Arbeiter eine höhere Kaufkraft zu geben, als der der übrigen Bevölkerung hat.
Die Unterschiede zwischen den Vorräten an Lebensmitteln und anderen Waren in den einzelnen Kooperativen sind sehr groß. Die besten sind die für die rote Armee und für die Angestellten des Kommissariats des Inneren, des Polizeiministeriums, das bis vor kurzem den Namen G. P. U. führte, und für die höheren Schichten der Regierungsangestellten. Das Endziel der Regierung ist es, dieses vielfältige System zum Verschwinden zu bringen und alle Nahrungsmittel und Waren im Sowjetreich durch die Handelsläden mit gleichen Preisen für alle Bürger zu verteilen.
Ein Schritt in dieser Richtung ist vor kurzem damit getan worden, daß die Rationierungskarten für Brot und Mehl abgeschafft und feste Preise für diese Waren in allen Läden festgesetzt wurden.
Dennoch ist es noch immer so, daß dem Sowjet-Arbeiter der größte Teil der Lebensmittel, die er braucht, in seiner geschlossenen Kooperative zu Preisen verkauft wird, die etwa ein Drittel der Preise in den Handelsläden betragen. Das heißt, sie werden ihm verkauft, soweit sie da sind. In Wirklichkeit sieht es so aus, daß in den geschlossenen Kooperativen oft Mangel an den wichtigsten Nahrungsmitteln eintritt und die Arbeiter gezwungen sind, ihre Vorräte zu ergänzen, indem sie zu durchschnittlich dreimal so hohen Preisen in den Handelsläden einkaufen.
Aber betrachten wir den denkbar günstigsten Fall und nehmen wir an, wozu es in Wirklichkeit nie kommt, daß nämlich unsere geschlossene Kooperative alle Lebensmittel habe, die wir brauchen, und daß wir so viel kaufen können, wie wir wollen. Sollte sich irgendwo eine Lücke zeigen, so werden wir sie mit anderen Nahrungsmitteln zu einem niedrigeren Preise ausfüllen.
So ist bei der Aufstellung der folgenden Tabelle vorgegangen worden. Die fünfzehn aufgeführten Lebensmittel und die Menge jedes einzelnen in Kilogramm stellen den typischen Lebensmittelkorb dar, dessen sich das internationale Arbeitsamt bei der Zusammenstellung der Preise in dreiundzwanzig Ländern bedient hat.
Ein Korb repräsentiert die Ernährung eines erwachsenen Arbeiters für eine Woche.
Um einen Vergleich zu ermöglichen, sind drei Kategorien von Preisen genannt, die zeigen, was der Korb in Torgsin, in Goldrubeln, was er in den Handelsläden und was er in den »geschlossenen Kooperativen« kosten würde.
Es werden die Preise für ein Kilogramm in Rubel und Kopeken genannt, und dann die sich ergebenden Kosten für die aufgeführte Menge.
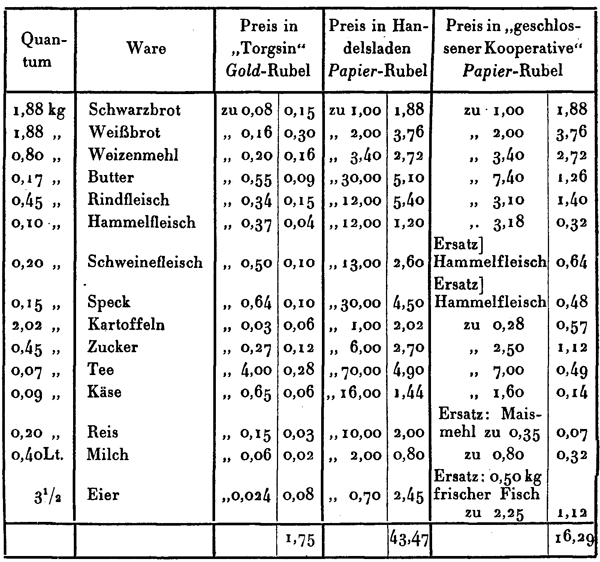
Alle diese Preise wurden an Ort und Stelle festgestellt, die Torgsinpreise im ersten Geschäft in der Petrowka, die für die Handelsläden in Gastronom Nummer eins in der Gorkistraße, und die für die geschlossenen Kooperativen im Geschäft der großen, nach Kaganovitch genannten Kugellagerfabrik am Rande Moskaus. Was die Kugellagerfabrik zu bieten hat, ist von Bedeutung, weil sie der Stolz der Sowjetunion, und ihre Kooperative die beste mit den niedrigsten Preisen ist.
Sie war tatsächlich so gut versehen, daß es nur dreimal notwendig wurde, einen Ersatz anzunehmen, Hammelfleisch für Schweinefleisch und Speck, und Maismehl für Reis. Im übrigen hatte diese geschlossene Kooperative alles, was die Liste des internationalen Arbeitsamtes enthält.
Wie man der Tabelle entnehmen kann, müßte der Arbeiter der Kugellagerfabrik 16,29 Rubel für seinen Lebensmittelkorb bezahlen. Die Durchschnittsbezahlung der Industriearbeiter war, entsprechend der letzten Gewerkschaftsstatistik, in der ganzen Sowjetunion 148,47 Rubel im Monat, aber man füge noch 10 Prozent hinzu für die Preiserhöhung, die die neueingeführte Verteilung durch die Handelsläden mit sich brachte, und wir kommen zu einem Durchschnittslohn von 053,31 Rubel. Man füge weitere 10 Prozent hinzu auf Grund der Privilegien, die die Kugellagerfabrik genießt, und wir kommen auf einen Durchschnittslohn von 168,64 Rubel. Sagen wir 170 Rubel im Monat, 2040 Rubel im Jahr.
Die durchschnittliche Arbeitszeit in der Sowjetunion ist sieben Stunden im Tag. Aber infolge des herrschenden Systems der Sechstagewoche macht die Anzahl der Arbeitsstunden im Jahr rund 2100 aus. Die Durchschnittsbezahlung ist also etwas weniger als ein Rubel in der Stunde. Nehmen wir an, es sei ein Rubel.
Der Arbeiter der Kugellagerfabrik müßte also, wenn er alle seine Lebensmittelbedürfnisse zu den niedrigsten Preisen aus seiner geschlossenen Kooperative bezöge, über sechzehn Stunden arbeiten, um seinen Wochenvorrat zusammen zu bekommen. Das heißt, er würde dafür fast zweieinhalb Tage arbeiten.
Der amerikanische gelernte Arbeiter bekommt 1 Dollar für die Stunde. Der Durchschnitt dürfte schwerlich unter 50 Cent für die Stunde liegen. Die Kosten desselben Korbes sind in New York 1,95 Dollar. Unter den schlimmsten Umständen würde ein Amerikaner auf einem Posten, der dem des Durchschnittsarbeiters in der Kugellagerfabrik ähnlich ist, vier Stunden arbeiten müssen, um das Geld für den Korb zusammen zu bekommen, während der Sowjet-Arbeiter mehr als sechzehn Stunden dafür arbeiten muß.
Das ist keine Betrachtung über die Bemühungen der Sowjetbehörden, die Lage ihrer Arbeiter zu bessern. Es ist ein Tatsachenbild von dem Verhältnis zwischen der wirklichen Arbeitszeit, die der amerikanische Arbeiter, und der, die der Sowjet-Arbeiter an die Beschaffung seiner Ernährung wenden muß.
Wie deckt sich nun dieses statistische Bild mit Einzelfällen? Wie steht es um Miete, Unterkunft, allgemeine Lebensbedingungen? Welche Rolle spielen die Fabrikküchen?
Russland
In Rußland klopft man einfach an und geht hinein, und immer wird man mit einem Lächeln empfangen. Es sind fast ausnahmslos frisch vom Lande Zugezogene, und in einem Bauernhaus klopft man nicht einmal an. Man geht einfach hinein.
Im Zimmer saß eine zarte junge Frau mit einem zwei Monate alten Kind in den Armen, die sich bemühte, das Kind in den Schlaf zu schaukeln und gleichzeitig einen Teller dünner Suppe zu essen; aber als die Besucher hereinkamen, hörte sie mit beidem auf.
Das Zimmer lag in den Unterkünften der Kugellagerfabrik, eines der wichtigsten Werke der Sowjetunion. Ein Bett stand da, ein Tisch, eine Holztruhe, zwei Stühle, ein Stalinbild an der Wand, eine klapperige Zinnuhr, und das war auch alles. Draußen lag tiefer Schnee. Drinnen sorgte die Zentralheizung für behagliche Wärme und brannte elektrisches Licht.
»Seit fünf Tagen haben wir kein Fleisch gegessen«, erklärte das Mädchen ein wenig scheu, während sie den Säugling auf das Bett legte. »Wir sind pleite. Es kostet eben so viel, wenn man ein kleines Kind hat.«
Ihr Mann war Mechaniker. Er verdiente 250 Rubel, die Bezahlung eines gelernten Arbeiters, 100 Rubel mehr im Monat als die Durchschnittsbezahlung der Industrie-Arbeiter in der Sowjetunion. Trotzdem war diese Familie ein ziemlich typisches Beispiel, denn nach den Statistiken hat jeder Arbeiter 1,7 Menschen zu erhalten, so daß dieser Mann mit einer Frau, die nicht arbeitete, und einem kleinen Kind mit seinem Einkommen von 250 Rubel nur wenig besser gestellt war als der Arbeiter des statistischen Durchschnitts.
»Was haben Sie heute zum Essen gehabt?«
Die Russen sind das am wenigsten befangene, natürlichste Volk der Erde, und man kann sie alles fragen. Das Essen ist außerdem in den letzten siebzehn Jahren einer der beliebtesten Gesprächsgegenstände in der Sowjetunion gewesen, und eine Erkundigung danach ist ganz in Ordnung.
»Ja«, sagte sie mit der Haltung eines Menschen, der jeden Tag mit ausländischen Korrespondenten zu sprechen hat, obgleich wir sicherlich die ersten waren, die sie in ihrem Leben kennen lernte, »ja, wissen Sie, wir essen alle Mahlzeiten zu Hause, weil es meinem Mann schmeckt, wie ich koche.
Er ißt nur sehr selten einmal im Speiseraum der Fabrik. Also, zum Frühstück hatten wir Tee und Brot. Mittags haben wir Nudelsuppe mit Kascha gegessen und etwas Obstsaft. Am Abend werden wir weiße Pilze essen.«
Für ihr Zimmer hatten sie 25 Rubel im Monat zu zahlen, das waren die üblichen 10 Prozent des Einkommens. Sie kochte in einer Gemeinschaftsküche mit vier anderen Familien zusammen auf einem Primus-Apparat. Die Küche war ursprünglich für eine Familie gedacht. Ihre obligatorische Regierungsanleihe, eine Art Besteuerung, kostete weitere 25 Rubel. Für Brot verbrauchten sie 45 Rubel im Monat und für die Milch, die das Kind bekam, gleichfalls 45 Rubel. Für Zucker gaben sie 6 Rubel aus und für Kandis, der als Ersatz für Zucker diente, weitere 5 Rubel. Die monatlichen Kosten für Petroleum betrugen 15 Rubel.
Es blieben ihnen also 84 Rubel für alle Nahrungsmittel außer Brot, für Kleidung, Beförderungsmittel, Vergnügungen und alles übrige. Wie sie dieses Geld ausgaben, konnte sie nicht mit Sicherheit sagen, aber sie zweifelte nicht daran, daß der größte Teil davon für Essen verbraucht wurde und daß sie nicht alle die Nahrungsmittel bekamen, die sie gern gehabt hätten.
Aber sie war aus drei Gründen glücklich: erstens weil sie vom Lande weggekommen war, zweitens weil sie ein kleines Kind hatte, und drittens weil es ihr in diesem Monat gelungen war, 32 Kilogramm Kartoffeln, das Kilo zu 30 Kopeken, zu kaufen. Wir erfuhren, daß das Haupternährungsmittel der Familie Brot und Kartoffeln waren. Wir konnten jedoch nicht ihre Freude darüber begreifen, daß sie nicht mehr auf dem Lande war, und verstanden auch das mit dem Kind nicht ganz.
»Warum freuen Sie sich so darüber, daß Sie vom Land weg sind?«
»Weil wir hier so viel besser leben«, antwortete sie, sich zufrieden in dem kärglichen kleinen Zimmer umsehend.
»Und das Kleine. Es kostet Sie so viel. Wollten Sie es haben?«
»Was? Was meinen Sie denn, warum ich es habe? Natürlich wollte ich es haben«, und sie lächelte über das ganze Gesicht, hob den Säugling hoch und küßte ihn.
Das wirft einiges Licht auf einen der Gründe, weshalb die Sowjetunion mit ihrer Bevölkerung von rund 168 000 000 sich um 3 000 000 jährlich vermehrt, also um mehr als die 360 000 000 aller übrigen Bevölkerungen Europas zusammen. Die Sowjetbehörden behaupten, der wahre Grund sei das Fehlen der Arbeitslosigkeit in der Sowjetunion. Jedermann hat Arbeit, und jedermann, wie wenig er auch verdienen und wie armselig er leben mag, hat das Gefühl, daß er immer irgendein Einkommen haben wird. Wenigstens haben die Frauen dieses Gefühl.
An Beweisen dafür fehlte es in der Kugellagerfabrik nicht. Die Beweise gerieten einem unter die Füße, watschelten aus jedem Zimmer heraus, füllten die Korridore und schrien in den Höfen.
Die Mieten sind für die Arbeiter in der Sowjetunion billig. Aber was bekommen sie dafür? Die Kugellagerfabrik, eines der schönsten Werke, errichtet, so schnell sie nur kann, immer mehr Häuser, aber ihre Arbeiter sind heute so untergebracht, daß eine Familie in einem Zimmer, vier Familien in einer Wohnung hausen.
Drei bis vier Menschen leben, essen, schlafen und verrichten alles, was das Familienleben mit sich bringt, in einem einzigen Zimmer. Zu zwölf und sechzehn drängen sie sich in einer Wohnung, die nach den Absichten der Urheber des Fünfjahrplanes von einer einzigen aus Mann, Frau und Kind bestehenden Familie bewohnt sein sollte.
Hier ist zum Beispiel ein Zimmer. Darin leben eine alte Frau, zwei noch junge Kinder und ein Arbeiter mit seiner Frau, zusammen fünf Menschen. Wie sie schlafen, ist ein Rätsel. Es sind nur zwei Betten zu sehen.
Die alte Frau forderte uns auf, uns zu setzen, und begann auf ein Wort hin eine Diskussion über die Kosten des Haushalts, die in der Erklärung gipfelte, daß sie 15 Rubel im Tag auf Essen auszugeben hätten. Aber ihre Arithmetik war wohl etwas schwach, denn das Gesamteinkommen der Familie, zu der drei Arbeiter gehörten und noch ein sechster, der auswärts schlief, betrug 500 Rubel im Monat, und wenn ihre Schätzung von 450 Rubel für Essen gestimmt hätte, wäre für alles andere so gut wie nichts übrig geblieben. Wir gingen treppauf und treppab und plauderten mit den Nachbarn, an der Tür stets von mindestens vier Menschen begrüßt, die die vier Familien der Wohnung repräsentierten, und stets herzlichst dazu aufgefordert, ein wenig dazubleiben und über den Haushaltsetat zu sprechen. Nur wenige von den Frauen konnten besser rechnen als die alte Frau mit ihren fünfzehn Rubel im Tag.
Aber drüben in der Frezerfabrik, einem Werk, auf das die Sowjetunion gleichfalls stolz ist, weit draußen am anderen Ende Moskaus stießen wir auf eine exakt buchführende Hausfrau.
Die ganze Familie war zu Hause, in ihrem Zimmer in einer Unterkunft, die ganz denen der Kugellagerfabrik glich. Der Mann lag da und schlief. Er machte Nachtschicht. Die junge Frau, die Hosen und Filzstiefel anhatte, bereitete eine Mahlzeit. Das Kind lag in seiner Wiege.
»Nein, wir kriegen nicht genug zu essen«, erklärte die Frau. »Na ja, genug kriegen wir, aber auch nur das Allernotwendigste, und es bleibt nichts übrig, wovon wir für das Kind etwas zum Spielen kaufen könnten.«
Der Mann drehte sich herum, sagte guten Tag und starrte uns an. Sein Bett und das Bett seiner Frau, eine Wiege, eine Holztruhe, ein Tisch und zwei Stühle bildeten das gesamte Mobiliar dieses Schlafzimmers, Wohnzimmers, Eßzimmers, Salons, Küche und Badezimmers – genau dieselbe Einrichtung wie die drüben in der Kugellagerfabrik. Hier hingen jedoch zwei Bilder an der Wand, eines von Stalin und eines von Lenin, und außerdem war eine alte Nähmaschine da, die sie von der Mutter der Frau geerbt hatten.
Konnte es sein, daß die schlechten Verhältnisse der Familie darauf zurückzuführen waren, daß das Familienoberhaupt vielleicht nicht ganz systemgetreu war?
»Sind Sie Parteimitglied?« fragten wir.
»Ja«, antwortete er, und zwar voll Stolz, »und außerdem bin ich ein Stoßbrigade-Arbeiter. Ich verdiene 250 Rubel im Monat.«
Es war deutlich zu sehen, daß die Protektionswirtschaft, die angeblich allen Mitgliedern der kommunistischen Partei etwas zugute kommen läßt, nicht immer die untersten Schichten erreicht.
Diese Familie eines kommunistischen Arbeiters verbraucht nach den Angaben seiner Frau, der er ab und zu bestätigende Blicke zuwirft, ihr Geld folgendermaßen. Die Zahlen bedeuten immer Rubel.
Miete, einschließlich Beheizung, elektrischer Beleuchtung, Wasser und Rundfunk 20. Das ist eine kleine Vergünstigung, denn ein Nichtparteimitglied müßte 25 zahlen. Petroleum 15; Brot 45; Fleisch 15. Das bedeutete neun Pfund Fleisch im Monat für die Familie im Hause. Kartoffeln 9; Karotten, rote Rüben und andere Wurzelgemüse 10; Zucker 5,70; Kandiszucker 8; 700 Gramm Butter 7; Tee 0,70; Heringe 3,75 und frische Fische 2,25. Eine Mahlzeit des Tages nahm der Mann im Speiseraum der Fabrik ein, wofür er im Monat durchschnittlich 25 Rubel zu zahlen hatte. Seine Regierungsanleihe kostete ihn 14 Rubel.
All dies macht zusammen 180 Rubel aus, der Familie blieben also 70 Rubel für alles, was man außer Essen und Wohnung zum Leben braucht. »Ist das nicht genug?« fragten wir.
»Nein, es ist nicht genug«, antwortete die Frau in festem Ton. »Wir haben nicht genug Milch für das Kind und keine Eier und nichts für sein Spielzeug, und so gut wie nichts für unsere Kleider. Sowie das Kind etwas größer ist, werde ich wieder auf Arbeit gehen und Geld dazu verdienen, damit wir besser leben können.«
»Würden Sie arbeiten, wenn Ihr Mann, sagen wir, vierhundert Rubel im Monat verdiente?«
»Nein, dann nicht.«
Sie waren beide vom Land gekommen, er 1931, sie 1932. »Also, sind Sie hier zufriedener als dort, wo Sie hergekommen sind? Würden Sie gern auf das Land zurückgehen?«
»Niemals«, riefen beide. »Sehen Sie doch«, rief er aus, »sehen Sie sich doch die Kultur hier an. Wir haben ein gutes Zimmer und elektrisches Licht und Heizung und ein Radio.«
»Ja«, warf die Frau ein, »und die Frauen müssen hier nicht so schwer arbeiten. Am liebsten würde ich ja nur die Wirtschaft führen, aber in der Fabrik arbeite ich immer noch viel lieber als auf dem Land.«
»Und es ist sauberer hier«, sagte der Mann. »Ja, es ist sauberer«, wiederholte die Frau.
Abendländischen Augen erschien ihr Zimmer traurig, öde und armselig. Ihre Ernährung war der Menge nach kärglich und der Qualität nach ziemlich minderwertig. Ihrem Leben schien alles zu fehlen, woraus man Freude schöpfen kann. Dennoch waren sie glücklich, und die Menschen, die die Sowjetregierung zufriedenstellen muß, sind russische Arbeiter.
Diese Familien sind genannt für eine ganze Reihe ähnlicher, die wir besucht haben. Sie schienen uns am typischsten zu sein, aber es wird nicht behauptet, daß sie wirklich typisch für alle Sowjet-Arbeiter seien, denn dieses Land hat, wie der große Jefferson bemerkte, riesige Ausmaße, und es gibt viel zu viele Unterschiede des Lebensstandards, als daß man von einigen wenigen Beispielen aus generalisieren könnte. Es wird jedoch behauptet, daß diese Familien einigermaßen typisch sind für die Arbeiter in den besten Fabriken Moskaus.
Die Leute, die uns in der Kugellagerfabrik und in der Frezerfabrik empfangen hatten, waren vor allem zufrieden und glücklich, daß sie etwas Schlimmerem entronnen waren. Was ist dieses Etwas? Wie ist das Leben draußen auf dem Lande?
Russland
Sie stehen vor Tageslicht auf und arbeiten bis nach Einbruch der Dunkelheit, und der reichste von ihnen verdient ungefähr acht Cent im Tag über sein Brot und seine Kartoffeln hinaus. Das sind die russischen Bauern, und deshalb will der russische Stadtarbeiter nicht auf das Land zurückkehren.
Das ist einer der Hauptgründe dafür, daß die russischen Proletarier, die meistens frisch vom Lande zugezogen sind, sich in Verhältnissen zufrieden dünken, die für einen amerikanischen Arbeiter unerträglich wären. Man braucht nur die Unterkunft, die Ernährung und das Leben des russischen Bauern mit denen des Arbeiters zu vergleichen, um einzusehen, daß die acht Millionen Bauern, die sich in den letzten vier Jahren der Industrie zugewendet haben, auf ein Niveau aufgerückt sind, das vielleicht Abendländern als elend erscheinen mag, für sie aber Luxus bedeutet.
Wir fuhren in einem Fordwagen zum Kollektivgut Frunze hinaus. Das Gut Frunze liegt fünf Meilen von der Eisenbahn ab, fünfunddreißig Meilen westlich von Iwanowo. Die Straßen waren eingefrorene Dreckberge. Der Wagen stellte sich auf die Nase, balancierte auf den Hinterbeinen, sprang hoch und sauste wieder hinab.
Wir kamen an vier Dörfern vorbei und nahmen unseren Weg durch Hinterhöfe, um nicht in Abgründe zwischen Hügeln aus gefrorenem Schlamm zu stürzen, wir umfuhren Hindernisse aus Bäumen, bewegten uns quer über gepflügte Äcker und sprangen über Gräben. Der Ford hielt alles aus und wollte noch mehr davon haben. Es war ein Sowjetford.
Vor vier Jahren besuchte ich die Chassisfabrik der Sowjetfordwerke in Nischni-Nowgorod, das jetzt Gorki heißt. Alle Welt sagte, sie würden nie mit den Gebäuden fertig werden. Als die Gebäude fertig waren, sagte alle Welt, sie könnten nie produzieren. Als die ersten Wagen herauskamen, sagte alle Welt, sie würden nicht fahren. Heute befahren mehr als 100 000 Sowjetautomobile das straßenlose flache Land, genau 24 000 000 weniger, als der amerikanische Autopark hat, aber für Rußland ist dieser Sprung vorwärts ebenso groß wie der Unterschied zwischen dem Lebensstandard auf dem Lande und dem in der Fabrik.
Dieser Unterschied ist für einen Amerikaner schwer zu fassen, weil das ganze Niveau des russischen Lebens noch immer so niedrig ist, daß wir nichts aus eigener Erfahrung kennen, womit es verglichen werden könnte. Jedes der Dörfer, durch die wir kamen, bestand aus vierzig bis fünfzig Häusern, nein, nicht Häusern, Blockhütten, zum größten Teil mit Strohdächern, zum größten Teil mit eingesackten Wänden, ausnahmslos schief, wie betrunken dastehend.
Sie lagen in der Winterdämmerung da wie armselige Gräber auf einem Friedhof, der nicht gepflegt wird. Nicht ein Licht schimmerte auf, nicht ein Gesicht zeigte sich. Zwischen den Häusern waren große Schlammengen in phantastischen Wagengeleisen gefroren.
Die amerikanischen Farmer mögen meinen, daß sie gelitten haben. Sie mögen ihr Schicksal beklagen. Aber das ärmste Haus des ärmsten Farmpächters in Amerika wäre, verglichen mit diesen bejammernswerten Behausungen, noch ein Palast.
Es gibt 25 000 000 Bauernhäuser in der Sowjetunion. Man stelle sich vor, daß 25 000 000 dieser elenden Katen eine Bevölkerung beherbergen, die so groß ist wie die der Vereinigten Staaten.
Das ist Rußland. Oder vielmehr, das war Rußland, denn dies ist das allgemeine Lebensniveau der überwiegenden Mehrheit der Russen, und dies war der Punkt, von dem die kühlen Männer ausgingen, die es sich zum Ziel gesetzt haben, ihr Land über das Niveau der kapitalistischen Welt hinaufzubringen. Nur im russischen Dorf begreift man ganz, welch grenzenloser Ehrgeiz das ist.
Plötzlich lief eine Schar von Kindern aus einer Hütte heraus, die etwas weniger armselig aussah als die anderen. Es war ein Schulhaus. Sie starrten uns an, schrien und liefen uns nach wie kleine Hunde. Sie waren warm gekleidet, und es waren viele.
Zwei Bauern weiter oben an der Straße, die uns den Rücken zuwandten, hörten unsere Sirene. Sie sprangen einen halben Meter hoch in die Luft und sausten davon in die Felder wie erschreckte Pferde.
In der Zentrale des Kollektivgutes Frunze erwartete uns Genosse Venkov. Wir hatten uns dieses Gut für unseren Besuch ausgesucht, weil es eines der besten war. Einen »durchschnittlichen« Bauern zu finden, ist ebenso schwierig, wie auf einen »durchschnittlichen« Arbeiter zu kommen, aber ebenso wie es interessant war, die Lage der bestgestellten Arbeiter zu studieren, so mußte es auch wertvoll sein, ihnen die Lage der bestgestellten Kollektivbauern entgegenzustellen.
Genosse Venkov hatte einen glatt rasierten Schädel und ein energisches Kinn. Er sah zäh aus und lächelte gern, er war bescheiden und offen und hatte einen raschen Witz; er war ein zweiunddreißig Jahre alter Bauer, seit einigen Jahren schon Kommunist, und war Leiter des Gutes, sein unumschränkter Herr. Zu seinem Gut gehörten 16 Dörfer und 276 Familien mit 1306 Individuen, die früher »Seelen« genannt wurden, jetzt aber »Esser« heißen.
Er führte uns durch das benachbarte Dorf. Ohne anzuklopfen, gingen wir in ein Haus nach dem anderen. Es waren ebensolche Häuser wie die, an denen wir auf der Straße vorübergekommen waren. Zu unserer Verblüffung waren alle diese öden Gräber voll Menschen.
»Haha!« kakelte ein altes Mütterchen, als wir uns zeigten. »Sieh dir mal das da an, mein Freund«, rief sie, unseren Führer bei der Hand nehmend und zur Decke ihrer Hütte hinaufzeigend.
Dort, oberhalb des Ofens, des berühmten russischen Ofens der russischen Romane, auf dem der bärtige Muschik den Winter verschläft und verträumt, war die Decke schwarz. Ein schwaches raschelndes Geräusch war zu hören, wie wenn sich das Laub eines Baumwollbaumes in einem sanften Windhauch bewegt.
Das Licht meiner elektrischen Taschenlampe brachte Bewegung in sie.
»Ich mag die Kakerlaken nicht haben«, beklagte sich die alte Frau, »sie machen zu viel Lärm, ich kann nicht schlafen.«
»Ich werde dir den Ungeziefervertilger schicken«, versprach Genosse Venkov.
Der große Backsteinofen nahm die Mitte des Hauses ein. Er beheizte den einzigen Raum, der für die ganze Familie da war. Sie alle schliefen auf ihm. Er kochte ihr kärgliches Essen. Er war das Herz ihres Lebens, so wie das Feuer des primitiven Menschen sein Kamin und sein Heim war. Nirgends sonst in der Welt, außer vielleicht in China, könnte man in einer Nation, der die Kultur nicht fremd ist, eine so große Anzahl von Menschen finden, die so sehr in nächster Nähe des Niveaus der Menschen leben, die in Felle gehüllt um ihre Lagerfeuer saßen.
Aber mit einemmal war der Raum von Licht durchflutet. Eine einzige elektrische Birne leuchtete. Alles sah stolz aus. Das war das Kollektivgut. Mit der Geschwindigkeit des Stromes hatte das elektrische Licht die Jahrhunderte zwischen dem alten und dem neuen Rußland übersprungen.
Noch leuchtete es dem alten Rußland. Bei seinem Licht besahen wir uns das Abendbrot auf der Kochstelle des Ofens. Da stand ein armseliges Töpfchen mit gekochtem Kohl und einer Handvoll gekochter Kartoffeln. Nichts weiter.
Die Einrichtung des Raumes bestand aus einem ungehobelten Holztisch, zwei selbstgezimmerten Stühlen, einem halben Dutzend hölzerner Löffel und Gabeln, und das war auch schon alles. In einer Ecke hing ein billiges, altes Ikon, Symbol der Kirche der Vergangenheit; in der anderen Ecke hing eine Lithographie Lenins, des Gründers der Kirche der Gegenwart.
Wir alle drängten uns in den Flur hinaus. Dort wurden die Vorräte aufgehoben. Auf einem Tisch stand ein Napf mit einer Handvoll grauen Mehls und ein zweiter mit geschnittenen Karotten und Kartoffeln, ein kleines Fäßchen enthielt gehobelten Kohl, ein anderes Salzgurken.
Es war bitter kalt im Flur. Die alte Frau schlug sich mit den Armen auf den Leib und teilte mit, daß sie ein Kalb verkaufen werde.
»Warum eßt ihr es nicht?« fragte ich.
Die Frage grenzte an Gotteslästerung. Bauern essen keine Kälber. Die russischen Bauern sind entschiedene Vegetarier. Das Fleisch ist für die Stadt.
Von irgendwo unten drang Stallgeruch herauf und durchzog das Haus. Eine halsbrecherische Treppe führte in den Keller hinunter. Wir stiegen hinab, und im Licht unserer Taschenlampe sahen uns die großen Augen einer Kuh vorwurfsvoll an. Sie stand bis an die Knie im Mist.
»Wie oft mistet ihr den Stall aus?« fragte ich den Mann des Hauses.
»Einmal im Jahr«, antwortete er, und lenkte unsere Aufmerksamkeit auf zwei Schafe, die in einer Ecke leise blökten. In einem anderen Winkel quiekte eine muntere Sau. Oberhalb von uns bewegten sich verschlafen Hühner und reckten beim Anblick der Lampe den Hals.
Die Kuh, die beiden Schafe, das Schwein und die Hühner gehören dem Bauern selbst. Das Haus ist sein Eigentum. Alles andere, was er einmal besessen haben mag, gehört dem Kollektiv. Als die Regierung vor fünf Jahren begann, die Bauern in die Kollektive zu treiben, versuchte sie, ihnen alles Vieh wegzunehmen und Pferde, Kühe, Schweine, Schafe und Hühner den gemeinsamen Herden einzuverleiben.
Das war der größte Fehler, den die Bolschewisten jemals begingen, denn er führte dazu, daß ungefähr die Hälfte des gesamten Viehbestandes der ganzen Sowjetunion geschlachtet wurde. Wie bitter die Regierung das jetzt bedauert, drückt sich in der Verordnung aus, daß alle Kollektivbauern gerade das besitzen sollen, für dessen Erhaltung sie kämpften, gerade das, was wir in diesem Bauernkeller vor uns sahen.
Drüben im Kuhstall des Kollektivs wehrten 114 Milchkühe, die auf sauberem Zementboden standen, mit ihren Schwänzen Insekten ab. Vor ihren Köpfen hatten sie breite Fenster. Ihre Stände wurden nicht ein Mal im Jahr, sondern zwei Mal täglich gesäubert. In einem Mutterstand streichelten grinsende Kuhmägde drei kleine Kälbchen, die auf sauberer Streu lagen; eines davon war gerade eine Stunde alt.
Im Elektrizitätswerk summte eine Dieselmaschine. Im Schuppen standen 4 Traktoren, 3 Dreschmaschinen, 2 von Traktoren gezogene und 10 von Pferden gezogene Mähmaschinen, und 22 Sämaschinen. Vor der Kollektivierung gab es fast gar keine Maschinen. Wieder schien zwischen dem Alten und dem Neuen eine ganze Reihe von Jahrzehnten zu liegen.
Das alles sah imposant aus. Aber was hat es gekostet? Wie lange wird es dauern, bis die Kosten abgedeckt sind? Und was hat der Kollektivbauer heute für Vorteile von der Diktatur, die sich offen »Diktatur des Proletariats« nennt?
Russland
Ein Kollektivbauer in Rußland arbeitet heute schwerer, gibt mehr her und bekommt weniger als die Bürger aller anderen Schichten in der ersten Arbeiter- und Bauernrepublik.
Daher die Erzählung, die, wie jede Sowjet-Anekdote, die herrschenden Zustände in der Union besser beleuchtet, als alle prosaischen Erklärungen es können.
Ein Kollektivbauer kam auf einer Rundfahrt nach Moskau, und man führte ihn zur Sendestation. Er sah dem Mann am Mikrophon zu und hörte mit Staunen, daß die Sendung an die ganze Welt ging.
»Die ganze Welt?« fragte er. »Das heißt, daß man den Mann außerhalb der Sowjetunion hören kann?«
»Ja, in Deutschland und England und Frankreich kann man ihn hören, und vielleicht sogar auch in Amerika«, wurde ihm freundlich geantwortet. »Willst du vielleicht noch etwas wissen?«
»Nein, nichts«, erwiderte der Kollektivbauer. »Aber ich möchte gern um einen Gefallen bitten. Es wäre ganz wunderbar, wenn ich bloß ein einziges Mal zur ganzen Welt sprechen könnte. Könnt Ihr das nicht machen?«
Man erklärte ihm, daß es unmöglich sei, das Programm abzuändern, gab aber widerstrebend nach und erlaubte es ihm, wenn er nicht mehr als ein einziges Wort sprechen wollte.
»Mehr als ein Wort brauche ich nicht«, versicherte der Kollektivbauer.
Zwischen zwei Sendungen ließ man ihn an das Mikrophon treten.
Er hielt sein Versprechen.
Das einzige Wort, daß er der ganzen Welt zurief, war: »Hilfe!«
Es nützt den russischen Bauern nichts mehr, »Hilfe« zu rufen. Nach fünf Jahren des erbitterten Kampfes mit ihnen hat die Regierung endgültig gesiegt. Der Bauer, der für seine individuelle Freiheit und für sein individuelles Eigentum kämpfte, ist geschlagen. Es war ein Bürgerkrieg. Sie nannten ihn den »Klassenkampf auf dem Lande«. Er war ebenso blutig wie der Bürgerkrieg der Jahre 1917 bis 1919. Er forderte auf beiden Seiten viele Opfer.
Heute sind von 25 Millionen Bauernhaushalten nahezu 19 Millionen kollektivisiert, und um 1937 werden alle so weit sein. Nahezu 90 Prozent des Getreide tragenden Bodens gehören zu Kollektiv- und Staatsgütern.
So weit der Sieg der Regierung im Bürgerkrieg. Aber die Bauern teilten furchtbare Schläge aus. Der größte, nahezu katastrophale Fehler der Regierung war der Versuch, dem Bauern sein ganzes Vieh für die Kollektivgüter abzunehmen. Ehe die Bauern von ihrem Vieh ohne Entschädigung ließen, schlachteten sie es. Und weil ihnen, wenn sie Jungvieh aufgezogen hätten, das Vieh nachher wieder abgenommen worden wäre, hörten sie fast ganz auf, welches zu ziehen.
Die Folgen waren so unheilvoll, daß Stalin die Zahlen erst im Jahre 1934 bekanntgab. Aus ihnen geht hervor, daß zwischen den Jahren 1929 und 1933 die Anzahl der Pferde im Lande von 34 000 000 auf 16 600 000 absank; die der Rinder von 68 100 000 auf 38 600 000; die der Schafe und Ziegen von 147 200 000 auf 50 600 000 und die der Schweine von 20 900 000 auf 12 200 000. Mit anderen Worten, die Hälfte der Pferde, nahezu die Hälfte des Rindviehs, fast zwei Drittel der Schafe und Ziegen und fast die Hälfte der Schweine des Landes war vernichtet.
Die fortgesetzte Verringerung des Viehbestandes noch nach der ersten Zeit der Schlachtungen bewies, daß die Bauern auch noch nach ihrer nominellen Kollektivisierung Widerstand leisteten. Was tat die Regierung da? Sie nahm den Bauern ab, was sie beansprucht hatte, ganz gleichgültig, ob diese für sich selbst genug erzeugten oder nicht. Das konnte die Regierung nun um so leichter durchführen, als die Bauern in einem System organisiert waren, in dem die Erzeugung durch einen zentralisierten Kanal floß, der zum größten Teil unter der Kontrolle von Kommunisten stand.
Überaus aufklärend ist die von dem Landwirtschaftsattaché der Deutschen Botschaft, Dr. O. Schiller, zusammengestellten Statistik, die zeigt, daß, während die gesamte Milchproduktion in der Sowjetunion, in Buttereinheiten berechnet, von 1 170 000 Tonnen im Jahre 1929 auf 800 000 Tonnen im Jahre 1933 herabsank, die an die Regierung gelieferten Mengen von 77 800 Tonnen im Jahre 1929 auf 140 000 Tonnen im Jahre 1933 stieg. Und während die Wollerzeugung von 179 000 Tonnen im Jahre 1929 auf 63 000 Tonnen im Jahre 1933 sank, stieg die Menge der an die Regierung abgelieferten Wolle von 25 000 auf 68 000 Tonnen.
Die Bauern verloren also in jeder Hinsicht. Damit, daß sie ihr Vieh schlachteten und sich weigerten, mehr aufzuziehen, verringerten sie weder die Forderungen der Regierung noch die tatsächlichen Requisitionen. Alles, was sie damit erreichten, war, daß sie damit verringerten, was für sie selbst übrigblieb.
Außerdem zeigen diese Zahlen deutlich, daß die Vermehrung der an die Städte gelieferten Nahrungsmittelmengen, die jetzt in Moskau so fühlbar ist, im Grunde nicht auf eine absolute Vermehrung der Erzeugung zurückzuführen ist, sondern in der Hauptsache auf eine Vermehrung der Mengen, die die Regierung von den Bauern nimmt. Solange der Viehbestand von 1929 nicht wieder erreicht und überschritten ist, kann unmöglich die Rede von einer allgemeinen Verbesserung des Ernährungszustandes der gesamten Bevölkerung sein.
Dazu kann es erst nach Jahren kommen. Die Sowjetbehörden selbst sind auf Grund von Schätzungen der Ansicht, daß der Verlust an Schweinen erst Ende 1935 zu ersetzen sein wird, der Verlust an Vieh 1940, der an Schafen 1942, und sie rechnen nicht damit, beim Ende des zweiten Planes im Jahre 1937 mehr als 21 300 000 Pferde zu haben, gegen 34 000 000 im Jahre 1929.
Vom wirtschaftlichen Standpunkt aus diente das ganze Kollektivisierungsprogramm dazu, die Rationalität der Landwirtschaft zu erhöhen. Sehr viel tut man sich auf die Menge der Traktoren zugute, die den Kollektiven geliefert werden. Die Regierung hat alle Ursache, stolz auf die Leistung zu sein, daß 1933 zehnmal so viel Traktoren da sind wie 1929, aber nach Stalins eigenen Ziffern lieferten die 204 000 Traktoren der Sowjetunion im Jahre 1933 3 100 000 Pferdekräfte. Man zähle diese mechanischen Pferde zu den übriggebliebenen Pferden, und das Ergebnis zeigt, daß die Sowjetunion heute noch immer 14 700 000 Pferde weniger hat als 1929.
Und am Ende des zweiten Planes wird, an 1929 gemessen, noch ein Defizit von 4 000 000 Pferden da sein, denn die Summe der geplanten 21 800 000 lebendigen Pferde und der für 1937 geplanten 8 200 000 Traktorenpferdekräfte gibt nur 30 000 000 maschinelle und tierische Pferdekräfte, während 1929 34 000 000 Pferde da waren.
Es hat also den Anschein, daß noch eine ziemlich lange Zeit verstreichen muß, bevor der Lebensstandard, was die Ernährung betrifft, in der Sowjetunion auch nur den Standard von 1929 erreicht, geschweige denn den der kapitalistischen Länder »einholt und übertrifft«. Und diese Berechnung zeigt die im Vergleich zu 1930 gebesserte Ernährungslage Moskaus im richtigen Licht.
Aber dies war nur ein Posten unter den Kosten der Kollektivisierung. Unten in der Ukraine und im Nordkaukasus faßten im Erntejahr 1932/33 rund 50 Millionen Bauern, die erbittert waren, weil die Regierung ihnen die Industriewaren, die sie brauchten, nicht im Austausch für ihr Getreide lieferte, auf Grund einer ganz sonderbaren, nie laut gewordenen, aber allgemeinen Übereinkunft den Beschluß, nicht mehr Getreide zu ernten, als sie für ihren eigenen Konsum brauchten, den Rest auf den Feldern verfaulen zu lassen und so der Regierung die von ihr beanspruchten Vorräte vorzuenthalten und Moskau durch Hunger dazu zu zwingen, daß es auf diesen ganzen Unsinn mit dem Sozialismus auf dem Lande verzichte.
Die Regierung nahm sich aber ihr Getreide, und kein Mensch weiß, wie viele Bauern Hungers starben. William Henry Chamberlin, eine Autorität mit zwölfjähriger Erfahrung in Rußland, kam auf Grund persönlicher Besuche im ganzen Gebiet nach der Hungersnot zu der Schätzung, das 10 Prozent starben. Das wären rund 5 Millionen.
Andere Autoritäten sind der Ansicht, daß diese Zahl zu hoch gegriffen sei, aber nur wenige nennen Ziffern, die nicht siebenstellig sind. Wie viele immer gestorben sein mögen, der von der Regierung erwünschte Erfolg trat ein. In den nächsten Saatzeiten besäten die Bauern ihr Land voll, und in der Erntezeit brachten sie alles bis auf das letzte Korn ein. Die Regierung brachte ihnen mit der Androhung der Todesstrafe bei, daß sie zuerst daran denken mußten, zu bauen und abzuliefern, was die Regierung forderte, und erst dann, was sie für sich selbst ernten konnten.
Damit ist aber die Geschichte von den Kosten des Regierungssieges für den »Sozialismus auf dem Lande« noch nicht zu Ende.
Hier auf dem Kollektivgut Frunze kamen wir an einem Haus im Dorf vorbei, das ein Blechdach hatte.
»Das Blechdach zeigt, daß der Besitzer ein Kulak war«, sagte mein Begleiter. Ein Kulak – das Wort heißt »Faust« – war ein sogenannter reicher Bauer. In der Sowjetpropaganda werden diese Leute als Wucherer und hartherzige, habsüchtige Ausbeuter der ärmeren Bauern geschildert.
»War der Kulak ein unangenehmer Mensch?« fragte ich.
»O nein, wir haben ihn alle gern gehabt.«
»Was habt ihr mit ihm gemacht?«
»Wir haben ihn zur Bahn geführt, mit vielen anderen in den Zug gesteckt und fortgeschickt.«
Er war »liquidiert«. Er fuhr fort, um Millionen seiner Genossen ins Exil nach Sibirien zu folgen, in die Straflager, die Zwangsarbeitkolonien. Weil er tüchtiger war als seine Nachbarn, mehr gearbeitet, ein wenig Besitz gesammelt hatte und deshalb nicht so war, daß man von ihm erwarten konnte, er würde eifrig auf einem Kollektivgut arbeiten, auf dem der Lebensstandard anfangs notwendigerweise niedriger sein mußte, als sein eigener war.
Drei Prozent der 25 Millionen Bauernhaushalte wurden offiziell als Kulakenbesitz bezeichnet. Das heißt, es gab 750 000 Kulakenwirtschaften, deren Rationalität durch die Tatsache bewiesen war, daß sie, obwohl sie ihrer Zahl nach nur 3 Prozent waren, 16 Prozent des Getreides bauten. Da eine Bauernfamilie durchschnittlich vier Köpfe zählt, wurden in dem Feldzug gegen die Kulaken mindstens 3 Millionen Menschen »liquidiert«.
Sie alle sind jetzt fort. Dr. Schiller erklärt: »Wahrscheinlich gibt es heute in der Sowjetunion nicht einen einzigen Bauernhaushalt mehr, der mehr als ein Pferd oder eine Kuh hat.«
Die Kulaken sind also fort. Der halbe Viehbestand ist fort. Die Schwächeren unter den widerspenstigen Bauern in der Ukraine und im Nordkaukasus sind fort. Der Sozialismus auf dem Lande hat triumphiert. Die destruktive Phase der Revolution sei nun vorüber, wird gesagt. Jetzt könne der Aufbau beginnen und die neue Gesellschaft auf den Gebeinen der alten aufwachsen.
Rußland
Was die Sowjetregierung an den Bauern im Durchschnitt verdient, ist ein Nettoprofit von mehr als tausend Prozent. Der »Profit« der Bauern ist die nackte Lebenserhaltung, und wenn ihnen auch die Diktatur des Proletariats Reichtümer in der Zukunft verspricht, tragen sie heute auf ihren Schultern die Hauptlast der Sowjet-Industrialisierung.
Wir saßen im Büro des Kollektivgutes Frunze am Tisch und diskutierten mit dem Leiter die Finanzlage der 1306 ihm unterstellten »Esser«. Wir saßen mit dem Rücken zur Tür. Minutenlang war ein leises, kaum vernehmbares Scharren zu hören. Wir sahen uns um, und da standen vierzig bis fünfzig Bauern, Männer, Frauen, Burschen und Mädchen, standen vierfach gestaffelt in einem Halbkreis da, still wie die Mäuse, und starrten, gelähmt von Verblüffung, dieses Geschöpf an, einen Ausländer, den ersten, den sie in ihrem Leben sahen.
Alle zehn Minuten klingelte das Telephon. Kein Mensch kümmerte sich darum. Wir redeten drei Stunden. Keine Seele regte sich. Wir sprachen über Preise.
In diesem Jahr zahlt die Regierung den Bauern 100 Rubel für eine Tonne des besten Weizens. Aus diesem Weizen macht die Regierung Brot und verkauft es der Allgemeinheit zu einem Preis von 1,10 bis 2,00 Rubel für das Kilo, oder 1100 bis 2000 Rubel die Tonne. An jeder Tonne verdient die Regierung 1000 bis 1900 Rubel.
Im Jahre 1934 bekam die Regierung von den Bauern rund 24 000 000 Tonnen Getreide, ungefähr zur Hälfte Weizen und zur Hälfte Roggen. Einen großen Teil davon bildeten Steuern in Naturalien, dafür wurde also nichts bezahlt. Wenn man jedoch lediglich den Weizen in Betracht zieht und annimmt, daß er voll bezahlt worden sei, betrugen die Kosten von 12 000 000 Tonnen für die Regierung 1 200 000 000 Rubel, und das Minimum dessen, was die Regierung für das daraus gemachte Brot bekommt, wird 12 000 000 000 Rubel sein. Der Nettoprofit wird mehr als 11 000 000 000 Rubel betragen.
Was verdient der Bauer? Wir baten Genossen Venkov, uns das System zu erklären, nach dem die Arbeiter auf dem Kollektivgut bezahlt werden. Vor allem liefert jeder, mit Ausnahme einer Kuh, eines Schweines, zweier Schafe und etlicher Hühner, seinen gesamten Besitz ab. Sein Pferd wird abgeliefert und alles, was er an Ackergerät besitzen mag. Sein Land ist natürlich das wichtigste von allem, was kollektivisiert wird. Nur ein kleines Stückchen von ungefähr einem Morgen wird ihm für seinen eigenen Gemüsegarten gelassen.
Dieser ganze Besitz, außer dem Boden, wird in Geld geschätzt und in den Büchern als Einlage verzeichnet. Theoretisch steht es ihm frei, nach Ablauf eines Jahres aus dem Kollektiv auszutreten, wenn er es wünscht, aber das bleibt wirklich reine Theorie, denn nach Ablauf des Jahres 1937 werden Einzelbauern nicht mehr geduldet sein. Theoretisch würde er bei seinem Austritt 75 Prozent des von ihm Eingebrachten wieder bekommen, aber in Papierrubeln, nicht in Naturalien.
Dann erhält er Bezahlung entsprechend der von ihm geleisteten Arbeit. Die Zahlungsnorm ist der sogenannte »Arbeitstag«. Dieser variiert je nach dem Können und nach der Anzahl der erforderlichen Stunden. Zehn Stunden Arbeit eines gelernten Pflügers würden zum Beispiel 1,75 Arbeitstage sein; zehn Stunden Arbeit eines Traktorführers würden 2,25 Arbeitstage sein; Kuhmägde werden nach der Menge des Gemolkenen bezahlt.
Jeder Bauer hat ein Arbeitsbuch, in dem seine tägliche Leistung eingetragen wird. Die Vorarbeiter machen wöchentlich Abrechnung. Am Ende des Jahres werden die Abrechnungen abgeschlossen und die Bauern ausgezahlt. Unterdessen, während des Rechnungsjahres, bekommen die Bauern Vorschüsse, damit sie leben können.
Auf dem Frunzegut besteht die Bezahlung für einen Arbeitstag in 1,3 Kilogramm Weizen, 900 Gramm Roggen, 1,4 Kilogramm Hafer, 1,5 Kilogramm Kartoffeln, 2,5 Kilogramm Heu, 2,5 Kilogramm Haferstroh, einer unbestimmten Menge Roggenstroh und zwei Rubel.
Auch hier war es nicht möglich, zu einem Durchschnitt zu gelangen, aber es war interessant, die Einkünfte der tüchtigsten Bauernfamilie unter allen 1306 »Essern« kennenzulernen. Es ist keineswegs so, daß ein gewöhnlicher Landarbeiter im Tag einen Arbeitstag verdienen kann.
Diese Familie, der Stolz des Gutes, bestand aus dem Oberhaupt, einem Mann im besten Alter, seiner Frau, die gleichfalls kräftig und eine gute Arbeiterin war (Frauen erhalten die gleiche Bezahlung wie Männer), zwei erwachsenen Kindern, die arbeiteten, und zwei kleineren nicht arbeitenden Kindern – im ganzen sechs Personen, die zu ernähren waren.
Sie hatten in den letzten neun Monaten zusammen 984 Arbeitstage verdient, jeder von den vier Arbeitern also 246 Arbeitstage; das war in diesen 270 Tagen eine Kleinigkeit weniger als ein Arbeitstag täglich. Was bleibt ihnen, nachdem sie für ihre Ernährung gesorgt haben?
Nach einem Jahre der Arbeit in diesem Maßstab hätten sie 1706 Kilogramm Weizen verdient, 1008 Kilogramm gegessen, 698 Kilogramm übrigbehalten; sie hätten 1180 Kilogramm Roggen verdient, 1008 Kilogramm gegessen und 172 Kilogramm übrigbehalten; sie hätten 1698 Kilogramm Kartoffeln verdient, 1152 Kilogramm gegessen und 816 Kilogramm übrigbehalten. Den Hafer, das Heu und das Stroh hätten sie an ihr Vieh verfüttert.
In barem Gelde würden sie 2624 Rubel für vier Personen bekommen. Wenn sie ihren Überschuß an Weizen, Roggen und Kartoffeln an die Regierung verkauften, würden sie weitere 260 Rubel erhalten; damit wäre die Gesamtsumme ihrer Bareinkünfte 2884 Rubel, 721 Rubel für jeden einzelnen im Jahr, also zwei Rubel im Tag.
Wenn sie alles, was sie brauchen, in der Kooperative zum billigsten Preis kaufen könnten, würde ihr Rubel eine Kaufkraft haben, die der von zehn Cent in Amerika entspräche. Wenn sie alles auf den offenen Märkten kauften, würde ihr Rubel eine Kaufkraft von vier Cent haben. In Wirklichkeit kaufen sie etwa ein Drittel in den Kooperativen und zwei Drittel auf dem Markt, so daß ihr Rubel eine durchschnittliche Kaufkraft von sechs Cent hat.
Ihr Einkommen von zwei Rubel im Tag bedeutet eine Kaufkraft von zwölf Cent im Tag für jeden einzelnen, 48 Cent im Tag für die ganze Familie. Auf die sechsköpfige Familie verteilt, ist das Durchschnittseinkommen dieser, der am besten gestellten Familie auf dem Frunzegut, acht Cent im Tag auf den Kopf, abgesehen von Brot, Kartoffeln und Obdach.
Nicht berücksichtigt dabei sind die Kuh, das Schwein, die zwei Schafe und zwölf Hühner, aber der Berechnung liegen auch die von der Regierung in ihrem alten Rationierungskarten-System berechneten minimalen Ernährungsbedürfnisse zugrunde, das jedem Arbeiter das Recht gibt, täglich zwei Pfund Brot und etwas mehr als ein Pfund Kartoffeln zu kaufen, eine Ration, die für einen Arbeiter zu klein ist.
Die Bezahlung für einen Arbeitstag auszurechnen, ist eine komplizierte Aufgabe für den Leiter des Gutes. Er muß zunächst zehn Prozent der Ernte für Steuern abrechnen. Weitere zehn Prozent werden für Saatgut gebraucht. Noch einmal zehn Prozent müssen für Viehfutter und Reserven berücksichtigt werden. Von den gebliebenen zwei Dritteln wird ein bestimmter Betrag für den Ankauf von Maschinen abgesetzt. Der Rest wird unter den Bauern verteilt.
In diesem Jahr kaufte sich das Frunzegut einen Eineinhalbtonner Sowjet-Ford-Lastwagen. Dafür wurden 16 Tonnen Weizen, 24 Tonnen Hafer und 600 Rubel bezahlt. Nach den Weltmarktpreisen für Weizen und Hafer hätte diese Getreidemenge einen Wert von rund 1088 Dollar. Ein amerikanischer Wagen dieses Typs kostet 550 Dollar. Wären jedoch der Weizen und der Hafer zu den regulären Regierungspreisen verkauft worden, so hätten sie ungefähr 2000 Rubel gebracht, und das würde zusammen mit den 600 Rubeln in bar einer Kaufkraft von ungefähr 100 Dollar auf den offenen Märkten in Rußland entsprechen. Die Regierung verkaufte also dem Gut einen 550-Dollar-Wagen für Getreide, das im Ausland 1088 Dollar, hier aber nur 100 Dollar wert ist. Womit einige der Schwierigkeiten der Sowjetfinanzen illustriert sind.
Genosse Venkov war stolz auf seine Musterfamilie, und sie erhob sich zweifellos wie ein wahrer Berg der Wohlhabenheit über ihre Nachbarn. Was dem Bauern jedoch in Wirklichkeit geboten wird, ist mehr als sein Einkommen. Genosse Venkov zählte folgende Leistungen des Kollektivs für seine Mitglieder auf:
Erstens mechanische Geräte; zweitens elektrisches Licht in drei Dörfern; drittens Kinderbewahranstalten, Klubhaus, gelegentlich Kino, jederzeit Radio, und eine Zeitung für jede Familie; viertens fachmännische landwirtschaftliche Beratung durch einen Regierungsagronomen; fünftens Belehrung der Jugend in wissenschaftlich betriebener Landwirtschaft; sechstens hundert neue Gebäude; siebentens ausgesuchtes Saatgut; achtens künstliche Düngemittel.
Nichtsdestoweniger räumte er ein, daß das eine große wirtschaftliche Ziel der Kollektivisierung, gesteigertes Erträgnis auf den Morgen, noch nicht erreicht worden war. Die offizielle Sowjetstatistik der Ernten, des wirtschaftlichen Hauptfaktors bei allem, was dieses Land tut, besagt folgendes:
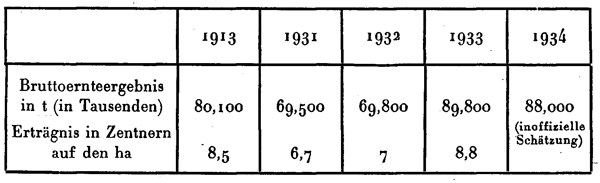
Das sind die offiziellen Zahlen, abgesehen von der Schätzung für 1934; diese nennt die Zahl, die die Regierung nach Ansicht ausländischer Experten bekanntgeben dürfte. Was bedeuten diese offiziellen Zahlen? Von außen betrachtet, würden sie eine große Vermehrung der Ernten seit der Kollektivisierung und eine Steigerung des Erträgnisses auf den Morgen zeigen.
Es ist jedoch eine überaus wichtige Korrektur anzubringen, die von nun an beim Lesen offizieller Sowjetverlautbarungen über Ernten von größter Wichtigkeit sein muß. Auf die Notwendigkeit der Korrektur wies das Mitglied des Planungsbüros der Regierung, der Chefstatistiker V. Ossinski, in einem Artikel der »Isvestia« vom 21. September 1933 hin; er machte darauf aufmerksam, daß infolge der unverbesserlichen Neigung der Bauern zum Stehlen von Getreide (in dem sie ihr Eigentum sehen) eine grundlegende Änderung in der Methode der Ernteberechnungen getroffen worden sei.
Bis dahin war die Ernte, wie in allen anderen Ländern, in den Speichern berechnet worden. Aber die Bauern stahlen so viel auf dem Weg vom Feld zum Speicher, daß die Regierung den Beschluß faßte, von nun an ihren Erntezahlen und damit den Steuern das Getreide auf dem Acker, die sogenannte »biologische Ernte«, zugrunde zu legen.
Auf Grund von Experimenten hatte die Regierung die Überzeugung gewonnen, daß ein zehnprozentiger Verlust auf dem Weg vom Feld zum Speicher unvermeidlich und gerechtfertigt sei. Infolgedessen wollte die Regierung die wirkliche Ernte von nun an so berechnen, daß sie von der geschätzten Ernte auf dem Halm zehn Prozent abzog. So wurde es bei der Ernte von 1933 gemacht, und so wird es auch in Hinkunft gehandhabt werden.
Weitere Versuche jedoch, die die Regierung auf Kollektivgütern anstellte, so sagt Ossinski noch, zeigten, daß auf dem Weg vom Feld zum Speicher in Wirklichkeit 30 bis 50 Prozent der Ernte in Verlust gerieten. Das würde die Regierung aber nicht davon abhalten, auch fürderhin nur 10 Prozent Verlust abzurechnen, da alle anderen Verluste von den untüchtigen oder diebischen Bauern getragen werden müßten.
Diese Erklärung hat ausländische Landwirtschaftsexperten dazu gebracht, von den Ernteziffern der Regierung noch weitere 20 Prozent abzuziehen, um so zu einer annähernd richtigen Vorstellung der tatsächlich eingebrachten Ernte zu gelangen. Bei dieser Berechnung würde sich herausstellen, daß die Ernte von 1933, für die offiziell die Ziffer von 89 000 000 Tonnen genannt und die als höchste in der Geschichte bisher begrüßt wurde, in Wirklichkeit nur ungefähr 71 800 000 Tonnen ergab, und daß die richtige Zahl für die Ernte von 1934, wenn sie, wie man erwartet, als nur wenig geringer als die von 1933 bezeichnet wird, nicht 88 000 000, sondern nur ungefähr 70 000 000 Tonnen lauten werde.
Die Ernte-Ergebnisse auf den Morgen wären für 1933 und 1934 entsprechend nach unten zu korrigieren, und dabei würde sich zeigen, daß das Erträgnis im Kollektivsystem beständig um etwa 15 Prozent unter dem Erträgnis der Vorkriegszeit liegt. Es gibt also, solange sich an diesen Verhältnissen nichts ändert, für die Sowjetunion keine andere Möglichkeit zur Steigerung ihrer Ernten als eine Vergrößerung des bebauten Bodens. Das steht in scharfem Gegensatz zum zweiten Plan, der ungefähr eine Beibehaltung der Saatflächen vorsieht, jedoch eine solche Steigerung des Erträgnisses, daß die gesamte Getreide-Ernte des Jahres 1937 mehr als 100 000 000 Tonnen ergeben solle.
Ob nun das Erträgnis größer oder geringer wird, die Tatsache, daß das Kollektivsystem der Regierung größere Möglichkeiten gibt, den Bauern das Getreide abzunehmen, hat dazu geführt, daß die Getreidelieferungen an die Regierung von 13 800 000 Tonnen im Jahre 1929 auf 21 000 000 im Jahre 1933 und 24 000 000 im Jahre 1934 gestiegen sind.
Die Städte werden mehr denn je zu essen haben, und ob die Bauern stehlen und schwindeln oder nicht, die Regierung bekommt auf jeden Fall ihr Getreide.
Rußland
»Seid fröhlich!« so lautet heute die gebieterische Anordnung in der ganzen Sowjetunion. Jedermann in diesem riesigen Lande, von der Arktis bis zum subtropischen Gebiet und vom Stillen Ozean bis zur Ostsee, gibt sich verzweifelt Mühe, diesem Befehl Folge zu leisten – und das zeigt nicht weniger als die Erschießungen, was eine Diktatur bedeutet.
»Habt Angst!« ist ein ständig existierender Befehl, der eben wieder dadurch bekräftigt wurde, daß innerhalb weniger Wochen nach der Ermordung Kirovs, des Herrn von Leningrad, mehr als hundert Personen erschossen wurden. »Habt Angst!« ist jedoch ein alter Befehl, ein regulärer Teil des Sowjetlebens. Die Parole »Seid fröhlich!« ist als Befehl nicht aufgehoben worden, und abgesehen von den vielen Verwandten und Freunden der hundert und einigen Toten, tut die Sowjetbürgerschaft ihr Bestes, um zu gehorchen.
Unser Gespräch auf dem Kollektivgut Frunze beschlossen wir mit der Frage, was die Hauptschwierigkeiten seien.
»Ja«, antwortete der Leiter ganz ernsthaft und nachdenklich, »wissen Sie, Moskau hat uns gesagt, wir sollen Foxtrott tanzen. Das«, sagte er mit aufeinandergebissenen Lippen, »ist das Schwerste, was wir jemals versucht haben.«
Hier in Iwanowo-Wosneschensk, einer der wichtigsten Textilstädte der Union, ist die Amüsier-Industrie in vollem Schwunge. Wir saßen unter 3000 Arbeitern im Zirkus und sahen ein Programm, das einen erstaunlichen Akt brachte. Dreißig Minuten lang vollführten zwei kleine Turnerknaben Kunststücke, die sie auf den besten Varietébühnen der Welt zeigen könnten.
Sie schlugen neunzigmal hintereinander Rad, schlugen zwanzig Purzelbäume nach vorn, zwanzig nach hinten, machten von einer Pyramide, die ihre älteren Kollegen bildeten, Doppelsaltos und schlossen mit einem prachtvollen Versuch zu einem dreifachen Salto rückwärts, der mißlang, aber in Ehren mißlang. Leider könnten sie mit einem Auftreten in westlichen Ländern nichts verdienen, weil sie noch nicht das zehnte Lebensjahr überschritten haben.
Die Sowjets sprechen mit Stolz davon, daß ihre humanen Gesetze die Kinderarbeit untersagen. Sowjetkritiker lassen kein gutes Haar an dem Vorkriegssystem hier, das den Frauen erlaubte, Schwerarbeit zu verrichten.
Eines der sonderbarsten Bilder bietet heute in Moskau die Schar von Frauen, die in geflickten Jacken, Segeltuchhosen und Stiefeln in den Untergrundbahnschacht zum Graben hinuntergehen. Wir kamen um zwölf Uhr nachts an einem Lastwagen vorbei, der im Zentrum der Stadt vor einem Untergrundbahneinschnitt stand. Er war mit Zement beladen. Zwei Frauen schaufelten ihn rasch heraus, um ihn ausgeladen zu haben, ehe er gefror. Es waren emanzipierte Frauen.
In der Kugellagerfabrik in Moskau werden die Arbeiter mit guten warmen Mahlzeiten versorgt. Wir aßen mit den gewöhnlichen Arbeitern und bekamen für einen Papierrubel eine Portion geschmorten Hammels, die besser war als alles, was in dem teuren Ausländerhotel National serviert wird. Draußen vor einem der Öfen des Kugellagerwerks sahen wir ein zartes Lehrmädchen von ungefähr achtzehn Jahren rotglühende Stahlringe aus dem Ofen herausholen. Sie war emanzipiert.
Hier in Iwanowo gingen wir durch Straßen, die vor vier Jahren noch wahre Schmutzkloaken waren. Heute sind sie so gut gepflastert wie die Straßen Moskaus.
Plötzlich hörten wir Löwengebrüll. Hier im kalten Norden wurden wilde Tiere aus den Tropen gehalten, damit dem Gesetz »Seid fröhlich« Genüge getan werde. Die Menagerie zog große Menschenmengen an.
Zwei Tiger, drei Löwen, eine Anzahl von Affen, Füchsen und Bären und der größte Wolf, den ich jemals zu Gesicht bekommen habe, sorgten für die Unterhaltung von mehreren hundert Sowjetbürgern. Der Wolf war ein Phänomen. Auf dem kapitolinischen Hügel in Rom werden zwei Wölfe gehalten, zum Andenken an die Wölfin, die Romulus und Remus, die Gründer der Ewigen Stadt gesäugt hat. Sie würden neben diesem sibirischen Wolf, der die Größe eines kleinen Pferdes hat, wie Junge wirken.
Die Menagerie hier ist eine der zwölf, die dem Moskauer Vergnügungstrust gehören. Außer dem Zirkus und der Menagerie haben die 40 000 Textilarbeiter in Iwanowo zwei große Filmtheater, 25 Fabrikkinos, drei Theater und einundzwanzig Klubs. Sie tun ihr Bestes, um fröhlich zu sein.
Ein Bürger ist nicht fröhlich. Er ist resigniert und hat Humor, aber fröhlich ist er nicht. Vierzig Jahre lang hat er als Textilarbeiter gearbeitet. Er ist sechsundfünfzig Jahre alt und sieht aus wie vierzig.
Er kennt das Vorkriegsrußland. Er kennt Sowjetrußland. In beiden ist er Arbeiter gewesen. Ihm ist das Vorkriegsrußland lieber.
Wir saßen in seinem Heim und hörten uns seine lehrreiche Geschichte an. Während er sich, ohne jede Hitze, vor mir und seiner Familie ausließ, spielte immer wieder ein Lächeln über sein gerötetes Gesicht, und er schüttelte seine weiße Haarmähne wie einen Fächer.
»Ich bin gelernter Mechaniker. Jetzt verdiene ich 300 Rubel im Monat. Früher habe ich 77 Goldrubel im Monat verdient. Als die Revolution kam, konfiszierten sie mir 2000 Goldrubel, die ich erspart hatte.
Wie es mir möglich war, 2000 Goldrubel zu sparen? Sehr einfach. Damals brauchte man zum Leben, und zwar zu einem viel besseren Leben, als ich es jetzt habe, ungefähr 25 Rubel im Monat. Jedenfalls gab ich nicht mehr aus, und den Rest sparte ich.
Freilich, heute arbeite ich nur sieben Stunden, und früher habe ich zwölf gearbeitet. Ich bin immer um sechs Uhr früh zur Arbeit gegangen und um sieben Uhr abends wieder fort. Aber wir hatten sehr viel Zeit zum Essen, und wir arbeiteten nicht sehr angestrengt, und auf jeden Fall hatte man etwas vom Arbeiten, wenn man sparen konnte.«
Seine beiden Jungen mischten sich ein. Der eine war vierundzwanzig, der andere neunzehn Jahre alt. Der Ältere war Ingenieur und verdiente ebensoviel wie sein Vater. Der Jüngere hatte soeben seine Studien als Elektrotechniker beendet und stand davor, eine Stellung anzunehmen.
»Und was ist mit uns? Hättest du uns die Erziehung geben können, die wir jetzt haben?« fragten sie.
Der Vater sah sie mitleidig an. Sie, so überlegte er, würden niemals begreifen, wie es einmal gewesen war. Sie waren zu jung, um es zu wissen, und in der Sowjetunion konnten sie es niemals erfahren.
Statistisch betrachtet, würden die 77 Goldrubel, die der Vater vor der Revolution verdiente, heute mindestens den Wert von ebensovielen Rubeln in »Torgsin« haben. Aber für 77 Torgsinrubel kann man heute ebensoviel Lebensmittel kaufen wie für 770 Rubel in einer geschlossenen Arbeiterkooperative, beziehungsweise so viel wie für 2925 Rubel in einem Handelsladen.
Der betreffende Arbeiter lebte auch nach der Revolution noch im Hause seines Vaters weiter. Infolgedessen spielt die Miete, die für Arbeiter heute so niedrig ist, in seinem Budget keine Rolle. Für alles andere, was er kaufen muß, hat sein Lohn heute nicht einmal halb so viel Kaufkraft wie sein Vorkriegslohn.
Nach den Angaben des amerikanischen kommunistischen Schriftstellers Joseph Freeman betrugen die Durchschnittslöhne in der russischen Industrie vor der Revolution 25 Rubel im Monat. Gäbe man diese Summe heute in Torgsin-Läden aus, so entsprächen sie 625 in Handelsläden ausgegebenen Papierrubeln, beziehungsweise 250 in geschlossenen Kooperativen ausgegebenen Rubeln. Der Durchschnittslohn in der Sowjet-Industrie ist heute rund 150 Rubel im Monat. Niedrigere Mieten, und was auf dem Gebiet der Erziehung und an sozialen Vorteilen geboten wird, kompliziert das Bild für den gewöhnlichen Sowjet-Arbeiter, aber was seinen eigenen Fall betraf, war der alte Mann in Iwanowo völlig sicher.
In seiner Fabrik draußen, dem gewaltigen neuen »Melange«-Werk mit 11 000 Arbeitern, die 28 000 000 Meter Stoff jährlich produzieren, und zwar vom Baumwollballen bis zum Fertigprodukt, sahen wir 2186 Webstühle in vollem Betrieb. Sie waren sämtlich Sowjetmaschinen. Damit ist einiges an dem Unterschied zwischen den Vorkriegs- und den Sowjetlöhnen erklärt.
In der ganzen Fabrik waren zwei Drittel des gesamten Maschinenparks Sowjetmaschinen. Vor dem Krieg fabrizierte Rußland keine Textilmaschinen. Das Hauptziel des Fünfjahrplanes war es, Maschinen zur Herstellung von Maschinen zu erzeugen. Der zweite Zweck war die Herstellung von Maschinen zur Erzeugung von Verbrauchsgütern.
Es dauerte Jahre, bis Verbrauchsgüter geliefert wurden, die auf Sowjetmaschinen, die mit Sowjetmaschinen gebaut waren, hergestellt wurden. Mittlerweile mußte die Bevölkerung, damit die Maschinen aus den eigenen Mitteln der Nation, die gar keine Auslandskredite bekam, bezahlt würden, darauf verzichten, so viel zu essen, sich so zu kleiden und in so guten Häusern zu wohnen, wie sie es früher getan hatte. Eine Methode zur Erreichung dieses Zieles war die Herbeiführung einer Währungsinflation. Auf Grund des Kapitalwertes der neuen Fabriken und der neuen Maschinen gab die Regierung Rubel aus. Der Rubel fiel. Der Reallohn des Arbeiters fiel. Auf diese Weise trug er das Seine zu den Kosten der Industrialisierung bei. Sein Rubel wird so lange keinen höheren Wert haben, wie die Erzeugung der Verbrauchsgüter sich nicht steigert.
Überlegungen solcher Art fochten die Mädchen im Melangewerk nicht an. Mehr als die Hälfte der Arbeiter bestand aus Frauen unter fünfundzwanzig. Sie alle wußten nichts vom Vorkriegsrußland und noch weniger von der Welt außerhalb der Sowjetunion.
Sie kamen sich in ihren großen roten Backsteinkasernen, die nördlich von der Fabrik lagen, sehr behaglich untergebracht vor. Wir machten in den Zimmern längs des Korridors Besuche. In einem Raum, der die Größe eines geräumigen amerikanischen Badezimmers hatte, wohnten drei Mädchen. Zwei schliefen in einem Einzelbett, die dritte auf einer Feldbettstelle.
Das Zimmer war völlig kahl, es war ungenügend geheizt und außer dem Bett und dem Feldbett standen nur ein Tisch und zwei Stühle da. Einen Teppich gab es nicht. An der Wand hingen Familienphotos, ein Bild, das Lenin als dreijähriges Kind zeigte, und eines von Stalin mit seinem wohlbekannten Schnurrbart.
Das eine der Mädchen hatte eine Mandoline. Sie sah aus wie eine Zigeunerin, war hübsch und lebhaft und freute sich, eine Gelegenheit zum Reden zu haben.
»Ich bekomme 150 Rubel im Monat«, sagte sie. »Mein Zimmer kostet mich im Monat 6 Rubel, drei Mahlzeiten täglich im Speiseraum hier 60 Rubel, eine Mahlzeit täglich in der Fabrik 15 Rubel, Regierungsanleihe 10, Steuern 2, und obligate Rücklage 5 Rubel. Das macht zusammen 98 Rubel, so daß 52 im Monat übrig bleiben.«
»Was ist mit Vergnügungen?«
»Ich?« rief sie aus. »Mich kostet es nichts, ins Theater zu gehen.«
Selbst kommunistische Mädchen lassen sich von kommunistischen jungen Leuten einladen. Die emanzipierten Frauen in der Sowjetunion erfreuen sich auch heute der weiblichen Privilegien, solange sie jung und hübsch sind. Die Hunderte älterer und alter Frauen, die die Straßen Moskaus sauber halten und im Winter bis nach Mitternacht an den Straßenbahnweichen stehen, erfreuen sich dieser Privilegien nicht mehr.
Für die Jugend bedeutet die Sowjetunion keine Entbehrung. Diese Mädchen in den Melange-Unterkünften waren so zufrieden wie die Mädchen im Campus eines College. Die Jugend hat das Gefühl, das Land zu regieren. Wie regieren sie es?
Wer leitet die Regierung, und was bedeutet der Terminus »Sowjetdemokratie« im Rahmen der Diktatur des Proletariats?
Rußland
Wie sieht die Demokratie in der ersten Arbeiter- und Bauernrepublik aus? Wie verleihen die Sowjetbürger ihrem Willen Ausdruck?
Zweitausendfünfhundert Arbeiter marschierten in geschlossener Formation zu den Wahlurnen. Sie versammelten sich in der großen Temperstahl-Abteilung der Frezer-Werkmaschinenfabrik. Sie hörten sich die siebzehnmal gespielte Internationale an. Sie lauschten drei Stunden und fünfundvierzig Minuten den Redekünsten von zehn Sprechern.
Sie hörten einem Mann zu, der schließlich zehn Minuten vor Ablauf der vorhergesehenen Versammlungszeit aufstand und verkündete: »Die kommunistische Organisation empfiehlt die folgenden Kandidaten zur Wahl in die Sowjets.« Er verlas die Namen.
»Alle, die für die Liste im Ganzen stimmen wollen, erheben die Hände.«
Zweitausendfünfhundert Hände gingen in die Höhe.
»Alle gegen die Liste erheben die Hände.«
Nicht eine Menschenseele regte sich. Eine kleine Pause. Alles stand auf. Die Internationale wurde zum achtzehntenmal gespielt.
Wie scharfsinnige politische Beobachter vorausgesehen hatten, war der Sieg in der Sowjetwahl den Kommunisten zugefallen. Die Kommunisten konnten weiterarbeiten. Sie hatten ihr »Mandat« erhalten.
Die Wahl ist in der Sowjetdemokratie öffentlich. Jedermann weiß, wie alle anderen wählen. Diese Wahl war die erste seit drei Jahren. Neunzig Millionen machten ihre Formalitäten durch. Neunzig Millionen Hände in der ganzen Sowjetunion wurden erhoben. Die neunzig Millionen sahen die Gestalten in olivgrünen Khakiuniformen auf der Tribüne an, und die neunzig Millionen stimmten sämtlich gleich: für die von der kommunistischen Partei empfohlenen Kandidaten.
Damit soll nicht gesagt sein, wie das Resultat ausfiele, wenn eine geheime Wahl für oder gegen das Sowjetregime abgehalten würde. Diese Frage steht hier nicht zur Diskussion. Es soll jedoch damit gesagt werden, daß die Methode der Sowjetwahlen keinen zufriedenstellenden Hinweis dafür liefern kann, wie die Menschen bei sich über die Regierung denken.
Sie können dafür sein. Die meisten der Arbeiter sind es wahrscheinlich. Sie können dagegen sein. Das ist wahrscheinlich bei vielen der Bauern der Fall. Aber es gibt in der Sowjetunion keine Alternative für die jetzige Regierung, und die meisten der »Wähler« wissen gar nicht, daß es überhaupt etwas anderes geben könnte.
Die kommunistische Parteimaschine läuft wie eine elektrische Lokomotive, und mit ihr verglichen wirkt die politische Maschinerie der amerikanischen politischen Führer dilettantisch. Aber wer zum Beispiel von der Wählerschaft in der Frezerfabrik sollte sich beklagen, wenn:
Erstens die meisten noch vor wenigen Jahren Bauern waren?
Zweitens die meisten in den letzten wenigen Jahren gerade lesen und schreiben gelernt haben?
Drittens ihr Durchschnittsalter dreiundzwanzig ist, sie also bei Ausbruch der Revolution im Jahre 1917 sechs Jahre alt waren, und
Viertens infolgedessen keiner von ihnen eine Erfahrung mit einem anderen Regierungssystem in der Heimat hat und nicht im entferntesten ahnt, was wahre Demokratie im Ausland ist?
Nur ein Mann lachte ganz leise vor sich hin, als der erste Redner donnerte: »Eine Wahlversammlung wie diese hat es in einem kapitalistischen Land niemals gegeben und wird es niemals geben.
Dort«, erklärte er, »stehlen verbrecherische Ausbeuter die Wahlen, um den Arbeitern das Blut abzuzapfen. Hier wählt ihr eure eigenen Vertreter.
Dort«, brüllte er, »würden die Arbeitslosen Schulter an Schulter in einer Reihe stehen, die von Minsk nach Wladiwostok und von Wladiwostok nach Sutschum reicht. Hier habt ihr alle Arbeit.«
Das war freilich wahr, aber der Beifall war sehr kärglich. Vor uns saß Clavdia Vinogradova und las in einem Buch. Clavdia Vinogradova, neunzehn Jahre alt, blond, hübsch, arbeitete im Zahnradwerk, verdiente 200 Rubel im Monat, war »Stoßbrigade-Arbeiterin« und Mitglied der Liga Kommunistischer Jugend, eine Komsomolka.
»Warum hören Sie nicht dem Redner zu?« fragten wir. Der zweite Sprecher hatte begonnen und hörte eine Stunde und fünfundvierzig Minuten lang nicht auf.
»Ach, das wissen wir schon alles«, antwortete sie.
Zweifellos las sie ihre »politische Grammatik« oder vielleicht auch eine Dissertation über Marx. Wir baten sie, uns das Buch zu zeigen.
Es hieß »Jagd auf Menschen« und war von Theodore Dreiser.
Der Redner erzählte weiter: »In Paris kommt eine Geburt auf 2000 der Bevölkerung; in Berlin 2,9 Geburten auf 1000; in Moskau haben wir sieben Geburten auf 1000. Warum? Weil die Arbeiter keine Angst vor der Zukunft haben.«
Clavdia Vinogradovas Kollegin zog gleichfalls ein Buch heraus und begann zu lesen. Es war »Der Mond von rechts«, ein beliebter erotischer Sowjetroman von Malischkin.
Nach einer Stunde der Reden hörte nicht ein Mensch mehr zu. Es war genau so, wie bei dem langen Hintereinander anödender Deklamationen bei einer Feier des Vierten Juli auf dem Lande in Amerika. Karl Marx statt George Washington; Lenin statt Abraham Lincoln. Die meisten der zweitausendfünfhundert Arbeiter standen. Sie hatten dieselben Reden schon unzählige Male gehört. Sie bewegten sich unbehaglich, und ein Geflüster setzte im ganzen Raum ein.
Clavdia Vinogradova kicherte und rief aus: »Ich würde nie einen Bourgeois heiraten.« Sie hatte noch nie in ihrem Leben einen Bourgeois gesehen und glaubte, daß sie alle dick seien.
Der Direktor des Werks sprach zwanzig Minuten, ein Arbeiter fünf Minuten, ein zweiter zehn Minuten, eine Arbeiterin zehn Minuten, ein ausländischer Ingenieur fünf Minuten, ein Vorarbeiter fünf Minuten, ein anderer Vorarbeiter zehn Minuten, der Schriftleiter der Werkzeitung zwölf Minuten. Sie alle sprachen darüber, was geleistet worden sei. Der Vorsitzende brachte einen Antrag ein: Man solle die Leistungen anerkennen. Zweitausendfünfhundert Hände fuhren in die Höhe.
Dann kamen die »Forderungen der Arbeiter«. Nacheinander trat eine Reihe von Rednern auf die Plattform und verlangte: neue Wohnstätten; Wasser und Kanalisierung in ihren Heimen; Gas; Badehäuser; eine Wäscherei; eine Straßenbahn und eine Chaussee zum Werk; Straßenbeleuchtung; das Postieren von Polizei an den Kreuzungen; besseres Trinkwasser; noch einen Kindergarten; eine Kindersiedlung; eine Poliklinik; eine automatische Telephonstation; einen neuen Lebensmittelladen; eine Arbeiterfürsorge; einen Frauenklub; eine Bibliothek.
Andere Arbeiter standen auf und riefen, was sie forderten; »Einen Fahrradständer.« – »Heizung des Bahnhofes.« – »Reparatur der undichten Dächer.«
»Wer stimmt diesen Forderungen zu?« fragte schließlich der Vorsitzende.
Zweitausendfünfhundert Hände wurden erhoben.
Es wurde bald Zeit, daß diese Schicht zur Arbeit ging. Der Vorsitzende verlas hastig das Gesetz über die Wahl der Sowjets und verkündete dann vier Namen.
»Nach dem Gesetz«, erklärte er, »sind diese Männer, Arbeiter in der Frezerfabrik, von der Wahl ausgeschlossen. Wenn sie hier sind, müssen sie sich jetzt entfernen.«
Einer davon war ein früherer Kulak oder sogenannter »reicher« Bauer, ein anderer war Polizist unter dem zaristischen Regime gewesen. Der dritte war der Sohn eines Priesters, der vierte der Sohn eines früheren Arbeitgebers. Sie waren nach dem Sowjetgesetz nicht Bürger, weil sie oder ihre Eltern »Klassenfeinde« gewesen waren.
Diese Männer gehörten zu der großen und beklagenswerten Schicht der Menschen ohne Rechte, der Ausgestoßenen, der Parias, die in Rußland »Lischensies« genannt werden. Manche davon konnten nicht einmal Brotkarten bekommen. Heute finden diejenigen, die noch am Leben geblieben sind, allmählich ihren Weg zum Sowjetleben, denn nach fünf Jahren können sie das Wahlrecht bekommen.
Keiner der vier war anwesend. Der Vorsitzende führte die Wahl durch. Die Hände gingen in die Höhe. Wir fragten Clavdia Vinogradova: »Warum stimmt Ihr ohne Debatte für diese Kandidaten?«
»Weil«, antwortete sie, ihre »Jagd auf Menschen« schließend, »weil die Partei Vertrauen zu ihnen hat und wir Vertrauen zur Partei haben.«
Die vier Männer in olivgrünem Khaki standen auf. Das ist die Uniform, die in der letzten Zeit bei höheren kommunistischen Beamten beliebt geworden ist. Sie wurde niemals vorgeschrieben, aber ihre nach dem Muster Stalins geschnittene Bluse mit dem hohen Kragen und den zwei Taschen ist jetzt Mode.
Die Internationale war zu Ende. Der Vorsitzende ließ drei Hurras für die Regierung und drei Hurras für Genossen Stalin ausbringen. Die Menschen begannen hinaus zu gehen. Der Vorsitzende schrie: »Geht jetzt anständig hinaus. Nicht drängen. Benehmt euch wie kultivierte Proletarier.«
So wählten sie ihre Delegierten für den Moskauer Sowjet. In genau derselben Weise werden sich diese Delegierten versammeln und wieder Reden anhören, wiederum wird ein Mann in olivgrünem Khaki im Namen der Partei dem Ortssowjet eine Kandidatenliste empfehlen, und wieder werden alle Hände erhoben werden. Ebenso werden die Ortsdelegierten ihre Hände für die Kandidaten erheben, die die Partei für die Provinzialsowjets empfiehlt, sie werden dasselbe für die Kandidaten tun, die die Partei für das Zentral-Exekutivkomitee empfiehlt, die ihrerseits wieder dasselbe für das Präsidium tun werden, und so wird, immer durch Handerheben weiter gewählt bis zum Rat der Volkskommissare, der die nominelle Sowjetregierung ist.
Aber die Sowjetregierung hat eine Doppelform. Offenbar liegt die Macht in den Händen der Männer in olivgrünem Khaki. Wie werden sie, die Kommunisten, gewählt? Wählen die Kommunisten selbst für diese hohen Ämter der Partei, bei denen die wahre Macht liegt, wen sie wollen?
Auch sie, die Kommunisten, genießen die Sowjet-Demokratie. Jede »Zelle«, die unterste Einheit der Partei erwählt ihren Sekretär durch Handerheben. Auf dieselbe Weise wählen die Zellen ihre Delegierten für die regionale Parteikonferenz. Die regionalen Delegierten wählen wieder durch Handerheben die Provinzialparteikonferenz, und die Provinzialdelegierten wählen gleichfalls durch Handerheben die Delegierten für den Unionsparteikongreß, die nach den Gesetzen der Partei die höchste regierende Körperschaft der Partei bilden. Immer geht die Wahl durch Handerheben vor sich, und immer ist allgemein bekannt, welche Delegierten die Billigung der höchsten Parteistelle haben.
Diese höchste Stelle ist das politische Büro. An seiner Spitze steht sein Generalsekretär Joseph Stalin.
Das aus zehn Mann bestehende Politische Büro wird nominell vom Zentralkomitee der Partei gewählt, das 71 Mitglieder und 68 Stellvertreter hat. Das Zentralkomitee wird von dem Parteikongreß gewählt, der alle drei Jahre einmal zusammentritt. An dem letzten, im Januar 1934 nahmen 1225 wahlberechtigte und 736 beratende Delegierte teil.
Nur im Parteikongreß geht die Wahl durch geheime Abstimmung vor sich. Aber die Delegierten zum Kongreß werden durch Handerheben gewählt, infolgedessen ist, was sie wählen, sicherlich in Übereinstimmung mit den Wünschen des zeitweiligen Zentralkomitees, das heißt des Politischen Büros, das heißt Stalins.
Das Zentralkomitee, die eigentliche Regierung der Sowjetunion ist also eine sich selbst in Permanenz haltende Institution, die ausschließlich der Kontrolle ihres eigenen Führers, Stalins, unterworfen ist. Formal ist seine Macht nichts, verglichen mit der Mussolinis, der sich selbst gesetzlich zum ständigen Diktator gemacht hat. Ebensowenig gleicht Stalins Stellung der Hitlers, der sich gleichfalls zum gesetzlichen Chef der deutschen Regierung gemacht hat.
Stalin hat in der Sowjetregierung keine andere Stellung als die der Mitgliedschaft im Zentral-Exekutivkomitee der Sowjetunion. Das faschistische Parteigesetz macht Mussolini zum Herrn. Und auch das nationalsozialistische Parteigesetz macht Hitler zu seinem Herrn. Das Gesetz der kommunistischen Partei macht keinen Führer zum Herrn, aber sie hat immer einen gehabt, und die politische Struktur der Partei, die ursprünglich zur Demokratie tendierte, hat sich jetzt unwiderruflich in eine Einmann-Diktatur innerhalb der Partei kristallisiert.
Es ist überaus schwierig, Mitglied der kommunistischen Partei zu werden, und überaus schwierig, es zu bleiben. Der Fehler, den Kritiker des Sowjetsystems vielleicht am häufigsten begehen, ist die Annahme, die kommunistische Partei sei klein, weil sie unbeliebt sei. Das ist darauf zurückzuführen, daß der Name »Partei« im Hinblick auf die kommunistische Partei irreführt, weil sie gar nicht eine Partei im amerikanischen Sinne des Wortes ist, sondern eine exklusive militärisch-religiöse Kaste mit eiserner Disziplin. Obwohl die Macht in den Händen der Partei liegt, ist es durchaus nicht vergnüglich ein Kommunist zu sein. Ein fauler Mensch würde keine Freude daran haben.
Es gibt 1 872 488 Vollmitglieder der Partei und 835 298 Kandidaten oder annähernd 3 000 0000 erwachsene Kommunisten. Es gibt 4 000 000 Jungkommunisten und 6 000 000 Pioniere. Das gibt zusammen rund 13 000 000 Erwachsene, junge Leute und Halbwüchsige, die fraglos loyale Stützen des Regimes sind. Sie sind die gegenwärtigen und die künftigen Regierenden. Der Anzahl nach sind es 8 Prozent der Bevölkerung.
Sie sind Anhänger der Sowjetdiktatur, ob es den übrigen 92 Prozent recht ist oder nicht. Deren Hände werden trotzdem auf jeden Fall erhoben.
Wie viele liberale Abendländer, wie viele amerikanische Demokraten würden die Hand erheben, wenn die Wahl darum ginge: »Für Sowjetdiktatur oder amerikanische Demokratie?«
Rußland
Im Juni wurden sechs Ernährungsbeamte wegen »Sabotage« in Kiew erschossen. Im Juli wurden vier Ernährungsbeamte wegen »Fahrlässigkeit« in Leningrad erschossen, fünf Ingenieure wegen »Korruption« in Swerdlowsk, elf Beamte des Pferdezuchttrusts wegen »Fahrlässigkeit« in Smolensk und neunzehn Eisenbahnbeamte wegen »Sabotage und Spionage«. Im Oktober wurden drei Ingenieure wegen »Spionage« erschossen.
Es wollte fast so aussehen, als ließe der rote Terror nach. Daß es in sechs Monaten zu nicht ganz fünfzig Erschießungen kam, war ein gutes Zeichen dafür, daß das Sowjetregime, im Gefühl seiner Stabilisierung, sich einer ständigen Verbesserung des Lebensstandards in den Städten bewußt, durch die internationale Lage beruhigt, stolz auf die Fortschritte des zweiten Fünfjahresplanes, seinen Terror milderte.
Gewiß, die Umgebung Moskaus bietet Ausländern noch immer ein ungewöhnliches Bild. Draußen an der Leningrader Chaussee erhebt sich an dem einen Ende eines langen, mit Stacheldraht versehenen Bretterzaunes ein Turm. Weiter unten an der Straße bezeichnet eine andere Turmwache das Ende des Konzentrationslagers. Darin halten sich Gefangene auf, »Klassenfeinde«, die jetzt bei der Ausgrabung des Moskau-Wolga-Kanals verwendet werden. Es sind frühere »reiche Bauern«, und wenn sie fünf Jahre lang bei ihrer jetzigen Arbeit geblieben sind, können sie freigelassen und Bürger werden.
An der anderen Seite der Stadt, auf der Straße, die zu der »Sperlingshöhen« genannten Erhebung führt, von der Napoleon auf die brennende Stadt Moskau zurückblickte, beherbergt ein anderes Konzentrationslager ein zweites Heer von Gefangenen, die Zwangsarbeit leisten müssen.
Wie viele solcher Gefangener es in der Sowjetunion gibt, ist unmöglich zu sagen. Siebzigtausend wurden »amnestiert«, nachdem sie zusammen mit einer unbekannten Anzahl anderer den Kanal zum Weißen Meer gegraben hatten. Mit Bestimmtheit kann man sagen, daß es sich um eine sechsstellige Zahl handelt.
Aber das ist ein so gewohnter Anblick, und politische Gefangene gehören seit dem Beginn so sehr zum traditionellen Bild des Sowjetlebens, daß die Bevölkerung im ganzen die Gefangenhaltung in den Lagern kaum noch als Terror ansieht. Erschießungen, das ist etwas anderes. Und die Anzahl der Erschießungen hatte sich entschieden verringert. Es ist durchaus nicht ironisch gemeint, wenn gesagt wird, daß fünfzig Erschießungen im Lauf von sechs Monaten einen Niedrigkeitsrekord darstellen.
Plötzlich, inmitten dieser Ruheperiode, fiel ein Schuß in Leningrad. Ein unzufriedener Kommunist, ein Mann, der unter Kirow gearbeitet hatte und entlassen worden war, erschoß ihn. Kirow war der dritte Mann in der Regierung, er gehörte dem politischen Büro an, war der Herr Leningrads und ein Freund Stalins.
Seit dem Jahre 1918, in dem Lenin angeschossen und verwundet und Uritzky getötet wurde, war es zu keinem Attentat auf einen Sowjetführer gekommen. Einer der Gründe, weshalb keine weiteren Morde begangen wurden, war, daß die Sowjetregierung für den Schuß auf Lenin solche Repressalien ergriff, daß nachher jeder, der einen Attentatsplan hatte, wußte, er werde nicht nur sein Leben verlieren, sondern auch das unzähliger anderer opfern, das Leben eines jeden Menschen, der durch Bande der Verwandtschaft oder der Freundschaft mit ihm verknüpft ist.
Die Erschießungen setzten also wieder ein. Die Regierung sprach nicht ausdrücklich von einem Zusammenhang zwischen dem Mörder Kirows und den nächsten Hinrichtungen, aber jedermann wußte, was es zu bedeuten hatte, als die Regierung zunächst sechsundsechzig Erschießungen, dann mehr und mehr bekannt gab, bis innerhalb eines Monats nach Kirows Tod hundertdrei Menschen erschossen waren. Sie alle wurden der »Vorbereitung terroristischer Akte« angeklagt.
H. G. Wells hat im Hinblick auf die Sowjetunion gesagt: »Ich habe etwas für Planwirtschaft übrig, aber nichts für Erschießungen.« Ist das Abschießen, ist der Terror ein wesentlicher und unvermeidlicher Bestandteil der sozialistischen Planwirtschaft oder des Kommunismus?
Moskau ist anscheinend der Überzeugung, er sei es. Es gab Anzeichen dafür, daß ein liberalerer Geist sich in Rußland auszubreiten beginne. Heute hat die Kirow-Affäre das Land zurückgeschleudert in seinen alten Zustand der Anspannung und der Tragik. Alle erdenkbaren »Klassenfeinde« waren als Klasse bereits »liquidiert«. Die Monarchisten waren fort. Der Adel war weg. Die Großgrundbesitzer waren längst verschwunden.
Die Industriellen waren fort. Ein jedes menschliche Wesen, das jemals Arbeit vergeben hatte, war weg. Die wohlhabenderen Bauern waren verschwunden. Es war keine Klasse mehr übrig, gegen die das Proletariat hätte kämpfen können. Nun aber hat mit dem Attentat auf Kirow eine neue Menschenjagd eingesetzt.
Wie sieht der Kontoauszug der Sowjetunion nach siebzehn Jahren aus? Es folgt ein roher Überschlag.
Auf der Kreditseite ist, vom Standpunkt der Diktatur des Proletariats aus, eine enorme Kräftigung ihrer wirtschaftlichen Lage zu verzeichnen. Ein wirtschaftlicher Zusammenbruch ist, soweit man voraussehen kann, in der Sowjetunion nicht mehr möglich, es sei denn, es komme zu einem Krieg.
Alle Zweige des Wirtschaftslebens sind völlig sozialisiert worden. Im Jahre 1937 wird der letzte Einzelbauer im Kollektiv aufgegangen sein. Industrie, Handel und Finanzen sind schon längst hundertprozentig sozialisiert. Von der 168 000 000 zählenden Gesamtbevölkerung arbeitet kein einziges Individuum mehr zur Erzeugung von Gütern für eine Privatperson; kein einziges Individuum mehr kauft und verkauft für seinen eigenen Profit. Oder, um es in der Sowjetphraseologie auszudrücken: »Kein Mensch in der Sowjetunion beutet einen anderen aus, kein Mensch kann oder darf es tun.« Sie alle arbeiten für den Staat.
Die Bolschewisten haben mit Erfolg das erste Ziel des ersten Fünfjahresplanes erreicht: Rußland in solchem Ausmaße zu industrialisieren, daß es, sollte es notwendig werden, seine Industrialisierung allein, ohne Hilfe vom Ausland, fortführen und vervollkommnen kann. Mit Hilfe dieses Programms ist die Arbeitslosigkeit zum Verschwinden gebracht worden.
Es wurde ein imposanter Anfang zur Erfüllung des Hauptzieles des zweiten Fünfjahresplanes gemacht: die Belieferung der Städte mit Nahrungsmitteln zu verdoppeln, die Menge der Verbrauchsgüter zu verdreifachen und den Prozeß der Industrialisierung in einem Tempo fortzusetzen, das nur um wenig hinter dem des ersten Planes zurücksteht.
Der Lebensstandard der Gesamtbevölkerung ist wahrscheinlich noch nicht so hoch, wie er vor dem Kriege war. Trotzdem steigt er wahrnehmbar, und wenn auch noch einige Zeit vergehen wird, bis dieselbe reichliche Menge der Nahrungsmittel für die Gesamtbevölkerung da ist wie zu Zeiten der NEP, scheint nichts dagegen zu sprechen, daß der allgemeine Standard sich weiter heben werde. Die Zeit, in der der Lebensstandard des Sowjet-Arbeiters dem der Arbeiter in vielen westeuropäischen Ländern überlegen sein kann, ist bereits in greifbare Nähe gerückt.
Die Bauern sind in einer Weise organisiert worden, die auch nach der Meinung gegnerischer ausländischer Fachleute schließlich zu einer Produktion führen muß, die die Produktion der früher 90 Prozent aller Bauerngüter ausmachenden Zwerggüter bei weitem übertreffen muß, wenn sie auch vielleicht niemals so viel hergeben kann wie ein vernünftiges System mittelgroßer Güter in den Händen von Privatbesitzern.
Man hat nahezu jedermann in der Sowjetunion lesen und schreiben gelehrt und in der Jugend einen Wissensdurst erweckt, der in keinem anderen Lande seinesgleichen hat. Man hat der Jugend Freude gegeben.
Mit anderen Worten, die Sowjets haben bewiesen, daß ihr System des Staatskapitalismus, das sie Sozialismus zu nennen belieben, funktionieren kann. Es knarrt und ächzt noch und arbeitet noch nicht halb so gut wie die privatkapitalistische Maschinerie in guten Zeiten, aber das völlige Fehlen der Arbeitslosigkeit söhnt die Sowjet-Arbeiter mit den noch existierenden Mängeln aus.
Als Volk unter anderen Völkern hat die Sowjetunion in den letzten vier Jahren ihre Lage so verbessert, daß sie gar nicht wiederzuerkennen ist. Der Botschafteraustausch mit den Vereinigten Staaten und der Eintritt in den Völkerbund brachten der Sowjetunion eine doppelte Besiegelung der Aufnahme in die Völkerfamilie. Die Entente mit Frankreich bedeutet ein Bündnis mit der stärksten Militärmacht auf dem Kontinent. Japan ist, zumindest für die nächste Zeit, überzeugt, daß es zu viel kosten würde, gegen Rußland zu kämpfen.
Das sind die Hauptposten auf der Kreditseite. Was hat dafür bezahlt werden müssen?
Vom Standpunkt der Umwelt gesehen, waren die Kosten fast zu groß, um überhaupt als möglich gedacht werden zu können, und die Reihe dieser Posten ist so lang, daß die ersten bereits in der Erinnerung zu verblassen beginnen.
An erster Stelle steht der Verlust an Menschenleben im Verlauf der ersten roten Revolution im Jahre 1917 und des Bürgerkrieges bis 1920. Es handelt sich um eine siebenstellige Zahl.
Dann kommt der Verlust an Menschenleben während der ersten Hungersnot von 1921. Eine siebenstellige Zahl.
An dritter Stelle steht der Verlust an Menschenleben im Verlauf der zweiten roten Revolution – der des ersten Fünfjahrplanes – und des Bürgerkrieges mit den Kulaken. Diese Verluste und die der zweiten Hungersnot von 1932/33 sind wiederum siebenstellige Zahlen.
Wenn man die Anzahl aller toten Monarchisten, Aristokraten, Bürger des Mittelstandes, Vertreter der Intelligenz, Kulaken und politischen Gegner zu denen der den Sowjets treuen Bürger, die im Kampf gegen sie fielen, zählte und noch die Anzahl der Menschen, roter und weißer, die in den schlechten Jahren einfach Hungers starben, hinzufügte, könnte das Resultat eine Summe sein, die etwas über oder etwas unter der Zahl von zehn Millionen liegt, aber daß sie ungefähr diese Höhe hätte, ist überaus wahrscheinlich.
Bolschewisten würden sagen, daß der größte Teil dieser Verluste an Menschenleben nicht ihre Schuld sei, aber auch wenn dies wahr wäre, würde es nichts an der Tatsache ändern, daß diese vielen Menschen im Zusammenhang mit der Gründung und Festigung des bolschewistischen Regimes getötet worden oder gestorben sind. Und das Ende des Erschießens ist noch nicht abzusehen.
Wenn man zu der einen Million weißrussischer Flüchtlinge, die nach dem Bericht des Völkerbundes jetzt im Ausland leben, die Anzahl derer hinzufügt, die in den traurigsten Gegenden der Sowjetunion gelebt haben oder gestorben sind und zum Teil auch heute noch im Exil leben, und dazu noch die Anzahl der Menschen in Gefängnissen, Strafkolonien und Zwangsarbeitslagern zählt, wächst die Summe der im Gefolge der Revolution auftretenden Leiden noch mehr.
Aber noch immer ist diese Summe nicht vollständig. Denn die gesamte Bevölkerung der Sowjetunion mußte über einen Zeitraum von vielen Jahren ein Ausmaß von Entbehrungen ertragen, wie es kein Volk, das selbst über sein Geschick zu bestimmen hat, gelitten hätte.
Bürgerliche Kritiker des Sozialismus pflegten zu behaupten, wenn der Sozialismus jemals in großem Maßstab von einer ganzen Nation angestrebt werde, müsse er Schiffbruch erleiden, denn unter dem Sozialismus würden die Menschen alles sofort verbrauchen wollen und darum keine Ersparnisse machen, also auch kein Kapital bilden können. Diese Ansicht gründete sich auf die Annahme, daß der Versuch des Sozialismus innerhalb einer Demokratie gemacht würde.
Es kam aber so, daß der erste Versuch mit dem Sozialismus unter einer Diktatur und in einem halbasiatischen Lande angestellt wurde. Den Männern, die in Rußland »den Sozialismus aufbauen«, rechtfertigt ihr Ziel jedes Mittel: erzwungene Entbehrungen für alle, sie selbst nicht ausgenommen, vor nichts zurückschreckender Terror gegen die Feinde und reichlich verteilter Tod. Durch dieses Ziel ist in ihren Augen die völlige Unterdrückung der Redefreiheit, der Preßfreiheit und selbst der Denkfreiheit gerechtfertigt, denn Gedanken können gefährlich werden, weil sie eines Tages entschlüpfen könnten. Durch dieses Ziel ist für sie die Zerstörung aller Kirchen außer der Kirche des Kommunismus gerechtfertigt.
Mit diesen Mitteln, mit Begeisterung und mit Terror, errichten die Baumeister des Sozialismus ihr Gebäude. Man müßte blind sein, um nicht zu sehen, daß der Bau emporwächst.
Eine nächste russische Generation mag vielleicht die Kosten vergessen, heute aber türmen sich die Kosten für alle Betroffenen so hoch auf, daß der Amerikaner gezwungen ist, dankbar seines Passes zu gedenken. Daheim nützt sich der Gedanke der Freiheit ab. Sie ist in Hülle und Fülle da, also ist sie billig. Die Menschen reden sogar davon, ihre Freiheit für einen Posten zu verkaufen. Das Wort: »Gib mir Freiheit, oder gib mir den Tod«, ist aus der Mode gekommen. Aber wie oft kommt mit dem Verlust der Freiheit der Tod!
Unterdessen durchschneiden über dem Roten Platz Scheinwerferstrahlen unzählige Schneeflocken. Eine jede Flocke funkelt auf, fällt zurück in das Dunkel. Sie decken den ungeheuren Platz zu, wie sie es vor Jahrhunderten taten, als Iwan der Schreckliche jenes Monument der Qual dort im Hintergrund aufrichtete, die Kirche des Heiligen Basilius.
Die zahllosen Flocken fallen stumm auf den Nachbarn des Heiligen Basilius, auf das Grabmal Lenins. In seinem Inneren liegt der seit zehn Jahren tote Leib, als schliefe er. Draußen zieht sich eine dunkle Linie hin, bis sie an ihrem Ende von der Wolke wirbelnden Schnees verdeckt wird. Das Tor zum Grabmal öffnet sich. Geistern gleich bewegen sich die Menschen, aus denen diese dreifach gestaffelte Linie besteht, mit lautlosen Schritten. Sie rücken hinein, küssen den Toten, gehen fort, verschwinden im Schatten der Kremlmauer.
Seit zehn Jahren tun sie dies. Das ist Rußland. Sein Motto heißt: Leiden.