
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Sie hatten sich ein Häuschen an den Berg gebaut, ganz allein und abseits. Im Rücken des Städtchens – viel zu weit weg und viel zu hoch gelegen nach den gewöhnlichen Begriffen.
Da waren sie von den Menschen unbelästigt. Nur die Bauersleute gingen den Feldweg an ihrem Thor vorüber, und die in ihrer Derbheit und rauhen Gesundheit störten ja nicht. Nur die »verzierlichten« Menschen mochte Dr. Wehrsam nicht. Und den »Verkehr« war er müde. Er wollte allein sein, wollte sich leben, wollte leben und wollte sich nicht von den anderen leben lassen. Und ganz seiner Meinung war seine Frau.
So gehörten sie beide zu den stillen Leuten, in denen meist das Leben schwerer liegt als es für andere Leute aussieht, denen es nie so leicht und angenehm worden, wie die Leute meinen. Denn sie verraten nichts von sich, sie fühlen mehr als sie sagen. Es liegt oft gar nicht an den äußeren Lebensumständen, es liegt in ihrer größeren Tiefe zum Leben, die sie alles schwerer und wichtiger nehmen läßt, in denen ihnen das Kleine und Geringe gar zu leicht groß und bedeutend wird. Solche Menschen waren Dr. Wehrsam und seine kleine Frau Marie. Ja, sie waren vielleicht wirklich so lebensfremd, so unpraktisch, so unwirklich, wie die Leute sagten. Ja, sie waren vielleicht so große Träumer und Phantasten, wie sie verrufen worden. Sie selbst wußten, daß sie sich hatten, sie wußten auch, daß sie eine Enge um sich geschaffen hatten; aber sie fühlten sich nicht beengt, sie entbehrten nichts. Ganz im Gegenteil – sie fühlten sich wachsen und bemerkten mit lächelndem Behagen, wie es sich füllte in ihrem engen Kreise und wie sehr ihr innerer Sinn, und mit ihm ihr Lebensinteresse, darüber hinauswuchs. Sie sagten es einander nicht, und dennoch wußten sie, daß es eines vom anderen sich selbst sagte.
Dr. Wehrsam hatte seine Arbeiten, denen er sein Leben gewidmet hatte. Wieviel reicher reiften ihm hier in der Einsamkeit Früchte entgegen! Wieviel edler war jede Frucht, die er pflücken durfte, da sie ihre ungestörte Stille für ihr Wachsen und Reifen hatte! Wie war das früher so viel anders und schwerer gewesen im Getriebe draußen, wo so Vieles auf einen einwirkte, wo jeder das Recht zu haben glaubte, auf einen Einfluß üben zu sollen, einem mit seinen bunten garstigen Fetzen herauszuputzen und das eigene Ich zu beschneiden, zu rauben geradezu. Und es hatte trotzdem einmal eine Zeit gegeben, wo er geglaubt hatte, das laute Leben rege ihn an, es sei ihm unentbehrlich, und wenn er's aufgäbe, müßte er seine Kraft an sich selbst nutzlos verzehren lassen. Die Quelle seiner Arbeiten dünkte es ihm, der Trieb seines Schaffens. Nun hatte er erkannt, daß das, was er Trieb genannt hatte, nur Hast und Unruhe war, und daß die beste Quelle seines Schaffens sein eigenes Wesen war. Und wie er dieses läuterte und zur Tiefe leitete und zur Vollkommenheit, errang er sich auch seine Einsamkeit, seine Lust, seinen Frieden.
Dann hatte er sich das kleine Häuschen gebaut – an den Bergabhang droben, im Rücken des Städtchens und über ihm.
Da lebte er mit seiner kleinen Frau – beglückt in friedlicher Harmonie; aber doch nicht – nein, eigentlich doch nicht glücklich!
Frau Marie fühlte das am deutlichsten. Ihr blieb in allem ein Rest – ihr ging das Letzte ihres Wesens nicht auf. Er hatte seine Arbeit und sie – sie hatte ihre Beschäftigung und ihn. Zufrieden damit sein – ja, sie zwang sich ja dazu. Aber aufgehen darin bis zum letzten, sich darin gespiegelt sehen, sich selbst darin wiederfinden – ganz und bis ins kleinste erhöht – nein, das war nur ein Verlangen für sie. Und blieb ihr ein Verlangen, ein Sehnen, eine Qual. Und sie konnte nicht dagegen. Es lag nun einmal so in ihr, und es stieg ihr auf in den glücklichsten, wärmsten Lebensmomenten. Und es lag auf ihr wie eine Hypnose, wie ein Bann, dem sie sich nicht entziehen konnte, nicht entziehen wollte. Nicht wollte, nein, – denn es war eine Süßigkeit und eine Qual zugleich, es war eine geträumte Lust und ein wirklicher Schmerz. Es war ein seliges Leiden, die langen Jahre schon – und es gehörte schon ganz zu ihrem Wesen und Leben, meinte sie. Es hatte sich damit eins gemacht – und hatte die Herrschaft darüber gewonnen. Es hatte ihre ganze persönliche Artung bestimmt und bezwungen.
O, sie hatten ja so gut und glücklich gelebt! Die zehn langen Jahre lang. Da sie noch mitten drin im Getriebe gestanden. Und »sie hatten sich gute Tage gemacht«, wie die Leute sagten. Täglich Spaziergänge – wie sie wollten und wann sie wollten. Theater, Konzerte, Bälle. Kleine und große Reisen, ganz nach Lust und Laune.
Ja, – »sie paßten gut zu einander«, wie die Leute sagten.
Ach ja wohl – die Leute beneideten sie ja. Und doch –
Anfangs wußte sie ja nicht so klar und bestimmt, was es war, das ihr fehlte. Sie war noch so jung gewesen, da sie einander geheiratet hatten. Und gewiß – sie wollte »leben«. Leben! – was man so nannte in ihren Kreisen – sich unterhalten, sich vergnügen, sich zerstreuen. »Etwas haben vom Leben«, wie sie sagten.
Und einmal war's ihr doch aufgegangen, was ihr fehlte. Wie nichtig, schal, oberflächlich erschien ihr alles auf einmal! Sie dachte oft daran zurück. Es war so plötzlich über sie gekommen wie eine Offenbarung. An diese Legende von dem Engel mußte sie dabei denken, der der Jungfrau erschienen war –
Wie sie sich gesehnt hatte! Wie es ihr eins und alles war! Wie sich ihr alles darin vereinigte! alles darin zerstreute! Wie sich alles darin verlor und wie sie alles, gerade alles, alles darin gewann!
Ein Kind!
Wie sie gewartet und gewartet hatte! Wie sie gewünscht und gehofft hatte! Wie sie sich gesehnt hatte!
Es sollte doch ja ein Bube sein. Ein blonder, mit blauen Augen. Lange Locken würde sie ihm wachsen lassen! Und wenn er erst mal Höschen trüge! Immer in Samt wollte sie ihn kleiden.
Sie wurde in diesen niedlichen Vorstellungen, über die sie sich manchmal schalt, gar nicht müde. Sie waren ihr aber so wichtig – und sie konnte und wollte sie nicht los werden.
Ein Bube!
Aber es war vergebens. Und nun hätt's auch ein Mädchen sein dürfen. Und ganz gleich, ob blond oder braun – oder gar schwarz. Wie glücklich wollte sie sein! Wie wollte sie's pflegen! Wiegen, und wachen Tag und Nacht! Und immer nur sorgen für den »kleinen Engel!«
Und wenn sie mal groß wäre, die Kleine – neben der Mutter herginge, leicht, heiter – immer so festlich, immer lachend, der Sonnenschein selbst, der liebe Sonnenschein – –
Sie wollte es gar nicht zu Ende denken – sie konnte nicht. Es war nicht auszudenken, das mußte man leben – es war ja ein zu, zu großes Glück! –
Sie sollte es nicht haben. Es kam ihr anfangs so hart und schwer vor. All ihre schönen Tage – sie waren ihr nur Betäubung. Ja, wenn sie ganz allein war, am Fenster saß und auf die Straße sah, wo die Kinder spielten, da fühlte sie es auf sich liegen wie ein großes Leid. Sie fühlte einen Schmerz, der ihr alle Lust am Leben nahm. Als sei sie vergebens auf der Welt, als sei sie nutzlos all ihre Tage. Ohne allen Wert, ein Spielzeug, das einmal zerbrechen würde, um dann hingeworfen, vergessen zu werden. Und als sei all ihr Leben selbst nur ein Spiel, ein Getändel – für einen Augenblick – und vergehend mit dem Augenblick – ohne Spur, nichts hinter ihr, auf das sie zurücksehen, nichts vor ihr, auf das sie wirken, für das sie ihre Kraft einsetzen, auf das sie hoffen, ja sogar vertrauen könnte. Dann war ihr das Leben ein Schein, ein gaukelnder, trügender, hinsterbender Schein – eine Lüge. Und eine Trauer, eine wahrhaftige Trauer kam über sie, lag dumpf und schwer auf ihr. Sie bohrte sich manchmal hinein, sie riß, sie zerrte daran – mit wahrer Wollust anfangs – bis ihr eine harte, schmerzliche Erkenntnis kam: dann war ja auch ihre Ehe nichts als eine Lüge! Sie hatte ihren Zweck verfehlt – sie selbst und ihre Ehe mit ihr. Sie hatte nie darüber gelesen, nie darüber vortragen hören – sie hatte es selbständig gefühlt, und es war ihr eine Wahrheit und eine Erkenntnis geworden. Eine Verzweiflung überfiel sie. Sie fluchte sich – und all diesen »schönen« Tagen, die ihr wie Strohblumen vorkamen, die nie duften, wie Totenblumen, die nicht leuchten, kein Auge erfreuen, kein lebendiges Wesen anlocken – die wohl leben, und doch immer sterben und immer den Toten sind.
Keine Ernte würde sie haben – keinen Tag erleben, an dem ihr Herz reich, wirklich reich wäre. Sie haderte mit ihrem Schicksal. Das Beste und Höchste hatte es ihr, gerade ihr, versagt.
Sie hätte davonrennen mögen, all das verlassen mögen, was ihr da gegeben, aufgedrungen war, zum Genuß, zur Freude, zur Unterhaltung, zur Arbeit.
Aber dann dachte sie ihres Mannes. Sie konnte ihm kein Leids anthun, sie wollte es um alles in der Welt nicht. Er war ja so lieb und gut gegen sie. Und er würde sie auch gar nicht verstehen. Verdammen würde er sie und undankbar schelten. Und nicht so ganz mit Unrecht, denn er litt ja nicht wie sie.
In »Stimmungsstunden«, wie er sagte, stiegen ihm wohl gleiche Wünsche auf. Aber er litt nicht eigentlich. Er hatte seine Arbeit, seine Ziele, die nach einer anderen Seite lagen.
Von einem Sohne sprach er wohl auch einmal – wie er ihn erziehen wollte, wie er alles nach seinen Einsichten und Ideen in ihm formen und bilden und wecken wollte. Wie er dann mal im Leben stehen müßte, fest und mutig und stark, und auf einem ganz anderen, höheren, bedeutenderen Platz wie sein Vater.
Nun es aber nicht sei, erlebe man auch keine Enttäuschungen. Denn so schön man sich's auch ausmale, so gut man's auch vorhabe und mache – Enttäuschungen blieben nie aus. Gott – und Kinder habe man nur, um sie zu verlieren. Nehme sie der Tod nicht, nehme sie ganz gewiß das Leben.
Aber dennoch – ein Bub oder ein Mädel – oder ein Bub und ein Mädel – ach ja – er möcht's wohl auch haben. Eine Freud wär's, sie wachsen zu sehen, sich in sie hineinzuleben und alles Beste aus sich in sie zu legen und dann aufgehen und wachsen zu sehen. Und eine Sorge zu wissen und einen nächsten Zweck in aller Arbeit – es müsse ein Glück sein, müsse Kräfte geben und immer neue Lust und neuen Mut und einen stärkeren Trieb. Und müsse in aller Arbeit viel höhere Resultate zeitigen, weil dann das Nächste das Letzte werde, das man hinterlasse, das man als Vermächtnis gebe von seinem eigenen Wert. Einen guten Stolz müsse das hervorbringen und einen rechten Ehrgeiz, so Vater zu sein.
Aber da's halt nicht sei – dagegen könne man nicht. Kopfhängen und Verzweifeln gar, das habe keinen Wert und keinen Sinn. Man müsse sich darüber hinaussetzen.
Daß sie daran dachte! Nicht deshalb war's, daß sie ihm nicht wehthun konnte! Seltsam, wie sich immer in der Seele das Kleine vor das Große drängt! Was erwägte sie, wo dies eine so stark in ihr war und mächtig! Sie war noch jung, wohl, aber sie war längst und ganz Weib. Mit Herz und Willen. Sie hatte ihre Vergangenheit, ihre Familie, alles für ihn hingegeben. Sie hatte gekämpft und gelitten, sie hatte verachtet und hatte sich verachten lassen. Sie war erniedrigt worden und nur stolzer und stärker in sich. Und alles in ihm und um ihn! Er war das eine, das sie und ihr Leben bestimmte und ihr Leben war: sie liebte ihn! Das war ihr Schicksal und blieb über ihr. Und ihm unterwarf sie sich, willig und freudig, wie sich auch ihr Leben gestalten sollte, was es ihr auch versagen mochte.
Nein, nein, nein, sie konnte ihm nicht wehe thun. Er litt ja nicht – und wie tief sie litt, konnte er ja nicht ahnen.
So wollte sie still sein, ihren Schmerz tragen und verwinden, ihre Verzweiflung niederkämpfen. Ihrem Manne nicht weh thun, nicht die Lebenslust, die Lebenskraft vernichten.
Er that ihr alles, er dachte alles Schöne und Unterhaltende für sie aus. Und da sie schließlich doch auch in ihrer Jugend innerlich fest mit dem Leben verwachsen war, fand sie sich zum Leben. Langsam wohl und schwer – aber sie lernte den Wunsch vergessen und die Voraussicht unterdrücken. Sie schaffte sich neue Werte, die geringer waren als die hohen Werte des Lebens. Die vielleicht nur Scheinwerte waren; aber sie sah darüber hinweg, sie wollte sich keine Klarheit darüber werden lassen. Sie benutzte sie als Krücken. Dem Augenblick sollten sie nur dienen, über den Augenblick hinweghelfen, ihm einen Reiz und Schimmer geben, den sie hastig in sich eintrank. Fast gierig anfangs und unersättlich. So lebte sie, genoß sie. So freute sie sich. So hatte sie ihre Zerstreuungen – und so hatte sie ihren Trost. So war sie nach und nach mit dem Leben zusammengewachsen. An seinem Äußeren und seinen Nichtigkeiten ließ sie sich genügen. Ihre höheren Forderungen als Weib stellte sie mählich zurück. Daß ihr das Leben ihre Rechte nicht gegeben, sie ihrer Bestimmung entzogen hatte, suchte sie zu vergessen.
Ganz ging die Sehnsucht nicht, ging die Hoffnung nicht. In gar manchen Stunden fanden sie sich ein. Aber die Gewohnheit an den Gedanken des Unmöglichen und die momentane Befriedigung in den kleinen Freuden und leichten Genüssen, den Zerstreuungen der Geselligkeit, des Theaters, der Musik, Bücher und Reisen halfen ihr darüber hinweg. Und es gab Tage und Wochen, wo ihr die ganze Größe des Verlustes an ihrem Ich durch die Herabminderung ihrer Forderungen ans Leben nicht mehr voll zum Bewußtsein kam. Das eine aber blieb ihr immer und immer gegenwärtig, daß sie für ihre Ruhe ein Schönes und Großes hatte opfern müssen: der Stachel aller Resignation.
Nun aber, da sie die Stadt verlassen hatten und in ihr einsames Häuschen an der Bergeslehne hinter dem Städtchen gezogen waren, hatte sie alle Krücken von sich geworfen. Stolz und freudig erkannte sie, daß ihr Selbst nichts eingebüßt hatte, daß ihr durch ihren Verlust nicht einmal ein Schaden erwachsen war, daß er ihr zum Gewinn geworden war: denn ganz fühlte sie sich auf sich selbst gestellt. Und fühlte sich stehen, fest und sicher. Und so wußten sie beide, ihr Mann und sie, daß sie sich hatten. Sie entbehrten nichts in ihrer Enge, sie füllten sie an wie eine Schatzkammer und verriegelten sie und ließen kein fremdes Auge hineinblicken und hüteten ihre Schätze, die gleichen Schätze, die sie sich errungen hatten und sich nun ganz auf die gleiche Art bewahrten. So war eine Stille und eine Einsamkeit, eine Fülle und ein Frieden in dem kleinen Hause an der Bergeshalde hinter dem Städtchen – und weit über ihm.
Und so vereint, und so eins, lag die Welt vor ihnen in Glanz und Sonne, und sie liebten sie vom kleinsten Steinchen bis zu den wechselnden Wolken und fühlten sich eins mit ihr und Herren über ihr. Sie sagten nichts von ihrem Glück – sie fühlten nur, wie alles Lebendige in sie strömte, daß das Leben ein Glück, das Glück sei.
Das Leben sei das Glück! – hatte sie's wirklich so ganz und recht verstanden! Nein, nein, seither – geahnt hatte sie's, aber doch – wenn sie ganz ehrlich war – ein Trost war's ihr mehr und eine Zuflucht. Aber nun wußte sie's, verstand sie's, lebte sie's – das Leben ist das Glück! – nun da sie in die Tiefe des Lebens stieg, wo ihr die letzte Offenbarung des Glückes ward, die des Lebens letzte Offenbarung war.
In ihren »Freuden« war ihr Leiden und Sehnen heimlich lebendig in ihr geblieben – wie dankte sie ihm nun. Es hatte ihr das Auge für diese Tiefe erschlossen. Sie ging wie im Traum und wußte doch die Wirklichkeit und wußte sie zu deuten, zu verstehen und zu werten. Sie genoß tiefer und fühlte sich doppelt erhöht.
Jetzt, da sie alle Hoffnung aufgegeben, ihr Leid verrungen hatte, dies unerwartete Glück! Diese Aufrüttelung, da sie sich in ihrer Ehe so sicher fürs Leben eingerichtet und festgesetzt hatte.
Nun war ein Bangen in ihr, ob sie das Schicksal nicht narre, ob es sie nicht doppelt bitter enttäuschen wolle, daß sie totwund wäre für immer.
Aber nein – sie durfte gewiß sein. Und sie ward ganz außer sich. Ganz betäubt war sie. Jubeln, jauchzen hätte sie mögen wie ein Kind. Die Welt schien ihr Frühling, Sonnenschein, Farbe, Duft, Glanz. Voller Kraft, voller Trieb, voller Blüte schien sie ihr. Und schien sie zu umfassen, zu erfüllen, zu stärken, zu heben. Und schien ihr allein für sie.
Das Leben ist das Glück! Es ist ein Glück, zu leben. Darin gipfelte ihr ganzes Fühlen. Und sich selbst fühlte sie wie ein Wunder, wie einen Traum, hineingesetzt in die leuchtende Gottesherrlichkeit.
Sie hätte weinen mögen. Und immer lachen. Wie eine Heiligkeit lag es in ihr, voller Weihe und Andacht und Dankbarkeit. Gütige Hände lagen auf ihrem Scheitel. Gotteshände! Und selige, trunkene Augen blickten zur Höhe. Sie zitterte. Sie war eingeführt in die Reihen der Lebendigen. Sie fühlte sich so wunderbar rein, so ohne Verlangen und Glühen, nur voller Erwartung und Gnade. Gesegnet, zur Mutter gesegnet, vom ewigen Odem des Schöpfers durchdrungen.
Sie war aus ihrem Grabe auferstanden, sie war dem Leben wiedergegeben, wie eine Verklärung kam ihr das vor. Und jetzt verstand sie das Leben ganz, jetzt, da sie sich Weib fühlte in seiner ganzen Tiefe, in dem all und einen: Mutter! –
Sie mußte fast über sich lächeln. Sie schalt sich. Mutter! Mutter! Mutter! hätte sie sich den ganzen Tag sagen mögen – und immer neu und schöner schien ihr dies Wort, voller Wonne und Schauer.
Mutter!
An ihre Mutter dachte sie. Daß sie ihrer Mutter Kind ja sei. So groß und tief kam ihr das vor. Immer lag ihr dieser eine simple Gedanke in der Seele, sie hegte ihn freudig und sie fühlte ihn mächtig über sich.
Ein Kind!
Einem Kinde sollte auch sie das Leben geben! In diesem Satze lag ihre höchste Seligkeit. Da fiel alles Schwärmen und Außersichgeraten weg, ward klein und verblaßte vollständig. Alles andere war ihr ein Stammeln – dies war ihr Musik, freudige, jauchzende, feierliche Musik.
Als sie's ihrem Manne gesagt hatte, lächelte der. Ach, sie bilde sich 'was ein.
Aber sie blieb dabei. Und bald mußte er's zugeben.
Er war nun bald an den Vierzig. Er hatte nun so seine festen Gewohnheiten. Aber er freute sich doch. Er finde sich nicht sogleich und ganz hinein, meinte er – er könne sich noch nicht so recht vorstellen, wie das auf ihn, auf all ihre Lebensverhältnisse wirken werde. Aber er freue sich – und ein wenig stolz sei er auch. Wenn's ein Bube wäre, wolle er sogar sehr stolz sein.
Ob sie denn auch froh sei? – Aber Gott, er denke mit einem halben Schrecken daran – da werde sie viel auszuhalten haben. All die Monate noch – das werde ein Dulden sein!
Wenn es sie nur nicht so arg mitnehme! Da werde sie jetzt manchmal ihren Gang auf die Berge nicht mehr machen können, werde sie zu Hause sitzen müssen. Dann dürfe sie ja nicht traurig werden. Der Mensch erkaufe meist sein Glück recht teuer, und besonders die Natur sei hart gegen die »Krone der Schöpfung«.
Sie wurde ein wenig herabgestimmt. Hatte er keine anderen Gedanken, keine höheren Gefühle jetzt! Konnte er sich nicht zu einem rechten Glücklichsein aufschwingen, in anderem freilich zu finden als in dem, was seither in seinem Kreise lag! Sie war geärgert, gekränkt, ja fast bös auf ihn.
Und doch war er so gut, gleich dachte er an ihre Schmerzen. Er tröstete sie im voraus. »Arm Mutterchen!« – hatte er sogar einmal gesagt, als er sie unwohl gefunden hatte.
Arm! – nein. Sie wollte gerne all die Schmerzen tragen – auch Trost sollte ihr nicht helfen dabei. Sie wollte den Leidensweg der Mutterschaft von Stufe zu Stufe gehen, klaglos, freudig sogar – um dann ihr Glück um so höher schätzen, um so tiefer genießen zu können.
Und manche schwere Stunde kam. Und manchmal verbiß sie ihre Thränen.
Sie arbeitete an all den kleinen Siebensachen, die vorläufig vor profanen Augen verborgen gehalten wurden, selbst vor denen des Mannes, und die Frauen so hehr und wichtig nehmen. Bei denen sie wieder Kinder werden, kleine Mädchen, voller Träume und glücklicher Vorstellungen. Alles wird ihnen so bedeutungsvoll dabei, alles Kleine und Zufällige – und sie nähen und häkeln Schicksale und Zukünftiges in die Hemdchen, Jäckchen, Binden, Windeln, Deckchen, Kleidchen und Kissen. Und sie formen so an dem Herzen, das mit ihrem Herzen schlägt, an der Seele, die in ihrer Seele lebt. Spielend geben sie dem werdenden Leben das Bedeutungsvolle seines Inhalts, dienen sie der Zukunft.
Wenn sie Stückchen nach Stückchen halb verschämt ihrem Manne zeigte, lächelte er wohl.
»O du heilige Einfalt!« spöttelte er gar.
Aber die »heilige Einfalt«, die saß ihr jetzt zutiefst im Gemüte. Diese Männer, ja die verpflänzchen. stehen das nicht, dies ganz Stille, ganz Leise, ganz Heimliche. Dies Hoffende, Zufriedene. Selbst bei einem so Einsamen, wie ihr Mann einer war, ging doch alles Wirken schließlich nach außen, unruhig und beharrte nicht. Immer Glied in der Kette, nie ganz abgeschnitten, nie bis zum letzten Rest für sich. Nie ganz hingegeben und ganz verloren. Das aber war's nun, was ihr so andere, reichere Ausblicke ins Leben eröffnete, daß sie sich so innig ins Leben verloren hatte. Wie viel mehr sie nun vom Leben wußte, als diese Männer mit ihrem Stolz, das Leben zu kennen. Sie wollen immer das Leben ausschöpfen – die Mutter aber ist begnadet, es zu erfüllen. Tief dankbar war sie darum ihrem Schöpfer, daß er sie noch erwählt hatte.
Und dankbar war sie ihrem Manne, daß er so gut war. Er that ihr, was er ihr an den Augen absehen konnte, wie rührend sorgte er für sie. Und er fand noch Zeit und Sinn für all die lieben Kleinigkeiten und Aufmerksamkeiten, die ihr jetzt so wohl thaten. Sie rechnete es ihm hoch an, daß ihm das all so einfallen konnte, da es ihm doch eigentlich all so fern lag.
»Du wickelst mich noch in Decken, Alterchen«, scherzte sie, »und bald wirst du mich in ein Glashäuschen gar setzen, daß ich von jedem windchen abgeschlossen bin, wie ein Treibhaus-* Aber ich bin stark und gesund und voller Freudigkeit und Zuversicht. Und ich hab eine eiserne Energie, das wußtest du gar nicht«, meinte sie.
Aber er mahnte. Es sei noch die Hauptsache zu erwarten. Sie möge sich nicht darüber täuschen, dann gehe es auf Tod und Leben.
Sie lachte ihn aus. »Leben! es gelte ja das Leben jetzt erst, was brauche er an den Tod zu denken! Daß sich die Menschen immer damit bange machen müßten – aber den müsse das Leben schon wert sein, – und ihr sei es den Tod jetzt wert geworden.«
So sprach sie – aber ihre Seele zitterte doch ein wenig. Es hatte sich ihr eine schwere Hand auf das Herz gelegt, und sein Schlag stockte ein wenig. Aber sie entwand sich. Und sie gewann die Vorstellung für die ganze Größe des zu erwartenden Augenblicks. Und sie beugte sich ihr und ergab sich ihr voll Vertrauen und Energie.
Ihr Mann war nun die Fürsorglichkeit selbst. Eine wunderbare Weichheit und Zärtlichkeit war in sein Wesen gekommen. Früher war er gut gewesen, jetzt war er liebreich geworden. Er hatte früher hauptsächlich seinen Interessen gelebt, jetzt widmete er sich ihr. Das Befinden seiner Frau war seine einzige Sorge. Und auch wirklich seine Sorge.
Sie sprachen oft zusammen von dem Kinde.
»Er habe eigentlich keine rechte Vorstellung«, meinte er. »Ach, – und er denke immer fast mit Angst daran.«
»O – es werde sein wie Sonnenschein, wie ein plötzlicher Lichtstrahl im Dunkeln. Oder wie Himmelsblau, klar und rein. So fühle sie's, und sie wisse es nicht zu sagen.«
Er regelte ganz genau ihr Verhalten. Vorsicht in allem, auf ihre Gesundheit bedacht sein, in Essen und Trinken das Kräftigste, Zuträglichste, während sie fast nur an das Kind dachte, dachte er fast ausschließlich an sie.
Es war eine besondere Innigkeit in ihr Zusammenleben gekommen, etwas Heimeliges, Liebes, das deutliche Gefühl der Zusammengehörigkeit, des Einandernötigseins. Das beglückte so sehr, weil es so tief befriedigte, machte ruhig und heiter. Frau Mariens Leben ging wunschlos hin, – bis auf den einen Wunsch für sich, der ihr alles war, und der denn auch immer lebendig blieb. Aber ohne diese brennende Qual zu verursachen, wie die anderen Wünsche der Menschen, die das Äußerliche des Lebens, seinen Schein und seine angenehmen Nichtigkeiten betreffen, an die sich die Herzen so leicht hängen, um sich darin zu verlieren und zu entwerten.
Sie war eine schlichte, gute Frau. Sie hatte nichts Auffälliges, Aufdringliches und Sensationelles an sich. Sie trug aber doch ihre Sensationen des Gemüts in sich, tiefer, heißer vielleicht als die, die sie stets ausdrücken; – und auch ausdrücken lernen, wo sie in Wirklichkeit nicht vorhanden sind. Denn sie war wahr. Und sie hatte ein gutes, warmes Herz, ein weiches, leichtbewegtes Gemüt und ein stilles, feines Empfinden. Still war sie. Sie reichte sich nicht aller Welt auf dem Präsentierteller. Sie war sparsam in ihren Worten, ja für manches Gefühl fand sie das Wort nicht gleich. Sie wollte es vielleicht auch gar nicht. Es fehlte ihr geradezu die Energie des Sichausdrückens. Sie war zufrieden, daß sie das fühlte, und wie sehr und ganz sie's fühlte, wußte sie genau. Das genügte ihr. Sie war nicht öffentlich, sie gehörte in ihre enge Behausung. Ihr größtes Glück war das Alleinsein. Darauf war ihr ganzes Wesen gegründet.
Wie froh war sie nun für die Einsamkeit!
Und die früheren Jahre voller Abwechselung und Zeitvertreib dagegen! Wie sehr hatte sie sich von sich selbst entfremdet! Und doch war sie froh darum gewesen, damals, wenn sie sich auch nicht behaglich dabei gefühlt hatte. Es hatte ihr doch über so vieles weggeholfen. Aber jetzt – jetzt lag es ihr vollständig fern. Nun wollte sie ganz und nur sich selbst sein. Und von nun an konnte sie's – konnte sie's immer: in ihrem Kinde.
Einmal fiel ihr ein – ob sich ihr Mann nicht eines Tages ins laute Leben zurücksehnen würde!? Ob er nicht eines Tages die Einsamkeit müde sein könnte?!
Sie erschrak heftig.
Aber eine starke Sicherheit kam über sie. Wenn es dann einen Kampf gäbe, sie wollte ihn kämpfen. Und sie würde siegen. Denn dann sei sie nicht mehr nur das Weib, dann habe sie die Kraft der Mutter.
Ach diese Angst! Sie lächelte. So weit würde es ja nicht kommen. Auch ihr Mann war ganz mit der Einsamkeit verwachsen. Und wenn nicht – er war ja gut.
Und das Kind – es wäre ja auch sein Kind. » Mein Kind und sein Kind!« jauchzte es in ihr. wie das groß, groß, groß, wahrhaft groß machte! Und wie das Leben gut war! welche Höhen es doch hatte, was für wunderbare Tiefen! Ein Glücklicher und Hochbegnadeter, der sie finden, schauen, in sich durchleben durfte! welche Offenbarungen es hatte! Daß sich der, dem sie geworden, selbst wie eine Offenbarung fühlte.
Die höchsten Leiden war das Leben wert!
So in ihrem Innersten lebendig, aufgewühlt und erschlossen, lebte sie die Zeit hin, bis der Tag ihrer Entbindung kam.
Dr. Wehrsam hatte den Arzt zur Amme bestellt. Er wollte sicher sein. Es sollte nichts versäumt werden. Eine ungeheure Verantwortung fühlte er auf sich ruhen.
Seine Frau litt furchtbar. Sie hatte ihn an ihr Bett gerufen, er möge ihr die Hand geben. Sie dulde alles leichter, wenn sie seine Hand halte. Sie preßte sie wie mit Schrauben in ihren Wehen. Er sagte nichts, er hielt's gerne aus. Und er mahnte sie, Geduld zu haben, ja nicht zu verzweifeln. Es werde bald vorübergehen. Dann sei's gut – es gehe ja alles vorüber – und dann werde sie beglückt sein und sich freuen.
Und wieder und wieder riß der Schmerz in ihr.
»Es sei furchtbar«, stöhnte sie. »Aber sie wolle es ja aushalten, gerne aushalten, wenn nur das Kind keinen Schaden davon habe.«
Ihr Mann tröstete sie, – mit den leeren Worten ängstlicher, schwerer Augenblicke. Dabei war er furchtbar aufgeregt. Alles zitterte in ihm. Er mußte beständig in Bewegung bleiben. Er täppelte hin und her. Er war vollständig trocken im Munde, hatte einen spitzen, sauren Geschmack. Wenn's nur vorbei wäre! Er hätte jetzt selbst körperliche Schmerzen aushalten mögen – nur um die seelischen Leiden nicht so schwer zu empfinden. Und auch aus Gerechtigkeitsgefühl – so war's ihm dunkel.
Dann sagte die Amme, nun sei's überstanden.
Und gleich ein Schrei.
Die Frau hatte ihr Haupt matt in die Kissen zurückfallen lassen.
»Ach Gott!« – seufzte sie.
Es war ein Mädelchen, ein kräftiger, »gesunder Brocken«.
Als ihr nach einer Weile – sie schien der Mutter ewig lang – die Amme das Kind zeigte, lächelte sie. Ganz matt und müde, – aber ihre Augen leuchteten. Es war ein Strahlen in ihnen, das nicht glitzerte und gleißte, nicht funkelte und glühte – es hatte nur eine Ruhe und eine stille, sanfte Wärme. Es gehörte nicht dem Augenblick – es war wie ein Blick in weite Fernen, die nicht schwanden, – in goldnen Morgenglanz. Es war wie ein Blick in die Ewigkeit – die Seligkeit selbst war dieser Blick. Darum hatte er auch so wunderbar ihre Züge verändert, hatte ihr in ihre matte Müdigkeit etwas Lebendiges gegeben, in ihre Schlaffheit eine Bewegung. Über das Leidenvolle ihres Antlitzes war ein Schein des Glückes gebreitet, eine Jugend, ein Kindliches. Es war alles dies Eine, dies unbegriffen Tiefe, das sich darin ausdrückte, diese Liebe und göttliche Leidenskraft der Mutter.
Und dieser Zug, der ihr Antlitz veredelte, blieb von nun an immer darin, und ihr Auge behielt die Schönheit dieses ruhigen Glückes und stillen Friedens.
Sie war glücklich, obgleich sie sich körperlich sehr schwach fühlte. Und auch, als sie das Krankenbett verlassen hatte, verlor sich diese Zerbrochenheit ihres Körpers nicht.
Sie schlug das aber nicht an. Sie war unermüdlich in der Sorge für ihr Kind. Es fiel ihr alles leicht, weil sie's so freudig that. wenn auch eine doppelte Ermüdung dann folgte. Immer wieder riß sie sich auf. Ihre freudige Erregung half ihr alles überwinden. Sie dachte nicht an sich, sie lebte nur in ihrem Kinde. Und wie es wuchs und gedieh, wuchs sie mit ihm, wuchs ihr Herz mit, das die verborgenste Schönheit des Lebens in sich lebendig fühlte. Ihre Seele wuchs zur Größe – und ward groß.
was sie die Jahre entbehrt, ersehnt, erträumt, sich vorgebildet hatte, es war ihr erfüllt. Das meiste von dem, was sie geschätzt, genossen, oft sogar geliebt hatte, war ihr entwertet. Nichts forderte sie vom Leben mehr, – und gar die Lautheiten des Lebens in Festen und Feiern waren ihr leer geworden. Sie trug eine selige Feier, eine feierliche Festlichkeit in sich. Sie hatte eine Ruhe und einen Reichtum, in ihren vier Wänden lag ihr eine ganze, wirkliche Welt.
Sie besaß die Einsamkeit.
In ihrem Kinde lebte sie ihrem Manne. Ja, sie ertappte sich dabei, daß sie nur noch an ihn als an den Vater dachte. Und ganz anders war ihre Liebe geworden.
Oder war's jetzt erst die Liebe?
Diese Liebe, die jeder Mutter eine Welt offenbarte und das Tiefste des Lebens gab. Wie mußte sie in jedem Weibe, das Mutter ward, ein Wunder der Schöpfung sehen und sie verehren. Im geringsten wie im vornehmsten Weib, das ein Kind getragen. Ob dieses Wunder ihm bewußt war – oder unbewußt blieb.
Wie tief menschlich erschien ihr die Marienverehrung, wie göttlich! Wie tief gemütvoll und undogmatisch!
Sie erschrak fast, wieviel ihr das eine Erlebnis eröffnet hatte, wieviel es sie von allem Leben und Verstehen gelehrt hatte.
Und das war's, wußte sie, was hieße: Mensch sein!
Ganz anders erfaßte sie die Arbeiten ihres Mannes, ganz anders begriff sie ihn. Von allem Geformten und Angelernten waren die Gespräche mit ihm entkleidet – jedes Wort hatte seinen eigenen, von ihr gelebten Sinn. In alle Dinge und in alles Sein legte sie den Sinn ihres Erlebens. So war ihr alles neu aufgegangen – die Welt tiefer, weil ihr eigenes Wesen tiefer war.
Viel feiner, empfindlicher und empfänglicher war ihre Seele geworden. Das Leiseste übte einen Eindruck auf sie und behielt sich in ihr. Sie war zarter geworden, und eine nervöse Spannung lag in ihr. Manches wirkte auf sie, that ihr sogar weh, was sie früher nicht beachtet hätte. Manches stieg plötzlich in ihr auf, was sie ängstigte, weil es eine Gereiztheit und Feindlichkeit in ihr erzeugte, die sie früher nicht gekannt hatte, die sie egoistisch, parteiisch machte und zu manchem in ein schiefes, ablehnendes Verhältnis setzte.
Darunter litt sie. Aber sie konnte nicht dagegen. Wie sie sich auch wehrte, es behielt Macht über sie. Es war manchmal eine Furcht, ein Gespenstersehen, eine Ärgerlichkeit, eine Phantastik, eine Traurigkeit und eine Ausgelassenheit, das sie quälte. Sie sah Fremdes in das Eigene, Liebe, Bekannte.
Einmal war's ihr, als müsse sie ihrem Manne feind sein. Er freute sich ja auch, daß sie das Kind hatten, er war gewiß auch glücklich. Allein er hatte in allem ein Aber. Das kränkte, verstimmte sie, machte sie ihm feindlich. Die Liebe, die er zu dem Kinde zeigte, genügte ihr nicht. Er war besorgt, er spielte mit dem Kinde, er herzte es.
Dann war er oft lange still.
»Nun, Alterchen, weißt du nichts zu sagen?«
»Was soll ich sagen?«
»Bist du nicht froh, glücklich, ganz von Herzen glücklich?«
»Doch, Mütterchen! Sehr froh und von Kerzen glücklich.«
Dann gab es eine Pause, die ihr tief peinlich war.
»Aber du hast deine Kraft eingebüßt, Mütterchen«, sagte er dann.
Sie war erregt aufgefahren.
»Es hat dir die Jugend genommen – das Leben ist doch hart, und sein Glück ist teuer.«
»So gefall' ich dir nicht mehr?«
Er war verblüfft.
»Und ist dir das bißchen Schönsein und Jugend lieber als das Kind, in dem wir beide leben, viel schöner und jünger, – in dem wir wachsen und werden, – während wir selbst still stehen?«
Er hatte sich gefaßt. Er lächelte. Er verstand sie. Die feinsten Fäden einer Frauenseele hatte er mit rauher Hand berührt. Aber auch in ihre Tiefe hatte er einen vollen Blick gethan. Wie vor etwas Heiligem stand er, fromm und scheu. Er beugte sich zu ihr nieder und wischte ihr die Thränen von den Wangen.
»O du Mutter!« sagte er, ohne recht zu wissen, warum er das jetzt sagte. Er fühlte nur, daß er so nur ausdrücken konnte, was er eben wollte, wie er auch suchte, er fand nichts anderes. Er wiederholte es.
»O du Mutter!«
Dann setzte er sich neben sie und nahm ihre blassen schmalen Hände, die wie Wachs waren. Nur vom Blau der Adern durchzogen. Sanfte, ergebene Hände.
»Du verstehst mich falsch«, flehte er, und seine Stimme war weich und mild. »Ich bitte dich, errege dich nicht. Du bist angegriffen, du bedarfst der Erholung. Ich werde den Arzt fragen – geh an die See, ins Gebirge, damit du wieder zu Kräften kommst. Ich will das Kind schon hüten, du darfst beruhigt sein.«
Sie gab das alles nicht zu. Und von dem Kinde könne sie sich nicht trennen, keinen Tag. Sterben müsse sie dann.
»Aber es wird sein müssen«, meinte er. »Du lebst hier nicht mehr, du bist wie im Traum. Du lebst dir nicht mehr. Du sollst dir wieder leben lernen. Und du wirst dein Kind gerad so lieben können, und mehr noch, wenn du gesund bist.«
»Ich bin gesund.«
»Du bist krank. Du lebst zwei Leben, – eines, das blüht und sich erneut – das Leben in deinem Kinde – und dieses andere in dir, das welk ist und hinsiecht. Das ist wider alle Vernunft.«
Aber wie er auch zuredete, es half nicht.
Sie nannte es ihre Liebe zu ihrem Kinde – es war aber die Macht einer unheimlichen Angst, die sie festhielt.
Sie ging nicht.
»Wenn sie ginge, müsse sie sterben.« Das war ihr zur festesten Gewißheit geworden.
Sie blieb und siechte hin.
Und still und tief ergriffen beobachtete es ihr Mann. Er war machtlos.
Das Kind gedieh – sie welkte mehr und mehr und ward schwächer und schwächer.
Aber sie wollte sich dessen nicht bewußt werden. Selbst ihr Spiegel sagte ihr es nicht. Sie war außerhalb alles Lebens, und hundertmal, fast im Zusammenbrechen, kommandierte ihre Seele ihren Körper.
Doch die völlige Erschöpfung blieb nicht aus. Sie mußte das Bett hüten.
Und eines Abends forderte sie ihr Kind. Sie müsse es jetzt haben. Daran hänge ihr Leben.
Sie betrachtete es lächelnd und küßte es.
»Sie könne ja nie sterben«, sagte sie, »sie lebe in ihrem Kinde.«
»Warum sie vom Sterben rede?
»Das sei ihr jetzt so lieb geworden. Und es sei ihr, als erringe sie damit das Höchste ihres Lebens und lerne ihr Kind nur noch tiefer lieben. Weil sie ihm damit ihr Leben auch erst ganz und allein gebe. –
»Als gäbe sie ihm darin die letzte Kraft ihres Lebens, sei es ihr.«
»Ob sie denn gar nicht an ihn denke, und ihm, ihm und dem Kinde leben wolle?« fragte sie ihr Mann.
Sie sah ihn groß an.
»Ob das Sterben danach frage? Und er müsse sein Kind wenig gern haben – und sie – denn er gönne ihr nicht mal, für ihr Kind sterben zu dürfen. Sie wolle ihm nicht nur das Leben gegeben haben, sie wolle auch ihr eigenes Leben für es geben. Dann sei sie ganz seine Mutter.«
Der Arzt selbst fand hier keinen Rat mehr.
Ihre Seele hatte sich der Körperlichkeit entschwungen und ging in der Seligkeit ihrer Ekstase.
Sie wollte ihre Bestimmung und würde ganz erfüllen.
Diese Auffassung bezwang sie. Sie unterlag ihr und starb.
Ihr Sterben war nur der Triumph ihrer Liebe die Verklärung ihrer Mutterschaft.
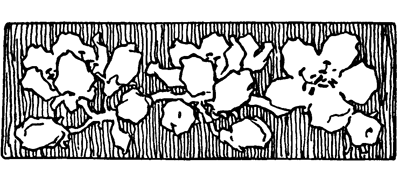
Dr. Wehrsam liebte sein Kind herzlich. Er liebte es mehr und mehr, wie es gedieh und sein Geist sich entwickelte. Seine Liebe wuchs, wie sich die Beziehungen von Seele zu Seele anknüpften und fest verbanden. Wie er lebte in seinem Kinde und sein Kind ein Teil seines Selbst ward.
Aber wie inniger auch das Band wurde – er konnte das Opfer der Mutter nicht vergessen. Seine Liebe war voller Trauer und Wehmut.
Er wurde alt und grau, sein Töchterchen wurde groß und schön. Und es wurde Frieden in ihm. Seine Tochter war die Mutter, in verjüngter Kraft
Er begriff das Leben in ihr und ward ihm gut. Und er verlernte die Trauer.
Und er wußte ganz, was Liebe heißt.
Das lehrte ihn die Weisheit alles Seins und Werdens, und ihre Milde verklärte sein Alter.
Und sein Alter war schön, und sein Sterben.