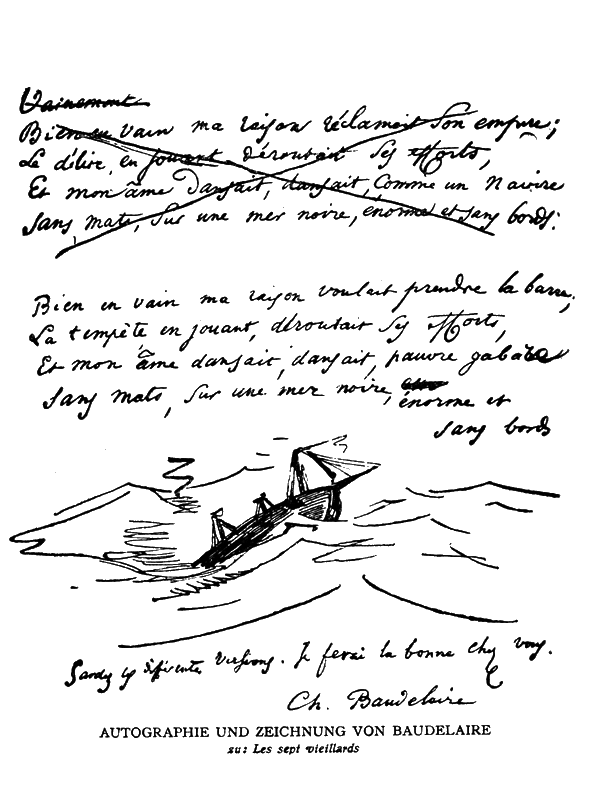|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Baudelaire im Jahr 1844
Nach einem Gemälde von De Roy
 Baudelaire gehörte nicht zu jenen, die blind und trunken von Jugend in den Lichtschein der Schönheit hineintaumeln, im ersten Rausch der Kraft, fast bewußtlos Rhythmen hinausschreien, an deren Rechtfertigung sie dann nicht selten Not und Lust eines langen Daseins wenden; sein Bild der Schönheit taugte solchem Überschwange schlecht, zu tief lag die Ehrfurcht vor den Riten der Form in ihm verankert. »J'unisuncoeur de neige à la blancheurdes cygnes, Je hais le mouvement, qui déplace les lignes ...« Diesem Bild einer Gottheit naht kein formloses Drängen, weitab von überschäumenden Strudeln spült beherrschte Brandung seine Stufen. Die Worte galten Baudelaire nicht allein für den Kult der geweihten Stunde, sie wurden ihm gewissermaßen auch zum Gesetz für die äußere Lebensführung; Ernst und Strenge, an die Form gewandt, wurde dem Menschen unter Menschen zur strengsten Zucht, einer Korrektion, die dem Bürger leicht als Manier erscheinen mochte, dem Künstler aber eine Bestätigung, wenn nicht Ergänzung bedeutete; unter den jungen Bohémiens, die kaum dem elterlichen Zwange, dem Frohn des Collège entschlüpft, durch wildeste Tracht und ungebärdige Lockerheit
ihren hehren Beruf dem erstaunten Passanten an den Kopf warfen, trug der kaum Zwanzigjährige bereits die weltkundige Überlegenheit des Dandy durch die Quartier-Latin-Gassen.
Baudelaire gehörte nicht zu jenen, die blind und trunken von Jugend in den Lichtschein der Schönheit hineintaumeln, im ersten Rausch der Kraft, fast bewußtlos Rhythmen hinausschreien, an deren Rechtfertigung sie dann nicht selten Not und Lust eines langen Daseins wenden; sein Bild der Schönheit taugte solchem Überschwange schlecht, zu tief lag die Ehrfurcht vor den Riten der Form in ihm verankert. »J'unisuncoeur de neige à la blancheurdes cygnes, Je hais le mouvement, qui déplace les lignes ...« Diesem Bild einer Gottheit naht kein formloses Drängen, weitab von überschäumenden Strudeln spült beherrschte Brandung seine Stufen. Die Worte galten Baudelaire nicht allein für den Kult der geweihten Stunde, sie wurden ihm gewissermaßen auch zum Gesetz für die äußere Lebensführung; Ernst und Strenge, an die Form gewandt, wurde dem Menschen unter Menschen zur strengsten Zucht, einer Korrektion, die dem Bürger leicht als Manier erscheinen mochte, dem Künstler aber eine Bestätigung, wenn nicht Ergänzung bedeutete; unter den jungen Bohémiens, die kaum dem elterlichen Zwange, dem Frohn des Collège entschlüpft, durch wildeste Tracht und ungebärdige Lockerheit
ihren hehren Beruf dem erstaunten Passanten an den Kopf warfen, trug der kaum Zwanzigjährige bereits die weltkundige Überlegenheit des Dandy durch die Quartier-Latin-Gassen.
Das Problem des Dandy beschäftigte ihn lange und tief. Gewiß streift eine Notiz (des Tagebuches: »Moncoeur mis a nu«): »Le dandy doit aspirer à être sublime sans interruption. Il doit vivre et dormir devant un miroir«, nur die nach der Außenwelt gekehrte Oberfläche des Problems. Der Dandy, wie Baudelaire ihn auffaßte, zur Schau trug, der Dandy in der heroischen Bedeutung des Wortes ist der echteste Sohn der Romantik, den die Erkenntnis der von dem Rest der Menschen scheidenden Eigenart auf die Höhe eines perfekten Egoismus getrieben hat, ein Schauspieler, dem's im Sturm der Dialoge nicht einfallen wird, auf ein andres Stichwort zu hören, als das er selbst sich gab, er geht in einem Maskengewand um, das ihm die Freiheit wahrt unter Menschen, die sich als seinesgleichen erachten, er hat eine Mauer um sich aufgebaut, damit die Geschehnisse, die sich hinter ihr abspielen, profanen Blicken entzogen werden. Es können nun Geschehnisse mancher Art sein, um die sich die Mauer des Dandysmus erhebt: ein Aufblühen, aber auch ein Erlöschen, Zusammenscharren großen Reichtums, Geiz, aber auch ein Verheimlichen unverdienter Dürftigkeit; es kann wohl die Snobsfarce, die Tragikomödie des Nichts, aber auch ein Zweikampf sein oder ein Selbstmord, der sich in solcher Verborgenheit abspielt. Denn der Dandy darf durchaus nicht mit dem kleinen travestierten Bürger verwechselt werden, der sich aus gutbürgerlicher Eitelkeit einen Kopf zurechtmacht, der's auf die Verblüffung des Bürgers abgesehen hat, also im Grunde doch den Bürger zum Ausgangspunkt nimmt, um seine Distanz klarzutun. Er wird sich vielmehr bemühen, äußerlich möglichst wenig von der Gesellschaftsklasse abzustechen, der er angehört, in einer unmerklichen Nüance aber den Abstand von allen auszudrücken. Er ist das Produkt einer Kette von Erlebnissen, Erfahrungen, Reflexionen, Entschlüssen, ein Mensch, durch den das Leben gegangen ist, durch und durch.
Daß Baudelaire die Maske des Dandy umtat, in einem Alter, da andre mit ihrem Herzen auf der Hand noch durch die Menge laufen, gibt Kunde von der vorzeitigen Desillusion durch die traurige Jugend; daß er die Mauer um sich aufrichtete, geschah: weil er die Tragödie ahnte, die sich nun in ihm begeben würde. Betrachtet einer sein Leben, muß er einen Punkt zu gewinnen suchen, von dem aus zu überblicken ist, wann der Dichter aus der Einfriedigung heraustritt, wann der Dandy sich in ihr Inneres zurückflüchtet – und vielleicht werden die Ereignisse auf jener schmalen Scheide die bezeichnendsten für die Einsicht in seinen Charakter sein.
Das erste Wort, das der Dandy aus seinem Wörterbuch streicht, ist: Sehnsucht; es ist das letzte, das der Dichter in seinem Wortschatz missen darf; der Dandy ist der große Unfruchtbare, des Dichters Leben ist von den Schmerzen des Gebarens erschüttert bis ans Ende; was der Dichterdandy am ersten verheimlichen muß, ist die Sehnsucht, Prinzip der Fruchtbarkeit, sind die Wehen, der Schmerz. An beiden war Baudelaire reich wie wenige. Als sei's nicht genug an der mitgeborenen Sehnsucht nach dem Glücke, das nur die Menschen, die animalische Wärme der Liebe geben kann; nach dem anderen, das »im tötlichen Schoß der Chimäre« verborgen ist – hatte das Schicksal ihn früh einen Blick tun lassen in die Herrlichkeiten der Welt, die man nur einmal sehen darf, die, sieht man sie zum zweitenmal, schal geworden sind. Wieder war's der Stiefvater Charles', dessen sich die Vorsehung bediente für ihren Zweck; die Reise nach den Tropen, Indien, Ceylon, Mauritius, fernen glühenden Himmelsstrichen voll großer Sonnen, überhitzter Lust und Düften, die die Stunden des Tages mit Träumen schwängern, diese Reise trat Baudelaire auf einem Schiffe an, dessen Kapitän, ein Freund Aupicks, den Auftrag hatte, Charles die Geheimnisse des überseeischen Handels zu erschließen. Baudelaire schildert diese Reise später, als sei ihr eigentlicher Zweck gewesen, ihn auf einleuchtende Art umzubringen; da gab's Schiffbrüche, böse Fieber, Händel mit den Eingeborenen, alle Fährlichkeiten fielen auf das Haupt des Stiefvaters zurück. Was Baudelaire unter diesen Rodomontaden zu verbergen suchte, war der tiefe, unauslöschliche Eindruck des Erlebnisses, war die Schönheit, die sich ihm auf dieser Reise aufgetan hatte.
Sie lebt in seinen Augen fort, die ihre Farbe suchen, in den Fibern seiner empfindlichen Sinne, denen die Erscheinungen des rauhen Klimas nicht mehr genügen, in seinen Begierden, denen eine kurze, unvergleichliche Erfüllung geworden war, in seinen Gedanken, die in unerhörten Fernen sich verlieren, in seinem Stil. Denn diese Schönheit ist's, die durch die großen fremdartigen Bilder der »Fleurs« einen Strom von Duft schwellen läßt, welcher das Herz der Worte sättigt, daß sie ihre Würze bewahren durch alle Zeiten; die wie ein machtvoll heißer Wind tausend Keime mit sich führt und die Worte wachsen läßt, daß sie bunt und stark und schattig werden wie tropische Wunderbäume. Diese Schönheit hat ihren Anteil an allem, was Baudelaire so hoch emporhebt künftig, so tief niederdrückt. Sehnsucht nährt sich von Freuden ohne Dauer, wie Eltern vielleicht jene Kinder am tiefsten betrauern, die bald nach der Geburt gestorben sind; eine Landschaft, im Lichte eines Blitzes gesehen, kann sich der Erinnerung dauernder einprägen, als eine, über der die Sonne schien, der Mond gestanden hat; dem Jüngling, der wider Willen ins Ungewisse mitgerissen wurde, zeigte sich in einem Aufflackern ein Irrwisch, Schein, ein Schimmern, und als es längst entschwunden, erkennt er's: es war das Ziel. Was im Bereich des Erlangens liegt, erscheint ihm fortan des Erlangens unwerter, er schminkt dem Sichtbaren Farben an aus der Erinnerung an jene unerreichten, doch wirklichen; die nüchternen Linien, an denen sein Blick, leidend vor Widerwillen, herabgleitet, biegt er zu Konturen um, die ihn an die fantastischen Schatten vor abendlichen Purpurhimmeln gemahnen; in die matte Seele der Dinge gießt er, daß sie überläuft, das Feuer, das einmal entfacht, in ihm nicht mehr verlöschen will. Was er sinnt und betrachtet, gewinnt einen Abglanz von Unwahrscheinlichkeit, das Natürliche schießt empor zur Höhe des Künstlichen, weil ja das Künstliche im letzten Grunde das Natürliche unter einem andern Breitegrade ist, über welchem ein glühenderes Gestirn brennt.
Auf dieser Reise, so verkündet es sich dunkel, hat der Künstler Baudelaire seine Weihe empfangen; er kehrte zurück, gereift, denn er hatte gesehen. Dies Wort: gesehn, schlägt die Sehnsucht ins Blut zurück, in einem dunkeln Vorgang wie jener es ist, der die Muttermilch im Weibe schafft.
Spleen et Idéal! »Trübsinn und Vergeistigung Stefan George. – die Worte stehen als Introite! über der Pforte des kleinen schwarzen Hauses, das in der Abgeschiedenheit der Insel St.-Louis Baudelaire nach seiner Rückkehr von den Tropen aufnahm. Er liebte dies sonderbare Viertel, das schmal und düster mit seiner Last tausendjähriger Abenteuer wie ein festangebundener Kahn mitten im Strom Paris ruht. Hier mußten die Augen sich nicht schließen, damit die Erinnerung die Gegenwart übertöne, Hoffnungen und Erschrecken konnten hierher getragen werden zur einsamen Sammlung, welche not tat in den Jahren, die nun folgen sollten. Denn Baudelaire ging sogleich daran, sein Leben einzurichten wie einer, der fortan nur dem Einen zu leben gedenkt: Schaffen, Kunst, Ruhm. Die gefährliche, zweideutige, abschüssige Existenz des Schriftstellers in Paris wurde der Plan, über den er seine gemessenen Gesten trug. Man trifft sich in Kaffeehäusern, sitzt in Redaktionsstuben, spricht über die Ereignisse der Literatur, spricht gut und schlecht über die Mitlebenden, stürzt klassische Reputationen, erhebt Verschollene auf die frei gewordenen Postamente; es wird überaus viel geschwätzt. Aber in dem Essay über Gautier ist vom Schriftsteller gesagt: »Théophile G. est J'écrivain par excellence: parce qu'il est l'esclave de son devoir, parce qu'il obéit sans cesse aux nécessités de sa fonction, parce que le goût du Beau est pour lui un fatum, parce qu'il a fait de son devoir une idéefixe.« Es ist nicht die Sprache des Schriftstellers aus den Redaktionsstuben, Kaffeehäusern, Konventikeln. Fatum – fixe Idee, die Schönheit, die solche Namen führt, gleicht dem Vampyr auf ein Haar, das Los dessen, der ihr dient, dem das Sisyphus. Gewiß kennt der Künstler nur die Eine Schönheit zutiefst, wie ein Pol ruht sie, fest und unverrückbar in seinem Innern, und mit heimlichem Magnetismus regiert dieser Pol das ganze, wie Wellenspiel bewegte Leben des Künstlers – –
»Je trône dans l'azur comme un sphinx incompris ...«
zwischen ihr und dem Künstler aber breitet sich das Wirrsal dieses Lebens aus. Alles was es an Wechselfällen enthalten wird, was die Sehnsucht schüren und verdecken wird, Freundschaft und Verachtung, Heiterkeit und Sorge, Kraft und Mühe, Wollust und Haß, alles wird Schleier um Schleier breiten zwischen die »Sphinx« und den irdischen Menschen. Sein Verhängnis ist: er muß sie suchen, das Wirrsal durchdringen, durch alle Hüllen die ewige Form im Auge haben, mag noch so Trübes sich dem Blicke bieten. Senkt sich ein schlimmes Leben zu tief, zu schwer auf ihn herab, können sich seine Sinne wohl verdüstern, so daß er der Schönheit, dem Gesetz das er selbst, sein Herz, seine Nerven, sich gab, die grausigen Umrisse des Unbegreiflichen, Drohenden, Übernatürlichen, Fatums verleiht.
»Tu marches sur des morts, Beauté, dont tu te moques,
»De tes bijoux l'Horreur n'est pas le moins charmant,
»Et le meurtre, parmi tes plus cheres breloques
»Sur son ventre orgueilleux danse amoureusement.«
Ein Stürzen und Emporstreben wie im sonderbaren Reich des Traumes kann sein Leben ausfüllen, so daß kein anderes Geschehen mehr Raum findet in diesem Leben. Und während tief unten der Mensch vergeht, ingrimmig die Augen festzusaugen an Glanz und Reinheit der Höhe, das ist's, was Größe und Verdammnis des Künstlers ausmacht. Zog er anfangs aus, um in allen Formen des Schönen, die ihm begegnen, das Glück zu suchen, die Harmonie, lehrt ihn die Unbarmherzigkeit gegen alles Unvollkommene seiner eigenen Unzulänglichkeiten inne zu werden; dann kann er bald soweit gelangt sein, sich ein dauerndes Bild der Schönheit aus den Elementen seiner Leiden zu formen, und damit ein für allemal dem Frieden dieser Welt zu entsagen. Aus Spleen und Ideal schweißt sich eine Seite der »Fusées« zusammen, sie zeigt den Menschen gebrochen, nackend, nach dem Sündenfall, dem Versagen der Welt und dem eigenen Versagen vor der ungemessenen Begierde nach Vollkommenheit; aber aus dem Paradies ist ein Tal voll Steinen und Disteln geworden. »J'ai trouvé la définition du Beau, de mon Beau. C'est quelque chose d'ardent et de triste, quelque chose d'un peu vague, laissant carrière à la conjecture ... Une tête séduisante et belle, une tête de femme, veux-je dire, c'est une tête, qui fait rêver à la fois, mais d'une manière confuse, de volupté et de tristesse; qui comporte une idée de mélancolie, de lassitude, même de satiété, – soit une idée contraire, c'est á dire une ardeur, un désir de vivre, associés avec une amertume refluante, comme venant de privation ou de désespérance. Le mystère, le regret sont aussi des caractères du Beau. Une belle tête d'homme ... contiendra aussi quelque chose d'ardent et triste, des besoins spirituels, des ambitions ténébreusement refoulées, l'idée d'une puissance grondante et sans emploi, quelquefois l'idée d'une insensibilité vengeresse (car le type idéal du dandy n'est pas a négliger dans ce sujet) quelquefois aussi, – et c'est l'un des caractères de beauté les plus intéressants – le mystère et enfin (pour que j'aie le courage d'avouer jusqu' à quel point je me sens moderne en esthétique,) le malheur. – Je ne prétends pas que la Joie ne puisse pas s'associer avec la Beauté, mais je dis que la Joie est un des ornements les plus vulgaires, tandis que la Mélancolie en est pour ainsi dire l'illustre compagne, à ce point, que je ne conçois guère (mon cerveau serait-il un miroir ensorcelé?) un type de Beauté, ou il n'y ait du Malheur.« Im kleinen schwarzen Haus der lle St. Louis, in der Alchimistenküche des Leidens, verwandelte sich »Gold in Eisen, Paradies in Höllenspuk«.

Harmonie, nach ihr durchstreifte Baudelaire die weiten Gebiete der Künste, zumal seiner eigenen Zeit. Der vom Vater ererbte Sinn, seine Liebe für die Farbe, durch die Indienreise bis zu schmerzhafter Intensität gesteigert, spornten ihn zur kritischen Betrachtung der Werke an, Unterhaltungen mit befreundeten Malern, Deroy, Boissard, weckten das Verlangen, durch das laute Wort mitzuhelfen bei der Entwicklung des Geschmackes, die Augen zu öffnen den Künstlern, vor allem diesen aber auch dem Publikum. Wie er bei diesem Unterfangen den Ton zu treffen wußte, zeigt die exquisite Apostrophe des Bourgeois in der Vorrede zur Broschüre über den Salon 1846: »Vous pouvez vivre trois jours sans pain, – sans poésie jamais ... vous êtes les amis naturels des arts, parce que vous êtes, les uns riches, les autres savants ...« hierauf werden mit ernsthafter Ehrerbietung dem »Protektor der schönen Künste« die Tore seiner Domäne erschlossen. Vieles Erfreuliche war in der Malerei, der Skulptur jener Tage nicht zu erforschen: die flaue Farbe der Ingresschule, die kaltausgeklügelte Pose der Nachfolger Davids mußten dem nach Farbe Dürstenden, nach leidenschaftsdurchwachsenen Ausdruck Begierigen zur harten Qual gereichen. Es war die Zeit vor Barbizon, Manet, Carpeaux; Horace Vernet, Baudelaires bête noire und die Fadaisen Scheffers besaßen den Beifall der Menge. Es war aber auch die Zeit von Eugene Delacroix. Ihm wandte sich Baudelaires ganze Liebe und Bewunderung zu. Der tiefdüstere Grundton seiner Bilder wie seiner Lebensanschauung, in dem mächtige Koloristik und wilde Energie der Geste zusammengehalten ist, erinnerte Baudelaire an seine Lieblinge, die Spanier des Louvre und Delacroix' Vorliebe für grausam erschütternde Szenen, die Glorifikation des Leidens, »hymnes terribles composes en l'honneur de la fatalité et de l'irrémédiable douleur« gewannen ihm Baudelaires verwandtes Herz, das sich mitglühendem Enthusiasmus diesem Genie ergab. Denn Baudelaire war in seinem kritischen Wirken hauptsächlich Enthusiast. Enthusiasmus ist Aktion, der Lyriker, der in der Kritik sein Komplement fand, kann nur Enthusiast sein. In Baudelaires Enthusiasmus verrät sich der Dandy als ein Mensch, der suchend, wie ratlos, seinen Überschuß an Wärme an den Mann zu bringen strebt, sich mit des Gebens schmerzlicher Wollust betäubt. Von ihr überströmen die Essays über Gautier, Poe, Wagner, Guys, sie ist es, die sich in einer projektierten Widmung der »Fleurs du mal« mit einer Selbsterniedrigung verbindet, welche Gautier voll Scham und Rührung von sich wies.
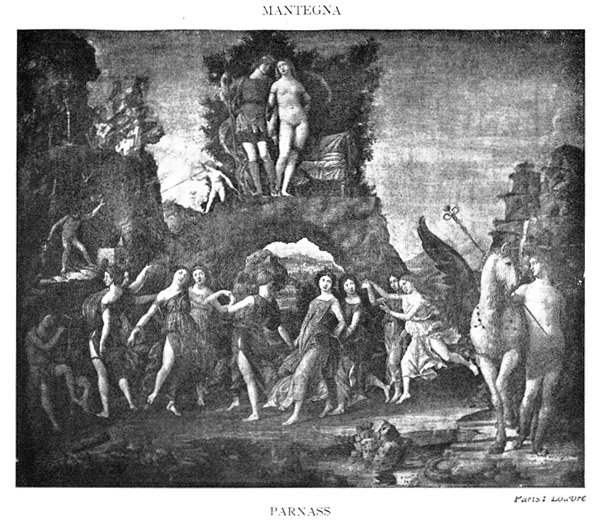
Wie Baudelaire sich zu den eben erwähnten großen Erscheinungen einer heraufkommenden Welt der Kunst verhielt, soll später berührt werden, hier sei nur verzeichnet, daß er durch sein eindringendes Verstehen aller Zauber der Farbe und des Lichtes dem Pleinair und dem Impressionismus die Wege bereitete und auf diesen Wegen als Erster Manet, Whistler, Yongkind begrüßen durfte. Das Büchlein vom Salon 1846 enthält prophetische Sätze über den harmonisierenden Wert der Atmosphäre, die Melodien im Spiele des Lichts, das die Konturen auflöst, und sehr fein werden hier später allgemein anerkannte Theorien aus Erscheinungen der Natur, Effekten des Himmels, dem Spiel der Adern unter der zarten Haut einer Frauenhand abgeleitet.
In den »Fleurs«, noch mehr vielleicht in den »Petits poêmes en prose« hat dies Verstehen der Wirkungen von Licht und Schatten, von den Valeurs, wie in der Malersprache die Wechselstellung heller und verschwindender, gleichwertiger und komplementärer Töne geheißen ist, die Vokale und Konsonanten gemischt, und der Sinn der Worte ist zuweilen von einer unterirdischen Musik begleitet, welche dort in die Tiefe taucht, wo die Macht des Wortes aufgehört hat. Es finden sich Sätze, Strophen von einer Intensität des melodischen Ausdrucks, die an die sonore Polyphonie Beethovenscher Sonatensätze, an die wilde Schmerzzerrissenheit der »fantastischen Symphonie« Berlioz' gemahnen und über deren dunklem Gewebe übersinnliche Lichter spielen, wie auf gewissen Gemälden Rembrandts; Zeilen wie diese:
»Désormais tu n'es plus, ô matière vivante!
Qu'un granit entouré d'une vague épouvante,
Assoupi dans Je fond d'un Saharah brumeux!«
brodelnder, magischer Dünste voll, Zeilen wie:
»Le violon frémit comme un coeur qu' on afflige,
Un coeur tendre, qui hait Je néant vaste et noir!«
ein farbigerer Corot.
Die herrliche Verdeutschung dieser Zeilen durch Stefan George lautet:
»Nun bist du weiter nichts – o staub mit leben –
Als ein granit mit schreckenshauch umgeben
In tiefer wüsten nebeldunst versenkt.« und:
»Die geige erbebt wie ein herz das die leiden besiegen,
Ein zartes herz das erschrickt vor der gähnenden kluft.«
In diesem meisterlichen Werke (Baudelaire: Die Blumen des Bösen. Umdichtungen von Stefan George. Georg Bondi, Berlin 1901) ist der deutschen Dichtung einer ihrer köstlichsten Schätze geschenkt worden.
Diese mächtige Gabe verleitet Baudelaire doch niemals zu den ins vag Musikalische sich verlierenden Spielen mit dem Wort. Die straffe Epidermis der Form ist geschwellt durch Bilder und Begriffe, welche plastisch und streng an ihrem Platze stehen wie an einem anatomisch vollendeten Körper. Aus der Seele des Kunstwerks selbst strahlen sie hervor und füllen die Form aus, Eins geworden mit ihrem Ausdruck leben sie ihr blutvolles Leben mit tönenden Pulsen fort. Die schonungslose Versenkung in die Welt der eigenen Lüste und Schmerzen fördert eine Aufrichtigkeit des Schauens und Anschaulichmachens zutage, die das Wort zu einer fast mythischen Bedeutung emporhebt. »Il y a dans le mot, dans le verbe, quelque chose de sacré, qui nous défend d'en faire un jeu de hasard. Manier savamment une langue, c'est pratiquer une espèce de sorcellerie évocatoire.« Baudelaire gesteht, daß in frühen Jahren, bei der Lektüre eines oder des anderen Werkes von Theo Gautier, ein besonders reiches Wort, la Sensation de la touche posée juste, du coup porté droit, in ihm eine nervöse Konvulsion hervorrief, in sublimer Weise direkt an die Quelle des Lebens rührte; kann somit die Selbstherrlichkeit, aber auch das ganze Schicksal des Künstlers in eine wuchtigere Formel gebracht sein als diese, von Gautier aufgestellte, die Baudelaire zur seinen machte: »L'inexprimable n'existe pas.«
Die Herrschaft über das Wort, große Freundin und Verbündete, in glücklichen Stunden des Überschwangs schwingt sie in jedem brausenden Blutstropfen mit, in kalten, bedrückten mag sie nach langer Not nahen, hilft dann, das verstörte Gemüt in eine schöne Vergessenheit versenken. Baudelaire kannte wie wenige die Qual der toten Tage, in denen sich der Wille aufbäumt vor dem Schweigen des Herzens; schon die liturgischen Worte, die er für den Prozeß des Schaffens fand, lassen die Tiefe des Versagens erkennen. Wie ein gedrungener Quadernbau mutet das Buch der Fleurs an, von der Kraft des Lebens, das ihn aufrichtete, darf kein Quentchen als vergeudet erscheinen, aber es war die Zeit der großen Arbeiter, Hugo, Balzac, Gautier, Baudelaire lebte in ihrer Gemeinschaft, wir wissen von Ratschlägen, die sie ihm für sein Schaffen gaben, und er hat Pläne entworfen für Romane, Novellen, Dramen, die nie ausgeführt worden sind, obzwar er zu Zeiten umherlief, toll vor Begierde, zu arbeiten, zu übertäuben ...
Eine der vornehmlichsten Aufgaben des Dandy bestand darin, die Inspiration als eine Dienerin, willige, fügsame und unterjochte Maitresse darzustellen, die im Nebenzimmer auf den Wink ihres Gebieters harrt, den Dichter selbst etwa als einen jungen, kräftigen Zuhälter, der die Muse, sein Ding, bei den Haaren faßt, umreißt, auf die Knie zwingt. (Sonett an Banville.) In späteren Jahren ruft er klagend: »de 1842 à 1858, seize ans de fainéantisme«! Doch stehen in den »conseils aux jeunes litérateurs«, einem Elaborat, in dem Mephisto im Mantel Fausts erscheint, diese Sätze: »L'inspiration est décidément la soeur du travail journalier ... L'inspiration obéit, comme la faim, comme la digestion, comme le sommeil. Il-y-a sans doute dans l'esprit une espèce de mécanique céleste, dont il ne faut pas être honteux, mais tirer le parti le plus glorieux, comme les médecins de la mécanique du corps.« In gleicherweise wird Poes groteske Anleitung zur Abfassung eines Poems mit mathematischer Vorausberechnung des Effektes (Essay vor den Gedichten, Orig. Ausg.; das Gedicht selbst ist: the raven) ernsthaften Betrachtungen unterzogen; gelegentlich wird die Badine ganz beiseite gelegt und es muß die Narrenpritsche herhalten, so soll (in der projektierten Vorrede zur 2. Ausgabe der »Fleurs«) eine Methode dargestellt werden, die es jedermann ermöglicht, in 20 Lektionen die Elemente des Dichtenkönnens sich anzueignen; »je me propose, pour vérifier de nouveau l'excellence de ma méthode, de l'appliquer prochainement à la célébration des jouissances de la dévotion et des ivresses de la gloire militaire, bien que je ne les aie jamais connues« – die Schlußpirouette stellt den Menschen wieder auf die Füße, dem der Boden gewaltsam weggerissen wird (es ist unmittelbar nach der schimpflichen Verurteilung Baudelaires im Prozeß gegen die »Fleurs du mal«).
In der Novelle »La Fanfarlo« hat Baudelaire ein sehr schmerzhaft echtes, unerbittlich scharf gesehenes Portrait des Dichters und Dandy Baudelaire gezeichnet; der Romantiker Samuel Cramer ist: »un grand fainéant, un ambitieux triste, un illustre malheureux ... l'homme des belles oeuvres ratées, Dieu de l'impuissance, Dieu moderne, colossale et hermaphrodite ... fécond en desseins difficiles et risibles avortements, esprit chez qui le paradoxe prenait souvent les proportions de la naïveté et dont l'imagination était aussi vaste que la solitude et la paresse absolues.« Sucht man in den intimen Tagebüchern nach Bekenntnissen ähnlicher Offenherzigkeit, so schlägt einem an ihrer Stelle schlechtverhohlene Ironie, hochmütige Unaufrichtigkeit entgegen, eine falsche Überlegenheit, die sich mit zitternden Lippen Mut zuspricht – in diesen Blättern ist die Maske des Dandy dem Menschen zugekehrt, der sie trägt, es ist die bitterste Form des Dandysmus, die der Dandy gegen sich selbst anwendet, wenn er am Ende des Tagewerks, im »examen de minuit« einsehen muß, daß er selbst die Forderung nicht zu erfüllen vermag, die er ans »Draußen« vergeblich stellt. Dieselbe triste Erklärung bleibt auch für die befremdliche Sorglosigkeit übrig, mit der Baudelaire bei der Wahl seines Umgangs verfuhr, denn es muß gesagt sein, daß er sich aus den Vorhallen des Tempels, von den Genossen des Kultes, zuweilen recht weit entfernen konnte; hieß es dann auch: »beaucoup d'amis, beaucoup de gants«! oder: »certains esprits solitaires au milieu de la foule, et qui se repaissent dans le monologue n'ont que faire de la délicatesse en matière de public. C'est en somme une fraternité basée sur le mépris« – so will's scheinen, als spräche sich in diesen Tiraden weniger der Mensch aus, dessen Leben die wechselnden Spiele der Sympathien und Antipathien weder Glück noch Kummer zu leihen vermögen, als einer, der seine Lust gefunden hat in einer Art gelegentlicher Deklassierung, der Pein und dem Vergnügen des durch Zweifel schwach gewordenen. –
Hier mag eine Seite angefügt werden, handelnd von der seltsamen Trunkenheit, die sich Baudelaires 1848 bemächtigte. Wie in jedem Künstler, dessen Heroismus auf verborgenerem Felde seine Schlachten schlägt, erregte die große demokratische Bewegung bloß seine Nerven, durch die Möglichkeit, mit einer singenden Menge zu ziehn, ein fremdes Weib unterzufassen, sich von der Krapüle dutzen zu lassen, bischen zu plündern. Und wenn Baudelaire, in der Bluse und mit Lackschuhen angetan, den Leuten seine wohlgepflegten feinen Hände entgegenstreckte, um sich durch ihren Pulvergeruch zu legitimieren, war er – den ein wild vorbeiziehender Haufe wohl schwerer aus dem Gleichgewicht werfen mochte als der Anblick einer schönen, unbekannten Frau, die an Tortonis Terasse vorüberging – gewiß nicht minder aufrichtig, als wenn er verkündete: »je comprends, qu'on dèserte une cause pour savoir ce qu'on éprouvera à en servir une autre«; übrigens war sein erster Gedanke beim Ausräumen eines Gewehrladens, sich mit einer schönen, blitzendneuen Flinte an die Spitze hergelaufenen Volks zu setzen: pour fusiller le général Aupick!!