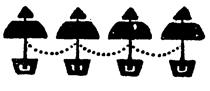|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Es will Morgen werden, der Tag graut, ein bläulicher, zitternder Septembertag.
Es saust in den Pappeln des Gartens. Ein Fenster thut sich auf, ein Mann lehnt sich hinaus und summt eine Melodie vor sich hin. Er hat keinen Rock an, er schaut wie ein Unangekleideter, der sich einen Rausch in Glück angetrunken hat, in die Welt hinaus.
Er wendet sich plötzlich vom Fenster ab und schaut nach seiner Thür; es hat jemand bei ihm angeklopft. Er ruft: Herein! Ein Mann tritt ein.
»Guten Morgen!« sagt er zu dem Eintretenden.
Es ist ein älterer Mann, er ist bleich und wütend, und er trägt eine Lampe in der Hand, weil es noch nicht ganz hell ist.
»Ich möchte Ihnen noch einmal anheimgeben, Herr Müller, Herr Johannes Müller, zu überlegen, ob Sie meinen, daß dies recht und billig ist?« stammelt der Mann erbittert.
»Nein,« entgegnet Johannes, »Sie haben recht. Ich habe etwas geschrieben, das mir so ganz von selber zufiel, sehen Sie, das alles habe ich geschrieben, ich bin erfolgreich gewesen über Nacht. Aber jetzt bin ich fertig. Ich öffnete nur das Fenster und sang ein wenig.«
»Sie brüllten!« sagt der Mann. »Das ist der lauteste Gesang, den ich gehört habe, verstehen Sie? Und dabei ist es mitten in der Nacht.«
Johannes greift in seine Papiere auf dem Tisch, nimmt eine Handvoll großer und kleiner Bogen.
»Sehen Sie hier!« ruft er. »Ich versichre Sie, es ist mir noch nie so gut von der Hand gegangen. Es war wie ein langer Blitz. Ich habe einmal einen Blitz gesehen, der an einem Telegraphendraht entlang lief, Gott sei Ihnen gnädig, es sah aus, wie ein Laken aus Feuer. So hat es heute bei mir geflutet. Was soll ich machen? Ich glaube nicht, daß Sie mir noch zürnen werden, wenn Sie hören, wie es zusammenhängt. Ich saß hier und schrieb, hören Sie, ich rührte mich nicht; ich dachte an Sie und war still. Aber dann kommt der Augenblick, wo ich nicht mehr daran denke, meine Brust wollte zerspringen, vielleicht bin ich da aufgestanden, vielleicht bin ich auch noch ein anderes Mal im Laufe der Nacht aufgestanden und ein paarmal im Zimmer umhergegangen. Ich war so glücklich.«
»Ich hörte Sie über Nacht nicht so viel,« sagte der Mann. »Aber es ist ganz unverzeihlich von Ihnen, das Fenster jetzt, um diese Zeit, zu öffnen und so zu brüllen.«
»Freilich. Ja, es ist unverzeihlich. Aber nun habe ich es Ihnen ja erklärt. Ich habe eine Nacht ohnegleichen gehabt, müssen Sie wissen. Gestern erlebte ich etwas. Ich gehe auf der Straße und begegne meinem Glück, ach, hören Sie mich doch, ich begegne meinem Stern und meinem Glück. Wissen Sie, und dann küßt sie mich. Ihr Mund war so rot, und ich liebe sie, sie küßt mich und berauscht mich. Haben Ihnen jemals die Lippen so gebebt, daß sie nicht sprechen konnten? Ich konnte nicht sprechen. Mein Herz machte meinen ganzen Körper zittern. Ich lief nach Hause und schlief ein; ich saß hier auf dem Stuhl und schlief. Als es Abend wurde, erwachte ich. Meine Seele schaukelte auf und nieder vor Stimmung, und ich fing an zu schreiben. Was ich schrieb? Hier ist es! Ich war beherrscht von einem seltsamen, herrlichen Gedankengang, die Himmel thaten sich auf, es war gleichsam ein warmer Sommertag für meine Seele, ein Engel reichte mir Wein, ich trank ihn, es war berauschender Wein, ich trank ihn aus einer Granatschale. Hörte ich, ob die Uhr schlug? Sah ich, daß die Lampe ausbrannte? Gott gebe, daß Sie es verstünden! Ich durchlebte das Ganze noch einmal, ich ging wieder mit meiner Geliebten auf der Straße und alle wandten sich nach ihr um. Wir gingen im Park, wir begegneten dem König, ich berührte vor Freude fast die Erde mit meinem Hut, und der König wandte sich nach ihr um, nach meiner Geliebten, denn sie ist so groß und schön. Wir gingen wieder in die Stadt hinab, und alle Schulkinder wandten sich nach ihr um, denn sie ist jung und trägt ein helles Kleid. Als wir an ein rotes, steinernes Haus gelangten, gingen wir hinein. Ich begleitete sie die Treppe hinauf und wollte vor ihr knien. Da schlang sie die Arme um mich und küßte mich. Dies begegnete mir gestern Abend, es ist nicht länger her. Wenn Sie mich fragten, was ich geschrieben habe, ist es ein einziges unaufhaltsames Lied an die Freude, an das Glück, das ich geschrieben habe. Es war, als läge das Glück nackend vor mir mit einem langen, lachenden Hals und wollte auf mich zueilen.«
»Ja, ich will Ihr Geschwätz wirklich nicht länger mit anhören,« sagt der Mann ärgerlich und verzagt. »Ich habe zum letztenmal mit Ihnen gesprochen.«
Johannes hält ihn an der Thür zurück.
»Warten Sie ein wenig. Nein, Sie hätten nur sehen sollen, wie eben gleichsam die Sonne über Ihr Gesicht huschte. Ich sah es gerade, als Sie sich umwandten, es war die Lampe, die einen Sonnenfleck auf Ihre Stirn warf. Sie waren nicht mehr so verbittert, ich sah es. Ich öffnete das Fenster, nun ja, ich sang zu laut. Ich war der fröhliche Bruder aller. So geht es zuweilen, der Verstand stirbt. Ich hätte bedenken sollen, daß Sie noch schliefen – –«
»Die ganze Stadt schläft noch.«
»Ja, es ist noch früh. Ich will Ihnen etwas schenken. Wollen Sie dies von mir annehmen? Es ist aus Silber, ich habe es als Geschenk erhalten. Ein kleines Mädchen, das ich einst rettete, hat es mir geschenkt. Bitte, nehmen Sie es. Es faßt zwanzig Cigaretten. Sie wollen es nicht haben? So, Sie rauchen nicht? Darf ich morgen zu Ihnen kommen und mich entschuldigen? Ich möchte gern etwas thun, Sie um Entschuldigung bitten –«
»Gute Nacht!«
»Gute Nacht! Jetzt will ich mich schlafen legen. Ich verspreche es Ihnen. Sie sollen hier drinnen keinen Laut mehr hören. Und in Zukunft will ich mich besser in acht nehmen.«
Der Mann ging.
Johannes öffnete plötzlich die Thür wieder und fügte hinzu:
»Es ist wahr, ich verreise jetzt. Ich werde Sie nicht mehr stören, morgen verreise ich. Ich vergaß, es zu sagen.«
— — — — — — — —
Er reiste nicht. Verschiedene Dinge hielten ihn auf, er hatte einige Besorgungen zu machen, etwas einzukaufen, etwas zu bezahlen, es wurde Morgen und Abend. Wie sinnlos taumelte er umher.
Schließlich schellte er beim Kammerherrn. Ob Victoria zu Hause wäre?
Victoria mache Besorgungen.
Er erklärt, daß sie aus demselben Ort seien, Victoria und er, er habe sie nur begrüßen wollen, falls sie zu Hause gewesen wäre, habe sich die Erlaubnis genommen, sie zu begrüßen. Er wolle gern daheim eine Bestellung ausgerichtet haben. Nun gut!
Er ging zur Stadt hinaus. Vielleicht konnte er sie treffen, sie entdecken, sie saß vielleicht in einem Wagen. Er wanderte bis zum Abend umher. Vor dem Theater gewahrte er sie, er grüßte, lächelte und grüßte, und sie erwiderte seinen Gruß. Er wollte auf sie zutreten, es waren nur einige Schritte, – da sieht er, daß sie nicht allein ist, sie hat Otto bei sich, der Sohn des Kammerherrn. Er trug Lieutenants-Uniform.
Johannes dachte: nun giebt sie mir vielleicht einen Wink, ein kleines Zeichen mit den Augen? Sie eilte ins Theater hinein, rot, mit gesenktem Kopf, als wolle sie sich verbergen.
Vielleicht konnte er sie da drinnen sehen? Er nahm ein Billet und ging hinein.
Er kannte die Loge des Kammerherrn, natürlich hatten diese reiche Menschen eine Loge. Dort saß sie in all ihrer Herrlichkeit und sah sich um. Sah sie ihn an? Nie!
Als der Akt zu Ende war, lauerte er ihr draußen im Vestibül auf. Er grüßte wieder; sie sah ihn ein wenig verwundert an und nickte.
»Hier drinnen kannst du Wasser bekommen,« sagte Otto und zeigte auf eine Thür.
Johannes sah ihnen nach. Eine wunderliche Dämmerung legte sich ihm vor die Augen. Alle diese Menschen waren ärgerlich auf ihn und pufften ihn; er bat mechanisch um Verzeihung und blieb stehen. Da war sie verschwunden.
Als sie zurückkam, verneigte er sich tief vor ihr und sagte:
»Verzeihen Sie, gnädiges Fräulein – –«
»Das ist Johannes,« sagte sie vorstellend. »Erkennst du ihn wieder?«
Otto antwortete und sah ihn mit den Augen zwinkernd an.
»Sie wollen gewiß gern erfahren, wie es daheim aussieht,« fuhr sie fort, und ihr Gesicht war schön und ruhig. »Ich weiß es wirklich nicht, aber es wird wohl allen gut gehen. Ausgezeichnet. Ich will die Müllersleute von Ihnen grüßen.«
»Danke. Reisen das gnädige Fräulein bald?«
»In den nächsten Tagen. Ja, ich will grüßen von Ihnen.«
Sie nickte und ging.
Johannes sah ihr wieder nach, bis sie verschwunden war, dann ging er hinaus. Eine ewige Wanderung, ein schwerfälliges, trübseliges Schlendern, Straßen auf, Straßen ab, schlug die Zeit tot. Um zehn Uhr stand er vor dem Hause des Kammerherrn und wartete. Jetzt war das Theater aus, jetzt kam sie. Er konnte vielleicht die Wagenthür öffnen, den Hut abnehmen, die Wagenthür öffnen und sich zur Erde beugen!
Endlich, nach einer halben Stunde kam sie. Konnte er dort an der Hausthür stehen bleiben und sich nochmals in Erinnerung bringen? Er hörte, wie sich der Thorweg öffnete, der Wagen hineinrollte und die Thür wieder ins Schloß fiel. Da wandte er sich um.
Jetzt schlenderte er eine Stunde lang vor dem Hause auf und nieder. Er wartete auf niemand und hatte kein Anliegen. Plötzlich öffnete sich die Hausthür von innen und Victoria kommt wieder auf die Straße hinaus. Sie hat keinen Hut auf, sie hat nur einen Shawl um die Schultern geworfen. Sie lächelt halb ängstlich, halb verlegen und fragt, um doch einen Anfang zu machen:
»Gehen Sie hier umher und denken?«
»Nein,« erwidert er. »Ob ich denke? Ich gehe hier nur.«
»Ich sah Sie hier draußen auf und niedergehen, und da wollte ich – – Ich sah Sie von meinem Fenster aus. Ich muß gleich wieder hinein.«
»Ich danke Ihnen, daß Sie gekommen sind, Victoria. Ich war eben noch so verzweifelt, und jetzt ist es vorüber. Verzeihen Sie, daß ich Sie im Theater begrüßte; ich habe leider auch hier im Hause des Kammerherrn nach Ihnen gefragt, ich wollte Sie sehen und erfahren, was Sie beabsichtigen, was Ihre Absicht ist.«
»Ja,« sagte sie, »das wissen Sie ja. Ich sagte heute vormittag so viel, daß Sie es nicht mißverstehen konnten.«
»Ich bin noch ebenso unsicher über alles.«
»Lassen Sie uns nicht mehr darüber reden. Ich habe genug gesagt, ich habe viel zu viel gesagt, und jetzt thu ich Ihnen weh. Ich liebe Sie, ich log vorgestern nicht und lüge auch jetzt nicht; aber da ist so vielerlei, was uns trennt. Ich habe Sie sehr gern, spreche gern mit Ihnen, lieber, als mit sonst irgend jemand, aber – – Ja, ich darf hier nicht länger stehen, man kann uns aus den Fenstern sehen. Johannes, da sind so viele Gründe, die Sie nicht kennen, deswegen sollen Sie mich nicht mehr bitten, zu sagen, was ich meine. Ich habe Tag und Nacht daran gedacht; ich meine, was ich gesagt habe. Aber es wird unmöglich sein.«
»Was wird unmöglich sein?«
»Das Ganze. Alles. Hören Sie, Johannes, nehmen Sie an, daß ich stolz für uns beide bin.«
»Wohlan, gut. Das will ich annehmen! Aber dann hatten Sie mich vorgestern zum besten. Es geschah, daß Sie mich auf der Straße trafen und daß Sie in guter Laune waren, und da – –«
Sie wandte sich um und wollte hineingehen.
»Habe ich etwas Verkehrtes gethan?« fragte er. Sein Gesicht war bleich und unkenntlich. »Ich meine, wodurch verscherzte ich Ihre – –? Habe ich während dieser zwei Tage und Nächte etwas verbrochen?«
»Nein, es ist nicht das. Ich habe nur darüber nachgedacht; haben Sie das nicht gethan? Es ist die ganze Zeit hindurch unmöglich gewesen, wissen Sie. Ich habe Sie gern, ich schätze Sie sehr – –«
»Und achte Sie.«
Sie sieht ihn an, sein Lächeln verletzt sie, und heftiger fährt sie fort:
»Mein Gott, begreifen Sie denn nicht selber, daß Papa es Ihnen abschlagen würde? Weshalb zwingen Sie mich, es zu sagen? Sie wissen es ja selber. Was hätte daraus werden sollen? Habe ich nicht recht?
Pause.
»Ja,« antwortet er.
»Außerdem,« fährt sie fort, »sind da noch so viele Gründe – – Nein, Sie dürfen mir wirklich nicht wieder ins Theater nachkommen. Mir wurde ganz bange vor Ihnen. Das dürfen Sie nie wieder thun.«
»Nein,« sagt er.
Sie ergreift seine Hand.
»Können Sie nicht auf einige Zeit nach Hause kommen? Ich würde mich sehr darüber freuen. Wie warm Ihre Hand ist; mich friert. Nein, jetzt muß ich gehen. Gute Nacht.«
»Gute Nacht!« erwidert er.
— — — — — — — —
Kalt und grau zog sich die Straße durch die Stadt dahin, sie sah aus wie ein Gürtel aus Sand, ein ewiger Weg zu gehen. Er stieß auf einen Jungen, der alte, verwelkte Rosen verkaufte; er rief ihn an, nahm eine Rose, gab dem Jungen ein Fünfkronenstück in Gold und ging weiter. Bald darauf sah er eine Schar Kinder, die in der Nähe eines Thorwegs spielten. Ein Knabe von zehn Jahren sitzt still da und sieht zu. Er hat alte, blaue Augen, die dem Spiele folgen, hohle Wangen und ein viereckiges Kinn, und auf dem Kopf trägt er eine Mütze aus Leinwand. Es war das Futter einer Mütze. Dies Kind trug eine Perücke, eine Haarkrankheit hatte diesen Kopf für immer verunziert. Seine Seele war vielleicht auch gänzlich verwelkt.
Das alles bemerkte er, obwohl er keine klare Vorstellung davon hatte, in welcher Gegend der Stadt er sich befand, oder wohin er ging. Es fing auch an zu regnen, er merkte es nicht und spannte auch seinen Regenschirm nicht auf, obwohl er ihn den ganzen Tag mit sich herumgetragen hatte.
Als er endlich an einen Platz kam, wo Bänke standen, ging er hin und setzte sich. Es regnete mehr und mehr, ohne es zu wissen, spannte er den Regenschirm auf und blieb sitzen. Nach kurzer Zeit befiel ihn eine unüberwindliche Müdigkeit, sein Gehirn lag wie im Nebel, er schloß die Augen und fing an zu nicken und zu schlafen.
Nach einer Weile erwachte er davon, daß einige Vorübergehende laut sprachen. Er erhob sich und schlenderte weiter. Sein Gehirn war klarer geworden, er entsann sich des Geschehenen, aller Ereignisse, sogar des Jungen, dem er fünf Kronen für eine Rose gegeben hatte. Er stellte sich das Entzücken des kleinen Herrn vor, wenn er diese wunderbare Münze zwischen allen seinen Schillingen fand, daß es kein Fünfundzwanzig-Öre-Stück war, sondern ein Fünfkronenstück in Gold. Geh mit Gott!
Und die andern Kinder waren vielleicht vom Regen vertrieben worden und spielten im Thorweg weiter, hüpften durch das Paradies oder spielten mit Murmeln. Und der entstellte Greis von zehn Jahren saß da und sah zu. Wer weiß, vielleicht saß er da und freute sich über etwas, vielleicht hatte er daheim in der Kammer im Hinterhaus eine Puppe, einen Hampelmann, einen Waldteufel. Er hatte vielleicht nicht alles im Leben verloren, es regte sich eine Hoffnung in seiner welken Seele.
Da taucht eine feine, schlanke Dame vor ihm auf. Er zuckt zusammen, bleibt stehen. Nein, er kannte sie nicht. Sie war aus einer Seitengasse gekommen und eilte vorwärts, und sie hatte keinen Regenschirm, obwohl der Regen herabströmte. Er holte sie ein, sah sie an und ging vorüber. Wie fein sie war und wie jung! Sie wurde naß, sie erkältete sich, und er wagte nicht, sich ihr zu nähern. Da klappte er seinen Regenschirm zu, damit sie nicht allein naß werden sollte. Als er nach Hause kam, war es nach Mitternacht.
Es lag ein Brief auf seinem Tisch, eine Karte, es war eine Einladung. Sejers würden sich freuen, wenn er morgen abend zu ihnen kommen wollte. Er würde Bekannte treffen, unter andern – ob er es wohl erraten könne? – Victoria, das Schloßfräulein! Freundliche Grüße.
Er schlief auf seinem Stuhl ein. Ein paar Stunden später erwachte er, es fror ihn. Halb wach, halb schlafend, durchschüttelt von Frostschauern, müde von den Widerwärtigkeiten des Tages setzte er sich an den Tisch und wollte die Karte beantworten, diese Einladung, die er nicht anzunehmen gedachte.
Er schrieb seine Antwort und wollte sie nach dem Briefkasten hinuntertragen. Plötzlich fällt ihm ein, daß auch Victoria geladen war. Ja, sie hatte ihm gegenüber aber nichts davon erwähnt, sie hatte gefürchtet, daß er kommen würde, sie wollte ihn da draußen zwischen den fremden Menschen los sein.
Er zerreißt seinen Brief, schreibt einen neuen und dankt, er würde kommen. Eine innere Heftigkeit macht seine Hand erzittern, eine eigenartige fröhliche Erbitterung bemächtigt sich seiner. Weshalb sollte er nicht gehen? Weshalb sollte er sich verstecken? Basta!
Seine heftige Gemütsbewegung geht mit ihm durch. Mit einem Ruck reißt er eine Handvoll Blätter von seinem Kalender an der Wand und versetzt sich eine Woche vorwärts in der Zeitrechnung. Er bildet sich ein, daß er über etwas erfreut, über alle Maßen entzückt ist, er will diese Stunde genießen, er will sich eine Pfeife anzünden, sich auf den Stuhl setzen und sich ergötzen. Die Pfeife ist ganz in Unordnung, er sucht vergebens nach einem Messer, einem Putzer und bricht plötzlich den einen Zeiger von der Uhr in der Ecke ab, um damit die Pfeife zu reinigen. Der Anblick dieser Zerstörung thut ihm gut, macht ihn in seinem Innern auflachen, und er späht umher nach mehr, was er in Unordnung bringen könnte.
Die Zeit vergeht. Völlig angekleidet in seinen nassen Kleidern, wirft er sich auf das Bett und schläft ein.
Als er erwachte, war es spät am Tage. Es regnete noch immer, es war naß auf der Straße. Sein Kopf war verwirrt, Reste von den Träumen, die er gehabt hatte, vermischten sich mit den Erlebnissen des gestrigen Tages; er fühlte kein Fieber, im Gegenteil, seine Hitze hatte sich gelegt, angenehme Kühle schlug ihm entgegen, als sei er die ganze Nacht in einem schwülen Walde gewandert und befinde sich jetzt in der Nähe eines Gewässers.
Es klopft. Der Postbote bringt ihm einen Brief. Er öffnet ihn, liest ihn, und es wird ihm schwer, ihn zu verstehen. Er war von Victoria, ein Zettel, ein halber Bogen: sie hatte vergessen, ihm zu sagen, daß sie heute abend zu Sejers gehe; sie wünschte ihn dort zu treffen, sie wollte ihm eine bessere Erklärung geben, wollte ihn bitten, sie zu vergessen, die Sache wie ein Mann zu tragen. Sie bat um Verzeihung wegen des schlechten Papiers und sandte freundliche Grüße.
Er ging zur Stadt, aß, kehrte nach Hause zurück und schrieb endlich eine Absage an Sejers, er könne nicht kommen, er möchte die Einladung aber gern zu gute haben, etwa für morgen abend.
Diesen Brief schickte er mit einem Boten zu Sejers.