
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
In dem Strahlenglanz eines schönen Morgens entfaltete sich das Schloß Bruyères auf die vorteilhafteste Weise der Welt. Die am Saume der großen Ebene gelegenen Domänen des Marquis waren ziemlich ergiebiger Boden, und der unfruchtbare Sand stieß mit seinen letzten weißen Wogen an die Mauern des Parkes.
Eine Wohlhabenheit, die zu der Armseligkeit der Umgebung einen entschiedenen Gegensatz bildete, erfreute, sobald man den Fuß dorthin setzte, den Blick. Ein Wolfsgraben mit einer schönen steinernen Mauer bezeichnete den Umkreis des Schlosses, ohne es zu maskieren. Darüber führte eine aus Ziegeln und Steinen erbaute Brücke. Diese Brücke führte an ein prachtvolles Gittertor von geschmiedetem Eisen. In der Mitte dieses Gittertores strahlte das Wappen des Marquis.
Es war ein beinahe königlicher Eingang, und als ein Diener in der Livree des Marquis das Tor geöffnet hatte, zögerten die den Wagen ziehenden Ochsen, wie geblendet von diesem Glanz und sich ihres schlichten ländlichen Ansehens schämend, die Schwelle zu überschreiten. Es bedurfte einer Berührung mit dem Stachelstock des Treibers, um sie dazu zu bestimmen. Diese wackern allzu bescheidenen Tiere wußten nicht, daß der Ackerbau der Ernährer des Adels ist. Eigentlich hätten durch ein solches Tor nur vergoldete Karossen mit Samtpolstern und venezianischen Spiegelfenstern einfahren sollen. Aber das Theater hat seine Vorrechte, und der Thespiskarren kommt überall durch. Ein Sandweg, der ebenso breit war wie die Brücke, führte durch einen nach der neuesten Mode angelegten kleinen Garten zum Schlosse. In diesem Garten herrschte die vollkommenste Symmetrie. Die Schere des Gärtners gestattete keinem Blatt, das andere zu überragen, und die Natur war trotz ihres Widerstrebens gezwungen, die gehorsame Dienerin der Kunst zu sein. In der Mitte jeder Anlage stand in mythologischer Haltung die Statue einer Göttin oder Nymphe. In der Mitte des Gartens kreuzte sich ein Weg von derselben Breite mit dem ersten, in dessen Mitte sich ein kleiner Teich mit einem jungen Triton befand, der aus seinem Muschelhorn einen Strahl flüssigen Kristalls emporsteigen ließ.
Diese Pracht setzte die armen Schauspieler, die nur selten Zutritt in solche Umgebung erhielten, in die größte Verwunderung. Serafina nahm sich fest vor, die Soubrette auszustechen und die Liebe des Marquis für sich selbst zu gewinnen, weil diese ihr als Trägerin des ersten weiblichen Rollenfaches, wie sie glaubte, mit Recht gebührte. Seit wann wäre auch wohl jemals der Soubrette der Vorzug vor der Primadonna eingeräumt worden?
Die Soubrette ihrerseits, die sich ihrer von den Frauen geleugneten, von den Männern aber ohne Widerspruch anerkannten Reize sicher war, betrachtete sich schon beinahe wie zu Hause und nicht ohne Grund. Sie sagte sich, daß der Marquis sie gar besonders ausgezeichnet und daß nur durch ihren das Herz treffenden tödlichen Blick plötzlich die Vorliebe für das Theater in ihm erwacht sei.
Isabella, deren Gedanken durch keinerlei ehrgeizige Pläne in Anspruch genommen wurden, sah sich nach Sigognac um, der hinter ihr in dem Wagen saß. Eine gewisse Scham hatte ihn veranlaßt, dorthin zu flüchten. Durch ihr reizendes Lächeln suchte sie seine unwillkürliche Melancholie zu zerstreuen. Sie fühlte, daß der Kontrast zwischen dem prachtvollen Schloß Bruyères und dem erbärmlichen Kastell Sigognac einen schmerzlichen Eindruck auf das Gemüt des armen Edelmannes machen mußte, der sich durch die Ungunst des Schicksals genötigt sah, die Abenteuer eines Karrens voll herumziehender Schauspieler zu teilen, und mit ihrem sanften Fraueninstinkt suchte sie den Schmerz des verwundeten Herzens zu beschwichtigen, das in jeder Beziehung eines bessern Schicksals würdig gewesen wäre.
Der Tyrann überlegte die Summe, die er als Gage für seine Truppe verlangen sollte, und fügte bei jeder Umdrehung der Räder der Ziffer eine neue Null hinzu, Blasius, der Pedant, leckte sich mit seiner Satyrzunge die vor unauslöschlichem Durst aufgesprungenen Lippen und dachte mit Wonnegefühl an den herrlichen Wein der besten Jahrgänge, die in den Kellern dieses Schlosses liegen mußten. Leander, der mittels eines kleinen Kammes seine ein wenig in Unordnung geratene Perücke in Ordnung brachte, fragte sich mit Herzklopfen, ob in diesem zauberhaften Schloß auch eine Herrin existiere. Diese Frage war für ihn von der höchsten Bedeutung. Die stolze, entschlossene, obschon joviale Miene des Marquis trübte jedoch ein wenig die kecken Hoffnungen, denen Leander sich im stillen bereits hinzugeben begann.
Unter der vorigen Regierung neu erbaut, zeigte das Schloß Bruyères sich nun von weitem am Ende des Gartens, den es beinahe in seiner ganzen Breite einnahm.
Der Stil, in dem es erbaut war, erinnerte an die Paläste des Place Royal in Paris. Ein großes Mittelgebäude und zwei Flügel bildeten einen Hof, und um die Eintönigkeit der langen Linie des Mittelgebäudes zu unterbrechen, hatte der Architekt in der Mitte eine Art von Pavillon angebracht, der das Eingangstor enthielt, zu dem man über eine Rampe hinaufstieg.
Nichts konnte für das Auge angenehmer sein als der Anblick dieses Schlosses, dessen Mauern von neuen Ziegeln und Steinen, die in einem gesunden Gesichte blühende Farben zeigten. Man war sofort überzeugt, daß hinter diesem neuen Luxus sich alter Reichtum berge.
Ein wenig hinter dem Schlosse zu beiden Seiten der Flügel sah man große hundertjährige Bäume, deren Gipfel safrangelbe Färbungen zeigten, deren Unterteil aber noch aus kräftigen grünen Zweigen bestand.
Der gute Baron von Sigognac hatte sicherlich niemals die Giftzähne des Neides in sein redliches Herz schlagen und jenes grüne Gift einfließen gefühlt, das bald sich durch alle Adern verbreitet und zuletzt selbst die besten Charaktere von der Welt verdirbt. Dennoch aber konnte er nicht ganz einen Seufzer unterdrücken, als er bedachte, daß früher die Sigognacs vor den Bruyères den Vortritt gehabt, weil sie von älterem Adel waren und sich schon zur Zeit des ersten Kreuzzuges hervorgetan hatten. Ohne daher auf den Marquis gerade eifersüchtig oder neidisch zu sein, konnte er nicht umhin, ihn sehr glücklich zu schätzen.
Der Wagen machte vor der Rampe des Schlosses halt, und der junge Baron erwachte aus seinen Betrachtungen, die ohnehin nichts Erfreuliches für ihn hatten. Er suchte, so gut er konnte, diese unzeitige Schwermut zu verbannen, unterdrückte mit männlicher Willenskraft die Träne, die ihm verstohlen ins Auge trat, und sprang entschlossen aus dem Wagen, um Isabella und den andern Damen, deren Röcke der Morgenwind ballonförmig aufbauschte, die Hand zu bieten.
Der Marquis von Bruyères, der die komische Karawane von weitem hatte kommen sehen, stand auf der Rampe des Schlosses in einem Wams von braunem Samt, Beinkleidern von demselben Stoffe, grauseidenen Strümpfen und weißen Schuhen, alles mit passenden Bändern verziert. Er kam einige Stufen der hufeisenförmigen Treppe herab wie ein höflicher Wirt, der es mit dem Stande und dem Range seiner Gäste nicht allzu genau nimmt. Übrigens konnte diese Herablassung durch die Gegenwart des Barons von Sigognac unter der Truppe gerechtfertigt werden. Auf der dritten Stufe blieb er stehen, denn er fand es nicht seiner Würde angemessen, noch weiter zu gehen, sondern begrüßte von hier aus die Schauspieler mit einer freundschaftlichen, gönnerhaften Handbewegung.
In diesem Augenblick steckte die Soubrette unter dem Leinwanddache des Wagens ihren Kopf hervor. Ihre Augen und ihr Mund schossen Blitze. Sie neigte sich, nachdem sie halb aus dem Wagen gestiegen und sich mit den Händen an das Querholz anhaltend, so daß man ein wenig von ihrem Busen sehen konnte, und schien auf Hilfe zu warten. Sigognac, der mit Isabella beschäftigt war, achtete nicht auf die erheuchelte Verlegenheit der durchtriebenen Schelmin, die ihre leuchtenden, bittenden Blicke zu dem Marquis emporhob. Der Schloßherr von Bruyères erhörte diesen Ruf. Er ging rasch die letzten Stufen der Treppe hinunter und näherte sich dem Wagen, um mit ausgestreckter Hand und wie zum Tanze vorgesetztem Fuße seine Pflichten als dienstbereiter Kavalier zu erfüllen. Mit einer flinken, koketten Bewegung, gleich der einer jungen Katze, schwang die Soubrette sich auf den Rand des Wagens, zögerte einen Augenblick, tat, als ob sie das Gleichgewicht verlöre, umschlang mit ihren Armen den Hals des Marquis und hüpfte leicht wie eine Feder auf den Boden hinab, so daß auf dem glattgerechten Sande kaum die Spur ihrer kleinen Vogelfüße zurückblieb.
»Entschuldigen Sie,« sagte sie zu dem Marquis, indem sie eine Verwirrung heuchelte, die sie weit entfernt war zu empfinden, »ich glaubte zu fallen und habe mich an Ihrem Halse wie an einem Aste festgehalten. Wenn man fällt, oder in Gefahr kommt zu ertrinken, hält man sich an, wo man kann. Ein Sturz ist übrigens für eine Schauspielerin keine Kleinigkeit und von schlimmer Vorbedeutung.«
»Erlauben Sie mir diesen kleinen Unfall als eine Gunst zu betrachten«, antwortete der Herr von Bruyères ganz erregt, denn er hatte den in sehr wissender Weise erzitternden Busen der jungen Dame an seiner Brust gefühlt.

Serafina hatte mit halb herumgewendetem Kopfe diese hinter ihrem Rücken vorgehende Szene mit jenem eifersüchtigen Scharfblicke einer Nebenbuhlerin beobachtet, der nichts entgeht und die es mit den hundert Augen des Argus aufnimmt. Sie konnte nicht umhin, sich auf die Lippe zu beißen. Zerbine – so hieß die Soubrette – hatte sich durch einen vertraulichen kecken Handstreich die Ehrenbezeigung des Schlosses zu erobern gewußt, die doch der Primadonna gebührt hätte. Es war dies eine verdammenswerte Ungeheuerlichkeit, die alle Rangordnung am Theater umzustürzen drohte.
»Seht doch diese Vagabundin, die einen Marquis braucht, um vom Karren herunterzusteigen«, sagte die Serafina für sich selbst in einer Weise, die mit dem manierierten Ton, den sie sonst beim Sprechen affektierte, durchaus nicht in Einklang stand. Aber der Ärger der Frauen bedient sich gern der Ausdrücke, die sonst bei Fisch- und Marktweibern üblich sind, und wären sie Herzoginnen oder erste Liebhaberinnen.
»Jean,« sagte der Marquis zu einem Diener, der sich auf einen Wink seines Herrn genähert hatte, »laß diesen Wagen auf den Hinterhof schaffen und die Dekorationen und Ausstattungsgegenstände in einem Schuppen unterbringen. Die Koffer dieser Herren und Damen kommen auf die durch meinen Intendanten angewiesenen Zimmer. Man verabreiche den Herrschaften alles, was sie brauchen oder verlangen. Ich will, daß man ihnen mit Ehrerbietung und Höflichkeit begegne. Geh!«
Nachdem diese Befehle erteilt waren, ging der Marquis würdevoll wieder die Freitreppe hinauf, nicht ohne, ehe er unter der Türe verschwand, der ihm zulächelnden Zerbine einen begehrlichen Blick zugeworfen zu haben.
Der Wagen lenkte, vom Tyrannen, Pedanten und Scapin begleitet, nach einem Hinterhofe, und mit Hilfe der Diener des Schlosses hatte man sehr bald einen Marktplatz, einen Palast und einen Wald in Gestalt dreier langer Rollen alter Leinwand ausgeladen. Dann folgten Leuchter von antiker Form, ein Stück vergoldetes Holz, ein blecherner in den Griff zurückzusteckender Dolch, Knäuel roten Garns, welche bestimmt waren, das Blut der Wunden darzustellen, ein Giftfläschchen, eine Aschenurne und andere für tragische Entwicklungskatastrophen notwendige Gegenstände.
Die Diener des Marquis berührten nur mit den Fingerspitzen und mit verächtlicher Miene diese dramatischen Siebensachen, die sie in dem Schuppen nach den Befehlen des Tyrannen, des Regisseurs der Truppe, aufstellten. Sie fanden es ein wenig demütigend, herumziehende Schauspieler zu bedienen. Aber der Marquis hatte gesprochen, und sie mußten gehorchen.
Mit so ehrerbietiger Miene, als ob er es mit wirklichen Königen und Prinzessinnen zu tun hätte, kam der Intendant mit dem Barett in der Hand, um den Schauspielern ihre Zimmer anzuweisen. In dem linken Flügel des Schlosses befanden sich die für die Gäste bestimmten Gemächer. Um zu ihnen zu gelangen, stieg man schöne, weiße steinerne Treppen hinauf und ging lange, schwarz und weiß getäfelte Korridore entlang, die durch ein Fenster an jedem Ende erleuchtet waren. Auf diese führten die Türen der Zimmer, die man nach der Farbe ihrer Tapete bezeichnete. Die Vorhänge an der äußeren Türe waren von derselben Farbe, damit jeder Gast mit Leichtigkeit sein Schlafgemach finden könne. Es gab das gelbe, das rote, das grüne, das blaue, das graue, das braune, das getäfelte, das Zimmer mit den Wandteppichen, das Zimmer mit den Fresken und noch eine Menge anderer, deren Namen man sich mit Hilfe der Analogie selbst denken kann, denn eine längere Aufzählung wäre zu langweilig und würde eher einen Tapezierer als einen Romanschreiber verraten.
Alle diese Zimmer waren sehr zweckmäßig eingerichtet und enthielten nicht bloß das Notwendige, sondern auch das Angenehme. Der Soubrette Zerbine fiel das Zimmer mit den Wandteppichen zu, an dessen Wänden man allerlei üppige Darstellungen aus dem Gebiet der Mythologie sah. Isabella bekam das blaue Zimmer, weil diese Farbe den Blondinen besonders gut steht. Das rote war für Serafina, und das braune erhielt die komische Alte, dessen Farbe ihrem Alter angemessen war. Der Baron erhielt ein Zimmer nicht weit von Isabellas Tür.
Es war dies eine zarte Aufmerksamkeit von Seiten des Marquis. Dieses prachtvolle Zimmer wurde nur vornehmen Gästen angewiesen. Der Herr von Bruyères legte Wert darauf, einen Mann von Geburt unter diesen herumziehenden Künstlern besonders auszuzeichnen und ihm zu beweisen, daß er ihn zu schätzen und zugleich das Geheimnis seines Inkognito zu respektieren wußte. Der übrige Teil der Truppe, der Tyrann, der Pedant, der Scapin, der Matamor und der Leander wurden in den andern Zimmern untergebracht.
Im Besitze seines Zimmers betrachtete Sigognac die Räumlichkeiten, die er während seines Aufenthaltes auf dem Schlosse bewohnen sollte, mit erstauntem Blick, denn niemals hatte er etwas der Art gesehen. Die Wände waren mit böhmischem Leder bekleidet, auf dem ein seltsames goldenes Muster strahlte. Die Fenstervorhänge waren von gelbem und rotem Brokat, und derselbe Stoff bildete die Garnitur des Bettes. Stühle mit viereckiger Lehne und gewundenen Füßen, mit vergoldeten Nägeln beschlagen, öffneten ihre wohlgepolsterten Arme. Dieser Kamin von weiß- und rotgeflecktem Marmor, war hoch, weit und tief. Ein an diesem frischen Morgen sehr wohltuendes Feuer loderte darin und beleuchtete mit seinem heitern Schein das darüber angebrachte Wappen des Marquis von Bruyères. Auf dem Sims stand eine kleine Uhr, die einen Pavillon mit der Glocke als Kuppel vorstellte, und zeigte die Stunde auf einem in der Mitte durchbrochenen silbernen Zifferblatt, das einen Blick in das Räderwerk sehen ließ. Ein Tisch mit gewundenen Füßen wie salomonische Säulen, mit einem türkischen Teppich bedeckt, nahm die Mitte des Zimmers ein. Vor den Fenstern neigte eine Toilette ihren venetianischen Spiegel auf eine Spitzendecke, die mit dem ganz koketten Arsenal der Verschönerungskunst versehen war. Unser armer Baron konnte, als er sich in diesem reinen Glas betrachtete, nicht umhin, seine äußere Erscheinung sehr armselig zu finden. Die Eleganz des Zimmers, die Neuheit und Frische der Gegenstände, von denen er umgeben war, machten sein lächerliches, herabgekommenes Kostüm, das schon vor Ermordung des vorigen Königs unmodern war, noch fühlbarer. Eine schwache Röte überzog, obschon er allein war, die mageren Wangen des jungen Mannes. Bis jetzt hatte er seine Armut nur beklagenswert gefunden. Jetzt kam sie ihm ungereimt und lächerlich vor, und zum ersten Male schämte er sich ihrer.
Da er sich ein wenig besser herausstaffieren wollte, so machte er das Paket auf, in das Pierre die wenigen Sachen, die sein Herr besaß, zusammengepackt hatte. Er faltete die verschiedenen Kleidungsstücke, die es enthielt, auseinander, fand aber nichts nach seinem Gefallen.
Diese betrübende Musterung beschäftigte ihn so ausschließlich, daß er nicht hörte, wie bescheiden an die Tür gepocht wurde, die gleich darauf sich öffnete und erst das rote aufgedunsene Gesicht und dann den dicken Körper des Meister Blasius hindurchließ, der mit vielen übertriebenen Reverenzen, die eine halb aufrichtige, halb erheuchelte Ehrerbietung verrieten, in das Zimmer trat.
Als der Pedant sich dem Baron näherte, hielt dieser gerade ein hundertfach durchlöchertes Hemd an den Ärmeln gegen das Fenster und betrachtete es mit trostlos kläglichem Kopfschütteln.
»Corpo di Baccho!« sagte der Pedant, bei dessen Stimme der Baron überrascht zusammenfuhr, »dieses Hemd hat ein tapferes, siegreiches Ansehen. Man sollte meinen, es habe bei Erstürmung eines festen Platzes die Brust des Gottes Mars bedeckt, so sehr ist es von Musketenkugeln, Bolzen, Pfeilen und anderen Wurfwaffen durchlöchert. Sie brauchen darüber nicht zu erröten, lieber Baron; diese Löcher sind Lippen, die den Ruhm verkünden, und manche funkelnagelneue, nach der neuesten Mode des Hofes zugeschnittene holländische Leinwand deckt die Schande eines einfältigen Emporkömmlings oder schlauen Betrügers. Wir armen Schauspieler, Schatten des menschlichen Lebens und Gespenster von Personen jeden Standes und Ranges, besitzen in Ermangelung des Seins doch wenigstens den Schein, der sich zu ersterem verhält wie das Spiegelbild zur Sache. Wenn es uns beliebt, so nehmen wir mit Hilfe unserer Garderobe, in der alle unsere Königreiche, Erbtümer und Herrschaften liegen, den Schein von Fürsten, Baronen und Edelleuten von stolzer Haltung und Miene an. In meiner Eigenschaft als Garderobemeister der Truppe verstehe ich, aus einem Lumpen einen Alexander, aus einem armen Teufel einen reichen, vornehmen Herrn, aus einer Landstreicherin eine große Dame zu machen, und wenn Sie es mir gestatten, so bin ich bereit, meine Kunst an Ihnen zur Anwendung zu bringen. Entsagen Sie dieser Livree der Schwermut und der Armut, die Ihre natürlichen Vorzüge verdunkelt und Ihnen ein ungerechtes Mißtrauen gegen sich selbst einflößt. Ich habe gerade einen sehr hübschen Anzug von schwarzem Sammet mit feuerfarbenen Bändern in Reserve, dem man das Theater nicht anmerkt, und den ein Hofkavalier tragen könnte. Ich habe das Hemd, die seidenen Strümpfe, die Schnallenschuhe, den Mantel, kurz alles, was zu dem Kostüm gehört, das, wie in Voraussicht unseres Abenteuers, ausdrücklich nach Ihrem Maß zugeschnitten zu sein scheint. Es fehlt nichts daran, nicht einmal der Degen.«

»Oh, den brauche ich nicht«, sagte der Baron mit einer Gebärde, in der sich der ganze Stolz des Edelmannes spiegelte. »Ich besitze den meines Vaters.«
»Heben Sie ihn gewissenhaft auf,« antwortete Blasius, »ein Degen ist ein treuer Freund und der Beschützer des Lebens und der Ehre seines Herrn. Er verläßt ihn nicht in Unglück oder Gefahren, wie die Schmeichler, diese Schmarotzer des Glückes, zu tun pflegen. Er wird Sie im Notfalle zu verteidigen wissen, wie er es schon getan, als der Bandit mit den Strohmännern jenen abscheulichen und lächerlichen Streich an der Heerstraße ausführte. Gestatten Sie jedoch, daß ich die Sachen aus dem Koffer herbeihole, der sie jetzt birgt. Ich sehne mich, die Puppe sich in den Schmetterling verwandeln zu sehen.« Nachdem der Pedant diese Worte mit dem grotesken Pathos gesprochen, das er sich angewöhnt und von seinen Rollen auf das gewöhnliche Leben übertragen hatte, verließ er das Zimmer und kam bald darauf mit einem in ein Tuch gehüllten, ziemlich umfangreichen Paket zurück, das er ehrerbietig auf den Tisch legte.
»Wenn Sie einem alten Pedanten der Komödie gestatten wollen, die Stelle Ihres Kammerdieners zu vertreten,« sagte Blasius, indem er sich zufrieden die Hände rieb, »so werde ich Sie auf schöne Art zum Adonis machen. Alle Damen werden sich sofort sterblich in Sie verlieben, denn, ohne der Küche des Schlosses Sigognac zu nahe treten zu wollen, muß ich doch sagen, daß Sie in Ihrem Hungerturm genug gefastet haben, um das wahre Aussehen eines vor Liebe Verschmachtenden zu besitzen. Die Frauen glauben nur an die mageren Leidenschaften. Wohlbeleibte Männer fallen bei ihnen ab, selbst wenn sie goldene Ketten im Munde trügen. Einzig und allein aus diesem Grunde habe ich bei dem schönen Geschlecht immer nur mittelmäßige Erfolge erzielt und mich deshalb frühzeitig der göttlichen Flasche gewidmet, die nicht so wählerisch ist, sondern gerade die Dicksten, als Gefäße, die viel in sich aufzunehmen vermögen, mit Gunst empfängt.«
So suchte der ehrliche Blasius den jungen Baron aufzuheitern, während er ihn ankleidete. Die Gelenkigkeit seiner Zunge tat der Rührigkeit seiner Hände keinen Eintrag. Selbst auf die Gefahr hin, für einen Schwätzer oder Zudringlichen gehalten zu werden, wollte er den jungen Edelmann lieber durch eine Flut von Worten betäuben, als ihn länger von der Wucht schmerzlicher Betrachtungen niederdrücken lassen.
Bald war die Toilette des Barons beendet. Als Blasius fertig war, führte er, mit seinem Werke zufrieden, an der Spitze des kleinen Fingers, wie man eine jugendliche Braut zum Altare führt, den Baron vor den auf dem Tische stehenden venezianischen Spiegel und sagte zu ihm:
»Haben Sie jetzt die Gnade, Herr Baron, einen Blick auf sich selbst zu werfen.«
Sigognac gewahrte in dem Spiegel ein Bild, das er anfangs für das einer andern Person hielt, so verschieden war es von dem seinigen. Er drehte unwillkürlich den Kopf herum und schaute sich über die Schulter, um zu sehen, ob nicht zufällig jemand hinter ihm stünde. Das Spiegelbild ahmte seine Bewegung nach. Es bestand sonach kein Zweifel mehr. Er war es wirklich selbst – nicht mehr der traurige, hagere, beklagenswerte, infolge großer Armut fast lächerliche Sigognac, sondern ein junger, eleganter, stattlicher Sigognac. Der junge Baron sah sich, so wie er sich zuweilen im Traume erschienen war, als Teilnehmer und Zuschauer eines eingebildeten Schauspiels. Ein stolzes, triumphierendes Lächeln umschwebte einige Sekunden lang wie ein Purpurschimmer seine bleichen Lippen, und seine so lange unter dem Unglück vergraben gewesene Jugend kam auf einmal auf der Oberfläche seiner verschönten Züge zum Vorschein.

Blasius, der neben dem Toilettetisch stand, betrachtete sein Werk, indem er zurücktrat, um es besser überblicken zu können, wie ein Maler, der an einem Gemälde, mit dem er zufrieden ist, soeben den letzten Strich getan hat.
»Wenn Sie, wie ich hoffe, sich bei Hofe emporarbeiten und wieder in den Besitz Ihrer Güter gelangen, dann machen Sie mich auf meine alten Tage zum Aufseher Ihrer Garderobe«, sagte er, indem er sich vor dem umgestalteten Baron tief verneigte.
»Ich werde mir dieses Gesuch merken,« entgegnete dieser mit wehmütigem Lächeln, »Sie, Meister Blasius, sind das erste menschliche Wesen, das sich etwas von mir erbittet.«
»Nach dem Diner, welches uns besonders aufgetragen werden wird,« hob der Pedant wieder an, »müssen wir dem Herrn Marquis von Bruyères unsern Besuch machen, um ihm das Verzeichnis der Stücke vorzulegen, die wir spielen können und um von ihm zu erfahren, in welchem Teile des Schlosses wir das Theater aufschlagen sollen. Sie werden für den Dichter der Truppe gelten, denn es fehlt in den Provinzen nicht an Schöngeistern, die zuweilen Thalia in der Hoffnung folgen, das Herz irgendeiner Schauspielerin zu rühren. Das ist übrigens sehr galant und hübsch. Isabella ist ein guter Vorwand, um so mehr, als sie Geist, Schönheit und Tugend besitzt. Die Naiven spielen öfter, als ein oberflächliches Publikum glaubt, ihr eigenes Naturell.« Nach diesen Worten entfernte sich der Pedant, um, obschon er nicht sehr eitel war, selbst Toilette zu machen.
Der schöne Leander, der fortwährend an die Burgherrin dachte, verschönte sich aufs beste, in der Hoffnung auf dieses unmögliche Abenteuer, das er immer noch verfolgte und das ihm, wie der Scapin behauptete, niemals etwas anderes als Enttäuschungen und Demütigungen gebracht hatte.
Die Schauspielerinnen, denen Herr von Bruyères galanterweise einige Stücke Seidenzeug geschickt hatte, um damit, im Notfalle, die Kostüme ihrer Rollen zu vervollständigen, machten, wie man sich leicht denken kann, von allen Hilfsmitteln Gebrauch, deren die Kunst sich bedient, um die Natur zu verschönern und bereiteten sich, soweit als die armselige Garderobe herumziehender Schauspielerinnen gestattete, zum Angriff.
Sodann begab man sich in das Zimmer, in dem das Diner aufgetragen war.
Von Natur ungeduldig, suchte der Marquis noch vor Beendigung des Mahles die Schauspieler bei Tische auf. Er duldete nicht, daß sie sich erhoben, und fragte den Tyrannen, welche Stücke er kenne.
»Ich kenne alle Werke des seligen Hardy,« antwortete der Tyrann mit seiner hohlen Grabesstimme, »ferner den ›Pyramus‹ von Theophil, die ›Sylvia‹, die ›Chriseidis‹ und die ›Sylvanira‹, die ›Treulose Vertraute‹, die ›Phyllis‹ von Scyra, den ›Lygdamon‹, den ›Bestraften Betrüger‹, die ›Witwe‹, den ›Ring des Vergessens‹ und alles, was die Schöngeister unserer Zeit Gutes hervorgebracht haben.«
»Seit einigen Jahren lebe ich zurückgezogen vom Hofe und bin daher von den Neuigkeiten der Literatur nicht unterrichtet«, sagte der Marquis mit bescheidener Miene. »Es würde mir daher schwer fallen, über so viele treffliche Stücke, von denen aber die meisten mir unbekannt sind, ein Urteil zu fällen. Ich glaube, das Rätlichste würde sein, mich Ihrer eigenen Wahl anzuvertrauen, die, auf Theorie und Praxis gestützt, nicht anders als eine kluge und angemessene sein kann.«
»Wir haben«, entgegnete der Tyrann, »oft ein Stück gespielt, das vielleicht nicht geeignet wäre, gedruckt zu werden, das aber wegen seiner Wortspiele, komischen Szenen und schlagenden Witze stets den Erfolg gehabt hat, die gebildetsten Leute zum Lachen zu bringen.«
»Suchen Sie kein anderes«, sagte der Marquis von Bruyères. »Wie heißt dieses glückliche Meisterwerk?«
»Die Rodomontaden des Kapitäns Matamor.«
»Ein guter Titel, bei meiner Ehre. Hat die Soubrette darin eine hübsche Rolle?« fragte der Marquis, indem er Zerbine einen Blick zuwarf.
»Die koketteste und schalkhafteste von der Welt. Und Zerbine spielt sie vortrefflich. Sie ist ihr Triumph. Es wurde ihr darin bis jetzt stets Beifall zugeklatscht, und zwar ohne Kabalen oder bestellte Claqueurs.«
Bei diesem direktorialen Kompliment hielt Zerbine es für ihre Pflicht, ein wenig zu erröten; es war ihr aber nicht leicht, ihrer braunen Wange einen Anflug von Rot zu verleihen. Die Bescheidenheit, diese innere Schminke, fehlte ihr gänzlich. Dieses Rouge war in keinem der Töpfe ihrer Toilette enthalten. Sie senkte die Augen, wodurch die Länge ihrer schwarzen Wimpern bemerkbar wurde, und hob die Hand empor, wie um den für sie allzu schmeichelhaften Worten Einhalt zu tun.
Zerbine machte sich so ganz reizend. Diese erheuchelte Schamhaftigkeit verleiht der wirklichen Verderbtheit viel reizvollen Beigeschmack. Sie gefällt den Lüstlingen wegen des pikanten Kontrastes, obschon sie sich dadurch nicht täuschen lassen. Der Marquis betrachtete die Soubrette mit feurigem Kennerblick und erwies den anderen Damen nur jene unbestimmte Höflichkeit des wohlerzogenen Mannes, der seine Wahl getroffen hat.
»Er erkundigt sich nicht einmal nach der Rolle der Primadonna«, dachte die Serafina, außer sich vor Ärger. »Das ist unerhört, und dieser an Geld und Gut so reiche Mann scheint mir an Geist, Anstand und Geschmack entsetzlich arm zu sein. Ganz gewiß besitzt er niedrige Geschmacksrichtungen. Sein Leben in der Provinz hat ihn verdorben, und die Gewohnheit, plumpen Bauerndirnen den Hof zu machen, hat ihm alles Zartgefühl geraubt.«
Diese Betrachtungen verliehen der Serafina keine liebenswürdige Miene. Ihre regelmäßigen, aber ein wenig harten Züge, die, um zu gefallen, durch ein studiertes Lächeln und sanfte Blicke gemildert werden mußten, gewannen durch diese Verzerrung einen schroffen, böswilligen Ausdruck. Ohne Zweifel war sie schöner als Zerbine, aber ihre Schönheit hatte etwas Hochfahrendes, Beleidigendes und Boshaftes.
Auch zog der Marquis sich zurück, ohne bei Donna Serafina oder bei Isabella, die er übrigens als dem Baron von Sigognac angehörig betrachtete, die mindeste Galanterie zu versuchen. Ehe er die Schwelle der Tür überschritt, sagte er zu dem Tyrannen:
»Ich habe Befehl gegeben, die Orangerie zu räumen, die der umfangreichste Raum des Schlosses ist, um dort das Theater aufzuschlagen. Man wird bereits Bretter, Tapeten, Bänke und alles, was sonst zu einer improvisierten Bühne notwendig ist, hingeschafft haben.«
Der Tyrann, Blasius und Scapin wurden durch einen Diener nach der Orangerie geführt. Diese drei besorgten in der Regel die Inszenierung. Der Orangeriesaal eignete sich ganz vortrefflich zu theatralischen Vorstellungen, namentlich wegen seiner länglichen Form, die gestattete, an einem der äußersten Enden die Bühne aufzuschlagen und in dem übrigen Raum Reihen von Sesseln, Stühlen und Bänken, je nach dem Range der Zuschauer und der Ehre, die man ihnen erzeigen wollte, aufzustellen. Die Wände waren mit grünen Spalieren auf himmelblauem Grunde bemalt und bildeten mit der ebenfalls geschmackvoll verzierten Decke eine der neuen Bestimmung des Ortes vollkommen passende Dekoration. An dem einen Ende des Saales legte man ein schräges Podium. Hölzerne, zur Befestigung der Kulissen bestimmte Träger wurden zu beiden Seiten des Theaters aufgerichtet. Große Tapetenvorhänge, die sich an gespannten Leinen hin und her schieben ließen, vertraten die Stelle des Vorhanges und öffneten sich nach links und rechts, wie die Falten eines Harlekinmantels. Ein ausgezackter Streifen, der der Garnitur eines Himmelbettes glich, bildete den oberen Teil und vervollständigte den Rahmen der Bühne.

Wir haben bis jetzt ganz vergessen zu erwähnen, daß der Marquis von Bruyères verheiratet war. Er erinnerte selbst sich dessen so selten, daß uns diese Unterlassung wohl zu verzeihen ist. Die Liebe hatte, wie man sich leicht denken kann, diesen Bund nicht geschlossen. Eine gleiche Anzahl von Ahnen und Gütern, die trefflich zusammenpaßten, war der Anlaß dazu gewesen. Nach einem sehr kurzen Honigmonat hatten der Marquis und die Marquise, die sehr wenig Sympathie füreinander fühlten, als Leute von gutem Ton, sich nicht in hartnäckig philiströser Weise die Aufgabe gestellt, einem unmöglichen Glück nachzujagen. Mit stillschweigender Übereinstimmung hatten sie darauf verzichtet und lebten freundschaftlich getrennt auf die artigste Weise von der Welt und mit der ganzen Freiheit, die der Anstand gestattet. Man darf deswegen nicht glauben, daß die Marquise von Bruyères eine häßliche oder unangenehme Frau gewesen sei. Was dem Ehemann wertlos erscheint, kann für den Liebhaber ein köstlicher Fund sein. Amor trägt eine Binde um die Augen, Hymen aber nicht.
Die Marquise bewohnte eine getrennte Etage, die der Marquis niemals betrat, ohne sich anmelden zu lassen.
Ihr Schlafzimmer war hoch und prachtvoll ausgestattet. Flandrische Tapeten bedeckten die Wände mit warmen, reichen und weichen Farben. Vorhänge von karmoisinrotem indischem Damast fielen in weiten Falten an den Fenstern herab und gewannen, durch das helle Tageslicht beleuchtet, purpurne Durchsichtigkeit. Der Kamin reichte ziemlich weit in das Zimmer herein, und ein großer venezianischer Spiegel in einem Kristallrahmen neigte sich vom Simse nach dem Zimmer, um dem sich Beschauenden entgegenzukommen. Auf den mit großen Kugeln von poliertem Metall versehenen Feuerböcken brannten knisternd drei Holzscheite. Die Wärme, die sie verbreiteten, war zu dieser Zeit des Jahres in einem Zimmer von diesem Umfange nicht überflüssig.
Zwei Schränke von seltsamer Form mit kleinen Säulen von Lapislazuli und geheimen Schubfächern, in die dem Marquis, selbst wenn er gewußt hätte, wie man sie öffnete, sicherlich nie eingefallen wäre, die Nase zu stecken, standen zu beiden Seiten eines Toilettentisches. Vor ihm saß Frau von Bruyères auf einem jener der Regierungszeit Ludwigs des Dreizehnten eigentümlichen Sessel, deren Lehne in der Höhe der Schultern aus einem gepolsterten, mit Fransen besetzten Brett besteht. Hinter der Marquise standen zwei Zofen, die sie bedienten, indem die eine ein Nadelkissen, die andere eine Schachtel mit Schönheitspflästerchen hielt.
Die Marquise konnte, obschon sie nur achtundzwanzig Jahre zugestand, doch das Kap der dreißig bereits umschifft haben – jenes Kap, vor dem die Frauen so große Scheu besitzen, als ob es weit gefährlicher wäre als das Kap der Stürme, vor dem Matrosen und Lotsen erzittern. Um wieviel Jahre sie über dieses Kap hinaus war, hätte niemand sagen können, nicht einmal die Marquise selbst, so sinnreich hatte sie die Chronologie in Verwirrung zu bringen gewußt.
Frau von Bruyères war eine Brünette, deren Teint die Wohlbeleibtheit, die auf die erste Jugend folgt, heller gemacht hatte. Die bräunlichen Farbentöne der Magerkeit, die früher mit Perlweiß und Talksteinpulver bekämpft wurden, waren einem matten Weiß gewichen, das am Tage ein wenig krankhaft, bei Kerzenlicht aber gar vortrefflich aussah. Das Oval ihres Gesichtes hatte durch die Fülle der Wangen gelitten, ohne jedoch von seinem Adel zu verlieren. Obschon man an der Form der Nase einiges auszusetzen gefunden hätte, ermangelte sie doch nicht des Stolzes. Die braunen Augen erhielten durch die ziemlich weit von den Augenlidern entfernten gewölbten Brauen einen Ausdruck des Erstaunens. Ihr üppiges schwarzes Haar hatte soeben die letzte Fasson von der Hand der Haarkünstlerin erhalten. Das Haar war eine der Schönheiten der Marquise und eignete sich zu allen möglichen Frisuren, ohne daß sie zu einer künstlichen Fülle zu greifen brauchte. Deshalb ließ sie gerne zu der Stunde, da ihre Frauen es ordneten, Damen und Kavaliere vor.
Nacken und Schultern waren weiß, rund und voll. Dasselbe galt von der herrlich geformten Büste.
Eine Schnur von schwarzer Seide, woran ein Herz von Rubinen und ein kleines Kreuz von Edelsteinen hing, umgab den Hals der Marquise, wie um die durch den Anblick dieser Reize erweckte heidnische Sinnlichkeit zu bekämpfen.
Über einem Unterrocke von weißem Atlas trug Frau von Bruyères ein Kleid von dunkelbrauner Seide mit schwarzen Bändern.
Jeanne, eine ihrer Frauen, bot ihr die Schachtel mit den Schönheitspflästerchen, die die letzte und unumgänglich notwendige Vervollständigung der Toilette darstellten für jede elegant sein wollende Dame zu jener Zeit. Die Marquise brachte eines in der Nähe des Mundwinkels an und suchte lange den geeigneten Platz für das andere, das man »Assassine« nennt, weil selbst dem stolzesten Mute dadurch Streiche versetzt werden, die er nicht parieren kann. Endlich entschied sich der zögernde Finger, und ein Punkt Taft, ein schwarzer Stern an einem weißen Himmel, markierte wie ein natürliches Mal den Rand der linken Brust. Dies hieß in galanten Hieroglyphen so viel, als daß man zu dem Munde nur auf dem Wege des Herzens gelangen könne.
Mit sich selbst zufrieden und nachdem sie einen letzten Blick in den auf dem Ankleidetisch stehenden venezianischen Spiegel geworfen, erhob sich die Marquise.
»Sie sind heute eine vollendete Schönheit, Frau Marquise,« sagte Jeanne in schmeichelndem Tone, »Ihr Haarputz steht Ihnen vortrefflich, und das Kleid könnte nicht besser sitzen.«
»Findest du das wirklich?« entgegnete die Marquise in zerstreut nachlässigem Tone. »Hat der Marquis viel Gäste zu dieser Komödie eingeladen?«
»Mehrere berittene Boten sind nach verschiedenen Richtungen abgegangen. Die Gesellschaft wird ganz gewiß sehr zahlreich sein; man wird von allen benachbarten Schlössern herbeikommen. Die Gelegenheiten zur Zerstreuung sind in dieser Gegend so selten.«
»Das ist wahr,« sagte die Marquise seufzend; »wer hier lebt, muß Vergnügungen sehr entbehren. Und hast du diese Schauspieler gesehen, Jeanne? Sind junge Männer von gutem Aussehen und galanten Manieren darunter?«
»Darüber kann ich nichts Genaues sagen, gnädige Frau. Diese Leute haben mehr Larven als Gesichter. Das Bleiweiß, die Schminke, die Perücke lassen sie beim Kerzenlicht schön und ganz anders erscheinen, als sie wirklich sind. Dennoch ist es mir vorgekommen, als befände sich wenigstens einer darunter, der nicht allzu zerlumpt einhergeht und sich benehmen kann wie ein Kavalier.«
»Das muß der Liebhaber sein, Jeanne«, sagte die Marquise. »Man wählt dazu gewöhnlich den hübschesten jungen Mann von der Truppe, denn es würde sehr schlecht aussehen, wenn ein stumpfnasiger, krummbeiniger Strolch sich auf die Knie niederwerfen wollte, um eine Liebeserklärung zu machen.«
»Das wäre allerdings sehr abgeschmackt«, rief die Zofe lachend. »Die Ehemänner mögen sein, wie sie wollen, die Liebhaber aber müssen tadellos sein.«
»Ich liebe auch diese Galans der Komödie, die stets in blühenden Ausdrücken sprechen, von zärtlichen Gefühlen überwallen, zu den Füßen einer Grausamen schmachten, den Himmel zum Zeugen anrufen, dem Schicksal fluchen, den Degen ziehen, um sich die Brust zu durchbohren, Feuer und Flammen sprühen wie Vulkane und Dinge sagen, die selbst die kaltblütigste Tugend in Ekstase versetzen müssen. Ihre Worte kitzeln mir angenehm das Herz, und es kommt mir zuweilen vor, als wenn sie sie an mich richteten. Oft macht die Unerbittlichkeit der Dame mich ungeduldig, und ich schelte sie im stillen, daß sie einen so vollkommenen Anbeter so lange schmachten und seufzen lassen kann.«
»Sie haben ein gutes Herz, gnädige Frau,« entgegnete Jeanne, »und es macht Ihnen kein Vergnügen, jemanden leiden zu sehen. Was mich betrifft, so habe ich ein härteres Gemüt, und es könnte mich nur belustigen, jemanden vor Liebe wirklich sterben zu sehen. Schöne Worte können mich nicht überreden.«
»Ich verstehe, Jeanne. Du verlangst etwas Positives und hältst dich zu sehr an das Materielle. Du liest nicht wie ich Romane und Theaterstücke. Sagtest du mir nicht soeben, der Liebhaber der Truppe sei ein schöner junger Mann?«
»Frau Marquise können dies selbst beurteilen«, sagte die Zofe, die in der Nähe des Fensters stand. »Eben geht er über den Hof, ohne Zweifel, um sich nach der Orangerie zu begeben, wo man das Theater aufschlägt.«
Die Marquise näherte sich dem Fenster und sah Leander mit kleinen Schritten und träumerischer Miene wie einen Menschen vorübergehen, der in eine tiefe Leidenschaft versunken ist. Um allen Zufällen zu begegnen, trug er diese melancholische Haltung zur Schau, die allemal die Aufmerksamkeit der Frauen erregt und sie glauben läßt, daß hier ein Herz des Trostes bedürfe. Unter dem Balkon angelangt, richtete er den Kopf mit einer gewissen Bewegung empor, die seinen Augen einen besonderen Glanz verlieh, und heftete auf das Fenster einen langen, traurigen, verzweiflungsvollen Blick unmöglicher Liebe, der dennoch die lebhafteste und ehrerbietigste Bewunderung ausdrückte. Als er die Marquise gewahrte, die ihre Stirn an die Glasscheibe lehnte, nahm er seinen Hut ab, so daß dessen Feder den Boden kehrte, und machte eine jener tiefen Verbeugungen, wie man sie vor Königinnen und Gottheiten macht. Dann bedeckte er sich wieder mit anmutiger Gebärde und nahm mit stolzer Miene die kavaliermäßige Haltung, der er einen Augenblick lang zu den Füßen der Schönheit entsagt, wieder an.
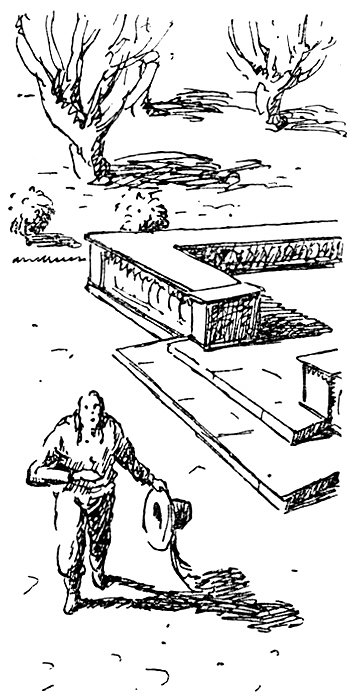
Geschmeichelt durch diesen zugleich diskreten und tiefen Gruß, wodurch man ihrem Range zollte, was ihm gebührte, konnte Frau von Bruyères nicht umhin, durch eine leichte Neigung des Kopfes, die von einem fast unbemerkbaren Lächeln begleitet war, zu antworten.
Diese günstigen Anzeichen entgingen Leander nicht, und sein angeborner Dünkel verfehlte nicht, ihre Bedeutung zu übertreiben. Er zweifelte keinen Augenblick, daß die Marquise sich in ihn verliebt habe, und seine zügellose Phantasie begann einen ganz märchenhaften Roman darauf zu bauen. Endlich sollte er den Traum seines ganzen Lebens erfüllt sehen, endlich sollte er ein galantes Abenteuer mit einer wirklichen vornehmen Dame in einem fast fürstlichen Schlosse bestehen, er, der arme Provinzkomödiant, der ohne Zweifel hohes Talent besaß, aber doch noch nicht vor dem Hofe gespielt hatte. Von diesen dünkelhaften Ideen erfüllt, ward ihm ganz sonderbar zumute, sein Herz schwoll, seine Brust erweiterte sich, und sobald als die Probe beendet war, kehrte er auf sein Zimmer zurück, um hier ein Billett im überschwenglichsten Stil zu schreiben, das er der Marquise in die Hände zu spielen gedachte.
Da jeder seine Rolle kannte, war es möglich, die Vorstellung der »Rodomontaden des Kapitäns Matamor« stattfinden zu lassen, sobald die Gäste des Marquis versammelt waren. Die in einen Theatersaal umgestaltete Orangerie bot den reizendsten Anblick dar. An den Wänden befestigte Armleuchter verbreiteten ein mildes Licht, das dem Putz der Damen günstig war, ohne die Wirkung der Bühne zu beeinträchtigen. Hinter den Zuschauern auf terrassenförmig angebrachten Brettern hatte man die Orangenbäume aufgestellt, deren Blätter und Früchte, durch die laue Atmosphäre des Saales erwärmt, einen angenehmen Geruch entwickelten, der sich mit den Moschus-, Benzoë- und Ambradüften mischte.
In der ersten Reihe, ganz nahe an der Bühne, auf prachtvollen Lehnstühlen strahlten Yolande de Foix, die Herzogin von Montalban, die Baronin von Hagémeau, die Marquise von Bruyères und andere vornehme Damen in Toiletten von einem Reichtum und einer Eleganz, die entschlossen waren, sich nicht übertreffen zu lassen. Da sah man nur Samt, Atlas, Silber- oder Goldstoff, Spitzen, Diamanten, Perlen und Edelsteine, die im Lichtschein funkelten, abgesehen von den noch viel lebhafteren Funken, die aus den Diamanten der Augen sprühten.
Wäre Yolande de Foix nicht dagewesen, so würden mehrere sterbliche Göttinnen einen Paris in Verlegenheit gebracht haben, welcher er den goldenen Apfel schenken sollte, aber ihre Gegenwart machte jeden Wettstreit überflüssig. Dennoch glich sie nicht der nachsichtigen Venus, sondern mehr der strengen Diana. Yolande besaß in der Tat eine grausame Schönheit, unerbittliche Grazie und eine zur Verzweiflung treibende Vollkommenheit. Ihr Mund, der wellenförmig war wie der Bogen der Jägerin, entsendete Spott, selbst wenn er stumm blieb, und ihr blaues Auge schoß kalte Blitze, die selbst den Kühnsten aus der Fassung bringen mußten. Dennoch war ihre Anziehungskraft unwiderstehlich. Ihre ganze strahlende Erscheinung gesellte zu der Begierde die Herausforderung des Unmöglichen. Noch nie hatte ein Mann Yolanden gesehen, ohne sich in sie zu verlieben; von ihr aber wiedergeliebt zu werden, dies war ein Hirngespinst, das sich nur wenige zu hegen gestatteten.
Auf niedrigen Sesseln und Bänken saßen hinter den Damen die Edelleute und Herren, die Väter, Ehemänner und Brüder dieser Schönheiten. Einige neigten sich anmutig über die Lehnen der vorderen Sessel und murmelten eine zierliche Schmeichelei in ein nachsichtiges Ohr, andere fächelten sich mit dem Federbusch ihrer Hüte oder ließen stehend, eine Hand in die Hüfte gestemmt, so daß ihre schöne stattliche Gestalt zur Geltung gebracht wurde, einen zufriedenen Blick über die Versammlung schweifen. Das Summen der Konversation schwebte über den Köpfen wie ein leichter Nebel, und die Erwartung begann in Ungeduld umzuschlagen, als ein feierliches dreimaliges Klopfen sich vernehmen ließ, worauf sofort die lautloseste Stille herrschte.
Die Vorhänge teilten sich langsam und ließen eine Dekoration sehen, die einen öffentlichen Platz darstellte, einen unbestimmten für die Intrigen und Begegnungen der damals noch in den Kinderschuhen steckenden Komödie geeigneten Ort.
Es war eine breite Straße von Häusern mit spitzigen Giebeln.
Eines dieser Häuser, das die Ecke zweier Gassen bildete, besaß eine wirkliche Tür und ein wirkliches Fenster.
Die beiden Kulissen erfreuten sich desselben Vorzugs. Überdies besaß eine davon einen Balkon, den man mittels einer für den Zuschauer unsichtbaren Leiter ersteigen konnte. Das Ganze aber ließ in willigen Zuschauern die Vorstellung eines öffentlichen Platzes aufkommen. Eine Reihe von vierundzwanzig sorgfältig geputzten Lichtern warf einen hellen Schein auf diese ehrliche Dekoration, die an solchen Glanz nicht gewöhnt war.
Dieser prachtvolle Anblick entlockte dem Auditorium ein Gemurmel des Beifalls und der Bewunderung.
Die von den Darstellern sehr gut gespielte Posse fand lebhaften Beifall. Die Männer fanden die Soubrette reizend, die Frauen ließen Isabellas Anstand und Grazie Gerechtigkeit widerfahren, und der Matamor hatte alle Stimmen für sich. In der Tat konnte diese Rolle kaum von jemand gespielt werden, der besser als der Künstler, der sie hier zur Ausführung brachte, dazu geistig und körperlich befähigt gewesen wäre. Leander wurde von den schönen Damen bewundert, obschon die Kavaliere ihn für etwas geckenhaft erklärten. Es war dies die Wirkung, die er gewöhnlich hervorbrachte, und im Grunde genommen wünschte er auch gar keine andere, denn es lag ihm mehr daran, die Schönheit seiner Person als sein Talent anerkannt zu sehen. Serafinas Schönheit fand viele Bewunderer, und mehr als ein junger Kavalier schwur, selbst auf die Gefahr hin, seiner schönen Nachbarin zu mißfallen, bei seinem Schnurrbarte, daß sie ein anbetungswürdiges Mädchen sei.
Sigognac hatte, hinter einer Kulisse versteckt, sein Entzücken an Isabellas Spiel gehabt, obschon er sich zuweilen im Innern ein wenig eifersüchtig über den zärtlichen Ton fühlte, den sie annahm, wenn sie Leander antwortete. Er war noch nicht an jene erkünstelten Liebeserklärungen auf der Bühne gewöhnt, hinter der sich oft tiefe Abneigung und wirkliche Feindschaft bergen. Als daher das Stück zu Ende war, machte er der jungen Schauspielerin mit einer gezwungenen Miene, die sie sofort bemerkte, und deren Ursache sie ohne Mühe erriet, seine Komplimente.
»Sie spielen die Liebhaberinnen ganz bewundernswürdig, Isabella, so daß man dadurch wirklich getäuscht werden könnte.«
»Nun, ist dies nicht mein Handwerk?« antwortete die junge Künstlerin lächelnd. »Und hat der Direktor der Truppe mich nicht dazu engagiert?«
»Allerdings,« sagte der Baron, »aber es sah ganz so aus, als wären Sie aufrichtig für diesen Gecken eingenommen, der weiter nichts versteht, als die Zähne zu zeigen, wie ein Hund, und mit seinem schönen Bein Parade zu machen.«
»Aber seine Rolle verlangte das ja. Sollte er vielleicht unbeholfen und mürrisch dastehen wie ein Klotz? Habe ich nicht übrigens die Bescheidenheit eines wohlerzogenen anständigen jungen Mädchens bewahrt? Wenn ich darin gefehlt habe, so sagen Sie es mir. Ich werde es dann ein andermal besser machen.«
»O nein. Sie waren ein vollkommen keusches, sittsames Mädchen, und man könnte nichts an Ihrem Spiele aussetzen, das so wahr, so richtig, so anständig ist, daß es die Natur aufs täuschendste nachahmt.«
»Mein lieber Baron, man fängt an die Lichter auszulöschen. Die Gesellschaft hat sich entfernt, und wir werden uns sogleich im Finstern befinden. Werfen Sie mir diesen Mantel über die Schultern und haben Sie die Güte, mich auf mein Zimmer zu geleiten.«
Der Baron entledigte sich ohne allzu linkisches Wesen, obschon ihm die Hände nicht wenig zitterten, der für ihn neuen Aufgabe des Begleiters einer Schauspielerin, und beide verließen den Saal, in dem niemand mehr anwesend war.
Die Orangerie lag in einiger Entfernung vom Schlosse, ein wenig links in einem großen Baumdickicht. Die Fassade, die man von dieser Seite sah, war nicht weniger prächtig als die andere. Da der Park niedriger lag als das Parterre, auf dem das Schloß stand, so führte zu ihm eine Terrasse hinauf, auf deren durchbrochenem Geländer Vasen von weißem und blauem Porzellan standen. In ihnen blühten Sträucher und Blumen, die letzten der Jahreszeit. Eine Treppe mit doppeltem Geländer führte von hier in den Park hinab.
Es konnte ungefähr neun Uhr sein. Der Mond war aufgegangen. Ein leichter Dunst, der einer Silbergaze glich, milderte die Umrisse der Gegenstände, hinderte aber nicht, sie deutlich voneinander zu unterscheiden. Man sah vollkommen die Fassade des Schlosses, von dessen Fenstern einige in rotem Licht erglühten, während einzelne von den Strahlen des nächtlichen Gestirns getroffene Scheiben schimmerten und funkelten wie Fischschuppen.

Wenn man ins Weite hinausblickte, so bot sich ein nicht minder bezaubernder Anblick. Man sah, wie die Alleen des Parkes sich in einem azurnen Nebel verloren, der zuweilen von dem silbernen Schimmer einer Marmorstatue oder einer Fontäne durchbrochen wurde.
Isabella und Sigognac stiegen die Treppe hinauf und wandelten, entzückt von der Schönheit des Abends, einigemal die Terrasse auf und ab, ehe sie sich auf ihre Zimmer begaben. Da der Ort völlig offen war und vom Schlosse überblickt werden konnte, so fand das Anstandsgefühl der jungen Schauspielerin gegen diesen nächtlichen Spaziergang nichts einzuwenden. Übrigens gab ihr die Schüchternheit des Barons Sicherheit, und obschon ihr Rollenfach das der naiven Naturkinder war, so verstand sie von den Dingen der Liebe doch genug, um recht wohl zu wissen, daß die Achtung nur der wahren Leidenschaft eigen ist. Der junge Baron hatte ihr noch kein förmliches Geständnis gemacht, aber sie fühlte sich von ihm geliebt und fürchtete von ihm keinen peinlichen Angriff auf ihre Tugend.
Mit jener reizenden Verlegenheit der beginnenden Liebe sprach dieses junge Paar, indem es Arm in Arm im Mondschein auf und ab wandelte, nur über die unbedeutendsten Dinge von der Welt. Wer sie belauscht hätte, wäre überrascht gewesen, nur alltägliche Bemerkungen, Fragen und Antworten zu hören. Wenn aber auch die Worte kein Geheimnis verrieten, so sagte doch das Zittern der Stimme, der bewegte Ton, das öftere Schweigen und das leise, vertrauliche Flüstern, mit welchen Gedanken die Seele beschäftigt war.
Der Baron führte Isabella zu ihrem Zimmer, und als er in seines hineingehen wollte, gewahrte er im Hintergrunde des Korridors eine geheimnisvolle Erscheinung, in einen mauerfarbenen Mantel gehüllt, dessen über die Schulter geworfener Zipfel das Gesicht bis an die Augen verdeckte. Der in die Stirn hereingezogene Hut gestattete ebensowenig die Züge zu unterscheiden, als wenn der Mann maskiert gewesen wäre. Als er Isabella und den Baron sah, drückte er sich so dicht als möglich an die Mauer. Von den Schauspielern, die sich schon in ihre Zimmer zurückgezogen hatten, war es keiner. Der Tyrann war größer, der Pedant dicker, Leander schlanker. Er hatte weder das Gehaben des Scapin noch das des Matamor, der übrigens an seiner außerordentlichen Magerkeit, die selbst durch den weitesten Mantel nicht unbemerkbar gemacht werden konnte, zu erkennen war.
Da Sigognac nicht neugierig erscheinen oder den Unbekannten belästigen wollte, so beeilte er sich, die Schwelle seines Zimmers zu überschreiten, nicht jedoch, ohne bemerkt zu haben, daß die Tür des Zimmers, das Zerbine bewohnte, geöffnet war, als ob sie einen Besucher erwartete, der nicht gehört sein wollte.
Als der Baron seine Tür hinter sich geschlossen, verriet ihm ein fast unhörbares Knistern von Schuhen und das leise Geräusch eines vorsichtig geschobenen Riegels, daß der so sorgfältig in seinen Mantel gehüllte Schleicher in dem ersehnten Hafen eingelaufen war.
Ungefähr eine Stunde später öffnete Leander behutsam seine Tür, sah, ob der Korridor leer wäre und lenkte seine Schritte, vorsichtig wie eine Zigeunerin beim Eiertanz, nach der Treppe. Diese ging er leichter und leiser als die in alten Schlössern umherirrenden Gespenster hinab, schlich sich im Schatten der Mauer entlang und nahm die Richtung nach einem Boskett des Parkes, wo eine Statue des Amors stand, der diskret den Zeigefinger auf den Mund hielt. An dieser ihm zweifellos im voraus bezeichneten Stelle blieb Leander stehen und schien zu warten.
Wir haben bereits gesagt, daß Leander das Lächeln, durch das die Marquise seinen Gruß erwidert, zu seinem Vorteil ausgelegt und sich erdreistet hatte, einen Brief an sie zu schreiben, den Jeanne, durch einige Pistolen verführt, heimlich auf den Toilettetisch ihrer Herrin gelegt hatte.
Diesen Brief teilen wir hier mit, um dem Leser einen Begriff von dem Stile zu geben, dessen sich Leander bei seiner Verführung vornehmer Damen, worin er so groß zu sein behauptete, bediente. Das Schreiben lautete folgendermaßen:
»Madame, oder vielmehr Göttin der Schönheit! – Legen Sie nur Ihren unvergleichlichen Reizen das Mißgeschick zur Last, das sie Ihnen zuziehen. Diese Reize zwingen mich durch ihren Glanz, aus dem Dunkel hervorzutreten, in dem ich hätte begraben bleiben sollen, und mich dem Lichte zu nähern, wie die Delphine beim Scheine der Laternen der Fischer aus der Tiefe des Ozeans heraufkommen, obschon sie dadurch ihren Tod finden und ohne Erbarmen von den Wurfspießen der Fischer durchbohrt werden.
»Ich weiß recht wohl, daß ich die Welle mit meinem Blute röten werde, da ich aber ebenso gewiß nicht leben kann, so ist mir der Tod völlig gleich. Es ist eine seltsame Kühnheit, den nur den Halbgöttern vorbehaltenen Anspruch zu erheben, den Todesstreich wenigstens durch Ihre Hand zu empfangen.
»Ich wage es, denn da ich schon im voraus verzweifle, so kann mir nichts Schlimmeres geschehen, und Ihr Zorn ist mir lieber als Ihre Verachtung. Um Ihrem Opfer den Todesstoß zu versetzen, müssen Sie es wenigstens ansehen. Ich werde daher, wenn Ihre Grausamkeit mir den Tod gibt, wenigstens der höchsten Seligkeit teilhaftig, von Ihnen bemerkt zu werden.
»Ja, ich liebe Sie, Madame, und wenn es ein Verbrechen ist, so bereue ich es doch nicht. Gott duldet auch, daß man ihn anbetet, die Sterne ertragen die Bewunderung des bescheidensten Schäfers. Es ist einmal das Schicksal einer hohen Vollkommenheit wie die Ihrige, nur von untergeordneten Wesen geliebt werden zu können, denn ihresgleichen haben sie auf Erden nicht, ja finden deren kaum im Himmel.
»Ich bin leider weiter nichts als ein armer umherziehender Schauspieler, aber selbst wenn ich Herzog oder Prinz und mit allen Gaben des Glückes gesegnet wäre, so würde mein Haupt immer noch nicht Ihre Füße erreichen, und es läge zwischen Ihrem Glanze und meinem Nichts die Entfernung des Gipfels bis zum Abgrunde.
»Um ein Herz aufzuheben, müssen Sie sich stets bücken. Das meinige, Madame, ist, ich wage es zu sagen, ebenso stolz wie zärtlich, und wer es nicht verschmäht, wird darin die feurigste Liebe, das vollkommenste Zartgefühl, die unbedingteste Achtung und die grenzenloseste Hingebung finden. Wenn übrigens mir ein solches Glück zuteil werden würde, so würde Ihre Nachsicht vielleicht nicht so tief herabsteigen, als Sie glauben. Obschon durch das widrige Schicksal und den eifersüchtigen Groll eines großen Herrn in die Notwendigkeit versetzt, mich hinter Rollen verkleidet im Theater zu verbergen, bin ich doch nicht von einer Geburt, über die ich erröten müßte. Wenn ich wagen dürfte, das Geheimnis zu verletzen, das Staatsgründe mir auflegen, so würde man sehen, daß ein ziemlich erlauchtes Blut in meinen Adern fließt. Wer mich liebt, vergibt seiner Würde durchaus nichts. Doch ich habe schon zuviel gesagt. Ich werde nie etwas anderes als der demütigste und gehorsamste Ihrer Diener sein, selbst wenn infolge einer jener Erkennungen, die die Entwickelungskatastrophen der Tragödien bilden, alle Welt mich als den Sohn eines Königs begrüßte. Möge ein Wink, wäre es auch nur der leiseste, mir zu verstehen geben, daß meine Kühnheit keinen allzu großen Grad von Zorn und Verachtung in Ihnen erweckt hat, und ich werde vor Ihren Augen auf dem Scheiterhaufen meiner Liebe gern und freudig sterben.«
Was hätte wohl die Marquise auf diese glühende Epistel, die vielleicht schon mehrmals verwendet worden war, geantwortet? Unglücklicherweise gelangte der Brief nicht an seine Adresse. Sein Augenmerk nur auf vornehme Damen gerichtet, beachtete Leander nicht genug die Zofen und war keineswegs gegen sie zuvorkommend. Er tat daran sehr unrecht, denn diese Wesen vermögen in der Regel viel über den Willen ihrer Herrinnen. Wären die Pistolen von einigen Küssen und Schäkereien unterstützt worden, so hätte Jeanne, in ihrer Eigenliebe befriedigt, sich ihres Auftrages mit mehr Eifer und Treue entledigt.
Während sie Leanders Brief nachlässig in der Hand hielt, begegnete ihr der Marquis und fragte sie ganz zufällig, denn er war von Haus aus durchaus kein neugieriger Ehemann, was das für ein Papier sei.
»Oh, es ist weiter nichts,« antwortete sie, »es ist ein Brief von Herrn Leander an die Frau Marquise.«
»Von Leander, dem Liebhaber der Truppe, der in den ›Rodomontaden des Kapitäns Matamoros‹ den Galan spielte? Was kann er meiner Frau zu schreiben haben? Ohne Zweifel will er sie um eine Gratifikation bitten.«
»Das glaube ich nicht«, antwortete die heimtückische Zofe. »Als er mir dieses Billett übergab, seufzte er und verdrehte die Augen wie ein Verliebter.«
»Gib den Brief her«, sagte der Marquis. »Ich werde ihn selbst beantworten. Der Marquise sage nichts davon. Diese Komödianten sind zuweilen unverschämt und wissen, verwöhnt durch die Freundlichkeit, die man ihnen beweist, sich nicht innerhalb ihrer Schranken zu halten.«
In der Tat beantwortete der Marquis, der sich gern einen Scherz machte, Leanders Brief in derselben Weise auf moschusduftendem Papier, mit wohlriechendem Wachs und einem Wappen gesiegelt, um die verliebte Einbildung des armen Teufels zu bestärken und zu nähren.
Als Leander nach beendeter Vorstellung in sein Zimmer zurückkam, fand er auf seinem Tische ein von geheimnisvoller Hand hier niedergelegtes Briefchen mit der Überschrift: »An Herrn Leander.« Zitternd vor Wonne öffnete er es und las folgende Zeilen:
»Wie Sie für meine Ruhe nur zu richtig bemerkten, können die Göttinnen nur Sterbliche lieben. Um elf Uhr, wenn alles auf der Erde schläft, und keine menschlichen Lauscherblicke mehr zu fürchten sind, wird Diana den Himmel verlassen und zu dem Schäfer Endymion herabsteigen. Es wird dies aber nicht auf meinem Berg Latmus geschehen, sondern im Park am Fuße der Statue des verschwiegenen Amor, wo der schöne Schäfer Sorge tragen soll, zu schlummern, um die Schüchternheit der Unsterblichen zu schonen, die ohne ihr Gefolge von Nymphen kommen wird, in eine Wolke gehüllt und ihrer Silberstrahlen entkleidet.«
Wir überlassen es dem Leser, auszudenken, welche wahnsinnige Freude das Herz Leanders beim Lesen dieses Briefes überflutete, der seine verwegensten Hoffnungen weit übertraf. Sofort goß er eine Flasche Essenz auf Haar und Hände, kaute ein Stück Muskat, um frischen Atem zu haben, bürstete sich die Zähne, drehte die Spitzen seiner Locken und begab sich in den Park an den bezeichneten Ort.
Das Fieber der Erwartung und die Frische der Nachtluft machten ihn frösteln und schaudern. Beim Falle eines Blattes fuhr er zusammen und bei dem mindesten Geräusche spitzte er das Ohr, das geübt war, das Murmeln des Souffleurs im Fluge zu erhaschen. Der unter seinem Fuße knisternde Sand schien ihm einen ungeheuren Lärm zu machen, den man im Schlosse hören müsse. Der heilige Schauer des Waldes bemächtigte sich seiner wider Willen, und die großen schwarzen Bäume beunruhigten seine Einbildungskraft. Er hatte nicht gerade Furcht, aber seine Gedanken glitten traurig ab.

Die Marquise blieb ein wenig lange aus, und Diana ließ Endymion ein wenig lange im Tau des Grases stehen.
»Wenn die Marquise nicht bald kommt, so findet sie dann statt eines feurigen Anbeters nur einen halb erfrorenen«, dachte Leander. »Dieses Warten, bei dem man den Schnupfen bekommt, kann der großen Aufgabe eines Liebenden nur nachteilig sein.«
Soweit war er in seinen Betrachtungen gekommen, als plötzlich vier dicke Schatten hinter den Bäumen und dem Sockel der Bildsäule hervorstürzten. Zwei dieser Schatten, die die Körper großer, lümmelhafter, im Dienste des Marquis von Bruyères stehender Lakaien waren, faßten den armen Schauspieler bei den Armen und hielten sie ausgestreckt fest, während die beiden andern rasch und nach dem Takte seinen Rücken zu bearbeiten begannen, auf dem die Hiebe dröhnten wie Hämmer auf einem Ambosse. Der arme Leander, der natürlich sich wohl hütete, durch Geschrei Leute herbeizulocken und sein unglückliches Abenteuer bekannt werden zu lassen, ertrug alles heldenmütig. Selbst Mucius Scävola bewies mit der Faust in der Kohlenglut keine größere Standhaftigkeit, als Leander unter dem Stocke.
Als die Züchtigung beendet war, ließen die vier Henker ihr Opfer los, verneigten sich tief und entfernten sich, ohne auch nur ein Wort gesprochen zu haben.
Welch schimpflicher Fall! Ikarus tat, aus der Höhe des Himmels herabstürzend, keinen tieferen. Zerbleut und zerschlagen, ging Leander, den Rücken krümmend und sich die Seiten reibend, wieder zum Schloß zurück. Aber seine Eitelkeit war so groß, daß er nicht im mindesten an eine Mystifikation dachte. Seine Eigenliebe fand es angemessener, dem Abenteuer eine tragische Wendung zu geben. Er sagte sich, daß die Marquise ohne Zweifel von ihrem eifersüchtigen Gemahle belauert, und ehe sie den Ort des Stelldichein erreicht, mit dem Dolch auf der Brust gezwungen worden sei, alles zu gestehen. Er dachte sie sich, wie sie mit aufgelöstem Haar zu den Füßen des Marquis kniete, ihn um Gnade anflehte, in Tränen schwamm und ihm versprach, für die Zukunft der Schwäche ihres Herzens besser zu widerstehen. Selbst mit Schwielen bedeckt, beklagte er sie, daß sie sich um seinetwillen in solche Gefahr begeben, und ahnte nicht, daß sie von der ganzen Geschichte nichts wußte, sondern in diesem Augenblicke ganz ruhig in ihrem warmen Bette ruhte.
Als er den Korridor entlang ging, bemerkte er zu seinem Ärger, daß Scapin den Kopf zu der ein wenig geöffneten Türe seines Zimmers heraussteckte und boshaft schmunzelte. Leander richtete sich so gut als möglich in die Höhe, aber es schien, als ob Scapin sich dadurch nicht täuschen ließe.
Am nächsten Morgen traf die Truppe Anstalten zur Abreise. Den Ochsenwagen gab man als zu langsam auf, und der Tyrann, der von dem Marquis freigebig bezahlt worden war, mietete einen großen vierspännigen Wagen, um seine Leute und ihr Gepäck fortzubringen.
Leander und Zerbine standen ziemlich spät auf – aus Gründen, die hier nicht näher erörtert zu werden brauchen, nur zeigte der eine einen kläglichen Gesichtsausdruck, obschon er gute Miene zum bösen Spiele zu machen bemüht war. Die andere strahlte im Gefühl befriedigten Ehrgeizes. Sie zeigte sich sogar gegen ihre Kolleginnen ungemein herablassend, und die komische Alte näherte sich ihr – und dies war ein bedeutungsvolles Symptom – auf eine schmeichlerische Weise, die sie bis jetzt noch nie gegen sie an den Tag gelegt. Scapin, dem nichts entging, bemerkte, daß Zerbinens Koffer, wie infolge einer Zauberei, auf einmal das Doppelte seines früheren Gewichtes gewonnen hatte. Serafina biß sich auf die Lippen und murmelte das Wort: »Kreatur!« Die Soubrette tat jedoch, als hörte sie es nicht, glücklich für den Augenblick über die Niederlage der ersten Liebhaberin.
Endlich setzte sich der Wagen in Bewegung, und man verließ das gastfreundliche Schloß Bruyères, von dem alle, mit Ausnahme Leanders, nur ungern schieden. Der Tyrann dachte an die empfangenen blanken Pistolen, der Pedant an die vortrefflichen Weine, an denen er sich tüchtig satt getrunken, der Matamor an den Beifall, womit man ihn überschüttet, Zerbine an die Stücke Seidenzeug, die goldenen Halsbänder und andere schöne Dinge.
Sigognac und Isabella dachten nur an ihre Liebe. Glücklich damit, beisammen zu sein, wendeten sie nicht einmal den Kopf, um die blauen Dächer und roten Mauern des Schlosses Bruyères noch einmal am Horizont zu sehen.