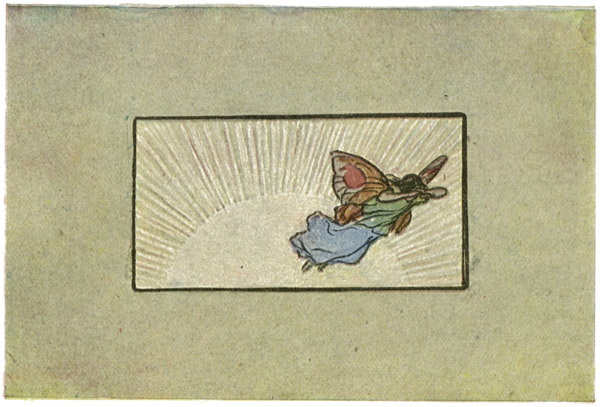|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Es gibt Tage der Arbeit, an denen zum Beispiel ein Schriftsteller drei Romankapitel hervorbringt, in der Stadtbibliothek sieben Bücher vorfindet und auszieht, seinen fünf Kindern die Schularbeiten verbessert, neunzehn Briefe schreibt, drei erfolgreiche Besuche macht und des Abends zwischen Auskleiden und Schlafengehen noch eine vollständige Novelle entwirft, kurz: Tage, an denen alles »fleckt«. Und es gibt Tage, die man mit frohem Arbeitsmut beginnt und die dahingehen mit Feder aussuchen, Tinte eingießen, Ofen regulieren, Fenster öffnen, Fenster schließen, Nagel putzen, Steuer zahlen, Medizin nehmen, umgestoßene Teetassen aufnehmen, aufdringlichen Besuch empfangen, zerrissene Hosenträger ausbessern und zerschnittene Finger umwickeln, o vermaledeite, höchst verruchte Tage! Und es gibt Tage des Sinnens und Träumens, die auch der Arbeit nicht freundlich und die dennoch fruchtreiche Tage sind. Tage, an denen das Leben uns gebieterisch verlangt und uns zuruft: »Fei're, du Arbeitswüterich, und wenn tausend Pflichten drängen, fei're und schaue die Welt, die um dich und in dir ist.«
 Solch ein Tag ist heute.
Solch ein Tag ist heute.
Vor einer Stunde ist mein Töchterlein Roswitha, bekannter unter dem Namen »Appelschnut«, am Fenster vorübergesprungen, hat im Fluge ihr Mündchen an die Scheibe gedrückt und gerufen: »Hier ist ein Tüßchen für dich,« und ist verschwunden. Und die Kühle des Maimorgens hat den Hauch ihres Mäulchens festgehalten, man sieht deutlich zwei runde, volle Lippen am Fenster abgedrückt, und jede zweite Minute muß ich nun nach dem Fenster blicken und nachsehen, ob auch das von Morgenhauch und Kinderatem gemalte Bild noch da ist. Ich kann heute beim besten Willen nicht arbeiten; denn ich muß unaufhörlich achtgeben, daß die reinliche Magd nicht mit ihrem Fenstertuch die liebliche Spur entferne.
 Ja, laßt uns mit träumendem Blick in den Kelch einer Kinderseele blicken, die in kaum erschlossener Knospe alle Ahnungen künftigen Lebens umfängt! Laßt uns mit Appelschnut durch Garten und Feld gehen!
Ja, laßt uns mit träumendem Blick in den Kelch einer Kinderseele blicken, die in kaum erschlossener Knospe alle Ahnungen künftigen Lebens umfängt! Laßt uns mit Appelschnut durch Garten und Feld gehen!
Sie ist so gern im Freien! Und wenn sie von draußen kommt, dann schwimmt ihr ganzes Persönchen im Rausch der frischen, freien Luft, und aus den Augen blitzt, aus den wirren Haaren glänzt, von den roten Wangen leuchtet eine wunderbare, beneidenswerte Strolchhaftigkeit!
»Pappi,« ruft sie eines Wintertags, »Irene will nich mit 'raus, weil es so kalt is! Denn is sie doch'n Stubenhöcker nich?«
»Jawohl.«
»Ich will nach der Eisbahn!«
»Du mußt mich aber doch erst schlafen legen!«
Es ist altgeheiligter Brauch, daß sie mich nach dem Essen auf die Chaiselongue wirft und daß sie dann auf meinen Schenkeln reitet, während ich ihr Lieder vorsinge oder allerlei Verslein vorspreche.
»Du mußt doch erst reiten!« sage ich also.
»Na ja.« Sie schwingt sich in den Sattel.
»Oder magst du nicht reiten?«
»O ja-a.«
»Willst du lieber nach der Eisbahn?«
»Och nee.«
»Was magst du lieber: Auf mir reiten oder nach der Eisbahn gehen?«
»Och – – beides gleich.«
Sie will mich durchaus schonen.
»Sag' einmal ganz ehrlich, was du lieber willst. Wenn du nach der Eisbahn willst, darfst du gleich gehen, und ich bin dir gar nicht böse!«
»Eisbahn!!« schreit sie, springt auf den Fußboden und wird nicht mehr geseh'n.

Aber jetzt ist der Frühling gekommen, und Appelschnut ist – »mit Tränen sag' ich es: ein Räuber.«

In einem finsteren Tannendickicht unseres Gartens ist ihr Versteck, und wenn sie aus einem schwarzen Loch dieses Dickichts mit ihrem brennend roten Riesen-Strandhut und ihren enormen Augen hervorfunkelt, dann mag wohl auch der beherzte Wanderer zittern, wenn nicht vor Angst und Schrecken, so doch vor Lachen und Rührung; denn aus diesen Augen glüht alles mögliche eher als Raub- und Mordlust. Ich muß vorübergehen und mich überfallen lassen. Sie schießt wie ein Pfeil aus ihrem Versteck hervor, umspringt mich und fährt immer mit den Händen an meiner Kleidung herunter, als wenn sie mich gänzlich abschälen wollte; dabei gibt sie ununterbrochen ein Zischen und Fauchen von sich wie eine Maschine, die Dampf ausstößt – sie scheint das für eine Eigentümlichkeit der Räuber zu halten. Sie schleift mich in ihre Höhle, und hier zeigt sie mir, was sie schon alles geraubt hat: eine alte Puppe, die ihr selbst gehört, eine leere Konservenbüchse und ein paar welke Kuhblumen. Dann blickt der Räuber eine Weile nachdenklich vor sich hin, und plötzlich ruft er:
»O Pappi, weiß du noch, wie ich mal mit Rudi am Fenster gespielt hab, im Schulweg, weiß noch? Da standen doch so' ne ganse Menge Blumentöpfe auf der Fensterbank, nich? un da setzten wir doch all meine wilden Tiere in die Blumen hinein, aus mei'm schilobischen Garten die Tiere, weiß du? Die setzten wir zwischen all die Zweige, un da reitet da'n Soldat durch'n Wald, un der pfeifte noch rech so gemütlich vor sich hin: tüt tütlüt tütlüt tüt tüt – un da – mit ei'mal – da springen all die Löwen un Tiger un Elefanten auf ihn los: hra, hra, hra, wu wu wu – o, wie war das unheimlich!?«
Dies Ereignis liegt schon Jahre zurück; aber es muß ein köstliches Spiel gewesen sein, denn immer wieder taucht es ihr aus der Vergangenheit hervor; sie hat es mir schon drei- oder viermal erzählt. Sie wird sich noch als Greisin dieses Waldes auf der Fensterbank erinnern.

Da – nach wenigen Minuten – ertönt Geschrei! Der Räuber hat sich von einem Kaninchen beißen lassen.
Sie hat zwei Kaninchen, ein schwarzes und ein weißes, und sie heißen »Swatt« und »Witt«. Sie hat »Swatt« ein Brotkrümchen hingehalten, so groß wie eine Erbse, da hat »Swatt« danach geschnappt und hat sie gebissen. Es ist kaum eine Wunde zu finden; aber der Schreck, der Schreck! Wer hätte solche Heimtücke von Swatt erwartet, von Swatt, der ein so seidenweiches Fell hat!
»Witt is viel süßer!« versichert der gebissene Räuber, »als Swatt mich gebissen hat, da hat Witt mich so süß angeguckt!«
Und sie streichelt dem menschlich fühlenden Witt voll Zärtlichkeit über Kopf und Rücken. So belohnt an allem Ende sich die Tugend.

Als ich ihr die beiden Kameraden schenkte, ließ ich den Stall und die Tierchen am späten Abend bringen. Sie sollte sie am Morgen unversehens im Garten finden, und ich wollte mich ungesehen vom Fenster aus an ihrer Überraschung weiden. Als sie sie am Morgen erblickte, genoß ihre Seele ein volles, wahres Wunder. Sie blieb erst von weitem wie erstarrt stehen; dann stöhnte sie in beklommener Freude: Ooooooo?? – Ooooooo?? – Oooooooooooo??« und dann blickte sie nach der Reihe ihre herbeigeeilten Geschwister an und fragte mit stummen Blicken: »Ist es Traum – ist es Wirklichkeit?« Nach einiger Zeit stieg ich erwartungsvoll hinab, um ihren feurigen Dank einzuheimsen.
»Pappi,« schrie sie, »das schwarze hat vorn auf der Brust 'n entzücknigten kleinen weißen Fleck, un das weiße hat ganz braune Ohren, un das schwarze hat eben so getan« – und sie machte einen richtigen Kaninchensprung – »un das weiße hat eben so gemacht« – und sie machte beide Hände krumm und putzte sich damit das Schnäuzchen.

Ich erhielt also nicht nur keinen Dank, ich bekam nicht einmal meinen Morgenkuß, nicht einmal einen Gruß! Das war der Dank! – Und es war einer. Wer das Herzklopfen in ihren Worten hörte, der genoß mehr als Dank.
Sie strich ihnen schüchtern mit freudezitternder Hand über den Kopf.
»Was haben sie für sanfte Ohren! Nich, Pappi?«
»Ja,« sagte Erasmus, um sie zu necken, »die Ohren sind zu hübsch, die wollen wir ihnen abschneiden und dann in einer Vase auf den Kamin stellen!«
»Pfui, Rasmus!« ruft Appelschnut, »das mußt du nicht sagen, sons träumen sie nachts davon!«
Endlich sagt meine Frau: »Hast du dich denn auch schon bedankt?«
»Ach ja,« ruft sie hastig, »ich dank auch schön, Mammi, ich dank auch schön, Pappi!«
»Nicht mal ein Küßchen kriegen wir?«
»Ach ja, hab' ich ganz vergessen –!« und Mutter und Vater bekommen je einen geschäftsmäßigen Kuß.
»Und guten Morgen hast du mir auch noch nicht gesagt.«
»Ach ja – guten Morgen – – o Pappi, es frißt, es frißt! Das weiße frißt!«
Erst am Abend blüht unter den fröhlichen Wirrnissen des Tages der eigentliche Dank empor. Sie ist nach vieler Mühe endlich unter der Bettdecke zur Ruhe gebracht worden. Als ich aber an ihr Bett trete, fliegen alle Kissen wieder umher; sie schlingt mir die Arme um den Hals und sagt:
»Ich dank' euch auch noch vielmals, daß ihr mir die Kaninchen geschenkt habt!«
»Hast du sie denn gern?«
»Leidenschaftlich!« versetzt sie mit so aufrichtigen Augen, als verstünde sie sich seit Jahren auf die Leidenschaft. Und nun regnet es richtige Küsse. Und dann ruft sie plötzlich:
»Die Natur ist zu süß, daß sie euch beide gemacht hat!«
Aus einer tiefgründigen Unterhaltung über Naturprodukt und Kunstprodukt weiß sie nämlich, daß Tische und Kleider und Würste u. dergl. von Menschen, Rosen und Menschen und Regenwürmer u. dergl. aber von der Natur hervorgebracht werden.
Voll psychologischer Hinterlist frage ich sie:
»Wo ist denn die Natur?«
Und prompt und sicher antwortet sie: »In der Luft!« und macht ein Gesicht dazu wie: »Das weißt du noch nicht?«
Endlich bring ich sie wieder unter die Decke, und sie schmiegt sich tief und fest hinein.
»Ich mag so gern in mein Bettschen liegen,« sagt sie mit wohlig-blinzelnden Augen, »das ist so wollig!« Soll heißen: mollig.
Sie hat das Talent, zu genießen, ein Talent von ernster Bedeutung für unsern Kampf mit den Greueln der Welt.
Als aber fünf Minuten später ihre Mutter durchs Zimmer huschen will, steht Appelschnut schon wieder aufrecht im Bett und winkt ihr.
»Nun, was willst du denn noch?«
»Ich muß dir mal was sagen!«
»Na, dann sag's doch!«
»Nein, ich muß es dir ganz leise in Ohr sagen.«
Meine Frau kommt heran, und Appelschnut sagt ihr ganz leise ins Ohr:
»Wenn ich mich freu, dann klopft mein Herz immer so laut. Sag' es aber nicht den andern!!«
»Nein, nein!« versichert die heuchlerische Mutter, die darauf brennt, dies neue Geheimnis ihrem Manne zu verraten. »Nun mußt du aber auch schlafen!«
»Du hast mir aber noch gar nichts vorgesungen.«
Das hat sie davon! Ihre Kinder schliefen alle ungesungen ein. Aber sie wollte, daß um die Wiege ihrer Kinder Gesang sei. Und so hat sie sie alle verwöhnt. Nun mag sie's haben. Und sie singt:
Da singt die Mutter Lied um Lied
Dem Kindchen vor und wird nicht müd';
Sie singt so sanfte Weise –

»Mutter, was is ›Weise‹?« fragt die mit allen Sinnen horchende Appelschnut, und die Sängerin muß es erklären.
So innig und so leise –
»Mutter, was is ›innig‹?«
Dscha – damit geht es schon schwerer! Erklär' einer, was innig ist, einem fünfjährigen Kinde, dessen ganzes Leben noch lauter Innigkeit ist! Die Antwort ist fast noch schwieriger als die auf die Frage, die Appelschnut eines Tages auf einem Spaziergang an mich richtete:
»Du Pappi, was sind eigenlich Kreuzzüge?«
Mit großem Eifer hörte sie die Geschichte Josefs, um sie mir, als ich nach Hause kam, brühwarm zu berichten.
»Da gingte Pharao an der Elbe spazieren, un da kamen mit eimal sieben dicke fette Ochsen aus 'm Wasser, un dann noch sieben dünne, un die sieben dünnen verschlangten die sieben fetten.«
»Warum kam Josef denn ins Gefängnis?« frage ich im Laufe der Unterhaltung.
»Weil er nix getan hat!«
Du ahnungsvoller Engel du!
Selbst als die Jungfrau von Orleans gelesen wurde, blieb sie drinnen und hörte zu, und endlich sagte sie:
»Wenn ich größer bin, geh ich auch ins Konzert und in die Jungfrau.«
»Wie heißt denn die Jungfrau?« fragte man sie.

»Johanna!«
»Und wie heißt sie noch weiter?«
»Jungfrau!« versetzte sie wieder mit einem Ausdruck, als wenn sie sagen wollte: Wie fragst du dumm!
Sie ließ auch keine Ruhe, bis die Mutter endlich mit ihr zu lesen begann. Aber auch ihre Lesestunden sind Lebestunden.
Sie liest: »Rübe«.
»Haben wir gestern gegessen!« ruft sie.
»Mus«.
»Ei –«, sie streicht sich über den Magen. »Mammi, wann essen wir mal wieder Apfelmus?«
»Lüge«.
»O Mammi, neulich hat aber Bertha gelügt! (Bertha: ein Nachbarskind.) Sie hat gesagt, ihre Mutter reist weg, un denn kriegt sie 'ne Stiefmutter. Das lügt sie doch, nich? Stiefmütter gibt es doch gar nich, nich? Die gibt es doch bloß in Märchen, nich?«
Sie liest: »Juni«.
»Was ist denn Juni?« fragt ihre Mutter.
»Juni? – Juni is 'n Oktober!«
Sie liest: »Karo«.
»Mammi!« ruft sie, »der Terry ist aber doch zu frech! Er läuft immer über mein Beet, un wenn ich denn sag: Terry, du solls das nich tun! Denn stellt er sich einfach so hin« – sie rutscht vom Stuhle und stellt sich auf alle Viere – »und kuckt mich ganz frech an.«

Sie liest: »Gaul«.
Und damit ist sie wieder beim A und O ihrer Sehnsucht.
»Mammi, wann krieg ich eigenlich 'n lebendiges Pferdschen!«
Ein Pferd, ein Pferd, ein Königreich für ein Pferd! Jedes Roß, das des Weges zieht, ist der Liebe und der Teilnahme Appelschnutens gewiß. Als der Eierhändler mit seinem Wagen beim Nachbar Schulze hielt, da schrie sie:
»O Pappi, was haben Schulzes für 'n wunderhübsches Pferd vor ihrem Eiermann!«
Ein guter Mann im tiefsten Süden von Afrika hat gehört, daß Appelschnut einmal so gern ihr Schaukelpferd gegen das lebendige Pferd eines Fuhrmanns vertauschen wollte. Er hat ihr geschrieben: Komm und besuch mich, dann geb ich dir für dein Schaukelpferd ein richtiges, lebendiges Pferd!
Seit der Zeit trägt Roswitha sich ernstlich mit Reisegedanken.
»Das geht ganz gut,« versichert sie, »ich brauch mein Schaukelpferd ja nich zu tragen; ich zieh es einfach am Band hintennach. Das kann man ja!«
»Das kann man, gewiß!«

Als sie aber doch jemand auf die etwas große Entfernung aufmerksam machte, rief sie:
»Er kann ja nur weiter herziehen!«
Wenn sie das Pferd erst hat, will sie es vor ihren Wagen spannen.
»Ich geb' das Pferdschen aber nich Rudi zum Spielen; der macht es latürlich gleich kaput!«
Und trotz alledem! Trotz all' der lebendigen Pferde, Hunde, Katzen, Hühner, Drosseln, Spatzen und Frösche, die sie mit zärtlicher Hand berührt hat, zieht sie stundenlang vom Keller bis zum Dachboden eine hölzerne Garnrolle am Bande hinter sich her und hört diese Garnrolle miauen und schnurren, sieht sie springen und sich putzen. Und als die Mutter gar diese Rolle mit einem Stück schwarzen Plüschs umwickelt hat, da muß sie ihr auch ein Schälchen Milch hinstellen, und Appelschnut hört und sieht sie mit feinem, rotem Zünglein schlecken, und sie stürmt mein Studierzimmer und führt mir das reizende Kätzlein vor und läßt es miauen und schlecken, buckeln und schnurren; denn nun ist sie nicht nur davon überzeugt, daß die Garnrolle genau wie ein Kätzchen aussehe, sie ist auch tief davon durchdrungen, daß all wir andern ob der ungemeinen Natürlichkeit und Lebendigkeit dieses köstlichen Tierchens der Bewunderung voll seien.
Gebt dem Kinde nur einen Stein, ein Stückchen Holz – sein schöpferisches Leben spricht ein wunderbares Werde! darüber, und je mehr Leben es geben kann, desto seliger ist es!

Doch dürfen wir den Bericht über Appelschnuts Bildungsgang nicht ganz aus den Augen verlieren! Er bewegt sich oft in hohen Bereichen, dieser Bildungsgang!
Sie spielt zuweilen mit ihren Geschwistern ein sogenanntes Quartettspiel, dessen Karten die Bilder von Dichtern und Komponisten zeigen.
»Ja,« sprach sie eines Tages, »Hertha mag ja lieber Gluck leiden; aber mein Engel ist Mozart!«
Ein guter Engel. Ein Erzengel. Ich wär's zufrieden, wenn er ihr Schutzengel würde. In allen Künsten wird sie ausgebildet, auch im Malen und Zeichnen. Sie zeichnet alle Geschichten, die sie gehört hat, und nach einem geheimnisvollen System der Ethik zeichnet sie die guten Menschen mit einem Zylinder, die bösen aber barhäuptig.
Aber am gespanntesten horcht Appelschnut doch, wenn ihr die Mutter vorsingt oder Geschichten erzählt. Dann wandern alle Geister des Liedes oder der Geschichte sichtbar über ihr rundes Antlitz, und so unlöslich gebunden hängen ihre Augen an den Lippen der Mutter, daß hinwiederum das Dienstmädchen in seiner Arbeit stockt und, die halberhobene Tischdecke unbewegt in den Händen haltend, unlöslich an den Augen des Kindes hängt und seine trinkende Seele belauscht.

Hirschlein ging im Wald spazieren.
Trieb allda sein artig Spiel,
Daß es allen andern Tieren
Als ein lust'ger Freund gefiel.
Aber hinter einer Linde
Hielt der Jäger und sein Hund,
Und der Jäger mit der Flinte
Schoß das arme Hirschlein wund.
Hirschlein kann nun nicht mehr springen.
Denn sein wundes Bein tut weh;
Aber wenn die Vöglein singen,
Legt sich's weinend in den Klee.
Am andern Morgen hörte ich sie im Garten singen. Sie lief um ein Beet herum und sang dazu mit lauter, hallender Stimme:
Hirschlein kann nun nicht mehr springen.
Denn sein wundes Bein tut weh –
und immer lauter sang sie und immer schneller lief sie, immer rund um das Beet herum, und auf jeder Wange lag eine richtige, dicke Träne.
Vor dem Tode hat sie das ganze Grauen eines luft- und lebensheißen Kinderherzens.
Einmal, als ich mit ihr spazieren ging – wir waren eine Weile still nebeneinander hergegangen; im Gebüsch und in den Halmen der Kornfelder lag summende Sommerglut – da rief sie laut und scheinbar unvermittelt:
»Ich möcht' nie in mein Leben sterben!«
Und nach einiger Zeit sagte sie:
»Wenn du stirbs un Mammi stirbt auch, dann mach ich mich auch tot. Wenn bloß einer von euch stirbt, denn mach ich mich wohl nich tot; aber wenn ihr beide sterbt, denn mach ich mich tot.«
Mit dem Tode beschäftigt sie sich auch, wenn sie abends in ihrem Bettchen liegt und sich uneingestandenermaßen vor der Einsamkeit fürchtet. Und so ist es ganz wohl möglich, daß sie, obwohl sie schon dreimal endgültig zum Schlaf gebettet worden und die Mutter ihr mehrere Lieder vorgesungen hat, dennoch zum vierten Male nach ihr ruft und aus ihren runden und roten Backen heraus mit angstvollem Tone zu der Herbeigeeilten sagt:
»Mammi, ich bin so bange, daß ich an Bleichsucht sterb'!«
Sie, die Fünfjährige, die scheinbar nur in der Gegenwart lebt, sie kennt schon ganz die Wehmut des Vergehens und des Vergangenen.
Am Schulweg, in unserer ehemaligen Wohnung stieß an unsern Garten ein anderer, kleiner Garten, und in diesem erschien zuweilen ein liebes, blondköpfiges Kind, das nie aus seinem Gärtchen heraus durfte, aber übers Gitter hinweg erzählten die beiden einander ihre großen Angelegenheiten und Herzensgeheimnisse. Und über ihren Köpfen raunte eine alte mächtige Ulme.
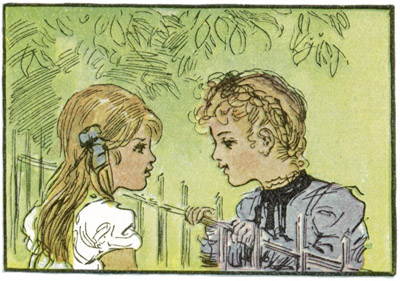
Während Appelschnut sonst in den hellen Tag hinein schläft, fand meine Frau sie eines Morgens in grauer Frühe wachend in ihrem Bett liegen.
»Warum schläfst du denn nicht, mein Liebling?« fragte ihre Mutter.
»Ach, ich muß immer an Schulweg denken, un wenn ich denn an den Blondkopf und an die Ulme denk', denn muß ich beinah weinen.«
Aber gleich darauf erschien ihr Bruder am Bett und schenkte ihr eine Stocklaterne. Und diese, obwohl sie ohne Licht war, scheuchte alle Schatten der Wehmut hinweg; Appelschnut nahm sie in den Arm, steckte – ich darf es eigentlich gar nicht sagen, und beileibe sag' es ihr keiner wieder! – steckte den linken Daumen in den Mund und entschlief beim Freudenschein der Laterne. – – – –
Immer, immer wieder muß ich nach dem Kuß am Fenster sehen und – leider – leider – die Sonne steigt und seine Spur beginnt zu verlöschen.
Ach, im Schulweg lebte ja auch Rudi, der goldgelockte Rudi, der immer Fridthjof Nansen spielte und die »Fram« im Waschbottich schwimmen ließ, und große Stücke weißen, schwimmenden Papiers waren die Eisschollen, Rudi, der Appelschnutens erste unglückliche Liebe war! Einstmals machte sie ihm einen regelrechten Heiratsantrag; aber Rudi lehnte ab, wahrscheinlich, weil der Gedanke nicht von ihm ausgegangen war. Dann aber sagte Roswitha:
»Ich geb' dir auch zwei Bonbons – wills du mich denn auch heiraten?«
Rudi dachte nach, schob die Lippen vor und sagte endlich mit ungalanter Lässigkeit:
»Na ja.«

Diesen Rudi liebt sie noch immer; aber zu ihrem Manne hat sie inzwischen einen anderen, einen achtzehnjährigen jungen Mann bestimmt, der Konrad heißt und den sie ebenfalls liebt, weil er »so vermoost« (famos) mit ihr spielen kann.
»Konrad soll mein Mann werden«, erklärt sie; »aber erst muß ich Mutter werden, und das dauert noch lange!«
Sie hat überhaupt kein Gefühl für Monogamie. Als bei irgend einer Gelegenheit ihre Schwester Hertha erklärte, sie wolle Hans Meyer zum Manne haben, und man Appelschnut fragte, wen sie denn wolle, da versetzte sie gleichgültig:
»Ach – ich nehm' Herthas Mann mit.«
Überhaupt die Moral dieser fünfjährigen Wichtelmännchen! Es ist eine gänzlich unbeschränkte Moral. Von dem goldgelockten Rudi hat Appelschnut auch das Wetten gelernt, das noch vor kurzem im Reichstag so streng verurteilt wurde. Eines Nachmittags stand auf dem Tische vor mir ein Teller mit einem Stück Kuchen. Mit einem Knall springt die Tür auf und herein strampelt Appelschnut, beide Hände auf dem Rücken.
»Woll'n wir wetten, ob ich Vagißmannich gefunden hab?« frug sie.
»Ja. Um was woll'n wir denn wetten?«
Sie hat natürlich längst den Teller entdeckt.
»Um'n Stück Kuchen!«
Wenn ich gewinne, krieg ich also ein Stück von meinem Kuchen.
Ein Jahr früher war sie aber noch viel dümmer.
Da kam sie einmal zu ihrer Mutter und rief: »Mammi, gibs du mir wohl'n Apfel?«
Da sie sonst nicht zu betteln pflegt, fragte meine Frau:
»Warum denn?«
»Och, ich hab mit Rudi um'n Apfel gewettet, ob ich ihm wohl mein Automobil schenk', un nu hab ich es ihm geschenkt, un nu muß ich ihm doch'n Apfel geben.«
Sie bekam zwei Äpfel, einen für Rudi und einen für sich, und zwei Küsse, einen vom Vater und einen von der Mutter; denn meine Frau und ich sind immer der Meinung, daß diese seltene Varietät der Dummheit belohnt werden müsse.
So dumm ist sie jetzt nicht mehr – o nein, sie wird immer klüger, immer klüger.
Die Sonne steigt immer höher, und das Lippenpaar am Fenster ist bis auf einen lichten, kaum erkennbaren Hauch verschwunden.
Steigende Sonne, du bringst uns das weiße Licht und nimmst uns den bunten Traum.
Auch unser sicherstes Glück: wachsen und sich vollenden – es ist Freude und Schmerz in einem Becher.