
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Silbergrau zieht im Talgrund ein Fluß. Wie der Heerwurm schildtragender Krieger. Und es meldet die Sage: Glück und Leben ließ Roricus, König Clodomars Sohn, in der reißenden Strömung. Ihm zum Gedächtnis hieß man den Fluß die Ruhr.
Im Brukterergau, an der Kreuzung des Hellwegs – der Heerstraße durch Westfalenland –, errichtet der Franke Karl ein Kastell. Altfried, ein sächsischer Edeling, gründet im Schutz der Burg ein Kloster. Lang streckt sich das hohe Kirchenschiff. Ein Glockenturm wächst zum Himmel empor, gebaut von einem lombardischen Meister, den Machthild kommen ließ, die fromme Mutter, die auch den vergoldeten Leuchter schenkte, den siebenarmigen, der, mit Bergkristall und Blutstein verziert, vor dem Altar des Münsters steht.
Wohl weiß es der Hütejunge, der am Waldhang die Herde des Oberhofs weidet. Denn wöchentlich einmal treibt er das Schlachtvieh zum Stift, wo er Freunde hat unter den Schülern. Die erzählen ihm viel: von Krone und Kreuz, vom Leben der Großen, vom Sterben der Heiligen. Er sieht den Leib des Erlösers hängen. Weihrauch hüllt ihn ein, Gold und Glas umgibt ihn.
Sehnsucht schwingt in des Jungen Herz:
Eine Glocke sein, den Menschen das Heil bringen!
Und er blickt auf die mauerumgürtete Stadt, die im tiefroten Schein des Abends glüht. Rauch steigt über den Häusern auf, langsam verblaßt der Horizont. Wie nun Licht um Licht sich entzündet, die Glocken des Münsters zur Vesper läuten, der Mond am blauen Himmel sich vorschiebt, ein Stern schräg seine Strahlen sendet, weint er vor Kälte und Traurigkeit.
»Schlangentöter,« sagt er zu seinem Hund – noch gibt es hier Schlangen, auch Bären und Wölfe –, »wir wollen ein Feuer anmachen, daß uns warm und lustig wird!«
Der Hund scharrt mit den Pfoten das Laub fort, das ein früher Herbst zum Fallen gebracht hat: kupferrote Blätter der Eichen, messinggelbe der Buchen und Birken. Der Junge trägt ein paar Steine herbei, die trocken sind und von glänzendem Schwarz. Moos und Zweige schichtet er wechselnd darauf. Dann schlägt er mit kundiger Hand den Funken.
Knisternd leckt die Flamme in die Nacht. Ihr ruhloser Schein fliegt über die Kühe hin, die still und wiederkäuend sich am Rand der Waldlichtung gelagert haben. Sie macht die alten Stämme lebendig, daß sie gleich schwarzen Männern drohend um das Feuer stehn. Die tragen allerlei Eisenwerk: Hämmer, Hacken und Schaufeln. Einer schwingt ein blitzendes Beil. Sein Antlitz ist furchtbar anzuschauen.
Von Grausen gepackt, springt der Junge auf.
Schlief er zwei Stunden oder eine Nacht?
Über dem Oberhof dämmert der Tag. Bleich das Feld, bleich der Wald. Doch wie der Junge zum Feuer sich kehrt, wähnend, die Flamme sei ausgegangen, sieht er diese zur Säule erhoben, dunstig rot, mit blauem Getupf. Moos und Zweige sind aufgezehrt. Aber die Steine brennen, knatternd wie der Hall der Donnerbüchsen.
Da wirft der Junge die Flöte weg, auf der er das Taglied zu spielen pflegt – hundertmal hat er es später selbst erzählt – und hetzt hinunter zum Oberhof. Schlangentöter jagt hinter ihm drein, fliegenden Haares, mit bangem Geheul. Sie wecken den Schultheißen, wecken die Bauern. Laut gellt der Schrei des Hütejungen:
»Feuer im Berg!«
Ungläubig hören es Freie und Unfreie. Doch der Kanonischen einer vom Stift, der hinzukommt, der die Welt gesehn hat und die Bücher der Alten liest, weiß vom brennbaren »thrazischen Stein«, der »so scharfen Geruch entwickelt, daß kein Kriechtier am Platze bleibt«. Er ermutigt den Jungen, sammelt die Bauern und führt sie geraden Wegs zum Waldhang. Die Flamme fraß sich tief in den Berg. Weit im Kreis dampft das Erdreich.
Der Stiftsherr wendet sich zum Jungen:
»Großes ward durch dich für die Menschen getan! Aus diesem Stein wird Segen erblühen, wenn der Wald seine letzten Stämme gab.«
Dem Jungen wird warm und freudig ums Herz. Vergessen die Hirtenflöte, deren süßes Lied der aufgehenden Sonne klang! Er nimmt den Spaten, den man ihm zuwirft, und legt mit festen Stichen den Stein bloß.
So fand ein Hütejunge die Kohle.
Bauern graben zunächst die Kohle. Von ihnen spricht mündliche Überlieferung. Als Kohlenjahrhundert darf man das vierzehnte ansehen. Es bringt die ersten schriftlichen Nachrichten.
1302 werden bei Schüren im Kreise Hörde »Kohlengrafften« verkauft.
1317 ist in einer zu Essen errichteten Herberge für Bettelmönche ein Raum für die Unterbringung der Kohlen vorgesehen, die als billiges, aber wegen der üblen Dünste wenig beliebtes Heizungsmittel vorwiegend von den Armen benutzt werden.
1389 machen die Dortmunder Schmiede einen Ausfall aus der belagerten Stadt zur Beschaffung von Steinkohlen.
1418 kostet die Karre Kohlen in Essen 4½ Schillinge. Eine Karre faßt 16 bis 17 Zentner.
1450 verpachtet der Essener Ratmann Hermann Borchard seinen Kohlberg auf der Waterhove zu Frohnhausen an drei Brüder Strunckede in Holsterhausen. Die Pächter, welche die gesamte Arbeit an der Erschließung und Ausbeutung des Bergwerks zu leisten und die Kosten zu tragen haben, müssen vierzehn Tage nach Auffindung der Kohlen drei Schilde an Borchard entrichten und, sobald die Kerzen im Berge brennen, wöchentlich eine Karre Kohlen an ihn abführen.
1492 läßt Diderich Huttrop, Bürger von Essen, eine Schiffsladung von 300 Malter Kohlen aus der Ruhr nach Neuß und Düsseldorf bringen.
1542 erläßt der Herzog von Jülich, Geldern, Kleve und Berg, Graf von der Mark und Ravensberg, eine Bergordnung, die auch auf die Kohle Anwendung findet.
1637 wird im Amt Wetter, Kirchspiel Schwelm, einem gewissen Cordt Stock die Mutung auf ein »stilliegendes« Steinkohlenbergwerk bergamtlich bestätigt. Die Urkunde deutet auf eine bestehende, feste Handhabung der Bergordnung und damit auf die seit längerer Zeit im Gang befindliche Entwicklung des Kohlenbergbaues.
Nur langsam setzt sich die Steinkohle durch. Der gewerbliche Mann hegt Vorurteile. Als Hausbrand tritt sie spät in Erscheinung.
1736 muß den sächsischen Bergschmieden landesherrlich befohlen werden, statt Holz oder Holzkohle Steinkohlen zu verwenden.
1755 bereist der Geheime Finanzrat von Hagen zu gleichem Zweck die westfälische Mark. Er erläßt an die Landräte den Befehl, dafür zu sorgen, daß bei Bierbrauereien, Färbereien und Kalkbrennereien, sowie für »Pottofen« und Herd Einrichtungen zur Steinkohlenfeuerung getroffen würden. In der Antwort des Landrates Grüter heißt es: Die Ämter Hattingen und Hörde hätten hinlänglich gemeine Marken, um daraus den Holzbedarf zu decken. Dagegen fehle es im Amt Bochum an Brennholz, und Dortmund beziehe seinen Holzbedarf von Hörde. In den Gegenden mit reichem Markenwald habe der Bauer sein Brennholz frei, Kohlen dagegen müsse er erst kaufen. Die Räucherung des westfälischen Schinkens, Specks, Rauchfleisches und der Würste geschehe nicht mit Kohlen, weil bei dem sich entwickelnden »schweflichtem Dampf kein Fleisch geräuchert und zum Konservieren nutzbar gemacht werden könne«. Nur im Winter nehme man in den Ämtern Bochum und Hattingen für die Herdfeuerung Kohlen.
1762 schreibt ein Herzoglich Braunschweigischer und Lüneburger Wirklicher Hof- und Kammerrat: Die Kohlen »kommen meist aus Engeland und Schottland, wo man dabei kochet und Stuben heizet«. Der Rauch sei für die Gesundheit sehr gefährlich, »darum wohl stürbe nach Meldung eines Engländers der dritte Teil der Londoner an Schwind- und Lungensucht«.
1763 läßt der Bayerische Staat bei Miesbach ein Quantum Kohlen fördern und in Kalk- und Ziegelbrennereien verwerten. Achtzehn Lütticher Ziegelbrenner werden eigens hierfür engagiert, aber die Ziegel mißraten wegen großer Nässe und schlechten Materials. Die Miesbacher Kohlen bleiben teils ungenützt liegen, teils überläßt man sie einem Schlosser in der Münchner Au »zur Mühsamen Aufarbeitung«. Zwölf Jahre später bietet das Bergamt den Rest zur unentgeltlichen Abfuhr an.
1764 gewinnt man aus den zu Tage gehenden Flözen bei Penzberg Kohlen. »Allein niemand wollte sich zum Gebrauch derselben verstehen.«
1796 bildet sich die »Oberländische Steinkohlengewerkschaft«, deren Vorsteher der Münchner Bürgermeister Philipp von Hepp ist. Auch sie hat mit Widerständen zu kämpfen. Schreibt doch das Münchner Intelligenzblatt: »Ist die Steinkohlenfeuerung dem prachtliebenden Engländer, dem reichen Niederländer, dem reinlichen Sachsen, dem ökonomischen Preußen und selbst dem empfindlichen Wiener nicht ungesund, nicht schädlich, warum soll sie es uns Bayern werden?«
1820 beträgt die pennsylvanische Anthrazitkohlenförderung nur 365 Tonnen. Man findet den »Coal-Stone mehr geeignet, das Feuer auszulöschen, als es zu erhalten«. Amerikanischen Dienstboten wird als besondere Empfehlung das Zeugnis gegeben: »Kann mit Kohlenfeuerung umgehen!«
Bauern – sagten wir – graben zunächst die Kohle. Wie etwa Torf gestochen wird. Später beginnt der »Kuhlenbau«. Grundwasser tut der Arbeit Einhalt.
1734/35 berichten die Inspizienten Richter und Decker: es fehle an der »höchst nötigen Aufsicht«, an Büchern und »Gegen-Büchern« sowie an Beamten, die etwas vom Bergbau verständen. Gefalle es irgend jemand, Kohlen zu fördern, so tue er sich selten mit Genossen in eine »sonst bei wohl eingerichteten Bergwerken übliche Gewerkschaft zusammen«, sondern nehme »ein allzu weitläufiges Revier in Muthung, hazardiert – gewinnt – aber dabei zu wenig, oder es kömmt wohl einem eintzelnen Bauer einmahl die Lust an, etwas zu gewinnen, worinnen er durch das alldort so genannte Kohlen-Graben seynen Zweck am kürzesten zu erreichen vermeynet, suchet also auf einem sich ausgesehenen Distrikt einen Muth-Schein, und wenn er einen solchen erhalten, ist er selbst Gewerke, Bergmeister und Kohlen-Gräber in einer Person, arbeitet vormittags etliche Stunden, so weit es seine Kräfte zulassen wollen, nimmt ohne Maß und Regul alles weg, so lange er Kohlen findet, und geht nachmittags wieder an seine Hausarbeit, solchergestalt fährt er täglich fort, bis in dem obersten Zuge nichts vorhanden, und wenn es auf die Kosten ankommt, ziehen beide Sorten von Gewerken die Hand ab und lassen alles zu Sumpffe gehen …«
»Jedem stehet es frey zu graben, und in der Erde herum zu wühlen, wie er will, findet er nichts nach seinem Verlangen, so lässet er das Angefangene stehen, und meldet es nicht; findet er aber eine gute Kohlen-Bank, so lässet er sich die Muthung geben, teuffet einen kleinen runden Schacht bis auf das Wasser ab, und fänget seinen Bau auf Raub an, nimmt weg, was Er ohne viele Mühe und Kosten kriegen kan, und wenn er an einem Ort fertig, wirft er es zu, lässet in der Teuffe die besten Kohlen stehen, gehet davon, fänget es an einem anderen Ort wieder so an, wie er es vorher getrieben …«
»Es weiß aber kein Gewerke oder Kohlen-Häuer zu sagen, wie tief eine Bank gesetzet, oder sich in einer gewissen Teuffe abgeschnitten hätte, sondern es bleiben alle diese sogenanndten Köhler darbey, daß es nicht möglich sey, die Kohlen tiefer, als jetzo geschehen, aus der Erden zu fördern; Wissen auch nicht, wie ein rechter Stollen angeleget, und durch quergestein getrieben, viel weniger wie die Rücken und Bergmittel durchbrochen werden müssen, sondern solange sie die Erde zu Tage auswerffen können, und Keilhauig Gestein haben, führen Sie ihre Ackerdruffte – Wasserabflüsse – fort, legen acht Zoll weite und sechs Zoll weite Fluder hinein, decken ein Brett darüber, werfen die Erde darüber her, führen es auf der Bank fort, und rauben die Steinkohlen weg, so lange sie können …«
Langsam weicht der Kuhlen- dem Stollenbau. Der mißachtete »Köhler« wird zum Bergmann.
1825 schreiben die Berghauptleute von Oeynhausen und von Dechen: »Das Steinkohlengebirge der Grafschaft Mark wird seiner Länge nach von der Ruhr durchströmt, und hierdurch sind eigentümliche Lokalverhältnisse herbeigeführt worden. Die in der Nähe des tiefen Ruhrtahls gelegenen Zechen, durch wichtige Stollenanlagen aus diesem tief eingeschnittenen Tale gelöst, setzen ihre Kohlen fast allein nur auf diesem Strome ab und werden daher vorzugsweise Ruhrzechen genannt. Sie liegen meist auf der Höhe des Gebirges und schaffen ihre Kohlen durch sehr lange Stollenstrecken oder durch eine eigentümliche Art von Schiebkarrenförderung über Tage, auf dem stark abfallenden Terrain, zu den am Ruhrstrom befindlichen Niederlagen. Diese Gruben haben daher vor allen anderen eine sehr weite und kostbare Förderung.«
Haspel und Pferdegöpel fördern die Kohlen aus dem Schacht zu Tage, sofern nicht Tagesstollen ein direktes Herausschaffen mit Schiebkarren, Schlepptrögen und Wagen – ungarischen oder deutschen »Hunden« – auf eichenem Bohlenweg ermöglichen. Unter Tage werden die Kohlen aus den Gewinnungspunkten – Abbauen – bis auf die Grundstrecke oder zu dem Betriebspunkt hinabgeleitet, von wo aus die Förderung zu Tage geschieht. Hier »schlug« der »Anschläger« das Fördergefäß »an«, das heißt, er befestigte es an dem Seil des über dem Schacht aufgestellten Haspels oder Göpels, und nun wurde es aufgewunden bis zur Hängebank, um dort auf den »Haufen« oder in die Karren und Wagen geschüttet zu werden. Auf weniger tiefen Schächten und bei geringer Förderung bedienten meistens zwei Arbeiter den Haspel; je nachdem wurden mehr Zieher angelegt. Wollte man die Arbeitsleistung ohne Vermehrung der Haspelzieher verstärken, so brachte man an der Haspelwelle ein Schwungrad an oder man benutzte Haspeln mit Vorgelege. Selten waren fünf, an den größten Haspeln meistens vier Zieher tätig. Statt eines sechsmännigen Haspels richtete man lieber Göpelförderung ein, »denn sechs Menschen kommen in ihrem Effekt etwa dem eines Pferdes gleich«.
1811 sieht der Essener Bezirk die erste Dampfmaschine, der vierzehn Jahre später eine zweite folgt.
1826 führt man die Grubenschienen ein.
Das neunzehnte wird zum Maschinenjahrhundert, es bringt der Kohle den Großbetrieb. Der Osten wirft seine Volkskraft nach Westen. In stärkstem Rhythmus schlägt hinfort der Puls der Ruhrarbeit.
Ich lege Hue's »Bergarbeiter« zur Seite und blicke hinaus. Am Bahndamm rasen Telegraphenpfähle. Summend schwingen die Drähte auf und ab …
Gestern noch München, die Stadt der Farbe und des hellen Lichts, das Silbergrau des Starnberger Sees, Schloß Berg in stillem Weiß aus welkem Laube dämmernd, am Horizont in Blau und Gold das Wettersteingebirge.
Heute, im Morgennebel, Frankfurt, die Stadt der Börse und der schwarzen Mappen, Geschäftigkeit auf allen Bahnsteigen, rote Laternen, Bogenlampen, die weiße Lichtkegel erdabwärts werfen, darüber das riesige Hallendach, in dessen Eisenkonstruktion noch Dunkel nistet.
Zwei D-Züge stehen fahrtbereit, der von München gekommene Rheinlandzug und ein anderer, der über Hagen nach Köln fährt. Uns ist seit gestern eine neue Route vorgeschrieben: Wiesbaden, Koblenz, über Köln nach Essen!
Bei dichtem Nebel gleiten wir hinaus. Schwer bricht der Tag sich Bahn. Rote Laternen werden gelb, farbige Lichtreklamen verblassen. Die Fenster des Abteils, von Ruß geschwärzt, beleben sich mit hellem Rot. Über dem Rhein geht die Sonne auf.
Gesegneter Nebel, gesegnete Sonne! Wie sich ein Bühnenbild bei seitlich aufrollendem Vorhang dem Beschauer zeigt, fließt schneegeschwellt, unendlich, grau der Strom. Schleppdampfer furchen ihn mit spitzen Kähnen. Goldrot die Felsen, goldrot die Ruinen.
»Im Rhein, im schönen Strome,
Da spiegelt sich in den Well'n,
Mit seinem großen Dome,
Das große, heilige Köln …«
Wir donnern über die Eisenbrücke. Zweitürmig ragt der Wunderbau zum Himmel.
»Im Dom, da steht ein Bildnis,
Auf goldenem Leder gemalt;
In meines Lebens Wildnis
Hat's freundlich hineingestrahlt.
Es schweben Blumen und Englein
Um unsre liebe Frau;
Die Augen, die Lippen, die Wänglein,
Die gleichen der Liebsten genau …«
Im Mittagsglast entschwindet die Stadt, die Ebene wird zum Hügelland. Wir jagen durch Felsentunnels, deren Eingänge mit Moos bewachsen sind. Stellwerke und Stationen mehren sich. Aus tausend Städten wächst die Stadt des Industriegebiets. Denn eine einzige Stadt ist dieses Land, umschnürt vom Netzwerk elektrischer Bahnen, erstickt vom Brodem zahlloser Schornsteine.
Und wie wir nun in den Abend schlingern, Alarmglocken der Stationen hören und die Masten der Starkstromleitungen sehn, schwimmen mir Bild und Gedanke zusammen. Das ist kein Zug mehr, der uns fährt! Das ist das Mahlen stählerner Schiffsschrauben und, was am Horizont jetzt auftaucht, das Zentrum einer nächtlichen Schlacht.
So schaut ein Heizer den Flottenkampf, wenn er von den Turbolüftern emporklimmt und sich an den eisernen Sehschlitz preßt: Steuerbord, groß die eigenen Schiffe, mit höchster Fahrt und ungeheurer Rauchentwicklung. Turmhohe Geiser von Dampf und Wasser, die bläulich-weiß ins Dunkel klatschen. Am Himmelsrand die feindlichen Geschwader: Schornstein an Schornstein über einer schwarzen Wolke, aus der das Mündungsfeuer der Geschütze sprüht. Dies Bild, in eines Herzschlags Kürze aufgenommen, trägt er hinunter zur Gefechtsstation. Und er vervollständigt es in Gedanken: an Backbord schor brennend ein Panzer aus …
Ich fahre empor und blicke um mich. Wir nähern uns einer größeren Stadt. Zur Linken flammen riesige Hochöfen. Ein scharlachrotes Blenden geht von ihnen aus. Mond und Sterne verbleichen!
Da wird mir die »Offenbarung« lebendig, Posaunen dröhnen an mein Ohr:
»Es ward ein Hagel und Feuer, mit Blut gemenget, und fiel auf die Erde; und das dritte Teil der Bäume verbrannte, und alles grüne Gras verbrannte.
»Es fuhr wie ein großer Berg mit Feuer brennend ins Meer; und der dritte Teil des Meeres ward Blut.
»Es ward geschlagen das dritte Teil der Sonne und das dritte Teil des Mondes und das dritte Teil der Sterne, daß ihr drittes Teil verfinstert ward, und der Tag das dritte Teil nicht schien, und die Nacht desselbigengleichen.«
Dreimal wechselt der Nebel am Tag die Farbe: milchweiß am Morgen, schattet er mittags schwefelgelb. Abends dampft er in schmutzigem Rot.
Die Sonne steht als blasser Mond kreisrund am Himmel. Dunkel die Straßen, dunkel die Geschäfte, die ihre Räume tagsüber beleuchten müssen. Man kann nicht arbeiten, nicht lesen, schreiben! Auf manchem Werktisch löscht die Lampe erst zur Nacht.
Ich gehe den Spuren der Vorfahren nach, durch ein Gewirr von hügeligen Gassen, deren eine den Namen »Dellbrügge« trägt. Es ist die alte Form unseres Familiennamens, der Teil der älteste der Stadt.
Was an Häusern dort steht, verzog der Berg. Die Giebel schief, kein Laden gerade! Das Holz der Fachwerkbauten fraß der Wurm. Mörtel entfiel den Fugen der Rohziegel. Ein Oberstock liegt armbreit über. Auch hier wohnen Menschen, hinter blinden Fenstern. Traurig hängt eine Esche auf das Pflaster, in dessen Mitte ölig blau ein Rinnsal fließt.
Aus schmaler Gasse ansteigend, zu freiem Platz. Häuserblöcke kanten rechts und links. Vier schwarze Kondensatoren starren in die Luft: düstere Türme der Bastille! Sie sind aus Ziegeln aufgeführt, wie auch die Schornsteine, die als ein Wald von Schachtelhalmen aus der Urzeit ragen.
Die Straße senkt sich breit zur Unterführung. Ein Kokswagen fährt vor mir her. Der Dampf der Ladung mischt sich mit dem winterlichen Nebel. Vor den Häusern liegen Kohlenhaufen. Der Fuhrmann hat sie am Morgen gekippt, Zahlung empfangen, Quittung gegeben. Das Fortschaufeln selbst obliegt dem Besteller. Der arbeitende Mann schafft es nach Feierabend. So tritt mein Fuß – noch über Tag – auf schmalem Steig die erste Kohle.
Der Nebel wandelt sich zu feinem Regen. Auf Kilometer ist der Fahrdamm aufgerissen. Automobile jagen, große Lehmbrocken bis an die Häuserwände schleudernd, durch diese Straße der Arbeit und Armut. Hier stehn die Häuser rötlich schwarz, einstöckig, in der Mitte eine Tür mit Stufenantritt, zu beiden Seiten je zwei Fenster, ein niederes Dach, worauf ein kleiner Schornstein: der Typ des alten Bergmannshauses.
Unmerkbar geht die Vorstadt in die Landschaft über. Ödland klafft zwischen eingesunkenen Hütten. Es ist Besitztum einer großen Zeche. Kein Bauer mag die Erde bebauen. »Das Bergwerk – sagt er – nahm dem Boden seine Kraft!«
Und plötzlich kommt mir zu Bewußtsein, daß alles, was ich bisher sah, ein kleiner Teil der schwarzen Stadt gewesen, daß unter all den Kirchen, Wohnhäusern, Fabriken noch eine andere Stadt ihr Leben lebe: viel hundert Meter tief, mit Straßen, Gassen, schmalen Steigen, mit Bahnhöfen, Geleisen und Maschinen, bewohnt von Tausenden von Menschen, die Tag und Nacht, in dreimaligem Wechsel, mit Hammer, Hacke, Schaufel dem Gestein zu Leibe gehen.
Ein Stöhnen scheint mir aus der Erde aufzusteigen, die, von Eisen, umkrallt, von Explosionen zerrissen, ihr Herzblut bis zur Oberfläche wirft. Und dieses Blut ist schwarz! Es quillt aus den Fugen der Pflastersteine, es klebt an den Mauern, färbt Treppenböden und Geländer. Der Kragen, den ich sauber umband, schwarz, das Wasser, drin ich mir die Hände wasche, schwarz!
Mein Wirt, der Bergmann ist, lacht über mich, den »Industrieneuling«.
»Das wird noch anders kommen, wenn Sie einfahren!«
Er nimmt ein altes Fernrohr aus der Lade – oft sah ich es Sonntags in seiner Hand – schiebt es bedächtig auseinander und sucht den für Sekunden klar gewordenen Himmel ab.
Auch ich trete zum offenen Fenster. Vor meinen Füßen breitet sich ein Sägewerk: Die Kreissägen auf blendend heller Bühne, ein langes, flaches Dach darüber, Schornsteine hoch und dünn von Eisenblech. Balkenhaufen dunkelte die Zeit. Die frisch geschnittenen Bretter glänzen gelb. Auch eine Miniaturbahn fährt auf zierlichen Geleisen. Der kobaltblaue Dampf der Zwerglokomotiven umschwebt den tiefen, roten Ball der Wintersonne.
Plötzlich reicht mir mein Wirt das Fernrohr.
»Visieren Sie dort rechts den großen Schornstein!«
Im Anfang sehe ich nichts Auffälliges. Dann aber unterscheide ich ein luftiges Gebilde, das turmartig, aus durchsichtigem Eisenwerk, zur Höhe strebt.
»Ein Förderturm«, sagt neben mir der Mann.
Ich wußte es, sah ihn am Tage in der Stadt. Und dennoch, wie ich nun den Horizont absuche, zehn, dreißig, ein halb Hundert solcher Türme finde, in deren Netzwerk Silberspinnen kreisen, schlägt mir das Herz bis in den Hals.
Immer denke ich an diese Silberspinnen, und daß an ihren Fäden Körbe hängen, die Menschen oder Kohle enthalten!
Zeche – vom althochdeutschen »gizëhôn«, anordnen – wird ursprünglich als eine zu gemeinsamem Tun – auch zu gemeinsamem Trinken, Zechen – verbundene Gesellschaft von Personen aufgefaßt. In dieser Bedeutung findet man eine Richerzeche – »Gesellschaft der reichen Leute«, Kaufleute – 1112 in Köln.
Beim Bergbau tritt eine Häuerzeche in der ersten Hälfte des dreizehnten Jahrhunderts zu Freiberg in Sachsen auf. Man überträgt die Bezeichnung »Zeche« später von der Genossenschaft auf deren Besitz, so daß Zeche in neuerer Zeit soviel wie Bergwerk, Bergwerkseigentum bedeutet …
Wir haben heute – ausnahmsweise – keinen Nebel. Die Landschaft grau, der Himmel grau, das Licht der Sonne hinter Wolken gleichmäßig verteilt. Grau präsentiert sich auch die Zeche, die man – als eine Stadt für sich – die eiserne benennen möchte.
Aus Eisen Gittertor und Zaun, aus Eisen die Geleise, über die ich stolpere. Aus Eisen Dampf- und Wasserrohre mir zu Häupten, aus Eisen hoch und schmal die Brücken, auf denen kleine Kohlenwagen rollen. Aus Eisen endlich der Förderturm, der, von der Nähe mächtig anzuschauen, elastisch zitternd Seilfahrt und Gewicht der Körbe trägt.
Rötliches Licht erfüllt das Innere des Schachtturms. Vor mir, in eisernem Gerüst, sausen die Förderkörbe hoch. Wie aus der Erde ausgespieen! Kaum denkbar, daß sie Menschen oder Kohle bergen.
»Geschwindigkeit der Seilfahrt?«, frage ich.
»Acht Meter in der Sekunde!«
Mir bleibt der Atem weg.
Entwicklung der Jahrhunderte kriecht durch mein Hirn:
Haspel, Pferdegöpel, Wasserrad …
Und nun dies!
Mechanisch notiere ich:
»Acht Meter in der Sekunde!!«
Mein Begleiter spielt einen Trumpf aus:
»Bei Produktenförderung achtzehn Meter!!!«
Ich nehme mir vor, mich über nichts mehr zu wundern …
Wir gehen weiter, zum Maschinenhaus, das jene ungeheure Kraft erzeugt. Eine Halle nimmt uns auf, die grün gekachelt ist und durch zwei Reihen großer Bogenfenster Licht empfängt.
»Glückauf!«
Zum ersten Mal klingt mir der Bergmannsgruß, der, seit dem siebzehnten Jahrhundert in Gebrauch, »Glück schließe sich dir auf!« gedeutet wird.
Im Vordergrunde sitzt der Maschinist auf festem Stuhl, Hebel für Steuerung und Bremse in den Händen. Auf beiden Seiten die Zylinder der Maschine, dazwischen, riesigen Formats, die Treibscheibe, auf der das vierzig Millimeter starke Drahtseil ruht.
Jetzt ein Signal, ein Hebelruck! Brüllend und fauchend strecken sich die Pleuelstangen, wie Löwen, die geduckt zum Sprung ansetzen. Das Treibrad kreist, schnell, immer schneller läuft das Seil. Links hält ein Diagramm Geschwindigkeiten fest, rechts sinkt der rote Pfeil des Teufenzeigers und gibt die Schachttiefe der Förderung an.
Ich lese ab:
»Zweihundert, fünfhundert, siebenhundert Meter …«
Der Pfeil steht still: es ist die letzte Sohle!
Morgen werde ich dort unten sein, nicht mit dem »Fahrstuhl« offiziell »Besuchstour« fahrend, nein, als »Kumpel« – das heißt Kamerad –, zu achtstündiger Schicht vor Ort.
»Glückauf!«
Wir kommen zu der Hauptmaschinenhalle, vorbei am Kesselhaus, in dem die Schürer halbnackt vor den Feuerlöchern ihre Schaufeln schwingen. Ein Ungeheuer von Maschine dröhnt. Es ist das Herz des Bergwerks, der »Kompressor«, der sämtlichen Maschinen unter Tage Preßluft zuführt. Daneben haben wir die Grubenlunge: Antriebsmaschine für den Ventilator, der, riesenhaft, die Ansaugung des Wetterstroms besorgt.
Draußen geht die Förderung ihren Gang. Volle Kohlenwagen werden auf die Hängebank gezogen und in die drunterstehenden Waggons gekippt. Der Zechenbahnhof dampft von Zügen, die mittels einer Grubenanschlußbahn zum nächsten Staatsbahnhof geleitet werden.
Ich sehe gerade noch den Schichtwechsel. Die Morgenschicht, um sechs Uhr eingefahren, verläßt die Grube um zwei Uhr. An ihre Stelle tritt die Mittagsschicht, die abends zehn Uhr von der Nachtschicht abgelöst wird.
Ein Strom von Menschen wälzt sich aus dem Zechentor. Alte und Junge führt er mit, Siebzig- und Siebzehnjährige, Kranke, Gesunde, Schwächliche und Starke. Der Stein grub scharfe Linien in die kantigen Gesichter.
An der Straßenkreuzung spielt ein Leiermann. Ich kenne ihn und auch sein Lied, das mir durch Klang und Rhythmus einmal aufgefallen:
»Glückauf, Glückauf! Der Steiger kommt.
Und er hat sein helles Licht bei der Nacht,
Und er hat sein helles Licht bei der Nacht
Schon angezünd't, schon angezünd't.
Schon angezünd't! Es gibt einen Schein,
Und damit so fahren wir bei der Nacht
Ins Bergwerk hinein …«
»Aufstehn!«, brüllt mein Kumpel durch die Wand.
Ich denke an den »Unteroffizier vom Tag« und bin mit einem Satz aus meinem Bett.
Dunkelheit, Kälte …
Was ist denn los?
Plötzlich fällt mir ein, daß ich ja heute in die Grube soll. Ankleiden also! Rasch entzünde ich den Kerzenstummel, der in dem Mundstück einer leeren Flasche steckt. »Doppelkorn« steht auf der Etikette. Wohin die Bettlampe, bei deren rotem Schein ich Dostojewski las? Und gleich darauf die korrigierende Empfindung, daß hier der bessere Platz, um Dostojewski zu erschöpfen, in dieser Kammer, die, gardinenlos, von trübem Kerzenlicht erhellt wird.
Schlag fünf Uhr bin ich in der Küche. Mein Kumpel sitzt schon auf dem gichtbrüchigen Sofa und überwacht das Aufgießen des Kaffees, das seine rundlich blondhaarige Frau besorgt. Hausbrot steht auf dem Tisch, ein Klumpen Margarine, etwas Schmalz.
Mein Kumpel sagt:
»Vor dem Kriege hatten wir Butter, Blockwurst und Schinkenspeck, während des Krieges oft nur Steckrüben und Wasser. Jetzt langt es kaum mehr zu Schmalz …«
Wir kauen schweigend, die Frau ist an der Schulter ihres Mannes eingeschlafen. Herdfeuer gibt dem Bilde weichen Schein. Der Mann streckt sich und gähnt:
»Wir müssen abhauen!«
Die Frau küßt ihren Mann zum Abschied. Wie täglich, seit nun achtzehn Jahren! Man kann nie wissen, ob es nicht das letzte Mal ist. Wir hängen unsere Kaffeepullen um und tauchen in den schwarzen Schlund der Treppe.
Vor der Haustür steht als dicke Wand der Nebel. In meinem Leben sah ich keinen solchen Nebel! Man glaubt, ihn mit den Händen ballen zu können. Wir stolpern wie in einem Sack. Die Sichtweite beträgt kaum einen Meter.
Plötzlich stößt mein Kumpel einen Fluch aus und versinkt. Wir haben die Hauptstraße erreicht, die schon seit Wochen aufgerissen ist. Löcher von Halbmannstiefe klaffen zwischen Steinbergen. Auf verlegtem Geleise tastet eine Trambahn sich heran. Der Schaffner geht mit einem Nebelhorn voraus und bläst, dumpf, schauerlich, als wenn er Toten riefe.
Schatten ich selbst, Schatten mein Gefährte, die wir im Dunkel eines Feldwegs schwimmen. Doch nicht mehr zweisam! Denn von allen Seiten wallt es heran, fließt ineinander, wird zum Strom von schwärzlichen Gestalten, die vorgebeugt und schweigend unseres Zieles sind.
Ehe ich's denken kann, stürzt Licht quer über das Gewimmel. Aus tausend Fenstern strahlend wie ein Schiff, bricht jäh die Zeche aus dem Nebel.
Halb sechs Uhr: die Morgenschicht hält ihren Einzug!
Ich gehe hinter meinem Kumpel her zur Waschkaue, dem Raum, in dem die Bergleute sich umziehen. Milchglasscheiben, grau gestrichene Wände. Drei Reihen Bänke stehen auf Hartasphalt, darüber hängen von der Decke Ketten, mit denen man das Grubenzeug herunterläßt, um seine Tageskleidung wieder aufzuwinden. An jeder Kette blitzt ein Schloß, den Schlüssel steckt der Bergmann vor der Einfahrt zu sich.
Langsam wie die andern kleide ich mich um, merke schon hier, was unter Tage mir zu festem Eindruck wird: alle Bewegungen sind abgemessen, nutzbringend und ohne Hast. Der »Kohlberg« frißt den Menschen ohnedies!
Ich habe Grubenzeug von meinem Kumpel: derbe schwarze Hosen, graues Flanellhemd, Halstuch, alte Schuhe. Von einem Steiger lieh ich mir den Fahrhut. Er ist aus dickem Leder, schwarz und etwa von der Form, wie sie die Jockeimützen zeigen.
Mein Kumpel grinst:
»Wirst dir trotzdem den Schädel einrennen …«
Es sei vorweggenommen, daß er recht behielt. »Bücken und drücken«, wie der Bergmann sagt, ist in der Tat das erste, was man lernen muß.
Reihe zu einem geht es durch die Lampenstube, wo Bergwerksinvaliden Dienst tun. Ich sehe deren zwei, einen mit Beinprothese und einen andern, dem der rechte Arm fehlt. Nachdem ich meine Schichtnummer genannt, reicht mir der erstere die Grubenlampe, die, luftdicht abgeschlossen und elektrisch, an ihrem oberen Ende einen Haken trägt.
Ich bin nun grubenfertig, im Besitz von »Totenhemd und Licht«.
»Glückauf!«
Nie schien mir dieser Gruß bedeutungsvoller, als eben jetzt, da sich der Schoß der Erde vor mir öffnen soll. Frostgeschüttelt drängen wir uns auf der Hängebank. Eisen und Steine kreischen in mein Ohr.
Man hat die letzten Wagen abgezogen. Vierschalig, hoch und schmal, dehnt sich vor uns der Förderkorb. Die Eisenwände sind durchlöchert, damit er leichter ist und die Bewetterung des Schachts nicht stört. Er faßt acht Wagen oder fünfzig Menschen.
Derbe Witze fliegen hin und her.
Ein Lehrhauer fragt:
»Ob die Fangvorrichtung wohl noch funktioniert?«
»Ja, im Sumpf!«, antwortet mein Kumpel zwinkernd.
Wir stehen eng gepreßt in eisernem Gestell, schimpfend, lachend, vier Schichten übereinander. Plötzlich ein Glockensignal: der Korb ruckt an! Sofort tritt Schweigen ein. In jedem schwingt – ihm selber unbewußt – etwas von dem Gedanken: fünfzig Menschenleben hängen an dem Drahtseil, das tückisch, unberechenbar schon manchmal riß!
Der Boden sackt mir unter den Füßen weg, wir stürzen ab. Fallen mit rasender Geschwindigkeit ins Dunkle, Stille! Ich wußte bisher nicht, was Stille heißt!! Grabesstille!!!
Bruchteile von Sekunden blitzen Lichter auf. Es sind die Anschläge, die wir passieren. Der Fall verlangsamt sich, wir schaukeln, halten. Siebenhundert Meter in vierundneunzig Sekunden: die siebente Sohle ist erreicht! Wir sind um dreizehn Meter tiefer, als über Tag der Donnersberg im Pfälzer Bergland ragt.
Vor meinen Augen rundet sich das Füllort, gleich einem Tunnel ausgebaut und matt erleuchtet. Hier werden, wenn die Kohlenförderung beginnt, die Wagen in den Förderkorb geschoben. Unendlich zieht ein Seil dann volle Wagen her, leere zurück, auf Grubenschienen, die im Dunkel sich verlieren.
Ich nehme Abschied von Kultur und Zivilisation. Wir biegen in den Querschlag ein und sind nun auf das Licht der Grubenlampen angewiesen. Ihr Schein fliegt über Eisenstempel hin, die, rechts und links, nach oben sich verengen. Kappschienen über uns bog das Gebirge durch.
Lautlos waten wir in schwarzem Kohlenstaub. Die Luft wird dick, legt sich auf Brust und Lunge. Man atmet tief, und doch ist es kein Atmen.
Ich stoße fragend meinen Kumpel an.
»Sonderbewetterung!«, antwortet er ruhig.
Wir sind nicht in dem frischen Luftstrom, der, durch den Grubenventilator angesogen, vom Hauptschacht sich zum Wetterschacht bewegt. Es ist ein künstlich abgezweigter Lebensstrom. Strahldüsen blasen die Luft vor Ort.
Längst habe ich mein Halstuch abgenommen und an den Hosenträgern festgeknüpft. Das Grubenthermometer weist auf dreiundzwanzig Grad: Hochsommernacht, schwül, stickig, unerträglich! Nicht Mond, nicht Sterne dringen zu uns ein. An ihrer Stelle blitzt um uns der schwarze Diamant der Kohle.
Nach etwa zehn Minuten Wegs versperrt uns eine Wand den Durchblick. Eisenbahnschienen sind zum Schild gefügt, das eine Haut von dicken Stämmen trägt.
»Der Schießschutz«, raunt mir mein Begleiter zu.
Noch fünfzig Meter, und wir sind vor Ort. Der Querschlag soll hier durchs Gestein getrieben werden! Die Kumpels nehmen ihr Gezähe auf – Arbeitsgerät, das sich in Kisten längs der Sohle birgt –, Jacken und Hemden werden abgelegt, nackt bis zum Gürtel treten drei zum Bohrhammer.
Sekunden Stille, dann bricht Hölle los: ein Brüllen, Knirschen, Fauchen, Winseln. Der Berg wehrt sich gleich einem wilden Tier. Steinstaub hüllt uns in eine dichte Wolke. Wir atmen warmes Öl und Schweiß.
Mein Kumpel winkt mich neben sich. Er steht auf hölzernem Gerüst und führt den einen der drei Hämmer. Das Bohr fraß sich um Zentimeter ins Gestein. Er dreht den Hahn ab, der die Preßluft regelt, stellt mich am Hammer an und öffnet das Ventil. Der erste Stoß haut mich vom Brett herunter! Die Kumpels winden sich vor Lachen. Zum zweiten Male bin ich oben, drücke mit aller Kraft den Hammer auf das Bohr. Und diesmal geht es. Wie rasend schlägt der Hammer gegen meine Schulter, dröhnt mir ins Hirn, erschüttert meinen Körper. In wenigen Minuten triefe ich von Schweiß, die Lunge keucht, der Mund füllt sich mit Staub.
Mein Kumpel gibt mir etwas Kautabak. Jetzt verstehe ich, was mir ein Steiger sagte: daß man im Bergwerk Kaffee oder Alkohol entbehren kann, niemals den »Stift«, den Kautabak!
Vier Löcher werden schräg gebohrt, die im Gestein möglichst auf einem Punkt sich treffen sollen. Nachdem sie fertig, lädt man sie mit Dynamit: der »Einbruch« wird herausgeschossen.
Schon kommt der Drittelführer mit der Schießkiste. Sie ist von starkem Blech, mit einem Schloß versehen und zeigt, da er den Deckel aufklappt, niedliche Kartons, die man – bis auf die fettige Papierhülle – recht gut als Schuhkartons ansprechen dürfte.
Jeder Karton faßt zwanzig Patronen, der Drittelführer nimmt sie vorsichtig heraus, ladet die Löcher, führt Zünder ein, besetzt die Schüsse mit gerollten Lehmpillen, verbindet die Leitungsdrähte und schließt sie an das Kabel an, das, fünfzig Meter rückwärts, hinter dem Schießschutz endet.
Inzwischen haben wir das Ort geräumt und sind hinter die Schutzbühne gegangen. Aus dem Dunkel schwankt das Licht des Drittelführers auf uns zu.
»Alles weg?«, fragt er hinter die Bühne.
Wir rufen: »Ja!«
Jetzt macht er sich an der Batterie zu schaffen – wie ich später erfuhr, schloß er die Kabeldrähte an – und brüllt, daß mir das Herz aussetzt:
»Es bre-e-e-nnt!«
Nie werde ich dies langgezogene »Es bre-e-e-nnt!« vergessen, das, aufreizend und tremolierend, dem Kriegsruf überfallender Indianer gleichen mag.
Plötzlich ein dumpfer Knall, ein Donnern wie von tausend Nahgewittern! Der Berg scheint auf uns zuzurollen, Luft fegt voraus, ein Steinhagel schlägt gegen unser Schild, dann Totenstille.
Stinkend und beizend kommt der Qualm, Steinstaub nimmt letzte Sichtigkeit. Die Grubenlampen leuchten nur als rote Fünkchen. Wir husten, spucken, warten. Zwanzig Minuten lang.
Behutsam tasten wir dann vor. Wir haben schlechtes Gebirge über uns: das Hangende zeigt große Risse. Ich stolpere über irgend etwas Schwärzliches, fahre hoch und schlage mit dem Kopf an eine Steinkante.
»Verdammt nochmal!«
Mein Kumpel schüttelt sich.
Es ist schwer, im Bergwerk nicht zu fluchen …
Vor Ort ein wüster Trümmerhaufen. Die Schüsse haben »gut gemacht«! Ein keilförmiges Loch klafft im Gestein: der Einbruch ist herausgeschossen!
Wir lassen uns zum »Buttern« nieder, halten Brotzeit. Die Kumpels öffnen ihre Kaffeepullen, ich nehme mein Notizbuch vor und schreibe. Nichts von Gefahr und Abenteuern! Das Gefühl der Sicherheit ist absolut. Nein, davon nichts! Ich setze her, was kaum entzifferbar auf der von Öl und Kohlenstaub geschwärzten Seite steht:
»Diese Arbeit, tagaus, tagein, Monat für Monat, Jahr für Jahr, ein Leben lang, bei solcher Luft, in stets gebückter Haltung: ein Tag ohne Licht!«
Wieder gehn die Kumpels an die Bohrmaschinen, wieder brüllt der Berg gleich einem wilden Tier. Der »Kranz« wird vorgebohrt, besetzt, herausgeschossen. Zum zweiten Male suchen wir den Schießschutz auf, erleben Knall und Qualm der Explosion. Dann wieder vor, um Steine fortzuräumen. Die dritte Sprengung gilt der Sohle.
Ich mache nur mehr automatisch mit. Die Sprengstelle zeigt roh die Form des Querschlags. An sechzig Wagen Steine mögen losgeschossen sein, die nun verladen und gefördert werden sollen.
»Wie spät?« fragt eine heisere Stimme.
»Halb zwei Uhr!«, antwortet mein Kumpel.
Der Drittelführer brummt:
»Na ja, Schicht …«
Wir packen das Gezähe weg und gehen zum Schacht, nachdem wir Hemd und Jacke angezogen haben. Eisig fegt der Luftstrom durch die Wettertüren. Ich trinke ihn wie einer, dem der Dursttod nahe war.
Plötzlich faßt mein Kumpel meinen Arm.
»Da schnell, der Berggeist …«
Ich wende rasch den Kopf.
»Gerad ist er um die Ecke!«
Die ganze Belegschaft lacht, eine Unterhaltung kommt in Gang. Wir sprechen von Frauen, sauberen Betten, Schlaf …
Im Förderkorb – wie bei der Einfahrt – Schweigen. Ein Glockensignal: der Korb ruckt an. Ich fühle mich emporgerissen, atme tief auf und werde in die Sonne ausgespieen, die mittagsrot die Hängebank umstrahlt.
Welch ein Augenblick, groß, befreiend, ja erschütternd!
Die Waschkaue stimmt den Eindruck herab. Ich muß an die Badestube denken, die Dostojewski im »Totenhaus« beschreibt. Dampf, Wasser, Kohlenschmutz und feuchter Staub. Ein Wimmeln nackter, schwärzlicher Gestalten, die stehend oder sitzend ihre Glieder reiben. Ketten klirren dazu von der Decke, und selbst die roten Narben fehlen nicht, die Steinfall riß, so breit und tief, daß man zwei Finger darin betten kann.
Mein Kumpel reicht mir eine Spiegelscherbe. Ich sehe mich und kenne mich nicht mehr: Nase und Backenknochen springen spitz hervor. Eine scharfe Falte grub sich um den Mund, die Lippen tragen eine Kohlenkruste.
Gegenseitig »buckeln« wir uns ab. Der Kohlenschmutz ist zäh und nur durch starkes Bürsten zu entfernen!
Die Kumpels machen ihre Witze.
»Mensch, hast du Narben auf 'em Balg!«, ruft einer.
»Das reinste Waschbrett!«, sekundiert ein anderer.
Alle Leiber glänzen appetitlich weiß. Der zarte Kohlestrich, der um die Wimpern bleibt und wie mit einem Schminkstift nachgezogen scheint, steht gut zu blondem Haar und rosigem Gesicht.
»Glückauf!«
Ein junger Kumpel geht als erster. Sein Mädchen wartet wohl am Zechentor! Langsam folgen die übrigen. Im Strom dränge auch ich hinaus.
Auf dem Heimweg werden mir die Knie steif. Das Kreuz beginnt zu schmerzen, die Gesichtshaut brennt. Mühsam klimme ich die steile Treppe hoch, ziehe meine Schuhe aus, Pantoffeln an und setze mich zu meinem Kumpel auf das Sofa.
Mit wilder Gier falle ich über die Suppe her.
Drei Tage dröhnt der Bohrhammer in meinem Kopf.
Sonnabend, drei Uhr nachmittags.
Das Sägewerk hat seine Arbeit eingestellt, der Rauch der Schornsteine nimmt ab. Sauber geschichtet glänzen Bretterstapel, die Zwerglokomotiven stehen in Reih und Glied. Selbst die Bogenlampen, die man früh entzündete, brennen ruhig in die Dämmerung, auch sie wie für den Sonntag blank geputzt.
In unserer Küche schafft die blondhaarige Hausfrau. Der Herd, mit Sand und Schmirgel abgerieben, strahlt seit dem Morgen rote Glut. Eimer nach Eimer spült die Treppe rein, die Lehm und Kohlenstaub in zäher Mischung trägt. Dann werden Tisch und Stühle abgeseift, Leisten und Fußboden gescheuert und endlich große Kessel Wassers aufgesetzt, um noch das von der Nachtschicht mitgebrachte Grubenzeug zu waschen.
Kräftige Arme schlagen Seifenschaum, drücken das Kleiderbündel in die Lauge. Das Wasser färbt sich grau, nun moorig schwarz. Ein halb Pfund Seife reicht nicht aus, fünfzehnmal Spülen macht den Stoff nicht sauber: Grubenzeug kann überhaupt nicht rein gewaschen werden!
Die Frau wischt sich den Schweiß von Stirn und Nacken und hängt im Nebenraum die Sachen auf. Ein Topf mit Bohnen brodelt auf dem Herd, Kartoffeln, die von Mittag blieben, werden hergerichtet, Brot und Margarine auf den Tisch gestellt. Jetzt erst läßt sie selbst sich auf der Herdbank nieder und wartet auf die Heimkehr ihres Mannes.
Ich überdenke das Leben dieser Frau:
Aus bäuerlichem Hause stammend, heiratete sie vor achtzehn Jahren einen Bergmann. »Nur eine Bergmannsfrau!«, ging damals das Gerede der Verwandten. Die Zeit floß ihr in eintönigem Wechsel. Wenn Morgenschicht, vor fünf Uhr aufstehen, um Kaffee für den Mann zu kochen, der gegen drei Uhr wiederkommt. Wenn Mittagsschicht, ein Warten bis zum Abend um elf Uhr. Wenn Nachtschicht, morgens sieben Uhr aus dem Schlaf, dem übernächtig Heimgekehrten warmes Essen zu bereiten. Alle zehn Tage Geld, das oft nicht reicht. Zwei schwere Grubenunfälle des Mannes, der überdies mit seiner Lunge nicht in Ordnung ist. Waschen, Flicken und Nähen, der Haushalt blitzt vor Sauberkeit …
»Nur eine Bergmannsfrau!«
Und noch etwas verlangt man von der Frau des Bergmanns: Tapferkeit! Betriebsunfälle können niemals ganz vermieden, Katastrophen wohl herabgemindert, niemals ausgeschaltet werden. Die Kohle ist ein unberechenbarer Faktor, jeder Abschied kann der letzte sein! Mein Wirt war einmal dreizehn Stunden hinter der zu Bruch gegangenen Strecke eingeschlossen. Was tat die Frau, indes die Rettungsarbeit vor sich ging? Ein anderes Mal riß Steinfall ihm den Rücken auf und quetschte seinen rechten Arm. Lungenentzündung trat hinzu. Die Heilung währte Monate, bei zwölf Mark Ende 1927, bei Krankenhausbehandlung, etwa 13.30 Mark. Krankengeld durchschnittlich in der Woche. Ersparnisse von Jahren wichen Schulden, die durch Schneidern abgetragen werden …
»Nur eine Bergmannsfrau!«
Ich liege schon im Bett, als mein Kumpel nach Hause kommt. Wir sagen uns durch Klopfen »Gute Nacht!« Mondschein wirft kaltes Grün in meine Kammer …
Der Sonntagmorgen findet mich um zehn Uhr in der Küche. Mein Kumpel ist soeben aufgestanden, hat sich rasiert und sitzt in einem weißen Hemd mit rosa Streifen vor der Kaffeekanne. Sein dunkles Haar fällt locker über die gebräunte Stirn, die feine blaue Striche zeigt: Kohlenstaub, der beim Vernarben in den Rissen blieb.
Während wir trinken, kocht die Frau das Mittagessen vor. Weißkohl wird zerschnitten, kurz gebrüht und in emaillenem Topf aufs Herdfeuer gestellt.
Mein Kumpel blickt enttäuscht:
»Kein Fleisch?«
»Hast du Marie?«, fragt seine Frau zurück.
Ein schlimmes Wort im Bergmannsleben: Marie heißt Geld!
Der Volksmund sagt: »Marie lacht …«, wenn Geld vorhanden, »Marie weint …«, wenn keines da ist.
Bei uns weint Marie …
Mein Kumpel steckt sich eine Pfeife an.
»Wir gehn am Nachmittag zur Großmutter!«, entscheidet er.
Die Großmutter zählt dreiundsiebzig Jahre, wohnt ganz allein in der Mansarde eines zweistöckigen Hauses und hat für ihre Söhne, Schwiegertöchter, Enkel stets etwas im Schrank. Als wir um vier Uhr bei ihr eintreffen, empfängt sie uns im schwarzen Sonntagskleide, das weiße Haar glatt an den Kopf gestrichen, rüstig und mit der Gastfreundschaft, der ich im Ruhrland überall begegnet bin.
Ein Schmuckkasten die kleine Stube, die durch ein schräges Fenster Licht erhält. Solider Hausrat an den Wänden: ein altmodisches Sofa, rot bespannt, ein fester Tisch, den noch der Urgroßvater zimmerte, auf grobem Leinentuch die Kaffeekanne, geblümte Tassen, eine Zuckerdose, Brot, ausgelassenes Schmalz und etwas Wurst.
Indes wir niedersitzen, mahlt die siebzehnjährige Enkelin den Kaffee. Mit ihrem Haarkranz, dem feinen Rund ihres Gesichts, den großen braunen Augen, gleicht sie dem Bild der Großmutter als Braut, das unter einer Schleife blassen Goldpapiers über dem Sofa hängt. Die Mühle, die sie handhabt, ist von dunklem Nußholz, abgegriffen und ein halb Jahrhundert in Gebrauch: auch diese ein Geschenk des Urgroßvaters.
Jetzt kocht das Wasser in dem Kupferkessel, die blondhaarige Hausfrau meines Kumpels brüht den Kaffee auf, Brot wird geschnitten und der Wurstteller herumgereicht. Man fällt hier niemandem zur Last, alle greifen, ohne sich zu zieren, zu.
Mir erzählt die Großmutter von ihrem Leben:
Sie hat seit ihrer Jugend schwer gearbeitet, der Mann starb früh. Fünf Kinder galt es aufzuziehen, zu kleiden und Berufen zuzuführen. Jedes ist in seiner Art etwas geworden.
Mein Kumpel räkelt sich behaglich.
»Und zum Schwiegersohn hast du 'en schmierigen Bergmann!«
Die Greisin legt die Hand über die Augen.
»Wo bist du schmierig?«, fragt sie scharf.
Wir müssen lachen.
In seinem grauen Anzug ist mein Kumpel allerdings ein Musterbeispiel für die Schmierigkeit des Bergmanns!
»Ja,« sagte die Großmutter, »immer Humor, immer gearbeitet, immer hinter den Gören her! Und wenn Gott mir das Leben läßt, feiere ich in sechs Monaten den vierundsiebzigsten Geburtstag.«
»Du stirbst nicht, Großmutter!«, bemerkt mein Kumpel.
»Wenn auch …«
Die alte Frau schaut zu dem Bilde auf, das ihren Mann in jungen Jahren darstellt.
»Ich gehe dann zu meinem Peter!«, schließt sie.
Wir schweigen.
Einfach, wie ihr Leben, ist für sie der Tod …
Ich sehe sie im Kreise sitzen, Großmutter, Tochter und Enkelin, drei Generationen um einen Tisch, unverbildet, tüchtig und genügsam:
Ehre den Frauen der Bergleute!
Wir sind im Querschlag hundertvierzig Meter vorgedrungen. Bohrhämmer dröhnen wie gewöhnlich.
Aus der Strecke kommt das Licht des Steigers auf uns zu.
»Glückauf!«
Wir antworten:
»Glückauf!«
»Na wie ist's denn?«, fragt der Steiger.
Der Drittelführer lehnt sich an den Stoß.
»Ich glaube, daß wir die Grenze haben!«
Der Steiger sieht sich das Gebirge an, klopft mit dem Meterstab an's Hangende und dreht sich um.
»Wo ist die letzte Stufe?«
Er meint den Punkt des Querschlags, bis zu dem der Markscheider die Strecke auf dem Grubenbilde eingezeichnet hat.
Steiger und Drittelführer gehen vierzig Meter weit zurück und machen unter einer Kappe Halt, an der ein kleines Brett befestigt ist. Zwei Zahlen stehen eingebrannt darauf: 10/24.
Der Steiger blättert im Notizbuch.
»Sie haben recht, die Grenze ist da …«
Er nimmt zur Sicherheit ein Bandmaß aus der Tasche, mißt von der Stufe bis zum Ort und sagt:
»Kinder, Ihr müßt mit Bohren aufhören!«
Der Drittelführer fragt:
»Was machen wir nun?«
Der Steiger stützt sich auf den Meterstab.
»Baut mal zunächst die Bude aus! Das Flöz erreichen wir doch nicht. Hier kommt ein Aufbruch her.«
Das war vor etwa fünfzig Tagen …
Wir arbeiten zu fünft im Aufbruch, der senkrecht dreiunddreißig Meter hoch getrieben ist. Die Gegenschicht hat über Nacht geschossen. Es gilt, die Schießbühne zu räumen, damit wir Holz legen und weitertreiben können.
Zwei Kameraden stehn am Rollkasten, die Steine poltern durch das Rolloch in den Wagen. Der Drittelführer ging allein nach oben, um mit der Hacke das vom Schuß gelockerte Gestein vom Hangenden und Stoß zu lösen.
Da ein Signal am Rohr der Wetterlutte.
Mein Kumpel klopft zurück.
»Hallo?«
Dumpf, geisterhaft ertönt es durch das Sprachrohr:
»Raufkommen!«
Mein Kumpel wendet sich zu mir:
»Los, Fahrten in die Hand!«
Haken der Grubenlampe in den Zähnen, geht es die schmalen Leitern hoch. Umsteigebühnen zeigen sich in Abständen von je acht Metern. Die Bühnenlöcher sind so eng, daß man sich winden muß, um zu der nächsten Fahrte zu gelangen.
Ich klettere hinter meinem Kumpel her, auf glitschig schmutzbedeckten Sprossen. Vor mir und links von mir der Stoß, der schon mit Eichenholz verzogen ist. Rechts, durch die Rahmen sichtbar, schwarz und feucht der offene Schacht.
Zu meinen Häupten schwankt die Lampe meines Kumpels, verschwindet, taucht gespenstisch wieder auf. Herabfallender Schmutz dringt mir in's Auge, Schweiß rinnt von meiner Stirn, das Herz schlägt rasch.
Wir sind am dritten Bühnenloch vorbei und mitten auf der vierten Fahrte. Plötzlich ein ungeheures Prasseln über meinem Kopf, Bruchteil von einem Schrei:
»Achtung …«
Im gleichen Augenblick saust eine schwere Masse neben mir herab, schlägt splitternd auf, dann unheimliche Stille.
Ich harre so, wie ich instinktmäßig mich an den Stoß gedrückt.
War das der Tod, der mich mit seinem Eishauch streifte?
Jetzt brüllt mein Kumpel:
»Gott verdamm' mich …«
Wut und Schrecken bebt in seiner Stimme.
»Was ist denn los?«, ruft es von oben.
»Du schmeißt uns Steine auf 'en Balg!«
»Der Rollkasten ist voll«, schimpft nun der Drittelführer, »laß sie doch unten flotter ziehn …«
Mein Kumpel dreht sich nach mir um.
»Hast du was mitgekriegt?«
»Na, komm' man!«, brummt mein Kumpel, wie erleichtert.
Ich klettere weiter, bis die Fahrte aufhört, krieche auf allen Vieren über eine schmale Bühne, die den hier dreißig Meter tiefen Schacht gleich einer Brücke überspannt, dann durch das Seitenloch des Steinkastens und schwinge mich im Handstand auf die Schießbühne.
Ein großer Haufen Steine liegt vom Stoß schräg abwärts bis zum Rolloch. Die Luft ist stickig, warm, vom Dunst der Explosion durchsetzt. Wir räumen möglichst schnell die Bühne ab, um die von Steinen zugedeckte Wetterführung zu bekommen. Mit Kratzen, Schippen fördern wir die Steine in den Rollkasten. Auf einmal weicht der Druck von unserer Brust: wir haben die Düse frei!
»Es war auch Zeit!«, bemerkt der Drittelführer.
Wir ruhen einige Minuten.
»Ja,« sagt mein Kumpel und wischt sich den Schweiß ab, »das ist nun so an siebzehn Jahre her, da hatten sie auch über Nacht geschossen. Ich war im zweiten Jahre Lehrhauer, der olle Ferdinand mein Drittelführer.«
Er spuckt den alten Kautabak in weitem Bogen aus und nimmt sich einen neuen Stift.
Mein Kumpel beginnt zu erzählen …
Seilfahrt der Morgenschicht. Er und sein Drittelführer warten auf die Nachtschicht, um bei den abgelösten Kameraden sich zu vergewissern, wie die Arbeit stehe. Drei Mann der Gegenschicht sind ausgefahren, zwei blieben drin, um nach der Schußwirkung zu sehn.
Mein Kumpel wartet mit dem Alten bis zum letzten Korb und fährt dann ein. Unten gehn sie, den andern rasch voran, zum Aufbruch: alles ist still! Nur eine Grubenlampe glimmt im Schacht hoch oben auf dem Einstrich.
»He-e-e-la!«, ruft Ferdinand hinauf.
Keine Antwort.
Mein Kumpel brüllt mit voller Kraft:
»Hannes …«
Nichts rührt sich.
Da sieht mein Kumpel einen Hut am Kasten liegen, hebt ihn auf und schreit:
»Fer'nand, das ist ja Hannes' Hut!«
Der Drittelführer wirft die Jacke ab.
»Herrgott, da ist etwas passiert …«
In tollem Tempo klettert er die Leitern hoch, mein Kumpel folgt ihm, Haken der Lampe in den Zähnen.
Vor ihnen fliegen die Gedanken her:
Was ist geschehen?
Leben die Kameraden noch?
Wie oft sind Grubenlampen schon als stumme Wächter neben Toten aufgefunden worden!
Mein Kumpel ist am fünften Bühnenloch und will die sechste Fahrte packen. Plötzlich ein Ruf des Drittelführers, voll Überraschung, wie ein Nachlassen gespannter Nerven: auf der Bühne über ihnen liegt ein Körper! Der Kopf hängt durch das Kletterloch herab.
Behutsam schiebt ihn Ferdinand zur Seite und steigt höher.
Mein Kumpel brüllt:
»Zwei Mann rauf! Heinrich liegt im Fahrschacht …«
Im gleichen Augenblick ruft schon der Drittelführer:
»Kaffee nach oben und den Luftschlauch anbauen!«
Mein Kumpel tut, wie ihm befohlen, läßt Preßluft blasen, nimmt die Kaffeeflasche, die ein Mann ihm zureicht, klettert weiter. Da sieht er – Grauen bannt ihn an die Fahrte – den Drittelführer von der Gegenschicht, der auf zwei losen Brettern sitzt und schläft. Blut rinnt aus einer tiefen Stirnwunde. Der Oberkörper lehnt am Mittelbolzen, die Beine hängen in den Schacht.
Blitzschnell wird eine primitive Bühne hergestellt.
Mein Kumpel stöhnt verzweifelt:
»Hannes, lebst du?«
Ferdinand fühlt den Puls.
»Er lebt! Rasch, Kaffee her …«
Sie gießen dem Verunglückten den kalten Kaffee ins Gesicht.
Ein Zittern läuft durch Hannes' Glieder, ein Gurgeln folgt:
»Wa-as ist los?«
Verwirrt blickt er nach unten, dann nach oben. Und plötzlich kommt ihm die Erinnerung, wie sie das zugefallene Rolloch mit dem Bohr durchstoßen wollten, wie Steine niederbrachen und die Sprenggase entwichen! Er sackt zusammen, gleitet hintenüber, stürzt. Vor Schreck laut brüllend, packen, halten ihn mein Kumpel und der Drittelführer an den Beinen. So stehen sie, mit kaltem Schweiß bedeckt, auf losen Brettern über dem hier fünfzig Meter tiefen Schacht.
Mühsam ziehn sie den Bewußtlosen zu sich herauf. Ein Strick wird um die Brust geschlungen, festgeknüpft. Der Drittelführer nimmt den schlaffen Körper auf die Schultern, mein Kumpel faßt den Kopf, daß er nicht aufschlägt, ein dritter hält das Seil und läßt es nach.
Unendlich langsam geht es abwärts, Sprosse für Sprosse, Fahrte nach Fahrte, bis zur Sohle …
»Ein schweres Stück Arbeit!«, schließt mein Kumpel.
Deutlich steht die Szene mir vor Augen.
War es der Steinfall, dem ich selbst mit knapper Not entronnen, war es die Erzählung meines Kumpels, ich höre eine weiche Frauenstimme singen:
»Gott helfe dir, wenn du
Die Sonne noch siehst,
Die Sonne noch siehst …«
Der Verletzte wird zum Förderkorb getragen.
Schweigend fahren die andern aus.
Sonne, blaßblauer Himmel, laue Luft.
Haben wir wirklich den vierundzwanzigsten Dezember?
Durch die Straßen ziehen Musikanten. Sie spielen auf den Plätzen, vor den Häusern, fünf Mann in schwarzen, abgeschabten Röcken:
»O Tannenbaum, o Tannenbaum,
Wie grün sind deine Blätter …«
Ich denke an die Tausende von Tannenstempeln, auf denen in der Grube das Gebirge lastet. Nicht minder liegt Erinnerung des Tages schwer auf mir.
Das Elternhaus, wohin?
Vater und Mutter, wohin?
Zwei Brüder, wohin?
Nicht nur das Bergwerk hat seine Toten …
Mein Kumpel ahnt, was in mir vorgeht. Er ist soeben von der Morgenschicht gekommen – die Mittagsschicht vom dreiundzwanzigsten fuhr heute Morgenschicht – und tritt zu mir ans offene Fenster. Wir schauen beide nach den Fördertürmen. Die Gruben sind seit zwei Uhr leer. Nur Pferdepfleger und Bedienung für die Wasserhaltung blieben unten. Der Fördermaschinist hat auch am Abend Dienst.
»Weißt du was«, beginnt mein Kumpel plötzlich, »mir geht der ganze Rummel auf die Nerven! Die Stadt mit ihren Läden, einkaufende Menschen … Wie wär's, wenn wir zum Isenberg hinaufstiegen?«
Ich willige augenblicklich ein. Mein Kumpel hat – wie viele seiner Kameraden – keinen Baum im Hause. Und Heiligabend in der kahlen Stube? Schrecklich zu denken!
»Wann gehn wir?«, frage ich.
»Sofort …«
Wir fahren mit der Trambahn durch die Stadt, mein Kumpel, seine blondhaarige Frau und ich. Die Großmutter putzt für die Feiertage, doch läßt sie uns die siebzehnjährige Enkelin.
Der Wald empfängt uns frühlingswarm und duftend. Mit kupferroten Stämmen leuchten Kiefern auf. Goldgrün das Moos, das späte Sonne streift. Opalisierend, blau und violett, entquellen Rinnsale dem Erdreich.
Bergauf, dann in ein Tal hinab, jenseits den steilen Berg empor, vorbei an Bauernhäusern mit schwarz-weißem Fachwerk, zieht sich der Weg zum Höhenkamm. Wir wandern zwischen dunkelgrünen Ilexhecken – »Heimliche Liebe« nennt der Volksmund diese Stelle –, durch Bergwald, den die Stürme bogen und verkrüppelten, zur Isenburg.
Rostbraun steht zwischen alten Buchen die Ruine. Felsquadern fügen sich zu breiter Wehr, die Baumwurzeln umklammert halten. Von hoher Warte ragt ein Mauerstück, epheuumrankt, über den Abgrund.
Hier hausten Nachkommen des Isenbergers, der vor siebenhundert Jahren Engelbert von Köln ermordete. Die Burg war stark, der Bergfried sechs Fuß dick. Den einzigen Zugang bildete die Fallbrücke, die über einen in den Fels gehauenen Graben führte. Das Unterhaus enthielt die Wohnungen, das Oberhaus lag fünfzehn Treppen höher und war mit Türmen zur Verteidigung versehen. Kurkölnisch, später Werdener Lehen, verschwand »dat schlot to Isenberg« aus der Geschichte …
»So etwas hast du in der Nähe unsrer schwarzen Stadt wohl nicht erwartet!«, sagt mein Kumpel.
Ich wende mich und stehe schweigend. Tief unter mir das Tal der Ruhr, von steilen Waldhöhen umfaßt. In weitem Bogen strömt der Fluß, in dessen Wellen Roricus ertrank, und schwindet hinter einem Bergvorsprung.
»Sehn Sie den Kirchturm?«, fragt das junge Mädchen neben mir. »Dort gründete vor mehr als elfhundert Jahren der heilige Ludgerus das Kloster Werden!«
Mit schwärmerischen Augen fährt sie fort:
»Ludgerus war nicht nur der erste Abt von Werden, sondern auch der erste Bischof von Münster. Als er in Billerbeck gestorben war, wurden seine Gebeine nach Münster gebracht und dort begraben. Aber sein Leib konnte nicht verwesen. Jeden Morgen stand die Totenlade oben auf dem Grab, und eine Stimme rief:
›Hier will ich nicht begraben sein!‹
»Man grub den Leichnam aus, legte ihn wieder in den Sarg und stellte ihn auf einen Wagen. Vor diesen spannte man zwei Ochsen und ließ sie hingehen, wohin sie wollten. So hatte es der Heilige vor seinem Tod befohlen. Die Tiere zogen an und kamen bis zur Kirchtüre von Werden. Dort hielten sie, und eine Stimme sprach:
›Hier will ich ruhen!‹
»Alle Felder, durch die der Leichenwagen fuhr, wurden in jenem Jahr mit reicher Ernte gesegnet. Über Ludgers Grabe aber zeigte sich oft eine Lichtsäule, und durch die feierlich erhellte Nacht tönten wunderbar die Turmglocken, ohne daß eine menschliche Hand sie berührt hätte …«
Ich lausche vorgeneigten Hauptes in die Dämmerung. Seltsam, ich glaube Glockentöne zu vernehmen, nein, ich höre sie! Von Werden, nun von Velbert, dessen schlanke Türme sich vom Horizont abheben, schallen Glockenklänge, auf welche die stromauf gelegenen Kirchen antworten: man läutet den Weihnachtsabend ein!
Silberner Dunst, der sich in goldenen Nebel wandelt, um dann mit feuchtem Blau das Tal zu füllen, webt Schleier des Geheimnisses um Baum und Strauch. Wir wandern abwärts, unter sternbesticktem Himmel. Über Werden strahlt ein weißes Licht.
So, zwischen Ilexhecken schreitend, erreichen wir ein kleines Haus, das, an den Berg geschmiegt, den Namen »Ruhrblick« führt. Es ist Besitztum eines Bergmanns, gleichzeitig Wirtschaft und hundertzwanzig Jahre schon in der Familie. Mit schwerem Schleppdach über dicken Mauern, blickt es durch eine Pergola zur Ruhr hinab. Unter den Fenstern wurzeln Kletterrosen.
»Wie grün die Ranken scheinen«, sagt das junge Mädchen, das in dem Gürtel seines Wollkleids eine weiße Rose trägt.
»Nacht der Wunder!«, lächle ich.
»Der Mond!«, bemerkt mein Kumpel trocken.
Wir treten in die niedere Stube, wo uns ein runder Eisenofen anglüht. Die Wände schief, doch sauber tapeziert, darüber weißgestrichene Deckbalken. Vor den drei Fenstern hängen Mullgardinen. Den Spiegel schmückt ein großer Ilexstrauß.
Frieden der Christnacht senkt sich über mich. Wir sitzen um den schmalen Tisch, den uns die Hausfrau eigenhändig deckt. Kaffee erscheint, ein frisch gebackener Rosinenstuten. Im Vorraum zündet man am Baum die Kerzen an. Ein Duft von Wachs und Tannennadeln, dann das Lied:
»Es ist ein' Ros' entsprungen
Aus einer Wurzel zart,
Wie uns die Alten sungen,
Von Jesse kam die Art
Und hat ein Blümlein bracht
Mitten im kalten Winter
Wohl zu der halben Nacht …«
In mehr als hundertjährigem Haus die alte Weise! Vor sechzehnhundert setzen sie die Bücher an. Ein Traum von Lichtern, Tönen. Unaufhaltsam kommen die Erinnerungen …
Wann wir an diesem Abend aufgebrochen sind, ich weiß es nicht. Als letzter gehend, harre ich noch einen Augenblick und nehme Abschied von dem kleinen Haus. Der Mond steht hoch, die Mauer schimmert grün. Im Rankenwerk blüht eine weiße Rose.
Fragend sehe ich das junge Mädchen an.
»Nacht der Wunder!«, lächelt sie.
Bergab, vorbei an Bauernhöfen, zwischen Haselhecken. Es ist die Stunde, da das Vieh, mit Menschenstimmen redend, auf den Knien liegt. »Wer es belauscht, muß sterben!«, sagt der Volksmund.
Die Stadt empfängt uns schwarz und schweigend. Nur wenig Fußgänger sind unterwegs, doch diese mit uns eines Zieles: zum Münster, wo um vier Uhr früh die Christmette gehalten wird.
Durch einen Kreuzgang, überrauscht von Glocken, betreten wir den tausendjährigen Bau. Gotische Wölbungen ob dicken Säulen. Mit grau und weißen Steinquadern belegt, streckt sich das Langschiff bis zur Kommunionbank. Vor ihr ein schwerer Leuchter, siebenarmig: Geschenk Machthilds, Enkelin Ottos des Großen. Dahinter kerzenstrahlend der Altar.
Jäh setzt die Orgel mit gewaltigen Registern ein.
Feierlich tönt die Stimme des Priesters:
»In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen!«
Die Messe beginnt.
Rede und Wechselrede hallen singend über uns hinweg. Blaßgoldene Gewänder schimmern zwischen Weihrauchwolken. Der Chor, beim Kyrie respondierend, bricht vielstimmig zu ungeheurem Jubel aus:
»Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax Hominibus bonae voluntatis …«
Die Kirche ist ein Meer von Lichtern, in dem rubinfarben die ewige Lampe schwebt. Auf der Empore stimmt der Chor das Credo an, versinkt in Schauer tiefster Mystik:
»Et incarnatus est de Spiritu Sancto ex Maria Virgine: Et homo factus est …«
Verzückte Augen, gefaltete Hände.
Vor der Krippe kniet das junge Mädchen. Ein blendend weißer Schein darum:
Nacht der Wunder, Heilige Nacht!
Das alte Lied mit seiner Lunge!
Der Knappschaftsarzt erklärte ihm:
»Arbeit vor Stein ist nichts für Sie! Ich habe Ihnen das schon wiederholt gesagt.«
Darauf mein Kumpel:
»Ich will vor Kohle, geben Sie mir die Bescheinigung!«
Die Bitte wurde ihm erfüllt: er hat drei Schichten in der Rutsche hinter sich …
Wir sitzen abends in der Küche.
»Wie wär's denn mit der Rutsche?«, frage ich.
»Nee,« sagt mein Kumpel, »das ist nichts für dich! Du langer Kerl wär'st dir ja selbst im Wege.«
»Warum?«
»Weil unser Flöz nur fünfundvierzig Zentimeter dick ist.«
»Das kann ich mir nicht vorstellen!«
»Nimm hier den Stuhl und krieche drunter durch, dann weißt du, wie es ist.«
Ich frage weiter:
»Tiefe und Temperatur?«
»Sechshundertfünfzig Meter, siebenundzwanzig Grad!«
Mein Kumpel lächelt ernst.
»Das Flöz trägt nicht umsonst den Namen ›Hölle‹.«
Der Hinweis reizt mich nur noch mehr.
»Sprich mit dem Steiger,« dränge ich, »damit er uns zusammentut. Ich habe ohnehin den Aufbruch bis zum Hals.«
Mein Kumpel überlegt.
»Na, woll'n mal sehn …«
Zwei Tage später fahren wir gemeinsam ein. Wieder tauche ich in jenes schwarze Schweigen, das ich bei meiner ersten Grubenfahrt so schauerlich empfand. Der Förderkorb bringt uns zur sechsten Sohle. Hauptquerschlag und Abteilungsquerschlag bleiben hinter uns. Wir wenden rechts, kommen zum Anschlag eines Bremsberges.
Die Eisenschienen laufen schräg nach unten. Auf einem Sockel von Beton zeigt sich der Haspel, der bei der Förderung volle Wagen in die Höhe zieht, leere herunterläßt.
Wir sind am Berg die ersten, machen halt. In Trupps zu zweien oder dreien nähern sich die Kameraden. Butterbrote werden vorgenommen, in Scherz und Ernst die Frauen, Vorgesetzten und politischen Ereignisse besprochen: das »Bergamt« findet statt, ein alter Brauch, der mehr und mehr dem Hochbetrieb der Kohlenförderung zum Opfer fällt.
Nach etwa zehn Minuten zieht mein Kumpel seine Uhr.
»Kinder, es ist halb drei! Wir müssen uns verdrücken …«
Schweigend wird aufgebrochen, man verteilt sich.
Die Lichter irren durch den Berg:
Seelen der Verdammten!
Wir klappern abwärts, kommen in die Förderstrecke. Der Gebirgsdruck ist hier ungeheuer. Das zeigen die gebrochenen Holzkappen, die durchgeknickten und verschobenen Tannenstempel. An einer Stelle liegt ein kleiner Bruch. Ein Knistern uns voraus im Hangenden: wir stehn.
Seltsam, wie das Gebirge arbeitet! Es flüstert menschlich, stöhnt und ächzt. Dann brüllt es plötzlich wie ein Tier. Wir springen, laufen, Steine krachen hinter uns. Die Kinnlade des Bergs ist zugeschnappt, Holzstempel splittern zwischen seinen Zähnen.
Rufe hinüber und herüber. Wir werfen unsere Jacken ab und räumen auf. Die Grubenschienen werden freigelegt, zwei Kameraden setzen neue Hölzer. Wir andern nehmen unser Zeug und gehn, gebückt, voll Schweiß, in elender, verbrauchter Luft.
»Wann kommt denn deine Rutsche?«, frage ich.
»Noch ein paar Schritte«, antwortet mein Kumpel.
Wir biegen links um eine Kurve. Ich sehe einen halb beladenen Kohlenwagen. Seitlich darüber klafft der Rutschenschacht: die Miniaturausgabe eines Querschlags! Mulden von Stahlblech fügen sich zu einer Rinne, die schräg nach oben sich ins Dunkel dehnt. Die Rutschentour ist hundert Meter lang und ruht auf Rollen.
Rechts von der Rutsche öffnet sich der Kohlenstoß.
»Jacke und Hemd aus!«, kommandiert mein Kumpel.
Wir steigen in ein schwarzes Loch und schieben uns auf Ellenbogen, Knien vorwärts. Schalhölzer müssen überkrochen werden, der nackte Rücken streift dabei das Hangende. Um Stempel winden wir uns, auf der Hüfte liegend. Die Luft ist glühend wie in einem Ofen.
»Na, wie gefällt's dir?«, fragt mein Kumpel, beim Schein der Grubenlampe wie ein Neger grinsend.
Ich murmele irgend etwas Unverständliches.
Last des Gebirges über mir, die fürchterliche Hitze, Enge:
Das ist unsagbar, unbeschreiblich!
Die Wirklichkeit schlägt alle Phantasie!!
Mein Kumpel reicht mir eine kurzstielige, breite Schaufel.
»Da nimm! Du kannst die Kohlen, die ich mache, in die Rutsche werfen.«
»Ja, Mensch, wie denn?«
»Du kniest dich hin …«
»Man kann doch gar nicht knien!!
Mein Kumpel wird ungeduldig.
»Lehn' deinen Rücken gegen einen Stempel! Los, los, wir müssen hier pro Mann und Schicht sieben Wagen fördern.«
Ich rechne mechanisch:
Ein Wagen faßt vierzehn Zentner. Das gibt bei sieben Wagen achtundneunzig Zentner auf den Mann. Die Zeche zahlt dem Hauer für den Zentner etwas über sieben Pfennige Ende 1927 etwas über 9 Pfennige.!
Was kostet der Zentner Kohlen im Reich?
Ein Heulen, Schrillen, Dröhnen schreckt mich auf. Mein Kumpel hat den Abbauhammer angesetzt, den Preßluft treibt. Es ist ein Kreischen wie von tausend Irren, ein Delirieren wie von Fieberkranken: die Hölle läßt ihre Dämonen los!
»Warum, zum Teufel, läuft die Rutsche noch nicht?«, brüllt mein Kumpel.
»Weiß ich das?«, brülle ich zurück.
Im gleichen Augenblick geht neben mir ein Zittern durch den Rutschenkörper, ein Knirschen folgt, ein ungeheures Rasseln. Von der Maschine ruckartig geschüttelt, gleitet der Kohlenstrom zur Förderstrecke.
Ich schippe wie ein Wahnsinniger drauf los. Rechts wächst die Kohle, die mein Kumpel löst, zu einem Haufen, links schneidet mich der scharfe Rand der Rutsche. Augen und Nase füllen sich mit Staub. Ich bin vom Lärm erschlagen, halb bewußtlos, blind …
Plötzlich – mir wie ein Wunder – bleibt die Rutsche stehn.
Gingen Minuten, Stunden, Tage?
Jenseits des Haufens arbeitet mein Kumpel. Ich sehe ihn, da ich mich aufrichte, krampfhaft verzogenen Gesichts schräg auf der Seite liegen. Den Kopf ans Hangende gepreßt, treibt er den Abbauhammer immer wieder in die Kohle. Ihm fließt nicht Schweiß, ihm stürzt Schweiß aus den Poren!
Erschöpft falle ich in mein Loch zurück. Ein Leichnam hat im Sarg mehr Raum als ich.
Meine Gedanken kreisen …
Das Flöz ist fünfundvierzig Zentimeter dick. Kaum faßbar, daß bei einer Mächtigkeit von dreißig Zentimetern Menschen Kohle fördern können, bei einer Hitze, die noch größer ist als unsere, denn es gibt Grubentemperaturen bis zu fünfunddreißig Grad!!
Hiob, der Herdenbesitzer, kannte ein Bergwerk. Er spricht – es ist der ältesten Berichte einer – vom »Schacht, drin hangen und schweben sie als die Vergessenen«. Stand ihm der Tag ohne Licht vor Augen, da er den Tag seiner Geburt verfluchte?
»Der Tag müsse finster sein, und Gott von oben herab müsse nicht nach ihm fragen; kein Glanz müsse über ihn scheinen!
»Die Nacht müsse ein Dunkel einnehmen; sie müsse sich nicht unter den Tagen des Jahrs freuen noch in die Zahl der Monden kommen!
»Ihre Sterne müssen finster sein in ihrer Dämmerung; sie hoffe aufs Licht, und es komme nicht; und müsse nicht sehen die Wimpern der Morgenröte …«
Ich brauche mich dessen nicht zu schämen!
Ein Steiger sagte mir, er habe kürzlich erst zwei Mann der Schupo mitgenommen, die sich persönlich überzeugen wollten, ob Bergwerksarbeit wirklich so schwer sei, wie sie geschildert werde. Es waren junge, gut trainierte Leute! Sie wurden durch vier Rutschen – achtzig Zentimeter Mächtigkeit – geführt, machten nach zweieinhalb Stunden schlapp und fuhren aus. Noch Schlimmeres passierte einem Mitglied einer von Berlin entsandten Kommission. Es fiel mitten in der Befahrung ab, mußte zum Schacht getragen und hinausbefördert werden.
Des Bergmanns Arbeit ist die schwerste, die menschliche Wesen zu verrichten haben! Luft, Temperatur und Raumverhältnisse machen sie höllisch, mörderisch!! Dabei stets zwei Gehirnfunktionen: eine, die lediglich der Ausführung der Arbeit gilt, und eine andere zur Beobachtung, Verhütung der ihm drohenden Gefahr. Der Bergmann steht vor Ort auf sich allein, selbständig handelnd, immer neuen Situationen gegenüber!!!
Wenn der »gelernte« Arbeiter sich mehr dünkt als die Kameraden von der schwarzen Zunft – ein Faktum, das mir Bergleute bestätigten –, so legt das Zeugnis ab, wie wenig man im Grunde doch vom Bergwerk weiß. Der Bergmann alten Stamms kommt sechzehnjährig in die Grube, wo er als Pferdejunge anfängt. Nach eineinhalb- bis zweijähriger Tätigkeit rückt er zum Bremser oder Schlepper auf und wird – nach der Anciennität – Gedingeschlepper einer Kameradschaft. Ein weiteres Jahr macht ihn zum Lehrhauer, was er drei bis vier Jahre bleibt, um die Qualifizierung eines zweiten Hauers zu erlangen. Dann erst befähigen ihn Alter, Tüchtigkeit zum Hauer ersten Grades, der, eine Kameradschaft führend, Ortsältester ist.
Auch sonst hat man vom Bergmann falsche Vorstellungen. Er ist durchaus nicht ungebildeter als etwa der »gelernte« Arbeiter! Ich habe Bergleute gefunden, die sich mit Philosophie beschäftigten. Andere trieben Astronomie, widmeten sich der Tier- und Pflanzenkunde. Liebhabereien sind nichts Seltenes. Ich sah erlesene Steinsammlungen, ausgewählte Bibliotheken. In manchem Gärtchen wuchsen Blumen edler Zucht.
Was den Familiensinn betrifft – ich folge hier den Worten eines Knappschaftsarztes –, so tut der Bergmann für die Seinen, was er kann! Bei Krankheiten, Verletzungen geduldig, in der Gefahr besonnen, rücksichtslos das Leben einsetzend, wo es die Rettung seiner Kameraden gilt, ist er ein ruhiger, umgänglicher Mensch, wenn ihm die Lohnverhältnisse ein Auskommen ermöglichen …
»Bergleut sein arme Pursche«, las ich irgendwo.
Wie hallte einst der Schacht vom Ruf der Treiber, wie vom Gewieher und Gedröhn der Pferde! Das war Musik des Lebens, wetteifernde Kraft, beseelte Klugheit, schlichte Treue! Heut überall die Wesenlosigkeit elektrischer Maschinen: Pferde im Bergwerk werden seltener.
Die Tiere kommen meist fünfjährig in die Grube und sind oft zwanzig Jahre Bergmann. Tagaus, tagein ziehen sie die schweren Kohlenzüge, um, wenn verbraucht und alt, des Gnadenbrotes sich zu freuen, mit dem die Zeche ihre Leistungen belohnt.
Tragisch die Einfahrt, tragischer die Ausfahrt! Schnaufend und wiehernd grüßen sie die Hängebank, als hätten sie den Tag voll Licht noch nicht vergessen. Die Binde, die man ihnen umgeschlungen, fällt. Glanzlose Augen starren in die Sonne: ein Tag ohne Licht …
Ich gebe einige Geschichten wieder, die mir von Bergleuten erzählt wurden und aus den Essener Kohlengruben stammen.
Ewald:
Ein Apfelschimmel unheimlicher Dimensionen. Er zog genau zehn volle Wagen, den elften – wie man es auch anfing – wies er ab. Beim Anziehen zählte er die Wagenrucke und stand beim elften Ruck wie angemauert. Schläge und Schmeicheleien nutzten nichts: der elfte Wagen mußte abgehangen werden! Als man das Pferd zu überlisten suchte – der elfte Wagen wurde mittels Haken stramm geknebelt, so daß ein Aufrucken unmöglich war –, zog Ewald dennoch nicht: er kannte seine Höchstladung bis auf den Zentner! Zur Schichtzeit, wenn die Kumpels mit den Grubenlampen kamen, tat er, auch wenn der Schacht nur vierzig Meter weit entfernt war, keinen Schritt mehr. Er stellte sich dann quer zur Strecke, ließ niemand durch und gab den Weg erst frei, wenn man ihn ausspannte.
Max:
Ein Pferd, das wie ein Bergmann Tabak kaute. Es forderte von den Vorübergehenden Tribut, weshalb man besser tat, den Kautabak nicht sehn zu lassen. Ein Kumpel, der die Eigenschaft des Pferdes noch nicht kannte, begegnete, frisch angefahren, Max am Schacht und nahm gewohnheitsmäßig einen Stift. Im gleichen Augenblick sprang Max laut wiehernd auf ihn los. Der Kumpel flüchtete erschrocken, Max galoppierte hinterdrein. Die Kameraden lachten, schrieen: »Gib ihm doch ein Stück Tabak, Mensch!« Der Kumpel sah und hörte nichts. Von Max gestellt und an den Stoß gedrückt, erwartete er, daß das Pferd ihn beißen werde. Max aber schnüffelte die Hand des Kumpels ab, zerrte den Stift hervor und trollte sich. Der Kumpel war nicht schlecht erstaunt, das Pferd – wie man sich denken kann – der Held des Tages.
Moritz:
Ein schwarzer Teufel und sehr klug. Schon mehrmals waren Butterbrote fortgekommen: dem Bergmann in der Grube ein empfindlicher Verlust! Um diesem Ärgernis ein Ende zu bereiten, hatten die Kumpels neben ihre Sachen eine Grubenlampe aufgehängt und lauerten in einiger Entfernung auf den Dieb, den man in einem jüngeren Lehrhauer vermutete. Zur allgemeinen Überraschung erschien – Moritz. Lautlos auftretend, nach allen Seiten Umschau haltend, ging er ganz langsam zu den Kleidern, zog vorsichtig ein Butterbrot aus einer Tasche, steckte den Kopf in einen Kohlenwagen, entledigte sich des Papiers und futterte. Ein unbeschreibliches Hallo entstand. Damit hatte man doch nicht gerechnet! Moritz soll sehr betrübt gewesen sein: die Butterbrote blieben ihm in Zukunft unerreichbar.
Wilhelm:
Ein Pferd, das einen sechsundzwanzigjährigen Treiber hatte, im Bergwerk eine Seltenheit, da – wie schon andern Orts erwähnt – die Pferdejungen achtzehnjährig Bremser oder Schlepper werden. Der Grund für diese Ausnahme war triftig: Wilhelm, so arbeitsam wie stark, gehorchte nur dem einen Treiber. Was andere auch mit ihm anstellten, ob sie ihn schlugen, stießen, nichts vermochte ihn vom Fleck zu bringen! Die Wut der Kumpels über diesen »Bock« war groß, verwandelte sich aber in Gelächter, als man dahinterkam, daß Wilhelm »auf Kommando« ziehe. Sobald ein Kohlenzug zur Abfahrt fertig war, brüllte der Treiber: »Stillgestanden!« Wilhelm erstarrte mit gespitzten Ohren. Darauf der Treiber: »Abteilung ma – r – sch!« Jetzt flogen Wilhelms Pferdebeine: stolz ging es im Paradeschritt zum Schacht. Bei Kriegsausbruch wurde der Treiber eingezogen, Wilhelm folgte ihm bald. Man konnte in der Grube nichts mehr mit ihm anfangen.
Emil:
Ein schöner Fuchs und seinem Treiber ungewöhnlich zugetan. An einem Abend, kurz vor Schicht, blieb Emil in dem engen, einspurigen Querschlag plötzlich stehn. Der Junge, rasch vom Wagen abgesprungen, sah einen durchgebrochenen Stempel in der Bahn und schob sich vor, um diesen fortzuräumen, als über ihm die Kappschiene herunterkam. Er hatte gerade Zeit, unter das Pferd zu schlüpfen, da brach auch schon das Hangende zusammen. Gestein und Schiene fielen auf das brave Tier, das, der Gefahr bewußt, nicht einen Zentimeter wich. Laut stöhnend trug es seine ungeheure Last, bis auf den Ruf des Jungen Hilfe kam. Bergleute, die der Szene beigewohnt, versicherten, der Junge habe seine Dankbarkeit nicht stürmischer geäußert als das Pferd, das mit Verständnis und Geschick den Anweisungen für die Rettung folgte.
Bei einer Flasche Doppelkorn, im Kreis von Steigern. Unglaublich, welche Fülle von Humor im Bergmann steckt! Sein Witz trifft schonungslos den Vorgesetzten, und was die Kumpels gegenseitig sich für Streiche spielen, läßt oft an Derbheit nichts zu wünschen übrig.
Ich lasse eine Auswahl kleinerer Geschichten folgen, obwohl ich fürchte, nicht den Eindruck zu erreichen, den ihr Erzähler in mir selbst hervorgebracht. Westfälisch Platt, ein rundes, lachendes Gesicht, worin zwei spitzbübisch verkniffene Augen, sind stärker als der tote Buchstabe.
Das Stempelstrecken
Ein junger, von der Bergakademie gekommener Praktikant wird einer älteren Kameradschaft zugeteilt, die eine Holzzimmerung zu setzen hat. Man gibt ihm einen frisch geschnittenen Stempel, den er auch glücklich in das Bühnenloch hineinbringt. Als er jedoch den Stempel aufrecht stellen will, fehlt eine starke Handbreit bis zur Kappe.
»Das tut nichts,« tröstet ihn ein Kumpel, »den kann man mit dem dicken Hammer strecken.«
Der Praktikant wehrt zweifelnd ab.
»Was wissen Sie vom Strecken,« trumpft der Kumpel auf, »schlagen Sie zu, ich werde drehen!«
In diesem Augenblick erscheint der Steiger.
»Na, was macht ihr denn da?«
»Wir strecken gerade einen Stempel!«
»So«, sagt der Steiger, der die Situation durchschaut, und nickt Gewährung.
Der Praktikant schwingt schweißtriefend den dicken Hammer, ein anderer Kumpel aber schiebt etwas Geröll – »Dreck« sagt der Bergmann – in das Bühnenloch.
»Probieren Sie jetzt mal!«
Von neuem aufgestellt, paßt der »gestreckte« Stempel auf den Zentimeter.
Der Steiger wendet sich zum Gehn.
»Ja, man kann immer noch was lernen …«
1 Liter Bergischen und 3 Zigarren
Fritz, Jupp und Heinrich, als »die Unzertrennlichen« bekannt, firm im Beruf, doch auch berüchtigt wegen ihrer Streiche, erhalten eine Arbeit zugewiesen, die bis zum Abend fertig werden muß.
»Kerls,« sagt der neue Steiger, »ich verlasse mich auf euch. Die Sache eilt, und euer Schade wird es auch nicht sein!«
Fritz räuspert sich und blickt die Kameraden an.
»Was meinst du, Heinrich?«
»Ich meine, wenn das da so eilig ist und unser Schade auch nicht sein soll, kann uns der Steiger gleich 'en Schein für Schnaps hierlassen …«
»Und für Zigarren!«, fällt ihm Jupp ins Wort.
»Gut,« sagt der Steiger, »sollt ihr haben!«, nimmt sein Notizbuch aus der Tasche und schreibt mit Bleistift auf ein Blatt:
1 Liter Bergischen und 3 Zigarren.
Darunter setzt er seinen Namen.
»Hier und Glückauf!«
»Glückauf!«, brüllen die drei …
Zur Schichtzeit ist die Arbeit fertig, die Kumpels steuern einer Wirtschaft zu, und auch den Steiger hält es nicht daheim: er geht mit seiner jungen Frau spazieren.
Als er, bei anbrechender Dämmerung das Lokal passiert, in dem die Kumpels sich den Schnaps abholen sollten, sieht er – er glaubt nicht recht zu sehen – Fritz, Jupp und Heinrich auf der Straße hocken. Gröhlend und sich vor Lachen schüttelnd, wiederholen sie die Worte:
»Wenn das der Kerl wüßt', wenn das unser Steiger wüßt'!«
Der Steiger hört das, denkt bei sich:
Von einem Liter können die doch nicht betrunken sein!
Weil seine junge Frau dabei ist, geht er weiter …
Am andern Tage sind die drei nicht angefahren. Der Steiger, eingedenk der abendlichen Szene, sucht ungesäumt die Wirtschaft auf, um seinen Liter und die drei Zigarren zu bezahlen.
»Was einen Liter,« sagt der Wirt, »was drei Zigarren! Sie schulden mir vier Liter Bergischen, dreißig Zigarren!«
»Nicht möglich«, antwortet verdutzt der Steiger.
»Doch, doch! Hier lesen Sie den Schein!«
Ein fürchterlicher Fluch des Steigers folgt.
»Die Kerle haben aus der 1 'ne 4 gemacht und an die 3 noch eine 0 gehängt!«
»Ja,« sagt der Wirt, »wie kann man aber auch in Ziffern schreiben!«
Nun kommt dem Steiger doch das Lachen.
Na wartet, denkt er, das will ich euch ankreiden …
Von Jupp und vom Maschinenöl
Wochen darauf – der Steiger hatte sich nichts merken lassen und auch der Wirt den Mund gehalten – bitten »die Unzertrennlichen«, nun kühn geworden, abermals um Schnaps.
»Nee,« sagt der Steiger, »kann ich nicht verantworten. Wir sind bereits der Leitung aufgefallen!«
»Ach Steiger,« flötet Jupp, »Sie sind zu ehrlich. In anderen Revieren schreibt man Scheine für Maschinenöl. Die Wirte wissen, was das zu bedeuten hat.«
Dem Steiger glänzt die Freude aus den Augen.
»Wenn das so ist,« erwidert er ganz ernst, »will ich euch nicht um euren Liter bringen!«, nimmt sein Notizbuch vor und schreibt die Anweisung:
1 Liter Maschinenöl.
»Hier und Glückauf!«
»Glückauf!«, grinsen die drei.
Beim Fortgehn hört er gerade noch, wie Jupp zu seinen Kameraden sagt:
»Der Kerl hat wirklich nichts gemerkt …«
Nach Schicht begeben sich die Kumpels zu der Wirtschaft: Jupp, als der Sparsame, mit ruhigem Gewissen, Heinrich und Fritz besorgt wegen der Saufschulden, die sie in dem Lokal noch hängen haben.
»Jupp,« beginnt Heinrich etwas mißtrauisch, »wir können da nicht gut hinein. Hol' du den Schnaps, wir werden draußen warten. Aber das sag' ich dir: wenn du nur einen Schluck machst, schlagen wir dich tot!«
An Körperkräften unterlegen, schwört Jupp bei seinem Schutzpatron Gehorsam und geht, vier Blechpullen im Arm – die Literzahl ist wie beim ersten Mal geändert worden – in die Wirtschaft.
Der Wirt liest aufmerksam den Schein, lacht, füllt die Pullen, Jupp zieht ab. Doch vor der Haustür übermannt ihn das Verlangen: er reißt den Stöpsel einer Flasche auf und trinkt, trinkt einen Riesenschluck.
Im gleichen Augenblick ein Würgen, Speien:
»Gott verdamm' mich, das ist ja Schmieröl!«
»Jupp,« brüllt es von der andern Seite, »wenn du nicht aufhörst, schlagen wir dich tot!! Das Vieh säuft uns den Schnaps weg, hierher Jupp!!!«
Der aber ist mit einem Satz am Schenktisch.
»Was haben Sie mir da gegeben?«
»Was auf dem Zettel stand: Maschinenöl!«
Jupp zwinkert wie besessen.
»Aber …«
Und plötzlich aufheulend:
»Das glauben die mir nicht! Wenn ich den Schnaps nicht bringe, schlagen sie mich tot!«
Von draußen schallt das Toben der zwei Kumpels.
»Borgen Sie mir vier Liter Bergischen!«, fleht Jupp.
Der Wirt bleibt ungerührt.
»Ich kenne Sie doch gar nicht, Mann!«
Jupp ist am Sterben …
Da, in der höchsten Not, erscheint sein Revierschießmeister. Jupp fällt ihm um den Hals, erzählt, was sich ereignet hat, und bittet, die vier Liter für ihn auszulegen.
Der Schießmeister hält sich den Bauch vor Lachen. Er weiß vom Steiger, daß der Wirt speziellen Anweisungen folgt, ist aber auch darüber orientiert, daß Jupp Besitzer eines Spartopfes.
»Ich will dir helfen,« sagt er schließlich, »doch wehe dir, wenn du darüber sprichst!«
Jupp schwört bei seiner Seligkeit, zu schweigen, erhält vier Liter Bergischen und geht. Draußen wird ihm »zur Strafe« der gesamte Vorrat abgenommen! Jupp muß es zähneknirschend dulden: er darf nicht reden, glauben würde man ihm auch nicht.
Heinrich und Fritz betrinken sich auf seine Kosten …
Wie alles herauskam
Nach einigen Tagen bleibt der Steiger wieder einmal bei dem Kleeblatt stehn.
»Wie ist's denn mit der Arbeit?«
Jupp schweigt.
»Schwer, schwer«, stöhnt Fritz.
Heinrich bemerkt:
»Sie können uns schon einen Liter schreiben!«
»Maschinenöl?«, fragt teilnehmend der Steiger.
»Ja, ja, Steiger, Maschinenöl …«
Da springt Jupp wie ein Tiger vor.
»Ich hab' genug Maschinenöl gesoffen!«
Heinrich und Fritz entrüsten sich.
»Bist du verrückt?«
»Nein,« fällt der Steiger ein, »der Schießmeister sprach von der Sache. Es muß da ein Versehn gegeben haben!«
»Was,« schreit nun Jupp, »der Schießmeister hat nicht geschwiegen? Dann brauch' ich auch mein Maul nicht halten!«
Und er erzählt, was in der Wirtschaft vorgegangen ist.
Heinrich und Fritz stehn fassungslos.
»Warum hast du uns nichts davon gesagt?«
»Weil mir der Schießmeister das streng verbot und weil …«
Jupp will nicht eingestehn, daß er vor seinen Kumpels Angst gehabt hat.
»Schufte …«, brüllt er, sich der vier Liter Bergischen erinnernd.
Im gleichen Augenblick sind alle drei im Handgemenge.
»Kinder, vertragt euch!«, sagt der Steiger.
Und mit erhobener Stimme:
»Wie du mir, so ich dir!«
Die Kumpels lassen voneinander ab. Der Steiger aber hört beim Fortgehn, wie Jupp erhitzt zu seinen Kameraden sagt:
»Der Kerl hat doch etwas gemerkt …«
Die Monatsabnahme
August hatte eine strenge Frau. Nicht nur, daß er den ganzen Lohn abliefern mußte, zwang sie ihn auch, die Zahl der Wagen anzugeben, die er pro Schicht gefördert hatte. Am Monatsschluß errechnete sie den Verdienst: schlimm für August, wenn ein Pfennig fehlte!
Einmal aber fehlten zweiundsiebzig Pfennige …
August steht in der Steigerstube.
»Was habe ich verdient?«, fragt er den Steiger.
»Sechs Mark und fünfundneunzig Pfennige!«
August schüttelt den Kopf.
»Nach Rechnung meiner Frau sechs Mark und achtundneunzig Pfennige!«
»Scheren Sie sich zum Teufel,« flucht der Steiger, »was habe ich mit Ihrer Frau zu tun?«
»Wohl, wohl,« sagt August, »aber rechnen kann sie!«
»Das müssen Sie erst mal beweisen!!«
August bleibt seelenruhig.
»Bei uns wird jeder Wagen aufgeschrieben!«
»Na,« sagt der Steiger kurz, »auf die Belege bin ich neugierig …«
August macht linksum kehrt, verschwindet. Der Steiger hat die Sache fast vergessen, als August mit Gepolter eintritt. Auf seinem Rücken trägt er eine – Stubentür.
»Mensch, sind Sie wahnsinnig geworden?« fährt der Steiger auf.
August setzt keuchend seine Bürde ab.
»Sie wollten doch die Rechnung meiner Frau nachprüfen!«
»Steht die denn auf der Tür?«, schmunzelt der Fahrsteiger.
»Gewiß,« sagt August, auf die Kreideziffern deutend, »hier haben Sie die Wagenzahl und hier die Schichten. Das macht im ganzen hundertsiebenundsechzig Mark und zweiundfünfzig Pfennige. Der Steiger bringt nur hundertsechsundsechzig Mark und achtzig Pfennige heraus. Es fehlen also zweiundsiebzig Pfennige!«
Ein brüllendes Gelächter füllt die Steigerstube.
»Nee,« sagt der Fahrsteiger zu August, »dagegen können wir nicht an. Der Steiger wird sich wohl vertan haben!«
August erhält das volle Geld und geht.
»Kommen Sie nicht noch einmal mit der Tür als Schichtenzettel!«, droht der Steiger.
Der Herr Betriebsführer, der literarisch etwas los hat, sagt:
»Wenn ich nicht selbst dabei gewesen wäre, würde ich glauben, daß die Sache von Hans Sachs sei …«
Mein Kumpel träumte von Leichen.
Seltsame Umwandlung, die der so kaltblütige Mensch erfahren! Er wird – gleich allen Bergleuten – nicht eingestehn, daß er – wie sie – Ahnungen unterworfen ist.
»Ich bin nur schlecht im Schuß!«, sagt er entschuldigend.
In Wahrheit spricht aus ihm des Bergmanns zweite Seele …
Wir stehn in einem alten Bau, der seit Jahrzehnten aufgegeben und verlassen ist. Stempel und Kappen sind gebrochen. Schwammpilz hängt weiß in langen Bärten von der Zimmerung und weht gespenstisch hin und her. Am Faulholz glimmen matte Lichter.
So wenig das moderne Bergwerk Stimmungen begünstigt: hier, von verwesenden Gebilden feucht umarmt, im Ohr das Rascheln, Ächzen des Gebirges, erlebt man das Entstehn von Grubensagen, glaubt an den »Stiefelmann«, der in der Zeche »Alte Sackberg und Geitling« schlürft, weil er bei Lebzeiten die Knappen um den Lohn betrog und daher nicht die ewige Ruhe finden kann. Glaubt an das Berggespenst im »Himmelsfürster Erbstollen«, das nachts die Knappen durch sein Stöhnen aufschreckt, doch niemandem etwas zuleide tut, solange man seiner nicht spottet. Nur einmal wagte ein tollkühner Bursch zu rufen: »Komm näher, Troll, und zeige dich!« Da trat eine Gestalt aus blauen Flammen, so grausig, daß der Knappe den Verstand verlor und starb …
Wunderbar sind die Warnungen der Grubengeister! Mündliche Überlieferung trug mir eine Sage zu, die aus der Zeche »Rosenblumendelle« stammt und dort vor zwanzig Jahren noch im Umlauf war.
Man weiß nicht mehr, auf welcher Sohle es gewesen, doch lag die Strecke unter schwerem Druck. Kleinere Brüche waren vorgekommen.
Ein junger Lehrhauer ist mit beladenem Wagen auf dem Weg zum Anschlag. Da sieht er plötzlich in der Strecke eine Anzahl Lichter, die er für Steigerlampen hält.
Um niemanden zu überfahren, ruft er:
»Achtung!«
Die mit den Lichtern lassen sich nicht stören. Sie deuten hin und her, als mäßen sie ein Stück der Strecke aus, Gemurmel wird vernehmbar, eine Stimme sagt:
»Von hier bis hier …«
Der Lehrhauer kann sich den Vorgang nicht erklären und folgt den Lichtern bis zum Anschlag. Dort aber ist kein Mensch zu sehn: die Grubenlampen sind verschwunden!
Seltsam geängstigt, läuft der Lehrhauer zur Arbeitsstelle seines Kameraden. Dieser, ein älterer Mann, hört, was dem jüngeren begegnet ist, läßt alles stehn und liegen und geht mit.
»Hier war es«, sagt der Lehrhauer, auf einen Punkt der Strecke zeigend.
Der alte Hauer blickt scharf um sich, lauscht.
»Komm, komm!«, ruft er mit heiserer Stimme.
Da weiß der Lehrhauer, daß es ein Rennen um das Leben gilt. Sie stolpern, laufen, jagen durch die Strecke. Plötzlich ein ungeheures Prasseln hinter ihnen: das Hangende bricht über hundert Meter weit zusammen!
Am Anschlag drehen sich beide um.
»Von hier bis hie...«, sagt atemlos der Lehrhauer.
Der Alte nickt.
Die mit den Lichtern hatten gut gemessen …
Ob Fügung oder Schicksal, es gibt Tatsachen, die rätselhaft und doch nicht selten sind. Was ich erzählen will, ist Hunderten von Bergleuten passiert. Zwei Fälle dieser Art mögen genügen.
Auf Zeche »Kaiserstuhl«, im Jahre 1893
Ein Kumpel, der zur Arbeit geht, entdeckt, daß er sein Butterbrot vergessen hat. Ärgerlich kehrt er um, holt sich die »Kniffen« und macht sich wieder auf den Weg.
Kurz vor der Zeche hat er das Gefühl, »daß irgend etwas noch nicht richtig sei«. Er denkt und denkt, steht schon im Zechentor. Da merkt er, daß ihm seine Uhr fehlt.
Anfahren ohne Uhr?
Nein, ausgeschlossen!
Also, marsch marsch nach Hause, dann zurück …
Als er das zweite Mal zur Zeche kommt, ist Schluß der Seilfahrt. Wütend, daß er die Schicht versäumt, doch auch darüber nachgrübelnd, wie er, der sonst gar nicht vergeßlich, heut Butterbrot und Uhr zu Hause lassen konnte, geht er heim.
Er sitzt mit seiner Frau noch auf dem Sofa, als eine Nachbarin ins Zimmer stürzt:
»Auf ›Kaiserstuhl‹ soll was passiert sein …«
Den Kumpel überläuft es kalt. Er küßt rasch seine Frau und rennt zur Zeche. Das erste, was er hört, ist: »Schlagwetterexplosion!«, und als er fragt: »Welche Abteilung?«, nennt man ihm die, in der er sonst gearbeitet!
Der Kumpel fuhr sofort zur Rettung seiner Kameraden ein, doch fand er keinen mehr am Leben. Glücklich heraus, lief er »dreimal um eine Kirche«.
Es war am neunzehnten August, und über sechzig blieben tot ..
Radbod, im Jahre 1908
Von dieser größten aller Katastrophen spricht jeder Bergmann heute noch mit Grauen. Dreihundertneunundvierzig Mann der eingefahrenen Belegschaft kamen um. Nur sechsunddreißig Mann konnten gerettet werden.
Am Tage, der der Unglücksnacht vorausging, hatten zwei Kumpels Morgenschicht gehabt und sollten abends wieder anfahren. Nachmittags sitzen sie in einer Wirtschaft.
»Ich weiß nicht, was mir fehlt,« beginnt der eine, »ich hab' so'n sonderbaren Druck: am liebsten blieb' ich heut zu Hause!«
»Ach Blödsinn,« antwortet der andere, »trinken wir einen, das wird schon vorübergehn!«
Sie trinken einen, trinken mehrere und haben schließlich einen Rausch. Um diesen auszuschlafen, steuern sie in ihr Quartier und werfen sich – bis zehn Uhr ist noch eine Menge Zeit – auf ihre Betten.
Die Kostmutter weckt sie nicht einmal, sondern viermal, die Kumpels rufen zwar: »Ja, ja, wir kommen!«, verpassen aber doch die Anfahrt, schlafen weiter.
Plötzlich – so zwischen vier und fünf Uhr früh – erwachen sie. Vor ihrer Tür ein unruhiges Laufen, Fenster werden aufgerissen, Frauen schreien:
»Der Schacht brennt …«
Die Kumpels sind mit einem Satz aus ihren Betten, Sekunden später unterwegs. Von weitem sehn sie eine dunkle Rauchsäule, die sich vom Nachtblau des Novemberhimmels abhebt.
Am Zechentor die furchtbare Bestätigung:
Schlagwetterexplosion!
Ganze Belegschaft eingeschlossen!!
Grubenbrand!!!
Schluchzend fallen sich die beiden Kumpels um den Hals.
»Wenn wir jetzt unten wären …«
Als man begann, die Grube zu ersäufen, machten die Kumpels, daß sie fortkamen.
Sie arbeiten zur Zeit auf einer Essener Zeche …
Ich will abschließend einer merkwürdigen Rettung denken, die wie ein Wunder klingt und doch bezeugt und wahr ist. Grundwasser auf der Sohle.
Man hat, um sich des Wassers zu entledigen, ein Sammelbecken angelegt. Das Loch ist über einen Meter tief, ein Kumpel arbeitet darin.
Plötzlich bricht überraschend das Gebirge. Ein riesenhafter Stein, härtester Art, fällt wie ein Deckel auf das Loch und klemmt sich fest. Alle Bemühungen, den Stein zu heben oder zu zerkleinern, sind vergeblich. Das Wasser steigt: es bleibt nichts anderes übrig, als zu sprengen!
Der Kumpel zieht dies dem Ertrinken vor, bittet jedoch – ein schmaler Spalt ermöglicht die Verständigung – um einen Priester. Man trifft sofort die für die Sprengung notwendigen Maßnahmen. Ein Priester wird geholt, fährt mit den Sterbesakramenten ein.
Tief in der Erde beichtet nun der Mann unter dem Stein, erhält Absolution und letzte Ölung. Dann gehen Priester und Betriebsführer in Deckung.
Sekunden fürchterlichen Wartens …
Ein Krachen, Vorwärtsstürzen:
Lebt er?
Ja, er lebt!
Bewußtlos zwar, doch ohne eine Schramme, wird er aus dunklem Loch hervorgezogen.
»Tantum ergo sacramentum
Veneremur cernui …«
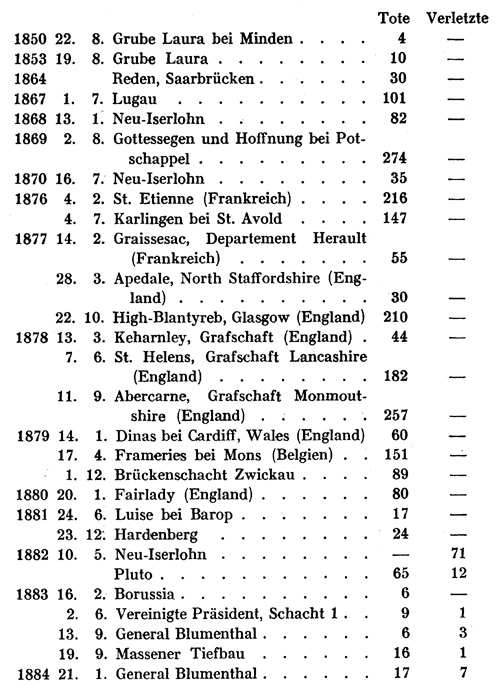
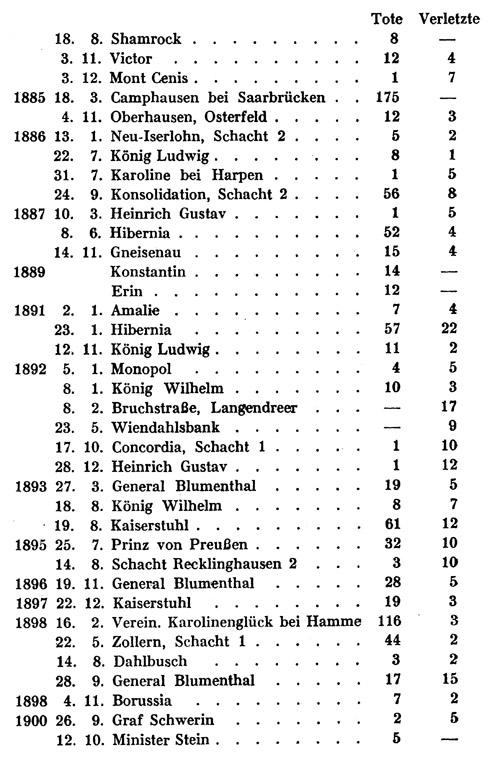
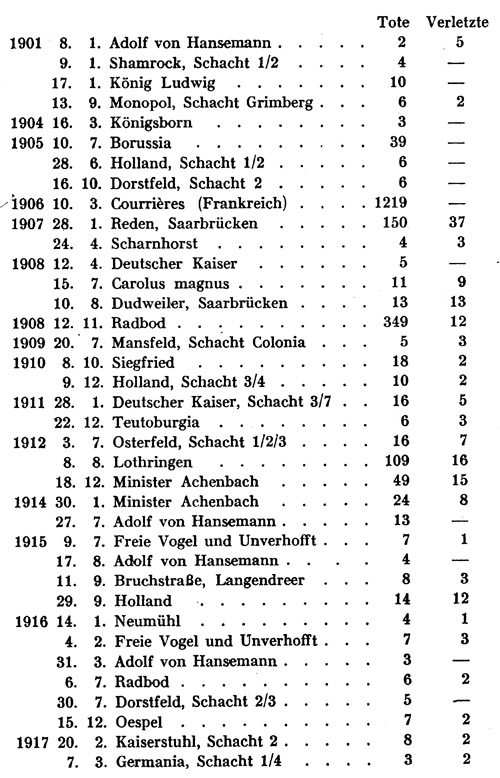

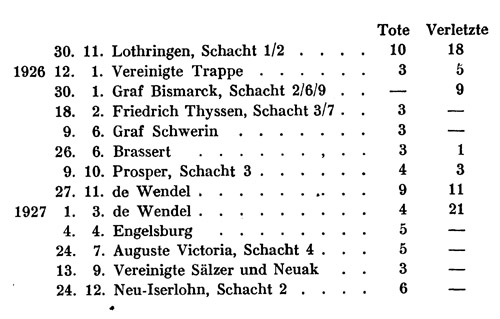
Schneller, als Telegraph und Fernsprecher es melden, fliegt das Gerücht von einem Unglück durch die Nacht. Reisende verbreiten es am Hauptbahnhof, wo ich, von fröhlichem Beisammensein nach Hause gehend, jäh die Worte höre:
»Dortmund, auf Zeche ›Minister Stein‹!«
Ich suche Näheres zu erkunden, doch man weiß nicht viel. Eins aber wird erzählt, das einen Schauer über meinen Nacken jagt: Bergleute sollen abgeschnitten sein in größerer Zahl! Ich fasse den Entschluß, sofort zu fahren. Der letzte Zug trägt mich noch abends spät hinaus.
Die Nacht ist blau, von Sternenglanz erfüllt. Wir rasseln über Weichen, durch Stationen. Fördertürme blinken rechts und links. Ich sehe, daß die Arbeit überall in Gang ist. Was aber wartet meiner auf der Unglücksstätte? Wird alles still sein, ewig still?
Vorbei an riesigen Kondensatoren, vorbei an einem Walzwerk, dessen Glut mich blendet, laufen wir in den Bahnhof ein. Ich springe ab, bevor der Zug hält, eile den Bahnsteig entlang und, durch die runde Schalterhalle, auf ein Auto zu.
Der Führer sieht mich an und fragt:
»Minister?«
»Ja!«, presse ich heraus.
Wir jagen los, vorüber an Hotels – ich lese »Fürstenhof«, »Rheinischer Hof« –, und biegen links in eine Straße ein. Fenster stehen auf, Gardinen wehen. Lichter flackern hin und her. Niemand ging in dieser Nacht zur Ruh, niemand bis auf die im Schacht …
Ich kann es nicht ausdenken!
Wir fahren in einem Menschenstrom. Lastkraftwagen überholen uns: Tschakos der Schupo blitzen auf und dunkeln. Mit rasender Geschwindigkeit kommt uns ein Sanitätsautomobil entgegen. Auf weißem Feld blutet das rote Kreuz.
»Lebende?«, frage ich mich bang.
Der Sanitäter brüllt etwas herab.
Ein graubärtiger Mann hat ihn verstanden.
»Lebende!« ruft er und hebt die Arme.
Kurz vor der Zeche lasse ich den Wagen halten und bezahle. Es scheint mir unrecht, dort den Weg zu sperren, wo Tod und Leben an Sekunden hängen. Im Strom der andern wälze ich mich mit, komme zum Tor der Hauptanlage.
Graurote Pfosten ragen zwischen Schmiedegittern. Der Blick fällt auf ein längliches Gebäude, an dem mit großen Buchstaben »Minister Stein« geschrieben steht. Schlägel und Eisen kreuzen sich darüber.
Aus Fragen, Antworten und kontrollierenden Vergleichen wächst mir das Anfangsbild der Katastrophe: Schlagwetterexplosion bald nach acht Uhr! Ein Kumpel, der sich durch Schacht 3 gerettet hat, nennt acht Uhr sieben Minuten als genaue Zeit. Um einhalb neun Uhr werden Rettungstruppen eingesetzt. Das Heulen der Alarmsirenen um neun Uhr ruft weitere Mannschaften zur Stelle. Nach elf Uhr rechnet man mit achtzig Mann Verlust, nach Mitternacht bereits mit über hundert!
Mir ist, als trüge ich das Leid der Welt in meiner Brust. Ich weiß genug vom Bergwerk, um des Unglücks Schwere zu ermessen. Wen nicht die Wetterexplosion vernichtet hat, ereilt die Explosion des viel gefährlicheren Kohlenstaubs. Wer dann noch lebt, den töten Gas und Nachschwaden.
In dieser Nacht werden Menschen zu Brüdern. Was um mich her dem Luftschacht zustrebt, durch den das Rettungswerk betrieben wird, ist eines Mitgefühls, ist einer Trauer! Man hat die Scheu des Fremdseins ganz verloren. Ich stütze eine junge Frau, die mühsam vorwärts wankt. Ihr Mann kam von der Mittagsschicht noch nicht nach Hause!
Die Gegend zeigt fast dörflichen Charakter. Felder schimmern mondgrün zwischen brachem Land. Bedeckt von Menschen, wie bei einer Prozession, zieht sich die Straße schwarz zur Hochfläche, auf der ein großer Schornstein düster ragt.
An Tausend mögen dort zusammenstehn, das Durchkommen erscheint unmöglich. Aber die junge Frau drängt keuchend weiter, langsam, doch stetig, ihre letzte Kraft hingebend. Wir werden zeitweilig getrennt. Dicht hinter ihr gelange ich zum Zechentor.
Und hier erfahre ich, was flammende Erregung in der Masse auslöst: bereits am Dienstag – das ist vorgestern – sind Wetter in der Grube explodiert! Der Fahrsteiger, da man ihm Meldung machte, bezeichnete sie als vom »Generaldruck des Gebirges« herrührend. Die Nachricht stammt von eben jenem Kumpel, der aus Schacht 3 lebend zu Tage kam. Ja, und noch mehr soll er erzählt haben: am Mittwoch Morgen – das ist gestern – sei eine zweite Explosion erfolgt, durch welche Mauerwerk zerstört und Schienen losgerissen wurden. Es habe Funkenzündung aus der Oberleitung der Maschine vorgelegen …
»Wenn das Wahrheit ist,« sagt neben mir ein Mann, »war Gas genug vorhanden, um die Bude in die Luft zu sprengen.«
Ich frage mich: Warum hat man dann noch gefördert?
Wie zur Antwort grollt eine Stimme aus dem Haufen:
»Wenn nur die Kohle raus ist, der Bergmann kann drinbleiben!«
Die Menge brandet an das Zechentor, Schupo müht sich, sie abzudrängen. Es ist ein Augenblick, der Furchtbares gebären kann! Doch siegt Vernunft. Ist nicht genug der Opfer, deren Namen jammernd in die Nacht gerufen werden?
Vorn am Gitter lehnt die junge Frau. Das Umschlagtuch ist ihr herabgeglitten. Ich sehe, daß sie schwanger ist! Schluchzend streckt sie die Arme aus:
»Mein Mann, mein Mann …«
Am Pfosten neben ihr ein grauhaariger Alter, fast ein Greis. Sein Mund zuckt, stammelt:
»Weiß niemand was von meinen Jungens?«
Er hat zwei Söhne bei der Mittagsschicht.
Krampfhaft weinend steht ein halbwüchsiges Mädchen da, schreit auf, schlägt um sich und muß fortgetragen werden:
Vater und Bruder sind nicht heimgekehrt.
Das Mütterchen, das in der Eile einen Wollschal überwarf, auf dessen violettem Grunde Rosen leuchten, fragt tränenlos, versteint:
»Mein Sohn?«
Dreimal sah ich sie im Lauf des Tages wiederkommen, dreimal hörte ich dieselben kurzen Worte:
»Mein Sohn?«
Niemand antwortet. Es ist Befehl ergangen, Zahl und Namen der Verunglückten nicht anzugeben! Feuerwehrleute, die am Tor die Wache halten, üben schwere Pflicht. Denn unabsehbar wächst das Heer der Angehörigen, schwillt Weinen, Schluchzen an zu lauter Klage.
Gingen alle wohl in Frieden auseinander?
Fiel kein hartes Wort zum Abschied?
Ein Spruch, den ich vor kurzem erst in einer Bergmannswohnung fand, wird mir lebendig:
»Geh nie im Zorn von deines Hauses Herd!
So mancher ging, der niemals wiederkehrt …«
Denn dieses scheint um sechs Uhr morgens schreckliche Gewißheit: mit Lebenden darf kaum mehr gerechnet werden! Außer den acht Geretteten – einer soll beim Transport gestorben sein – barg man an Leichen sechsunddreißig. Die Markenkontrolle zählt dreiundneunzig Vermißte. Das gäbe hundertdreißig Tote!
Wird diese Zahl sich noch erhöhen?
Aus der Nacht des Grausens steigt ein Tag des Jammers. Mond und Sterne haben ihr Antlitz verhüllt. Fahl bricht die Dämmerung an. Vom Förderturm über Schacht 3 weht halbmast eine schwarze Fahne.
Und nun erlebe ich, was mir in meiner letzten Stunde noch vor Augen stehen wird: bleich, gelblich, rußgeschwärzt, in ihren hellen Anzügen gespenstisch wirkend, fahren die Rettungsmannschaften aus! So, wie sie gestern von der Mittagsschicht gekommen, mit Schmutz und Schweiß bedeckt, sind sie, als die Sirenen heulten, auf die Lastautos gestiegen, um ihre eingeschlossenen Kameraden zu befreien. Von Gas betäubt, zum Tode matt, schwanken sie über den Zechenplatz. Ihre Grubenlampen sind fast am Erlöschen.
Ich habe viel gesehen in jener Nacht und bin hart geblieben. Dies wirft mich um! Tränen stürzen mir – ich kann, mag es nicht hindern – über das Gesicht.
»Oh, die braven Kerle!«
Wagen auf Wagen braust durchs Zechentor: Ablösung naht für die Erschöpften. Auch die Hibernia-Mannschaft ist dabei, die in Courrières zu Weltruf kam.
Ein riesenhafter Kumpel springt als erster ab:
»Wo kriegen wir die Lampen?«
Hundert Hände weisen ihm den Weg:
»Rechts, oben in der Lampenstube!«
In wenigen Sekunden ist er wieder unten, Gruppen von je acht Mann formieren sich. Sauerstoffapparate auf dem Rücken, gehn sie zur Hängebank und fahren ein. Die Grubenlampen brennen hell im Grau des Tages.
Ruhm den Tapferen, ewiger Ruhm!
Vor der Waschkaue sammeln sich die Abgelösten. Nicht alle kamen ohne Hilfe aus dem Förderkorb. Drei haben Gas geschluckt und müssen zum Verbandszimmer getragen werden. Behutsam fassen Sanitäter zu. Ein Arzt sucht mit dem Pullmotor die schwere Ohnmacht zu beheben.
Inzwischen lassen sich die übrigen auf Bänken nieder, manche schlafen augenblicklich ein. In großen Waschkesseln wird Kaffee auf den Zechenplatz gebracht. Langsam erholen sich die Leute, trinken und beginnen stockend zu erzählen:
Zwei Steigerreviere sind von der Explosion betroffen worden, die Strecken auf der ersten, zweiten, dritten Sohle durch Brüche gesperrt. Diese Brüche galt es zu durcharbeiten, um an die Eingeschlossenen heranzukommen. Giftige Gase hinderten das Rettungswerk, das unter Einsetzung des Lebens Schritt für Schritt geschah. Das kunstvolle System von Querschlägen, von blinden Schächten, Rutschen, Wetterführungen ein wüstes Chaos! Holzstempel weggefegt, Eisenbahnschienen durchgeknickt wie Strohhalme. Halbmeterdicke Mauern waren glatt durchschlagen, Kohlenwagen an fünfhundert Meter weit geschleudert. Berge mußten überklettert, an Seilen Retter wie zu Rettende herabgelassen werden!
Und die Toten?
Wohl denen – furchtbar ist es auszusprechen –, die von der anrasenden Stichflamme erfaßt, verbrannt, getötet wurden, ehe sie es denken konnten. Wohl denen auch, die plötzlich ungeheurer Luftdruck traf und am Gestein zerschmetterte. Sie starben einen blitzartigen Tod. Mit Grausen aber höre ich, was selbst den Kumpels schwer ankommt zu sagen: viele haben nach der Explosion gelebt!!
Gelebt?
Nur wer die Luft des Bergwerks atmete, kann ganz ermessen, welch eine Qual dies Wort umschließt: Warten auf Hilfe, die nicht kommt, Erstickungstod, bewußtes Sterben!!!
An einer Rutsche stand mit Kreideschrift:
»Es ist jetzt 10.30 Uhr. Wir sind hier 17 Mann. Zwei haben abgebaut. Es bleiben nur noch 15. Karl Ott.«
Eine zweite Aufschrift lautete:
»Jetzt ist es 11 Uhr. Wir wissen keinen Ausweg mehr.«
Eine dritte:
»Es ist 11 Uhr …«
Dann kam das Ende, langsamer Tod im Dunkeln. Woran haben sie zuletzt gedacht?
Der Bergmann Ott, der jene Aufzeichnungen hinterließ, hat Frau und Kinder! Scheu sucht mein Blick die Menge vor dem Zechentor. Der Bleistift zittert in meiner Hand. Ich fühle mich alt werden …
Gegen Mittag liegen achtzig Leichen in der neuen Waschkaue. Man fand sie haufenweis und einzeln, in Querschlägen, wohin die nach der Explosion noch Lebenden geflüchtet waren, in Rutschen, zwischen Wagentrümmern und Gesteinsmassen: die Knie an den Leib gezogen, Arme krampfhaft vorgestreckt, als hätten sie die Augen schützen sollen, Finger tief in das Gesicht gebohrt, verkohlt, zerschmettert und verstümmelt. Mehrere hingen an den Firsten, erstarrt im Klimmzug, den sie wohl gemacht hatten, um den letzten Rest der Luft zu atmen. Einer biß sich im Todeskampf an einer Eisenschiene fest!
So, wie sie aus der Grube kamen, hat man in Reihen sie auf Stroh gebettet. Manche schlafen friedlich still: sie sind den Nachschwaden erlegen. Andre Gesichter sind so schwarz verbrannt, daß ein Erkennen kaum noch möglich scheint. Dort, wo die Körper identifiziert, sind an den Kleiderfetzen Zettel angebracht, die Namen und die Markennummer tragen. Schwarz ist das Leichentuch, darunter schwarz die Knappen liegen. Grubenlampen brennen hier als Totenlichter …
Nachmittags ruht die Förderung eine Weile: die Strecken sind oft hundert Meter weit zu Bruch gegangen! Transportarbeiter werden aufgerufen, Freiwillige aus der Masse melden sich. Der riesenhafte Kumpel von der Rettungsmannschaft prüft jeden einzelnen, bemerkt dann kurz:
»Marke nehmen und anfahren!«
Auf dem Zechenplatz, steht eine Uhr. Auch sie wird mir in meiner letzten Stunde gegenwärtig sein: das nüchtern weiße Zifferblatt, der schwarze Zeiger, der, unerbittlich vorrückend, Nahen des Todes kündete! Alles starrt auf den Förderturm, wo fünf Minuten vor dreiviertel fünf der Anschlag tönt. Langsam drehen sich die Förderräder, halten still. Man hört das Abziehen der Kohlenwagen, Sanitäter laufen zu der Eisentür des Schachts. Zwei Leichen werden gleich darauf vorbeigetragen. Die Kohlenwagen, die sie gestern noch gefüllt, sind heute ihre Totenwagen auf der Fahrt zu Tage.
Die Abendsonne scheint zu furchtbarer Parade.
Mein Notizbuch zählt:
Um fünf Uhr: drei Leichen, davon eine verkohlt.
Fünf Uhr fünfzehn Minuten: zwei Leichen, eine verkohlt.
Fünf Uhr zwanzig Minuten: zwei verkohlte Leichen …
So geht es fort!
Aus der Menge steigt ein tiefes Seufzen.
Mich friert.
Schlag sechs Uhr stürzt ein junger Mann mit einem weißen Bogen aus dem Zechentor und heftet ihn an den Stamm einer Akazie. Ich lese, was mit großen Buchstaben der Blaustift schrieb:
»Die Nachricht von dem schweren Unglück auf der Zeche ›Minister Stein‹ hat mich tief erschüttert. Ich bitte den Hinterbliebenen der an ihrer Arbeitsstätte getöteten Bergleute die Versicherung meiner herzlichen Anteilnahme auszusprechen, auch der Direktion der Gelsenkirchener Bergwerks-Aktiengesellschaft und den Bergarbeiterverbänden mein Beileid zu übermitteln. Als Beitrag zur Verhinderung von Notständen in den betroffenen Bergarbeiterfamilien habe ich aus meinem Dispositionsfonds den Betrag von 50+000 Mark überwiesen.
Reichspräsident Ebert.«
Am Torpfosten bemerke ich noch einen zweiten Anschlag, der mit geschäftlicher Maschinenschrift geschrieben ist: morgen um zehn Uhr sollen sich die Angehörigen auf der Zeche melden!
Ich denke an die Leichen in der neuen Waschkaue.
Wird die junge Frau den Anblick ihres Mannes ertragen können?
Was wird der grauhaarige Alte sagen, wenn er seine Jungens sieht?
Das halbwüchsige Mädchen, wird es Vater und Bruder wiederfinden?
Ob das Mütterchen den Sohn erkennen wird?
Langsam gehe ich den Weg, den ich die Nacht zuvor gekommen bin, schaue noch einmal hinter mich. Bedeckt von Menschen, wie bei einer Prozession, zieht sich die Straße schwarz zur Hochfläche, auf der ein großer Schornstein düster ragt:
Hundertsechsunddreißig haben ihr Gezähe niedergelegt.
Ein Volk rüstet sich zur Totenfeier.
Auf dem Hauptbahnhof, dem ich im Morgendunkel zustrebe, Bergknappen in Paradetracht: Jacken aus schwarzem Tuch, mit goldenen Tressen, blanken Knöpfen. Vom Schachthut wehen Hahnenfederbüsche. Darunter blitzen die Embleme der verschiedenen Zechen.
Zug nach Zug rollt überfüllt hinaus, auf den Stationen steht die Menge Kopf an Kopf. Zylinder, Trauerhüte, Kreppschleier. Verhüllte Fahnen, Kranzdeputationen: Westfalenland ist unterwegs!
Die Halle auf dem Bahnhof Dortmund scheint ein Blumengarten, so häuft sich Kranz auf Kranz hier an. Weißer Flieder duftet zwischen roten Rosen, Tulpen öffnen ihre gelben Kelche. Frühling kam über Nacht, der Frühling des Todes.
Im Licht des Tages brennen schwarz umflort die Bogenlampen und Laternen: ein Bild von düsterer Großartigkeit! Alle Flaggen stehen auf halbmast, die Schaufenster, soweit sie ihre Läden nicht herabgelassen, zeigen Trauerschmuck. Der Ärmste hing ein schwarzes Fähnchen aus. Oft schaukeln Grubenlampen vor den Häusern.
Entlang an sich formierenden Vereinen – man rechnet fünfundzwanzigtausend Menschen auf den Zug – fahre ich zum Zentralfriedhof. Die Stadt bleibt hinter mir in blauem Rauch. Bepflanzt mit Doppelreihen junger Bäume, ragt der Westfalendamm, so breit als hoch, über der Landschaft. Der Tag scheint klar zu werden, Sonne bricht hervor. Schupo zu Pferde fordert Legitimationen.
Langsam füllt sich der Ehrenhof vor der Haupttrauerhalle. Schwarze Wimpel flattern seitlich der Estrade. Aus gelbem Ruhrsandstein springt, von Figuren eingerahmt, die Kanzel. Darunter sind im Halbkreis Bänke aufgestellt, die von dem Heer der Angehörigen eingenommen werden.
Wieder tritt die Nacht des Grausens vor mein Antlitz. Da wankt die junge Frau, diesmal von Verwandten vorsichtig gestützt. Sie trägt das schwere, blonde Haar als eine Last. Den Alten sehe ich in einer Schar von Männern, deren Stirnen kohlennarbig sind. Schmächtig, in großem Trauerhut, erblicke ich das halbwüchsige Mädchen. Das Mütterchen hat seinen bunten Wollschal abgelegt. Ein schwarzes Tuch umhüllt die kleingewordene Gestalt.
Glockengeläut rauscht dunkel über die Versammlung. Vom hochgeschütteten Westfalendamm trägt feuchter Wind Bruchstücke von Chorälen her. Die Luft ist geisterhaft belebt. Beethoven tönt As-dur, von Bläsern feierlich geblasen: Adagio aus der »Pathétique«!
In diesem Augenblick – Sonne steht zwischen Regenwolken über den Flambeaus, die düster rot von dem Portal des Ehrenhofes flackern – erscheint der Fahnenzug im Torbogen: alte Standarten, Schützenbanner, aus schwerer, goldgestickter Seide, purpurn und tief grün, leuchtend blau und weiß.
Unabsehbar defilieren die Verbände, an der Estrade Kränze niederlegend. Es ist, als ob ein Volk begraben würde, die Welt sich aufgemacht hätte, den Toten das Geleit zu geben!
Männergesang verklingt, auf die Kanzel tritt der Bischof. Er spricht, vom schwarzen Flor der Draperie umweht, kräftig, volkstümlich, über den ganzen Platz vernehmbar:
»Hundertsechsunddreißig brave Bergknappen sind vor einigen Tagen durch einen gräßlichen Tod mitten aus der Vollkraft des Lebens gerissen worden. Draußen, in den Anlagen des Schachtes, sind sie aufgebahrt, wie im Leben, so auch im Tode vereinigt! Wer kann das Jammern der schwer heimgesuchten Angehörigen, der Väter und Mütter, der Witwen und Waisen, der Brüder und Schwestern anhören, wer die lange Reihe der Särge überschauen, ohne aufs tiefste erschüttert zu werden?
»Grubenunfälle gehören zu den Vorkommnissen, deren Wirkungen verheerend sind. Eine Katastrophe aber, wie wir sie auf ›Minister Stein‹ erlebt haben, ist, wenn wir absehen von dem Unglück auf der Zeche ›Radbod‹, in der Geschichte des westfälischen Bergbaues nicht zu verzeichnen. Gebe Gott in seiner großen Güte, daß sich ähnliche Ereignisse nicht wiederholen!
»Abermals hat sich der Ausspruch bestätigt, daß der Bergmann täglich sein Totenhemd anzieht. Der Anblick der vielen Särge ruft uns ein Wort in den Sinn, wonach Bergmannslos kein einfaches Los ist, sondern ein Los des Massensterbens. Es muß Vorsorge getroffen werden – des Bischofs Stimme hallt wie eine Glocke –, daß solche Unfälle sich nicht mehr wiederholen und so viel Menschen in der Blüte ihrer Jugend, ihrer Manneskraft dahingerafft werden …«
Ein Beben geht durch den Fahnenwald, die Menge weint auf.
Unsichtbar spielt auf dem Westfalendamm ein Bläserchor:
»Ach bleib mit deiner Gnade
Bei uns, Herr Jesu Christ …«
Der Bischof fährt fort:
»Hier ist erzählt worden, daß einer von den Rettungsmannschaften bei der Bergungsarbeit sein Leben eingebüßt habe. Diesem braven Mann sei von dieser Stelle ein ganz besonderes Ave geweiht! Ich möchte aber auch als Bischof laut und feierlich dem Wunsche Ausdruck geben, daß es der tatkräftigen Mitwirkung der Staatsbehörden gelingen möge, im Verein mit der Wirtschaft eine gerechte soziale Gesetzgebung herbeizuführen!
»Soll diese Totenfeier eine nachhaltige Wirkung üben, dann darf sie nicht nur ein Schaustück der Neugier, nicht nur eine Trauerparade sein: sie muß eine Seele haben von innerlich leuchtender Kraft! Die toten Knappen rufen uns die Mahnung zu: ›Horchet auf und nehmt es ernst mit eurem Leben, denn es ist ein überaus kostbares Gut!‹ In gegenseitigem Verständnis müssen wir die Volksgemeinschaft aufbauen. Wir müssen dabei aber auch das Seelische beachten, denn der Herr kommt wie ein Dieb in der Nacht, und müssen sorgen, daß wir vorbereitet sind.
»Mit aller Zuversicht dürfen wir hoffen, daß die Verstorbenen einen gnädigen Richter gefunden und ihr höchstes Ziel erreicht haben. Das ist für uns der beste Trost, insbesondere für euch, liebe Leidtragende, die ihr so viel verloren habt! Die Lücke, welche die Toten gerissen, wird lange Zeit unschließbar sein. Aber ich hoffe zu Gott, daß bald der Tag kommt, wo ihr in Geduld sprechen könnt: ›Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gebenedeiet!‹
»Nun wollen wir Abschied nehmen von den Toten. Wir danken ihnen für alles, was sie für uns getan! Gott der Herr gebe ihnen das ewige Leben …«
Wieder geht ein Rauschen durch den Fahnenwald, wieder schluchzt die Menge auf. Der Bischof verläßt die Kanzel. An seine Stelle tritt der Generalsuperintendent, der von den Sprechern der Behörden abgelöst wird: Deutschland neigt sich vor den gefallenen Knappen!
Großartig, überwältigend ist die Ehrung hier durch Reich und Volk. Und doch, mich zieht es nach der kleinen Straße, die an Schacht 3 vorüberführt, zu den Akazien, deren Dornen Witwen und Waisen nun als Krone tragen, zur neuen Waschkaue, in der die langen Reihen eichener Särge aufgestellt: Bergmannsbegräbnis nimmt, nach altem Brauch, schlicht von der Zeche seinen Ausgang.
Dort oben ist es still. Nach Regenschauern glänzt die Kolonie im Sonnenlicht. Kein Haus, das nicht einen oder zwei seiner Bewohner in der Waschkaue liegen hätte! Schweigend und schmerzgebeugt versammeln sich die Angehörigen. Unter der Hängebank hervor kommt durch das Zechentor, das eine Girlande schwarz umflorter Grubenlampen überspannt, der Leichenzug.
Schwer ziehen die Pferde an den Rollwagen, auf denen je vier oder fünf Särge stehn. Vom Kopfende der Särge leuchten Rosensträuße. Ein Wunder scheint die Rosen von dem Schal des Mütterchens vertausendfacht und über diese Toten ausgestreut zu haben!
Der erste Wagen rollt vorbei, wir nehmen die Hüte ab.
»Zum letzten Male fährst du an
Und fährst nicht mehr herauf,
Drum grüßt dich auf der dunkeln Bahn
Ein inniges Glückauf!«
Männer murmeln es mit nassen Augen, »Glückauf!« weint über uns der Regenwind, »Glückauf zur letzten Fahrt!« flimmert ein Transparent vom Giebel eines zweistöckigen Hauses.
An der Straßenkreuzung harren die Vereine, in deren Mitte sich die Leichenwagen einreihen. Es ist drei Uhr. Von allen Türmen läuten jetzt die Glocken. Mit Trommelschlag, geführt vom düsteren As-moll des Beethovenschen Trauermarsches, setzt sich der Zug der Fünfundzwanzigtausend in Bewegung.
Voran Schupo auf braunen Pferden, dann die Belegschaft von »Minister Stein«, mit dem Musikkorps an der Spitze. Gleich roten Tulpen stehn die Federbüsche auf den Schachthüten. Verband folgt auf Verband, Fahne auf Fahne, Kranz auf Kranz. Mit blau-weiß-roten Schärpen kommen die Vertreter von Courrières. England, Italien, Belgien und Österreich weisen ihre Farben.
Wer ging in einem Zug von fast zwei Stunden Länge?
Wer trauerte an hundertsechsunddreißig Särgen?
Wer sah fünfhundert Fahnen sich im Winde bauschen?
Wer hörte fünfundzwanzig Bläserchöre blasen?
Zahlen können nicht den Eindruck wiedergeben:
Es ist ein ungeheures Sterben, das sich nun vollendet!
Kommando schallt, die Fahnenträger schwenken ein und stellen sich seitlich der Straße auf. Langsam nähern sich die Sargwagen. Sanitäter schreiten rechts und links. Die erste Fahne neigt sich, küßt die Särge, dann eine zweite, dritte, vierte. Dumpfer Trommelwirbel tönt:
Die toten Knappen nehmen die Parade ab.
Hinter den Särgen wallt das Heer der Angehörigen. Noch einmal sehe ich die junge Frau: wegmüde, schmerzverlorenen Blicks. Der Alte stapft mit schweren Schritten vorwärts, das halbwüchsige Mädchen muß getragen werden. Einsam geht am Schluß das Mütterchen.
Sind nicht alle, die hier starben, einer Mutter Sohn?
In großer Schleife senkt die Straße sich zum Friedhof. Ein Regenbogen wölbt sein buntes Tor, durch das der Leichenzug zu Tale zieht. Berittene Schupo salutiert. Die Bläser blasen »Ases Tod«.
Ich bin am Rand der Hochfläche zurückgeblieben, Musik verweht in klagendem H-moll. Ein Lied steigt tröstend aus der Tiefe auf und schwillt zum Purpursaum der Wolken:
»Wie sie so sanft ruhn, alle die Seligen,
Von ihrer Arbeit, die sie in Gott getan,
Und ihre Werke folgen ihnen
Nach, in des ewigen Friedens Hütten …«
Das Feld, das dunkel lag, wird plötzlich hell: Hunderttausend entblößen ihre Häupter.
Unten tragen sie die Särge in das Massengrab.
Die Landschaft träumt in blauem Violett, Schatten des Abends ziehn herauf, der Wind schläft ein.
Noch glühen Fahnenspitzen in der Sonne.
Hörner blasen: