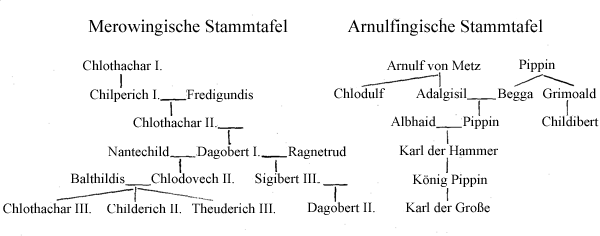|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Einige Wochen darauf saßen Vanning, Hermengar und dessen Söhne in der Halle des Palatiums zu Paris beim Abendtrunk beisammen: es war zugleich ein Abschiedstrunk: denn am folgenden Morgen sollten die vier Gäste des Majordomus in wichtigen Sendungen ausziehen. Er ward noch erwartet mit Weisungen, die er ihnen mündlich und schriftlich mitgeben wollte.
Ungern ließ der treue Vanning ihn allein: er wußte daß er sich ungezählte Feinde gemacht hatte, die ihm – mit Unrecht oder Recht – Haß trugen: und in jenen Tagen war der Haß nie weit entfernt vom Mord. Dazu kam, daß der Freund beklagte, den Gewaltigen nun nicht wie bisher von mancher allzuraschen, allzuharten Handlung abhalten zu können. Er sprach darüber offen zu Hermengar.
»Seit die Heilige den Hof mit dem Kloster vertauscht hat, ist sein guter Engel von ihm gewichen,« klagte er. »Aber du standest ihm auch jetzt – ein treuer Warner – zur Seite.« – »Ach, meine beste Rede wirkt nicht wie ein Blick aus ihren sanften Augen that. Konnt' ich es verhindern, daß er all' diese Zeit her, seit seinem Sieg, furchtbar streng und blutig – alle fünfzehn hat er hingerichtet! – bis an die äußerste Grenze gerechter, aber schärfster Strafe – und wohl auch darüber hinaus! – die Herrschaft geübt hat in Neuster und Burgund?«
Bei diesen Worten trat der Majordomus ein. Er hatte sich stark verändert in diesen Monaten: seine Züge hatten eine Schärfe, sein Blick ein finster Drohendes angenommen, das früher fehlte: wieder noch tiefer hatte sich die Stirnfalte zwischen den Augen eingefurcht, herber waren die bärtigen Lippen geschlossen. Nach kurzem Gruß ließ er sich neben seinen Gästen nieder, mehrere gesiegelte und offene Schreiben auf den Schenktisch werfend.
»Ihr reitet morgen bei Tagesanbruch! Euer Werk eilt. Drum wollt' ich euch heut' abend noch Winke geben, die ich der Schrift nicht anvertrauen mag. – Ich habe in diesen Monaten im Innern des Reiches viel Arbeit gethan, harte Arbeit.« »Ja, harte für dich . . . und für andere,« sprach Vanning, »blutige.« Ebroin furchte die Stirn: »Mit Honig, Freund, leimt man nicht den zerbrochenen Staat. – Nun aber fliegt mein Blick über unsre Grenzen hinaus: nun gilt es, zu erwahren, ob ich das Recht dazu hatte, die Macht in diesem Halbreich an mich zu reißen – mit eiserner Faust –: die Probe liegt darin, ob ich die zerstückten Fetzen des einstigen Gesamtreichs wieder zu einem Ganzen machen kann. Das ist's, was ich schon vor Jahren mit Pippin erörtert habe und mit jenem Schurken:« – hier funkelte sein Auge – »die Unterwerfung Austrasiens unter den neustrischen Königsstab.« »Die Austrasier freilich,« wandte Vanning ein, »sind recht andrer Meinung.« »Jawohl,« rief Ebroin lachend. »Ein Auerstier wie dieser Martinus, der will überhaupt von uns ›Weichlingen‹ nichts wissen: – Weichling ist ihm jeder, der lesen und schreiben und – denken kann und sich nicht jede Nacht in Met oder Bier – wie schauderhaft! – bezecht.« »Aber Pippin, der . . .,« meinte Hermenfred. »Der will freilich, was ich will,« sprach Ebroin ernst, »aber umgekehrt: wohl ein einzig Reich, aber Austrasien soll uns unterwerfen. Die Gedanken fliegen ihm hoch: – allzuhoch. Man muß dem Arnulfingen-Aar die Schwingen knicken. Es darf kein König herrschen mehr in Metz neben dem in Paris.«
»Das heißt: neben dem Majordomus in Paris,« lächelte Vanning.
»Und dies große Werk vorzubereiten,« fuhr Ebroin mit leuchtenden Augen fort, »dazu hab' ich euch ersehen: – deshalb sollt ihr morgen reiten. Die Arbeit ist leichter als sie aussieht! Ich habe seit langer Zeit meine Späher, meine geheimen Anhänger da drüben: so bin ich über die Leute und die Dinge an Mosel und Rhein und Main und Lahn und Donau und Inn nicht gar viel schlechter unterrichtet als über die an Seine und Loire. Ich weiß gewiß, der starke Einfluß Pippins ist andern mächtigen Adelsgeschlechtern der Uferfranken keineswegs wohlgefällig; ich weiß, der aus der Fremde plötzlich herbeigeholte junge König ist gar vielen dieser stolzen Häuser, die selbst nach dem Throne trachteten, höchst unerwünscht gekommen. So könnte's vielleicht nicht schwer sein, den mönchischen Knaben da drüben so einzuschüchtern, daß er freiwillig seinem neustrischen Vetter zu Paris auch den Königstuhl zu Metz räumt und froh ist, in den Frieden seiner heiligen Insel zurückzufliehen. Wollen ihn aber die Arnulfingen, die ihn erhoben, darauf erhalten, – wohlan, so laßt uns dieses unbequem emporstrebende Geschlecht samt seinem Schützling hinwegfegen durch Gewalt der Waffen.« »Seit zwanzig Jahren kriegserfahren und sieggekrönt darfst du dir das ohne Überhebung zutrauen,« sprach Hermengar. »Wohl,« meinte Vanning, »aber diese Ostleute, zumal die Überrheiner, sind bärenhaft tapfer und auch volkreich . . .« »Gewiß,« nickte Ebroin, »deshalb muß die Staatskunst dem Angriff der Kriegskunst vorarbeiten, wie unsre Ahnen sich etwa in ihrem Wotan den listigen Planer und den stürmischen Helden vereint dachten: – der war gar nicht übel! Könnt' ich nur an ihn glauben, ich hätte mich längst mit meinem Blut ihm zum Wahlsohn geweiht! – Man muß die Macht der Austrasier im Innern schwächen, teilen, zersplittern, bevor der hitzige, heißblütige Anfall der Unsern sie trifft. Hört mich zu Ende. Längst haben sich, in der Zeit der Schwäche und des innern Haders der Könige zu Paris und Metz, jene Stämme östlich des Rheins vom Reiche gelöst, die früher den Merowingen gehorcht hatten: die Thüringe an der Unstrut, die Alamannen am Neckar, die Bajuvaren an der Donau: ihre Herzoge grollen Pippin, weil der – wie freilich seine Pflicht! – sie wieder heranzuzwingen trachtet. Leicht sind sie zu gewinnen, in derselben Zeit von Norden, von Südwesten und von Südosten her in Austrasien einzudringen, während wir von Westen her auf den Rhein, den Main, die Lahn stoßen. Auch die Friesen und Sachsen, geärgert durch die Priester, die unablässig von Austrasien aus in ihre Gaue wandern und ihnen die alten Götter nehmen wollen, wie die austrasischen Grafen die alte Freiheit, kann man Pippin von Norden und Nordwesten her auf den Nacken hetzen, daß er zu thun bekommt an allen Ecken.«
»Du bist ein Feldherr, wahrlich!« rief der junge Hermenfred begeistert.
»Dann können,« meinte Hermenvech, »die Austrasier, von allen Seiten angegriffen, uns nur dünne Reihen entgegenführen: bei meinem Schwert, die renn' ich über den Haufen!« »Aber,« wandte der fromme Hermengar ein, das Haupt schüttelnd, »Sachsen und Friesen: – das sind arge Heiden! Mit diesen willst du gegen gute Christen dich verbünden?« »Mit dem Dämon der Hölle, lieber Herzog, wenn's zum Siege führt,« lachte Ebroin. »Leider ist er ein Wahn, wie Wotan: sonst hätt' ich ihn schon in der Haft zu Luxeuil zu Hilfe beschworen.« Hermengar schlug ein Kreuz über die Brünne und warf den Söhnen mißbilligende Blicke zu, »Jedoch,« wandte Vanning bedächtig ein, »erwäge, was du thust. Du willst das ganze Frankenreich, wie es vor etwa sechzig Jahren bestand, in seiner Macht, in seinem Umfang wieder herstellen . . .« »Das werd' ich! Oder drüber fallen,« rief Ebroin und stieß die Fingerknöchel der geballten Faust auf den Tisch. »Und fängst damit an, jene Herzoge der Thüringe, Alamannen, Bajuvaren, die uns damals dienten, noch mächtiger werden zu lassen?« »Ja,« rief Ebroin und überlegener Geist sprühte aus den blitzenden Augen, »damit fang' ich an, aber damit end' ich nicht. Laß doch diese drei Barbarenstämme, uns zu entlasten, einen Plünderzug bis an den Main machen: was schadet's viel? Sobald ich zu Metz herrsche wie zu Paris und Orleans, falle ich mit dem Heerbann der drei Reiche über die überraschten, niemals einigen, plumpen, schwerfälligen Waldleute her und unterwerfe die Gaue. – Und ihre drei Herzoge und Herzogsgeschlechter? In drei Klöster mit ihnen! Wozu sind die vielen Klöster da? Es soll kein Fürst mehr in der Mitte stehen zwischen dem Frankenkönig und jenen Stämmen.« »Ebroin, du bist . . .« rief Hermenvech. »Eben Ebroin, unser aller Meister,« sprach Vanning und faßte seine Hand. »Und doch ein so freudloser Mann!« raunte der ihm leise zu. – – »Hier nun eure Vollmachten und Briefe. Du, Hermengar, gehst mir zu dem Baier Theodo, dem Agilolfing, zu Regensburg, zu dem Stolzesten der Vornehmste. Du, Vanning zu dem Alamannen Gotfrid in Augsburg, ihr beiden Hermengaringe zu dem Thüring Radwin, Radulfs Sohn, in seiner Holzburg an der Unstrut; zu den Sachsen und Friesen schick' ich ein paar ihrer heidnischen Seeräuberhäuptlinge, die ich vor kurzem in ihren Raubschiffen auf der Schelde gefangen: ich gebe ihnen die Freiheit, – wie gut nun, daß ich sie nicht gleich henkte, wie ich vorhatte, an den Rahen ihrer Masten! – reiche Geschenke und die Aufforderung an ihre Stammesgenossen mit, auf meinen Wink zu Wasser und zu Land bis Utrecht und Köln raubfrohe Heerfahrt zu thun: Pippin, den sie fürchten, werde alsdann ganz wo anders zu schaffen haben! Was meint ihr wohl, ob diese Wilden sich's zweimal sagen lassen?« »Schad' um die Kirchen dort zu Lande,« seufzte Hermengar. »Bah,« lachte Ebroin, »die Mönche haben ihnen auch viele Tempel und Haine verbrannt. Das hebt sich. Und übrigens von Metz aus werd' ich den Raubfahrern gar bald die Wege verbauen: – nicht mit Kirchen und Klöstern! – mit festen Markwehren und Grenzburgen.« »Aber,« mahnte Vanning, »die minder wichtigen Aufgaben hast du verteilt, wen aber sendest du . . .?« »Jawohl,« fragte der Herzog, »an König Dagobert?« »Das,« antwortete der Majordomus, indem er lächelnd seinen Bart strich und sich erhob, »das ist mein Geheimnis. Hei, keiner von euch würde mir dazu taugen.« Aber das Lächeln war nicht schön und unheimlich glänzten dabei die grauen Augen.
Während die vier Gäste sich, des frühen Aufbruchs am folgenden Morgen gedenk, zur Ruhe begaben, schritt Ebroin noch lange sinnend in seinem Schreibgemach auf und nieder.
Oberhalb des Tisches, auf dem alte römische Straßenkarten von Gallia, Belgien und Germania, Pergamente und Papyrosrollen gehäuft lagen, befand sich an der Wand, an einer Schnur aufgehangen und jetzt von einer Schwebe-Ampel mit sanftem Lichte bestrahlt, ein längliches Mosaik: es stellte eine Heilige dar, Sankta Lintrudis, und der Künstler, ungeschickt und ungefüg im übrigen, hatte Eine Wirkung voll erzielt: er hatte seiner Heiligen die Züge Balthildens geben wollen und das war ihm trefflich gelungen. Der Majordomus hatte das Bild dem Kloster der Heiligen zu Châlons-sur-Marne teuer abgetauscht: seine reiche Villa Latiniacum im Gau von Embrun – mit hundert Knechten und Mägden – hatte er dafür gegeben.
Vor diesem Bilde machte er jetzt in seinem unsteten Hin- und Herschreiten Halt: schmerzlich war der Ausdruck der sonst so adlerhaft blickenden Augen, wie er sinnend hinaufsah und seufzend sprach: »Schöne Heilige, leblose, fühllose, steinerne! So wenig wie dies Steinbild ahnst du, Urbild im fernen Kloster, wie soviel von allem, was ich litt und leide, was ich that und thue und plane, nur um dich, für dich gelitten und gethan ist. Ist es doch dein Sohn, den ich zum mächtigsten Herrscher des Abendlandes machen will. Für dich – um dich hab' ich das erste Verbrechen begangen, das erste Blut frevelhaft vergossen. Dein Bild hat mir tröstend vorgeschwebt, ein heller Stern, als alle meine andern Sterne erloschen schienen in finstrer Nacht, bei dem herzverbrennenden, herzkränkenden, herzabstoßenden Abfall meiner Bauern, in der verzehrenden Pein meiner Klosterhaft. Dein Bild begeistert mich in heißer Schlacht und reißt mich durch Schwerter und Speere zum Sieg dahin: – zu deines Namens Ehre thu' ich des Guten viel: – und auch wohl manches, was du nicht billigen würdest. – Sie und des Reiches Heil sind mir in Eins verschmolzen. Und dabei ist mir dies schöne Weib so fern gerückt, als lebte es auf dem Monde. Nicht durch Kloster, Schleier und Gelübde ist sie von mir getrennt: – hei, jauchzend durchbräche ich sie alle drei und zerdrückte das holde Geschöpf mit heiß lodernder Glut in diesen Armen! Nein! Durch ihre liebeleere Kälte. Ah, nie hat sie geliebt! Auch nicht ihren elenden Gatten. Sie kann gar nicht lieben! Sie ist von Stein, wie dies Gebild. Ah, hätte sie je geliebt, liebte sie einen Sterblichen, ich riß' ihm vor Heißwut das zuckende Herz aus der Brust. Aber das ist mein einziger, – mein armer! – Trost: sie liebt keinen Mann auf Erden, nur ihren geträumten Gott im Himmel!«
Da ward er aus seinem Sinnen geweckt durch leises Pochen an einer geheimen Thür, die unmerkbar in das Marmorgetäfel der Wand eingefügt war: dreimal in zwei gleichen Zwischenräumen, ward das Klopfen hörbar.
»Ja, ja,« sprach der Einsame, »das ist die Welt, die mich ruft – aus dem Himmel. Die Welt? Die Erde? . . . Vielleicht noch Tieferes, Finstreres, Ärgeres. Verhülle dein Antlitz, Heilige.«
Er trat dicht an die Thür und drückte auf einen dunklen Stein in dem Marmor: geräuschlos sprang die schmale Pforte nach innen auf und herein schlich auf den Zehen eine dunkle, riesenhohe Gestalt: – dunkel war die schlichte, bäuerische Kleidung, dunkel Haar und Haut und Bart und die seltsam funkelnden Augen: er bückte den Kopf tiefer als bei Freien üblich, ja er wollte sich auf die Knie werfen. Unwillig hemmte ihn Ebroin: »Du hast noch immer das Wesen eines Knechts an dir, Gallus! Warst doch frei geboren! Und bist wieder frei.«
»Sie währte lange, Herr, die Unfreiheit, die Schuldknechtschaft. Und der Vogt des Herrn Patricius peitschte so arg, unterließ man die gewünschte Demut!« – »Unterlasse sie aber fortab, diese Sklaventugend: – zumal auf der Sendung, die ich dir jetzt übertrage. Du kennst unsern Vertrag: du warst der allerersten einer, welche die Kleinleute zu den Waffen riefen: – noch vor mir, ohne mich, also in offenem Aufruhr. Du hast auf offener Heerstraße des Reichs den Patricius Hektor erschlagen . . .« – »Herr, er war dein Feind wie meiner. Auch du tötest – man weiß es! – deine Feinde, wo du sie triffst. Und jenen flüchtigen Bischof half ich doch auch einfangen und . . .« »Manche blut'ge That: Raub, Brand hat später diese Verdienste ausgetilgt, wenn's solche waren. Nicht umsonst heißest du im ganzen Land der Reißewolf! Du hast, nachdem ich euren Bund geschaffen, das Leben zweimal verwirkt: ich hab' dir's zweimal geschenkt, weil, . . .« »Weil du mich gut brauchen kannst, Herr,« grinste der, die weißen Zähne zeigend. »Ich bin dein bester Dolch.« – »Frech bist du, Gallus. Und ich schwöre bei . . . an welchen Heiligen glaubst du am frömmsten? Das heißt, welchen fürchtest du am ärgsten?« »Sankt Martin zu Tours,« stammelte der Schwarze und faltete erschrocken die Hände. – »Also: ich schwöre bei Sankt Martin von Tours: bei dem geringsten Vergehen gegen meine Banne hängst du am nächsten Baum. – Nun gieb acht! Morgen reist als mein offenkundiger Gesandter an den Hof nach Metz der fromme Bischof Landolen von Bienne.« Gallus machte ein verschmitztes Gesicht und blies leise vor sich hin. – »Was soll's, Bursche?« – Je nun, Herr: ist's ein schwierig Geschäft?« – »Warum?« – »Man sagt, der fromme Mann weiß besser im Himmel und in den Kirchen Bescheid als auf Erden und in den Palatien.« – »Schweig! Der Bischof ist nur zum Prunke mein Gesandter: – er übergiebt ein Schreiben von mir an den Knaben Dagobert, das kann jeder! Mein wirklicher Gesandter nach Austrasien aber – bist du.«
»Ich? O Herr. Ich Knecht?« – »Frei bist du ja, Schuft, freigekauft von mir, sowenig du's verdienst.« – »Was soll ich dem Herrn König dort sagen? Er wird mich gar nicht anhören!« – »Sagen? Nichts dem König: – viel, sehr viel, alles dem Volke dort. Höre. Meine Forderung, den Thron von Metz zu räumen, wird ohne Zweifel abgewiesen: dann giebt es Krieg.« – »Hussa! Hei! Das ist gut. Es ist ohnehin so langweilig jetzt hier zu Lande.« – »In diesem Krieg muß das Volk – das heißt müssen die Kleinleute – abfallen von dem Mönch-König.« – »Ah so! Ich fange an, zu verstehen.« – »In Austrasien sind die Leiden, die Bedrängnisse der Geringen zwar nicht gerade ganz so hart wie sie hier im Lande waren . . .« – »Bis du sie – alle! – getilgt,« flötete der Schwarze süßlich; er wollte ihm die Hand küssen. – »Laß! Laß das Lecken den Hunden! – Aber jedenfalls arg genug, so daß sie sich gern erheben werden.« »Zumal wenn ihnen einer zuredet!« lachte der Reißewolf: es war ein Lachen, bei dem Ebroin graute, »Und das will ich, das, bei Sankt Martin, kann ich.« – »Ich weiß es: – wie kein anderer, wie der Satan!« »O nenne den nicht!« rief Gallus und schlug hastig zwei Kreuze. – »Du könntest – ich hab's erfahren! – die Engel im Himmel zum Aufruhr wider den Herrgott treiben! – Also ich zähle auf dich: sobald ich unsern Heerbann aufrufe, rotten sich dort – bei Metz, vor allem – die Kleinleute zusammen und schlagen los.« – »Sie sollen's! – Herr: dürfen sie im Anfang – nur im Anfang! – auch ein wenig – nur ein klein bischen! – brennen und plündern und . . .?« – er machte die Bewegung des Erstechens.
Ebroin zog die Brauen zusammen, aber er schwieg.
»Nur im Anfang! – Es wäre doch gut. Sie folgen mir dann rascher, lieber.« Der Majordomus stampfte mit dem Fuß: »Warum fragst du mich? Ich will von nichts wissen! Thu', was du nicht lassen kannst . . .« – »Ei! Hab' verstanden!« Und er machte einen Kratzfuß. – »Bin ich zufrieden, geb' ich dir zehntausend Solidi und Martia, die dralle Magd, aus meiner Villa Calma, um die du mich neulich batest.« – »Du wirst zufrieden sein, mehr als zufrieden!« – »Höre noch eins: die Hauptsache! Unserm König Theuderich steht nichts entgegen als jener Mönch Dagobert. Mit ihm fällt das Reich Austrasia. Sorge dafür, daß dieser König . . .« – »Nun?« Wieder stampfte der Ungeduldige – heftiger diesmal! – mit dem Fuße. »Tölpel! Hab' ich dich, um mich auszufragen oder um mich zu verstehen? Jener Knabe darf nicht etwa durch die Flucht ins Innere seines Landes, über den Rhein, sich meinen Waffen entziehen. Da dürft' ich ihm nachlaufen: – jahrelang! Ich muß ihn haben – verstehst du? Lebend oder . . . Nun, wenn ihn seine empörten Unterthanen totschlügen, – es wäre auch kein Unglück!« »Herr,« fiel der Reißewolf, diesmal ohne Besinnen, ein, »er soll nicht ins Innere seines Landes entfliehn, verlaß dich auf mich!« – »Geh.« Er wies gebieterisch auf die Geheimpforte.
Mit vielem Bücken glitt der Riese hinaus.
Da, als die Thüre einschnappte, fiel das Mosaikbild von der Wand: es zersprang auf dem Marmorestrich in viele, viele Stücke. »Ein böses Zeichen,« sprach Ebroin, finster auf die Splitter herniederschauend. »Die Heilige zürnt. Aber es muß sein!«
In dem Palatium zu Metz, dem alten Bau, der sich an der Stelle der ursprünglich keltischen Feste auf dem rechten Ufer der Mosel auf steiler Hochfläche erhob, lag vor den sieben Marmorstufen, die zu dem Eingang des Mittelsaales führten, ein weiter Hof, auch hier, wie der zu Paris, den Waffenübungen der Hofknaben dienend, die – wie an der Seine – in beträchtlicher Zahl das Königshaus belebten.
Aber während zu Paris das Vulgärlatein und die dunkelhaarigen Römer oder stark romanisierten Neustrier und Burgunden des Südens überwogen, hörte man die zahlreichen Blondköpfe hier an der Mosel fast nur die markige Sprache der Unterfranken reden.
In dieser Sprache stellte auch seine vielen, lebhaften Fragen ein auffallend schöner Knabe von etwa vierzehn Jahren, dem die goldgelben Haare in kurzkrausen Locken das wohlgebildete Haupt dicht umstanden. Die blauen Augen blitzten, als er sie wieder zu dem stattlichen Krieger aufschlug, an dessen Hand er dahinschritt, während wie die Knaben so die geistlichen und weltlichen Großen, die sich allmählich von der tiefer liegenden Stadt her zahlreich hier zusammenfanden, mit ehrdienigem Gruße den beiden Wandelnden auswichen.
Da schritt vom Hofthor her ein neuer Ankömmling, voll gewaffnet, auf sie zu. Der Knabe sprang ihm entgegen: »Willkommen, Oheim Martinus. Du kommst gerade recht, mir die Schwertleite zu geben: – in ein paar Tagen soll's geschehen.« – »Ei, Karlchen,« sprach der Oheim, ihm zunickend, »was bist du groß und stark geworden in diesen Monaten! Gegrüßt, Vetter Pippin! Wie geht's Frau Albhaid, der viel Schönen?« »Gut,« erwiderte Pippin. »Und du sprichst wahr: sie ist immer noch das schönste Weib Austrasiens.« »Ja, meine Mutter!« lachte der Knabe stolz. »Wie die ist sonst gar kein Mensch auf Erden. Die sollte unter Krone gehn statt der . . .« »Wirst du schweigen?« schalt Pippin. – »Es ist wohlgethan, ist hohe Zeit, Vetter, daß du dich endlich wieder einmal zeigst im Palatium. Dringend entbot ich dich zum heut'gen Tage.« »Ah,« meinte der Hüne, über den breiten roten Bart streichend, »ich tauge nicht für den Hof: ich gehöre in den Eichwald um unsern alten Stammhof an der Maas, in deren Sümpfen die Elche noch in Rudeln gehn und der Wisent dem Jäger den Hag verbieten möchte. Geradewegs komm' ich von daher und der Jagd.« – »Ohm, Ohm, du mußt mich mitnehmen! Der Wisent, sagst du . . .? Mit welcher Waffe fällst du ihn?« – »Ja, mein Hämmerlein . . . wahrhaftig, der Bub' trägt immer im Gurt die kleine Streitaxt, die ich ihm schenkte.«
»Und er hat gelernt, sie gut zu werfen,« sprach der Vater, die Hand auf den Krauskopf legend. »Komm, Karl, zeig's dem Ohm. Sieh, dort, am andern Ende des Hofes, pickt ein Sperling an der Strohschütte vor der Stallthür. Getraust du dich . . .?«
Schon flog der zierliche Streithammer schwirrend durch die Luft, in hohen Sätzen sprang der Werfer nach, schon brachte er den toten Vogel am Fittich in der linken Hand zurück, die Waffe in der rechten wägend.
»Gut, Hämmerlein. Ja, nun sollst du bald das Schwert empfahn und mir den Wisent fällen helfen. – Aber nun sprich, Vetter! Weshalb mußte ich durchaus zu diesem Hoftag herbei?« – »Weil er Wichtiges zu entscheiden haben wird. Du weißt, der junge König hatte gar bald nach seiner Ankunft alle Herzen gewonnen . . .« – »Jawohl, Und nicht zum mindesten durch seine Frau Königin, das kindjunge Weib. Einer Elbin acht' ich sie ähnlich. Frau Berthgundis daheim in der Halle ward ganz zornig, so hoch pries ich die Holdselige.« – »Und er hat auch bisher gar gut und weise gewaltet . . .« »Weil er immer that, was der Vater sagte,« meinte der Knabe lachend, wofür er von diesem einen Schlag – aber nicht einen allzuharten, – auf den Mund erhielt.
»Seine echte Frömmigkeit gewinnt ihm die Bischöfe, die Äbte. Er verschenkt mit vollen Händen Königsland an sie . . .« »Vater,« unterbrach der junge Karl, stehen bleibend, »darf ich was fragen?« – »Ja, wenn's nicht frech ist, wie gewöhnlich.« – »Nein, nein, im Ernst. Ist's nicht allzuviel, was der Herr König so der eignen Macht entzieht? Rieselt er noch lange fort, dieser unaufhörliche Regen von Gaben an Land und Leuten, – ja, was bleibt dann noch dem Reich?« – »Das war nicht frech gefragt, mein Bub'. Und auch nicht dumm. Aber an die Herren Bischöfe mußt du nicht solche Fragen thun.« – »Bah, ich fürchte sie nicht, die Geschornen,« »Der Bub' gefällt mir,« lachte der Ohm. »Ja, du, noch ein halber Heide, in deinen Wisentwäldern hast du sie nicht kennen gelernt. Ich aber kenne sie und scheue ihre Macht: – Wie auf Erden, so im Himmel« – schloß er andächtig, »Also die Kirche,« fuhr er fort, »hat der Herr König wohl für sich: – aber gar manche der weltlichen Seniores grollen ihm, weil, . . . nun, weil nicht gerade sie ihn aus dem Kloster geholt haben . . .« – »Sondern der Vater. Und weil deshalb der König ihm folgt, dem er den Königstab dankt, nicht ihnen.«
»Er hat nicht unrecht, der Bub'. Nun kommt dazu, daß jener Ebroin . . .« – »Du, Ohm, das ist ein großer Held, sagt der Vater. Aber, nicht wahr, der Vater ist ein noch viel größerer? Und du bist viel, viel stärker, nicht?« »Ich glaube,« lachte der Riese und bog die gewaltigen Armmuskeln. »Ich fasse den Stier am Horn und beug' ihm den Nacken.« »Schwerlich aber,« seufzte Pippin, »jenem blutigen Eber der Neustrier. Der hat – durch Gold und allerlei Ränke – viele Seniores hier im Lande mir und dem König abspenstig gemacht und unsere Nachbarn in Aufgang, Mittag und Mitternacht ringsum aufgehetzt. Des Jünglings Thron steht nicht gar fest. Und nun haben auch die geringen Leute, bedrückt von den Seniores, angesteckt von der Wut der wildempörten ›Kleinleute‹ dort im Westen, angefangen, gegen den König und gegen die Seniores zu murren.« »Ei, sie haben Ursach', mein' ich, Vater, nicht? Du sagst ja selber, auch bei uns thun sich in gar vielen Gauen kleine Gewaltherren auf – ›Tyranni‹, sagt mein Lehrer Hluthardt, der fromme Mönch, – die dem Herrn König über die Krone wachsen. Hei, wäre ich nur Herr an des sanften Dagobert Statt – ich wollte sie niederhämmern – so!« Und er führte einen sausenden Streich durch die Luft auf den dicken Ast einer der mächtigen Eichen, die in dem Hofe, schattenspendend, ihre Zweige spreiteten, – glatt durchhauen stürzte das harte Holz.
»Der wird einmal nicht ganz übel,« lachte der Ohm.
»So muß es unser junger König nun entweder mit den Großen verderben oder mit den Kleinen: – beides ist gefährlich. Und heute gilt es, dem Gesandten des Neustriers Bescheid erteilen auf das Schreiben, das er überbringt.« – »Was enthält's?« Pippin zuckte die Achseln: »Niemand weiß es. Aber es kommt von Ebroin . . .« »So bringt es nichts Gutes,« grollte Martinus. »Lauf nun, Karlchen, zu den übrigen bösen Buben des Hofes: da drüben, auf der untersten Stufe stehen sie, links und rechts. Und du, Vetter, komm mit mir hinauf: – neben den Thron: – dort ist unser, der Arnulfinge Platz. Hörst du den Hornruf? Der Herr König naht.«
Und alsbald nahm auf dem Thron vor der Palastthüre auf der obersten Treppenstufe die jugendliche Gestalt Dagoberts Platz.
Er schien in der kurzen Zeit seiner Herrschaft rasch gereift: sein Flaumbart war dichter geworden: aber die Stirne war nicht mehr wolkenlos und statt des Ausdrucks heiterer gottvertrauender Frömmigkeit hatten sich die Schatten der Sorge dunkel über diese sanften Züge gebreitet.
Auf seinen Wink ward der Gesandte und dessen zahlreiches, aus Geistlichen und Laien bestehendes Gefolge, die in dem gastlichen Hause des Bischofs Chlodulf von Metz – der war Pippins Vaterbruder – Aufnahme gefunden, abgeholt und in den Hof geführt, wo die geringeren Begleiter nahe dem Eingang stehen blieben, »Du, Blutigel,« flüsterte da einer aus diesen, ein schwarzhaariger Riese, der als Pfeilschütz gekleidet war, seinem Waffengenossen zu, »der junge König ist zu dünn für seinen breiten Thron.« – »Ja, Reißewolf; und auf seinem Gesicht liegt was . . . so was zum Tode Trauriges.« – »Ja, ja! Ich seh's den Menschen an, die bald sterben. Der wird nicht alt, fürcht' ich.«
Einstweilen hatte der Bischof von Vienne, ein ehrwürdiger Greis mit sanften Zügen, geleitet von seinem Metzer Amtsgenossen und Wirt, die oberste Stufe erstiegen. Er verneigte sich tief vor dem König, der huldvoll nickte, überreichte seine Vollmachturkunde dem neben dem Throne stehenden Pfalzgrafen, holte ein anderes Schreiben aus seinem Gürtel, zeigte dem Referendar links vom Throne das unversehrte Siegel, erbrach es, entfaltete die Rolle und las: »Dagobert, dem Sohne Sigiberts, dem Mönch aus Irland, Theuderich, Chlodovechs Sohn, König von Neuster, Burgund und Auster.« Da ging ein zorniges Murren durch die Reihen: aber der König winkte mit der Hand, zu schweigen. »Da dir zweifellos bekannt ist, daß das Reich der Franken durch die Teilherrschaft zweier Könige lange Zeit schwer gelitten hat und noch leidet, da nach zweifellosem, göttlichem und menschlichem Recht die Herrschaft wie über Neuster und Burgund so über Auster mir gebührt, . . .«
»Maßlos frech ist dieser Ebroin!« schrie da eine laute Stimme dazwischen und Pippin hatte schwere Mühe, den Vetter zu bändigen.
»Da du überdies – wie sicher verlautet – in der Einsamkeit jenes fern im Weltmeer schwimmenden Eilandklosters ein Mönchsgelübde abgelegt und aller weltlichen Macht und Herrlichkeit entsagt hast für immerdar, . . .«
»Eine grobe Lüge,« donnerte Martinus.
»So fordere ich dich im Namen Gottes und unter Zustimmung aller Bischöfe und Seniores unserer Reiche auf, den Thron zu räumen, der dir nicht gebührt, und uns den Königstab für Auster abzutreten.«
Hier tönte abermals Gemurmel durch die Bänke der Bischöfe und Äbte; aber auch manche der Weltgroßen grollten vernehmlich, während andere sich verlegen still verhielten. »Das müssen wir dem Eberfreund berichten, jenes Brummen und dies Schweigen,« flüsterte Gallus seinem Genossen zu.
»Dann magst du unversehrt und frei in dein Kloster zurückkehren, das der Mönch nie hätte verlassen sollen. Weigerst du dich aber, den angemaßten Platz zu räumen, so sollst du wissen, daß wir mit dem nie besiegten Heere von Neustrien und Burgund in dein Land brechen und uns aus dem Palast zu Metz Königstab und Königschatz von Austrasien holen werden. Den unwiderstehlichen Ansturm unserer Tapfern, deine Feldherren kennen ihn, – wenn auch du noch nie unsere oder andere Waffen geschaut hast.« –
Sowie der Bischof zu Ende gelesen, sprang Martinus vor und schrie: »Herr König, laß mich an deiner Statt diesen welschen Prahlhänsen antworten.«
Jedoch Dagobert winkte ihm, zu schweigen, erhob sich würdevoll vom Thron und sprach mit fester Stimme: »Herr Bischof, ich beklage euch, daß ihr der Träger so frevelhafter Botschaft werden mußtet. Kehrt heim und meldet denen, die euch gesandt haben: ›Dagobert, Sigiberts Sohn, vertrauend auf sein gutes Recht und Gott, wird als König siegen oder sterben‹.«
»Heil König Dagobert!« Dieser Ruf erscholl nun doch fast aus aller Munde: auch derer, die vor kurzem noch geschwankt und geschwiegen hatten; die männlich feste Antwort hatte überrascht und erfreut.
Gallus aber raunte seinem Gesellen zu: »Jetzt stirbt er noch viel früher als ich vorhin meinte! Fort! Aufs Land hinaus! Die Armen sollen's jetzt erst lernen, wie schlecht es ihnen bisher in diesem Reich ergangen ist und geht.« – »Ja, wir wollen's ihnen schon sagen! Und auch, wie wir es bei uns daheim abgestellt haben.« – »Ja, auch das sollen sie von uns lernen!«
Mit der Raschheit, die Ebroin eigen war, übrigens die »raschen Franken« im Süden und Westen Galliens, wo keltisch-römisches Blut sich dem germanischen so stark gemischt hatte, überhaupt von den schwerfälligeren Ostleuten, zumal auf dem rechten Rheinufer, auszeichnete, hatte der Majordomus von Neuster und Burgund den Heerbann beider Reiche aufgeboten und über den Sammelplatz Paris mit Windeseile dem Feind entgegengeworfen.
Das war ihm stark erleichtert, da er ja die Antwort des Austrasters vorausgesehen und deshalb gleich bei, ja schon vor Abschickung seiner Gesandten sämtliche Vorbereitungen für den Feldzug getroffen hatte. Alles war geglückt und glückte. Friesen und Sachsen hatten bereits Raubzüge unternommen, die jene zu Wasser bis Nimwegen, diese zu Land über Köln hinaus bis gen Aachen hin führten; die dortigen Gauleute der Austrasier wurden zur Verteidigung des eigenen Herdes daheim festgehalten. Die Thüringe bedrohten – für sich allein handelnd – von Osten, von der Werra her die Gegenden an der Lahn, so daß die hessischen Aufgebote König Dagoberts zur Deckung ihrer Marken meist zu Hause blieben. Hermengar und Vanning war es sogar gelungen, ein Waffen-Bündnis zwischen dem Agilolfing zu Regensburg und dem Schwabenherzog – den beiden nur so selten gemeinschaftlich handelnden Nachbarn – zu stande zu bringen, infolge dessen bajuvarische und alamannische Scharen sich von Ost und Süd her gegen die austrasische Grenze an Altmühl und Main in Bewegung setzten; auch diese Gebiete durfte man nicht unbeschützt lassen.
Endlich verlautete alsbald allerlei von Unruhen unter der ärmeren Landbevölkerung in Dagoberts Reich, die, seit die Kriegserklärung bekannt geworden, sich immer drohender gestaltet und gerade in der nächsten Umgebung von Metz gefährlich gesteigert hatte; um deswillen konnte man jene Gegenden nicht ganz von Kriegern entblößen. So war es nur ein schwaches Heer, das Pippin und Martinus – ungeachtet eifrigster Mühung – aufzubringen und dem Feind entgegenzuführen vermochten.
Die politischen Verhältnisse wie strategische Erwägungen brachten es mit sich, daß der Zusammenstoß der beiden Heere nördlich von Paris erfolgen mußte: das Ziel der Neustrier war Metz, das Ziel der Austrasier Paris: jene wollten dort Dagobert, diese hier wenigstens Ebroin vernichten, wenn nicht auch seinen König Theuderich absetzen. Die Champagne, seit langer Zeit zwischen Auster und Neuster schwankend, – am liebsten hätte sie sich ganz unabhängig gemacht! – war jedoch in der jüngsten Zeit für und von Ebroin gewonnen worden: so konnten die Austrasier nicht den nächsten Weg nach Paris – über Châlons-sur-Marne – einschlagen; da aber das feste Laon von seinem Grafen noch für Dagobert gehalten ward, wollten die Austrasier, so weit nördlich ausbiegend, von dieser Stadt aus über Soissons auf Paris vordringen, während Ebroin ebenso notwendig ihnen Laon, diesen wichtigen Stützpunkt, zu entreißen trachten mußte, um nach dem Siege für den Zug auf Metz sich den Rücken frei und sicher zu wissen. So mußten die einander suchenden Heere zwischen Laon und Soissons zusammentreffen: und also geschah's auch, nachdem die Austrasier die starken Wälle von Laon verlassen und die alte Römerstraße nach dem Süden eingeschlagen hatten.
Martinus hatte, seinem Ungestüm entsprechend, vom König den Befehl über die Vorhut erbeten und erhalten. Er brannte vor Begier, die »welschen Prahler«, die Maulhelden, die eiteln, überklugen Weichlinge samt ihrem blutbefleckten Führer durch einen wisent-haften Ansturm über den Haufen zu stürzen. Und ganz heimlich im Herzen hatte er sich vorgenommen, diese, wie er wähnte, leichte Aufgabe, allein zu vollenden, bevor noch Pippin die Hauptmacht herangeführt haben würde, geschweige der junge König von Metz her, wie geplant war, die Nachhut, die erst jetzt aus verspäteten Nachzüglern oder fernher aus den von Osten herankommenden Heerhaufen gebildet werden sollte.
Ohne Rast trieb der Hüne, auf seinem mächtigen Brandfuchs an der Spitze der vordersten Reiter einherjagend, seine dünnen Haufen mit sich vorwärts gen Süden: es waren die Neustrien und Burgund zunächst siedelnden Wehrmänner: die Alamannen des Elsaß und die Unterfranken um die Mosel, während Pippin, etwa einen halben Tagemarsch weiter zurück, die Unterfranken von der Ems, vom Niederrhein, und die – etwa verfügbaren – Hessen heranführte.
Da nun auch Ebroin seine starken Massen eilig entgegenbrachte, drängte Alles zu rascher Entscheidung.
Der Ort des Zusammenstoßes war Lufao, heute Laffaux, auf der Straße südlich von Laon über Soissons nach Paris, genauer etwas südlich unterhalb Laffaux, zwischen Margival und Nanteuil-la-Fosse. Martinus hatte am Tage vorher von Laon aus Urcel erreicht und dort für die Nacht gelagert, Ebroin am gleichen Morgen vorher den Seinen nur den Weg von Soissons bis Margival und Laffaux zugemutet und sie am Ziel den ganzen Tag und die Nacht über rasten lassen.
Dem Reisenden, der heute mit einem Blick für solche Dinge die Gegend durchwandert, drängt sich die Beobachtung auf, wie günstig die Verteidigungsstellung im Südwesten auf den Höhen von Margival ist, während ein von Nordosten kommender Angreifer die Hügel von Nanteuil verlassen, das Thal durchqueren und nun jene steilen Erhebungen erklimmen muß.
Ebroin selbst hatte die Spähreiter geführt, die, im Dunkel der Nacht, durch Waldpfade von Landessöhnen geleitet, weit über das bei Margival und Laffaux bezogene Lager hinaus auf mehreren Straßen, gegen Urcel und gegen Rethel, vorgetrabt waren.
Um Mitternacht kehrte er freudig zu den Seinen zurück mit zwei Gefangenen – tolldreisten Alamannen, die sich unvorsichtig zu weit vorgewagt hatten – und mit wichtigster Erkundung. »Ich meine,« rief er schon vom Gaule herab, bevor er absprang, seinen Führern zu, »ich meine, wir haben sie, die tapfern Barbaren des Ostens! Wenn nicht Sankt Martin von Tours ein Wunder thut, sie zu retten, was wenig wahrscheinlich: der Heilige ist gut neustrisch gesinnt und der rote, der lange Martin hat weniger mit seinem Namenspatron als mit Donar gemein. Kommt ins Zelt, dort vernehmt meinen Schlachtplan und den sicheren Sieg.«
In freudigster kriegerischer Erregung eilte er voran.
»So mag ich ihn leiden,« schmunzelte Vanning. »Viel besser, als wenn er grübelt und vor sich hinbrütet,« – »Ja,« schloß Herzog Hermengar, »und dann plötzlich auffährt, ausbricht, unberechenbar in voller Wut. Das Werk seines Lebens war doch wohl allzuschwer, die Last zu drückend, des Blutes zu viel: – ich hätte nimmermehr solches auf mich genommen! – ich meine, es hat auch ihn geschädigt.« – »Aber nicht am Heldentum, nicht an der Feldherrnschaft: – das wirst du sehen!«
Und der Erfolg des nächsten Tages gab dem Treuen recht.
Ebroin hatte seine Mitte, erlesene Scharen – Salfranken von der Schelde, alte Bataver – auf dem steilen unbewaldeten Höhenzuge aufgestellt, der sich, von der steil gen Süden ansteigenden Römerstraße durchbrochen, quer von Ost nach Westen zog.
Hier, in der ersten Reihe, hielt Ebroin, selbst weithin sichtbar auf seinem hohen Rapphengst, dicht vor dem neustrischen Königsbanner, das immer noch, wie vor Chlodovechs Taufe, den heidnischen Meerdrachen, aus Gold gewirkt, im wasserblauen Felde führte: Hermenfrid war es anvertraut. »Hier,« sprach Ebroin, »geschieht der erste, hitzigste Stoß der Ostleute: gerade hierher führt die Römerstraße, auf welcher der rote Stier heranschnaubt. Salische Männer, ihr bleibt mir wie angewurzelt stehen, laßt euch nicht verlocken, auf sie zu Thal zu stoßen! Laßt sie nur Kraft und Atem verbrauchen, bis sie halbwegs nach oben gekeucht sind: dann aber, sobald sie die tiefen Kies- und Sandbrüche hinter sich haben die sich überall von unserer Reihe den Hügel entlang hinziehen, dann drauf los und werft die Ungestümen in jene Tiefen, folgt ihnen aber nicht: es wird dort schon für sie gesorgt! Denn du, Herzog Hermengar, stehst mit der ganzen aquitanischen Reiterei auf unserem linken westlichen Flügel bei Laffaux, dort, wo das ebene Wiesengelände zum Ansprengen gerade einladet; sobald du unsere Mitte verfolgend vorbrechen siehst, reitest du gegen der Feinde rechte Flanke an: sie ist die schwächste – ich hab's erkundet: – ich vertraue, du wirfst die rasch zersprengten seitwärts, auf ihre weichende Mitte, und . . .«
»Und der Tag ist unser!« frohlockte Vanning.
»Noch nicht, Freund: denn noch fehlt dein Stück Arbeit dabei, auf unserer rechten Flanke im Osten bei Margival und Vauveny: – ein gar wichtiges. Denn wir müssen auch für den klugen Meister Pippinus ein kräftig Tränklein brauen.« – »Pippin? Du erfuhrst ja, er sei noch weit zurück?« meinte der junge Hermenvech. »Er war's noch gestern Abend. Aber ich trau' ihm nicht. Er kennt seinen wilden Stier. Er wird – so gut wie ich! – erraten, daß der sofort losstürmt, sowie er ein rotes Tuch – das ist meines Vaters Sohn! – erblickt. Ich fürchte, in solcher Sorge hat Pippin seinen Chatten, Hama-Leuten und Emsmännern keine Ruhe gegönnt: er ist die Nacht über vorwärts geeilt, in die Schlacht einzugreifen, bevor der Tollkopf sie vollends verloren hat. Nun, Freund Vanning, giebt es aber noch eine andere Straße von Norden hierher. Da, schau, auf dieser alten Karte der Römer für die gallischen Straßen – ist doch hübsch von ihnen, daß sie uns die hinterlassen haben: im Cäsarenpalast zu Paris fand ich gar viele; die da trägt die Inschrift: »Julianus Imperator« – wer das wohl war? – Da steht der Weg verzeichnet: – östlich von dem Anmarsch des Martinus: – auf diesem wird Pippin – ja er muß, es ist sein nächster Weg! – von Rethel her, im Osten von Laon – über Trucy, Jouy und Sancy – heraneilen, zu retten, was zu retten ist, die Schlacht zu stellen, vielleicht zu wenden: denn er ist ein guter Kriegsmann und seine Schar ist die Hauptmacht, Nun, Vanning, du sorgst dafür, daß er gar nicht oder mit arg gelichteten Reihen auf der Walstatt erscheint.«
»Gut, ich eile ihm also entgegen.«
»Das laßt du hübsch bleiben! Sieh, hier führt sein Weg und zwar auf der rechten – also seiner Leute schildlosen Seite – an jenem dichten Wald – voll Unterholzes – hin; Pippins böser Dämon hat diese Büsche hier wachsen lassen: da hinein, Vanning, mit allen unseren Pfeilschützen aus Armorica, aus Wasconien, aus dem Poitou und der Touraine: das ist ein Hinterhalt ohnegleichen! Ihr bleibt ganz ruhig, bis sie auf halbe Pfeilschußweite an euch vorüberziehen; dann haltet auf den Leib unterhalb der Brünne oder auf den schutzlosen Schwertarm: wenn ihr nicht zielt wie die Blinden, müssen sie fallen wie unter dem Hagel der Hafer. Dann – aber erst, wenn ihr dreimal geschossen! – werft die Bogen weg, zieht die Schwerter und streckt mir alles nieder, was noch steht.«
»Heil Ebroin, Heil dir und Sieg!« riefen die beiden Jünglinge. Und auch die reifen Männer faßten bewegt seine Hände.
Und wie geplant, so geschah's.
Am späten Vormittag des folgenden Tages erblickte Martinus, mit seinen Reitern den Kamm der Hügel im Norden erreichend, über das Thal hin, auf dem Höhenzuge gegenüber, die Schlachtreihe der Feinde.
Aber er täuschte sich über deren Ausdehnung nach Osten: der dichte Wald verdeckte ihm Ebroins rechten Flügel: so hielt er den östlichen Teil von Ebroins Mitte bereits für dessen äußerste Stellung im Osten, ein volles Drittel der Gegner blieb ihm unermittelt: jenen Wald durch vorstoßende Späher erforschen zu lassen, kam ihm nicht in den ungestümen, vertrauenseligen Sinn.
Er hielt, die blendende Mittagsonne auszuschließen, die Hand vor die Augen unter das Dach des Helmes, den zwei mächtige Wisenthörner schmückten, und nach kurzer Ausschau gegen den Saum jenes Gehölzes hin, rief er, frohgemut sich auf den Bügeln hebend: »Hei, meine Buben, es sind ihrer ja viel weniger, als der Vetter meinte. Rasch drauf und kurze Arbeit mit den Südlingen, daß die andern gar nichts mehr zu thun finden. Mit denen werden wir leicht allein fertig! Drauf!« Und er jagte mit seinen Reitern weit voran, das Fußvolk konnte so rasch nicht folgen.
Unbeweglich hielten die wohlgeschulten Krieger Ebroins oben auf der kahlen Höhe in der Mitte seiner Stellung, sie ließen die Reiter – deren Gäule ermatteten bei dem steilen Aufwärtsklimmen – und die erste und zweite Schar des Fußvolks bis über jene Kiesgruben hinandringen.
»Jetzt!« befahl Ebroin.
Und blitzend und klirrend ergossen sich, plötzlich lebendig geworden, die bisher starren Erzreihen auf die erschöpften, schwitzenden, keuchenden Stürmer.
Da ersah Martinus den verhaßten Feind.
»Ah, dort – dort – auf dem Rappen! – ist er, Platz! Laßt mich durch! Den Tag entscheidet Ein Hammerstreich. Laß sehn, ob sein schlauer Kopf den ausholt.« Und mit dem vollen Ansprengen des gewaltigen Rothengstes allein durchbrach er, ohne Schlag zu schlagen, die nächsten feindlichen Fußkämpfer und erreichte Ebroin. Zu furchtbarem, allzerschmetterndem Streich hoch aushebend schwang er den Steinhammer, den, von frühen Ahnen ererbt, der Hüne nicht gegen eine neuere, bessere Waffe vertauschen wollte.
»Stirb, Natter!« schrie er. »Sieh dich vor! Sie beißt!« rief Ebroin entgegen und, das Roß an des Feindes rechter Seite vorbeispornend, stieß er ihm die schmale gotische Klinge in die klaffende, ungeschützte Achselhöhle des hocherhobenen Armes. Wohl sauste da der wuchtige Hammer, aber neben das Ziel: und er entfiel dann der sich lösenden Faust: der Reiter stürzte sterbend nach links aus dem Sattel.
Des Führers Fall entsetzte die Alamannen: sie wandten die Gäule zur Flucht, ritten dabei ihr eigenes Fußvolk über den Haufen und stürzten, in dichte Knäuel geballt, mit diesen Speerleuten zusammen in die tiefen Kiesgruben, an denen vorbei sie hinaufgekommen. Die Fußkämpfer der Sieger begnügten sich, diese Wehrlosen von oben herab mit Wurfspeeren zu erlegen, während Ebroin mit seinen Reitern die noch vom Thal aufsteigenden Moselleute zersprengte: diese waren schon dadurch widerstandsunfähig geworden, daß gleichzeitig ihr eigener rechter Flügel, durch Hermengars Reiterangriff entschart, in Auflösung in ihre Reihen geworfen ward.
Allein Flucht und Verfolgung fanden bald ein Ende: links von dem weichenden Heer, auf der breiten Straße, die von Nordosten, von Rethel herführte, zeigten sich die Reiter, dicht hinter diesen aufschließend auch die ersten Haufen des Fußvolks Pippins in raschester Annäherung.
»Jetzt, Vanning, thue deine Schuldigkeit, sonst giebt's eine zweite Schlacht,« sprach Ebroin, sich hoch im Sattel hebend und auf jene vorwärtsdrängenden Reihen im Osten blickend, die nun gerade den Waldsaum erreicht hatten, an dem sie vorüber mußten. »O könnt' ich jeden Pfeil dort zielen mit dieser Hand! Die Schwalbe im Fluge entgeht mir nicht! Auf, Hermenfred, eile zu deinem Vater da drüben: – er soll mit all' den Seinen nach rechts schwenken und mir folgen, dem neuen Feind entgegen.«
Jedoch es kam nicht zu weiterem, ernstem Kampf.
Sobald der ganze Zug Pippins sich mit der Strecke des Waldsaumes deckte, flog plötzlich auf seine rechte Seite ein solches Gewölk von Pfeilen, daß man das Schwirren der Sehnen weit, weithin vernahm. In dichten Haufen, Mann auf Mann und Gaul auf Gaul, wie sie geschritten, wie sie geritten, fielen sie, so daß nach der Schlacht die Sieger Mühe hatten, die Gefallenen voneinander zu lösen! durch sie hindurchzuschreiten, war, ohne solche Lösung, unmöglich. Am meisten litten die Reiter: sie boten das breiteste Ziel.
An ihrer Spitze sank auch Pippin von seinem weißen Roß: er hatte einen Pfeilschuß in den Schwertarm und einen schlimmeren unter dem Wehrgurt erhalten: mit Mühe zogen ihn die Seinen unter dem toten Gaul hervor und flüchteten den Schwerwunden in Sicherheit. Das ging nicht leicht: und nicht ohne Aufopferung manches treuen Gefolgen. Denn Ebroin hatte mit lautem Freudeschrei ihn fallen, dann mit knirschendem Zorn davontragen sehen: »Nach!« rief er. »Nach! Nach!« Und grimmig spornte er den Rappen. »Alle hierher! Alle auf Pippin! Sein Tod erspart uns alles weitere: – mit ihm fällt Austrasien heute noch in unsere Hand.«
Allein aller blutiger Eifer der Verfolger blieb vergeblich: Pippin ward weder gefangen noch getötet: der Sieger mußte sich damit begnügen durch den Angriff seiner drei nun vereinten Scharen auch dies zweite Heer mit starken Verlusten vollends zu werfen und zum Rückzug nach Austrasien zu zwingen.
An dem Tage, da die Schlacht bei Laffaux verloren und gewonnen ward, hatte König Dagobert seine Vorbereitungen vollendet.
So viele Mannschaften, als überhaupt noch – nach Deckung der rings bedrohten Grenzen – zur Abwehr der Neustro-Burgunden verwendet werden konnten und nun dem Heere Pippins nachgeführt werden sollten, waren jetzt allmählich an dem ihnen bezeichneten Sammelplatz – Metz – eingetroffen und lagerten, soweit sie in der alten Feste der Mediomatriker nicht Unterkunft fanden, vor den Thoren auf dem linken Ufer der Mosel, des Aufbruchs gen Nordwesten gewärtig.
Das junge Ehepaar saß in dem hochgelegenen Castrum, im Schlafgemach, dessen Rundbogenfenster den herrlichen Ausblick über das Thal der vielfach geschlungenen Mosel gewährte, die im Strahl der sinkenden Herbstsonne wie ein Silbergürtel glänzte.
Die Gatten lehnten sich über die breite, mit weichen Teppichen behängte Mauerbrüstung und sahen hinaus gen Westen, wo ein düsterer Tannenwald den Ausblick abschloß; die zarte Frau hatte den Arm um seinen Nacken geschlungen. Zu Füßen des breiten Ehebettes, im Hintergrunde des Gemachs, lag der treue Ryan, das mächtige Haupt auf die beiden vorgestreckten Pfoten gestreckt, aber die klugen Augen stets merksam auf die Herrin gerichtet.
Der junge Herrscher war soeben von einer letzten Musterung aus dem Lager vor den Westthoren in das Palatium zurück; wenig freudig sah sein schönes Antlitz; umsonst bemühte er sich, das vor seiner Königin zu verbergen. »Wir hatten noch nie ein Geheimes vor einander,« sprach sie und zog ihm sanft die Hand hinweg, mit der er Stirn und Augen bedeckte. »Laß uns nicht damit beginnen bei unserer ersten Trennung. Es gelänge dir ja doch nicht! Tief seh' ich dir durch die Augen in die Seele. Du sorgst um den Sieg, um das Heer, Es sind wohl zu wenig Helme?« »Es ist nicht das,« seufzte Dagobert. »Aber es fehlt am besten: an der rechten Freudigkeit, an dem guten Willen, der allein den Sieg verbürgt. Wohl sind sie gekommen die Männer von Köln, von Trier, von Mainz und Worms, von Main und Saale: aber widerwillig, nicht gern. Noch war die alte Pflicht, dem Merowing Heerfolge zu leisten, stark genug: aber sollte ich . . .« – »Sterben? Warum? An Siechtum? In der Blüte der Jugend? Und in der Schlacht wird dein Schutzengel dich schirmen. Und mein Gebet!« Und sie umschlang seine Rechte mit ihren beiden weißen kindlichen Händen. »Dann, mein' ich, liefen alle auseinander, jeder den eigenen Herd zu schützen, und, so vereinzelt, alle unterzugehen. Ja, auch mir selbst ins Angesicht wagt sich aus vielen Reihen ein böswilliger, drohender Geist hervor.« »Wie? Diesem Antlitz gegenüber?« Und sie strich ihm zärtlich die Locken aus den edlen Schläfen zurück. »Ja,« lächelte er, »die derben Kölner sind mir nicht so hold gesinnt wie Karin. Du hast davon gehört: schon lange gärt es draußen in den Gauen, in den armen Hütten der geringen Hufner. Sendlinge – fremde – schleichen von Gehöft zu Gehöft: sie halten den Darbenden vor, wie Bischof, Abt und Senior – und der König zu Metz vor allem! – im Überfluß schwelgen und prassen, während ihnen der Fronbote des Grafen das letzte Rind vom Pfluge und den Pflug selbst, den alten, vielgeflickten, pfändet für Dingwette oder Heerbannbuße. Das dringt nun alles aus den Gauen in das Heer mit den Wehrleuten, die aus jenen niedrigen Schilfhütten und morschen Lehmwänden hierher zusammenströmen. Und hier klagt dann einer dem andern seine Not, und einer schürt so und hetzt den andern. So riefen sie mir denn heut' auch zu, – eben jetzt! – da ich ihre Waffen prüfte und ob die Köcher der Pfeile voll – die Leute von dem Rhöngebirge – dem ›Hungerbühl‹ – waren's und von der rauhen Eifel: – ›ja, Herr König, die Köcher sind voll, aber die Magen sind leer.‹ – ›Und leer das Säcklein für Brot und Speck.‹ – ›Wir ziehen aus, für dich zu sterben: derweilen greifen deine Büttel auf unsere schmale Scholle daheim.‹ – ›Und kommen wir lebend nach Hause, sitzt ein anderer unter unserem Dach.‹ – ›Und Weib und Kind sind verdorben.‹ – ›An die daheim denken wir, nicht an deinen Sieg und Thron und Ruhm.‹ – ›Ich denk' an meinen alten Vater, der hungert jetzt am kalten Herde.‹ So riefen sie mir – um die Wette – zu!«
»O laß ab,« seufzte die bleiche Frau; große Thränen glitten langsam über die schmalen Wangen. »Und du kannst nicht helfen?«
»Könnt' ich's, hätt' ich's nicht längst gethan? Wie soll ich, der Eine, in Einem Jahre, bessern, was ungezählte Könige vor mir verschuldet oder doch nicht verhütet haben seit Chlodovech, unserem Ahn? Und wenn ich thäte, wie die Armen, Bethörten, verlangen, wenn ich den Kirchen und den Seniores ihren Besitz entrisse – wie jener blutige Eber da drüben täglich thut – und ihn den Armen zuteilte, wär' es minder Unrecht? Wem nehmen? Welcher Besitz stammt von Raub oder List? Wer soll das heute noch untersuchen – nach zweihundert Jahren? Und wem geben? Wer ist bedürftig – bedürftig durch fremde, nicht durch eigene Schuld? O wehe mir: ich sehe die Not des armen Volkes: – sie ist da, wirklich da, in schrecklicher, stummer Aufdringlichkeit: – denn die Besten klagen nicht! – Ich schaue das zehrende Verderben im Lande, und ich sehe kein Mittel der Rettung. Und wenn ich nun wirklich sieghaft hierher zurückkehre, – soll ich mich freuen, dasselbe unheilbare Elend wiederzufinden? O wehe, o Fluch dem Tage, da sie mich mit jenem gleißenden, goldenen Königsstab aus dem stillen Frieden unseres Klosters lockten und ich dich aus der grünen Einsamkeit deiner Schäfertrift mit mir davon riß. O hätt' ich nie der Merowingen Königsthron bestiegen! Mir ist, es lastet ein alter Fluch darauf seit jener blutigen Fredigundis Tagen, meiner schrecklichen Ahnfrau. Und dich, du Reine, frei von der Erbschuld meines Hauses, hab' ich mit herein in diesen Fluch gezogen. Vergieb! Aus großer Lieb' ist das geschehn.« Und er umschlang das braune Köpflein und küßte sie auf die Stirn.
Sie aber küßte ihn herzhaft auf den Mund und sprach: »Und wär' es so, – so wär's ein selig Los, mit dir Fluch und Untergang zu teilen! Und wäre dieser Tag unser letzter – wahrlich, mich reute meiner Liebe nicht! Und um nichts und mit keinem andern Weibe tausche ich –. Gedenkst du nicht mehr all' der seligen Stunden, seit – noch im Kloster – Abt Wilfrid uns verband? Ja: lieben, Freund, ›lieben ist Ewigkeit!‹ So sang uns einst ein weißbärtiger Harfenschläger am Sunwendfeuer. Er hatte recht. – Und die süße Hoffnung,« flüsterte sie, schämig das Haupt an seiner Brust bergend, »die mir unter dem Herzen keimt, – dein Kind! – ist das nicht Glück, unsagbar Glück? Laß uns den Abend – den letzten! – noch so verbringen, wie deine Königspflicht erheischt: – ich meine nicht die Waffenpflicht: – genug hast du der obgelegen all' diese Wochen! – ich meine die schönere Pflicht, zu schützen und zu schirmen die Schutzbedürftigen und Armen. Da drüben, jenseit des großen Königsforstes, gegen Norden nach der Villa Thiodos hin, weiß ich gar arme und gar wackre Leute wohnen. – Ich sprach jüngst in der Hütte, der zerfallenen, ein, durstig von dem Staub der Straße: ich fand die junge Hausfrau – die junge Mutter! – in Thränen: ich hatte um einen Trunk Milch gebeten: – sie wies auf das schreiende Kind, das sie in den mageren Armen hielt: ›Milch?‹ rief sie klagend. ›Ach! Unsre letzte Ziege nahm der Fronknecht – und mir versagt die elende Brust den Trunk für diesen Säugling, der nichts zu saugen findet. O, läg' er tot und ich dabei! Mein Mann? In Metz! In der Schuldzelle hält ihn der Vicegraf.‹ Ich gab der Armen die Silberspange von der Schulter weg, ich löste hier den Schuldknecht aus. Komm, laß uns zu den guten Leuten! Wir wollen sehen, wie's ihnen nun ergeht. Und weiter helfen, thut es not. Komm, Lieber!« Und sie erhob sich.
Tief ergriffen sprang er rasch auf und umschloß die zarte Gestalt mit beiden Armen. »Ja, du hast recht, du Holde, Süße, Gute! Ich folge dir. Laß uns den Dürftigen helfen. Mich deucht, Gott wohlgefälliger beschließ' ich so den letzten Tag, als betete ich viele Stunden in der Basilika auf den Knieen. Ich lasse deinen Zelter satteln: – sein sanfter, gleicher Schritt kann dir nicht schaden: auch führ' ich ihn am Zaum. Und welche deiner Hofmaide . . .?« – »O keine! Laß uns diese letzten Stunden allein verbringen.« – »Wohl! Auch brauch' ich keinen Reitknecht für das eine Tier. Ryan, komm mit: – es geht ins Freie. Komm!« Freudig bellend und mit dem mächtigen Schweife wedelnd sprang das schöne Tier an dem Herrn hinauf.
Blutrot war die Sonne hinter den düstern Tannenwipfeln des Westens gesunken: glanzlos schwamm die matte Scheibe in dem grauen Meere dichten Nebels, der, von der Mosel und ihren Sümpfen aufgestiegen, nun das ganze Thal erfüllte und mit kalter Nässe sich an Pflanzen, Tiere und Menschen heftete. Schon dunkelte der Herbstabend stark. Zumal in dem dichten Urwald, durch den nur ein schmaler Reitpfad geschnitten war, schlossen die dicken Tannen- und Eschenstämme fast jeden Strahl des sinkenden Tages aus.
Da tauchten an der Beuge des Pfades von Norden nach Osten – nach der Stadt zu – in der Ferne schattenhafte Umrisse auf: ein kleines Pferd, darauf eine Frauengestalt, daneben schreitend ein Mann, voraus springend ein großer Hund.
Wo der Weg thalabwärts gen Metz zu sich in einen Engpaß senkte, von beiden Seiten überhöht durch dicht bebuschte Hügel, ward nun etwas lebendig in dem Gesträuch. Eine Amsel, die in dem nächsten Rainweidenbusch gesessen, flog, aufgescheucht von der plötzlichen Bewegung in den Zweigen, erschrocken ihren lauten Warnruf schmetternd, über den Weg hin auf die andere Seite des Waldes.
Ein Mann – riesenlang – streckte, vorsichtig spähend, den unbedeckten, schwarzstruppigen Kopf aus den hohen Hagebuchen und lugte aus. »Sie sind's!« flüsterte er dann nach rückwärts. »Sie kommen zurück.« »Bebilo, der Thorwart, ein treu eifriger Genosse des Bundes, hat's uns also richtig gemeldet,« antwortete ein tiefer im Busch Versteckter. »Und wirklich: kein Gefolge! Sie sind allein.« – »Hier ist's günstig: sie können nicht ausbiegen . . .«
Ein leiser Pfiff: – da raschelte es auch auf der linken Seite in dem Buschicht der Haselstauden.
Einstweilen kam der Zelter näher: sein helles Weiß war das einzig Lichte in dem düstern Nebeldunkel. »Rascher, Lichtelb,« mahnte Dagobert, dem Tier auf den Hinterbug klopfend. »Wenn dir der schnellere Schritt genehm? Die kalten Nebel fallen so naß auf dich hernieder. Dein Mantel trieft.« »Ja! Und es dunkelt rasch,« sprach Karin. »Aber welche Freude sahen wir doch in der armen Hütte! Dies Bild durchleuchtet mir den finstern Wald. Die junge Mutter! Wie freudig sie ihr gedeihend Kind an die volle Brust legte! Welch heiliger Anblick! Mir kamen Thränen der Rührung.« – »Und der Mann! Frei von Schulden und Sorgen! Wie er dir dankte!« – »Nein, dir! Denn du schenktest ihm ja alles Gold aus deiner Gürteltasche. Und dazu ein Roß und sechs Rinder aus der Villa Thiodos, deines Freigelassenen. Diese Erinnerung wird mich stets erfüllen, denk' ich an dich in der Ferne. Und zum Dank für solches Wohlthun wird dich ein Engel Gottes schützen vor jeder Gefahr, jedem drohenden Eisen!«
»Nun, Ryan, was hast du?« fragte Dagobert. »Sieh nur den Hund! Er steht, den Kopf hoch aufgerichtet, auf der Straße und bellt wie wütend in die Büsche. Ryan, komm! Hierher.« Aber das so gehorsame Tier gehorchte nicht: es bellte drohend, bald nach rechts, bald nach links.
Nun war das Paar heran: da sprangen von links und rechts je zwei Männer von den Strauchhöhen auf den Weg herab. »Halt!« rief der vorderste. »Wir haben mit dir zu reden.« – »Wer seid ihr?« – »Das ist gleich. Geringe Leute! Wir wissen aber, wer du bist, Herr König Dagobert.« »Halte die Bestie von Hund fest,« forderte der zweite, »daß deine Unterthanen zu dir sprechen können, ohne zerrissen zu werden.« Dagobert zog das Tier am Halshaar zurück mit der Linken, mit der Rechten faßte er den Griff des Schwertes: »Was wollt ihr?« fragte er. – »Das wirst du gleich hören.« – »Allerlei.« »Höre du,« flüsterte der dritte dem vierten zu, »ich mag nicht. Ich thu's nicht. Was kann er am Ende dafür?« »Ja,« erwiderte der vierte. »Und vollends vor der jungen Frau! Sie ist noch ein Kind. Ich sah sie heute Mittag ganz nah, in der Kirche. Sie ist schön wie . . .« »Schweigt dahinten,« befahl der zweite, sich drohend wendend, »oder! . . .« Und er zog nun aus dem Mantel eine Axt. »Wer nicht mitthut,« rief der vorderste zurück, »den trifft kein Lohnteil. Sondern das!« Und damit riß er eine krumme Sichel aus dem Gürtel.
»Was wollt ihr?« wiederholte der König und zog nun das Schwert. – »Dagobert, Lieber! Nicht du führe den ersten Streich! Steig aufs Roß und flieh. Nur du bist ja bedroht.« »Glaubst du, Kleine?« schrie der erste, Gallus war's, der Reißewolf. »Thu ihr nichts! – Wie ist sie so treu!« mahnte der vierte. »Was wir wollen?« begann der zweite wieder. »Leben wollen wir, nicht Hungers sterben. Kurz: ich bin das Bundeshaupt der Kleinleute deines Reiches, wo die Armen ebenso verrecken vor Not wie . . .« »Bisher in meiner Heimat Neustrien,« unterbrach Gallus. »Aber dort habe ich es gebessert, ich und mein Freund Ebroin, der dich grüßen läßt und dir das schickt . . .« Und er hob die Axt zum Streich. »Und das dir, Püppchen!« schrie der zweite. Und hob die scharfe Sichel gegen die Königin. Aber mit wütendem Bellen fuhr ihm Ryan an die Gurgel: er zerbiß sie: röchelnd fiel der Mörder. »Bestie!« schrie Gallus und spaltete mit der Axt dem treuen Tier den Schädel.
Da traf ihn des Königs Schwert in den Arm: er ließ die Waffe fallen. »Drauf, drauf!« kreischte er, außer sich vor Schmerz und Wut. »Drauf, sag' ich. Wollt ihr ihn siegen lassen: – entfliehen? König, die beiden sind Maurus und Hatto und wohnen in Remilly. So! Jetzt laßt ihn entkommen, daß er euch rädern läßt?«
Das wirkte. Beide Männer sprangen zugleich vor und schwangen zwei Kurzschwerter gegen Dagobert: den zur Rechten traf er zum Tode, aber der zweite stieß ihm gleichzeitig die Klinge ins Herz. »Schont der Frau!« stöhnte er noch. »Sie trägt ein Kind.« – »Dagobert! Ich will nicht leben!« »Sollst auch nicht, armes Täubchen!« höhnte Gallus und hob mit der Linken die Axt vom Boden auf. »Laß sie!« mahnte der noch übrige. »Du hörst ja: sie geht mit Kinde.« – »Eben deshalb. Soll sein Sohn ihn rächen? Wer den Wolf schlug, schlag' auch den Welp.« Und ein sausender Streich der Axt: – die weiße Stirn ward blutigrot: lautlos sank sie aus dem Sattel, einer geknickten Blume vergleichbar.
»Scheußlich!« schrie der andre. »Ich kann's nicht sehen! Sie war so schön! Ich will nichts von dem Blutgeld!« Und schaudernd floh er in eiligen Sprüngen querwaldein. Hinter ihm schlugen die nassen Büsche zusammen. »Desto besser!« sprach Gallus. »Behalt' ich alles allein. Denn die beiden Kerle« – er stieß mit dem Fuß an die Körper – »sind tot. Mausetot! Und – laß doch sehn! was trägt so ein Königspaar bei sich? Schmuck der Frau? – Der würde mich verraten. Aber Geld?« Er griff in das Ledertäschlein, das Dagobert von dem Wehrgurt niederhing. »Puh, leer! Ganz leer! Ein schäbiger König Habenichts! Jetzt rasch heim, zum Majordomus. Er wird zufrieden sein! Das war ganze Arbeit. Er, sie und der Königserbe.«
Noch auf dem Schlachtfelde von Laffaux hatte Ebroin mit der an ihm gefürchteten, rastlos vorwärts ans Ziel treibenden Thatkraft beschlossen, die Verfolgung sofort bis zur vollen Vernichtung des feindlichen Widerstandes fortzusetzen.
Aber der Sieger sollte verhindert werden, diesen seinen richtigen Gedanken auszuführen. Gerade wie er mit der Vorbereitung fertig war, seine gesamte Heeresmacht angreifend über die Grenze von Austrasien zu führen – Laon ergab sich am nächsten Tag, Metz sogar hoffte er in raschem Anlauf nehmen zu können –, trafen schlimme Nachrichten aus dem Westen und Süden, von Neuster und Burgund, im Lager ein.
Die Ausschreitungen des Bundes der Kleinleute waren doch keineswegs durch des Majordomus Maßregeln gedämpft. Nach Niederwerfung seiner inneren Feinde durch diese Bundesgenossen, hatte er freilich gar schnell der entfesselten, wilden Kraft, die er zu Hilfe gerufen, wieder Zügel und Zaum anlegen wollen: er hatte die Aufständischen aufgefordert, die Waffen niederzulegen, nicht mehr Bischöfe, Äbte und Seniores mit Feuer und Schwert zu bekämpfen, sondern die Forderungen der Abhilfe, der Erleichterung ihrer Lasten, des Schutzes gegen Willkür, im einzelnen aufgezeichnet, vorzubringen auf jenem großen allgemeinen Reichstag, den er demnächst zusammenberufen wollte und der alle gerechten Verlangen durch umfassende Gesetze gewähren sollte.
Manche der wilden Haufen verliefen sich auf diese Zusagen hin, die ihnen seine Sendboten zutrugen. Andre aber – und gerade die zuchtlosesten! – dachten nicht daran, sich damit zu begnügen: ihnen gefiel das monatelang getriebene Räuberleben viel zu sehr, um es freiwillig aufzugeben: in Rache, in Haß und auch in einfacher Lust an Raub, Totschlag, Brand, Gewalt jeder Art wüteteten sie fort und verjagten oder erschlugen gleich gar die abmahnenden Boten des Majordomus.
So mußte dieser sich entschließen, die Eroberung Austrasiens, die in diesen Tagen, zumal seit der Nachricht von dem Tode des jungen Königs und dem darauf erfolgten Auseinanderlaufen seines bei Metz versammelten Heeres, leicht durchzuführen schien, aufzuschieben und vor allem Ordnung und Ruhe im eignen Lande herzustellen.
Schwer fiel es ihm auf die Seele, daß er nun neben dem königlichen Heerbann gegen seine bisherigen – arg verwilderten – Bundesgesellen auch deren eigne Standesgenossen, deren Haufen er bei sich unter seinen Fahnen hielt, zum Kampf führen mußte: oft stiegen ihm Zweifel auf, ob sie ihm dazu Folge leisten würden? Denn Ungehorsam, Zuchtlosigkeit, Unbotmäßigkeit, die Neigung zu jeder Gewaltthat gegen die Reichen auch im eigenen Lande hatten sich sogar unter diesen Scharen vor seinen Augen gar schlimm spürbar gemacht. Unablässig drohten sie, seiner ehernen Faust zu entschlüpfen und unter der Leitung ihrer eigenen selbstgewählten und ihnen soviel näherstehenden Führer – zumal des Blutigels, des Brandhahns und des Reißewolfs – ihren wilden Leidenschaften wie früher zu fröhnen. Nur die Furcht vor Ebroins Strenge, vor seinen ihm treu ergebenen Lanzenträgern zumal, hielt sie in knirschendem Gehorsam.
Da wurde gemeldet, daß sogar in der Umgegend von Paris wüste Banden aufgetreten, daß die reichen und wehrlosen Klöster dort – wie Saint-Denis und Chelles – bedroht seien. Ebroin schickte sofort Herzog Hermengar mit einer Reiterschar voraus, diese Haufen, die sich zumal bei Meaux angesammelt hatten, zu zerstreuen; er folgte mit der Hauptmacht schleunig nach.
Mit Befriedigung fand er wie Saint-Denis so Chelles unversehrt: er schlug Lager in dem Walde zwischen diesem Kloster und der Stadt Paris; in diese wagte er nur die verlässigen Heermänner zu verlegen, die Kleinleute – er fürchtete ihre Plünderungsgelüste – behielt er nebst einem schwachen Häuflein seiner Lanzenträger bei sich vor den Mauern der Hauptstadt; er selbst fand Unterkunft in einer königlichen Villa nahe bei Chelles, da, wo später das »kleine Kloster« Montreuil (»Monasteriolum«) entstand. Am nächsten Tag schon wollte er das Heer weit gen Nordwesten führen, wo die Unruhen sich die Seine entlang ausdehnten.
Vorher begab er sich, solch schwerer Sorgen voll, in das Kloster, sich von Balthildis zu verabschieden: auf geraume Zeit, wie er fürchtete. Sie empfing ihn im Beisein ihrer Schwester: wie innig und wie traurig deren Blicke an ihm hingen, entging ihm diesmal wie bei jeder früheren Begegnung.
»Es ist hart,« seufzte die Königin, »die Waffen gegen die eignen Freunde zu wenden, gegen diese Bethörten, die böse Dämonen entkettet und aufgehetzt haben.« »Königin,« sprach der Majordomus, »du weißt nicht, wie scharf dies Wort mich trifft.« Und er gedachte jenes seines ersten Aufrufs in lodernden Zornesworten – zu Freiheit, zu Rache!
»Muß es denn sein?« fragte Gunthildis schüchtern.
»Es muß! Höret nur, was mir gestern alles gemeldet wurde: die wilden Banden der Touraine haben das Kloster der heiligen Maria bei Beauvais in Brand gesteckt und geplündert, den Bischof von Rouen haben sie – mit vielen seiner Geistlichen – am Altare gemordet, den Grafen von Bayeux in offener Schlacht geschlagen, sie leisten meinen Heerbannleuten blutigen Widerstand, ja, ganz in der Nähe hier bei Meaux sollen sie vor kurzem einen Herzog . . .«
Da eilte Vanning in das Gemach und rief: »Ja, ja, es ist richtig! Es war Herzog Hermengar!«
Da erbleichte die Königin: sie wankte, sie griff nach der Lehne des hinter ihr stehenden Stuhles: »Es war . . .?« stammelte sie. »Er war? – So ist Herzog Hermengar . . . tot?« »So ist's,« sprach Vanning traurig. »Er fiel mit vielen Wunden.« »O Gott! Weh mir!« schrie Balthildis und stürzte ohnmächtig in den Stuhl. Die Schwester kniete neben ihr nieder: »O was hast du gethan!« rief sie Vanning zu.
Sprachlos vor Staunen, wie geblendet und zugleich gelähmt von plötzlichem, grell erhellendem Blitzstrahl hatte Ebroin das mit angesehen – mit weit aufgerissenen Augen: jetzt erst fand er das Wort zu einer stammelnden Frage: »Was, . . . was ist das? Was bedeutet dieses wilde Weh? Was . . .?«
»Was?« rief die Schwester ausbrechend in einen Strom von Thränen. »O du blinder, blinder Mann, der nichts sieht als Macht und Ruhm. Was das bedeutet? Das bedeutet, daß sie diesen Hermengar geliebt hat mit der ganzen Macht ihrer Seele, all' diese Jahre lang.«
Ebroin stöhnte: er taumelte gegen die Thüre.
Da ward diese aufgerissen, ein Lanzenträger eilte herein und meldete: »Nein, Graf Vanning. Es war ein falsch Gerücht: ein andrer Feldherr fiel. Herzog Hermengar lebt: – eben steigt er die Treppe herauf.«
»Er lebt?« schrie Ebroin. »Ah, beim Satan! Er soll nicht leben! Sterben soll er – ihr Geliebter!«
Und er riß das Schwert heraus, stürmte aus dem Saal und stieß es dem ahnungslos nun auf der obersten Stufe Auftauchenden mit solcher Wucht in den Hals, daß der lautlos die ganze Treppe rücklings hinunterstürzte: rasselnd klirrten seine Waffen auf den Marmorstufen. Tot hoben ihn unten die entsetzten Wachen auf. Ebroin starrte ihm nach: dann eilte er, das bluttriefende Schwert in der Hand, in das Gemach der Königin zurück: an der Schwelle blieb er stehen.
Balthildis hatte sich soeben wieder aufgerichtet; mit großen, angsterfüllten Augen sah sie umher. »Es war ein Irrtum,« tröstete die Schwester, ihr die Schläfen streichend, »er ist nicht gefallen in der Schlacht.« »O Barmherzigkeit Gottes, Dank!« betete sie, gen Himmel blickend. »Nein,« sprach da eine Stimme, die sie nicht erkannte, so grabeshohl klang sie, bis Ebroin wiederholte: »nein, danke nicht! Er lebte eben noch, aber er sollte mir nicht leben. Erstochen hab' ich ihn, mit dieser Hand, ihn, der all' diese Jahre her der geheime Buhle deiner Seele war!« »Ermordet?« schrie die Königin sich hoch aufrichtend, »von dir? So sei verflucht vom Wirbel bis zur Sohle.« Und sie ballte die Faust und trat drohend einen Schritt gegen ihn vor.
Entsetzt brach er auf die Kniee nieder, der Helm fiel ihm vom Haupt. . .
Sie hob die Hand wie zum Schlage gegen sein Antlitz: – aber plötzlich sank sie, abermals ohnmächtig, in die Arme der Schwester.
Ein paar Tage darauf trafen sich gegen Abend in dem Wald, der düster – es war nun später Herbst und die entblätterten Bäume starrten traurig in die grauen Wolken – sich um das Lager und die Villa hinzog, vier Männer.
Von zwei Seiten her schlichen sie – je zwei – durch das dichte Gebüsch, den offenen Weg meidend, auf den die sinkende Sonne, durch die dunkeln Tannenzweige hin ein unheimliches Rot ergoß: Sonne, Himmel, Erde, – alles schien wie in Blut zu schwimmen. Behutsam reckten die zwei, die etwas früher angelangt waren, ihre Waffen winkend aus dem Gebüsch, sie gleich wieder zurückziehend: die beiden jetzt Herankommenden hatten das Zeichen verstanden; mit ein paar Sprüngen kreuzten sie den offenen Waldpfad und standen nun bei den Harrenden in dem dichten Strauchwerk.
»Leise, vorsichtig, Graf Hermenfred,« flüsterte einer der Ankömmlinge. »Ich meine, man ist uns auf der Spur. Dieser Vanning, wachbar für seinen Herrn wie ein Schäferhund, läßt uns kaum aus den Augen.« »Ein Glück, Herr Oberfalkenwart Hermenvech,« fügte der andre ebenso leise bei, »daß der Eber ganz verstört ist seit seiner letzten Blutthat.« »Seiner scheußlichsten,« knirschte der eine der beiden Jünglinge. »Sie soll nicht zwei Nächte noch ungerächt bleiben, oder ich sterbe!« drohte der zweite. »Wir sind ja eben erst eingetroffen: sag' an, was treibt er, Gallus?« – »Irres Zeug, Herr Graf! Er wird vielmehr umgetrieben! Seine Schärfe, seine Klugheit, seine rasche Thatenfreude sind von ihm gewichen. Er wankt ziellos bald durch die Gassen des Lagers, bald durch den Wald, stehenbleibend, mit sich selber redend . . .«
»Ja, ich sah ihn einmal – das hat man noch nie bei dem schäumenden Eber bemerkt! – in die neue Basilika bei dem Kloster treten, aus deren geöffneter Thür frommer, süßer Gesang psallierender Nonnen erklang.« – »Aber freilich, gleich stürzte er wieder – ganz hastig – hinaus und lief wie fliehend in anderer Richtung fort. Bald traten aus der Kirche die Frau Königin und ihre Schwester.« – »Man sagt, die Königin habe, als sie den Mord erfahren, laut geschrieen und getobt und habe Ebroin, dem Blutmenschen, geflucht.« – »Der aber habe laut flehend die ganze Nacht auf der Schwelle vor ihrer verschlossenen Thüre gelegen.« – »Da habe ihm endlich am Morgen die Schwester die Hand herausgereicht und verkündet: die Heilige nehme in christlicher Vergebung ihren Fluch zurück.« – »Aber sie werde nie des Mörders Antlitz wiederschauen, überhaupt keines Mannes Antlitz mehr.« – »Sie hab's geschworen.« – »Und das Gleiche ihre junge Schwester.« – »Und beide würden das Kloster niemals wieder verlassen.« – »Jener Fluch aber, obwohl zurückgenommen, soll ihm den Geist ganz verstört haben. Ich hörte ihn in seinem Schlafgemach – ich hatte vor dem Vorhang zu warten – Zwiegespräch halten: – ich dachte, mit Vanning: aber als ich eingelassen ward, da war er ganz allein: – ›Verflucht, verflucht von ihr!‹ hat er stets wiederholt.« – »Ja, er ist ganz verwandelt, wie irrsinnig ist er.« »Mag sein, daß endlich das Gewissen in dem Bluthund sich regt. Wie viele Morde belasten seine Seele!« sprach Hermenfred. »Wohl mahnte mich mein Beichtiger, die Rache Gott zu überlassen und den Gewissensqualen: – aber nein! Mit eigner Hand muß ich die Blutrache vollenden,« knirschte mit verhaltener Wut sein Bruder.
»Deshalb, Gallus, haben wir's auch nicht euch überlassen. – Nicht der hohe Lohn, den ihr verlangtet, hat uns abgeschreckt . . .« – »Wir zahlen euch, dir und dem Brandhahn hier, das Gleiche, führt ihr uns nur so zu ihm, daß wir's mit eignen Händen vollführen mögen.« – »Aber sagt: – dürfen wir euch auch vertrauen? So gut ihr jetzt euren Feldherrn verratet, so gut könntet ihr uns in seine Gewalt liefern wollen.« – »Ja, er hat doch wahrlich, so grausam er Adel und Bischöfe verfolgte, an euch Kleinen des Guten viel gethan.« »Das dank' ihm der Teufel,« schrie Gallus, der Reißewolf. »Er hat's ja nicht um unsertwillen gethan,« meinte der Rothaarige. »Er brauchte eben unsre Knittel, unsre Sensen gegen seine Feinde.« – »Hätt' er's ehrlich mit uns gemeint, hätt' er viel weiter gehen müssen gegen die Großen.« – »Aber all' unsere Verlangen danach – wir wollten den Klöstern und den Seniores alles nehmen! – hat er trotzig abgeschlagen.« – »Und unsern besten Genossen, den Blutigel . . .« – »Hat er schmählich hängen lassen.« – »Hängen zwischen zwei tote Hunde.« – »Und warum? Wegen einer Beute! Er hat ein paar Klosterkelche genommen.« – »Und meinen Vetter hat er gevierteilt. Warum? Nur weil er eine Nonne auf dem Altar zu Beauvais – . . . nun, sagen wir: etwas stark geküßt hatte.«
»Kleinigkeiten! Unser ganzer Haufe bat für die beiden, wir zwei voran. Ich erinnerte ihn, wie ich weiland seinem Hauptfeind Hektor das Gehirn verspritzt hatte.« – »Und ich mahnte, wie der Blutigel in der Erstürmung der Höhen an der Oise einen tödlichen Streich von des Blutigen eigenem Haupt gewehrt.« – »Half alles nichts! ›Der Dieb, der Altarschänder hängen!‹ hieß es.« – »Und sie hingen.« – »Und die gute Nachtfahre, die liebherzige, hat er erdrosseln lassen, weil sie einer gefangenen schönen Herzogstochter die Nase abschnitt. Warum? Nur aus gerechter Eifersucht! Der Raubrabe, ihr Schatz, hatte sich in das glatte Lärvchen ganz vergafft!« – »Hat der Grausame uns doch schon gezwungen, mit seinen Lanzenträgern zusammen gegen unsre eignen Brüder zu fechten, die ein paar Villen bei Meaux ausgebrannt hatten. Damals haben wir ihm Rache geschworen. Da thun wir nicht mehr mit.« – »So war's nicht gemeint, daß wir ihm helfen sollten, die Reichen beschützen.« – »Ganz anders lautete sein flammender Ruf zur Rache.« – »Er ist ein Verräter!« – »Drum fort mit ihm!« – »Ist er gefallen, – dann ist der letzte Schild zerschlagen, der die Kirchen und Klöster und die Schatzkammern der Seniores schützt!« »Dann,« lachte der Brandhahn, »dann wird erst recht flott geplündert.«
Bedeutungsvolle, besorgte Blicke tauschten die beiden vornehmen Seniores. »Gleichviel,« flüsterte Hermenfred dem Bruder ins Ohr, »wir haben keine andere Wahl: auch er nahm seine Helfer wo er sie fand.« – »Also, es gilt! Ihr erhaltet die verlangte Summe, sobald ihr uns dazu verholfen.« – »Und wann könnt ihr das?« – »Heute Nacht noch.« – »Um Mitternacht werden die beiden Wachen vor seiner Villa – bis dahin haben sie seine Lanzenträger – abgelöst von zwei aus unsern Bundesleuten.« – »Diese zwei werden wir sein.« – »Auch wir werden – statt unsrer Sicheln und Äxte – Lanzen tragen.« – »Das täuscht in der Nacht weithin.« – »Das andre ist leicht.« – »Er schläft allein?« – »Immer.« – »Aber jetzt: – auseinander!« – »Also vorsichtig!« – »Erst ihr nach rechts . . .« – »Dann wir nach links.« – »So. Still! Rasch!«
Spät am Abend dieses Tages saßen Ebroin und Vanning in dem Speisesaal im Erdgeschosse der Königsvilla bei ihrem freudlosen Nachtmahl.
Die Fenster waren geöffnet: so sah man von innen die Schatten der beiden Wachen, die draußen im Licht des Vollmonds, die langen Lanzen auf den Schultern, auf und nieder gingen. Man erblickte ihre langgestreckten Schatten an den Wänden der gegenüberliegenden Häuser, durch die herbstlichen Nebel vergrößert und man hörte den gleichmäßigen, eintönigen Schall ihrer Schritte.
Die beiden Freunde waren allein: Ebroin hatte die Diener zum Schlafen in das Hintergebäude entlassen, nachdem sie die Tafel abgeräumt; nur der hohe bronzene Weinkrug und die beiden altrömischen Silberbecher standen noch auf dem Tisch, auf welchem eine Hängeampel von mattem Opal, von der steingetäfelten Decke herabschwebend, weniger Licht verbreitete, als der voll durch das Fenster hereinflutende Mond.
Geraume Zeit hatte Schweigen geherrscht in dem weiten, aber niedrigen Raum. Ebroin hatte den gefüllten Becher, den ihm der Freund wiederholt hingeschoben, zur Seite gerückt, den Ellbogen auf den Tisch gestützt und in die offene Hand das mächtige Haupt, das in der letzten Zeit merklich ergraut war. »Trink, Freund!« mahnte Vanning. »Oder sprich doch! Nicht dies Schweigen und in dich Hineingrübeln! Was denkst du nur jetzt wieder?«
»Immer dasselbe. Immer das Alte. Es ist zum wahnsinnig werden! Stets das eine muß ich denken: – oder vielmehr die eine Kette von Gedanken – Glied in Glied gefügt – unlösbar – und stets das Gleiche!« – »Und das ist?« – »Sie! – Wie sie, diese Heilige, ein Segen für alle andern Menschen, nur für mich zum Fluche lebt, zur Ursache all' meiner Verschuldung geworden ist! Wie schuldlos, freudig floß mein Leben hin, großer, edler Pläne voll für meines Volkes Heil und die eigne Ehre, – bis ich auf jenem Strohlager vor der Kirche zu Saint-Denis die rührende Gestalt erblickte. Fluch, Fluch dem Tag und der Stunde . . .! Und doch: – nein! Dank und Segen über ihr geliebtes Haupt! Aber um sie hab' ich das erste Blut in Raub und Totschlag vergossen, um sie zuerst mich mit Schuld befleckt. Und einmal vom Blut berauscht . . . schritt ich weiter darin, immer weiter! Valerius! Und Leodegar und Gairin und andere!«
»Haben's die Hunde nicht verdient?« rief Vanning und that einen kräftigen Trunk.
»Gewiß! – Aber ich hatte Wollust in der Rache, in der grausamen Tötung. Und wie viele Häupter ihrer Freunde rollten, den ihrigen nach, in den Sand! Waren alle schuldig? Und dann: – ich habe den Brand, den die Kleinleute entzündet, nicht gedämpft, wie ich gleich zu Anfang gekonnt, gesollt; ich habe diese Flammen geschürt und auf meine Feinde geschleudert, bis die Gluten stark genug wurden, weit über diese hinaus – gegen meinen Willen! – zu wüten; nun schlagen sie mir drohend über dem Haupt zusammen. Ach, seit meine eignen Schützlinge mich damals verraten, mich, der sie befreien wollte, in Ketten geworfen, hat ein böses Gift mein einst so gesundes, so unschuldig Blut verderbt. Menschenhaß, Rache, Zorn, Wut: – es sind üble Gesellen und Gehilfen! Wie der Reißewolf und der Blutigel und die Nachtfahrt! – Und sie weichen nicht mehr aus meinen Gedanken am Tag und von meinem Traum und Pfühl des Nachts! Wohl kamen nochmal schöne Tage: die Ufer der Oise bei Compiegne und der Tannenbühl bei Laffaux! Aber jener unschuldige Königsknabe und sein Weib, – fällt nicht auch ihr Tod schwer in die Wagschale meiner Schuld? Das hatt' ich freilich nicht gewollt – oder doch nicht so gewollt; aber Ähnliches doch wohl! Und nun das Letzte, Ärgste! Der Dämon des Jähzorns, den ich gebändigt gewähnt hatte durch jahrelange Zucht, – er reißt sich plötzlich los – und wieder ist sie es, die Geliebte, die Heilige meiner Seele, um welche ich die letzte ach! wie die erste Blutschuld auf mich lade: ein wackrer Mann, oft mein Kampfgenosse in Krieg und Rat, er fällt, ein Opfer meiner unsinnigen Wut. O viel würdiger war er ihrer Liebe!«
»Ja, es ist ein schweres Unheil,« seufzte Vanning. »Aber du mußt es tragen, darfst nicht zusammenbrechen wie ein schuldbewußter Knabe. Auf dir ruht dieses Reich der Franken. Du mußt den Brand des Bürgerkriegs ersticken, du mußt jenen Pippin vollends unschädlich machen . . .« – »Pippin! Der Beneidenswerte! Der Mann ohne Falsch und Fehle, ohne Schuld und Makel! Und ich? Mir fluchen die Weiber, die Kinder im eigenen Land! Gestern hat mich aufs tiefste erschüttert – niedergestürzt – ein Kind! Du weißt, ich habe sie stets so gern gehabt. In Wasconien – in meiner guten Zeit! – liefen mir die Schwarzköpflein auf der Straße entgegen, so freundlich lachte ich sie an. Gestern gehe ich über den Platz an der Basilika: ein Rudel Kinder spielt auf den Stufen: ich gehe auf sie zu, ich reiche dem kleinsten Mädchen die Hand, das will einschlagen: – da reißt es die ältere Schwester heftig hinweg und ruft: ›Nicht! nicht! Lauft davon! Das ist ja der Bluteber: – Ebroin!‹ ›Ebroin, der Mörder!‹ schreit eine zweite. ›Ebroin! Der Gottverfluchte!‹ kreischen die andern und stieben auseinander wie die Tauben vor dem Habicht. O das hat weh gethan!« Und er legte beide Arme vor sich auf den Tisch und das schwere Haupt darüber.
»Bah, die Priester haben dir das Volk verhetzt.«
»Wehe, daß sie Ursache haben! Ich forschte nach: – ich ließ die Mutter des einen Kindes ermitteln. Ach, die Kleinleute haben ihr Haus verbrannt, ihren Gatten gemordet. Und der Vater des zweiten? Ein Freund Gairins: – hingerichtet – nur, weil er ein Freund Gairins! Ah, all' das drückt mir Hirn und Herz zusammen, wie mit ehernen Gewichten.«
Seufzend stand Vanning auf: »Du bist krank, Freund.« »Ja, an der Seele. Unheilbar!« erwiderte Ebroin, sich ebenfalls erhebend. »Das darf nicht sein! Du mußt gesund sein und schaffen für das Reich. – Höre, die Söhne des . . . nun, des Verstorbenen – eben Hermengars – sind eingetroffen in Paris, ja in dem Lager.« – »Sie wurden ja lang erwartet.« – »Wohl, aber . . . jetzt? Hüte dich! Du weißt das Blut des Vaters zu rächen . . .« – »Ist des Sohnes Pflicht. Wem sagst du das?«
»Drum eben! Sieh' dich vor! Mir ist, ich sah sie heute gegen Abend in einer dunkeln Gasse des Lagers beisammen stehen mit den Führern der Kleinleute, die . . .« – »Sind mir freilich nicht mehr gewogen.« – »Deshalb Vorsicht!« – »Ei, soll ich, auf meine alten Tage, anfangen, mich zu fürchten?« – »Biete den Hermengaringen Sühne: . . . das Wergeld . . .« – »Sie nehmen's nicht. Haben recht. Ich nähm's auch nicht. Aber ich will ihnen Kampf antragen, allen beiden zugleich: das können sie füglich annehmen und dann . . . Gute Nacht! Ich bin müde, denkensmüde, lebensmüde. Ich will versuchen zu schlafen.« – »Wo? In dem Gemach, – da hinter diesem offenen Saal?« – »Aber Vanning! Da draußen – siehst du die zwei Speere aus dem Nebel ragen? – wachen zwei meiner Lanzenträger. Und der beste Riegel ist mein Schwert: – es lehnt an meinem Bettpfosten. Gute Nacht.« Und er zog die Hängeampel an ihrer Doppelschnur herab und blies das Licht aus. »Und überdies – die Königin ließ mir durch ihre Schwester sagen: sie bete jede Nacht für mich. Ist das nicht, wie wenn ein Engel Gottes Wache hielte an meinem Lager? Ach, aber freilich! Sie betet nur für meine arme Seele im Jenseits, nach dem Tode. Und es giebt weder einen Engel noch einen Gott im Himmel. Sonst wäre mein Haupt nicht so schwer belastet. Schlaf wohl!« Und schweren, langsamen Schrittes ging er in das Schlafgemach und ließ die Vorhänge in der Thür hinter sich zusammenrauschen.
Vanning sah ihm traurig nach: »Er ist geknickt! Ist er gebrochen? Ah, ich hoffe, nicht. Allein man muß für ihn wachen. Er ist allzu sorglos!« Er bog sich zum Fenster durch den vom Mond durchlichteten Nebel hinaus auf die Straße. »Zwar die Lanzenträger . . . ich kenne sie beide – Benniko und Beling – . . . sind treue Männer. Aber es kann doch nicht schaden.«
Geräuschlos warf er seinen langen dunkeln Mantel dicht vor die Schwelle des Schlafgemachs, gürtete den Wehrgurt ab, zog die Klinge, legte sie neben sich auf die Schwelle, das Haupt auf den Mantel und schlief bald ein.
Auch daß da jenseit der Vorhänge Ebroin im Fiebertraum abgerissene Worte sprach, störte ihn nicht.
Bald nach Mitternacht huschten von der Straße her die Eingangstufen hinauf zwei Männer; die beiden Wachen auf der obersten Stufe, links und rechts von der Thüre, rührten sich nicht, als jene die angelehnte Pforte erreicht hatten.
»Nur keine Furcht,« flüsterte der eine Lanzenträger. »Sein Schwertgriff ist mit der Scheide an den Bettpfahl festgeschnürt,« fügte der zweite bei. Zwei leise Schritte: die Ankömmlinge standen in dem Saal, den das Mondlicht ganz erfüllte. »Halt! Es liegt ein Mann auf der Schwelle.« – »Er schläft.« Und beide zückten die Waffen, der eine ein gotisch Schwert, der andre eine bretonische Streitaxt. »Nein, er schläft nicht!« schrie Vanning aufspringend. »Flieh, Ebroin! Mörder! Rette dich! Zu Hilfe, Wachen!« Er stieß den einen der Angreifer – den mit der Streitaxt – nieder: aber im selben Augenblick durchbohrte ihm der andere das Herz und sprang durch die Vorhänge in das Schlafgemach.
Wohl mühte sich Ebroin, durch den Schrei Vannings jäh geweckt, mit aller Kraft, aber doch vergeblich, das siebenfach mit dem Griff an den Bettpfahl gebundene Schwert loszumachen oder die Klinge zu ziehen: und während dieser verzweifelten Anstrengung traf ihn ein Stoß in den rechten Arm: aber er ließ nun das Schwert, ergriff mit der Linken den vor dem Bette stehenden schweren Fußschemel von Eichenholz, wehrte mit diesem die Stiche des Angreifers ab und schmetterte zuweilen wuchtige Hiebe auf dessen Haupt und Arm.
»Horch, du! Der wehrt sich,« flüsterte der Brandhahn draußen. »Das dauert zu lang,« grollte der Reißewolf. »Kommt er durch, sind wir Wächter verloren.« – »Rasch! Hinein!« Beide stürmten in das Haus mit geschwungenen Speeren – über Vannings Leiche – in das Schlafgemach. Ein Lanzenstich lähmte Ebroins linken Arm, er ließ den Schemel fallen. Nun stieß Hermenfred zu: »Das schickt dir mein Vater,« rief er. »Und das das Volk der Franken!« sprach der Brandhahn.
»Und das der Stand der Kleinleute!« flüsterte der Reißewolf. Das traf ins Herz. »O Balthildis!« stöhnte er noch und stürzte rücklings tot auf das Lager.
Sorgenvoll saß auf der obersten Stufe der Freitreppe seines Landhauses Victoriaca an der Mosel bei Trier Graf Pippin und sah dem Gleiten des Flusses im Abendscheine zu.
Noch immer trug er den Schwertarm in der Binde; die Wunde schien noch zu schmerzen: denn zuweilen langte er mit der Linken darauf.
Neben ihm stand sein Oheim, der Bischof Chlodulf von Metz, der ihm die Hand auf die Schulter legte und wohl eben ermutigend zugesprochen hatte.
»Gewiß,« erwiderte Pippin, »du hast recht. Und weit weise ich von mir alle Verzagtheit. Mein erster Anlauf ist mißglückt, meine erste Schlacht ward eine Niederlage: aber das entmutigt mich nicht. Wir Arnulfingen sind ein zäh' Geschlecht: auch unsern Ahnen mißlangen die ersten Schritte, allein Ausdauer fühlte sie zum Sieg.« »Und Gottvertrauen,« mahnte der Bischof. »Ja, volles Gottvertrauen! Nicht eine Stunde könnte ich leben ohne das. Gott ist allwissend: so weiß er auch, daß ich nichts für mich begehre, nur das Wohl dieses armen, kampfzerrissenen Frankenreichs suche.« – »Und auch dessen Heil nur mit reinen Mitteln, auf gerechten Wegen . . .« – »Die Gott wohlgefällig sind wie der Zweck. Das ist es, siehst du, was mich oft staunen macht bei den Geschicken meines Nebenbuhlers, – meines Überwinders! – dieses gewaltigen Ebroin: wohl glaub' ich – weiß ich! – von ihm, daß auch er des Reiches Heil anstrebt: – wie er es eben sich vorstellt! – Aber er schreitet zu seinen Zielen auf blutigen Wegen, mit freveln Mitteln: und siehe da, der Himmel, der mich hemmt auf meinen gerechten Pfaden, – ihm wirft er Kranz auf Kranz auf den Helm. Ach, wie lange noch? Ich gestehe, nur ungern, zögernd, greife ich gegen ihn nochmals zu den Waffen, das Werk meines Lebens durchzukämpfen: die Vereinung des ganzen Frankenreiches unter austrasischer Herrschaft: solang jener böse, aber eherne Held das Schwert schwingt, das uns so schwer getroffen hat dort bei Laffaux, ist's ein harter Entschluß! Und wir sind in den gleichen Jahren: – leicht mag geschehn, daß er mich überlebt. Und wer ist dann der Erbe meiner Macht, meiner Gedanken? Ein Knabe!«
»Ergieb dich in Geduld in die Fügungen des Herrn. Wie leicht mag er jenen blutigen Eber fällen in der Vollblüte seiner Kraft und seiner Sünden! Und dein Knabe, Karl, – mir ist, in ihm hat Gott unser Haus und unser ganzes Volk gesegnet: so kühn, so rasch und bei so jungen Jahren – kaum sechzehn – schon so klug. Sieh, da kommt er – von der Metzer Straße her – in den Hof gesprengt auf seinem weißen Rößlein! Wie ihm das goldne Haar das junge Haupt umfliegt! Ei, wie eilig hat er's gehabt! Wie seine roten Wangen glühn! Schon eilt er die Stufen herauf.«
»Vater,« rief der schöne Knabe atemlos, schon auf der untersten Stufe. »Vater, ich heische Botenlohn. Ich bringe frohe, große Kunde.« Hier mußte er innehalten, der Atem versagte ihm. »Was ist geschehn?« – »Was bringst du?« So fragten Vater und Großohm zugleich.
»Tot liegt Ebroin, der grimme Eber! Zuverlässige Boten meldeten's nach Metz.« – »Tot?« – »Gestorben?« – »Erschlagen: von Bluträchern, von den Söhnen Hermengars, und verraten von seinen eigenen Kleinleuten. Sie sind ohne Führer da drüben, völlig uneins. Zwei, drei Hausmeier bekämpfen sich um das Erbe der Macht!«
»Ebroin tot?« rief Pippin, aufspringend von dem Stuhl. »Das ist der Ruf des Herrn! Auf, Oheim, rasch, Karl, versammelt alle Reiter dieses Hofes: sie sollen als meine Boten davonjagen. Aufbieten sollen sie den Heerbann von ganz Austrasien! Die Stunde kam! Wir ziehn zu Feld! Nun gilt's, das Frankenreich emporzuziehn durch diese Hand.«
»Vater, Vater, aber ich darf diesmal mit!«
»Ja,« lächelte der, »du und dein Hämmerlein, – ihr dürft fortan immer mit!« – »Hei, dann geht's besser, du sollst sehn, als bei Laffaux.« »Du aber, Bischof,« fuhr Pippin feierlich fort, »ich bitte dich: du segne dies, mein Schwert.« Und er kniete nieder, zog das Schwert und hielt die nackte Klinge vor sich hin.
»Ich segne und ich weihe diese Waffe! Ich segne sie mit Sieg: höre mich, Gott: so wahr Pippin, der Selbstsucht bar, nur das Heil des Frankenreiches sucht, so sicher sende ihm den Sieg.«
»Amen!« sprach Pippin aufspringend und das Schwert in die Scheide stoßend. »Ich falle oder ich vereine wieder die hadernden Reiche.« »Und wohin, Vater?« fragte der junge Karl, »wohin sollen die Heerbanne ziehen, die Aufgebote eilen? Wohin zielt dein Stoß?« Pippin sann eine Weile. »Nach Tertri. Denn ich vernahm zuletzt, König Theuderich und sein Hof lagert bei Tertri. Den Königsknaben muß ich haben, in seinem Namen zu herrschen: aus seinem geschlagnen Heere greif' ich ihn heraus. Auf, Karl, mein Sohn! Laß die Hörner schmettern. Auf! Nach Tertri geht der Zug! Und der Herr Christus zieht mit uns!«