
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Worauf die Welt seit Jahrzehnten gewartet hatte, das ist nun beinahe über Nacht zur Tatsache geworden. Der Brand in Asien hat auch die Neue Welt ergriffen.
Mit einem Schlag steht ein neuer Sektor unseres Planeten in Flammen, entsteht ein Kriegsschauplatz von unvorstellbaren Dimensionen. Von der pazifischen Küste Nordamerikas über zwei Drittel der Erdkugel hinweg bis zu den atlantischen Gestaden Nordafrikas reicht dieser Kampfgürtel eines wahrhaftigen Weltbrandes. Denn das schwelende Feuer von Indien, Arabien und Afrika ist im selben Augenblick zu heller Flamme aufgeschossen. Japan hat zwischen sich und Europa einen Feuerriegel gelegt, hinter dem es seinen Kampf mit Amerika ohne wesentliche fremde Einmischung austragen kann.
Von Rußland ist nichts zu fürchten. An der mongolischen Front ist es erledigt, und in Turkestan kämpft es mit der restlichen Kraft.
Wieder hat Japan auf die Kavaliersgeste einer Kriegserklärung verzichtet und an Stelle einer Ankündigung die Tat gesetzt.
Es hat die Verhandlungen wegen der Flottenaktion gegen Manila abgebrochen und die Philippinen unter japanischer Oberhoheit stehend erklärt. Gleichzeitig haben japanische Landungstruppen die amerikanische Insel Guam besetzt, die Kabelverbindung mit dem Kontinent unterbrochen. Nun ist die Kriegslawine nicht mehr aufzuhalten. –
England, von diesem japanischen Vorstoß direkt bedroht, stärkte der amerikanischen Kriegspartei den Rücken.
Und nun nimmt das Schicksal seinen Lauf. – –
Wenn auch durch das zu erwartende Eingreifen Englands die Zahl der gegnerischen Kampfmittel steigt, so sind doch Japans Chancen immer noch gut. Denn Amerika ist trotz seiner gewaltigen Flotte und seiner riesigen Luftgeschwader kein ebenbürtiger Gegner, weil das Volk versagt.
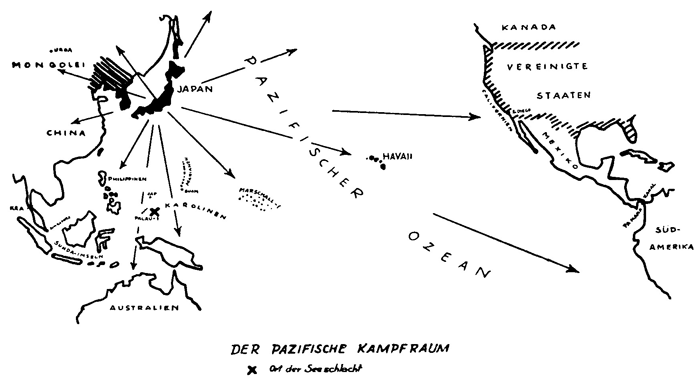
Schon die ganze überstürzte Mobilmachung klappt nicht. Die sehr scharfen Mobilmachungsbestimmungen, die jeden Kriegsgewinn, jede Lohn- und Preissteigerung unmöglich machen und die ganze Bevölkerung in den Dienst der Heeresleitung einspannen sollten, stoßen in den meisten Staaten auf einen nicht mitberechneten, erbitterten Widerstand. Die Industriearbeiter, die sich um die Errungenschaften ihrer Aufstandsbewegung betrogen fühlen, die Farmer, die durch Heereslieferungen ein Ansteigen ihrer Lebensmittel- und Wollepreise erhofften, die Hyänen der Börse, die sich auf fette Geschäfte eingestellt haben, pazifistische Frauenklubs, selbst Studentenvereinigungen, natürlich die ganze kommunistische Partei und auch die Neger verhindern eine durchgreifende Einführung der notwendigen Mobilmachungsbestimmungen. Es sind drakonische Maßnahmen des Präsidenten, der Einsatz von riesigen Polizeitrupps und Teilen der Armee notwendig, um einigermaßen Ordnung zu schaffen. In den großen Städten der östlichen Staaten und in vielen Landbezirken kommt es zu richtigen Schlachten zwischen der Bevölkerung und den Machtmitteln des Staates.
Und noch ein anderer Umstand lähmt die Schlagkraft Nordamerikas. Auch jetzt noch hält die Regierung an der Forderung fest: die atlantische Küste darf nicht entblößt werden. Was in früheren Zeiten geraten erschien, ist heute, da England selbst im Existenzkampf steht, sinnlos geworden. So werden beträchtliche Teile von Armee und Marine dem Kampf im Stillen Ozean entzogen.
Der Grund, weswegen Bars in der Nacht so plötzlich gestartet war, weswegen auch die Kriegsschiffe den Hafen verlassen hatten, war der: auf Hawaii hatte man auf Grund verschiedener Anzeichen den Eindruck, daß die dort ansässigen Japaner – es sind über die Hälfte der Gesamtbevölkerung – etwas im Schilde führen. Auffällige Zusammenkünfte mit Eingeborenen an entlegenen Stellen der Inseln, da und dort entdeckte Anschläge auf militärische Anlagen, bei einer Razzia der Polizei in die Hand gefallene Pläne vom Kriegshafen Pearl Harbour, und eine ganze Reihe weiterer Vorfälle haben den Gouverneur nervös gemacht. Da außerdem von Agenten der Marineleitung eine Verstärkung der japanischen U-Bootsbasis auf den Marianen und Marschall-Inseln gemeldet worden war, entschloß man sich, das Flugzeuggeschwader und weitere Teile der Flotte nach Hawaii zu entsenden.
Bars ist die Führung der Kampf- und Schlachtflugzeuge übertragen worden. Er fliegt auf dem Weg nach Hawaii in der Maschine des Geschwaderkommandanten, des alten erprobten Jenkins. Das ist ein zweimotoriges Ganzmetall-Großflugboot mit Bordfunker und zwei Maschinengewehrschützen. Obwohl zum Teil gepanzert und mit vier Maschinengewehren und einem kleinen Geschütz ausgerüstet, ist es in den Augen des Panthers mehr ein ›bewaffneter fliegender Kommandostand‹ als eine Kampfmaschine. Aber Jenkins ist sehr stolz darauf.
Die Maschinen machen alle ihre 450 Stundenkilometer, zum Teil mehr. Für sie ist also der Weg nach den Inseln keine große Sache. Weit auseinandergezogen braust das Geschwader über den Ozean. Jenkins macht seinen Führer der Kampfflugzeuge mit den Eigentümlichkeiten der Inseln und mit denen des Kommandanten von Pearl Harbour vertraut.
»Sie müssen nicht alles glauben, was er sagt; manchmal sieht er Gespenster. Seit dem großen Explosionsunglück wittert er überall Gefahr und Hinterhalt. Schließlich, ganz einfach ist das ja nicht mit den Japanern, die da überall herumwimmeln.« Bars hört nur mit halbem Ohr zu. Er sieht hinunter auf die blaugrüne See, über der lange dunkle Wolkenschatten liegen. Das Wetter ist stürmisch geworden, in langen Zügen laufen die schaumgekrönten Wellen. Tief hängende Wolkenfetzen wischen unter den Flugzeugen hin, verdecken zeitweise die Sicht. Ein großer Dampfer mit weißen Deckaufbauten und leuchtend roten Schornsteinen kämpft sich durch die rauhe See. Hoch spritzen die Brecher über das Vorschiff, weiß quirlt das Heckwasser hinter ihm her. Auf Anfrage meldet er Name, Reederei und Ziel.
»Der kommt von Honolulu, bringt ängstlich gewordene Familien nach San Franzisko,« brummt Jenkins nachdenklich.
»Ist es schon so weit?« fragt Bars.
»Sie meinen, die letzten Ratten …« der Kommandant sieht ihn an, »hm, könnte schon sein.«
Seit einiger Zeit steht man in Radioverbindung mit einem Marineluftschiff, das auf gleichem Kurs voraus liegt. Der Führer des Schiffs ist ein alter Freund von Jenkins. Die beiden unterhalten sich ein bißchen.
»Soll ich für dich Quartier machen? In spätestens einer Stunde haben wir euch Wolkenschleicher eingeholt,« neckt Jenkins den Luftschiffkommandanten.
Nach fünfzig Minuten, gerade als das Schiff steuerbords querab und etwas tiefer steht, bringt der Funker eine Meldung.
»Donnerwetter, Oberst, da lesen Sie mal!« Jenkins reicht Bars den Zettel hin. Der liest: »Der Truppentransportdampfer ›Boston‹ ist vom Atlantik kommend, in der Mirafloresschleuse des Panamakanals aus bisher unerklärlicher Ursache explodiert. Die Schleusentore und große Teile der Mauern sind zerstört. Der Kanal für längere Zeit unpassierbar.«
»Verdammt,« knirscht Jenkins, »diese Hunde …«
»Sie meinen …«
»Da gibt's gar nichts zu meinen,« poltert der Alte los, »da stecken die Gelben dahinter, darauf können Sie Gift nehmen!«
Bis sich aus dem Dunst des aufklarenden Horizonts der Eiszacken des Mauna-Kea erhebt, wird kein Wort mehr gesprochen. Um so lebhafter ist der Funkverkehr zwischen dem Geschwader und den Stationen Pearl Harbour und Diamond Head. Die Liegeplätze werden bekannt gegeben, das Geschwader soll geteilt, die einzelnen Staffeln auf Oaku und Hawaii verteilt werden. Gegenordres kommen, neue Anweisungen werden gegeben, dazwischen meldet eine Maschine Motordefekt – es ist ein ziemliches Durcheinander. Schließlich klappt dann doch alles noch, nur die vorzeitig zu Wasser gegangene Maschine geht verloren.
*
Während das Geschwader in Hawaii liegt, bricht das Gewitter los.
Auf den Philippinen schlägt der Blitz zuerst ein.
Der zweite springt über den Ozean und entzündet die Sandwich-Inseln. In tollkühnem Angriff brechen japanische U-Boote in die enge Einfahrt des Kriegshafens ein, speien ihre furchtbaren Torpedos aus. Ein Entkommen ist für sie nicht möglich, wohl auch nicht vorgesehen, sie sprengen sich nach dem letzten Schuß selbst in die Luft. Diese vier Boote vernichten zwei zu Anker liegende Großkampfschiffe, drei Panzerkreuzer und Kreuzer, das Flugzeugmutterschiff »Tonopah« und eine Reihe Torpedofahrzeuge. Andere Boote haben unbemerkt vor den Hafeneinfahrten Minensperren gelegt, denen weitere Fahrzeuge zum Opfer fallen. Andere wichtige Seegebiete um die Inseln werden ebenfalls durch Ruinenfelder verseucht.
In der Nacht erscheint ein Bombengeschwader, von Kampfstaffeln begleitet. Durch Horchgeräte von weitem erkannt, wird es noch über der See von amerikanischen Kampfmaschinen gestellt. Während des Luftgefechts gelingt es einigen Bombenträgern, den Kriegshafen und die Stadt zu erreichen. Von ein paar Dutzend Scheinwerfern gefaßt und festgehalten, werden sie aber vom konzentrischen Abwehrfeuer heruntergeholt, bevor sie größeren Schaden anrichten können. Doch haben andere auf verschiedene Plätze der Inseln ihre vernichtende Last abgeladen. Ob auch Tanks von Windmühlenflugzeugen abgesetzt worden sind, läßt sich nicht ermitteln.
Die Luftkämpfe verlaufen ziemlich ergebnislos. Die Gegner verlieren sich in der Dunkelheit aus den Augen.
Der überraschende Vorstoß der U-Boote und Flugzeuge ist der Auftakt zu einem Generalangriff auf dieses Kernwerk der amerikanischen Brücke über den Ozean. Die Japaner auf den Inseln stehen wie ein Mann auf, sind über Nacht bewaffnet, fallen von rückwärts über ihre Feinde her. Mit beispiellosem Einsatz vernichten sie in tollkühnen Unternehmungen militärische Anlagen, legen Camps und Siedlungen in Asche, zerstören Lagerplätze und Werkstätten.
Auf allen Inseln das gleiche Bild. Bald sind die Amerikaner, obwohl sie über die überlegenen Kampfmittel verfügen, in die Verteidigung gedrängt. Von See aus unterstützen immer neue überraschende U-Bootsvorstöße den Kampf im Innern, stören die Verbindung mit dem Festland in empfindlichster Weise. Nächtliche Bombenangriffe suchen den Kriegshafen und die Truppenstandorte heim. Durch Spezialflugzeuge werden die Japaner auf den Inseln mit Kriegsmaterial, vor allem mit leichten Tanks versorgt. Wenn auch der Angreifer hierbei empfindliche Verluste erleidet, so wird doch die Lage der Amerikaner immer bedrohlicher. Mit dem Einsatz von Kampf- und Bombengeschwadern und vom Festland herangebrachten Tankformationen gelingt es nicht, das Feuer zu ersticken. Wohl werden da und dort Erfolge erzielt, aber der Einsatz steht in keinem Verhältnis zu dem unter großen Verlusten Erreichten. Dieser Sonderkriegsschauplatz bindet bedeutende Teile der amerikanischen Heeresmacht, zersplittert ihre Kräfte. Ungeheuer aber ist die moralische Wirkung auf die Staaten. Amerika fühlt sich bereits im eigenen Lande bedroht. Geht Hawaii verloren, dann wird Kalifornien, das Mutterland selbst, Kriegsschauplatz!
Inzwischen vollendet sich das Schicksal der geringen amerikanischen Besatzungen auf den Philippinen. Ein Entsatzversuch der Flotte wird von den Japanern vereitelt. Es gelingt lediglich, Teile der Luftstaffeln und einige Schiffe zu retten. Alles übrige fällt in die Hände der Japaner. Die Selbständigkeit der Inseln war nur von kurzer Dauer. Statt der Sterne und Streifen wehen jetzt rote Sonnenbanner über dem Land.
Die Besetzung der Inseln hat die im Südseeraum interessierten europäischen Mächte und auch Australien alarmiert. England, das in Arabien um seinen Weg nach Indien kämpft, wird nun auch von Osten her in seinem Kronjuwel bedroht. Für die Niederlande bedeutet der Japaner auf den Philippinen den Feind vor den Toren. Die Sunda-Inseln liegen seinem Zugriff preisgegeben. Auch Australien kann die ungeheure Gefahr, die hier den weißen Völkern droht, nicht gleichgültig sein. Und Frankreich, das für Indochina fürchtet, ist in seinem östlichen Kolonialbesitz schwer bedroht. Doch ist die Republik nicht in der Lage, sich dort wirkungsvoll zu verteidigen. Die Revolution in der Heimat und die verzweifelten Kämpfe in Nordafrika nehmen ihre ganze Kraft in Anspruch.
Die Auseinandersetzung Japans mit den Vereinigten Staaten von Nordamerika zieht sie alle mit hinein in das ungeheure Ringen um die Macht im Stillen Ozean. Den Japanern entsteht in ihrer rechten Flanke ein neuer Feind. Europäische und australische See- und Luftflotten greifen in den Kampf ein.
Östlich der Philippinen, im Raum zwischen den Palau-Inseln und den Molukken ballt sich das Gewitter zusammen.
Die Streitkräfte der Vereinigten Staaten sammeln sich in der Gegend zwischen Guam, das auch von den Japanern besetzt ist, und den Karolinen. Es sind die von den Philippinen kommenden Schiffe und Flugzeuge und Teile des pazifischen Geschwaders. In der Celebes-See und um die Molukken herum steht die englisch-holländisch-australische Flotte.
Oberst Bars, an Stelle des bei den Kämpfen um Hawaii schwer verwundeten Jenkins zum Führer eines neu zusammengestellten Kampf- und Bombengeschwaders ernannt, ist mit seinen Maschinen auf dem Flugzeugmutterschiff »Theodor Roosevelt« stationiert. Ein weiteres Kampf- und Aufklärungsgeschwader, aus schweren Hochseeflugbooten bestehend, das vor Guam gelegen hatte und noch vor dem Fall der Insel zum pazifischen Geschwader beordert worden war, fährt von Spezialschleppern gezogen auf dem Master mit. Es ist dies das erstemal in der Geschichte der Marine, daß Flugboote auf diese Weise von der Flotte mitgenommen werden. Ein Wagnis des Admirals, der auf diese Verstärkung seiner Luftstreitkräfte nicht verzichten wollte. Er handelt damit gegen den Befehl, die Flugboote nach Hawaii zurückzusenden.
Die Flotte ist auf dem Marsch nach Südwesten. Die »Roosevelt« fährt im Verband des zweiten Geschwaders, das an der Spitze liegt. Dahinter beim dritten Geschwader befindet sich ein zweiter Flugzeugträger, die alte »Enterprise«. Die lange Kiellinie der Schlachtschiffe wird von Zerstörern und U-Booten und dem Rudel der Schnellboote umkreist. Weit draußen, an der flimmernden Kimm kaum noch wahrnehmbar, stehen die Kreuzer und Torpedobootsflottillen. Voraus über der Aufklärungsgruppe fährt das Marineluftschiff »Akron II«. Die See ist seit Tagen vollkommen ruhig, vom wolkenlosen Himmel brennt eine unbarmherzige Sonne herab. Alle Metallteile sind glühend heiß. Der Fahrtwind kühlt nur wenig. Unter Deck ist es unerträglich. Wer irgend kann, liegt im Schatten der Aufbauten, läßt sich immer wieder mit Wasser bespritzen. Am bedauernswertesten sind die startbereiten Besatzungen, die in ihren Lederanzügen, von der Hitze völlig aufgelöst in ihren Bordstühlen liegen.
Bars, im Tropenhelm und nur mit Hemd und Hose bekleidet, sieht neben den Marinemannschaften wie ein »Badegast« aus. Das für einen Flieger langsame Dahinschleichen der großen Kriegsschiffe macht ihn nervös. Er spürt die Spannung über den Weiten des Ozeans, fühlt fast körperlich die Kraftlinien, die von den sich nähernden Flotten ausgehen. Er weiß, daß irgendwo südwestlich das europäisch-australische Kontingent steht. Die Nähe des japanischen Geschwaders ahnt er nur.
Man weiß seit Tagen nichts Bestimmtes vom Gegner. Bei den letzten Aufklärungsflügen ist immer nur die Anwesenheit kleinerer Gruppen von Kreuzern, Zerstörern und U-Booten bei der Insel Jap festgestellt worden. Wo sich das Gros der Linienschiffe und Schlachtkreuzer befindet, bleibt im Dunkel. Aber der Admiral vermutet auf Grund verschiedener Umstände die japanischen Streitkräfte im Raum der Palau-Inseln.
Bars steigt im ganzen Schiff herum, kontrolliert die Aufzüge, mit denen die unter Deck befindlichen Maschinen heraufbefördert werden, die Benzin- und Öldepots, macht den Flaks und Scheinwerfern seinen Besuch und landet schließlich in der F.T.-Zentrale. Hier ist es nicht so drückend heiß, eine Kühlanlage macht den Aufenthalt in diesem Raum erträglich. Der diensttuende Funker sitzt trotzdem schweißüberströmt an seinen Apparaten. Bars nimmt still neben dem Tisch Platz, überfliegt die letzten Meldungen. Jeder Funkverkehr zwischen den Schiffen des Geschwaders ist untersagt, damit seine Anwesenheit nicht vorzeitig verraten wird. Nur in allerdringendsten Fällen darf von der F.T.-Einrichtung Gebrauch gemacht werden. Die notwendige Befehlsübermittlung geschieht durch Flaggensignale und Flugzeuge.
Der Funker horcht angespannt in den Raum hinaus, sucht vom Feind Wellen einzufangen, die über seinen Standort und seine Bewegungen Aufschlüsse geben könnten. Während er an seinen Apparaten hantiert, spricht er halblaut mit dem Oberst: »Da muß ein großer Dampfer ganz in der Nähe stehen – er spricht anscheinend mit Jap. Ein toller Bursche, funkt in einem Höllentempo. Japanisch. Chiffriert.«
Dann nach einer Pause: »Auf Mindanao ist allerhand los. Kann auch Ilo-Ilo sein. Da quatscht alles durcheinander.«
Bars fragt den Mann: »Können Sie mal Babeltoab anpeilen?«
»Augenblick mal.« Der Funker sucht die Station zu bekommen; erst vor zehn Minuten hat er den Schiffsstandort erhalten, vielleicht gelingt es, Babeltoab zu finden.
Bars nimmt sich einen Kopfhörer, stülpt ihn über die Ohren. Da meldet sich der Fernsprecher, ärgerlich greift er danach, hebt die eine Muschel hoch, legt den Telefonhörer an: »Hallo?«
»Hallo, ist der Oberst im F.T.-Raum?«
»Ist da, was soll's?«
»Winkspruch vom Flaggschiff, der Oberst wird sofort zum Admiral gebeten.«
»Gut, ich komme.«
Ein Torpedoboot legt sich längsseits, Bars steigt über und fährt zum Flaggschiff. Dort empfängt ihn der erste Offizier: »Oberst, wir haben Nachricht vom Gegner!«
In der Offiziersmesse hat der Admiral die Kommandanten versammelt: »Meine Herren, wir haben Funksprüche aufgefangen, aus denen mit Sicherheit die Anwesenheit eines größeren japanischen Geschwaders bei den Palau-Inseln hervorgeht …«
Eine halbe Stunde später weiß jeder Mann auf den amerikanischen Schiffen, daß es los geht. Daß man aber wahrscheinlich einen weit überlegenen Gegner vor sich hat, wissen nur die Kommandanten.
Das bei der Aufklärungsgruppe stehende Luftschiff bekommt durch ein Flugzeug – F.T. ist immer noch untersagt – einen Befehl überbracht. Die hierzu verwendete Maschine hängt sich an den Anflugbügel, der sich unter dem Schiff befindet. Durch eine Art Rohrpost wird dann die Kapsel mit dem schriftlichen Befehl zum Kommandanten hinaufbefördert. Gleich darauf heulen die gedrosselt gewesenen Motoren auf, die »Akron« nimmt Kurs nach Süden und entschwindet langsam im Dunst. Sie steuert zunächst, um nicht japanischen Flugzeugen in die Hände zu laufen, Neu-Guinea an; von dort nach Westen abbiegend, soll sie mit den nördlich von Halmahera vermuteten europäisch-australischen Geschwadern in Verbindung treten. Der amerikanische Admiral bittet seine Verbündeten, mit ihm an einem näher bezeichneten Punkt östlich der Palau-Inseln zusammenzutreffen.
Inzwischen entsendet Bars eine der Aufklärungsstaffeln nach der Inselgruppe. Die Flugzeuge haben den Auftrag, in der größtmöglichen Höhe – man rechnet bei den gegebenen Luftverhältnissen mit neuntausend Metern – die Inseln zu überfliegen und den Standort des japanischen Geschwaders festzustellen. Die neu eingeführten schwingungsfreien starken Ferngläser und »Nebelaugen«, Apparate für Infrarot-Photographie, ermöglichen auch unter ungünstigen Verhältnissen eine befriedigende Durchführung dieses Auftrags.
Wie Nordpolfahrer vermummt, mit elektrischer Heizung und künstlichen Atmungsgeräten, mit einer taucherhelmähnlichen Kopfbedeckung ausgerüstet, klettern die Besatzungen schwerfällig in ihre Boeing-Eindecker. In kurzen Abständen starten die Maschinen vom Deck der »Roosevelt« und ziehen steil weg. Nach wenigen Minuten sind sie im blauen Glanz des Himmels verschwunden. Gleichzeitig wird eine Staffel der Flugboote nach Jap und das Gebiet nördlich davon zur Aufklärung entsendet.
Oberst Bars steht mit dem Kommandanten der »Roosevelt« auf dem an Steuerbord aufragenden Befehlsstand. Vor ihnen, von der sinkenden Sonne in Bronzefarben getaucht, schieben sich die Kolosse der Linienschiffe durch die funkelnde See. Ein goldener Dunst von schwachem Ölrauch lagert über dem Wasser.
»Wo stehen wir eigentlich?« fragt Bars. »Meiner Schätzung nach müßten jetzt östlich von uns die Aurepik-Inseln liegen.«
»Das dürfte wohl stimmen, aber wir stehen zu weit davon ab, um sie sehen zu können.«
Bars beugt sich über die Karten: »Was sind das eigentlich für Inseln?«
»Eine trostlose Gegend, Oberst, gehören zu den Karolinen; Korallenriffe, ein paar Palmen, nichts zu holen da als ein Leck.«
Dann schweigen beide, warten auf die Rückkehr der Flugzeuge.
Eben als die Sonne als riesige rote Scheibe am glühenden Horizont versunken ist, und eine violette Tropennacht unvermittelt einbricht, stoßen die Flugboote herab. Ihre Meldung ist dürftig. Das einzig Interessante ist die Anwesenheit zweier japanischer Luftschiffe auf Jap. Größere Verbände der Flotte wurden nicht beobachtet.
Bars wartet jetzt auf seine Eindecker. Von ihnen erhofft er mehr.
Seit Stunden steht er auf der Brücke, läßt sich die weiche Nachtluft um das Gesicht streichen, lauscht und starrt in die Dunkelheit. Von weit her hört er das Summen der zurückkehrenden Aufklärungsstaffel. Die Startmannschaften an Deck der »Roosevelt« bereiten alles zur Nachtlandung vor. Ein Übereifriger gibt mit dem Riesenscheinwerfer, der senkrecht nach oben strahlt, den zurückkehrenden Flugzeugen den Standort des Mutterschiffs an.
»Scheinwerfer blenden!!!«
Bars brüllt den unvorsichtigen Kerl an: »Sind Sie des Teufels, Mann, jetzt zu ›illuminieren‹! Wenn nun feindliche U-Boote in der Gegend sind? Sie sind wohl wahnsinnig geworden?!!«
Beim Schein der schwachen Deckbeleuchtung, die vom Wasser her nicht zu sehen ist, landen in vorbildlichem Manöver in kurzen Abständen nacheinander die Eindecker.
Aus ihren Meldungen geht einwandfrei hervor, daß sich bei den Palau-Inseln größere japanische Schiffsverbände versammeln. »Aus dem Gewimmel zwischen den Inseln und Riffen,« sagt der Staffelführer, »war schwer etwas Genaues auszumachen. Es war schon so dunkel, daß wir Mühe hatten, die Schiffe überhaupt zu sehen. Übrigens haben die Kerle bei unserem Herankommen sofort alles tadellos abgeblendet.«
»Haben Sie Luftkämpfe gehabt?« fragt ihn der Oberst.
»Nein, dazu ist es gar nicht gekommen, obwohl wir ziemlich tief heruntergegangen sind. Es waren wohl ein paar Japaner hinter uns her, aber rangekommen sind sie nicht.«
Die Flugzeuge verschwinden mit den Aufzügen in der Tiefe des Schiffsrumpfs. Still liegt wieder das lange Deck der »Roosevelt«. Bars steigt wieder auf den Befehlsstand hinauf. Der Kommandant ist wütend über das Scheinwerferleuchten: »Erschossen gehört der Kerl auf der Stelle! Wenn wir heute nacht keinen feindlichen U-Bootsbesuch bekommen …«
Im selben Augenblick zucken vorn bei den capital ships Scheinwerfer auf, mit blauen Lichtarmen greifen sie über die schwarze See.
»Da haben wir ja die Schweinerei!«
Weiter rechts bei den Zerstörern leuchtet es nun auch. Wie blitzende Degenklingen kreuzen sich die Strahlenbänder, silbern funkelt das Wasser auf.
Durch die »Roosevelt« gellt »U-Bootsalarm!«
Im Nu sind die Bedienungen an die Abwehrgeschütze, an die Scheinwerfer gestürzt. Tausend Augen bohren sich in die Dunkelheit.
Lautlos bringen die Aufzüge jetzt ein paar Windmühlen-Flugzeuge herauf, die Wasserbomben werden eingehängt – ein Blick noch auf den Scheinwerfer unter der Maschine, alles klar – schon starten sie und heben sich nach wenigen Metern vom Deck ab und schwirren über die See.
Weiter rückwärts rauschen mit dröhnenden Motoren auch einige Flugboote auf, um sich an der Suche nach den feindlichen U-Booten zu beteiligen. Wie kleine Glühwürmchen flimmern ihre Positionslampen durch die Nacht. Vorn leuchten die großen Schiffe nun nach beiden Seiten. Weiter draußen in langer Kette lassen Schnellboote und Zerstörer ihre Scheinwerfer spielen. Von Leuchtgranaten wird minutenlang die See blendend erhellt. In rasender Fahrt, das ganze Vorschiff von der hohen Bugsee überspült, jagen die Schnellboote daher.
Da fährt plötzlich flammendes Feuer auf, rot durchglühte Rauchwolken fahren wirbelnd hinter den schwarzen Silhouetten von Masten und Aufbauten heraus, dröhnendes Krachen zerreißt die Stille der Nacht.
Die Linienschiffe feuern!
Im gleichen Augenblick stechen von den Flugzeugen senkrecht aus der Höhe herab bläuliche Lichtbalken, zuckend, suchend über das Wasser hin. Haushohe Gischtfontänen der Granateinschläge leuchten als phantastische Springbrunnen auf. Mit ihren niederprasselnden Wassermassen mischen sich neue, die von den Wasserbomben der Flugzeuge aufspringen.
Die durch die Wellen ziehenden Spuren der Periskope, das verräterische Anzeichen von der Anwesenheit feindlicher U-Boote, sind die Fährten, an die sich die Meute der jagenden Zerstörer und Schnellboote, die Flugzeuge mit der wirksamen Waffe ihrer Bomben heftet.
»Scheinwerfer leuchten!«
Von der »Roosevelt« schießt jäh das gerichtete Licht hinaus, sucht den unheimlichen Feind; reißt im Gleiten zwei heranpreschende Schnellboote in blendende Helligkeit, gleitet weiter über die blitzende See.
»Scheinwerfer blenden!«
Mit einem Schlag schließen sich die Lichtaugen, in völliges Dunkel getaucht ist wieder das Schiff.
»Wir wollen den Kerlen nicht allzusehr die Nase darauf stoßen, wo wir stehen,« meint der Kommandant zu Bars, »die Boote da draußen leuchten sowieso schon genug herum.« Von den kleinen Lämpchen beim Rudergänger auf der Brücke werden die Gesichter der Offiziere von unten her matt erleuchtet. Sonst ist nirgends auf dem ganzen Schiff Licht zu sehen.
»Bei der verdammten Festbeleuchtung muß unser Kasten doch als deutlich sichtbare Silhouette zu sehen sein.« Der erste Offizier knurrt es vor sich hin.
»Ja, Smith, unsichtbar machen können wir uns leider noch nicht!«
Die See ist jetzt ein funkelndes Feuerwerk zuckender Scheinwerferstrahlen. Die Linienschiffe, Schnellboote und Zerstörer suchen ringsum das Wasser nach U-Booten ab.
Vorn wird immer noch geschossen.
Nun feuert auch an Backbord die Mittelartillerie. Über verschiedenen Stellen stehen die Scheinwerferaugen der Flugzeuge.
Da – – ein dumpfer Schlag – – eine gewaltige Detonation erschüttert die Luft …
Eine zweite, der unmittelbar darauf eine dritte folgt …
Eine ungeheure Stichflamme schießt hoch über die Masten empor, erleuchtet taghell die See und formt aus den Rauchwolken der feuernden Schiffe phantastische Wolkenkulissen.
Da vorn ist ein Panzerriese in die Luft gegangen!
»Ruder hart Steuerbord!!«
Beim Drehen sieht man, daß es die »Texas« ist, die mitten auseinandergeborsten eben in den Fluten verschwindet.
Aber auch das davorstehende Flaggschiff, das neueste und schönste Schiff der U.S.A.-Navy, liegt stark qualmend mit schwerer Schlagseite da. Es ist aus der Linie geschoren, Zerstörer kommen längsseits.
Die übrigen großen Schiffe steuern in Zickzackkursen von der Unglücksstelle weg, zu der weitere Zerstörer und der Kreuzer »Tacoma« heraneilen.
Es wird nicht mehr geschossen.
Nur die Scheinwerfer tasten unentwegt über die aufgewühlte See.
Bars ist mit dem Kommandanten auf die Brücke hinausgetreten. Sein Mund ist ein dünner schmaler Strich, zwischen den Augenbrauen steht eine harte, böse Falte. Seine Hände sind zu Fäusten geballt, daß weiß die Knöchel hervortreten.
In ihm kocht eine ungeheure Wut. Er muß hier stehen auf dem schwerfälligen Kasten, ausgeliefert einem unsichtbaren Feind, der heimtückisch heranschleicht, ohne daß man sich gegen ihn wehren kann; muß tatenlos warten, bis vielleicht so ein von einem opfermutigen Gelben gesteuerter Stahlfisch den Leib des Schiffs aufreißt und alles miteinander in die Luft fliegen läßt!
Dieses ekelhafte Warten auf ein Schicksal, das von irgendwo her unversehens zuschlägt, nein, das ist nichts für den Panther! Er ist gewohnt, dem Feind ins Auge zu sehen, in offenem Kampf seine Kräfte mit ihm zu messen, – – aber nicht zu warten, bis ihn ein vernichtendes Geschoß aus dem Nichts heraus überfällt!
Auch der Kommandant hat die gleichen Empfindungen. Als langjähriger Führer eines Panzerkreuzers ist ihm die »Roosevelt« – das »Himmelfahrtsschiff« – kein Betätigungsfeld, das seinem Draufgängertum zusagt. Doch er hat noch weitere Sorgen. Das aufgestörte Geschwader, das tolle Herumwimmeln der Boote und Zerstörer, der schwer rechtzeitig auszumachende Unterwasserfeind – und das alles in der Dunkelheit, das ist wirklich keine Kleinigkeit für den Führer eines großen Schiffs.
Die ganze Nacht hindurch werden die Amerikaner durch U-Bootsangriffe in Atem gehalten. Doch gelingt den Japanern kein weiterer Erfolg gegen die nun über einen weiten Raum verstreuten Großkampfschiffe. Nur ein Zerstörer wird zufällig getroffen und in Atome zersprengt. Ein anderes Torpedoboot treibt als weißglühende Fackel lange Zeit wie ein Geisterschiff durch die Tropennacht. Ein Schnellboot wird von der »Roosevelt« gerammt, wie ein Stein versinkt es augenblicklich in die Tiefe. Und eines der Flugboote wird beim Wassern schwer havariert.
Das Flaggschiff ist nicht mehr zu retten. Es neigt sich immer mehr zur Seite; im Morgengrauen kentert es plötzlich und ist in wenigen Minuten von der Oberfläche verschwunden. Ein riesiger aufquirlender Fleck, ein paar treibende Wrackstücke zeigen die Stelle an, wo es versank. In fünftausend Meter Tiefe liegt das schönste Schiff der amerikanischen Marine.
Der Admiral ist auf die »California« übergestiegen und sammelt von da aus sein versprengtes Geschwader.
*
Als der erste Morgenschein über die Kimm hochsteigt und die See mit seinem fahlen Licht erfüllt, braust Bars mit Aufklärungs- und Kampfstaffeln los, um das japanische Geschwader zu suchen, das man im Anmarsch weiß. Wieder fliegt er – wie in Rußland – einen schneeweißen Einsitzer, nur daß diesmal das Hoheitszeichen der Vereinigten Staaten auf Rumpf und Flügeln leuchtet. Im Rücken die strahlend heraufkommende Morgensonne, unter sich die tiefblaue Südsee, hinter sich die ausgesuchtesten Piloten Amerikas auf den schnellsten Maschinen der Welt, so jagt er dem Feind entgegen.
Die Aufklärungsgruppe der schnellen Kreuzer wird in großer Höhe überflogen. Wundervoll sieht es aus, wie die schlanken Schiffe mit schäumender Bugsee durch das Wasser ziehen. Bald sind sie achteraus vom spiegelnden Sonnenglast verschluckt.
Nun ist Bars ganz allein mit seinen brausenden Vögeln in der Höhe. Rundum nur Wasser und Himmel.
Einen Augenblick lang genießt der Panther die beglückende Losgelöstheit, das beseligende traumhafte Schweben im unbegrenzten Raum, die Beziehungslosigkeit zur Zeit. Rings ist nichts, an dem man die Eigenbewegung messen könnte. Das Meer da unten ist ein einziger blauer Spiegel des unendlichen Himmels – der Horizont ohne Maß.
Nur die Instrumente arbeiten ohne Empfindung für das, was die Menschenseele erfüllt. Mit kalter Präzision registrieren sie gesetzmäßige Zahlen.
Eine kleine Dissonanz im kristallenen Blau des Äthers, so wie eine geringe Klangunreinheit im gleichförmigen Lied der Motoren von den verfeinerten Sinnen empfunden, reißt die Aufmerksamkeit des Geschwaderführers in eine bestimmte Richtung. Halb links voraus nähert sich schnell ein feiner grauer Streifen. Wächst zusehends in Breite und Höhe, verliert an Dichte und ist jetzt ohne Zweifel als ein Schwarm von Flugzeugen zu erkennen.
Japaner?
Bars hält direkt darauf zu.
Noch ist der Typ der Maschinen nicht auszumachen, als er plötzlich englische Laute in seinem Kopfhörer wahrnimmt.
Engländer? – Aus dieser Richtung?
Tatsächlich!
Der Führer der entgegenkommenden Staffeln ruft die Amerikaner an.
Bars ist verblüfft. »Auf unserer Welle! – – Erstaunlich!«
Er gibt Antwort, fragt nach woher, wohin, nach dem Feind. Während das Gespräch hin und her geht, nähert man sich einander rasch. Schöne große Aufklärungsmaschinen, Australier sind es, die da kommen.
Sie melden das japanische Geschwader auf einem Kurs Ost-Süd-Ost liegend. Von feindlichen Kampfstaffeln in schwerem Luftkampf abgedrängt, sind die Australier auf dem Rückweg zur eigenen Flotte, die im Anmarsch in Richtung der Palau-Inseln ist. Über die Stärke der Japaner machen sie nur ungenaue Angaben. Die Luftkämpfe scheinen ihnen noch in den Knochen zu liegen. Sie haben ein Drittel ihrer Maschinen verloren und sind knapp an Betriebsstoff.
Bars empfiehlt ihnen, das näherstehende amerikanische Geschwader anzufliegen, um dort Meldung zu erstatten und zu tanken. Doch stolz dankt der australische Führer und entfernt sich, Hals- und Beinbruch wünschend, mit seinen Staffeln nach Süden.
Nach einer guten halben Stunde kommt wieder etwas in Sicht.
Diesmal sind es wirklich Japaner.
Bars zieht mit seinem Geschwader so hoch hinauf, als es irgend geht, um einem Luftgefecht auszuweichen. Er will seine Maschinen zuerst über die feindliche Flotte führen, zuerst seinen Auftrag erledigen. Nur unwillig gehorchen seine Piloten. Am liebsten hätten sie sich sofort auf die Gelben gestürzt. Die Luft trägt schlecht heute, sie erreichen nur mit Mühe als Höchstes achttausendeinhundert Meter. Dem Gegner geht es aber genau so. Freund und Feind hängt mit hochgestellter Nase im Blau. Die Japaner haben, herangekommen, gewendet; ohne die Amerikaner wesentlich belästigen zu können, ziehen sie nun zusammen mit ihnen nach Westen.
Nur ein Teil der feindlichen Maschinen steuert weiter nach Osten. Bars detachiert sofort eine Kampfstaffel, die sich hinter den Gegner hängt, der sich durch diese unfreundlichen Begleiter indes nicht stören läßt. Da beide Staffeln annähernd gleich schnell sind, verschwinden sie bald, ohne noch aneinander zu geraten.
Mit gespanntester Aufmerksamkeit beobachtet der Oberst die japanischen Maschinen, die in einigem Abstand neben und etwas unter ihm her fliegen. Wie eine lauernde Meute von Hyänen begleiten sie den stattlichen Schwarm der Amerikaner. Gleichzeitig sucht sein Blick den Horizont nach den feindlichen Schiffen ab.
Ganz fein in die schimmernde Metallscheibe der See eingraviert zeichnen sich in der Ferne winzig kleine weiße Streifen und Punkte ab. Es muß die Spitze des japanischen Geschwaders sein.
Davor steht ein silbern leuchtender länglicher Fleck, der zusehends größer wird.
Bars starrt hinunter. Wie mit unsichtbaren Fäden verbunden zieht dieser helle Fleck einen länglichen Schatten dunkel über das Wasser hin. Ein Luftschiff, jetzt den Aufklärungskreuzern weit voraus, zieht wohl zweitausend Meter tiefer als die Flugzeuge ruhig unter ihnen hin.
Mit seiner Metallhülle und seiner nicht brennbaren Gasfüllung kein Ziel für Maschinengewehre. Man muß es zunächst ungeschoren lassen.
Und nun liegen vor den staunenden Augen der Amerikaner die langen Perlenschnüre des japanischen Geschwaders. In fast nicht endenwollender Kiellinie, von unzähligen Booten begleitet, furchen die Panzerkolosse und Kreuzer die See.
Atemlos versucht Bars zu zählen: vier, fünf, sechs riesige Panzerschiffe hinter einem Schirm von Kreuzern und Zerstörern an der Spitze, weiter zurück aus dem schäumenden Kielwasser nur schwer herauszulesen wohl ein gutes Dutzend Linienschiffe und Schlachtkreuzer. Unzählbar das Gewimmel der Zerstörer und kleineren Boote, die zu beiden Seiten, voraus und dahinter das Wasser mit feinen, sich kreuzenden Pfeillinien durchziehen. Zwei weitere Luftschiffe, die zur Seitendeckung fahren, heben sich deutlich darüber heraus. Links voraus, von weißen Schaumstreifen umgürtet, von zahllosen Schaumspritzern der kleinen Atolle umgeben, hebt sich die Felsenkette der Palau-Inseln aus den Fluten.
Nur einen Augenblick lang zeigt sich das imposante Bild des feindlichen Geschwaders. Torpedoboote und tieffliegende Flugzeuge beginnen aus langen weißlichen Streifen einen undurchdringlichen Schleier zu weben, der in kurzer Zeit eine Nebeldecke über alles breitet.
Bars führt sein Geschwader über den ganzen Bereich der feindlichen Schiffe hin, um seinen Beobachtern die Möglichkeit zu geben mit ihren »Nebelaugen« die künstlichen Wolken zu durchdringen. Von unten herauf sendet der Feind feurigen Regen von Brandgeschossen, der ein Tiefergehen wenig ratsam erscheinen läßt.
Die Aufklärungsaufgabe ist gelöst, die Flotte erkannt, Stärke und Fahrtrichtung in großen Zügen festgestellt. Nun teilt der Oberst sein Geschwader; unter Bedeckung einer Kampfstaffel sendet er seine Aufklärungsmaschinen zurück, um Meldung zu erstatten. Wohl hat man Beobachtungen zurückgefunkt, aber die Wahrscheinlichkeit, daß die Meldungen durch die Störungsstation auf Babeltoab oder von den Linienschiffen aus wirkungsvoll gestört werden, macht das Zurückschicken der Aufklärungsstaffeln notwendig. Sie müssen sich ohne die Begleitung stärkerer Kampfeinheiten durchschlagen. Und nun stürzt sich der Panther mit seinen schweren Kampfmaschinen und den schnellen Einsitzern auf den Feind! Wenn nicht von unten her Verstärkungen heraufkommen, ist er zahlenmäßig den Japanern überlegen. Die Flugeigenschaften und die Kampfkraft seiner Maschinen sind den feindlichen mindestens ebenbürtig. Und fliegen und schießen können seine Leute. Aber ob sie Disziplin halten können? In den Kämpfen um Hawaii hat Bars die Kampfweise seiner amerikanischen Kameraden hinreichend kennengelernt. Zu oft hat wildes und unüberlegtes Draufgängertum zu unnötigen Verlusten, zur Sprengung der Disziplin geführt.
Bars zieht seine Staffeln zu einer ganz engen Formation zusammen, verbietet jedes eigenmächtige Handeln. Wie ein gewaltiger Keil stürzt sich das gedrängte Geschwader rücksichtslos hinunter.
Elastisch und elegant weichen die Japaner nach beiden Seiten aus.
Unbekümmert stößt der Panther, seine Maschinen eisern zusammenhaltend, weiter nach unten.
Bis 5000 Meter herab geht der unaufhaltsame Sturzflug.
Der Feind hinter her.
Noch ist kein Schuß gefallen.
Auf ein kurzes Kommando reißen die Amerikaner ihr Höhensteuer hoch, fast an den Propellern hängend stehen sie für einen Augenblick wie eine senkrechte Wand in der Luft.
Und nun vollführt Bars, der Panther, eines seiner unnachahmlichen Manöver, zu dessen exakter Ausführung er seine Piloten in eisernem Drill erzogen hat.
Auf der Spitze stehend, wirft er das ganze Geschwader herum! Indem sich jede Maschine überschlägt und dabei um 180 Grad um ihre Längsachse dreht, rennt die ganze Formation direkt in den nachfolgenden Feind.
Und nun bricht ein Höllenfeuer los!
Die Amerikaner knallen aus allen Gewehren in den verblüfft auseinanderspritzenden Gegner.
Bars läßt nicht locker. Immer noch geschlossen, wie eine feuersprühende Wolke stößt er wieder und wieder in die japanischen Rudel hinein.
Schon flattern da und dort beim Gegner zerschossene Maschinen hinunter, stürzen brennende Fackeln ins Meer.
In wilden, kühnen Angriffsstößen versucht der Feind den knatternden Keil zu sprengen, reißt auch einzelne Lücken, aber es gelingt ihm nicht, den übermenschlichen Willen des amerikanischen Führers, der alle seine Flieger zu einem einzigen Instrument zusammenballt, zu zersetzen.
Jetzt ändert der Japaner die Taktik.
Der aufgelöste Schwarm formiert sich ebenfalls zu einem dichtgeschlossenen Rudel, das jetzt die Amerikaner übersteigt.
Im Augenblick hat Bars seine Chance erkannt.
Jetzt setzt er alles auf eine Karte.
Er teilt sein Geschwader – halten seine Leute auch jetzt die Disziplin, dann sind die Japaner verloren – rechts die schweren Kampfmaschinen, links die Einsitzer; beide zu Himmelstreppen formiert, nimmt er den Feind in die Zange.
Während es den Kampfmaschinen sofort gelingt, die von ihnen angegriffenen feindlichen Maschinen zusammenzuschießen, lassen sich die Einsitzer verleiten, dem ausbiegenden Feind nachzuwenden. Für einen Augenblick ist der Erfolg des Angriffsmanövers in Frage gestellt. Fünf amerikanische Maschinen gehen verloren.
Da reißt Bars seine eigene Staffel, die er wie damals in Rußland stets um sich behält, herum und stößt rücksichtslos zwischen die in Einzelkämpfe verwickelten Einsitzer. Die Japaner weichen aus und suchen wieder Höhe zu gewinnen. Sofort zieht der Oberst seine versprengten Jagdmaschinen wieder dicht an sich, steigt ihnen nach. Ein Blick zurück: seine Kampfmaschinen haben mit ihren Gegnern aufgeräumt. Auch sie beordert er heran. Die Maschinengewehre schweigen, beide Gegner steigen, einander belauernd.
Allzu lange kann Bars den Kampf nicht mehr führen, er muß den Betriebsstoffverbrauch so einteilen, daß er noch zum Rückflug reicht.
Er muß versuchen, in kurzer Zeit den Feind niederzuringen; auf einen Kampf mit den zu erwartenden Verstärkungen kann er sich nicht einlassen.
Jetzt zieht er sein durch die Verluste beim Feind zahlenmäßig weit überlegenes Geschwader so auseinander, daß um den Kern der Kampfflugzeuge ein Schleier der Jagdmaschinen entsteht. So greift er erneut an.
Diesmal stellt sich der Feind erstaunlicherweise nicht. Die Japaner drücken steil nach unten weg. Zwei amerikanische Einsitzer, die hinterher jagen, werden dabei abgeschossen.
Bars, im Gefühl des Sieges, verzichtet auf eine Verfolgung, wendet und kehrt zu den Schiffen zurück.
Daß soeben von unten her neue japanische Staffeln heraufkommen, dämpft wohl das Gefühl der Überlegenheit, aber verleitet ihn nicht dazu umzukehren. Der Panther weiß, daß er, wenn die Flotten aneinander geraten, wenn es zu der ersehnten entscheidenden Seeschlacht kommt, seine Maschinen braucht. Vielleicht werden heute noch die Aufklärungskreuzer ins Gefecht kommen. So wird es Zeit für ihn, sein Geschwader zurückzuführen, um für den Endkampf gerüstet zu sein.
*
Noch bevor die amerikanischen Schiffe in Sicht kommen, fällt eine starke, senkrecht in den Himmel ragende Rauchwolke auf. Wie ein Pfahl steht sie über dem flimmernden Horizont. Von dunklen Ahnungen erfaßt, ruft Bars das Mutterschiff an. Sollte die »Roosevelt« …? – Endlich kommt Antwort. Ein japanisches Bombengeschwader hat während seiner Abwesenheit die amerikanische Flotte angegriffen und die »Enterprise« in Brand geworfen.
Beim Näherkommen sieht man, daß das Flugzeugmutterschiff ein einziges Flammenmeer ist. Die »Enterprise« liegt, in einzelnen Teilen schon weißglühend, mit schwerer Schlagseite da. Schwarze Rauchwolken wirbeln aus dem Vorschiff hoch, das Heck ist bereits ausgebrannt. Dort haben die Bomben getroffen. Von den Maschinen sind nur die dem Verderben entronnen, die zur Bekämpfung der feindlichen Bomber aufgestiegen waren. Die dreiundzwanzig noch unter Deck befindlichen sind verbrannt. Von der Besatzung des Schiffs und von den Piloten sind nur wenige gerettet worden.
Bars läßt sich von einem Staffelführer der auf der »Enterprise« gewesenen und nun auf der »Roosevelt« untergebrachten Jagdflugzeuge berichten.
»Ihre Aufklärungsmaschinen waren eben gemeldet, wir sahen sie schon herunterkommen – kein Mensch achtete mehr auf die Horchgeräte, die Ausguckposten haben wohl auch geschlafen – da stoßen plötzlich von Süden her, direkt aus der Sonne heraus, weitere Flugzeuge herunter. Ehe wir recht wußten, daß es feindliche sind, kamen schon die ersten Bomben. Ich stand gerade mit meinen Leuten an Deck – so rasch sind wir wohl noch nie hochgekommen – wir sind gestartet, wie jeder gerade stand. Die ersten Bomben lagen weit, lagen alle im Wasser, dabei hat der Zerstörer »Biddle« eine abgekriegt. Ehe wir hoch waren, haben schon unsere Flaks zwei Japaner heruntergeholt. Die andern griffen aber nochmal an. Diesmal haben sie dann getroffen. Es müssen wohl so etwas wie Brandtorpedos gewesen sein, jedenfalls Bomben mit kolossaler Wirkung. Unser Schiff stand sofort in Flammen. Die Benzinbunker müssen getroffen worden sein. Da war nichts mehr zu retten.«
»Und was ist mit den Japanern geworden?«
»Na, mit denen haben wir dann gründlich aufgeräumt. Nur ihre Geister werden nach Japan zurückkehren.«
Der Admiral tobt. Noch vor der Schlacht hat sein Geschwader empfindliche Verluste erlitten, zwei Großkampfschiffe und der eine Flugzeugträger sind vernichtet, eine große Anzahl Maschinen verloren gegangen. Zu allem Unglück meldet die »Akron II« schwere Havarie. Mit ihrem Einsatz ist für die nächsten 48 Stunden nicht zu rechnen. Die Meldungen über die Stärke des japanischen Geschwaders lassen die Aussichten für den bevorstehenden Kampf immer ungünstiger erscheinen. Und die Verbündeten lassen auf sich warten. Für die ersten Nachmittagsstunden war das Zusammentreffen vereinbart, aber die Engländer und Holländer stehen wer weiß wo, nur nicht da, wo sie sein sollten. Nur die Australier sind in der Nähe. Das kleine Geschwader, das aus drei Großkampfschiffen, sechs Kreuzern, einigen Flottillen und Flugzeugstaffeln besteht, wird stündlich erwartet.
Der Admiral beschließt nach Vereinigung mit ihnen zunächst südlich auszuweichen, um in der Nacht mit den Engländern und Holländern Verbindung zu bekommen, dann andern Tags gemeinsam das japanische Geschwader anzugreifen. Um vor weiteren Überraschungen gesichert zu sein, läßt er ständig eine Aufklärungsstaffel in großer Höhe über seinen Schiffen kreisen. Einen Teil seiner U-Boote entsendet er nach den Palau-Inseln, sie sollen dort im Schutze der Dunkelheit Minenfelder legen und auf dem Rückmarsch versuchen, an das japanische Geschwader heranzukommen.
Bars erhält den Oberbefehl über sämtliche bei der Flotte befindlichen Flugzeuge, auch über die Flugboote.
*
Den Tag über ist es ruhig. Vom Gegner hört und sieht man nichts. Gegen vier Uhr kommen die Australier in Sicht. Während man noch miteinander verhandelt, ob sie in das amerikanische Geschwader eingereiht werden, oder ob sie für sich bleiben sollen, beginnt der bisher glasklare Himmel sich zu überziehen. Die Sonne steht verschwommen in gelblichen Schleiern, die leichte Brise schläft vollkommen ein, bleierne Hitze lastet schwer auf der bewegungslosen See. Von Minute zu Minute wird es dunkler. Von einer im Süden drohend heraufwachsenden, schwefelgelb umsäumten Riesenwolkenwand wird alles Licht aufgesogen und erstickt.
Jetzt ist die See ein schwarzer, aber noch immer glatter Spiegel, in die das Geschwader seine weiße Fahrrinne schneidet. Noch rührt sich kein Hauch, aber jedermann weiß, daß in kurzer Zeit ein Orkan einfallen wird, der das Bild völlig verändern muß.
Die Aufklärungsflugzeuge sind auf die »Roosevelt« zurückbeordert worden. Die Maschinen werden unter Deck gebracht. Doch finden nicht alle im Innern des Schiffes Platz. Ein paar von den größeren Bombern und von den Kampfmaschinen müssen oben bleiben. Sie werden sorgfältig festgezurrt, damit sie nicht über Bord gefegt werden können. Um die Flugboote ist Bars in Sorge. Nur bei den kleineren können die Tragflächen zurückgeklappt werden. Einige von ihnen finden in dem U-Bootmutterschiff Platz, das ihnen durch das Auslaufen der nach den Palau-Inseln entsandten Boote Unterschlupf gewähren kann. Die andern hätte man zur Not auch auf das Deck der »Roosevelt« hinaufheben und dort festmachen können. Aber dazu ist keine Zeit mehr. Jeden Augenblick kann der Sturm losbrechen. Durch die zurückgeklappten Flügel sind sie weniger gefährdet, so daß sie es wagen können auf dem Wasser zu bleiben. Sie lösen sich von ihren Schleppern und fahren mit eigener Kraft weiter. Aber die großen mehrmotorigen Boote mit ihren über dreißig Meter Spannweite will Bars nicht dem Unwetter und hohen Seegang aussetzen. Er läßt sie starten. Sie sollen in große Höhen gehen und dort den Sturm, der erfahrungsgemäß nicht lange dauern wird, erwarten. Daß überhaupt ein Sturm kommt, ist für diese Breiten in der jetzigen Jahreszeit eine außerordentliche Seltenheit.
Kaum sind die Maschinen hoch, da beginnt im Süden die messerscharfe Kimm sich plötzlich aufzulösen. Himmel und Meer in Eins verwoben, kommen als braungraue Wand herangedrückt. Mit einem Schlag wird es dunkel.
Und jetzt jagt auch der erste Windstoß heran. Als kalter, pfeifender Hauch fegt er durch die Masten, über die Decks, jault um die Türme, Schornsteine und Aufbauten, zerrt an den Flugzeugen, fällt aufrauhend in den stumpfen Bleiglanz der See.
Für Sekunden folgt Stille.
Dann aber bricht der Orkan los.
Wie von ungeheurer Hand aufgerollt und hochgehoben scheint sich die Wasserfläche über die Flotte stürzen zu wollen. Vom gewaltigen Luftdruck getroffen, holen die schweren Schiffe über, pendeln schwerfällig zurück. Die erste heranrollende Flutwelle schlägt donnernd an die Panzerwände, übersprüht klatschend die Decks. Tief hauen die Vorschiffe ein, haushoch fahren die Brecher auf, stürzen krachend herab. Im Augenblick sind die schlingernden und stampfenden Schiffe in der vom peitschenden Regen und aufgewühlten Salzwasser gesättigten Atmosphäre verschluckt.
Besonders schwer hat es die hoch im Wasser liegende »Roosevelt« mit ihrem breiten, flachen Schornstein, der wie ein großes Brett den Winddruck fängt.
Nach zwei Stunden endlich läßt die Gewalt des Sturmes nach. Die Finsternis wandelt sich in eine blasse Dämmerung, die einen ersten Blick über die aufgewühlte See erlaubt. Da draußen tanzen die Schnellboote in den mächtigen Wellen, tauchen die Zerstörer auf und nieder. Von den Flugbooten ist nichts zu sehen.
Da wird mit einem Schlag am westlichen Horizont die Wolkenwand hochgerissen, ein glutender Abendhimmel überflutet die See mit Feuerfarben. Der Wind schläft ganz ein, die See beruhigt sich, der Wellentanz geht in eine hohe Dünung über.
Bars ist an Deck geeilt, untersucht mit seinen Monteuren die Sturm- und Wasserschäden an den Maschinen. Manche sehen schlimm aus, verbeult und zerschlagen sind Flügel- und Steuerflächen. Zwei haben sich losgerissen und sind in die Danebenstehenden hineingekeilt. Sie bilden mit ihnen einen unentwirrbaren Trümmerhaufen.
Aber was ist mit den Flugbooten, die auf dem Wasser waren, und mit denen, die gestartet sind?
Noch vor Einbruch der Dunkelheit kommen die letzteren zurück. Sie haben sämtlich wohlbehalten den Sturm überstanden. Zwei von ihnen sind noch unterwegs, um die kleinen Flugboote zu suchen. Zerstörer und Schlepper sind zur Hilfeleistung ausgeschickt. Im Laufe der Nacht werden die Flugboote eingebracht. Sie sind alle mehr oder weniger havariert, eines ist gesunken. Immerhin haben sie bei diesem Sturm ihre Seetüchtigkeit bewiesen.
*
Die ganze Nacht hindurch wird auf allen Schiffen fieberhaft gearbeitet. Überall hat der Sturm Schäden verursacht, fast alle Schnellboote haben Havarie erlitten. Die »Roosevelt« gleicht einer riesigen Werkstatt. Ein Reparaturschiff ist längsseits gekommen, um bei der Instandsetzung der Flugzeuge behilflich zu sein. Es ist eine fast übermenschliche Aufgabe, in wenigen Stunden wenigstens den größeren Teil der Maschinen wieder flugklar zu machen. Bars ist bei dem technischen Personal, überwacht die Arbeiten und treibt die Leute zu größter Eile an. Stillschweigend duldet er es, daß in den Werkstatträumen unentwegt Grammophone spielen. Daß neben dem Yankee-Doodle und den neuesten Tonfilmschlagern – ob mit Absicht oder sonst wie – auch die Internationale erklingt, scheint niemand weiter aufzufallen. Aber der Oberst denkt sich sein Teil. Er ist hier nur Soldat, nur »Vertragsangestellter«. Die Folgen solcher »Einstreuungen« werden den Amerikanern nicht erspart bleiben.
Ein Wunder, daß in dieser Nacht keine japanischen U-Boots- oder Bombenangriffe erfolgen. Es läßt sich nicht vermeiden, daß auf allen Schiffen Licht zu sehen ist. Die »Roosevelt« ist besonders verräterisch erleuchtet. Aber alles bleibt ruhig, der Feind stört die Arbeiten nicht. Vielleicht ist er mit seinen eigenen Schäden genug beschäftigt.
Gegen Morgen kommen die Australier wieder in Sicht, mit denen seit dem Sturm die Verbindung abgerissen war.
Bars wird beauftragt, zwei Staffeln zur Aufklärung zu entsenden, eine weitere soll mit den Engländern, deren Standort nunmehr bekannt ist, Verbindung aufnehmen.
Jetzt ist es mittlerweile 8 Uhr 30 vormittags geworden; seit gestern nachmittag weiß man nichts Näheres vom Feind. Aus den wenigen aufgefangenen Funksprüchen geht aber hervor, daß er nicht weit ab stehen kann.
9 Uhr 13 – die Flugzeuge sind noch nicht zurück – wird vom Kreuzer »Mohican«, der weit draußen zur Seitensicherung fährt, ein großer Dampfer gesichtet, der eben mit seinen weißen Aufbauten über der Kimm hochkommt. Er wird bald als ein Schiff der Toyo-Kisen-Kaisha-Linie erkannt. Der Kapitän, noch unschlüssig, ob er ihm zwei Torpedoboote auf den Hals hetzen soll, gleitet mit seinem Glas weiter am Horizont, hat plötzlich im Blickfeld Masten, die unzweifelhaft zu einem Kriegsfahrzeug gehören. Schon kommt auch die Meldung vom Vormars: »73 Grad ein Kreuzer!«
Sekunden darauf weiß der Admiral bei der Flotte, daß der Feind in Sicht ist. Auf den capital ships, auf den Kreuzern und Booten, überall gellt der Alarm:
»Klar Schiff zum Gefecht!«
Auf der »Roosevelt« klappen die großen Decktore auf, die Aufzüge bringen die Maschinen nach oben. Da kommt die Aufklärungsstaffel zurück. Von den sechs Maschinen kommen nur vier wieder, die übrigen sind vor dem Feind geblieben. Noch bevor sie auf dem Mutterschiff landen können, werden hinter ihnen in verhältnismäßig geringer Höhe eine Reihe japanischer Flugzeuge gesichtet. Auf der »Roosevelt« wimmelt alles durcheinander. Das Anrolldeck wird freigemacht, zwei Jagdstaffeln starten; um das Schiff kreisen wartend die Aufklärungsmaschinen, alles flucht, rennt, schimpft, der Kommandant donnert von der Brücke herab, Bars fährt, seinem Namen Ehre machend, zwischen Startmannschaften und Bedienungspersonal, schafft Ordnung in den aufgestörten Haufen.
Jetzt krachen auf allen Schiffen die Fliegerabwehrkanonen, Torpedoboote rasen mit qualmenden Nebelapparaten an den Geschwadern entlang, Flugboote ziehen dicht über den Masten hin, im Nu ist alles in milchigen Dunst gehüllt. Dumpf dröhnen die Abschüsse durch den Nebel. Aus steilen Drillings- und Doppelrohren fauchen Granaten und Brandgeschosse hinauf, legen eine todbringende Wand zwischen die Schiffe und den fliegenden Feind.
Die Jagdstaffeln stürzen sich knatternd auf den Gegner, der schwach kurvend und sich erbittert wehrend unaufhaltsam auf sein Ziel losgeht. Es sind schwerbewaffnete, mittlere Bombenmaschinen, von Kampfflugzeugen umringt. Die Bomber stoßen unbekümmert um das rasende Abwehrfeuer und den Geschoßhagel der Jagdflugzuge weiter vor. Ihre Begleiter nehmen mit den Amerikanern den Kampf auf, der in wildem Kurvengetümmel außerhalb der Granatensperre tobt.
Es geht alles sehr schnell. Plötzlich sind die Japaner über dem Nebelmeer, mittendrin im Hexenkessel der explodierenden Granaten. Drei von ihnen werden sofort mehrfach getroffen und stürzen in Flammen gehüllt herab. Andere müssen, flügellahm geschossen, zu Wasser. Der Rest jedoch schleudert seine Bomben. Beim Abdrehen fahren noch zwei von ihnen explodierend auseinander. Die wenigen, die entkommen können, werden von ihren Kampfmaschinen in die Mitte genommen. Der erbitterte Luftkampf zieht sich nach Westen hin weiter.
Durch die Wolken des künstlichen Nebels glüht Feuerschein, schwarzer Qualm breitet sich aus – irgendwo haben die Bomben getroffen und wohl Kartuschen und Munitionsstapel entzündet.
Langsam hebt sich der milchige Dunst, man sieht, daß rückwärts beim dritten Geschwader ein Großkampfschiff in Brand steht. In dichte Rauchwolken gehüllt, schert es langsam aus der Linie aus.
Die Aufklärungsgruppe der schnellen Kreuzer steht mit dem Feind im Gefecht. Die Geschwader sind zur Dwarslinie eingeschwenkt, die Schiffe fahren nebeneinander. Die »Roosevelt« wird unter Bedeckung von zwei Kreuzern und einigen Flottillen hinter die Mitte der Linienschiffe zurückgezogen. Um sie herum liegen die Flugboote. Alle übrigen Spezialschiffe, ebenfalls von Flottillen gedeckt, laufen einige Seemeilen vom Kampfplatz weg.
Hinter dem linken Flügel der Flotte fahren in kurzer Kiellinie die australischen Einheiten. Mit einem Kurs West-Nord-West steuern die Geschwader höchste Fahrt laufend auf den Feind zu, dessen Gros hinter dem abziehenden Rauch des kurzen Kreuzergefechts eben über der Kimm auftaucht. An der Spitze stehen die neuesten phantastisch schnellen Schlachtkreuzer, dann kommen die Kolosse der Linienschiffe mit ihren 40,6 cm-Türmen, kommen zahllose Flottillen mit ihren Führerkreuzern. Hoch über ihnen fährt der Silberfisch des Marineluftschiffs, umschwirrt von Jagdstaffeln.
Die beiderseitigen Aufklärungskreuzer mit ihren Begleitbooten sind zu den Geschwadern zurückgekehrt. Auch über der amerikanisch-australischen Flotte steht jetzt ein Flugzeuggeschwader, bereit, den Kampf zu eröffnen.
Bars hat sorgfältig ausgewählt. In der Mitte Bombenmaschinen, rund um sie herum schwere Kampfflugzeuge, davor und darüber die Jagdeinsitzer. Er selbst fliegt diesmal auf ausdrücklichen Wunsch des Admirals in einer der Kampfmaschinen als Kommandant.
Noch kreisen sie über der eigenen Flotte. Der Admiral hat den Zeitpunkt des Einsatzes sich selbst vorbehalten.
Von der Höhe herab bietet sich den Augen der Flieger ein imposantes Bild. Auf der nur mehr leichtbewegten, grenzenlosen See streben die zahllosen großen und kleinen Schiffe wie lebendig gewordene Gefechtsskizzen einer Admiralstabskarte aufeinander zu. In zwei Ebenen übereinander, auf zwei Elemente verteilt, stehen sich Freund und Feind zum Kampf auf Leben und Tod gerüstet einander gegenüber.
»Hier oben müßten die leitenden Admirale stehen, von hier aus hätten sie einen idealen Überblick über ihre Flotten, könnten mit einer unbehinderten Rundsicht, wie sie nie zuvor möglich war, die Schlacht leiten.« Bars ahnt bei diesem Gedanken nicht, daß drüben in dem silberglänzenden Luftschiff der japanische Admiral steht, daß zum erstenmal in der Geschichte der Kriege von der Luft aus eine Seeschlacht geleitet wird.
Noch immer kommt keine Angriffserlaubnis, noch immer brausen die Flotten drohend aufeinander zu, noch schweigen die Geschütze.
Mit angespanntester Aufmerksamkeit starren Kommandanten und Artillerieleiter durch die Sehrohre, drehen die Bedienungen an den Entfernungsmessern, da – eben liegt der Zeiger des Übermittlungstelegraphen auf 240 hundert – da drehen langsam die japanischen Schiffe.
Gleich darauf steigen auf der »California« bunte Flaggensignale hoch, werden auf allen Schiffen wiederholt, die Geschwader schwenken in Kiellinie ein. Nun liegen die schnellen australischen Schlachtschiffe an der Spitze. Höchste Fahrt laufend, versuchen sie und die Amerikaner, sich vor den Gegner zu setzen. Mit hochaufschäumender Bugsee rauschen die Stahlriesen, preschen von Gischt übersprüht die Zerstörer und Boote durch das Wasser. Von den Richtungsweisern gelenkt, starren auf beiden Seiten steil erhobene Rohre von Türmen und Kasematten drohend hinüber. Noch immer fällt kein Schuß.
Zwischen den feindlichen Flotten liegt eine nicht mehr zu überbietende Spannung, die an den Nervensträngen der Besatzungen aller Schiffe zerrt und sie zu zerreißen droht.
Langsam nähern sich die Kiellinien, ohne daß es einem der Gegner gelingt, seine Schiffe vor den Feind zu ziehen. Auf gleicher Höhe bleibend, verringern sie nur die Entfernung.
Endlich dringt zu Bars der erlösende Angriffsbefehl. Mit dem vorher genau bestimmten Teil seiner Maschinen dreht er auf den Feind zu; den silbernen Fisch als Richtungspunkt nehmend, stürzt er hinüber.
Hoch aufgerichtet steht der Oberst in dem kleinen runden Kommandostand, der über den Rumpf seiner Maschine hinausragt. Vor ihm sitzen in dem etwas tiefer liegenden Steuerstand die beiden Piloten, neben ihm hockt der Funker, ganz vorn im abgerundeten Rumpfbug kauert der Mann an der Revolverkanone. Unter dem Stand, in einer Art Gondel, ist ein Maschinengewehrschütze untergebracht, ein zweiter hat rückwärts vor dem Leitwerk im Rumpf seinen Sitz. Führerraum, Kommandostand und die Motoren sind gepanzert.
In einem dreifachen Keil, die Bomber in der Mitte, an deren Spitze die Führermaschine, die Jagdflugzeuge zu beiden Seiten, so führt Bars als »Admiral der Luftgeschwader« seine Streitkräfte in die Schlacht.
Die Japaner lassen sie herankommen. Jagdstaffeln lösen sich vom Schwarm der übrigen ab, steigen höher, doch ohne noch anzugreifen.
Jetzt brechen jäh auf allen Schiffen unzählige Feuerstrahlen hoch, Sekunden darauf steht in der Luft eine lange, hohe und breite berstende Wolkenwand, in der es unaufhörlich zuckt, kracht und flammt. Ein Trommelfeuer der Abwehrgeschütze setzt ein, das ein Durchstoßen der Feuerwand zum Selbstmord macht.
Bars schwenkt scharf ab, im Kurven steht er, daß auf allen amerikanischen Schiffen gewaltige Rauchwolken auffahren, eine lange Kette zuckender Funken spielt an der ganzen Linie entlang.
Die Flotte hat das Feuer eröffnet. Das unsichtbare Gewölbe der Geschoßbahnen baut sich über die See auf.
Mit allen Bombenmaschinen durch die Flaksperre zu kommen, ist ohne schwerste Verluste nicht möglich. Es hat keinen Sinn, jetzt am Anfang der Schlacht ein solches Opfer zu wagen. Die Amerikaner müssen mit ihren zusammengeschmolzenen Kräften haushalten. Aber umkehren oder sich irgendwo nutzlos herumschlagen – nein, das kann der Panther nicht. Angegriffen wird auf jeden Fall!
Oberst Bars dreht mit dem ganzen Geschwader zurück, gibt einem guten Dutzend Maschinen den Befehl ihm zu folgen, und stürzt sich hinunter. Seine Leute in Reihe hinter ihm her. In steilem Sturzflug, dem die Abwehrgeschütze nicht rasch genug folgen können, rast er auf die feindlichen Schiffe zu. Über und neben ihm krachen, spritzen und knallen Granaten und Brandgeschosse. Von feurigen Regen übersprüht, wirft sich seine große Maschine hinein in die Hölle.
Über den Schiffen reißt sie ihr Führer herum, saust an der Spitze der nachfolgenden Kameraden weiter hinab über die Kiellinie hin.
Jetzt werden Bomben und Torpedos losgemacht, hinuntergeschleudert auf die Panzerkolosse da unten.
Aber schon ist der Angreifer wieder von der Meute der zahllosen Flaks gefaßt.
»Einzeln raus!« brüllt Bars durch die Antenne seinen Maschinen zu. Hochgerissen und auf die Flügelspitze gestellt, wieder steil gedruckt, wieder in die Kurve, so suchen die Bomber sich durch die Todessperre zu winden.
In kalter Ruhe steht der Oberst in seinem Stand. Mit den Händen an den Haltebügeln festgekrallt, steht er durch die Fenster hinaus in den um ihn herumwirbelnden Totentanz. Mit grimmiger Befriedigung erhascht sein Blick ein brennendes Panzerschiff, das neben der feuerspeienden Linie der japanischen Flotte eben in den aufgewühlten Fluten versinkt. Der Sprung in die Hölle war also nicht umsonst gewesen.
In einer neuen Kurve sieht er dicht über sich, von mehreren Granaten getroffen, eine seiner Maschinen aufflammen und auseinanderbrechen. Im selben Augenblick fahren Splitter klatschend durch die Fenster seines Kommandostands, prasseln an die Panzerwände; Bars spürt einen schweren Schlag gegen den Leib, taumelt zur Seite, achtet nicht weiter darauf, steht sich nach seinen Leuten um. Der eine Pilot ist zusammengesackt, sein Körper legt sich schwer auf das Steuer.
Mit einem Satz ist der Oberst bei ihm unten – verdammtes Stechen im Leib – versucht den Mann aufzurichten. Ein dicker Blutstrahl quillt sprudelnd aus seinem Hals, in dem ein langer, zackiger Splitter steckt. Der Kopf, halb vom Rumpf getrennt, hängt auf die Brust herab.
Nur mit Mühe kann Bars den leblosen Körper zur Seite ziehen, um selbst das Steuer zu ergreifen. Der andere Pilot ist unverletzt geblieben, nur sein Anzug ist am Rücken bis zum Hemd aufgerissen.
Bars greift mit klammerndem Griff in das Rad, schiebt seine Füße in das Seitensteuer. Durch die zerrissenen Fenster jagt mit dem rasenden Fahrtwind beizender Gifthauch der Granaten herein, sticht mit tausend Nadeln in seine Augen, die von keiner Brille geschützt sind. Wie eine riesige Hummel im engen Käfig wirbelt der Wind brausend und zerrend im Stand. Fast blind, nur nach dem Instinkt steuernd, sucht Bars aus dem Splitter- und Feuerregen herauszukommen. Sein Nachbar reicht ihm eine Reservebrille herüber – jetzt kann er wenigstens wieder sehen. Dort halblinks tanzt die Kimm, davor das in Rauchwolken halb verhüllte amerikanische Geschwader, darüber – verdammt – ebenfalls Flakfeuer!
Also sind die Gelben drüben.
Wenn er nur schon aus dem verfluchten wandernden Feuer heraus wäre, das jeder seiner Bewegungen folgt.
Er muß hier heraus!
Er weiß jetzt, daß er verwundet ist, daß ihn der Tod gezeichnet hat. Der Schlag vorhin traf nur zu gut.
Im Augenblick, als er gerade kurvt, wird seine Maschine plötzlich mit unwiderstehlicher Gewalt vorn hochgehoben, zur Seite geschleudert; sie kracht in allen Fugen, erzittert in einem zerreißenden Knall. Neue giftige Rauchschwaden fahren durch die Fenster herein, füllen den engen Raum und drohen die Insassen zu ersticken.
Halb betäubt sucht Bars die stürzende Maschine zu fangen – ohne Druck flattert das Steuer in den Händen – man kann nichts sehen, kann nicht atmen – und der wachsende Schmerz im Leib –
Das ist – ist das Ende?
Noch nicht. Jetzt hat er die Maschine wieder in der Hand, vorsichtig richtet er sie auf, der Rauch verzieht sich –
Da vorn – Herrgott – der ganze vordere Rumpf ist abgerissen, das kleine Geschütz und der Mann dahinter sich weg!
Jetzt setzen auch die spuckenden Motoren aus. Beim Griff nach den Instrumenten steht Bars, daß sein Nebenmann tot ist. Von einem kleinen Loch mitten in der Stirn rinnt ein dünner Blutstreifen über sein Gesicht. Noch um einen Schatten härter wird das Gesicht des Panthers. Den Blick starr vorausgerichtet, steuert er seine todwunde Maschine, seine toten Kameraden hinab. Langsam sinkt er tiefer, nähert sich den Wellen zwischen den kämpfenden Flotten, dem vom Feuerorkan überwölbten »Niemandsmeer«.
*
Im Panzerstand der »Leonard Calvert« dem Schlußschiff des amerikanischen Geschwaders.
Der Kommandant am Sehrohr beobachtet die Feuerwirkung seiner Artillerie. Sein Schiff schießt auf die »Kirishima« auf eine Entfernung von 180 hundert. Die Sicht ist schlecht, der Wind treibt den Qualm der eigenen Abschüsse vor das Schiff. Nur undeutlich sind die Konturen in dem braunen Rauch, der sich breithin über das Wasser zieht, zu erkennen. Die »Leonard Calvert« feuert in schneller Folge mit drei Türmen, der vierte ist durch einen Treffer ausgefallen. Himmelhohe Fontänen der in nächster Nähe einschlagenden Granaten lassen immer wieder prasselnde, giftig gelb gefärbte Wassermassen über das ganze Schiff niederstürzen. Der Gegner ist glänzend eingeschossen, immer wieder hauen schwere Treffer in das Schiff. Aber auch die Artillerie der »Leonard Calvert« weiß ihr Ziel zu finden. Eben wieder beobachtet der Kommandant eine große, aufschießende Flamme mittschiffs der »Kirishima«.
Über der ganzen japanischen Flotte braut zuckendes Flakfeuer. Mit Sorge denkt der Kapitän an die eigenen Flugzeuge, die dort in ihr Verderben rennen müssen; daß sie hier, bei dem zu erwartenden japanischen Fliegerangriff fehlen werden. Er weiß, daß ein Teil seiner Flakgeschütze bereits zerschossen oder sonst unbrauchbar geworden ist. Ob die gefechtsklar gebliebenen bei dem ungeheuren Feuerhagel, der dauernd auf seinem Schiff liegt, überhaupt bedient werden können? –
Er schiebt den Panzerdeckel von einem der Sehschlitze zur Seite, späht hinunter auf das Vorschiff, wo neben und hinter den schweren Türmen ein Teil der noch klar gemeldeten Abwehrgeschütze steht. Da wird er von ungeheurem Luftdruck zur Seite geschleudert; sein Signaloffizier, der neben ihm stand, reißt ihm im Fallen die Uniform auf, schwer schlagen die Männer gegen die Panzerwand. Mit donnerndem Getöse stürzen schwere Eisenteile auf die Decke, rutschen scharrend und kratzend an der Außenwand entlang, durch den offenen Sehschlitz dringt giftiger Qualm ins Innere. Für Augenblicke ist alles betäubt im Kommandoturm. Der Navigationsoffizier rafft sich zuerst auf, sieht durch den Schlitz. Da liegen und hängen dicht vor seinen Augen verbeulte, verbogene Panzerbleche, wie Strohhalme geknickte schenkeldicke Stahlträger, Trossen und Taue zu Knäueln verwickelt, da hängt in blutgetränktem weißem Jackett der Oberkörper eines Offiziers im verdrehten Gestänge. Einsam flattert an einer zerrissenen Leine der bunte Fetzen einer Signalflagge.
Der ganze obere Teil des gewaltigen Mast's mit dem Artilleriebeobachtungsstand ist heruntergeschossen, seine jammervollen Trümmer hängen über den Kommandoturm und liegen als unentwirrbarer Knäuel über dem oberen Geschützturm, die Drillingsrohre wie Lianen umklammernd. Alle Sehrohre im Stand sind abgerissen, die Schiffs- und Artillerieführung blind gemacht.
Noch bevor auf den hinteren Leitstand umgestellt werden kann, heult es von neuem heran, senkt sich rauschend nieder auf das weiterfeuernde Schiff; eine Riesenfaust schlägt mit Brüllen mitten hinein, reißt mit elementarer Gewalt seinen Leib auf. Hoch über den stürzenden hinteren Mast schießt jäh eine Stichflamme auf, schwarzer Qualm wirbelt empor, mit alles überdonnerndem Knall fliegt die »Leonard Calvert« in die Luft.
Eine riesige Rauchwolke steigt rasend schnell in den strahlenden Tropenhimmel, hoch hinauf bis zu den japanischen Flugzeugen, die in diesem Augenblick herankommen.
Es sind nicht mehr viele Flakgeschütze auf der hartbedrängten Flotte, die den furchtbaren Feind empfangen. Aber sie feuern trotz ringsum einhauender Treffer in rasender Folge und mit sichtbarem Erfolg. Schon sind große Lücken in der Kette der japanischen Bomber entstanden, aber die Maschinen steuern ruhig weiter. Nun sind die ersten nahe heran. – Das vorderste Flugzeug fliegt auseinander, auch das nächste taumelt und rutscht seitlich weg, um gleich darauf über Kopf zu gehen. Aber schon senken sich die übrigen zum Sturzwurf herab, schleudern kaltblütig zielend ihre Bomben und Torpedos nach unten.
*
Bars ist mitten zwischen den Linien zu Wasser gekommen. Tief taucht der zerrissene Bug des Rumpfes ein, zischender Dampf fährt von den glühend heißen Motoren auf, Wasser strömt gurgelnd durch die zerstörten Fenster in den Führerstand. Bars wirft sich hoch, klettert mit Mühe den kurzen Niedergang zum Kommandostand hinauf, taucht aufatmend mit dem Kopf aus dem salzigen, öligen Naß, steht mit verklebten Augen, wie der Funker verzweifelt das Dach des Standes zu heben versucht, steigt schwerfällig zu ihm hin, drückt trotz stechender Schmerzen mit ihm vereint gegen den dünnen Panzerdeckel. Mit einem Ruck gibt er nach, fällt klirrend nach außen. Die beiden drängen sich durch.
Die Maschine steht mit hocherhobenem Schwanz seitlich geneigt im Wasser. Sie scheint nicht weiter zu sinken, Teile der Notschwimmer neben dem Fahrwerk und im Tragdeck sind wohl dicht geblieben. Aus dem hinteren Maschinengewehrstand ragen die Läufe des Gewehrs steil nach oben, von dem Schützen ist nichts zu sehen.
Bars ruft seinen Namen – –
Keine Antwort.
»Sehen Sie doch mal nach,« befiehlt er dem Funker.
An den über den Rumpf hinlaufenden Antennendrähten sich haltend, klettert der Mann hinauf, beugt sich hinunter:
»Erledigt.«
Beim Herunterkommen steht Bars, daß der Funker blutet.
»Sind Sie verwundet?«
»Ach, ist nichts weiter, mir ist da so ein Ding an der Hüfte entlang gefahren.«
Der Oberst untersucht ihn; das Ding entpuppt sich als ein Granatsplitter, der die ganze Seite aufgerissen hat. Nur mit Mühe gelingt es, die große, zerrissene Wunde notdürftig zu verbinden. Sich selbst auch einen Verband anzulegen, unternimmt Bars nicht; er weiß, daß das nutzlos sein wird.
Von dem Flugzeugwrack dicht über dem Wasser sind die kämpfenden Flotten nicht zu sehen. Nur die am Horizont hinwallenden Wolken vom Pulverqualm der unzähligen Geschütze, im Wind verwehendes Flakfeuer und der unaufhörlich rollende Donner der Schlacht lassen erkennen, in welcher Richtung der Kampf tobt. Ab und zu ziehen Flugzeuge in großer Höhe vorüber. Einmal glaubt Bars seine Flugboote zu erkennen. Der Funker hat aus Leinwandstücken ein dürftiges Notsignal gemacht und es an den Rohren des Maschinengewehrs befestigt. Von Zeit zu Zeit feuert er eine Leuchtrakete ab. Ein großer Teil der Munition ist naß geworden, mit dem Rest muß sehr sparsam umgegangen werden.
Gegen Nachmittag kommt der Kampflärm näher, im Norden tauchen wieder die Kolosse der japanischen Flotte auf. Das Luftschiff aber ist nicht mehr da. Eben will der Funker wieder eine Leuchtkugel abschießen, da schlägt sie ihm der Oberst aus der Hand:
»Nein, lieber saufen wir hier ab, als daß wir uns von denen da auffischen ließen!«
Ein in Brandwolken gehüllter Kreuzer steht zeitweilig deutlich erkennbar in nicht zu großer Entfernung; langsam treibt er außer Sicht.
Einmal kommen ganz nahe amerikanische Zerstörer und Schnellboote vorbei; der Funker feuert eine Leuchtkugel nach der andern hoch – sie laufen weiter, ohne das Flugzeugwrack zu bemerken.
Zweimal dröhnen gewaltige Explosionen über das Wasser. Sehen kann man nichts, die Schiffe sind wieder unter den Horizont untergetaucht. Nur das Dröhnen der Schlacht rollt immer noch über die See.
Die Sonne ist schon im Sinken, als von neuem große Schiffe auftauchen. Mit höchster Fahrt laufen sie auf und sind nach einiger Zeit unzweifelhaft als britische › capital ships‹ zu erkennen.
»Da kommen die Engländer,« sagt Bars zu dem Funker, der apathisch und von Fieber geschüttelt neben ihm hockt. »Los, eine Leuchtkugel abschießen.« Zischend fährt der Schuß hoch, mit schwachem Knall springen weiße Sterne auseinander, sinken glitzernd langsam nieder. Alle zehn Minuten wird eine hochgejagt. Zwei Augenpaare starren zu den Schiffen hinüber, die greifbar nahe zu sein scheinen.
Nichts erfolgt. – Sie ziehen in schäumender Fahrt vorüber. Bald sind sie verschwunden.
Die Kräfte der beiden Männer lassen nach, teilnahmslos und ohne Hoffnung hängen sie an ihrem Wrack.
Irgendwo weit unter der flimmernden Kimm geht die Entscheidungsschlacht weiter, ringen die Vertreter der weißen Rasse mit dem asiatischen Führervolk.
Schon nach den ersten Stunden der Schlacht wird die Überlegenheit der japanischen Übermacht so drückend, daß der amerikanische Admiral seine und die australischen Schiffe aus dem vernichtenden Feuer zieht. Die Japaner folgen nicht. Die Luftaufklärung ergibt, daß sie mit höchster Fahrt auf die Palau-Inseln zusteuern.
»Hoffentlich laufen sie da auf unsere Minen,« meint der Admiral zu dem Führer der U-Boote, mit dem er einen neuen Vorstoß dieser Waffe bespricht. Die vom Minenlegen zurückgekehrten Unterseekreuzer haben keine Torpedos anbringen können, dagegen sind zwei von ihnen von japanischen Schnellbooten und Zerstörern vernichtet worden.
Die Fühlung mit dem Gegner bleibt aufrechterhalten, die Nachmittagsstunden sind mit kleineren Kreuzergefechten und kurzen Luftkämpfen ausgefüllt. Die britisch-niederländische Flotte, endlich auf dem Kampfplatz angelangt, nimmt mit den Amerikanern Verbindung auf. Noch während sich die Flotten in einer Neugruppierung befinden, erscheinen die japanischen Schiffe wieder. Durch ein schnelles und sehr geschickt ausgeführtes Manöver gelingt es den Engländern, sich vor die Spitze des Gegners zu setzen, das berühmte › crossing the T‹ zu erzielen.
Die vereinigten Geschwader, vorn die Engländer, in der Mitte die Niederländer, am Schluß die abgekämpften Amerikaner und Australier, eine den Japanern numerisch überlegene Flotte, hat alle Aussicht, den weiteren Verlauf der Schlacht zugunsten der Verbündeten zu gestalten. Den ganzen südlichen Horizont entlang ziehen die feuernden Schiffe, eine imposante Kette blitzender Funken in der langen Rauchwand der ineinanderfließenden Abschußwolken.
Schon glaubt der britische Admiral, der die Führung der vereinigten Flotten übernommen hat, den Gegner überflügelt zu haben, ihm die Gesetze des Handelns aufzwingen zu können, als von dort ein Angriff der Zerstörer und Schnellboote erfolgt, wie ihn die Geschichte aller Seekriege noch nicht erlebt hat.
Während Schwärme von Kampf- und Bombengeschwadern auf die vereinigte Flotte niederstoßen, brechen hinter den japanischen Schiffen die Boote vor. Mit phantastischer Geschwindigkeit rasen sie heran, ungeachtet des vernichtenden Feuers, das auf sie konzentriert wird.
Von den Fontänen der Einschläge aller Kaliber umringt, von niederbrechenden Wassermassen und surrenden Splittern überschüttet, preschen sie wie ein riesiges Feld von Delphinen gischtsprühend durch das Wasser. Da und dort wird ein Torpedoboot getroffen, von den schweren Kalibern zusammengehauen, aber die wendigen Schnellboote bieten ein zu kleines und allzu bewegliches Ziel. Immer näher kommen sie heran. Immer näher bringen sie ihre Torpedos an die schwerfälligen Großkampfschiffe heran.
Alle verfügbaren Zerstörer der verbündeten Flotte brausen ihnen entgegen, suchen ihren Vorstoß aufzufangen, das Unheil von der Flotte abzuwenden. Aus dem Zweikampf der Riesenschiffe ist eine Schlacht der kleinen und kleinsten Einheiten geworden.
Ein ungeheuer erregendes Ringen im Raum zwischen den feindlichen Flotten beginnt, das nur mit dem Luftkampf der Jagdgeschwader verglichen werden kann.
Hier zeigt sich zum erstenmal die außerordentliche Gefährlichkeit der neuen Waffe, zeigt es sich, daß der Kampfwert der Riesenpanzerschiffe, dieser schwimmenden Festungen, fraglich werden kann gegenüber einer so schnellen, kaum zu treffenden und in fast unbeschränkter Zahl herzustellenden Angriffswaffe. Es zeigt sich ferner, daß, – was viele einsichtsvolle Köpfe schon lange behauptet haben, – die Zeit der in Tonnage, Bestückung und Panzerung überdimensionierten Großkampfschiffe endgültig vorüber ist. Diese Einsicht muß die vereinigte europäisch-australisch-amerikanische Flotte teuer bezahlen. Ihren zur Abwehr entsandten Zerstörern und wenigen Schnellbooten gelingt es nicht, dem Angreifer den Weg zu verlegen. Sie sind an Zahl schon weit unterlegen, den unerhörten opfermutigen Angriffsgeist der Japaner können sie trotz aller Tapferkeit nicht brechen. Von Anfang an in die Verteidigung gedrängt, müssen sie sich darauf beschränken, das Allerschlimmste zu verhüten.
Dem unaufhaltsamen Ansturm der feindlichen Boote suchen die Großkampfschiffe durch Abdrehen auszuweichen. Die lange Kiellinie wird zerrissen, der Vorteil der günstigen Stellung geht verloren, der Angriff wird zur Abwehr umgewandelt. Nicht genug damit: der zähe Gegner bricht stellenweise bis zu den Linienschiffen durch, feuert seine Torpedos ab, von denen viele ihr Ziel finden.
Nicht alle sind tödlich. Der immer mehr gesteigerten Sprengkraft des Torpedos hat die unermüdliche Technik auch Sicherungen und Panzerarten entgegensetzen können, die ihm die Waage halten.
Trotzdem ist die Wirkung des unerhörten Angriffs furchtbar. Zwei niederländische, zwei britische und ein australischer Schlachtkreuzer, drei englische Linienschiffe und ein amerikanisches werden vernichtet. Weitere Einheiten, besonders bei den Amerikanern sind so schwer beschädigt, daß sie aus der Schlacht gezogen werden müssen. Das englische Flugzeugmutterschiff brennt und fliegt nach kurzer Zeit durch innere Explosion in die Luft. Selbst die weiter zurückstehende »Roosevelt« wird von einem Weitschuß getroffen, bleibt aber schwimmfähig.
Trotzdem der Admiral der verbündeten Flotten so ein Drittel seiner gesamten Schiffe verloren hat, gibt dieser zähe Engländer den Kampf nicht auf. Erneut stürzt er sich der vorbrechenden japanischen Flotte entgegen, die aus der drohenden Umklammerung befreit nun den Vorteil auf ihrer Seite hat.
Sie weiß ihn zu nutzen.
Als die Nacht hereinbricht, ist die Schlacht zu ihren Gunsten entschieden.
Obwohl die Japaner nur ein taktisches »Unentschieden« erreichen konnten – die eigenen Verluste waren infolge des rigorosen Einsatzes enorm – ist die Schlacht strategisch doch ein wirklicher Sieg. Die verbündete Flotte verläßt das Kampffeld, eine Weiterführung der Schlacht am anderen Tag wäre aussichtslos. Das englische Geschwader tritt den Rückmarsch nach Singapore an, die Holländer ziehen sich auf die Sunda-Inseln zurück. Die wenigen den Amerikanern gebliebenen Schiffe gehen mit den Australiern nach Port Darwin, um zunächst die nötigsten Reparaturen vorzunehmen, bevor sie den Rückmarsch nach Hawaii antreten können.
Die japanische Flotte ist unumstrittene Herrin der Südsee, Herrin des Stillen Ozeans.
Als nach verzweifeltem Ringen nun auch Hawaii verloren geht, sind die Vereinigten Staaten vollständig vom Pazifik verdrängt.
Auf allen Inseln zwischen den Philippinen und der Küste Amerikas steht Japans Banner. Und auf dem asiatischen Kontinent beginnt der schrittweise Rückzug Europas.
Die Tore zu einer neuen Epoche der Weltgeschichte sind aufgetan.
*
Es ist Nacht, der grollende Donner der Seeschlacht ist verklungen. Das ungeheure Gewölbe des tropischen Sternenhimmels steht funkelnd über der schwarzen See.
Die Brandung rauscht und nagt an den Korallenriffen, Nachtwind raschelt in den schlanken Kokospalmen, an deren Fuß der sterbende Panther und sein Funker kauern.
Eine starke Strömung hat das sinkende Wrack auf eines der zahlreichen Atolle getrieben, die um die Palau-Inseln liegen. Die Schiffbrüchigen haben sich mit letzter Kraft auf den schmalen Landstreifen hinaufgezogen. Dort sitzen eng aneinandergelehnt die frierenden ausgebluteten Männer. Nun nicht mehr Vorgesetzter und Untergebener: nur zwei weiße Menschen, verloren in den Wasserweiten des asiatischen Meeres, aus der Schlacht weggespült an eine namenlose Küste, vergessen von der Zeit.
Lange sitzen sie schweigend da, hängen Gedanken nach, die um ferne Heimat kreisen.
»Wird uns jemand finden, werden wir wieder nach Hause kommen?« Die angstvolle Frage quält sich aus der Brust des Funkers.
Bars, der Kämpfer und Flieger, dessen Schicksal nur noch mit dem des jungen Menschen neben ihm verbunden ist, schon aufsteigend in eine Sphäre, die über den leiblichen Bindungen steht, antwortet ihm: »Wir werden heimkommen, wenn auch anders, als du es dir vorstellst.«
»Unser Weg ist nun wohl zu Ende. – Doch unsere Kameraden werden weiterkämpfen müssen.« –
»Aber die Schlacht ist doch vorbei – und uns hat man vergessen!« Verzweifelt sinkt der Funker in sich zusammen.
Tröstend legt ihm Bars seine Hand auf die Schulter:
»Mußt es nicht so schwer nehmen, Bruder. – Wir brauchen bald keine Hilfe mehr – wir werden heimkommen –«
Sein Leidensgenosse hört es nicht mehr; besinnungslos lehnt er am Stamm der Palme.
Wie um ihn nicht zu wecken, flüstert Bars:
»Wir brauchen keine Hilfe mehr – aber ihr dort, Kameraden in der Ferne, wer wird euch helfen? Werdet ihr allein den Weg finden, der euch zusammenführt?« –
Lange noch schweift sein Blick über den verschwimmenden Horizont. Dann, kaum hörbar, kommen die letzten Worte über seine Lippen: »Ihr werdet stark sein, wenn ihr stark sein wollt« –
Der aufdämmernde neue Tag findet Hand in Hand am Stamm der im Morgenwind sich wiegenden Palme zwei Tote.
Von dem strahlend im Osten auftauchenden Tagesgestirn beleuchtet flattern rote Sonnenbanner über den japanischen Geschwadern, die am fernen Horizont vorüberziehen. – –