
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
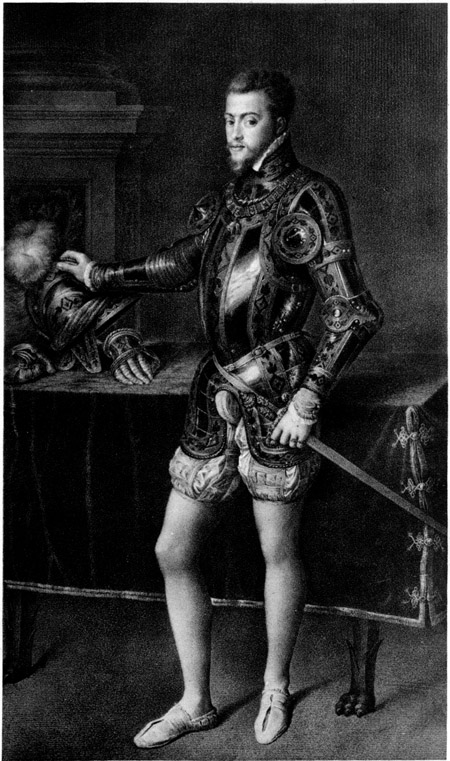
Philipp II.
Lithographie von G. Sensi, nach einem Gemälde von Tizian. Porträtsammlung der Nationalbibliothek Wien
Philipp II. von Spanien war streng und mißtrauisch. Niemals schenkte er sein Vertrauen vollständig, und selbst wenn man die augenscheinlichsten Beweise seines Vertrauens erhielt, war man nicht sicher, es noch zu besitzen. Erst in dem Augenblick, wo er losschlug, erkannte man den Verlust seiner Gunst. Kein Zeichen der Ungeduld oder der Erkaltung verriet jemals den Wechsel seiner Absichten oder seiner Neigungen. Wie alle anderen Sachen, zog er auch das Aussprechen seiner Ungnade in die Länge. Die Ratschläge seiner Beamten befolgte er noch, nachdem er schon Mißtrauen gegen sie gefaßt hatte. Er selbst besaß einen langsamen, wenig erfinderischen und ziemlich unentschlossenen Geist. Seine pedantische Regierungsweise bestimmte ihn ebenso wie sein mißtrauisches Temperament, sich Männer zu bedienen, die sich nach Geist und Tendenz unterschieden und durch den Wetteifer des Ehrgeizes getrennt waren. Er regierte die weiten Strecken der spanischen Monarchie schriftlich; alles, Kleines wie Großes, ward ihm vor Augen gelegt. Er fragte viel um Rat, schwankte lange und entschied sich infolge seiner Unentschlossenheit und der unvermeidlichen Langsamkeit, welche aus seiner Gewohnheit, alles selbst zu lesen, zu notieren, anzuordnen, für den Geschäftsgang erwuchs, nur langsam. Obwohl er in hohem Grade fleißig und arbeitsam war, vermochte er doch der Masse der Geschäfte nicht zu genügen. Dabei ließ er länger als 20 Jahre zwei nebenbuhlerische Parteien an seiner Seite bestehen, um eben aus ihren widersprechenden Meinungen Aufschlüsse zu gewinnen, je nach den Umständen die verschiedenartigen Eigenschaften ihrer Führer benutzen zu können und mit größerem Wetteifer bedient zu sein.
An der Spitze dieser beiden Parteien standen lange Zeit der Herzog von Alba und Ruy-Gomez de Silva, Fürst von Eboli, der eine ebenso hochfahrend und entschlossen wie der andere gewandt und klug. In allen ihren Auffassungen und Urteilen standen sie sich schroff entgegen. Was bei dem einen Glück machte, scheiterte bei dem anderen. Der König sah ihre Nebenbuhlerschaft, die bis zur Feindschaft anstieg, keineswegs ungern, da sie seinen mißtrauischen Charakter beruhigte; freilich aber vermehrte die Meinungsverschiedenheit dieser seiner beiden hauptsächlichsten politischen Ratgeber die Unsicherheit seiner Entschließungen. Im Grunde des Herzens zog er Ruy-Gomez vor, der seit langen Jahren nie von seiner Seite gewichen war und ihm mit unbedingter und diskreter Ergebenheit diente, ihn beratend, ohne ihn sichtbar zu leiten. Als jedoch der Aufstand der Niederlande erfolgte, schien es, als hätte der Herzog von Alba einen Augenblick den Sieg davongetragen. Nach vielem Schwanken und Zeitverlust schickte ihn Philipp mit einem Heere und unumschränkter Vollmacht in die aufständischen Provinzen. Als aber Macht und Gewalttat keinen Erfolg gehabt hatten, ließ Ruy-Gomez, der inzwischen an der Seite des Königs geblieben war, den Herzog durch den milden und maßvollen Großkomtur von Kastilien, Don Louis de Requesens de Cuniga, ersetzen, der mit versöhnlichen Maßregeln beauftragt ward. So hinterließ der Fürst von Eboli, als er im Jahre 1573 starb, seine Partei mächtiger als je, und durch seine Kreaturen Antonio Perez und Juan Escovedo geleitet, sowie von dem Ruhm und den Siegen ihres erlauchten Mitgliedes Don Juan d'Austria umstrahlt, herrschte sie bis 1579 in den Räten des Königs. Zu derselben Partei gehörte der Erzbischof von Toledo, Don Gaspard de Quiroga, der als ein Mann von heiterem Temperament und sanftem Charakter, als beredt und das Gute wollend geschildert und von dem versichert wird, daß er allgemein für rechtschaffen gegolten und sich der Gunst des Königs erfreut habe. Ferner Don Pedro Fajordo, Marquis de Los Velez, Oberhofmeister der Königin, ein zurückhaltender, schweigsamer Mann von verschlossenem Charakter, wie er dem Wesen des Königs entsprach, der sich seiner vielfach bediente.
Antonio Perez war damals (1577) 36 Jahre alt. Er war ein natürlicher Sohn des Gonzalo Perez, der lange Zeit Staatssekretär unter Karl V. und Philipp II. gewesen war und durch kaiserliches Dekret (d. d. Valladolid, 14. April 1542) legitimiert worden. Mit einem lebhaften Geist und einem gewinnenden Wesen begabt, einer Hingebung, die weder Grenzen noch Skrupel kannte, fruchtbar an Auskunftsmitteln, in schriftlichen Aufsätzen kräftig und geschmackvoll, ein fertiger Arbeiter, hatte er Philipp II. außerordentlich gefallen, und dieser hatte ihm nach und nach fast sein ganzes Vertrauen geschenkt. Der König ließ ihn seine geheimsten Anschläge wissen, weihte ihn in seine verborgensten Gedanken ein, und Perez war es, der bei dem Dechiffrieren der Depeschen das, was dem Staatsrate mitgeteilt werden sollte, von dem, was dem König allein vorbehalten blieb, ausschied. So hohe Gunst hatte ihn berauscht. Selbst gegen den Herzog von Alba befliß er sich, wenn sie zusammen an der Tafel des Königs speisten, einer Schweigsamkeit und eines hochfahrenden Wesens, die zugleich den Übermut des Hasses und die Verblendung des Glückes verrieten. Auch hatten seine geringe Mäßigung im Glück, seine im höchsten Grade luxuriösen Gewohnheiten, seine Neigung zum Spiel, seine zügellose Vergnügungssucht, seine übermäßigen Ausgaben, die ihn dahin brachten, von allen Seiten Geld zu nehmen, Neid und Feindschaft gegen ihn an dem düsteren und gespaltenen Hofe Philipps II. erweckt und seinen dereinstigen Sturz vorbereitet, den er selbst beschleunigte, indem er den mißtrauischen Stimmungen des Königs zu willig diente, ja sie vielleicht selbst gegen zwei Männer seiner eigenen Partei, gegen Don Juan d'Austria und dessen Sekretär Escovedo im Übermaß aufregte.
Da Requesens 1576 gestorben war, ohne die Niederlande beruhigt zu haben, deren Beschwerden vielmehr durch die Exzesse der spanischen Soldaten, die Städte geplündert und sich gegen ihre Führer empört hatten, gestiegen waren, so hatte Philipp II. seinen natürlichen Bruder Don Juan in jene Provinzen gesendet. Die Lage war ungemein schwierig, die Wahl des Beauftragten aber trefflich. Ein Sohn Karls V., dessen Andenken den Niederlanden so teuer blieb, voll Adel der Gesinnung und Loyalität, von dem Glanz seiner Siege umstrahlt, aus mehreren großen Unternehmungen mit vollständigem Erfolge hervorgegangen, erschien er geeigneter als jeder andere, die 17 Provinzen, die sich soeben (8. November 1576) durch den Genter Vertrag vereinigt hatten, zum Gehorsam zurückzuführen. Auch er hatte indessen große Pläne. Diese Pläne schrieben sich von langer Zeit her; er hatte sie, Perez zufolge, nach der Schlacht von Lepanto (7. Oktober 1571) und der Einnahme von Tunis (1573) gefaßt. Damals soll er die Absicht gehabt haben, auf der Nordküste Afrikas ein Reich zu gründen, weshalb er Tunis, statt es, wie der Hof befohlen, zu schleifen, befestigt habe. Nun, die Ausführung dieses Planes, der jene reichen Gegenden der Zivilisation zurückerobern und das Piratenwesen an seinen Wurzeln ersticken konnte, wäre in der Tat eine Aufgabe für Spanien gewesen, die auch auf das Mutterland ebenso segensreich zurückwirken konnte, wie die amerikanischen Erwerbungen verderblich darauf gewirkt haben. Philipp war eifersüchtig auf den Ruhm seines Bruders, mochte vielleicht in der Unternehmung nur des letzteren Vorteil erblicken, ungeachtet es gar nicht gewiß ist, daß Don Juan bloß an sich und nicht vielmehr an Spanien dachte und es wohl nicht schwer gewesen wäre, die neue Eroberung in bleibender Abhängigkeit von Spanien zu halten, ohne dessen Beistand sie doch nicht zu behaupten war. So ließ er das Unternehmen, trotz der Verwendung des Papstes, fallen, rief Don Juan zurück und ließ sein Werk verkümmern.
Philipp vermutete, daß jene ehrgeizigen Gedanken seines Bruders demselben durch seinen Sekretär Juan de Soto eingegeben worden wären, der Ruy-Gomez dem Prinzen bei dem Krieg gegen die Moriskos von Granada beigegeben und der ihn dann auf seinen Seezügen im Mittelländischen Meer begleitet hatte und beschloß daher, Don Juan diesem gefährlichen Einfluß zu entziehen. Zwar ließ er Soto an dessen Seite, um den Prinzen nicht zu verstimmen, ernannte ihn aber zum Zahlmeister der Armee und ersetzte ihn bei dem Prinzen durch Juan de Escovedo, dessen Treue er für sicherer hielt und der vor seiner Abreise die Weisung bekam, den Prinzen auf andere Wege zu leiten. Es mochte wohl sein, daß Don Juan überhaupt nicht geleitet ward, sondern leitete. Weit entfernt, den Absichten des Madrider Hofes zu entsprechen, ging Escovedo vielmehr in die Pläne des Prinzen ein. Man erfuhr zu Madrid, daß er häufig heimliche Reisen nach Rom mache, von denen er nichts an den Hof berichtete und bald erfuhr man auch durch den päpstlichen Nuntius, um was es sich handelte. Don Juan dachte, so ward versichert, nachdem ihm Tunis entrissen worden war, an England. Der Papst freute sich natürlich dieses Gedankens sehr und verwendete sich für dessen kräftige Unterstützung von Seiten Spaniens. Auch dieses Projekt war nun freilich nicht nach Philipps Sinn, der seinem Bruder keinen Königsthron gönnte, am wenigsten einen solchen, dem er selbst einst nahegestanden. Philipp fand es in einem Augenblick, wo er Don Juan für die Niederlande brauchte, doch für gut, sich zu verstellen und erklärte sich daher bereit, dem Prinzen nach Erledigung der niederländischen Angelegenheit den Versuch auf England zu gestatten, wozu er sich der spanischen Truppen bedienen sollte, wenn die flandrischen Stände in deren Einschiffung willigten. Um aber die Absichten seines Bruders vollständig kennenzulernen und Escovedos Umtriebe zu überwachen, ermächtigte er Perez, der das Vertrauen des Prinzen genoß und mit Escovedo befreundet war, in seiner Korrespondenz mit ihnen in ihre Absichten einzugehen, sich zu stellen, als begünstige er diese beim König, sich sogar sehr freier Ausdrücke über den letzteren zu bedienen, um auch sie zu freierem Herausgehen mit der Sprache und zur Offenbarung ihrer Geheimnisse zu ermutigen. Perez schrieb ihnen Briefe, in denen er nicht immer achtungsvoll von dem König sprach und die er doch diesem selbst vorgelegt hatte, und er teilte wieder dem König die verwegenen Schreiben Escovedos und die Ergießungen des unruhigen und schwermütigen Ehrgeizes des Don Juan mit. An diesem auf Verstellung und Verrat beruhenden und seine Opfer zur Schuld provozierenden Verfahren fanden weder der König noch der Minister einen Anstoß. Nur so viel fühlte Perez doch, daß eine Entdeckung desselben ihn unrettbar kompromittieren würde, und empfahl dem König daher die größte Vorsicht. Sonst aber erklärte er, »wohl zu wissen, daß er, was seine Pflicht und sein Gewissen anlange, in dem allen nichts tue, als was er solle, und keiner anderen Theologie als seiner eigenen zu bedürfen, um das zu begreifen«. Und auch der König versicherte: »Meine Theologie versteht die Sache genau so wie die Eure und findet, daß Ihr nicht bloß tut, was Ihr sollt, sondern Euch gegen Gott und die Menschen vergangen haben würdet, wenn Ihr nicht so gehandelt hättet, um mich so vollständig als nötig über alle die Trugwerke der Welt und über diese Dinge, die mich wahrhaft erschreckt haben, ins Klare zu setzen.«
Inzwischen befand sich Don Juan in den Niederlanden in einer Lage, die ihn äußerst verstimmte. Es gelang ihm nicht, das Mißtrauen der Niederländer gegen Spanien zu beschwichtigen. Trotz der gemäßigten Bedingungen, die er den versammelten Ständen anbot, wurde er mehr als Feind denn als Friedensstifter empfangen. Die flandrischen Stände weigerten sich, in eine Einschiffung der spanischen Truppen zu willigen, damit diese nicht gegen Holland und Seeland verwendet würden, und verlangten ihren Abzug zu Lande nach Italien. Ohne Macht, ohne Geld, außerstande, die Herrschaft des Königs wieder aufzurichten und seinen eigenen Ruf aufrechtzuerhalten, faßte er Widerwillen gegen eine Stellung, bei der er nicht absah, wie er darin zum Ziele kommen solle. Bis dahin an rasche und glänzende Unternehmungen gewöhnt, kränkte er sich über seine Ohnmacht. Er verlangte in Ausdrücken der Verzweiflung seine Abberufung. Es handle sich um sein Leben, seine Ehre und seine Seele, soll er an Peres geschrieben haben, wenn er diese Statthalterschaft nicht aufgäbe. Stehe er an, sich dazu zu entschließen, so werde er die beiden ersten und mit ihnen die ganze Frucht seiner früheren und künftigen Dienste sicher verlieren, und seine Verzweiflung bedrohe selbst die dritte mit großen Gefahren. In einem anderen Schreiben kündigte er eine eigenmächtige Rückkehr auf jede Gefahr hin an, da er lieber ungehorsam als ehrlos werden wolle. Gleichzeitig soll Escovedo geschrieben haben, bald, daß Don Juan lieber mit 6000 Fußgängern und 1000 Reitern als Abenteurer nach Frankreich gehen, als Statthalter von Flandern bleiben, bald, daß er nach Spanien zurückkehren, am Hofe bleiben und von dort aus alles beherrschen wolle.
Don Juan blieb jedoch in Flandern und schickte vielmehr Escovedo nach Spanien, um dort seine bitteren Beschwerden, seine dringenden Forderungen, seine unbestimmten Entwürfe vorzulegen. Während dieser Reise fand Escovedo seinen Tod: er wurde auf Anstiften des Perez mit Genehmigung des Königs ermordet. Bevor wir in die zweifelhaften Gründe dieser Gewalttat eingehen, wollen wir den Vorgang selbst nach dem Berichte eines Teilnehmers schildern, des Antonio Enriquez, eines Pagen des Perez. Dieser ward nämlich, wie er späterhin aussagte, von Diego Martinez, dem Haushofmeister seines Herrn, eines Tages gefragt, ob er nicht einen Landsmann kenne, der jemand einen Messerstich beizubringen bereit sei. Es sei etwas dabei zu verdienen; man werde gut bezahlen, und wenn der Streich selbst den Tod zur Folge habe, so habe es nicht viel zu bedeuten. Enriquez erklärte sich bereit, mit einem Maultiertreiber, den er kannte, zu sprechen, tat es, und der Mann übernahm das Geschäft. Bald darauf gab Martinez aber zu verstehen, daß der Betreffende sterben müsse, daß es eine Person von Bedeutung sei und daß Perez die Sache gutheißen würde, worauf Enriquez erwiderte, es sei das hiernach keine Sache, die man einem Maultiertreiber anvertrauen könne, es gehörten vielmehr Personen von höherer Stellung dazu. (Man sieht, in diesem Banditenwesen war System.) Martinez bemerkte noch, die dem Tode zu weihende Person komme oft ins Haus, und wenn man irgend etwas in ihre Speise oder ihr Getränk bringen könne, so müsse man das tun, da es das beste, sicherste und geheimste Mittel sei. Man beschloß darauf, wie es scheint, ohne an irgendeinen moralischen Skrupel zu denken, sondern die Sache wie jedes andere Geschäft zu behandeln, diesen Weg einzuschlagen und sich zu beeilen. Da nun Enriquez um diese Zeit Veranlassung hatte, nach Murcia zu reisen, so gab ihm Martinez ein Verzeichnis gewisser Kräuter mit, die für ihren Zweck sehr geeignet sein sollten, die er in Murcia finden würde und die er sich dort verschaffen sollte. Er trieb sie in der Tat auf und schickte sie an Martinez, der sich inzwischen von Molina in Aragonien einen Apotheker hatte kommen lassen, der den Saft jener Kräuter in Enriquez' Wohnung unter Martinez' Beistand destillierte. Man mußte sich jedoch in den Kräutern oder im Verfahren geirrt haben, denn ein Hahn, an dem man die Probe machte, verzehrte den Extrakt, ohne den mindesten Nachteil davonzutragen, worauf der Apotheker, für seine Mühe bezahlt, wieder nach Hause geschickt wurde. Bald darauf sagte Martinez, er sei im Besitz eines gewissen Wassers, das gut sei, es jemand zu trinken zu geben. Perez wolle sich niemand anvertrauen als dem Enriquez, und dieser solle nun bei einem Gastmahl, das ihr Gebieter auf dem Lande geben würde, jenes Wasser dem Escovedo beibringen, der sich unter den Gästen befinden würde und für den auch das vorhergegangene Experiment bestimmt gewesen wäre. Als Enriquez jetzt zum erstenmal erfuhr, um wen es sich eigentlich handle und daß er nicht mehr bloß als vermittelndes Werkzeug, sondern als Haupttäter auftreten sollte, erklärte er doch, daß er sich nicht zur Ermordung eines Menschen hergeben würde, solange nicht sein Gebieter ihm selbst den Befehl erteilte. (Dann aber freilich!) Hierauf beschied ihn Perez eines Abends aufs Land und sagte ihm, es läge ihm viel daran, daß Escovedo sterbe; er solle nicht verfehlen, diesem an dem Tage des Festmahles den fraglichen Trank beizubringen und sich mit Martinez zu verabreden. Der Staatssekretär fügte dem Antrage freundliche Worte und Gunsterbietungen bei, womit Enriquez sehr zufrieden war und sich mit Martinez über die einzuschlagenden Maßregeln verständigte. Bei dem Festmahl brachte Enriquez, der die Bedienung Escovedos übernommen hatte, dem letzteren in der Tat zweimal mit dem fraglichen Wasser in der ihm vorgeschriebenen Quantität vermischten Wein bei. Aber auch diesmal blieb der Versuch ohne Wirkung. Etwas besser gelang es einige Tage später, als Perez wieder ein Festmahl gab. Damals reichte Enriquez dem ausersehenen Opfer nochmals die erwähnte Mischung und in eine Schüssel Milchcreme, die für Escovedo bestimmt war, ward ein Pulver getan. Diesmal wurde Escovedo in der Tat krank. Da die Krankheit nicht so rasch und sicher verlief, als man wünschte, vermittelte Enriquez, daß einer seiner Freunde, ein königlicher – Küchenjunge, der früher Page der Gemahlin des Perez, der Donna Juana Coello gewesen und der Sohn des Kapitäns Juan Rubio, Gouverneurs des Fürstentums Melfi und ehemaligen Haushofmeisters des Perez war, seine Bekanntschaft mit Escovedos Koch benutzte, in eine für den Kranken bereitete Suppe etwas von einem Pulver zu bringen, das Martinez ihm gegeben hatte. Als jedoch Escovedo etwas von der Suppe genossen hatte, schöpfte er Verdacht, man entdeckte, daß sie vergiftet sei, worauf ein Sklave Escovedos, der die Suppe zu bereiten gehabt, von ihrer Vergiftung aber keine Ahnung hatte, unschuldigerweise gehenkt wurde. So hatten schon diese Versuche einem völlig unbeteiligten Menschen das Leben gekostet und einen unfreiwilligen Justizmord veranlaßt, dergleichen die menschliche Justiz zu begehen in Gefahr bleiben wird, solange sie zu verurteilen wagt, während noch eine Möglichkeit der Unschuld besteht.
Nach so vielen gescheiterten Versuchen gab man das Gift auf und entschied sich für das kürzere und sicherere Mittel des blutigen Mordes. Pistole und Dolch sollten dem Leben des Escovedo ein Ende machen; um einen Banditen und einen besonders geeigneten Dolch zu holen, begab sich Enriquez in sein Vaterland Italien, von wo er einen seiner Brüder, namens Miguel Boscue, mitbrachte, mit dem er an demselben Tage zu Madrid ankam, an dem der arme Sklave des Escovedo gehenkt wurde. Während seiner Anwesenheit hatte Martinez zwei Spießgesellen, Juan de Mesa und Insausti, aus Aragonien kommen lassen und versammelte die saubere Gesellschaft nebst dem Küchenjungen Juan Rubio am nächsten Tage außerhalb Madrids, um Zeit und Mittel des Mordes zu beraten. Nachdem sie über beides übereingekommen waren und sich mit erlesenen Waffen versehen hatten, schritten sie zur Tat. Perez war inzwischen, jedenfalls in der Absicht, allen Verdacht von sich abzulenken, nach Alcala gegangen, um dort die heilige Woche zu verbringen, die zum Zeitpunkt der Bluttat bestimmt war. Die Verschworenen fanden sich jeden Abend auf dem kleinen St. Jakobsplatz ein, um hier ihrem Opfer aufzulauern, gegen das zunächst Insausti, Rubio und Miguel Bosque bestimmt waren, während Martinez, Mesa und Enriquez sich in der Nähe hielten, um im Notfall zu Hilfe zu kommen. Am 31. März hatten Enriquez und Mesa sich verspätet, trafen ihre Genossen nicht mehr, und erfuhren, als sie sich auf dem Platz umhertrieben, gerüchtweise, daß Escovedo ermordet sei, worauf sie sich in ihre Wohnungen zurückbegaben. Enriquez fand daselbst Bosque, seinen Mantel und seine Pistole, und Mesa fand Insausti, der auch seinen Mantel bei dem Vorgang verloren hatte. Insausti war es, der den Escovedo mit einem einzigen Streich des ihm von Martinez gebotenen Schwertes gefällt hatte, das darauf von ihm und Mesa in den Brunnen ihrer Wohnung geworfen wurde. Rubio eilte dieselbe Nacht nach Alcala, um Perez, der sehr erfreut war, daß niemand ergriffen worden, von dem Vorgefallenen zu benachrichtigen. Die Mörder wurden eilends aus Madrid entfernt und erhielten den versprochenen Lohn. Miguel Bosque bekam 100 Goldtaler, mit denen er in sein Vaterland zurückkehrte. Juan de Mesa erhielt eine goldene Kette, 400 Goldtaler und eine silberne Tasse, ward auch von der Fürstin von Eboli bei der Verwaltung ihrer Güter angestellt. Die drei anderen wurden zu Fähnrichen in der spanischen Armee mit einem Sold von 20 Goldtalern ernannt, wozu die Bestallungen vom König und von Perez am 19. April 1578 unterzeichnet wurden, und gingen darauf, nachdem sie sich zuerst nach Aragonien gewendet hatten, Rubio nach Mailand, Enriquez nach Neapel und Insausti nach Sizilien.
In dieser Weise also sagte Enriquez später über den Hergang des Mordes aus. Jetzt haben wir aber zunächst nach den Urhebern und den Beweggründen desselben zu fragen, worüber mancherlei Streit und Zweifel gewesen ist. Perez selbst gab folgendes an. Zu Rom seien neue Unterhandlungen in betreff der Unternehmung gegen England eingeleitet worden. Don Juan habe sich mit den Guisen in eine bedrohliche Verbindung eingelassen. Escovedo habe sich sogar vernehmen lassen: wenn sie erst Herren von England wären, so könnten sie sich auch zu Herren von Spanien erheben. Don Juan habe dringend Escovedo zurückverlangt und unter anderem geschrieben: »Geld, nochmals Geld und Escovedo.« In Erwägung dieser Umstände habe der König für gut befunden, den Rat des Marquis de Los Velez zu erfordern, dem Perez die ganze Sachlage nach Maßgabe der Originalpapiere vorgetragen habe. Man sei übereingekommen, daß irgendein großer Entschluß und die Ausführung irgendeines großen Streiches zu fürchten sei, der geeignet sein würde, den öffentlichen Frieden und die Ruhe der Staaten Seiner Majestät zu stören, sowie auch den Prinzen Don Juan, wenn man den Sekretär Escovedo länger bei ihm ließe, ins Verderben zu stürzen. Infolge dieser Besorgnisse soll denn der Tod des Escovedo beschlossen worden sein, und Perez versicherte, der Marquis de Los Velez sei von der Angemessenheit dieser Maßregel so überzeugt gewesen, daß er erklärt habe: wenn er, die Hostie im Munde, befragt würde, welches Leben zu opfern am wichtigsten sein würde, das des Juan Escovedo oder das irgendeines von denen, die am gefährlichsten wären, er sich für das des Escovedo entscheiden würde.
Mignet bestreitet die Richtigkeit dieser Angabe zunächst aus dem Grunde, weil die angeführten Besorgnisse zum großen Teil nicht auf Wahrheit beruht hätten. Er bezweifelt, daß selbst Escovedo jemals den ausschweifenden Gedanken gehegt hätte, den Don Juan auf den spanischen Thron zu setzen, und behauptet wohl mit Recht, daß dieser Gedanke von Don Juan geradezu unmöglich zu erklären sei, da er im Widerspruch mit dessen Loyalität und gesunder Einsicht gestanden habe. Don Juan sei seinem Bruder gegenüber immer pflichtgetreu gewesen, und wenn er etwas chimärische Pläne gehegt habe, so habe er doch keine schuldbaren und sinnlosen gehegt. Es lasse sich ferner nachweisen, daß die Angaben des Perez über die Verbindungen des Prinzen mit den Guisen falsch seien. Perez behaupte, der spanische Gesandte zu Paris Vargas Mexia habe diese dem König entdeckt und scheine diese Mitteilung in das Frühjahr 1577 zu verlegen, da er sie in einen Bericht von den dem Don Juan zugeschriebenen Entwürfen aus dem März, April, Mai jenes Jahres einschiebe. Vargas Mexia sei aber erst im Oktober 1577 zum Nachfolger des Don Diego de Cuniga ernannt worden und erst am 10. Dezember in Paris angekommen. Weiter versichere Perez: Vargas habe wiederholt berichtet, daß die Agenten des Prinzen sich zwar anfänglich öffentlich in Paris zeigten, daß aber, nachdem sie ihre ostensiblen Geschäfte verrichtet, der eine oder andere wiederkomme und sich im Kabinett des Guise verborgen halte, und daß diese geheimen Unterhandlungen zu einer Verbindung des Prinzen mit den Guisen geführt hätten, die den Namen der Verteidigung der zwei Kronen führte. Nun hat Mignet bei sorgfältiger Durchsicht der Korrespondenz des Vargas mit seinem Hofe von Ende Dezember 1577 bis zum Juni 1580, als Vargas starb, jene Angaben nicht bestätigt gefunden. Seine Mitteilungen über Don Juan und die Guisen seien weit weniger beunruhigend gewesen, als Perez behaupte, und fielen fast alle erst nach dem Mord des Escovedo, auf den sie daher nicht eingewirkt haben könnten. Don Juan hatte im August 1577 den Jerome Curiel zum Zwecke der Geldbeschaffung nach Paris geschickt, ersetzte ihn, als Curiel starb, im Februar 1578 durch den Zahlmeister Pedro Arcanti, der darauf den Alonzo Curiel, den Bruder des Jerome, zum Nachfolger hatte. Dann schickte er noch den Longueval de Vaulx. Diese Agenten standen alle mit Vargas in amtlichem Verkehr und korrespondierten auch mit dem König und mit Perez direkt von Paris aus. Erst nach dem Tode des Escovedo, zu Anfang des Mai 1578, kam Don Alonzo de Sotomayor, der sich mit den Guisen über niederländische Angelegenheiten vernehmen sollte. Vargas gedenkt nun in seinen Depeschen, soweit von Mignet gefunden, aller dieser Agenten, erwähnt aber nicht, daß sie sich heimlich in Guises Kabinett aufgehalten und geheime Verhandlungen mit diesem gepflogen hätten. Die Beziehungen Don Juans zu den Guisen schienen ihm den Triumph der katholischen Sache in den Niederlanden, in Schottland und England zum Zwecke zu haben, und er sagt, nach Mignet, nirgends in seinen Korrespondenzen, daß jene Prinzen sich zur Verteidigung der zwei Kronen verbündet hätten. Unter dem 31. Dezember 1577 erwähnt er zwar, daß die Guisen Pläne hätten, die darauf abzielten, sie zu Herren eines Teiles von Frankreich zu machen, spricht aber dabei nicht von Don Juan, und gerade diese Mitteilung benutzt Philipp II., um selbst eine Annäherung an die Guisen einzuleiten, die auch einige Jahre später zu dem bekannten gänzlichen Anschluß der Guisen an Spanien führte, 1578 aber von Philipp hauptsächlich benutzt wurde, die Unternehmungen der Guisen auf England und Schottland im Interesse der katholischen Sache, also gerade dieselben Unternehmungen zu ermutigen, wegen deren die Guisen auch mit Don Juan in Verhandlung standen und die dem letzteren zum Vorwurf gemacht worden sein sollen. Über den Stand und die Tragweite der letzteren Verhandlungen weiß Vargas nichts als unbestimmte Gerüchte zu berichten, so daß man in Rom dem Don Juan die englische Krone zudenke, daß ein Projekt bestehe, ihn mit der Königin von Schottland zu vermählen, Mitteilungen, die Philipp II. mit wenigstens anscheinender Indifferenz und als das behandelt, was sie waren. Bald darauf (1. Oktober 1578) macht der Tod des Don Juan diesen Entwürfen ein Ende, ein Todesfall, der Philipp aufrichtig nahe zu gehen schien. »Mit lebhaftem Schmerze habe ich«, so schrieb er am 13. Oktober an Vargas, »die üble Nachricht empfunden, dir mir von dem Tode des erlauchtesten Don Juan, meines Bruders, gekommen ist, sowohl weil ich ihn lieb hatte, als wegen der Lage, in der sich meine Angelegenheiten befinden.« So schrieb er noch einige Tage später: »Ich liebte und achtete seine Person und er wird mir überall fehlen, besonders wegen der flandrischen Angelegenheiten.«
Mignet findet nun in dem allen den Beweis, daß es nicht die von Perez angeführten Ursachen hätten sein können, die den Tod des Escovedo herbeiführten. Und in der Tat, selbst wenn man annehmen wollte, daß die von Perez angeführten Verdachtsgründe so gewesen oder doch von ihm dem König und dessen Ratgeber so dargestellt worden wären, wie er angibt, würde eine einfache Entfernung Escovedos von der Person des Prinzen dem Zweck ebenso genügt haben wie in dem früheren Fall mit Soto, und man hätte keine Ursache gehabt, zu dem schlimmen und gefährlichen Mittel eines Mordes zu greifen. Mignet sieht sich daher für den letzteren nach persönlichen Motiven um, wie sie auch im Laufe des Prozesses zutage gekommen sind, die aber nicht überall Glauben gefunden haben, und erklärt sich nun für die von den Gegnern des Perez in den Vordergrund gestellten Angaben, wobei er namentlich gegen Ranke polemisiert. Es handelt sich um eine Buhlschaft zwischen Perez und der verwitweten Fürstin von Eboli. Ranke hat eine solche bezweifelt, weil die Fürstin alt und einäugig gewesen sei und weil des Perez Gemahlin ihm während der ganzen Dauer des Prozesses die eifrigste, ausdauerndste, hingehendste Zuneigung bewiesen habe. Diesen angeführten Grund erklärt Mignet kurzweg, aber wohl mit Recht, daß er keiner sei. Es fehlt ja, zur Ehre der Frauen und der Ehe, nicht an Beispielen, wo Gattinnen ihren notorisch untreuen Gatten die hingehendste, aufopferndste Treue bewiesen haben. In Betreff des übrigen bemerkt Mignet, daß alle Zeitgenossen die Schönheit der Fürstin gepriesen hätten. Alt sei sie damals noch nicht gewesen. 1540 geboren, war sie 1553, erst dreizehnjährig, zu Alcala mit Ruy-Gomez vermählt worden, und in der hier berührten Zeit erst 38 Jahre alt. Auch sei sie nicht einäugig gewesen, sondern habe nur auf dem einen Auge einen Schelblick gehabt. Für die Verbindung zwischen der Fürstin und Perez sprächen zahlreiche Zeugnisse, die er nun aufführt. Perez hatte viele und kostbare Geschenke von ihr erhalten, und ein gerichtlicher Entscheid verurteilte ihn später zu deren Rückgabe. Der Erzbischof von Sevilla, Don Rodrigo de Castro, sagte aus, Perez habe sich der Sachen der Fürstin wie seiner eigenen bedient. Doña Catilina de Herrera erzählte, Escovedo habe der Fürstin eines Tages vorgestellt, daß die Reden, die man über die Besuche des Perez bei ihr führe, ihr nachteilig seien, und hinzugefügt: er sage das, weil er das Brot ihres Hauses gegessen. Die Fürstin aber sei aufgestanden und habe sich mit den Worten entfernt: Die Stallmeister hätten nicht über das zu reden, was die großen Damen täten. Doña Beatrix de Frias, die Frau des Juan Lopez de Biranco, bestätigte das und fügte hinzu, das ganze Haus der Fürstin habe sich über das beständige Kommen und Gehen des Perez, das sich auch nach dem Tode des Escovedo fortgesetzt habe, dergestalt aufgehalten, daß der Fürst von Melito, der Marquis de La Fabara und der Graf von Cifuentes, sämtlich Verwandte der Fürstin, den Perez hätten töten wollen; eine Aussage, die auch durch Don Lorenzo Tellez de Silva, Marquis de La Fabara selbst bestätigt ward. Dieser versicherte auch: Die Fürstin habe ihn gefragt, ob er wisse, daß Perez der Sohn ihres verstorbenen Gemahls sei, und habe ihn ersucht, dies allgemein bekanntzumachen. Das wäre denn eine seltsame Rede gewesen, der man nur die Absicht unterlegen kann, jeden Verdacht als unmöglich erscheinen zu lassen. Sowohl in dem Hause der Fürstin wie im Publikum überhaupt soll man übrigens bei dem Tode des Escovedo überzeugt gewesen sein, daß Escovedo als ein Opfer für die Ehre seines verstorbenen Gebieters und Wohltäters, des Fürsten von Eboli, gefallen sei. Das freilich war ein jederzeit plausibler Verdachtsgrund, da das Publikum in solchen Fällen den Schein zu oft für Gewißheit hält und das Gerücht es mit den Tatsachen nicht genau nimmt. Doch auch die Fürstin selbst verstärkte den Verdacht durch ihre Reden. Sie sagte zu Beatrix de Frias nach Escovedos Tode: dieser habe eine böse Zunge gehabt, von großen Damen sehr übel gesprochen und die zu St. Maria predigenden Mönche, von deren Ermahnungen die Fürstin sich manchmal getroffen fühlen mochte, beredet, sehr boshafte Dinge zu reden, die sie selbst sehr kränken könnten. Gleich nach dem Morde soll sie auch gegen dieselbe Dame geäußert haben: sie wisse wohl, daß die Angehörigen des Escovedo ihr seinen Tod zur Last legten. Hierauf wendete man denn den bekannten, gleichfalls trügerischen, wenn auch zuweilen zutreffenden Satz an: Qui s'excuse s'accuse. Die Anstellung des Mesa bei der Güterverwaltung der Fürstin war ein weiterer und allerdings stärkerer Verdachtsgrund.
Perez und die Fürstin sollen aber noch einen anderen Grund zu dem Wunsche gehabt haben, der Beobachtungen und der Überwachung des Escovedo enthoben zu werden, einen Grund, der allerdings auch auf ihrem angeblichen Verhältnisse beruhte. Sie hätten, glaubt man, die Eifersucht des Königs gefürchtet. Philipp II. stand in dem Rufe, ein inniges Verhältnis mit der Fürstin Eboli gehabt zu haben. Trotz seiner düsteren Strenge und seiner vier Gemahlinnen schrieb man ihm derartige Schwachheiten zu. In einem handschriftlichen italienischen Berichte von 1584 heißt es in dieser Beziehung: »Er ist ein starker Frommer, beichtet und kommuniziert des Jahres mehrmals, betet täglich und will das Gewissen rein haben. Man glaubt, daß seine größte Sünde die des Fleisches sei, weil (sie) er haarig und kahlköpfig ist, dünne Beine hat, unter Mittelgröße, ist und eine starke Stimme besitzt. Es gibt mehrere Herren an seinem Hofe, die für seinen Sohn gelten, wie der Herzog von P., Don ... und andere.« Nun befand sich zu jener Zeit nur ein Herzog, dessen Name mit einem P begann, am Hofe, oder überhaupt unter den kastilianischen Großen, der Herzog von Pastrana, und das war allerdings der eigene Sohn der Fürstin von Eboli. Escovedo aber soll gedroht haben, das Verhältnis der Fürstin mit Perez dem König entdecken zu wollen. Rodrigo de Morgado, ein sehr vertrauter Stallmeister des Perez, hat seinem Bruder André de Morgado erzählt: Escovedo habe die Fürstin und Perez eines Tages juntos en la cama o en el estrado en Cosas deshonestas getroffen und dabei ausgerufen: »Das ist nicht mehr zu dulden, und ich bin verpflichtet, es dem König zu berichten«, worauf die Fürstin erwidert habe: »Escovedo, tut es, wenn Ihr wollt, que mas quiero el trasero de Antonio Perez que al rey.« Schließlich soll Perez selbst, nachdem er sich an den Hof Heinrichs IV. geflüchtet, seine Buhlschaft mit der Fürstin von Eboli und daß der König sein Rivale gewesen, eingestanden haben.
Nun, das Letztere, das von Mignet für den schlagendsten Grund erklärt wird, scheint uns auch noch kein Beweis zu sein, da Perez hierin sehr wohl gelogen haben könnte, und das übrige sind Aussagen ohne materielle Grundlage und können von den Feinden des Perez ausgegangen sein. Aus inneren Gründen ist es jedoch nicht unwahrscheinlich, daß Perez durch ein solches persönliches Motiv zu dem Morde eines alten Freundes und Parteigenossen getrieben wurde, dessen politische Gefährlichkeit auf milderem Wege zu beseitigen war und dem Perez überhaupt schwerlich so bedenklich erschienen ist. Würde uns aber auch durch diese Annahme der Anteil des Perez und der Fürstin von Eboli an dem Morde des Escovedo erklärt, so würden wir doch immer auf jene politischen Besorgnisse zurückkehren müssen, um begreifen zu können, wie der König vermocht wurde, seine Zustimmung zu dieser Gewalttat zu geben. Da die Besorgnisse in Wirklichkeit nicht so ernster Natur waren, um eine derartige, niemals zu rechtfertigende oder auch nur zu entschuldigende Maßregel wenigstens zu erklären, so muß man zu weiterer Verstärkung der Schuld des Perez annehmen, daß er dem König die Besorgnisse schwärzer ausgemalt hat, als sie waren. Er wollte den Escovedo los sein, weil er ihn als den Wächter seiner Beziehungen zu der Eboli fürchtete, und der Haß einer beleidigten, einer in ihrer Leidenschaft durchkreuzten Spanierin drängte zur Bluttat. Um diese ungestraft ausführen zu können, wurde dem König vorgespiegelt, die Wegräumung des Escovedo sei durch politische Notwendigkeit geboten. Dies scheint noch die wahrscheinlichste, die beiden streitenden Meinungen vereinigende Annahme. Daß aber der König und sein unbeteiligter, rein geschäftsmännischer Ratgeber, Los Velez, so leicht auf ein so abnormes und in Wahrheit über alle Notwendigkeit hinausgreifendes Mittel eingingen, spricht denn doch dafür, daß dergleichen in die Reihe der gewöhnlichen Staatsmittel der Zeit und des Landes gehörte, wobei es immer noch zu Spaniens Ehre gereicht, daß man dort nicht genug Werkzeuge dafür fand, sondern sie zum Teil aus Italien, dem klassischen Lande des Meuchelmordes, entlehnen mußte.
Wie es aber immer mit der Beteiligung all dieser Personen an dem Morde des Escovedo gestanden haben mag, sie sollten die Früchte ihres Verbrechens nicht in Ruhe genießen. Die Witwe und die Kinder des Escovedo hielten sich an den nächsten Anlaß, an den nächsten wahrscheinlichen Urheber, kannten die weitere politische Verflechtung nicht oder wollten sie nicht kennen, richteten sich unmittelbar gegen Perez und verlangten vom König Gerechtigkeit. Philipp gewährte dem Sohne des Ermordeten, Don Pedro Escovedo, eine Audienz, hörte mit allem Anschein der Teilnahme seine Klagen gegen die Mörder seines Vaters an, empfing aus seiner Hand die von der Familie entworfenen Anklageschriften und versprach, sie geeigneten Falles den Gerichten zu übergeben. Bei alledem war er in großer Verlegenheit. Zwar war es ihm ganz recht, daß der Verdacht sich auf andere wendete statt auf ihn, indem die Ankläger bloß das Verhältnis des Perez zu der Fürstin als das Motiv des Mordes betrachteten und von den politischen Gründen nichts zu wissen schienen; aber er fürchtete doch das Aufsehen einer Untersuchung, in die er selbst verwickelt werden konnte. Die Verlegenheit, in der er sich zwischen den Klagen der Escovedo und den Gefahren des Perez, zwischen seinen Pflichten als König und seinen Interessen als Mitschuldiger befand, wurde noch dadurch erhöht, daß die Escovedos sehr mächtige Beschützer in seiner Nähe fanden. Der bedeutendste von ihnen war der Kabinettssekretär Matteo Vasquez, ein heimlicher Feind des Perez, der schon lange auf dessen Einfluß eifersüchtig gewesen war und jetzt um so weniger Bedenken trug, ihn offen anzugreifen, je gewisser er eine Gelegenheit gefunden zu haben glaubte, ihn zu stürzen. Er verband sich mit Don Pedro de Belandi, Pedro Negrete, Diego Nuñez de Toledo, welche die Esvovedos bei ihren Maßregeln berieten und leiteten, und tat alles, was er konnte, den unentschlossenen König zu Maßregeln gegen Perez zu bestimmen.
Der König hielt es im Anfang mit beiden Parteien. Er hörte Vasquez gnädigst an und schien sich doch mit Perez einzuverstehen. Er unterrichtete Perez an demselben Tage, an dem die Escovedos ihre Klage erhoben hatten, von dieser Maßregel. Er verschwieg ihm nicht, welche hohe Feindschaften sich gegen ihn erhöben, versprach ihm daher gleichzeitig, ihn nicht verlassen zu wollen, und gab ihm, wie wenigstens Perez behauptete, sein Wort als Edelmann darauf. Gleichwohl tat er zunächst nichts, ihn aus seiner gefährlichen Lage zu ziehen. Perez fühlte diesen Widerspruch sehr wohl, hielt den König für schwach und vielleicht für treulos und verhehlte ihm seine Besorgnisse nicht. »Diese Geschichte«, schrieb er ihm, »verursacht mir täglich tausend Sorgen, die einen Stein zermalmen würden. Ew. Majestät kann mich mit der Verbrechermütze bedecken lassen, denn ich bin gewiß, daß ich es bin, der in dieser ganzen Sache für alles wird zahlen müssen.« Philipp II. antwortete mit freundschaftlicher Vertrautheit: »Ihr müßt heute nicht bei gesunden Sinnen sein; glaubt nichts von dem, was Ihr mir da sagt.« Trotz dieser Versicherungen sah Perez das Schicksal voraus, das ihm vorbehalten war; er fuhr mit seinem Anliegen an den König fort und schrieb ihm: »Ich fürchte, Sire, daß meine Feinde mich in dem Augenblicke, wo ich mich dessen am wenigsten versehe, erdolchen, oder daß meine Neider zu ihrem Ziele gelangen, indem sie Ew. Majestät überraschen und auf Ihre Milde und Nachgiebigkeit rechnen. Ich sage das aus Anlaß des Vorgefallenen, weil ich weiß, daß meine Feinde sich keine Ruhe gönnen.« Auch auf dieses Billett antwortete der König durch die Randbemerkung: »Ich habe Euch schon gesagt, Ihr müßtet nicht bei gesundem Verstande sein; mögen sie sich immer keine Ruhe gönnen, glaubt nur, daß das alles umsonst sein wird.« Perez hätte es gerne geglaubt, aber er kannte seinen Gebieter nur zu gut. Er bat ihn daher um Erlaubnis, seinen Dienst zu verlassen, um seine Person dem Neide der einen und der Rache der anderen zu entziehen. Hätte Philipp II. voraussehen können, wozu er selbst sich noch entschließen würde, so hätte er großmütig gehandelt, wenn er sich diesem Gesuche gefügt hätte. Er mochte aber damals allerdings noch die Absicht haben, Perez nicht fallen zu lassen, und gab daher seine Zustimmung nicht. Nun drängte Perez, hierin zugleich großmütig, kühn und klug handelnd, den König, ihn vor Gericht zu stellen, ohne jedoch die Fürstin in den Prozeß verwickeln zu lassen. Er versicherte ihm dabei, daß sein Geheimnis nicht verraten werden würde, da keiner der Mörder ergriffen worden sei und der Ankläger gegen Perez selbst keinen Beweis habe. Philipp II. wollte es nicht auf diesen gefährlichen Versuch ankommen lassen. Er hielt es für besser, daß Perez dem Präsidenten des Rates von Kastilien, Don Antonio de Pazos, Bischof von Cordova, die Gründe, die zu dem Morde des Escovedo geführt hätten, entdeckte, damit Pazos mit dem jungen Escovedo und mit Velasquez spreche, um sie zu veranlassen, ihre Verfolgungen aufzugeben.
Dieses Manöver, das geeignet schien, den Gefahren des Perez ein Ende zu machen, glückte wohl dem gegenüber, der ein wirkliches Recht hatte, die Bestrafung des Perez zu betreiben, nicht aber bei dem, den Mißgunst und Ehrgeiz zur Verfolgung desselben antrieben. Der Präsident, welcher Perez jetzt nicht mehr für schuldig betrachtete, da er nur dem Befehle seines Königs gehorcht habe, und der nichts davon wußte, wie und warum dieser Befehl erwirkt worden, ließ den ältesten Sohn des Escovedo kommen und erklärte ihm: der König lasse ihm sagen, daß er der Familie Escovedo volle Gerechtigkeit zuteil lassen werde, ohne Ansehen von Personen, Ort, Geschlecht oder Stand. Vorher aber müsse er, der Präsident, ihn erinnern, sorgfältig zu prüfen, was für Beweise er habe. Denn wenn diese Beweise nicht sehr genügend wären und die Klage nicht wahrhaft begründeten, so könnte sich die Sache leicht gegen ihn wenden, da denn doch die Personen, die Abkunft und der hohe Stand der Fürstin und des Perez alle Rücksicht erheischten. Schließlich müsse er ihm im Vertrauen sagen und bekräftige es auf sein Priesterwort: daß die Fürstin und Perez so unschuldig seien wie er selbst. Das war freilich etwas viel gesagt, da dem Bischof aus des Perez eigener Erklärung bekannt sein mußte, daß wenigstens dieser um den Mord gewußt hatte, wenn er auch dabei nur als Werkzeug des Königs und aus Staatsgründen gehandelt haben wollte. Auf den jungen Escovedo machte aber die ganze Vorstellung den beabsichtigten Eindruck. Er war sich bewußt, daß er nur Verdacht, aber keinen Beweis hatte, der vor Gericht genügen konnte. Er antwortete daher: »Weil es so steht, so gebe ich, für mich, meinen Bruder und meine Mutter mein Wort, niemals wieder gegen den einen noch gegen den anderen von diesem Morde zu sprechen.«
Nun ließ der Präsident den Matteo Vasquez kommen und sagte ihm in ziemlich scharfer Weise: Da er weder durch sein Amt noch durch irgendeine Verpflichtung gegen den Toten veranlaßt sei, die Mörder des Escovedo zu verfolgen, überdies seine Beflissenheit hierin bei ihm als Priester sehr zweideutig erscheine, so möge er sich von der Sache zurückziehen, die ganz anders stehe, als er annehme. Matteo Vasquez, der wahrscheinlich besser als der Bischof den ganzen Zusammenhang kannte, sich aber nicht in seinen wohlberechneten, ehrgeizigen Plänen irremachen lassen wollte, zog sich nicht von der Sache zurück. Da die Söhne des Escovedo den Prozeß aufgaben, so regte er einen anderen Verwandten an, der den König um Gerechtigkeit in dieser Mordsache drängte, während auf der anderen Seite die Fürstin Eboli den Vasquez in offenster und stolzester Sprache beim König verklagte. So schrieb sie ihm: »Ew. Majestät geruhen Sich zu erinnern, daß ich zu Ihrer Kenntnis gebracht habe, was ich wußte, daß Matteo Vasquez und seine Leute gesagt hatten: daß, wer einen Fuß in mein Haus setze, Ihre Gnade verlöre. Da diese Leute so besonders keck und auf einen solchen Grad der Verwegenheit und Unehrerbietigkeit gelangt sind, so ist Ew. Majestät in Ihrer Eigenschaft als König und als Edelmann verpflichtet, ein solches Exempel zu statuieren, daß der Ruf davon überall hingelangt, wo die Beleidigung bekannt ist. Sollte Ew. Majestät die Sache nicht so ansehen, sollten Sie wollen, daß der Ruf meines Hauses mit dem Vermögen meiner Vorfahren und der so wohl erworbenen Gunst meines fürstlichen Gemahls zugrunde gehe, sollten Sie deren Dienste mit einer solchen Vergeltung und mit einer derartigen Belohnung bezahlen, so hätte ich, indem ich eine solche Sprache gegen Sie führe, wenigstens getan, was ich meiner Stellung schuldig bin. Ich ersuche Ew. Majestät, mir diesen Brief zurückzuschicken, da das, was ich sage, nur für einen Edelmann ist, auf dessen Diskretion ich bei aller Empfindlichkeit über die erfahrene Beleidigung vertraue.« Zugleich verlangte sie die Bestrafung des Vasquez, den sie einen maurischen Hund nannte, und berief sich nach erfolgter Anfrage auf das Zeugnis des Don Gaspar Quiroga, Kardinal-Erzbischofs von Toledo, und des königlichen Predigers Hernando del Castillo, die es ihr auch nicht versagten. Zwischen Perez und Vasquez brach offener Krieg aus. Als Perez einmal einen Beamten zu Vasquez schickte, um ein dem König vorzulegendes Aktenstück holen zu lassen, fügte Vasquez eine andere, von ihm selbst geschriebene Schrift bei, welche voll Anklagen und Beleidigungen gegen Perez war. Perez brachte sie, äußerst entrüstet, dem König und verlangte Genugtuung oder die Erlaubnis, sich sie selbst zu nehmen. Philipp versprach Genugtuung zum Schein, verschob aber die Sache immer, indem er vorgab, den Vasquez erst gewisse schwebende Geschäfte erledigen lassen zu wollen, wobei er doch wieder behauptete, er habe gar nicht den Mut, mit diesem Menschen Geschäfte zu verhandeln. Er glaubte, so hier wie in allen Dingen, daß Zeit gewonnen, alles gewonnen sei, was denn freilich höchstens da zutrifft, wo die Dinge sich im Verlaufe der Zeit besser gestalten. Außerdem verlor er den Vasquez ungern, der ihm wegen seiner angenehmen Persönlichkeit und seiner pünktlichen und geordneten, dem König vieles erleichternden Geschäftsführung wert war. Auch stand Vasquez nicht allein, sondern bildete mit dem Beichtvater Diego de Chaves und dem Grafen von Barajas, dem Oberhofmeister der Königin, einen leitenden Bund (eine amistad, wie man es damals nannte), wie er einst zwischen Perez, Los Velez und dem Kardinal von Toledo bestanden hatte. Philipp beauftragte Chaves zunächst, eine Aussöhnung zwischen Perez und der Fürstin zu vermitteln.
Perez erriet aus allem sein bevorstehendes Sinken. Er schrieb an den König: »Ich sehe, nachdem ich mit den schwachen Talenten, die ich besitze, gedient, nachdem ich meinem Fürsten eine Treue ohne Grenzen bewiesen habe, nach den Versicherungen, die er mir gegeben hat und nach denen ich mich in Achtung und Ehren glauben konnte, daß mein böser Stern den Sieg davonträgt, während jenem anderen trotz seiner zahllosen Fehler und seiner Beleidigungen gegen eine große Dame und gegen einen Mann, der nur nützlich hat sein wollen und der, um es zu werden, sich so weit gewagt hat, wie ich getan habe, alles von statten geht.« Sein böser Stern trug in der Tat den Sieg davon. Philipp II., zu dem die Gerüchte gedrungen sein sollen, die über das vertraute Verhältnis der Fürstin Eboli und des Perez und über die wahren Ursachen, denen man den Tod Escovedos zuschrieb, umherliefen, mochte jetzt die Meinung fassen, daß sie ihr Spiel mit ihm getrieben, und dann war es natürlich, wenn ein tiefer Groll gegen sie erwachte und mit jedem Schritte, den er wider sie tat, weiter fraß. Doch die steigende Härte, mit der er namentlich gegen Perez verfuhr, das gänzliche Vergessen früherer Gunst und Vertraulichkeit und früherer Dienste, ist ja nur zu oft mit der Undankbarkeit der Großen verbunden. Wenn er den Perez auch nicht als einen begünstigten Nebenbuhler betrachtet haben wollte, so ist er ihm doch als ein abgenutztes und unbequem gewordenes Werkzeug erschienen. Wollen die Großen dieser Erde, wenn sie von dem Sinne sind, der die Menschen wie Schachfiguren betrachtet, ein solches los werden, wollen sie die Reste der ausgepreßten Zitrone wegwerfen, so ist es ihnen am liebsten, wenn sie sich, mit oder ohne Grund, sagen können, das Opfer ihrer Selbstsucht habe es nicht besser verdient.
Zunächst aber mußte erst ein Ersatz für Perez und für den soeben voll Sorgen und Kummer verstorbenen Marquis von Los Velez beschafft werden. Philipp dachte an den Kardinal Granvella, dessen Vater der berühmte Kanzler Karls V. gewesen, der selbst das Zweitälteste Mitglied des spanischen Staatsrates war, bis 1564, wo er sich vor dem Hasse der Flamänder nach Besançon zurückzog, an der Spitze der niederländischen Angelegenheiten gestanden hatte, dann zum Vizekönig von Neapel ernannt worden war und sich jetzt in Rom aufhielt. Am 30. März 1579, ein Jahr nach der Ermordung des Escovedo, hatte Perez ein dringendes königliches Einladungsschreiben an den Kardinal, eilends nach Madrid zu kommen und die Arbeit an der Seite des Königs zu übernehmen, mit seiner Gegenzeichnung zu versehen. Dies sollte für ihn den Anfang schlimmer Zeiten bezeichnen, wenn auch nicht Granvella sein spezieller Verfolger ward.
Dieser war durch den Ruf überrascht und keineswegs freudig betroffen worden. Er war 74 Jahre alt, hätte gern sein Leben in Rom beschlossen, wo er ein otium cum dignitate genoß, scheute schon die Reise nach Madrid, mehr noch die Last der Geschäfte, die Eifersucht der allen Fremden abholden Spanier, die Intrigen der Hofleute, die gefährliche Freundschaft eines mißtrauischen, unentschlossenen und wankelmütigen Fürsten. Der Papst erwartete wesentliche Vorteile für die Kirche davon, wenn der Kardinal den Ruf annähme und bestimmte ihn dazu. Granvella verließ daher Rom am 16. Mai, um sich zu Civitavecchia auf der Flotte des mit 23 Galeeren zu seinem Empfang herbeigekommenen Fürsten Johann Andreas Doria einzuschiffen, langte aber, durch widrige Winde in der Gegend der Rhonemündungen aufgehalten, erst am 28. Juli 1579 in Carthagena an, von wo er sich nach Madrid begab. Er hatte sich vorgenommen, sich den Irrgängen der Hofintrigen und überhaupt den inneren Angelegenheiten Spaniens möglichst fernzuhalten und sich auf die äußere Politik zu beschränken. So würde er vielleicht auch dem Perez nicht gefährlich geworden sein, außer daß er ihn bei dem König in jenen Geschäften ersetzte. Aber ihn begleitete Don Juan Idiaquez, welchen Perez als einen zu fürchtenden Nebenbuhler sorgfältig von dem Staatssekretariate entfernt gehalten und der jetzt von der wankenden Stellung des Günstlings Kunde bekommen und sich auf den eigenen Rat Granvellas entschlossen hatte, sich dem König vorzustellen, wenn auch ohne Ermächtigung.
Den Tag ihrer Ankunft wählte der König zu seinem ersten Schlag gegen Perez, der jedoch noch immer mit Bemäntlung und Verstellung verbunden war. Die Fürstin und Perez hatten anfangs jede Aussöhnung mit Vasquez verweigert. Die Fürstin hatte dem Bruder Diego de Chaves geantwortet: Eine Person wie sie könne auf nichts Derartiges hören; die Beleidigung, über die sie sich beschwere, gestatte es nicht. Perez hatte an den König in Ausdrücken eines übelverhehlten Verdrusses geschrieben: Er gäbe ihm das von ihm empfangene Wort in betreff zu erlangender Genugtuung zurück; er verzeihe die Beleidigungen, deren Ziel er gewesen, da der König sich diejenigen gefallen lassen wolle, die ihm selbst zugefügt würden. Er flehe aber Seine Majestät an, ihm zu erlauben, sich ähnlichen Verfolgungen zu entziehen, indem er sich zurückzöge und zum Zeugnis seiner Treue und als ganzen Lohn seiner Dienste nur die Gnade des Königs mitnähme. (War es ein richtiges Gefühl, daß noch Schlimmeres bevorstehen möge, was den Perez bewog, so wiederholt seine Entlassung zu begehren? Oder glaubte er, dem König unentbehrlich zu sein? Und warum ging der König auf den gebotenen Ausweg nicht ein?) Die Fürstin war inzwischen klüger geworden und hatte auch Perez für eine Aussöhnung mit Vasquez bestimmt, so daß er sich vorgenommen hatte, dem König am 29. Juli diesen Entschluß anzuzeigen. Das war um einen Tag zu spät. Am 28. Juli, dem Tage, wo Granvella und Idiaquez in Madrid eintrafen, abends um 11 Uhr, wurde Perez durch den Alkalden des Hofes, Alvaro Garcia de Toledo, auf Befehl des Königs in Haft genommen. Gleichzeitig wurde die Fürstin von Eboli auf die Festung Pinto gebracht. Es spricht allerdings für ein ganz besonderes persönliches Interesse des Königs an dem letzteren Akt, daß er sich selbst unter den Portikus einer der Wohnung der Fürstin gegenüberliegenden Kirche stellte und hier die Ausführung seines Befehles mit Spannung erwartete. Er soll darauf bis 5 Uhr morgens in großer Bewegung in seinem Gemach umhergegangen sein. Übrigens bezog man diese Verhaftungen noch nicht unmittelbar auf die Ermordung des Escovedo, sondern nahm die halsstarrige Verweigerung der Aussöhnung mit Vasquez zum Vorwand, wobei freilich leicht zu durchschauen war, daß dies nur ein Vorwand war, und daß das Ganze den Anfang einer ernsteren Ungnade bezeichnete, wenn diese auch noch lange eine wunderlich verhüllte und verbrämte bleiben und ihre Opfer in peinlicher Ungewißheit halten sollte. Jedenfalls machte der Sturz des Perez der Herrschaft der von dem Fürsten von Eboli begründeten Partei ein Ende, einer Partei, welche wenigstens vergleichsweise gemäßigte Grundsätze befolgt, versöhnliche Maßregeln versucht und das Interesse des Staates nicht gänzlich den Leidenschaften der Kirche untergeordnet hatte. Nachdem sie länger als 20 Jahre die Angelegenheiten der spanischen Monarchie im Sinne einer gewissen umsichtigen Mitte geleitet, hatte sie hintereinander ihr kluges und geschicktes Haupt Ruy-Gomez, ihren jungen und glänzenden Feldherrn Don Juan d'Austria, endlich den immerhin festen und geachteten Marquis von Los Velez verloren. Die Partei verlor jetzt den letzten Führer, der sich so lange gewandt in der Gunst des Königs zu behaupten gewußt, der ihr aber auch durch den blutigen Gewaltstreich, zu dem er seinen Einfluß mißbrauchte, den eigentlichen Todesstoß versetzt hatte. An ihre Stelle trat eine andere Partei, unter deren Leitung eine heftigere Politik betrieben und zu ausschweifenden Plänen und übertriebenen Maßregeln geschritten wurde. An der Spitze dieser Partei standen drei Nicht-Kastilier: der Kardinal Granvella, der aus der Freigrafschaft stammte, der Biskayer Idiaquez, der Portugiese Christoval de Moura. Unter diesen dreien war Granvella unbedingt der bedeutendste, beschränkte sich aber, von seiner Stellung als Präsident des Rates von Italien aus auf die Leitung der auswärtigen Angelegenheiten, die er bis zu seinem im Jahre 1586 erfolgten Tode besorgte. Nachher blieben Idiaquez, der die Expedition bei dem König hatte, und Moura, der hauptsächlich die inneren Angelegenheiten besorgte, die Hauptratgeber des Königs. Es waren dies zwei Männer, die weder durch Stand noch Geist hervorragten. Idiaquez soll eine langjährige Geschäftserfahrung erworben haben, aber ohne alle Selbständigkeit des Willens gewesen sein, während Moura zwar Entschlossenheit, aber keine Kenntnis besessen habe. Unter dem Einfluß dieser neuen Minister, denen noch der Graf von Chinchon, der Günstling des Königs, beizuzählen ist, wurde das System Philipps II., sei es infolge eines extremen religiösen Zelotismus oder eines blinden Gehorsams oder eines unbesonnenen Unternehmungsgeistes, zu jenen Ausschreitungen geführt, welche die maßlose Vergrößerung der spanischen Monarchie bezweckten und ihr darüber unheilbare Schwäche bereiteten. Bald nach der Ankunft des Kardinals Granvella und auf seinen Vorschlag vom 13. November 1579 wurde ein Preis von 30.000 Talern auf den Kopf des Prinzen von Oranien gesetzt. Dann folgten die angestifteten Verschwörungen gegen die Königin Elisabeth. Dann die Eroberung Portugals durch den Herzog von Alba, der zu diesem Ende aus seiner Ungnade wieder in Tätigkeit berufen wird. Dann die berufene Armada gegen England. Endlich die Bildung der heiligen Liga in Frankreich und die an sie geknüpften Versuche Spaniens, die französischen Religions- und Staatswirren zu benutzen, um zur Obermacht über Frankreich, ja in Europa aufzudringen.
Perez wurde noch lange in schwankender Ungewißheit gehalten. Der König gab keineswegs sofort Befehl, den Prozeß gegen ihn einzuleiten; vielmehr mußte der Kardinal von Toledo am Morgen nach der Verhaftung Doña Juana Coello, des Perez Gemahlin, besuchen, um sie zu beruhigen und ihr zu sagen, daß das Vorgefallene in keiner Weise die Ehre oder das Leben ihres Gemahls berühre und seine Haft keinen anderen Grund habe, als seinen Streit mit Vasquez. In demselben Sinne schrieb der König unter dem 29. Juli an die nahen Verwandten der Fürstin Eboli, die Herzoge von Infantado und von Medina Sidonia. Perez ward in den ersten Wochen seiner Haft von dem königlichen Beichtvater besucht, der ihm lachend sagte: »Ihre Krankheit wird keine tödliche sein.« Der König ließ ihm seine Kinder schicken, ihn zu trösten und zu zerstreuen. Als Perez trotz aller dieser Aufmerksamkeiten und Hoffnungsschimmer über den Verlust der Gunst des Königs, die demütigende Haft, die Vereitlung seiner Rache, den Überdruß an der ungewohnten Untätigkeit, was alles seine stolze und feurige Seele bedrückte, in Krankheit verfiel, gestattete der König, daß er aus dem Hause des Alkalden in sein eigenes gebracht werde. Hier erschien 6 Tage später der Hauptmann seiner Wache, Don Rodrigo Manuel, bei ihm und verlangte ein feierliches Versprechen, daß Perez jeder Feindschaft gegen Matteo Vasquez entsage und diesem weder selbst noch durch seine Verwandten oder Freunde ein Leid zufügen wolle. Perez gab das Versprechen und damit schien jeder Grund seiner Haft behoben. Gleichwohl blieb er zunächst noch acht Monate unter Hausbewachung. Dann wurde die Wache zurückgezogen und er bekam Erlaubnis, spazieren zu gehen und die Messe zu besuchen, durfte auch Besuche empfangen, aber keine abstatten. Volle Freiheit hatte er sonach noch immer nicht und eben die Zeit, in der er derselben am nächsten schien, sollte nicht fern von dem Anfang bedrohlicherer Schritte liegen als die bisherigen gewesen. Erinnert das alles nicht an das grausame Spiel, das die Katze mit der Maus treibt? Doch wir wollen den Grund nicht in einer Grausamkeit, sondern in der Unentschlossenheit des Königs und in der eigentümlichen delikaten Natur der Sachlage suchen. Wohl hatte er den Perez verderben wollen, aber um das zu können, mußte man von außen her Beweise gegen ihn haben und ihn zugleich außerstande wissen, sich durch den König selbst zu decken. Beides war schwierig.
Die Sache war noch in dieser Lage, als Philipp II. sich im Sommer 1580 nach Portugal begab, um von dem durch Alba eroberten Königreich Besitz zu nehmen. Während er damit beschäftigt war, verabsäumte Perez nichts, was dazu beitragen konnte, ihm seine vollständige Freiheit und seine alte Stellung zurückzuverschaffen. Er hatte zu diesem Ende erst einen Geistlichen, den Pater Rengipho, dann seine Gattin, ungeachtet diese im neunten Monat ihrer Schwangerschaft stand, zu dem König abgesendet; aber Philipp beharrte in seiner zweideutigen Haltung. Wie er erfuhr, daß die Dona Juana Coello sich Lissabon nähere, befahl er dem Alkalden Tejada, sie zu verhaften, und dieser führte den Befehl mit einer Rücksichtslosigkeit, welche schwerlich in den Intentionen des Königs lag, am hellen Tage zwischen Aldea Galleja und Lissabon in Gegenwart vieler Personen dergestalt aus, daß die Dona aus Schreck darüber eine Fehlgeburt hatte. Der Alkalde stellte ein Verhör mit ihr an und brachte das Protokoll dem König, der es, in einen neuen Widerspruch verfallend, ohne es zu lesen in Gegenwart des bestürzten Alkalden, zu dem er kein Wort sprach, ins Feuer warf und verbrennen ließ. Die Doña ließ er durch den Pater Rengipho zur Heimkehr auffordern, indem er ihr, auf sein Wort als König und Edelmann, versicherte, daß er sofort nach seiner Rückkehr nach Madrid Befehl geben werde, die Angelegenheit ihres Mannes zu erledigen. Er tat aber nichts dergleichen.
Im übrigen beobachtete auch Perez, ungeachtet mancherlei Anzeichen seines Mißgeschickes, keineswegs die seiner Stellung entsprechende Eingezogenheit und Klugheit. Sei es, daß er sich seiner gewohnten Zerstreuungen nicht entschlagen konnte, oder daß er an den Tag legen wollte, wie wenig er in Sorge sei, er führte sein Leben ganz im früheren Stil fort. Er machte einen ausschweifenden Aufwand, hatte im Winter 1581 eine tapezierte Loge im Theater und spielte in seinem Hause mit dem Amirante von Kastilien, dem Marquis d'Auñon, Don Antonio de la Cerda, Octaviano Gonzaga und anderen großen Herren vom Hofe sehr hohes Spiel. Dieser unvorsichtige Aufwand gab zunächst Anlaß, den König zur Anordnung einer Untersuchung über die Amtstreue seines gewesenen Ministers zu bestimmen, womit Rodrigo Vasquez de Arce, damals Präsident des Finanzrates, beauftragt ward. Dieser verhörte verschiedene notable Personen, deren Aussagen allerdings ungünstig für Perez ausfielen, zumal wenn man übersah, daß sie nicht alle miteinander in Einklang standen, daß sichtbar der Mund dabei etwas sehr vollgenommen ward und daß sich mehrfach darin eine neidische Animosität gegen den Emporkömmling aussprach. Jedenfalls ergab sich, daß Perez von seinem Vater Gonzalo nichts geerbt hatte, daß er aber ein Vermögen oder doch einen Haushalt besaß, welche ganz außer Verhältnis zu den regelmäßigen Einkünften seines Amtes standen. Wir finden jedoch nicht, daß ihm nachgewiesen oder auch nur nachgesagt worden wäre, die öffentlichen Gelder unredlich verwaltet oder des Geldes halber pflichtwidrig gehandelt zu haben. Die Beschuldigungen in betreff ungebührlichen Gelderwerbes reduzieren sich alle auf solche Fälle, wo Perez von Personen, die in ihm einen Fürsprecher bei Hof zu besitzen wünschten, Geschenke angenommen hatte. So hatte er, als dem Peter Medici der Befehl über das italienische Fußvolk anvertraut worden war, 4000 Dukaten für das Brevet bekommen. Aber würde Prinz Peter jenen Befehl ohne diese Zahlung nicht auch erhalten haben? Andreas Doria gab ihm jährlich eine hübsche Summe, damit er seine Interessen bei dem König vertrete. Von den italienischen Fürsten und wer sonst etwas am spanischen Hof zu suchen hatte, wurde er mit ansehnlichen Geschenken bedacht. Namentlich die Italiener zogen es vor, ihm die Vertretung ihrer Interessen in Madrid zu vertrauen, statt selbst einen langen, kostspieligen Aufenthalt in Verfolgung ihrer Gesuche daselbst zu nehmen. Nun ist ohne Zweifel das Geschenknehmen von Seiten einflußreicher Staatsbeamten eine sehr bedenkliche, dem moralischen Ansehen des Standes nachteilige, leicht zu Pflichtwidrigkeiten verführende Sache und wird in unserer Zeit mit Recht als unzulässig betrachtet. An sich jedoch und solange die Geschenke auf die Handlungen der Beamten keinen nachteiligen Einfluß äußern, kann man es nicht für etwas Unmoralisches erklären und mindestens im 17. und der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts war es ein allgemeiner Brauch in den europäischen Staaten. In der Zeit des Perez scheint es allerdings noch nicht so systematisch ausgebildet und zur Gewohnheit geworden zu sein, wie nicht lange nach ihm. Daß es aber nicht unbekannt und nicht unbedingt verurteilt war, dürfte denn doch aus manchen Beispielen hervorgehen und auch dadurch bestätigt werden, daß das Mißverhältnis zwischen Perez' Aufwand und seinem ordentlichen Einkommen schon lange Jahre bestanden hatte, ohne zu einem Verdacht und einer Untersuchung Anlaß zu geben. Es scheint daher, daß jenes Geschenknehmen damals etwas war, das man bei einflußreichen Staatsmännern, besonders wenn sie von Haus aus kein Vermögen hatten, nicht befremdend fand und ihnen nachsah – solange sie in Gunst standen –, das aber doch noch nicht dergestalt zur allgemeinen Gewohnheit geworden war, daß man es ihnen nicht hätte als Schuld anrechnen können, sobald man eine Schuld an ihnen zu finden wünschte. Zunächst ward selbst nach jener Untersuchung gegen Perez in dieser Sache nichts vorgenommen, wiewohl sie ihm nicht geschenkt bleiben sollte.

Antonio Perez. Zeitgenössischer Stich. Porträtsammlung der Nationalbibliothek Wien
Wohl aber richteten Vorgänge, die an sich geeignet schienen, den Perez auch in bezug seiner schlimmeren Händel sicherzustellen, die Aufmerksamkeit wieder auf diese. Im Laufe des Jahres 1583 starben plötzlich zwei Männer, die zu seinen Vertrautesten gehört hatten: der Astrolog Pedro de La Era, der ihn häufig begleitete und den er über die künftigen Ereignisse seines Lebens und die Wechselfälle seines Geschickes befragt hatte und sein Stallmeister Rodrigo Morgado, der seine Botschaften an die Fürstin von Eboli überbracht hatte, Zeuge ihrer Vertraulichkeiten gewesen war. Er kannte die heftigen Szenen, die deshalb zwischen der Fürstin und Escovedo vorgekommen waren, und soll ihnen auch das tragische Ende des Escovedo zugeschrieben haben. Der Bruder des Astrologen, Bartholomeo de La Era, wie der Bruder des Stallmeisters, Andrea de Morgado, behaupteten darauf beide, daß ihre Brüder von Perez oder auf dessen Veranlassung vergiftet worden seien. Auch mehrere Teilnehmer an dem Mord des Escovedo waren bereits hinüber. Insausti war bald nach seiner Ankunft in Sizilien, Miguel Bosque ebenso in Katalonien gestorben, und der Bruder des letzteren, Antonio Enriquez, schrieb auch diesen Tod dem Perez zu, fürchtete für sich selbst das gleiche Schicksal, ward außerdem durch einen nahen Verwandten des Escovedo, den Hauptmann Don Pedro de Quintana angetrieben und entschloß sich, seinen Anteil an dem Mord des Escovedo zu entdecken. Wollte man annehmen, daß alle diese Beschuldigungen begründet wären, so würde sich hier ein wahrhaft schauerliches Gemälde eines Gedränges von Verbrechen aufrollen und zugleich einen neuen Beweis bieten, wie eine Missetat zur fruchtbaren Mutter vieler anderer werden kann. Manches macht doch die Sache indessen zweifelhaft. Wegen der Todesfälle des Astrologen und des Stallmeisters ist Perez späterhin, wie wir sehen werden, gerichtlich freigesprochen worden. Die anderen Fälle sind, wenn sie auch in den gegen Perez gehäuften Anklagen mitspielen, weiterhin nicht gerichtlich untersucht worden. Es war damals etwas sehr Gewöhnliches, beruhte aber doch nur auf trügerischen Schlüssen, daß man Todesfälle denen zur Last legte, denen sie eben bequem kamen. Nach Enriquez' eigener Aussage war auch gegen Escovedo zweimal Vergiftung versucht worden, aber beide Male mißlungen, ungeachtet alle Umstände es damals erleichterten, und es wäre doch eigen, wenn sie jetzt, wo Perez gestürzt, überwacht, ein halber Gefangener war, ihm in drei oder vier Fällen, zum Teil in weiter Entfernung gelungen wäre. Wollte er damit die Mitwisser seiner früheren Missetat beseitigen, so mußte er doch wieder neue Agenten neuer Missetaten anwerben und war auch hiermit um nichts gebessert. Auch ergibt sich, daß keineswegs alle Teilnehmer des früheren Verbrechens die Besorgnis des Enriquez teilten, einige der vertrautesten ihm vielmehr eine fortdauernde tätige Anhänglichkeit bewahrten. Dazu kommt, daß zu der Zeit, wo jene Todesfälle vorkamen, Perez sich schwerlich veranlaßt hielt, in der Escovedoschen Sache große Besorgnisse zu hegen, wie er sich denn in dieser Angelegenheit überhaupt darauf verließ, daß der König um die Sache gewußt und sie genehmigt hatte. Erfährt man nun vollends, daß Enriquez unter dem Einfluß eines Verwandten des Escovedo stand, so liegt es nahe, an der Unparteilichkeit und Wahrhaftigkeit dieses Hauptzeugen gegen Perez zu zweifeln. Allerdings, was er über seinen Anteil an der Ermordung des Escovedo erklärt hat, ist im wesentlichen durch anderweitige Geständnisse bestätigt worden. Eben darum, daß er an jenem Mord teilgenommen, und daß dies den Escovedos bekanntgeworden, konnte ihn in deren Hände geben und ihn selbst in dem Gedanken befestigen, sich Straflosigkeit zu sichern, indem er so viel Schuld als möglich auf Perez häufte. Jedenfalls wird man ohne weitere Beweise nicht zu weit gegen Perez gehen dürfen, dem ohnedies schon genug zur Last fällt.

Don Juan d'Austria, Statthalter der Niederlande.
Zeitgenössischer Stich. Porträtsammlung der Nationalbibliothek Wien
Enriquez schrieb unter dem 23. Juni 1584 von Saragossa aus an den König, bat um ein freies Geleite und erbot sich vor Gericht zu beweisen, daß Perez die Ermordung des Escovedo angeordnet habe, indem er sich bereit erklärte, sich, wenn ihm das nicht gelänge, wie ein Verräter an einem Fuße aufhängen zu lassen. Als er darauf erfuhr, daß ein Fähnrich Chinchilla mit einem Empfehlungsschreiben an den Vizekönig von Aragonien, den Herzog von Villa-Hermosa, in Saragossa angekommen sei, der, nach des Enriquez Meinung oder Behauptung, Anschläge gegen seine Person haben sollte, floh er nach Lerida und richtete von da (16. August) ein zweites, noch dringenderes Schreiben an den König. Gleichzeitig schrieb der Kapitän Quintana an diesen: »Ich flehe Eure Majestät demütigst an, in Anbetracht der zahlreichen Dienste, welche der verstorbene Sekretär Escovedo geleistet hat, geruhen zu wollen, zu befehlen, daß man in der Frist, die Ihnen angemessen erscheinen wird, dazu schreitet, uns die Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, die wir gegen Antonio Perez erwarten, da das Verbrechen noch ungesühnt ist. Auch ich würde mich hiermit für die 20 Jahre, die ich Eurer Majestät im Kriege diene, hinreichend belohnt erachten, nachdem der genannte Antonio Perez, nicht zufrieden mit dem, was er schon verübt hat, auch Don Pedro Escovedo und den Fähnrich Enriquez zum Tode bringen will, damit alles im Dunkel erstickt und begraben bleibe.«
Auch jetzt tat der König in dieser Sache zunächst nichts, fügte aber dem Perez nicht lange darauf in einer anderen Beziehung einen Schlag bei, welcher deutlich ergab, daß er ihm zürnte, und daß er ihn fest in seiner Gewalt halten wollte. Unter dem 23. Januar 1585 ließ er in der Bestechungssache ein Urteil sprechen, wodurch Perez verurteilt wurde, zwei Jahre und so lange es weiter dem König belieben würde, in eine Festung eingesperrt, dann aber 10 Jahre lang auf 30 Meilen vom Hofe verbannt zu werden und während derselben Zeit von seinen Funktionen suspendiert zu sein. Zugleich müsse er auch in den ersten 9 Tagen 12,287.193 Maravedis als Wert für die von der Fürstin von Eboli und von Don Juan erhaltenen Geschenke, die er zum Teil entweder in Natura zurückgeben oder durch bestimmte Geldsummen ersetzen sollte, an die Kinder und Erben des Fürsten Ruy-Gomez und an den Fiskus zurückerstatten. Es ist dabei bemerkenswert, daß von denjenigen Geschenken, die er von ihm fremden Personen mit Rücksicht auf seine amtliche Stellung empfangen, also gerade von denen, deren Annahme am ersten tadelnswert erscheinen konnte, keine Rede ist, sondern lediglich solcher Erwähnung geschieht, die ihm wirklich aus Gunst ihm Befreundeter zuteil geworden. Es scheint aber, man ging wenigstens bei den Geschenken der Fürstin davon aus, daß sie darin über Gegenstände verfügt habe, die nicht ihr ausschließliches Eigentum waren. Auch mag die Hervorhebung der zahlreichen Geschenke, welche Perez von der Fürstin von Eboli empfangen, vielleicht auf den König berechnet gewesen sein. Drei Tage vor Publikation des Urteiles erschienen zwei Alkalden, Espinosa und Alvaro Garcia de Toledo, in Perez' Wohnung, die neben der St. Justuskirche lag. Espinosa begab sich nach dem Büro, um sich der Papiere des Perez zu bemächtigen und der andere Alkalde trat in das Zimmer ein, wo sich Perez mit seiner Gemahlin befand und verhaftete ihn. Perez kam sogleich auf den Gedanken, sich unter die geistliche Gerichtsbarkeit zu flüchten, und es gelang ihm, einen Diener an den Kardinal von Toledo abzufertigen, um dessen Meinung darüber einzuholen. In der Zwischenzeit hielt er den Alkalden hin, und als der Bediente zurückkehrte und ihm durch Zeichen zu verstehen gab, daß der Kardinal mit dem Plan einverstanden sei, ging Perez mit dem Versprechen, sogleich zurückkommen zu wollen, in ein Nebenzimmer, ließ sich da zum Fenster herab und floh in die benachbarte Kirche, die sogleich verschlossen ward. Doch auch dies sollte ihm nichts helfen. Die Alkalden eilten ihm nach, ließen die Kirchentüren, als deren öffnen verweigert ward, aufbrechen, fanden den Perez nach langem Suchen unter den Dachsparren zusammengekauert, zogen den ganz von Staub und Spinnweben Bedeckten hervor und ließen ihn trotz des Protestes und des Widerstandes der Priester durch ihre Alguazils in den Wagen schaffen, der ihn nach der Festung Turruegano brachte. Zwar entspann sich nun ein langer und heftiger Streit zwischen der weltlichen und der geistlichen Gerichtsbarkeit. Der Kirchenfiskal klagte die beiden Alkalden der Verletzung der kirchlichen Freiheiten an und sowohl der Gerichtshof des Generalvikars wie der der Nuntiatur verurteilte sie, den Gefangenen in die Kirche zurückzubringen. Philipp II. aber zwang die geistlichen Richter, die Sache fallen zu lassen und ließ (1589) durch den Rat von Kastilien die gegen die Alkalden ausgesprochenen Zensuren annullieren, so daß auch dieser Vorgang ein charakteristisches Zeugnis über die Aufrichtigkeit oder doch über die Konsequenz des kirchlichen Eifers jenes Königs sowie darüber bietet, wie es selbst in dem Spanien Philipps II. mit der Macht der Kirche gestanden, sobald sie mit den Interessen oder den Leidenschaften der weltlichen Machthaber in Konflikt kam.
Jedenfalls war die Festungshaft des Perez ein fait accompli, und er mußte die Hoffnung aufgeben, sich unter den Schutz der geistlichen Gerichte stellen zu können, mochte jedenfalls den Ausgang jenes Kompetenzstreites nicht abwarten wollen. Er versuchte daher, schon im Sommer 1585 seine Zuflucht zu der unabhängigen Justiz Aragoniens zu nehmen. Ein bei der Ermordung des Escovedo Beteiligter, Juan de Mesa, kam aus dem Innern Aragoniens in die Nähe der Festung, ihn mittels zweier verkehrt beschlagenen Stuten zu entführen. Doch dieser Fluchtplan, welchen Don Balthasar de Alamos geschickt ersonnen hatte und dafür mit sechsjähriger Verbannung büßen mußte, wurde entdeckt und vereitelt. Perez wurde schärfer bewacht. Um ihn zur Auslieferung der von ihm in Sicherheit gebrachten Papiere zu nötigen, die ihn auf Kosten des Königs rechtfertigen konnten, nahm man auch seine Frau und seine Kinder in Haft. Man bedrohte die Frau mit fortwährendem Gefängnis bei Wasser und Brot, wenn sie die verlangten Papiere nicht ausliefere. Der Beichtvater des Königs und der neue Präsident des Rates von Kastilien, Graf Barajas, verfolgten sie mit ihrem Drängen und ihren Drohungen. Doch würde sie mit mutvoller Ausdauer widerstanden haben, wenn ihr Gemahl ihr nicht selbst mittels eines eigenhändigen, mit seinem Blut geschriebenen Billetts die Auslieferung der Papiere geheißen hätte. Er hatte dies nach langer Weigerung getan, um der Gefangenschaft seiner Frau ein Ende zu machen und seine eigene zu mildern. Zwei verschlossene und versiegelte Kisten, welche die so eifrig begehrten Papiere enthielten, wurden dem Beichtvater übergeben, der sie uneröffnet ließ und die Schlüssel sofort an den König schickte, bei dem die Erwerbung um so größere Freude erregte, als er nun seinen Diener der Mittel beraubt zu haben glaubte, ihn anzuklagen und sich zu verteidigen. Allein ebenso schlau wie Philipp II. hatte Perez mit Hilfe der treuen und kundigen Hände seines Haushofmeisters Diego Martinez von den auszuliefernden Papieren die für seine Rechtfertigung wichtigsten Stücke und namentlich viele eigenhändige Briefe des Königs zu trennen gewußt und brachte sie später vor der aragonischen Justiz zum Vorschein.
Der König konnte nun glauben, den Perez völlig in seiner Gewalt zu haben, fuhr aber noch immer in seinem trügerischen Spiele mit ihm fort. Perez war krank geworden und seine Gemahlin erlangte es, daß er gegen Ende des Jahre 1587 nach Madrid gebracht wurde, wo er wieder 14 Monate lang in einer der besten Wohnungen der Stadt, dem Hause des Don Benito de Cisneros, eine halbe Freiheit genoß und die Besuche des ganzen Hofes empfing, auch in der heiligen Woche dem Gottesdienst in Notre Dame d'Atocha beiwohnen durfte, während Don Pedro Escovedo seine Stelle im Finanzkollegium verlor und in Haft kam, weil er sich über Justizverweigerung beklagt hatte und damit umgehen sollte, den Perez ermorden zu lassen. Rodrigo Vasquez selbst, der über das widersprechende Verfahren befragt worden, antwortete: »Was soll ich sagen? Bald treibt mich der König an und läßt mir freie Hand; bald hält er mich zurück und bindet mir die Hände; ich verstehe das ganze Verfahren nicht.«
Inzwischen war die Untersuchung über die Ermordung des Escovedo im Sommer 1585 insgeheim fortgesetzt worden, indem Rodrigo Vasquez die Reise des Königs nach Aragonien, wo derselbe den Cortes präsidierte, benutzt hatte, am 31. August zu Monzon den Fähnrich Enriquez zu vernehmen, bei welcher Gelegenheit denn dieser die oben berichtete Erzählung über die Ermordung des Escovedo vorbrachte. Weiter vernahm Vasquez den Geronimo Diaz und den Martin Guttierez, von denen der eine sich über die Verhältnisse des Perez zu der Fürstin Eboli verbreitete und der andere aussagte, was er von der Flucht der Mörder des Escovedo nach Aragonien und besonders von seinem Nachbar Juan de Mesa wußte. Als ferner Diego Martinez, welchen Enriquez als den Leiter der sämtlichen Anschläge gegen das Leben des Escovedo bezeichnet hatte, im Herbst 1587 aus Aragonien, wo er herstammte, nach Madrid gekommen war, um die Papiere des Perez in der schon gedachten Absicht zu sichten, ließ ihn Vasquez festnehmen und verhörte ihn. Er leugnete alles mit größter Kaltblütigkeit und versicherte selbst, daß sein Herr sich über den Tod des Escovedo, dessen warmer Freund er gewesen, sehr betrübt und sich vielfach bemüht habe, den Urheber desselben zu entdecken. Den Perez versetzte aber die Verhaftung dieses seines Vertrautesten in äußerste Unruhe und er schrieb wiederholt, am 20. November 1587 von Turruegano und am 3. Februar 1588 auf das dringendste an den König, daß er die Freilassung des Martinez vermitteln oder doch eine rasche Entscheidung der Sache herbeiführen möge, die Perez gewünscht zu haben scheint, damit nicht inzwischen noch weitere Zeugen aufgetrieben würden.
Der König tat aber nichts und ließ den Rodrigo Vasquez die Sache ruhig fortsetzen. Dieser stellte den Martinez und den Enriquez einander gegenüber, wobei Martinez den letzteren mit geringschätzigem Stolz als einen undankbaren Diener, einen bestochenen Zeugen und einen hassenswerten Bösewicht behandelte, der bereits Verbrechen begangen habe, wie er beweisen wolle. Die Aussagen beider standen sich zu schroff entgegen, als daß der Richter zu einer Entscheidung hätte kommen können. Vasquez suchte weitere Zeugen. Der Küchenjunge Juan Rubio war nach Aragonien zurückgekommen und hier befand sich auch der Apotheker, der das Gift für Escovedo bereitet haben sollte. Die kastilische Justiz vermochte in Aragonien nichts und während Vasquez alles aufbot, die Zeugen herbeizuschaffen, wendete Perez seine ganze Geschicklichkeit an, sie am Erscheinen zu verhindern. Er beauftragte den Juan de Mesa mit dieser Sorge, dem es auch gelang, sie zurückzuhalten. Perez wurde gleichwohl die Besorgnis keinen Augenblick los, sie möchten, fortgerissen oder verführt, ihm entrinnen, um ihn durch ihr Zeugnis zu verderben. Nochmals schrieb er an den König, von dem er immer annahm, daß ihm ebenso viel daran gelegen sein müsse als ihm, eine vollständige Entdeckung zu verhindern, enthüllte ihm offen die getanen Schritte und bat ihn flehendlichst, der Sache ein Ende zu machen, seine Unschuld, seine, seines Vaters und seiner Vorfahren treue und loyale Dienste zu berücksichtigen und ihm ein Zeichen seiner Gnade zu geben, deren er ebenso bedürfe wie des Lebens. Der König aber weit entfernt, sich rühren zu lassen und in dem Glauben, daß Perez keine Beweise mehr gegen ihn habe, überwies dieses Schreiben wie alle, die Perez zu dieser Zeit an ihn schrieb, an Rodrigo Vasquez als Prozeßstücke. Dieser setzte die Untersuchung fort, ohne jedoch auf sichere Beweise zu stoßen. Indessen hielt er die Aussage des Enriquez doch durch andere Zeugnisse für so weit bestätigt, daß dem Prozeß ein anderer Charakter gegeben und derselbe aus dem Stadium vorläufiger Recherchen in das einer förmlichen gerichtlichen Verhandlung übergeleitet werden könne. Am 21. August 1589 ließ er den Ort untersuchen, in welchem Perez als halber Gefangener bewacht wurde. Da er erfuhr, daß die Wohnung des Gefangenen aus 16 Zimmern bestand, daß die beiden mit seiner Bewachung beauftragten Alguazils, Erizo und Zamora, ihn nicht hinreichend überwachen könnten, daß nach hinten zu zwei Türen wären, die nicht geschlossen würden und durch die man des Nachts aus- und einginge, daß Perez am hellen Tage ohne Wache auf den Straßen gesehen worden sei, so verlangte er von dem Grafen von Barajas, daß größere Sicherheitsmaßregeln getroffen würden und dieser befahl sogleich, die Türen und Fenster des Haftlokales sorgfältig zu verschließen und verstärkte die Zahl der Alguazils.
Nachdem diese Maßregeln getroffen waren, verhörte Vasquez am 23. und 25. August 1589 über 11 Jahre nach dem Mord den Perez zum erstenmal über denselben und teilte ihm die Anklagen mit, mit denen die Aussage seines früheren Pagen Enriquez ihn und seinen Haushofmeister Martinez belastete. Perez leugnete alles und suchte mit ziemlichem Geschick und mit anscheinender Unbefangenheit von der wahren Ursache des Mordes abzuleiten. Mit nicht größerem Erfolge wurde seine Gemahlin verhört. Inzwischen verfaßte Vasquez am 25. August ein Protokoll, welches das Verbrechen konstatierte, die aus der Untersuchung hervorgegangenen Belastungsgründe gegen Perez und Martinez feststellte und ihnen 10 Tage ihrer Erklärung und Rechtfertigung einräumte. Perez ward jetzt in Fesseln gelegt, stellte aber zu deren Beseitigung eine ansehnliche Kaution. Don Pedro Escovedo erhob förmliche Anklage. Die Beklagten wählten ihre Advokaten und erlangten eine achttägige Fristverlängerung. Am 7. September brachte Perez sechs Entlastungszeugen, welche erklärten, daß Escovedo und Perez vertraute Freunde gewesen seien und er sich zur Zeit des Mordes mit dem Marquis de Los Velez in Alcala befunden habe; er sei auch über den Mord sehr betrübt gewesen. Sie hielten den Enriquez für einen falschen und bestochenen Zeugen, da er von den Escovedos unzertrennlich sei. Perez sei ein ausgezeichneter Mann, ein guter Christ und gottesfürchtig und habe niemand Leides getan. Diese sechs Zeugen, unter denen sich übrigens niemand von Bedeutung befand, bezeugten auch die Unschuld des Martinez.
Diese Zeugnisse würden dem Angeklagten schwerlich viel geholfen haben. Obschon er in der gefährlichen Lage war, daß seine Richter ihn zu verurteilen wünschten, und daß mächtige Feinde ihn verfolgten, gab es doch zur Zeit nur ein positives Zeugnis gegen ihn und dieses unterlag manchem Verdacht. Vasquez bemühte sich daher immer eifriger, die weiteren Zeugen aus Aragonien zu beschaffen, während Perez auf schleunige Entscheidung drang. In dieser Sachlage trat der Beichtvater des Königs wieder einmal auf, angeblich aus eigenem Antriebe und aus Mitleid mit den Leiden des Perez und der Seinigen und riet ihm, seinen Anteil an dem Mord des Escovedo zu bekennen, da er ja in dem Befehl des Königs eine vollständige Rechtfertigung besitze. Perez erkannte jedoch die Falle. Er sollte den mangelhaften Beweis vervollständigen und dann einen Verteidigungsgrund vorbringen, für den er, wie wenigstens seine Gegner glaubten, keinen Beweis gehabt hätte und der ihm, wenn er ihn vorgebracht hätte, jeden Anspruch auf die Hilfe des Königs entzogen haben würde. Hatte der König ihm doch geschrieben: »Beunruhigt Euch nicht über das, was Eure Feinde tun und was ich sie tun lasse; ich werde Euch nicht verlassen und seid gewiß, daß ihre Gehässigkeit nichts gegen Euch vermögen wird ... Ihr müßt aber einsehen, daß man nicht entdecken darf, der Mord sei auf meinen Befehl erfolgt.« Perez erklärte daher dem Beichtvater, nachdem er sich vorher mit dem ihm fortwährend wohlwollenden Kardinal von Toledo beraten: sich in einem so schweren Falle selbst zu verdammen, hieße gegen sein Gewissen handeln, zumal viele Unschuldige dadurch kompromittiert werden könnten. Etwas zu erklären, das der König geheimgehalten wissen wollte, würde nicht klug getan sein; alles erwogen, würde es schließlich das Beste sein, sich mit Escovedo zu verständigen. In der Tat gelang es, den Escovedo, dem ein anonymer Brief die Aussichtslosigkeit seiner Bemühungen vorhielt und ihn mit der Ungnade des Königs, ja selbst mit dem Schicksale seines Vaters bedrohte und der sich jedenfalls sagen mußte, daß er nach 11 Jahren noch keinen hinlänglichen Beweis gegen Perez aufgebracht habe und wenn er keinen solchen ermöglichen könne, selbst einer schweren Buße ausgesetzt sei, zu vermögen, daß er gegen eine Summe von 20.000 Dukaten auf seine Rache verzichtete. Am 28. September 1589 erklärte er diesen Verzicht in aller Form, ersuchte alle beteiligten Gerichtspersonen nicht weiter in dieser Sache zu verfahren und Perez und Martinez in Freiheit zu setzen und erklärte: Er verzeihe ihnen, um seine Pflicht gegen Gott zu erfüllen und allem Streite mit ihnen ein Ende zu machen, auch, weil er von bedeutenden Personen darum gebeten worden. Diese bedeutenden Personen waren: der Amirante von Kastilien, Don Luis Enriquez de Cabrera, Herzog von Medina de Rio Seco und Modica, Don Rodrigo Zapata, der eigene Sohn des Grafen Barajas, Don Alonzo de Campo und Jacome Mazengo. Sie unterzeichneten auch die Rücktrittsakte des Escovedo, die dieser am 2. Oktober bestätigte.
Das somit ergriffene Auskunftsmittel war auch von dem königlichen Beichtvater, der übrigens trotz seiner Stellung die Seelengeheimnisse dieses verschlossenen Königs nicht vollständig gekannt zu haben scheint, wenigstens in Ermanglung eines Besseren gebilligt worden. »Der andere Ausweg, dessen Ihr gedenkt«, hatte er an Perez geschrieben, »ist nicht übel und man könnte sich desselben bedienen, ohne jedoch den König hineinzuziehen, der diesen Menschen (den Escovedo) sowohl seines Vaters als seiner selbst halber nicht leiden kann.« Gleichwohl aber half die neue Wendung der Sache dem Perez gar nicht. Sei es, daß Vasquez aus Gerechtigkeitsgefühl oder Parteihaß den Perez um jeden Preis verderben wollte, oder daß er am besten wußte, was der König eigentlich wolle, er schrieb an Philipp II.: Der König müsse bedenken, daß viele Gerüchte über den von ihm zur Ausführung jenes Mordes gegebenen Befehl in Umlauf gewesen wären; es komme jetzt viel darauf an, durch Perez die Ursachen darlegen zu lassen, die man zur Zufügung jener Strafe gehabt habe. Der König möge ein ostensibles Billett an Vasquez schreiben, worin er ihn beauftrage, dem Perez zu sagen, es sei im Interesse des Königs, daß er die Motive des Mordes erkläre. Als der Kardinal von Toledo von diesem neuen Plane erfuhr, begab er sich zu dem königlichen Beichtvater und stellte ihm das Widersinnige dieses Verfahrens vor, das allerdings jedem als widersinnig erscheinen mußte, der nicht wie der König von der Überzeugung ausging: Perez werde kaum beweisen können, daß der König ihm den Mord befohlen habe, werde aber gewiß nicht beweisen können, daß die Motive dieses Befehles auf Wahrheit beruht hätten; ein Beweis, der ihm, auch wenn die Motive weit stärker gewesen wären, als sie wahrscheinlich waren, in seiner jetzigen Lage und nach so langer Zeit, nach der ganzen Lage der Sache überaus schwer fallen mußte. Philipp wollte den Perez verderben; er hatte ihn hassen gelernt und haßte ihn wohl um so bitterer, je größere Gunst er ihm früher geschenkt hatte, haßte ihn immer mehr, je härter er den Perez behandelte. Wir möchten gern annehmen, daß dieser Stimmung des Königs eine Reue über den Mord und ein Unwille darüber zugrunde gelegen habe, daß Perez ihn durch falsche Berichte zu dem verhängnisvollen Befehl verleitet habe. Man findet nirgends eine Spur, daß Philipp jenen Mord bereut, daß er ihn für ungerechtfertigt gehalten habe und der Umstand, daß er den Sohn des Ermordeten mit Ungunst betrachtete und behandelte sowie daß Vasquez den Mord als eine Strafe bezeichnete, scheint denn doch dagegen zu sprechen. Dies jedoch hatte der König jedenfalls erkannt oder argwöhnte es, daß Perez, was immer für Gründe zu Escovedos Beseitigung bestanden haben möchten, diese hauptsächlich um der Fürstin von Eboli willen betrieben und den König dabei düpiert und als Werkzeug benützt habe und deshalb haßte er ihn, wie uns scheint, so bitter.
In den Prozeßakten selbst findet man unter dem 21. Dezember 1589 folgendes von Vasquez aufgezeichnet: »Nach erstattetem Bericht an den König unseren Herrn, daß Antonio Perez betreffs der Ermordung des Sekretärs Juan Escovedo nur nach dem Willen und mit der Zustimmung Seiner Majestät gehandelt zu haben scheine, und daß es angemessen erscheine, diese Zustimmung im Prozeß zu konstatieren, um zu einer Entlastung des genannten Perez zu gelangen und damit er demzufolge dem Rechte gemäß in allen Punkten losgesprochen werden könne, da es auch nötig sein dürfte, die Ursachen jener Zustimmung bekanntzumachen, damit die Ehre des Fürsten und sein christlicher Name keinen Eintrag erleide, hat Seine Majestät genehmigt und befohlen, daß man aus dem Munde des genannten Perez erfahre, welches die erwähnten Ursachen gewesen, weil er es ist, der sie kennt und Seiner Majestät vorgelegt hat und zugleich die von ihm gelieferten Beweise von der Stärke und Dringlichkeit der Motive des Todes erhalte.« Dem König sollte es überlassen bleiben, zu entscheiden, ob diese Erklärung des Perez den Prozeßakten beigefügt werden solle oder nicht. Der König erließ nun unter dem 4. Januar 1590 folgenden schriftlichen Befehl an Rodrigo Vasquez: »Ihr könnt dem Antonio Perez als von mir kommend und im Notfall unter Vorzeigung dieses Papieres sagen: Er wisse wohl, daß ich mir bewußt bin, ihm den Tod des Escovedo befohlen zu haben und die Motive, von denen er mir gesagt hat, daß sie dafür bestünden (que me dixo que avia para ello); da es nun zu meiner und meines Gewissens Beruhigung wichtig sei, daß man wisse, ob diese Ursachen hinlänglich gewesen oder nicht, so befehle ich ihm, sie auf das speziellste anzugeben und zugleich das demgemäß Angeführte, das Euch übrigens nicht unbekannt ist, da ich es Euch im Vertrauen bekanntgemacht habe, zu beweisen. Wenn ich die Antworten, die er Euch erteilt und die Gründe, die er Euch angegeben haben wird, gesehen habe, werde ich befehlen, daß in betreff des Ganzen die gebührenden Maßregeln ergriffen werden.«
Man hatte die Aufsicht über den Gefangenen verdoppelt. Den Alguazils Erizo und Zamora war befohlen, ihn scharf zu bewachen, ihn mit niemand, wer immer es sei, sprechen oder sonst verkehren zu lassen und bei Todesstrafe selbst nicht mit ihm zu sprechen. Nun zeigte man Perez den Befehl des Königs. Er antwortete: »Unbeschadet der demütigen Ehrerbietung, die er den Worten Seiner Majestät schulde, habe er nichts weiter zu sagen, als was in seinen vorhergehenden Erklärungen enthalten sei, daß er nichts in betreff der Ermordung des Escovedo wisse und nichts damit zu tun gehabt habe.« Zugleich berufe er nochmals, wie er schon früher getan, den Rodrigo Vasquez als einen leidenschaftlichen und feindseligen Richter. Ohne diesem Gesuche wahrhaft stattzugeben, wollte der König ihm wenigstens scheinbar einigermaßen entsprechen und gab dem Vasquez den Lizentiaten Juan Gomez bei, der zu der Kammer und dem Rate des Königs gehörte. Diese beiden Richter drangen nun wiederholt am 25., 27., 28. Januar, 12., 20. und 21. Februar 1590 in Perez, er solle die Gründe des Todes des Escovedo erklären und deren Stärke und Dringlichkeit beweisen. Perez beharrte dabei, daß er nichts sagen würde, weil er nichts wisse. Die Richter, die allerdings von dem König selbst wußten, daß dieses Vorgehen auf völlige Unwahrheit beruhte, beschlossen nun, ihm das Geständnis mit Gewalt abzupressen und dürften unter den damals herrschenden Ansichten immer noch eher zu entschuldigen sein als der König, daß er ein solches Verfahren zugab. Am 21. Februar 1590 wurde Perez an eine Kette geschlossen und bekam Fußeisen, weshalb er sich mit Rücksicht auf seinen Gesundheitszustand flehentlich, aber vergebens an den König wandte. Schon am nächsten Tag sollte noch Schlimmeres kommen. Am 22. Februar begaben sich Vasquez und Gomez in sein Gefängnis und forderten ihn nochmals auf zu antworten, wie der König befohlen. Als er sich abermals weigerte, bedrohten sie ihn mit der Tortur, und als er sich auch hiedurch nicht schrecken ließ, zog sich Vasquez in ein nahes Gemach zurück und überließ den Unglücklichen seinem Kollegen Gomez, dem Gerichtsschreiber Antonio Marquez und – dem Scharfrichter Diego Ruiz. Nach einer nochmaligen Aufforderung und Bedrohung, wobei Perez gegen die Anwendung der Folter protestierte, weil er adeliger Geburt und weil er durch elfjährige Haft bereits gelähmt sei, wurden ihm die Fesseln abgenommen, und der Scharfrichter entkleidete ihn bis auf seine leinenen Unterbeinkleider. Nachdem man ihn abermals mit der Leitertortur bedroht und den Apparat herbeigebracht hatte, wurde er dieser Folter unterworfen. Wenn er auch furchtbar schrie und jammerte und um sofortigen Tod bat, ward er doch erst bei dem achten Anziehen vermocht, zu erklären, daß er das Verlangte sagen wolle. Der Scharfrichter entfernte sich nun und Perez bekannte sich als den Urheber des Todes des Escovedo und entwickelte ausführlich die Staatsgründe, aus denen derselbe verfügt worden. Als er nun aber aufgefordert wurde, die letzteren zu beweisen, bezog er sich darauf, daß ihm alle seine Papiere weggenommen worden, und daß seine besten Zeugen, wie namentlich der Marquis de Los Velez, inzwischen gestorben seien. – Als Martinez erfuhr, daß sein Herr alles bekannt habe, brach auch er das so lange treu bewahrte Schweigen und bestätigte umständlich den Bericht, den der Fähnrich Enriquez gegeben.
Weit entfernt aber, daß die nunmehr gebotene Gewißheit der Beteiligung des Perez an der Ermordung des Escovedo ihn in der öffentlichen Meinung vernichtet hätte, machte gerade jetzt die Mißgunst dem Mitleid Platz. Am Hofe namentlich war man betroffen und erschreckt, einen Mann seines Ranges, einen Minister, einen gewesenen Günstling, ein gefügiges Werkzeug des Königs der Tortur unterworfen zu sehen. Niemand glaubte sich jetzt gegen die barbarischen Maßregeln dieser gewalttätigen Justiz gesichert. Zudem ward es jetzt allmählich bekannt, daß der König und Perez Teilnehmer derselben Tat gewesen, wegen deren der eine die Tortur verhängte und der andere sie erlitt. Ob Perez vielleicht den König durch falsche Gründe zu seiner Zustimmung bewogen, wußte oder bedachte man nicht. Man murrte laut am Hofe und eine der bedeutendsten Persönlichkeiten rief voll Unwillens aus: »Verrätereien von Untertanen gegen Souveräne sind gewöhnlich, aber noch nie hat man einen solchen Verrat eines Souveräns gegen einen Untertanen gesehen.« Selbst der Hofprediger sprach vor der vollen Gemeinde der Kapelle: »Menschen, wonach rennt ihr ganz außer euch und mit offenem Munde? Seht ihr denn nicht die Enttäuschung? Seht ihr die Gefahr nicht, in der ihr lebt? Habt ihr nicht gestern denselben Mann auf dem Gipfel des Glückes gesehen, der heute unter der Folter ist? Und weiß man nicht, weshalb er so viele Jahre hindurch gemartert worden? Was wünscht ihr noch und was hofft ihr noch?«
Perez war inzwischen, nachdem seine Richter und der Henker ihn verlassen, zermalmt, gebrochen, dem Fieber und einer verzehrenden Unruhe des Geistes preisgegeben. Er erkannte deutlich das Schicksal, das man ihm vorbehielt: den Tod nach der Folter. Er wußte, daß Vasquez dem König gesagt hatte: Perez könne, nachdem er seiner Papiere verlustig worden, sich nicht mehr rechtfertigen und sein Verfahren wie seine Erklärung würden den Verdacht des Truges nicht loswerden. Auch hörte Vasquez neue Zeugen ab und richtete seine Untersuchungen darauf ein, mehr und mehr zu beweisen, daß die Ermordung des Escovedo die verbrecherische Vertraulichkeit des Perez mit der Fürstin von Eboli zum Grunde gehabt habe und auch den Tod des Astrologen Pedro de La Era und des Stallmeisters Rodrigo Morgado dem Perez zur Last fallen zu lassen. In dieser äußersten Not dachte Perez mehr als je daran, sich durch die Flucht der schimpflichen Hinrichtung, die ihn erwartete, zu entziehen. Aber wie das erreichen? Er war an beiden Armen gelähmt, krank, allein, streng bewacht. Am 27. Februar verlangte er, daß man seine gewohnten Diener zu ihm lasse, ihn in seiner Krankheit zu warten. Der darauf zu ihm geschickte Arzt Dr. Torres bezeugte, daß er ihn in starkem Fieber und, wenn er keine Pflege erhalte, in Lebensgefahr gefunden habe. Am 2. März erhielt nun ein von Juana Coello, deren vorgerückte Schwangerschaft ihre Hingebung nicht schwächte, ausgewählter Page Erlaubnis, ihn im Gefängnis zu bedienen, unter der Bedingung, dasselbe nicht zu verlassen und mit niemand zu sprechen. Da sich die Krankheit zu verschlimmern schien, verlangte Dona Juana Coello um Mitte März, daß man ihr und ihren Kindern gestatte, dem Perez beizustehen, damit er nicht ohne Pflege sterbe. Anfangs erfuhr sie eine abschlägige Antwort; da sie aber von ihrem Anliegen nicht abließ, gelang es ihr endlich, anfangs April zu ihrem Gemahl gelassen zu werden. Perez schien mehr wie je von seinen Leiden erschöpft. Am Mittwochabend in der Karwoche gegen 9 Uhr ging er, in ein Kleid und einen Mantel seiner Frau gehüllt, durch die Wachen durch und aus dem Ort seiner Gefangenschaft heraus. Vor demselben erwartete ihn ein Freund und etwas weiter hielt der Fähnrich Gil de Mesa mit Pferden. Ehe sie aber diesen noch erreicht hatten, begegneten sie einer Patrouille von Sicherheitsdienern. Ohne sich außer Fassung bringen zu lassen, blieb der Freund des Perez stehen und plauderte mit ihnen, während Perez, als gehöre er zur Dienerschaft, sich schweigend und ehrerbietig hinter ihm hielt. So ging dieser kritische Augenblick glücklich vorüber; Perez gelangte bald zu Gil de Mesa, stieg mit ihm zu Pferde, ritt, noch von einem Genuesen begleitet, 30 Meilen ohne anzuhalten und gelangte endlich auf aragonischen Boden unter den Schutz einer unabhängigen Justiz, inmitten eines Volkes, das mit seinen Freiheiten Stolz und Mut bewahrt hatte.
Die ganze Lage der Dinge war von nun an eine wesentlich andere. War aber auch in Aragonien nicht mehr zu erwarten, daß die Richter sich bei ihren Maßnahmen irgendwie von den Absichten und Plänen des Königs bestimmen lassen würden, so war doch Perez weit entfernt, seine alte Ehrerbietung für seinen Gebieter aufzugeben und eine unbesonnene Sicherheit zu verraten. Er hätte dem ungleichen Schritt gern ein Ende gemacht und hatte kaum die kastilische Grenze überschritten, als er von Calatayud am 24. April 1590 an den König einen Brief voll Unterwürfigkeit und flehendlicher Bitten für sich, seine Frau und seine Kinder richtete, worin er um nichts bat, als daß der König sie in irgendeinem Winkel, sei es welcher es wolle, ruhig leben lassen möge. Gleichzeitig schrieb er an den Beichtvater Diego de Chaves und an den Kardinal von Toledo, teilte ihnen sein Schreiben an den König mit und bat sie um ihre Fürsprache.
Weder diese Bitten noch die allgemeine Befriedigung, die die Flucht des Perez erregt und die selbst der königliche Hofnarr, der Onkel Martin, gegen den König vor dem ganzen Hofe bezeigt hatte, vermochten irgend etwas den Sinn des Königs zu mildern und das letztere mag ihn wohl eher erbittert haben. Noch am Tage nach der Flucht des Perez, die erst am nächsten Morgen entdeckt worden zu sein scheint, mitten unter den heiligen Gebräuchen, die das höchste und am meisten zu Mitleid und Vergebung auffordernde Fest der Christenheit einleiteten, ließ er die hochschwangere Frau des Perez und seine sämtlichen Kinder, die zum Teil noch so klein waren, daß sie auf dem Arme getragen werden mußten, in das öffentliche Gefängnis werfen. Perez war kaum 10 Stunden in Calatayud, als der Befehl kam, ihn tot oder lebend zu ergreifen, bevor er den Ebro überschritten. Auch Perez hatte indessen nicht gezaudert. Er hatte sogleich nach seiner Ankunft mit seinem Gefährten Mayorini ein Asyl in dem dem heiligen Peter dem Märtyrer gewidmeten Dominikanerkloster aufgesucht, während Gil de Meso nach Saragossa geeilt war, um für Perez und Mayorini das Privilegium der Manifestados in Anspruch zu nehmen, das sie unter das Gericht des Großrichters von Aragonien stellte. So kam denn auch Don Manuel Zapata zu spät, der im Namen des Königs den Perez reklamierte, um ihn vor das königliche Gericht zu stellen. Don Juan de Luna, Baron von Purroy und Mitglied der permanenten Deputation des Königreiches Aragonien, erschien mit 50 Arkebusierern in Calatyud, ward von der Einwohnerschaft unterstützt und brachte beide Gefangene in das nach den Fueros benannte Gefängnis zu Saragossa. Nun mußte der König sich darein ergeben, seine Sache vor der aragonischen Justiz ausfechten und erhob eine förmliche Klage gegen Perez, daß derselbe den Escovedo habe töten lassen, indem er sich fälschlich des königlichen Namens bedient, daß er den König selbst verraten habe, indem er die Staatsgeheimnisse ausgeplaudert und Depeschen gefälscht habe, und daß er flüchtig geworden sei.
Die Aragonesen, die unter ihren eigenen Fürsten eine ausgedehnte mittelalterliche Freiheit genossen, hatten mit einer noch eifersüchtigeren Sorgfalt über die Erhaltung ihrer alten Privilegien gewacht, seit sie gegen den Anfang des 16. Jahrhunderts unter die Herrschaft der kastilischen Könige gekommen waren. Die letzteren nahmen den Titel als Könige von Aragonien nicht eher an, als bis sie feierlich geschworen hatten, die Verfassung dieses Königreiches zu beachten. Eine Verletzung derselben von seiten des Königs ermächtigte die Untertanen zum Aufstand und wenn der Ruf: Contra fuero! erschallte, erhoben sich, sagt der Geschichtschreiber Herrera, selbst die Steine in Aragonien. Die berühmten stolzen Worte, die der Großrichter von Aragonien, nachdem der König den Eid geleistet, im Namen seiner Landsleute mit entblößtem Haupte an ihn richtete: »Wir, die wir ebenso viel wert sind wie Ihr und die wir mehr vermögen als Ihr, wir machen Euch zu unserem König unter der Bedingung, daß Ihr unsere Rechte achtet, wo nicht, nicht«, waren keine leere Formel. Verlor zwar dieses Verhältnis in seiner Bedeutung, seit Aragonien Könige hatte, deren Macht auf weiterem Besitz ruhte und anderwärts wurzelte als in Aragonien, so hatten doch selbst Karl V. und Philipp II. nicht gewagt, die Verfassung dieses stolzen und mutigen Bergvolkes zu verletzen. Den Vizekönig, dem sie ihre schwache Autorität übertragen mußten sowie die anderen Agenten der Krone, hatten sie aus den Aragonesen zu wählen gehabt. Kein fremder Soldat durfte den Fuß auf das aragonische Gebiet setzen. Das Land verteidigte, regierte, besteuerte, verwaltete, richtete sich selbst. Die aus den Deputierten des Klerus, des hohen Adels (ricos hombres), der Ritter- und Landschaft (cavalleros et hidalgos) und der Städte bestehenden Cortes, die alle zwei Jahre von dem König zusammenberufen wurden, stellten unter dem Vorsitz des Königs oder eines von ihm dazu bestellten Prinzen seines Hauses die Steuern fest und entschieden über die vorliegenden Staatsfragen. Der König konnte die Versammlung nicht ohne ihre einmütige Zustimmung auflösen oder vertagen. Zwar war ihre Sitzungsperiode auf 40 Tage beschränkt, aber in der Zwischenzeit wurden die Cortes durch einen immerwährenden Ausschuß vertreten. – Wie in den anderen Staaten der spanischen Monarchie gab es königliche und geistliche Richter. Aber diese Richter waren unter die Oberaufsicht und höchste Autorität des Großrichters (justicia mayor) gestellt, der aus der Ritterschaft gewählt wurde. Jeder Bewohner Aragoniens konnte an ihn appellieren und sofort waren die Befugnisse der anderen Gerichtshöfe suspendiert; die Exekution ihrer Urteile wurde gehemmt. Der Großrichter, unterstützt von seinen fünf Stellvertretern, revidierte dieselben und annullierte sie, wenn er sie den Privilegien des Königreiches entgegengesetzt fand. Sein Verfahren war öffentlich; seine Untersuchungen schlossen – was in der Tat eine Erhabenheit dieser Verfassung über ihre Zeit bekundet – die Tortur und jeden sonstigen Zwang aus; selbst sein Gefängnis führte den Namen Manifestado oder auch den der Freiheit. Seine Autorität war der Gegenstand einer unvordenklichen und selbst leidenschaftlichen Ehrfurcht. Zwar ernannte der König den Großrichter, konnte aber diesen großen Schutzwächter der Verfassung, der berechtigt war, gegen den König selbst, wenn dieser die Verfassung gefährdete, zu den Waffen zu rufen, nicht wieder entlassen. Nur die Cortes hatten das Recht, ihn in seinen Funktionen zu suspendieren, wenn er dieselben schwach oder untreu ausübte.
Unter die Ägide dieser schützenden Magistratur, die damals Don Juan de la Nuza verwaltete, fand sich Perez bei seiner Ankunft in Saragossa gestellt. In dieser Stadt befand sich damals ein Kommissar des Königs, Don Iñigo de Mendoza Marquis d'Almenara, der beauftragt war, auf Erweiterung der königlichen Autorität hinzuwirken. Philipp II., dem die aragonische Selbständigkeit, die einen so ansehnlichen Teil seiner Staaten seiner freieren Verfügung entzog, ein Dorn im Auge war, verfolgte mit leisen Schritten das Ziel, Aragonien besser unter seine Botmäßigkeit zu bringen. Bereits hatte er in Madrid einen obersten Rat von Aragonien errichtet und damit wenigstens äußerlich dargelegt, daß der Sitz der Entscheidung über die Angelegenheiten Aragoniens nicht mehr lediglich in Aragonien selbst sei. Jetzt beanspruchte er das Recht, auch einen Nicht-Aragonesen zum Vizekönig zu bestellen und Almenara sollte diesen Anspruch vor dem Tribunal des Großrichters durchführen. Derselbe Beauftragte empfing jetzt auch die gegen Perez ergangenen Akten mit dem Befehl, Perez in Einklang mit dem Fiskal vor der aragonischen Justiz zu verfolgen. Der Prozeß begann. Während desselben machte Perez nochmals einen Versuch, den König auf andere Gesinnungen zu bringen. Er schrieb am 8. und 10. Mai an den königlichen Beichtvater in Ausdrücken, die noch immer die größte Ehrfurcht und Ergebenheit für den König atmeten, aber doch mit bitteren Klagen über die bestandenen Leiden und die nicht erfüllten Versprechungen verbunden, jedoch nicht ohne Drohungen waren. Denn Perez gab jetzt zu erkennen, daß er wichtige Papiere zurückbehalten habe, und daß es im Interesse des Königs sei, die Vorlegung derselben vor Gericht zu vermeiden.
Er erhielt keine Antwort. Man hoffte in Madrid noch, es werde Almenara gelingen, die Auslieferung des Perez zu bewirken. Aber alle Bemühungen desselben scheiterten an der aragonischen Rechtlichkeit. Perez schrieb nun am 10. Juni nochmals an den König und kündigte ihm an, daß er ihm jemand zuschicken werde, der ihm mündlich darlege, was er dem Papiere zu vertrauen Gedenken trage. Er benutzte dazu den Prior von Gotor, dem er unter dem Siegel des geistlichen Geheimnisses alle noch in seinem Besitz befindlichen Papiere zeigte und von den meisten Abschriften gab. Es befanden sich darunter eigenhändige Billetts des Königs, die Perez ermächtigten, mit Don Juan d'Austria und mit Escovedo über die geheimsten Staatsangelegenheiten zu korrespondieren, ihre Depeschen bei dem Dechiffrieren zu ändern, ihre Entwürfe durch den Tod des Escovedo zu vereiteln und welche ihm befahlen, die durch diesen Tod veranlaßten Verfolgungen zu bestehen, ohne irgend etwas zu bekennen. Der Prior erhielt mehrere Audienzen bei dem König, der Kenntnis von den betreffenden Papieren nahm und von dem ihm damit geleisteten Dienst befriedigt schien. Dem Perez hatte er aber keineswegs vergeben, war vielleicht über den ihm durch Zurückbehaltung jener Papiere abermals gespielten Streich nur mehr erbittert und bedachte nicht, daß Perez ein Leben zu verteidigen hatte, und daß es ihm nicht zuzumuten war, sich willenlos und mit gebundenen Händen der Willkür eines Königs zu überliefern, der kein Versprechen und keine Treue hielt. Philipp sah wohl ein, daß es bedenklich sei, den Prozeß gegen Perez fortzusetzen, solange dieser sich vor einem unabhängigen Gericht mittels jener Papiere verteidigen könnte. Bevor er aber in dieser Beziehung einen definitiven Entschluß faßte, wollte er öffentlich zu erkennen geben, daß Perez keine Gnade von ihm zu erwarten habe, und sich noch für die Zukunft Waffen gegen den Verhaßten sichern. Einige Tage nach jenen Audienzen am 1. Juli 1590 ließ er Perez durch die in Madrid gegen ihn bestellten Richter Vasquez und Gomez verurteilen: geschleift und gehenkt zu werden. Sein Kopf sollte nach dem Henken abgeschnitten und auf einem öffentlichen Platz aufgestellt, sein Vermögen sollte konfisziert werden. Nun glaubte Perez sich jeder Rücksicht entbunden und publizierte eine mit großer Energie der Sprache verfaßte Denkschrift über seine Sache, worin er seine Verteidigung auf die eigenhändigen Schreiben des Königs und die Briefe des Beichtvaters stützte, die er zugleich den aragonesischen Richtern vorlegte. Jetzt ließ der König sich von dem Referenten in der Sache, einem Stellvertreter des Großrichters, dem Baptista de la Nuza, einen Bericht über die Sachlage und ein Gutachten über den wahrscheinlichen Ausgang des Prozesses erstatten. Als das letztere dahin ausfiel, daß Perez in allen Punkten freigesprochen werden dürfte, erklärte der König am 20. September 1590 seinen Rücktritt von der Klage, tat es aber in einer Weise, die offen darlegte, daß er damit seine Absicht noch keineswegs aufgebe. Er bezog sich darauf, daß Perez seine Verteidigung veröffentlicht habe, und versicherte: wenn auch er eine Widerlegung dieser Verteidigung veröffentlichen wollte, würde kein Zweifel über die Schwere der Verbrechen des Perez bleiben und seine Verurteilung keine Schwierigkeit finden. Dabei würden aber Angelegenheiten von höchster Wichtigkeit, Geheimnisse, die nicht enthüllt werden dürften, Personen, an deren Ruf und Ehre mehr gelegen wäre als an der Verurteilung des Perez, berührt werden müssen. Um dies zu vermeiden, verzichte er darauf, ihn vor dem aragonischen Tribunal zu belangen. Aber seine Gerechtigkeit sei bekannt. Er bezeuge, daß die Verbrechen des Perez sowohl nach den sie begleitenden Umständen als nach der Zeitlage, dem Augenblicke und der Art ihrer Begehung so groß seien, wie nur je ein Untertan gegen seinen König und Herrn sie habe verüben können. Schließlich behielt er sich alle seine Rechte vor, um die Klage zu jeder Zeit vor jedem anderen Tribunal verfolgen zu können. Das Schwert des Damokles hing noch immer über dem Haupte des Perez.
Zunächst versuchte man jedoch selbst noch in Aragonien neue Anklagen. Fünf Tage nach der Rücktrittserklärung wurde Perez angeklagt, den Astrologen Pedro de la Era und den Stallmeister Rodrigo de Morgado ermordet zu haben. Es wurde jedoch durch die Erklärungen der Ärzte erwiesen, daß beide eines natürlichen Todes an einer bekannten Krankheit gestorben waren. Man gab daher auch diese Klage auf, aber nur deshalb, um sogleich eine andere vorzubringen. Der König hatte das Recht, Beamte wegen übler Amtsführung in Aragonien zu verfolgen, ohne daß sie die aragonischen Privilegien anrufen konnten. Almenara erhob daher eine Anklage gegen Perez wegen Bestechlichkeit und verlangte seine Auslieferung. Perez bewies jedoch, daß jenes Recht nur auf die aragonischen Beamten Bezug habe, daß er aber niemals in Aragonien bedienstet gewesen sei, außerdem machte er geltend, daß er wegen derselben Sache schon 1585 verurteilt worden sei und nicht zweimal wegen derselben Sache verurteilt werden könne. Er behauptete übrigens, sich auch in diesem Punkte durch die Briefe des Königs rechtfertigen zu können. So scheiterte auch dieser Versuch, und Perez, der noch immer im Gefängnis war, ohne daß man eigentlich einen Grund dafür ersehen konnte, verlangte jetzt seine Freilassung, im Notfall gegen Bürgschaftsleistung.
Jetzt nahm der König seine Zuflucht zu dem für Perez allerdings gefährlichsten Werkzeug, zu derselben geistlichen Gerichtsbarkeit, der er ihn einst abgekämpft hatte, und zu dem schlimmsten Zweige derselben, der Inquisition, jener höllischen Erfindung, die den Glauben der Menschen zum Gegenstande einer in juristische Formen gekleideten Erörterung und Bestrafung nach menschlicher Willkür machte, eines die Polizei in die Kirche verpflanzenden Institutes, das namentlich in Spanien wesentlich mehr politisches Werkzeug als kirchliche Anstalt und dem König dienstbarer war als der Kirche. Bei der Masse und Vieldeutigkeit der kirchlichen Dogmen und der elastischen Auslegungskunst der Inquisitoren unterlag zuletzt jedermann der Möglichkeit, einer Ketzerei beschuldigt zu werden. Bei dem Verfahren jenes die Menschheit entehrenden Gerichtes war es jederzeit möglich, den zu verurteilen, den man zu verurteilen wünschte. Perez hatte sich in der Bitterkeit seines Verdrusses und der Ungeduld seiner Leiden vor Menschen, die er für seine Freunde hielt, unbedachte Äußerungen entschlüpfen lassen, die seine Verzweiflung verkündeten, die aber leicht, zumal in ihrer drastischen, der südlichen Lebhaftigkeit angehörenden Sprache, als gotteslästerlich und gottesleugnerisch ausgelegt werden, ja, es dem erscheinen konnten, der etwas mehr in ihnen sehen wollte als unerwogene Ausbrüche der Verzweiflung. Außerdem hatte er mit seinem Haftgenossen Mayorini daran gedacht, eine neue Flucht zu versuchen und sich nach Frankreich oder Holland zu begeben. Da in diesen beiden Ländern Ketzer lebten, war auch dieser Plan ein Grund zum Ketzergericht.
Dem Marquis d'Almenara war es gelungen, den Diego Bustamente, der seit achtzehn Jahren in den Diensten des Perez gestanden hatte, und den Juan de Basante, einen Lehrer der griechischen und römischen Sprache zu Saragossa, der den Perez fast täglich in seinem Gefängnisse besuchte, zwei Menschen, deren Treue und Freundschaft Perez völlig vertraute und vor denen der von Haus aus in seinen Reden nicht vorsichtige Mann sich kein Blatt vor den Mund nahm, auf seine Seite zu bringen. Diese Leute hinterbrachten aber die Reden und Pläne des Perez heimlich einem der Inquisitoren zu Saragossa, Don Molina de Medrano. Dieser verhörte auch noch acht andere Zeugen und schickte dann die Akten an das oberste Tribunal der Inquisition zu Madrid. Der Großinquisitor Don Gaspard de Quiroga legte sie zur Begutachtung dem königlichen Beichtvater Bruder Diego de Chaves vor, und dieser fand denn auch in seinem am 4. Mai 1591 erteilten Gutachten mancherlei gotteslästerliche, ketzerische oder der Ketzerei verdächtige Äußerungen darin. Am 21. Mai entschied der Großinquisitor mit seinen drei Beiständen, daß Perez und Mayorini in die geheimen Gefängnisse der Inquisition in Aragonien gebracht und daß ihnen dort der Prozeß in aller Form gemacht werden solle. Dieser Beschluß wurde in zwei Tagen durch einen Kurier von Madrid nach Saragossa gebracht, worauf die Inquisitoren am Morgen des 24. von ihrem Sitze im Schlosse Aljaferia aus Befehle an einen Alguazil der Inquisition erließen, wonach dieser sich nach Saragossa begeben, Perez und Mayorini, wo immer er sie finde, ergreifen und in die Gefängnisse des Santo officio abliefern solle. Der Alguazil fand sich mit acht Familiaren der Inquisition in dem Gefängnisse der Manifestados ein, wo man ihm aber mit Bezug auf die Fueros die Auslieferung der Gefangenen verweigerte. Hierauf erließen die Inquisitoren einen Befehl an die Stellvertreter des Großrichters, worin sie ihnen kraft des heiligen Gehorsams, bei Strafe der größeren Exkommunikation und einer Geldbuße von 1000 Dukaten für jeden, geboten, Perez und Mayorini binnen drei Stunden an den Alguazil der Inquisition ausliefern zu lassen, da alle entgegenstehenden Rechtssatzungen auf Glaubenssachen keine Anwendung hätten.
Dieser Befehl gelangte zwischen 8 und 9 Uhr des Morgens, also mit der höchsten Beschleunigung, an den Großrichter Don Juan de Nuza, der sich bereits mit seinen fünf Stellvertretern im Ratssaale befand. Der Großrichter war schon entschieden. Er hatte in der vorhergehenden Nacht eine geheime Unterredung mit dem Marquis von Almenara gehabt, in der er bestimmt worden war, sich dem Willen des Königs zu fügen. (In einer späteren Zeit wird er wohl mit bitteren Gefühlen daran gedacht haben, wie schlecht ihm diese Nachgiebigkeit verdankt worden!) Er entschloß sich, den Forderungen der Inquisition nachzugeben, und verfügte die Auslieferung. Vor derselben wurde eine Inventur der Effekten des Perez vorgenommen, unter denen man ein Exemplar der Fueros, eine Porträt seines Vaters und ein Bild der Mater Dolorosa fand. Dann wurde Perez mit Mayorini in einen Wagen gesetzt und nach Aljaferia geschafft
Jetzt schien er verloren, und doch war er auch jetzt nicht ohne Hoffnung. Trotz des beobachteten Geheimnisses und der beschleunigten Ausführung hatte sich die Nachricht von der Auslieferung, die mit den Privilegien des Königreiches zu streiten schien, in Saragossa verbreitet und setzte die Bewohner in Aufregung. Perez hatte sogar in dem Palast der Inquisition Verbindungen: ein Sekretär derselben, Francesco Valles, verdankte ihm seine Stelle. Sogar ein Inquisitor, Antonio Morejon, neigte sich in seinem aragonischen Nationalgefühl seiner Sache zu. In voraus von dem Vorgefallenen unterrichtet, hatte Perez Sorge getragen, auch seine Parteigänger zu benachrichtigen. Viele Herren vom hohen Adel und von der Ritterschaft waren für ihn, weil sie in ihm die Institutionen ihres Landes zu verteidigen glaubten. Drei der Entschlossensten unter ihnen, Don Martin de La Nuza, Baron von Biescas, Don Pedro de Bolea und Don Iban Coscon, die Perez oft in seinem Gefängnisse besucht hatten, fanden sich auf dem Marktplatz, wo das Gefängnis lag, während der Auslieferungshandlung ein und fragten zunächst einen Familiaren der Inquisition: was da vorgehe. Natürlich erhielten sie zur Antwort: »Nichts, was ihr wissen könnt; geht euern Weg und Gott geleite euch.« Sie wendeten sich darauf an den Alcalden des Gefängnisses und machten ihm Vorwürfe, daß er Gefangene, die unter dem Schutz der Manifestados ständen, aus seinen Händen gäbe, und als sie von ihm erfuhren, daß er auf Befehl des großrichterlichen Rates handle, begaben sie sich, von zusammenlaufendem Volke gefolgt, zu dem nahen Palaste des Großrichters, drangen in den Ratssaal, griffen den Großrichter an, beschuldigten ihn, die Fueros zu verletzen, und forderten ihn, stolz und zornig, auf, den Auslieferungsbefehl zu widerrufen. Der Großrichter erwiderte: er habe sich nach den Fueros gerichtet, die die Zurückhaltung von Gefangenen, die in Glaubenssachen verfolgt würden, nicht gestatteten, und forderte sie auf, sich zu beruhigen und zurückzuziehen. Nun stiegen sie in den Saal des permanenten Ausschusses hinab und rissen die Deputierten mit sich vor den Großrichter, damit auch sie jene Klagen und Forderungen erhöben. Sie taten es, erhielten aber dieselbe Antwort.
Jetzt wendeten sie sich an die Masse und verließen den Palast mit dem Rufe: »Contra fuero! Es lebe die Freiheit! Zu Hilfe der Freiheit!« Auf diesen Ruf und auf den Schall der Sturmglocken, die der Prior von La Seu, Don Vincenzio Augustin, läuten ließ, brach ein gewaltiger Aufstand in Saragossa aus. In einigen Augenblicken war eine zahlreiche bewaffnete Menge versammelt. Eine Abteilung derselben, an deren Spitze Don Antonio Ferris, Don Pedro de Sese, Don Francesco de la Cavalleria, Don Miguel Torres und Gil de Mesa standen, wendete sich nach dem Palaste der Inquisition, wo auch eigentlich allein der erklärte Zweck des Aufstandes zu erreichen war. Eine andere Abteilung, die von Don Diego de Heredia, Don Martin de La Nuza, Don Iban Coscon, Don Pedro de Bolea, Don Juan d'Aragon, also von den bedeutenderen Leitern geführt war, zog nach der Wohnung des Marquis von Almenara, dem man die Verhaftung des Perez zuschrieb und den man beschuldigte, ein Komplott gegen die Fueros angesponnen zu haben. Als die Leute des Marquis den wütenden Haufen unter dem Geschrei: »Es lebe die Freiheit! Tod den Verrätern!«, heranrücken sahen, verschlossen sie die Türen und bewaffneten sich. Nachdem die Aufständischen vergebens versucht hatten, die Türen zu erbrechen, verfielen sie auf ein Trugmittel, an denen ja die Anstifter revolutionärer Bewegungen so reich und so schamlos dabei sind. Ein gewisser Gaspard Burces behauptete: sein Vetter Dominico Burces, der in Wirklichkeit in Amerika war, sei wider die Gesetze des Reiches in dem Hause des Marquis eingesperrt. Er erwirkte sich auf dieses Vorgeben hin einen Manifestationsbefehl zugunsten seines Vetters, womit man dann die Öffnung der Türen zu erreichen hoffte. Der Marquis jedoch verweigerte die Öffnung, ließ aber heimlich den Großrichter von seiner Gefahr benachrichtigen und um Beistand bitten. Der Großrichter begab sich denn auch, unter Vortritt seiner Stabträger und von seinen Assessoren begleitet, in aller Eile durch die Haufen der Aufständischen, die, 3000–4000 an der Zahl, das Haus belagerten, zu dem Marquis. Wie hatte sich die Szene verändert, seit sie in der verflossenen Nacht die geheime Unterredung gepflogen hatten, die das Schicksal des Perez besiegeln sollte!
Der Großrichter trat mit Burces in das Haus ein und ließ seinen ersten Rat, den Assessor Chalez, an der Tür, um dem Volke den Zutritt zu wehren. Während nun Burces seinen Vetter suchte, der nicht im Hause und folglich nicht zu finden war, bestürmten die Edelleute, die den Aufstand hervorgerufen hatten, den Chalez, den Marquis durch den Großrichter verhaften zu lassen, widrigenfalls sie alle als Verräter betrachtet und verfolgt werden würden. Zeuge ihrer Wut und durch ihre Drohungen eingeschüchtert, rief Chalez den Großrichter ans Fenster und forderte ihn im Namen des Volkes auf, den Marquis zu verhaften. Bei diesen Worten erhoben die Aufständischen den Ruf: »Es lebe die Freiheit!« Der Großrichter sagte ihnen darauf: sie dürften diesen Ruf nur erheben, wenn er ihnen das Zeichen dazu gegeben habe, und befahl ihnen, sich zurückzuziehen, wenn sie nicht ihre Namen aufgezeichnet wissen und sich als Rebellen verfolgt sehen wollten. Doch sie erstickten seine Stimme durch nur noch stärkeres Wiederholen jenes Rufes, dem sie das unheimliche, entweihende »Tod den Verrätern!« beigesellten und einige Schüsse dazu abfeuerten. Der Großrichter, bestürzt und den Forderungen der Volksmasse mit allerdings durch die Notlage etwas besser entschuldigter Schwäche nachgebend, wie er nur eben dem Eigenwillen des Königs nachgegeben hatte, schlug dem Marquis vor, sich zur Beschwichtigung der so furchtbaren Bewegung ins Gefängnis führen zu lassen. Der Marquis weigerte sich. Der Großrichter erschien nochmals am Fenster und versuchte das Volk zu erweichen, das die Türe mit einem Balken bearbeitete und immer gebieterischer die Verhaftung des Marquis und seiner Leute forderte. »Nun wohlan«, sagte der Großrichter endlich, »gebt ihr mir euer Wort als Edelleute, als Hidalgos und als Männer von Ehre, daß, wenn ich sie herausgehen lasse, sie in eurer Mitte in Sicherheit sind!« »Ja, ja!« erwiderten sie, und auf dieses Wort der leidenschaftlichen Führer des aufgeregten, tumultuarischen Haufens hin beschloß der Großrichter, dem Verlangen der Aufständischen nachzugeben, und als der Marquis, klüger als er, sich noch immer weigerte, befahl er ihm im Namen des Königs und zum Besten des Reiches, ihm zu folgen.
In dem selben Augenblicke, in dem sie herausgehen wollten, hatte die Volksmasse die Tür gesprengt und stürzte sich auf die Treppen. Trotz ihrer Aufregung respektierte sie im Anfang den Marquis, der zwischen dem Großrichter und dem Assessor Torralba ihre Reihen durchschritt, ohne beschimpft oder angegriffen zu werden. So ging der Zug. dessen Schluß der Sekretär, der Haushofmeister und der erste Diener des Marquis, von den übrigen Stellvertretern des Großrichters umgeben, bildeten, eine Zeitlang vorwärts. Doch den Führern der Aufständischen, die eine Einschüchterung der künftigen Feinde der Privilegien des Landes bezweckten, vielleicht auch von persönlichem Hasse gegen den Marquis getrieben waren, ja vielleicht in der raffinierten Berechnung der Revolutionsführer handelten, die durch Blut und Verbrechen ihre Werkzeuge unauflöslich an der Sache zu ketten wähnen, genügte es nicht, daß dem Marquis auf seinem Gange die Worte »Verräter, Renegat, Störer des Reiches!« zugerufen wurden, wenn sie auch des Einflusses sich freuen mochten, den dieses Geschrei auf die Stimmung der Massen äußerte. Als der Zug vor die große Kirche de La Seu kam, sagten Diego de Heredia und Pedro de Bolea, des gegebenen Wortes vergessend und ohne Rücksicht auf das Schimpfliche der Ermordung eines Wehrlosen, zu den Ihrigen: »Er sterbe!, er sterbe!« Sofort stürzten sich die Heftigsten der Aufständischen auf den unglücklichen Marquis, warfen ihn nieder, entrissen ihm seine Mütze und seinen Mantel, mit denen er seinen Kopf und den übrigen Oberkörper decken wollte, und verwundeten ihn schwer. Er empfing drei Messerstiche in den Kopf, einen in die Hand, mit der er sein Schwert hielt, das er nun fallen lassen mußte, und würde sofort umgebracht worden sein, wenn ihn nicht einige Edelleute, die sich dieses Mannes würdig verhielten, verteidigt und wieder aufgehoben hätten. Seine Diener, die doch schwerlich irgendeine Schuld trugen, wurden beinahe ebenso mißhandelt wie er. Man hielt es für zu gefährlich, ihn bis in das Gefängnis der Manifestados zu schaffen, und brachte ihn daher, ganz zerschlagen und mit Blut bedeckt, in das alte Gefängnis, an dem man vorbeikam, und hier ist er nach vierzehn Tagen an seinen Wunden gestorben. Damit war es entschieden, daß eine Bewegung, die sich mit einer solchen Bluttat befleckte, schließlich scheitern und Unheil über ihre Anstifter und das verleitete Volk heraufbringen mußte.
Während diese Mordszene in Saragossa vorfiel, verlangte die andere Schar der Aufständischen, die die Stadt verlassen und sich gegen Aljaferia gewendet hatte, mit großem Geschrei die Gefangenen von den Inquisitoren. Diese, die sich in ihrem sehr festen Schlosse sicher hielten, waren nichts weniger als geneigt, diesen Forderungen des Aufstandes nachzugeben. Um sie zu zwingen, hatte Don Pedro de Sese Karren voll Holz kommen lassen, mit denen man das Schloß in Brand zu stecken bezweckte, und die sich um den Palast der Inquisition drängenden Insurgenten riefen: »Kastilische Heuchler, gebt den Gefangenen die Freiheit wieder, wenn ihr nicht im Feuer sterben wollt, wie ihr andere sterben laßt.« Der Vizekönig Don Jaime Ximeno, ganz bestürzt über diese Bewegung, begab sich mit Dr. Monreal, einem Beamten des Erzbischofs, zu den Inquisitoren. Die Aufständischen umringten seinen Wagen und riefen ihm laut und gebieterisch zu: »Vizekönig, schafft uns Gerechtigkeit und verteidigt unsere Freiheiten!« – »Das wird geschehen, meine Kinder«, erwiderte er; »ich werde Gerechtigkeit für euch verlangen, und eure Fueros werden gewahrt werden.« In der Tat forderte er die Inquisitoren auf, die Gefangenen auszuliefern. Auch der Erzbischof Bobadilla schrieb ihnen: »Das Haus des Marquis von Almenara ist angegriffen, und um die Gefahr, die seine Person bedroht, abzuwenden, sehe ich kein anderes Mittel, als daß Antonio Perez in das Gefängnis der Manifestados zurückgebracht werde.« Die Inquisitoren Hurtado de Mendoza und Morejon schienen geneigt zu diesem Akte der Nachgiebigkeit, während Molina de Medrano mit seiner Festigkeit, deren man sich freuen möchte, wenn sie einer besseren Sache gegolten hätte, den Vorschlag als eine der Diener der Inquisition und der Wächter des Glaubens unwürdige Schwäche zurückwies. Er drang auch durch, und man beschloß, die Gefangenen zu behalten. Bald aber wurde die Gefahr größer, und die Grafen Aranda und Morata trafen in Aljaferia ein, um die Inquisitoren zu beschwören, dem Willen des Volkes nachzugeben. Gleichzeitig schickte der Erzbischof ein zweites, dringenderes Billett und ließ den Inquisitoren sagen, die Dinge gingen immer schlechter, und die Aufständischen erwarteten nur die Nacht, um den erzbischöflichen Palast, das Haus des Großrichters und Aljaferia in Brand zu stecken und nicht wieder gutzumachenden Unfug zu begehen, wenn ihnen Perez nicht zurückgegeben würde. Noch konnten die Inquisitoren sich nicht entschließen, als Don Juan Paternoy ihnen ein drittes, lakonisches Billett des Erzbischofs brachte, worin es hieß: »Die Freigebung des Antonio Perez ist unerläßlich geworden; schickt ihn daher ohne Verzug und mit Vorsicht in das Gefängnis der Manifestados zurück.« Zugleich ließ er sie wissen, daß das Volk den Marquis Almenara ergriffen und verwundet habe. Jetzt wich auch Molina dem Drange der Umstände. Perez und Mayorini wurden gegen 5 Uhr des Abends in die Hände des Vizekönigs und der Grafen Aranda und Morata ausgeliefert. Die Inquisitoren wollten damit keineswegs ihre Opfer aufgegeben wissen, sondern machten es zur Bedingung, daß die Gefangenen sorgfältig bewacht würden und daß das Reichsgefängnis für sie wie das Gefängnis der Inquisition sei.
Das Volk jedoch wußte hiervon nichts und stieß einen großen Freudenschrei aus, als es die Gefangenen erblickte. Man brachte sie in eine Kutsche, und der Vizekönig bat Perez, sich aufrechtzuerhalten, damit jedermann ihn sehen könne. Die Fahrt von Aljaferia bis zu dem Gefängnis der Manifestados war für Perez ein wahrer Triumphzug. Das Volk drängte sich um ihn und rief ihm zu: »Senor Antonio Perez, zeiget Euch im Gefängnis dreimal täglich am Fenster, damit wir Euch sehen und damit hienach kein Loch in unsere Freiheiten und in unsere Fueros gemacht wird.« Sobald Perez wieder in der Obhut des Großrichters war, legte sich der Aufstand.
Dieser am 24. Mai 1591 von dem Volke von Saragossa errungene Sieg war freilich weit entfernt, ein endgültiger zu sein. Philipp II. ergab sich nicht darein, sich den Perez von neuem entrissen zu sehen, und konnte auch die Mißachtung der Inquisition und die Beeinträchtigung seiner Autorität nicht dahingehen lassen. Er übereilte aber nichts. Abgesehen davon, daß er überhaupt in ernsten Fällen langsam vorzugehen pflegte, hatte er auch sonst Gründe, sich nicht ohne weiteres seinem Zorn zu überlassen. Im Krieg mit den Türken im Mittelmeer war er genötigt, sich auf dem Ozean gegen die Engländer zu verteidigen, die die amerikanischen Kolonien und die spanischen Küsten angriffen. In Portugal war er noch immer den Angriffen des Don Antonio de Crato ausgesetzt und in den Niederlanden in einem blutigen Kampf gegen die Aufständischen der sieben Provinzen begriffen, durch Parteiinteressen und Herrschsucht bestimmt, in Frankreich die katholische Liga mit Geld und Truppen zu unterstützen, daher konnte er nicht wünschen, zu so zahlreichen und zu so furchtbaren Feinden sich andere im Innern seiner Staaten gesellen zu sehen. Die Erhebung eines Königreiches wie Aragonien, dessen Lage fest war, dessen Bevölkerung für kriegerisch galt, dessen Gesetze der Gegenstand allgemeiner und ausdauernder Anhänglichkeit waren, schien seine Macht erschüttern und seine mannigfaltigen Unternehmungen gefährden zu können. Er war daher geneigt, Milde zu zeigen, wenn die Aragonesen zum Gehorsam zurückkehrten, und diese waren dazu um so bereiter, als sie im Widerspruch mit den gewöhnlichen Illusionen der Revolutionäre kein großes Vertrauen in ihre eigene Kraft setzten. Seit 75 Jahren gewohnt, ihre Rechte unter der kastilischen Dynastie zu genießen, ohne sie verteidigen zu müssen, wußten sie nicht, ob sie imstande sein würden, sich mit den Waffen in der Hand zu behaupten. Sie fürchteten alles zu verlieren, wenn sie alles verlangten. Von beiden Seiten war man daher zu einem Vergleiche geneigt, der unter trügerischer Form den aragonischen Stolz befriedigte und zugleich dem König genugtat, das Manifestationsrecht scheinbar bestehen ließ und es doch faktisch der Inquisition unterordnete.
Der König verlangte um so mehr einen solchen Vergleich, dessen Vorteil in der Tat ihm allein zu statten kam, da der Inquisitor Don Pedro Pacheco, der im Juli 1591 zu Madrid eine geheime Untersuchung über die Vorgänge des 24. Mai eröffnet hatte, in der Tat auf Dinge gestoßen war, die ganz geeignet waren, das Mißtrauen des Monarchen zu nähren. Er hatte achtzehn Zeugen abgehört, unter denen sich zwei Stellvertreter des Großrichters, Dr. Geronimo Chalez und Juan Francesco Torralba, die, weil sie sich dem Perez feindlich gezeigt haben sollten, ihre Posten hatten aufgeben und Saragossa verlassen müssen, drei Diener des Marquis Almenara, ein Page des Perez, Antonio Añon, und sein alter Verräter Diego Bustamente befanden. Namentlich der letztere brachte vieles vor, was auf ausschweifende und zum Teil in der Tat hochverräterische Pläne und Umtriebe hinwies. Perez sollte unter anderem geäußert haben: bei den nächsten Cortes, wo der König zugegen sein würde, müsse er frei sein und werde dann die Erstattung von 200.000 Dukaten, um die er von ihm geschädigt worden, fordern, ihn auch zwingen, die Fassung seiner Rücktrittserklärung von der Klage zu ändern. Er werde zu den Cortes mit verzierten Schabracken kommen, auf deren Ecken Fesseln und Ketten, auf die Mitte ein Folterapparat mit den Devisen »Gloriosa pro praemio« und »Decora pro fide« sowie »Barato, desengano«, als Einfassung feste Schlösser und Kerker gemalt wären, habe diesen Emblemen eine höchst gehässige Auslegung gegeben und dieselben durch Basante zeichnen und von einem Maler in seinen Farben, blau und gold, ausführen lassen. Nach Notre-Dame del Pilar habe er eine prächtige silberne Lampe stiften wollen mit der Inschrift: »Captivus pro evasione ex voto dedicat; majora dedicaturus pro uxoris natorumque liberatione de populo barbaro iraque regis iniqui et de potestate judicum semen Canaan.« Er habe geäußert: Marcus Crassus sei sechs Monate in einer Höhle versteckt gewesen und habe dann doch noch über alle seine Feinde triumphiert. So könne auch ein Tag kommen, wo Don Iñigo (der Marquis Almenara) froh sein werde, wenn er sich durch die Schnelle seines Rosses retten könne, und wo Rodrigo Vasquez keinen Ort finden werde, sich zu verbergen. Heinrich IV. werde zuletzt der allgemeine Herrscher werden, er sei ein großer Fürst, der alle Welt zu Danke regieren würde. Aragonien könne eine Republik werden wie Venedig und Genua und im Notfall könne es sich an Frankreich anschließen und dabei seine eigenen Bedingungen machen. Mit Don Pedro de Bolea und Don Juan de Luna habe er viel verhandelt und ihnen dabei eine zukünftige große Beförderung in Aussicht gestellt. Er habe aber auch mit Don Balthasar Alamos de Barientos in Kastilien in einem Briefwechsel gestanden, der sich um einen in Kastilien selbst hervorzurufenden Aufstand bewegt habe. Don Balthasar habe darin Perez mit Moses, Philipp II. mit Pharao verglichen und von einer Übersetzung des Tacitus gesprochen, an der er arbeite und worin die Beziehungen auf die Zeit hervorgehoben seien.

Philipp II. von Spanien.
Stich von Vischer, nach einem Gemälde von Tizian. Porträtsammlung der Nationalbibliothek Wien
Nun, die Zeugen waren nicht unverdächtig und Übertreibungen und Entstellungen sind wohl nicht ausgeblieben. Es ist aber auch wohl denkbar, daß Stolz, Ehrgeiz, Erbitterung und Verzweiflung Perez zu manchen ausschweifenden Gedanken führten, denen seine jederzeit ungezügelte Zunge in vertrautem Kreise freien Lauf ließ, und daß er auch sich und seinen Anhängern über manche Besorgnisse und Bedenken durch Hindeutung auf mögliche Eventualitäten der Zukunft und zu Gebote stehende Notmittel wegzuhelfen gesucht hat, auch ohne dieselben ernstlich ins Auge gefaßt zu haben. Zuletzt war er durch den König selbst in die Lage gebracht, für sein Leben kämpfen und sich auch wider den König halten zu müssen, und eine solche Stellung konnte ihn wohl aus den Fugen bringen. Wie dem auch sei, jene Äußerungen, auch wo sie sichtbar nur der augenblicklichen Aufwallung erklärlichen Unmutes entsprangen, mußten am Hofe zu Madrid in dem schwärzesten Licht erscheinen und das Drohende, das in ihnen lag, schien durch die erst nach ihnen erfolgten Ereignisse zu Saragossa eine Bestätigung erhalten zu haben. So ging denn Philipp II. bereit und freudig auf einen Vorschlag ein, den die vornehmsten Aragonesen, die, weil sie am meisten zu verlieren hatten, auch am wenigsten wagen wollten und darüber nur so viel aufs Spiel setzten, nach vielen Beratungen und Schwankungen aufgestellt hatten. Anfangs hatten sie daran gedacht, eine Gesandtschaft an den Papst zu schicken, damit dieser ihre Fueros, die schon vor alters die Genehmigung und den Beistand des Heiligen Stuhles erhalten hatten, gegen die Eingriffe der Inquisition sichere. Doch dieser Plan erhielt keine Folge, und die Mitglieder des beständigen Ausschusses erfaßten einen anderen. Sie beriefen erst vier, dann dreizehn Rechtsgelehrte, um ihnen den Konflikt zwischen dem Tribunal des Großrichters und den Inquisitoren vorzulegen. Diese Juristen wußten, wie so häufig, eine Auslegung der Gesetze zu finden, die den Absichten, denen sie dienen sollte, entsprach. Sie erklärten zwar zuvörderst: das Recht der Manifestation der Gefangenen könne nur durch den Urteilsspruch des Großrichters erlöschen, und seine Annullierung, wie die Inquisitoren sie versucht hätten, sei in der Tat eine Verletzung der Fueros, ein contrafuero gewesen. Dann aber erfanden sie die Theorie, daß eine bloße Suspension jenes Rechtes kein contrafuero sein würde, und schlossen daraus in wesentlicher Erweiterung selbst dieses Zugeständnisses, daß wenn die Inquisitoren trotz der Manifestation die Gefangenen verlangten, sie ihnen ausgeliefert werden müßten. Ein Manöver juristischer Sachwalterkunst, das dem 19. Jahrhundert auch in diesen Beziehungen den Ruhm der Ursprünglichkeit raubt. Eine Konzession, die in dem schwebenden Kompetenzkonflikt faktisch der Inquisition den unbedingten Sieg einräumte und in dem speziellen Fall, um den es sich handelte, die bis dahin von den Aragonesen Geschützten ihren Verfolgern preisgab. Sowohl der beständige Ausschuß als auch der Hof des Großrichters nahmen diese Auslegung an. Die Grafen Aranda, Morata, Sastago, der Herzog von Villa-Hermosa, die meisten Barone und Edelleute billigten sie auch, und die Vorsteher der Stadt Saragossa versprachen, sie aufrechthalten und das Volk daran binden zu wollen. Selbst die näheren Freunde des Perez schienen sich darein zu ergeben. Don Pedro de Bolea und Don Antonio Ferris erschienen in der Versammlung der Deputierten, um im eigenen Namen und in dem Don Fernandos d'Aragon, Don Martins de La Nuza, Don Martins de Bolea, Don Juans Coscon, Don Felipes de Castro, Don Diegos de Heredia, Don Manuels de Lope und mehrerer anderer ihr Verlangen auszudrücken, dem König zu dienen und die Befriedung des Landes zu fördern. Als die von Anfang an Gemäßigten oder Indifferenten in dem gemachten Vorschlag einen bequemen Ausweg sahen, sich aus ihrer Verlegenheit zu helfen, so wurden die Heftigeren, die erst durch ihre Gewalttat gegen Almenara die Sache so schlimm gemacht hatten, jetzt über die weiteren Folgen ihrer Schritte besorgt, und wünschten um jeden Preis ihren Frieden zu machen. Sie versuchten sogar, den Perez zu überreden, daß er am besten tue, dem Privilegium der Manifestation zu entsagen und sich freiwillig der Inquisition zu stellen, um sich dadurch Mitleid und Schonung zu verdienen, während außerdem seine Freunde sich alles verderben würden, ohne ihm helfen zu können.

Der Escorial in Madrid
Perez hütete sich wohl, diesem Rate zu folgen. »Niemand, der mich liebt«, erwiderte er, »kann mir ihn im Ernste geben. Midi der Inquisition überliefern, hieße den Verlust meines Lehens und meiner Ehre vollenden. Molina, der dort sitzt, ist mein Todfeind und würde gern sein eigenes Blut vergießen, um das meine, zu trinken, so verlangt er danach. Wenn nicht er dort wäre, so würde ich mich schon längst in die Hände Morejons gegeben haben, der meine Angelegenheit leidenschaftslos untersuchen und beurteilen würde. Möge der Kardinal von Toledo ihn und zwei andere unparteiische Richter bestimmen, ich werde mich gern vor ihnen stellen, wo sie mich dann strafen mögen, wenn ich ein Ketzer bin. Gott weiß wohl, daß ich es nicht bin, daß ich es niemals gewesen. Nicht die Gerechtigkeit fliehe ich, sondern die Leidenschaft der Richter, die mich stets verfolgt hat.« Die fortwährenden Aufregungen und der Anblick der neuen Gefahr, die ihn bedrohte, hatten ihm Fieber zugezogen; aber selbst das konnte ihn nicht brechen, und er entwickelte um so größere Tätigkeit, Entschlossenheit und Geschicklichkeit, je verzweifelter seine Lage schien. Er mußte jetzt selbst die Rolle des Agitators übernehmen, die er bis dahin seinen Freunden gelassen, und verfaßte und verbreitete mehrere Flugschriften, die die Aufregung des Volkes unterhalten und es für einen neuen Aufstand stimmen sollten. Die Gewalttätigkeit der Inquisitoren, die Schwäche des Großrichters, die Pflichtwidrigkeit der Rechtsgelehrten, die Ungesetzlichkeit ihrer Entscheidung, das Alter der Fueros im Gegensatze zu der Neuheit der Einführung der Inquisition, die Notwendigkeit, jene bei dieser Gelegenheit zu verteidigen, um sie nicht für immer zu verlieren, bildeten die Themen dieser kleinen Schriften, die er unter den wechselnden Formen des Dialogs, der Erörterung, des Spottes, der Ansprache, an das Volk richtete, das sie mit Begier las. Gleichzeitig beeilte er sich auch, dem Tribunal des Großrichters eine Widerlegung der Entscheidung der Juristen zu übergeben, und erneuerte seine Berufung auf diese Widerlegung, als er auf die erste Eingabe keine Antwort erhielt. Er hob dabei wohl mit Grund hervor, daß man zur Entscheidung der schwebenden Frage vor allem den Vertrag, der bei Einführung der Inquisition in Aragonien zwischen dieser und dem Königreich geschlossen worden, vergleichen sowie einen Beschluß der Cortes von 1585 berücksichtigen müsse, der jeden Eingriff der Inquisition in die Fueros oder in die Rechte einzelner an den Richter gewiesen haben sollte.
Aber der Großrichter und seine Assessoren blieben gegen alle Bitten und Vorstellungen des Perez taub. Sie hatten ihre Partie ergriffen und setzten alles in Bereitschaft, ihn ohne Störung und Gefahr nach Aljaferia zu schaffen. Unter diesen Umständen dachte Perez an nichts, als wie er auch aus dem Gefängnis der Manifestados entfliehen könne. Er verabredete den Fluchtplan mit Gil de Mesa, Don Martin de La Nuza, Thomas de Rueda, Christoval Frontin, Francisco de Ayerbe, Dyonisio Perez de San Juan und Juan de Aynsa, die ihm treu geblieben waren. Mit Hilfe einer Feile, die sie ihm verschafften, feilte er drei Nächte hindurch an dem Gitter seines Fensters und durfte in der nächsten Nacht hoffen, seinem Kerker entrinnen zu können, als er mitten in seinen Vorbereitungen zur Flucht überrascht und in einem anderen Teile des Gefängnisses in engere Haft gebracht wurde. Der treulose Basante, den er noch immer für seinen Freund hielt, hatte die Sache vier Jesuiten erzählt, die ihn veranlaßt hatten, die Inquisitoren zu benachrichtigen, die darauf den Großrichter von dem Fluchtplan in Kenntnis setzten.
Perez schien jetzt den Inquisitoren und dem König preisgegeben. Der König hatte sich alle Mühe gegeben, die Personen, die in Aragonien auf die Sache Einfluß haben konnten, bei guter Stimmung zu erhalten, und hatte die gnädigsten Schreiben an Männer erlassen, denen er später den Kopf abschlagen ließ. Der Vizekönig hatte die beste Hoffnung, daß die Auslieferung in aller Ruhe von statten gehen würde. Am 23. September erließen die Inquisitoren eine neue Requisition, bei der die das Manifestationsrecht gefährdende Stelle weggelassen war, während sie doch ein faktisches Hinwegsetzen über dieses begehrte. Sie wurde am Morgen des 24. zwischen 10 und 11 durch den Sekretär Lanceman de Sola dem von seinen Assessoren umgebenen Großrichter eingehändigt. Dieser berief sogleich die Deputierten der Reichsstände und die Geschworenen der Stadt zu einer Beratung, in der die Auslieferung der Gefangenen einmütig beschlossen ward, welcher Beschluß darauf in einer öffentlichen Sitzung des Tribunals eine solenne Bekräftigung erhielt, wobei zugleich das anwesende Publikum zur seiner Unterstützung aufgefordert ward. Hierauf setzte sich ein stattlicher Zug in Bewegung. Voran marschierte eine Abteilung Arkebusiere. Dann folgten die Stabträger des obersten Gerichtshofes, der Assessor Claveria, die Stabträger des beständigen Ausschusses, zwei Deputierte des letzteren, die Stabträger des Magistrats, ein Geschworener des Rates, und den Schluß machte der Gouverneur mit der reitenden Garde. So zogen sie zu der Wohnung des Vizekönigs, wo sich die Räte des letzteren, der Vorsteher der königlichen Kanzlei, der Herzog von Villa-Hermosa, die Grafen Aranda, Sastago, Morata und viele Herren vom hohen Adel und der Ritterschaft, alle bewaffnet und von ihren Lehensleuten umgeben, ihnen anschlossen. In so imponierender Stärke und Ausrüstung wendete sich der Zug nach dem Marktplatze, der wie die Hauptstraßen der Stadt schon seit 3 Uhr früh von Truppen besetzt war. Hier angelangt, verfügten sich der Assessor Claveria, der Deputierte Miguel Turlan und der Ratsgeschworene Inigo Bucle Metelin in das Gefängnis, um Perez und Mayorini dem Alguazil der Inquisition zu überantworten.
Jetzt schien Perez verloren, und doch sollte eben jetzt die Wendung eintreten, die seine Befreiung aus der Gewalt seiner Verfolger, zugleich aber freilich die schließliche Vernichtung der aragonischen Freiheiten bewirkte. Perez selbst war nicht ohne Hoffnung. Mayorini, der sich mit Sterndeuterei abgab, hatte ihm angekündigt, daß ihre Widerwärtigkeiten im Vollmonde des Septembers endigen würden, und zu besserem Troste hatte ihm Gil de Mesa noch in der vorhergehenden Nacht geschrieben: er solle keine Furcht haben und auf den Beistand seiner Freunde vertrauen. Dieser unerschrockene Aragonese hatte das erkaltete Feuer und den wankenden Mut der alten Parteigänger des Perez in neues Leben gerufen. Er selbst war zu allem entschlossen. Noch wenige Tage vorher sagte er zu Basante, dem sie also noch immer trauten: »Ich schwöre zu Gott, daß, wenn die ganze Welt den Perez verließe, ich ihn nicht verlassen werde; ich werde auf den Platz gehen, mich mit allen zu messen, und wenn ihrer Hunderttausende wären, und ich werde mich in seinem Dienste opfern und sterben, damit ihm sein Recht werde. Ich werde ihm, wie er mir geheißen, lieber das Leben nehmen, als ihn in den Händen der Inquisition sehen.« Dann verbreitete er sich über die Aussichten des Gelingens seiner Pläne, wobei er namentlich auf den Beistand Don Martins de La Nuza, Don Diegos de Heredia und Don Juans de Torrellas, der abwesend war, aber Mannschaften schicken wollte, sowie darauf rechnete, daß, wenn sie nur einmal losbrächen, das ganze Gefolge der großen Herren für sie Partei nehmen würde. So wurde es auch Punkt für Punkt. Am Morgen des 24. September hatten neben den Anstalten der Autoritäten auch die Bewegungsmänner ihre Anstalten getroffen und sich mit einer Schar entschlossener Dienstleute (lacayos) in den Häusern Don Juans de Torellas und Don Diegos de Heredia bereitgestellt. In demselben Augenblick, in dem man Perez Fußeisen anlegte, brach Don Martin de La Nuza, ein Schild am Arm und das Schwert in der Hand, an der Spitze einer bewaffneten Schar, die durch sich anschließende Leute aus dem Volke anwuchs, aus Torrellas Hause, ließ auf die Soldaten, die den Ausgang der großen Straße bewachten, schießen, drängte sie zurück und rückte durch das Tor von Toledo auf den Marktplatz. Hier waren ihm Gil de Mesa und Francisco de Ayerbe bereits um einige Augenblicke zuvorgekommen, indem sie, Musketen in den Händen, von mit Büchsen bewaffneten Dienstleuten umgeben und vom Volke unterstützt, im Sturmschritt die Straße de la Albarderia durchschnitten hatten und unter dem Rufe »Freiheit! Freiheit!« auf dem Platze erschienen waren. Von zwei Seiten angegriffen, hatten die Truppen des Gouverneurs und des Vizekönigs die Flucht ergriffen und die Aufständischen im Besitze des Platzes gelassen. Der Vizekönig, die Richter und die Großen in seiner Begleitung hatten sich eilends in ein Haus verschlossen, das aber von dem Volk in Brand gesteckt wurde, so daß sie sich nur dadurch retten konnten, daß sie die Hinterwand durchbrachen, um in die befestigte Wohnung des Herzogs von Villa-Hermosa zu gelangen. Die um Perez beschäftigten Beamten wurden von Schrecken ergriffen, verließen ihn und flohen über die Dächer in den Palast des Großrichters. Die siegreichen Aufständischen erbrachen nun die Türen des Gefängnisses, befreiten den Perez und trugen ihn im Triumph in das Haus des Don Diego de Heredia. Hier stieg er sogleich mit Gil de Mesa, Francisco de Ayerbe und zwei lacayos zu Pferde und verließ Saragossa durch das Tor von Santa-Engracia, während eine Masse Volkes ihn eine Viertelmeile weit unter Zurufen und Glückwünschen begleitete. Er wendete sich dem Gebirge zu, hielt erst nach acht Meilen Weges an und behielt dann bloß seinen treuen Gil de Mesa bei sich. Nun hielt er sich einige Tage lang in den Bergen verborgen, ging bloß des Nachts heraus, sich etwas Wasser zu suchen, lebte von ein wenig Brot, das er mitgebracht, und erwartete einen günstigen Augenblick, um über den Paß von Ronceval die Pyrenäen zu überschreiten. Da er aber erfuhr, daß die Leute des Gouverneurs ihm nachspürten, so kehrte er, auf den Rat des Don Martin de La Nuza verkleidet nach Saragossa zurück, wo er am 20. Oktober ankam und in dem Hause des genannten Edelmannes versteckt blieb.
Denn was immer für ausschweifende Pläne man ihm zugeschrieben, die Sachlage war nicht danach, daß er als Haupt einer bewaffneten Opposition gegen den König hätte auftreten können, ungeachtet es zu einem Kampfe zwischen dem König und Saragossa oder doch zu dem Anfange und Anscheine eines solchen kam. Der Aufstand vom 24. September hatte sich gegen 5 Uhr des Abends gelegt. Als hätte es sich bloß um Perez gehandelt – und für Gil de Mesa mochte es sich in der Tat am wesentlichsten um diesen handeln –, begaben sich die Teilnehmer des Aufstandes wieder zur Ruhe, sobald sie wußten, daß Perez befreit und entflohen sei. In der folgenden Nacht durchzogen noch einige Haufen die Stadt und ließen von Zeit zu Zeit den Freiheitsruf erschallen. Sonst schien alles zur Ordnung zurückgekehrt, und die Autoritäten dachten nur daran, den König zu begütigen. Der Vizekönig berichtete ihm von den Maßregeln, die man zur Verhütung eines Tumultes ergriffen gehabt, und von den bestandenen Gefahren. Der Ausschuß dachte an eine nach Madrid zu sendende Deputation. Der König ließ keinen Unwillen merken und schien zu keiner Strenge geneigt. Er erklärte sich bereit, die Deputation zu empfangen, und versicherte, sie mit Vergnügen anhören zu wollen. Dem Vizekönig sprach er Anerkennung, Lob und Dank aus (1. Oktober 1591). Der alte heuchlerische Tyrann hatte jedoch ganz anderes im Sinne. Er hielt jetzt den Augenblick gekommen, wahr zu machen, was seine Urgroßmutter Isabella einst gesagt: »Mein größter Wunsch ist, daß die Aragonesen sich empören, um Gelegenheit zu haben, ihre Fueros zu vernichten.« Während er die aragonesischen Deputierten nicht ungnädig aufnahm, verfügte er die Bildung einer castilischen Armee, die sich zu Agreda, an der Grenze Aragoniens, zusammenzog und deren Befehl dem Don Alfonso de Vargas vertraut ward, einem General von nicht hoher Herkunft, der noch keine Verwandtschaften in Aragonien hatte. Die Ansammlung castilischer Truppen in solcher Nähe beunruhigte die Aragonesen, und am 27. Oktober begaben sich Don Diego Fernandez de Heredia, Don; Pedro de Bolea, Don Miguel de Sese, Don Balthasar de Gurrea, Don Juan d'Aragon, Don Juan de Moncayo, Don Juan Augustin, Don Martin de La Nuza, Don Manuel Lope, Christoval Frontin und mehrere andere zu dem beständigen Ausschuß und forderten ihn auf, in Gemäßheit des Fuero von 1300 für die Verteidigung des Königreiches zu sorgen und in Ausführung des Fuero von 1361 Vargas und seine Soldaten mit Todesstrafe zu bedrohen, wenn sie die Grenze zu überschreiten wagten. Die Deputierten beratschlagten hierauf über die sie bedrohende Gefahr und über die Mittel, ihr zu entgehen. Sie riefen die Mitwirkung aller Städte Aragoniens an und verlangten von den beständigen Ausschüssen des Königreiches Valencia und des Fürstentums Katalonien den Beistand, der in den Verträgen zwischen den drei Ländern für den Fall eines Einfalles in eines derselben festgestellt war. Gleichzeitig schrieben sie an den König (28. und 29. Oktober), stellten ihm vor, daß der Eintritt kastilischer Truppen auf ihr Gebiet den Fueros zuwider sei und gaben zu erkennen, daß sie verpflichtet sein würden, sich einem solchen offen zu widersetzen.
Die Antwort des Königs vom 2. November war zwar immer noch voll Verstellung, ließ aber doch Beunruhigendes durchblicken. Die Armee komme nicht, um irgendeine Staatsgewalt auszuüben, sondern ziehe nach Frankreich und – hier kam der hinkende Bote – werde bloß haltmachen, um der Gerechtigkeit Leben und Kraft zu geben, damit sie, in den Händen von nach der Verfassung des Königreiches kompetenten Dienern des Königs ihren Lauf haben könne. Indem sie die Frage erörtert hätten, ob die Armee komme, um eine Staatsgewalt auszuüben und ein Übel zu erzeugen, hätten sie sich vergangen. Dieses Vorgehen sei noch größer von Seiten derer, die sich solche Sachen einredeten und auf so leeren Grund hin Vorstellungen und Forderungen erhöben und in dem allen ein sehr pflichtwidriges Mißtrauen zeigten. Die Lügen einiger Menschen und der offenbare Druck, in dem sie alle anderen hielten, hätten ihn verpflichtet, zu dem Mittel zu greifen, das allein helfen könne. Er versicherte, daß er dieses Mittel mit Mäßigung anwenden werde und schien nur die Hauptschuldigen von seiner Milde auszuschließen. Er kündigte die baldige Ankunft seines Kommissars Don Francisco de Borgia Marquis de Lombay an, der seine Absichten noch näher darlegen würde und machte den Deputierten einstweilen zur Pflicht, sich nicht zu anarchischen Gedanken hinreißen zu lassen, die geeigneter wären, das ganze Königreich über den Haufen zu stürzen, als die Herstellung eines Rechtes zu erwirken, das weder verletzt noch bedroht sei. »Es ist stets«, so hieß es am Schluß, »mein Wille gewesen und ist es noch, die Fueros aufrechtzuhalten, alle nur mögliche Güte zu betätigen und Euch durch die Wahrung des Friedens im Königreich und durch die fortwährende Dauer einer Eintracht zu beglücken, welche geeignet ist, meinen Untertanen den guten Ruf und Namen zu erhalten, deren sie sich erfreuen. Da ich keinen anderen Wunsch habe, so würde es für die, die sich meinem Willen nicht gemäß halten wollten, eine schwere Anklage und Verschuldung sein. Was Euch betrifft, so werdet Ihr Euch demgemäß verhalten und dem Gesagten entsprechen, damit denen von keiner Seite eine Entschuldigung bleibe, die sich, während sie wissen, was ich gesagt habe, freiwillig für ihr Verderben entscheiden.«
Möglich, daß, wenn die Vertreter Aragoniens sich ruhig gefügt hätten, der König sich begnügt hätte, die hauptsächlichsten Führer des Aufstandes zu verfolgen und vielleicht den Anspruch der Inquisition etwa auf dem Fuße des vorher getroffenen Vergleiches festzustellen. Möglich freilich auch, daß er die Anwesenheit eines kastilischen Heeres in Aragonien benutzt hätte, die Änderung der Verfassung durchzusetzen, die er wünschte, und daß jene Fügsamkeit nur den Vorstehern des Volkes persönlich genutzt hätte. Wie dem auch sei, die letzteren trauten denn noch den Versicherungen des Königs, die mit einer offenbaren, nur schlecht bemäntelten Verletzung der Fueros verbunden waren, nicht, hielten sich vielmehr nun verpflichtet, genau nach Maßgabe der letzteren zu verfahren, mußten aber freilich erfahren, daß die Bedingungen, unter denen diese entstehen und sich erproben konnten, nicht mehr bestanden. Nachdem sie 13 Rechtsgelehrte befragt und zwölf davon erklärt hatten, die Fueros geböten, dem kastilischen Heere Widerstand zu leisten, proklamierten die Mitglieder des ständigen Ausschusses und die fünf Richter des obersten Gerichtes die Gesetzlichkeit und Notwendigkeit der Verteidigung, verfügten die Bildung eines Heeres, ernannten den Großrichter zu dessen Befehlshaber, wie das schon in seinem Amte lag und bezeichneten Don Martin de La Nuza als seinen Stellvertreter. Es wurden Waffen verteilt und aus den festen Schlössern des Herzogs von Villa-Hermosa Geschütze entnommen. Vier Boten und Notare der Cortes und des Großrichters erschienen bei Vargas, um ihm anzuzeigen, daß er der Todesstrafe verfallen sei, wenn er das Gebiet des Königreiches verletze. Vargas hörte sie ruhig an und entließ sie in Frieden, indem er nur entgegnete, daß er sein Recht in Saragossa begründen werde, überschritt aber ohne weiteres die Grenze an der Spitze von 10.000 Mann Fußvolk, 1500 Reitern und zahlreicher Artillerie.
Die Verteidigungsmittel ergaben sich so völlig unzureichend, daß dadurch auch der Mut und die Entschlossenheit der Verteidiger gelähmt schienen, durch welche im Notfall auch die nötigen Mittel zu beschaffen gewesen wären. Weder aus Valencia noch aus Katalonien kam der erwartete Beistand und selbst in ganz Aragonien erhoben sich nur noch zwei Städte, Teruel und Albaraccin, für die Sache, die Saragossa im gemeinsamen Interesse ergriffen hatte. War in der Tat der alte Mut und Freiheitssinn in den Argonesen erloschen, seit sie aufgehört hatten, einen selbständigen Staat zu bilden, der seine Regierung ganz und vollständig in seiner Mitte trug? Oder ließ sich die Mehrzahl von den trügerischen Versicherungen des Königs täuschen, handelte in der Meinung, sein Einschreiten werde nur Teilnehmern gelten, die sich das selbst zugezogen hätten und ahnte nicht, daß alle zu büßen haben würden, was einzelne begonnen? Saragossa und die in ihm versammelten Autoritäten blieben im wesentlichen allein und auch Saragossa bewährte in dieser Sache nicht entfernt die Entschlossenheit und Ausdauer, durch die es sich in unserem Jahrhunderte Bewunderung verdient hat. Wohl ließ Don Juan de la Nuza die Sturmglocke läuten, entfaltete das Banner St. Georgs, rückte Vargas entgegen und nahm drei Meilen von dem kastilischen Heere Stellung. Es entging ihm aber nicht, daß sein Heer weder zahlreich noch kriegerisch genug war, um Vargas den Weg zu sperren. In diesem Gefühl ergriff er eine halbe, schwache Maßregel, bei der er nur an seine persönliche Sicherheit dachte und auch diese nicht recht bedachte. Er verließ das Heer und zog sich in eines seiner Schlösser zurück. Sein Stellvertreter und der ihm beigegebene Geschworene des Rates brachten gleichfalls ihre Personen in vermeintliche Sicherheit. Wie ihre Soldaten sich ohne Führer sahen, wichen sie in Unordnung auf Saragossa zurück und auch in dieses zog Vargas ohne Widerstand zu finden am 12. November ein. Tags vorher hatte Perez dasselbe verlassen, um den Weg zum Exil, nun seiner einzigen Rettung, zu suchen.
Noch immer verstellte sich der König, wahrscheinlich um jeden Gedanken an ferneren Widerstand ersterben und seine Gewalt sich erst vollständig befestigen zu lassen. Vargas überließ sich keinerlei Strenge. Er beschränkte sich darauf, die vornehmsten Plätze und Straßen Saragossas mit seinen Truppen und seinen Geschützen zu besetzen. Der König schien die besiegten Aragonesen schonen und sich mit ihnen vergleichen zu wollen. Der von ihm ernannte Kommissär Don Francisco de Borgia traf am 28. November zu Saragossa ein und eröffnete Konferenzen mit den Deputierten des Landes. Da der Vizekönig Don Jaime Ximeno, Bischof von Teruel, bei Ausbruch des Krieges in sein Bistum zurückgekehrt war, so war seine Stelle anderweit zu besetzen. Der König wählte am 6. Dezember ein Mitglied des aragonischen hohen Adels zu dieser Würde, den Grafen Morata, der zwar in der letzten Zeit die Sache des Königs mit Eifer ergriffen, am 24. Mai aber sich den Volkswünschen sehr günstig gezeigt hatte. Seine Ernennung wurde als ein Pfand der Versöhnung betrachtet und beruhigte einen Teil von denen, die Saragossa verlassen hatten, so daß nicht wenige zurückkehrten. Die Deputierten hielten noch immer mit Starrheit an ihren alten Rechten, ohne vollständig zu erkennen, wie wesentlich der erhobene und erfolglose Widerstand die Sachlage geändert. Statt in Unterhandlungen einzutreten, bei denen sie versuchen konnten, wenigstens so viel als möglich zu retten, erklärten sie, nicht beraten zu können, solange fremde Truppen im Königreich wären. Da sie aber gleichwohl fühlten, daß sie ohne Macht seien und von der Gnade des Königs abhingen, wendeten sie sich (12. Dezember) in einem sehr demütigen Schreiben an den Prinzen von Asturien, um ihn zum Vermittler zwischen ihnen und dem König zu gewinnen. Sie beschworen ihn, im Namen des ganzen Königreiches, das in die Fehltritte einer sehr kleinen Zahl verwickelt worden, ihnen die Gnade des Königs wieder zu verschaffen und schlossen mit den Worten: »Wir legen unsere Rettung in Ihre Hände und beschwören Eure Hoheit, es nicht zu verschmähen, dieses neue Anrecht an uns zu erwerben. Wir werden Ihnen künftig durch die Gnade gehören, wie wir Ihnen bereits durch das Recht und die Natur gehören. Möge unser Herr die erlauchteste Person Eurer Hoheit schützen, wie das die Christenheit braucht.«
Philipp II. war an sich nicht geneigt, sich von seinem Thronfolger beeinflussen zu lassen, und die demütige Sprache der Aragonesen ermutigte ihn mehr zu seinem Vorhaben, als daß sie ihn gerührt und erweicht hätte. Er hatte nun die Überzeugung erlangt, daß die Aragonesen ihm keinen Widerstand leisten würden, den er irgend zu fürchten brauche. Nun ließ er plötzlich die Maske fallen und es begann eine Reihe von Bluttaten, denen man nur die Absicht zuschreiben kann, die Aragonesen dergestalt einzuschüchtern, daß sie sich willenlos dem König hingäben. Am 18. Dezember kam ein neuer Kommissär des Königs zu Saragossa an, Don Gomez Velasquez, Stallmeister desselben Prinzen von Asturien, dessen Vermittlung die Aragonesen angerufen. Schon am Morgen nach seiner Ankunft wurden der Herzog von Villa-Hermosa, der von den alten Königen des Landes abstammte, der Graf Aranda und der Großrichter Don Juan de La Nuza zu! ihm berufen und sogleich bei ihm festgehalten. Das erste Opfer ward der Großrichter, so nachgiebig derselbe sich auch gegen die Wünsche des Königs gezeigt hatte. Aber es sollte in seiner Person die Unabhängigkeit Aragoniens und sein Widerstandsrecht getroffen werden. Sowie er verhaftet worden, kündigte man ihm an, daß er sich zum Tode vorzubereiten habe. »Und wer ist der Richter«, frug er bestürzt, »der das Urteil gefällt hat?« »Der König«, erwiderte man. Als er das Urteil zu sehen verlangte, zeigte man ihm einige eigenhändige Zeilen Philipps II. folgenden Inhaltes: »Ihr werdet Don Juan de La Nuza, Großrichter von Aragonien, festnehmen und Ihr werdet ihm den Kopf abschlagen lassen. Ich will seinen Tod gleichzeitig wie seine Verhaftung erfahren.« Konnte ein orientalischer Despot willkürlicher verfügen? Vergebens berief sich der Unglückliche darauf, daß niemand ihn richten oder verurteilen könne als die ganzen Cortes, der König und das Land. Er wurde ins Gefängnis gebracht und den Tröstungen der Jesuiten überlassen. In der folgenden Nacht wurde ein Schaffot auf dem Marktplatz aufgeschlagen, und am nächsten Morgen bestieg es der letzte der unabhängigen Großrichter Aragoniens, schwarz gekleidet, mit Fesseln an den Füßen. Nachdem er kniend sein Gebet verrichtet, schlug ihm der Scharfrichter in Gegenwart seiner bestürzten Landsleute den Kopf ab. Unter dem Schaffot war folgende Schrift angebracht:
So ist die Gerechtigkeit, welche der König, unser Herr, diesem Edelmann widerfahren zu lassen befiehlt, weil er Verräter gewesen, die Waffen gegen Seine Majestät, seinen König und angeborenen Herrn, ergriffen, mit Banner, Fahnen und Kriegszeug gegen ihn marschiert ist und unter dem Vorwand einer angeblichen Freiheit diese Stadt und die anderen Städte dieses Königreiches und der benachbarten Königreiche in Unruhe und Aufstand gebracht hat. Er befiehlt, ihm den Kopf abzuschlagen, sein Vermögen zu konfiszieren, seine Häuser und seine Schlösser zu schleifen und verurteilt ihn noch weiter zu allen gegen seinesgleichen verhängten Strafen.«
Seit 141 Jahren, seit der König Alfonso V. 1450 Ferrer de La Nuza mit dem Amte beliehen, war die Würde des Großrichters von derselben Familie bekleidet worden, deren Sprößling jetzt die Unverträglichkeit seiner Stellung mit den veränderten Verhältnissen und seine eigene Schwäche und Halbheit durch den Tod büßte. Perez sagte darüber: »Mit ihm wurde die Gerechtigkeit zum Tode verurteilt und hingerichtet.« Aber bei seiner Hinrichtung blieb man nicht stehen. Der Herzog von Villa-Hermosa, der weder bei dem Aufstand am 24. Mai, noch bei dem am 29. September beteiligt gewesen, am letzteren Tage sich vielmehr eifrig für die Sache des Königs gezeigt, wohl aber nach seiner verfassungsmäßigen Pflicht an dem Widerstandsversuch teilgenommen hatte, wie die berechtigten Autoritäten den Widerstand proklamiert hatten, wurde unter neuer Verletzung der Fueros nach Kastilien gebracht und zu Burgos enthauptet. Der Graf von Aranda, der nach Alaejos geschafft worden war, entging dem Schaffot nur durch den Tod im Gefängnis. Die Barone von Barbolis und von Purroy aus den edlen Häusern Heredia und Luna wurden zu Saragossa enthauptet. Weiter verurteilte der mit dieser Spottjustiz beauftragte Mailänder Senator Dr. Lanzi zum Tode: Don Martin de La Nuza, Baron von Biescas, dem es jedoch gelang, nach Frankreich zu entkommen, Don Miguel Gurrea, einen Vetter des Herzogs von Villa-Hermosa, Don Martin de Bolea, Baron von Sietamo, Don Antonio Feriz de Lizana, Don Juan d'Aragon, der Schwager des Grafen Sastago, Francisco Ayerbe, Dionisio Perez de San Juan, mehrere andere Edelleute, viele Arbeiter und Handwerker und selbst den Scharfrichter Juan de Miguel, der von seinem Gehilfen gehenkt wurde. Die Güter der Gerichteten wurden wider die Verfassung konfisziert, ihre Schlösser und Häuser bis zum Boden geschleift. Dann erfolgte eine sogenannte Amnestie (24. Dezember 1592), die aber durch ihre zahlreichen Ausnahmen einer Proskription glich. In diesem Erlaß wurden nach einem salbungsvollen, heuchlerischen Eingang, der von der großen Güte und Milde des Königs und von allen den Gründen handelte, aus denen er sich bewegen lassen, Gnade für Recht zu üben und darunter selbst auf das Beispiel des Herrn hinzuweisen sich nicht entblödete, von der Amnestie ausgenommen: alle Geistliche und Mönche, die an den Unruhen teilgenommen, wofür sie unter die Zucht der Inquisition kommen sollten; alle Rechtsgelehrte, die erklärt hätten, daß man berechtigt sei, die kastilische Armee zurückzutreiben; alle Hauptleute, die an der Spitze ihrer Kompagnien zur Bekämpfung derselben ausgerückt wären; alle Fähnriche, die das Banner gegen sie getragen und außerdem noch 119 Personen, unter denen sich Antonio Perez, Don Juan de Torrellos Bardari, der Schwiegersohn des Grafen Sastago, Don Pedro de Bolea, der Vetter des Grafen. Fuentes, Don Felipe de Castor-Cervellon aus dem Hause der Grafen von Boil, Don Pedro de Sese, Don Juan de Moncayo, Don Louis de Urrea, Don Juan Coscon, Don Manuel Lope, Don Juan Agustin, Don Denis de Eguaras, Gil de Mesa und viele andere Edelleute, Geistliche, Notare, Prokuratoren, Advokaten, Kaufleute Handwerker und Arbeiter befanden. Den meisten glückte es jedoch aus dem Königreich zu entkommen, in das sie wenigstens zu Philipps II. Zeiten zurückzukehren nicht wagen durften.
Die blutige Härte dieser königlichen Willkür war zuletzt doch nur etwas Vorübergehendes und hörte auf, wie der politische Zweck erreicht war, zu dem man sie für nötig gehalten. Nun aber erhob sich zu dauerndem Druck die heuchlerische Grausamkeit der Inquisition, jetzt in unbedingter Sicherheit und mit verschärfter Strenge waltend. In dem Personal trat eine Veränderung ein. Molina de Medrano wurde nach Madrid berufen, um dort den Lohn seines Eifers zu empfangen. Hurtado Mendoca und Morejon wurden von Saragossa entfernt, der erstere, weil er zu mild erschienen, der letztere, weil man ihn wohl gar in Verdacht hatte, dem Perez günstig gesinnt zu sein. An ihre Stelle traten die Lizentiaten Pedro de Zamora und Velarde de la Concha und die Doktoren Moriz de Salazar und Pedro Reves, deren Ergebenheit so unbegrenzt war wie ihre Härte. Sie luden 374 Personen vor ihr Tribunal, in dessen Klauen sie jedoch nur 123 zu bringen vermochten, da die übrigen entweder schon von Dr. Lanzi besorgt worden waren oder die Flucht ergriffen hatten. Von den Gefangenen verurteilten sie 79 zum Tode und sprachen gegen mehrere andere schimpfliche Strafen aus. Perez stand an der Spitze der Verurteilten, nachdem die Inquisatoren über seinen Glauben, seine Sitten, seine Handlungen, seine Pläne, selbst über seine Herkunft Untersuchungen angestellt und Zeugen abgehört hatten. Wie viele Zeugen mögen es gewagt haben, vor der Inquisition etwas anderes auszusagen, als die Inquisitoren wissen wollten? Um dem Perez einen in Spanien sehr empfindlichen Makel anzuhängen und seine Ketzerei dadurch wahrscheinlicher zu machen, daß man ihm einen erblichen Hang zu solcher zuschrieb, suchte der Fiskal der Inquisition zu beweisen, daß er der Urenkel eines bekehrten und wieder abtrünnig gewordenen Juden Antonio Perez de Hariza sei, der zu Calatayud mit seinem Bruder verbrannt worden und verwarf die entgegenstehenden genauen und glaubwürdigen, später durch authentische Urkunden außer Zweifel gesetzten Angaben, die seine adelige Abkunft erhärteten. Das am 7. September 1592 gefällte Urteil wurde am 13. Oktober von dem obersten Inquisitionsgericht zu Madrid bestätigt. Nachdem ausführlich die von Perez in Aragonien erregten Unruhen, die ihm als Staatssekretär zur Last gelegten Pflichtwidrigkeiten, seine als blasphemierend und ungebührlich betrachteten Reden aufgezählt, ihm die Absicht, die Inquisition zu vernichten – eine Absicht, die, wenn er sie gehabt hat, höchst löblich gewesen wäre – sowie die, eine Armee von Lutheranern nach Aragonien kommen zu lassen, beigemessen, seine Schritte einer Hinneigung zu Heinrich IV., der nur als M. de Vendome bezeichnet wurde, zugeschrieben, er widernatürlichen Verbrechens bezüchtigt und zuletzt noch versichert worden, daß er in Frankreich wie ein Ketzer lebe und an dem Gottesdienst der Hugenotten teilnehme, verurteilten ihn die Inquisitoren zum Feuertode, den er – zum Glück für ihn nur in effigie bestehen sollte. Schlimmer, daß seine Kinder und deren Mannesstamm für unfähig erklärt wurden, irgendwelche kirchliche oder weltliche Ämter zu bekleiden. Auch sollten sie kein Gold, Silber, keine Perlen, Edelsteine oder Korallen, keine Seide, keinen Kamelot, kein feines Tuch tragen dürfen usw. Am 20. Oktober wurden die 79 Schlachtopfer jener Mischung von Aberwitz, teuflischer List und Bosheit, die sich in keiner politischen Form so grell findet wie in der hierarchischen, in einem von 8 Uhr früh bis 9 Uhr abends währenden Autodafé verbrannt, dem wohl viele derselben Saragossaner mit regem Anteil zugeschaut haben mögen, die vorher den Kämpfern gegen die Inquisition ihren Beifall zugerufen. Das Bild des Perez figurierte als lächerliche Beigabe in dem schaurigen Zug, mit der Mütze des Verurteilten und einem mit Flammen eingefaßten Sanbenito bekleidet, worauf die Inschrift stand: »Antonio Perez, Exsekretär des Königs, unseres Herrn, gebürtig aus Moreal de Ariza und wohnhaft zu Saragossa, überführter, flüchtiger und rückfälliger Ketzer.« Das Verbrennen des Bildes machte den Beschluß der, wie so vieles in diesen Dingen, auf tiefe geistige und sittliche Beschränktheit berechneten Szene.
Nachdem die unternehmendsten Führer und viele Teilnehmer der Bewegung geschlachtet, verbrannt oder entflohen waren und die fortdauernde offene Gewalt und mehr noch jene finstere, geheime Greuelmacht dumpfe Entmutigung über das Volk verbreitet hatten, führte der König den Plan aus, auf welchen dies alles berechnet gewesen. Er berief die Cortes nach Tarragona, wo er aber dem Gebrauch zuwider nicht selbst den Vorsitz führte, sondern sich durch den Erzbischof von Saragossa, Bobadilla, vertreten ließ. Hier wurden alle die Änderungen an den Fueros, die er verlangte, bewilligt. Er erhielt das Recht, den Großrichter zu entlassen, Kastilier zu Vizekönigen zu ernennen, 9 Richter zu bezeichnen, von denen die Cortes, die bis dahin alle gewählt hatten, nur einen zurückweisen konnten. Der Großrichter wurde ein gewöhnlicher königlicher Beamter. Daß das absolute Veto der einzelnen Mitglieder der Cortes abgeschafft wurde, mochte ganz gut sein und zu verwundern war, daß man es bei Einführung neuer Steuern bestehen ließ. Aljaferia wurde zu einer Zitadelle umgeändert und mit Truppen versehen, die Saragossa in Gehorsam und Furcht halten sollten. Aragonien war eine gewöhnliche spanische Provinz und ward damit in den allgemeinen Sumpf des Verfalles hineingezogen.
Perez, der zu dem allen den Anlaß gegeben, war inzwischen in leidlicher Sicherheit und bewahrte diese, sollte aber sein ferners Leben im Exil, getrennt von den Seinen und von dem Vaterlande, nach dem er sich stets zurücksehnte, in viel vergeblichem Ringen, Mühen und Sorgen verbringen. Nachdem er Saragossa verlassen, hatte er mehrere Tage und Nächte des Novembers unter Felsen oder in Höhlen zugebracht. Dann hatte er sich gegen Sallen, an der äußersten Grenze Aragoniens, gewendet, wo ihn Don Martin de La Nuza in einem alten Schlosse aufnahm. Alles war in Bewegung, ihn zu ergreifen. Die Inquisitoren hatten in alle Dörfer entsprechende Befehle geschickt, und die Soldaten des Vargas durchstreiften die Berge und marschierten gegen Sallen. Trotz dieser äußersten Gefahr entschloß sich Perez sehr schwer, sein Vaterland zu verlassen und hoffte noch immer auf eine unerwartete günstige Wendung. Endlich mußte er sich entscheiden und schickte am 18. November seinen Gil de Mesa nach Pau mit einem Schreiben an die Prinzessin Katharina von Bourbon, worin er um den Schutz dieser Fürstin bat, der ihm auch in ausgedehntester Weise zugesichert ward. Noch ehe er diese Antwort erhalten, mußte er sein Asyl verlassen, da 300 Mann Soldaten in Sallen eingetroffen waren und am Morgen des 24. in dem Schlosse anlangen sollten. In der Nacht vorher überschritt er von zwei Lacayos begleitet, das Gebirge, wobei der Schnee der Pyrenäen zwar seinen Weg erschwerte, zugleich aber ihm als Schutz gegen die Verfolger diente. Am 26. November kam er in Pau an, wo er von der Prinzessin mit einer Herzlichkeit empfangen wurde, an der die Politik so viel Anteil hatte wie das Mitleid.
Philipp II., der hiemit seine Rache vereitelt sah und zugleich den Nachteil fürchtete, den ihm des Perez Enthüllungen in Europa bringen könnten, versuchte jetzt, ihn durch List nach Spanien zurückzulocken. Don Martin de La Nuza hatte, nachdem er Sallen verlassen und sich auf französisches Gebiet begeben hatte, an der Grenze eine Unterredung mit den Führern der Truppe gehabt, welche den Perez verfolgte. Infolge dieser Unterredung begab er sich nach Pau, um Perez von ihrer Seite einen Vergleich vorzuschlagen, zu dessen treuer Erfüllung sie sich in ihrem, des Königs, des Vizekönigs, des Don Alonso de Vargas und der Inquisitoren Namen verpflichteten. Perez erklärte, er werde die Vorschläge gern entgegennehmen, wenn sie bona fide gemacht wären und werde sich ihrem Inhalt gemäß entscheiden. Don Martin kam zwar nicht wieder. Aber am 1. Januar 1592 schrieb Thomas Perez Rueda, der die zweite Flucht des Perez gefördert hatte, an diesen und suchte ihn zu bewegen, sich im Interesse seiner Familie und des Königreiches Aragonien, auf welchem bereits die Hand des Königs zu lasten begann, mit Philipp II. zu verständigen. Perez verlangte in seiner vom 6. Januar datierten Antwort vor allem vorläufige Bürgschaften, namentlich Maßregeln der Milde in betreff seiner Kinder und ihrer Mutter. Der Gang der Dinge in Saragossa war nicht geeignet, sein Mißtrauen zu beschwichtigen, und man mußte die Hoffnung aufgeben, ihn herbeizulocken. Man beschloß nun, ihn in Frankreich zu meucheln. Schon wie er noch in den Pyrenäen war, hatte man zwei wegen Schmuggelei Verurteilten, Antonio Bardari Baron de Concas und Rodrigo de Mur Baron de Pinilla, Begnadigung versprochen, wenn sie den Perez einbrächten. Als er in Frankreich war, versprach man zuerst dem Mayorini, der mit Perez entkommen, dessen Freundschaft für diesen aber erkaltet war, Begnadigung und Geld, wenn er den Perez töte. Mayorini verschwieg die ihm gemachten Anerbietungen 10 Tage lang; endlich aber siegte sein Gewissen und er entdeckte sie seinem alten Freunde in Gegenwart des Don Martin de La Nuza. Man wendete sich nun mit denselben Versprechungen an jenen Gaspard Burces, der einen so wesentlichen Teil an der Gefangennehmung und Ermordung des Marquis von Almenara gehabt hatte. Das Komplott, das wie das erste durch einen navarresischen Adeligen vermittelt worden war, wurde entdeckt und Burces zum Tode verurteilt, jedoch auf Perez' eigene Verwendung begnadigt. Hierauf versuchte man es mit einer schönen, galanten und vornehmen Bearner Dame, einer kühnen Jägerin und Reiterin, der man 10.000 Taler und sechs spanische Pferde anbot, wenn sie nach Pau komme, Beziehungen mit Perez anknüpfe, ihn zu sich einlade und ihn da eines schönen Abends ausliefere oder auf einer Jagdpartie entführen lasse. Die Dame kam in der Tat nach Pau, machte Bekanntschaft mit Perez. Diese Bekanntschaft nahm einen sehr innigen Charakter an, hatte aber nur die Folge, daß die Dame selbst die ganze Sache dem Perez entdeckte, dem sie zugleich ihr Haus und ihr Einkommen zur Verfügung stellte.
Inzwischen genügte die enge Bühne zu Pau, abgesehen davon, daß die Nähe Spaniens ihn hier den Versuchen seiner Feinde besonders aussetzte, dem feurigen und ruhelosen Geist des Perez nicht. Schon am 9. Dezember 1591 hatte er an Heinrich IV. geschrieben, der jedoch erst im Frühjahr 1593 seine Schwester, die Prinzessin Katharina veranlaßte, ihn nach Tours zu bringen. Hier hatte der König mehrere lange Unterredungen mit Perez, die ihn bestimmten, denselben mit einem sehr empfehlenden Schreiben an die Königin Elisabeth von England zu schicken, wohin sich Perez im Sommer 1593 begab und damit Gelegenheit erhielt, im Dienste der beiden großen Gegner Philipps II. gegen diesen zu wirken. In England fand er den Hof in die Parteien Burleighs und Essex' geteilt, während die Königin, wo unter ihrer ganzen Regierung der Parteikampf im Gange war, die Parteien selbst im Gleichgewicht zu halten suchte, übrigens mit ihrer Neigung dem jüngeren Bewerber, in ihrer Politik dem älteren Ratgeber zugewendet war. Burleigh sowohl als die Königin hielten die Zeitlage für dergestalt angetan, daß man recht wohl das gute Einvernehmen mit Frankreich pflegen und dieses für den gemeinsamen Zweck benutzen könne, ohne nötig zu haben, sich sonderlich dabei anzustrengen, während Essex die innigste und tätigste Verbindung mit Frankreich betrieb. Perez schloß sich natürlich bei seiner Ankunft an den letzteren an, mit dem er auch bald in das vertrauteste Verhältnis kam. Beide mochten verwandte Naturen sein, ehrgeizig, ruhelos, genußsüchtig, dem blendenden Schein ergeben, gleichgültig in der Wahl der Mittel. Essex stellte ihn der Königin vor und verschaffte ihm von dieser eine Pension von 130 Pfund, während sie freilich ihre Politik nichts weniger als durch ihn bestimmen ließ, sondern gerade in jener Zeit die Truppen, die sie in die Bretagne geschickt hatte, zurückzog. Er lebte in London als Gast des Earls und nahm an dessen Schwelgereien vollen Anteil. Hier verband er sich auch mit den Brüdern Franz und Anton Bacon, von denen der erstere durch seinen Geist unsterblichen Namens geworden, aber leider bestimmt, durch einige Schwächen des Charakters seinen Ruhm zu trüben, sich, weil Burleigh, obwohl sein Oheim, den talentvollen Neffen, in dem er einen gefährlichen Konkurrenten für seinen eigenen Sohn fürchtete, nicht förderte, an Essex angeschlossen hatte. Dieser nahm sich auch seiner Interessen auf das wärmste an und hatte ihn sogar mit einem Gute in Twickenham beschenkt, mußte aber erleben, daß Bacon, als die Krisis herankam und als er nach schwachen Versuchen, Essex zu retten, das Verderben seines großmütigen Freundes als unausweichlich erkannt hatte, aus Furcht, in seinen Sturz verwickelt zu werden oder doch den eben durch Essex erlangten Fuß bei Hofe zu verlieren, sich zuletzt als Ankläger gegen ihn gebrauchen ließ und diese Aufgabe mit einer Schärfe und Feindseligkeit erfüllte, für die man leider keine bessere Entschuldigung finden kann, als daß Bacon wußte, er gelte für eine Kreatur des Essex und fürchtete, die geringste Schonung, die er demselben bei Erfüllung seines Auftrages beweise, könne ihm eben deshalb zur Schuld gerechnet werden. Dieser Gefahr entging er, verwirkte aber die Achtung aller ehrenhafter Männer, selbst unter den Gegnern des Essex. – Franz Bacon fand viel Interesse an der Unterhaltung mit dem geistreichen und vielerfahrenen Spanier und schloß sich eng an ihn an. Es bezeugt aber den Ruf, in welchem Perez im allgemeinen und abgesehen von der Nachsicht, die ihm die Politik bewies, weil sie ihn brauchen konnte, bei dem englischen Publikum stand, daß die Mutter Bacons über diese Bekanntschaft an ihren älteren Sohn Anton schrieb: »Ich bedaure Euren Bruder, solange er sich nicht selbst bedauert, sondern diesen blutigen Perez, einen stolzen, weltlich gesinnten, verschwenderischen Gesellen, dessen Verkehr mit ihm, wie ich wahrhaftig fürchte, der Herrgott mißbilligt und deshalb Euren Bruder in Ruf sowohl wie in Gesundheit weniger segnet, zum Genossen in Wagen und Bett hat. Ein Elender wie er liebt Euren Bruder nicht anders, als weil er seinen Kredit zu nutzen und auf seine Kosten zu leben gedenkt.« Möglich freilich, daß auf die besorgte Mutter der Einfluß ihres ernsten, soliden, puritanischen Schwagers gewirkt hat und jedenfalls ist Bacon durch Perez nicht zu ausschweifendem Leben verführt worden.
Perez konnte in England zu jener Zeit wenig oder nichts für seinen Auftraggeber tun, benutzte aber seine Muße, um in seinem eigenen Interesse eine Schrift zu verfassen, die er unter dem Titel Relaziones und dem Namen Raphael Peregrino herausgab und in der er mit ungemeiner Kunst den Haß gegen seinen Verfolger zu schärfen, für sich selbst aber zu Wohlwollen und Mitleid zu stimmen suchte, die auch noch in demselben Jahre (1594) in einer Übersetzung in holländischer Sprache erschien. Der Verdruß, den Philipp II. über diesen neuen Angriff empfand, machte sich in einem abermaligen Mordversuche Luft. Zwei Irländer empfingen von dem Gouverneur der Niederlande, dem Grafen Fuentes, den besonderen Auftrag, wurden aber in London festgenommen, gestanden ihre Absicht und wurden zum Tode verurteilt und hingerichtet, worauf ihre Köpfe auf ein Stadttor gepflanzt wurden. Ebensowenig gelang es dem König im Wege der Intrige ein Mißtrauen des englischen Hofes gegen Perez zu erzeugen. Bald darauf ward er von Heinrich IV., der inzwischen (20. Januar 1595) den förmlichen Krieg an Philipp II. erklärt hatte, zurückgerufen. Vorher hatte er noch eine Audienz bei der Königin, die sich sehr gnädig bezeigte und an die er eine französische Denkschrift mit politischen Ratschlägen richtete, sich auch zu einer geheimen Korrespondenz anheischig machte, die nicht recht mit seinen Verpflichtungen gegen Frankreich harmonieren wollte.
In den ersten Tagen des August zu Dieppe angelangt, wurde er von dem Gouverneur mit großer Auszeichnung empfangen und unter einer Bedeckung von 50 Reitern nach Rouen gebracht, wo er ein sehr gnädiges Schreiben des Königs (d.d. Lyon, 26. August) fand, worin ihm freigestellt ward, einstweilen in Rouen zu bleiben, wo der Herzog von Montpensier beauftragt sei, für ihn Sorge zu tragen, oder nach Paris zu kommen, wo der Prinz von Conti, der Herr von Schomberg und die Räte des Königs auch während der Abwesenheit des letzteren sich seiner auf das beste annehmen würden. Zugleich benachrichtigte der König ihn aber mit vielem Bedauern von dem Tode des mit Perez nach Frankreich übergetretenen Don Martin de La Nuza, den, wie es scheint, ein besonderer Unfall hinweggerafft hatte (qui a esté tué par un très-grand malheur). Perez zog es vor, den König in Paris zu erwarten, wo er den schmeichelhaftesten Empfang fand. Man wies ihm ein schönes Gebäude, das dem Herzog von Mercoeur gehört hatte, zur Wohnung an und gab ihm zwei Soldaten bei, welche Tag und Nacht über seine Sicherheit wachen sollten. Solche Vorsichtsmaßregeln schienen auch nötig, denn es war eben wieder ein Komplott gegen Perez entdeckt worden. Von Spanien aus waren der Staatssekretär Villeroi und der Marschall de La Force benachrichtigt worden, daß derselbe Schmugglerbaron von Pinilla, der dem Perez schon in den Pyrenäen nachgestellt hatte, mit zwei Begleitern, deren einer ein als Laie verkleideter biscayischer Mönch war, auf dem Wege seien, um Perez zu töten. In der Tat wurde Pinilla, der bereits 600 Dukaten zur Ausführung dieses Streiches erhalten hatte, mit einem seiner Mordgehilfen in Paris ergriffen. Dem Mönch gelang es, zu entkommen. Man fand bei Pinilla zwei Pistolen, deren jede mit zwei Kugeln geladen war. Er hatte alle Anstalten getroffen, um nach verrichteter Tat die Flucht ergreifen zu können. Auf der Folter gestand er alles – was freilich kein Beweis war, wenn nicht sonst ausreichende Momente dazugekommen sind – und wurde einige Monate später (19. Januar 1596) auf dem Grèveplatz hingerichtet.
Heinrich IV. war inzwischen in Paris angelangt, wo er vielfach mit Perez konferierte. Es waren wesentliche Veränderungen in den politischen Stellungen eingetreten. Philipp II. mußte die Hoffnung aufgeben, den Bourbon von dem französischen Throne zu verdrängen, stellte sich nun aber die einfachere Aufgabe, Frankreich zu bekämpfen, um es zu schwächen und Eroberungen über dieses zu machen. Während der Bürgerkrieg sich zu Ende neigte, ein Bezirk, ein Großer nach dem anderen sich unterwarf, griffen die Spanier die Picardie von den Niederlanden und Burgund von der Freigrafschaft aus an, und wenn auch Heinrich IV. bei Fontaine-Française (5. Juni 1595) den Connetable Velasco schlug, so fiel doch in der Picardie ein Platz nach dem anderen in die Hände des Grafen Fuentes. Unter diesen Umständen war dem König sehr viel an wirksamer Unterstützung durch die Königin Elisabeth gelegen, die sich aber, obwohl die Fortschritte der Spanier in Frankreich sie auch beunruhigten, fortwährend karg erwies. In der Tat war ihr ein Erstarken Frankreichs kaum weniger unangenehm wie eine Übermacht Spaniens. Seit Heinrich IV. zur römischen Kirche zurückgekehrt war, verlor ihr Bündnis mit ihm den protestantischen Nimbus. Vergebens schickte der König den Requêtenmeister Chevalier nach London und bat um 4000 Mann Fußvolk, die die Stadt Paris bezahlen wolle. Die Königin erklärte sich nur bereit, Calais, Dieppe, Boulogne und andere Küstenplätze zu besetzen, nicht aber Truppen geradezu zur Verfügung des Königs zu stellen. In dieser Sachlage richtete Essex an Perez ein charakteristisches, wohlberechnetes, mit einem wichtigen avis au lecteur versehenes lateinisches Schreiben, worin es hieß: »Wir sind in Sorge über die französischen Angelegenheiten, wir, die Sie in allen Dingen so lässig kennen. Wenn Ihr, Ihr in Frankreich, sage ich, uns kenntet, so würdet ihr die Geschäfte nicht so mit uns verhandeln, wie Ihr tut. Ja, wenn Ihr die menschliche Natur erwöget, so würdet Ihr uns nicht so nichtige Gesandtschaften schicken. Denn was bewegt die Menschen als Begierde und Schrecken? Mögen Freigebige Wohltaten spenden, bei uns ist alles käuflich. Jene ahmen Gott nach, wir die Wucherer. Wir verstehen es, den demütig Bittenden beständig abzuschlagen. Selbst Juno (Elisabeth) ist, nachdem sie oft umsonst um Hilfe gefleht, endlich in den Ausruf ausgebrochen: Flectere si nequeo superos, Acheronta movebo, auf jenen spanischen Pluto anspielend, der den Namen von seinen Schätzen hat! Doch schweige, Feder, und schweige, Antonio, denn ich scheine die Dichter zu viel gelesen zu haben.«
Heinrich IV. verstand den Wink, der in dem oben erwähnten Ausruf der Juno gegeben war. Er ließ der Königin erklären: wenn sie ihn verließe, so werde sie ihn nötigen, mit denen zu unterhandeln, die ihren gemeinsamen Ruin bezweckt hätten. In besonderer Mission schickte er ihr den de Lomenie, um ihr anzuzeigen, daß der Papst ihm durch eigens zugesendete Kardinäle einen ehrenvollen Frieden mit Spanien vorgeschlagen habe, und daß er verhindert sein würde, diesen abzulehnen, wenn die Königin ihn nicht zur Fortsetzung des Krieges unterstütze. Das alles jedoch beunruhigte und verdroß zwar die Königin, machte sie aber nur noch zäher, als sie gewesen war. Sie zählte in einer offensiblen Depesche alle die Dienste auf, die sie dem König geleistet, entschuldigte ihre derzeitige Untätigkeit mit der Notwendigkeit, für ihre eigene Sicherheit in England zu sorgen, das von den Spaniern und von einem irischen Aufstande bedroht sei, erklärte, daß sie nicht glauben könne, der König werde einen Separatfrieden schließen, fügte aber hinzu: wenn dies doch geschähe, so werde sie sich Gott anheimstellen, der sie zu schützen wissen werde. Jede weitere Hilfe als die schon angebotene schlug sie ab. Als nun jedoch der König kurzweg erklärte: er sei außerstande, die Last des Krieges allein zu tragen, und wenn er genötigt sein sollte, einen anderen Weg einzuschlagen, so werde die Schuld nicht an ihm liegen, und die Königin werde für alle Entschuldigungen und Rechtfertigungen später nur Ursache zur Sorge haben, wurde die Königin doch bedenklich und schickte gegen Ende Dezember 1595 Sir Henry Unton an den König. Es war dies allerdings eine dem König angenehme Persönlichkeit, da Unton in dessen Dienste gekämpft und an seiner Seite verwundet worden war. Er war aber ein ergebener Anhänger des Essex. Er war von der Königin beauftragt, die wahren Gesinnungen des französischen Kabinetts zu erkunden, damit man, falls der König ernstlich an einen Frieden mit Spanien denke, ihn durch das Anerbieten kräftigen Beistandes davon abbringe. Wenn er aber bloß drohe, die Sachen zu lassen, wie sie ständen, war er von Essex angewiesen, dem König zu erklären, daß er Ernst machen müsse, wenn er das englische Kabinett aus seiner Lethargie erwecken wolle. Der König müsse die Mittel vorlegen, die ihm zu einer Unterhandlung zu Gebote ständen. Er müsse sagen: es tue ihm leid, daß England ihn nicht unterstützen könne, und noch mehr, daß er nicht ohne dieses Krieg führen könne. Er müsse sich verletzt zeigen, daß Unton nichts als Worte bringe, und sich stellen, als nähme er dessen Sendung wie, einen Hohn auf. Er müsse sich öffentlich kalt und mißvergnügt gegen ihn bezeigen, ohne ihn jedoch ungnädig zu behandeln. Er solle zu erkennen geben, daß er ihm persönlich, nicht aber als Gesandter, willkommen sei. Kurz, er müsse sich so halten, daß Unton donnernde Briefe nach England schicken könne. Gleichzeitig beauftragte er Perez, ihm zu schreiben: Die Sendung Untons habe die Sache schlimmer gemacht als je, und er fürchte, daß man nicht mehr Zeit haben werde, eine neue Sendung und Unterhandlung zu versuchen, weil der König inzwischen zu weit gehe, um wieder zurückgebracht werden zu können. Alles geschah so, wie Essex es vorgezeichnet hatte. Der König spielte seine Rolle um so sicherer, als er sich eigentlich dabei gar nicht sonderlich zu verstellen brauchte, und Unton und Perez schrieben ganz in dem vorgeschriebenen Sinne, wie denn Unton bloß zu berichten brauchte, was er sah und hörte, um diesem zu entsprechen. Perez war mit Essex einverstanden.
Perez war übrigens trotz der Aufmunterung, die für ihn in der Freundschaft des Essex, in den Aufmerksamkeiten und Vertrauensbeweisen des Königs, dem Anteil, den er an den Angelegenheiten Englands und Frankreichs nahm, liegen mußte, traurig, unruhig, voller Besorgnisse und wechselnder, vielartiger Entwürfe. Seit seiner Rückkehr aus England war ihm eine Pension von 4000 Talern angewiesen worden. Man machte ihm Hoffnung, daß er Geheimrat werden und den Heiligen-Geist-Orden erhalten werde. In einer Zeit, in der die Finanzen Heinrichs IV. in dem kläglichsten Zustande waren und dieser Fürst selbst an Rosni schrieb, daß seine Hemden ganz zerrissen, seine Wamse am Ellbogen durchlöchert und sein Topf oft umgekehrt sei, wurde die Pension nicht immer pünktlich bezahlt, und seine Beförderung wollte auch nicht eintreten. Die Verzögerungen machten Perez mißtrauisch. Er hielt sich für einen Zielpunkt der Feindschaft der Prinzen des Hauses Guise, weil er in seinen Relaziones von ihren mit Don Juan betriebenen Entwürfen gesprochen, des Neides der Hofleute, der Eifersucht des Staatssekretärs Villeroi, und sah selbst seinen treuen Gil de Mesa. der ihn aus zwei Gefängnissen gerettet hatte, mit ihm ins Exil gegangen war und Heinrich IV. zu seinen Kammerherrn ernannt hatte, für einen Spion an. Nachrichten, die ihm über neue gegen sein Leben entworfene Pläne zukamen, vermehrten seine mißtrauischen Besorgnisse. Bald wollte er sich nach England, bald nach Florenz, oder Venedig, oder Holland zurückziehen. Heinrich IV. suchte ihn zu beruhigen und sagte ihm: »Antonio, Ihr werdet nirgends sicherer sein als bei mir, und ich will nicht, daß Ihr mich verlaßt.« Dann aber schmetterte ihn wieder eine falsche Nachricht von dem Tode seiner Gattin nieder. »Ich habe«, schrieb er damals an Essex, »die Gefährtin meiner Leiden, die Trösterin meines Kummers, die Hälfte meiner Seele, ja, ich sollte sagen, die ganze Seele dieses Leibes verloren. Die anderen Frauen sind die Leiber der Männer; diese und ihr ähnliche, falls die Natur dergleichen erzeugen kann, sind vielmehr die Seele des Leibes der Männer.« Er wollte damals in einen geistlichen Orden treten, um, wie er sagte, öfter unter Gräbern zu sein. Heinrich IV. versprach ihm, in seine Gedanken eingehend, die Anwartschaft auf das Bistum Bordeaux.
Von solcher Traurigkeit gebeugt und täglich mehr verbitterten Wesens werdend, übernahm er im Frühjahr 1596 eine neue Sendung nach England. Erzherzog Albrecht, jetzt Statthalter der Niederlande und bestimmt, der Schwiegersohn Philipps II. zu werden, hatte im April mit 50.000 Mann die Belagerung von Calais eröffnet. Während England und Frankreich über die Bedingungen, unter denen sie sich zur Abwehr dieses Angriffes verbinden wollten, nicht einig werden konnten, hatte Albrecht den Platz genommen.. Dieses Ereignis machte die Königin Elisabeth denn doch empfänglicher für die französischen Wünsche, und Heinrich IV. schickte erst de Sancy, dann noch den Herzog von Bouillon, dem Perez beigegeben ward, nach England, um über ein Bündnis zu Schutz und Trutz zu unterhandeln. Perez sagte beim Scheiden: er wolle die Rolle des Priesters spielen, d.h. nachdem er die Einsegnung dieser Ehe verrichtet, wolle er das Paar sich selbst überlassen, zusammen zu leben und sich zu lieben, er wolle sich anderswo, wo er sein Alter unter geringerer Gefahr und Eifersucht verbringen könne, anderen Betrachtungen hingeben.
Der Verlauf auch dieser Mission war nicht geeignet, die trübe Stimmung des spanischen Flüchtlings zu heben. Es schien ihm bestimmt zu sein, seinen neuen Herren nicht die Dienste leisten zu können, die sie Ursache hatten, von ihm zu erwarten. Er war der Gesandtschaft hauptsächlich wegen seiner Vertrautheit mit Essex beigegeben worden. Als er nach London kam, ergab sich, daß Essex nicht zu treffen war, daß er sich den Franzosen und Perez geflissentlich entzogen und nach Plymouth begeben hatte. Die Sache war: es war Essex gelungen, die Königin zu einer gegen die spanischen Küsten bestimmten Expedition unter seinem Kommando zu bestimmen, er brannte auf diese Unternehmung und fürchtete, Heinrich IV. möchte verlangen, daß die dazu bestimmten Truppen lieber in Frankreich verwendet würden. Er beeilte sich daher, die Ausrüstung der Flotte zu betreiben, die sich bald, aus 150 Segeln bestehend und mit 14.000 Soldaten an Bord, unter Admiral Howard und Essex gegen die Küsten Andalusiens in Bewegung setzte. Perez, dem der Earl weder mündlich noch schriftlich etwas von sich hören ließ, war sehr empfindlich darüber und schüttete seine Beschwerden so reichlich gegen Anton Bacon aus, daß dieser, um sich, wie er seinem Bruder Franz schrieb, den spanischen Exklamationen und scheltenden Beschwerden des Perez zu entziehen und ihn nicht täglich auf die Ehre seines teueren Lords loshämmern zu hören, nach Twickenham zurückzog. Allein, verlassen, dem Lord Burleigh als Freund des Essex verdächtig, bei der Königin angeschwärzt, nahm Perez keinen Teil an den Unterhandlungen, die übrigens einen wunderlichen Gang nahmen, zuletzt aber doch zum Abschluß des Allianzvertrages vom 10. Mai 1596 führten. Wie wenig er nun auch bei diesem Vertrage geleistet hatte, er fand bei seiner Rückkehr nach Frankreich doch, daß nicht bloß Essex fortwährend auf seine Freundschaft Wert legte, sondern auch der König ihm Gunst bewahrte. Essex war von seiner Expedition nach England zurückgekehrt, diese war glänzend verlaufen und hätte ohne die übergroße Vorsicht des beigegebenen Kriegsrates noch größere Resultate erzielt. Essex schrieb (14. September) an Perez einen Brief, der mit den Worten schloß: »Antonio, höret nicht auf, mich zu lieben, und beeilt Euch nicht, mich ungehört zu verdammen; wartet die Rechtfertigung des Essex ab.« Essex wünschte, sich auch ferner des Perez zu bedienen, um Heinrich IV. von einem Frieden mit Spanien abzuhalten. Dies um so mehr, als Perez jetzt förmlich in den Dienst des Königs getreten war, und zwar unter Bedingungen, die deutlich zeigten, daß Perez sich nicht wohlfeil zu verkaufen gedachte und daß Heinrich IV. hohen Wert auf seine Dienste legte. Perez selbst hatte seine Bedingungen gemacht und sie schriftlich in die Hände seiner besonderen Gönner und Freunde, des Marquis de Pisani und des Connetable von Montmorency gelegt (Dezember 1596). Der König hatte nichts gegen den Inhalt, mißbilligte aber die Form, die mehr den Charakter eines Vertrages als den eines Gesuches trug. So ward die Form in der Weise geändert, daß Perez (1. Januar 1597) folgende Bitten stellte: 1. den Kardinalshut für ihn, nach dem Tode seiner Frau oder, falls er das nicht erlebe, für seinen Sohn Gonzalo; 2. eine auf Bistümer, Abteien und andere geistliche Pfründen begründete Pension von 12.000 Talern mit .dem Rechte, sie seinen Kindern abzutreten; 3. bis zur vollständigen Anweisung dieser Einkünfte die Zahlung seiner derzeitigen Pension von 4000 Talern und einer Zulage von 2000 Talern; 4. eine Gratifikation von 2000 Talern, um sich dem ihm verliehenen Range eines königlichen Rates gemäß auszurüsten; 5. ein oder zwei Schweizer Soldaten, um über die noch immer von Philipp II. bedrohte Sicherheit seiner Person zu wachen; 6. im Falle eines Friedens zwischen Frankreich und Spanien die Befreiung seiner Frau und Kinder und die Rückgabe seines Vermögens. Heinrich IV. genehmigte diese Bedingungen, die am 13. Januar 1597 in seinem Namen von dem Staatssekretär Villeroi unterzeichnet wurden und auf Perez' Wunsch am 18. Januar noch die besondere Bürgschaft des Connetable Montmorency erhielten. Perez gab sich nun die äußerste Mühe, das Bündnis zwischen England und Frankreich zu erhalten, jeden Gedanken an einen Frieden mit Spanien als unsinnig erscheinen zu lassen und den Bemühungen des päpstlichen Legaten entgegenzuarbeiten, der fortwährend bei Heinrich für den Frieden wirkte und in der gleichen Absicht den General der Franziskaner, Calatigirone, zu Philipp II. geschickt hatte, damit die unnatürliche Feindschaft zwischen den großen katholischen Monarchien und das Bündnis Frankreichs mit dem Ketzerstaate einmal ein Ende nehme. Das Ketzertum der Elisabeth würde sie nicht von Heinrich IV. getrennt haben, wenn sie sonst eine Verbündete gewesen wäre, wie dieser sie wollte. Elisabeth aber verfiel sehr bald wieder in ihre alte Kargheit, tat so wenig als möglich für Frankreich. Wenn Heinrich IV. darüber klagte oder auf einen Separatfrieden hinwies, verfiel sie in Zorn, ward beleidigend und tat doch nichts. In der Tat, die Schwierigkeiten hatten weit mehr auf Seiten Philipps II., dem es Ernst war mit seiner Feindschaft, als auf der des französischen Königs gelegen, der lediglich den Eingebungen der Politik folgte. Als nun Philipp durch die Erfolge der Franzosen wie durch das Gefühl eines nahenden Todes doch dahingebracht war, ernstlich den Frieden zu wollen, ward es bald klar, daß der Abschluß eines Friedens nicht lange auf sich warten lassen werde. Bevor jedoch Heinrich IV. sich auf offene Unterhandlungen, wie sie zu Anfang des Februar 1598 zu Vervins eröffnet wurden, einließ, schickte er im Dezember 1597 Hurault de Maisse nach England, um die Königin zur Teilnahme an diesen Verhandlungen einzuladen. Elisabeth erwiderte: einem Vergleiche mit einem so unwürdigen König würde sie den Tod vorgezogen haben. Sie schickte Sir Robert Cecil, Burleighs Sohn, nach Frankreich, wohin auch von Seiten der Generalstaaten Justin von Nassau und Barneveld kamen, um einen letzten Versuch zu machen, den König vom Abschluß des Friedens abzubringen. Doch dieser Monarch hatte seinen Entschluß gefaßt. Er und das Land bedurften einiger Ruhe, um sich von vierzig Jahre währenden inneren und äußeren Kriegen zu erholen, bevor zu neuen Unternehmungen des Machtstrebens geschritten ward, zu denen es auch ihm nicht an Ehrgeiz gebrach. Er erkannte an, wie verpflichtet er seinen alten Verbündeten für die geleisteten Dienste sei, und versicherte, es nie an der ihnen schuldigen Freundschaft mangeln lassen zu wollen, beseitigte aber innerhalb weniger Monate alle die Händel, die ihm noch zu tun gegeben, brachte den Herzog von Mercoeur zur Unterwerfung, beruhigte die Hugenotten durch das Edikt von Nantes (30. April 1598) und schloß mit Spanien den Frieden von Vervins (2. Mai 1598).
Sowie es ernstlich auf diesen Frieden losging, änderte sich die Stellung des Perez zu seinem Nachteil. Er hatte fortwährend durch Vermittlung Stauntons, des Pariser Agenten des Earls von Essex, eine geheime Korrespondenz mit England unterhalten. Das war von dem französischen Kabinett entdeckt oder geargwohnt und unter den nunmehrigen Umständen sehr übel aufgenommen worden. Heinrich berief ihn nicht mehr zu sich, hielt ihn entfernt von dem Kreise seiner Vertrauten und Ratgeber und ließ ihm sogar Verweise geben, daß er nach England über französische Angelegenheiten schreibe. Perez erklärte dies für eine Verleumdung, leugnete es in einer dem Connetable übersendeten Denkschrift ausdrücklich ab, bat um Erlaubnis, sich aus Frankreich zurückzuziehen, stellte sich krank und ließ alle seine Mitteilungen und Beschwerden durch seinen Gil de Mesa und den Italiener Marenco an den Connetable, der ihn mit schönen Worten tröstete, an die Prinzessin Katharina, die ihm fortdauernd ihre Teilnahme bewahrte, und an den König gelangen, der sich zwar schweigsam verhielt, aber wenigstens den Schein des Wohlwollens für ihn nicht aufgeben wollte. Immerhin empfand Perez jetzt die Bitterkeiten der Lage eines Dieners, der den Großen, die ihn lange geschützt und genutzt hatten, nicht mehr brauchbar oder gar unbequem geworden ist und dessen Dienste sie weit weniger im Bewußtsein tragen als seine jetzige Lästigkeit. Schon gegen Ende des Dezembers von 1597 klagte er gegen Staunton über die Veränderlichkeit und die Schwankungen des Königs, der Beweglichkeit seiner Ratschlüsse, die Unbeständigkeit seiner Neigungen, den Wechsel seiner Entschlüsse, und wie er nur darin beharre: alles halb zu tun. Aber schon im folgenden Januar, als an den Verhandlungen mit Spanien nicht mehr zu zweifeln war und die französischen Bevollmächtigten, die Präsidenten Pompone von Bellèvre und Brulart de Sillery, sich anschickten, nach Vervins abzureisen, hielt es doch Perez selbst für geraten, den einmal unvermeidlichen Frieden auch für sich zu nutzen. Er erinnerte daher den König in angemessener Sprache an die Versprechungen, die ihm für einen solchen Fall gemacht worden. Perez schlug zugleich vor: da der König von Spanien einen Artikel zugunsten des Herzogs von Aumale vorschlagen werde als Gegenkonzession die Freigebung der Perezschen Familie und die Rückgabe seines Vermögens zu verlangen. Es soll ihm das auch versprochen worden sein, und er selbst versichert, daß die französischen Bevollmächtigten in der Tat jene Bedingung gestellt, die spanischen aber sie zurückgewiesen hätten, weil die Fälle zu ungleich seien. Der Herzog von Aumale sei im Exil, weil er an bürgerlichen Wirren teilgenommen, Perez, weil er von der Inquisition verurteilt worden. Es findet sich aber weder in den Instruktionen der französischen Gesandten noch in ihren Depeschen irgendeine Erwähnung des Perez, wohl aber die ausdrückliche Anweisung, die Aufnahme des Herzogs von Aumale und der anderen hartnäckigen Ligisten in den Vertrag abzuschlagen, da der König sieh zwar vorbehielt, sie, wenn sie sich unterwürfen, zu begnadigen, sie aber nicht in Kraft eines Vertrages mit einem fremden Monarchen zurückkehren lassen wollte. Ob mündlich etwas über Perez verhandelt und ob er dabei mit der Aumaleschen Sache in Verbindung gebracht worden, muß dahingestellt bleiben. Möglich, daß das französische Kabinett erfahren hatte, Philipp II. sei in Betreff des Perez unerbittlich, und nun nicht den ganzen Frieden an den Interessen eines einzelnen scheitern lassen wollte. Zwei Jahre später bekam der französische Gesandte in Spanien, der Graf de La Rochepot, allerdings Auftrag, sich für Perez und seine Kinder zu verwenden. Für jetzt blieben die Gattin und die Kinder des Verbannten in den Kerkern seines unversöhnlichen Verfolgers.
Doch diesem selbst war nur noch eine kurze Frist vergönnt, anderen Menschen weh oder wohl zu tun. Philipp II. starb nach langem und peinlichem Siechtum am 13. September 1598. In einer dem Perez zugeschriebenen handschriftlichen Lebensbeschreibung dieses Königs wird seine letzte Krankheit mit den abschreckendsten Farben geschildert und dabei auch versichert, daß die gegenwärtigen Schmerzen ihn nicht so gequält hätten wie seine Besorgnisse vor der abzulegenden Rechenschaft. Was jedoch weiterhin im einzelnen angeführt wird, zeigt den König gefaßt dem nahe Tode ins Auge sehend, in den Willen Gottes ergeben. Während erst behauptet wird, wenn er sich die Tiefen der göttlichen Gerechtigkeit vergegenwärtigt und der Rechenschaft gedacht hätte, die er über so viele Tage seines Lebens, so viele Taten, die er verübt, soviel nutzlos vergossenes Blut abzulegen habe, so hätte er lieber als ein armer Hirte wie als Monarch der spanischen Reiche geboren sein mögen, heißt es bald darauf: »Er sprach von dem Tode wie von einem königlichen Einzug in die beste seiner Städte und von seinem Leichenbegängnis, wie er von seiner Krönung hätte sprechen können.« Als ihm schmeichelnde Hoffnungen auf längeres Leben gemacht wurden, ließ er sich nicht dadurch täuschen, sondern sagte vielmehr, seine Überzeugung von der Nähe des Todes bekundend: »Gebt dieses Bild Unserer Frau der Infantin. Es hat meiner Mutter gehört und ich habe es 50 Jahre bei mir getragen.« Auch befahl er, ein hölzernes Kruzifix auf seine Brust zu legen, mit dem der Kaiser, sein Herr und Vater, gestorben sei. Bei allen Schmerzen beschränkten sich seine Klagen auf den flehenden Wunsch: »Mögen damit meine Sünden abgekauft sein!« und es ist stark zu zweifeln, daß er dabei an seine schlimmsten Sünden, an die Ausflüsse seiner Härte, seines Ehrgeizes, seiner politischen Falschheit gedacht hat, was alles er als Geschäftssache, vielleicht als Pflicht und Tugend betrachtet haben mag. Er wird an solche Sünden gedacht haben, die ihm seine Priester als die schlimmsten ausmalten, an irgendeine Vernachlässigung kirchlicher Satzungen, irgendeine sinnliche Ausschweifung u.dgl. Seinen Sohn erinnerte er an die Vergänglichkeit menschlicher Größe und empfahl ihm den Krieg gegen die Ungläubigen und den Frieden mit Frankreich. Als der König nach Empfang der letzten Ölung sein Gesicht nach der Wand gekehrt und zu sprechen aufgehört hatte, glaubte der Thronfolger, es sei alles vorüber und verlangte von Don Christoval de Moura den vergoldeten Schlüssel des geheimen Kabinetts. Dieser erklärte jedoch, er könne ihn nicht herausgeben, solange der König noch lebe, und wie der Prinz sieh hierüber empfindlich zeigte, klagte Don Christoval es dem König. Philipp II. fand das Verlangen allerdings etwas vorzeitig, befahl jedoch, daß Don Christoval demselben willfahren und den Prinzen um Verzeihung bitten solle. Dann entschlug er sich aller irdischen Gedanken und verschied gegen 5 Uhr abend sanft und ruhig.
Sogleich nach dem Tode Philipps verbreitete sich das Gerücht in Europa: er habe auf dem Sterbebett die Freilassung der Frau und der Kinder des Perez und die Rückgabe ihres Vermögens verordnet, habe auch seinem Sohn empfohlen, sich mit Perez zu verständigen und ihn in Italien zu verwenden, ihn aber niemals nach Spanien zurückkehren, noch sich in den Niederlanden fixieren zu lassen. Perez selbst schöpfte Hoffnung, um so mehr als er mit dem Günstling des neuen Königs, Don Francisco Gomez de Sandoval y Rojas, Marquis von Denia, der dann unter dem Namen des Herzogs von Lerma die spanische Monarchie so lange regierte, sehr freundliche Beziehungen gehabt hatte. »Von seiner Jugend an«, schrieb er an einen Freund, »habe ich ihn als einen Mann von trefflichem Wesen, als sanft und edel gekannt. Während meiner Unfälle und meiner Gefangenschaft verwünschten seine Verwandten die Urheber meiner Verfolgungen und sprachen offen gegen die Günstlinge jener Zeit, die sich von meinem Vermögen nährten und sich mit meiner Beute schmückten. Sein Vater liebte mich; er gehörte zu der Partei des Ruy-Gomez de Silva und war diesem ganz ergeben. Seine Vettern, die Söhne des Don Hernando de Rojas, sind im elterlichen Hause meiner Gattin geboren und erzogen worden, mit) meiner Frau und ihren nächsten Freunden aufgewachsen. Er selbst hat mich öffentlich im Gefängnis besucht und sich damit dem Zorn des Königs ausgesetzt.« – Wußte Perez nicht, wie es mit den Freundschaften der Großen beschaffen ist und wie vieles sich durch den Übergang aus dem Privatstand auf die Spitze der Macht ändert? Zudem konnte er in seiner Entfernung nicht übersehen, welche Rücksichten den neuen Minister verhindern konnten, so rasch vorzugehen, wie Perez in natürlicher Ungeduld erwartete. Es vergingen sechs Monate und die Lage des Perez und seiner Familie war noch dieselbe. Erst als Philipp III. im April 1599 nach Valencia abreiste, um seine junge Gemahlin, die Erzherzogin Margarethe von Österreich, zu empfangen, erschien ein Notar in der Festung, wo Doña Juana Coello mit ihren sieben Kindern schmachtete und sagte zu ihr: »Madame, Seine Majestät befiehlt, daß Sie frei seien. Sie können an den Hof gehen oder wohin sonst Sie für gut finden; aber Ihre Kinder müssen hier bleiben.« Die würdige Frau wurde durch diese wundersame Botschaft in große Unschlüssigkeit versetzt. So wert und wichtig ihr die Freiheit sein mußte, so machte es ihr doch großes Bedenken, ihre Kinder (drei Söhne, vier Töchter), deren ältestes ein Mädchen von 20 Jahren, Dona Gregoria, war, allein inmitten von Soldaten und Alguazils zu lassen. Nach heftigen inneren Kämpfen entschloß sie sich dennoch dazu, um in den Stand zu kommen und für die Befreiung ihrer Kinder wirken zu können.

Heinrich IV. von Frankreich.
Stich von Goulu, nach einem Gemälde von Porbus. Porträtsammlung der Nationalbibliothek Wien
Sie begab sich an den Hof und besuchte zuerst den Rodrigo Vasquez de Arce, den Perez seinen Oberhenker nannte und der bei ihrem Anblick Tränen vergoß. Sie hatte die Genugtuung, Zeuge des plötzlichen Sturzes dieses jetzt 80jährigen Dieners der Rache Philipps II. zu sein, der so unbarmherzig gegen ihren Gemahl, gegen sie, gegen ihre Kinder gewesen. Die Präsidentschaft des Rates von Kastilien wurde ihm ohne weiteres entzogen und er erhielt den Befehl, den Hof zu verlassen und sich in einer Entfernung von 20 Meilen von Madrid und 10 Meilen vom Valladolid zu halten. Sein Nachfolger, der Graf von Miranda, durch den Marquis von Denia auf diesen Posten befördert, zeigte sich der verfolgten Familie sehr geneigt. Die Kinder des Perez verließen das Gefängnis, das sie seit 9 Jahren bewohnt hatten und wo das Jüngste von ihnen geboren war. Auch wurde ihnen gestattet, den Vasquez auf Rückgabe der 20.000 Taler zu belangen, die er auf eine dem ältesten Sohn des Perez von dem Papst Gregor XIII. verliehene Pfründe entnommen und zur Bezahlung der Alguazils, die diese Familie zu bewachen hatten, verwendet hatte, während er niemals Mittel gefunden haben soll, für die nötigsten Bedürfnisse der Bewachten selbst zu sorgen. Vasquez, der seine Ungnade nicht lange überlebte, starb, bevor über diese Klage entschieden war. – Der neue König, der überhaupt milden Wesens war, wurde durch seinen Leiter auch zu einer weitergreifenden versöhnlichen Maßregel bestimmt, die nicht den Perez und die Seinen, wohl aber solche betraf, zu deren Unglück das des Perez der Anlaß geworden. Bald nach Beendigung der Festlichkeiten seiner zu Valencia gefeierten Vermählung reiste er nach Saragossa, in dessen Nähe er am 11. September anlangte, das er aber nicht betreten wollte, bevor nicht die aufgepflanzten Köpfe der wegen des Aufstandes Verurteilten entfernt worden waren. Am selben Abend brachte der Graf Morata die Söhne des Don Diego de Heredia in das Kloster, wo der König übernachtete, damit sie dem Marquis von Denia ihre Bitten vortrügen. Der König gestattete sogleich, daß die Köpfe der Verurteilten den Familien überlassen, das konfiszierte Vermögen diesen zurückgegeben, die Verdammungsurteile von den Mauern vertilgt würden und befahl, die Geächteten zurückzurufen, die noch Gefangenen freizulassen, »damit«, sagte er, »keiner seiner Untertanen an dem Tag seiner Freude eine Ursache zur Trauer habe«. Er wurde dafür bei seinem Einzug in Saragossa mit allgemeinen Bezeigungen lebhafter Freude und Dankbarkeit empfangen, und den Cortes kam es nicht bei, als der König die Fueros beschwor, die Herstellung derselben zu ihrem früheren Stand zu beantragen.

Philipp II. von Spanien.
Stich von Suyderhoef, nach einem Gemälde von Moro. Porträtsammlung der Nationalbibliothek Wien
Alle diese Nachrichten erhöhten natürlich die Ungeduld des Perez, dem nach seinem Vaterland, nach seiner Familie, dem auch ungeachtet er in jener Zeit viel Schönes und Wahres gegen das Trügerische des Glanzes und Glückes schrieb, nach einer Herstellung zu Überfluß und Macht verlangte. Und doch sollte es ihm beschieden sein, im Exil zu altern und zu sterben und die letzten Jahre der Verbannung zum Teil durch eigene Schuld in weit ungünstigeren Verhältnissen zu verbringen als die ersten. Er fand sich unbehaglich zu Paris, wo er seit dem Frieden von Vervins unnütz und verdächtig geworden war. Seine Pension wurde nicht pünktlich bezahlt und die ihm versprochenen Pfründen wurden ihm nicht zugeteilt, überhaupt die ihm bei dem Eintritt in den französischen Dienst gemachten Zusagen in mehrfachen Punkten nicht gehalten. Vergebens bestürmte er den Bürgen des Vertrages, den Connetable, mit Briefen, überhäufte ihn mit Schmeicheleien, machte ihm selbst kleine Geschenke, deren Wert in der feinen Weise lag, in der sie geboten wurden. Die Finanzen Frankreichs standen nicht glänzend; Sully war ein sparsamer Mann; man gab nur ungern das Geld für einen Fremden, der eigentlich nie etwas geholfen hatte und den man jetzt gar nicht mehr brauchen konnte. Perez brauchte viel und wurde in seinen Bedrängnissen oftmals bitter, zuweilen unklug drohend. Er mußte die Zahlung seiner Pension von Jahr zu Jahr herausstreiten, sich dabei Abzüge gefallen lassen und sich bedanken, wenn er etwas von dem erhielt, was man ihm schuldig war. Der König bewahrte ihm dabei noch ein gewisses nachsichtsvolles Wohlwollen und half ihm zuweilen. So schrieb er einst an Rosny (Sully): »Mein Freund Antonio Perez ist bei mir gewesen, um sich für die 3000 Taler zu bedanken, die ich ihm gebe, mir seine Zufriedenheit mit der erwiesenen Verbindlichkeit zu bezeigen und mich zu bitten, daß man auf dem Etat 4000 angeben möge, damit die Spanier, wenn sie zufällig davon erführen, nicht wüßten, daß er in diesem Jahre schlechter gehalten würde als in den vorhergehenden. Ich bitte Euch, ihm hierin zu willfahren, um die Eitelkeit dieses Menschen zu befriedigen.«
In dieser prekären Lage sehnte er sich mehr als je nach der Rückkehr ins Vaterland und kam auf den Gedanken, dieselbe in England zu verdienen, während er wohl besser getan hätte, wenn er den französischen Ministern vorgestellt hätte, daß sie ihn am anständigsten loswerden könnten, wenn sie ihm in Spanien, wenn nicht unbedingte Herstellung, doch eine solche Entschädigung auswirkten, mit der er etwa in Italien oder sonst auf unverfänglichem Boden behaglich leben und sich mit den Seinigen wiedervereinigen könne. Das war jedenfalls das Höchste, was er erwarten konnte, aber er war zu gereizt und zu hochfahrend, als daß er auf solchen Gedanken hätte kommen sollen. Die Königin Elisabeth war tot (am 24. März 1603); ihr zaghafter Nachfolger Jakob I. sehnte sich nach Frieden, und Bevollmächtigte Spaniens, der Graf von Aremberg und Johann von Taxis, begaben sich zur Unterhandlung darüber nach England. Perez hatte fortwährend vertraute Beziehungen zu den englischen Gesandten in Paris unterhalten, ohne viel zu fragen, wie das zu seinen Verpflichtungen gegen Frankreich passe und hatte ihnen geeignete Mitteilungen gemacht, die sie ihrem Minister berichteten. Er redete jetzt dem derzeitigen Gesandten Thomas Parry ein, daß er bei den Unterhandlungen gute Dienste würde leisten können, und Parry ermunterte ihn in der Tat, nach England zu reisen, versprach ihm gute Aufnahme und gab ihm einen Brief an den Staatssekretär des Äußeren mit. Diese Reise sollte sehr übel für ihn ausschlagen und er verdiente das, weil er dabei ohne Rücksicht auf Frankreich, in dessen Dienst und Brot er stand, ohne ehrliche Absicht in betreff Englands, das er benutzen wollte und lediglich in seinem persönlichen Interesse handelte. Seine Absicht war nämlich, das Vertrauen, das ihm, wie er erwartete, in England geschenkt werden würde, zu benutzen, um Spanien solche Dienste zu leisten, durch die er sich seine Herstellung verdienen könne. Diesem so wenig redlichen und dabei so unsicheren, von so mehrfachen Instanzen abhängigen Plane schenkte er solches Vertrauen, daß er unbesonnen genug war, auf seine französische Pension zu verzichten, sei es nun, daß er dies in reinem Übermut getan, oder, was wir lieber glauben möchten, daß er nur unter dieser Bedingung Frankreich verlassen konnte. Der Plan scheiterte, wie er verdiente und wie Heinrich IV., der von Spanien aus über die Absichten des Perez unterrichtet worden war, vorausgesagt hatte, nach allen Seiten. Der Staatssekretär Villeroy schrieb sogleich an den französischen Gesandten in England, Christoph de Harlay, Grafen von Beaumont, in zugleich für die Meinung, die er über Perez hegte, bezeichnender Weise (18. Januar 1604): »Nehmen Sie sich wohl in acht, daß Antonio Perez, der, wie er uns sagt, nach dort zurückkehren will, nicht mit seinen Schmeicheleien und gewöhnlichen Flatterien die Herzen der Höflinge und der Damen gewinnt, beachten Sie, daß er laut seinem Gelöbnis bei dieser Friedensschlußsache dem König von Spanien einen so ausgezeichneten Dienst leisten wird, um die Herstellung zu den früher besessenen Gütern und Ehren zu verdienen. Noch nie habe ich bei irgend jemand soviel Eitelkeit und Unklugheit mit soviel Übermut verbunden angetroffen. Beobachten Sie, was er tut und angibt und melden Sie es uns, wie alle andern Sachen, auch die geringsten, denn der König findet sehr großes Vergnügen daran, wie er mir Ihnen zu schreiben befohlen hat.« Nun, diese französische Depesche hätte an sich dem Plane des Perez nicht entgegengestanden. Aber es war schon ein sicheres Zeichen, daß derselbe scheitern müsse, wenn von Spanien aus, wohin Perez von seinen Absichten Nachricht gegeben haben mochte, der französische Hof von der das tiefste Geheimnis bedingenden Intrige in Kenntnis gesetzt wurde. Es ist ferner wahrscheinlich, daß nun auch England – vielleicht durch den französischen Gesandten – von der Sache unterrichtet wurde. Wo nicht, so betrachtete es den Perez als ein französisches Werkzeug, das die Friedenshandlung stören solle. Denn sobald Jakob I. erfuhr, daß Perez sich auf den Weg gemacht habe, sagte er zu dem Grafen Beaumont: Er trage kein Verlangen, jenen zu sehen und da er wisse, wie unangenehm seine Anwesenheit dem spanischen Gesandten sein würde, der eine sehr schlechte Meinung von ihm habe, so habe er ihm Befehl zur Umkehr erteilen lassen. In der Tat hatte Lord Mountjoy, Graf von Devonshire, diesen Befehl an Perez übermittelt, der ihn zu Boulogne empfing. Perez, der, nachdem er die Brücke hinter sich abgebrochen, keine Aussicht mehr hatte, als die in der beabsichtigten Unternehmung lag, scheute sich nicht, den Befehl zu übertreten. Er schiffte sich ein, landete in England und ging bis Canterbury, von wo er, nachdem ihm dort die Weiterreise untersagt worden, dem König den Brief seines Gesandten schickte und diesen mit einem Schreiben begleitete, worin er sich über das gegen ihn beobachtete Verfahren beschwerte und schließlich bat, ihm wenigstens den Aufenthalt in irgendeinem Winkel des Landes zu gestatten (23. Februar 1604). Man ersieht daraus zugleich, daß der englische Gesandte ihm noch nach Boulogne Geleitbriefe nachgeschickt und ihn einem königlichen Kurier empfohlen hatte, der sich auf der Reise seiner annehmen solle. König Jakob aber geriet in den äußersten Zorn, rauft sich den Bart vor Wut, sagte: Sein Gesandter zu Paris sei ein seines Amtes unwürdiges Tier, dessen er sich nicht mehr bedienen wolle und erklärte, er würde lieber England selbst verlassen, als Perez da dulden. In der Tat mußte Perez auf das Festland zurückkehren, und der Friede kam ohne ihn zustande. Die Spanier wußten ihm nicht einmal für seinen guten Willen Dank und noch zwei Monate nach dem Frieden beschwerte sich der Herzog von Lerma gegen den französischen Gesandten über den Schutz, den Heinrich IV. dem Perez und anderen spanischen Flüchtlingen angedeihen lasse.
Mehr als Schutz oder Aufenthaltserlaubnis hatte Perez jetzt in der Tat nicht mehr von Frankreich. Von Paris nach Saint Denis übersiedelt, bat er jetzt demütig um Wiedergewährung seiner Pension als Gnade, rief die Großmut Heinrichs IV. an, schickte zu Villeroy seinen ältesten Sohn Don Gonzalo, der mit seinem Bruder Don Raphael nach Frankreich zu dem Vater gekommen war, nahm vor allem die Fürsprache des Connetable in Anspruch. Alles umsonst; die Pension ward ihm nicht zurückgegeben. Nun richtete er seine letzte Hoffnung ganz auf Spanien. Er zog nach St. Lazare, um dem spanischen Gesandten Don Balthazar de Zuniga näher zu sein. Als derselbe im Frühjahre 1606 eine Urlaubsreise nach Paris machte, beschwor er ihn, ihm die Gnade auszuwirken, sein Vaterland wiedersehen und in der Mitte der Seinigen sterben zu dürfen. Wie er erfuhr, daß der Gesandte nach Paris zurückkehre, hoffte er wenigstens eine schließliche Entscheidung zu erlangen, womit er sich alsdann beruhigen wolle, da dies der letzte Versuch habe sein sollen. Als aber, nachdem Zuniga keine Begnadigung mitgebracht hatte, derselbe durch Don Pedro de Toledo ersetzt ward, wendete Perez sich doch wieder auch an diesen und richtete auf dessen Rat unter dem 9. August ein unterwürfiges und flehendes Schreiben an den Herzog von Lerma. Drei Monate später mußte er den Gesandten fragen, ob er noch keine Antwort von dem Herzog habe oder nicht wenigstens bald eine solche erwarte, da er in der äußersten Not sei, nachdem er die Hilfe alle seiner Freunde erschöpft habe und nicht wisse, wo er das tägliche Brot hernehmen solle. Mit Recht ruft Mignet aus: »Klägliche Lage eines Mannes, der, nachdem er der begünstigte Minister des mächtigsten Königs in Europa gewesen, nachdem er ein ganzes Land in die Verteidigung seiner Person und seiner Sache gezogen, nachdem er an dem Vertrauen und den Geschäften der zwei furchtbarsten Feinde seines alten Gebieters teilgenommen, in solche Hilflosigkeit verfallen war und seine demütigsten Bitten durch in Verzweiflung setzende Weigerungen zurückgewiesen sah!«
Seine Dürftigkeit war ohne Zweifel nicht ohne Anteil an seinem öfteren Wohnungswechsel. Er zog von St. Lazare auf die Rue du Temple, von da in die Vorstadt St. Victor und 1608 in die Nähe des Arsenals auf die Rue de la Cerisaie. Genötigt, allen anderen Zerstreuungen zu entsagen, suchte er solche in den Erinnerungen seiner Jugend, den Beschäftigungen seines Geistes und ging viel in die Kirche, um bei Gott den Trost zu suchen, den ihm die Menschen versagten. Er schrieb und betete. Viele seiner damals verfaßten Schriften sind verloren gegangen. Ein für den Herzog von Lerma geschriebenes Werk unter dem Titel: »Polarstern der Fürsten, der Vizekönige, der Räte, der Statthalter, und politische Ratschläge über die öffentliche und private Verwaltung einer Monarchie«, ist im Manuskript in der kaiserlichen Bibliothek zu Paris noch vorhanden und soll manche Erfahrung eines gewesenen Ministers, manchen hellen Blick auf praktische Zeitfragen, auch liberale Warnungen gegen absolute Willkür, sonst aber nicht viel Bemerkenswertes enthalten. Die letzten Jahre des Flüchtlings wurden immer trüber, man könnte wohl fragen, ob er nicht glücklicher gewesen wäre, wenn er lange vorher dem Hasse seiner Feinde zum Opfer gefallen wäre, statt noch so viel Jahre in stets getäuschten Bemühungen, in Verdruß, Sorge und Not zu verbringen und zuletzt den Becher der Leiden bis zu den Hefen zu leeren; man könnte es fragen, wenn man nicht annehmen müßte, daß eben diese Leiden ihn besser zum Tode vorbereitet haben, als wenn er mitten im Glück oder Kampf und in der Tatkraft gestorben wäre. Die Gebrechen des Alters, durch früheres Übermaß des Genusses und durch spätere Widerwärtigkeiten beschleunigt, brachen über ihn herein. Da die Schwäche seiner Beine ihm nicht gestattete, sich auch nur in die nahe Kirche zu begeben, so hatte er vom Papst, der ihn schon von den durch seinen Verkehr mit Ketzern verwirkten Zensuren losgesprochen hatte und sich – was auch bezeichnend ist – um das Urteil der Inquisition nicht gekümmert zu haben scheint, die Erlaubnis erwirkt, eine Betstube in seiner Wohnung zu haben. Wie nach dem Tode Heinrichs IV. (14. Mai 1610) der Herzog von Feria als außerordentlicher Gesandter nach Paris kam, um die beabsichtigte Doppelheirat zu unterhandeln, erkundigte sich Perez eifrig, ob er ihm nicht das Ende seines Exils anzuzeigen habe; aber der Herzog hatte gar keinen Befehl in betreff des Verbannten. Den letzten Versuch machte der Unglückliche einige Monate später, indem er auf den Rat seines Freundes, des Franziskanergenerals, Bischofs der kanarischen Inseln und Mitgliedes der Inquisition, Sesa, vom obersten Inquisitionsgericht freies Geleite verlangte, um sich vor demselben zu rechtfertigen. Auch dies war vergeblich.
Einige Monate später verfiel er in seine letzte Krankheit. Der Aragonese Don Manuel Lope und andere spanische Flüchtlinge zu Paris pflegten ihn mit liebevoller Sorgfalt, und der Dominikaner André Garin, der nicht von seiner Seite wich, spendete ihm die kirchlichen Tröstungen. Als er sein Ende nahen fühlte, diktierte er noch seinem bis zum Tode getreuen Freunde Gil de Mesa eine Erklärung, worin er Gott zum Zeugen nahm, daß er immer als Christ und treuer Katholik gelebt habe und als solcher sterbe, stets ein treuer Diener und Untertan seines Königs gewesen zu sein versicherte, die Schritte aufzählte, die er zu seiner Herstellung getan, und schließlich seine Frau und seine Kinder der Gnade des Königs empfahl. Er unterschrieb diese Erklärung mit schwacher Hand und verschied einige Stunden darauf, am 3. November 1611, 72 Jahre alt. Er wurde bei den Cölestinern beerdigt, wo noch am Ende des 18. Jahrhunderts sein Epitaphium zu lesen war, worin der ihm bewiesenen beneficentia Heinrichs IV. über Verdienst gedacht und das odium male auspicatum Philipps II. erwähnt wurde. Seine ihn überlebende Gattin und seine Kinder, von denen nur die älteste Tochter, Doña Gregoria, einige Jahre früher gestorben war, bemühten sich, um seines Andenkens und ihrer eigenen Stellung willen wenigstens nach seinem Tode die Zurücknahme des Urteils der Inquisition gegen ihn zu erwirken. Es bedurfte aber fast vierjähriger ausdauernder Anstrengungen, des Beistandes der mächtigsten Personen in Kirche und Staat und der ausdrücklichen Willenserklärung Philipps III., bevor das Inquisitionstribunal sich entschloß, den Prozeß des Perez zu revidieren und das gegen ihn und die Seinen ergangene Urteil aufzuheben, was schließlich erst am 6. Juni 1615 erfolgte.