
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
1945
Vier Teile meiner Skizzen und Erinnerungen »Sösewasser« erschienen in den Jahren 1921–1924 und 1927 im »Osteroder Kreis-Anzeiger«. Es fällt mir schwer, den Faden wieder dort anzuknüpfen, wo ich aufgehört habe, und mich in das Jugendland zurückzuversetzen.
Es fragt sich, ist es überhaupt an der Zeit, jetzt alte Erinnerungen niederzuschreiben. – Ja, es ist an der Zeit. Ich will versuchen, abzulenken von dem, was uns bedrückt. Die sonnige Jugendzeit wird auch heute noch die Kraft haben, auf uns zurückzustrahlen und unsere Herzen zu erwärmen.
Unsere Heimat besteht nicht allein aus der Landschaft mit Bergen, Tälern und Gewässern, den Wäldern, den fruchtbaren Aeckern und saftigen Wiesen. Nicht allein aus den Dörfern und Städten und den Menschen, die dort leben. Es sind da noch gewisse Imponderabilien, die man körperlich nicht erfassen kann. Es ist die Seele des Menschen, der dort zuhause ist. Es ist seine Heimat, von der er träumt, mag er auch noch so weit davon entfernt sein. Es ist sein Jugendland, das er als köstlichen Schatz in seinem Herzen überall mit sich trägt.
Und von diesem Jugendland, das uns heilig ist und in dem auch wieder unsere Kinder und Enkel aufwachsen, will ich erzählen. Ich will es so schildern, wie ich es vor rund 4½ Jahrzehnten gesehen habe. Unsere Kinder sahen es mit anderen Augen, und unsere Enkel sehen es wieder mit anderen Augen. Aber im Wesen ist es immer das gleiche geblieben und wird es auch immer das gleiche bleiben. Jeder findet sein Jugendland am schönsten, und so hört man denn auch immer wieder sagen: »Als wir jung waren, war es doch schöner als heute! Das, was wir hatten, hat die heutige Jugend nicht.« Wir wieder bedauern unsere Eltern, daß sie unsere Jugend schon als Erwachsene erlebten. Und unsere Kinder werden das wieder von uns denken und von ihren eigenen Kindern.
In den bisher veröffentlichten Teilen des »Sösewassers« habe ich dem Leser schon wesentlichen Einblick in unser Jugendland gegeben. Auf die Schulzeit selbst bin ich dabei weniger eingegangen. Und das will ich nachholen. Wenn ich nun auch von und aus der Schule plaudern werde, so soll sich doch in diesen Zeilen gerade auch das Leben eines Osteroder Jungen außerhalb der Schule widerspiegeln. Denn das Schönste an der Schule waren die Ferien und die sonstigen Freizeiten.
Ich will mich auch bemühen, recht vorsichtig zu Werke zu gehen. Und zwar nach dem Grundsatz, daß man über einen Toten nichts Böses sagen soll. Und ähnlich soll man auch über die Schule, wenn man sie glücklich hinter sich hat, nur Gutes berichten. Kleinere und größere Verärgerungen, mit denen ein Kinderherz sich so oft beschwert, haben an Gewicht verloren, ja, sie sind wohl ganz verflüchtigt, so daß die Sonne, die über unserer Jugend schien, in vollem Glanze über uns leuchtet.
Wir sind beglückt, wenn wir einem alten Schulkameraden wieder gegenüberstehen. Amt und Beruf sind vergessen. Wir haben ihn wieder vor uns, wie er mit dem Butterbrot in der Hand auf dem Schulhof herumtollt, oder wie er sich abmüht, seine schlecht gelernten Lektionen aufzusagen und schließlich doch eine 4 trotz unseres Vorsagens angeschrieben bekommt. Es werden ja immer weniger, die mit mir zusammen die Schulbank drückten. So wäre es nur ein kleiner Leserkreis, wollte ich für die alten Mitschüler diese Blätter schreiben. Ich will für alle schreiben, die in Osterode jung waren und jung sind. Für alle, die empfänglich sind für Klänge aus dem Jugendland.
Denkst du noch an den ersten Tag,
wo du zur Sexta zogest
und unters hohe Säulendach
das wirre Köpfchen bogest?
Des alten Beckers Disziplin
versank in weite Fernen,
doch, daß poeta masculin,
das mußtest du erst lernen.
Wehmütig singen wir das Lied der alten Pennäler von Robert Degering, das in einer geradezu klassischen Weise alle Freuden und Nöten von Sexta bis Prima uns vor Augen führt. –
24 Jungen fanden sich in der Sexta, der untersten Klasse des Realgymnasiums, zusammen. Jungen aus Osterode und der näheren Umgebung, die zum Teil hier in Pension waren. Erst in den folgenden Klassen stellten sich auch Schüler aus entfernteren Orten ein.
Schon damals waren Kinder aus allen Schichten der Bevölkerung vertreten. So war der Primus der Sohn eines Briefträgers, und einen der nächsten Plätze füllte der Sohn eines Waldarbeiters aus Lonau aus.
Die unteren Klassen besuchten auch viele sogenannte »lateinische Bauern«, Landwirtssöhne älterer Jahrgänge, die gewöhnlich in Quarta oder Untertertia »Abitur« machten und so einen Hauch von höherer Schulbildung mit ins Leben nehmen wollten. Wenigstens war das der Wunsch ihrer Eltern.
In Quarta hat schon mancher sich
die Hosen durchgesessen
und hat im Leben sicherlich
den Nepos nie vergessen.
Damit soll nicht gesagt sein, daß sie schlechte Schüler waren. Manch' einer von ihnen hat die Schule bis zum »Einjährigen« oder gar bis zum Abitur glänzend durchlaufen. Unbekümmert um städtische Moden trugen sie ihre praktische Dorfkleidung: geschlossene Männerjoppen und weite Hosen, die nicht lang und nicht kurz waren und die wir mit »Hochwasser« bezeichneten. Die Hosen reichten nämlich bis zum Stiefelrand.
Ein starkes Kontingent stellten auch die »Lerbcher«, Sie hatten von Lerbach jeden Morgen einen weiten Schulweg und kamen in den Wintermonaten immer recht verfroren an. Eine Autobusverbindung gab es ja noch nicht.
Die Aufnahmeprüfung für die Sexta war ein großes Ereignis. Und die Herzen der kleinen Buben schlugen zum ersten Mal in ihrem Leben gewaltig. Sie waren sich dessen bewußt, daß sie an einem Scheideweg standen, der für ihren späteren Beruf von Bedeutung war. Und nicht alle fanden Aufnahme unter dem Säulendach auf dem Lindenberg.
Als mein Jahrgang dort einzog, bestand die Vorschule nicht mehr, die unter Leitung des guten alten Lehrers Becker so vorzüglich geblüht hatte und mit ihren drei Klassen Nona, Oktava und Septima an das Realgymnasium angehängt war. Die Vorschüler trugen genau wie die echten »Realprömmel« Schülermützen, und zwar von schwarzem Tuch, unten mit verschiedenfarbigem Rand und Gold- oder Silberborde, die die einzelnen Klassen von einander unterschieden.
Wo ich nun einmal die Schülermützen erwähne, will ich als gewissenhafter Chronist auch noch festhalten, welche Farben die einzelnen Klassen des Realgymnasiums trugen.
Die unterste Klasse, die Sexta, Hatte braune Mützen mit blauem Rand und goldener Borde. Füchse wurden die Träger genannt. Die Quintaner hießen Frösche nach ihrer grün-weiß-goldenen Mütze, die Quartaner Veilchen; blau-rot-silber waren ihre Farben; Untertertia: grün-rot-gold, Obertertia: grün-rot-silber, Untersekunda: karminrot-schwarz-gold, Obersekunda: karminrot-schwarz-silber, Unterprima: taubenblau-schwarz-gold, Oberprima: taubenblau-schwarz-silber. Sämtliche Mützen hatten um den Mützendeckel je nach der Borde einen goldenen oder silbernen Paspel. Etwas ganz Eigenartiges waren die Zentral-Sekundaner und Zentral-Primaner, Schüler, die in Untersekunda oder in Unterprima sitzengeblieben waren und denen man die Möglichkeit gab, nach einem halben Jahr die Obersecunda, bzw. die Oberprima zu erreichen. Sie trugen als besonderes Kennzeichen eine schmale Silberlitze auf dem schwarzen Samtstreifen der Mütze. Diese Einrichtung hat nur wenige Jahre bestanden.
Die Schülermützen hatten für die Lehrer ihr Gutes. Die Beaufsichtigung der Schüler war erleichtert. Auf der Straße mußte sich jeder anständig benehmen, denn er wurde sofort als Angehöriger der Schulklasse erkannt, deren Mütze er trug.
Besonders störend waren die Mützen in der Zeit, wo sich in der Jünglingsbrust die ersten Regungen für das weibliche Geschlecht fühlbar machten. »Das Flanieren auf den Straßen« wurde nach den Ferien bei jedem Schulbeginn durch den Direktor vom Katheder der Aula aufs neue verboten. Und trotzdem blühte der Bummel, besonders an den Herbst- und Wintertagen, von der linken Marktseite (vorbei an Stella foris!) bis zum Schilde jeden Nachmittag von 5 bis 7 Uhr. Wurde sonntags nicht vom Turm geblasen, war auf dem Kornmarkt Platzkonzert, und da sah man
Blaue Mützen, rote Mützen,
jugendfrisch die Mägdelein.
Stadtkapelle auf dem Marktplatz
spielt ein Lied im Sonnenschein.
Flüchtig Grüßen, heiß Erröten.
Fritz und Lisbeth schau'n sich an.
Doch der Fritz ist viel zu schüchtern,
und so spricht er sie nicht an.
Seine jäh erwachte Liebe
wagt er nicht, ihr zu gestehn,
sieht nur einmal seufzend seitwärts,
um dann schnell vorbeizugehn.
Eingedenk des Schulverbotes, wagte niemand, mit seiner Angebeteten hier zusammenzugehen. Doch auch die verschwiegenen Gassen boten keinen Schutz vor Entdeckung, zu verräterisch leuchteten die roten und die blauen Mützen, Noch dazu hatten die Lehrer eine Art Straßendienst eingerichtet, so daß man nie sicher war, plötzlich seinem Ordinarius gegenüber zu stehen. Da konnte man sich dann für den nächsten Tag besonders vorbereiten, denn man kam bestimmt »dran«.
Auch Schützenpark und Uehrderberg, wohin man im Frühling und Sommer bei hellem Sonnenschein mit einer Jemandin einen kleinen Spaziergang wagte, boten keine Tarnung. Ich vergesse daher nie, wie ich einst auf einer einsamen Bank beim Georgspavillion von meinem Klassenlehrer aufgeschreckt wurde.
Die schönsten Mützen trug die Sekunda, ein wundervolles Karminrot, so recht geeignet, die Herzen der Tanzstunden»damen« zu entflammen. Dazu war Sekunda gewöhnlich die Zeit, wo man von »Frau Ladany & Sohn« in die Kunst des Tanzens eingeführt wurde. Aber auch innerlich war man durch die rote Mütze gehoben. Von nun ab redeten uns die Lehrer nicht mehr mit: »Du dummer Bengel«, sondern mit »Sie dummer Bengel« an. Und von Sekunda ab tollten wir nicht mehr auf dem Schulhof umher, sondern durften uns gemeinsam mit den Primanern in den Pausen im anliegenden Kurpark ergehen.
Sekunda bringt das erste Sie,
man sonnt sich in dem Glanze
und nippt von dem Krambambuli
im Krug zum grünen Kranze.
Man bringt das erste Räuschchen mit
nach Haus auf dunklen Wegen,
man lernt den ersten Walzerschritt,
und »Franz«
Prof. Franz Arnold hat nichts dagegen.
Eine Schülermütze zu tragen, war indessen garnicht so einfach. Es war streng verboten, sie »nach studentischer Art« auf den Hinterkopf zu setzen, eine Anweisung, die uns gleichzeitig mit dem Verbot betr. Abschießen von Singvögeln alle Vierteljahre neu unterbreitet wurde. Die Mütze aber sittsam und steif uns auf die Stirn zu drücken, widerstrebte uns. Und so war es das erste, wenn wir uns eine neue Mütze aufsetzten, daß wir vorn, rechts und links einen tiefen »Kniff« hineinmachten. So war wenigstens etwas der pedantische Bann gebrochen.
Die Schülermützen schützten ihre Träger nicht nur vor Regen und Sonne, kennzeichneten sie nicht nur als Klassenkameraden, sondern sie waren auch die Signalflaggen für die Versetzung.
Am Schluß eines jeden Schuljahres gab der Direktor vor Lehrer- und Schülerschaft kund: »Versetzt wurden von Sexta nach Quinta: Müller, Rosinski, Gehrcke, Reinhardt, Hofmann, Scheele, Gerke usw. usw.« Dann pflegte eine Pause einzutreten, und die Uebriggebliebenen schauten sich traurig an. Von neuem fuhr er fort: »Trotz gewisser Bedenken wurden ferner versetzt: »X., Y. und Z.« Es waren dann gewöhnlich nur 2 oder 3 Namen. Ja, es kam sogar vor, daß eine zweite Pause folgte und »trotz ganz schwerer Bedenken« noch ein letzter »Nachkömmling« zitiert wurde.
Die Zeugnisse wurden in der Klasse verteilt, und nun ging ein Wettrennen los. Nach Haus? Kein Gedanke!
Die ganze Schule rannte, was das Zeug halten wollte, zum Mützenhändler.
Und hier entwickelte sich ein fürchterliches Gewühle, und Schubsen und Stoßen. Denn jeder wollte eine neue Mütze haben, und um die passenden Größen ging der Streit. Wer aber zuletzt kam, und noch dazu mit einem zu großen oder zu kleinen Kopf, der hatte das Nachsehen, denn der Vorrat der fertigen Mützen war bald erschöpft.
Nur die braven Musterschüler, die schon Wochen vorher genau wußten, daß sie die Versetzung in der Tasche hatten, betraten geruhsamen Schrittes den Laden. Denn für sie lagen, klassenweise geordnet und mit ihrem Namen versehen, die Mützen auf dem Tresen zum Abholen bereit. Sie hatten sich wohlweislich einige Tage vorher ihre Mützen anmessen lassen. So konnten sie schnell abgefertigt werden.
Unter den ganz Schlauen, die ihre bestellte Mütze abholten, waren aber auch Schulbeflissene, die vom ersten Sitzenbleiben nicht gestorben waren und die von vornherein nicht damit rechneten, die Klasse, in der sie gerade saßen, in einem Jahre zu absolvieren. Diese holten sich eine neue »alte« Mütze aus dem Laden. So wahrten sie auf der Straße den Anschein, als seien sie versetzt. Denn wer Ostern mit einer alten Mütze umherlief, dem sah ja jeder an, daß er »backen« geblieben war.
Währenddessen lugte die Mutter zum Fenster hinaus, ob wohl in der Ferne eine neue Mütze auftaucht. Und groß war dann immer die Freude, wenn der Junge um die Ecke bog und die neue Mütze schon aus weiter Ferne signalisierte: »Hurra, ich bin versetzt!«
Waren wir im allgemeinen auch stolz auf unsere Mütze, so empfanden wir sie doch mitunter, wie bereits ausgeführt, lästig. Das Tragen der Mützen war Zwang. Und bestraft wurde, wer sich eine andere Kopfbedeckung aufsetzte. Die angenehme hutlose Mode kannte man damals noch nicht. Und weil es Zwang war, setzten wir alle möglichen anderen Kopfbedeckungen auf. Besonders dann, wenn wir nicht erkannt werden wollten. Das war hauptsächlich in den höheren Klassen der Fall. Mit Stolz wurden aus rangierte Hüte der Väter zu neuen Ehren gebracht. Hellen Neid erregte Mile, der einige Klassen über mir war, mit einem bräunlich-grünen Velourhut, der vordem Jahrzehnte lang auf dem Haupte des Vaters im Amtsgericht aus- und eingegangen war. Die Opposition ging einmal so weit, daß wir in einer der oberen Klassen alle mit Räuberhüten in der Schule erschienen. Unser Klassenlehrer, der sonst die Abgeklärtheit selbst war und sich nie aus der Ruhe bringen ließ, wurde wild, als er an dem Hakenbört seiner Klasse eines Morgens statt der Mützen eine Versammlung der verwegensten Hüte vorfand. Er riß jeden Hut einzeln vom Haken und warf ihn auf den Boden. Die Klasse hatte an dem Tage nichts zu lachen. Von den Hüten sprach er keinen Ton. Aber am nächsten Morgen hing an jedem Haken wieder brav eine Mütze.
Die Schülermützen hatten aber auch Konkurrenten. Wenn die kleinen »lateinischen Bauern« mit ihren bunten Mützen in ihrem heimatlichen Dorf umherstolzierten, dann erregten sie den Neid ihrer dortigen Gespielen und ihrer Brüder, welche nicht die Stadtschule besuchten. Dem wußte der Mützenhändler in Osterode abzuhelfen. Und so baute er »Schülermützen« in den herrlichsten Phantasiefarben, die in der Form genau den Mützen der »Realschule« glichen. Und solche Mützen tragen die kleinen Jungen teilweise jetzt noch auf dem Lande.
Die Farben der Oberprima schwarz-blau-silber haben sich in dem 1904 gegründeten Verein ehemaliger Osteroder Pennäler (V. e. O. P.) erhalten, der diese zum Andenken an die Schulzeit in seinem Wappen führt und besonders die Verbindung mit alten Osteroder Schülern, die in der Fremde ihren Lebensberuf gefunden haben, aufrechterhält.
Und nun wieder zurück zum alten Becker. Ich habe ihn nicht mehr als Schullehrer erlebt, denn er war, wie ich bereits erwähnte, aus dem Amt geschieden, als ich meine Tätigkeit als ABC-Schütze begann. Ich habe daher die Höhere Töchterschule besucht, von der ich in früheren Abschnitten erzählte. Wir standen da unter der strengen Leitung von Valeska Jaensch. Heute denke ich mit Schmunzeln daran, wie sie einst sämtliche Jungen unserer Klasse verprügelte. Wir hatten in die frisch gestrichenen Pulte Buchstaben und Figuren geritzt. Sie kommandierte: »Hände vorstrecken!« Dann ging sie von Platz zu Platz und hieb uns mit dem Rohrstock tüchtig auf die Finger. Nur mein Freund Gerhard D. war so gerissen, die Hände auf den Rücken zu legen, so daß er als einziger frei ausging.
Während dieses Schulbesuches las ich bei Herrn Becker in dessen Wohnung wochenlang Robinson Crusoe, denn mein Vater wollte gern eine Kontrolle über mein Wissen haben. August Becker rauchte dabei seine lange Pfeife, hatte ein schwarzes Samtkäppchen auf dem Kopf und trug einen langen, altväterlichen Schlafrock, der um die Lenden mit einer seidenen Kordel zusammengebunden war.
In diesem Aufzug erschien er auch oft bei uns im Krummen Bruch. Das war uns selbstverständlich, niemand konnte etwas dabei finden. In seinem letzten Lebensjahre kam er täglich zu uns ins Kontor, um sich seine Uhr stellen zu lassen, denn seine Augen waren mit dem Alter schwach geworden. Ich war ja kaum 6 Jahre alt, als er mein Lesen überprüfte, und doch fühlte ich, wie sehr ich bei ihm lernte und welch gütiger Mensch er war. Es gibt wohl keinen seiner alten Schüler, der nicht mit Verehrung und Dankbarkeit seiner gedenkt.

Lehrer August Becker
Nach Beckers Pensionierung setzte sich die Sexta aus Schülern zusammen, die, abgesehen von den auswärtigen, von der Bürgerknabenschule oder von der Höheren Töchterschule kamen. Wir von der Höheren Töchterschule waren froh, diese nicht mehr zu besuchen, denn wir fühlten uns doch beschämt, als Jungen in einer Mädchenschule zu sein. Und dies um so mehr, weil die Knaben der anderen Schulen hinter uns herriefen:
»Töchterlappen,
Hosenklappen!«
Jetzt waren wir »Realprömmel« geworden. Diesen Osteroder Spottruf haben wir gern dafür eingetauscht.
Waren wir nun auch schulmäßig von den Bürgerschülern getrennt, so waren sie doch unsere Spielkameraden geblieben. Und jede der alten Osteroder Straßen bildete so eine Art Spielgemeinschaft für sich. Spiele waren da, die sich von Generation auf Generation vererbten, und jede Straße hatte wieder ihre Sonderheiten.
Kleine Mädchen auf den Straßen
spielen Ball und tanzen Ringelreih'n.
Kecke Buben tollen, spaßen,
necken sie und mischen sich darein.
Aus den Fenstern Frauen schwatzen
mit der liebsten, besten Nachbarin.
In der Sonne blinzeln Katzen
wohlig schnurrend zwischen Dachgerinn.
Meine Wiege stand im Krummen Bruch. Und da waren immer viel Kinder und sind es noch heute. Wenn meine Enkel den »Brummküsel« schlagen, so stecken sie ihn zum »Anmachen« in dieselben Löcher, wo wir ihn feststeckten, um ihn dann mit einem Peitschenhieb zum Drehen zu bringen. Und der Frühling kündigt sich im Krummen Bruch noch genau so an wie vor rund 50 Jahren. Die Mädchen hüpfen und tanzen und singen dazu ihre Spiellieder. Die Jungen schlagen Ball oder »hicken« mit Springkugeln.
Wir waren höchstens noch etwas emsiger dabei. Das kann aber auch Einbildung sein. Springkugeln kauften wir von Deppe und Brummküsel von Wesemann. Für die Springkugeln brauchten wir nur einige Pfennige, da hatten wir die ganze Hosentasche voll. Die Kugeln waren poliert und leuchteten in den schönsten Farben. Schien die Sonne, so wurde auf dem »Trottoir« oder auf dem Fahrweg geflickt. Da gab es eine ganze Reihe Spielregeln. Wer erinnert sich noch an Kippe und Spann? Ich hatte nur kleine Hände, und groß sind sie auch heute nicht. So war ich bei Spann immer im Nachteil. Regnete es, so setzten wir uns in einen »Tritt«, einen Hauseingang mit Stufen. Vorher aber ließen wir uns den Mairegen auf den Kopf tropfen, denn von Mairegen wird man groß! Im Tritt wurde mit indirekten Kugeln gespielt, beinahe so kunstvoll wie Billard. Und hierbei konnte man mit einer Kugel sogar ein Dutzend und mehr gewinnen – oder auch verlieren. Besonders begehrt waren gläserne Kugeln, die im Innern herrliche bunte Muster zeigten und teils so groß waren wie eine Pflaume. Um eine solche Kugel zu gewinnen, mußte man mehrmals darauf hicken. Gern gespielt wurde auch mit bleiernen Kugeln, mit denen man auf dem Fahrdamm gut trulen konnte. Sie goß uns Herr Meine in der Schildwache.
Ein beliebtes Ballspiel war »Kuhschwanz«. Wir stellten uns in einer langen Reihe mit einem Abstand von etwa 10 m hintereinander auf. Dem letzten der Reihe stand ein Junge mit einem »Ballholz« gegenüber. Dieser mußte den Ball möglichst weit und hoch schlagen. Wer den Ball auffing, erhielt das Ballholz und durfte das Spiel fortsetzen. Wurde der Ball nicht aufgefangen, so mußte derjenige, welcher den Ball an der Erde hatte aufhalten können, ihn seinem Vordermann ins Kreuz werfen. Traf er ihn, so rückte er auf bis zum nächsten, und diesen mußte er wieder treffen. Zum Schluß mußte sich der Ballschläger umdrehen; traf ihn der Aufrückende auch mit dem Ball, so war dieser jetzt an der Reihe, den Ball zu schlagen.
Bei dem »richtigen« Ballschlagen stand neben dem Ballschläger ein Junge, der »einschenkte«, der also den Ball leicht in die Höhe werfen mußte, damit jener ihn traf. Nach dem Schlag mußte der Ballschläger bis zu einem bestimmten Punkt hin- und zurücklaufen. Von den vor ihm aufgestellten Jungen versuchte jeder, den Ball zu erhaschen und damit den Laufenden zu treffen. Gelang dies, so durfte er den Ball schlagen. Gewöhnlich wurde der Ball von dem Jungen, der »am Schlag« war, beim Einschenken gefehlt. Dann ergriff schnell der Einschenker den Ball und hatte es so leicht, den fortlaufenden Schläger zu treffen und dessen Stelle zu gewinnen. Die Stelle des Einschenkers nahm dann der nächste in der Reihe stehende Junge ein, während der abgesetzte Ballschläger nunmehr den letzten Platz in der Reihe erhielt.
Viel trieben wir uns auch auf dem Meineschen Gehöft in der Schildwache herum. Dort konnten wir herrlich versteckenspielen. Wißt ihr noch, wenn wir riefen: »Ein Schlag für mi-ich!« oder »Bleib sitzen, wo du bist, der Jäger kommt!« Da standen uns sämtliche Gebäulichkeiten zur Verfügung, denn Vater Meine war großzügig und ließ uns überall freien Lauf. Er war nebenbei Eichmeister und ein geschickter Mann. Bei meiner Mutter war er sehr angesehen, weil er allein die Fertigkeit besaß, in die Gipswände unseres alten Hauses, die undurchdringlich wie Eisen waren, Nägel einzutreiben. Und die Bilderhaken, die er dort eingefügt hat, erfüllen heute noch ihren Zweck. Er gehörte mit seinem Schimmel genau so zu den Idyllen des Krummen Bruchs wie der blühende Zwetschenbaum am Hause des Tischlers Niemeyer.

Der blühende Zwetschenbaum im Krummen Bruch
Wenn wir Soldaten spielten – heute spielen die Jungen Indianer und sind vom Militarismus befreit –, mußte Heiseckes schwarzer Thebe (Hund) herhalten, den wir vor einen Handwagen spannten. Das war unser »Train«. Die Infanteristen trugen lange Schwerter aus Holz und Zündplättchenpistolen. Die Kavallerie hatte hölzerne Lanzen mit kleinen Fähnchen. Zu uns gesellte sich noch mein Freund Gockel von der Söse, der einen schweren Hammer mit sich schleppte, um auf einem Stein gleich ein Dutzend Zündplättchen auf einmal zur Explosion zu bringen. Gockel vertrat so die schwere Artillerie. Er hatte gleichzeitig das Kommando über die Jungen, welche gut mit Steinen werfen konnten. Von unseren »Feinden« wurde er sehr gefürchtet, denn im Nahkampf hatte er einmal sogar sein Taschenmesser gezogen. Aus sicherer Entfernung riefen sie seitdem hinter ihm her: »Sösekönig, Messerheld!« Eine Fahne hatten wir natürlich auch. Und bei den Schlachten, die in der Schildwache und sonntags am Kalkberg bei der Bergbrauerei ausgetragen wurden, flatterte sie uns voran. Oft wurde blutig um sie gekämpft, selbst unter Zuhilfenahme von »Käserlingen« (Steinen), wenn es galt, sie gegen Jungen anderer Stadtteile zu verteidigen.
Manche Spiele hatten wir mit den Mädchen gemeinsam. So bildeten wir mit ihnen eine Kette und sangen:
»Hat eins geschlagen, der Wolf kommt nicht.
Hat zwei geschlagen, der Wolf kommt nicht usw.«
Und wenn es dann hieß:
»Hat zwölf geschlagen, der Wolf kommt!«
stürzte der böse Wolf auf die kreischende, auseinanderstiebende Schar, um sich ein Schäfchen zu fangen.
Oder wir spielten mit den Mädchen:
»Wer graut sich nicht vorm schwarzen Mann?«
Bei diesem Spiel standen wir auf der einen Seite des Bürgersteigs, der »schwarze Mann« mitten auf dem Fahrweg. Wenn er die obigen Worte gerufen hatte, antworteten wir: »Niemand!« Und jeder mußte die Fahrstraße bis zum gegenüberliegenden Bürgersteig durchlaufen. Hierbei kam es darauf an, sich nicht vom schwarzen Mann fassen zu lassen.
Bei diesem Spiel fiel meine Nachbarin Bertchen B. so unglücklich, daß sie unter lautem Wehklagen nach Haus gebracht werden mußte.
Es war der erste Pfingsttag. Man muß sich in die Zeit um die Jahrhundertwende zurückversetzen. Autos fuhren noch nicht. Die Pferdegespanne hatten Ruhe. Nach menschlichem Ermessen konnte wirklich nichts passieren. Und krank wurde am ersten Pfingsttag morgen auch niemand. Die Festtagsfolgen stellten sich gewöhnlich erst am dritten Feiertag ein. Kann man es da einem braven alten Hausarzt übelnehmen, wenn er am ersten Pfingsttag sich einmal auf sich selbst besinnt und den Frühschoppen über die Mittagszeit ausdehnt? Jedenfalls war er nicht zu erreichen. Und so schickten die Eltern nach bangem Warten zur ärztlichen Konkurrenz, die auch sofort eintraf. Bald erfuhren wir, Bertchens Arm sei gebrochen. Wir stellten uns das entsetzlich vor, denn wir glaubten, er sei ganz abgebrochen wie der Arm einer Schumacherschen Gipsfigur und läge nun auf dem Fußboden der Kammer. Als jedoch nach einigen Tagen Bertchen mit einem Gipsverband am Fenster erschien, waren wir beruhigt. Der neue Doktor hatte den Arm wieder angegipst und stieg so gewaltig in unserer Achtung. Der »abgebrochene« und wieder »angegipste« Arm war aber anscheinend nicht Bertchens größter Schmerz, sondern das zerschnittene Pfingstkleid. Der Arm war durch den Bruch angeschwollen, und der lange, enge Aermel ließ sich nicht abstreifen. In der Aufregung hatte die Mutter den Aermel nicht in der Naht schnell aufgetrennt, sondern ihn ritsche-ratsch mit der Schere von unten bis oben aufgeschlitzt. Und damit war das Kleid hin.
Wollten wir »Kriegen« spielen, so stellten wir uns vorher im Kreise auf und zählten ab:
»1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
wo ist denn mein Schatz geblieb'n?
Ist nicht hier, ist nicht da,
ist wohl in Amerika!«
Noch schöner war:
»Iter pater – iker Strick,
sieben Katzen schlugen sich
mit dem blanken Hammer
in der dunklen Kammer.
Eine kriegt 'nen harten Schlag,
daß sie hinter Türe lag.«
Und hinter diese Abzählsprüche wurde zum Schluß angehängt:
»Ix, ax, ei,
du bist frei!«
Der zuletzt Uebrigbleibende mußte nun die Fortlaufenden jagen. Wem er drei Schläge versetzt hatte, löste ihn ab. Es gab aber auch ein »Taubenhaus«, in das man flüchten konnte und vor dem Kriegen sicher war. Auf: »Eins, zwei, drei!« mußte das Taubenhaus – gewöhnlich ein Haustritt – geräumt werden, und weiter ging das Spiel.
Hatten wir es eilig, so zählten wir ab:
»Ich und du,
Müllers Kuh,
Müllers Esel,
das bist du!«
Oder:
»Wir wol-len nicht lan-ge ab-zäh-len,
son-dern du sollst es sein!«
Wer dann »ist«, mußte die andern kriegen.
Doch die Zeit bleibt nicht stehen. Daher zum Schluß ein Abzählvers, der während des Krieges im Munde der Jungen und Mädchen war:
Achtung, Achtung – Ende, Ende,
aus dem Westen Kampfverbände!
Ueberm Kuhstall fliegen Jäger,
morgen kommt der Schornsteinfeger.«
Waren die Mädchen unter sich, so spielten sie mit ihren Puppen oder fingen Ball. Eine unverwüstliche Geduld hatten sie, wenn sie die »Ballprobe« machten. Damit konnten sie sich stundenlang beschäftigen.
Sprangen die Mädchen Strick, so liefen wir Stelzen. Und der war natürlich der angesehenste unter uns, der die höchsten Stelzen hatte.
Unvergeßlich sind mir die Weisen der » Singspiele«, die an den Frühlings- und Sommertagen im Krummen Bruch ertönten. Wenn es mir auch schwer gefallen ist, die Texte dazu wieder auszugraben. Den alten Osterodern, die mir dabei geholfen haben, herzlichen Dank! Die Mädchen, die sie einst sangen, sind inzwischen Großmütter geworden, und ihre Enkel kennen die Singspiele kaum noch. Man ersieht daraus, daß auch alte Sitten und Gebräuche vergänglich sind.
Und nun wollen wir uns mit den Mädchen im Kreis drehen – Anna sitzt in der Mitte – und singen:
»Die Anna saß am Breitenstein, Breitenstein, Breitenstein
und kämmte sich ihr goldnes Haar, goldnes Haar.
Und als sie damit fertig war, fertig war, fertig war,
da fing sie an zu wa-einen, wa-einen«.
Anna weint, und ein kleiner Junge wird zu ihr in den Kreis geschoben.
»Da kam der Bruder Fähnrich rein:
»O Anna, warum weinest du?«
»Ach, weil ich heut noch sterben muß!«
Der Bruder Fähnrich geht hinaus, ein anderer Junge tritt in den Kreis und »ersticht« Anna.
»Da trat der Bruder Karl herein
und stach sie dreimal in die Brust.
Die Anna kriegt 'nen goldnen Kranz,
der Karl, der kriegt 'nen Rattenschwanz!«
Damit ist das Spiel zu Ende. Bei den letzten Worten wirbeln wir alle im Kreis herum. – Das Spiel stimmte uns immer sehr traurig. Ich habe bis heute nicht begriffen, warum der böse Karl seine Schwester erstochen hat.
Kennt ihr noch »Schäfer und Edelmann«? Zwei Gruppen stehen sich gegenüber, und abwechselnd geht eine Gruppe singend vor und zurück:
»Wer klopft da draußen vor meiner Tür?
Vallerie, vallera, vallerie, vallera!«
»Es ist eines armen Schäfers Sohn
und bittet um Verzeihung schon.
Vallerie, vallera, vallerie, vallera!«
»Das Bitten ist dem Edelmann nichts wert,
nein, Schäfer, du mußt sterben unter meinem Schwert!
Vallerie, vallera, vallerie, vallera!«
»Ach Edelmann, ach Edelmann, schenk mir das Leben,
ich will dir meine Lämmer geben!
Vallerie, vallera, vallerie, vallera!«
»Die Lämmer sind dem Edelmann nichts wert,
nein, Schäfer, du mußt sterben unter meinem Schwert!
Vallerie usw.«
»Ach Edelmann, ach Edelmann, schenk mir das Leben,
ich will dir tausend Taler geben!
Vallerie usw.«
»Die Taler sind dem Edelmann nichts wert,
nein, Schäfer, du mußt sterben unter meinem Schwert!
Vallerie usw.«
»Ach Edelmann, ach Edelmann, schenk mir das Leben,
ich will dir Diamanten geben!
Vallerie usw.«
»Willst du mir Diamanten geben,
so will ich dir die Freiheit geben.
Vallerie usw.«
»Die goldne Freiheit hab ich schon.
Ich bin des Kaisers von Rußland Sohn,
Vallerie usw.«
»Bist du des Kaisers von Rußland Sohn,
so bitt' ich um Verzeihung schon!
Vallerie usw.«
Und weil zum Schluß die Edelmann-Gruppe in die Knie sinkt, wird ihr Verzeihung gewährt.
Ein ähnliches Spiel in zwei Gruppen ist »Heißa Pilatus«. Je eine Gruppe stellt sich auf den Bürgersteigen rechts und links des Fahrwegs auf. Abwechselnd schreitet eine Gruppe bis zu dem gegenüberliegenden Bordstein und wieder zurück. Dabei wird gesungen:
Ist der Vater wohl zu Haus?
Heißa Pilatus!«
»Was soll er dann zu Hause sein?
Heißa Pilatus!«
»Wir woll'n dem Herrn ein Brieflein schreib'n.
Heißa usw.«
»Was soll denn in dem Brieflein stehn?
Heißa usw.«
»Daß Else H. die Braut soll sein.
Heißa usw.«
»Wer soll denn aber der Bräut'gam sein?
Heißa usw.«
»Das soll der Emil J.. sein.
Heißa usw.«
»Emil J... will sie nicht.
Heißa usw.«
»Dann schlagen wir die Fenster ein!
Heißa usw.«
»Dann machen wir die Läden zu.
Heißa Pilatus!«
»Dann stecken wir das Haus in Brand!
Heißa Pilatus!«
»Dann löschen wir's mit Apfelbrei!
Heißa Pilatus!«
Nachdem das »Heißa Pilatus« ausgeklungen ist, bilden beide Gruppen einen Kreis, der sich schnell dreht, und singen dazu:
»Wir hab'n die Braut, wir hab'n die Braut,
die Hochzeit ist beschlossen!«
Als letztes ein Singspiel, das sich' sogar bis heute erhalten hat. Eine Gruppe singt:
»Wir kommen aus dem Mohrenland,
die Sonne hat uns schwarz gebrannt.
Wir sehen aus wie Mohren
und haben schwarze Ohren.«
Dabei geht sie vom Bürgersteig bis mitten auf die Straße. Eine andere Gruppe, die auf dem gegenüberliegenden Bürgersteig steht, ruft nun:
»Was soll er sein?«
Dann muß die erste Gruppe durch eine entsprechende Hand- oder Fußbewegung ein Handwerk andeuten (Hobeln, Schustern, Nähen o. a.). Hat einer der zweiten Gruppe das Handwerk richtig erraten, so springt die erste Gruppe schnell auf ihren neutralen Bürgersteig zurück, um sich von der fragenden Gruppe nicht greifen zu lassen. Der Zweck des Spieles ist, bemüht zu sein, die meisten Spieler in der Gruppe zu haben. Im Kommen und Fragen wechseln sich die Gruppen ab.
Kein eigentliches Spiel, aber eine Begebenheit, wo sich die Jugend im Gesang zusammenfand, war »Martengautmann«.
Am Geburtstage Martin Luthers gingen wir in kleinen Trupps in die Häuser und sangen wie einen Choral:
»Als Martin noch ein Knabe war,
hat er gesungen manches Jahr
vor fremder Leuten Türen.
Er sang so hell, er sang so zart
nach echter deutscher Knaben Art.
Das kann ein Herz wohl rühren.«
Nach einer kurzen Kunstpause kam die zweite Aufforderung zum Geben:
»Marten, Marten, gaut Mann,
der meck woll wat geben kann.
Appel un ne Beere,
kann eck gaut vertehre.
Gif meck wat, gif meck wat,
lat meck nich so lange stahn,
denn eck mött noch wieher gahn.
Denn eck mött na Polen.
Polen is en wieten Weg,
Seht ihr nich, daß's dunkel wird?«
Dieser frisch-fröhlichen Weise konnte wohl niemand widerstehen. Wer aber harthörig war, mußte sich gefallen lassen, daß die Bittsteller sangen:
»Marten, Marten hären,
Müllers, das sind Bären!«
oder sogar:
»Marten, Marten hemmerbetten
Müllers hab'n sich ins H..d g..... tten.«
Die Sängergruppen konnten zur Plage werden, wenn sie zu wilden Haufen anwuchsen und so die Bäcker- und Kaufmannsläden geradezu umlagerten. Dann konnte man wirklich Verständnis dafür haben, daß ihnen die Tür nicht geöffnet wurde. Im allgemeinen gab aber jeder gern, seien es Obst, Näschereien oder kleine Nutzgegenstände. Professor W. A. dessen Obstgärten berühmt waren, wurde klassenweise aufgesucht. Er rechnete fest mit uns und hatte schon entsprechende Mengen Aepfel und Birnen bereitgelegt, damit wir unsere kleinen Beutel füllen konnten.
Es mögen noch andere Singspiele gewesen sein, die im Krummen Bruch gepflegt wurden. Es war aber schon ein schwieriges Unternehmen, die von mir angeführten einigermaßen vollständig wiederzugeben. Abschließend ein Lied, das die Großmütter im Krummen Bruch ihren Enkeln vorsangen:
»Hänschen satt in'n Schornstein
un flicke sien Schauh'.
Da kämm so'n wacker Mäken rein
un sach so niepe tau.
»Mäken, wenn dau frien wutt,
dann frie dau doch meck,
Eck hewe'n blanken Dahler lien,
den will eck geben deck.«
Hans nüm se nich, Hans nüm se nich,
se hett en weihen Faut! –
Schmer Salbe drup, schmer Salbe drup,
denn ward hei wedder gaut!«
In ähnlicher Weise habe ich auch, unterstützt durch Rückfragen bei Altersgenossen, zwei unserer beliebtesten Hüpfespiele festhalten können. Diese spielten wir auf dem »Trottoir«, auf das Osterode ja so stolz ist; beginnt doch das alte Heimatlied von Nitsch:
»Ich lobe meine Heimatstadt
Ost'rode an dem Harz,
nicht, weil sie schöne Straßen hat
und Asphalt-
Trottoirs ...«
Mit einem Stück Kreide oder Gips aus der Schildwachenmauer zeichneten wir auf dem Bürgersteig einen »Hüpfekasten« mit einem Himmel oder eine große Spirale, in die wir geschickt auf einem Bein hineinhüpfen mußten.
Und nun zum Spiel selbst. Figur I stellt den Hüpfekasten dar. Wir nehmen einen kleinen Stein, werfen ihn in Feld 1, hüpfen auf einem Bein in Feld 1 und wieder zurück. Dann werfen wir in Feld 2, hüpfen auf einem Bein in Feld 1, von da in 2 und wieder zurück über 1. Und so geht es fort bis Feld 5. Es kommt darauf an, den Stein genau in die betreffenden Felder zu werfen und beim Hüpfen keinen Kreidestrich zu berühren. Sind wir von Feld 5 zurückgehüpft, so werfen wir den Stein in Feld 6, hüpfen wieder bis in Feld 5 und springen nun mit beiden Füßen zugleich in die Felder 6 und 7, so daß also der linke Fuß in 6 und der rechte in 7 stehen. Dann erst geht es wieder auf einem Bein durch' die anderen Felder zurück. Wer nun in die 9 trifft und glücklich bis in den »Himmel« gehüpft ist, hat gewonnen. Wer sich verworfen hat oder falsch' gehüpft ist, hat einen »Brenner« und muß wieder von vorn anfangen.
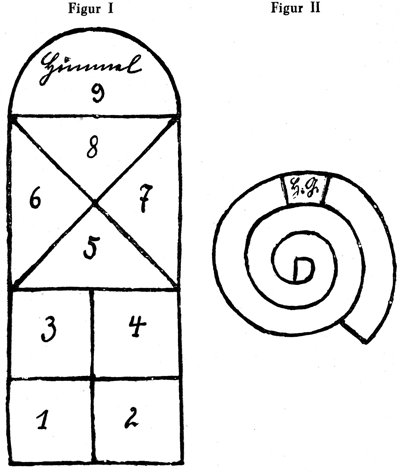
Beim zweiten Spiel (Figur II) brauchen wir kein Sternchen. Wir zeichnen eine Spirale mit einem Durchmesser von etwa drei Meter. Wir nannten sie Schnecke und das Spiel »Schneckenhüpfen«.
Zunächst hüpfen wir in die Schnecke auf dem rechten Bein bis zur Mitte, wo wir uns einen Augenblick ausruhen können, und dann wieder zurück. Und nun dasselbe auf dem linken Bein. Jetzt wird es aber schwieriger, denn bei der dritten Uebung müssen wir die Schnecke im »Scherenschritt« durchgehen, ohne die gezogenen Linien zu überschreiten. Das Schwierigste aber kommt zum Schluß. Es gilt, mit geschlossenen Augen in gewöhnlichem Schritt durch die Spiralgänge zu gehen. Haben wir alle 4 Uebungen geschafft, so können wir uns ein »Haus« einrichten. Das ist ein abgestrichener Kasten mit unserem Namen, wo wir uns beim weiteren Spiel ausruhen können. Dieser Kasten darf von den anderen Spielern nicht betreten werden. Bei der vierten Uebung rufen die Mitspieler dem Schreitenden »Halt« zu, wenn er vor einem fremden Haus steht, damit er dieses überschreiten kann. Steht er vor seinem eigenen Haus, rufen die Mitspielenden: »Haus!« Wenn er dort eingetreten ist, darf er die Augen öffnen und sich orientieren. Es ist daher zweckmäßig, sich möglichst am Anfang der Schnecke das erste Haus zu bauen. Ist die Schnecke ganz mit Häusern ausgefüllt, so hat das Spiel, meist erst nach Stunden(!), ein Ende, und wer die meisten Häuser hat, ist Sieger. Hat einer beim Hüpfen oder Schreiten die Spirale oder ein fremdes Haus berührt, so muß er die Uebung von neuem beginnen.
Uns haben diese Spiele immer große Freude bereitet. Die kleine M. war mit solchem Feuereifer dabei, daß sie sich' einmal lahm hüpfte und am nächsten Tag keinen Schritt gehen konnte.
Vor manchen Häusern durften wir nicht spielen. Da öffnete sich gleich ein Fenster, und auf die harmlos Spielenden entlud sich eine Schimpfkanonade, weil das so schön blank gescheuerte Trottoir durch die Kreidemalerei »verrungeniert« worden war. Die Frauen, die so schimpften, hatten kein Kind dabei und wohl auch vergessen, daß sie in ihrer Jugend genau so gespielt haben wie wir.
Wir Kinder fühlten uns im Krummen Bruch auch sonst recht heimisch. Wir waren eigentlich überall zu Haus und besuchten bald diesen, bald jenen Nachbar.
Gern ging ich rüber zu Meister Busch. Der schusterte in einem großen, freundlichen Zimmer, das gegen Süden lag und Ausblick gewährte auf einen weiten Hof und einen sich dahinter erstreckenden Garten. Dieses Zimmer war geradezu ideal aufgeteilt. An der Fensterseite diente die eine Ecke als Werkstatt, wo Meister Busch mit seinem Schusterschemel auf einem hohen Thron saß. Die andere Ecke war als Wohnzimmer eingerichtet mit einem gemütlichen Sofa, dazu Tisch und Stühle und an der Wand ein Bauer mit einem Kanarienvogel. Wenn er auch nicht sang, so machte er doch dadurch Freude, daß er hin und wieder ein kleines weißes Ei legte. Was nun noch von dem Zimmer übrig blieb, war Küche. Hier zierten blitze-blanke Zinnteller die Wand. Es herrschte überhaupt im ganzen Raum eine mustergültige Ordnung und eine geradezu beängstigende Sauberkeit. Dafür sorgte die »Buschhexe«, wie wir im geheimen die tüchtige Frau unseres väterlichen Freundes nannten. Bei unseren Besuchen empfing sie uns immer streng verweisend: »Habt ihr euch abgetreten?« Auch sorgte sie dafür, daß unsere Besuche nicht allzu lange dauerten. sie schob uns dann einfach ab, denn der Meister mußte ja schließlich auch arbeiten. Nachbar Busch war ein großer Kinderfreund und konnte wundervoll erzählen. Das Ehepaar selbst hatte keine Kinder, und so stellten wir uns wie von selbst, als seine kleinen Freunde ein.
Eines Sonntags hatte mir meine Mutter einen neuen blauen Samtanzug angetan. Es war selbstverständlich, daß ich damit gleich zu »Onkel« Busch rüberging, um mich bewundern zu lassen. Frau B. mußte natürlich wissen, woher und wie teuer, und so richtete sie wie gewöhnlich die Frage an mich: »Den Anzug hast du doch sicher von M...s geschenkt bekommen?« Damit wollte sie meinen Widerspruch hervorrufen, und ich fiel auch prompt darauf hinein und erzählte munter, wo er gekauft war und was er gekostet hatte. Als ich nun etwas überhastig den Schusterthron besteigen wollte, – Onkel Busch sollte den feinen Samt befühlen – plumpste ich in meiner ganzen Größe in den großen Wasserbottich, in dem das Sohlenleder aufgeweicht wurde. – Es war für meine Mutter kein erfreulicher Anblick, als sie ihren untergetauchten »Sonntagsjungen« wiedersah. Und selbst meinem Hemd hatte der Samtanzug von seiner schönen blauen Tönung abgegeben.
Dieser kleine »Rein«fall hat aber meiner Freundschaft mit Onkel Busch nicht beeinträchtigt. Ich war schon an einem der nächsten Tage wieder bei ihm. Da schob er den Lederbottich sorgsam beiseite. Es war ja auch zu schön bei ihm wenn das Kanarienweibchen piepte und er in den Lichtreflexen der geheimnisvollen Schusterkugel hämmerte. Sie hing wie eine strahlende Sonne vor seiner Petroleumlampe. Ich schaute sie wie ein größeres Wunder an, als heule unsere Enkel die bunten Lichtreklamen in den Großstadtstraßen betrachten würden. Und geheimnisvoll und interessant war seine Arbeit selbst. Da wurde das starke Sohlenleder mit einem breiten Hammer geklopft. Das Oberleder wurde aus großen, glänzenden Stücken geschnitten, zusammengenäht und kunstvoll über den Leisten gespannt. »Pekedraht« wurde aus Pech und Bindfaden gedreht. Mit dem Schusterpech spielten wir Kinder gar zu gern, wenn wir auch schwarze Finger davon bekamen. Aber wir erhielten nur selten eine Kugel zum Spielen.
Wie groß war da eines Tages meine Freude, als ich vor der Haustür des Nachbarn eine ganze Menge kleiner Pechkugeln fand. Ich sammelte sie schnell auf, steckte sie in meine Hosentasche und übergab den Fund bis auf einen kleinen Rest, den ich für mich zum Spielen zurückbehalten wollte, Onkel Busch als Ueberraschungsgeschenk. Er war auch sehr überrascht. Die Kugeln stammten von Ziegen, die vorbeigetrieben worden waren. Ich war recht ernüchtert.
Ein anderer Handwerksmeister, zu dem wir uns hingezogen fühlten, war Buchbindermeister Eichner mit dem Seehundsbart. Seine Werkstatt war eng und bot wegen der Stöße von Büchern, Pappen, Mappen und Druckbogen ein wüstes Durcheinander. Aber wir fanden trotzdem dazwischen Platz und lauschten seinen Erzählungen. Herr Eichner war lange Zeit als Handwerksburschen gewandert. Und was er da alles erlebt hatte, das war für uns spannender als die Märchen aus »Tausend und einer Nacht«. In seiner Arbeit ließ er sich dabei nicht stören. Seine große Schneidemaschine, mit der er die hohen Papierstöße zerschnitt, kam uns vor wie eine Guillotine. Das ging alles so schnell, daß wir mitunter Angst bekamen, er würde seine Finger mit abschneiden.
Dem Hause gegenüber war eine Schmiede. Da mußten wir erst durch einen Torweg gehen. Die Schmiede selbst befand sich hinten auf dem Hof. Wenn das Feuer loderte und der Blasebalg quietschte, kamen uns die angeschwärzten Schmiede wie Sagengestalten vor. Dazu das Sprühen der Funken und das Pochen der schweren Hämmer. Wir glaubten uns wirklich im Märchenland, wo Brünnen und Schwerter für Drachentöter geschmiedet wurden.
Brauchten wir zu unserem Soldatenspielen Lanzen und Schwerter, so half uns »Onkel« Niemeyer in seiner Tischlerei hinter dem damals noch im Krummen Bruch blühenden Zwetschenbaum. Mehr noch als heute war die Straße von Handwerkern bewohnt. Sie haben uns manchen praktischen Hinweis für das Leben gegeben, und mit kindlicher Neugier bewunderten wir sie bei ihrem fleißigen Schaffen.
Auch mein väterlicher Betrieb war damals fast rein handwerksmäßig aufgezogen. Die einzige Maschine war eine »Schnell«presse aus dem Jahre 1870, die mit einem Gasmotor angetrieben wurde. (Staune, Leser, sie arbeitet heute noch!) Auf ihr wurden sämtliche Drucksachen, auch das »Wochenblatt«, das Montag, Mittwoch und Freitag abend erschien, hergestellt. Sie wurde bedient von dem Maschinenmeister Carl Heinzmann, der schon bei dem Vorgänger meines Vaters, Ferdinand Einschlägel, gearbeitet hatte und noch getreu seine Pflicht erfüllte, als ich später in den Betrieb eintrat. Die Zeitungen trug der gute dicke Eichler mit seiner Familie aus. Da das Zeitungsabonnement für Abholer einige Pfennig billiger war, wurde ein großer Teil der Zeitungen aus der Geschäftsstelle, damals nur das Haus Nr. 34, abgeholt. Zu diesem Zweck wurde ein schweres Eichenbrett auf einen Holzbock gelegt und dieser in die offene Haustür gestellt. Ein Schuljunge der 1. Klasse hatte eine große Liste mit Namen vor sich und gab jedem Abholer einen Strich. Er hatte aber auch eine Kasse zu führen, denn viele Abholer bezahlten jeden Abend ihre 5 Pfennig für die neueste Zeitungsnummer.
Nebenan von uns wohnte mein liebster Spielkamerad Emil J. Im ersten Weltkrieg ist er gefallen. Sein Vater war Bote in einer Fabrik und kam abends immer mit einer großen, breiten Karre nach Haus, die nachts auf der Straße stehen blieb. Auf diese Karre sind wir oft geklettert und damit gefahren. Fast jeden Abend, wenn Vater J. mit seiner Karre bei Grubers um die Ecke bog, sprangen wir ihm entgegen und wurden von ihm bis vor die Haustür kutschiert. Wenn Emil von »Deppen« für 2 Pfennig Senf in einem Tassenkopf holen mußte, ging ich natürlich mit, denn wir bekamen zusammen ein »Zuckerbolchen« zu! Dies »Bolchen«, auf das wir beide Anspruch nahmen, wurde dann solange auf das Trottoir geworfen, bis es in kleinste Stücke zersprang. Appetitlich war das zwar nicht, indessen konnten wir nur auf diese Weise ehrlich teilen.
Im Herbst besorgten wir uns von Pötte-Meyer oder von Meines Runkschen. Die höhlten wir aus, schnitzten in die Außenseite eine Teufelsfratze und stellten ein Licht hinein. Die anderen Jungen taten das gleiche, und bald bewegte sich ein Dutzend glühender Teufelsköpfe wie ein Höllenspuk auf der Straße. Wenn es dunkel geworden war, und wir nach Haus gerufen wurden, stellten wir die Rübenlaternen in die Fensterbank. Alle Vorübergehenden hatten an dieser eigenartigen Illumination ihre helle Freude. Damals war noch niemand auf den Gedanken gekommen, zu rufen: »Licht aus!«
Kam die Zeit des Schweineschlachtens, dann erhob sich in den frühen Morgenstunden bald auf diesem, bald auf jenem Hof im Krummen Bruch ein schreckliches Gequieke. Denn wer sein Schwein selbst gemästet hatte, durfte es auch abstechen und brauchte es nicht nach dem Schlachthaus zu fahren. Wir Jungen wurden aufgefordert, das Schwein beim Abstechen am Schwanz festzuhalten. Aber mit Grausen wandten wir uns ab. War das Schwein tot, so baten wir um den kleinen Ringelschwanz. Wir konnten es nicht lassen, ihn irgend einem großen Mädchen heimlich anzustecken, das so Heiterkeit auf der Straße erregte, ohne zu wissen, wodurch. »Unser« Schwein kam stets tot ins Haus, denn wir hatten es ja nicht selbst fett gemacht. Im Waschhaus wurde ein großer Hackeklotz aufgestellt, auf dem zwei Männer mit dem schweren Wiegemesser das Fleisch zu Mett verarbeiten, denn einen Wolf zum Durchdrehen hatte man noch nicht. Währenddessen brodelten im Waschkessel Fett- und Fleischstücke für die Rot-, Weiß- und Leberwurst und für die Sülze. Sämtliche Wurst wurde in Därme gedrückt. Das Konservieren in Dosen und Gläsern kannte man noch nicht. Wenn wir ein neues Mädchen hatten, machte sich der Hausschlachter den Scherz, es auf die Nachbarschaft zu schicken, um einen »Darmhaspel« und eine »Sülzenpresse« zu holen. Die Nachbarn verstanden den Spaß und verwiesen das Mädchen von einem zum andern. Wenn es dann schließlich mit leeren Händen zurückkehrte, wurde es tüchtig ausgelacht. Für uns Kinder waren die Schlachtefeste im Krummen Bruch recht einträglich. Wir bekamen von den schlachtenden Nachbarn kleine Weißwürste, die wir auch ganz allein verzehrten. Ich entsinne mich, daß meine gute Mutter stets an die 30 solcher Würste machen ließ, die an die Kinder von Bekannten und Nachbarn verschenkt wurden. Allein sieben Stück kamen in das Elternhaus meines Freundes Gockel, der sechs Geschwister hatte.
Zu Fastnacht erfüllte die Straße ein anderer Lärm. Pferde zogen Baumstämme, auf denen zwei Räder hintereinander so angebracht waren, daß sie links oder rechts auf dem Pflaster schleiften und sich dadurch drehten. Auf diesen Rädern hockten je zwei Fuhrleute in blauen Kitteln, Masken vor dem Gesicht und eine Schnapsflasche in der Hand. Es war ein wahrer Höllenspektakel, wenn die Fuhrleute auf ihren Teufelsrädern vom Spritzenhausplatz in den Krummen Bruch einbogen und über das holprige Pflaster rumpelten. Wir Jungen waren begeistert. Jedesmal gab es ein großes Hallo, wenn ein solcher »Über Berg und Tal«-Fahrer herunterpurzelte und mit vereinten Kräften wieder auf sein kreisendes Rad gehoben wurde.
Wenn ich nun dauernd von dem Erleben im Krummen Bruch erzähle, so bekommt der Leser den Eindruck, als hätte es daneben eine Schule gar nicht gegeben.
Das war aber leider nicht der Fall. Und meine geduldige Mutter hat selbst noch die lateinischen Vokabeln mitlernen müssen, um mich zu überhören. Ein Wort konnte und konnte ich nicht in den Kopf bekommen, obwohl meine Mutter es mir xmal vorgepredigt hatte. Als sie nach einer kurzen Unterbrechung mich wieder danach fragte und ich es schon wieder nicht wußte, antwortete die Stimme meiner fünfjährigen Schwester, die im Hintergrund mit ihren Puppen spielte: »Repudiare«. Sie hatte besser aufgepaßt als ich.
Die Wissenschaften zogen mich in Sexta nicht besonders an. In den folgenden Klassen blieb mein Wissensdurst auch nur bescheiden. Die Pausen zwischen den Unterrichtsstunden hatten es mir mehr angetan. Damals gab es noch Spiele, an denen die Klassen Sexta bis Obertertia geschlossen teilnahmen. Das eine war der »Kampf um die Burg«.
Mit »Burg« bezeichneten wir die Terrasse an der Mauer beim Eingang nach dem Schulhof. Diese war mit Lindenbäumen bepflanzt. Heute ist die Terrasse abgetragen, und nur eine Steinpackung deutet an, wo sie einst gewesen. Diese Burg wurde gewöhnlich von den unteren Klassen besetzt und verteidigt. Die Mittelklassen aber setzten zum Sturm an und beförderten die »Füchse« (Sextaner mit brauner Mütze), »Frösche« (Quintaner mit grüner Mütze) und »Veilchen« (Quartaner mit blauer Mütze) über die Mauer. Ja, die Kämpfe zogen sich zeitweilig bis zum Spritzenhausplatz hin. Wir waren von diesen Kampfspielen begeistert – unsere Lehrer nicht. Und mit einem Mal wurde das Betreten der Burg und des hinteren Schulhofes Alte Northeimer Straße) den Schülern verboten.
Es folgte nun ein anderes gemeinsames Spiel, an dem sich wieder alle unteren und mittleren Klassen beteiligten. Das war das Ball treiben.
Ein »echter« Gasball – die blauen waren besser als die roten – wurde von der einen Partei nach vorn geworfen, und die andere Partei warf ihn zurück. So wogte der Kampf von der Schulhofmauer an der Dörgestraße bis zur Turnhalle hin und her. Hier galt es vor allem, tüchtige »Einzelkämpfer« zu finden, d. h«. Schüler, die besonders weit werfen konnten. Das waren u. a. Carlos S., Schläger R. und Metje T. Lange hat aber auch diese Freude nicht gedauert. Der Schulhof wurde weiter eingeengt und das Balltreiben untersagt. 10 Lehrer genügten anscheinend nicht, uns zu beaufsichtigen. Das »verlorene Paradies« lag zwischen den »Fröschen« und der Turnhalle.

Diese Frösche sind weder Reptilien noch Quintaner, sondern zwei runde, etwa ein Meter hohe Sandsteinsäulen, von denen je eine vor dem Direktorhaus und vor dem Zeichensaal steht. Für uns hatten sie einen besonderen Zweck (ihr eigentlicher ist mir unbekannt). Wer sich eines unkameradschaftlichen Verhaltens schuldig gemacht hatte, wurde von seinen Mitschülern über den Frosch gelegt und tüchtig verbläut.
Vergessen hätte ich bald, die Schneeballschlachten zu erwähnen, die mit großer Erbitterung zwischen »Schulhof« und »Kurpark« ausgetragen wurden. Die Schulhofmannschaft bestand, aus den Klassen Sexta bis Obertertia, die Kurparkmannschaft aus den Sekunden und Primen. Sobald eine Unterrichtsstunde zu Ende war, lief alles die breite Treppe hinunter ins Freie. Die Schüler der unteren und mittleren Klassen bildeten eine enge Gasse zwischen Freitreppe und Kurparkeingang und ließen die Primaner und Sekundaner Spießruten laufen, d. h., jeder die Gasse Durchlaufende wurde mit Schneebällen bedacht. Sobald aber die Sekundaner und Primaner vollzählig im Kurpark waren, erscholl aus ihren Kehlen der Kampfruf: »Sturm«, und in geschlossener Phalanx ging es zurück auf den Schulhof. Wer nicht schnell genug flüchten konnte, wurde in den Schnee geworfen und »gewaschen«, oft so, daß die Nase blutete. Das hatte zur Folge, daß das Stürmen bald abgeblasen wurde. Aber wenn dann im folgenden Jahr Frau Holle neues Material für Geschosse geliefert hatte, waren alle Verbote vergessen, und die Schneeballschlachten begannen von neuem.
Wurde ein Sextaner in das Direktorzimmer befohlen, so war das schon ein besonderes Ereignis und bedeutete für gewöhnlich nichts Gutes. Wir besuchten die Anstalt noch kein Vierteljahr, als eines Morgens unser Primus und ich zum Direktor gerufen wurden. Als wir noch nichts ahnend vor der Tür seines Zimmers standen, fragte der vorbei» trippelnde« Turnlehrer – wegen seines Ganges wurde er »Trippel« genannt –: »Habt ihr was verbrochen?« »Nein«, antworteten wir seelenruhig, denn wir waren uns keiner Schuld bewußt. Die Tür ging auf, und der Direktor herrschte uns an: »Was habt ihr gemacht?« »Nichts!« antwortete der Primus, und schon hatte er eine Ohrfeige weg. »Das fängt ja gut an«, dachte ich, und mein kleines Herz begann, doch etwas lebhafter zu schlagen. Der Direktor wetterte los: »Ihr habt einen Hüter der Ordnung beleidigt!« – Langsam dämmerte es uns. Am Nachmittag vorher hatten wir bei einem Klassenkameraden, der in der Bergbrauerei wohnte, Geburtstag gefeiert. Als wir dort im Garten Schokolade tranken und Kuchen aßen, sahen wir von weitem den »Pender« mit seinem Hund über einen Wiesenweg gehen. Es war der berüchtigte Feldhüter, der im Volksmund Barnabas genannt wurde und eine geradezu krankhafte Neigung hatte, jeden anzuzeigen oder anzubrüllen, den er im Bereich der städtischen Schonungen antraf. Ein bekanntes Osteroder Original, der Ackerbürger Wilhelm Fraatz auf der Neustadt, hatte ein Spottlied auf ihn verfaßt, das nach der Melodie »Ich bin der kleine Postillon« von alt und jung gesungen wurde, woimmer Barnabas auftauchte. Auch wir hatten daher bei seinem Erscheinen aus vollem Halse den Kehrreim gesungen:
Drum, ihr lieben Leute, merkt euch das,
wie schlecht ist dieser Barnabas.
Wenn er dazu kommen kann,
so zeigt er jeden an!
Da wir uns in der Gartenlaube so sicher fühlten, wie die Ziege auf dem Dach, hätten wir nicht im entferntesten daran gedacht, daß Barnabas uns erkennen und anzeigen würde. Gleich bei Schulbeginn war er in aller Frühe zum Direktor gegangen und hatte den Namen des Geburtstagskindes angegeben. Alle Festteilnehmer erhielten eine Stunde Arrest; es war fast die ganze Klasse. So hatten wir noch eine unerwartete Nachfeier!
Die Unterrichtsstunden in Sexta sind fast gänzlich aus meinem Gedächtnis verschwunden; nur die Naturgeschichtsstunden bei Professor Dr. Wilhelm A. machen eine Ausnahme. Damals schon ein älterer Herr, war er der einzige Träger des Professortitels. Er wurde daher auch kurz nur der » Professor« genannt. In einer der ersten Unterrichtsstunden führte er uns ein richtiges Menschenskelett vor, und wir mußten erst ein gelindes Grauen überwinden, bis wir selbst die Knochenhände und den Schädel berührten. Ja, wir bewunderten den Mut unseres Mitschülers – er hatte die Sexta schon einmal, wenn auch ohne Erfolg, durchlaufen – der dazu ausersehen war, das Knochengerüst aus dem Naturalienkabinett, das sich damals hinter dem Konferenzzimmer befand, in die Klasse zu tragen. Weniger interessierte uns die Zahl der Wirbelknochen und Rippen, als die Tatsache, daß das Skelett von einer jungen Seiltänzerin stammte, die in der Göttinger Anatomie seziert worden war. Wir spürten hier eigentlich zum ersten Mal die Nähe des Todes. Wir sahen im Geist ein hübsches junges Mädchen auf dem Seil balanzieren und dachten dabei an die Seiltänzerfamilie Strohschneider, die zu jener Zeit ein gewaltiges Seil über den Markt gespannt hatte und uns mit ihrer eleganten Kunst erfreute. Wir grübelten darüber nach, auf welche Weise »unsere« Seiltänzerin wohl den Tod gefunden, ob sie abgestürzt sei und dabei das Genick gebrochen habe. Und so lag während des Unterrichtes ein schwerer Traum auf der ganzen Klasse, der erst nach und nach durch die freundliche Art des Lehrers verscheucht wurde.

Der Professor
Gern unterstrich unser Professor die Bedeutung seiner Persönlichkeit, indem er sich uns als früheren Assistenten des »großen Wöhler« in Göttingen vorstellte, dem bekanntlich dort ein Denkmal gesetzt worden ist. Prof. A. führte uns in die heimatliche Flora ein. Seine Unterrichtsstunden zählen mit zu den schönsten Jugenderinnerungen. Er war uns wie ein guter Onkel. Und blieb es auch bis in die höheren Klassen, wo wir es ganz selbstverständlich fanden, von ihm weiter mit »du« angeredet zu werden.
Daß es meinem Jahrgang nicht allein so ging, davon zeugen die in diesem Abschnitt eingefügten Strophen aus Gedichten ehemaliger Schüler (Armin Werner und Robert Degering), die schon in 80er bzw. 90er Jahren Naturkunde bei dem gleichen Lehrer hatten.
Doch an
einem Fache hingen
alle wohl mit Zuversicht,
schätzten wir vor allen Dingen
stets doch die Naturgeschicht'.
Und so waren auch wir mit großem Eifer dabei, als wir in der Naturgeschichtsstunde mit botanischen Untersuchungen begannen, die sich freilich in den einzelnen Klassen kaum von einander unterschieden. Das erste Objekt unserer Betrachtungen war stets der Bote des Frühlings, das Schneeglöckchen (galanthus nivalis).
Jedes Jahr als erste Blüte
wurd' das Schneeglöckchen gewählt,
und stets wurd' – du meine Güte! –
lustig dann drauflos »gezählt«.
Ganz besonders wurd' zerleget
der botan'sche Nam' mit Fleiß,
und wohl jeder von uns lieget
als der Mühen höchsten Preis:
»gala« sollst als »Milch« du nennen,
»anthos« merk' als Blume dir,
und »nix-nivis« sollst du kennen
als den Schnee, des Winters Zier!
Dann folgten Buschwindröschen, Sumpfdotterblume, Wiesenschaumkraut, Ehrenpreis, weißer, gelber und roter Bienensaug usf. Wir schleppten ungeheure Mengen herbei. Die Klasse hätte ganz gut eine Milchkuh davon halten können. Im Anfang hatte es für uns auch noch Reiz, die Pflanzen zu pressen und uns ein Herbarium anzulegen.
Man klebte ins Herbarium
des Harzes bunte flores,
monandrium, diandrium,
o tempora, o mores!
Mit dem Pressen der Blüten und Blätter verdarben wir uns aber bald sämtliche Bücher. Auch hielten die zart gepreßten, hauchdünnen Pflanzenmumien unseren fest zupackenden Jungenhänden nicht stand und zerfielen in unansehnliche Heureste. So hatten dann die Herbarien bald das Zeitliche gesegnet.
In den höheren Klassen unterrichtete der Professor uns in Chemie. Er warf Kalium oder Natrium ins Wasser. Das gab einen Knall und sonstige kleine Zwischenfälle. Dann schrieb er eine Formel an die Tafel, über deren Entstehung wir aber stets im Dunkeln blieben. Oder er goß Schwefelsäure auf Zink und erzeugte zu unserer Verwunderung ein brennbares Gas. In Prima hatten wir jeder unseren eigenen Experimentiertisch. Da stank es dann fürchterlich, und noch fürchterlicher wurde geknallt. Es war Ehrensache, daß wir auch zu Haus eifrig Experimentierversuche unternahmen. Die Bunsenbrenner, Reagenzgläschen und Chemikalien lieferte dazu die Schule, wenn sie auch selbst davon nichts wußte. Wir waren nun einmal solch strebsame Schüler, die von sich aus mehr taten, als ihnen die Schule aufgab!
Nachdem mein Freund Gockel, der in seinen privaten Experimentierversuchen schon sehr weit fortgeschritten war, in die häusliche Waschschüssel ein fast faustgroßes Stück Kalium geworfen hatte, war er für längere Zeit experimentierunfähig. Er hatte aber auch eine unvorhergesehene Wirkung erzielt. Mit einem Donnerschlag zerstieb das Kaliummetall. Die Waschschale zersprang, und die zertrümmerte Fensterscheibe fiel klirrend auf die Straße. Ihm selbst flogen zerberstende heiße Kaliumstücke ins Gesicht. Wie durch ein Wunder ist ihm das Augenlicht erhalten geblieben.
Schularbeiten machte ich beim Besuch der unteren Klassen im Hause unseres Gesanglehrers, der gleichzeitig eine Schülerpension hatte. Und das kam so. Ein elternloser Junge aus Badenhausen war als kleiner Sextaner bei ihm untergebracht. Und damit jener sich nicht verlassen fühlte, bat der fürsorgliche Rektor meinen Vater, mit dem er befreundet war, daß sein Zögling und ich die Schularbeiten gemeinsam machten. So arbeiteten wir im Hause des Rektors und spielten bei uns im Garten. Wir maßen nach Jungenart unsere Kräfte. Im Boxen war mir mein Freund R. W. über, aber beim Ringen legte ich ihn stets auf die Erde.
Im Hause des Rektors gestaltete sich die Arbeitsstunde recht ersprießlich. An einem langen Tisch saßen wohl ein Dutzend Schüler aus den verschiedensten Klassen. Der Rektor hatte sich gemütlich mit seiner langen Pfeife auf dem Kanapee niedergelassen, und jeder einzelne trat nach und nach an ihn heran, um seine Lektion aufzusagen oder von ihm die schriftlichen Arbeiten überprüfen zu lassen. Wir haben dabei großen Gewinn gehabt. Wir lernten sorgfältig und selbständig arbeiten. Mitunter wurde die Tätigkeit auch durch eine gemeinsame Kaffeetafel unterbrochen. Ich denke mit Dankbarkeit an ihn und an seine Gattin zurück.
In der Schule war er streng und ahndete schnell mit einem kleinen Röhrchen. Vor Beginn der Gesangstunde (heute heißt es Musikunterricht) mußten wir unser Handwerkszeug beisammen haben und vorzeigen: Gesangbuch, Chorliederbuch und »Sang und Klang« (ein kleines Wanderliederbuch). Fehlte ein Stück, so bekamen wir eins über die Knie gezogen. Eine gesunde Gedächtnisstärkung. Im Singen kamen wir schnell voran, denn wir waren mit ganzer Seele dabei. Wir lernten die Noten kennen, und eine Auszeichnung war es, wer die zweite Stimme singen durfte. Die Schüler der oberen Klassen, welche den Stimmwechsel hinter sich halten, sangen Tenor und Baß. Ein vierstimmiger Chor wurde zusammengestellt, der bei festlichen Anlässen, wie Sedanfeier und Kaisers Geburtstag, die schönsten Proben seines Könnens gab.
Waren wir auch kein Vollgymnasium, so nahm der Lateinunterricht von Sexta bis Oberprima doch einen breiten Raum ein, und die Zensuren in Latein wogen schwer. Ich kann nicht behaupten, daß Latein meine starke Seite war. Trotzdem habe ich mich mit den Lateinlehrern nicht schlecht gestanden. Nur vorübergehend kam einmal eine leichte Trübung, an der weder das Latein, noch ich schuldig waren.
Und das verhielt sich so. Die wissenschaftlichen Lehrer unserer Anstalt trugen die Bezeichnung Oberlehrer, die technischen Lehrer Realgymnasiallehrer. Die Oberlehrer erhielten nach Ablauf gewisser Dienstjahre den Titel Professor. Das war dann immerhin ein Ereignis, und der so Ausgezeichnete wurde mit Glückwünschen und Blumenspenden bedacht. Und so füllte sich denn auch eines Tages das Haus meines Lateinlehrers mit Gratulanten und Blumen, denn in meines Vaters Zeitung hatte gestanden, daß der Herr Oberlehrer zum Professor ernannt worden sei. Die Nachricht war für alle recht plötzlich und überraschend gekommen, selbst für den Herrn Direktor, der doch eigentlich hätte im Bilde sein müssen.
Es war an sich nichts Erstaunliches, daß die Nachricht die Presse früher erreicht hatte als die amtliche Benachrichtigung den neuen Professor. Als aber das Amtsschreiben auch in den folgenden Tagen noch nicht eintraf, begab sich der neue Titelträger in die Schriftleitung der Zeitung, um die Quelle zu erfahren, aus der die Nachricht geschöpft war.
Die Quelle, die so lauter und rein erschien, erwies sich als ein Märchenbrunnen. Die Schriftleitung war auf den Till-Eulenspiegel-Streich eines früheren Schülers der Anstalt hereingefallen, der es verstanden hatte, in glaubhafter Weise die Sensationsnachricht der Zeitung zuzuleiten. Das war nun eine recht peinliche Angelegenheit. Und doch hatte sie wieder ihr Gutes. Der Vorfall wurde höheren Orts zur Sprache gebracht, und kurz danach wurde der Herr wirklich Professor, und zwar zu einem früheren Zeitpunkt, als er es sonst geworden wäre. Und damit war auch ich als Sohn meines Vaters bei ihm rehabilitiert.
Meine Leistungen im Turnen waren gleichfalls bescheiden, wenn ich es später auch zu einem guten Fechter und Reiter gebracht habe. Mir hat daher kaum ein Lehrer so imponiert wie unser Turnlehrer, der, obwohl er auf die 60 zuschritt, an dem Schiffstau frei hinaufkletterte wie ein Jüngling, ohne dabei die Beine zu benutzen. Wir Sextaner sperrten Mund und Nase auf. Er hatte uns straff in der Hand und sorgte dafür, daß auch die letzten Schlacken der »Töchterschule« von uns abfielen.
Mit Zeichnen begannen wir erst in Quinta. Unser Lehrer war ein hervorragender Aquarellmaler, und seine Rosenbilder atmeten eine solche Anmut und Natürlichkeit, daß man glaubte, den Duft zu spüren. Wir lernten bei ihm auch die Vielheit der Farben erkennen. So gab es bei ihm weder Weiß noch Schwarz. Wir schwelgten in den glühendsten Farben, wenn wir Blumen, Obst oder Schmetterlinge malten. Daneben aber führte er uns in geschickter Weise in die zeichnerische Perspektive ein, die aber trotzdem für manche ein Buch mit sieben Siegeln geblieben ist. Als Modell diente uns eine Zigarrenkiste, die wir in allen Stellungen, geöffnet und geschlossen, abzeichnen mußten. »Senkrecht bleibt senkrecht, waagerecht bleibt waagerecht, alle anderen Linien laufen zusammen.« Das war dann immer der Weisheit letzter Schluß.
Als wir im Laufe der Jahre in unserer Kunst weiter fortgeschritten waren, hatten wir zwei Zeichenstunden hintereinander. In der ersten wurde skizziert und in der zweiten wurde gemalt. Für diese zweite Stunde bauten wir uns kleine Stilleben aus Früchten und Blumen auf, die wir zu diesem Zweck mit in die Schule bringen mußten. Gewöhnlich wurden aber die Obstmodelle (Kirschen, Aepfel, Birnen, Weintrauben usw.) in der Pause verzehrt, und wir erschienen dann mit leeren Händen in der zweiten Unterrichtsstunde. Wir bekamen dafür als Strafarbeiten zehnmal das Einmalsiebzehn oder das Einmalneunzehn auf. Hatten wir die Strafarbeiten abgegeben, dann legte sie der Lehrer in die große Schublade seines Pultes. Nach Schluß des Unterrichts wußten wir uns die Arbeiten wieder geschickt anzueignen. So schufen wir uns eine stille Reserve für das nächste Mal.
Meine einzige Eins in den Leistungsfächern war Zeichnen, ein kleines Talent, das ich von meiner Mutter geerbt habe. Mir war es allmählich langweilig geworden, in der Skizzierstunde nur die Bänke und Pulte oder irgend eine Ecke des Zeichensaales abzuzeichnen. Ich belebte daher meine Zeichnungen mit den dort sitzenden Gestalten meiner Mitschüler. Als nun »zufällig« auf einer solchen Zeichnung auch unser Lehrer erschien und dessen wohl gepflegtes Bäuchlein mir etwas zu groß geraten war, zog er mich recht unsanft an den kurzen Haaren hinter dem Ohr und versetzte mir eine wohlproportionierte Ohrfeige. Dabei sagte er nur: »Straßenschlapps!« Das war sein gängiger Ausdruck höchster Mißbilligung. Ich war so zerknirscht, daß ich mich für die Folgezeit »wegen chronischer Bindehautentzündung« vom Zeichenunterricht befreien ließ. Unsere Freundschaft hat aber darunter nicht gelitten. Als das Abitur sich näherte, lud mich Herr K. herzlich zur Mitarbeit ein, und freudig sagte ich ja. Noch heute hängen meine Rosenbilder, die ich für die Abiturientenprüfung gemalt hatte, in den Räumen mir lieber Menschen.
In Quarta war »Olaf« unser Klassenlehrer. Warum er so hieß, weiß ich nicht. Seine ungelenke, hagere Gestalt, sein kahler Schädel und sein schlesischer Dialekt machten es ihm nicht leicht, daß wir ihm, die wir gerade in den Flegeljahren waren, mit dem notwendigen Ernst begegneten und seinem Unterricht folgten. Je höher wir aber die Stufen der Anstalt erklommen, um so mehr erkannten wir, welch hervorragenden Lehrer wir an ihm hatten. Und so übersahen wir bald seine Eigentümlichkeiten. Sein deutscher Unterricht hat uns viel gegeben. Er schliff und drechselte an jedem Satz, den er schrieb. Aber dann war es auch ein kleines Kunstwerk geworden. Wir waren stolz darauf, daß er ein Dichter und noch dazu ein Vetter Gerhart Hauptmanns war.
Wenn wir mit ihm Ausflüge machten – sein Lieblingsweg war nach Lonau; seine ersten Werke schrieb er unter dem Namen »Walter Lonau« – wurden unterwegs im Walde eine größere Pause eingelegt und Wettspiele veranstaltet. Hierzu hatte er dann eine Anzahl wertvoller Preise eingekauft, die an die Sieger verteilt wurden. Oder er belebte die Ausflüge durch irgendwelche interessante Einfälle. So ließ er einmal mit Stimmzetteln abstimmen, welcher Schüler wohl der beliebteste in der Klasse sei. Die meisten Stimmen vereinte Karl Lips aus Lerbach auf sich. Er ist im ersten Weltkrieg gefallen.
Olaf war auch sonst ein gütiger Mensch und unterstützte viele Arme. Selbst seinen vielgeliebten Dichterhut, der eigentlich nur zu ihm paßte, verschenkte er eines Tages an einen seiner Almosenempfänger. Das hätte er aber nicht tun sollen. Als der glückliche Hutträger einem Schüler der höheren Klassen in die Arme lief, konnte dieser dem Drang nicht widerstehen, jenem den Hut abzukaufen. Am nächsten Morgen feierte der Professor mit dem an der Tafel hängenden Hut ein unverhofftes Wiedersehen.
Zum Schluß noch eine kleine Olaf-Erinnerung aus den letzten Schuljahren. In jener Zeit durchzogen recht oft fremde Orgelmänner mit ihren Leierkästen unsere Stadt, und mancher verirrte sich auch nach dem Lindenberg. Wenn dann auf dem Schulhof »An der schönen blauen Donau« oder »Die lustige Witwe« erklangen, wurde O. nervös. Er konnte Orgelspieler nicht leiden. Und so warf er dann immer reichlich Münzen aus dem Fenster mit dem Ersuchen an den Leierkastenmann, sofort einen anderen Standort für seine musikalischen Darbietungen auszuwählen.
Unser Mitschüler Freddy aus Berlin kannte diese Schwäche des Lehrers. Und eines Tages erschien während der Lateinstunde wieder ein Orgelmann, ausgerechnet unter dem Fenster unserer Unterprima. O. zückte seine Geldbörse, warf ihm ein Halb-Markstück hinunter und bat ihn, den Schulhof zu verlassen. Der Orgelmann lüftete seinen Hut, machte eine linkische Verbeugung und – spielte weiter. Wieder trat der Professor ans Fenster. Abermals warf er dem »Künstler« ein Halb-Markstück in den Hut und forderte ihn nunmehr energisch auf, zu verschwinden. Dieser dankte wieder mit einer tiefen Verbeugung, deutete an seine Ohren, zum Zeichen, daß er nicht hören könne – und spielte weiter. Spielte immer wieder dieselbe Walze. Kurz vor dem Läuten der Schulglocke hörte er auf, klappte umständlich seinen Orgelbock zusammen, hängte sich den Leierkasten auf den Rücken und verabschiedete sich mit einem ergebenen Diener vor unserem Klassenfenster. Dann schritt er müde, schleppenden Ganges durch den Kurpark und weiter die Dörgestraße hinunter.
Zunächst waren wir über das Verhalten des Orgelmannes auch erstaunt. Als wir aber Freddys leeren Platz sahen, wußten wir Bescheid. Der Böse hatte am Tage vorher einen Orgelmann getroffen und von ihm Rock, Hut und Leierkasten geliehen. Eine Perücke mit Glatze hatte er sich bei seinem Friseur besorgt.
Wenn ich diese Schülerstreiche hier angeführt habe, so lag mir fern, damit das Andenken an unseren allseits verehrten Lehrer irgendwie herabzusetzen. »Jugend hat keine Tugend«, und oft müssen darunter gerade die Besten leiden. –
Auf Quarta folgten Untertertia und Obertertia, Jahre der echten Flegelzeit. Es waren aber auch Jahre, wo ich »für« die Schule am wenigsten gearbeitet habe. Wir spielten auf dem Uehrderberg oder weiter draußen vor der Stadt »Räuber und Landgendarm« oder auch getreu nach Carl Mays Büchern »Indianer«.
Klinkerbrunnen – Jettenhöhle,
Bremketal und Kaiserteich
liebten wir mit Herz und Seele –,
und der Wald war unser Reich. (P. K.)
Indessen trübte nicht nur die Schule diese schönsten Tage, sondern ein Ereignis, das zunächst in unserem Hause große Freude ausgelöst hatte. »Unglücklicherweise« schenkten meine Großeltern meiner Mutter ein Klavier. Und es war Ehrensache, daß ich auf dem Paradestück einexerziert wurde. Mein Exerziermeister – ich meine Klavierlehrer – sollte Kantor Kümmel werden, welcher im Küsterhaus der Marienvorstadt wohnte. Ich habe ihn bitter enttäuscht. Denn nach knapp vier Wochen, als ich wieder unvorbereitet bei ihm erschien, eröffnete er mir, lieber Holz hacken zu wollen, als mir Klavierstunde zu geben. Selig sprang ich vom Klavierbock auf, raffte meine Noten zusammen und verschwand.
Während ich nun langsam über den Kornmarkt nach Hause schlenkerte, war Herr K. in berechtigtem Zorn auf dem schnellsten Wege durch die Schildwache zu meinem Vater geeilt, um ihn von dem ungebührlichen Betragen seines Sohnes in Kenntnis zu setzen. Ich hatte kaum unseren Flur betreten, als mein Vater mir rechts und links ein paar Tüchtige hinter die Ohren gab. Aber gesiegt hatte ich doch! Mit meinen musikalischen Studien war es aus. – Dessen ungeachtet sind später meine Lieder in Konzerten und im Rundfunk gesungen. Und als mein Lied »Die allerallerschönste Zeit« in weiten Kreisen Anklang gefunden hatte, ging ich zu meinem alten Klavierlehrer, um ihn zu bitten, meine Melodie für vierstimmigen Männerchor zu übertragen, denn er war als Chormeister und Komponist eine Kapazität. Ich war nicht wenig stolz, als er mir sagte: »Ich bin von der Melodie so begeistert, daß ich meinen eigenen Namen darunter schreiben möchte!« So hat sich der »musikalische Ring« mit meinem väterlichen Freund Kümmel auf die harmonischste Art wieder geschlossen. Und gerade wegen dieser Arbeit, die die letzte vor seinem Tode sein sollte, gedenke ich seiner in herzlicher Dankbarkeit.
Doch nicht nur mein Verhältnis zur Musik mutet paradox an. Aehnlich ist es mir auch in anderen Fächern ergangen. Vom Zeichenunterricht hatte ich mich befreien lassen – und wollte eigentlich Kunstmaler werden. Meine deutschen Aufsätze erregten das Mißfallen des düsteren »Butler«, meines Deutschlehrers in Oberprima, – und trotzdem schrieb ich Bücher.
Verehrter Leser, wenn Du mir zu gut er Letzt auch noch eine schlechte Zensur für mein »Sösewasser« gibst, dann will ich lieber mit Schreiben aufhören.
Ich wage trotzdem fortzufahren ...
Neben dem Schulunterricht mußten wir in Obertertia auch noch die Konfirmandenstunde besuchen. Hier trafen wir mit unseren Spielkameraden aus der Bürgerschule zusammen. Auch nahmen die Mädchen der verschiedenen Schulen an dem Unterricht teil. Und nicht immer gaben gerade die Schüler und Schülerinnen der höheren Lehranstalten die besseren Antworten.
Wir gehörten zur Schloßgemeinde und waren dem Kantor Schaub Untertan, denn er und der Herr Superintendent konfirmierten uns. Oder vielmehr, er drohte, uns nicht zu konfirmieren, wenn wir Kinderlehre oder Konfirmandenunterricht geschwänzt oder wenn wir vor Beginn des Unterrichts, der in dem sogenannten Konfirmandenzimmer des Küsterhauses stattfand, zu laut getobt hatten. Dann erschien mitunter sogar die Frau Kantor und brachte mit strenger Miene Ordnung in die lärmende Schar.
Den Konfirmandenunterricht selbst hielt Superintendent G. ab, ein gütiger Mensch, den wir alle liebten und auf dessen Worte wir bauten.
Acht Tage vor der Konfirmation fand in der Kirche die Konfirmandenprüfung statt, bei welcher die ganze Gemeinde Zeuge davon sein sollte, was wir im Konfirmandenunterricht gelernt hatten. Vor dieser Prüfung hatten wir gewaltigen Druck. Die zehn Gebote mit den Erklärungen, die Glaubensartikel, die Sakramente, die sieben Bitten, Bibelstellen und Gesangstrophen mußten sitzen. Ich habe immer schlecht auswendig lernen können – und mir dabei auch wenig Mühe gegeben –, so daß ich bei der Konfirmandenprüfung bestimmt nicht geglänzt hätte. Der Superintendent half mir über diese Klippe hinweg, indem er mich bei der Prüfung nach der Inschrift über dem Kreuz fragte. Die vier Buchstaben I. N. R. I. wußte ich, und sie aus dem Lateinischen übersetzen, war nicht schwer. So überstand ich auch diese Prüfung, ohne daß sich meine Eltern ihres Sohnes zu schämen brauchten.
Daß die Prüfung eine besondere Begebenheit war, kam schon durch die Kleidung der Konfirmanden zum Ausdruck. Die Mädchen trugen zum ersten Mal lange Kleider und wir lange Hosen. Die einzelnen Schulen unterschieden sich wieder voneinander. Die Gymnasiasten trugen blaue Anzüge und die farbige Schülermütze. Die Bürgerschüler meist gemusterte Anzüge und den schwarzen Konfirmandenhut. Die Mädchen aus der Töchterschule bevorzugten weiße Kleider, während die Mädchen aus der Bürgerschule farbige Gewänder liebten. Wir kamen uns in unserem »Staat« zum ersten Mal wie Erwachsene vor.
Zwei Tage vor der Konfirmation wurden die Fichtenbäume für die Haustüren der Konfirmanden geholt. Dazu fuhren wir Jungen mit einem Gespann nach Fuchshalle, wo die Bäume schon geschlagen waren. Hier luden wir sie auf, und dann ging es in die Stadt zurück nach den Häusern unserer Mitkonfirmandinnen, wo wir rechts und links von den Haustüren je ein Bäumchen annagelten.
Es gab damals noch Klassenplätze. Und in dieser Reihenfolge saßen wir auch in der Konfirmandenstunde. Die Mädchen ebenfalls. Das Mädchen auf dem ersten Platz war der »Gegenpart« des Jungen auf dem ersten Platz usf. So hatte jeder seinen Gegenpart. Und diesem Gegenpart brachte jeder Konfirmand die Hausbäumchen, sich selbst natürlich auch. Truppweise scharten sich die Jungen zusammen, um sich gegenseitig beim Anschlagen der Bäume zu helfen. Und truppweise wurden sie in den Häusern der Mitkonfirmandinnen mit Wein und Kuchen belohnt. Das wurde uns kleinen Kavalieren reichlich viel, denn wir mußten ja an mehr als ½ Dutzend Häusern Bäume anschlagen.
Am nächsten Vormittag war Beichte, wo sich nur die Konfirmanden mit dem Geistlichen in der Kirche versammelten. Alle Kinder schwarz gekleidet. Die Gymnasiasten trugen sogar um die Schülermütze einen schwarzen Ueberzug. Das Ganze machte einen erschreckend düsteren Eindruck. Es war damals noch Sitte, daß die Kinder vor der Beichte zu ihren Paten, Verwandten und Bekannten gingen und ihr Sprüchlein aufsagten: »Wenn ich dir etwas zu Leide getan habe, so vergib es mir!« Man kam sich dann wirklich wie ein armer Sünder vor.
Ich muß nun hier ein Erlebnis einschieben, das ich als sechsjähriger Bub hatte. Martha, deren Eltern mit unserer Familie besonders befreundet waren, erscheint gegen 8 Uhr morgens bei uns in ihrem schwarzen Büßerkleid. Bleich wie der Tod ist das arme Mädchen. Sie wird in unser Wohnzimmer geführt, um auf meine Mutter zu warten, die gerade oben in der Kammer meine kleine Schwester wäscht. Martha setzt sich auf einen Stuhl und rührt kein Glied. Ich bin allein mit ihr im Zimmer. Auf irgend eine Frage von mir antwortet sie nicht. Sie stiert immer nur geradeaus. Mir kommt sie allmählich unheimlich vor, und ich denke schließlich, sie ist wirklich erstarrt. Da tauche ich einen Federhalter umgekehrt in das auf dem Sekretär stehende Tintenfaß und tippe mit dem dicken Ende leise an Marthas Backe. Sie rührt sich nicht, auch nicht, als ich ihr über die andere Backe einen breiten Tintenstreifen ziehe. Indem betritt meine Mutter das Zimmer. Martha sitzt in ihrer schwarzen Tracht mit schwarzem Tintenschnurrbart auf dem Stuhl. »Um Gottes Willen, Martha«, bricht meine Mutter endlich das Schweigen, »was hast du denn gemacht?« »Das hat Hänschen getan«, antwortet das Mädchen, als sei es das Natürlichste auf der Welt. Die gute Martha war vor ihrem Gang zur Beichte innerlich so ergriffen, daß sie die Außenwelt ganz vergessen hatte. –
Am Tage der Konfirmation war die Kirche überfüllt, denn auch die Paten von nah und fern waren zu der Feier erschienen. Tief bewegt hat mich das Lied: »Mein Schöpfer steh' mir bei«, welches von uns Konfirmanden allein gesungen wurde. Selbst die Orgel schwieg. Wir waren mit reinem und gläubigem Herzen dabei. Der Glaube unserer Kindheit ist etwas Heiliges, ein Schatz, den uns niemand entreißen kann.
Von der Kirche begaben wir uns nach Haus. Hier stellten sich bald die ersten Gratulanten ein, und reich wurde ich mit Blumen und anderen Geschenken bedacht. Und dann folgte eine richtige Familienfeier, wo an Essen und Trinken nicht gespart wurde.
Die überflüssigste Person war dabei der Konfirmand selbst. Bei den Kindern saß er nicht mehr, und zu den Erwachsenen paßte er auch noch nicht. Ich hatte u. a. von einem Paten eine silberne Zigarettendose geschenkt bekommen. Selbstverständlich waren auch Zigaretten darin. Und so war es auch ganz natürlich, daß ich mir, als die Tafel aufgehoben wurde und die Herren sich eine Zigarre anzündeten, aus dem Etui eine Zigarette nahm und mir ansteckte. Und es wäre nicht natürlich gewesen, wenn mein Vater mir nicht seinen väterlichen Segen in Gestalt einer Ohrfeige verabfolgt hätte. Das hat aber dem Sinn der Feier keinen Abbruch getan.
Den Beschluß der Konfirmation machte die Nachfeier in »Villa Cludius« (das Gartenlokal ist inzwischen abgebrannt. Es stand auf dem jetzigen Hullenschen Grundstück), wohin die Schloßkonfirmanden mit Eltern und Paten hin auswanderten und wo man sich zu einer gemeinsamen Kaffeetafel bei mitgebrachtem Kuchen vereinte. Hier wurden kindliche Spiele veranstaltet wie Drittenabschlagen, Blindekuh, »Alle Bäume wechseln sich« und »Dreht euch nicht um, der Plumpsack geht rum«. Zum Abschied trafen wir uns noch einmal in dem Konfirmandenzimmer. Hier überreichte der Superintendent jedem von uns den für ihn bestimmten Konfirmationsspruch auf einem farbig gedruckten Bogen. Eingerahmt wird er noch in manchem Osteroder Hause hängen und an längst vergangene Zeiten erinnern.
Villa Cludius ruft in uns noch eine andere Jugenderinnerung wach. Dort brannte am Abend des ersten Ostertages unser Osterfeuer. Es war ein wundervoller Anblick, wenn auf den Bergen ringsum und in weiter Ferne im Sösetal die Feuer zum Himmel auflohten und zahllose Fackeln geschwenkt wurden, als tanzten sprühende Teufelchen. Mit zäher Ausdauer hat sich dieser alte Brauch erhalten.
In Osterode bauten die nächstjährigen Konfirmanden jedes Jahr drei Osterfeuer auf: die der Schloßgemeinde bei Villa Cludius, die der Marktgemeinde auf der Bleichestelle und die Marienvorstädter auf dem Röddenberg. Eine riesige Fichte wurde errichtet und um ihren Stamm ein großer Reisighaufen aufgeschichtet. Das Geld für die Fichten und das Anfahren des Reisigs sammelten die Jungen in den Häusern.
Bevor die aufgebauten Osterfeuer angezündet wurden, mußten sie bewacht werden, damit sie nicht von Jungen anderer Gemeinden aus Schabernack vorzeitig angesteckt wurden. Das gab besonders Schlägereien zwischen den Osterodern und den Freiheitern, die ihr Feuer auf dem Butterberg hatten.
Als Fackel diente ein Fichtenstamm, welcher der Länge nach mehrmals aufgespalten wurde. Das dünnere Ende, glatt behauen, war der Stiel. In die Spalten steckten wir kleine Holzkeile und trugen dann die Fackel einige Tage vor Ostern zum Bäcker, der sie hinter den Backofen stellte, damit das Holz recht trocken wurde. Am Ostersonntag stopften wir in die durch das Spalten entstandenen Hohlräume Holzspäne. Das erleichterte das Anstecken der Fackel. Dann ging es die Höhe hinauf nach Villa Cludius zu, etwa dorthin, wo jetzt die Siedlung Dreilinden beginnt.
Gewöhnlich waren die Fackeln so lang und so schwer, daß die Väter sie bis zum Feuer tragen und so lange schwenken mußten, bis wir sie selbst regieren konnten. Bei dem Osterfeuer war immer ein mächtiges Getümmel. Funken flogen nach allen Seiten in die Luft, und man mußte scharf acht geben, daß die Kleider nicht versengt wurden. Große Freude bereitete es uns, mit dem verkohlten Holz den Mädchen heimlich die Gesichter schwarz zu machen.
War das Osterfeuer so weit niedergebrannt, daß der in dem Reisighaufen errichtete Baum umstürzte, so bedeutete das den Schluß. Die meisten Fackeln waren dann auch schon erloschen. Nun ergriffen die Jungen den Stamm und zogen singend mit ihm durch die Straßen:
»Ein freies Leben führen wir,
ein Leben voller Wonne.
Der Wald ist unser Nachtquartier,
der Mond ist unsre Sonne.
Eins, zwei, drei.
wir wollen lustig sein!
Lustig, wie die Vögel singen
und im Wald die Rehe springen!«
Mit besonderer Wonne kam dann der Nachsatz (die Freiheiter sangen ihn umgekehrt):
»Die Städter hab'n den Sieg gewonnen,
die Freiheiter hab'n die Schläg' bekommen!«
Dieses seit Generationen gesungene Lied, teilweise Schillers »Räubern« entnommen, deutet auf die oben erwähnten Schlachten um die Osterfeuer.
Der lange Fichtenstamm wurde gewöhnlich von den Jungen meistbietend versteigert und von dem Erlös und dem noch übrig gebliebenen Sammelergebnis Wurst und Brot für die Jungen gekauft, die das Osterfeuer mit aufgebaut und bewacht hatten. Seinen Fackelstumpf nahm jeder mit nach Haus und steckte ihn hinter einen Dachsparren. Die alten Osteroder wissen, daß in ein solches Haus der Blitz nicht einschlägt. Donar, dem Gott der Donner und Blitze, ist ein Feueropfer gebracht. Er wird nun das Haus in seinen Schutz nehmen.
Eine weitere Gepflogenheit möchte ich nicht unerwähnt lassen. Regelmäßig nach dem Osterfeuer trafen sich die ehemaligen Osteroder Pennäler, besonders die, welche von auswärts gekommen waren und sich während der Festtage hier aufhielten, im Ratskeller, um alte Erinnerungen aufzufrischen. Und der Abend wurde um so schöner, je später die Gäste kamen – und gingen.
Interesse für das weibliche Geschlecht hatten wir noch nicht. Wohl trafen wir mit den Mädchen zusammen, wenn auf »Bärs Wiese« oder auf den Teichen – dem Lehmteich, dem Pferdeteich, dem Kuhteich oder dem »verbotenen« Kaiserteich – Schlittschuh gelaufen wurde. Wir boten ihnen dann schüchtern unsere Dienste an, ihnen die Schlittschuhe anzuschnallen. Das war früher nicht so einfach wie heute. Sie mußten an den Hacken geschraubt und über dem Spann mit einem Riemen befestigt werden. Hin und wieder liefen wir auch mit den Mädchen zusammen. So auch ich. Doch ich hatte Pech. Die Blonde, mit der ich lief, war etwas pummelig geraten, und ich kam trotz der Kälte in Schweiß, als ich mich mit ihr über die Eisfläche bewegte. Zu meinen Kameraden zurückgekehrt, fragten sie mich, was ich hätte, und ich antwortete wahrheitsgemäß: »Ich habe mich soeben mit der dicken P. abgequält.« Das warf ich harmlos hin. Es lag mir fern, das gute Mädchen herabzusetzen. Bald darauf sah ich, wie P. einer der am Ufer aufgestellten Bänke zusteuerte, um sich ihrer Schlittschuhe zu entledigen. Ich schoß auf sie zu, um ihr behilflich zu sein. Unnahbar wie eine Königin wies sie mich ab: »Du brauchst dich mit der dicken P. nicht abzuquälen!« Sie hatte meine Worte vernommen, und wie ein begossener Pudel zog ich ab. – Sie ist mir Jahrzehnte böse gewesen.
Von besonderem Reiz waren die Eisfeste. Schon nachmittags spielte die Stadtkapelle, und bei Eintritt der Dämmerung wurden Pechfackeln angezündet, die rings um die Eisfläche aufgestellt waren. Auch war ein Stand errichtet, wo es heiße Würstchen und Grog gab. Für derartige Veranstaltungen sorgte der Eisverein, der auch täglich die Eisbahn kehren ließ. Gewöhnlich schlug das Wetter um, wenn im Wochenblatt ein Eisfest angekündigt worden war. Nach abermaliger Verschiebung fand es dann schließlich doch statt. Bewunderung erregten diejenigen, welche nach den Takten der Musik Bogen laufen konnten, und mancher Junge und manches Mädchen brachten es hierin schon zu einer gewissen Fertigkeit. Vorsitzender des Eisvereins war einer unserer Lehrer, den wir deswegen den »Eiskönig« nannten. Das eifrigste Mitglied war ein Handwerksmeister mit anscheinend recht viel Zeit. Denn er ließ keinen Tag aus, wenn eine laufbare Eisfläche vorhanden war. Er trug eine braune Pelzkappe, einen Pelzkragen und einen Pelzmuff. Das war uns ungewöhnlich, und so nannten wir ihn den »Eisbären«.
Ein ebenso beliebter Sport war das Rodeln. Ursprünglich nannten wir es Rutscheln oder Kutschern und benutzten dazu Schlitten, die plump und primitiv aus zwei Seitenbrettern und einem Querbrett hergestellt waren. Unser erstes Sportgelände war der Kurze Krumme Bruch, wo wir an »Hanschuhklapp« vorbei bis zu Kuhlmanns Haus kamen. War die Straße glatt, dann begannen wir schon vom Spritzenhausplatz an zu fahren.
Wir mußten freilich recht auf der Hut sein, denn »Kutschern« war auf den Straßen der Stadt streng verboten, und wenn ein Polizist erschien, dann schrieb er nicht nur den Namen des armen Sünders auf, sondern nahm ihm auch den Schlitten ab.
Bald aber waren wir flügge und konnten wie die großen Jungen auf dem Uehrder Berg unseren Sport treiben. Die plumpen Schlitten verschwanden mehr und mehr und bald hatte jeder Junge einen richtigen Rodelschlitten. Das gab manche Arm- und Beinbrüche. Fast jede Klasse hatte einen oder sogar mehrere Patienten zu beklagen.
Zwei Rodelbahnen wurden besonders bevorzugt: der Uehrder Steilweg, wo man einen Schwung bekam bis in die Seesener Straße, und der Hang beim Bürgerwäldchen mit der natürlichen Sprungschanze. Bei nicht zu hoher Schneelage konnte man auch auf dem Serpentinenweg hinunterrodeln, der in den Uehrder Steilweg mündet. Die städtische Rodelbahn, für die später die Alte Northeimer Straße unterhalb des Bürgerwäldchens frei gegeben wurde, haben wir nicht benutzt. Dort hatten wir nicht den richtigen Schwung.
Wollten wir eine längere Rodelpartie unternehmen, so stampften wir nach dem »Heiligenstock«. Hei, war das eine Lust, wenn wir die kurvenreiche Straße bis ins Lerbachtal in glatter Fahrt hinuntersausten! Gewöhnlich machten wir noch zweimal den beschwerlichen Aufstieg über die lange Bergwiese, so die Windungen der Straße abkürzend.
Kam uns jemand während der Abfahrt entgegen, so riefen wir schon von weitem: »Bahn!«. Früher, als wir noch die kleinen Ruschelschlitten hatten, riefen wir als Kinder: »Auster!«, das war ein echt Osteroder Warnruf, entstanden aus der Abkürzung: »Aus der Bahn!«
Heute ist Schneeschuhlaufen der Hauptwintersport, sodaß das Rodeln etwas in den Hintergrund getreten ist. Als Jungen kannten wir noch keine Schneeschuhe. Wir begnügten uns mit »Eisläufern«. Das waren etwa ½ m langte, schmale, mit Eisenblech beschlagene Holzkuven, die mit einer einfachen Lederbindung an den Füßen befestigt wurden. Damit begaben wir uns auf die Straße oder aufs Eis. Einen längeren Stock mit einer Eisenspitze stemmten wir in den Boden und schoben uns so vorwärts. Die größeren Jungen wagten auch, dort, wo Rodelschlitten glatte Bahn gemacht hatten, Steilhänge hinunterzufahren. Das war immerhin eine gefährliche Sache. Die Eisläufer durften hierbei nur lose an den Füßen sitzen, damit man sie beim Fallen jederzeit abschleudern konnte.
Wir hatten nun Untersekunda erreicht, und es galt, sich für die »Einjährigen-Prüfung« vorzubereiten. Das war zu meiner Zeit eine Art kleines Abitur mit Prüfungsarbeiten und mündlichem Examen und dauerte gewöhnlich eine Woche.
Ich arbeitete mit mehreren Kameraden im Hause meines Freundes Harpagon, dessen Vater eine Schülerpension hatte. Bei diesen Vorbereitungen zum Examen rauchten wir die ersten männlichen Zigarren. Harpagon machte dabei seinem Namen Ehre, indem er uns die Zigarren heimlich aus der Kiste seines Vaters anbot, sich aber von uns für jede Zigarre 5 Pfennig bezahlen ließ!
Unser Hauptaugenmerk verwandten wir indessen nicht auf die Vorbereitung zum Examen, sondern auf die Herstellung der »Einjährigen-Zeitung«. Verse wurden gemeinsam geschmiedet und Zeichnungen von mir entworfen. Mit einer besonderen Tinte wurde alles auf Kanzleibogen übertragen, um in einer Steindruckerei vervielfältigt zu werden.
Der eifrigste Mitarbeiter war unser Freund Quassel aus Magdeburg, der sich hierbei so verausgabte, daß der Rest seines Geistesblitzes nicht mehr zur Bezwingung des Examens langte. Auf der »Einjährigen-Kneipe«, die heimlich und verboten in Aschenhütte stieg, war er indessen der lustigste von allen. Während dieser feucht-fröhlichen Feier trugen wir »Einjährige« traditionsgemäß Achselklappen aus Pappe mit schwarz-weißer »Einjährigenschnur« und der Regimentsnummer »§ 11«.
Von dem Inhalt unserer Einjährigen-Zeitung habe ich keinen Schimmer mehr. Aehnliche Zeitungen wurden auch zum Abiturientenexamen hergestellt, deren Text sich zum Teil über das Niveau einer platten Bierzeitung erhob. Als Beweis füge ich ein Gedicht aus der Abiturientenzeitung vom Jahrgang 1906 an – wir haben als Muli keine Zeitung mehr herausgegeben – welches an das klassische Liebespaar Pyramus und Tisbe erinnert, das sich vor 2000 Jahren heiße Küsse durch eine sie trennende Mauer sandte:
Die Ballade vom Kuß
Sie liebten sich beide seit langer Zeit
und konnten kaum länger warten:
er war ein Primaner und sie eine Maid
wie die Rosenknospe im Garten.
Der Vater erfuhr's, und wutentbrannt
hielt er mit starrem Mute
die Tochter jahrelang verbannt
auf dem einsamen Rittergute.
Doch wenn er geglaubt, er könnte die Lieb'
der beiden verbieten – er irrte,
Hans schlich sich abends ganz leis' wie ein Dieb
ans Fenster und klopfte und girrte.
»O öffne mir, Liebchen!« – »Ich kann es ja nicht,
man hat mir das Fenster verschlossen:
so geh' doch: ich bitt' dich!« das Mägdelein spricht,
von rosiger Glut übergössen.
»Ein Küßchen nur, Grete, ich bitte recht schön,
du versprachst mir's, du wirst es doch wissen.«
Und so nun geschah es, man konnte sie sehn,
durch die Fensterscheibe sich küssen.
Und so heiß und glücklich küßten sie sich,
daß schmelzend die Fenster verschwanden
und die rosigen Lippen nun inniglich
zum wirklichen Kusse sich fanden.
Noch waren wir Jungen. Aber in dem folgenden Frühjahr, das uns in Obersekunda sah, wurde uns klar gemacht, daß wir »Herren« und die Mädchen »Damen« waren. Das lernten wir in der Tanzstunde bei »Ladany & Sohn«.
Wie junge Füllen hatten wir bislang umhergetollt und auf die Mädchen nur mit einer gewissen Geringschätzigkeit herabgesehen. Nun machten wir eine neue Schule durch, die unsere äußere und innere Haltung wesentlich veränderte.
Wir achteten mit einem Mal von selbst darauf, daß unser Kragen sauber und unsere Stiefel blank geputzt waren. Die Zeilen, wo wir nach Gosse und toten Mäusen rochen, lagen weit hinter uns. »Dunkel-weiße« Taschentücher kamen nicht mehr zum Vorschein, dafür leuchtete ein blütenweißes aus der linken Brusttasche. Und wer ein »Gent« war. ließ aus dem linken Rockärmel ein buntseidenes Taschentuch hervorquellen. Die Hose halle keine Löcher mehr, wohl aber eine stets frische Bügelfalte!
Es war bisher ganz selbstverständlich gewesen, daß wir die Mädchen ganz einfach mit »du« anredeten. Nun erschienen sie uns plötzlich in einer ganz anderen Welt, und wir wurden unsicher, wie wir uns nun ihnen gegenüber verhalten sollten.
Die Klärung wurde schnell herbeigeführt. Denn im Sprachschatz Ladany & Sohn waren sie »Damen«.
Nachdem vorerst an einigen Abenden die »Herren« und die »Damen« gesondert dressiert worden waren, wurden wir auf dem »Vorstellungsabend« auf einander losgelassen.
Das war ein großes Ereignis.
An der Spiegelseite des Ratswaagesaales saßen die Mädchen. Wir standen ihnen gegenüber auf der anderen Seite. Links vom Eingang war der »Drachenfels«. Von hier aus genossen die Mütter den stolzen Anblick ihrer Sprößlinge.
Ladany Sohn rief jeden Herrn mit Namen auf. Einzeln stolzierten sie dann mit ungelenken und unsicheren Schritten über das gefürchtete Parkett bis in die Mitte des Saales, wo sie eine tiefe Verbeugung vor den Damen machen mußten.
Für die Jünglinge war das eine Höllenpein.
Die Mädchen, die innerlich sich totlachen wollten, nickten leicht mit dem Kopf und trugen hoheitsvolle Mienen zur Schau.
Der »Vorführung der Raubtiere« folgte die Aufforderung zum Tanz.
Das waren aber plötzlich keine Herren mehr, die ehrerbietig auf ihre Damen zuschritten, um mit ihnen den ersten Tanz zu wagen. Das war eine Horde wilder Jungen, die sich auf die Mädchen stürzten, um die von ihnen Erwählte zu erhaschen. Dabei wurde geschubst und gestoßen, und manch einer lag am Boden!
Doch Frau Ladany war die Ruhe selbst. Die Herren wurden wieder auf die andere Seite des Saales geschickt und die Aufforderung zum Tanz wiederholt. Und zwar solange, bis man beinahe annehmen konnte, die Jungen seien Herren.
Im Anfang blieben einige Mauerblümchen übrig. Das waren meist Schöne aus Nachbarorten, an welche sich die Osteroder Herren aus angeborener Schüchternheit noch nicht heranwagten. Die zaudernden Tänzer wurden aber von dem Tanzlehrer schnell eingefädelt. Und nun konnte der Tanz beginnen.
Es war ein schreckliches Gehüpfe, und wir schwitzten tatsächlich Blut. Wochen gingen erst darüber hin, bis uns das Tanzen wirklich Freude machte.
Die Tanzlehrerin, eine gewichtige Person in mittleren Jahren, gab mit einer selten tiefen Stimme ihre Anweisungen. Besonders bei der Quadrille und beim Menuett kommandierte sie wie ein alter Sergeant. Das gab freilich Durst. Und nach jedem Tanz schwang sie an der Theke ein großes Helles. Sie blieb sich indessen immer gleich. Auch, als an einem Abend der vorwitzige G. aus Kassel ihr in jedes Glas Bier heimlich einen Korn geschüttet hatte. –
Zu Beginn jeder Tanzstunde übergaben wir dem alten Nothdurft, der als Lohndiener tätig war und ohne den man sich eine Ladanysche Tanzstunde nicht denken konnte, vom Gärtner zierlich gebundene Blumensträußchen. Auf einem mit einer weißen Serviette bedeckten Tablett überreichte er diese kleinen Aufmerksamkeiten den von uns bestimmten Damen, welche sich dann mit den Sträußchen schmückten.
Ein stilles, blasses Mädchen hatte ich an mehreren Abenden beobachtet, wie es sehnsüchtig nach den Blumen sah: aber niemals fiel ein Sträußchen für es ab. Das tat mir leid, und so ließ ich auch ihm eines Abends durch Herrn N. ein Sträußchen zukommen, wobei dieser, wie er es stets zu tun pflegte, den Namen des Spenders diskret verschwieg. Die Kleine errötete, schüttelte mit dem Kopf und sagte leise in rührender Bescheidenheit: »Das ist doch wohl ein Irrtum!« Erst als Herr Nothdurft nochmals betonte, daß die Blumen für sie bestimmt seien, nahm sie glückselig lächelnd den Strauß entgegen. Sie weiß heute noch nicht, daß er von mir war.
Die Zeit war gekommen, wo sich in den Herzen der Jungen und Mädchen jene zarten Regungen einstellen, die sich zunächst in unbewußtem Sehnen äußern und so den herannahenden Liebesfrühling ankündigen. Und so fragte ich mich:
»Wozu sind denn nur die Mädchen
und die Liebe auf der Welt?
Warum möcht' ich Liesbeth küssen?
Nur, weil sie mir gut gefällt?
Nur, weil ihre Augen strahlen
und ihr rotes Mündchen lacht?
Weil der Herrgott ihre Glieder
hat so fein, so zart gemacht?«
In Wirklichkeit hieß sie nicht Liesbeth, sondern – nein, das sage ich nicht. Und geküßt habe ich sie während der Tanzstundenzeit auch nicht. (Was später geschah, darüber brauche ich ja nicht zu berichten!) Aber geliebt haben wir uns mit aller Lust und Seligkeit, wie sie nur der »ersten Liebe goldene Zeit« gibt. Wir waren glücklich, wenn wir uns nur sahen. Und wir sahen uns täglich und waren so täglich glücklich und freuten uns schon auf den anderen Tag.
Vergessen waren Schule, Freunde – alles.
Jeden Abend trafen wir uns in der Laube ihres väterlichen Gartens. Oft erst zu später Stunde, wenn ihre Eltern schon schliefen. Und doch, wie waren wir harmlos! Es waren »Tage, die den Rosen glichen: sie dufteten und leuchteten.« Heute noch stiehlt sich ein kleiner Sonnenstrahl in mein Herz, wenn ich an dem Garten vorübergehe.
Den Höhepunkt unserer Tanzstunde bildete der Abschiedsball. Der Herr schenkte seiner Balldame einen großen Blumenstrauß, die Dame dem Herrn eine weißseidene Schleife mit ihrem Monogramm in Gold gestickt. Es gab eine Festtafel, wo wir Gelegenheit hatten zu zeigen, daß wir vollendete Kavaliere waren: wir führten unsere Dame zu Tisch, schenkten den Wein ein, reichten die Speiseschüsseln geschickt weiter und aßen die Kartoffel, ohne sie mit dem Messer zu zerschneiden. Der ungewohnte Wein gab den Gedanken freien Lauf, und so schrieb mir meine Balldame auf die Seidenschleife:
»Ach, wie ist's möglich dann,
daß ich Dich lassen kann.
Hab' Dich von Herzen lieb,
das glaube mir.«
Ich habe es ihr auch geglaubt und die Ballschleife lange in Ehren gehalten.
*
Unsere Jugendlieben trugen Mozartzöpfe, die mit breiten Haarschleifen gehalten wurden. Es war eine recht anmutige Tracht. Was im Mittelalter dem Ritter der Handschuh seiner Dame bedeutete, den er an seinem Helm befestigte, das war für uns eine solche Haarschleife. Nur sträubend wurde sie als Zeichen höchster Minnegunst gewährt. Wir schmückten damit die Wand unserer »Bude«. ließen sie an unserer Gitarre flattern oder banden sie an unsere lange Pfeife, die uns eigentlich noch garnicht recht schmeckte.

Als ganz großer Don Juan galt mein Vetter, der einige Jahre älter war als ich. Er hatte – horribile dictu – an seiner Pfeife ein rosa Strumpfband baumeln. Das ging entschieden zu weit und trug ihm den Namen »Dusenschön« zu. – Und doch war alles nur Angabe. Das diskrete Stück war von einer seiner Schwestern als unbrauchbar abgelegt worden und unverdient zu einem »Ehrenplatz« gekommen.
Gedichte machte ich in Obersekunda noch nicht, statt dessen beging ich andere Dummheiten. Für die Dame meines Herzens – in der Pennälersprache sagte man »Flamme« – suchte ich aus allen erreichbaren Klassikern die schönsten Liebesgedichte heraus, schrieb sie in ein kleines, in rotes Safranleder gebundenes Büchlein und verzierte die Seiten mit Herzen und Initialen. Dieses Buch verlor ich auf dem Schulhof. Ich sehe noch heute, mit welcher Wollust meine Lehrer sich auf das objectum sceleris stürzten und das Buch, begleitet von spöttischem, überlegenem Lächeln, von Hand zu Hand ging. Ich fühlte mich aller Hüllen entblößt und schämte mich fürchterlich. – Das Buch gelangte trotzdem wieder in meine Hände, und ich konnte es der geben, für welche es bestimmt war.
Daß in Obersekunda nicht viel gearbeitet wurde, lag auf der Hand. Wir hatten ja noch drei Jahre Zeit, bis zum Abitur und das Einjährigenexamen gerade hinter uns. Das Pensum war leicht und darauf abgestimmt, daß von auswärts eine große Anzahl neuer Schüler hinzukam. Besonders aus Berlin und von dem Kadettenkorps stellten sich Zöglinge ein, aber auch aus den Nachbarstädten von Lehranstalten, welche mit Obersekundareife endeten. So kam ein ganz anderer Geist in unsere Klasse und brachte uns etwas aus dem alltäglichen Trott der Kleinstadt. Das Lernen kam dabei erheblich zu kurz; es waren also nicht nur Tanzstunde und Frühlings-Erwachen daran schuld.
Ich entsinne mich, daß ich einen Hausaufsatz, für den wir vier Wochen Zeit hatten, an einem Sonntag abend um 11 Uhr begann und ihn bei Kerzenlicht gleich ins Reine schrieb. Licht durfte ich nicht anknipsen, denn meine Eltern in der Kammer nebenan hätten sonst meinen übergroßen Eifer bemerkt. Selbst das Schlüsselloch mußte ich abdunkeln. Am nächsten Morgen konnte ich den Aufsatz abgeben und bekam bei unserem Deutschlehrer, der uns durch seine frische Art begeisterte, uns aber leider bald wieder verließ, eine Drei minus. Dieser Deutschlehrer hatte es auch verstanden, unser Interesse für die Kunst, besonders für die Malerei, zu erwecken. Er besaß mehrere Sammelmappen von Kopien deutscher Meister, die er uns unterbreitete. Mich fesselte der Totentanz von Rethel. Der Ausdruck des Knochengesichts wechselt, je nachdem Licht und Schatten sich in den Augenhöhlen verteilen. Vom höhnischen Grinsen bis zum milden Lächeln gibt es da die verschiedensten Stufen. Und gerade die Ausdrucksmöglichkeit des Totenschädels war es, die mich reizte, mich in der Darstellung eines eigenen Totentanzes zu versuchen.
So ging ich zu unserem alten Totengräber und bat ihn, mir einen Schädel aufzuheben, wenn er wieder ein altes Grab aufrode. Er sah mich mit seinen schwermütigen Augen an und schüttelte zunächst den Kopf. »Die Ruhe der Toten ist heilig,« sagte er. Als ich ihm erklärte, daß auch die Mediziner an toten Körpern lernten, ich aber ohne Modell meine Zeichnungen nicht ausführen könne, sagte er zu. Ich mußte ihm mein Wort geben, mit dem Schädel keinen Unfug zu treiben.
Nach etwa acht Tagen, an einem Sonnabend abend, erschien der Freund der Toten und überreichte mir, in Zeitungspapier eingewickelt, ein rundliches Paket, das mir ziemlich schwer vorkam. Ich mußte nochmals versichern, den Schädel wie eine Reliquie in Ehren zu halten. Es war geradezu feierlich, wie die Uebergabe auf unserem halbdunklen Hausflur in aller Heimlichkeit vor sich ging. Man merkte dem Manne an, daß er mit seinen Toten lebte. Und ich glaube, er wußte auch, wessen Kopf er mir ins Haus getragen hatte.
Als sich mein Besucher entfernt hatte, löste ich die Hülle. Ein Grauen erfaßte mich. Die Knochen waren noch nicht bloßgelegt und das Haupthaar noch vorhanden. Ich brachte meinen schauerlichen Schatz ins Waschhaus.
Meine Eltern gingen an jenem Abend zu einer Veranstaltung des Kaufmännischen Vereins; ich war daher sicher, daß sie erst spät zurückkehren würden. Da auch die Eltern meines Freundes Gockel dorthin gingen, verständigte ich ihn, und so machten wir uns gleich daran, den Kopf im Waschhaus zu präparieren. Wir begossen ihn zunächst mit Lysol und ließen ihn dann in einem alten Eisentopf kochen. Trotzdem wir lange Pfeifen rauchten, erfüllte ein penetranter Gestank den Raum. Meine Base, die uns im Waschhaus hantieren sah und nicht wußte, worum es sich handelte, baten wir, uns Gesellschaft zu leisten und uns zur Stärkung einen steifen Grog nach dem andern zu brauen.
Sie erschrak nicht wenig, als wir nach einigen Stunden den blanken Schädel aus dem brodelnden Kessel herausschöpften. Gockel hatte ihn mit zwei Stöcken erfaßt, um ihn auf ein Brett zu legen, da ging es klack-klack-klack, und eine pechschwarze Masse – das Hirn – klatschte durch das Hinterhauptloch auf die Erde. –
Jedenfalls haben wir ihn sauber bekommen. Wir müssen ihn aber zu scharf gekocht haben, denn als ich ihn gegen Mitternacht ins Haus trug, um ihn auf unserem obersten Hausboden zum Trocknen aufzustellen, stolperte ich im Dunkeln, der Schädel rollte mir aus der Hand und verlor bei dem Fall die Zähne. Ich konnte mich erst am nächsten Morgen dazu überwinden, sie aufzulesen und wieder einzusetzen.
Von den Zeichnungen, die ich anfertigte, entsinne ich mich noch deutlich des ersten Bildes, das den Tod als König mit einer funkelnden Krone darstellte, die einen wirkungsvollen Kontrast gab zu den in schwarzen Schatten liegenden, glanzlosen Augenhöhlen. –
Garnicht gearbeitet wurde für die Religionstunde. Nicht, weil es Religionstunde war, sondern weil wir sie bei einem jüngeren Lehrer hatten, der meistens zu spät kam und sich von seinen Kollegen dadurch unterschied, daß er ein Freund der Götter Bachus und Gambrinus war. Mit schwerem Kopf setzte er sich zu Beginn des Unterrichts auf das Katheder, wo er die ganze Stunde verblieb. So konnten wir unsere Bibelstellen, die wir auswendig lernen sollten, einfach ablesen. Unser Neues Testament bestand daher nur noch aus losen Blättern. Wir steckten, wenn wir aufgerufen wurden, unseren Zettel dem Vordermann in den Rockkragen und lasen fröhlich ab. Aber an einem Wintermorgen wollte und wollte es nicht hell werden. Obgleich der Unterricht erst 8.30 Uhr begann, hatten wir noch kein »Büchsenlicht«. Ich kam als erster dran. Wohl hatte ich meinem Vordermann den richtigen Zettel in den Kragen gesteckt; so sehr ich mich auch nach vorn hinüberlegte, konnte ich doch kein Wort lesen. Ich kniff meinen Nebenmann und meinen Hintermann. Diese hielten sich das Blatt vor die Nase. Dennoch war es ihnen nicht möglich, mir zu helfen. Es war das erste Mal, daß dieser Lehrer aus seinem Trance-Zustand erwachte und mir eine wohlverdiente 5 anschrieb. Der Lehrer ist nicht lange in der Stadt des »Sösewassers« geblieben.
Gewissermaßen den Nachklang zu unserer Tanzstundenzeit bildeten die abendlichen Abonnementskonzerte im Kurpark. An den lauen Sommerabenden, wenn die Glühwürmchen sanft aufleuchteten und die Jasminsträucher schwer dufteten, wandelten wir bei den Klängen der Stadtkapelle auf den Rundwegen des Parks. Sozusagen ganz alleine: er mit der roten Sekundanermütze und sie mit dem koketten Mozartzopf. Ach, was redeten wir über nichtige Dinge! Und doch war es sooo schön! Hin und wieder gab es auch »Italienische Nacht«. Dann wurden bunte Lampions zwischen den alten Bäumen aufgehängt. Stadtmusikdirektor Sietas blies aus einer verschwiegenen Ecke sein Trompetensolo »Post im Walde«, und der Höhepunkt der Romantik war erreicht. Um 10 Uhr fand das Konzert sein Ende, und im Saale begann der Tanz. Die einzelnen Paare fanden sich und zeigten, was sie bei Ladany & Sohn gelernt hatten. Wenn dann aus der »Lustigen Witwe« die Weise erklang:
»Lippen schweigen,
flüstern Geigen:
»Hab' mich lieb!«
und die Stelle gespielt wurde:
»Jeder Druck der Hände
deutlich mir's verriet«,
gab es wohl kein jugendliches Paar, das sich beim Walzertakt nicht ganz fest die Hände drückte. Wißt ihr es noch?
In der Tanzpause saßen wir von den Mädchen getrennt und hatten zur Löschung unseres Durstes – es war meist eine große Hitze und eine fürchterliche Fülle im Saal – auf dem Tisch bescheiden ein kleines Helles stehen. Aber unter dem Tisch stand verstohlen ein halbes Liter.
Im Kurparksaal gastierte in jenen Jahren die Theatertruppe Seidemann, die sich recht und schlecht durchschlug und sich mit den primitivsten Mitteln an die Aufführung von Werken unserer Klassiker und sogar von Operetten heranwagte, so das Osteroder Kunstleben befruchtend. Uns übermittelten diese Vorstellungen überhaupt erst einmal den Begriff Theater, und wir lernten unsere Klassiker in einer lebendigeren Gestalt kennen als in der Schule, wo ihre Werke in Aufsatzthemen zerpflückt wurden. Zu den Schauspielern blickten wir mit scheuer Bewunderung empor. Wir sahen in ihnen die Verkörperung Schillerscher Idealgestalten. Aber unser Blick wurde eines Tages doch erheblich getrübt. Eine Vorstellung wurde plötzlich abgeblasen und die folgenden auch. Die »Jungfrau von Orleans« und die »Naive« (Elvira hieß sie) hatten in zwei »besseren« Herren, die in der Dörgestraße wohnten, zahlungskräftige Liebhaber gefunden. Mit diesen waren sie durchgebrannt, um erst nach Tagen wieder auf der Bildfläche zu erscheinen. Wir »reinen Toren« waren sittlich entrüstet. Unser Idealismus hatte einen hörbaren Knacks bekommen; die folgenden Vorstellungen konnten uns nicht mehr begeistern. –
Vergessen hätte ich bald ein Fest von ungebundener Fröhlichkeit, das jedes Jahr in Osterode wiederkehrte und gerade in unserem Tanzstundenjahr von uns so recht ausgekostet wurde: den Osteroder Schüttenhoff.
Das Scheibenschießen interessierte uns damals noch nicht, wohl aber der Festplatz auf der Bleichestelle. Und der war prächtig aufgebaut: Kinomathographisches Theater mit riesiger goldstrotzender Orgel (nach 10 Uhr abends nur für Herren!), Hippodrom, Schießbuden, Panoptikum, »Die Dame ohne Unterleib«, Riesenpanorama, Reveres Karussel, Mulls »Ueber Berg und Tal«, Luftschaukel, »Haut den Lukas«, der dichtende Moppenonkel, Cotts Zuckerbude, August Hafts Konditorei und was sonst das Herz begehrte. Wir fühlten uns als Kavaliere und luden unsere »Damen« zu allen Herrlichkeiten ein. Schon nach einigen Stunden waren wir blank, denn das Schüttenhoffgeld war ja nicht für zwei vorgesehen. Doch am nächsten Tag fühlten wir uns schon wieder stark, denn es gab Onkel und Tanten, die eine offene Hand hatten.
Ich hatte das Glück, daß die Eltern meiner kleinen Freundin zu den Osteroder Familien gehörten, die aus alter Tradition auf dem Festplatz ihr eigenes Bürgerzelt – im Osteroder Volksmund hießen sie »Dicke Milchbuden«! – aufgeschlagen hatten. So war denn in dem Trubel eine Oase, wo wir bei Kaffee und Kuchen einige Augenblicke ungestört verweilen konnten. Es war Schützenfest, und so wurde ich auch von ihren Eltern als willkommener Gast aufgenommen. Da wir nun tanzen konnten und uns jetzt wirklich zu den Erwachsenen rechneten, kam der »Kinderball« für uns nicht mehr in Frage, sondern wir tanzten in dem Junggesellenzelt genau wie die behäbigen Bürger.
Acht kurze Tage dauerte all das Vergnügen. In den Straßen dröhnte es von morgens bis abends:
»Freut euch des Lebens,
weil noch das Lämpchen glüht.
Pflücket die Rose,
eh' sie verblüht!«
Das waren die Trommler und Pfeifer, welche zum »Wecken« aufgespielt hatten und sich nun nach altem Brauch in den Dielen der Bürgerhäuser ihre Spielmannsgroschen zusammentrommelten. Auf dem Festplatz versuchte vom frühen Nachmittag an jede Orgel, die andere zu übertönen. Ganz alte Walzen wie »Fischerin, du kleine« und »Was nützt denn dem Seemann sein Geld« maßen sich mit den neuesten Operettenschlagern. »Musik wird störend oft empfunden, dieweil sie mit Geräusch verbunden!« Uns störte sie nicht. Wir fanden den Trubel herrlich. Er paßte so ganz zu unserer frisch-fröhlichen Ungebundenheit. Ganz Osterode war auf den Beinen, und es war ein echtes Volksfest, zu dem jeder willkommen war und sich auf seine Weise vergnügen konnte. Wer in Osterode seine Jugend verbracht hat, wird gern daran zurückdenken.
Ein ähnliches Bild boten die Osteroder Jahrmärkte. Abwechselnd wurde auf dem Marktplatz oder auf dem Spritzenhausplatz eine Budenstadt aufgeschlagen. Sie unterschied sich von der auf der Bleichestelle dadurch, daß auf dem Jahrmarkt nur Verkaufstände aufgebaut waren, während auf dem Schützenhof sich Schaubuden und Vergnügungsstätten darboten. Lärm und Trubel waren aber auch auf den Jahrmärkten genug. Straßenmusikanten bliesen, Drehorgeln quietschten, und aus jeder Bude priesen die Verkäufer mit großem Stimmenaufwand ihre Waren an. Durch die Straßen bewegten sich Bärenführer, denen Hunderte von Kindern folgten wie einst dem Rattenfänger von Hameln. Eine gräßliche Erinnerung sind mir die Riesenorgeln mit den Moritaten. Eine Art Möbelwagen wurde von ein oder zwei Pferden durch die Straßen gezogen. Im Innern befand sich eine unsichtbare Orgel, die von einem Mann gedreht wurde. Die Seitenwände des Wagens waren mit den schauervollsten Bildern bedeckt. So sah man einen Mann mit einer Spitzhacke einer Frau den Schädel zertrümmern, daß das Blut »haushoch« spritzte, Kinder mit abgeschnittenen Köpfen und andere Ausgeburten einer qualvollen Phantasie. Und die Menge weidete sich an diesen blutrünstigen »Kunstwerken«! – Die Bedeutung der Jahrmärkte wurde von Jahr zu Jahr geringer. In meiner frühesten Jugend war der Osteroder Jahrmarkt noch ein wichtiges Ereignis. Wir gingen zu unseren Eltern, Onkeln und Tanten und riefen: »Prost Jahrmarkt!« Dann bekamen wir unseren Jahrmarktgroschen. Viel brauchten wir ja nicht. »Die meisten Sachen 10 Pfennig!« riefen die Verkäufer aus, und ein Zießchen (Würstchen) kostete sogar nur 5 Pfennig. Wenn der »Apfel auch nicht weit vom Pferd fiel«, so schmeckte es uns doch. Und köstlich waren die Spritzkuchen und Krapfen, von deren Duft die ganze Stadt erfüllt war. Es roch geradezu nach Jahrmarkt. All die Herrlichkeit währte aber nur einen Tag. Schon am folgenden Morgen zeigten die Straßen ihr gewohntes Bild, und die Budenstadt war wie durch Zauberschlag verschwunden.
Zum Schluß noch ein kleines Jahrmarktsereignis aus der Lokalgeschichte. Der berüchtigte Harzschütze Hans (Warnecke) von Eisdorf wurde 1627 beim Besuch des Osteroder Martinimarktes durch die List des Bürgermeisters mit seinem Kameraden Hans Sötefleisch aus Badenhausen in einem Hause der Neustadt gefangen genommen, indem jener die Jahrmarktfreiheit früher als festgesetzt ausläuten ließ und so die Wagemutigen überrumpelte.
Es kann die tiefste Dichterbrust
die Prima nicht besingen.
Der Lebenslauf ist Lieb und Lust,
ein Schweben und ein Klingen.
Selbst (a b c) hoch m
kann uns nicht niederdrücken,
wir bauen nach Jerusalem
der Freiheit gol'dne Brücken. (R. D.)
Ganz so begeistert wie der Verfasser obiger Verse war ich nicht von der Prima, wenn ich auch manche schöne Erinnerung an sie habe.
Das leichte »Schweben und Klingen« habe ich mehr in der Obersekunda gespürt. Ich fand, daß wir in der Prima schon »gesetzter« waren. Zwar winkten in der Ferne die hohen Zinnen der »goldenen academia«, doch, um dieses Ziel zu erreichen, mußten wir erst ein Hindernisrennen gewinnen: das Abitur. Und was ich sonst kaum während meiner Schulzeit getan hatte, ich arbeitete!
Die Erkenntnis, vieles zu leicht genommen zu haben, kam reichlich spät. So mußte ich allerlei nachholen, was anderen geläufig war. Auch hätte ich es in Mathematik, einem Fach, das ich liebte, zu einer besseren Note als genügend bringen können, und ich ärgere mich heute noch über die Beurteilung in meinem Abiturientenzeugnis, wo es heißt: »... ist zur Lösung einfacher Aufgaben befähigt.« Dabei hatte ich manchem Klassenkameraden gerade durch die Lösung schwieriger Aufgaben geholfen.
Ich war indessen für Arbeitsteilung. Mein Mitschüler Zeta hatte fast die gleiche Handschrift wie ich. Er mußte die lateinischen, englischen und französischen Präparationen machen und die Vokabeln in mein Präparationsheft schreiben. In den Pausen übersetzte er mir die aufgegebenen Lektionen hinter einem dicken Baum im äußersten Winkel des Kurparks. Ich lieferte ihm dafür die deutschen und die französischen Aufsätze und löste die mathematischen Aufgaben.
Es kam vor, daß die Pausen zur Bewältigung des Aufgabenpensums nicht ausreichten. Und das Unglück wollte es, daß ich eines Tages den letzten Abschnitt übersetzen sollte, von dem ich wegen der Kürze der Pause keinen Schimmer hatte. Ich versuchte, aus dem Stegreif irgend einen Sinn aus dem französischen Text herauszuholen. Mir fehlten aber die Vokabeln. »Sie haben garnicht präpariert. Zeigen Sie Ihr Präparationsheft vor!« Fein säuberlich waren Seiten von Vokabeln eingetragen. Der Lehrer stand vor einem Rätsel. –
Unterprima und Oberprima wurden gemeinsam unterrichtet. Das Pensum wechselte von Jahr zu Jahr. Und verlangt wurden in beiden Klassen dieselben Leistungen.
In Unterprima wurden von Olaf meine Aufsätze mit gut, in Oberprima von Butler mit ungenügend zensiert. Das war mir um so unerklärlicher, weil die Aufsätze, welche ich für meinen Mitschüler Zeta anfertigte, von Butler mit genügend und besser gewertet wurden. Tu meiner Verzweiflung bat ich meinen Freund Hans-Helmuth, der bei Butler in Deutsch »sehr gut« gehabt hatte und jetzt in Göttingen Philosophie studierte, mir den nächsten Aufsatz zu schreiben. Der Erfolg war verblüffend. »Ungenügend« – »Zeitungsdeutsch« – »Echt Bremeneck« kündete die rote Tinte. Da stand ich »machtlos vis à vis«!
Englisch und Französisch gab unser Direktor. Sein lebhafter Unterricht riß uns alle mit fort. Die Shakespeareschen Dramen lasen wir im Urtext. »Macbeth« hätte auf der Bühne nicht ergreifender wirken können, als ihn uns die Unterrichtsstunde des Direktors vor Augen führte. Wir hatten garnicht das Empfinden, im Englischen unterrichtet zu werden. Das Sprachliche war zum Hilfsmittel geworden, um in den Geist der großen Dichtungen einzudringen. Wir hätten das aber nicht vermocht, wenn der Direktor uns nicht auch das Rüstzeug dazu gegeben hätte. Wir lernten bei ihm fremde Sprachen mit einer Gründlichkeit, wie sie nur von einem ganz großen Pädagogen ausgehen kann. Daß er noch mehr war, ahnten wir damals schon. Er hat sich als Sprachforscher ein unvergängliches Denkmal gesetzt. Mit der von ihm begründeten Lehre von der Wortbildung und vom Bedeutungswandel hat er die Aufmerksamkeit der Wissenschaftler der ganzen Welt auf sich gelenkt.
Weltfremd, wie Gelehrte hin und wieder sind, fand er für den Freiheitsdrang der Jugend wenig Verständnis. Trotzdem hingen wir alle mit Liebe und Verehrung an ihm. Er gehörte zu den wenigen Menschen, von denen man sagen kann: er hatte keine Feinde. Sein unbeirrbarer Sinn für Gerechtigkeit, sein tiefes Mitgefühl für die Nöte jedes einzelnen, seine persönliche Anspruchslosigkeit und Bescheidenheit offenbarten die Lauterkeit seines Charakters.
Golden war sein Humor, den er im Unterricht natürlich und ohne Ziererei trefflich zu verwenden wußte. So stellte er einmal an uns die Frage: »Wie schreibt man das Wort kaputt?« – Die einen buchstabierten mit einem »t«, andere wieder mit »tt« usf. »Och, gornix«, erwiderte er in seinem thüringischen Dialekt und schrieb an die Tafel:
entzwei.
Ein anderes Mal übersetzten wir einen Abschnitt aus der Schlacht bei Waterloo, wo die Napoleonische Garde aufgefordert wird, sich zu ergeben. Aber stolz antwortet sie: »La garde meurt, mais elle ne se rend pas!« (Die Garde stirbt, aber sie ergibt sich nicht!)
Man merkte dem Direktor an, er möchte etwas sagen, war sich aber nicht recht schlüssig. Da wir ihn fragend ansahen, kam er schließlich doch damit heraus: »Was in dem Buch steht, ist nicht historisch, sondern nur eine Umschreibung. In Wirklichkeit hat die Garde nur ein Wort gerufen. Das mag ich aber nicht sagen.« Und er ging an die Tafel und schrieb: »Merde!«, löschte aber schnell das Wort wieder aus. Als er merkte, daß es uns unbekannt war, legte er beide Hände an den Mund und flüsterte ganz leise: »Sch....e!«
Selbst als wir die Schule verlassen hatten und er nicht mehr im Amt war, nahm er noch lebhaften Anteil an dem Schicksal seiner früheren Schüler. Als der Verein ehemaliger Osteroder Pennäler sein 25-jähriges Stiftungsfest feierte, widmete er den von fern Herbeigeeilten ein Lied, dessen 3. Strophe lautete:
»Es grüßt euch das vertraute Haus,
die alte Kaffeemühle,
es schau'n zu allen Fenstern raus
der Jugend Lustgefühle;
die Straßen, die der frohe Schwarm
mit lautem Tritt durchhallte,
die Wälder, die er Arm in Arm
in Fröhlichkeit durchwallte.«
Damit brachte er selbst das verpönte Wort »Kaffeemühle« zu Ehren, wie in der Pennälersprache unser Schulgebäude so treffend bezeichnet wurde. – Es fehlte ja auch nur der »Kreckel«.
Ein lieber Mensch war auch unser Geschichtsprofessor, der uns von Sexta, wo er unser Klassenlehrer gewesen war, bis Oberprima begleitete. Er hat oft ein Auge zugedrückt, wenn unser Wissen hier und da haperte. Wer aber durchaus nicht wollte, über den hatte er sich »sein Urteil gebildet«. Ein solcher Schüler konnte sich dann wirklich nicht beklagen, wenn er eine vier bekam.
Sein gutmütiges Gesicht gab ihm den Namen »Moppel«. Daneben wurde er von uns auch noch »Alsobert« genannt. Bei seinem Geschichtsvortrag hörten wir weniger auf den Inhalt als auf die vielen »Alsos«, die wir gewissenhaft zählten, wenn wir nicht gerade während der Geschichtsstunde unter der Bank für ein anderes Fach Schularbeiten machten. Als er einst unseren Mitschüler Kuno H. dabei überraschte, fragte er vom Katheder weg: »H., was haben Sie da?« »Nichts, Herr Professor«, erwiderte Kuno mit unschuldiger Miene. »Dann nehmen Sie es weg!« Alsobert sprach's und setzte seinen Vortrag fort.
Wenn ich in diesen Blättern hin und wieder der Schulmänner gedachte, die uns unterrichteten, so will ich zum Schluß noch zwei »Schulmänner« erwähnen, die uns betreuten. Das waren unsere Pedelle: der alte Hartung und Wilhelm Heinecke. – Jetzt gibt es nur noch Hausmeister.
Ich war gerade dreiviertel Jahr in Sexta, als der alte Hartung in Pension ging. Er fühlte sich aber noch bis in sein hohes Greisenalter zu »seinen« Schülern hingezogen und nahm als Ehrengast an allen Zusammenkünften ehemaliger Osteroder Pennäler (V.e.O.P.er) teil. Er war kein Verächter von Schnaps, Bier und Zigarren. Wenn er diese drei Gottesgaben in reichem Maße genossen hatte, setzte er regelmäßig zu seiner großen Rede an, die mit den Worten begann: »Meine lieben Apturjenten!« Bald kam er an eine Stelle, wo ihn die Rührung übermannte und sein Sprechapparat für kurze Zeit aussetzte. Unbekümmert legte er dann eine andere Platte auf, Bruchstücke aus einer vaterländischen Rede, die er vor Jahren einmal in der Aula gehört hatte und sonderbarerweise in seinem Hirn haften geblieben war. Zum Schluß sprang er aber wieder ab und endete mit einem Hoch »auf seine lieben Schüler.«
Herrn Heineckes Wirken kann man sich nicht ohne seine wackere Frau vorstellen. Beide sorgten für uns Schüler, als seien wir alle ihre Kinder. In der geräumigen, sauberen Küche ihrer Kellerwohnung war ein stetes Kommen und Gehen. Einer brauchte ein Gesangbuch, ein anderer ein Taschentuch, wieder ein anderer hatte Durst usf. Alle Wünsche wurden erfüllt. Im Kellerflur neben der Wasserleitung, wo wir die Schwämme für die großen Tafeln anfeuchten mußten, waren Pyramiden von Bänken und Pulten abgestellt. Hierhinter verschanzten wir uns in der Pause, wenn wir eine Hausarbeit vergessen oder darin Fehler entdeckt hatten. Kontrollierte der Aufsicht habende Lehrer den Keller, so gab H. rechtzeitig Warnzeichen; dann waren wir mäuschenstill, und die Gefahr ging vorüber. Im Notfall öffnete er die stets verschlossene Kellertür unter der Freitreppe, so daß wir ungesehen auf den Schulhof gelangen konnten. Heinecke war peinlich korrekt in seinem Amt. Deshalb kämpften oft zwei Seelen in seiner Brust, doch siegte stets sein gutes Herz. Und wir danken ihm heute noch dafür!
Nebenbei gesagt, ein Schuldiener ist mächtiger als ein König: er regiert sogar über die Zeit. So war es z. B. erst dann 8 Uhr, wenn Heinecke läutete. Und solange er läutete, blieb die Zeit stehen. Sämtliche Uhren in der Stadt waren damit ausgeschaltet. Von seinem Läuten hing es daher ab, ob man zu spät kam oder nicht.

Herr Heinecke zieht die große Schulglocke. Neben ihm seine Frau
Gutmütig wie er war, zögerte er, die Glocke unter dem Säulendach zu ziehen, wenn aus der Dörgestraße noch einige Nachzügler angehastet kamen, oder er dehnte das Läuten entsprechend aus, damit sie noch vor Beginn des Unterrichts in der Klasse waren.
Beim Schluß der Unterrichtsstunde kam es oft auf die Minute an. Manchmal war man froh, wenn es schellte und man der Gefahr entronnen war, noch im letzten Augenblick sich eine 5 zu holen. Wenn aber eine Arbeit geschrieben wurde, dann zählte man jede kostbare Minute, um die sich die Stunde verlängerte, besonders bei den mathematischen Arbeiten, wenn man gerade bis kurz vor die Lösung gekommen war. So bewahrheitete sich auch hier das alte Sprichwort: »Wat dem einen sin Uhl, is dem andern sin Nachtigall«
Zwei Szepter waren es, mit denen Herr Heinecke seine Herrschaft ausübte: die große Schulglocke, welche draußen links vom Eingang hing, und die Klingel, welche er in die Hand nahm und im Keller bellen ließ. Jene kündete den Beginn des Unterrichts, diese den Schluß an. Heute noch fahre ich wie elektrisiert zusammen, wenn ich gelegentlich Schulglocken höre: solch tiefen Eindruck haben sie in der Schulzeit auf mich gemacht.
Auf die große Schulglocke hatten wir von Sexta bis zum Verlassen der Schule eine furchtbare Wut. Sie setzte uns in Laufschritt, wenn wir auf dem Wege nach der Schule waren. In den Pausen zerriß sie unsere schönsten Spiele. Mit ihrem Klang hörte unser Eigenleben auf. Wie durch einen eisernen Vorhang waren wir von der Außenwelt abgeschnitten. Wir saßen im Käfig der Unterrichtsstunde.
Ist es da zu verwundern, wenn es uns danach drängle, unser Mütchen an der Glocke zu kühlen?
Hatten wir abends im Kurpark getanzt, oder waren wir auf dem Nachhauseweg von einer heimlichen Kneipe, dann huschten wir, lautlose Schatten, die Freitreppe hinauf, zogen und zogen an der langen Stange, so daß gellende Glockentöne die Stille der Nacht durchpeitschten. Uns wurde frei und wohl dabei. Wir konnten es nicht lassen, immer und immer wieder dies kindliche Spiel zu wiederholen. Für die kleinen Schüler hing die Glocke zu hoch. Deren Wunschtraum war, die ganze Penne möchte einmal abbrennen. Sie waren ja noch so naiv zu glauben, daß dann die Schule ausfiele. So weit dachten sie nicht, daß der Unterricht in irgendwelchen anderen Räumen der Stadt fortgesetzt werden würde. –
Die Jugend braust über, je mehr sie sich eingeengt fühlt oder am Gängelband gehalten wird. Uns war als Schülern der Besuch von Gastwirtschaften ohne elterliche Begleitung streng untersagt. Gerade weil es verboten war, reizte es uns, es den Studenten nachzutun und regelrechte Kommerse mit Fuxmajor und Fuxenstall abzuhalten. Petershütte, Aschenhütte, »Sösetal« und Kurhaus Eichental hallten oft wider vom Becherklang und Schlägerklirren. Es wurden donnernde Salamander gerieben ohne Nachklappen, Bierjungen getrunken ohne Bluten, und Biergerichte tagten mit geradezu juristischer Spitzfindigkeit.

Ausflug nach Petershütte
Schon als Obertertianer fochten wir Schläger. Seit Sekunda hatten wir eine Pennälerverbindung: »Consortia madida« mit den Farben blau-weiß-gold, später schwarz-rot-gold. Mit den Northeimer und Göttinger Pennälern standen wir in Verkehrsverhältnis. Als ich als Unterprimaner 14 Tage in Göttingen in augenärztlicher Behandlung war, wurde ich gleich von der dortigen Schülerverbindung »Teutonia« gekeilt und mir das rot-weiß-schwarze Band angetragen. Ehemalige Mitschüler, welche mit dem »Einjährigen« oder bereits früher abgegangen waren und in Osterode sich ihrer beruflichen Ausbildung widmeten, nahmen weiter an den Schülerkneipen teil. (In den V.e.O.P. konnten sie ja erst eintreten, wenn ihr Jahrgang Abitur gemacht hatte.) Sie galten dort als »Inaktive« und konnten sich, zumal sie der Schule nicht mehr unterstanden, mehr Freiheiten erlauben als wir.
Mir ist heute noch die kraftstrotzende Gestalt meines Freundes Gockel vor Augen, wie er nach einer Kneipe im Kurhaus Sösetal stolz mit Band und Mütze singend durch die Straßen schritt. Er kam nicht weit. Bei der Wache am Johannistor stellte ihn ein Nachtwächter. Tief beleidigt rief G. ihm zu: »Was wollen Sie denn, ich bin Student!« Doch der getreue Hüter der Nacht hatte ihn erkannt und entgegnete freundlich: »Sei'n Se man ruhig, Herr Gockel, ich kenne Ihnen, Sie sind bei die Braunschweigische Bank!« Damit war er der Blamierte.
Der gute Gockel, der sich in manchen Klassen die Hosen durchgesessen hatte, wollte Bankbeamter werden. Ostern war er nach Obersekunda versetzt. Da aber erst zu Michaelis auf der Braunschweigischen Bank eine Lehrstelle frei wurde, hielten es seine Eltern für ratsam, daß er bis zu diesem Zeitpunkt sich weiter studienhalber in Obersekunda aufhielt. Dieses halbe Jahr, gewissermaßen ohne Zweck und Ziel, empfand er als eine Art Gefangenschaft. Als die Zeit vorüber war und er das Abschiedszeugnis in die Tasche steckte, holte er daher zu einer großen Geste aus. Er stürmte nicht wie die Schüler nach Schulschluß die Freitreppe hinunter, sondern stellte sich, im Nacken die rote Sekundanermütze, oben breitspurig im Säulengang auf und entzündete sich zum Entsetzen der an ihm vorbeigehenden Lehrer umständlich eine dicke Zigarre. Wie eine Freiheitsfackel hielt er sie in der Hand und schritt damit, gewaltig paffend, langsam die breite Treppe hinunter. Die Schüler sperrten Mund und Nase auf.
Außer der Schulglocke setzten wir auf unseren nächtlichen Heimwegen auch die Nachtwächter in Bewegung. »Nachtrat heraus!« riefen wir durch die stillen Gassen, und im Sturmschritt kam ein Hüter der Nacht angewetzt. Schon aber erscholl aus einer anderen Ecke der gleiche Ruf. Kreuz und quer lockten wir sie durch die Stadt. Gefaßt haben sie uns aber nie. Wir mochten sie nicht, weil sie nach unserer Ansicht recht unmusikalisch waren und ruhestörenden Lärm nicht von wohltönender Musik unterschieden. Freddy, von dessen musikalischem Talent als Orgelmann ich bereits berichtet habe, hatte aus Berlin seine Gitarre mitgebracht und damit die Anregung gegeben, daß wir selbst anfingen, die Laute zu schlagen. So stieg nächtlicher Minnesang, begleitet von zartem Saitenspiel. Unser Freund Axel schleppte seine Gitarre immer mit sich umher. Kein Wunder, daß die Nachträte ihn bald kannten. So kam ruhestörender Lärm allein auf sein Konto, und er hatte die Strafmandate zu bezahlen. Um hierfür Geld flüssig zu bekommen, verpfändete er seine Laute an kapitalkräftige Freunde, die ihm nach ein paar Tagen gewöhnlich das Musikinstrument wieder überließen. Einmal jedoch war sein Kredit zu Ende; da ging er zum Rathaus und legte statt des erwarteten Talers die Gitarre auf den Tisch des Hauses. Schmunzelnd nahm der Polizeibeamte das objectum sceleris als Pfand an, denn nun war ja für einige Zeit in Osterode die Nachtruhe gewährleistet. Gute Freunde hatten aber Erbarmen, so daß Axel nach ganz kurzer Zeit seine Zupfgeige wieder einlösen konnte.
Als den Primanern gestattet wurde, Mittwoch und Sonnabend nachmittag im Kurpark einzukehren, hielten wir die Kneipen nur noch ab, wenn ein besonderer Anlaß, z. B. Geburtstag eines Klassenkameraden, Besuch von auswärtigen Pennälern und dgl., vorhanden war. Bei dem Nachmittagsschoppen im Kurpark waren wir recht brav und solide. Kein Wunder, wo das Haus des Direktors am Kurpark stand und wir so gewissermaßen unter Aufsicht unser Glas Bier tranken. Um die gleiche Zeit pflegten drei Honoratiorendamen an den warmen Sommertagen ihren Nachmittagskaffee im Kurpark einzunehmen. An unsere Anstalt war ein junger Lehramtskandidat versetzt, der in den unteren Klassen Unterricht erteilte und von einer erschreckenden Unbeholfenheit war. Als auch er gelegentlich im Kurpark erschien, ermunterten ihn die drei Damen, an ihrem Tisch Platz zu nehmen. Die reifen Frauen hatten ihren Rosenkavalier gefunden, der von nun ab an keinem Nachmittage fehlte. Wieder saßen wir an unserem großen Tisch vor der Veranda, als der Kandidat erschien und nach seinen »Marschallinnen« Ausschau hielt. Aber ausnahmsweise waren sie nicht erschienen. Während er noch dastand und schwankte, was tun, hatten wir schon Engelbert, den jungen Kurparkwirt, instruiert. Verbindlich lächelnd ging er auf seinen Gast zu und übermittelte: »Es würde den Herren Primanern eine besondere Ehre sein usw.« – Der Kandidat kam zu uns, und es wurde ihm alle Ehre zuteil. Höflich erhob sich einer nach dem andern, lüftete seine Mütze und gestattete sich, auf das Wohl des Herrn Kandidaten zu trinken. Und jedesmal kam er dem Zutrunk nach. Er hatte bald vergessen, daß er Lehrer und wir Schüler waren. Es wurde der feuchtfröhlichste Nachmittag, den wir im Kurpark verlebten. Dem Herrn Kandidaten schien aber diese Kur im Park nicht zu bekommen. Seine Beine und seine Zunge wurden schwer und schwerer. Es war schon weit nach 7 Uhr, als wir aufbrachen. Wenn es an einem Nachmittag ausnahmsweise einmal lebhaft zugegangen war, konnten wir sicher sein, daß der Direktor den Kopf zum Fenster herausstreckte, um seine schwarzen Schäfchen an sich vorüberziehen zu lassen. Wir teilten uns daher in zwei Gruppen. Die größere ging mutig an dem Direktorhaus vorüber, die kleinere – zum Abtransport des Kandidaten – umschlug links das große Rondell und erreichte so den Ausgang des Kurparks. Es ging alles gut ab. Den Kandidaten haben wir seitdem im Kurpark nicht wieder angetroffen. Die drei Kaffeetanten warteten vergebens auf ihren Galan und sandten uns seitdem tötende Blicke zu; denn ihnen war der Grund seines Ausbleibens bekannt geworden.
Bei uns war das weibliche Geschlecht im letzten Primanerjahr mehr und mehr in den Hintergrund getreten. Nicht, daß wir Frauenverächter geworden wären. Es war das bevorstehende Examen, das unsere Gedanken voll in Anspruch nahm. Dessen ungeachtet hatte ich als Oberprimaner ein kleines Erlebnis, das ich in meiner Erinnerung nicht missen möchte.
Ein Unterprimaner – beide Primen wurden ja gemeinschaftlich unterrichtet – kam eines Tages in die Klasse gestürmt und prahlte damit, er habe zwei blendende Mädels »aufgetan«, die in Osterode bei Verwandten zu Besuch weilten. Zeta und ich spitzten die Ohren und wußten bald, wo sie wohnten. Schon am Nachmittag standen wir vor ihrer Tür. Es war für uns Ehrensache, daß wir sie dem tumben Brüderlein ausspannten:
Denn wer ein Mädel hat
und sagt es jedermann,
der klopft dann auch sehr oft
bei ihr vergebens an!
Er hatte nicht zuviel gesagt. M. war ein entzückendes Geschöpf. Sie hatte ein Engelsgesicht, umrahmt von leuchtendem Blondhaar. Ihre kleine Freundin übernahm Zeta. Und köstlich war es, wenn wir im Schützenpark oder auf dem Röddenberg lustwandelten. »Es war ein kurzer, schöner Traum – mehr sollt' es auch nicht sein ...«
Im düsteren Zimmer
sind Texte bereitet,
harrt Zirkel und Kreide,
harrt blecherne Urne
und Tisch des Gerichts.
Verfehlt ihr die Fragen,
so stürzet ihr Aermsten
geschmäht und geschunden
in nächtliche Tiefen
und harret in Aengsten,
zermarternd den Kopf euch,
erneuten Gerichts.
Ganz so schlimm, wie ein Gedicht aus dem Jahre 1908 die Reifeprüfung – frei nach Goethe – schildert, war es nicht. Wir bestanden alle. Das Examen ging schnell vorüber in Gegenwart des Schulrats, des Bürgermeisters in Ausübung der Patronnatsrechte der Stadt und des Lehrerkollegiums. Das Tribunal in feierlichem Gehrock, der bislang auch für die Abiturienten vorgeschrieben war. Wir hatten aber die Tradition durchbrochen und uns anstatt des altväterlichen Gewandes einen Smoking bauen lassen. Das Kleidungsstück sah zum ersten und letzten Mal solch ernste und bedrückte Mienen, denn später zogen wir es nur zu frohen Festen an.
Niemals in meinem Leben habe ich mich so frei gefühlt, so losgelöst von aller Erdenschwere wie damals, als ich nach bestandenem Abitur die breite Freitreppe hinuntersprang. Ich hätte laut jubeln können:
»Frei ist der Bursch!«
Vergessen waren Mühen und Sorgen, und ein dankbares Gefühl für die Schule stieg in mir auf.
Während wir noch in Examensnöten saßen, »beteten« die Schüler der höheren Klassen im Hinterzimmer des Ratskellers für unser Durchkommen. Das war schon immer so gewesen.
Nachdem wir zu Haus die Freudenbotschaft überbracht hatten, kehrten auch wir zu einem kurzen Umtrunk bei Clito ein, beendeten die Betstunde und bezahlten die Zeche.
Dann ging es zum Photographen, um eine lustige Gruppenaufnahme von der Abiturientia 1911 machen zu lassen. Das Bild war für das V.e.O.P.-Zimmer im Ratskeller bestimmt, wo schon eine Reihe von Jahrgängen an der Wand prangte.
Acht Tage liefen wir als Muli umher. Acht Tage, wo wir nicht wußten, wohin mit der Freud'! Sie wurden gekrönt durch den Abiturientenkommers im Festsaal der »Ratswaage«. Dazu waren von uns geladen: die Honoratioren der Stadt, unsere Lehrer, unsere Väter, Freunde und Bekannte, ehemalige Schüler und die Unterprima. Es leuchteten auch schon Studentenmützen im Saal. Vertreter der Cimbern, Westfalen und Chuibellinen waren aus Göttingen erschienen und somit die Verbindung zwischen Schule und Universität hergestellt!
Das Präsidium führte der Primus omnium. Keck schmetterten wir das Lied der Muli durch den Raum:
»Leb wohl Realgymnasium!
Ich scheide ohne Trauern:
ich trieb mich lang' genug herum
in deinen dumpfen Mauern.
Du sollst mir stets in Ehren sein,
doch kriegt kein Pferd mich mehr hinein.
Tralarum, lirum, larum, hic finis est curarum.«
Rede folgte auf Rede und Lied auf Lied. Der Kommers wurde »verschönt« durch einen Einakter der Unterprimaner. Dann trat der Schülerturnverein auf.
Der Vorhang hatte sich schon längst wieder geschlossen, das Rumoren und Hantieren dahinter nahm indessen kein Ende. Und als ein Kommerslied mit der 3. Strophe fiel, hallte aus dem Hintergrund der Bühne unbekümmert die 4. Strophe weiter. Die heimlichen Zecher waren die Obersekundaner, welche in den Ankleideräumen hinter der Bühne den Abiturientenkommers mitfeierten. Es war aber schon in der x. Fidelität, und das Präsidium hielt gerade ein alter Korporationsstudent in Händen. Schnell rief er: »Vers nächster steigt!« Der Geistergesang wurde übertönt und die Gefahr gebannt.
Einige Tage nach dem Kommers fand in der Aula des Realgymnasiums unsere feierliche Entlassung statt. Wir saßen auf Stühlen vor dem Podium, hinter uns war die ganze Schule versammelt.
Der Kronensaal des alten Herrenhauses sah uns zum letzten Mal als seine Gäste. Jetzt, wo wir Abschied nahmen, wurden wir uns erst so recht seiner Schönheit bewußt. Der Geist des Klassizismus hatte ihn vor 100 Jahren geschaffen. An der Ost- und an der Westseite je eine kleine Vorhalle, durch dorische Säulen abgeteilt. Von der Decke funkelten die fünf prächtigen Bronzeleuchter, die Hunderte von Kerzen halten konnten, behängt mit Schnüren geschliffener Kristallperlen und -prismen. Die Decke selbst und die Wände weiß, gelb und zartblau bemalt mit eigenartigen Licht- und Schattenreflexen, so kunstvoll ausgeführt, daß Ornamente und figürliche Darstellungen von wirklicher Plastik nicht zu unterscheiden waren. Das Schachtruppsche Wappen, Opferlamm mit Siegesfahne, in der Mitte der Decke erinnerte an den einstigen Besitzer Johann Georg Schachtrupp.
Als der Festsaal Aula der Schule geworden war, hatten sich nach und nach die Götter Griechenlands und drei deutsche Kaiser eingestellt, deren Büsten an den Wänden entlang aufgestellt wurden. Bei vaterländischen Schulfeiern trugen die Götter Kränze, die Kaiser schwarz-weiß-rote Schärpen, und die Wände waren mit Tannengrün und Fähnchen geschmückt.
Heute trug die Aula kein buntes Paradekleid. Und das war gut so. Uns Abiturienten war doch etwas wehmütig ums Herz. Der Gesanglehrer intonierte am Flügel: »Bis hierher hat mich Gott gebracht«. Nach dem gemeinsamen Gesang sprach der Direktor zu uns. Obwohl wir wirklich keine Musterknaben gewesen sind, waren wir ihm doch ans Herz gewachsen, und eine Träne stahl sich über sein gütiges Gesicht, als er uns zum Schluß die Zeugnisse aushändigte. Mit Händedruck verabschiedeten, wir uns von den Lehrern. Würdig schritten wir die Wendeltreppe hinab, ohne deren Geländer wie sonst als Rutschbahn zu benutzen. Geradezu ehrfurchtsvoll sahen uns die kleineren Schüler nach und dachten: »ach, wären wir doch auch erst so weit!« –
Ein Bild aus einer alten Abiturientenzeitung tauchte vor mir auf. In das Dach des Schulgebäudes ist ein Kreckel gesteckt, die Kaffeemühle ist fertig. Eine Riesenhand ergreift eine Schar Sextaner und steckt sie in den Trichter, eine andere dreht den Kreckel, und unten aus dem Kasten marschieren sie als Abiturienten.
Aus den Füchsen waren Maulesel geworden, aus den Knaben Jünglinge.
Nun gings hinaus ins Leben, jeder mit den größten Erwartungen und Hoffnungen.
Wir stürmten vorwärts, in alle Winde zerstreut.
Auf und nieder hoben uns des Lebens Wogen. Die Besten zerschellten in der Blüte der Jahre. Schon das erste Völkerringen ließ ihr Lebensschiff versinken. Wir Uebriggebliebenen führten den Kampf ums Dasein fort. Und wieder entbrannte ein Weltkrieg, und das, was durch Fleiß und Arbeit errungen, zerstob wie Spreu vor dem Winde.
Was ist uns geblieben, und was kann uns niemand nehmen? Die Erinnerung an unsere goldene Jugendzeit, an unser Jugendparadies Osterode an dem Harz.
Und so schließe ich mit den Worten des früh verstorbenen Osteroder Pennälers Dr. Viklor Bernstorff:
»Das alles liegt nun schon so weit,
wie weiße Wolken droben schweben.
Ich gäbe viel, könnt ich die Zeit
der ersten Jugend nochmal leben!
Und reicht' ein König mir den Speer,
die Krone, Amt und alle Würde
und spräche: »Gib die Jugend her!«
– Ich trüge weiter meine Bürde.
Viel lieber soll ein güt'ger Traum
mich hin zur Jugend tragen.
Schon blüht der alte Kirschenbaum
wie einst in Maientagen«.