
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
»Die Schiltkrotten«, sagte der alte Geßner, »sind gantz wunderbare, auch scheutzliche thier anzüschouwen, ligend in einem harten geheüß, so hardt verschlossen, daß sich an jrem leyb gantz nichts erzeigt dann der kopff, vnnd ausserste füß oder bein, doch also daß sy auch die selbigen in das harte vnnd dicke schalen oder hauß ziehen vnnd verbergen mögend, welches so dick ist, daß auch ein geladner wagen, so er daräber fart, die selbigen nit zerbrächen mag, jr kopff vnnd füß so sy härauß streckend sind gantz schüppächt wie ein Schlangen oder Nateren vnnd jrer dreyerley geschlächt. Etliche wonend allein im erdterich, etliche in süssen wasseren, etliche in dem weyten Meer.«
Unser Forscher rechnet, wie die Alten überhaupt, die Schildkröten noch zu den vierfüßigen Tieren, »so blüt habend, vnnd sich durch die eyer merend.«
Der Bau der Schildkröten ist so eigentümlich und weicht von dem der andern Glieder ihrer Klasse so wesentlich ab, daß sie nicht verkannt werden können. Ihr in einem Panzer steckender Leib, der plumpe Kopf, dessen Kiefer, wie der Vogelschnabel, mit Hornschneiden bedeckt sind, und die kurzen, gleichsam stummelhaften oder zu langen, schmalen Flossen umgewandelten Füße sind Merkmale, die sich mit denen anderer Tiere nicht vergleichen lassen. Der Panzer besteht aus zwei Teilen, dem Ober- oder Rücken- und dem Unter- oder Brustpanzer. Ersterer ist mehr oder weniger gewölbt, länglich, rundlich oder herzförmig, der letztere schildartig, eirund oder abgerundet kreuzförmig, da seine Verbindungsstelle mit dem Rückenpanzer sich verschmälern kann. Die Verbindung selbst wird hergestellt durch Knorpelmasse, die entweder während des ganzen Lebens weich bleibt oder verknöchert und dann Ähnlichkeit mit einer Naht gewinnt. So bilden beide Panzer zusammen eine Kapsel, die nur vorn und hinten zum Durchlassen des Kopfes, der Füße und des Schwanzes geöffnet ist, also den Rumpf mehr oder weniger vollständig in sich einschließt. Der Kopf ist gewöhnlich eiförmig, hinten quer abgestutzt, an den Kiefern bald mehr, bald weniger vorgezogen, der Hals verschieden lang, immer aber verhältnismäßig sehr beweglich; die vier Füße sind entweder Gang-, Schwimm- oder Flossenfüße; der meist kurze, rundliche und kegelförmige, mehr oder weniger zugespitzte Schwanz ändert hinsichtlich seiner Länge erheblich ab und ist an seiner Spitze oft mit einem Nagel bewaffnet. Hornplatten oder Schilder, nur bei wenigen Arten ein lederartiger Überzug, decken den Panzer; eine warzige, mit größeren oder kleineren Schuppentafeln, Schildern, Höckern, körneligen Gebilden besetzte sowie durch besondere, an einzelnen Stellen auftretende, anders geformte hornige Anhänge, Sporen, Stacheln usw. ausgezeichnete Haut bekleidet Kopf, Hals, Füße und Schwanz. Die Platten der Rückenseite des Panzers zerfallen in Wirbel-, Seiten- oder Rippen- und Randplatten, unter denen man wiederum eine Nacken- und zwei Schwanzplatten unterscheidet; die paarigen der Brustseite werden eingeteilt in Kehl-, Arm- oder Oberbrust-, Brust-, Bauch-, Unterbauch-, After-, Achsel- und Weichenplatten. Sie alle stoßen in der Regel aneinander und sind dann durch Nähte vereinigt; doch kann auch eine Lagerung nach Art der Dachziegeln vorkommen. Anzahl, Verhältnis zueinander und Lagerung bieten bei Bestimmung der Arten wichtige Anhaltspunkte.
Die Schildkröten zählen zu den uralten Bewohnern unserer Erde. Unzweifelhafte Überreste von ihnen finden sich bereits in dem zur ältesten Sekundärzeit gehörenden Trias, über die Verbreitung der heutzutage lebenden Arten der Ordnung sind wir durch Strauch auf das genaueste unterrichtet worden. Er nimmt sieben verschiedene, wohlumgrenzte Wohngebiete der Tiere an. In dem ersten oder mittelmeerländischen Gebiete, das das südliche Europa, einen Teil des westlichen Asiens und den ganzen Nordrand Afrikas umfaßt, leben sechs, in dem zweiten, afrikanischen, zu dem, mit Ausnahme des Nordrandes, das ganze Festland von Afrika und die benachbarten Inseln zu rechnen sind, zweiunddreißig, im dritten, asiatischen, zu dem auch die zugehörigen Inseln zählen, vierundfünfzig, im vierten, australischen, acht, im fünften, südamerikanischen, das auch Westindien und die Galapagos- oder Schildkröteninseln in sich begreift, fünfunddreißig, im sechsten, nord- und mittelamerikanischen, vierundvierzig, und im siebenten, dem Meere, fünf Arten. Auf der östlichen Halbkugel sind achtundneunzig, auf der westlichen achtundsiebzig Arten gefunden worden. Heute kennt man auf der östlichen Halbkugel etwa 130, auf der westlichen einige 90 Arten. Auf die Strauch'schen Regionen verteilt ergeben sie nahezu die gleichen Verhältniszahlen. Herausgeber. Zwei Seeschildkröten sind in allen Meeren, mit Ausnahme des Schwarzen, gefangen worden; die übrigen Arten der Familie haben ein verhältnismäßig beschränktes Verbreitungsgebiet.
Aus vorstehenden Angaben geht hervor, daß auch die Schildkröten den allgemeinen Verbreitungsgesetzen der Kriechtiere überhaupt unterliegen. In warmen, wasserreichen Gegenden erreichen sie ihre größte Mannigfaltigkeit; nach den Polen zu wie nach der Höhe hinauf nehmen sie rasch an Anzahl ab; bis zum Polarkreise dringt keine einzige Art vor. Sie können wohl glühende Hitze und Dürre, nicht aber Kälte ertragen. Flüsse, Sümpfe, Moräste, feuchtschattige Wälder, aber auch Steppen und Wüsten sowie endlich das Meer bilden ihre Aufenthaltsorte.
Alle Lebensäußerungen der Schildkröten sind träge, langsam, unregelmäßig. Schildkröten können unglaublich lange Zeit leben, ohne zu atmen, ohne ihr Blut zu reinigen, sich nach den fürchterlichsten Verstümmelungen noch monatelang bewegen, im gewissen Sinne also Handlungen verrichten, die denen unverwundeter Tiere ähnlich sind. Enthauptete Schildkröten bewegen sich noch mehrere Wochen nach der Hinrichtung, ziehen z. B. bei Berührung die Füße unter die Schale zurück: eine, der Redi das Hirn weggenommen hatte, kroch noch sechs Monate umher; im Pflanzengarten zu Paris lebte eine Sumpfschildkröte sechs Jahre, ohne Nahrung zu sich zu nehmen.
Die willkürlichen Bewegungen der Schildkröten geschehen durchschnittlich ebenfalls langsam, träge und täppisch; doch gibt es viele unter ihnen, die in ihrer Behendigkeit an andere Kriechtiere erinnern. Im Gehen zeigen sich alle tölpelhaft und ungeschickt, die Land- und Seeschildkröten am ungeschicktesten, die Sumpfschildkröten noch am gewandtesten. Im Schwimmen und Tauchen bekunden Sumpf- und Seeschildkröten die größte Beweglichkeit, deren sie überhaupt fähig sind; aber sie übertreffen in dieser Fertigkeit schwerlich ein anderes im Wasser lebendes Kriechtier. Erstaunlich ist die Muskelkraft, die alle Arten betätigen. Schon eine mäßig große Landschildkröte trägt einen auf ihr rittlings sitzenden Knaben, eine Riesenschildkröte einen auf ihr reitenden Mann anscheinend ohne Beschwerde davon; im Sande mühsam dahinkriechende Seeschildkröten spotten der Kräfte eines Mannes, der versuchen will, sie aufzuhalten; kleine Sumpfschildkröten, die sich an einem Stocke oder Stricke festgebissen haben, hängen an ihm tagelang, ohne loszulassen, und ob man sie auch in die heftigsten Schwingungen versetzt.
Die Landschildkröten nähren sich hauptsächlich von Pflanzenstoffen, und zwar von Gräsern, Kräutern, Blättern und Früchten, genießen jedoch auch Kerbtiere, Schnecken, Würmer und dergleichen; einzelne Sumpf- und ebenso die Seeschildkröten sollen ebenfalls, wenigstens zeitweilig, Pflanzenstoffe, insbesondere Blätter von Sumpfgewächsen, im Wasser schwimmende Früchte oder aber Tange verzehren: die große Mehrzahl aber besteht aus Raubtieren, die verschiedenartige Wirbel-, Weich-, Gliedertiere, Würmer und vielleicht auch Strahltiere jagen; einzelne Arten werden als sehr tüchtige Räuber geschildert. Sie fressen eigentlich nur während der warmen Sommertage oder bezüglich in den Gleicherländern während der Regenzeit, dem dortigen Frühlinge, feisten sich innerhalb weniger Wochen, lassen dann allmählich ab, Nahrung zu sich zu nehmen, und fallen, wenn hier der Winter, dort die Dürre eintritt, in Erstarrung und Winterschlaf.
Bald nach dem Erwachen im Frühjahr beginnt die Fortpflanzung. Ihre Begattung währt oft tagelang. Bei einzelnen sitzt das Männchen auf dem Weibchen, bei andern klammern sich beide Geschlechter mit den Bauchschildern gegeneinander. Geraume Zeit später gräbt das befruchtete Weibchen, nicht ohne Vorsorge, Löcher in den Boden, gewöhnlich in den Sand, legt in sie die Eier und deckt sie wieder mit einer Lage Sand oder Erde zu. Die Eier haben eine kalkige, pergamentartige, dünne Schale, sind rundlich und nicht groß; das ölige Eigelb sieht orangefarben, das erst bei großer Hitze gerinnende Eiweiß grünlich aus. Viele Schildkröten legen kaum ein Dutzend, die großen Arten weit über hundert Eier. Die Mutter bekümmert sich nach dem Legen nicht um ihre Brut, so entschieden auch das Gegenteil behauptet worden ist. Die Eier werden nach Verlauf von einigen Wochen oder selbst Monaten gezeitigt; die Jungen kriechen nachts aus der Erde hervor und wandern nun entweder hier umher oder dem nächsten Wasser zu. Unzählige von ihnen werden von andern Kriechtieren, Säugetieren und Vögeln aufgelesen und vernichtet; die ungewöhnliche Lebensdauer von denen, die diesem Schicksal entgehen, schützt jedoch die Arten vor dem Aussterben. Bei den Japanesen gelten die Schildkröten als Bild eines hohen Alters und der Glückseligkeit, hinsichtlich des ersteren gewiß mit vollem Rechte.
Der französische Forscher de Lacépède, der Ende des vorigen Jahrhunderts über Kriechtiere schrieb, nennt den Panzer der Schildkröten ein ebenso treffliches Haus wie eine Schutzwehr, eine Burg, die die Tiere vor allen Angriffen ihrer Feinde schützt. »Die meisten von ihnen«, sagt er, »vermögen, wenn sie wollen, Kopf, Füße und Schwanz in die harte, knochige, sie oben und unten bedeckende Schale zurückzuziehen, und die Löcher sind klein genug, daß die Klauen der Raubvögel und die Zähne der Raubtiere ihnen schwerlich gefährlich werden können. Wenn sie unbeweglich in diesem Verteidigungszustände bleiben, können sie ohne Furcht und ohne Gefahr die Angriffe der Raubtiere abwarten. Sie sind dann nicht wie lebende Wesen zu betrachten, die der Kraft wieder Kraft entgegensetzen und durch den Widerstand und den Sieg selbst mehr oder weniger leiden; sondern sie stellen dem Feinde nichts als ihren dichten Schild entgegen, an dem seine Angriffe abprallen. Seine Waffen treffen einen Felsen, und sie sind unter ihrem natürlichen Schilde so gedeckt wie in der unzugänglichsten Felsenhöhle.« Diese Sätze sind hübsch erdacht und gesagt, leider aber nicht wahr. Schon Bechstein, der Lacépèdes Werk übersetzte, macht darauf aufmerksam, daß die Landschildkröten in dem Jaguar, die Seeschildkröten in den Haifischen Feinde haben, die ihnen wohl noch weit gefährlicher werden können als der Mensch; wir aber wissen, daß nicht allein der Jaguar, sondern auch der Tiger und vielleicht noch andere größere Katzen selbst große Schildkröten, die sundaischen Adjags, eine Art wilder Hunde, sogar Seeschildkröten überfallen und töten, daß die Katzen sie umwenden, um sie bequem handhaben zu können, und dann mit den Tatzen alle Fleischteile aus dem Panzer ziehen, daß Schweine sie, solange sie noch jung sind, trotz ihres Panzers verschlingen; wir wissen ebenso, daß große Raubvögel, so namentlich der Bartgeier, die kleineren Arten von ihnen ergreifen, hoch in die Luft erheben und so oft auf einen Felsen fallen lassen, bis der Panzer zerschmettert ist, daß außer diesem gewaltigen Raubvogel auch Bussarde und andere Falken, Raben und Reiher wenigstens die Jungen verzehren. Welche Feinde die gepanzerten Tiere sonst haben mögen, ist zurzeit nicht bekannt; daß ihrer jedoch mehr sind als die angegebenen, unterliegt kaum einem Zweifel.
Den tierischen Feinden gesellt sich fast allerorten der Mensch zu. Wir dürfen die Schildkröten als die nützlichsten aller Kriechtiere bezeichnen, weil wir nicht bloß das Fleisch, sondern auch die Eier von fast allen Arten genießen und wohlschmeckend finden. Einzelne freilich riechen so stark noch Moschus, daß wenigstens wir Europäer uns mit den aus ihrem Fleische bereiteten Gerichten nicht befreunden können, andere hingegen liefern, wie bekannt, wirklich köstliche Gerichte.
Seit uralter Zeit hält man Schildkröten in Gefangenschaft. Ich habe im Laufe der Jahre viele von ihnen gepflegt, mich jedoch mit ihnen, die Seeschildkröten vielleicht ausgenommen, niemals sonderlich befreunden können. Sie sind mir zu träge, zu stumpfgeistig, zu langweilig erschienen. Doch gibt es Liebhaber, die auch an ihnen hohes Wohlgefallen finden, sie mit Lust und Liebe behandeln und sie für anziehende und fesselnde Gefangene erklären. Ihre Pflege erfordert übrigens mehr Sorgsamkeit und Verständnis, als man gewöhnlich annimmt. So groß ihre Lebenszähigkeit ist, so leicht erliegen sie mancherlei Krankheiten, die in der Gefangenschaft zumeist ihren Grund in mangelnder oder ungeeigneter Wartung haben. Wärme ist die erste und hauptsächlichste Bedingung ihres Wohlbefindens: hält man sie in kalten Räumen, in kaltem Wasser, so gedeihen sie nie. »Es wird« sagt Fischer, dem wir treffliche Beobachtungen und Mitteilungen über gefangene Schildkröten verdanken, »viel gesündigt gegen diese armen Tiere, indem man fälschlich wähnt, daß die Zähigkeit ihres Lebens auch eine feste Gesundheit beanspruche. Nein, die Schildkröten sind für äußere, scheinbar unbedeutende Einwirkungen höchst empfindlich. Sie leiden nur langsam. Und das ist es, was zu glauben verleitet, daß sie alles ertragen könnten.«
Die Schriften der Alten gestatten uns nicht nur allein einen Einblick in die damalige Kenntnis der Schildkröten, sondern enthalten auch mancherlei geschichtliche Mitteilungen, die immerhin der Beachtung wert sind. Aristoteles schildert das Eierlegen. Plinius stellt alles ihm Bekannte zusammen, zählt wie gewöhnlich alle Arzneimittel auf, die aus den Bestandteilen der Schildkröten angefertigt werden können, und bemerkt, daß es der verschwenderische und prunksüchtige Carvilius Pollio war, der zuerst verschiedene Gegenstände mit Schildpatt belegen ließ. Aelian weiß, daß der abgehauene Kopf der Seeschildkröten sich noch bewegt, beißt und mit den Augen blinzelt; versichert auch, daß die Augen der Schildkröten weit in die Ferne strahlen, und daß die glänzend weißen und hellen Augäpfel, in Gold gefaßt, zu Halsbänderschmuck verwendet und von den Frauen sehr bewundert werden. Pausanias gibt an, daß auf dem Parthenonischen Berge in Arkadien Schildkröten vorkommen, aus deren Schale man vortreffliche Lauten verfertigen könne; daß man die Tiere aber nicht wegnehmen dürfe, weil die dort wohnenden Leute sie als dem Pan geweihte Geschöpfe ansähen und schätzten. Julius Capitolinus erwähnt beiläufig, daß in Rom kaiserliche Prinzen in Schildkrötenschalen gebadet wurden, und Diodorus Siculus endlich erzählt von den Schildkrötenessern, die kleine, im Weltmeere, aber nahe am Festlande liegende Inseln bewohnen und die ihre Eilande besuchenden Seeschildkröten in absonderlicher Weise fangen. Diese Tiere sind ungeheuer groß, kleinen Fischerkähnen vergleichbar, und gehen bei Nacht ihrer Nahrung nach, wogegen sie am Tage im Sonnenscheine auf der Oberfläche des Meeres schlafen. Um diese Zeit schwimmen die Schildkrötenesser leise herbei; einige heben das Tier auf der einen, andere senken es auf der andern Seite, um so es auf den Rücken zu werfen; dann bindet einer ein Tau an den Schwanz und schwimmt dem Lande zu, während die übrigen die schwere Last schiebend weiter bewegen. Am Ufer angelangt, töten sie die Beute, verzehren alles Fleisch, nachdem sie es an der Sonne braten ließen, benutzen auch die Schilde als Kähne oder als Dächer ihrer Hütten. Die Merkmale der ersten Familie ( Testudinida), die wir, ungeachtet der verschiedenartigen Lebensweise ihrer Mitglieder, als die der Landschildkröten bezeichnen wollen, sind die folgenden: Der Rückenschild ist stets eirund, aber in sehr verschiedenem Grade gewölbt; die Brustschildknochen sind stets zu einer Platte verwachsen, die höchstens in der Mitte offen bleibt, Rücken- und Brustschild auch stets mit Hornplatten gedeckt. Das Trommelfell ist immer sichtbar. Die Beine, Gang- oder Schwimmfüße, haben Krallen von verschiedener Form, die Vorderfüße nie unter vier, gewöhnlich aber fünf, die Hinterfüße in der Regel vier, selten fünf und nur in einem Falle deren drei. Fast alle warmen Länder der Erde beherbergen Landschildkröten, Afrika, so viel bis jetzt bekannt, die meisten, Europa nur deren drei. Sie bewohnen zwar auch Steppen und Wüsten, mit Vorliebe aber doch waldige oder dicht mit Pflanzen bewachsene feuchte Orte und führen hier ein beschauliches oder richtiger, langweiliges Stilleben. Wie alle Kriechtiere der Wärme im höchsten Grade zugetan, zeigen auch sie sich in den gemäßigten Gürteln nur in den heißen Monaten des Jahres und verbringen die kühlere Zeit winterschlafend in selbstgegrabenen Löchern unter der Erde. Genau dasselbe findet in den Gleicherländern statt, jedoch während der heißesten und trockensten Monate des Jahres, die unserm Winter entsprechen.
Die Sippe der Landschildkröten im engsten Sinne ( Testudo) kennzeichnet sich, laut Strauch, dessen »Chelonologischen Studien« ich auch fernerhin die Merkmale der einzelnen Sippen entnehmen werde, durch folgendes: Der meist stark gewölbte Rückenpanzer besteht aus einem Stück, der Brustpanzer, der stets aus zwölf Platten zusammengesetzt ist, aus einem oder zwei Stücken, im letzteren Falle aus einem vorderen unbeweglichen und einem Hinteren beweglichen; die Schwanzplatte ist stets einfach, obwohl zuweilen auf ihrer Oberfläche geteilt; die Nackenplatte kann zwischen der andern eingeschoben sein oder fehlen; Achsel- und Leistenplatten sind vorhanden. Der Kopf ist beschildert, das Schwanzende zuweilen mit einem Nagel versehen. Große, meist dachziegelförmig gelagerte Schuppenknötchen bekleiden die Vorderarme, sporenartige Knoten die Hacken der Hinterfüße, oft auch die Hinterseite der Schenkel. Die Zehen der plumpen Füße sind bis an das Nagelglied unbeweglich miteinander verwachsen und vorn mit fünf, seltener vier, hinten stets mit vier Krallen ausgestattet. Alle hierher gehörigen Arten gehen auf den Zehen und sind Landtiere im eigentlichen Sinne des Wortes.
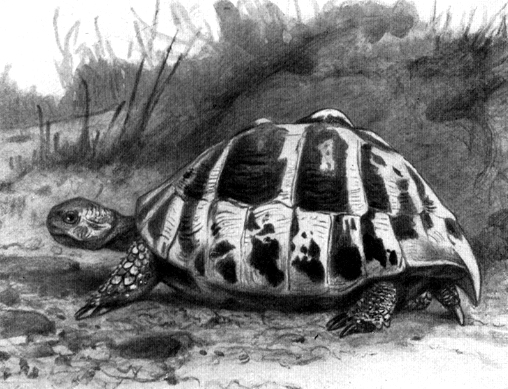
Griechische Schildkröte ( Testudo graeca)
Als Vertreter der drei in Europa vorkommenden Arten dieser Sippe wird gewöhnlich die griechische Schildkröte ( Testudo graeca) aufgeführt. Ihr Panzer ist im ganzen eiförmig und hoch gewölbt, nach hinten etwas verbreitert und steiler abfallend als nach vorn; der beim Weibchen platte, beim Männchen etwas gewölbte Brustteil vorn abgestutzt, hinten tief ausgerandet. Die Platten sind hoch, die Wirbelplatten schwach buckelig, die drei mittleren sechs-, die vordere und Hintere fünfseitig, die beiden mittleren Rippenplatten fast doppelt so lang als breit, undeutlich fünfeckig, d. h. viereckig mit gebrochener Linie der Innenseite, die beiden vorderen fünfeckig mit gebogenem Unterrande, die beiden hinteren verschoben viereckig. Unter den fünfundzwanzig Randplatten ist die Nackenplatte die kleinste, die obere, hinten vorgezogene und über den Schwanz herabgebogene die größte; die übrigen haben eine unter sich meist verschiedene, ungleichseitig fünfeckige Gestalt. Die Mittelfelder aller Platten sind bei jüngeren Tieren gekörnelt, bei älteren glatt, und werden von deutlichen Anwachsstreifen umgeben. Der ziemlich plumpe Kopf ist merklich dicker als der Hals, die Schnauze vorn abgestumpft, das Auge mäßig-, das Ohr dem Auge annähernd gleichgroß, der Ober- und Seitenteil der Schnauze mit einer großen rundlichen Nasen-, einer kleinen Stirn- und einer sehr großen, langen Trommelschuppe, der Kopf übrigens oben mit kleinen unregelmäßigen Schildchen bekleidet. Jede Platte des Rückenpanzers ist in der Mitte schwarz, dann gelb und schwarz gesäumt; über den Brustschild verläuft ein breiter unregelmäßiger Längsstreifen von gelblicher Färbung; die Seiten sehen ebenfalls gelb aus; das übrige ist schwarz. Kopf, Hals und Glieder haben schmutzig grüngelbe Färbung. Wie bei den meisten Schildkröten überhaupt unterliegt die Farbenverteilung mannigfachem Wechsel; selbst die Anzahl der Krallen der Vorderfüße kann bei einzelnen Stücken bis auf vier herabsinken. Die Weibchen unterscheiden sich von den Männchen durch bedeutendere Größe und längeren, an der Wurzel dickeren Schwanz, die Jungen von den Alten durch gedrungenere Form ihres Panzers. Die Länge des ausgestreckten Tieres, von der Schnauze bis zur Schwanzspitze gemessen, beträgt höchstens 30 Zentimeter, das Gewicht selten über 2 Kilogramm.
Das ursprüngliche Vaterland unserer Schildkröte beschränkt sich auf die im Norden des Mittelmeeres gelegenen Länder, und zwar eigentlich nur auf die der griechischen und italienischen Halbinsel nebst den dazu gehörigen Eilanden; außerdem kommt sie noch in Kleinasien und, laut Tristram, ungemein häufig auch in Palästina vor. Nachweislich und allem Vermuten nach als von jeher heimisches Tier hat man sie in Griechenland, Dalmatien und der Türkei, den Donautiefländern, in Unteritalien, einschließlich der Inseln Corsica, Sardinien und Sizilien sowie endlich bei Brussa und Angora in Kleinasien beobachtet, als freilebende, jedoch wahrscheinlich eingebürgerte, beziehentlich unzweifelhaft freigelassene oder der Gefangenschaft entflohene Fremdlinge in Südfrankreich und der Schweiz, auf den Balearen, ja sogar in Schweden gefunden. Laut Schreiber soll diese Schildkröte namentlich von Klosterleuten vor verhältnismäßig ziemlich langer Zeit häufig in vielen Gegenden als Haustier eingeführt worden und dann verwildert sein. Sie bewohnt waldige und buschige Gegenden, einzelne in sehr großer Menge, ist insbesondere in Süditalien, Griechenland und bei Mehadia, am Fuße des Allion, sehr häufig.
Die Wärme liebt sie ungemein und setzt sich deshalb stundenlang mit höchstem Behagen den Strahlen der Mittagssonne aus: Dumeril fand sie in Sizilien, wo sie überall allgemein ist, zu beiden Seiten der Straßen liegen, von der Sonne derartig durchglüht, daß er nicht imstande war, seine Hand auf den Panzer zu legen. Gegen den Winter hin vergräbt sie sich tief in die Erde und verschläft hier die kühle Jahreszeit, anfangs April wieder zum Vorscheine kommend.
Ihre Nahrung besteht aus verschiedenen Kräutern und Früchten; nebenbei verzehrt sie Schnecken, Würmer und Kerbtiere, wird deshalb auch oft in ihrer Heimat in den Gärten gehalten, um hier dem Ungeziefer Einhalt zu tun. Abweichend von ihrer in den Ländern des Schwarzen Meeres lebenden Verwandten ( Testudo campanulata), die sich, nach Erbers Erfahrungen, streng an Pflanzenstoffe hält, zeigt sie sich durchaus nicht wählerisch in ihren Speisen. »Was mir die Eßlust auf Schildkrötensuppe gründlich verleidet hat«, schreibt mir Erber, »war die Beobachtung, daß sie mit Vorliebe Menschenkot frißt. Ich fand oft größere Gesellschaften von ihr, die sich wegen dieses ekelhaften Gerichtes versammelt hatten.« Die Gefangenen nehmen Obst, Salat, in Milch oder Wasser geweichtes Weißbrot, Mehl- und Regenwürmer zu sich, halten sich bei solchem Futter vortrefflich, falls man sie vor den Einwirkungen der Kälte schützt, und sollen mehrere Menschenalter in der Gefangenschaft ausdauern: so berichtet Tschudi von einer, die auf einem Landgute in der Nähe von Adorf im Kanton Uri gegen hundert Jahre gelebt haben soll. »Eine Landschildkröte«, erzählt White, »welche einer meiner Freunde über vierzig Jahre in einem umschlossenen Räume hielt, und die dann in meinen Besitz gekommen ist, vergräbt sich jährlich um Mitte November und kommt Mitte April wieder an das Tageslicht. Bei ihrem Erscheinen im Frühjahr zeigt sie wenig Freßlust, später im Hochsommer frißt sie sehr viel, gegen den Herbst hin wiederum wenig und, bevor sie sich eingräbt, mehrere Wochen gar nichts mehr. Milchige Pflanzen sind ihre Lieblingsspeise. Wenn sie im Herbst ihre Höhle gräbt, kratzt sie äußerst langsam und bedächtig mit den Vorderbeinen die Erde los und zurück und schiebt sie dann mit den Hinterbeinen noch weiter weg. Vor Regengüssen fürchtet sie sich: bei nasser Witterung bleibt sie auch den ganzen Tag über verborgen. Bei gutem Wetter geht sie im Hochsommer gegen vier Uhr nachmittags zur Ruhe, und am nächsten Morgen kommt sie erst ziemlich spät wieder hervor. Bei sehr großer Hitze sucht sie zuweilen den Schatten auf; gewöhnlich aber labt sie sich mit Behagen an der Sonnenwärme.« Reichenbach beobachtete, daß die Gefangenen dieser Art, die er im Pflanzengarten zu Dresden hielt, weit umherwanderten, stets aber dieselbe Bahn einhielten und sich, wenn es kühler wurde oder die Sonne nicht schien, immer wieder unter einer bestimmten breitblätterigen Pflanze wiederfanden. Im Herbste gruben sie sich ein.
Auf Sardinien, woselbst die Winter zwar gelinde, aber doch immer noch rauh genug sind, um die Schildkröten zu nötigen, in der Erde Zuflucht zu suchen, graben sie sich, laut Cetti, im November ein und kommen im Februar wieder zum Vorscheine. Im Juni legen sie bereits ihre Eier, vier bis zu einem Dutzend, die an Größe einer kleinen Nuß gleichkommen und weiß von Farbe sind. »Zur Brutstelle erwählen sie einen möglichst sonnigen Ort, scharren mit den Hinterbeinen eine Grube aus, legen die Eier da hinein und vertrauen die weiteren Sorgen für ihre Nachkömmlinge dem großen Lichte der Welt. Beim Eintritte der ersten Septemberregen erscheinen die jungen Schildkröten, in der Größe einer halben Walnußschale gleichend; die artigsten Dingerchen von der Welt.« Wenn man ihnen volle Freiheit läßt, benehmen sie sich selbst in sehr nördlichen Ländern ganz wie zu Hause, pflanzen sich auch fort oder begatten sich wenigstens. In einem gleichmäßig und stark geheizten Zimmer fallen sie nicht in Winterschlaf, leben dann aber, nach Fischers Beobachtungen, nicht so lange, als wenn man ihnen allwinterlich Ruhe gönnt.
Gefangene, die längere Zeit einer Kälte unter Null ausgesetzt werden, gehen bald zugrunde, so unempfindlich sie sich im übrigen zeigen. Ohne Schaden können sie fast ein Jahr lang fasten und Verwundungen der fürchterlichsten Art mit einer uns unbegreiflichen Gleichgültigkeit ertragen. Nimmt man ihnen das bohnengroße Gehirn heraus, so laufen sie noch sechs Monate umher; schneidet man ihnen den Kopf ab, so bewegt sich das Herz noch vierzehn Tage lang, und der abgeschnittene Kopf beißt noch nach einer halben Stunde.
Daß ein Tier, bei dem das Hirn eine so untergeordnete Rolle spielt, sich nicht durch höhere Begabung auszeichnen kann, versteht sich von selbst. Ein gewisses Verständnis kann man ihm jedoch trotzdem nicht absprechen. Alle Tierfreunde, die längere Zeit Landschildkröten in Gefangenschaft hielten, versichern, daß sie sich nach und nach an den Pfleger gewöhnen, und ebenso geht aus den Beobachtungen Dumerils hervor, daß unsere Schildkröten sich auch zeitweilig aufregen lassen. »Wir haben«, sagt dieser Forscher, »einige Male zwei Männchen sich um den Besitz eines Weibchens mit unglaublicher Hartnäckigkeit streiten sehen. Sie bissen sich gegenseitig in den Hals, versuchten sich umzustürzen usw., und der Streit endete nicht eher, als bis einer der beiden Streiter besiegt und kampfunfähig gemacht wurde.« Wie lange ein zärtliches Verhältnis zwischen einer männlichen und einer weiblichen Schildkröte währen mag, weiß man nicht, soviel aber hat man beobachtet, daß die Begattung der unbehilflichen Tiere erst nach vielen vergeblichen Versuchen vor sich geht.
In Italien bringt man diese Landschildkröten regelmäßig auf den Markt, weil das Fleisch überall gegessen und insbesondere die aus ihm bereitete Suppe geschätzt wird.
Eine der schönsten Arten der Gruppe ist die Sternschildkröte ( Testudo actinodes), die aus Ostindien stammt. Der länglich eirunde Panzer ist in der Mitte stark erhöht, an beiden Enden fast gleichmäßig abgeflacht, seitlich leicht gewölbt, im ganzen eher höher als breit, der Rückenschild vorn, der Brustschild hinten fast dreieckig tief ausgeschnitten. Die Mittelfelder der einzelnen Platten erheben sich, wenigstens bei den alten Stücken, so bedeutend, daß die Platten zu hohen Höckern anschwellen. Auf den Wirbelplatten liegen die Mittelfelder oder höchsten Erhebungen, um nicht zu sagen Spitzen, der Höcker in der Mitte, auf den Rippenplatten zwischen der Mitte und dem oberen Rande, auf den Randplatten in der unteren hinteren Ecke; an den drei hintersten Randplatten treten sie, sich erhebend, besonders hervor. Die Nackenplatte fehlt; die Kehlplatten sind verlängert dreieckig, die Oberbrustplatten länger als breit, die Brustplatten sehr schmal, die Bauchplatten ebenso breit als lang, die Afterplatten rhombisch. Kleinere vielseitige Schuppen bekleiden den Oberkopf und liegen auf der Oberseite der Schnauze beiderseitig gleichmäßig verteilt; eine größere, längliche deckt wie gewöhnlich die Gegend über dem Ohre. Die Kinnladen sind schwach gezähnelt. Die Vorderbeine panzern auf der Vorder-, die Hinterbeine auf der Rückseite vortretende, große, flache, dreieckige Schuppen. Der Kopf und die Glieder zeigen auf gelblichem Grunde unregelmäßige Marmelung, die einzelnen Schilder des Panzers auf schwarzem Grunde eine wirklich prachtvolle Zeichnung, denn von allen hell und lebhaft gelben Mittelfeldern aus strahlen sternartig gleichgefärbte, mehr und mehr sich verbreiternde Streifen aus, die den ganzen Panzer in höchst ansprechender Weise zieren. Die Länge des ausgestreckten Tieres beträgt ungefähr 30, die der Schale 20 Zentimeter. Die Sternschildkröte bewohnt, hier sehr, dort minder häufig, hochstämmige, grasreiche Wälder Hindostans, Birmas, Pegus und Ceylons, wird aber trotzdem nicht eben häufig gefangen. Dies hat, laut Hutton, dem wir das Nachstehende zu danken haben, seinen Grund hauptsächlich darin, daß ihre Färbung auf das genaueste mit der des Bodens ihrer Aufenthaltsorte übereinstimmt und sie demgemäß kaum von ihrer Umgebung unterschieden werden kann, vorausgesetzt, daß sie sich überhaupt zeigt und nicht, wie sie während der Hitze zu tun pflegt, unter Gestrüpp oder in dichten Grasbüschen verbirgt. Erfahrene eingeborene Jäger suchen jedoch auf sandigen oder staubigen Stellen ihre Fährte auf, folgen derselben mit überraschender Sicherheit und gelangen so oft in ihren Besitz. Während der Regenzeit sind die Sternschildkröten am muntersten und laufen fast den ganzen Tag über umher, um zu fressen und sich zu paaren. Mit Beginn der kalten Jahreszeit suchen sie sich ein Versteck und bergen sich, so gut sie können, um sich besser gegen die Kälte zu sichern; hier verweilen sie in stumpfer Untätigkeit, nicht aber in bewußtlosem Schlafe, bis zum Eintritt der heißen Monate, während deren sie sich in den Mittagsstunden ebenso, wie früher gegen die Kälte, gegen die Hitze zu schützen bemühen und nur gegen Sonnenuntergang zum Vorscheine kommen.
Hutton hielt mehrmals Sternschildkröten in Gefangenschaft, einmal deren sieben, vier Männchen und drei Weibchen zusammen, brachte sie in einem weiten Gehege unter, versah sie mit Wasser, frischem und trockenem Grase, auch einem großen Haufen von Reisig und grobem Heu, der ihnen zum Rückzuge diente, und beobachtete sie hier sorgfältig. Während der heißen Zeit verblieben sie den ganzen Tag über in ihrem Versteck und kamen erst kurz vor Sonnenuntergang hervor, um zu fressen, zogen sich aber bei Nacht nicht wieder zurück, sondern verweilten, anscheinend schlafend, auf einer und derselben Stelle, als wollten sie sich der Kühle erfreuen, und wanderten erst mit Anbruch des Tages wieder ihrem Schlupfwinkel zu. In dieser Zeit nahmen sie auch öfters ein Bad, indem sie ins Wasser stiegen, hier meist eine halbe Stunde lang verweilten und dabei gelegentlich sich entleerten. Sie tranken jetzt auch viel Wasser.
Mit Beginn der Regenzeit wurden sie lebendiger, wanderten während des ganzen Tages in ihrem Gehege umher, fraßen, ruhten wiederum, und trafen endlich Anstalten zur Paarung. Oft folgten sich zwei Männchen in kurzen Zwischenräumen, ohne jedoch das Weibchen, das währenddem, ruhig fressend, auf einer und derselben Stelle verblieb, zu belästigen. Bei der Begattung bestiegen die Männchen die erwählten Weibchen nach Art sich paarender Säugetiere, indem sie mit den Vorderbeinen die Schale desselben umklammerten, mit den Hinterbeinen aber auf dem Boden stehen blieben. Während der Vereinigung, die oft zehn bis fünfzehn Minuten dauerte, ließ das Männchen zeitweilig einen grunzenden Laut vernehmen. Solange die Regenzeit anhielt, also von Ende Juni bis Mitte Oktober, ließen die Weibchen die Männchen zu; dann zeigten sich beide Geschlechter wiederum gleichgültig gegeneinander. Zwei Männchen kämpften nicht selten zusammen, zogen Kopf und Vorderfüße ein, stemmten die Hinterbeine gegen den Boden und schoben nunmehr beide Panzer solange gegeneinander, bis einer der beiden Kämpfer ermattet abließ. Zuweilen gelang es dem einen, seinen Gegner umzuwenden und auf den Rücken zu werfen, aus welcher Lage er sich dann immer nur durch geradezu verzweifelte Anstrengungen mit Kopf und Füßen zu befreien vermochte. An solchen Kampfspielen beteiligten sich übrigens auch die Weibchen, und sie gingen, dank ihrer bedeutenderen Stärke, gewöhnlich als Sieger aus dem Ringen hervor.
Am elften November begann eine der weiblichen Schildkröten eine Grube zur Aufnahme ihrer Eier auszutiefen, und zwar geschah dies in folgender Weise: Nachdem sie einen abgelegenen Platz in der Nähe eines Busches dichten und groben Grases erwählt hatte, befeuchtete sie denselben zunächst mit Wasser, das sie aus dem After fließen ließ, und kratzte nunmehr die erweichte Erde mit den Hinterfüßen weg, wobei sie einen um den andern bewegte. Indem sie fortfuhr, tropfenweise Wasser abzulassen, verwandelte sie den Boden allgemach in steifen Schlamm und vermochte nunmehr erst, ihn nach Wunsch zu bearbeiten. Nach ungefähr zweistündiger Arbeit hatte sie eine Vertiefung von zehn Zentimeter Durchmesser und fünfzehn Zentimeter Tiefe ausgegraben, legte in dieser vier Eier ab, füllte sie mit der ausgescharrten Erde wieder zu, stampfte diese in der Grube mit Hilfe der Hinterbeine ein und rammte den Boden, nachdem die Vertiefung gefüllt war, außerdem noch dadurch fest, daß sie, so hoch sie konnte, auf den Beinen sich erhob und plötzlich fallen ließ. Hierdurch ebnete sie den Platz so vollkommen, daß Hutton die Stelle nicht gefunden haben würde, hätte er die Schildkröte nicht bei ihrer Arbeit beobachtet. Nachdem sie ihr Werk vollendet, verließ sie den Platz sofort, blieb aber bald auf einer Stelle liegen, als ob sie von ihrer Arbeit ermüdet wäre. Letztere hatte vier volle Stunden in Anspruch genommen.
Als die kalte Jahreszeit anbrach, wurden sämtliche gefangenen Sternschildkröten träger, verließen seltener und immer seltener ihren Schlupfwinkel, verblieben endlich vom Anfang des Dezember an bewegungslos auf derselben Stelle und nahmen keine Nahrung mehr; keine einzige von ihnen aber versuchte, sich einzugraben, wie die griechischen Schildkröten zu tun pflegen. Volle zwei Monate verweilten sie in ihrer Lage, einer trägen, verdrossenen Ruhe sich hingebend, ohne jedoch in Winterschlaf zu fallen. Als es gegen Mitte Februar regnete, kamen sie wieder zum Vorscheine, fraßen etwas Luzerne, tranken gierig erhebliche Mengen von Wasser, kehrten jedoch wiederum zu ihrem Winterlager zurück und verfielen in denselben Zustand wie früher. Erst um Mitte April, bei Beginn der warmen Jahreszeit, erschienen sie regelmäßig in ihrem Gehege, jetzt aber meist in den Mittagsstunden. Behaglich gaben sie sich nunmehr den belebenden Sonnenstrahlen hin, und erst gegen Abend suchten sie den ihnen zur Gewohnheit gewordenen Schlupfwinkel auf.
In Schichten der Tertiärzeit fand man im unteren Himalaja, mit urweltlichen Säugetierknochen vermischt, die Überreste eines gewaltigen, den Landschildkröten verwandten Kriechtieres, dessen Panzer eine Länge von vier und eine Höhe von drei Meter zeigte ( Colossochelis atlas), ebenso in Amerika und neuerdings auch in Deutschland annähernd aus derselben Zeit stammende Reste verwandter Vorweltsschildkröten ähnlicher Größe. Von derartigen Riesentieren können wir kaum eine richtige Vorstellung gewinnen, auch wenn wir die heutzutage noch lebenden Elefantenschildkröten ( Testudo elephantopus), die alle übrigen auf dem Lande lebenden Arten der Ordnung an Größe überbieten, zu Hilfe nehmen. Vor noch nicht allzu langer Zeit sah man die letztgenannten Tiere, ungeachtet ihres verschiedenen Wohngebietes, als Abänderungen einer und derselben Art an, die man Testudo indica nannte; neuerdings hat Günther, gestützt auf Untersuchungen einer zahlreichen Menge von Elefantenschildkröten, eine Reihe von Arten unterschieden und zugleich die älteren Berichte über deren Vorkommen, Verbreitung und Nutzung in übersichtlicher Weise zusammengestellt, so daß wir wenigstens von der Geschichte der betreffenden Arten ein klares Bild gewonnen haben.
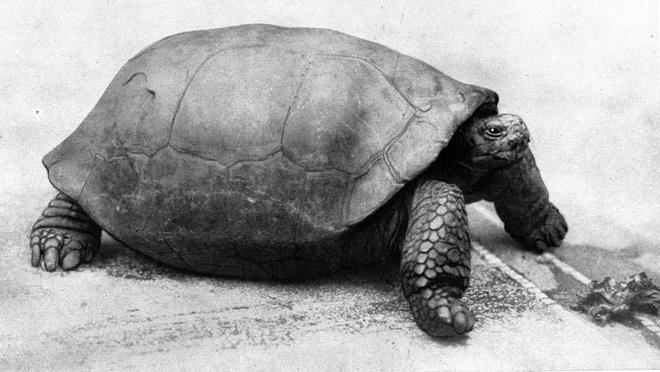
Elefantenschildkröte ( Testudo elephantopus)
»Fast alle Reisenden des sechzehnten und siebzehnten Jahrhunderts, die von ihren Begegnissen und Entdeckungen im Indischen und Stillen Weltmeere Nachricht gegeben haben«, bemerkt Günther, »gedenken zahlloser Riesenschildkröten, denen sie auf gewissen vereinzelten oder in Gruppen verbundenen Eilanden begegneten. Diese Eilande, sämtlich zwischen dem Gleicher und dem Wendekreise des Steinbocks gelegen, bilden zwei tierkundliche Brennpunkte. Einer von ihnen begreift die Schildkröten- oder Galapagosinseln, der andere Aldabra, Réunion, Mauritius und Rodriguez in sich. Beide sind unter sich sehr verschieden beschaffen; beiden aber war gemeinschaftlich, daß sie zur Zeit ihrer Entdeckung weder Menschen noch andere größere Säugetiere beherbergten. Kein einziger der betreffenden Seefahrer berichtet, die gedachten Schildkröten irgend anderswo, auf einem Eilande ebensowenig wie auf dem indischen Festlande, gefunden zu haben. Es ist nicht glaublich, daß einer oder der andere Reisende eine solche Begegnung nicht erwähnt haben sollte; denn alle Seeleute jener Zeit erwiesen den Riesenschildkröten vollste Beachtung, weil diese einen wichtigen Teil ihrer Nahrung bildeten. Reisen, die wir gegenwärtig in wenigen Wochen zurücklegen, erforderten damals Monate; alle Schiffe waren wohl so zahlreich als möglich bemannt, aber nur dürftig mit Nahrungsvorräten ausgerüstet: jene Schildkröten, von denen man binnen wenigen Tagen mit der größten Leichtigkeit eine beliebige Anzahl einfangen konnte, mußten daher stets im hohen Grade willkommen sein. Man konnte sie im Raume oder sonstwo auf dem Schiffe unterbringen, monatelang aufbewahren, ohne sie zu füttern, und gelegentlich schlachten, und man gewann dann aus jeder einzelnen vierzig bis hundert Kilogramm treffliches Fleisch: kein Wunder daher, daß einzelne Schiffe auf Mauritius oder den Galapagosinseln mehr als vierhundert Stück einfingen und mit sich nahmen. Die vollkommene Sicherheit, deren die hilflosen Geschöpfe auf ihren heimischen Inseln vormals sich erfreuten, wie auch ihre Langlebigkeit, die ermöglichte, daß viele Geschlechter gleichzeitig nebeneinander lebten, lassen uns die außerordentliche Häufigkeit der Tiere sehr begreiflich erscheinen.«
Als Leguat im Jahre 1691 die Insel Rodriguez besuchte, waren sie noch so häufig, daß man zwei- oder dreitausend von ihnen in dichten Scharen zusammen sehen und über hundert Schritte weit »auf ihren Rücken dahinschreiten« konnte. Um das Jahr 1740 legten, wie Grant mitteilt, die nach Indien segelnden Schiffe, um sich mit ihnen zu versorgen, bei St. Mauritius an, und noch zwanzig Jahre später waren mehrere kleine Fahrzeuge fortwährend beschäftigt, Tausende von ihnen, hauptsächlich zur Verwendung im Krankenhause, hierhin zu bringen. Von dieser Zeit an scheinen sie sich rasch vermindert zu haben; die alten wurden weggefangen, die jungen durch Schweine vernichtet, die einen wie die anderen durch den fortschreitenden Anbau der Eilande zurückgedrängt, so daß sie bereits zu Anfang unseres Jahrhunderts auf mehreren Inseln der Gruppe ausgerottet waren. Gegenwärtig lebt nicht ein einziges Stück mehr von ihnen, weder auf Mauritius, noch auf Rodriguez, noch auf Réunion. Alle diese Riesenschildkröten stammen von der kleinen Insel Aldabra, diesem Eilande des Indischen Weltmeeres. Hier fanden sie die Gebrüder Rodatz noch in Menge, vorzugsweise in dichtem Gebüsche. Fänger, die alljährlich hierher zur Jagd kamen, hatten besondere Stapelplätze mit Mauern umgeben, um die Tiere bis zur Verschiffung nach Madagaskar oder an das afrikanische Festland einsperren zu können. In einem solchen Zwinger sahen unsere Gewährsleute zweihundert, in einem andern dreihundert Stück, die einfach mit Gras und Laub gefüttert wurden. Ein Hamburger Kaufmann erzählte Kersten, daß auf Aldabra noch im Jahre 1847 von hundert Menschen, der Bemannung zweier Schiffe, binnen kurzer Zeit zwölfhundert solcher Schildkröten gefangen wurden, darunter immer noch Riesen von vierhundert Kilogramm Gewicht. Heutzutage sind sie hier so gut wie ausgerottet.
Ähnlich wie hier wird es mit der Zeit auch auf den Galapagosinseln Kürzlich hat ein amerikanischer Zoologe, W. Beebe, eine Expedition nach den Galapagosinseln unternommen und in seinem vortrefflichen Buche hierüber (Galapagos, world's end, deutsch Leipzig 1927 bei Brockhaus) den Riesenschildkröten ein ganzes Kapitel gewidmet. Auch er schildert die allmähliche Ausrottung dieser Tiere, von denen er auf jeder Insel nur noch eine Art angetroffen hat. Unsere Elefantenschildkröte gibt er auch dort als ausgerottet an. Herausgeber. aussehen. Als die Spanier diese Inseln entdeckten, fanden sie dieselben so dicht bevölkert mit Schildkröten, daß sie jene nach diesen benannten. Gegen Ende des siebzehnten Jahrhunderts besuchten Schiffer die Inselgruppe nur aus dem Grunde, um sich mit Wasser und Schildkröten zu versorgen. »Landschildkröten«, sagt Dampier in seinem, im Jahre 1697 erschienenen Reisewerke, »gibt es hier in so großer Anzahl, daß fünf- bis sechshundert Menschen sich einzig und allein von ihnen monatelang würden ernähren können. Sie sind außerordentlich groß, fett, und ihr Fleisch ist so wohlschmeckend wie das eines zarten Hühnchens.« Bis zu den ersten Jahrzehnten unseres Jahrhunderts scheinen die Verhältnisse auf den Schildkröteninseln sich nicht wesentlich verändert zu haben. Delano, der vom Jahre 1800 an die Inseln mehrmals besuchte, fand auf Hoods-, Charles-, James- und Albemarleseiland noch Schildkröten in Menge, beschrieb sie recht gut und brachte nach sechzigtägiger Fahrt von dreihundert eingeschifften Stücken ungefähr die Hälfte nach der Insel Massa Fuero, andere später zweimal nach Kanton. Da die beklagenswerten Geschöpfe unterwegs nicht gefüttert wurden, also monatelang hungern mußten, erlagen viele; diejenigen aber, die die Zeit so harter Prüfung dennoch überstanden, wurden, nachdem sie sich satt gefressen hatten, sehr bald befriedigt, schienen mit dem ungewohnten Klima Massa Fueros sich auszusöhnen und würden wahrscheinlich am Leben geblieben sein, vielleicht sogar sich eingebürgert haben, hätte man sie nicht geschlachtet, um sie zu verspeisen. Porter traf im Jahre 1813 die Tiere auf allen größeren Schildkröteninseln in mehr oder minder namhafter Anzahl an und fing noch Riesen von anderthalb bis zweihundert Kilogramm Gewicht, im ganzen über fünfhundert Stück, die zusammen über vierzehn Tonnen wogen. Auf Madisoneiland gab er eine nicht unbeträchtliche Anzahl der von ihm mitgenommenen Tiere frei. Zweiundzwanzig Jahre später als Porter, im Jahre 1835, besuchte Darwin die Galapagosinseln. Sie waren inzwischen in den Besitz des Freistaates Ecuador übergegangen und mit zwei- bis dreihundert Verbannten besiedelt worden, die den Schildkröten erklärlicherweise ungleich mehr Abbruch taten als alle früheren Besucher der Eilande, da sie einen förmlichen Vernichtungskrieg gegen die wehrlosen Geschöpfe führten, dieselben fingen und ihr Fleisch einsalzten. Mit den Ansiedlern waren auch Schweine auf die Insel gekommen und zum Teil verwildert, so daß sich die Anzahl der Feinde unserer Schildkröte wesentlich vermehrt hatte. Indessen begegnete Darwin den letzteren immerhin noch fast auf allen von ihm besuchten Eilanden. Als elf Jahre später das wissenschaftlichen Zwecken dienende Kriegsschiff Herald an Charleseiland anlegte, fand der mitreisende Naturforscher auf genannter Insel wohl zahlreiche Herden von Haustieren, verwilderte Hunde und Schweine, nicht aber Schildkröten: sie waren inzwischen ausgerottet worden. Doch lebten sie noch auf der Chathaminsel. Laut Steindacher zählten die Galapagoseilande im Jahre 1872 nicht mehr als einen weißen und zwei schwarze menschliche Bewohner, die auf der Charlesinsel ein elendes Dasein fristeten; alle übrigen Ansiedler waren gestorben oder ausgewandert; die Schildkröten sind, nach Aussage dieser drei Leute, aber auch auf letztgenannter Insel gegenwärtig fast ausgerottet worden. Was sich auf den Maskarenen bereits erfüllt, wird auch auf den Galapagos geschehen.
Porter macht zuerst auf die Unterschiede der Schildkröten aufmerksam, die auf verschiedenen Eilanden der Galapagosgruppe lebten. Auf Porterseiland zeichneten sie sich durch ihre außerordentliche Größe aus: denn einzelne von ihnen waren über anderthalb Meter lang, nur um dreißig Zentimeter weniger breit und fast einen Meter hoch, abgesehen von noch größeren, die von Seeleuten gefunden worden sein sollen; die Panzer der auf Jameseiland lebenden fielen auf wegen ihrer geringen Dicke und Brüchigkeit; die sehr dicke Schale der auf der Charlesinsel hausenden war sehr verlängert, der Rückenschild vorn nach Art eines spanischen Sattels aufgeworfen und die Färbung braun, alles im Gegensatz zu den runden, plumpen, ebenholzschwarzen Stücken der Jamesinseln; die von Hoodseiland stammenden endlich waren klein und ähnelten denen der Charlesinsel. Günther hat diese Angaben berücksichtigt, gelangt aber durch eigene Untersuchungen zu dem Schlusse, daß die Schildkröten der Galapagosinseln fünf verschiedene Arten Beebe unterscheidet noch 15, allerdings rein geographische Arten. Herausgeber. dargestellt haben. Ich begnüge mich anzugeben, daß sich alle Riesen- oder Elefantenschildkröten der Galapagosinseln von der ihnen in der Größe gleichenden nahe verwandten Art der Maskarenen dadurch unterscheiden, daß ihrem Schilde die Nackenplatte fehlt und die hinteren Ränder der beiden Kehlplatten zusammenlaufen, demgemäß also einen mehr oder minder stumpfen Winkel bilden. Mit allen übrigen Landschildkröten aber lassen sich unsere Tiere nicht verwechseln, weil sie sich nicht allein durch ihre riesenhafte Größe, sondern auch durch ihren langen, schlangenartigen Hals, ihre hohen Füße und die schwarze Farbe ihrer Schale so auszeichnen, daß sie nicht verkannt werden können.
Porters Angaben über das Freileben der Elefantenschildkröten sind durch Darwins ausgezeichnete Schilderung so wesentlich übertroffen worden, daß ich auf jene nur, um hier und da eine kleine Lücke auszufüllen, zurückzukommen brauche.
»Auf meinem Wege«, so beginnt Darwin zu erzählen, »begegnete ich zwei großen Schildkröten, von denen jede wenigstens hundert Kilogramm gewogen haben muß. Eine fraß ein Stück Kaktus, sah mich an, als ich näher kam, und ging dann ruhig weiter; die andere ließ ein tiefes Zischen vernehmen und zog ihren Kopf ein. Diese ungeheueren Kriechtiere, von der schwarzen Lava, dem blätterlosen Gesträuch und dem großen Kaktus umgeben, erschienen mir wie Geschöpfe der Vorwelt.
»Diese Tiere finden sich wahrscheinlich auf allen Eilanden der Inselgruppe, sicherlich auf der größeren Anzahl derselben. Sie leben vorzugsweise auf hochgelegenen feuchten Stellen, besuchen aber auch die niedrigen und trockenen. Einzelne erreichen eine ungeheuere Größe: Lawson, ein Engländer, der zur Zeit unseres Aufenthaltes die Aufsicht über die Ansiedlung hatte, erzählte uns von einigen so großen, daß sechs oder acht Mann erforderlich waren, um sie in die Höhe zu heben, und daß solche Stücke bis hundert Kilogramm Fleisch gegeben haben. Die alten Männchen, die von den Weibchen an dem längeren Schwanze leicht unterschieden werden können, sind merklich größer als die Weibchen.
»Diejenigen, die auf den wasserlosen Inseln leben oder in niedrigen und trockenen Teilen der andern sich aufhalten, nähren sich hauptsächlich von dem saftigen Kaktus; die, welche in der feuchten Höhe hausen, fressen die Blätter verschiedener Bäume, eine saure und herbe Beere, Guayavita genannt, und eine blaßgrüne Flechte, die in Gewinden von den Ästen der Bäume herabhängt. Sie lieben das Wasser, trinken große Mengen davon und gefallen sich im Schlamm. Die größeren Inseln allein haben Quellen, diese aber liegen immer nach der Mitte zu und in einer beträchtlichen Höhe. Wenn also die Schildkröten, die in Niederungen herbergen, trinken wollen, müssen sie weite Strecken zurücklegen. Eine Folge hiervon sind breite und wohl ausgetretene Pfade in jeder Richtung von den Quellen bis zur Meeresküste, die Spanier entdeckten zuerst die Wasserplätze, indem sie diesen Pfaden folgten. Als ich auf der Chathaminsel landete, konnte ich mir anfänglich nicht erklären, welches Tier so regelrecht auf wohlgewählten Pfaden wandeln möge. An den Quellen bot sich ein merkwürdiges Schauspiel. Viele von den großen Ungeheuern waren zu sehen, einige mit lang ausgestreckten Hälsen, eifrig vorwärts wandernd, andere, die bereits getrunken, zurückkehrend. Wie die Schildkröte an der Quelle ankommt, taucht sie ihren Kopf bis über die Augen ins Wasser, ohne auf einen etwaigen Zuschauer Rücksicht zu nehmen, und schluckt begierig, ungefähr zehn große Züge in der Minute nehmend. Die Einwohner sagten, daß jedes Tier drei bis vier Tage in der Nähe des Wassers verweile und dann erst in die Niederung zurückkehre, waren aber über die Häufigkeit solcher Besuche unter sich nicht einig. Das Tier regelt sie wahrscheinlich nach der Beschaffenheit der Nahrung, die es verzehrt hat. Demungeachtet steht fest, daß Schildkröten auch auf solchen Inseln leben, auf denen sie höchstens zeitweilig Regenwasser benutzen können.
»Es ist ziemlich ausgemacht, daß die Blase eines Frosches als Behälter für die zu seinem Bestehen erforderliche Feuchtigkeit dient. Dies scheint auch für die Schildkröten zu gelten. Einige Tage nach dem Besuche der Quellen ist die Blase dieser Tiere infolge der in ihr aufgespeicherten Flüssigkeit ausgedehnt; später nimmt jene an Umfang ab und vermindert sich die Reinheit dieser. Die Einwohner benutzen, wenn sie in der Niederung von Durst befallen werden, diesen Umstand zu ihrem Vorteil, indem sie eine Schildkröte töten und, falls die Blase gefüllt ist, deren Inhalt trinken. Ich sah eine töten, bei der die gedachte Flüssigkeit ganz hell war und nur einen schwach bitteren Geschmack hatte. Die Einwohner trinken übrigens stets zuerst das Wasser aus dem Herzbeutel, das das beste sein soll.
»Wenn die Schildkröten einem bestimmten Punkt zuwandern, gehen sie Tag und Nacht und kommen viel früher am Ziele ihrer Reise an, als man erwarten sollte. Die Einwohner glauben, nach Beobachtungen an gezeichneten Stücken annehmen zu dürfen, daß die Tiere eine Entfernung von ungefähr acht Meilen in zwei oder drei Tagen zurücklegen können. Eine große Schildkröte, die ich beobachtete, ging mit einer Schnelligkeit von sechzig Yards in zehn Minuten oder dreihundertsechzig Ellen in der Stunde, was, wenn man eine kurze, unterwegs zum Fressen verwendete Zeit abrechnet, täglich vier englische Meilen ausmachen würde.« Ihre Schritte sind, wie Porter bemerkt, langsam und unregelmäßig, aber schwer; und sie trägt beim Gehen ihren Leib ungefähr dreißig Zentimeter über dem Boden.
»Während der Fortpflanzungszeit, die beide Geschlechter vereinigt«, fährt Darwin fort, »hört man vom Männchen ein heiseres Brüllen oder Blöken, das man noch in einer Entfernung von mehr als hundert Schritten vernimmt. Das Weibchen gebraucht seine Stimme nie und das Männchen die seinige auch nur während der Paarung, so daß die Leute, wenn sie die Stimme hören, wissen, daß beide Geschlechter sich vereinigt haben. Die Weibchen legten gerade jetzt, im Oktober, ihre Eier. Da, wo der Boden sandig ist, graben sie Löcher, legen die Eier zusammen in ein Loch und decken dieses mit Sand zu; auf steinigem Grunde hingegen lassen sie dieselben aufs Geratewohl in ein Loch fallen. Bynoe fand ihrer sieben der Reihe nach in einer Spalte liegen. Das Ei ist weiß und rund; eins, das ich maß, hatte achtzehn Zentimeter im Umfang.« Porter bemerkt hinsichtlich der Fortpflanzung, daß die Weibchen wahrscheinlich nur, um zu legen, vom Gebirge herab in die sandigen Ebenen kommen. Unter allen denen, welche er mit sich nahm, befanden sich bloß drei Männchen, und auch diese wurden weit im Innern in der Nähe der Berge gefangen. Alle Weibchen dagegen trugen sich mit reifen Eiern, ja mit zehn bis vierzehn an der Zahl, die sie offenbar in den sandigen Ebenen ablegen wollten.
»Während des Tages«, sagt der letztgenannte Beobachter noch, »sind die Schildkröten auffallend scharfsichtig und furchtsam, was daraus hervorgeht, daß sie bei der geringsten Bewegung irgendeines Gegenstandes ihren Kopf und Hals in der Schale bergen; des Nachts aber scheinen sie vollkommen blind zu sein, ebenso wie sie taub sind. Der lauteste Lärm, selbst das Abfeuern eines Schusses, behelligt sie nicht im geringsten, macht nicht den leisesten Eindruck auf sie.«
Darwin bestätigt letztere Angaben. »Die Einwohner glauben, daß diese Tiere gänzlich taub sind; so viel ist gewiß, daß sie jemand, der gerade hinter ihnen geht, nicht hören. Es ergötzte mich immer, wenn ich eins von diesen Ungeheuern, das ruhig dahinschritt, überholte und nun sah, wie es in demselben Augenblick, der mich an ihm vorüberführte, Kopf und Beine einzog, ein tiefes Zischen ausstieß und mit lautem Schalle zu Boden fiel, als ob es tot wäre. Ich setzte mich häufig auf ihren Rücken; und wenn ich ihnen auf den hinteren Teil der Schale einige Schläge gab, so standen sie auf und gingen hinweg; ich fand es jedoch schwierig, das Gleichgewicht zu behaupten.«
»Kein Tier kann zuträglicheres, süßeres und schmackhafteres Fleisch bieten als die Schildkröten«, versichert Porter, und auch dieser Angabe widerspricht Darwin nicht. »Das Fleisch«, so schließt er, »wird sowohl frisch wie gesalzen vielfach gebraucht, und aus dem Fett ein schönes, helles Öl bereitet. Wenn ein Mann eine Schildkröte fängt, schlitzt er ihr nahe am Schwanz die Haut auf, um zu sehen, ob sie unter dem Rückenpanzer eine dicke Lage von Speck besitzt. Ist dies nicht der Fall, so wird das Tier wieder in Freiheit gesetzt, soll sich auch bald von jener Quälerei erholen. Um sich seiner zu versichern, ist es nicht genug, es auf den Rücken zu werfen, da es seine aufrechte Stellung leicht wieder gewinnen kann. Die eben ausgekrochenen Jungen werden in großer Anzahl eine Beute des bussardartigen Raubvogels. Die Alten scheinen gemeiniglich zufällig zu sterben oder, wenn sie von Abhängen herunterfallen, zugrunde zu gehen. Wenigstens erzählten mir die Einwohner, daß sie, es sei denn aus solchen Ursachen, niemals eine tote gefunden hätten.«
Verschiedene Seeleute versicherten Porter, von ihnen gefangene und in den Schiffsraum gestaute Elefantenschildkröten ohne jegliches Futter achtzehn Monate lang erhalten und nach Ablauf dieser Zeit beim Schlachten gefunden zu haben, daß sie weder gelitten, noch an Feistigkeit verloren hatten. Sie ertrugen noch ganz andere Mißhandlungen ohne Schaden. Die Elefantenschildkröte, die unserm Zeichner zur Vorlage diente, hatte, bevor sie nach Berlin gelangte, bereits mehrere Jahre in Gefangenschaft gelebt und zuletzt als – Hackklotz gedient. Entrüstet über wiederholtes Entweichen hatten die Diener ihres Besitzers, denen die Aufgabe zufiel, das nach Freiheit strebende Tier immer wieder einzufangen, sie zuletzt zwischen eingeschlagenen Pfählen eingekerkert und ihren Rückenpanzer in der angegebenen Weise zum Holzspalten benutzt. Dank der Leichtigkeit, mit der die riesigen Tiere länger währende Seereisen überstanden, brachte man sie oft auch nach Europa, und man sah sie daher noch vor einem Jahrzehnt nicht allzuselten in Tiergärten und Schaubuden. Ich selbst habe mehrere gepflegt und andere beobachtet. Ihre Unterhaltung verursachte keinerlei Schwierigkeiten, ihre Wartung nicht mehr als die anderer Landschildkröten überhaupt. Im Winter hielt man sie in wohlgeheizten Räumen und ernährte sie mit Pflanzenstoffen aller Art; im Sommer setzte man sie auf Grasplätze, legte ihnen für alle Fälle eine genügende Menge von Kraut und Kartoffeln vor und gestattete ihnen überdies, nach eigenem Belieben zu weiden. Dies taten sie, indem sie große, dicke Grasbüsche abbissen oder ausrissen, sie hierauf kauend zu Ballen formten und schließlich, oft ersichtlich würgend, verschlangen. Sie gewöhnten sich an den Verkehr mit Menschen, legten ihr Zischen und ihre Schreckhaftigkeit ab, ließen, auch ohne durch Stockschläge angetrieben zu werden, jemanden auf sich aufsitzen und trugen den Reiter gleichgültig, aber freilich auch überaus langsam davon. Heutzutage sieht man nur noch in den reichsten Tiergärten eine Schildkröte dieser Art, und binnen wenigen Jahren wird auch dies unmöglich sein, falls nicht die wenigen noch in Europa lebenden Gefangenen, dank ihrer Langlebigkeit, das unvermeidliche Schicksal ihrer Artgenossen überdauern.
*
In ihrem Sein und Wesen eine Land-, ihrer Gestalt nach eine Sumpfschildkröte, stellt die wohlbekannte nordamerikanische Dosenschildkröte ein Verbindungsglied der auf festem Lande und im Wasser lebenden Arten dar und verdient auch aus diesem Grunde besondere Beachtung. Die Kennzeichen der von ihr vertretenen Sippe ( Terrapene) sind: stark gewölbter Rückenschild mit Nacken- und doppelter Schwanzplatte, eirunder, aus zwölf Platten gebildeter Brustschild, der aus zwei beweglichen Stücken besteht und so groß ist, daß die beiden Teile vorne und hinten dicht an den Rückenschild angezogen werden können, sehr verkümmerte Achsel- und Weichenplatten, die auch gänzlich fehlen können, kurzer Schwanz und ziemlich lange, vorn fünf-, hinten vierzehige Füße mit deutlichen Schwimmhäuten. Der Kopf ist mit glatter Haut bekleidet; die Vorderfüße sind mit größeren Schuppen bedeckt.
Die Dosenschildkröte ( Terrapene carinata) ändert vielfach ab. In der Regel ist die Färbung ihrer Oberseite ein schönes Braun oder Braunschwarz; die Zeichnung besteht aus gelben, unregelmäßigen Flecken und Streifen; die Schilder des Brustpanzers sind auf gelbem Grunde braun geädert. Die Panzerlänge beträgt höchstens 15, die Breite 9 Zentimeter. Der länglich eirunde Kopf zeigt scharfe, ungezähnelte Kiefer und ist wie die Vorder- und Hinterfüße braun und gelb gefleckt.
Das Verbreitungsgebiet der Dosenschildkröte erstreckt sich über den größten Teil der Vereinigten Staaten, von Maine an bis Florida, westlich bis Iowa, Missouri und Texas; ja sie kommt, wenn auch nur in einer besonderen Spielart, noch im südlichen Mexiko vor, fehlt jedoch auf den westindischen Eilanden. Innerhalb der angegebenen Länderstriche findet man sie fast allerorten und meist sehr häufig. In ihrer Lebensweise stimmt sie mit andern Schildkröten vollkommen überein.
*
Von den meisten Forschern werden die Landschildkröten mit flach gewölbtem Rückenschild und kurzen Schwimmfüßen in einer besonderen Unterfamilie vereinigt, obwohl sich die Trennung von den nur auf dem Lande lebenden Arten der Familie nicht durchführen läßt. Dagegen bietet die Lebensweise der sogenannten Sumpfschildkröten so viel Übereinstimmendes, daß den nunmehr folgenden Sippen eine allgemeine Schilderung vorausgehen mag.
»Wer die Schildkröten in ihrer Mannigfaltigkeit studieren und sie täglich im Freien beobachten will«, sagt Weinland, »muß Nordamerika besuchen, das Schildkrötenland der Erde, wo sie in etwa zwei Dutzend verschiedenen Arten Teiche und Flüsse, Wald und Tal beleben.
»Wenn der europäische Naturforscher dort etwa in dem Deutschland so ähnlichen Neuengland an einem warmen Sommernachmittage einen Spaziergang durch die schöne Landschaft macht, so wird er umsonst nach den Eidechsen spähen, welche in Deutschland an jedem warmen Raine zu seinen Füßen rascheln, wird er keine Blindschleichen entdecken, und wenn er noch so viel Steine umkehren sollte; führt ihn aber sein Weg zu einem kleinen See, zu einem langsam fließenden Wiesenbach, so findet er da plötzlich die Hülle und Fülle für seine Wißbegierde. Was ist wohl das eigentümliche, kreisrunde, talergroße, braune Geschöpf, das auf jenem Teichrosenblatt sitzt? Er tritt schnell näher; aber wie ein Blitz ist es hinab von dem schwimmenden Blatt in das kühle Wasser. Sehnsüchtig verfolgt er es mit seinen Blicken und gewahrt endlich ein niedliches Schildkrötchen, das aus dem Grunde hurtig dahin schreitet und im nächsten Augenblick im Schlamm oder unter Wasserpflanzen sich verbirgt. Wohl mag es eine Stunde währen, bevor es wieder zum Vorschein kommt, um zu atmen, und unser Naturforscher muß, wie der Jäger auf dem Anstand, jede Bewegung, jedes Geräusch vermeiden. Da sieht er endlich hier und dort ein Köpfchen aus dem Wasserspiegel hervortauchen; lebhaft glänzen die beiden klugen, schwarzen Äuglein, und langsam rudert das Tier, fast ohne das Wasser zu kräuseln, ans Land heran und eben auf die Stelle zu, wo sein eifriger Beobachter sitzt: denn alle seelisch niedrig stehenden Tiere erkennen die Gegenwart eines Menschen oder eines andern belebten Wesens nur an dessen Bewegungen. Eine Schildkröte würde im Freien vom Wasser aus ebenso leicht auf die dargebotene Hand steigen als auf den Stein oder auf die Erde daneben, vorausgesetzt, daß man sich vollkommen ruhig hält. Soll der Forscher zugreifen? Gewiß, denn ein etwaiger Biß kann nicht viel schaden. Freudig hält er das zappelnde Tier in seiner Hand, eilt auch bald mit seiner Beute nach Haus und zeigt dem ersten amerikanischen Freunde, dem er begegnet, seinen glücklichen Fund. Wenn dich dies befriedigen kann, sagt der Yankee lächelnd, so kannst du Tausende haben.«
In der Tat, Amerika ist das Land der Schildkröten; aber auch Asien ist reich an ihnen und Afrika wenigstens nicht arm. Da, wo es in warmen Ländern Wasser gibt, fehlen sie nicht.
Alle Sumpfschildkröten leben nur in feuchten Gegenden, die meisten im Wasser der langsam fließenden Flüsse, der Teiche und Seen; im Meer hat man sie, so viel mir bekannt, noch niemals beobachtet. Sie dürfen als trefflich begabte Wassertiere bezeichnet werden. Ihr Gang auf festem Land ist unbeholfen und langsam, obschon bedeutend schneller als der aller eigentlichen Landschildkröten, ihre Bewegung im Schwimmen dagegen ungemein rasch und auffallend gewandt. Man sieht sie ruhig auf der Oberfläche des Wassers liegen oder umherschwimmen, beim geringsten, verdächtig erscheinenden Geräusch aber blitzschnell in die Tiefe tauchen, um in demselben Augenblick im Schlamm oder unter Wurzeln sich zu verbergen. Bei ihrer Jagd entfalten sie eine Schwimmfähigkeit, die in Erstaunen setzt. Sie nähren sich hauptsächlich von tierischen Stoffen, und zwar von kleineren Säugetieren, Vögeln, Kriechtieren, Lurchen, Fischen und wirbellosen Tieren, nehmen wahrscheinlich auch, solange sie tierische Beute gewinnen können, Pflanzenstoffe nicht an, ziehen wenigstens in der Gefangenschaft Fleisch im weitesten Sinne Kartoffeln oder Brot entschieden vor. Stundenlang schwimmen sie auf der Oberfläche des Wassers, die Augen nach unten gerichtet, einem nach Beute suchenden Adler vergleichbar, und sorgfältig suchen sie den unter ihnen liegenden Grund des Gewässers ab. Erspähen sie eine Beute, so lassen sie einige Luftblasen aufsteigen, beschleunigen ihr Rudern und sinken zur Tiefe hinab, um gierig nach dem sie verlockenden Bissen zu schnappen, der, einmal mit den scharfen, niemals nachlassenden Kiefern gepackt, einen Augenblick später mit einem kräftigen Ruck des nach vorn jählings sich ausstreckenden Kopfes verschlungen wird. Einzelne sind wahrhaft gefährliche Raubtiere, die sich nicht bloß auf kleinere Beute beschränken, sondern selbst an die Vögel von der Größe einer Hausente wagen oder, gereizt, ohne Bedenken sogar den Menschen angreifen und unter Umständen gefährlich verwunden. Tristram erfuhr zu seinem nicht geringen Erstaunen, daß afrikanische Sumpfschildkröten von ihm erlegte oder verwundete Schwimmvögel in die Tiefe zogen, auch die einmal gepackte Beute nicht wieder losließen, ja, an größeren Vögeln so fest sich einbissen, daß man sie mit letzteren aus dem Wasser ziehen konnte. Unter den Fischen hausen sie noch weit ärger als unter den Vögeln, und überall, wo jene bereits Wert erlangt haben, benachteiligen sie den Menschen in nicht unempfindlicher Weise.
Ihre Sinnesfähigkeiten scheinen weit schärfer entwickelt zu sein als bei den Landschildkröten. Sie merken es sehr wohl, wenn sie beunruhigt werden, und einzelne offenbaren eine List und Vorsicht, die man ihnen gewiß nicht zutrauen möchte, wählen sich die am günstigsten gelegenen Schlupfwinkel und beachten klüglich gesammelte Erfahrungen. In der Gefangenschaft werden sie eher zahm als alle übrigen Schildkröten und lernen ihren Pfleger wirklich, wenn auch nur bis zu einem gewissen Grade kennen: sie gewöhnen sich an den Umgang mit den Menschen, ohne jedoch den einzelnen zu unterscheiden.
Bei herannahendem Winter graben sie sich ziemlich tief in den Boden ein und verbringen hier die ungünstige Jahreszeit in einem totähnlichen Zustand. Dasselbe tun sie in den Gleicherländern, da wo die Dürre ihnen ihre Wohngewässer zeitweilig austrocknet, während der dürren, winterlichen Jahreszeit. Müller sagt, daß sie an einzelnen Flüssen Nordamerikas die Ufer förmlich unterhöhlen. »Darum sind auch diese Winterlager leicht zu finden; denn es sieht aus, als ob eine Herde Schweine an solchen Stellen gewühlt habe.« Im Norden Amerikas kommen sie bei einem nicht zu spät eintretenden Frühjahr einzeln schon im April oder doch anfangs Mai aus ihrer Winterherberge wieder zum Vorschein und beginnen dann ihr Sommerleben, zunächst das Fortpflanzungsgeschäft.
Die Begattung dauert bei ihnen tagelang, und während der Dauer derselben sind sie für alles andere abgestorben; ihre gewöhnliche Vorsicht und Schüchternheit verläßt sie gänzlich. »Ich habe«, bemerkt Müller, »die gemalte Sumpfschildkröte Amerikas während der Begattung auf der Oberfläche des Wassers schwimmend gefunden und sie mittels eines Netzes leicht herausfischen können, da sie sich nicht im geringsten stören ließ.« Sie hängen und halten, mit den Brustschildern gegeneinander gekehrt und mit den Beinen umklammert, so fest zusammen, daß ziemlich bedeutende Kraft angewendet werden muß, um sie auseinander zu reißen. Kurze Zeit später gräbt das Weibchen Löcher in die Erde oder in den Sand und legt in diese ihre sechs bis acht Eier ab.
Diese Eier sind für manche Völkerschaften von erheblichem Nutzen, wie überhaupt die Bedeutung der Sumpf- und Flußschildkröten für den menschlichen Haushalt nicht unterschätzt werden darf. Bates erzählt, daß er in Ega, am Amazonenstrom, fast das ganze Jahr hindurch von Schildkröten gelebt und sie sehr satt bekommen habe, zuletzt ihr Fleisch gar nicht mehr riechen konnte und deshalb zuweilen genötigt war, wirklichen Hunger zu leiden. Jeder Hauseigentümer besitzt dort einen kleinen Teich, in welchem die gefangenen Tiere bis zur Zeit des Mangels, d. h. bis zum Eintritt der Regenzeit, gehalten werden. Zu ihrer Jagd verwendet man Netze und Pfeile, deren Spitze beim Eindringen sich vom Schafte trennt, mit diesem aber durch eine lange Schnur verbunden bleibt. Der Schaft schwimmt auf dem Wasser, wird von dem herbeirudernden Jäger aufgenommen und angezogen, bis das Tier nahe zur Oberfläche emporsteigt; dann schießt man diesem unter Umständen noch einen zweiten Pfeil in den Leib und schafft es nunmehr ans Land. Die eingeborenen Frauen verstehen Schildkrötenfleisch auf verschiedene Weise, aber vortrefflich zuzubereiten.
Die meisten Tierpfleger behandeln die verhältnismäßig sehr unempfindlichen Sumpfschildkröten gewöhnlich insofern falsch, als sie denselben während des Winters nicht die nötige Wärme gewähren. Diejenigen, die man im Freien hält, graben sich selbst in den Schlamm ein und bilden sich dadurch eine ihnen zusagende Winterherberge; während hingegen die, die im Zimmer leben müssen, nur in gleichmäßig erhaltener Wärme einen Ersatz für diese ihnen fehlende Schlafkammer finden können. »Seit mehreren Jahren«, schreibt Effeldt, ein eifriger und kenntnisreicher Liebhaber, »bekam ich nordamerikanische Sumpfschildkröten, aber sie starben regelmäßig im Winter. Die wenigen, die diese Zeit überlebten, fraßen währenddem nichts und magerten dabei so bedeutend ab, daß sie im Frühjahr sicher zugrunde gingen. Endlich kam ich auf den Einfall, das Wasser auch im Winter lauwarm zu halten, weil ich beobachtet hatte, daß meine Schildkröten selbst im Sommer nur dann Nahrung zu sich nahmen, wenn das Wasser lauwarm war. Nun ließ ich einen Ofen setzen, auf welchem ich meine Gefangenen unterbringen konnte, und das Ergebnis hiervon war so günstig, daß alle meine Sumpfschildkröten, von der kleinsten bis zur größten, nicht allein jeden Tag fraßen, sondern sich um ihr Futter rissen, so daß ich die größten Arten allein füttern mußte. Bald wurden sie so zahm, daß sie, wenn ich mich dem Gefäß näherte, die Köpfe in die Höhe streckten und sich aus der Hand mit rohem Fleisch füttern ließen.« Dasselbe Verfahren beobachten neuerdings alle achtsamen Liebhaber, die gefangene Schildkröten am Leben erhalten wollen. Wärme ist und bleibt die hauptsächlichste Bedingung für glückliches Gedeihen unserer Tiere, und man kann in dieser Beziehung kaum zu viel, leicht aber zu wenig tun. Junge Sumpfschildkröten erzieht man, laut Fischer, am sichersten, wenn man sie in möglichst hellen Behältern, in Glasgefäßen, unterbringt, auch in diesen das Wasser lauwarm erhält und den Tieren, die rohes Fleisch oder Fische noch nicht verdauen können, zunächst kleine Krebse, Weichtiere, Würmer, Frosch- und Fischlaich, Ameisenpuppen und dergleichen reicht, erst später zur Fütterung mit Wasserasseln, Flohkrebsen, Kaulquappen und Fischchen übergeht und die halb erwachsenen endlich an Fleisch gewöhnt. Fische werden, nach meinen Erfahrungen, auch von erwachsenen Sumpfschildkröten dem Fleische von Vögeln und Säugetieren vorgezogen.
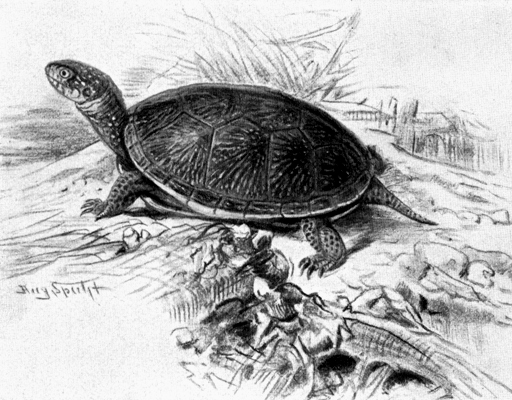
Teichschildkröte ( Emys orbicularis)
Unter den Sumpfschildkröten beschränken wir uns auf die Schilderung unserer einheimischen Art. Der Rückenschild der Pfuhlschildkröten ( Emys), zu denen sie gehört, ist mäßig gewölbt, eine Nackenplatte und doppelte Schwanzplatte vorhanden, der mit jenem durch ein Knorpelband verbundene Brustschild breit, vorn aus zwölf Platten und zwei beweglichen Stücken zusammengesetzt; doch sind letztere zu klein, als daß sie die Öffnung des Rückenschildes vollständig schließen könnten. Die Vorderfüße haben fünf, die Hinterfüße vier Krallen, die einen wie die anderen wohl entwickelte Schwimmhäute. Glatte Haut bekleidet den Kopf, wogegen die Beine, zumal die vorderen mit großen Schuppen bedeckt sind. Dem ziemlich langen Schwanz fehlt der die Spitze vieler Schildkröten umhüllende Nagel.
Unsere Teichschildkröte ( Emys orbicularis) erreicht eine Gesamtlänge von 35 Zentimeter, wovon 10 Zentimeter auf den Schwanz zu rechnen sind, der Panzer hat eine Länge von 20 Zentimeter. Die ungepanzerten Teile sind auf schwärzlichem Grunde hin und wieder mit gelben Punkten, die Platten des Rückenpanzers auf schwarzgrünem Grunde durch strahlig verlaufende, gleichsam gespritzte Punktreihen von gelber Färbung gezeichnet, die des Brustschildes schmutzig gelb, unregelmäßig und spärlich braun gepunktet oder strahlig geflammt, alle in Färbung und Zeichnung vielfachen Abänderungen unterworfen.
Als die wahre und vielleicht ursprüngliche Heimat der Teichschildkröte muß man den Osten und Südosten unseres Erdteiles ansehen. Sie ist gemein in Griechenland, Dalmatien und der Türkei, in Italien, einschließlich seiner Inseln, sowie in der südlichen Schweiz, in den Donautiefländern und Ungarn, aber auch in Südfrankreich, kommt ebenso in Spanien, Portugal und Algerien und nicht minder in einem ausgedehnten Teil des russischen Reiches, nach Osten hin bis zum Syr-Darja, ja selbst in Persien vor. In Deutschland bewohnt sie fließende und stehende Gewässer in Brandenburg, Schlesien, Posen, West- und Ostpreußen, Mecklenburg, Sachsen und Bayern, namentlich das Gebiet der Elbe, Oder und Weichsel, in Bayern aber die Donau bis Passau. In der Havel und Spree ist sie, obgleich sie nur stellenweise regelmäßig beobachtet wird, nicht selten, in der südlichen Oder und Weichsel ebensowenig; der Ostsee dagegen nähert sie sich nicht. Heute ist sie natürlich überall seltener geworden, kommt aber in vielen Seen des östlichen Deutschlands noch öfter vor. Herausgeber. Unter allen Schildkröten dringt sie am weitesten nach Norden vor, verbreitet sich auch über ein ausgedehnteres Gebiet als irgendeine ihrer Verwandten.
Die Teichschildkröte zieht stehende oder langsam fließende, seichte und trübe Gewässer rasch strömenden Flüssen und klaren Seen vor. Übertags verläßt sie, um sich zu sonnen, das Wasser nur an gänzlich ungestörten, ruhigen Orten, hält sich auch still und lautlos mehr oder weniger auf einer und derselben Stelle auf; kurz vor Sonnenuntergang wird sie rege und scheint von jetzt ab während der ganzen Nacht tätig zu sein. Während der Wintermonate vergräbt sie sich im Schlamm; Mitte April kommt sie, falls die Witterung nur einigermaßen günstig ist, wieder zum Vorschein und macht sich mehr als sonst durch ein sonderbares Pfeifen, das wohl der Paarungsruf sein mag, bemerklich. Auch ist sie vorsichtig und taucht, wenn sie im Wasser schwimmt, beim geringsten Geräusch sofort unter. In ihrem heimischen Element zeigt sie sich sehr behend, aber auch auf dem Land keineswegs tölpelhaft. Ihre Nahrung besteht in Regenwürmern, Wasserkerfen, Schnecken; sie stellt jedoch auch den Fischen nach und wagt sich selbst an ziemlich große, denen sie Bisse in den Unterleib versetzt, bis das Opfer entkräftet und dann vollends von ihr bewältigt wird. An Gefangenen beobachtete Marcgrave, daß sie den getöteten Fisch sodann ins Wasser zogen und ihn bis auf die Gräten auffraßen. Bei dieser Zerlegung der Beute wird oft deren Schwimmblase abgebissen und kommt zur Oberfläche des Wassers empor: findet man also auf einem Gewässer die Schwimmblasen von Fischen umhertreiben, so darf man mit aller Sicherheit annehmen, daß Teichschildkröten vorhanden sind. In der Gefangenschaft erhält man sie bei gutem Wohlsein viele Jahre lang, wenn man ihnen Fische, Schnecken und Regenwürmer füttert; sie werden auch bald so zahm, daß sie aus der Hand fressen, gewöhnen sich an bestimmte Lagerplätze und fallen im erwärmten Raume nicht in Winterschlaf; während sie, wenn man ihnen einen kleinen Teich in einem umschlossenen Garten anweist, mit Beginn der kühlen Jahreszeit sich vergraben.
Über die Fortpflanzung der Pfuhlschildkröten, zumal über das Eierlegen, hat Miram in sehr eingehender Weise berichtet. Zwar sind die Ergebnisse seiner Beobachtungen im wesentlichen dieselben, die auch bei anderen Schildkröten gewonnen wurden, Miram schildert jedoch so ausführlich, wie keiner vor ihm, und verdient, daß seine Mitteilungen vollständig wiedergegeben werden. Behufs wissenschaftlicher Untersuchungen hielt gedachter Forscher geraume Zeit viele lebende Schildkröten in seinem durch eine Mauer abgeschlossenen Garten, der in Ermangelung eines Teiches mit einer in die Erde eingegrabenen, als Wasserbecken dienenden Mulde versehen war. Bauern der Umgegend von Kiew brachten ihm aus nahen Seen und Teichen so viele Pfahlschildkröten als er wünschte, jedoch fast nur erwachsene, höchst selten junge, die meisten immer im April und Mai. Häufig kam es vor, daß die eingelieferten Tiere im Garten Eier fallen ließen; Miram gewährte ihnen deshalb Freiheit und konnte bald beobachten, daß die trächtigen Weibchen die höchste Stelle des Gartens, dessen Boden mit Sand gemischter Lehm war, aufsuchten, um hier ihre Nester zu graben.
Das Eierlegen findet immer abends vor Sonnenuntergang, gegen sieben oder acht Uhr statt; da aber gleichzeitig das Graben und Zudecken des Nestes vor sich geht, so dauert dasselbe fast die ganze Nacht hindurch. Am 28. Mai 1849, einem sehr warmen, schönen Sommertage, nach anhaltender Dürre, legten zu gleicher Zeit fünf Schildkröten ihre Eier und fanden sich an besagter Stelle schon um sieben Uhr abends ein. Sie versammelten sich nicht innerhalb eines engen Raumes, sondern hielten sich in sehr bedeutender Entfernung voneinander. Nachdem sie sich einen bequemen, von allen Pflanzen freien Platz erwählt, entleerten sie eine ziemlich beträchtliche Menge Harn, wodurch der Erdboden, wenn auch oberflächlich, doch einigermaßen erweicht wurde, und fingen nun an, mit dem Schwanz, dessen Muskeln straff angezogen waren, eine Öffnung in die Erde zu bohren, und zwar so, daß die Spitze des Schwanzes fest gegen den Boden gedrückt wurde, während der obere Teil desselben kreisförmige Bewegungen ausführte. Durch dieses Bohren entstand eine kegelförmige, oben weitere, unten engere Öffnung, in welche die Schildkröten, um den Boden zu erweichen, noch mehrmals kleine Mengen von Harn fließen ließen. Nachdem diese Öffnung ausgebohrt war und eine Tiefe erlangt hatte, die fast den ganzen Schwanz aufnahm, begannen sie mit den Hinterfüßen, das Loch weiter zu graben. Zu diesem Zweck schaufelten sie abwechselnd bald mit dem rechten, bald mit dem linken Hinterfuß die Erde heraus, wobei sie dieselbe jedesmal an dem Rand der Grube nach Art eines Walles aufhäuften. Bei diesem Vorgang wirkten die Füße ganz wie Menschenhände; die Schildkröten kratzten mit dem rechten Fuß von rechts nach links und mit dem linken Fuß von links nach rechts abwechselnd, sozusagen, jedesmal eine Hand voll Erde aus, legten sie sorgfältig in einiger Entfernung vom Rande der Grube im Kreise nieder und arbeiteten so lange fort, als die Füße noch Erde erreichen konnten. Der Körper war während dieser ganzen Zeit fast unbeweglich, der Kopf nur zum kleineren Teil aus dem Brust- und Rückenschild herausgetreten. Auf diese Weise brachte jede Schildkröte eine Höhle zustande, die etwa zwölf Zentimeter Durchmesser hatte, im Inneren aber bedeutend weiter wurde und daher beinahe eiförmig sich gestaltete. Der ganze Vorgang hatte bis dahin wohl eine Stunde und darüber gedauert.
Ohne ihre Stellung zu verändern, begann die Schildkröte unmittelbar darauf mit dem Eierlegen, das nicht minder merkwürdig war. Es trat nämlich aus der Afteröffnung ein Ei hervor, das von der, man möchte sagen, Handfläche des Hinterfußes vorsichtig aufgefangen wurde, die es, indem der Fuß in die Höhle hinablangte, auf den Boden derselben herabgleiten ließ. Hierauf zog sich der eben in Tätigkeit gewesene Fuß zurück, und der andere fing auf dieselbe Art ein zweites aus dem After heraustretendes Ei auf, es ebenso wie das vorhergehende in der Höhle bergend; so abwechselnd nahm bald der eine, bald der andere Hinterfuß ein Ei ab, um es in das Nest hinabzuführen. Die Schale der Eier war beim Hervortreten zum Teil noch weich, erhärtete aber rasch an der Luft. Ihre gewöhnliche Anzahl war neun, nur selten weniger; einmal nur hat Miram ihrer elf von einer Schildkröte legen sehen. Da die Eier sehr schnell aufeinander folgten, oft schon nach einer Minute, seltener nach einer Pause von zwei bis drei Minuten, so dauerte das Eierlegen ungefähr eine viertel, selten eine halbe Stunde.
Nach dem Eierlegen schien das Tier sich etwas zu erholen; ohne irgendeine Bewegung auszuführen, lag es da. Oft blieb der zuletzt in Tätigkeit gewesene Fuß erschlafft in der Höhle hängen; der Schwanz, der während des Ausscharrens der Grube und des Eierlegens seitwärts lag, hing zuletzt ebenso ermattet herab. So mochte wohl eine halbe Stunde vergehen, bis die Schildkröte ihre letzte, wie es scheint, aber auch angestrengteste Tätigkeit begann, die darin bestand, die Höhle zu verschütten und dem Erdboden gleich zu machen.
Zu diesem Ende zog sie den Schwanz wieder an die Seite des Leibes, auch den Fuß wieder zurück und an sich; der andere faßte eine Hand voll Erde, brachte sie vorsichtig in die Höhle hinab und streute sie ebenso sorgsam über die Eier aus. Hierauf wurde dasselbe mit jenem Fuß ausgeführt und so abwechselnd bald mit dem einen, bald mit dem anderen, solange die Erde des ausgeworfenen Walles ausreichte. Die letzten Hände voll Erde wurden jedoch nicht mit derselben Vorsicht in die Grube gebracht wie die früheren: das Tier bemühte sich im Gegenteil, die Erde mit dem äußeren Rande des Fußes fester anzudrücken. War in ungefähr einer halben Stunde die von dem Wall genommene Erde verbraucht, so trat abermals eine Ruhepause von demselben Zeitraume ein. Hierauf erhob sich die Schildkröte, schob den Kopf zwischen den Schildern hervor und umkreiste das Nest, gleichsam um sich zu überzeugen, wie ihr Werk gelungen. Und nunmehr begann sie, mit dem Hinterteil des Brustschildes auf den durch die aufgeworfene Erde entstandenen Hügel zu stampfen. Dabei hob sie den Hinterteil des Körpers in die Höhe und ließ ihn wieder mit einer gewissen Wucht herabfallen. Dieses Stampfen wurde in einem Kreise ausgeführt und war eine sehr anstrengende Arbeit; denn das Tier führte alle Bewegungen mit erstaunlicher, von einer Schildkröte kaum zu erwartenden Schnelligkeit aus und beobachtete dabei eine außerordentliche Sorgfalt, wodurch es denn auch möglich wurde, alle Spuren zu verwischen, die auf das an dieser Stelle errichtete Nest hindeuten konnten. Dies gelang so vollständig, daß Miram am Morgen, wenn er sich nicht durch ein Zeichen die Stelle gemerkt hätte, vergebens nach den Eiern gesucht haben würde.
Die solcherart in eine Tiefe von ungefähr acht Zentimeter unter der Oberfläche der Erde gelegten Eier blieben daselbst bis zum April des nächsten Jahres liegen; dann erst, gewöhnlich zwischen dem fünfzehnten und zwanzigsten des Monats, schlüpften die Jungen aus. Diese haben eine Länge von fünfzehn bis zwanzig Millimeter. Wenn sie nicht mit noch anhängendem Dottersack erscheinen, bemerkt man wenigstens meist in der Mitte des Brustschildes, zwischen den Brustplatten, die Spuren des Dotterschlauches.
Sie zu erziehen, gab sich Miram viele Mühe; doch erreichte er es nie, eine länger als drei Monate am Leben zu erhalten. Marcgrave war glücklicher: ihm gelang es, mehrere neugeborene Pfuhlschildkröten aufzuziehen. Eine von ihnen hatte nach drei Jahren zwei Zentimeter an Länge und ein Gewicht von sechzehn Gramm erreicht. Während des Winters fraß sie wenig und blieb meistens auf dem Boden des Wasserkübels mit eingezogenem Halse unbeweglich sitzen; an heiteren Tagen ging sie ein wenig umher. Bei Eintritt des Frühlings begann sie wieder zu fressen, war auch im dritten Jahre schon imstande, ganze Regenwürmer zu verschlingen und kleine Fische zu töten. Im Juni fraß sie am gierigsten, vom September an weniger und im November gar nicht mehr. Sie erreichte ein Alter von fünf Jahren.
Ob alle Pfuhlschildkröten über dreiviertel Jahre in der Erde liegen müssen, bevor die Jungen ausschlüpfen, oder ob sie auch in kürzerer Frist gezeitigt werden können, wage ich nicht zu entscheiden. Mirams Angaben stimmen überein mit denen Marsiglis, nicht aber mit denen Marcgraves, der, ebenfalls in seinem Garten, die Paarung, das Eierlegen und das Auskriechen beobachtete. Seine Mitteilungen sind jedoch ebenso kurz als unbestimmt.
Das Fleisch der Teichschildkröte ist eßbar; der geringe Nutzen, den sie dem Menschen hierdurch und durch Verzehren der Schnecken und Regenwürmer bringt, hebt aber den von ihr durch Raub an nützlichen Fischen verübten Schaden nicht auf.
*
»Gegen elf Uhr vormittags«, so schildert Alexander von Humboldt, »stiegen wir an einer Insel mitten im Strome aus, die die Indianer in der Mission Uruana als ihr Eigentum betrachten. Die Insel ist berühmt wegen ihres Schildkrötenfanges oder, wie man hier sagt, wegen der Eierernte, die jährlich hier gehalten wird. Wir fanden mehr als dreihundert Indianer unter Hütten aus Palmblättern gelagert. Außer den Guanos und Otomakos aus Uruana, die beide für wilde, unbezähmbare Stämme gelten, waren Karaiben und andere Indianer vom unteren Orinoko zugegen. Jeder Stamm lagerte für sich und unterschied sich durch die Farbe, mit der die Haut bemalt war. In dem lärmenden Haufen bemerkten wir einige Weiße, namentlich Krämer aus Angostura, die den Fluß heraufgekommen waren, um von den Eingeborenen Schildkröteneieröl zu kaufen, trafen auch den Missionär von Uruana, der uns erzählte, daß er mit den Indianern wegen der Eierernte herübergekommen sei, um jeden Morgen unter freiem Himmel die Messe zu lesen und sich das Öl für die Altarlampe zu beschaffen, besonders aber, um diesen ›Freistaat der Indianer und Kastilianer‹, in dem jeder für sich allein haben wolle, was Gott allen beschert, in Ordnung zu halten.
»In Begleitung dieses Missionärs und eines Krämers, der sich rühmte, seit zehn Jahren zur Eierernte zu kommen, umgingen wir die Insel, die man besucht wie bei uns zulande die Messen. Wir befanden uns auf einem ebenen Sandstriche. ›Soweit das Auge an den Ufern hinreicht‹, sagte man uns, ›liegen Schildkröteneier unter der Erdschicht‹. Der Missionär trug eine lange Stange in der Hand und zeigte uns, wie man mit ihr untersuche, um zu sehen, wie weit die Eierschicht reicht, wie der Bergmann die Grenzen eines Lagers von Mergel, Raseneisenstein oder Steinkohle ermittelt. Stößt man die Stange senkrecht in den Boden, so spürt man, wenn der Widerstand auf einmal aufhört, daran, daß man die Höhlung oder das lose Erdreich, in dem die Eier liegen, erreicht hat. Wie wir sahen, ist die Schicht im ganzen so gleichförmig verbreitet, daß die Stange in einem Halbmesser von zehn Toisen (zwanzig Meter) rings um einen gegebenen Punkt sicher darauf stößt. Auch spricht man hier nur von Geviertstangen Eiern, als ob man ein Bodenstück, unter dem Erze liegen, in Lose teile und ganz gleichmäßig abbaue. Indessen bedeckt die Eierschicht bei weitem nicht die ganze Insel, hört vielmehr überall auf, wo der Boden rasch ansteigt, weil die Schildkröte zu diesen kleinen Hochebenen nicht emporkriechen kann. Die Uferstrecken, auf denen fast sämtliche Schildkröten des Orinoko sich jährlich zusammenzufinden scheinen, liegen zwischen dem Zusammenflüsse des Orinoko und Apure und den großen Fällen oder Randales, und hier finden sich die drei berühmtesten Fangplätze. Eine Art, die Arráuschildkröte, geht, wie es scheint, nicht über die Fälle hinauf.«
Die Arráuschildkröte ( podocnemis expansa), ein großes Tier von 50 Zentimeter Panzer- und 80 Zentimeter Gesamtlänge, vertritt die Sippe der Schienenschildkröten ( Podocnemis), die sich durch folgende Merkmale auszeichnen. Dem mäßig gewölbten Rückenschilde, dessen Rand wagerecht vorspringt, fehlt die Nackenplatte, dem Brustschilde die Achsel- wie die Leisten-Platte. Die Schwanzplatte ist doppelt; die auffallend kleinen Armplatten erreichen kaum die halbe Größe der Brustplatten. Große, dicke Schilder bekleiden den Kopf, der wegen der tiefen und breiten Furche zwischen den Augen besonders auffällt; ein oder zwei Bärtel hängen vom Kinne herab. Auch die Vorderarme und das Außenende der Hinterfüße werden von einigen Schuppen bedeckt; im übrigen ist die Haut der Glieder wie die des Halses nackt. Die Schwimmhäute sind sehr stark entwickelt.
Außer dem Orinoko bewohnt die Arráuschildkröte übrigens in großer Anzahl die Flüsse Guayanas, den Amazonenstrom mit seinen Verzweigungen und andere Ströme Brasiliens, kommt auch in den nördlichen Provinzen von Peru vor, hat also ein sehr ausgedehntes Verbreitungsgebiet.
»Die Zeit, in der der Arráu seine Eier legt«, fährt Humboldt fort, »fällt mit dem niedrigsten Wasserstande zusammen. Da der Orinoko von der Frühlings-Tagundnachtgleiche an zu steigen beginnt, so liegen von Anfang Januar bis zum 29. März die tiefsten Uferstrecken trocken. Die Arráus sammeln sich schon im Januar in großen Schwärmen, gehen aus dem Wasser und wärmen sich auf dem Sande in der Sonne, weil sie, nach Ansicht der Indianer, zu ihrem Wohlbefinden notwendig starker Hitze bedürfen, und die Sonne das Eierlegen befördert. Während des Februar findet man die Arráus fast den ganzen Tag auf dem Ufer. Anfangs März vereinigen sich die zerstreuten Haufen und schwimmen nun zu den wenigen Inseln, auf denen sie gewöhnlich ihre Eier legen: wahrscheinlich kommt dieselbe Schildkröte jedes Jahr an dasselbe Ufer. Wenige Tage vor dem Legen erscheinen viele Tausende von ihnen in langen Reihen an den Ufern der Inseln Cucuruparu, Uruana und Pararuma, recken die Hälse und halten den Kopf über dem Wasser, ausschauend, ob nichts von Tigern oder Menschen zu fürchten ist. Die Indianer, denen viel daran liegt, daß die vereinigten Schwärme auch zusammenbleiben, stellen längs des Ufers Wachen auf, damit sich die Tiere nicht zerstreuen, sondern in aller Ruhe ihre Eier legen können. Man bedeutet den Fahrzeugen, mitten im Strome sich zu halten und die Schildkröten nicht durch ihr Geschrei zu verscheuchen.
»Die Eier werden immer bei Nacht, aber gleich von Sonnenuntergang an, gelegt. Das Tier gräbt mit seinen Hinterfüßen, die sehr lang sind und krumme Klauen haben, ein meterweites und sechzig Zentimeter tiefes Loch, dessen Wände es, um den Sand zu befestigen, nach Behauptung der Indianer mit seinem Harne benetzen soll. Der Drang zum Eierlegen ist so stark, daß manche Schildkröten in die von anderen gegrabenen, noch nicht wieder mit Erde ausgefüllten Löcher hinabgehen und auf die frischgelegte Eierschicht noch eine zweite legen. Bei diesem stürmischen Durcheinander werden so viele Eier zerbrochen, daß der Verlust, wie der Missionär uns durch den Augenschein belehrte, ein Dritteil der ganzen Ernte betragen mag. Wir fanden Quarzsand und zerbrochene Eierschalen durch das ausgeflossene Dotter der Eier zu großen Klumpen zusammengekittet. Es sind der Tiere, die in der Nacht am Ufer graben, so unermeßlich viele, daß manche der Tag überrascht, ehe sie mit dem Legen fertig werden konnten. Dann beeilen sie sich mehr als je, ihre Eier los zu werden und die gegrabenen Löcher zuzudecken, damit der Tiger sie nicht sehen möge. Sie, die verspäteten, achten dabei auf keine Gefahr, die ihnen selbst droht, sondern arbeiten unter den Augen der Indianer, die frühmorgens kommen und sie ›närrische Schildkröten‹ nennen. Trotz ihrer ungestümen Bewegungen fängt man sie leicht mit den Händen.
»Die drei Indianerlager an den oben genannten Orten werden in den letzten Tagen des März oder ersten Tagen des April eröffnet. Die Eierernte geht das eine Mal vor sich wie das andere, mit der Regelmäßigkeit, die bei allem vorherrscht, was von Mönchen ausgeht. Ehe die Missionäre an den Fluß kamen, beuteten die Eingeborenen ein Erzeugnis, das die Natur hier in so reicher Fülle bietet, in geringerem Maße aus. Jeder Stamm durchwühlte das Ufer nach seiner eigenen Weise, und es wurden unendlich viele Eier mutwillig zerbrochen, weil man nicht vorsichtig grub und mehr Eier fand, als man mitnehmen konnte. Es war, als würde eine Erzgrube von ungeschickten Händen ausgebeutet. Den Jesuiten gebührt das Verdienst, die Ausbeutung geregelt zu haben. Sie gaben nicht zu, daß das ganze Ufer aufgegraben wurde, ließen vielmehr ein Stück unberührt liegen, weil sie besorgten, die Schildkröten möchten, wenn nicht ausgerottet werden, ja doch bedeutend abnehmen. Jetzt wühlt man das ganze Ufer rücksichtslos um; man meint aber auch zu bemerken, daß die Ernten von Jahr zu Jahr geringer werden.
»Ist das Lager aufgeschlagen, so ernennt der Missionär seinen Stellvertreter, der den Landstrich, wo die Eier liegen, nach der Anzahl der Indianerstämme, die sich in die Ernte teilen, in Lose zerlegt. Er beginnt das Geschäft damit, daß er mit einer Stange untersucht, wie weit die Eierschicht im Boden reicht. Nach unsern Messungen erstreckt sie sich bis zu vierzig Meter vom Ufer und ist im Durchschnitt einen Meter tief. Der Beauftragte steckt ab, wie weit jeder Stamm arbeiten darf. Nicht ohne Verwunderung hört man den Ertrag der Eierernte wie den Ertrag eines Getreideackers abschätzen. Es kommt vor, daß ein Flächenraum von vierzig Meter Länge und zehn Meter Breite hundert Krüge oder für tausend Franken Öl liefert. Die Indianer graben den Boden mit den Händen auf, legen die gesammelten Eier in kleine, Mappiri genannte Körbe, tragen sie ins Lager und werfen sie in große, mit Wasser gefüllte, hölzerne Tröge. In diesen werden die Eier mit Schaufeln zerdrückt, umgerührt und der Sonne ausgesetzt, bis der ölige Teil, das Eigelb, das obenauf schwimmt, dick geworden ist. Das Öl wird abgeschöpft und über starkem Feuer gekocht, soll sich auch um so besser halten, je stärker man es kocht. Gut zubereitet, ist es hell, geruchlos und kaum ein wenig gelb. Die Missionäre schätzen es dem besten Baumöle gleich. Man braucht es nicht allein zum Brennen, sondern auch, und zwar vorzugsweise, zum Kochen, da es den Speisen keinerlei unangenehmen Geschmack gibt. Doch hält es schwer, ganz reines Schildkrötenöl zu bekommen, das meiste hat einen fauligen Geruch, der davon herrührt, daß Eier darunter geraten sind, in denen die jungen Schildkröten sich bereits ausgebildet hatten.
»Das Ufer von Urnana gibt jährlich tausend Krüge Öl. Der ganze Ertrag der Uferstrecken, auf denen jährlich Ernte gehalten wird, läßt sich auf fünftausend Krüge anschlagen. Da nun zweihundert Eier eine Weinflasche voll Öl geben, so kommen fünftausend Eier auf einen Krug. Nimmt man an, jede Schildkröte gebe hundert bis hundertsechzehn Eier, und ein Dritteil werde während des Legens, namentlich von den ›närrischen Schildkröten‹ zerbrochen, so ergibt sich, daß, um diese fünftausend Krüge Öl zu füllen, dreihundertunddreißigtausend Arráuschildkröten auf den drei Ernteplätzen dreiunddreißig Millionen Eier legen müssen. Und mit dieser Rechnung bleibt man noch weit unter der wahren Anzahl. Viele Schildkröten legen nur sechzig bis siebzig Eier; viele werden im Augenblicke, wo sie aus dem Wasser gehen, von den Jaguars gefressen; die Indianer nehmen viele Eier mit, um sie an der Sonne zu trocknen und zu essen, und zerbrechen bei der Ernte viele aus Fahrlässigkeit. Die Menge der Eier, die bereits ausgeschlüpft sind, ehe der Mensch darüber kommt, ist so ungeheuer, daß ich beim Lagerplatze von Uruana das ganze Ufer des Orinoko von jungen, zollbreiten Schildkröten wimmeln und mit Not den Kindern der Indianer, die Jagd auf sie machten, entkommen sah. Nimmt man noch hinzu, daß nicht alle Arráus zu den drei Lagerplätzen kommen, daß viele zwischen der Mündung des Orinoko und dem Einflusse des Apure einzeln und ein Paar Wochen später legen, so gelangt man notwendig zu dem Schlusse, daß sich die Anzahl der Schildkröten, die alljährlich an den Ufern des unteren Orinoko ihre Eier legen, nahezu auf eine Million beläuft. Dies ist ausnehmend viel für ein Tier von beträchtlicher Größe, das einen halben Zentner schwer wird und unter dessen Geschlecht der Mensch so furchtbar aufräumt; denn im allgemeinen Pflanzt die Natur in der Tierwelt die größeren Arten in geringerer Anzahl fort als die kleinen.«
Daß die Eier der Arráuschildkröte auch anderseits geschätzt werden, ergibt sich aus nachstehender Schilderung Schomburgks. »Den Jubel, mit dem die Bootsleute gewisse Sandbänke des Essequibo begrüßten, konnte ich nicht eher enträtseln, als bis mehrere der Indianer, ehe noch die Kähne landeten, ungeduldig in den Fluß sprangen, nach einer der Sandbänke schwammen, Plötzlich dort im Sande zu scharren begannen und eine Menge Eier zum Vorschein brachten. Die Legezeit der Schildkröten hatte begonnen, eine Zeit, der der Indianer mit ebenso großer Sehnsucht als unser Feinschmecker dem Schnepfenstriche oder dem Beginne der frischen Austersendungen entgegensieht. Die Begierde der Indianer war so groß, daß sie, glaube ich, auch wenn Todesstrafe auf eigenwilligem Verlassen des Kahnes gestanden hätte, sich nicht würden haben abhalten lassen, nach den Sandbänken zu schwimmen, die in ihrem Schoße die wohlschmeckenden Eier bargen. Als ich jenen gefeierten Leckerbissen kennenlernte, fand ich die Leidenschaft der Indianer erklärlich. Was sind unsere viel gepriesenen Kibitzeier gegen das Ei der Schildkröte!
» Martius gibt als Legezeit der Schildkröte im Amazonenstrome die Monate Oktober und November an; nach Humboldt fällt sie für den Orinoko in den März; im Essequibo dagegen beginnt sie mit Januar und währt höchstens bis Anfang Februar. Diese Verschiedenheit der Legezeit scheint genau mit dem verschiedenen Eintritte der Regenzeit innerhalb der Grenzen der drei Stromgebiet in Verbindung zu stehen. Diese Tiere entledigen sich ihrer Eier während jener günstigen Tage, in denen die Sonne vor dem Eintritte der großen Regenzeit noch ihr Brutgeschäft beendigen kann. Für den Indianer ist das Erscheinen der jungen Schildkröten das sicherste Merkmal für den baldigen Beginn der letzteren; denn wenn jene, nachdem sie ausgekrochen sind, dem Wasser zueilen, kann man sicher darauf rechnen, daß die Regenzeit naht. Vierzig Tage, nachdem das Ei gelegt wurde, durchbricht das Junge die Pergamentumhüllung und schlüpft aus.«
Außer dem Menschen, dessen regelrecht betriebene Eierplünderung dem wohl noch heutigentags zahlreichen Heere der Arráuschildkröten die erheblichsten Verluste zufügt, haben dieselben auch von Raubtieren zu leiden. »Man zeigte uns«, schließt Humboldt seine malerische Schilderung, »große, von Jaguaren geleerte Schildkrötenpanzer. Die ›Tiger‹ gehen den Arráus auf den Uferstrichen nach, wo sie legen wollen, überfallen sie dabei und wälzen sie, um sie gemächlich verzehren zu können, auf den Rückenpanzer. Aus dieser Lage können die Schildkröten sich nicht aufrichten, und da der Tiger ihrer weit mehr umwendet, als er in einer Nacht verzehren kann, so machen sich die Indianer häufig seine List und seine boshafte Habsucht zunutze.«
*
Otterschildkröten mögen einige wenige Arten genannt werden, die Wagler mit vollem Rechte in einer besonderen Sippe ( Hydromedusa) vereinigt hat. Sie kennzeichnen der flache, gewölbte, an den Seitenrändern rinnenartig aufgebogene, aus vierzehn Scheibenplatten zusammengesetzte Rücken- und der sehr flache, aus einem Stücke bestehende Brustschild, der flachgedrückte, mit weicher Haut bekleidete Kopf, der sehr lange, warzige Hals, der kurze Schwanz und die vorn und hinten vierkralligen Füße. Die Schwanzplatte ist doppelt, die fast viereckige Zwischenkehlplatte sehr groß; Achsel- und Weichenplatten fehlen, Kinnbärtel ebenso.
Die Schlangenhalsschildkröte ( Hydromedusa maximiliani) ist wohl die bekannteste Vertreterin der Gruppe. Die Färbung ihres Rückenschildes ist ein gleichmäßiges, tief dunkles Olivengrün, die des Brustschildes ein schmutziges Bräunlichgelb, das auch auf dem unteren Rande der oberen Randplatten hervortritt, aber an der Verbindungsstelle beider Schilder ins Braunschwarze übergeht. Kopf, Hals, Füße und Schwanz haben bleigraue, eine an der scharf abgestutzten oberen Schnauzenkante, zu beiden Seiten der Nase beginnende, als schmaler Strich bis zum Auge verlaufende, von hier an sich verbreiternde und nunmehr gleich breit längs des ganzen Halses sich hinabziehende Binde, ebenso eine zweite, die jederseits innen neben der Unterkinnlade verläuft und mit jener bald sich vereinigt, endlich die Querseite der Schenkel gelblichweiße Färbung. Die Gesamtlänge des erwachsenen Tieres wird zu 1,2 Meter, die des Halses zu 40, die des Panzers zu 72 Zentimeter angegeben. Das Verbreitungsgebiet der Schlangenhalsschildkröte scheint auf den Süden Brasiliens und die benachbarten Freistaaten beschränkt zu sein.
Die Lebensweise und Lebensart der Schlangenhalsschildkröte muß, so sehr sie im großen und ganzen auch dem Tun und Treiben anderer Wasserschildkröten ähneln mag, in mehr als einer Beziehung merkwürdig sein. Übertags sieht man von ihr selten mehr als den Panzer; denn Kopf und Glieder sind vollständig eingezogen. Der lange Hals liegt dann wie ein dicker Wulst quer und ziemlich tief in dem Raume zwischen Rücken und Brustschild, fast die ganze Breite der vorderen oder Halsöffnung ausfüllend, und der Kopf wird so fest zwischen die weiche Haut der Schultergegend gepreßt, daß nur ausnahmsweise mehr als ein Teil der Seite des Hinterhauptes ersichtlich ist, Nase und Auge aber vollständig den Blicken entzogen sind, weil sich die Haut allseitig über diese Sinneswerkzeuge weglegt. Beine und Schwanz werden in üblicher Weise eingezogen und beziehentlich umgeklappt; die Sohlen der mit langen, jedoch kräftigen Nägeln bewehrten Füße liegen dabei aber frei an der Oberfläche. So gibt das Tier außer ihnen nur den Panzer dem Blicke oder einem etwaigen Angriffe preis. Aber der lange Hals kann auch plötzlich hervorschnellen und dann eine so überraschende Biegsamkeit, Geschwindigkeit und Beweglichkeit betätigen, daß man immer und immer wieder an eine Schlange erinnert wird. Nunmehr ist unsere Schildkröte zur Abwehr bereit und geht, sobald ihr dies rätlich erscheint, zu Angriffen über, die an Lebhaftigkeit hinter denen der Schnappschildkröte nicht im geringsten zurückstehen, an Gewandtheit sie aber bei weitem überbieten. Boshaftes Glühen scheint die lichtgelben Augen zu beleben; schlangenhaft legt sich der Hals in Windungen, um die zum Vorstoße erforderliche Länge zu gewinnen, und blitzartig, wie die Bewegung einer beißenden Schlange, schnellt ihn das bissige Tier vor, wenn es die rechte Zeit für gekommen erachtet. Gegenüber der Gelenkigkeit und Behendigkeit, mit der diese Schildkröte den Hals zusammenzieht und ausstreckt, dreht und wendet, erscheinen alle übrigen Bewegungen, obgleich sie denen anderer Ordnungsverwandten nichts nachgeben, besonderer Erwähnung kaum wert, sind wenigstens in keiner Weise bezeichnend.
Erlaubt man sich, von dem, was man an einer gefangenen und jungen Schlangenhalsschildkröte wahrnimmt, einen Schluß auf das Freileben zu wagen, so wird man sich ungefähr folgendes Lebensbild des Tieres gestalten dürfen. Die Schlangenhalsschildkröte liegt übertags ruhend im oder auf trockenen Stellen über dem Wasser und beginnt erst nachts ihre Jagd. Ihren, schlammigem Boden gleichgefärbten Rückenschild entzieht sie dem Auge der Fische, auf die sie, halb im Schlamme vergraben, lauert, und arglos nähern sich jene, bis plötzlich der lange Hals vorschnellt und die schnabelartigen Kiefer das unvorsichtige Opfer ergreifen. Bleibt der Anstand ohne Erfolg, so wird dieser Hals auch beim Nachjagen einer Beute treffliche Dienste leisten. Gegen Feinde wird die Schlangenhalsschildkröte mit ebensoviel Mut und Nachdruck als Geschick und Erfolg sich verteidigen, im ganzen also wenig, vielleicht nur in ihrer Jugendzeit von übermächtigen Gegnern zu leiden haben. Ihre ganze Ausrüstung stempelt sie zu dem, was ihr glücklich gewählter Name besagt: sie ist eine »Hydromedusa« oder Beherrscherin des Wassers.
*
Durch die zu Flossen umgestalteten Beine, deren vordere die hinteren an Länge bedeutend überragen, unterscheiden sich die Meerschildkröten ( Cheloniida) von ihren Ordnungsverwandten. Jeder ihrer Füße bildet eine lange, breitgedrückte Flosse, die, wie Wagler hervorhebt, mit denen der Robben große Ähnlichkeit hat; die Zehen werden von einer gemeinschaftlichen Haut überzogen und dadurch unbeweglich, verlieren auch größtenteils die Nägel, da nur die beiden ersten Zehen jedes Fußes, und diese nicht immer, spitzige Klauen tragen. Außerdem zeichnen sich die Meerschildkröten durch den herzförmigen, vorn rundlich ausgerandeten, hinten zugespitzten, flach gewölbten, gegen das Ende der Rippen unvollkommen verknöcherten Rückenpanzer, in den die Gliedmaßen nicht zurückgezogen werden können, die Bildung des Brustpanzers, dessen einzelne Stücke keinen zusammenstoßenden Schild herstellen, sondern durch Knorpel verbunden werden, die Art der Beschuppung oder Beschilderung, den kurzen, dicken, runzeligen, halb zurückziehbaren Hals, den kurzen, starken, vierseitigen Kopf und die nackten, mit scharfen, zuweilen am Rande gezähnelten Hornschneiden bedeckten Kiefer, die sich an der Spitze hakenförmig überbiegen und so ineinander passen, daß die oberen die unteren vollständig in sich aufnehmen, die großen vorspringenden Augen und die sehr kleinen Nasenlöcher, die eigentümliche Beschilderung des Kopfes und der Füße und den kurzen, stumpfen, mit Schuppen bekleideten Schwanz usw. aus.
Alle zu dieser Gruppe zählenden Schildkröten leben im Meere, zuweilen Hunderte von Seemeilen entfernt von der Küste, schwimmen und tauchen vorzüglich und begeben sich nur, um ihre Eier abzulegen, auf das Land. Inwiefern sich die Lebensweise der einzelnen Arten unterscheidet, ist schwer zu sagen, weil man ausführliche Beobachtungen über alle Seeschildkröten eigentlich nur während ihrer Fortpflanzungszeit oder, richtiger, während des Eierlegens angestellt hat, von ihrem Leben im Meere aber nicht viel mehr weiß, als bereits die Alten wußten. Ich beschränke daher meine Schilderung aus die bekannteste Sippe der Padschildkröten ( Chelone).

Suppenschildkröte ( Chelone mydas)
Ihr Kopf ist pyramidenförmig und an den Seiten stark abfallend, und die Vorderglieder sind fast doppelt so lang, aber weit schmäler als die hinteren. Der Rückenschild besteht aus dreizehn Scheibenplatten, deren erste Rippenplatten größer als die letzten sind, und fünf- bis siebenundzwanzig Randplatten, der Brustschild, da die Zwischenkehlplatte gut entwickelt ist, ebenfalls aus dreizehn Platten, zu denen noch jederseits vier bis fünf ziemlich große und kleinere Brustrippenplatten kommen. Zehn bis zwölf regelmäßige Schilder decken die obere wagerechte Fläche des Kopfes, vielseitige Schilder sehr verschiedener Größe die Beine, mit Ausnahme der Schultergegend und des oberen Teiles der Schenkel, ähnliche endlich die Mitte und das Ende des kurzen Schwanzes.
Die Suppenschildkröte ( Chelone mydas), ein sehr großes Tier von mehr als 2 Meter Länge und über 500 Kilogramm Gewicht, kennzeichnet sich durch den vorn nicht hakig gekrümmten und vorgezogenen, sondern abgestumpften, übrigens aber scharfen, fein gezähnelten Kiefer, durch die neben-, nicht übereinander liegenden Platten ihres Rückenschildes und ein einziges Schilderpaar zwischen den Nasenlöchern und dem Stirnschilde. Alle übrigen Merkmale ändern so vielfach ab, daß sie zur Aufstellung von etwa zehn verschiedenen Arten Veranlassung gegeben haben. Die ebensowenig beständige Färbung der Oberseite ist in der Regel ein düsteres Bräunlichgrün, die der Unterseite ein vielfach bläulich und rötlich geädertes Schmutzigweiß.
Mit Ausnahme des Mittelmeeres, in dem sie durch andere Seeschildkröten vertreten wird, bewohnt die Suppenschildkröte alle Meere des heißen und gemäßigten Gürtels, scheint hier auch überall häufig zu sein. Man hat sie beobachtet von den Azoren an bis zum Vorgebirge der Guten Hoffnung, längs der ganzen afrikanischen Küste und auf allen zu diesem Erdteile gehörigen Inseln, an der atlantischen Küste Amerikas vom vierunddreißigsten Grade nördlicher Breite an bis zur Mündung des Platastromes, im Stillen Weltmeere aber von Peru an bis Kalifornien und auf den Schildkröteninseln, ebenso endlich im Indischen Weltmeere und den dazu gehörigen Teilen und Straßen, von den Maskarenen und dem Kanal von Mosambik an bis ins Rote Meer, an allen Gestaden Ostindiens, an den Sundainseln und Philippinen sowie endlich an den Gestaden Australiens. Einzelne verschlagene Stücke sind auch im Nordosten Amerikas und an den europäischen Küsten gefangen worden.
Die Suppenschildkröten sind, wie ihre sämtlichen Verwandten, vollendete Meertiere. Sie halten sich vorzugsweise in der Nähe der Küste auf, finden sich nicht allzu selten vor oder in der Mündung größerer Flüsse oder Ströme ein, werden aber doch oft auch sehr weit von dieser, manchmal mitten im Meere gefunden. Hier sieht man sie nahe der Oberfläche umherschwimmen, zuweilen auch wohl, anscheinend schlafend, auf ihr liegen, bei der geringsten Störung aber sofort in der Tiefe verschwinden. »Die Landschildkröten«, meint Lacépède, »galten von jeher als Wahrzeichen der Langsamkeit; die Seeschildkröten dürfen das Sinnbild der Vorsicht genannt werden.« In der Tat stimmen alle Berichte darin überein, daß diese Tiere, solange sie wach oder nicht durch überwältigende Triebe in einen Zustand des Selbstvergessens versetzt worden sind, vor dem Menschen ängstlich flüchten; schwerlich aber ist man berechtigt, ihnen deshalb eine höhere Begabung als andern Ordnungsverwandten zuzuschreiben. Ihre geistigen Fähigkeiten sind ebenso gering als ihre leiblichen erheblich. Man sagt ihnen nach, daß sie auf dem Lande mit so vielen Männern, als auf ihrem Rückenschilde Fuß fassen können, große mit vierzehn Mann, fortzukriechen vermögen; ihre wahre Beweglichkeit entfalten sie aber doch nur in dem Wasser. Sie erinnern, wenn sie hier sich tummeln, auf das allerlebhafteste an fliegende große Raubvögel, z. B. Adler; denn sie schwimmen wundervoll, mit ebensoviel Kraft als Schnelligkeit, mit ebenso unwandelbarer Ausdauer als Anmut; sie schwimmen gleich ausgezeichnet in verschiedener Tiefe und nehmen im Wasser alle denkbaren Stellungen an, indem sie bald mehr, bald weniger die wagerechte Lage verändern. Da, wo sie häufig sind, sieht man manchmal förmliche Herden von ihnen, wie sie überhaupt sehr gesellig zu sein scheinen. »Da sie«, sagt Lacépède, »an den Küsten, die sie besuchen, stets hinlängliche Nahrung finden, so streiten sie miteinander niemals um das Futter, das sie in Überfluß haben; da sie außerdem, wie alle Kriechtiere, Monate, selbst Jahr und Tag fasten können, so herrscht ein ewiger Friede unter ihnen. Sie suchen einander nicht, aber sie finden sich ohne Mühe zusammen und bleiben ohne Zwang beieinander. Sie versammeln sich nicht in kriegerische Haufen, um sich einer schwer zu erlangenden Beute leichter zu bemächtigen, sondern einerlei Trieb führt sie an den nämlichen Ort, und einerlei Lebensart hält ihre Herde in Ordnung. Sie sind vorsichtig, nicht aber mutig, verteidigen sich selten tätig, sondern suchen jederzeit so viel und so rasch als möglich in Sicherheit zu gelangen, strengen auch alle Kräfte an, um dieses Ziel zu erreichen.« Ich glaube, daß man mit dieser Schilderung einverstanden sein kann, mit andern Worten, daß sie im großen ganzen naturgemäß ist. Geselligkeit und Friedfertigkeit sind hervorragende Eigenschaften vieler Schildkröten, der Seeschildkröten aber ganz besonders.
Abweichend von der verwandten Karette, die ein zünftiges Raubtier ist, frißt die Suppenschildkröte, wenigstens zeitweilig, hauptsächlich Seepflanzen, insbesondere Tange, und verrät sich, da wo sie häufig ist, durch die von ihr abgebissenen Teile dieser Pflanzen, die auf der Oberfläche des Meeres umherschwimmen. So gibt, übereinstimmend mit fast allen Berichterstattern, auch Holbrook an und fügt, Audubons Mitteilungen wiederholend, hinzu, daß sie die zartesten Teile einer Seepflanze ( Zostera marina), der geradezu Schildkrötengras genannt werde, allen übrigen Meergewächsen vorziehe. Auch die Gefangenen soll man, wie er bemerkt, ausschließlich mit Pflanzenstoffen, und zwar mit Portulak füttern. Ich bin nicht imstande, diesen Angaben zu widersprechen, muß jedoch bemerken, daß nicht allein meine gefangene Karette, sondern auch die in demselben Becken untergebrachten Suppenschildkröten Fischfleisch begierig fraßen.
Zu gewissen Zeiten verlassen die weiblichen Suppenschildkröten das hohe Meer und steuern bestimmten, altgewohnten Plätzen zu, um aus ihnen ihre Eier abzulegen. Sie erwählen hierzu sandige Stellen des Strandes unbewohnter Inseln oder vom menschlichen Getriebe entfernte Küstenstrecken und suchen einen und denselben Legeplatz, wenn nicht Zeit ihres Lebens, so doch während eines gewissen Abschnittes desselben immer wieder auf, auch wenn sie Hunderte von Seemeilen durchwandern müßten. Die Männchen folgen, laut Dampier, ihren Weibchen auf dieser Reise, gehen aber, wenn diese legen, nicht mit ihnen ans Land, sondern bleiben, in der Nähe verweilend, im Meere zurück. Vorher hatten sich beide Geschlechter begattet, welches Geschäft nach Catesby mehr als vierzehn Tage in Anspruch nehmen soll. Villemont sagt, daß das Männchen während der Begattung aus dem Rücken des Weibchens sitze und gleichsam reite; Lacépède dagegen, auf handschriftliche Mitteilungen Fougeroux' sich stützend, daß beide die Brustschilder gegeneinander kehren und das Männchen sich mit den Nägeln der Vorderfüße an der schlaffen Halshaut des Weibchens festhalte. Beide, insbesondere aber die Männchen, sollen, solange die Paarung währt, ihre sonstige Scheu vollständig vergessen. »Ich habe«, versichert Dampier, »Männchen während der Begattung gefangen. Sie sind dann gar nicht scheu und leicht zu erlangen. Das Weibchen wollte beim Anblick des Bootes entfliehen, aber das Männchen hielt es mit den beiden Vorderflossen fest. Will man sich paarende Schildkröten erbeuten, so braucht man nur das Weibchen zu töten; denn das Männchen hat man dann sicher.« Wie viele Zeit nach der Paarung vergeht, bis die ersten Eier legereif sind, weiß man nicht. In der Nähe des Strandes angekommen, wartet die Schildkröte ihre Zeit ab und begibt sich dann abends mit großer Vorsicht ans Land. Schon am Tage sieht man sie, nach Beobachtung des Prinzen von Wied, unweit der Küste umherschwimmen, wobei sie den dicken, runden Kopf allein über dem Wasser zeigt, den Rückenpanzer aber eben nur an die Oberfläche des Wassers bringt. Hierbei untersucht sie die selten beunruhigten Küsten auf das genaueste. Audubon, der sie von einem Versteckplatze aus beobachtete, versichert, daß sie, ehe sie ans Land steigt, noch besondere Vorsichtsmaßregeln ergreift, namentlich einen pfeifenden Laut ausstößt, der etwa versteckte Feinde verscheuchen soll. Das geringste Geräusch veranlaßt sie, sich augenblicklich in die Tiefe des Meeres zu versenken und einen andern Platz aufzusuchen; ja, nach St. Pierres Versicherung soll ein Schiff, das einige Stunden in der Nähe einer Brutinsel ankert, die vorsichtigen Geschöpfe tagelang aus der Nähe des Eilandes vertreiben und ein Kanonenschuß sie so ängstigen, daß sie erst nach Wochen wieder in der Nähe der Küsten erscheinen. Bleibt alles ruhig und still, so nähert sich die Schildkröte endlich langsam dem Strande, kriecht auf das Trockene heraus und mit hoch erhobenem Haupte bis in eine Entfernung von dreißig oder vierzig Schritte jenseits der Flutwelle, schaut sich hier nochmals um und beginnt nunmehr ihre Eier zu legen. Hierbei hat sie der Prinz von Wied beobachtet und uns darüber Nachstehendes mitgeteilt. »Unsere Gegenwart störte sie nicht bei ihrem Geschäft; man konnte sie berühren und sogar aufheben (wozu aber vier Mann nötig waren); bei all den lauten Zeichen unseres Erstaunens und den Beratschlagungen, was man wohl mit ihr anfangen sollte, gab sie kein anderes Zeichen von Unruhe als ein Blasen, wie etwa die Gänse tun, wenn man sich ihrem Neste nähert. Sie fuhr mit ihren flossenartigen Hinterfüßen langsam in der einmal begonnenen Arbeit fort, indem sie gerade unter ihrem After ein zylinderförmiges, etwa fünfundzwanzig Zentimeter breites Loch in dem Sandboden aushöhlte, warf die herausgegrabene Erde äußerst geschickt und regelmäßig, ja gewissermaßen im Takte zu beiden Seiten neben sich hin und begann alsdann sogleich ihre Eier zu legen. Einer unserer beiden Soldaten legte sich nun seiner ganzen Länge nach neben die Verfolgerin unserer Küche auf die Erde nieder, griff in die Tiefe des Erdloches hinab und warf die Eier beständig heraus, sowie die Schildkröte sie legte. Auf diese Art sammelten wir in einer Zeit von etwa zehn Minuten an hundert Eier. Man beratschlagte nun, ob es zweckmäßig sei, dieses schöne Tier unsern Sammlungen einzuverleiben; allein das große Gewicht der Schildkröte, für das man ein besonderes Maultier einzig und allein hätte bestimmen müssen, und überdies die Schwierigkeit, die ungefüge Last aufzuladen, bestimmten uns, ihr das Leben zu schenken und mit ihrem Zoll an Eiern uns zu begnügen. Als wir nach einigen Stunden an den Strand zurückkehrten, fanden wir sie nicht mehr vor. Sie hatte ihr Loch verdeckt, und ihre breite Spur im Sand zeigte, daß sie ihrem Elemente wieder zugekrochen war.«
In seinen »Beiträgen zur Naturgeschichte Brasiliens« fügt der Prinz dem eben Mitgeteilten noch einiges hinzu: »So viel weiß ich aus der Erfahrung, daß diese Tiere in der Zeit des brasilianischen Sommers, der Monate Dezember, Januar und Februar, sich in Mengen den Küsten nähern, um daselbst ihre Eier in den von den glühenden Strahlen der Sonne erhitzten Sand zu verscharren. Hierin kommen alle Meerschildkröten miteinander überein, und die Erzählung der Art und Weise dieses Geschäfts, von dem ich Augenzeuge war, gilt für alle diese durch gleichartigen Bau und Lebensweise verwandten Tiere. Der Reisende findet in der Legezeit häufig Stellen im Sande der Küste, auf denen zwei gleichlaufende Rinnen den Weg anzeigen, den die Schildkröten genommen, als sie das Land bestiegen. Diese Furchen sind die Spuren, die die vier Flossenfüße hinterlassen; zwischen ihnen bemerkt man alsdann eine breite Schleife, die der Unterpanzer des schweren Körpers eindrückt. Folgt man dieser Spur etwa dreißig bis vierzig Schritte weit auf die Höhe des Sandufers, so kann man das schwere, große Tier finden, wie es unbeweglich in einem flachen, wenig vertieften, durch ein kreisförmiges Herumdrehen gebildeten Kessel dasitzt, mit der Hälfte des Körpers darin verborgen. Sind die sämtlichen Eier in der beschriebenen Weise gelegt, so scharrt das Tier von beiden Seiten den Sand zusammen, tritt ihn fest und begibt sich, ebenso langsam als es gekommen, auf derselben Spur wieder in sein Element zurück.«
Das erste Gelege scheint den Vorrat der befruchteten Eier eines Weibchens nicht zu erschöpfen, dieses vielmehr nach Ablauf geraumer Zeit wieder zu derselben Stelle zu kommen, um eine ähnliche Anzahl inzwischen gereifter Eier der mütterlich waltenden Erde zu übergeben, so daß sich die gesamte Anzahl aller Eier eines erwachsenen Weibchens auf drei-, vielleicht vierhundert belaufen mag. Ältere und neuere Schriftsteller, die Gelegenheit hatten, Suppenschildkröten an ihren Legestellen zu beobachten oder hier, an ihrer Wiege, Nachrichten über sie einzuziehen, stimmen in der Angabe überein, daß die Tiere alljährlich mehr als einmal, und zwar in Zwischenräumen von je vierzehn Tagen bis drei Wochen, auf den Brutstätten erscheinen und jedesmal eine mehr oder weniger gleiche Anzahl von Eiern ablegen. Zurückkehren bestimmter Weibchen zu den Legeplätzen konnte mit Sicherheit festgestellt werden. Auf den Tortugasinseln, einem der bevorzugten Brutplätze Mittelamerikas, waren, laut Strobel, verschiedene Suppenschildkröten gefangen und gezeichnet, sodann nach Key West gebracht und hier in einem Gehege eingeschlossen worden. Ein Sturm zerstörte die Umhegung und befreite die Gefangenen. Wenige Tage später wurden sie auf derselben Stelle, also unter gleichen Umständen wie das erste Mal, gefangen. Je nach der Gegend ist die Legezeit verschieden. In der Straße von Malakka fällt sie in dieselben Monate wie in Brasilien, auf den Tortugasinseln in die Monate April bis September, an der Goldküste, laut Loyer, dagegen in die Zeit zwischen September und Januar; anderweitige Angaben finde ich nicht verzeichnet. Die Brutdauer soll ungefähr drei Wochen betragen, je nach der Wärme des Brutplatzes mehr oder weniger. Auf den Inseln des Grünen Vorgebirges sollen die jungen Schildkröten am dreizehnten Tage nach dem Legen auskommen. Sie kriechen nun sofort dem Meere zu, können aber nicht sogleich untertauchen, und viele werden den Möwen, Reihern, Raubvögeln und Raubfischen zur Beute. Ihr Panzer ist anfänglich mit einer weißen, durchsichtigen Haut überzogen, wird aber bald hart, dunkel und teilt sich dann auch rasch in die einzelnen Platten.
Während des Eierlegens sind auch die außerdem ziemlich gesicherten Suppenschildkröten arg gefährdet. Große Raubtiere und Menschen bemächtigen sich jetzt der wehrlosen Geschöpfe. Ärger als jene haust unter diesen der Mensch, und zwar der Weiße nicht minder rücksichtslos als der Farbige. Nur an wenigen Orten jagt man auf die wertvollen Tiere in vernunftgemäßer Weise. An den Küsten Guayanas stellt man weitmaschige, durch Schwimmer in den oberen Wasserschichten festgehaltene Netze, untersucht dieselben von Zeit zu Zeit und löst die in den Maschen verwickelten Seeschildkröten aus; im Mittelmeere, insbesondere in der Nähe der Kykladen, betreibt man die Jagd noch in ähnlicher Weise wie in alten Zeiten. Ein Boot, das bei vollkommener Windstille mit leisem Ruderschlage langsam durch das blaue Wasser des Kykladenmeeres zieht, stößt, laut Erhard, mehrere Seemeilen von der nächsten Insel oft genug auf eine ganz an der Oberfläche schlafend hingleitende Seeschildkröte (in der Regel die dem Mittelmeere angehörige Kaguana), die in der Ferne einem umgestürzten Kahne ähnelt. Kann man sich ihr nahen, ehe sie erwacht, so wird sie von erfahrenen Fischern an einem Beine gepackt, durch hastiges Umdrehen leicht auf den Rücken gelegt und ist dann hilflos, obwohl jene auch jetzt noch sich hüten, einem Bisse des Tieres sich auszusetzen, denn ein solcher schneidet zwei Zentimeter starke Stäbe morsch entzwei. In der Regel freilich ist das Gehör der Schildkröte feiner als ihr Schlaf tief, und wenn sie rechtzeitig erwacht, sinkt sie vor den Augen der getäuschten Feinde langsam, fast ohne Bewegung in die blaue Tiefe hinab, »in welcher sie nach zehn Minuten noch, zuletzt wie ein grünverlöschender Stern dem Auge des Menschen sichtbar ist.«
Die menschenleeren, wilden Küsten Brasiliens, die von den Schildkröten zum Legen benutzt werden, werden nur selten von Reisenden betreten, in der Legezeit aber von allen in der Nachbarschaft wohnenden Indianern besucht. »Diese Indianer«, sagt der Prinz, »sind die grausamsten Feinde der Schildkröten; sie finden täglich mehrere Tiere dieser Art, die im Begriff sind, ihre Eier zu legen, und töten sie sogleich, da die schweren, langsamen Geschöpfe auf dem Lande ebenso unbehilflich als im Wasser geschickt im Schwimmen sind. Überall geben daher die traurigen, öden, nichts als Sand und nach dem Lande hin als finstere Urwälder zeigenden Küsten, die von den tobenden Wogen des Weltmeeres bespült werden, ein Bild der Zerstörung und der Vergänglichkeit alles Lebens; denn die Knochenschädel, Panzer, ja ganze Gerippe dieser, gerade in der Zeit ihrer Vermehrung aufgeriebenen Tiere liegen überall in Mengen umher, nachdem sie von den Rabengeiern des letzten Restes von Fleisch beraubt worden sind. Die Indianer töten die Meerschildkröten des Öles wegen, das in ihrem Fleisch enthalten ist, kochen dasselbe und sammeln die zahlreichen Eier, die in dem Sand oder noch in dem Leibe des Tieres enthalten sind, in großen Körben, um sie zu Hause zu verzehren. In dieser Zeit der Schildkröteneier begegnet man den mit den genannten Schätzen beladenen Familien der Indianer oft an dieser Küste; auch erbauen sie sich wohl Hütten von Palmenblättern, um mehrere Tage und Wochen sich am Strande niederzulassen und täglich das Geschäft des Einsammelns zu betreiben.« In ähnlicher Weise wird den nutzbringenden Tieren allerorten, an allen Küsten, die sie zum Eierlegen besuchen, nachgestellt. Und dennoch würde die sehr bedeutende Vermehrung der Suppenschildkröten die durch Wegfangen der alten Weibchen verursachten Verluste ausgleichen, wollte man sich mit den Weibchen selbst begnügen und nicht auch die Brutstätten Plündern, Tausende und Hundertausende von Eiern rauben. Durch den rücksichtslosen Eierraub erwächst dem Bestände der Art die größte Gefahr; hieran aber denkt der rohe, selbstsüchtige Schildkrötenjäger nicht. Wenn die Zeit des Eierlegens der Tiere naht, rottet sich allerlei Gesindel zusammen, um möglichst reiche und lohnende Beute zu gewinnen. Die Jäger nahen sich in kleinen Booten vorsichtig dem Strande der unbewohnten Inseln oder vom Lande her den Legeplätzen an bewohnten Küsten, verbergen sich in der Nähe, verhalten sich still und warten, bis die ängstlichen Tiere an das Land gekrochen sind und sich hinlänglich weit vom Wasser entfernt haben. Erheben sich die Jäger zu früh, so eilen die Schildkröten sofort dem Meere zu, und da, wo der Strand einigermaßen abschüssig ist, gelingt es ihnen oft, sich zu retten, indem sie sich schnell herumdrehen und dann über den Sand hinabgleiten lassen; kommen jene rechtzeitig zur Stelle, so sichern sie sich ihre Beute dadurch, daß sie dieselbe umwenden, das heißt auf den Rücken wälzen. Keine Seeschildkröte ist imstande, aus dieser Lage sich zu befreien, obgleich sie, um dies zu ermöglichen, wütend mit den Flossen um sich und auf ihren Panzer schlägt, mit der Zeit auch derartig sich quält, daß ihre Augen mit Blut unterlaufen und weit aus dem Kopfe heraustreten. Nicht allzu selten geschieht es, daß die Fänger grausam genug sind, mehr Schildkröten umzuwenden, als sie gebrauchen können, einzelne von ihnen in der hilflosen Lage liegen und elendiglich verschmachten lassen. Sehr große und schwere werden vermittels Hebebäume umgewälzt, viele mit Hilfe von Netzen gefangen, andere mit dem Wurfspeer erbeutet. Audubon lernte einen Schildkrötenfänger kennen, der im Lause eines Jahres nicht weniger als achthundert Stück »gesichert« hatte: eine den Fortbestand der Art gefährdende Anzahl, da es sich fast ausschließlich um fortpflanzungsfähige Weibchen handelt. Man jagt immer während der Nacht und schreitet am nächsten Morgen zum Einsammeln der Gefangenen, die nun zunächst entweder in eigens für sie bereitete Behälter oder auf die Schiffe gebracht und von hier aus versandt werden. In den Zwingern, die selbstverständlich mit Seewasser angefüllte Becken sind, sieht man sie langsam umherschwimmen und oft ihrer drei oder vier sich übereinander lagern. Auf trockenem Boden frei gelassen, kriechen sie lebhaft umher und geben ihre Unbehaglichkeit von Zeit zu Zeit durch Schnauben zu erkennen. An das Fressen gehen die Gefangenen selten, magern deshalb bald ab und verlieren an Wert. Diejenigen, die man auf europäische Märkte bringt, kommen meist aus Westindien, namentlich aus Jamaika. Man legt sie an einer passenden Stelle des Verdecks auf den Rücken, befestigt sie mit Stricken, breitet ein Tuch über sie und begießt dasselbe oft mit Seewasser, daß es beständig naß oder wenigstens feucht bleibt, steckt den armen Schelmen ein Stück mit Seewasser getränktes Weißbrot in das Maul und vertraut im übrigen auf ihre außerordentliche Lebenszähigkeit. In den europäischen Seestädten hält man sie in großen Kübeln, die alle zwei bis drei Tage einmal mit Wasser angefüllt werden, schlachtet sie dann, indem man ihnen den Kopf abhackt, und hängt sie nun einen oder zwei Tage lang so auf, daß alles Blut ablaufen kann. Erst dann hält man das Fleisch für geeignet zur Bereitung jener köstlichen Suppen.
In Indien und insbesondere auf Ceylon macht man weniger Umstände mit den für die Küche bestimmten Seeschildkröten. Ein äußerst widerwärtiger Anblick bietet sich, laut Tennent, auf den Märkten von Ceylon dem Besucher dar. Man sieht hier die gefangenen Schildkröten in unglaublicher Weise quälen. Wahrscheinlich wünschen die Käufer das Fleisch so frisch als möglich zu erhalten oder wollen sich die Verkäufer besondere Mühe nicht mit dem Schlachten geben; man trennt also einfach den Brustpanzer des lebenden Tieres ab und schneidet dem Kauflustigen das von ihm gewünschte Fleischstück aus dem Leibe heraus. Bei der bekannten Lebenszähigkeit der Schildkröten sieht dann der entsetzte Europäer, wie das geschundene Tier die Augen verdreht, das Maul langsam öffnet und schließt, wie das Herz, das gewöhnlich zuletzt gefordert wird, pulsiert, wie das Leben sich noch in allen den Tieren regt, die noch keine Liebhaber fanden.
Die zweite Art der Sippe ist die Karettschildkröte oder die Karette ( Chelone imbricata). Sie steht an Größe merklich hinter der Suppenschildkröte zurück, dieser aber in Bau und Gestalt sehr nahe, unterscheidet sich von der Verwandten jedoch in allen Altersstufen durch den mehr oder minder stark hakigen Oberkiefer, die Beschilderung des Kopfes, die zwischen den Nasenlöchern und dem Stirnschild zwei aufeinanderfolgende Schilderpaare zeigt, sowie endlich durch die stets mehr oder minder deutlich nach Art der Dachziegel, also zum Teil übereinander liegenden Platten des Rückenschildes, auf deren mittlerer oder Wirbelreihe meist auch ein Längskiel hervortritt. Alle Platten des Rückenschildes sind auf düster grünlich- bis schwarzbraunem Grunde flammig gezeichnet, indem von einer Stelle, in der Regel vom hinteren Winkel des einzelnen Schildes aus, lichtere durchsichtige, rosarötlich, rotbraun, ledergelb und ähnlich gefärbte Streifen auslaufen, die unter Umständen sich so verbreitern können, daß die ursprünglich dunkle Färbung der Schilder als Zeichnung erscheint; die Platten des Brustschildes sind auf gelblichweißem Grunde teilweise schwarz gefleckt oder geflammt, Kopf, Hals und Glieder oben und unter dem Grunde des Rücken- oder Brustschildes gleich, unten aber gegen den Rand oder das Ende der Flossen hin dunkel gefärbt, nicht aber auch gezeichnet oder geflammt. Dumeril und Bibron geben die Gesamtlänge der Karettschildkröte zu 1,9, die des Schildes zu 1,45 Meter an; Günther dagegen sagt, daß sie, mindestens im Indischen Meer, niemals die Größe anderer Seeschildkröten erreiche, und daß Panzer von 60 Zentimeter Länge als außerordentlich große angesehen würden.
Wie es scheint, fällt das Verbreitungsgebiet der Karette so ziemlich mit dem der Suppenschildkröte zusammen. Auch sie bewohnt die zwischen den Wendekreisen liegenden Meere beider Halbkugeln und tritt namentlich im Karaibischen Meere und in der Sulusee häufig auf. Gefangen oder beobachtet wurde sie an vielen Stellen längs der atlantischen Küste Amerikas von den südlichen Vereinigten Staaten an bis Santa Rosa unterhalb Montevideo, am Vorgebirge der Guten Hoffnung, im Kanal von Mosambik, im Roten Meer, an vielen Stellen der ostindischen und malaiischen Küste, in der Sunda- und Bandasee, dem Chinesischen und Japanischen Meere, in der Australischen See und an der Stillen Meeresküste Amerikas.
In ihrem Auftreten und Gebaren, ihrer Lebensweise, ihren Sitten und Gewohnheiten stimmt, so viel uns bekannt, die Karette mit der Suppenschildkröte überein. Sie ist aber ein Raubtier in des Wortes vollster Bedeutung, verschmäht Pflanzennahrung wahrscheinlich gänzlich, hält sich wohl ausschließlich an tierische Stoffe und soll sich selbst großer Tiere zu bemächtigen wissen. Laut Catesby erzählen die amerikanischen Fischer, daß man oft große, von ihr halb zerbissene Muscheln finde. Neben Weichtieren bilden wahrscheinlich Fische den Hauptteil der Nahrung unseres Tieres, dessen Schwimmfertigkeit auch den Fang gewandterer Arten glaublich erscheinen läßt.
Die Fortpflanzung entspricht wohl in jeder Beziehung der aller Seeschildkröten. Ihre Eier werden ebenfalls im Sande der Küste, und zwar in denselben Monaten wie die der Suppenschildkröte abgelegt, und gleich der letzteren kehren die Karetten immer wieder zu den Stellen zurück, an denen sie geboren wurden. Im Jahre 1826 wurde, laut Tennent, eine Karette in der Nähe von Hambangtotte gefunden, die in einer ihrer Flossen einen Ring trug, den ihr dreißig Jahre früher ein holländischer Offizier genau an derselben Stelle beim Eierlegen eingeheftet hatte.
Diese treue, um nicht zu sagen hartnäckige Anhänglichkeit der Tiere an den Ort ihrer Geburt hat die beklagenswerte Folge, daß sie in ersichtlicher Weise abnehmen. Denn auch ihnen stellt der Mensch mit der nur ihm eigenen Unerbittlichkeit und Rücksichtslosigkeit nach. Ihr Fleisch wird zwar nur von den Eingeborenen der von ihr besuchten Gelände, nicht aber von Europäern gegessen, weil es Durchfall und Erbrechen verursacht oder Beulen und Geschwüre hervorruft, dagegen nach Ansicht der Indianer und Amerikaner auch wieder vor andern Krankheiten bewahren soll; allein man fängt auch die Karetten weder des Fleisches, noch der nach Klunzingers Ansicht faden, nach anderer Meinung höchst wohlschmeckenden Eier, sondern des Pads oder Krots wegen, von dem eine ausgewachsene zwei bis acht Kilogramm liefern kann. Auch bei Gewinnung dieses kostbaren Handelsgegenstandes werden abscheuliche Grausamkeiten verübt. Das Pad löst sich nur, wenn es bedeutend erwärmt wurde, leicht von dem Rückenpanzer ab; die beklagenswerte Karette wird also über einem Feuer aufgehängt und so lange geröstet, bis jene Wirkung erzielt wurde. Die Chinesen, die einsahen, daß das Krot durch trockene Wärme leicht verdorben werden kann, bedienen sich gegenwärtig des kochenden Wassers zu dem gleichen Zwecke. Nach überstandener Qual gibt man die Karette wieder frei und läßt sie dem Meere zulaufen, da man glaubt, daß sich das Pad wieder erzeuge. Möglich ist es wohl, daß eine derart geschundene Karette noch fortlebt; schwerlich aber wird sie mehr als einmal gemartert werden; denn so umfassend dürfte die Ersatzfähigkeit des Tieres denn doch nicht sein, daß ihr Schild mit neuen Platten sich decken soll.
Das Pad übertrifft nicht bloß hinsichtlich seiner Schönheit und Güte jede andere Hornmasse, sondern läßt sich auch leicht zusammenschweißen. Es genügt, die einzelnen Tafeln, die ungleich dick und spröde sind, in siedend heißes Wasser zu tauchen und sie dann zwischen Holz- oder Metallplatten zu pressen. Bei hinreichendem Druck kleben sie so fest aneinander, daß man die einzelnen Teile nicht mehr unterscheiden kann, behalten auch jene ihnen im erweichten Zustande beigebrachte Form, nachdem sie langsam erhärtet sind, vollkommen bei und eignen sich somit vortrefflich zu Dosen und dergleichen. Selbst die Abschabsel werden noch benutzt, da man mit ihnen die Vertiefung zwischen den einzelnen Tafeln ausfüllt und sie wieder in heißem Wasser so lange preßt, bis sie sich mit jenen innig verbunden haben. Der des Pads entkleidete Rückenschild wird ebenfalls hier und da verwendet, so, laut Klunzinger, von den arabischen Schiffern zum Ausputz ihrer Barken; das aus dem Fett geschmolzene Schildkrötenöl endlich gilt sogar in den Augen einzelner Europäer als wahres Wundermittel. Karettschildkröten gelangen ebenso oft als Suppenschildkröten lebend auf unsern Markt, können daher ohne erhebliche Kosten erworben werden und dauern bei geeigneter Pflege recht gut in Gefangenschaft aus. Klunzinger hielt, wie er mir brieflich mitteilt, während seines Aufenthaltes am Roten Meere wiederholt einige Karetten in einem mit der See in Verbindung stehenden Brunnen, in dem sie sich von Muscheln zu ernähren schienen, fand jedoch, daß die Tiere stets eingingen, wenn im Frühjahre das Wasser besagten Brunnens sich zu erwärmen begann. Diese Mitteilung ist auffallend, weil anderseits beobachtet wurde, daß auch Seeschildkröten mäßig erwärmtes Wasser verlangen, wenn sie sich munter zeigen, überhaupt gedeihen sollen. Sie bedürfen unter solchen Umständen nicht einmal unbedingt Seewasser. Fischer hat junge Seeschildkröten mit bestem Erfolge selbst in süßem Wasser gehalten und mit Wasserasseln und Flohkrebsen mühelos ernährt. Ich habe mehrere von ihnen gepflegt und sie sehr lieb gewonnen. Anfänglich erschienen sie mir allerdings langweilig. Des Wassers entwöhnt, bemühten sie sich längere Zeit, bevor es ihnen gelang, in die Tiefe des ihnen gebotenen Beckens hinabzusteigen, und lagen, wenn sie endlich in ihrem Elemente wieder heimisch geworden waren, tagelang auf einer und derselben Stelle; dies aber änderte sich, wenn sie zu Kräften gekommen waren. Von der Bissigkeit, die man gefangenen Alten ihrer Art nachsagt, habe ich bei meinen jungen Pfleglingen auch dann nichts bemerkt, wenn sie durch reichliche Fütterung bereits wieder erstarkt waren. Sie verursachen, falls man sie in nicht zu kaltes, das heißt unter zehn Grad Réaumur anzeigendes Wasser setzt, wenig Umstände, nehmen bald Nahrung zu sich, dieselbe dem Pfleger auch wohl aus der Hand oder Zange, greifen, trotzdem sie Fischfleisch begieriger als jedes andere Futter verzehren, die in dem Becken umherschwimmenden Fische nicht an und entzücken jeden Beschauer durch ihre wundervollen Bewegungen. Der Vergleich mit fliegenden Raubvögeln drängt sich jedem auf, der sie schwimmen sieht. Langsam, aber stetig bewegen sie ihre Flossen, und ruhig und gleichmäßig gleitet der Leib in jeder Richtung durch die Schichten des Wassers. Kein einziges mir bekanntes Mitglied anderer Familien schwimmt wie sie, wie die Seeschildkröten überhaupt. Niemals nimmt man Hastigkeit an ihnen wahr; scheinbar spielend teilen sie die Flüssigkeit um sich her; und dennoch legen sie in derselben Zeit wie eine kleine, heftig arbeitende Wasserschildkröte die gleiche Strecke zurück. Ihr Schwimmen ist ein Schweben im Wasser.