
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Der erste eingehende Bericht über den Tarpan rührt meines Wissens von Samuel Georg Gmelin her und begründet sich auf Beobachtungen, welche genannter Forscher in den Jahren 1768 und 1769 sammeln konnte; weitere Nachrichten danken wir Pallas, welcher vier Jahre später Gmelins Spuren folgte. Beide äußern sich ziemlich übereinstimmend. »Vor einigen zwanzig Jahren«, sagt der erstgenannte, »gab es hier, in der Nachbarschaft von Woromesch, wilde Pferde genug; sie wurden aber, weil sie so vielen Schaden anrichteten, immer weiter in die Steppen gejagt und gar oft zerstreut.« Gmelin erzählt hierauf, wie er von dem Vorhandensein der Thiere neuere Nachricht erhalten, daraufhin zur Jagd ausgezogen sei, in der Nähe der kleinen Stadt Bobrowsk sie und in ihrer Gesellschaft eine russische Stute auch wirklich gesehen, endlich, nachdem man den führenden Hengst getödtet, außer zwei erlegten Stuten auch ein lebendes Füllen in seine Gewalt bekommen habe, schildert Gestalt und Färbung, Auftreten und Wesen des Tarpan und schließt wie folgt. »Es ist doch artig, zu wissen, es befinden sich noch in Europa wilde Pferde. Könnte man nicht, weil die wilden Pferde beinahe halb Pferde, halb Esel sind, auf den Gedanken kommen: sind nicht letztere ausgeartete Pferde, durch die Zucht zu Eseln geworden? Machen also zahme, wilde Pferde und Esel nicht eine einzige allgemeine Rasse aus? Von den beiden ersten ist gar kein Zweifel; denn sie begatten sich, und die Bastarde sind fruchtbar. Was die letzteren betrifft, so müßte man die Eigenschaften der Maulthiere genauer kennen etc.« Auch Pallas hält Tarpan und Pferd für gleichartig. »Ich fange immer mehr an zu muthmaßen«, sagt er, »daß die in der Jaikischen und Donischen Steppe sowie auch in der Baraba herumschweifenden wilden Pferde großentheils nichts anderes als Nachkömmlinge verwilderter kirgisischer und kalmückischer Pferde oder vordem hier umherziehenden Hirtenvölkern gehöriger Hengste sind, welche theils einzelne Stuten, theils ganze Herden entführt und mit selbigen ihre Art fortgepflanzt haben.« »Zu Anfange der fünfziger Jahre«, so schreibt mir Freund Radde, »bezeichnet man östlich vom unteren Dnjepr mit dem Namen Tarpan ein Pferd von brauner Farbe, plumpem Baue, kleinem Wuchse, schwerfälligem Kopfe und etwas bogigem Umrisse des Schnauzentheils. Dasselbe wurde dort nicht als verwildert, sondern als wild angesehen. Nach Aussage der Herren Vasell, welche am unteren Dnjepr große Besitzungen hatten und durchaus zuverlässige Leute waren, sollte es in kleinen Trupps in den Steppen sich aufhalten und gejagt werden. Uebereinstimmend mit diesen Berichten fand ich die Mittheilungen der Schweizer Merz und Filibert auf dem Gute Atimanai am Assow'schen Meere, nicht weit von der so blühenden Ansiedelung der Mennoniten und Würtemberger. Auch hier halten die eingeborenen und eingewanderten Bewohner das Thier für ein wildes. Ich schließe mich diesen Ansichten an. Es liegen uns aus den weiten Steppengebieten um Dnjepr und Don keine sicheren Nachrichten vom Verwildern der Pferde vor, und wir sind somit nicht berechtigt, Rückschlüsse zu ziehen, welche zur Aufhellung der Frage beitragen könnten. Im Tarpan finden wir die Eigenschaften alle, welche andere wilde Arten der Pferdefamilie besitzen. Wäre er nur ein durch Geschlechter verwildertes Pferd, so würde ihm wohl eine oder die andere der edleren Eigenschaften und Formen geblieben sein. Dies ist jedoch nicht der Fall, und deshalb erscheint es mir nicht unwahrscheinlich, daß wir im Tarpan es wirklich mit einer wilden Pferdeart zu thun haben, und zwar mit der einzigen, welche dem gezüchteten Hauspferde tatsächlich nahe steht. Wichtig wäre es zu wissen, inwieweit die amerikanischen verwilderten Pferde, verglichen mit dem Tarpan, von dem spanischen Pferde in ihrer Körpergestaltung abweichen, beziehentlich, inwieweit sie dem Tarpan nahe kommen. Hierdurch würden wir vielleicht in den Stand gesetzt werden, über diese Frage ein richtigeres Urtheil zu gewinnen.«
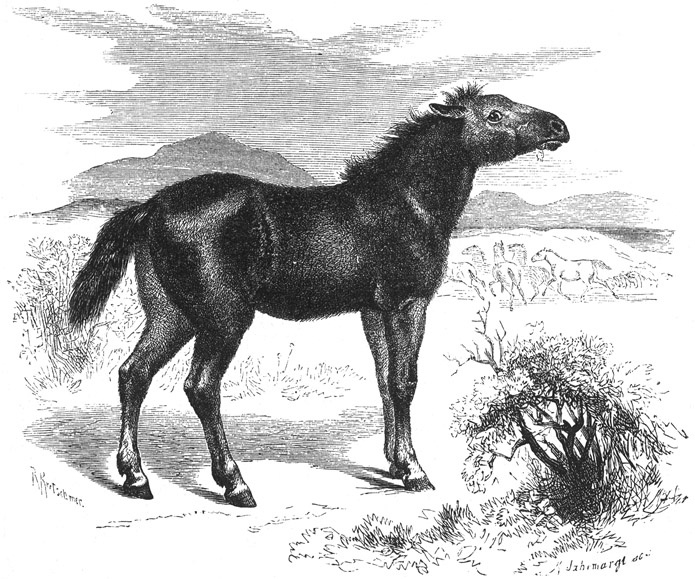
Tarpan. 1/25 natürl. Größe.
Früher nahm man an, daß der Tarpan alle Steppen Südrußlands und Mittelasiens bevölkere und zumal in der hohen Gobi, in den Waldungen des obern Hoangho und auf den Hochgebirgen im Norden Indiens vorkomme. Dem widerspricht Radde. »Soweit ich Mittelasien von Sibirien aus bereiste«, schreibt er mir ferner, »habe ich von den Eingeborenen nirgends Nachrichten über den Tarpan erfahren können. Am Nordende der hohen Gobi, wo der Dschiggetai noch lebt und zumal im Winter, gegen Norden wandernd, noch regelmäßig erscheint, fehlt der Tarpan entschieden.«
Ueber die Lebensweise berichten Gmelin und andere etwa das nachstehende. Man begegnet dem Tarpan immer in Herden, welche mehrere hundert Stück zählen können. Gewöhnlich zerfällt die Hauptmenge wieder in kleinere, familienartige Gesellschaften, denen je ein Hengst vorsteht. Diese Herden bewohnen weite, offen- und hochgelegene Steppen und wandern von Ort zu Ort, gewöhnlich dem Winde entgegen. Sie sind außerordentlich aufmerksam und scheu, schauen mit hoch erhobenem Kopfe umher, sichern, spitzen das Gehör, öffnen die Nüstern und erkennen regelmäßig zu rechter Zeit noch die ihnen drohende Gefahr. Der Hengst ist der alleinige Beherrscher der Gesellschaft. Er sorgt für deren Sicherheit, duldet aber auch keine Unregelmäßigkeiten unter seinen Schutzbefohlenen. Junge Hengste werden von ihm vertrieben und dürfen, solange sie sich nicht selbst einige Stuten erschmeichelt oder erkämpft haben, nur in gewisser Entfernung der großen Herde folgen. Sobald dieser irgend etwas auffällt, beginnt der Hengst zu schnauben und die Ohren rasch zu bewegen, trabt mit hochgehaltenem Kopfe einer bestimmten Richtung zu, wiehert gellend, wenn er Gefahr merkt, und nun jagt die ganze Herde im tollsten Galopp davon. Manchmal verschwinden die Thiere wie durch Zauberschlag: sie haben sich in irgend einer tiefen Einsenkung geborgen und warten nun ab, was da kommen soll. Vor Raubthieren fürchten sich die kampfesmuthigen und kampflustigen Hengste nicht. Auf Wölfe gehen sie wiehernd los und schlagen sie mit den Vorderhufen zu Boden. Die Fabel, daß sie sich mit dem Kopfe im Mittelpunkte eines Kreises zusammen stellen und beständig mit den Hinterhufen ausschlagen sollen, ist längst widerlegt; wohl aber bilden die Hengste einen Kreis um die Stuten und Fohlen, wenn einer jener feigen Räuber sich naht. Unter sich kämpfen die Tarpanhengste mit Ingrimm und zwar ebensogut durch Beißen wie durch Schlagen. Junge Hengste müssen sich ihre Gleichberechtigung immer durch hartnäckige Zweikämpfe erkaufen.
Die pferdezüchtenden Steppenbewohner fürchten die Tarpane noch mehr als die Wölfe, weil jene ihnen oft großen Schaden zufügen. Nach den von Gmelin gesammelten Nachrichten halten sie sich gern in der Nähe der großen Heuschober auf, welche von den russischen Bauern oft in weiter Entfernung von den Ortschaften gestapelt werden und »lassen es sich bei denselben so belieben, daß zwei im Stande sind, einen in einer Nacht leer zu machen«. Gmelin meint, daß hieraus ihre Fettigkeit und kugelrunde Gestalt sich leicht erklären lasse. »Dies aber«, fährt er fort, »ist nicht der einzige Schaden, welchen sie anrichten. Der Tarpanhengst ist auf die russischen Stuten sehr erpicht, und wofern er einer habhaft werden kann, so wird er diese, ihm so erwünschte Gelegenheit nicht aus den Händen lassen, sondern sie gewiß mit sich fortschleppen. Daher erwähnte ich auch eines russischen Pferdes, welches unter denen wilden befindlich war. Es erhellt aber noch mehr aus folgendem: Ein wilder Hengst erblickte einmal einen zahmen Hengst mit zahmen Stuten. Nur um die letzteren war es ihm zu thun; weil aber der erste nicht damit zufrieden sein wollte, so geriethen beide in heftigen Streit. Der zahme Hengst wehrte sich mit den Füßen, der wilde aber biß seinen Feind mit den Zähnen, brachte es auch, aller Gegenvertheidigung ohngeachtet, so weit, daß er ihn zu todt biß und sodann seine verlangten Stuten mit sich nehmen konnte. Es ist daher kein Wunder, wenn die Bauern alle Mittel zu ihrer Verteidigung und seiner Verjagung anwenden. Wenn ein wilder Hengst eine zahme Stute bespringt, so kommt eine Zwischenart heraus, die etwas vom zahmen und etwas vom wilden Pferde hat. Die russische Stute, welche wir mit der wilden erlegt hatten, scheint die Mutter des Bastards, den wir lebendig bekommen haben, gewesen zu sein; denn erstlich war sie schon alt und dabei noch überdies schwarz; der Bastard aber hatte eine mausbraune, mit der schwarzen gemischte Farbe. Sein Schweif war schon mehr haarigt, doch noch nicht ganz, sein Kopf dick, die Mähne kurz und kraus, der Leib der Gestalt nach mehr länglich; die Haare befanden sich wie bei den zahmen Pferden, sowohl der Länge als der Dichtigkeit nach. Es war eine Stute, deren man aber ohne Gefahr nicht nahe beikommen durfte.«
Der Tarpan ist schwer zu zähmen: es scheint, als ob das Thier die Gefangenschaft nicht ertragen könne. Sein höchst lebendiges Wesen, seine Stärke und Wildheit spotten sogar der Künste der pferdekundigen Mongolen. Auch Fohlen erlangen nur einen geringen Grad von Zahmheit, bleiben vielmehr selbst bei der sorgfältigsten Behandlung wild und stutzig. Als Reitpferde sind solche Wildlinge nicht zu gebrauchen, sie lassen sich höchstens mit einem zahmen Pferde vor den Wagen spannen und machen auch hier dem mitarbeitenden Rosse und dem Lenker viel zu schaffen.
»Mein liebenswürdiger Freund Josef Schatiloff«, bemerkt Radde noch, »erhielt Ende der fünfziger Jahre einen lebenden Tarpan und sandte ihn an die kaiserliche Akademie der Wissenschaften, von welcher er dem hochverdienten Akademiker von Brandt überantwortet wurde. Bei regelmäßiger Stallfütterung benahm sich der Tarpan ganz gut, sobald man an ihn keine weiteren Anforderungen stellte, als daß er sein Heu täglich fresse, war und blieb aber in allem übrigen ein tückisches, launenhaftes Thier, welches starrsinnig und beharrlich bei jeder Gelegenheit zu schlagen und zu beißen versuchte und sich auch der sanftesten Behandlung unzugänglich zeigte. Da man ihn an maßgebender Stelle für ein nur verwildertes Pferd hielt, verschenkte man ihn nach geraumer Zeit an einen Pferdeliebhaber.«
Wegen des nicht unbedeutenden Schadens, welchen der Tarpan den freien Stutereien durch Wegführen der Pferde zufügt, jagt man ihn mit Eifer und Leidenschaft. Nach Radde gewordenen Mittheilungen wählt man am Dnjepr vorzugsweise den Frühling zur Jagdzeit, weil das in diesem Jahresabschnitte oft weite Strecken der Steppe überziehende Glatteis der raschen Bewegung unserer Wildpferde hinderlich wird, und die scharfbeschlagenen Jagdpferde sie dann leichter einholen können. Am Assow'schen Meere jagt man im Spätwinter, mit Erfolg jedoch nur dann, wenn man auf gewisse Entfernungen frische Pferde in der Steppe aufstellt und bei der Jagd diese mit den durch die unermüdlichen Tarpane bereits ermatteten wechseln kann. Vor allen fahndet man auf den Hengst, weil die Stuten, wenn jener fällt, sich zersprengen und dann um so leichter den Jägern zur Beute werden.
Vorstehende Angaben lassen die Abstammungsfrage des Pferdes ungelöst. Gmelin wagt nicht, wie es scheinen will, eine bestimmte Ansicht auszusprechen, und Radde's Auffassung steht jener des scharfsinnigen Pallas entgegen. Das Gebaren des Tarpan ist für sein ursprüngliches Sein nicht beweisend, denn Pferde verwildern leicht und rasch. So lehren uns überzeugend die unzählbaren Herden, welche gegenwärtig die Steppengebiete Südamerikas bevölkern. Werfen wir unter Leitung bewährter Führer zunächst einen Blick auf sie.
»Die im Jahre 1535 gegründete Stadt Buenos-Ayres«, sagt Azara, »wurde später verlassen. Die ausziehenden Einwohner gaben sich gar nicht die Mühe, ihre sämmtlichen Pferde zu sammeln. So blieben deren fünf bis sieben zurück und sich selbst überlassen. Als im Jahre 1580 dieselbe Stadt wieder in Besitz genommen und bewohnt wurde, fand man bereits eine Menge verwilderter Pferde, Nachkommen der wenigen ausgesetzten, als Wildlinge vor. Schon im Jahre 1596 wurde es jedem erlaubt, diese Pferde einzufangen und für sich zu gebrauchen. Dies ist der Ursprung der unzählbaren Pferdeherden, welche sich im Süden des Rio de la Plata umhertreiben.« Die Cimarrones, wie diese Pferde genannt werden, leben jetzt in allen Theilen der Pampas in zahlreichen Herden, von denen manche ungefähr zwölftausend Stücke zählen mögen. Jeder Hengst sammelt sich so viele Stuten als er kann, bleibt aber mit ihnen in Gemeinschaft der übrigen Mitglieder der Herde. Einen besonderen Anführer hat diese nicht. Sie sind ebensogroß und stark wie die Hauspferde, aber nicht so schön, weil Kopf und Beine dicker, Hals und Ohren länger zu sein pflegen. Alle diese Pferde haben braune oder schwarze Färbung; Schecken fehlen gänzlich, und die schwarzen unter ihnen sind so selten, daß man wohl annehmen darf, Braun müsse ihre eigentliche Farbe gewesen sein.
Die Cimarrones belästigen und schaden, weil sie nicht nur unnützer Weise gute Weide abfressen, sondern auch die Hauspferde entführen. Wenn sie letztere sehen, eilen sie in vollem Laufe herbei, begrüßen ihre Artgenossen freundlich mit Gewieher, schmeicheln ihnen und verleiben die willfährigen ohne großen Widerstand ihren Gesellschaften ein. Reisende gerathen nicht selten in Verlegenheit durch jene ihren Reitthieren gefährlichen Entführer. Deshalb ist stets jemand auf der Hut und verscheucht die Wildlinge. Sie erscheinen nicht in Schlachtlinie, sondern wie die Indianer, eines hinter dem anderen, aber so dicht, daß die Reihe niemals unterbrochen wird. Zuweilen laufen sie in weiten Kreisen um den Menschen und seine Pferde herum und lassen sich nicht leicht verscheuchen; ein andermal gehen sie vorüber und kehren nicht zurück. Manche rennen wie Blinde heran, oft wie toll in die Wagen hinein. Zum Glück erscheinen sie nicht bei Nacht, sei es, weil sie nicht gut sehen, oder weil sie die zahmen Pferde nicht verspüren. Mit Verwunderung bemerkt man, daß die Wege, welche sie überschreiten, oft auf mehrere Kilometer hin mit ihrem Miste bedeckt sind. Es unterliegt keinem Zweifel, daß sie die Straßen aufsuchen, um ihre Nothdurft zu verrichten. Und weil nun alle Pferde die Eigenheit haben, den Koth anderer ihrer Art zu beriechen und durch ihren eigenen zu vermehren, wachsen diese Miststätten zu förmlichen Bergen an.
Die Wilden in den Pampas essen das Fleisch der Cimarrones, namentlich das von Fohlen und Stuten herrührende. Sie fangen sich auch manche, um sie zu zähmen; die Spanier hingegen machen kaum Gebrauch von ihnen. Nur da, wo Holz mangelt, tödten sie bisweilen eine fette Stute, um das Lagerfeuer mit dem Knochenfette des Thieres zu verstärken. Höchst selten fängt man einen Wildling, um ihn zu zähmen. Zu diesem Behufe bindet man ihn an einen Pfahl, läßt ihn drei Tage hungern und dursten und reitet ihn dann; doch muß man ihn vorher auch gleich verschneiden, weil nur die Walachen wirklich zahm werden. Um Cimarrones zu fangen, reitet man an eine Herde hinan und schleudert die Wurfkugeln unter sie, gewöhnlich so, daß man die Beine des erwählten Thieres verwickelt und es so zu Falle bringt. Dann wird es gefesselt und an einer etwa zwanzig Meter langen, festen Schnur nach Hause geführt. Die Gutsbesitzer verfolgen die Wildlinge, wo sie nur können, weil sie sonst ihrer eigenen Pferde nicht sicher sind.
Tschudi, welcher anfangs der sechziger Jahre die Pampas bereiste, gibt eine mit vorstehender Beschreibung wenig übereinstimmende Schilderung dieser Pferde. »Vergebens«, sagt er, »sucht man, wenigstens in diesem Theile der Pampas, nach einem einheitlichen Charakter der Pferde; man findet nichts als ein buntes Gemisch von Formen, Größenverhältnissen und Farben. Besonders häufig bemerkte ich bunte Schecken. Ich hatte oft Gelegenheit, viele Hunderte zusammengetriebener Pferde zu beobachten, gestehe aber, daß ich jedesmal vergeblich nach dem von verschiedenen Reisenden erwähnten Typus der Pampaspferde gesucht habe. Kopf, Hals und Widerrist haben mir durchaus keine Anhaltspunkte gegeben, um einen einheitlichen Charakter dieser Thiere herauszufinden. Ich will nicht in Abrede stellen, daß vielleicht ein solcher bei den Pampaspferden südlich von Buenos Ayres vorkomme; in den von mir durchreisten Theilen des Landes ist dies jedoch nicht der Fall.«
In Paraguay finden sich keine verwilderten Pferde, und zwar, wie Rengger vermuthet, wegen einer in den Pampas von Buenos Ayres fehlenden Schmeißfliege, welche ihre Eier in den blutigen Nabel der Füllen legt und hierdurch tödtliche Geschwüre verursacht. Auch ist in den Pampas das Futter reichlicher als in Paraguay. Der Zustand der Pferde des letzteren Landes unterscheidet sich aber nicht wesentlich von dem jener Wildlinge. Die Thiere, welche man Mustangs nennt, werden so vernachlässigt, daß sie förmlich ausarten. Sie sind mittelhoch, haben einen großen Kopf, lange Ohren und dicke Gelenke; nur der Hals und der Rumpf sind ziemlich regelmäßig gebaut. Die Behaarung ist im Sommer kurz, im Winter lang. Mähne und Schwanz sind immer dünn und kurz. Nur in einzelnen Meiereien findet man noch Pferde, welche an ihre edlen Ahnen erinnern. An Schnelligkeit und Gewandtheit stehen die einen wie die anderen den andalusischen Pferden nicht im geringsten nach, und an Ausdauer übertreffen sie diese bei weitem. Rengger versichert, oft und selbst während der Hitze mit einem Pferde acht bis sechzehn Stunden fast in ununterbrochenem Galopp zurückgelegt zu haben, ohne daß hieraus irgend ein Nachtheil für das Thier erwachsen wäre.
Die Pferde Südamerikas bringen das ganze Jahr unter freiem Himmel zu. Alle acht Tage treibt man sie einmal zusammen, damit sie sich nicht versprengen, untersucht ihre Wunden, reinigt sie, bestreicht sie mit Kuhmist und schneidet von Zeit zu Zeit, etwa alle drei Jahre, den Hengsten die Mähne und den Schwanz ab. An Veredelung denkt niemand. Die Weiden sind schlecht; eine einzige Grasart bedeckt den Boden. Im Frühjahre treibt dieses Gras stark hervor, verursacht aber dann den Pferden Durchfall und ermattet sie. Im Sommer und Herbste erholen sie sich wieder und werden auch wohl fett; aber ihre Wohlbeleibtheit verschwindet, sobald sie gebraucht werden. Der Winter ist die schlimmste Zeit für sie. Das Gras ist verwelkt; die Thiere müssen sich daher mit den dürren, durch den Regen ausgelaugten Halmen begnügen. Diese Nahrung erregt auch in ihnen das Bedürfnis nach Salz. Man sieht sie stundenlang an den Sulzen verweilen, und hier die salzhaltige Thonerde belecken. Bei Stallfütterung bedürfen sie des Salzes nicht mehr. Besser gefütterte und gehaltene Pferde gewinnen schon nach wenigen Monaten kurzes und glänzendes Haar, festes Fleisch und stolze Haltung.
»Gewöhnlich«, sagt Rengger, »leben die Pferde paarweise in einem bestimmten Gebiete, an welches sie von Jugend auf gewöhnt worden sind. Jedem Hengste gibt man zwölf bis achtzehn Stuten, welche er zusammenhält und gegen fremde Hengste vertheidigt. Gesellt man ihm zu viele Stuten zu, so hütet er diese nicht mehr. Die Füllen leben mit ihren Müttern bis ins dritte oder vierte Jahr. Diese zeigen für jene, so lange sie noch saugen, große Anhänglichkeit, und vertheidigen sie zuweilen sogar gegen den Jaguar. Einen eigenen Kampf haben sie nicht selten mit den Maulthieren zu bestehen, bei denen sich zu Zeiten eine Art von Mutterliebe regt. Dann suchen diese durch List oder Gewalt Füllen zu entführen. Sie bieten ihnen wohl ihr milchleeres Euter zum Saugen dar; aber die armen Füllen gehen dabei natürlich zu Grunde. Wenn die Pferde etwas über zwei oder drei Jahre alt sind, wählt man unter den jungen Hengsten einen aus, theilt ihm junge Stuten zu und gewöhnt ihn, mit denselben in einem besonderen Gebiete zu weiden. Die übrigen Hengste werden verschnitten und in eigenen Trupps vereinigt. Alle Pferde, welche zu einer Truppe gehören, mischen sich nie unter andere und halten so fest zusammen, daß es schwer fällt, ein weidendes Pferd von den übrigen zu trennen. Werden sie miteinander vereinigt, z. B. beim Zusammentreiben aller Pferde einer Meierei, so finden sie sich nachher gleich wieder auf. Der Hengst ruft wiehernd seine Stuten herbei, die Walachen suchen sich gegenseitig auf, und jeder Trupp bezieht wieder seinen Weideplatz. Tausend und mehr Pferde brauchen keine Viertelstunde, um sich in Haufen von zehn bis dreißig Stück zu zertheilen. Ich glaube bemerkt zu haben, daß Pferde von gleicher Größe oder von der nämlichen Farbe sich leichter an einander gewöhnen als verschiedene, und ebenso, daß die fremden, aus der Banda-Oriental und aus Entre-Rios eingeführten Pferde sich vorzugsweise zu einander und nicht zu inländischen gesellen. Die Thiere zeigen übrigens nicht allein für ihre Gefährten, sondern auch für ihre Weiden große Anhänglichkeit. Ich habe welche gesehen, die aus einer Entfernung von achtzig Stunden auf die altgewohnten Plätze zurückgekehrt waren. Um so sonderbarer ist die Erscheinung, daß zuweilen die Pferde ganzer Gegenden aufbrechen und entweder einzeln oder haufenweise davonrennen. Dies geschieht hauptsächlich, wenn nach anhaltender trockener Witterung plötzlich starker Regen fällt, und wahrscheinlich aus Furcht vor dem Hagel, welcher nicht selten das erste Gewitter begleitet.
»Die Sinne dieser fast wildlebenden Thiere scheinen schärfer zu sein als die europäischer Pferde. Ihr Gehör ist äußerst fein; bei Nacht verrathen sie durch Bewegung der Ohren, daß sie das leiseste, dem Reiter vollkommen unhörbare Geräusch vernommen haben. Ihr Gesicht ist, wie bei allen Pferden, ziemlich schwach; aber sie erlangen durch ihr Freileben große Uebung, die Gegenstände aus bedeutender Entfernung zu unterscheiden. Vermittels ihres Geruches machen sie sich mit ihren Umgebungen bekannt. Sie beriechen alles, was ihnen fremd erscheint. Durch diesen Sinn lernen sie ihren Reiter, das Reitzeug, den Schuppen, wo sie gesattelt werden etc., kennen, durch ihn wissen sie in sumpfigen Gegenden die bodenlosen Stellen auszumitteln, durch ihn finden sie in dunkler Nacht oder bei dichtem Nebel den Weg nach ihrem Wohnorte oder nach ihrer Weide. Gute Pferde beriechen ihren Reiter im Augenblicke, wann er aufsteigt, und ich habe solche gesehen, welche denselben gar nicht aufsteigen ließen oder sich seiner Leitung widersetzten, wenn er nicht einen Poncho oder Mantel mit sich führte, wie ihn die Landleute, welche die Pferde bändigen und zureiten, immer tragen. Falls sie durch den Anblick irgend eines Gegenstandes erschreckt werden, beruhigt man sie am leichtesten, wenn man denselben von ihnen beriechen läßt. Auf größere Entfernung hin wittern sie freilich nicht. Ich habe selten ein Pferd gesehen, welches einen Jaguar auf fünfzig und noch weniger Schritte gewittert hätte. Sie machen daher in den bewohnten Gegenden von Paraguay die häufigste Beute dieses Raubthieres aus. Wenn in trockenen Jahren die Quellen, aus denen zu trinken sie gewohnt sind, versiegen, kommen sie eher vor Durst um, als daß sie andere aufsuchten, während das Hornvieh dem Wasser oft bis zehn Stunden weit nachgeht. Der Geschmack ist bei ihnen verschieden; einige gewöhnen sich leicht an Stallfutter und lernen allerlei Früchte und selbst getrocknetes Fleisch fressen, andere verhungern lieber, ehe sie außer dem gemeinen Grase andere Nahrung berühren. Das Gefühl ist durch ihr Leben unter freiem Himmel, durch die Qual, welche Mücken und Bremsen ihnen zufügen, von Jugend auf sehr abgestumpft.
»Das paraguanische Pferd ist gewöhnlich gutartig; es wird aber oft durch gewaltsame Behandlung bei der Bändigung verdorben. Wenn nämlich das Pferd ein Alter von vier bis fünf Jahren erreicht hat, wird es eingefangen, an einen Pfahl gebunden, und trotz seines Widerstrebens gesattelt und gezäumt. Nun wird es vom Pfahle losgemacht; im nämlichen Augenblicke aber schwingt sich ein Pferdebändiger, welcher mit sehr großen und scharfen Sporen und einer starken Peitsche bewaffnet ist, auf seinen Rücken und tummelt das arme Geschöpf unter Sporenstreichen und Peitschenhieben so lange auf dem Felde herum, bis es sich vor Müdigkeit nicht mehr widersetzen kann und der Lenkung seines Reiters folgt. Man wiederholt diese Uebungen von Zeit zu Zeit, und das Pferd heißt zahm, sobald es keinen Bocksprung mehr macht. Es ist erklärlich, daß bei einer solchen Behandlung sehr viele Pferde störrisch und bösartig werden, ausschlagen, Seitensprünge machen, sich bäumen bis zum Ueberschlagen, kurz, den Reiter abzuwerfen suchen; bei sanfter Behandlung dagegen wird das Pferd, selbst wenn man es früher gemißhandelt hatte, äußerst lenksam und zuthunlich, läßt sich auf der Weide leicht fangen und unterzieht sich willig den stärksten Anstrengungen. Kranke oder schwächliche Pferde und auch solche, welche als Füllen von einem Jaguar verwundet wurden, sind fast unbrauchbar; jene können den Ansprüchen der Südamerikaner nicht entsprechen, diese entsetzen sich vor jedem lebenden Wesen.
»Bewunderungswürdig ist das Gedächtnis dieser Pferde. Einzelne, welche nur einmal den Weg von Villa Real nach den Missionen gemacht hatten, kehrten aus den letzteren nach mehreren Monaten auf dem nämlichen, mehr als fünfzig Meilen langen Wege nach Villa Real zurück. Wenn in der Regenzeit des Herbstes alle Wege voller Wasser, voller Pfützen und bodenloser Stellen und alle Bäche angeschwollen sind, wird doch ein gutes Pferd, welches diese Wege schon einige Male zurückgelegt hat, seinen Reiter nicht nur bei Tage, sondern auch bei Nacht sicher durch alle diese oft gefährlichen Stellen tragen. Wenn es nicht angetrieben wird, geht es immer mit größter Bedächtigkeit zu Werke, und dies umsomehr, je weniger ihm die Gegend bekannt ist. In sumpfigen Stellen beriecht es bei jedem Schritte den Boden und untersucht ihn beständig mit den Vorderhufen. Diese Bedächtigkeit ist keineswegs Mangel an Muth; denn das paraguanische Pferd ist sehr beherzt und stürzt sich, wenn es von einem kräftigen Reiter gelenkt wird, ohne Zaudern in jede Gefahr. Es geht dem wüthenden Stiere und selbst dem Jaguar entgegen, springt vom schroffen Ufer in die Flüsse und durchschneidet im vollen Laufe die Feuerlinie einer brennenden Steppe.
»Im ganzen sind die Pferde wenigen Krankheiten unterworfen. Wenn sie gute Nahrung erhalten und nicht übermäßig angestrengt werden, erreichen sie ein ebenso hohes Alter wie die Pferde in Europa; da ihnen aber gewöhnlich weder gutes Futter, noch gute Behandlung zu theil wird, kann man ein zwölfjähriges Pferd schon für alt ansehen. Die Bewohner Paraguays nützen übrigens die Pferde durchaus nicht in dem Grade wie wir. Sie halten sie hauptsächlich der Fortpflanzung wegen und machen eigentlich bloß von den Walachen Gebrauch. Dennoch findet man nirgends mehr berittene Leute als in Paraguay. Das Pferd dient dazu, der angeborenen Trägheit seines Herrn zu fröhnen, indem dieser hundert kleine Verrichtungen, welche er weit schneller zu Fuß vornehmen würde, seiner Bequemlichkeit wegen zu Pferde ausführt. Es ist ein gewöhnlicher Ausruf der Paraguaner: ›Was wäre der Mensch ohne das Pferd!‹«
In den weiter nach Norden hin gelegenen Llanos sind die verwilderten Pferde meist zahlreicher als in den Pampas von Buenos Ayres. Ihr Leben hat uns Alexander von Humboldt in seinen herrlichen »Ansichten der Natur« mit kurzen Worten meisterhaft geschildert. »Wenn im Sommer unter dem senkrechten Strahle der niebewölkten Sonne die Grasdecke jener unermeßlichen Ebenen gänzlich verkohlt ist und in Staub zerfällt, klafft allmählich der Boden auf, als wäre er von mächtigen Erdstößen zerrissen. In dichte Staubwolken gehüllt und von Hunger und brennendem Durste geängstet, schweifen die Pferde und Rinder umher, erstere mit langgestrecktem Halse, hoch gegen den Wind aufschnaubend, um durch die Feuchtigkeit des Luftstromes die Nähe einer noch nicht ganz verdampften Lache zu errathen. Bedächtiger und verschlagener suchen die Maulthiere auf andere Art ihren Durst zu lindern. Eine kugelförmige und dabei vielrippige Pflanze, der Melonenkaktus, verschließt unter seiner stachlichen Hülle ein wasserreiches Mark. Mit den Vorderfüßen schlägt das Maulthier diese Stacheln seitwärts, um den kühlen Distelsaft zu trinken. Aber das Schöpfen aus dieser lebenden, pflanzlichen Quelle ist nicht immer gefahrlos; denn oft sieht man Thiere, welche von den Kaktusstacheln an den Hufen gelähmt sind. Folgt endlich auf die brennende Hitze des Tages die Kühlung der gleichlangen Nacht, so können die Pferde und Rinder selbst dann nicht ruhen. Die blattnasigen Fledermäuse verfolgen sie während des Schlafes und hängen sich an ihren Rücken, um ihnen das Blut auszusaugen.
»Tritt endlich nach längerer Dürre die wohlthätige Regenzeit ein, so ändert sich die Scene. Kaum ist die Oberfläche der Erde benetzt, so überzieht sich die Steppe mit dem herrlichsten Grün. Pferde und Rinder weiden im frohen Genusse des Lebens. Im hoch aufschießenden Grase versteckt sich der Jaguar und erhascht manches Pferd, manches Füllen mit sicherem Sprunge. Bald schwellen die Flüsse, und dieselben Thiere, welche einen Theil des Jahres vor Durst verschmachteten, müssen nun als Amphibien leben. Die Mutterpferde ziehen sich mit den Füllen auf die höheren Bänke zurück, welche lange inselförmig über den Seespiegel hervorragen. Mit jedem Tage verengert sich der trockene Raum. Aus Mangel an Weide schwimmen die zusammengedrängten Thiere stundenlang umher und nähren sich kärglich von der blühenden Grasrispe, welche sich über dem braungefärbten, gährenden Wasser erhebt. Viele Füllen ertrinken, viele werden von den Krokodilen erhascht, mit dem Schwanze zerschmettert und verschlungen. Nicht selten bemerkt man Pferde, welche die Spuren der Krokodile in großen Narben am Schenkel tragen. Auch unter den Fischen haben sie einen gefährlichen Feind. Die Sumpfwasser sind mit zahllosen elektrischen Aalen erfüllt. Diese merkwürdigen Fische sind mächtig genug, mit ihren gewaltigen Schlägen die größten Thiere zu tödten, wenn sie ihre Batterien auf einmal in günstiger Richtung entladen. Die Steppenstraße am Uri Tucu mußte deswegen verlassen werden, weil sie sich in einer solchen Menge in einem Flüßchen aufgehäuft hatten, daß jährlich viele Pferde durch sie betäubt wurden und in der Furt ertranken.«
Einen ungleich gefährlicheren Feind tragen die Herden in sich selbst. Zuweilen ergreift sie ein ungeheuerer Schrecken. Hunderte und tausende stürzen wie rasend dahin, lassen sich durch kein Hindernis aufhalten, rennen gegen Felsen an oder zerschellen sich in Abgründen. Den Menschen, welcher zufällig Zeuge von solch entsetzlichem Ereignis wird, erfaßt ein Grausen; selbst der kalte Indianer fühlt sein sonst so muthiges Herz furchterfüllt. Ein Dröhnen, welches immer größere Stärke erlangt und schließlich den Donner, das Brausen des Sturmes oder das Toben der Brandung übertönt, verkündet und begleitet den Vorüberzug der auf Sturmesfittigen dahinjagenden, angstergriffenen Pferde. Sie erscheinen plötzlich im Lager, stürzen sich zwischen den Feuern hindurch, über die Zelte und Wagen weg, erfüllen die Lastthiere mit tödtlichem Schrecken, reißen sie los und nehmen sie auf in ihren lebendigen Strom – für immer. So berichtet der Reisende Murray, welcher solchen Ueberfall erlebte und überlebte.
Weiter nach Norden hin vermehren die Indianer die Zahl der Feinde, welche den Wildlingen das Leben verbittern. Sie fangen sie ein, um sie als Reitthiere bei ihren Jagden zu benutzen, und quälen sie so, daß auch das muthigste Pferd nach kurzer Zeit unterliegen muß. Wie bei den Beduinen der Sahara wird auch bei den Indianern das Pferd oft die Ursache der blutigsten Kämpfe. Wer keine Pferde hat, sucht solche zu stehlen. Der Roßdiebstahl gilt bei den Rothhäuten für ehrenvoll. Banden von Dieben folgen wandernden Stämmen oder Karawanen wochenlang, bis sie Gelegenheit finden, sämmtliche Reitthiere fortzutreiben. Auch der Häute und des Fleisches wegen werden die Pferde Amerikas eifrig verfolgt. Bei Las-Nocas schlachtet man, wie Darwin berichtet, wöchentlich eine große Anzahl Stuten bloß der Häute wegen. Im Kriege nehmen die Truppenabtheilungen, welche in die Ferne gesandt werden, als einzige Nahrung Herden von Pferden mit. Diese Thiere sind ihnen auch aus dem Grunde lieber als Rinder, weil sie dem Heere größere Beweglichkeit gestatten.
Daß noch heutigen Tages Hauspferde verwildern, erfahren wir durch Przewalski. Während seiner Reisen in der Mongolei sah dieser treffliche Beobachter kleine Herden verwilderter Pferde, welche noch vor einem Jahrzehnt im Hausstande gelebt hatten, von den Bewohnern der chinesischen Provinz Gansu während der Dunganenunruhen ihrem Geschicke überlassen und binnen dieser kurzen Frist dermaßen scheu geworden waren, daß sie vor dem Menschen wie echte Wildpferde entflohen.
Aus solchen Beispielen erhellt, wie gewagt es ist, derartige Wildlinge als die Stammeltern unseres Hausthieres anzusprechen. Man hat die freilebenden Pferde unzweifelhaft falsch beurtheilt und auf ihr Vorkommen in verschiedenen Ländern mehr Gewicht gelegt, als sich rechtfertigen läßt. Aeltere Geschichtsurkunden gedenken wiederholt solcher Wildlinge, unterscheiden sie bestimmt vom Hauspferde, beschreiben sie auch wohl mehr oder minder ausführlich, fördern unsere Erkenntnis aber nicht und lassen höchstens Vermuthungen Raum. Solche Wildpferde lebten noch im dreizehnten Jahrhundert auf den dänischen Inseln, noch im sechzehnten in Polen, Preußen, Pommern; sie wurden gefangen, gezähmt und endlich ausgerottet. Letzteres läßt sich erklären; daraus folgt jedoch nicht, daß sie thatsächlich etwas anderes waren als die Tarpane, verwilderte Pferde nämlich, und daß auch die wirkliche Stammart ausgestorben sein müsse.
Waren es die alten Hyksos, welche das Pferd zuerst nach Egypten brachten, waren es asiatische Hirtenvölker überhaupt, welche das ausgezeichnetste aller Hausthiere gewannen oder, mit anderen Worten, ein Wildpferd zähmten, so müssen wir dessen ursprüngliche Heimat in Asien suchen. Daß die wilde Stammart hier gänzlich ausgestorben sein sollte, ist eine Annahme, welche, weil sie in keiner Weise unterstützt wird, als durchaus willkürlich bezeichnet werden muß. Nun kennen wir zur Zeit Innerasien zwar noch herzlich wenig, aber immerhin genau genug, um zu wissen, daß hier ein unserem Hauspferde in allen Stücken entsprechendes Wildpferd nicht lebt, und unsere Rathlosigkeit bleibt bestehen, so lange wir nach einer Urart des Pferdes suchen, wie wir sie uns ausmalen. Gedenken wir dagegen des Entstehens und Vergehens der Hausthierrassen insgemein, lassen wir die endlose Reihe von Pferderassen an unserem Auge vorüberziehen, erinnern wir uns des ins früheste Alterthum sich verlierenden Zeitraumes, binnen dessen das Pferd Hausthier des Menschen ist, so drängt sich uns der Gedanke auf, daß der Urahne des edlen Geschöpfes recht wohl auch ein von unserem heutigen Pferde erheblich verschiedenes Thier gewesen sein kann. Und dann erkennen wir diesen Urahnen wahrscheinlich leicht in dem Wildpferde, welches gegenwärtig noch alle Steppen Innerasiens bevölkert: dem Kulan, Dschiggetai oder Kiang, und wie er sonst noch genannt werden mag. Dieses keineswegs unedle Thier besitzt allerdings nicht alle Merkmale unseres Pferdes, aber auch keines, welches ihn der Stammvaterschaft unwürdig oder unfähig erscheinen lassen könnte. Man darf sagen, unser Pferd sei in ihm veranlagt. Weit mehr, als er sich vom Pferde unterscheidet, weichen die Rassen unseres Hausthieres unter einander ab. Sein Wesen und Gebaren ist gleichsam das Vorbild aller Eigenheiten des Pferdes: kein Zug seines Betragens steht im Widerspruche mit dem Auftreten des Rosses, und die Uebereinstimmung der Eigenschaften überrascht, so bald man die Lebensweise aller Pferde, welche größere Freiheit genießen, mit der seinigen vergleicht. Jedes Unterscheidungsmerkmal des Pferdes läßt sich als Ergebnis jahrtausendelanger Züchtung auffassen, die in verschiedenen Ländern mehr oder weniger gleichzeitig erfolgte Zähmung desselben ungezwungen einzig und allein durch sein ungemessenes Verbreitungsgebiet erklären. Seinen, nicht aber des Tarpans Abkömmlingen werden die Hyksos das Joch der Knechtschaft auferlegt, sie nach Egypten gebracht, sie anderen Völkern des Morgen- wie des Abendlandes, Indiens und Chinas, wie Arabiens, Persiens, Nordafrikas, Europas übermittelt haben. Beweisen, durch bestimmte Beobachtungen erhärten, läßt sich solche Annahme freilich nicht; glaublicher, um nicht zu sagen überzeugender als jede andere scheint sie mir zu sein. Sie beansprucht nicht mehr Recht, unterstützt dieses Recht aber durch triftigere Gründe als jede andere.
Der Kulan der Kirgisen, Dschiggetai, zu Deutsch »Langohr«, der Mongolen insgemein, Dschan der Tungusen, Kiang der Tibetaner ( Equus hemionus, polyodon und Kiang, Asinus Kiang und polyodon) wird von Pallas, seinem wissenschaftlichen Entdecker, beschrieben wie folgt: »Man kann diese Dschiggetai eigentlich weder Pferde noch Esel nennen. Sie sind in der ganzen Gestalt fast so ein Mittelding zwischen beiden wie die Maulthiere, daher sie Messerschmied, welcher sie zuerst bemerkt hat, fruchtbare Maulthiere nannte. Sie sind aber nichts weniger als Zwitter, sondern eine eigene Art, welche viel eigenes und eine weit schönere Gestalt als die gemeinen Maulthiere haben. Der Dschiggetai hat gewisse Schönheiten, welche ihn dem Esel weit vorzüglich machen. Ein überaus leichter Körper, schlanke Glieder, wildes und flüchtiges Ansehen und schöne Farbe des Haares sind seine vortheilhaften Seiten. Auch die Ohren, welche noch besser als beim Maulthiere proportionirt und munter aufgerichtet sind, stehen ihm nicht übel, und man würde es noch übersehen können, daß der Kopf etwas schwer und die kleinen Hufe wie beim Esel gestaltet sind. Nur der gerade, eckige Rücken und der unansehnliche Kuhschweif, welchen er mit dem Esel gemein hat, verunstalten ihn. Seine Größe ist etwas über die kleine Art von Maulthieren, fast einem Klepper gleich. Der Kopf ist etwas schwer gebildet, die Brust groß, unten eckig und etwas zusammengedrückt. Das Rückgrat ist nicht wie beim Pferde hohl ausgeschweift und rund, auch nicht so gerade und eckig wie beim Esel, sondern flach auswärts gebogen und stumpfeckig. Die Ohren sind länger als beim Pferde, aber kürzer als bei gemeinen Maulthieren. Die Mähne ist kurz und straubigt, vollkommen wie sie ein Esel hat, und so sind auch der Schweif und die Hufe. Die Brust und die Vorderschenkel sind schmal und bei weitem nicht so fleischig wie bei Pferden; auch das Hintertheil ist hager und die Gliederung überaus leicht und fein, dabei ziemlich hoch. Die Farbe des Dschiggetai ist licht gelbbraun; die Nase und Inseite der Glieder sieht fahlgelblich aus; die Mähne und der Schweif sind schwärzlich, und längs des Rückgrates läuft ein zierlicher, aus dem braunschwarzen Riemen gebildeter Streifen, der im Kreuz etwas breiter, gegen den Schweif aber wieder ganz schmal wird.«
Mit diesen Angaben stimmt Radde's Beschreibung überein, erweitert jene aber in mehrfacher Beziehung. Im Winter erreicht das Haar bis 25 Millim. Länge, erscheint dann zottig und ist weich wie Kamelwolle, außen silbergrau, an der Wurzel blaß eisengrau gefärbt; im Sommer hat es wenig über 1 Centim, Länge und etwas lichtere, gelblichröthliche, grau überflogene Färbung; die Schnauze bis über ein Drittel von ihrer Spitze bis zu dem innern Augenwinkel, und eine Rinne zwischen den Unterkieferästen werden allmählich nach ihrer Spitze zu heller und fast rein weiß während die Unterseite erst zwischen den Vorderfüßen in ein nicht ganz reines Weiß übergeht. Die Mittellinie des Rückens, welche eine bräunliche, etwas ins Gelbe und Graue ziehende Färbung zeigt, verschmälert sich gegen die Mitte des Rückens von Fingerbreite bis zu einer Breite von nicht ganz 1 Centim,, nimmt dann rasch in ihrem Querdurchmesser zu, gewinnt über dem Kreuzbeine dreier Finger Breite, behält diese über dem Becken bei, verschmälert sich hierauf sehr rasch und läuft längs des Schwanzrückens in einer schmalen Längsbinde abwärts, setzt sich aber überall scharf von der Körperfärbung ab. Die seitlichen Leibestheile nehmen nur in den Weichen eine hellere Färbung an, dasselbe findet auch an den Füßen im allmählichen Uebergange von oben nach unten statt; aber ein fingerbreiter Rand brauner, verlängerter Haare umsteht die ganze Hufwurzel und steigt an der vordern Fußseite, nach und nach heller werdend, aufwärts. Die Gesammtlänge beträgt ungefähr 2,5 Meter, wovon der Kopf etwa 50, der Schwanz ohne Quaste 40 Zentimeter wegnimmt; die Höhe am Widerrist schwankt zwischen 1,3 bis 1,5 Meter.

Kulan ( Equus hemionus). 1/18 natürl. Größe.
Ein erst vor wenigen Tagen geborenes Fohlen des Kulan, welches wir am dritten Juni 1876 in der Steppe zwischen Saisansee und Altaigebirge fingen, war ungemein zierlich gebaut; nur die Beine schienen, wie dies auch beim Pferde der Fall, im Verhältnisse zu hoch zu sein, und die Gelenke hatten fast unförmliche Dicke. Sein Kleid war im wesentlichen das der Alten in ihrer Sommertracht, das Haar jedoch, wie bei allen jungen Thieren, weicher und länger, auch etwas gekräuselt; Mähne und Schwanzquaste waren bereits wohl entwickelt, die Beine dünn und fein, nicht aber auch spärlich behaart, die Lippen und die Umrandung der Nasenlöcher dagegen mit sehr einzeln stehenden, langen, weichen, zum Theil gewellten Haaren besetzt. Die Färbung des Rumpfes oben und seitlich, des Halses, mit Ausschluß der Mähne, und der Achseln und Schenkel ist ein schönes Grauröthlichisabell, welches auf der Stirne etwas dunkelt und auf der Unterseite in Licht- bis Weißlichgelb übergeht. Ein Fleck an der äußeren und hinteren Seite des Ohres sowie die Stelle zwischen den Ohren sind rostroth, die Augenbrauenbogen roströthlich, die Ohren an der Wurzel und gegen die Spitze hin rostbraun, der kurze Pinsel an ihrer Spitze dunkel- oder schwarzbraun, der vordere Rand unten an der Wurzel, die Umrandung der Lippen, nicht weit nach oben reichend, ein Theil der Nase, das untere, nur mit wenigen, aber sehr langen Wimperhaaren besetzte Augenlid und das Innere des Ohres, die Weichen und die ganze Innenseite weiß, letztere mit einem Schimmer ins Gelbliche, welcher auf dem Spiegel zu Isabellgelb sich verstärkt, die Läufe vorn und außen etwas lichter als der Rumpf, die verlängerten Haare, welche die Hufe überdecken, schwarzgrau, die Mähne und der nach hinten allmählich sich verbreiternde, auf dem Kreuze aber wieder verschmälernde Rückenstreifen röthlich graubraun, die seitliche Einfassung des letzteren auf lichtgrauem Grunde durch bräunliche Haare gesprenkelt. Auf den hinteren Läufen war eine schwache Andeutung von drei dunklen Querstreifen zu bemerken. Die Iris ist dunkelbraun, der nackte Lippenrand bleigrau, der Huf schwarz, die warzige Stelle am inneren Vorderlaufe tief schwarz.
Pallas hielt, auf die Aussagen eines der kirgisischen Gefangenschaft entronnenen Kosaken und »andere glaubwürdige Nachrichten«, also nicht auf eigene Beobachtungen sich stützend, Dschiggetai und Kulan für verschiedene Arten. »Soviel ich habe erfragen können«, sagt er, »ist diejenige wilde Pferde- oder Eselsart, welche die Kirgisen und Kalmücken Kulan oder Chulan nennen, und die noch nie gezähmt worden ist, nicht nur von den Tarpanen, sondern auch vom Dschiggetai verschieden. Die meisten haben mir selbigen als bläulicht oder eselsfarbig von Haar, mit einem ordentlichen Eselskreuz über die Schultern beschrieben. Nach anderem Bericht sind sie gelbbraun mit einem schwarzen Rückenstrich und gedoppelten Querstreifen über die Schulter, mit Ohren, die kürzer als Eselsohren sind, und einem Kuhschwanze wie der Dschiggetai.« Nach der einen Mittheilung, welche Pallas erhielt, wird der Kulan als Mittelding zwischen Dschiggetai und Esel, nach anderen als der »wirkliche wilde Esel, der Onager der Alten«, beschrieben. Wäre es Pallas vergönnt gewesen, durch eigene Anschauung sich zu unterrichten, so würde er erkannt haben, daß Dschiggetai und Kulan ein und dasselbe Thier sind. Schon Eversmann bezweifelt die örtliche Verschiedenheit beider Wildpferde; Radde stimmt ihm bei, und ich bin durch vergleichende Betrachtung des Dschiggetai und Kulan zu der Ueberzeugung gelangt, daß beide Namen nur ein und dasselbe Wildpferd bezeichnen. Das Gleiche gilt für den Kiang, welcher ebenfalls nichts anderes ist als Dschiggetai oder Kulan. Auf die in vielen Stücken abweichenden Beschreibungen der genannten Thiere darf besonderes Gewicht nicht gelegt werden, auf die verschiedene Länge der Ohren ebensowenig; denn alle Beschreibungen, mit Ausnahme der von mir benutzten, sind mangelhaft, und die Länge der Ohren ändert, wie ich mich an gefangenen, neben einander stehenden Dschiggetais überzeugen konnte, nicht unerheblich ab. Daß auch die Färbung verschiedener Stücke einer merklichen Abänderung unterliegt, scheint mir zweifellos zu sein. Somit ergibt sich, daß ganz Mittelasien, vom Ostabhange des südlichen Ural an bis zum Himalaya und beziehentlich der mongolisch-chinesischen Grenze, nach Westen hin aber bis zu den persischen Grenzgebirgen der Aralokaspischen Steppen nur von einer einzigen Wildpferdeart bewohnt wird, und die zweite, eben der Onager der Alten, auf Kleinasien, Syrien und Palästina, Persien und Arabien sowie den Westen der Ostindischen Halbinsel beschränkt ist.
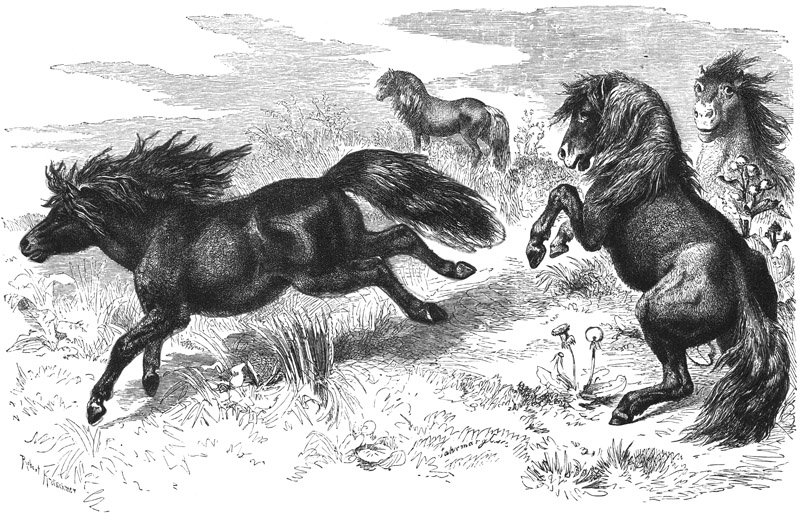
Shetland-Pony.
Bis in die neuere Zeit blieb die von Pallas gegebene Schilderung des Dschiggetai maßgebend für unsere Lebenskunde des Thieres; erst seit Beginn der Fünfziger Jahre erhielten wir werthvolle Bereicherungen der ersten Mittheilung. Gehaltvolle Beiträge danken wir Hodgson, Adams, Hay, Eversmann, Radde, Sewerzoff und Przewalski; außerdem Apollon Rusinoff, welcher die Güte gehabt hat, zu Gunsten des »Thierlebens« von mir gestellte Fragen kundigen Kirgisen vorzulegen, die Antworten zu sammeln und, mit seinen Erfahrungen verschmolzen, mir zuzusenden. Ich versuche in nachstehendem, die verschiedenen Angaben zusammen zu fassen und gebe damit ein fast erschöpfendes Lebensbild der wahrscheinlichen Stammart des Pferdes.
Der Dschiggetai oder Kulan ist ein Kind der Steppe und belebt die verschiedenartigsten Theile oder Ausprägungen derselben. Obwohl mit Vorliebe in der Umgebung der Seen und Flüsse hausend, meidet er doch auch die dürren, wasserlosen und wüstenhaften Striche nicht, und ebensowenig scheut er sich vor Gebirgen, vorausgesetzt, daß auch ihrer die Steppe sich bemächtigt hat, mit anderen Worten, daß sie unbewaldet sind. Hauptsächlich des verschiedenen Aufenthaltes wegen glaubte man sich berechtigt, Dschiggetai und Kiang zu unterscheiden. Man hielt es für unmöglich, mindestens für unwahrscheinlich, daß ein und dasselbe Thier in den Tiefebenen und auf Hochgebirgen von mehr als dreitausend Meter unbedingter Höhe leben könne: nach der Ansicht der Gebrüder Schlagintweit müßte sogar der Kiang in den Tiefebenen unfehlbar zu Grunde gehen. Diese durch nichts unterstützte Auffassung widerlegt am schlagendsten Przewalski, welcher zweifellos ein und dasselbe Thier auf den Hochgebirgen Nordtibets wie auf den reichen Wiesen am Kuku-Nor weiden sah. Nicht die verdünnte Luft des Hochgebirges noch die im Sommer glühende Sonnenhitze, im Winter eisige Kälte der Tiefebenen, nicht die stechenden Schneestürme der Höhe, noch die vom Winde aufgewirbelten heißen Sandwolken der Tiefe sind es, welche dem wettergestählten Thiere Schranken setzen in der Steppe: es ist einzig und allein der Mensch, welcher sein Vorkommen und Auftreten wenn nicht bedingt, so doch beeinflußt. Da, wo das weite Land noch nicht einmal durch schweifende Hirtenvölker beunruhigt wird, oder dort, wo der Wanderhirt mit seinen Herden regelmäßig hin und wider zieht, scheucht er den Kulan; da, wo inmitten ergiebiger Weiden Strecken sich breiten, welche so arm, so öde, so wüstenhaft sind, daß selbst jener Vorläufer des seßhaften Menschen sie meidet: da findet das ungebundene Freiheit verlangende Wildpferd sich sicher. Schon zu Pallas Zeiten bemerkte man, nachdem die Grenzwachten angelegt worden waren, innerhalb der russischen Grenzen selten mehr ordentliche, von alten Hengsten geführte Herden, sondern nur verlaufene, oder von den Tabunen abgejagte junge Hengste oder einzelne Stuten; heutzutage sind die flüchtigen Thiere noch weiter zurückgedrängt, keineswegs aber innerhalb der inzwischen hinausgeschobenen Grenzen des russischen Reiches ausgerottet worden. Hart an der Grenzscheide Europas kann man ihnen begegnen. Sie bevölkern noch gegenwärtig in namhafter Menge mehrere Gebiete von Akmolinsk: so einen längs des Flusses Tschu, zwischen den Grenzzeichen von Kaktau und der Furt Bisch-Kulan gelegenen Landstrich von fünfhundert Kilometer Länge und Breite, welcher im Nordosten von dem Flusse Utsch-Kon, im Westen von dem Gebirge Ulutau begrenzt wird; sie bewohnen ebenso einen schmalen Steppenstreifen zwischen dem Altaigebirge und dem Saisansee und finden sich von hier aus nach Osten und Süden hin auf allen geeigneten Stellen des südlichen Sibiriens und Turkestans, wenn auch nicht in so beträchtlicher Anzahl wie in den wüstenhaften Steppen der Mongolei und des nordwestlichen China oder auf den Gebirgen Tibets.
Wahrscheinlich verweilt der Kulan an keiner Stelle seines ausgedehnten Verbreitungsgebietes jahraus, jahrein auf derselben Oertlichkeit. Seine wetterwendische Heimat zwingt ihn zum Wandern. Mit Eintritt des Winters sammeln sich die einzelnen Genossenschaften zu größeren Trupps, vereinigen sich mit anderen bereits gescharten und schwellen nach und nach zu Herden an, welche tausend und mehr Stück zählen können, um gemeinschaftlich nahrungsversprechenden Gegenden zuzuwandern. Die genannten Sommerstände des Gebietes von Akmolinsk z.B. verlassen sie, in einem Jahre wie in dem anderen, bereits im August, um der sogenannten Hungersteppe Bitpak zuzuwandern. Einen Monat später trifft man sie hier auf den alt gewohnten Winterständen, und zwar auch jetzt noch in so zahlreichen Herden, daß ihr dröhnender Hufschlag auf weithin vernommen wird und, wie man uns in Sibirien erzählte, mehr als einmal die Kosaken in den Grenzwachten unter die Waffen gerufen haben soll. Mit Beginn der Schneeschmelze treten sie die Rückwanderung an, und im April rücken sie wiederum auf den Sommerständen ein. So geschieht es mit größter Regelmäßigkeit in jedem Jahre und im Westen ihres Verbreitungsgebietes wie im Osten. »Die bedeutendsten Wanderungen des Dschiggetai«, sagt Radde, »finden (in Ostsibirien) im Herbste statt, weil die unstete Lebensweise erst dann beginnen kann, wenn die Füllen vom letzten Sommer kräftig genug sind, die anhaltenden schnellen Märsche mitzumachen. Ende September trennen sich die jungen Hengste von den Herden, denen sie bis ins dritte oder vierte Jahr angehörten, und ziehen einzeln in die bergigen Steppen, um sich selbst eine Herde zu gründen. Dann ist der Dschiggetai am unbändigsten. Stundenlang steht der junge Hengst auf der höchsten Spitze eines steilen Gebirgsrückens, gegen den Wind gerichtet, und blickt weit hin über die niedrige Landschaft. Seine Nüstern sind weit geöffnet; sein Auge durchirrt die Oede. Kampfgierig wartet er eines Gegners; sobald er einen solchen gewahrt, sprengt er ihm in gestrecktem Galopp entgegen. Nun entbrennt ein blutiger Kampf um die Stuten. Der Angreifende jagt gehobenen Schweifes an dem Führer der Herde vorbei und schlägt im Laufe mit den Hinterfüßen nach ihm. Mehr und mehr erhebt sich die struppige Mähne; dann, nach wenigen Sätzen, hält er plötzlich an, wirft sich seitwärts und umkreist trabend in weitem Bogen die Herde, deren Führer er ins Auge gefaßt hat. Aber der alte, wachsame Hengst wartet geduldig, bis sein frecher Gegner ihm nahe genug kommt. Im geeigneten Augenblicke wirft er sich rasch auf ihn, beißt und schlägt, und nicht selten büßen die Kämpfer ein Stück Fell oder die Hälfte des glatten Schweifes ein.« Alle von Radde erlegten Hengste bewiesen durch ihre zahlreichen Narben, wie kampflustig diese schnellen Pferde sind.
Die Anzahl der Stuten, welche ein Hengst sich erkämpft, schwankt, je nach der Oertlichkeit und Gelegenheit, zwischen drei bis zwanzig und mehr, so daß ein Trupp aus sechs oder acht bis fünfzig Stück bestehen kann. Unter Umständen vereinigen sich auch im Sommer, jedoch immer nur ausnahmsweise, mehrere Trupps, und man kann dann mehrere Hunderte von Kulans gewahren, welche zeitweilig gemeinschaftlich werden und sodann wiederum in kleinere Herden sich zertheilen. Jedem einzelnen dieser Theile steht ein Hengst als unbedingter Beherrscher, Leiter und Führer vor. Je nach seinen Begabungen, seinem Alter und Muthe, seiner Kampfeslust und Stärke ist die Anzahl der Stuten größer oder geringer. Ein Hengst ist zum Bestehen eines Trupps unbedingt erforderlich; wird er getödtet, so zerstreuen sich die Stuten; wird er besiegt, so folgen sie anderen Bewerbern. Der in der Vollkraft stehende Hengst sammelt die meisten Stuten um sich, der junge, noch unerprobte, die wenigsten. Solange ein Hengst noch nicht mannbar ist, wird er in dem Trupp geduldet, sobald er sich zu fühlen beginnt, rücksichtslos vertrieben. Wochen- und monatelang geht er einsam umher, und neidvoll blickt er aus der Ferne auf das Glück des stärkeren und älteren Hengstes, bis quälende Eifersucht Kampfesmuth in ihm entfacht und ihn zu den geschilderten Herausforderungen treibt. Pallas gibt die Erzählung der Eingeborenen wieder, daß alte Hengste zur Sprungzeit junge Stuten, welche noch nicht rossig sind, aus dem von ihnen geleiteten Trupp verjagen und dadurch jüngeren Mitbewerbern Gelegenheit zur Bildung einer Genossenschaft verschaffen: die Angabe erscheint begründet, da die Kirgisenpferde genau ebenso verfahren.
Geselligkeit ist ein Grundzug des Wesens unseres Wildpferdes und aller Einhufer überhaupt. Ebenso wie Zebra, Quagga und Dauw den Herden der afrikanischen Antilopen und der Strauße sich zugesellen, sieht man den Dschiggetai im Hochgebirge gemeinschaftlich mit verschiedenen Wildschafen, der Tibetantilope und dem Grunzochsen, in den Tiefebenen mit Kropf- und Saigaantilopen weiden. Auch mit versprengten Pferden hält er gute Gemeinschaft. Rusinoff schreibt mir, daß die Pferde die Kulane fürchten und sich von ihnen entfernen sollen, weil ihnen die Ausdünstung der verwandten Thiere widerlich zu sein scheine: ich darf, auf eigene Beobachtungen gestützt, das Gegentheil behaupten. Als wir am dritten Juni des Jahres 1876 die erwähnte Steppe am Saisansee durchschritten und wiederholt auf Kulane stießen, sahen wir einmal auch zwei Einhufer, welche wir für Wildpferde halten mußten, auf dem Rücken eines langgestreckten Hügels stehen. Sofort begannen die uns begleitenden Kirgisen einen weiten Halbkreis um die beiden Thiere zu ziehen, in der Absicht, sie uns zuzutreiben und zum Schusse zu bringen. Das eine von ihnen setzte sich beim Erscheinen der vielen Reiter in Bewegung und entfloh; das andere weidete zuerst ruhig weiter, schaute sich sodann neugierig die herannahenden Kirgisen an und lief endlich, zu nicht geringer Ueberraschung von uns allen, geraden Weges auf uns zu. Einer und der andere griff zur Büchse, untersuchte flüchtigen Blickes Waffe und Ladung und harrte gespannt dem Näherkommen des Thieres. Da glitt ein Lächeln über das Antlitz des neben mir reitenden Kirgisen: er hatte nicht allein den Beweggrund des auffallenden Handelns des Einhufers, sondern in diesem auch ein Pferd erkannt. Vor mehr als Monatsfrist mochte es seinem Tabun entlaufen sein, sich in der Steppe verirrt und, in Ermangelung einer ihm besser zusagenden Gesellschaft, Kulanen angeschlossen haben; jetzt verließ es diese, um wiederum seinesgleichen sich anzuschließen. Widerstandslos ließ es sich fangen und zäumen, und wenige Minuten später trabte es so gleichmüthig neben unseren Reitthieren einher, als habe es niemals vollste Freiheit gekostet.
Ich will unentschieden lassen, in wie weit Gemeinsamkeit der Bedürfnisse so verschiedenartige Thiere der Steppe verbindet, glaube in ihr aber einen wesentlichen Beweggrund der Geselligkeit des Kulan erblicken zu dürfen. Die Einhufern und Wiederkäuern gemeinschaftliche Weide übt sicher wesentlichen Einfluß auf ihr gegenseitiges Verhalten aus, die den einen wie den anderen eigene Wachsamkeit vielleicht nicht geringeren. Eine Thierart fühlt sich sicherer in Gesellschaft der anderen, und keine beeinträchtigt die mit ihr auf derselben Fläche weidenden Genossen. Denn die Wildpferde genießen andere Gräser und Kräuter als Antilopen, Wildschafe und Grunzochsen. Das liebste Futter der Kulane ist im Sommer wie im Winter Steppenwermut, von den Kirgisen Dsjusan genannt, oder eine strauchartige, stachelige Pflanze, Bajalysch geheißen, welche namentlich in der Hungersteppe häufig vorkommt. Auf ihren Wanderungen müssen die sonst sehr wählerischen Thiere sich bequemen, auch andere in der Steppe wachsende Kräuter und Gräser abzuweiden, und im Winter oft längere Zeit mit Schößlingen von Tamarisken und anderen Sträuchern sich begnügen, obschon solche Aesung ihnen so wenig zusagt und sie derartig von Kräften bringt, daß sie wandernden Gerippen gleichen. Bei spärlichem Futter weiden sie fast zu jeder Stunde des Tages, bei reichlicher Weide sind sie mit dem Aufnehmen ihrer Nahrung ebenfalls sehr lange beschäftigt; nach Sonnenuntergang pflegen sie der Ruhe, jedoch, wie die Kirgisen versichern, immer nur kurze Zeit.
Ueber die Roß- und Fohlzeit des Kulan lauten die Angaben verschieden. Im Westen des Verbreitungsgebietes fällt erstere in die Zeit zwischen Mitte Mai und Mitte Juli, letztere ungefähr einen Monat früher; denn die Tragzeit stimmt mit der unseres Pferdes überein. Hay's Meinung, daß der Kiang in Tibet im Winter fohle, wird zwar von ihm durch die Bemerkung unterstützt, daß eine von ihm im August erlegte Stute ein fast ausgetragenes Fohlen trug und er im Sommer niemals Fohlen sah, welche unter sechs Monate alt sein konnten, dürfte aber doch irrthümlich, mindestens nur ausnahmsweise zutreffend sein. Wir fingen, wie erwähnt, am dritten Juni ein offenbar erst wenige Tage altes Fohlen des Kulan ein.
Wer jemals Kulane in ihrer Heimat und in vollster Freiheit sah, wird nicht anstehen, sie als hochbegabte Thiere zu bezeichnen. Bezaubert folgt das Auge ihren Bewegungen; entzückt und erstaunt zugleich versucht es, die unvergleichliche Behendigkeit der flüchtigen Thiere zu erfassen. »Das wundervollste Schauspiel«, sagt Hay, gewiß mit vollstem Rechte vom Kiang, »ist es, zu sehen, mit welcher Schnelligkeit sie an den Bergen emporklimmen, und wie gewandt sie abwärts steigen, ohne jemals zu straucheln.« Als ob sie mit ihren unerreichbaren und unversieglichen Kräften spielen wollten, so jagten die von uns verfolgten Kulane über die Hügel und durch die Thäler der Steppe dahin. Die Pferde unserer Kirgisen fegten beinah den Boden mit ihrer Brust: sie berührten mit ihren leichten Hufen kaum die Erde und gewannen trotzdem so viel Vorsprung, als sie bedurften, um selbst unseren Geschossen zu entrinnen. Nur das junge Fohlen wurde unseren Kirgisen bald zur Beute; die alten Kulane spotteten deren Anstrengungen. Kein Reiter holt sie ein; sie wetteifern an Flüchtigkeit mit jeder Antilope, wie sie an Kletterfertigkeit kaum hinter der Gemse, dem Steinbocke zurückstehen. Ihre Sinnesfähigkeiten sind nicht geringer als die Kräfte ihrer Glieder; ihre geistigen Begabungen entsprechen den übrigen. Die Kirgisen bezeichnen sie als Trotzköpfe und vergleichen mit ihnen Leute, welche der Meinung anderer nicht beistimmen und auch dem von diesen für nützlich erachteten sich widersetzen, thun aber den Thieren damit Unrecht. Trotz und Eigensinn bekunden die Kulane wohl nur in der Gefangenschaft. Selbstbewußtsein und Muth, Neugier und Dreistigkeit sind hervorstechende Eigenschaften ihres Wesens. Unverfolgt traben sie nur, anscheinend nachlässig, ihres Weges fort und peitschen mit dem stets beweglichen Schwanze lustig die Weichen; verfolgt fallen sie in einen ebenso leichten und zierlichen als fördernden Galopp; aber auch währenddem bleiben sie von Zeit zu Zeit stehen, stellen sich sämmtlich in einer und derselben Richtung auf, sichern und stürmen dann, eine lange Reihe bildend, unbesorgt, gleichsam übermüthig, mit derselben Eile weiter wie vorher. Gewöhnlich, aber nicht immer, entfliehen sie bei Annäherung des Menschen schon von weitem. Eines der Thiere steht, laut Hay, regelmäßig als Wache aus, meist in einer Entfernung von hundert bis zweihundert Meter von der Herde. Diese Wache nähert sich, wenn sie eine ihr drohende Gefahr bemerkt, gemächlich den Gefährten, rüttelt dieselben auf, setzt sich an die Spitze des Zuges und eilt nun mit den Genossen entweder im Trabe oder im vollen Galopp davon. Der gescheuchte Kulan läuft immer gegen den Wind, erhebt, wenn er in vollster Flucht ist, seinen Kopf und streckt den dünnen Schwanz von sich. Nachdem die Herde so einige hundert Schritte zurückgelegt hat, stutzt sie in der geschilderten Weise, vergewissert sich über den Stand der Gefahr, stürzt wiederum vorwärts und flieht nunmehr weiter als das erste Mal, bis sie endlich, ihr Gebaren in gleicher Weise wiederholend, dem Auge entschwindet. Zuweilen läßt eine Herde den Menschen bis auf wenige hundert Schritte an sich herankommen, manchmal wiederum entflieht sie schon aus größter Entfernung. Der Hengst hat nicht allein für den Zusammenhalt, sondern auch für die Sicherheit eines Trupps Sorge zu tragen und umkreist denselben beständig, gibt auch in der Regel das Zeichen zur Flucht. Bemerkt ein Mitglied der Herde einen ungewöhnlichen Gegenstand, beispielsweise einen sich nahenden Menschen, von fern, so springt der Hengst vor und sucht sich dem verdächtigen Wesen durch Umschweife so weit zu nähern, bis er sich über dasselbe klar geworden ist. Nicht selten trabt er geraden Wegs dem herankommenden Jäger zu, wird bei solcher Gelegenheit auch wohl niedergeschossen. Unter Umständen folgt er längere Zeit dem Reiter: »bei einer Gelegenheit«, bemerkt Hay, »liefen zwei Kiangs längere Zeit hinter einem Pony her, auf welchem einer meiner Diener ritt und näherten sich diesem so weit, daß er fürchtete, von ihnen angegriffen zu werden.« Ein so geartetes Thier entgeht leicht den Verfolgungen größerer Raubthiere. In den westasiatischen Steppen gibt es solche, welche den Kulanen nachstellen, überhaupt nicht; denn die hier hausenden Wölfe wagen nicht, gesunde Wildpferde anzufallen, weil diese ihre kräftigen Hufe gegen Feinde trefflich zu gebrauchen wissen. Höchstens ermattete und erkrankte, abseits der Herde gehende Kulane dürften von den Wölfen angegriffen werden. Im südlichen und südöstlichen Theile des Verbreitungsgebietes tritt vielleicht der Tiger als Feind unserer Thiere auf; da die Steppen ihm jedoch nur hier und da entsprechende Aufenthaltsorte bieten und diese von den Kulanen gemieden werden, fügt wahrscheinlich auch er dem Bestande der letzteren erhebliche Verluste nicht zu. Als gefährlicherer Feind erweist sich der Mensch. Die eingeborenen Wanderhirten der Steppe jagen das Wildpferd mit Leidenschaft, umsomehr, als dieses alle Geschicklichkeit des Jägers herausfordert. In den Ebenen gelingt es zuweilen, einer Herde, auf welche man geraden Wegs zugeht, bis auf fünf- oder vierhundert Schritte nahe zu kommen und dann einen Schuß abzugeben; die Wirkung auch der trefflichsten Büchse bleibt jedoch unter solchen Umständen immer fraglich, weil der Kulan gegen Wunden sehr unempfindlich ist. Selten gelingt es, selbst auf einer bewegten Fläche, bis auf drei- oder zweihundert Schritte anzuschleichen; denn der weitsichtige Kulan hat den nahenden Jäger längst bemerkt, schöpft sofort Verdacht, wenn dieser, um gedeckt bis in Schußweite sich zu nähern, in ein Rinnsal oder eine langgestreckte Mulde hinabsteigt, wird unruhig und entflieht. Erreicht der Jäger aber wirklich ungesehen bis auf schußgerechte Nähe die Herde, so muß er sicher zielen, wenn er einen Kulan fällen will. Nur ein Blattschuß wirft das kräftige, lebenszähe Wild im Feuer nieder; weidwund oder mit zerschmettertem Beine entrinnt es noch in fast unbehinderter Eile, birgt sich endlich außer Sicht des Schützen in einer Bodensenkung, verendet hier und fällt dann den Wölfen, nicht aber dem Schützen zur Beute. Daher ziehen es Kirgisen wie Mongolen vor, dem Wildpferde an der erkundeten Tränke aufzulauern oder ihm, wenn dessen gefährlichster Feind, der Winter, mit dem Menschen sich verbündet, Schlingen zu legen. Nur im Osten Sibiriens betreibt man, laut Radde, die Jagd in anderer Weise. »Der Jäger zieht hier, um den scheuen Dschiggetai zu erlegen, am frühen Morgen, auf einem hellgelben Pferde sitzend, in das Gebirge. Ueber Berg und Thal reitet er langsam durch die Einöde, in welcher die Murmelthiere auf ihren Hügeln sich sonnen und die Adler hoch in den Lüften kreisen. Sobald er die Höhe eines Gebirges erreicht hat, blickt er in die Ferne, um zu sehen, ob nicht ein dunkler Flecken das ersehnte Wild ihm verrathe. Wenn er es erspäht, reitet er rasch vorwärts. Der Weg ist lang; denn es darf nur in den Thälern und gegen den Wind geritten werden. Zu derjenigen Höhe, welcher der Dschiggetai am nächsten steht, kriecht der erfahrene Jäger mit der größten Vorsicht. Das Thier steht wie festgebannt; es blickt fest nach Norden hin. Bald ist das diesseitige scheidende Thal überschritten, und nun erst beginnt die eigentliche Jagd. Dem raschen Klepper werden die losen Schweifhaare oben zusammengebunden, damit sie nicht im Winde hin- und herfliegen; dann bringt man das Reitthier auf die Höhe des Berges, wo es zu grasen beginnt. Der Jäger legt sich, etwa hundert Schritte von ihm entfernt, platt auf den Boden; seine, in eine kurze Gabel gelegte Büchse ist zum Abfeuern bereit. Der Dschiggetai bemerkt das Pferd, hält es für eine Stute seines Geschlechts und stürmt im Galopp auf das Thier zu. Aber er wird stutzig, sobald er in die Nähe kommt; er hält an, er bleibt stehen. Jetzt ist der Augenblick zum Schusse gekommen. Der Jäger zielt am liebsten auf die Brust und erlegt nicht selten das Wild auf dem Platze; zuweilen aber bekommt der Dschiggetai fünf Kugeln, bevor er fällt. Oefters gelingt es auch, das Thier trotz seiner feinen Witterung zu beschleichen, wenn es an stürmischen Tagen an der Mündung eines Thales grast und langsam geht.«
Der Gewinn der Jagd ist nicht unbedeutend. Kirgisen und Tungusen schätzen das Wildpret des Kulan hoch. Erstere würdigen es dem Pferdefleische gleich; letztere erachten es als ausgezeichneten Leckerbissen. Die Haut des Kreuzes und der Schenkel, von den Kirgisen »Saur« genannt, wird an die Bucharen verkauft, um zu Saffian Verarbeitung zu finden, und willig mit zwei Rubel Silber und mehr bezahlt, die übrige Haut zu Riemen und Pferdekoppeln zerschnitten und verflochten. In der Haut des Schweifes mit der langen Quaste liegt nach dem tungusischen Volksglauben eine wunderbare Heilkraft verborgen: ein Stück davon auf Kohlen verbrannt, läßt kranke Thiere, welche den aufsteigenden Rauch und Dampf einathmen, sicher gesunden.
Versuche, den Kulan zu zähmen, sind neuerdings in seinem Vaterlande selten und stets ohne vollständigen Erfolg angestellt worden. Einzelne Kirgisen haben, wie Rusinoff mir mittheilt, dann und wann Kulanfohlen gefangen, von Stuten bemuttern und groß ziehen lassen. Die Wildlinge gewöhnen sich bald an die ihnen zugewiesenen Ammen, besaugen sie mit derselben Befriedigung wie ihre Mütter, beweisen ihnen kindlichen Gehorsam und verlassen sie auch im reiferen Alter nicht, weiden frei unter den zahmen Herden und finden sich mit ihnen in der Nähe der Jurte ein, beugen ihren stolz getragenen Nacken jedoch nicht unter das Joch des Menschen, sondern bewahren ihre Selbständigkeit und, trotz der herzlichsten Pflege, unbesiegliches Mißtrauen, welches bei jeder Gelegenheit sich äußert. So lange sie jung und hülfsbedürftig sind, erwecken sie die besten Hoffnungen. Das Kulanfohlen, welches unsere Kirgisen fingen, war ein überaus liebenswürdiges Geschöpf. Mit kindischer Neugier schaute es Pferde und Reiter an, ließ sich, ohne Widerstand zu leisten, halftern, berühren, streicheln, schien die ihm gespendeten Liebkosungen sogar mit Behagen zu empfinden, fraß was wir ihm bieten konnten und trank die Kuhmilch, welche wir ihm verschafften, benahm sich überhaupt nicht im geringsten anders als ein gleich altes Füllen und erregte in uns das lebhafteste Bedauern, ihm nicht die geeignete Pflege angedeihen lassen zu können. So, wie er, sollen sich alle benehmen. Allein dieses Betragen ändert sich, so bald das Thier seine Kraft zu fühlen beginnt. Zwei Kulans, welche uns Rusinoff zeigte, waren ebenfalls wenige Tage nach ihrer Geburt gefangen und durch kirgisische Stuten bemuttert worden. Den ersten Sommer ihres Lebens hatten sie mit der Herde verbracht, welcher ihre Amme angehörte, den ersten Winter mit dieser ohne Beschwer in einem kalten Stalle überstanden. Nach sehr kurzer Zeit begannen sie Heu, Hafer und gebackenes Brod zu fressen, folgten gern dem Zurufe des Menschen, ließen sich durch ihnen vorgehaltene Leckerbissen herbeilocken, auch streicheln, liebten es aber nicht, wenn man ihren Rücken berührte und ließen sich, nachdem sie genügend erstarkt waren, niemals von einem Reiter besteigen, sondern bissen und schlugen aus, geriethen schon, wenn man ihnen den Zaum auflegte, in heftigen Zorn. Sie ans Einspannen zu gewöhnen, war unmöglich. Mit jedem Jahre wurden sie wilder und bösartiger, so daß man schließlich alle Versuche, sie zu zähmen, aufgeben zu müssen glaubte.
Pallas berichtet von einer Kulanstute, welche nach Petersburg gebracht wurde, vorher aber sehr schlecht abgewartet worden war. Gleichwohl hatte dieselbe im Sommer den Weg von Astrachan bis Moskau, über zweihundert deutsche Meilen, in beständigem Laufe hinter dem Postwagen ausgehalten, ohne mehr als ein paar Nächte zu rasten, hatte dabei noch durch Fallen und Stoßen gelitten, war sogar hinter dem Wagen hergeschleift worden, und lief nach einem kurzen Aufenthalte in Moskau, doch noch mit ebensowenig Ruhe als vorher, über hundert Meilen, bis Petersburg. Hier kam sie freilich höchst mager und so elend an, daß sie sich kaum auf den Füßen erhalten konnte; aber sie gelangte bald wieder zu Kräften, und als sie gegen den Herbst hin starb, war nicht jene Erschöpfung die Ursache, sondern die Kälte, die Nässe des Klimas, des Bodens und der Weide, und endlich die Mittel, welche man anwandte, um eine auf ihrer Haut ausgebrochene böse Räude zu vertreiben. Auch dieser Krankheit ungeachtet erholte sie sich genugsam, um einen Theil ihrer vorigen Munterkeit und Schnelligkeit sowie ihre anderen, vom Lastesel sehr verschiedenen Eigenschaften und Vorzüge zu zeigen. Der feuchtkalte Herbst brachte ihr den Tod. Sie wurde auf der nassen Heide hufrissig, und diese Krankheit nahm so überhand, daß die Hufe sich endlich stückweise von den Füßen schälten. Sie war übrigens sehr zahm und folgte den Leuten, welche sie fütterten und tränkten, wie ein Hund nach. Mit Brod konnte man sie locken wohin man sie haben wollte. Nur wenn man sie an der Halfter gegen ihren Willen leiten wollte, zeigte sie sich eigensinnig.
Einen anderweitigen Bericht verdanken wir Hay, welcher einen Kulan in Kleintibet erhielt und nach England brachte. Das Thier war in einer Grube gefangen und an eine weiße Stute gewöhnt worden. Diese wurde von einem tibetanischen Lama zurückbehalten, Hay kaufte deshalb einen Maulesel, zu dem Zwecke dem Kulan Gesellschaft zu leisten. Letzterer vertrug sich jedoch nicht mit dem Gefährten, und dieser genoß alles andere, nur nicht ein glückliches Leben. Gleichwohl folgte ihm der Kulan nach, war überhaupt erst zufriedengestellt, wenn er ein Pferd, zumal ein weißes, zur Gesellschaft hatte. Unterwegs bekundete er stets die größte Abneigung eine Brücke zu überschreiten, und wenn sein thierischer Gefährte solches that, pflegte er zu warten, bis dieser das andere Ufer erreicht hatte, warf sich dann furchtlos selbst in den reißendsten Strom und schwamm in fast schnurgerader Linie durch denselben. Auf dem Wege nach Simla mußte der Fluß Biaß, zur betreffenden Jahreszeit ein schäumender Strom, überschritten werden. Der Kulan stürzte sich auch in diesen, wurde jedoch von dem Strome mehrere hundert Meter abwärts geführt und landete auf einer Insel. Hier blieb er ruhig während der Nacht und des darauf folgenden Morgens, und Hay sah sich genöthigt, das Maulthier mit vieler Mühe nach der Insel bringen zu lassen, um den Kulan wieder in seine Gewalt zu bekommen. Später kreuzte er den Strom an einer andern Stelle, wo das Wasser weniger Fall hatte, mit größter Sicherheit und Schnelligkeit. Der Sudlej war während des Marsches so voll und reißend, daß Hay es für rathsam hielt, den Kulan auf einem Flosse überzusetzen. Dies konnte aber nur mit größter Schwierigkeit geschehen. In Simla gewöhnte sich der Kulan nach und nach an den ihm anfänglich fremden Anblick der Leute. Trotz der Meinung Schlagintweits befand er sich hier während der ganzen Regenzeit sehr wohl, und als er später die Ebenen erreichte, zeigte er sich munterer und übermüthiger als je, so daß vier Männer nothwendig waren, um ihn zu halten und zu leiten. Nicht selten entrann er seinen Pflegern, ließ sich aber immer ziemlich leicht wieder fangen. Den letzten Theil des Weges nach der Küste sollte er in einem Boote zurücklegen, welches ausdrücklich für ihn vorbereitet war. Der hohle Laut unter seinen Füßen setzte ihn so in Schrecken, daß er ohne weiteres aus dem Boote sprang, Zaum und alle übrigen Fesseln mit sich nehmend. Erst nachdem der Boden des Fahrzeuges mit Rasen belegt worden war, ließ er sich hier festhalten, bekundete aber die größte Freude, als er wieder Land unter den Füßen fühlte. Gleichwohl schien er sich hier wenig zu gefallen, und wenn nicht sein alter Wärter ihn begleitet hätte, würde er wahrscheinlich zurückgerannt sein.
Auf der Seereise nach England hatte der Kulan mancherlei auszustehen. Schon der Weg vom Lande nach dem Bord des Schiffes war sehr schwierig; denn das arme Thier fürchtete sich wegen des hohen Seeganges im Boote, und Hay war froh, als er es endlich glücklich an Bord und in dem hergerichteten Stalle hatte. Obgleich für die Ueberfahrt eine ziemliche Menge von Heu, Stroh, trockene Luzerne und Körnerfutter mitgenommen worden war, fand sich bald, daß die Nahrungsmittel nicht recht reichen wollten. Die Körner waren wurmfräßig, und der Kulan weigerte sich deshalb lange Zeit, sie zu berühren. Außerdem gingen die Matrosen so unachtsam mit dem Heu und Stroh um, daß der Kulan zweimal auf das Stroh, welches in den Matratzen des Schiffsvolkes sich gefunden hatte, angewiesen war. Halb verdorbenes Wasser, wie es gereicht wurde, wollte er ebenfalls nicht trinken; ehe jedoch St. Helena erreicht wurde, hatte er sich an alles gewöhnt und fraß oder trank, was man ihm gab. In seinem Hause richtete er sich bald und mit großem Geschick ein und hielt sich so trefflich im Gleichgewichte, daß er nur bei sehr ungünstigem Wetter in die Schwebe gehängt zu werden brauchte. Während eines Sturmes arbeitete er mit allen Kräften, um sich aufrecht zu erhalten, schien auch dankbar für jede Beihülfe zu sein. Nach und nach wurde er überaus zahm und lernte Hay zuletzt schon an der Stimme erkennen. Beim Kreuzen der Linie litt er drei oder vier Tage sehr unter der Hitze, wurde auch krank davon, genas aber wieder und bekundete nun auf der ganzen Reise kein weiteres Zeichen von Krankheit, entwickelte vielmehr eine außerordentliche Freßlust und verbrauchte in vier Monaten so viel, als man für sechs berechnet hatte. Hay fand den Kulan stets außerordentlich empfänglich für freundliche Behandlung. Dankbar nahm er ihm gereichte Leckerbissen entgegen und drückte seine Befriedigung in der Regel dadurch aus, daß er die Ohren nach vorwärts bewegte. Nach allen Beobachtungen spricht Hay die Ansicht aus, daß dieses Thier durchaus nicht unzähmbar ist, wie man früher geglaubt hatte, vielmehr verhältnismäßig leicht unter die Herrschaft des Menschen sich fügt. Von Eingebornen Tibets erfuhr unser Berichterstatter, daß man den Kulan soviel als möglich zur Kreuzung mit Pferden benutzt und die von ihm erzeugten Maulthiere nicht allein ihrer ausgezeichneten Eigenschaften halber, sondern auch deshalb sehr hoch schätzt, weil sie wiederum fruchtbar sind. In unseren Thiergärten gehört der Kulan noch immer zu den Seltenheiten, obgleich man ihn in den letzten zwanzig Jahren öfters eingeführt und er sich auch wiederholt, in Paris allein sechzehnmal, fortgeflanzt hat. Ebenso ist er mit Erfolg mit dem Esel, dem Quagga, Zebra und neuerdings auch mit dem Pferde gekreuzt worden.
In den Sagen und Erzählungen der Kirgisen spielt der Kulan eine wichtige Rolle. Eine der ersteren berichtet folgendes: Vor Zeiten lebte ein Kirgise, Namens Karger-Bei, welcher ebenso reich als geizig war. Er starb endlich, ohne Erben zu hinterlassen. Aber auch auf andere kam nichts von seinem Besitzthume, denn seine Herden wurden, seinem Volke zum warnenden Beispiele, verwandelt in Thiere der Wildnis: seine Schafe in Saigaantilopen, seine Pferde in Kulane. Seitdem bevölkern beide die Steppe. Auch die Sage also bezeichnet Pferd und Kulan als dasselbe Thier.
Eine Schilderung oder auch nur Aufzählung der fast zahllosen Rassen oder Stämme des Pferdes gehört nicht in den Rahmen unseres Werkes. Die eine wie die andere würde, selbst wenn ich die erforderlichen Kenntnisse zur Unterscheidung des wahren und falschen, richtigen und unrichtigen besäße, über die mir gestellte Aufgabe hinausgehen. So mag es genügen, wenn ich die trefflichen Abbildungen, welche wir der Meisterhand Camphausens danken, mit einigen Worten begleite, mehr in der Absicht, die Unterschriften zu erläutern als Beschreibungen zu liefern.
Obenan unter allen Pferdestämmen steht noch heutigen Tages der Araber. Jahrtausende lange, verständnisvolle Zucht hat ihm allmählich Vollendung der Gestalt und eine Fülle trefflicher Eigenschaften verliehen. Nach arabischen Anforderungen muß das edle Pferd in sich vereinigen: ebenmäßigen Bau, kurze und bewegliche Ohren, schwere, aber doch zierliche Knochen, ein fleischloses Gesicht, Nüstern, »so weit, wie der Rachen des Löwen«, schöne, dunkle, vorspringende Augen, »an Ausdruck denen eines liebenden Weibes gleich«, einen gekrümmten und langen Hals, breite Brust und breites Kreuz, schmalen Rücken, runde Hinterschenkel, sehr lange wahre und sehr kurze falsche Rippen, einen zusammengeschnürten Leib, lange Oberschenkel, »wie die des Straußes es sind«, mit Muskeln, »wie das Kamel sie hat«, einen schwarzen, einfarbigen Huf, eine feine und spärliche Mähne und einen reich behaarten Schwanz, dick an der Wurzel und dünn gegen die Spitze hin. Es muß zeigen viererlei breit: die Stirn, die Brust, die Hüften und die Glieder, viererlei lang: den Hals, die Oberglieder, den Bauch und die Weichen, und viererlei kurz: das Kreuz, die Ohren, den Strahl und den Schwanz. Diese Eigenschaften beweisen, daß das Pferd von guter Rasse und schnell ist; denn es ähnelt dann in seinem Baue »dem Windhunde, der Taube und dem Kamele zugleich.« Die Stute muß besitzen: »den Muth und die Kopfbreite des Wildschweins, die Anmuth, das Auge und das Maul der Gazelle, die Fröhlichkeit und Klugheit der Antilope, den gedrungenen Bau und die Schnelligkeit des Straußes und die Schwanzkürze der Viper.«
Ein Rassenpferd kennt man aber auch noch an anderen Zeichen. Es frißt bloß aus seinem Futterbeutel. Ihm gefallen die Bäume, das Grün, der Schatten, das laufende Wasser, und zwar in so hohem Grade, daß es beim Anblick dieser Gegenstände wiehert. Es trinkt nicht, bevor es das Wasser erregt hat, sei es mit dem Fuße oder sei es mit dem Maule. Seine Lippen sind stets geschlossen, die Augen und Ohren immer in Bewegung. Seinen Hals wirft es zur Rechten und zur Linken, als wollte es sprechen oder um etwas bitten. Ferner behauptet man, daß es nun und nimmermehr sich paare mit einem seiner Verwandten.
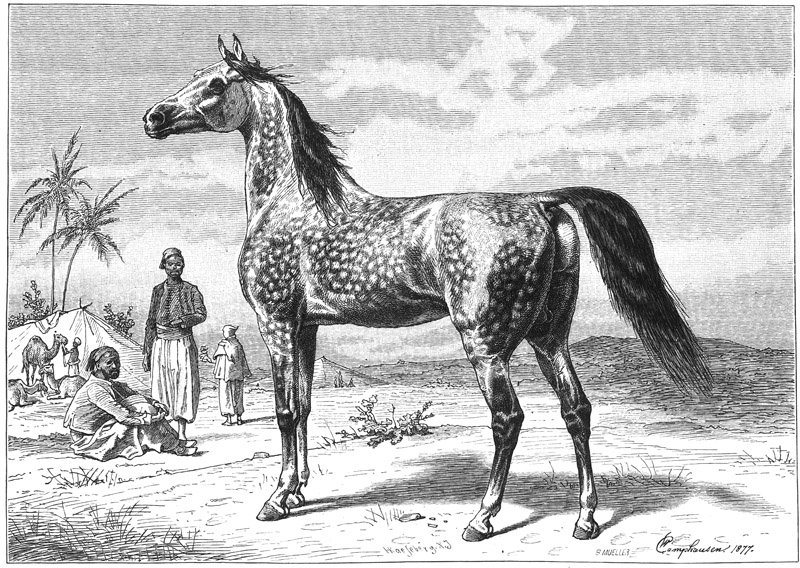
Arabisches Pferd.
In den Augen der Araber ist das Pferd das edelste aller geschaffenen Thiere, genießt daher fast dieselbe Achtung wie ein vornehmer, größere als ein geringer Mann. Bei einem Volke, welches einen weiten Raum unseres Erdballes spärlich bevölkert, welches ungleich weniger an der Scholle klebt als wir Abendländer, dessen Hauptbeschäftigung die Viehzucht ist, muß das Roß nothwendigerweise zur höchsten Würdigung gelangen. Das Pferd ist dem Araber nothwendig zu seinem Leben, zu seinem Bestehen; er vollbringt mit seiner Hülfe Wanderungen und Reisen, hütet auf ihm seine Herden, glänzt durch das Pferd in seinen Kämpfen, bei den Festen, bei den geselligen Vereinigungen; er lebt, liebt und stirbt auf seinem Rosse. Mit der Natur des Arabers, zumal des Beduinen, ist die Liebe zum Pferde unzertrennlich; er saugt die Achtung für dieses Thier schon mit der Muttermilch ein. Das edle Geschöpf ist der treueste Gefährte des Kriegers, der geachtetste Diener des Gewaltherrschers, der Liebling der Familie, und eben deshalb beobachtet es der Araber mit ängstlichem Fleiße, erlernt seine Sitten, seine Nothwendigkeiten, besingt es in seinen Gedichten, erhebt es in seinen Liedern, findet in ihm den Stoff seiner angenehmsten Unterhaltung. »Als der Erschaffende das Roß erschaffen wollte«, verkündigen die Schriftgelehrten, »sagte er zum Winde: ›Von dir werde ich ein Wesen gebären lassen, bestimmt, meine Verehrer zu tragen. Dieses Wesen soll geliebt und geachtet sein von meinen Sklaven. Es soll gefürchtet werden von allen, welche meinen Geboten nicht nachstreben.‹ Und er schuf das Pferd, und rief ihm zu: ›Dich habe ich gemacht ohne gleichen. Alle Schätze der Erde liegen zwischen deinen Augen. Du wirst meine Feinde werfen unter deine Hufe, meine Freunde aber tragen auf deinem Rücken. Dieser soll der Sitz sein, von welchem Gebete zu mir emporsteigen. Auf der ganzen Erde sollst du glücklich sein, und vorgezogen werden allen übrigen Geschöpfen; denn dir soll die Liebe werden des Herrn der Erde. Du sollst fliegen ohne Flügel und siegen ohne Schwert!‹« Aus dieser Meinung entspringt der Aberglaube, daß das edle Pferd nur in den Händen der Araber glücklich sein könne; hierauf begründet sich die Weigerung, Rosse an Andersgläubige abzulassen. Abd el Kâder bestrafte, als er noch auf der Höhe seiner Macht stand, alle Gläubigen mit dem Tode, von denen ihm gesagt worden war, daß sie eines ihrer Pferde an Christen verkauft hätten.
Alle Araber glauben, daß die edlen Pferde schon seit Jahrtausenden in gleicher Vollkommenheit sich erhalten haben, wachen daher ängstlich über der Zucht ihrer Rosse. Eigene Gebräuche sind herrschend unter ihnen geworden. So hat fast jeder Pferdebesitzer die Verpflichtung, dem, welcher bittend kommt, seinen Hengst zum Beschälen einer edlen Stute zu leihen, und deshalb veredelt sich der Bestand mehr und mehr. Hengste von guter Rasse werden sehr gesucht: die Stutenbesitzer durchreiten oft Hunderte von Meilen, um solche Hengste zum Beschälen zu erhalten. Als Gegengeschenk erhält der Hengstbesitzer eine gewisse Menge Gerste, ein Schaf, einen Schlauch voll Milch. Geld anzunehmen, gilt als schmachvoll; wer es thun wollte, würde sich dem Schimpfe aussetzen, »Verkäufer der Liebe des Pferdes« genannt zu werden. Nur wenn man einem vornehmen Araber zumuthet, seinen edlen Hengst zum Beschälen einer gemeinen Stute zu leihen, hat er das Recht, die Bitte abzuschlagen. Während der Trächtigkeit wird das Pferd sehr sorgfältig behandelt, jedoch nur in den letzten Wochen geschont. Während des Wurfes müssen Zeugen zugegen sein, um die Echtheit des Fohlens zu bestätigen. Das Fohlen wird mit besonderer Sorgfalt erzogen und von Jugend auf wie ein Glied der Familie gehalten. Daher kommt es, daß die arabischen Pferde zu Hausthieren geworden sind und ohne alle Furcht im Zelte des Herrn oder der Kinderstube geduldet werden können. Ich selbst sah eine arabische Stute, welche mit den Kindern ihres Herrn spielte, wie ein großer Hund mit Kindern zu spielen pflegt. Drei kleine Buben, von denen der eine noch nicht einmal ordentlich gehen konnte, unterhielten sich mit dem verständigen Thiere und belästigten es soviel als möglich. Die Stute ließ sich alles gefallen, zeigte sich sogar höchst willfährig, um die eigensinnigen Wünsche der spielenden Kinder zu befriedigen.
Mit dem achtzehnten Monate beginnt die Erziehung des edlen Geschöpfes. Zuerst versucht sich ein Knabe im Reiten. Er führt das Pferd zur Tränke, zur Weide, reinigt es und sorgt überhaupt für alle seine Bedürfnisse. Beide lernen zu gleicher Zeit: der Knabe wird ein Reiter, das Fohlen ein Reitthier. Niemals aber wird der junge Araber das ihm anvertraute Füllen übernehmen, niemals ihm Dinge zumuthen, welche es nicht leisten kann. Man überwacht jede Bewegung des Thieres, behandelt es mit Liebe und Zärtlichkeit, duldet aber niemals Widerstreben und Böswilligkeit. Erst wenn das Pferd sein zweites Lebensjahr überschritten hat, legt man ihm den Sattel auf. Das Gebiß wird anfangs mit Wolle umwickelt und diese manchmal mit Salzwasser besprengt, um das Thier leichter an das ihm unangenehme Eisen im Maule zu gewöhnen, der Sattel zuerst so leicht als möglich genommen. Nach Ablauf des dritten Jahres gewöhnt man es allgemach daran, alle seine Kräfte zu gebrauchen, läßt ihm aber durchaus nichts abgehen. Erst wenn es das siebente Jahr erreicht hat, sieht man es als erzogen an, und deshalb sagt das arabische Sprichwort: »Sieben Jahre für meinen Bruder, sieben Jahre für mich und sieben Jahre für meinen Feind.« Nirgends ist man von der Macht der Erziehung so durchdrungen wie in der Wüste. »Der Reiter bildet sein Pferd, wie der Ehemann sein Weib sich bildet«, sagen die Araber.
Die Leistungen eines gut erzogenen arabischen Rassepferdes sind außerordentlich. Es kommt vor, daß der Reiter mit seinem Pferde fünf, sechs Tage lang hintereinander täglich Strecken von siebzig bis hundert Kilometer zurücklegt. Wenn dem Thiere hierauf zwei Tage Ruhe gegönnt worden, ist es im Stande, in derselben Zeit zum zweitenmale einen gleichen Weg zu machen. Gewöhnlich sind die Reisen, welche die Araber unternehmen, nicht so lang, dafür aber durchreitet man in einem Tage noch größere Entfernungen, auch wenn das Pferd ziemlich schwer belastet ist. Nach der Ansicht der Araber muß ein gutes Pferd nicht bloß einen vollkommen erwachsenen Menschen tragen, sondern auch seine Waffen, seine Teppiche zum Ruhen und Schlafen, die Lebensmittel für sich selbst und für seinen Reiter, eine Fahne, auch wenn der Wind hinderlich sein sollte, und im Nothfalle muß es einen ganzen Tag lang im Zuge fortlaufen, ohne zu fressen oder zu trinken. »Ein Pferd«, schrieb Abd el Kâder an General Daumas, »welches gesund an allen seinen Gliedern ist und soviel Gerste bekommt, als es benöthigt, kann alles thun, was sein Reiter verlangt; denn das Sprichwort sagt: »Gib ihm Gerste und mißhandle es.« Gute Pferde trinken oft zwei Tage nicht, haben kaum genug zu fressen, und müssen doch den Willen ihres Reiters ausführen. Dies ist die Macht der Gewöhnung; denn die Araber sagen, daß die Pferde wie der Mensch nur in der ersten Zeit ihres Lebens erzogen und gewöhnt werden. »Der Unterricht der Kinder bleibt, wie die in Stein gehauene Schrift, der Unterricht, welchen das höhere Alter genießt, verschwindet wie das Nest des Vogels. Den Zweig des Baumes kann man biegen, den alten Stamm nimmermehr!« Vom ersten Jahre an unterrichten die Araber ihr Pferd, und schon im zweiten bereiten sie es. »In dem ersten Jahre des Lebens«, sagt das Sprichwort, »binde das Pferd an, damit ihm kein Unglück zustoße, im zweiten reite es, bis sein Rücken doppelte Breite gewonnen, im dritten Jahre binde es von neuem an, und wenn es dann nichts taugt, verkaufe es.«
Die Araber unterscheiden viele Rassen ihrer Pferde, und jede Gegend hat ihre besonderen. Es ist eine bekannte Thatsache, daß das arabische Pferd nur da, wo es geboren, zu seiner vollsten Ausbildung gelangt, und eben deshalb stehen die Pferde der westlichen Sahara, so ausgezeichnet sie auch sein mögen, noch immer weit hinter denen zurück, welche im Glücklichen Arabien geboren und erzogen wurden. Nur hier findet man die echten »Kohhéli« oder »Kohchlani«, zu deutsch: die Vollkommenen; jene Pferde, die unmittelbar von den Stuten des Profeten abstammen sollen. Wenn wir an der Richtigkeit des Stammbaumes gelinde Zweifel hegen dürfen, steht doch soviel fest, daß der bereits während seines Lebens hochgeehrte Profet vortreffliche Pferde besessen haben mag, und daß also schon von diesem Vergleiche auf die Güte der betreffenden Pferde geschlossen werden kann. Ebenso sicher ist es, daß die Araber mit großer Sorgfalt die Reinhaltung ihrer Pferderassen überwachen.
Unter allen edlen Pferden achten die Araber diejenigen am höchsten, welche in Nedschd, dem inneren Gelände der Arabischen Halbinsel, einem von schroffen Felsen durchzogenen Hochlande, gezüchtet werden. Der Stamm der Khadam hat den Ruhm, die besten Pferde zu besitzen. In Nedschd gibt es zwanzig Pferdefamilien vom ersten Range, deren alte Abstammung erwiesen ist. Schon die Hengste der echten Kohhéli werden mit hohen Preisen bezahlt, die Stuten sind kaum käuflich: ein Mann büßt seinen guten Ruf ein, wenn er gegen Gold oder Silber einen so kostbaren Schatz hinweg gibt. Gerade im Hedjâs gehört das Roß so recht eigentlich zur Familie, und diese widmet ihm ungleich mehr Sorgfalt als ihren Angehörigen selber. Wenn ein Krieger einen gefährlichen Zug vollführen will, wünscht die Familie nicht dem Manne, sondern dem Pferde das beste Glück, und wenn dieses nach einer Schlacht allein zum Zelte hereinkommt, ist der Schmerz über den im Gefecht gebliebenen Reiter bei weitem nicht so groß als die Freude über die Rettung des Rosses. Der Sohn oder ein naher Verwandter des Gefallenen besteigt das edle Thier, und ihm liegt die Verpflichtung ob, den Tod des Reiters zu rächen. Wenn ein Pferd in der Schlacht getödtet oder geraubt worden ist, und der Reiter allein zu Fuße zurückkommt, wartet seiner schlechter Empfang. Wehklagen will kein Ende nehmen, und die Trauer währet monatelang.
Aber ein solches Pferd ist auch nicht mit irgend einem andern zu vergleichen. Der Araber muthet seinen Kräften sehr viel zu, behandelt es dafür jedoch mit einer Liebe ohne Gleichen. Von Jugend auf vernimmt das Thier kein böses Wort, bekommt es keinen Schlag. Es wird mit der größten Geduld, mit der größten Zärtlichkeit erzogen und theilt mit seinem Herrn Freude und Leid, das Zelt, ja beinahe das Lager. Es bedarf keiner Peitsche, kaum eines Sporenstoßes, ein Wort seines Reiters genügt, um es anzutreiben. Mensch und Thier haben sich auf das innigste verbrüdert, und der eine wie das andere fühlen sich gedrückt, wenn der treue Gefährte fehlt. Mehr als einmal ist es vorgekommen, daß ein Pferd den Leichnam seines im Kampfe gefallenen Reiters noch von der Wahlstatt bis zum Zelte trug, gleichsam als wisse es, daß es den gefallenen Mann nicht dem Hohne und Spotte des Feindes preis geben dürfe.
Ebenso groß, wie die liebenswürdigen Eigenschaften des Wesens, sind die Genügsamkeit und Anspruchslosigkeit des arabischen Pferdes. Es ist mit wenigem zufrieden und im Stande, bei schmaler Kost noch die größten Anstrengungen zu ertragen. Kein Wunder, daß solch ein Thier von hundert Dichtern glühend besungen worden, daß es das ausschließliche Gespräch der Männer am Lagerfeuer, daß es der Stolz und das höchste Kleinod des Arabers ist!
Ergötzlich anzuhören sind die Lobeserhebungen, welche einem hochedlen Pferde gespendet werden. »Sage mir nicht, daß dieses Thier mein Pferd ist, sage, daß es mein Sohn ist! Es läuft schneller als der Sturmwind, schneller noch, als der Blick über die Ebene schweift. Es ist rein wie das Gold. Sein Auge ist klar und so scharf, daß es ein Härchen im Dunkeln sieht. Die Gazelle erreicht es im Laufe. Zu dem Adler sagt es: Ich eile wie du dahin! Wenn es das Jauchzen der Mädchen vernimmt, wiehert es vor Freude, und an dem Pfeifen der Kugeln erhebt sich sein Herz. Aus der Hand der Frauen erbettelt es sich Almosen, den Feind schlägt es mit den Hufen ins Gesicht. Wenn es laufen kann nach Herzenslust, vergießt es Thränen aus seinen Augen. Ihm gilt es gleich, ob der Himmel rein ist, oder der Sturmwind das Licht der Sonne mit Staub verhüllt; denn es ist ein edles Roß, welches das Wüthen des Sturmes verachtet. In dieser Welt gibt es kein zweites, welches ihm gleiche. Schnell wie eine Schwalbe eilt es dahin, so leicht ist es, daß es tanzen könnte auf der Brust deiner Geliebten, ohne sie zu belästigen. Sein Schritt ist so sanft, daß du im vollsten Laufe eine Tasse Kaffees auf seinem Rücken trinken kannst, ohne einen Tropfen zu verschütten. Es versteht alles wie ein Sohn Adams, nur daß ihm die Sprache fehlt.«
Als den Arabern ebenbürtige Pferdezüchter dürfen gegenwärtig die Engländer angesehen werden. Noch vor zwei Jahrhunderten züchteten die Spanier und Italiener bessere Pferde als die Briten; seitdem sind jene ebenso zurückgegangen als diese vorgeschritten. Das Rennpferd ist Ergebnis des beharrlich fortgesetzten Strebens, ein Pferd zu erzielen, welches alle übrigen an Schnelligkeit im Laufen überbieten sollte. Arabische, türkische und Berberpferde sind die nachweislichen Stammeltern dieses Thieres, welches in den Augen der Engländer als das schönste aller Pferde gilt, nach Ansicht jedes Unbefangenen aber dem Araber an Schönheit nachsteht. Aeußerst schlanke, an die Grenzen des Zerrbildlichen streifende Formen zeichnen es aus; Kopf und Hals sind kaum noch als ebenmäßig zu bezeichnen. Gleichwohl wird es, um zur Veredelung zu dienen, nach allen von Europäern bewohnten Ländern der Erde ausgeführt, und nicht selten mit zweihunderttausend Mark und darüber bezahlt. Freilich kann solches Pferd, wenn es bei Rennen wiederholt als Sieger hervorgeht, seinem Besitzer auch erkleckliche Summen einbringen: » King Herod« gewann im Rennen 201,505 Pfund Sterling. Ein dreijähriges Vollblutpferd durchläuft beim Wettrennen ungefähr 850 Meter in der Minute. Jedes Vollblutpferd muß, um als solches zu gelten, im Gestütbuche Großbritanniens eingetragen worden sein, also seinen Stammbaum nachweisen können.

Rennpferd. 1/24 natürl. Größe.
In unserem Vaterlande wird der Pferdezucht erst seit Anfang des vorigen Jahrhunderts die gebührende Aufmerksamkeit zu theil. Bis dahin begnügte man sich, Pferde zu erzielen, ohne auf deren Veredelung besondere Rücksicht zu nehmen. Ende des siebenzehnten Jahrhunderts stand die Pferdezucht in Deutschland wahrscheinlich überall auf tieferer Stufe als im Mittelalter, welches, wie bekannt, mit dem Morgenlande ungleich regere Verbindung unterhielt als die spätere Zeit. Von einer Landespferdezucht war nicht die Rede. In Preußen war es erst Friedrich Wilhelm I., welcher die Pferdezucht in richtige Bahnen lenkte. Zunächst um seinen eigenen Marstall mit guten Pferden zu versorgen, errichtete derselbe das Gestüt Trakehnen und legte damit den Grund zu einer vernunftgemäßen Veredelung des bis dahin arg vernachlässigten altpreußischen Pferdes. Durch vielfache Kreuzungen mit arabischen und englischen Vollblutpferden erzielte man nach und nach den Trakehner, ein dem Renner sehr nahestehendes, jedoch kräftigeres, im hohen Grade leistungsfähiges Thier, welches man gegenwärtig wohl das deutsche Pferd nennen darf, zumal Trakehnen und seine Zweiganstalten den wesentlichsten Einfluß auf die Zucht und Veredelung aller altpreußischen Pferde geübt haben und noch fortwährend ausüben.
Nächst Preußen züchtet man gegenwärtig hauptsächlich noch in Würtemberg, Hannover, Mecklenburg und Holstein gute und schöne Pferde zu allgemeinem Gebrauche, während man in Westfalen und den Rheinländern schweren und plumpen Thieren vielfach begegnet. Insbesondere ist es der Percheron, ein riesiges und sehr kräftiges Thier, genannt nach seiner ursprünglichen Heimat, der alten französischen Provinz Perche, welcher neuerdings mehr und mehr Verbreitung findet, da er sich zum Bewegen schwerer Lasten vorzüglich eignet.
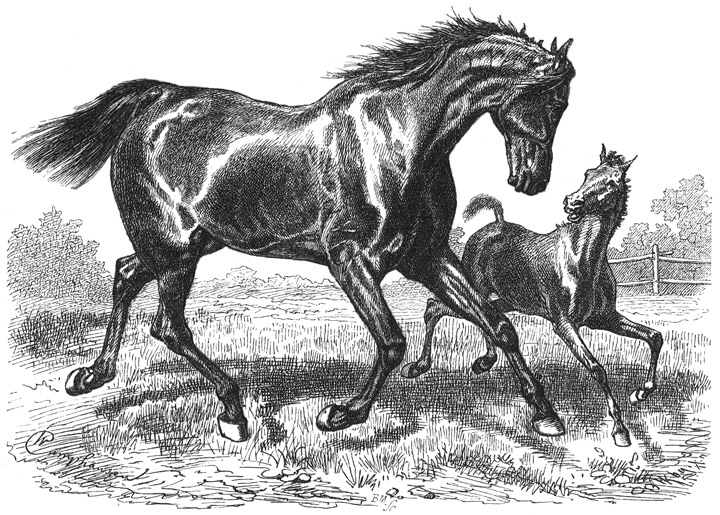
Trakehner. 1/25 natürl. Größe.
Heutzutage ist das zahme Pferd fast über den ganzen Erdball verbreitet. Es fehlt nur in den kältesten Landstrichen und auf mehreren Inseln, wo der Mensch seiner noch nicht bedarf. In trockenen Gegenden gedeiht es entschieden besser als in feuchten, sumpfigen, obwohl es schlechtere Gräser verzehrt als andere Hausthiere. Man züchtet es in wilden, halbwilden und zahmen Gestüten. In den wilden Gestüten Rußlands werden die Herden das ganze Jahr hindurch sich selbst überlassen. Die dort geborenen Pferde sind sehr dauerhaft, kräftig und genügsam, erlangen aber niemals die Schönheit der unter Aufsicht des Menschen geborenen und erzogenen. Halbwilde Gestüte sind solche, in denen sich die Pferdeherden vom Frühjahr bis zum Herbste in den Wäldern und auf großen Weideplätzen herumtreiben, im Winter aber in Ställen gehalten und beaufsichtigt werden; zahme Gestüte endlich jene, wo die Pferdezucht unter strengster Aufsicht des Menschen getrieben wird. Die größten Gestüte befinden sich in Rußland, Polen und Ungarn. In Rußland soll Graf Orloff in einem einzigen seiner Gestüte an achttausend theils zahme, theils halbwilde Pferde besitzen. Das größte Gestüt des österreichischen Kaiserreichs befindet sich in Niederungarn und zählt an dreitausend Pferde.
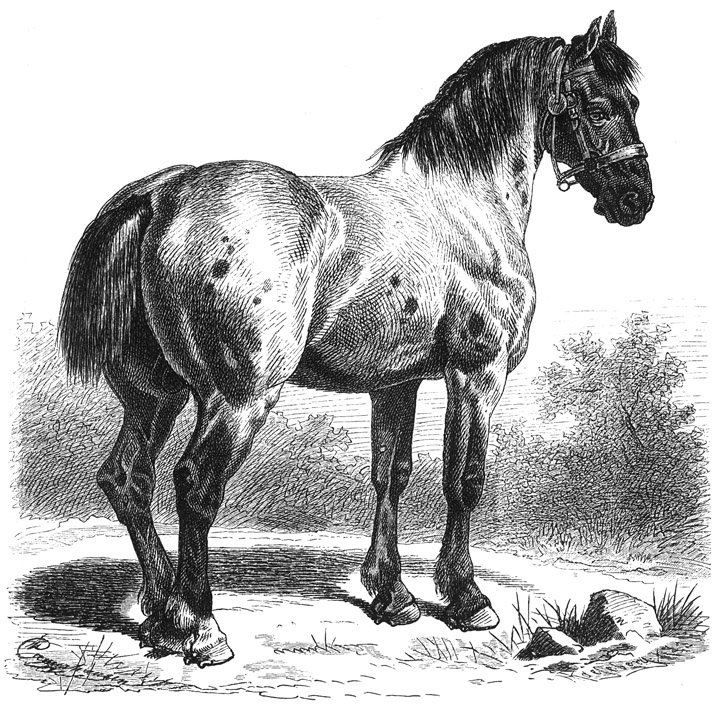
Percheron. 1/20 natürl. Größe.
Die Pferdezucht ist, entsprechend ihrer volkswirtschaftlichen Bedeutung, zu einer Wissenschaft geworden, welcher sich mehr und mehr tüchtige Kräfte zuwenden. Erste und hauptsächlichste Bedingung zum Gelingen der Bestrebungen ist sachverständige und geschickte Auswahl der Elternthiere, unter steter Rücksicht aus den besonderen Zweck, welchen man in der Nachkommenschaft verwirklicht sehen will. Denn Vorzüge wie Fehler oder Gebrechen der Eltern vererben sich auf die Kinder, und die wesentlichsten Erfolge der Züchtung beruhen vorzugsweise auf dieser erst spät erkannten Thatsache. Zwar fehlt uns, laut Schwarznecker, noch genügender Aufschluß, wie diese Vererbung zu Stande kommt; denn es ist weder nachgewiesen, inwieweit die Eigenschaften des Vaters und der Mutter überhaupt sich vererben, noch wie die Vererbung unter bestimmten Verhältnissen sich geltend macht: indessen nimmt man als feststehend an, daß die Eigenschaft eines Schlages um so eher sich forterbt, je länger der betreffende Stamm sie schon besaß. Nicht allzuselten tritt auch ein Rückschlag ein, indem die Eigenschaften der Eltern nicht unmittelbar auf die Kinder, sondern vielleicht erst auf die Enkel übergehen. Nächst der Vererbung beruhen die Erfolge der Züchtung in der naturgemäßen Aufzucht der Füllen; denn die von den Eltern ererbten Eigenschaften entwickeln sich nur unter den für diese Anlage günstigen Verhältnissen.
Die Paarungszeit des Pferdes fällt zwischen Ende März und Anfang Juni. Dreijährige Stuten sind fortpflanzungsfähig; den Hengst läßt man nicht gern vor dem vierten Jahre zur Paarung. Von seinem siebenten Jahre an genügt er für fünfzig bis hundert Stuten. Letztere werfen elf Monate nach der Begattung ein einziges Füllen, welches sehend und behaart geboren wird und wenige Minuten nach der Geburt stehen und gehen kann. Man läßt es etwa fünf Monate saugen, sich tummeln und spielen und entwöhnt es von der Mutter, nachdem man ihm gelehrt hat, nach und nach allein zu fressen. Im ersten Jahre trägt es einen molligen Pelz, eine kurze, aufrechtstehende, gekräuselte Mähne und ähnlichen Schweif, im zweiten Jahre werden die Haare glänzender, Mähne und Schweif länger und schlichter. Das spätere Alter erkennt man ziemlich richtig an den Schneidezähnen. Acht bis vierzehn Tage nach der Geburt erscheinen oben und unten die beiden mittelsten, die sogenannten Zangen; zwei oder drei Wochen später bricht zu jeder Seite der Zangen wieder ein Zahn aus, und nun sind die sogenannten Mittelzähne vollständig. Nach fünf bis sechs Monaten treten die äußeren Schneidezähne hervor, und damit sind die Milch- oder Füllenzähne, kurze, glatte, glänzende, milchweiße Gebilde, vollendet. Nach dem Ausfallen der Füllenzähne erhält das Roß die Pferdezähne. Im Alter von dritthalb Jahren werden die Zangen ausgestoßen und durch neue Zähne ersetzt; ein Jahr später wechseln die Mittelzähne, im nächsten Jahre die sogenannten Eckzähne oder besser die äußeren Schneidezähne. Mit ihnen brechen die wirklichen Eckzähne oder Haken durch, zum Zeichen, daß die Ausbildung des Thieres beendet ist. Vom fünften Jahre ab sieht der Beurtheiler des Alters bei Pferden nach den Gruben, Kunden oder Bohnen in den Zähnen, linsengroßen, schwarzbraunen Höhlungen auf der Schneide der Zähne. Diese verwischen sich an der untern Kinnlade im Alter von fünf bis sechs Jahren, an den Mittelzähnen im siebenten, an den Eckzähnen im achten Jahre des Alters; dann kommen in gleicher Zeitfolge die Oberzähne daran, bis im elften bis zwölften Jahre sämmtliche Gruben verschwunden sind. Mit zunehmendem Alter verändert sich auch allmählich die Gestalt der Zähne: sie werden um so schmäler, je älter sie sind. Bei manchen Pferden verwischen sich die Kunden niemals.
Das Pferd wechselt nur die kleinen, kurzen Haare und zwar hauptsächlich im Frühjahre. Das längere Winterhaar fällt um diese Zeit so schnell aus, daß es schon in Zeit eines Monats der Hauptsache nach beendet ist. Nach und nach werden die Haare ersetzt, und von Anfang September oder Oktober an beginnen sie sich wieder merklich zu verlängern. Die Haare in der Mähne und im Schwanze bleiben unverändert.
Leider ist das edle Roß vielen Krankheiten unterworfen. Die wichtigsten sind der Spat, eine Geschwulst und spätere Verhärtung des Sprunggelenkes, die Druse, eine Anschwellung der Drüsen unter den Kinnladen, die Räude, ein trockener oder nasser Ausschlag, wobei die Haare ausgehen, der Rotz, eine starke Entzündung in der Nasenscheidewand, welche furchtbar ansteckt, sich selbst auf Menschen überträgt, der rasende Koller, eine Gehirnentzündung, oder der Dummkoller, ein ähnliches Leiden, der graue und der schwarze Star und andere. In den Gedärmen und in der Nase wohnen die Larven von Biesfliegen, in den Nieren » Pallisaden«, in den Augen Fadenwürmer, auf der Haut Lausfliegen und Milben.
Das Pferd kann ein Alter von vierzig Jahren erreichen, wird aber meist so schlecht behandelt, daß es oft schon mit zwanzig Jahren greisenhaft ist. Das Pferd, welches der österreichische Feldmarschall Lacy im Türkenkriege ritt, wurde auf Befehl des Kaisers sorgfältig gepflegt und erreichte ein Alter von sechsundvierzig Jahren. Der Bischof von Metz besaß ein Pferd, welches fünfzig Jahre alt und noch bis zu den letzten Tagen zu leichter Arbeit verwendet wurde. In England soll ein Pferd sogar das Alter von zweiundsechzig Jahren erreicht haben.
Ueber die Eigenschaften, Gewohnheiten, Sitten und Eigenthümlichkeiten der Pferde, kurz, über das geistige Wesen will ich Scheitlin reden lassen. »Das Pferd«, sagt er, »hat Unterscheidungskraft für Nahrung, Wohnung, Raum, Zeit, Licht, Farbe, Gestaltung, für seine Familie, für Nachbarn, Freunde, Feinde, Mitthiere, Menschen und Sachen. Es hat Wahrnehmungsgabe, innere Vorstellungskraft, Gedächtnis, Erinnerungsvermögen, Einbildungskraft, mannigfache Empfindungsfähigkeiten für eine große Anzahl von Zuständen des Leibes und der Seele. Es fühlt sich in allen Verhältnissen angenehm oder unangenehm, ist der Zufriedenheit mit seinem gegebenen Verhältnisse oder aber des Verlangens nach einem anderen, ja selbst der Leidenschaften, gemüthlicher Liebe und gemüthlichen Hasses fähig. Sein Verstand ist groß und wird leicht in Geschicklichkeit umgewandelt; denn das Pferd ist außerordentlich gelehrsam.
»Viele Thiere sehen und hören besser als das Pferd. Dieses riecht und schmeckt auch nicht besonders fein, und sein Gefühl ist nur an den Lippen gesteigert. Dafür ist seine Wahrnehmungsgabe für nahe Gegenstände ganz außerordentlich, so daß es alle Gegenstände um sich her genau kennen lernt, womit dann erst noch ein vortreffliches Gedächtnis verbunden ist. Wir kennen die Erzeugnisse seiner Wahrnehmungsgabe, seinen Ort-, Stall-, Steg- und Wegsinn, seine Sicherheit, einen Pfad, wenn es ihn auch nur einmal gemacht hat, wieder zu erkennen. Es kennt den Weg viel besser als sein Führer. Seiner Kenntnis gewiß, widersetzt es sich an einem Scheidewege fast starrsinnig dem Unrechtführer. Reiter und Kutscher können ruhig schlafen und im tiefsten Dunkel dem Pferde die Wahl des Weges überlassen. Diese Wahl ist schon vielen betrunkenen Fuhrleuten aufs beste zu statten gekommen und hat schon tausenden Leben und Habe gerettet. Wie schnell erkennt es den Gasthof wieder, in welchem es einmal eingekehrt ist, aber auch wie hartnäckig glaubt es wieder einkehren zu dürfen! Es ist, als ob es meine, der Führer, der Reiter kenne den Gasthof nicht so gut als es ihn kenne, als ob es ihn zurechtweisen müsse. Ist es einmal beim Gasthof vorüber, so läuft es wieder ganz willig. Es scheint nun sich selbst zu berichtigen und zu denken, sein Führer habe nicht Unrecht; denn er wolle nun einmal da nicht einkehren. Doch erkennt es den Gasthof als solchen nicht am Schilde. Willig läuft es bei denen vorbei, in welchen es noch nie gewesen. Seinen ehemaligen Herrn und Knecht erkennt es nach vielen Jahren noch sogleich wieder, läuft auf ihn zu, wiehert ihn an, leckt ihn und bezeigt eine gar innige Freude; es weiß nur nicht recht, wie es seine Freude äußern soll. Es merkt augenblicklich, ob ein anderer Mensch als der gewöhnliche auf seinem Rücken sitzt. Bisweilen schaut es rückwärts, sich darüber völlig ins reine zu setzen. Vollkommen erkennt es den Sinn der Worte des Wärters, und vollkommen gehorcht es denselben. Es tritt aus dem Stalle zum Brunnen, zum Wagen, läßt sich das Geschirr an- und auflegen, läuft dem Knechte wie ein Hund nach, geht von selbst wieder in den Stall. Einen neuen Knecht oder ein neues Nebenpferd schaut es sinnvoll an, in ganz anderer Weise als die Kuh das neue Thor. Alles neue erregt es stark, ein neuer Wagen, eine neue Kutsche ist ihm wichtig. Wo etwas neues, auffallendes durch Größe, Form und Farbe zu sehen ist, trabt es herzu, schaut und schnauft es an.
»Seine Wahrnehmungsgabe, sein Gedächtnis und seine Gutmüthigkeit machen es möglich, ihm alle Künste des Elefanten, Esels und Hundes beizubringen. Es muß Räthsel lösen, Fragen beantworten, durch Bewegen mit dem Kopfe Ja und Nein sagen, durch Schläge mit dem Fuße Zahlengrößen der Uhr etc. bezeichnen. Es sieht auf die Bewegung der Hände und Füße des Lehrers, versteht die Bedeutung der Schwingung der Peitsche und diejenige der Worte, so daß es schon ein kleines Wörterbuch in der Seele hat. Aufs Wort stellt es sich krank, steht es dumm mit ausgebreiteten Beinen und hängt es den Kopf, schwankt es traurig und matt, sinkt langsam, plumpt auf die Erde, liegt wie todt, läßt auf sich sitzen, die Beine auseinander legen, am Schwanze zerren, die Finger in die so sehr empfindlichen Ohren stecken etc., aber aufs hingeworfene Wort, es durch den Henker abholen zu lassen, springt es wieder auf und rüstet sich wieder munter und froh: es hat den Befehl völlig verstanden. Daß ihm der Spaß, den es oft wiederholen muß, gefalle, nimmt man nicht wahr; ihm kann nur Laufen und Springen behagen. Wie lange wird man es lehren müssen, bis es durch zwei große Reifen springt, welche, ziemlich weit von einander entfernt, mit weißem Papier scheibenartig sich ihm wie eine weiße Mauer darstellen? Daß der Mensch lernen kann und will, nimmt uns nicht wunder, sondern, daß das Pferd lernen kann. Man muß wirklich nicht fragen: Was kann es lernen? sondern: was kann es nicht lernen?
»Wer einem Pferde etwas menschliches lehren will, muß es, anfangs wenigstens, rein menschlich, d. h. nicht durch Prügel, noch Drohungen, noch Hunger lehren wollen, sondern nur das gute Wort brauchen und es geradeso behandeln, wie ein guter, verständiger Mensch einen guten, verständigen Menschen behandelt. Was auf den Menschen wirkt, wirkt auch auf das Pferd. Will es sich z. B. nicht beschlagen, den Fuß nicht aufheben lassen, so streichelt man es, streichelt seinen Fuß, gibt ihm gute Worte, verweist ihm seine Ungeduld, seinen Ungehorsam, hält ihm, um es zu zerstreuen, Hafer vor; frißt es, so probirt man, den Fuß aufzuheben; will es solches nicht geschehen lassen, so entzieht man ihm den Hafer; schaut es diesem nach, so hält man ihm denselben wieder vor, probirt es nochmals mit dem Fuße etc. So gewinnt man alle Pferde, welche früher nicht mißhandelt, nicht schlecht erzogen worden sind. Der Regel nach sind die Pferde völlig Kinder im guten und bösen.
»Das Pferd hat neben seinem Ortsgedächtnis auch Zeitsinn. Es lernt im Takte gehen, trotten, galoppen und tanzen. Es kennt auch Zeitunterschiede im großen, es weiß, ob es Morgen, Mittag oder Abendzeit ist. Es ermangelt selbst des Tonsinnes nicht. Wie der Krieger, liebt es den Trompetenton. Es scharrt freudig mit dem Vorderfuße, wenn dieser Ton zum Laufen im Wettrennen und zur Schlacht ertönt; es kennt und versteht auch die Trommel und alle Töne, welche mit seinem Muthe und mit seiner Furcht in Verbindung stehen. Es kennt den Kanonendonner, hört ihn aber, wenn es in Schlachten zerschossene Gefährten gesehen, nicht gerne. Der Wolkendonner ist ihm ebenfalls nicht angenehm. Vielleicht wirkt das Gewitter nachtheilig ein.
»Das Pferd ist der Furcht sehr zugänglich und nähert sich auch darin dem Menschen. Es erschrickt über einen ungewohnten Ton, ein ungewohntes Ding, eine flatternde Fahne, ein Hemd, welches zum Fenster herausweht. Sorgsam beschaut es den Boden, welcher Steine hat, sorglich tritt es in den Bach, den Fluß. Ein Pferd, welches in eine Hausgrube gefallen und wieder heraufgezogen worden war, war sehr erschrocken; ein anderes, welches in eine Kalkgrube gesprungen war, ließ sich willig binden und herausziehen: es wollte den Rettenden helfen. Auf schmalen Gebirgspfaden zittert es. Es weiß, daß es nur Fuß ist und sich an gar nichts anhalten kann. Den Blitz fürchtet es heftig. Im Gewitter schwitzt es vor Angst, erschlagen zu werden. Reißt eins aus, so kann das andere, unerschrockene es zurückhalten; gewöhnlich aber ergreift es der Schrecken ebenfalls und beide rennen in immer steigernder Furcht und Angst, rasen über und durch alles mögliche heim, in die Tenne, an eine Wand, wie toll. Wieviel Unglück veranlaßt und verursacht das sonst so verständige, gehorsame und gutwillige Thier, welches dem Herrn, dem Knechte, der Frau, dem Mädchen, jedem, der es gut behandelt, gehorcht!
»Das Pferd kann sich verwundern, es kann stutzen, kann über unbedeutende Dinge wie ein Kind erschrecken, es kann sich enttäuschen lassen, und sein Kennen kann durch seinen Verstand zum Erkennen werden. Daraus erhellt, daß sein Verstand zerrüttet, daß es verrückt werden kann. Durch rohe Behandlung, durch Fluchen und Prügeln der Roßknechte ist schon manches Pferd schändlich verdorben, um allen seinen, geistigen und gemüthlichen Werth gebracht und völlig dumm und toll gemacht worden. Dagegen wird das Pferd durch edle Behandlung veredelt, hoch gehoben, durch sie zum halben Menschen gemacht.
»Die einzige wahre Lust des Pferdes ist zu rennen. Es ist von Natur ein Reisender; bar zur Lust rennen weidende Pferde in den russischen Steppen, reisen mit den Kutschen im Galopp viele Stunden, eine Tagereise weit, sicher, daß sie ihren langen Pfad wieder zurückfinden. Auf den Weiden tummeln sie sich munter, werfen vorn und hinten auf und treiben allerlei Muthwillen, rennen mit einander, beißen einander. Es gibt solche, welche immer andere necken. Junge necken sogar Menschen. Eine beachtenswerthe Erfahrung! Das Thier, welches sich am Menschen versucht, muß sich dem Menschen nahe fühlen, muß in ihm beinahe seines Gleichen sehen. Ein junges Pferd rannte in einem langen, schmalen Alpenthale einem Trüppchen Reisender nach, d. h. es ließ sie zuerst ungehindert vorbeigehen, dann galoppirte es ihnen nach bis auf einen einzigen Schritt vor sie hin, stand dann plötzlich still und sah sie an, dann rannte es wieder zurück, that als ob es weiden wollte, kam dann wieder herangesprengt, und so neckte es sie vier- oder fünfmal zu deren nicht geringer Furcht. Es trieb offenbar reinen Muthwillen, wie ihn ein Mensch treibt, welcher sich überlegen fühlt. Als die Reisenden endlich über eine als Hecke dienende Mauer gestiegen waren, rannte es an dieser mehrmals auf und ab, um eine Stelle zum Hinüberspringen zu finden, um sie noch weiter zu necken. Da es keine fand, sprengte es wieder lustig auf seine alte Weidestelle zurück.
»Seine Rennlust in Verbindung mit seinem Adel oder seinem Stolze leisten im römischen Korso beinahe unglaubliches. Auf ein gegebenes Zeichen sind die Pferde bereit, den Wettkampf zu beginnen: sie wiehern hell auf, sie stampfen vor Ungeduld. Dann stürzen sie sich auf die Bahn, und eins will das andere übereilen. Niemand sitzt auf ihnen, niemand sagt ihnen, um was es sich handele, niemand feuert sie an; sie merken es von sich aus. Jedes feuert sich selbst an und wird von jedem angefeuert. Und das, welches zuerst am Ziele ist, lobt sich selbst und wird von den Menschen gelobt. Es ist dafür empfindlich; doch wird Neid oder Haß gegen den Sieger bei ihm nicht wahrgenommen. Voll Ehrgefühl schadet es sich bisweilen selbst, weil es immer voran will und sich zu Tode liefe, wenn man es nicht zurückhielte. Manche muß man voranlassen; viele laufen nur, wenn andere vor ihnen sind, wollen aber dann doch nicht hinter diesen zurückbleiben; manche laufen nur mit Bekannten, mit Kameraden. Welches Ehrgefühl entwickelt sich in dem englischen Wettrenner! Wie schmeichelt sich das Pferd des Generals! Es merkt seine Vortrefflichkeit und daß es ein Königsroß sei, welchem die Ehre gebühre, und daß man es verehre.
»Der ganze Hengst ist ein furchtbares Thier. Seine Stärke ist ungeheuer, sein Muth über alle Begriffe, sein Auge sprüht Feuer. Die Stute ist viel sanfter, gutmüthiger, willfähriger, gehorsamer, lenksamer; darum wird sie auch den Hengsten oft vorgezogen. Der Trieb zur Begattung ist bei den Pferden heftiger als bei anderen Thieren; aus solcher Kraft entspringen eben große, stolze Kräfte. Der Walach hat zwar durch Verschneidung viel verloren, ist aber durch sie nicht, wie der Stier, zum matten Ochsen, sondern nur ein milderes, gehorsameres Wesen geworden, hat bloß aufgehört, eine lodernde, verzehrende Flamme zu sein.
»Das Pferd ist aller Erregung fähig. Es liebt und haßt, ist neidisch und rachsüchtig, launisch etc. Mit manchen Pferden verträgt es sich sehr gut, mit anderen schwer oder gar nicht, und diese oder jene nimmt es nie zu Gunsten an. Es kennt den Blick des Menschen wohl und hält ihn aus; man nimmt jedoch wahr, daß der Blick des Menschen, wenn er scharf ist, einwirkt. Man erzählt vom Pferde Wunderdinge des Verstandes, Gemüthes und seiner tiefen, inneren Natur. Bedenklich stellten sich Pferde über den Leichnam ihres Herrn, neigten sich über ihn hin, beschauten sein Angesicht lange, schnopperten es an, wollten nicht von ihm weg, wollten ihm im Tode noch treu bleiben. Andere bissen in der Schlacht Pferd und Mann ihres Gegners, als ob auch sie gegen einander kämpfen müßten. Ein Pferd ergriff seinen betrunkenen Reiter, um ihm wieder hinaufzuhelfen; ein anderes wandte und drehte sich, um es dem im Steigbügel Hängengebliebenen zu ermöglichen, daß er seinen Fuß herausziehen könne. Durch den Umgang mit guten Menschen wird das Pferd immer menschlicher, durch den mit bösen immer thierischer, viehischer.
»Kein Pferd ist dem andern gleich. Bissig und böse, falsch und tückisch ist das eine, zutraulich und sanft das andere. Entweder hat die Natur oder die Erziehung oder beides sie so verschieden gemacht. Ein Pferd, welches beschlagen werden sollte, stieß mit dem Kopfe den Schmied plötzlich um, und stampfte mit seinen Füßen so auf ihm herum, daß er bluttriefend hervorgezogen werden mußte.
»Wunden fürchtet das Pferd nicht; Operationen unterwirft es sich mit viel Verstand und Willen. Muthvoll hält es in der Schlacht aus, und hat sogar Lust im Streite: es wiehert hell auf. Sein Wiehern ist eigenthümlich genug: es lacht der Gefahr. Wird es verwundet, so stöhnt es nur. Es stirbt in seinen Wunden heldenartig, still und ruhig; es merkt den Tod.
»Wie verschieden ist das Schicksal der Pferde! Das Loos der meisten ist, jung geliebt und mit Hafer genährt, alt ein Karrengaul und mit Riedgras und mit Prügeln gefüttert und verachtet zu werden. Vielen Rossen ist schon eine Thräne nachgeweint und mit Recht ein marmornes Denkmal gebaut worden. Sie haben ihre Jugendzeit zum Muthwillen, ihre Jünglingszeit zum Stolziren, ihre Manneszeit zum Arbeiten, ihr Alter, in welchem sie träger, matter werden; sie blühen, reifen und verwelken!«
Das zweite, vom Kulan sicher verschiedene Wildpferd Asiens ist der Onager der Alten, welcher auch in der Bibel wiederholt erwähnt wird. Xenophon traf ihn in der Nähe des Euphrats in Menge an, Strabo, Varro und Plinius kennen ihn aus Kleinasien, Marcellin aus dem Lande der Kurden. Nach Sclaters Vergleichungen lebender Wildpferde ist es mehr als wahrscheinlich, daß der in den Wüsten Indiens hausende Wildesel vom Onager sich nicht unterscheidet, und durch Tristram wissen wir, daß letzterer noch heutigen Tages nicht allein in Mesopotamien, sondern ebenso in Palästina lebt, auch nicht allzuselten gefangen nach Damaskus gebracht wird. Somit würde sich sein Vaterland von Syrien über Arabien und Persien bis Indien erstrecken.
Der Onager, »Gurkur, Gaur, Kerdét, Ischaki« und wie er bei den verschiedenen Völkern sonst noch genannt wird ( Equus Onager, E. und Asinus hemippus, indicus und Hamar) ist merklich kleiner als der Dschiggetai, aber doch höher und feiner von Gliedern als der gemeine Esel. Der Kopf ist verhältnismäßig noch höher und größer als beim Kulan; die dicken Lippen sind bis an den Rand mit steifen, borstigen Haaren dicht bekleidet, die Ohren ziemlich lang, jedoch kürzer als bei dem Esel. Ein schönes Weiß mit silberartigem Glanze, die vorherrschende Färbung, geht auf der Oberseite des Kopfes, an den Seitenflächen des Halses und des Rumpfes, sowie an den Hüften in Blaßisabell über. Am Seitenbuge zieht sich ein weißer Streifen von Handbreite herab; ein zweiter Streifen verläuft längs des ganzen Rückens und an der Hinterseite der Keulen; in seiner Mitte liegt der kaffeebraun gefärbte Riemen. Die Behaarung ist noch seidenartiger und weicher als beim Pferde. Das Winterhaar kann man mit Kamelwolle vergleichen, das Sommerhaar ist äußerst glatt und zart. Die aufrechtstehende Mähne besteht aus weichen, wollartigen, etwa 10 Centim. langen Haaren; der Quast am Schwanze wird eine gute Spanne lang.
In der Lebensweise erinnert der Onager an den Kulan. Ein Haupthengst führt die Herden, welche aus Stuten und Füllen beiderlei Geschlechts bestehen; doch scheint es, daß die Hengste weniger eifersüchtig sind als bei den verwandten Arten, wenigstens sollen zur Wanderzeit oft mehrere sich vereinigen. Zu Beißereien zwischen den Hengsten kommt es dann freilich immer noch. Hinsichtlich der Beweglichkeit steht der Onager durchaus nicht hinter dem Dschiggetai zurück. Schon Xenophon berichtet, daß das Thier im Laufe die besten Pferde bei weitem überbiete, und auch die neueren Schriftsteller lassen dieser Schnelligkeit Gerechtigkeit widerfahren. Der Reisende Porter spricht mit Bewunderung von unserem Wildpferde. In der Provinz Fars nahm sein vorzüglicher Windhund die Verfolgung eines Wildes auf, welches seine Begleiter als Antilope erkennen wollten. Man verfolgte das Thier augenblicklich im vollen Galopp und bekam es, Dank der Geschicklichkeit des Hundes, auch wirklich wieder zu Gesicht. Da sah man zu nicht geringer Verwunderung, daß die vermeintliche Antilope ein Wildpferd war. »Ich beschloß«, sagt der Reisende, »diesem prachtvollen Geschöpfe mit einem außerordentlich geschwinden Araber nachzureiten; allein alle Bemühungen des edlen Rosses waren vergeblich, bis das Wild plötzlich still stand und mir Gelegenheit gab, es in der Nähe zu betrachten. Mit einemmale aber floh es wieder mit Gedankenschnelle dahin, Luftsprünge machend, ausschlagend und auf der Flucht scherzend, als ob es nicht im geringsten ermüdet und die Hatze ihm nur eine Lust wäre.«
Die Sinne des Onager, zumal Gehör, Gesicht und Geruch, sind so fein, daß ihm in freier Steppe gar nicht beizukommen ist. Außerordentlich genügsam, kommt er höchstens einen Tag um den anderen zur Tränke, weshalb der Anstand auf ihn meist vergeblich ist. Salzhaltige Pflanzen sind ihm die angenehmste Nahrung, neben diesen die bittermilchigen, wie Löwenzahn, die Saudistel und dergleichen; aber auch Kleearten, Luzerne und allerlei Schotenpflanzen werden nicht verschmäht. Zuwider sind ihm dagegen alle wohlriechenden, balsamischen Pflanzen, Sumpfkräuter, Ranunkeln und alle stacheligen Gewächse, auch die Distel. Salziges Wasser liebt er mehr als frisches, jedoch muß es rein sein; denn trübes trinkt er nie.
Ueber die Zeit der Paarung und des Wurfes ist nichts bekannt geworden; es läßt sich jedoch annehmen, daß letzterer in die Frühlingszeit fallen muß.
Das Wildpret des Onager wird hochgeschätzt von allen Völkern, welche innerhalb seines Verbreitungsgebietes leben. Sogar die Araber, welche in Bezug auf Speisen sehr heiklich sind und von einen zahmen Esel niemals essen würden, betrachten es als rein. Wahrscheinlich war es bei den Hebräern nicht anders. Daß die Römer nach jungen Onagern lüstern waren, wissen wir. Plinius erzählt uns, daß die besten Onager in Phrygien und Lykaonien gefunden würden. »Die Füllen dieser Thiere sind als Leckerbissen unter dem Namen Lalisiones bekannt. Mäcen war der erste, welcher bei seinen Gastereien Maulthierfüllen statt jenes ausländischen Wildprets einführte.« Die Perser benutzen außer dem Fleische die Galle des Wildesels als Augenmittel. Man jagt dem edlen Thiere eifrig nach. Die Perser reiten gemeinschaftlich zur Jagd aus, stellen sich in Entfernungen von acht bis zehn Kilometern auf den bekannten Wechseln des Wildesels auf und lösen sich in der Verfolgung desselben ab, bis er ermattet ihnen zur Beute wird. Auch tieft man Gruben aus, bedeckt sie leicht mit Zweigen und Gras und füllt sie unten bis zu einer gewissen Höhe mit Heu an, damit die hereinfallenden Thiere sich nicht verletzen; dann treibt man die Wildpferde nach den Thälern hin, in welchen man die Gruben angelegt hat, und verkauft die gefangenen jungen Füllen behufs der Zucht an die Stutereien der Vornehmen des Landes zu theueren Preisen. Aus diesen Gefangenen zieht man die schönsten und flinksten Reitesel, deren man sich in Persien und Arabien bedient, und zählt gern bis hundert Dukaten für das Stück. Sie behalten alle guten Eigenschaften ihrer wilden Stammeltern: die schöne Bildung, den muntern Anstand und die Schnelligkeit im Laufe, ihre Genügsamkeit und die Ausdauer. Niebuhr gibt an, daß man unter den arabischen Reiteseln viele finde, welche in der Färbung genau mit dem Onager übereinkommen; ich dagegen habe auf allen meinen Reisen in Nordostafrika keinen Esel gesehen, welcher jene Angaben bestätigt hätte.
Der Steppenesel ( Equus taeniopus, Asinus taeniopus und africanus) ähnelt in Größe und Ansehen seinem gezähmten Nachkömmlinge in Egypten, in seinem Anstande und seinem Wesen aber den wildlebenden asiatischen Verwandten. Er ist groß, schlank und hübsch gebaut, bald aschgrau, bald isabellfarben, an der Unterseite heller, mit deutlich ausgesprochenem Schulterkreuz und einigen mehr oder weniger bemerkbaren Querstreifen an der Außenseite des Unterfußes. Die Mähne ist ziemlich schwach und kurz, die Quaste am Schwanze dagegen stark und lang.
Dieses Thier findet sich wahrscheinlich in allen Steppenländern östlich vom Nil. Um den Atbara, den Hauptzufluß des göttlichen Stromes, ist er häufig, ebenso auch in den Barkaebenen; sein Verbreitungskreis reicht bis an die Küste des Rothen Meeres. Hier lebt er unter ganz ähnlichen Verhältnissen wie der Dschiggetai und Onager. Jeder Hengst führt eine Herde von zehn bis fünfzehn Stuten und bewacht und vertheidigt sie. Er ist ausnehmend scheu und vorsichtig, seine Jagd daher überaus schwierig. Von einem Reisenden, welcher den Weg vom Rothen Meer nach Charthum zurückgelegt hatte, erfuhr ich, daß die Wildesel, wie die Pferde Paraguays, oft auf das Lagerfeuer zulaufen, etwa vierhundert Schritte davon sich aufstellen und stutzen, bei der geringsten Bewegung im Lager aber mit hoch emporgehobenem Schweife eilenden Laufes davonjagen. Zahme Eselinnen sollen sie nicht selten wegführen und unter ihre Herden aufnehmen.

Afrikanischer Wildesel ( Asinus taeniopus). 1/18 natürl. Größe.
Alle im Süden und wahrscheinlich auch in Habesch benutzten zahmen Esel scheinen von dieser Art abzustammen; denn nach der Versicherung der Araber gleichen ihnen die Wildesel täuschend. Mir wurden Esel gezeigt, von denen man behauptete, sie in der Jugend eingefangen und gezähmt zu haben. Ich weiß nicht, ob diese Behauptung der Wahrheit entsprach; soviel aber kann ich versichern, daß jene sich von den anderen dort gebräuchlichen Eseln nur durch etwas stolzere Haltung und größere Ausdauer unterschieden. Mehrere Male habe ich solche Thiere benutzt und dabei beobachten können, daß sie ebenso lenksam und anspruchslos waren wie die im Hausstande geborenen. Ein Hengst, welchen ich längere Zeit pflegte und beobachten konnte, ein schönes, munteres, kluges Geschöpf, hatte sich seine edle Haltung bewahrt und machte deshalb einen sehr guten Eindruck auf den Beschauer. Sein Wesen war nicht minder angenehm. Er war gutmüthig, seinem Wärter und seinen Bekannten sehr zugethan, zeigte aber oft einen gewissen Muthwillen, welcher seine Behandlung oder mindestens ein innigeres Verhältnis mit ihm erschwerte. Obwohl er Liebkosungen verlangte und, wie es schien, mit Dank anerkannte, konnte er es sich doch nicht versagen, gelegentlich nach der ihm schmeichelnden Hand zu schnappen oder, falls ihm dies möglich, dem sich mit ihm abgebenden Menschen einen Hufschlag beizubringen. Demungeachtet war auch er lenksam, nicht störrisch, höchstens spiel- oder rauflustig.
Die gebänderten Füße dieses Thieres sind ein beachtenswerthes Merkmal; denn sie lassen unsern Esel als ein Mitglied zwischen seinen Verwandten und den Tigerpferden erscheinen und beweisen wieder einmal, daß jeder Landstrich seinen Geschöpfen gewisse Eigenthümlichkeiten verleiht.
Mag es auch noch nicht bestimmt entschieden sein, welchem Wildesel wir unser nützliches Hausthier verdanken, so steht doch soviel fest, daß der Onager sowohl wie der Steppenesel von Alters her gezähmt und zur Veredelung der Eselzucht benutzt wurden. Die alten Römer gaben große Summen für diese Veredelung aus, die Perser und Araber thun es noch heute. Nur bei uns ist der zahme Esel ( Equus Asinus, Asinus vulgaris) durch fortwährende Vernachlässigung zu einem wahren Krüppel herabgesunken.
Wenn man den Esel, welcher bei uns zu Lande zur Mühle trägt oder den Milchkarren zieht, mit seinen südländischen Brüdern vergleicht, könnte man versucht werden, beide als verschiedene Arten anzusehen, so gering ist die Aehnlichkeit zwischen ihnen. Der nordische Esel ist, wie allbekannt, ein träger, eigensinniger, oft störrischer Gesell, welcher allgemein, wenn auch mit Unrecht, als Sinnbild der Einfalt und Dummheit gilt, der südliche Esel dagegen, zumal der egyptische, ein schönes, lebendiges, außerordentlich fleißiges und ausdauerndes Geschöpf, welches in seinen Leistungen gar nicht weit hinter dem Pferde zurücksteht, ja es in mancher Hinsicht noch übertrifft. Ihn behandelt man aber auch mit weit größerer Sorgfalt als den unsrigen. In vielen Gegenden des Morgenlandes hält man die besten Rassen so rein wie die des edelsten Pferdes, füttert die Thiere sehr gut, plagt sie in der Jugend nicht zuviel und kann deshalb von den erwachsenen Dienste verlangen, welche unser Esel gar nicht zu leisten im Stande sein würde. Man hat vollkommen Recht, viele Sorgfalt auf die Zucht des Esels zu verwenden; denn er ist dort Hausthier im vollsten Sinne des Wortes: er findet sich im Palaste des Reichsten wie in der Hütte des Aermsten und ist der unentbehrlichste Diener, welchen der Südländer kennt. Schon in Griechenland und Spanien trifft man sehr schöne Esel an, obgleich sie noch immer weit hinter den im Morgenlande und zumal in Persien und Egypten gebräuchlichen zurückstehen. Der griechische und spanische Esel kommen einem kleinen Maulthiere an Größe gleich; ihr Haar ist glatt und weich, die Mähne ziemlich, die Schwanzquaste verhältnismäßig sehr lang; die Ohren sind lang, aber fein gebaut, die Augen glänzend. Große Ausdauer, ein leichter, fördernder Gang und ein sanfter Galopp stempeln diese Esel zu unübertrefflichen Reitthieren. Manche Arten gehen einen natürlichen Paß, so z. B. die größten von allen, welche ich je gesehen habe, die sogenannten spanischen Kohlenesel, welche hauptsächlich benutzt werden, Kohlen von den Gebirgen herab nach dem Süden zu bringen. Neben dem großen Esel findet man auch in Griechenland und Spanien kleinere; sie sind aber ebenfalls viel feiner gebaut und weicher, zierlicher behaart als die unsrigen.
Noch weit schöner als diese trefflichen Thiere sind die arabischen Esel, zumal diejenigen, welche in Jemen gezogen werden. Es gibt zwei Rassen, eine große, muthige, rasche, zum Reisen höchst geeignete, und eine kleinere, schwächere, welche gewöhnlich zum Lasttragen benutzt wird. Der große Esel ist wahrscheinlich durch Kreuzung mit dem Onager und seinen Nachkommen veredelt worden. Ganz ähnliche Rassen finden sich in Persien und Egypten, wo man viel Geld für einen guten Esel ausgibt. Ein allen Anforderungen entsprechender Reitesel steht höher im Preise als ein mittelmäßiges Pferd, und es ist gar nicht selten, daß man bis fünfzehnhundert Mark unseres Geldes für ihn bezahlt. Die beste Rasse befindet sich nur in den Händen der Vornehmsten des Landes. Sie ist von der Größe eines gewöhnlichen Maulthieres und diesem bis auf die langen Ohren täuschend ähnlich. Feiner Bau und schönes glattes, weiches Haar zeichnen sie besonders aus. Der gewöhnliche Esel, welcher sich in jedermanns Händen befindet, ist von Mittelgröße, aber dennoch von ausgezeichneter Güte. Er ist fleißig, äußerst genügsam und sehr ausdauernd. Während der Nacht bekommt er sein Hauptfutter, harte Bohnen, welche er mit lautem Geräusche zermalmt, bei Tage empfängt er nur dann und wann ein Bündel frischen Klees oder eine Hand voll Bohnen.

Esel ( Equus Asinus). 1/16 natürl. Größe.
»Etwas nutzbareres und braveres von einer Kreatur als dieser Esel«, sagt Bogumil Goltz, »ist nicht denkbar. Der größte Kerl wirft sich auf ein Exemplar, welches oft nicht größer als ein Kalb von sechs Wochen ist, und setzt es in Galopp. Diese schwach gebauten Thiere gehen einen trefflichen Paß; wo sie aber die Kräfte hernehmen, stundenlang einen ausgewachsenen Menschen selbst bei großer Hitze im Trabe und Galopp herumzuschleppen, das scheint mir fast über die Natur hinaus in die Eselmysterien zu gehen, welche auch noch ihren Esel-Sue bekommen müssen, wenn Gerechtigkeit in der Weltgeschichte ist.«
Man verschneidet den Reiteseln das Haar sehr sorgsam und kurz am ganzen Körper, während man es an den Schenkeln in seiner vollen Länge stehen läßt; dort werden dann noch allerlei Figuren und Schnörkel eingeschnitten, und die Thiere erhalten dadurch ein ganz eigenthümliches Aussehen.
Im Innern Afrikas, wo das nützliche Geschöpf ebenfalls häufig als Hausthier gehalten wird, sieht man wenig edle Esel, und auch diese werden erst aus Jemen oder Egypten eingeführt. Der im Ostsudân gewöhnliche steht dem egyptischen in jeder Hinsicht nach. Er ist kleiner, schwächlicher, fauler und störrischer, dem Sudânesen aber ein sehr theurer Gegenstand, obgleich er ihn halb verhungern oder sich selbst Futter suchen läßt. Ungeachtet dieser Freiheit verwildert der Esel hier jedoch nicht wie an anderen Orten.
In früheren Zeiten traf man halb verwilderte Esel auf einigen Inseln des griechischen Archipels und auf der Insel Sardinien an, und heutzutage noch findet man sie im südlichen Amerika. Solche der Zucht des Menschen entronnene Esel nehmen bald alle Sitten ihrer wilden Vorfahren an. Der Hengst bildet sich seine Herden, kämpft mit anderen auf Tod und Leben, ist scheu, wachsam, vorsichtig und läßt sich nicht so leicht dem Willen des Menschen wieder unterwerfen. Auch in Südamerika waren diese Wildlinge früher weit häufiger als gegenwärtig, wo sie schon fast ganz verschwunden sind.
Durch vorstehendes ist der Verbreitungskreis des Esels bereits angedeutet worden. Der östliche Theil Vorder- und Mittelasiens, das nördliche und östliche Afrika, Süd- und Mitteleuropa und endlich Südamerika sind die Landstriche, in denen er am besten gedeiht. Je trockner das Land, um so wohler befindet er sich. Feuchtigkeit und Kälte verträgt er weniger als das Pferd. Deshalb findet man in Persien, Syrien, Egypten, in der Berberei und Südeuropa die schönsten, in dem regenreichen Mittelafrika oder in unseren doch schon an die Grenzen seines Verbreitungsgebietes heranreichenden Ländern aber die schlechtesten Esel. Freilich wird er in Mitteleuropa und im Innern Afrikas auch am meisten vernachlässigt, während man ihn in den Ländern des nördlichen Afrikas und in Asien wenigstens durch Kreuzung zu veredeln sucht. Eine gute Behandlung wird übrigens im Morgenlande nur den werthvollen Eseln zu theil; die übrigen führen fast ein ebenso trauriges Leben wie die unsrigen. Der Spanier z.B. putzt seinen Esel wohl mit allerlei Quasten und Rosetten, bunten Halsbändern, hübschen Satteldecken und dergleichen, behauptet auch, daß sein Grauthier sich noch einmal so stolz trage, wenn es im Schmucke gehe, also an der Aufmerksamkeit seines Herrn gar sehr sich ergötze, behandelt seinen armen vierbeinigen Diener aber überaus schlecht, läßt ihn hungern, arbeiten und prügelt ihn dennoch auf das unbarmherzigste. Nicht anders ergeht es dem beklagenswerthen Geschöpfe in den meisten Ländern Südamerikas. »Namentlich in Peru«, so schreibt mir Haßkarl, »ist der Esel das geplagteste Wesen der Welt und das allgemeine Lastthier. Er muß Steine und Holz zu den Hausbauten, Wasser zu den Haushaltungen und sonstige Lasten, kurz alles schleppen, was man nöthig hat und infolge der Faulheit der Menschen nicht gern selbst tragen will. Dabei setzt sich der gewichtige Zambo oder Mischling von Eingebornen und Neger noch dazu hinten auf und schlägt ohne Erbarmen auf das arme Thier los. Zwei Reiter auf einem Esel sind ebenfalls gar nichts seltenes. Es gibt in Lima ein Sprichwort, welches diese Stadt für den Himmel der Frauen und die Hölle der Esel erklärt. Niemals sieht man den Esel hier wie in Europa im trägen, langsamen Schritte, sondern stets im Laufe oder Tritte gehen. Nirgends hört man so oft als hier das klägliche, I–ah' und dazwischen das Fluchen der Treiber und das Klatschen der Peitsche, und noch jetzt fühle ich mich auf die Plazza major in Lima versetzt, wenn ich unerwartet Eselgeschrei vernehme.« Auch der gewöhnliche egyptische Esel hat nicht etwa ein beneidenswerthes Loos. Er ist jedermanns Sklave und jedermanns Narr. Im ganzen Morgenlande fällt es niemandem ein, zu Fuß zu gehen; sogar der Bettler hat gewöhnlich seinen Esel: er reitet auf ihm bis zu dem Orte, wo er sich Almosen erbitten will, läßt den Esel, wie er sich ausdrückt, auf »Gottes Grund und Boden« weiden und reitet abends auf ihm wieder nach Hause.
Nirgends dürfte die Eselreiterei so im Schwunge sein wie in Egypten. Hier sind die willigen Thiere in allen größeren Städten geradezu unentbehrlich zur Bequemlichkeit des Lebens. Man gebraucht sie, wie man unsere Lohnkutschen verwendet, und deshalb gilt es auch durchaus nicht für eine Schande, sich ihrer zu bedienen. Bei der Enge der Straßen jener Städte sind sie allein geeignet, die nothwendigen Wege abzukürzen und zu erleichtern. Daher sieht man sie in Kairo z.B. überall in dem ununterbrochenen Menschenstrome, welcher sich durch die Straßen wälzt. Die Eseltreiber Kairos bilden einen eigenen Stand, eine förmliche Kaste, sie gehören zu der Stadt wie die Minarets und die Palmen. Sie sind den Einheimischen wie den Fremden unentbehrlich; sie sind es, denen man jeden Tag zu danken hat, und welche jeden Tag die Galle in Aufregung zu bringen wissen. »Es ist eine wahre Lust und ein wahrer Jammer«, sagt der Kleinstädter in Egypten, »mit diesen Eselsjungen umzugehen. Man kann nicht einig mit ihnen werden, soll man sie für gutmüthiger oder bösartiger, störrischer oder dienstwilliger, träger oder lebhafter, verschmitzter oder unverschämter halten: sie sind ein Quirl von allen möglichen Eigenschaften.« Der Reisende begegnet ihnen, sobald er in Alexandrien seinen Fuß an die Küste setzt. Auf jedem belebten Platze stehen sie mit ihren Thieren von Sonnenauf- bis Sonnenuntergang. Die Ankunft eines Dampfschiffes ist für sie ein Ereignis; denn es gilt jetzt, den in ihren Augen Unwissenden, bezüglich Dummen, zu erkämpfen. Der Fremde wird zunächst in drei bis vier Sprachen angeredet, und wehe ihm, wenn er englische Laute hören läßt. Sofort entsteht um den Geldmann eine Prügelei, bis der Reisende das klügste thut, was er thun kann, nämlich auf gut Glück einen der Esel besteigt und sich von dem Jungen nach dem ersten besten Gasthause schaffen läßt. So stellen sie sich zuerst dar; aber erst wenn man der arabischen Sprache kundig ist und statt des Kauderwelsches von drei bis vier durch sie gemißhandelten Sprachen in ihrer Zunge mit ihnen reden kann, lernt man sie kennen.
»Sieh, Herr«, sagt der Eine, »diesen Dampfwagen von einem Esel, wie ich ihn Dir anbiete, und vergleiche mit ihm die übrigen, welche die anderen Knaben Dir anpreisen! Sie müssen unter Dir zusammenbrechen; denn es sind erbärmliche Geschöpfe und Du bist ein starker Mann! Aber der meinige! Ihm ist es eine Kleinigkeit, mit Dir wie eine Gazelle davon zu laufen.« »Das ist ein Kahiriner Esel«, sagt der Andere; »sein Großvater war ein Gazellenbock und seine Ururmutter ein wildes Pferd. Ei, du Kahiriner, lauf' und bestätige dem Herrn meine Worte! Mache deinen Eltern keine Schande, geh' an im Namen Gottes, meine Gazelle, meine Schwalbe!«
Der Dritte sucht beide womöglich noch zu überbieten, und in diesem Tone geht es fort, bis man endlich eines der Thiere bestiegen hat. Dieses wird nun durch unnachahmliches Zucken, Schlagen oder durch Stöße, Stiche und Schläge des an dem einen Ende zugespitzten Treibstockes in Galopp gebracht, und hinterher hetzt der Knabe, rufend, schreiend, anspornend, plaudernd, seine Lungen mißhandelnd, wie den Esel vor ihm. »Sieh' Dich vor, Herr! Dein Rücken, Dein Fuß, Deine rechte Seite ist gefährdet! Nimm Dich in Acht, Deine linke Seite, Deinen Kopf! Passe auf! ein Kamel, ein Maulthier, ein Esel, ein Pferd! Bewahre Dein Gesicht, Deine Hand! Weiche aus, Freund; laß mich und meinen Herrn vorbei! Schmähe meinen Esel nicht, Du Lump; der ist mehr werth, als Dein Urgroßvater war. Verzeih', Gebieter, daß Du gestoßen wurdest.« Diese und hundert andere Redensarten umsurren beständig das Ohr des Reitenden. So jagt man zwischen allen den Gefahr bringenden Thieren und Reitern, zwischen Straßenkarren, lasttragenden Kamelen, Wagen und Fußgängern durch, und der Esel verliert keinen Augenblick seine Lust, seine Willfährigkeit läßt sich kaum zügeln, sondern stürmt dahin in einem höchst angenehmen Galopp, bis das Ziel erreicht ist. Kairo ist die hohe Schule für alle Esel. Hier erst lernt man dieses vortreffliche Thier kennen, schätzen, achten, lieben.
Auf unsern Esel freilich sind Okens Worte vollkommen anzuwenden: »Der zahme Esel ist durch die lange Mißhandlung so herunter gekommen, daß er seinen Stammeltern fast gar nicht mehr gleicht. Er bleibt nicht bloß viel kleiner, sondern hat auch eine mattere, aschgraue Farbe und längere, schlaffere Ohren. Der Muth hat sich bei ihm in Widerspenstigkeit verwandelt, die Hurtigkeit in Langsamkeit, die Lebhaftigkeit in Trägheit, die Klugheit zur Dummheit, die Liebe zur Freiheit in Geduld, der Muth in Ertragung der Prügel.« Ihn meint auch Scheitlin in seiner vortrefflichen Thierseelenkunde. »Der zahme Esel ist eher gescheit als dumm; nur ist seine Gescheitheit nicht so gutmüthig als die des Pferdes, mehr Tücke und Schlauheit und drückt sich am stärksten durch Eigenwillen oder Eigensinn aus. Jung, obschon von einer Sklavin geboren, ist er sehr munter, und liebt possirliche Sprünge, wie alle Kindheit, ahnt, wie auch das Menschenkind, sein vielleicht gräßliches, trauriges Schicksal nicht. Ist er erwachsen, so muß er ziehen und tragen und läßt sich gut dazu abrichten, was auf Verständnis deutet; denn er muß in den Willen eines andern Wesens, in den eines Menschen, treten. Das Kalb ist hierzu niemals verständig genug, und sogar das Pferdefüllen merkt anfänglich nicht, was man eigentlich mit ihm will. Wie geduldig aber auch der Esel seine große Last trägt, er trägt sie doch nicht gern; denn sobald er entlastet worden, trollt er sich gern auf dem Boden herum und schreit sein schreckliches Geschrei heraus. Es muß ihm ein musikalischer Sinn völlig mangeln. Seine Ohren deuten wirklich etwas besonderes an.
»Sein Schritt ist außerordentlich sicher. Etwa einmal will er schlechterdings mit dem Wagen nicht von der Stelle, und etwa einmal nimmt er Reißaus. Man muß immer auf seine Ohren sehen; denn er spielt fleißig mit ihnen und drückt wie das Pferd seine Gedanken und Vorsätze durch sie aus. Daß er die Prügel verachtet und kaum durch sie angetrieben wird, deutet einerseits auf Eigensinn, anderseits auf seine harte Haut. Seinen Wärter kennt er wohl; davon aber, daß er wie die Pferde Anhänglichkeit an ihn gewinne, ist nicht die Rede. Doch läuft er auf ihn zu und bezeigt einige geringe Freude. Auffallend ist an ihm die Empfindlichkeit für die erst von fern herannahende Witterung: er hängt entweder den Kopf, oder er macht muntere Sprünge.
»Wir können die Ehre des Esels noch vollkommen retten, weil wir sagen dürfen, daß er zu sehr vielem, wozu man sonst nur das Pferd abgerichtet sieht, ebenfalls eingeschult werden kann. Manche Kinder lernen schwer, aber gründlich und auf die Dauer, so der Esel. Man gibt Wettrennen mit ihm; man lehrt ihn durch Reifen springen und Kanonen lösen. Er springt gut und sicher und ist ganz unerschrocken. Er paßt auf seines Herrn Auge und Wort und versteht beide wohl. Darum kann man ihn auch tanzen lehren, sich im Takte bewegen und Thüren öffnen, wobei er sein Maul wie eine Hand gebraucht, Treppen auf- und absteigen und die schönste, älteste, verliebteste Person, die Zeit an einer vorgehaltenen Taschenuhr, die Anzahl der Augen auf einer Karte oder einem Würfel durch Schläge mit dem Fuße auf den Boden angeben und auf jede Frage seines Herrn mit Kopfschütteln oder Kopfnicken oder Ja und Nein antworten.
»Sein Gesichtsausdruck ist sehr ausgezeichnet und nur höchst selten durch den Pinsel wiedergegeben worden. Fast immer vergißt man in den Bildern das eigentlich Eselige. Seine Kopfform ist der des Pferdes sehr ähnlich, aber sein Blick von jenem des Rosses bedeutend verschieden.«
Alle Sinne des zahmen Esels sind gut entwickelt. Obenan steht das Gehör, hierauf folgt das Gesicht und dann der Geruch; Gefühl scheint er wenig zu haben, und der Geschmack ist wohl auch nicht besonders ausgebildet, sonst würde er sicher begehrender, anspruchsvoller sein als das Pferd. Seine geistigen Fähigkeiten sind, wie uns Scheitlin lehrte, nicht so gering als man gewöhnlich annimmt. Er besitzt ein vortreffliches Gedächtnis und findet jeden Weg, welchen er einmal gegangen ist, wieder auf; er ist, so dumm er aussieht, manchmal doch recht schlau und listig, auch keineswegs beständig so gutmüthig als man meint. Zuweilen zeigt er sogar abscheuliche Tücke. Er bleibt plötzlich auf dem Wege stehen, läßt sich selbst durch Schläge nicht zwingen, wirft sich wohl auch mit der Ladung auf die Erde, beißt und schlägt. Manche meinen, daß sein empfindliches Gehör an allem diesen Ursache sei, daß ihn jeder Lärm betäube und erschrecke, obgleich er sonst nicht eben furchtsam, sondern nur launisch ist. Aeußerst sonderbar benimmt sich der Esel in Gegenden, wo es Raubthiere gibt, welche ihm gefährlich werden können. Es ist eine wahre Lust oder ein wahrer Jammer, wie man will, auf einem Esel oder Maulthiere durch eines der engen Gebirgsthäler von Habesch zu reiten. Ueberall wittert das lange Ohr Gefahr. Es dreht und wendet sich nach allen Seiten, neigt sich bedeutsam einem Felsblocke zu, welcher einen guten Hinterhalt abgeben könnte, versucht sogar mit ein Paar kühnen Drehungen das ganze oberhalb liegende Gelände abzuhorchen, richtet sich plötzlich steif in die Höhe und lauscht nach einer Seite hin. Kommt nun gar noch der Geruch dem Gehör zu Hülfe, dann ist es vollends vorbei mit der Seelenruhe des edlen Reitthieres. Es will nicht von der Stelle. Gerade da, wo es steht, ist vielleicht in voriger Nacht das Schauderhafte geschehen, daß ein Löwe, ein Leopard, eine Hiäne, ein anderes greuliches, zur höchsten Vorsicht mahnendes Raubthier über den Weg gegangen ist! Der Esel schnoppert, äugt, lauscht; die Ohren drehen sich förmlich auf dem Kopfe herum; er rührt sich nicht vom Flecke, bis endlich einer der Leute ihm vorausgeht. Dann folgt er, denn er ist schlau genug, einzusehen, daß dieser wahrscheinlich der erste sein würde, welcher in den Krallen des grimmigen Raubthieres verbluten muß, und geht also innerlich beruhigt weiter. Auf seinen Reisen kann der Esel keinen seiner Sinne entbehren. Bindet man ihm die Augen zu, so bleibt er augenblicklich stehen, verhüllt oder verstopft man ihm das Ohr, nicht minder; erst wenn er im vollen Gebrauch seiner Sinne ist, geht er weiter. Nur seine Verliebtheit läßt ihn alles überwinden: wir konnten einen alten, blinden Esel, welcher bestimmt war, oben auf der Höhe eines spanischen Berges den Geiern zur Mahlzeit zu dienen, nur dadurch auf das Gebirge bringen, daß wir eine Eselin vor ihm herführten! Jetzt leitete ihn der Geruchssinn, und er folgte seiner Freundin mit großem Eifer nach.
Der Esel begnügt sich mit der schlechtesten Nahrung, mit dem kärglichsten Futter. Gras und Heu, welches eine wohlerzogene Kuh mit Abscheu verrathendem Schnauben liegen läßt und das Pferd unwillig verschmäht, sind ihm noch Leckerbissen: er nimmt selbst mit Disteln, dornigen Sträuchern und Kräutern vorlieb. Bloß in der Wahl des Getränkes ist er sorgsam; denn er rührt kein Wasser an, welches trübe ist; salzig, brakig darf, rein muß es sein. In Wüsten hat man oft sehr große Noth mit dem Esel, weil er, alles Durstes ungeachtet, nicht von dem trüben Schlauchwasser trinken will. Gleichwohl macht er auch hierin meist weniger Umstände als das in jeder Beziehung anspruchsvollere Pferd.
Bei uns fällt die Roßzeit des Esels in die letzten Frühlings- und ersten Sommermonate; im Süden ist er eigentlich das ganze Jahr hindurch brünstig. Der Hengst erklärt der Eselin mit dem ohrzerreißenden, wohlbekannten »I–a, I–a« seine Liebe, und hängt den langgezogenen, fünf- bis zehnmal wiederholten Lauten noch ein ganzes Dutzend schnaubender Seufzer an. Solche Liebesbewerbung ist unwiderstehlich; sie äußert selbst auf alle Nebenbuhler ihre Macht. Man muß nur in einem Lande gelebt haben, wo es viele Esel gibt, um dies zu erfahren. Sobald eine Eselin ihre Stimme hören läßt, – welch ein Aufruhr unter der gesammten Eselei! Der nächststehende Hengst fühlt sich überaus geschmeichelt, derjenige zu sein, welcher die für ihn so ansprechenden Töne sofort pflichtschuldigst beantworten darf, und brüllt aus Leibeskräften los. Ein zweiter, dritter, vierter, zehnter fällt ein: endlich brüllen alle, alle, alle, und man möchte taub oder halb verrückt werden über ihre Ausdauer. Ob dieses Mitschreien auf zartem Mitgefühl oder nur in der Lust am Schreien selbst beruht, wage ich nicht zu entscheiden; soviel aber ist sicher, daß ein Esel alle übrigen zum Brüllen anregen kann. Die vorhin beschriebenen Eselbuben Kairos, denen die Stimme ihrer Brodthiere viel Vergnügen zu machen scheint, wecken das gesittete Ohren so fürchterlich rührende I–a einfach dadurch, daß sie die ersten Töne jenes unnachahmlichen, kurzgestoßenen »Ji, Ji, Ji«, welches dem Hauptinhalte der Eselsrede vorausgeht, nachahmen: dann übernimmt schon einer der Esel die Mühe, die freudige Erregung weiter fortzupflanzen.
Etwa elf Monate nach der Paarung – gewöhnlich nimmt man einen Zeitraum von 290 Tagen an – wirft die Eselin ein (höchst selten auch zwei) vollkommen ausgebildetes, sehendes Junge, leckt es mit großer Zärtlichkeit ab und bietet ihm schon eine halbe Stunde nach seiner Geburt das Euter dar. Nach fünf bis sechs Monaten kann das Fohlen entwöhnt werden; aber es folgt noch lange seiner Mutter auf allen Wegen nach. Es verlangt auch in der zartesten Jugend keine besondere Wartung oder Pflege, sondern begnügt sich, wie seine Eltern thun, mit jeder Nahrung, welche ihm gereicht wird. Gegen Witterungseinflüsse ist es wenig empfindlich, und daher erkrankt es auch nicht so leicht. Es ist ein überaus munteres, lebhaftes Thier, welches seinen Muthwillen und die innere Fröhlichkeit seines Herzens durch die possirlichsten Sprünge und Bewegungen zu erkennen gibt. Jedem andern Esel geht es mit großer Freude entgegen, aber auch an den Menschen gewöhnt es sich. Wenn man es von der Mutter trennen will, gibt es auf beiden Seiten große Noth. Mutter wie Kind widersetzen sich und geben, wenn ihnen dies nicht hilft, ihren Schmerz und ihre Sehnsucht noch tagelang durch Schreien oder wenigstens durch lebhafte Unruhe zu erkennen. Bei Gefahr vertheidigt die Alte ihr Kind mit Muth und gibt sich selbst lieber preis, achtet sogar Feuer und Wasser nicht, wenn es gilt, ihren Liebling zu schützen. Schon im zweiten Jahre ist der Esel erwachsen; aber erst im dritten Jahre erreicht er seine volle Kraft. Er kann, auch wenn er tüchtig arbeiten muß, ein ziemlich hohes Alter erlangen: man kennt Beispiele, daß Esel vierzig bis fünfzig Jahre alt wurden.
Schon seit alten Zeiten hat man Pferd und Esel mit einander gepaart und durch solche Kreuzung Bastarde erhalten, welche man Maulthiere nennt, wenn der Vater, Maulesel aber, wenn die Mutter zum Eselgeschlecht zählte. Beide haben in ihrer Gestalt mehr von der Mutter als vom Vater, in ihrem Wesen aber mehr von diesem als von jener ererbt.
Das Maulthier ( Asinus vulgaris Mulus ) kommt an Größe fast dem Pferde gleich und ist ihm auch ähnlich gebildet, aber durch die Form des Kopfes, die Länge der Ohren, den an der Wurzel kurz behaarten Schwanz, die schmächtigen Schenkel und die schmäleren Hufe, welche an den Esel erinnern, unterschieden. In der Färbung ähnelt es regelmäßig der Mutter. Es röhrt wie sein Herr Vater.
Der Maulesel ( Asinus vulgaris Hinnus ) behält die unansehnliche Gestalt, die geringe Größe und die langen Ohren seiner Mutter, empfängt vom Pferde nur den dünnern und längern Kopf, die volleren Schenkel, den seiner ganzen Länge nach behaarten Schwanz und die wiehernde Stimme, von seiner Mutter hingegen außer der Gestalt auch die Trägheit.
Pferde und Esel kreuzen sich nicht freiwillig, und es bedarf deshalb die Maulthierzucht immer der menschlichen Beihülfe. Gerade unter den Pferden und Eseln, welche in größerer Freiheit leben, hat man einen Haß zwischen beiden beobachtet, welcher bis zu erbitterten Kämpfen ausartet. Die Kreuzung erfordert mannigfaltige Vorbereitung und besondere Kunstgriffe. Der Esel paart sich leicht mit der Stute, nicht so aber diese mit ihm oder der Hengst mit der Eselin. Gewöhnlich verbindet man der Stute, welche durch einen Esel beschlagen werden soll, die Augen, damit sie den ihr aufgedrungenen Liebhaber nicht sehen kann; auch führt man ihr erst ein schönes Pferd vor und vertauscht dieses dann mit dem Esel. Mit dem Pferdehengste muß man dasselbe thun, was man mit der Stute that. Weit leichter gelingt es, Pferd und Esel zur Paarung zu bringen, wenn man beide von Jugend auf an einander gewöhnt, also zusammen aufgezogen hat. Hierdurch verlieren die Thiere einen guten Theil der natürlichen Abneigung. Bereits die alten Römer sorgten dafür, daß Esel und Pferde, welche zur Maulthierzucht benutzt werden sollten, ununterbrochen beisammen lebten; die Spanier und Südamerikaner wenden dieses Verfahren noch heute an. So gibt man die jungen Eselsfohlen wenige Tage, nachdem sie geboren sind, säugenden Pferdestuten bei, deren Mutterliebe in den meisten Fällen bald alle Abneigung gegen das aufgedrungene Pflegekind besiegt. Zwischen der Alten und dem Säuglinge bildet sich nach kurzer Zeit eine innige Anhänglichkeit aus, welche soweit gehen kann, daß der junge Esel gegen seines Gleichen einen größern Widerwillen zeigt als gegen Pferde. In Südamerika soll es Eselhengste geben, welche durchaus nicht mehr zu einer Paarung mit Eselinnen zu bringen sind.
Eigentümlich ist das Benehmen dieser von Pferden bemutterten Eselhengste. Die Südamerikaner überlassen die Eselinnen auf den ausgedehnten Weiden einzig und allein der Führung ihrer Hengste, und diese üben auch das ihnen übertragene Amt mit der größten Gewissenhaftigkeit aus. Nicht so thun jene. Sie werden bald faul und laufen anstatt der Herde voran, hinter den Stuten her, gleichsam als wollten sie sich noch jetzt bemuttern lassen. Man ist deshalb gezwungen, die zur Maulthierzucht bestimmten Pferdestuten von unvollkommen verschnittenen Pferdehengsten führen zu lassen.
Eine der nothwendigsten Bedingungen zur Maulthierzucht ist: besondere Pflege der trächtigen Pferde- und Eselstuten; denn die Natur rächt sich wegen der gewaltsamen Eingriffe in ihre Gesetze. Gerade bei den durch Esel beschlagenen Pferdestuten oder umgekehrt bei den durch Pferde belegten Eselinnen kommen Fehlgeburten am häufigsten vor. Die Pferdestute trägt das Maulthier etwas länger als ihr eigenes Fohlen; das neugeborne Maulthier steht aber viel eher auf den Beinen als das junge Pferd; dagegen währt die Zeit seines Wachsthums länger als beim Pferde. Unter vier Jahren darf man kein Maulthier zur Arbeit anhalten; dafür währt seine Kraft jedoch regelmäßig bis in das zwanzigste und dreißigste, nicht selten sogar bis in das vierzigste Jahr. Ein Reisender berichtet von einem Maulthiere, welches zweiundfünfzig Jahre alt wurde, und ein römischer Schriftsteller erzählt, daß eins in Athen sogar ein Alter von achtzig Jahren erreichte.
Wegen der größern Nutzbarkeit züchtet man fast ausschließlich Maulthiere. Nur in Spanien und Habesch habe ich Maulesel gesehen; hier schien es gar keine Maulthiere zu geben. Das Maulthier vereinigt die Vorzüge seiner beiden Eltern in sich. Seine Genügsamkeit und Ausdauer, sein sanfter, sicherer Tritt sind Erbtheile des Esels, seine Kraft und sein Muth ein Geschenk seiner Mutter. In allen Gebirgsländern hält man die Maulthiere für unentbehrlich; in Südamerika sind sie dasselbe, was dem Araber die Kamele. Ein gutes Maulthier trägt eine Last von drei Centnern und legt mit ihr täglich drei bis vier Meilen zurück. Dabei bemerkt man selbst nach längerer Reise kaum eine Abnahme der Kräfte, auch wenn das Futter nur spärlich und so schlecht ist, daß ein Pferd es gar nicht genießen würde. In Brasilien ist, laut Tschudi, das Maulthier für den Waarenversandt wie für den Reisenden von unbezahlbarem Werthe. »Seine Stärke, Ausdauer, Klugheit und Sicherheit sind Eigenschaften, welche ihm für diese Bestimmung einen großen Vorzug vor dem weit edlern Pferde geben. Es ist eine durchaus nicht zu gewagte Behauptung, daß ohne das Maulthier die Stufe der Bildung und Gesittung in einem großen Theile Südamerikas eine weit niedrigere wäre als sie heutzutage ist. Allerdings läßt sich nicht in Abrede stellen, daß die Thiere auch viele Untugenden haben, welche ihre Behandlungen für nicht an sie gewöhnte Fremde sehr erschweren und ausnehmend viele Geduld erfordern; aber diese Untugenden treten vollkommen in den Hintergrund im Vergleiche mit ihren außerordentlichen Vorzügen bei langen und beschwerlichen Reisen.«
Tschudi, welcher mit den Maulthiertreibern und ihren Thieren in vielfache Berührung gekommen ist, schildert in ebenso ausführlicher wie belehrender Weise beider Leben und Wirken. Seiner Darstellung will ich das Nachstehende entnehmen:
Der brasilische Maulthiertreiber, Tropeiro genannt, bewerkstelligt mit seinen Maulthiertruppen den Waarenverkehr zwischen den verschiedenen Landestheilen. Er bringt aus den entferntesten Gegenden des Reiches die Erzeugnisse des Bodens und des Gewerbfleißes nach der Küste und führt von hier aus Gegenstände des täglichen Bedarfes und des Luxus zurück, ist der Vermittler des Handels und des Geldverkehrs und spielt daher im Staatshaushalte eine nicht unbedeutende Rolle. Er hat von der Pike auf gedient, ist schon als Knabe mit den Tropas oder Maulthierzügen gegangen und vereinigt alle zu seinem schweren und mühseligen Geschäfte erforderlichen Eigenschaften in sich: Muth, Entschlossenheit, Kraft, Gelenkigkeit, Geistesgegenwart, zähe Ausdauer und größte Genügsamkeit. Einige Acker und Weiden, einige Sklaven und seine Maulthiere sind sein Besitzthum, letztere sein Stolz. Er besorgt und pflegt sie, als wären sie Glieder seiner Familie, gibt jedem von ihnen einen eigenen Namen, kennt die guten und schlechten Eigenschaften eines jeden auf das genaueste, weiß bis auf das Pfund wie viel jedes tragen kann, welches von ihnen er mit Vorsicht erfordernden Waaren beladen darf und welches nicht etc. Zu seinen Maulthieren wählt er sich die schönsten und besten Stücke, welche er zu finden und zu bezahlen vermag, sorgt auch ebenso für gutes, zweckmäßiges Sattelzeug, wie er ihnen eine umsichtige und treffliche Pflege angedeihen läßt.
Jede Tropa wird in kleinere Abtheilungen von je acht, in den südlichen Provinzen von je zehn bis zwölf Thieren zusammen- und unter Aufsicht eines Treibers gestellt. Diese Züge, welche sich in gewissen, nicht allzu geringen Abständen folgen, gehen während der Reise reihenweise hinter einander: jedes einzelne Maulthier nimmt dabei denselben Platz regelmäßig ein, und fast mit pünktlicher Genauigkeit tritt das folgende in die Fußstapfen des vorherschreitenden. Ein Leitthier, Madrinha genannt, führt die ganze Tropa an. Es ist das schönste, kräftigste und erfahrenste Maulthier von allen und auch äußerlich durch sein prächtiges Geschirr ausgezeichnet. Auf dem Kopfe trägt es einen rothen oder bunten Panasch von Baumwolle, auf dem Stirnriemen ein großes silbernes Schild mit dem Namenszuge seines Eigeners; an einem eigenthümlichen Gestelle sind eine Anzahl helltönender Glöcklein angebracht, welche bei jeder Bewegung des Kopfes lustig klingen, und das ganze Leder des Kopfzeuges und Brustriemens, zuweilen auch des Hinterzeuges, ist mit großen oder kleinen silbernen Zieraten bedeckt. Das Thier ist sich seines Werthes bewußt und daher stolz auf seinen Platz: Tropeiros versichern, daß das Leitthier, dem sein Schmuck und seine Glöcklein genommen werden, traurig und oft krank werde. Alle übrigen Maulthiere gewöhnen sich an die Glöckchen der Madrinha und folgen ihr in der Regel freiwillig nach.
Die Tropas machen sehr kurze Tagereisen; denn sie legen, je nach Witterung und Beschaffenheit des Weges, nur zwei, höchstens drei Meilen zurück, wozu sie vier bis sechs Stunden Zeit gebrauchen. Wenn die Tropa im Rancho, einem großen, leeren, auf einer Seite offenen Schuppen, mit Pfählen zum Anbinden der Thiere, nach zurückgelegter Tagereise eintrifft, hat der dem Zuge vorauseilende Tropeiro bereits die erforderlichen Vorkehrungen zur Nachtherberge getroffen, namentlich aus einem benachbarten Verkaufsladen Futter herbeigeschafft. Die ankommenden Maulthiere werden unverzüglich an die erwähnten Pfähle gebunden und entlastet, ihre Packsättel gelüftet und, nachdem jene sich abgekühlt haben, abgenommen, ihre Rücken genau untersucht, wunde Stellen heilkünstlerisch behandelt, fehlende Nägel in die Eisen geschlagen und sonstwie erforderliche Geschäfte besorgt. Unterdessen sind die Thiere ungeduldig geworden; denn sie haben das Geräusch gehört, welches die Treiber verursachen, wenn sie Mais in die Futtersäcke schütten: sie wiehern, scharren, stampfen, beruhigen sich auch erst, wenn jedem sein Futtersack umgehangen worden ist. Und nun beginnen sie die harten Körner zu zermalmen, und thun dies mit so viel Geräusch, als wenn eine Schrotmühle in Bewegung gesetzt worden wäre. Sobald sie die Mahlzeit beendet haben, werden ihnen Futtersäcke und Halftern abgenommen; hierauf wälzen sie sich zunächst, suchen sodann Wasser zum Trinken auf und werden endlich auf die Weide gebracht. Sorgsame Tropeiros lassen sie abends noch einmal zum Rancho treiben und geben ihnen noch etwas Mais zu fressen. Noch ehe der Morgen graut, werden sie auf der Weide gesammelt und oft erst nach langem Suchen und unter vieler Mühe zum Rancho zurückgebracht, gefüttert, beladen und in Bewegung gesetzt. Der Tropeiro reitet voraus, untersucht den Weg und weist den Thieren durch verschiedene Zeichen, auf welche sie sehr sorgfältig achten, die einzuschlagende Richtung an; die Treiber begleiten die einzelnen Abtheilungen und ermuntern, strafen, ordnen und regeln, wo es Noth thut. In dieser Weise geht es, falls nicht sehr heftige Regen die Reise unterbrechen, tagaus tagein, bis das oft zweihundert Meilen und darüber entfernte Ziel erreicht worden ist.
In Peru und Chile werden alljährlich Maulthiere in bedeutender Anzahl eingeführt und mit verhältnismäßig sehr hohen Preisen bezahlt. Man benutzt sie in der ausgedehntesten Weise, ebensowohl zum Reiten wie zum Lasttragen. »Eine Eigenthümlichkeit, welche ich nirgend anderswo gefunden habe«, schreibt mir Haßkarl, »ist die Sitte, bei Geschäfts- und anderen Besuchen in Lima das Maulthier zu verlassen, ohne es anzubinden. Das Thier bleibt vor dem Hause, welches sein Reiter betreten hat, ruhig stehen, ohne sich um das Hin- und Herreiten anderer die Straße besuchenden Menschen und Thiere zu kümmern. Reitet man ein Maulthier, welches noch nicht an das Warten gewöhnt ist, so setzt man ihm einen brillenartigen Augendeckel von Leder auf und geht dann unbesorgt seines Weges. Daß man in Peru und anderen von den Nachkommen der Spanier bewohnten Ländern Südamerikas nur mit ungeheueren, oft fünf bis sieben Centimeter im Durchmesser haltenden Sporen reitet, ist bekannt; daß man aber in Sporen, wie wir sie führen, Marterwerkzeuge zu erkennen glaubt, weiß man bei uns zu Lande nicht. Oft wollte man mir kein Maulthier leihen, wenn ich europäische Sporen trug, und zwar behauptete man, daß ich damit dem Thiere die Adern durchschneiden könne; kam ich dagegen mit den ortsüblichen Sporen an, deren mehr als zwei Centimeter lange Zacken zuweilen bis zur Hälfte mit Haaren und Blut bedeckt waren, so hatte niemand Einwendungen zu erheben.« Einzelne Peruaner und Chilesen halten ihre Thiere allerdings ebenfalls sehr gut; im allgemeinen aber plagt und quält man sie ebenso wie im Mutterlande. Hier wendet man das Maulthier allgemein zum Ziehen an, und zahlt gern dieselben Summen für ein Paar guter »Mulas«, welche ein Paar Pferde kosten. Der Spanier ist stolz auf sein Maulthier und putzt es mit allerlei Flitterwerk, namentlich mit rothen Quasten und Schnüren, bunten Satteldecken und dergleichen bestmöglichst heraus, behandelt es jedoch nur selten gut. Zwar wird es ordentlich abgewartet, bekommt genügend zu fressen und rechtzeitig zu trinken; dafür aber muthet man ihm beinahe Unmögliches zu, und bestraft es hart mit Prügeln, Steinwürfen, auch wohl mit Messerstichen, wenn es den Wünschen des Herrn nicht augenblicklich nachkommt. Eine Reise mit dem spanischen Eilwagen ist eine wahre Höllenfahrt. Fünf Paar Maulthiere werden hinter einander gespannt; auf dem vordersten Sattelthiere sitzt der Vorreiter, hinten auf dem Bocke der Kutscher mit einer fürchterlichen Peitsche und neben ihm noch ein besonderer Maulthiertreiber, welcher einen tüchtigen Knüttel führt. Jedes Maulthier hat seinen besondern Namen erhalten, und der Teufel ist ihm bei seiner »Taufe« gründlich ausgetrieben worden. Das zum Postdienste bestimmte Thier wird fest an einen Pfahl gebunden und außerdem noch durch einen starken Mann gehalten. Ein zweiter Sachverständiger führt eine ungeheure Peitsche in der Hand und prügelt nun plötzlich auf das arme, unschuldige Geschöpf los, ihm dabei aus voller Kehle den bestimmten Namen ins Ohr schreiend. Nach etwa einer Viertelstunde führt man den »Täufling« ab und gibt ihm gut zu fressen; die nächsten Tage aber beginnt die Lehre von neuem, und gewöhnlich hat erst am achten oder zehnten Tage das Maulthier dem Teufel und all seinem Wesen und Wirken entsagt, d. h. sich der Absicht seiner Peiniger gefügt. Wenn es fortan seinen Namen hört, gedenkt es der greulichen Prügel, legt die Ohren zurück und beginnt zu laufen.
Noch in der neuesten Zeit ist wiederholt behauptet worden, daß Maulthier oder Maulesel unfruchtbar seien. Dies ist jedoch nicht immer der Fall. Schon seit den ältesten Zeiten sind Beispiele bekannt, daß die Blendlinge zwischen Esel und Pferd wiederum Junge erzeugten; weil man aber solch ein ungewöhnliches Geschehnis als ein Hexenwerk oder ein unheildrohendes Ereignis betrachtete, sind solche Fälle oft verschwiegen worden. Bekanntlich wird die Maulthierzucht gerade da am eifrigsten betrieben, wo die Herren Pfaffen noch die meiste Macht ausüben, oder was dasselbe sagen will, wo sie noch mit vollem Eifer der Bildung und Gesittung entgegenwirken können. Aus diesen Ländern erfährt man, wie leicht erklärlich, sehr wenig naturwissenschaftliches, und deshalb können wir bis jetzt auch nur von einigen Beispielen reden, welche die Fruchtbarkeit solcher Bastarde bestätigen. Der erste bekannte Fall ereignete sich in Rom im Jahre 1527; später erfuhr man von zwei Fällen in San Domingo. In Valencia in Spanien wurde im Jahre 1762 eine schöne braune Maulthierstute mit einem prächtigen grauen Andalusier gekreuzt und warf nach der üblichen Tragzeit im folgenden Jahre ein sehr schönes fuchsrothes Fohlen mit schwarzer Mähne, welches alle Eigenschaften der guten, reinen Pferderasse zeigte, außerordentlich lebhaft und bereits im Alter von 2½ Jahren zum Reiten geeignet war. Dieselbe Stute warf je zwei Jahre später ein zweites, drittes, viertes und fünftes Fohlen, welche sämmtlich von demselben Hengste erzeugt wurden und alle von gleicher Schönheit wie das erste waren. Auch in Oettingen warf eine Maulthierstute im Jahre 1759 ein männliches, von einem Pferdehengste erzeugtes Fohlen, welches sich nur durch die etwas langen Ohren auszeichnete, sonst aber einem jungen Pferde vollkommen glich. Ein anderes, von Pferd und Maulthierstute erzeugtes Fohlen wurde in Schottland geworfen, aber von den biederen Landleuten, welche das Thier für ein Ungeheuer erklärten, sofort getödtet. Aus der neuern Zeit liegen ebenfalls mehrere Beobachtungen vor, welche die Fortpflanzungsfähigkeit des Maulthieres außer Zweifel stellen.
Ein alter lateinischer Schriftsteller erzählt, daß Caracalla im Jahre 211 unserer Zeitrechnung in Rom neben Tiger, Elefant und Nashorn auch einen Hippotigris auftreten ließ und eigenhändig tödtete. Daß jener Schriftsteller mit der Bezeichnung »Tigerpferd« nur eine Art der afrikanischen gestreiften Wildpferde meinen konnte, dürfte schwerlich bezweifelt werden, und der Engländer H. Smith hat somit Recht, wenn er jenen Namen zur Bezeichnung einer Sippe oder richtiger einer Gruppe der Pferdefamilie anwendet.
Die Tigerpferde ähneln, was ihre Gestalt anlangt, ebensosehr den Rossen wie den Eseln. Ihr Leib ist gedrungen, der Hals stark, der Kopf ein Mittelding zwischen Pferde- und Eselkopf, die Ohren sind ziemlich lang, aber dabei breit, die Haare der aufrechtstehenden Mähne nicht so hart und dick wie beim Pferde, aber doch weniger weich und minder biegsam als beim Esel; der Schwanz ist gegen das Ende hin lang behaart. Alle bekannten Arten haben ein buntes, lebhaft gefärbtes und gestreiftes Fell. Die südliche Hälfte Afrikas ist ihre Heimat, über den Gleicher herüber geht vielleicht nur eine Art. Sie leben auf den Gebirgen und in den Ebenen; doch scheint jede Art ein besonderes Gebiet zu bevorzugen.
Das Quagga (Equus Quagga, Hippotigris Quagga und H. isabellinus) nähert sich in seiner Gestalt dem Pferde mehr als dem Esel, steht jedoch hinter dem Tigerpferde oder Dauw merklich zurück. Der Leib ist sehr wohlgebildet, der Kopf mittelgroß und zierlich; die Ohren sind kurz, die Beine kräftig. Längs des ganzen Halses erhebt sich eine kurze und gerade Mähne; der Schwanz ist von der Wurzel an behaart, der Schweif länger als bei allen übrigen Tigerpferden, jedoch bedeutend kürzer als beim Pferde. In der übrigen Behaarung ähnelt das Quagga dem letztern ebenfalls: das Haar ist kurz und liegt dicht am Leibe an. Ein am Kopfe dunkleres, auf dem Rücken, dem Kreuze und den Seiten helleres Braun ist die Grundfarbe des Felles; der Bauch, die Innenseite der Schenkel und die Schwanzhaare sind rein weiß. Ueber Kopf, Hals und Schultern verlaufen graulichweiße, in das Röthliche ziehende Streifen, welche auf der Stirne und den Schläfen der Länge nach gerichtet und gedrängt, auf den Wangen aber der Quere nach und etwas weiter auseinander gestellt sind. Zwischen den Augen und dem Munde bilden sie ein Dreieck. Auf dem Halse zählt man zehn solcher Binden, welche sich auch in der Mähne zeigen, auf den Schultern vier und auf dem Leibe noch einige, welche, je weiter sie nach hinten zu stehen, um so kürzer und blässer werden. Längs des ganzen Rückens zieht sich eine schwärzlichbraune, zu beiden Seiten röthlichgrau besäumte Binde bis auf den Schwanz herab. Die Ohren sind innen mit weißen Haaren besetzt, außen gelblich weiß, einmal dunkelbraun gebändert. Beide Geschlechter sind sich sehr ähnlich, nur ist das Weibchen etwas kleiner und sein Schweif kürzer. Das erwachsene Männchen wird 2 Meter und mit dem Schwanze 2,6 Meter lang; die Höhe am Widerrist beträgt etwa 1,3 Meter.

Zebra.
Das Tigerpferd oder der Dauw (Equus Burchellii, Asinus und Hippotigris Burchellii, Equus montanus und festivus), unzweifelhaft das edelste seiner Sippschaft, weil in Gestalt am meisten dem Pferde ähnelnd, ist kaum kleiner als das Quagga, über zwei Meter lang, am Widerrist 1,3 Meter hoch, besitzt einen runden Leib mit sehr gewölbtem Nacken, starke Füße und eine aufrechtstehende, kammartige, 13 Centim. hohe Mähne, einen dem Quagga ähnlichen oder pferdeartigen, fast bis zur Wurzel behaarten, ziemlich langen Schwanz und schmale, mittellange Ohren.

Quagga (Equus Quagga). 1/18, natürl. Größe.
Das weiche, glatt anliegende Haar ist oben isabellfarben, unten weiß. Vierzehn schmale schwarze Streifen entspringen an den Nasenlöchern; sieben von ihnen wenden sich auswärts und vereinigen sich mit ebenso vielen, von oben herabkommenden; die übrigen stehen schief längs der Wangen und verbinden sich mit denen des Unterkiefers; einer umringt das Auge. Längs der Mitte des Rückens verläuft ein schwarzer, weiß eingefaßter Streifen, über den Hals hinweg ziehen sich zehn breite schwarze, manchmal getheilte Binden, zwischen denen sich schmale braune einschieben; die letzte Binde spaltet sich nach unten und nimmt drei oder vier andere auf. Die Binden umringen den ganzen Leib, nicht aber auch die Beine; denn diese sind einfarbig weiß.
Das Zebra oder Bergpferd (Equus Zebra, Hippotigris Zebra und antiquorum) endlich, welches etwa die gleiche Größe hat, ist am ganzen Leibe gestreift und hierdurch leicht von dem Dauw zu unterscheiden. Bei genauerer Untersuchung ergeben sich übrigens noch andere Kennzeichen. Es hat in seinem Leibesbau weniger Aehnlichkeit mit dem Pferde als vielmehr mit dem Esel, und zwar vorzugsweise mit dem Dschiggetai. Der auf schlanken, gut gebauten Beinen ruhende Leib ist voll und kräftig, der Hals gebogen, der Kopf kurz, die Schnauze wulstig, der Schwanz mittellang, seiner größten Länge nach kurz und nur gegen das Ende hin lang behaart, also dem Eselschwanze ähnlich, die Mähne dicht, aber sehr kurz. Auf weißem oder hellgelblichem Grunde verlaufen von der Schnauze an bis zu den Hufen Querbänder von glänzend schwarzer oder rothbrauner Färbung; nur die Hinterseite des Bauches und die Innenseite der Oberbeine sind nicht gebändert. Der dunkelbraunschwarze Längsstreifen auf dem Rücken ist ebenfalls vorhanden, und längs des Unterleibes verläuft ein zweiter.
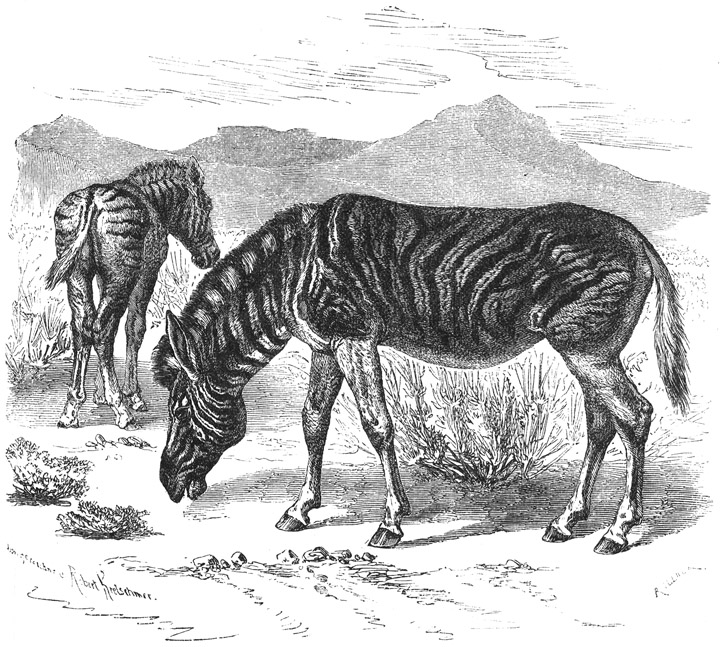
Tigerpferd oder Dauw (Equus Burchellii). 1/16 natürl. Größe.
Wahrscheinlich war es das Zebra, welches den Europäern zuerst bekannt wurde. Ob der Hippotigris, welchen Caracalla tödtete, gerade dieser Art angehörte, läßt sich nicht behaupten, da die Beschreibung dieses Thieres nicht genau genug ist. Auch ein späterer Berichterstatter, Pilostorgius, welcher um das Jahr 425 schrieb und von großen, wilden, gescheckten Eseln spricht, gibt nur eine ungenügende Beschreibung des betreffenden Wildpferdes. Die ersten genaueren Nachrichten erhalten wir durch die Portugiesen, welche nach ihrer Ansiedelung in Ostafrika zunächst das Zebra kennen lernten. Im Jahre 1666 brachte ein Gesandter aus Aethiopien das erste wahre Zebra als Geschenk für den Sultan nach Kairo. Später berichten Kolbe, Sparrman, Levaillant, Lichtenstein, Burchell und Harris über das Freileben, und in der neuern Zeit von Cuvier an alle achtsameren Beobachter über das Gefangenleben der Tigerpferde. Ich versuche aus den mir bekannten Angaben das wichtigste zusammenzustellen.
Heimat und Aufenthaltsorte der sich so nahe verwandten Thiere sind verschieden. Das Quagga findet sich nur im Süden Afrikas, und zwar in Ebenen, nach Norden hin bis zum Vaalflusse; das Tigerpferd, welches ähnliche Gegenden bewohnt, reicht weiter nach Norden herab, wahrscheinlich bis in die Steppen zwischen dem Gleicher und dem zehnten oder zwölften Grade nördlicher Breite; das Zebra endlich lebt ausschließlich in Gebirgsgegenden des südlichen und östlichen Afrika vom Kap bis Abessinien hin.
Quagga und Dauw halten in ziemlich starken Herden zusammen. Die Reisenden sahen sie zu zehn, zwanzig, dreißig Stücken vereinigt; einzelne Beobachter sprechen auch von Gesellschaften, welche Hunderte zählen. So zahlreiche Herden kommen, nach Harris, gegenwärtig nur noch außerhalb der Kapansiedelung vor; innerhalb derselben, und hier auch nur an den Grenzen, sieht man gewöhnlich nur Trupps von zwölf bis zwanzig Stücken. Anders verhält es sich mit dem Dauw, welcher im nördlichen Südafrika noch in sehr starken Herden auftritt. Immer sieht man jede einzelne Art für sich allein. Vielleicht fürchtet ein Tigerpferd das verwandte; vor anderen Thieren aber scheut es sich nicht. So geben alle Beobachter übereinstimmend an, daß man zwischen den Quaggaherden fast regelmäßig Spring- und Buntböcke, Gnus und Straußen findet. Zumal die letzteren sollen die beständigen Begleiter gedachter Wildpferde sein, jedenfalls deshalb, weil diese aus der Wachsamkeit und Vorsicht jener Riesenvögel den besten Vortheil zu ziehen wissen. Nach Harris vereinigt sich der Dauw ebenso regelmäßig mit dem Kokun oder gestreiften Gnu wie das Quagga mit dem Wildebeest oder Gnu; ja es scheint fast, als ob eins der genannten Thiere ohne das andere sich nicht behaglich fühle. Derartige Freundschaften gewisser Thiere mit scheueren, klügeren sind nichts seltenes. Die wachsamsten Mitglieder solcher gemischten Gesellschaften geben dann immer den Ton an; solange sie sich ruhig verhalten, bekümmert sich das ganze übrige Heer um nichts anderes als um ihre Ernährung oder ihren Zeitvertreib; sobald jene stutzig werden, erregen sie die Aufmerksamkeit der Gesammtheit und wenn sie die Flucht ergreifen, folgen alle ihnen nach. Gewöhnlich laufen die alten und jungen Tigerpferde mit einander, zuweilen aber, wahrscheinlich zur Zeit der Paarung, halten sich alte und junge getrennt.
Alle Tigerpferde sind ungemein schnelle, flüchtige, wachsame und scheue Thiere. Sie jagen mit Windeseile dahin, über die Ebene sowohl wie über die Berge. Harris schildert ihr Auftreten und Gebaren in malerischer Weise. »Im Norden des Orangeflusses«, so ungefähr drückt er sich aus, »da wo der Kokun seinen Verwandten, das Gnu, vertritt, lebt im innigsten Verbande mit jenem der Dauw, und zwar hier selten in schwächeren Herden als solchen, welche zwischen achtzig und hundert Stücke zählen. Schwerlich kann man sich ein schöneres Geschöpf denken als dieses prachtvoll gezeichnete, kräftige, wilde, schnelle Kind der Steppe es ist, und sicherlich vermag man kaum eine Vorstellung von dem Eindrucke zu gewinnen, welchen diese ebenso schönen wie lebhaften Thiere hervorrufen, wenn sie im Vollgefühle ihrer Freiheit den heimischen Boden stampfen oder vor dem berittenen Verfolger in geschlossener Reihe dahinjagen. Auf weithin vor dem Auge des Jägers erstreckt sich die sandige Ebene, und bloß hier und da wird deren rothschimmender Grundton durch dunkle Flecken sonnenverbrannten Grases unterbrochen, spärlich nur beschattet durch einzelne Bestände federblätteriger Mimosen und in weitester Ferne begrenzt durch die scharfen Linien im klaren Dufte schwimmender Berge. Inmitten solcher Landschaft erhebt sich eine dichte Staubwolke und steigt, von keinem Lufthauche beirrt, wie eine Rauchsäule zum klaren, blauen Himmel auf. Einige Geier kreisen über ihr. Näher und näher rollt sie heran. Endlich werden dunkele, lebende Wesen, welche sich in ihr wie tanzend zu bewegen scheinen, von Zeit zu Zeit, immer nur auf Augenblicke, sichtbar. Vom Dunkel sich lösend, erglänzen prachtvoll und seltsam gefärbte und gezeichnete Thiere im Strahle der Sonne: und heransprengt, den Bauch auf der Erde, unter dröhnenden Hufschlägen, als ob ein Reiterregiment vorübereile, ein Trupp Tigerpferde, der Vortrab einer geschlossenen, in gedrängter Reihe dahinstürmenden Herde. In ungeordneter Eile jagen sie dahin, Hälse und Schweife gehoben, Nacken an Nacken mit ihren absonderlichen, streifigen, wiederkäuenden Genossen. Jetzt schwenkt und hält der Trupp einen Augenblick um zu sichern. Langsamen Ganges, die Nüstern geweitet, die Mähne gesträubt, mit dem Schweife die Flanken peitschend, tritt ein kräftiger Hengst einige Schritte vor, erkennt den Jäger, schnaubt heftig und springt zu der Herde zurück: und dahin eilt diese von neuem, wiehernd und die gestreiften Köpfe schüttelnd. Ein anderer Halt und neues Sichern. Die kleinen Pferdeohren böswillig nach hinten gelegt, verläßt jetzt eine flüchtige Stute die Reihe, naht, nicht ohne vorher noch ihre behenden Hufe gegen die Rippen eines ihrer Bewunderer zu werfen, dessen Muthwillen ihn verleitet hatte, eine verlockende Gelegenheit wahrzunehmen und ihr einen Liebesbiß beizubringen. Und mit frohlockendem Wiehern und siegestrunkenem und gefallsüchtigem Aufwerfen ihres Hauptes, frei und fessellos wie der Wind, sprengt sie weiter, gefolgt von ihrem keineswegs abgeschreckten Liebhaber, bis der aufwirbelnde Staub beide wieder umhüllt und dem Auge entzieht«.
Eine solche geschlossen dahinjagende Herde von Tigerpferden einzuholen, fällt dem gutberittenen Jäger nicht schwer, so leicht auch ein einzelnes Quagga oder Dauw dem flüchtigsten Reiter entrinnt. Man erzählt, daß die jungen Quaggas, wenn es dem Verfolger gelingt, mit dem Pferde in die Herde zu sprengen und die Fohlen von den Müttern zu trennen, sich willig gefangen geben und dem Pferde nachfolgen wie früher der eigenen Mutter. Es scheint überhaupt zwischen den Tigerpferden und den einhufigen Hausthieren eine gewisse Freundschaft zu bestehen; Quagga und Dauw wenigstens folgen gar nicht selten den Rossen der Reisenden und weiden ruhig unter ihnen.
Durchaus verschieden tritt das Zebra auf. Es bewohnt, laut Harris, ausschließlich Gebirge, nicht allzu selten noch einzelne Berggegenden der Ansiedelung des Vorgebirges, steigt freiwillig niemals in die Ebene herab und vermischt sich daher auch nirgends mit seinen Verwandten. Im Gebirge pflegt es die wildesten und abgelegensten Oertlichkeiten auszuwählen und außerdem stets eine Wache auf einem weiteste Umschau gewährenden Vorsprunge auszustellen. Auf das geringste Lärmzeichen des Wachtthieres ergreift die bunte Herde die Flucht und jagt längs der steilsten Abstürze oder an gähnenden Abgründen vorüber mit einer Schnelligkeit, Behendigkeit und Sicherheit, daß der menschliche Fuß ihr nicht zu folgen vermag, und es dem Jäger nur selten gelingt, mit seiner weittragenden Büchse eines der stolzen Thiere zu erlegen.
In ihrer Nahrung sind die Tigerpferde nicht besonders wählerisch; doch besitzen sie nicht die Anspruchslosigkeit der Esel. Ihre Heimat bietet ihnen genug zu ihrem Unterhalte, und wenn die Nahrung an einem Orte ausgeht, suchen sie andere günstige Stellen auf. So unternehmen Quagga und Dauw, wie die übrigen in Herden lebenden Thiere Südafrikas, zeitweilige Wanderungen, wenn die Trockenheit in jenen wüstenartigen Strecken, welche ihren bevorzugten Aufenthalt ausmachen, alles Grün vernichtet hat. Man hat mehrfach beobachtet, daß sie dann mit verschiedenen Antilopen das bebaute Land besuchen und, plündernd und raubend, den Ansiedlern lästig werden. Mit der beginnenden Regenzeit verlassen sie jedoch freiwillig die bewohnten Gegenden, in denen sie so viele Verfolgungen oder wenigstens Störungen erleiden müssen, und wenden sich wieder ihren alten Weideplätzen zu.
Die Stimme der Tigerpferde ist ebenso verschieden von dem Wiehern des Pferdes wie von dem Röhren des Esels. Nach der Cuvier'schen Beschreibung stößt das Quagga wohl zwanzigmal hinter einander die Silben »Oa, Oa« aus, andere Reisende geben sie durch »Quä, Quä« oder »Quähä« wieder und erklären uns hierdurch zugleich den hottentottischen Namen: das Tigerpferd läßt kurze Laute vernehmen, welche wie »Ju, ju, ju« klingen und selten mehr als dreimal nach einander ausgestoßen werden; über das Geschrei des Zebra finde ich keine Angabe, habe das Thier auch niemals schreien oder wiehern gehört. Im Vergleiche zu dem Pferde und dem Esel, muß man die Tigerpferde als schweigsame Geschöpfe bezeichnen, so wenig dies auch mit ihrer sonstigen Erregbarkeit in Einklang zu bringen ist.
Alle Sinne der Tigerpferde sind scharf. Dem Ohre entgeht nicht das geringste Geräusch, das Auge läßt sich nur äußerst selten täuschen. In ihrem geistigen Wesen stehen sich sämmtliche Arten ziemlich gleich. Ein unbegrenzter Hang zur Freiheit, eine gewisse Wildheit, ja selbst Tücke und ein hoher Muth ist allen gemein. Tapfer wehren sie sich mit Ausschlagen und Beißen gegen die Angriffe der Raubthiere. Die Hiänen lassen sie wohlweislich in Ruhe. Vielleicht gelingt es nur dem gewaltigen Löwen, sich eines Tigerpferdes zu bemächtigen; der freche Leopard stürzt sich wohl nur auf schwächere, weil erwachsene ihn durch Wälzen auf dem Boden abschütteln und durch Ausschlagen und Beißen vertreiben dürften. Der schlimmste Feind ist auch für die Tigerpferde der Mensch. Die Schwierigkeit der Jagd und das schöne Fell der Thiere, welches vielfach Verwendung findet, spornt die Europäer zur Verfolgung des im ganzen sehr unschädlichen Wildes an. Manche Ansiedler am Vorgebirge der Guten Hoffnung jagen Quagga und Dauw mit Leidenschaft, aber auch die Abessinier scheinen den bei ihnen vorkommenden Arten eifrig nachzustellen, weil die Vornehmen den Hals ihrer Pferde gern mit Fransen schmücken, welche aus der bunten Mähne jener wilden Verwandten des Rosses zusammengesetzt sind. Die Europäer erlegen die Tigerpferde mit der Kugel, die Eingebornen mit dem Wurfspeer; häufiger aber werden die schmucken Thiere in Fallgruben gefangen und nachher mit leichter Mühe getödtet oder für die Gefangenschaft bestimmt. Für die eingebornen Bewohner des Innern haben nur die getödteten Tigerpferde Werth, da sie das von den Europäern verschmähte Fleisch als Leckerei betrachten und es, laut Harris, zuweilen selbst dem Löwen abjagen. Ihren »gezähmten« Buschmans zu Gefallen, nehmen wohl auch die Ansiedler das Fleisch eines erlegten Tigerpferdes mit sich heim, während sie sonst nur das Fell benutzen.
Mit Unrecht haben die Tigerpferde für unzähmbar gegolten. Die richtige Hand hat sich nicht genügend mit den herrlichen Thieren beschäftigt, der rechte Ernst, Erfolge zu erzielen, bisher noch gefehlt. Einzelne Versuche gelangen, andere schlugen fehl. Quaggas sind mehrere Male zum Ziehen und Tragen abgerichtet worden. In der Ansiedelung am Kap sieht man nicht allzu selten Quaggas unter den Zugpferden, und in England hatte Sherif Parkins ein Paar dieser schönen Thiere soweit gebracht, daß er sie vor einen leichten Wagen spannen und mit ihnen ganz wie mit Pferden umherfahren konnte. Andere Mittheilungen stehen dem entgegen. Cuvier erzählt von einem gefangenen Quagga, welches sich bisweilen nahe kommen und selbst streicheln ließ, aber ehe man sichs versah, wüthend ausschlug und seinen Pfleger mit Bissen bedrohte. Wenn man es aus einem Pferch in den andern führen wollte, wurde es wüthend, fiel auf die Knie und zerbiß mit den Zähnen alles, was es erreichen konnte. Sparrman berichtet von dem ersten Versuche, welchen ein reicher Ansiedler am Kap mit Tigerpferden anstellte. Der Mann hatte einige jung eingefangene Zebras aufziehen lassen und schien mit ihrem Verhalten zufrieden zu sein. Eines Tages kam er auf den Gedanken, die hübschen Hausthiere vor seinen Wagen zu spannen. Er selbst nahm die Zügel und fuhr mit den Rennern davon. Die Fahrt mußte sehr rasch gegangen sein; denn nach geraumer Zeit befand sich der glückliche Zebrabesitzer in dem gewohnten Stalle seiner Thiere wieder, seinen Wagen zerschellt neben sich. Ein anderes junges Zebra war in seiner Jugend sorgfältig gewartet, später aber wieder vernachlässigt worden, und so änderte sich denn auch seine frühere Sanftmuth und Gelehrigkeit in Falschheit um. Dennoch wollte es ein kühner Reiter versuchen, dieses Thier zu bändigen. Kaum hatte er sich auf den Rücken desselben geschwungen, so schlug es mit großem Ungestüm mit den Hinterbeinen aus, stürzte zusammen und blieb mit dem Reiter auf dem Boden liegen. Plötzlich raffte es sich wieder auf, sprang von einem hohen Flußufer ins Wasser und schüttelte in ihm den Reiter ab; doch dieser hielt sich am Zügel fest und wurde von dem Zebra, welches dem Ufer zuschwamm, wieder glücklich auf das feste Land gezogen. Hier aber empfing er eine Belehrung von den Ansichten seines Reitthieres, welche er höchst wahrscheinlich nie wieder vergessen hat. Das Zebra wandte sich plötzlich um, fuhr mit dem Kopfe nach dem Gesichte seines Bändigers und biß ihm ein Ohr ab.
Diese und ähnliche andere Versuche haben die Ansiedler am Kap stutzig und sie glauben gemacht, daß die Zähmung der Tigerpferde unmöglich wäre; alle verständigen Beobachter aber zweifeln nicht daran, daß wir doch noch die bunten Pferde mit der Zeit zu unserem Dienste verwenden werden. Barrow behauptet, daß der Erfolg sicher sein müsse, wenn man mit mehr Geduld und Umsicht als die holländischen Bauern am Kap zu Werke gehen und nicht vergessen wolle, daß ein von Natur stolzes und muthiges Thier eine andere Behandlung verlangt als ein furchtsames, daß jenes durch Schläge und Mißhandlungen wohl zum hartnäckigsten Widerstande, nicht aber zur demüthigen Unterwerfung gebracht werden könne. Allerdings scheint die Zähmung nicht leicht zu sein, sie ist aber möglich. Dem berühmten Pferdebändiger Rarey haben die Zebras ungleich mehr Mühe gemacht als die wildesten Pferde; allein seine Bemühungen wurden zuletzt doch von Erfolg gekrönt. Auch Cuvier berichtet von einer Zebrastute des Pariser Pflanzengartens, welche höchst gelehrig und so sanft war, daß man sie reiten konnte. Die großartigen Anstalten der Neuheit für Einführung und Einbürgerung nützlicher Thiere geben uns ganz andere Hülfsmittel zur Hand, als unsere Vorfahren sie besaßen. Man wird in den Thiergärten mehr und mehr dieser Thiere züchten und bei den in der Gefangenschaft gebornen Nachkommen schon halbgezähmter Tigerpferde sicherlich das erreichen, was man bei den wilden frischgefangenen vergeblich anstrebte. Auch in diesem Falle wird Beharrlichkeit zum Ziele führen.
Alle Tigerpferde ertragen die Gefangenschaft in Europa ohne Beschwerde. Wenn sie ihr gutes Futter erhalten, befinden sie sich wohl, und wenn man sie gut behandelt, pflanzen sie sich auch in engerer Gefangenschaft fort. Weinland hat in der früher von ihm herausgegebenen Zeitschrift »Der zoologische Garten« eine Zusammenstellung der Thiere gegeben, welche in der Gefangenschaft Nachkommen erzeugten. Aus dieser Aufstellung ersehen wir, daß die Tigerpferde nicht allein mit ihres gleichen, sondern auch mit anderen Einhufern fruchtbar sich vermischen. Schon Buffon erklärte solche Kreuzungen für möglich; die von ihm angestellten Versuche blieben aber erfolglos. Lord Clive wiederholte sie und war glücklicher: er hatte die Zebrastute mit einem zebraartig angemalten Eselhengste zusammengebracht. Später erhielt man in Paris ohne alle derartige Vorbereitung von einem spanischen Esel und einer Zebrastute einen wohlgebildeten Blendling, welcher leider dem Vater mehr ähnelte als der Mutter und sich zudem höchst ungelehrig erwies. In Italien kreuzten sich Esel und Zebra im Jahre 1801, in Schönbrunn beide Thiere zweimal in den vierziger Jahren; leider blieben diese Bastarde nicht lange am Leben. Später dehnte man die Kreuzungen noch weiter aus, und so hat man bis jetzt schon folgende Blendlinge erhalten: Zebra mit Eselin, Eselhengst mit Zebra, Halbesel mit Zebrastute, Halbesel mit Quagga und mit Eselin, Bastard von Zebra und Eselstute und Bastard von Esel und Zebrastute mit einem Pony. Es ist also auch durch diese Fälle die Möglichkeit bewiesen, daß Bastarde wiederum fruchtbar sich vermischen. Die Blendlinge ähnelten gewöhnlich dem Vater; einzelne zeigten jedoch deutliche Zebrastreifen. Ein Dauw- oder Ouaggahengst (die Artbestimmung ist nicht genügend) belegte in England eine kastanienbraune Stute arabischer Abkunft, und diese warf einen weiblichen Bastard, welcher in seiner Gestalt mehr der Mutter ähnelte als dem Vater, braun von Farbe war und einen buschigen Schweif, ein Mittelding zwischen Pferdeschweif und Quaggaschwanz, aber nur wenige Querstreifen am Halse, dem Vorderrücken und einem Theile der Vorder- und Hinterbeine zeigte. Dieser angebliche Quaggabastard vermischte sich wieder fruchtbar mit einem arabischen Pferdehengste und erzeugte ein Fohlen, welches wenigstens noch die kurze aufgerichtete Halsmähne und einige Streifen seines Großvaters besaß. Später ließ man die arabische Stute von einem schwarzen Hengst zu drei verschiedenen Malen belegen, und siehe da, alle geworfenen Fohlen waren mehr oder minder quergestreift. Die erste Paarung mit dem so fremdartigen Thiere zeigte also einen nachhaltigen oder nachwirkenden Einfluß.
Es unterliegt nach diesen Versuchen, welche wir doch als sehr anfängliche bezeichnen müssen, gar keinem Zweifel mehr, daß alle Einhufer sich fruchtbar unter einander vermischen können, und daß die erzeugten Blendlinge wiederum der Fortpflanzung fähig sind. Diese Thatsache stößt den Lehrsatz von den Einpaarlern, welcher zwischen den Naturforschern und ihren Gegnern vielen Streit hervorgerufen, vollständig über den Haufen. Wer nach solchen Beweisen noch an die Unumstößlichkeit des beliebten Lehrsatzes glauben will: »Nur reine Arten können sich fruchtbar unter einander vermischen und Junge erzeugen, welche wiederum fruchtbar sind«, mag es thun; der Naturforscher wird sich mit einer durch das Gegentheil widerlegten Ansicht nicht mehr befreunden können.