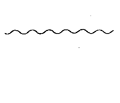|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
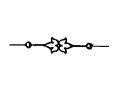
Eudoxia von Mayenwald saß am Fenster ihres Elternhauses vor dem zierlichen Nähtische: aber ihre Aufmerksamkeit war keineswegs von der Arbeit gefesselt. Das fünfzehnjährige Herz schlug etwas aufgeregt, denn sie sollte heute abend mit ihrer Mama zum allererstenmale ein Konzert der Hauptstadt besuchen, weshalb sie auch bereits in geeigneter Toilette prangte. Die fröhlichen Augen schweiften wiederholt zum großen Ankleidespiegel, der gerade die rechte Stellung für diesen Zweck einnahm, und wahrhaftig, ein niedliches Bild glänzte auf dem Glase. Die dunkeln Haare, wellenartig zurückgestrichen, ließen eine rosige, breite Stirne sehen, das feine Näschen war eine Zier in Mitte des blühenden Gesichtes, um den hübschen Mund spielte ein Lächeln, und was die Augen betraf, so lag darin eine liebe, heitere Seele. Ihr Anzug bestand aus einem blauen Baregekleide. Es war eben alles nach der neuesten Mode, da sie erst seit zwei Monaten sich wieder zu Hause befand und die abgelegten Institutskleider eines armen Kindes harrten, um dieses zu Weihnachten auszustaffieren.
Nach einigen solchen Seitenblicken konnte Eudoxia kaum ein lautes Auflachen unterdrücken, denn sie machte Vergleichungen. Welch ein Unterschied zwischen diesem Spiegelbilde und dem Institutszöglinge mit den festgeflochtenen Zöpfen, welche wie angenagelt ums Haupt gewunden waren! dazu das grüne Uniformskleid, unter dem sich dicke Lederschuhe produzierten! Sie erkannte sich kaum selbst in dieser Umwandlung und wünschte sehnlich, daß ihre ehemaligen Mitzöglinge sie sehen könnten. Wie hatten sie sich bei den Fastnachts-Unterhaltungen, Bälle genannt, gegenseitig bewundert, und wie altmodisch und geschmacklos erschienen Eudoxien jene Anzüge gegen den jetzigen! Auch im Institute hatten sie bisweilen selbstveranstaltete Konzerte gehabt, wo das kleine Linchen sang: »Ein junges Lämmchen, weiß wie Schnee« – und Lotte sogar Klavierauszüge einer Oper vortrug; aber heute sollte sie ein wirkliches Konzert von Künstlern hören, sie sollte unter dieser geputzten Menschenmenge selbst im Putze erscheinen. Es begannen sich also ihre Hoffnungen und Träume zu erfüllen, sie betrat wirklich die jugendliche Laufbahn der Vergnügungen, und ein wiederholter Blick nach dem Spiegelbilde erweckte die Hoffnung, in diesem Zauberlande des Glückes selbst eine kleine Rolle zu spielen.
Aus solchen Träumereien wurde sie plötzlich durch den laut nachhallenden Klang der Hausglocke geweckt. Eudoxia sprang auf, denn sie kannte dieses Läuten; wer von uns, der schon sehnsüchtig Briefe erwartete, kennt es nicht? Ja, das kleine erzene Zünglein hat nicht minder einen verschiedenen Ton, als die menschliche Stimme, welche bald leise, weich, zaghaft, bald heftig, schrill, munter oder gebieterisch tönt, obgleich sie aus einem und demselben Munde kommt. Ein wohlgeübtes Ohr kann leicht den bekannten Ankömmling am Läuten der Hausglocke unterscheiden; vor allem ist jedoch der Briefträger erkennbar. Das schallt mit der Zuversicht eines längst Erwarteten, als wollte die Glocke rufen: »Aufgemacht! etwas Neues! Andere warten ebenfalls darauf!«
Eudoxia hatte bereits vier Briefe aus dem Institute erhalten, und trotz ihrer gegenwärtigen Freude sehnte sie sich nach diesen Briefen, besonders jetzt, wo alle Zöglinge wieder dort weilten. Sie kannte also ebenfalls das Läuten des Briefboten, und deshalb sprang sie ihm entgegen, trat jedoch errötend zurück, als wirklich der Briefbote mit lauter Stimme von der Adresse ablas: – »Fräulein Eudoxia von Mayenwald.«
Ein freudiger Schimmer überflog das jugendliche Gesicht; aber im Gefühl ihrer Würde beherrschte sie sogleich die Aufregung und nahm mit ruhiger Miene den lieben Brief in Empfang. Seit den verflossenen zwei Monaten hatte sie bereits gelernt, daß es nicht schicklich sei, die jedesmalige Gemütsbewegung zu zeigen, während sie im Institute nicht nur das Herz auf der Zunge, sondern sogar in den Augen und in jeder Bewegung trugen. Als jedoch der Briefbote ihr den Rücken kehrte, brach die freudige Erwartung hervor. Vor allem drückte sie den Brief an Lippen und Brust und rief: »O du liebes altes Institutssiegel! wie heimelt es mich an!« Dann wandte sie ihn um, betrachtete die Schrift der Adresse und sagte lächelnd: »Nein, die verrät ihre Schreiberin nicht! gerade so gut könnt ich es selbst geschrieben haben. Doch was zerbreche ich mir den Kopf? lieber das Siegel!«
Schon wollte Eudoxia hastig das rote Wachs zerdrücken, plötzlich aber griff sie nach dem Scherchen und machte zwei Schnitte, um das liebe, teure Siegel zu schonen. Nun las sie lachend: » Liebe Doxl!« Das klang ihr vom eigenen Munde so frisch und traut ins Herz hinein. Jetzt wurde sie von niemand mehr mit dieser Abkürzung genannt. Anfangs kam ihr der Mutter freundlicher Ruf: »Eudoxia!« wie der Beginn einer Strafrede vor, denn im Institute war die Abkürzung so allgemein geworden, daß die Lehrerinnen nur bei ernsten Ermahnungen den vollständigen Namen gebrauchten. Freilich schmeichelte es ihr auch wieder gewaltig, nunmehr Fräulein Eudoxia genannt zu werden; ganz unwillkürlich nahm sie dabei eine gar hübsche aufrechte Haltung an und fühlte sich nachgerade als ein zur Huldigung berechtigtes Dämchen.
Nach einer kurzen Pause, während sie die Seiten zählte – und welch ein dicker und eng beschriebener Brief war dies! – blickte sie auf die Unterschrift und rief, sich schüttelnd vor jugendlicher Freude: »Von meiner Fanny! meiner süßen, lieben, einzigen Fanny! – Hätte ich mir's doch gleich denken können! Wer ist auch so gewissenhaft im Halten eines Versprechens, als die rotbackige, ehrliche Fanny! wer opfert soviel Erholungszeit, als sie!« Und wieder küßte sie ihren Brief, indem sie flüsterte: »Diesen Kuß dem ganzen Institute! und jetzt wollen wir einmal sehen, was sie dort treiben.«
Eudoxia stand am Fenster und vertiefte sich bei immer mehr einbrechender Dämmerung in ihren kostbaren Brief, ohne zu bemerken, daß der Bediente die Hänglampe anzündete und die Mutter sich entfernt hatte. Beim Lesen glich ihr junges Gesicht selbst einer wechselvollen Zuschrift – Liebe – Sehnsucht – Heiterkeit – Ernst – Schelmerei, alles wechselte rasch darin und mancher Ausruf klang dazwischen. Sie war erst bis zur Hälfte gekommen, denn manche Stelle las sie wieder und wieder, als der fatale Bediente, auf den sie sich eigentlich etwas einbildete, obwohl er nur ein verkleideter Bauernbube war, mit der Meldung ins Zimmer trat: »Die Herrschaften warten im Salon.«
Eudoxia legte mißmutig ihren Brief zusammen und schob ihn schnell in die Tasche; wenigstens sollte er sie als Talisman ins Konzert begleiten. – Sie wußte schon, ja, sie hatte wie im Traume das Anfahren eines Wagens gehört, sie wußte also, daß Frau von Glauchberg mit ihrer Tochter, der schönen Emma, welche zu ihrer Freundin bestimmt schien, – sie und die Mama ins Konzert abholte. Mit einem kurzen, leisen Seufzer nahm sie von Fanny im Geiste Abschied und begab sich zu der neuen Freundin, von der ihr die Mama schon ins Institut soviel des Verheißenden geschrieben, und der sie in Gedanken damals sehnsüchtig die Arme entgegengebreitet hatte. Doch wie ganz anders war es gekommen! Bei der ersten Begegnung breiteten sich die Arme keineswegs aus; schüchtern reichte sie der feinen, eleganten Emma die Hand und fühlte kaum eine leise Berührung, während im Institute ein fester, herzhafter Druck gleichsam aus dem Gemüte in die Finger fuhr. Bei der vierten Begegnung hatten sie allerdings auf Anordnung der Mütter sich »Du« genannt, aber es war und blieb ein ganz gewöhnliches Du.
Als Eudoxia in den Salon trat, kam ihr Emma freundlich entgegen, und wieder reichten sie sich die Hände. Eudoxia's Blicke hingen mit Bewunderung an der lieblichen Erscheinung, und es überkam sie wie ein Zauber; sie konnte kein Wort hervorbringen, während Emma ihren Schützling von oben bis unten betrachtete, ob auch alles sich dem Konzerte anpasse. – Frau von Glauchberg trat nun zu den beiden Mädchen und sagte: »Es freut mich, Eudoxia, daß du mit meiner Emma zuerst in die Welt trittst, und ich hoffe, ihr werdet ein dauerndes Freundschaftband knüpfen, wie es bei deiner Mutter und mir in gleichen Verhältnissen der Fall gewesen. Möget ihr einst sowohl in traurigen, wie in diesen fröhlichen Stunden so treu zusammenhalten, wie eure Mütter!«
Der Schluß dieser Worte bewegte Eudoxiens weiches Gemüt, und sie machte eine Bewegung, Emma in die Arme zu schließen, die jedoch auswich in sorgsamer Behütung ihres fast duftigen Anzuges, und zum weggelegten Fächer griff, indem sie mahnte, daß es höchste Zeit zur Abfahrt sei. Nun rüstete sich Eudoxia eilig, man stieg in den Wagen, er rasselte durch die beleuchteten Straßen und bald schritten die beiden Mädchen hinter ihren Müttern in den Saal.
Eudoxia war völlig geblendet von dem Lichtermeere, das den Glanz der seidenen Gewänder, Blumen und wohl auch der Edelsteine noch erhöhte. Schüchtern nahm sie neben Emma Platz; dieser aber war es nichts Neues; sie suchte ohne jede Verlegenheit einige ihrer Bekannten auf der Galerie zu entdecken und lenkte auch Eudoxiens Blicke dahin. Aber wie eilig schlug diese die Augen nieder, als sie die Hunderte von Köpfen und all die Ferngläser, welche in den Saal gerichtet waren und auf sie selbst gelenkt schienen, bemerkte! Nun hätte sie sich am liebsten zwischen ihren beiden Nachbarinnen versteckt. Wie nur Emma es wagen konnte, hier zu stehen und sogar umherzuschauen! Sie sehnte sich unaussprechlich nach dem Beginn der Musik und drückte die Hand auf den lieben Brief in ihrer Tasche. Endlich rauschte die Ouvertüre durch den Saal, und bald schwamm ihr Herz so ganz und gar auf den Wogen der Töne, daß sie alles um sich vergessen hatte. In ihrer Lebhaftigkeit wiegte sie oftmals das Haupt, erhob den Fächer nach dem Takte, ihre Augen glänzten, und in das Herz zog ein so weiches, seliges, frommes und dann wieder jauchzendes oder trauriges Gefühl, daß sie der ganzen Umgebung entrückt schien, während manches Auge wohlgefällig lächelnd auf ihr ruhte.
Während der Konzertpause kam Eudoxia wieder zum Bewußtsein; sie erwachte aus ihrer musikalischen Begeisterung, aber dieselbe hatte eine erhöhte Stimmung zurückgelassen. Sie blickte um sich und gewahrte Emma in einer Gruppe höchst eleganter, junger Dämchen und konnte leicht bemerken, daß sie selbst Gegenstand ihrer Besprechung war. Emma's Mutter winkte ihre Tochter zu sich heran und flüsterte derselben etwas zu, hierauf nahm diese ihre anvertraute Gefährtin bei der Hand und stellte sie ihren Bekannten vor. Eudoxia lächelte ihnen nickend entgegen, und bald plauderte das heitere Kind so unbefangen, wie im Institute und auch von ihrem Institute. Am liebsten hätte sie den Brief hervorgezogen und vorgelesen. Ihre kindliche Naivität weckte manches heitere Lächeln der kleinen Schar, alle drängten sich näher um sie, und die beobachtenden Blicke ringsherum erfreuten sich an dem »Gänseblümchen« der freien Natur, welches sich in den künstlichen Rosengarten verirrt hatte.
Wieder begann die Musik; aber Eudoxiens Aufmerksamkeit war nun geteilt; so ganz und gar wie zuvor konnte sie sich nicht mehr hineinversenken; ein zweifacher Eindruck stritt um ihr Herz, und als das Konzert nun zu Ende war, schien es ihr, als ob sie unendlich viel in den wenigen Stunden erlebt hätte. Zu Hause angekommen, warf sie sich stürmisch ihrer Mutter an die Brust und rief ein über das andere Mal: »O Mama, wie schön, wie herrlich ist das gewesen! ich danke dir für diese Freude!«
Noch eine lange Zeit saß sie in seliger Berauschung vor ihrem Bette. Alles wogte durcheinander im jungen Kopfe: Musik, Geplauder, Lichterglanz und Seidenschimmer. Plötzlich gedachte sie ihres noch ungelesenen Briefes; aber nein, jetzt konnte sie ihn nicht hervornehmen! am liebsten hätte sie selbst während der ganzen Nacht das Erlebte in einem Briefe geschildert; doch die Mutter schaute noch einmal ins Schlafzimmer und ermahnte, sich zur Ruhe zu begeben. So mußte sie also beides, Lesen und Schreiben, auf den nächsten Morgen verschieben. Sie legte ihr Köpfchen in die weichen Kissen und begann halb wachend zu träumen; dann entschlief sie, aber es war und blieb ein unruhiger Schlummer.
Als sie am Morgen geweckt wurde, konnte sie den Geist nicht losmachen von den Banden des Schlafes; die sonst so plötzlich geklärten Augen schlossen sich stets aufs neue. Sie träumte, daß alle Lehrerinnen, eine nach der andern, herbeikämen und sie weckten. Statt dieser stand jedoch ihre Mutter vor dem Bette und strich sanft das Haar vom glühenden Gesicht.
Eudoxia beeilte sich nun bei ihrer Toilette, um rechtzeitig am Frühstückstische zu erscheinen. Die unruhige Nacht hatte ihre Konzertbegeisterung herabgestimmt und das strafende Gewissen hielt ihr vor, was ehemals die Lehrerinnen oft gethan hatten: daß sie sich allen neuen Eindrücken zu rückhaltlos hingebe. Wie der Vater nun den gestrigen Abend besprach und scherzend beifügte: »Nun, Eudoxia, du hast gewiß keinen sehnlicheren Wunsch, als schon morgen wieder in der großen Welt zu erscheinen, und ich muß wohl meinen Ballfrack in Bereitschaft setzen?« Da errötete sie und rief: »O nein, Papa, lieber noch nicht!« aber die Antwort hatte nur dem letzten Satze gegolten, und sie fügte schüchtern bei: »Ein Konzert möchte ich freilich bald wieder hören, es war so himmlisch!« und bei diesen Worten gewann der Eindruck des gestrigen Abends wieder die Oberhand.
Nach dem Frühstück besorgte die Mutter gewöhnlich ihre Haushaltungsgeschäfte, in welche nun auch Eudoxia eingeführt werden sollte. Es war bisher von Tag zu Tag verschoben worden; beim Klirren der Schlüssel sagte die Mama: »Eigentlich sollten wir heute mit deiner neuen Pflicht beginnen; aber ich merke schon, du brennst vor Begierde, deinen Institutsbrief zu beantworten; nun, so will ich dir eine Gnadenfrist schenken.«
Eudoxia umarmte ihre Mutter in jugendlicher Lebhaftigkeit und eilte von dannen. In ihrem Stübchen angekommen, entfaltete sie den Brief und begann von neuem beim Anfange. Der Brief enthielt die ausführlichsten Nachrichten, besonders über ihre Weihnachtspläne bei der Armenbescherung.
Eudoxia war gänzlich von seinem Inhalte beherrscht, als sich die Thüre öffnete und Emma's rosiges Gesicht hereinschaute. Mehr schwebend als gehend eilte diese auf die neue Freundin zu und rief:
»Ausgeschlafen nach deinen Triumphen? Haben dich die Lorbeeren nicht ins Köpfchen gestochen?« –
Eudoxia fuhr wie aus einem Traume empor und sagte verwundert:
»Triumphe? – Lorbeeren?«
»Thu' nicht so unbefangen,« neckte Emma mit erhobenem Zeigefinger und setzte bei: »Du weißt gar wohl, wie alle die jungen Mädchen von dir bezaubert waren. Ja, ja, du hast gute Anlage zur Koketterie! Ist das vielleicht auch ein Unterrichtsgegenstand im Institute gewesen?«
Eudoxia's Erstaunen vermehrte sich immer mehr. Das arme Kind hatte kaum je zuvor dieses Wort gehört, viel weniger sich davon einen Begriff gemacht, und nun wurde es auf sie angewendet! Emma rief jedoch: »Nein, sich so zu verstellen! Du weißt gar wohl, wie reizend dir deine Naivität stand und wie du damit Gefallen erregtest. – Ich gönne dir aber den Triumph als ehrliche Freundin, welche beim mütterlichen Auftrage gewissenhaft sein will. Unser gemeinsames Auftreten in der Welt soll ja den Freundschaftsknoten unauflösbar machen! Also nichts von Mißgunst! Laß uns lieber den gestrigen Abend besprechen und sag mir nun einmal dein weises Institutsurteil über jede der neuen Bekannten. Natürlich mußt du mich dann der Reihe nach zu ihnen begleiten, und heute machen wir den Anfang bei Marie Grafenstein.«
Bald begaben sie sich auf den Weg. Marie Grafenstein nahm sie äußerst freundlich auf; verschiedene Zusammenkünfte und Vergnügungen wurden verabredet, und als Eudoxia nach Hause zurückkehrte, konnte sie gar nicht zu Ende kommen mit ihrer Schilderung all der schönen Sachen, welche sie gesehen hatte.
Des Nachmittags erbat sich Eudoxia von der Mutter die Erlaubnis, an Fanny schreiben zu dürfen, und nach Beendigung des langen, langen Briefes hatte diese wieder die Oberhand gewonnen. Als sie des Abends bei ihrer Mutter saß, beriet sie sich vertraulich über die von Fanny angeregte Weihnachtsvorbereitung und fand das herzlichste, freudigste Entgegenkommen und Verständnis. Die Mutter erzählte von einer blinden, armen Frau, welche unlängst an ihrer Enkelin die einzige Stütze verloren hatte. Eudoxia entwarf sogleich einen Plan. Sie wollte ihr Taschengeld zum Ankauf von Strickwolle verwenden, und die Blinde auf diese Weise beschäftigen, zugleich aber auch durch Verkauf der Strümpfe für einen Verdienst sorgen. Jeden Samstag wollte sie nachsehen und dem leiblichen Werke ein geistiges beifügen. Die Mutter versprach, der Einleitung hilfreiche Hand zu bieten, und Eudoxia freute sich herzinnig auf den nächsten Morgen, wo sie Mutter Lene aufsuchen wollten.
Wir müssen uns nunmehr mit Eudoxiens häuslichen Verhältnissen beschäftigen.
Ihre Eltern gehörten zur vermöglichen Adelsklasse und besaßen nur dieses einzige Kind. Es waren höchst verständige Eltern, welche aus diesem Umstande für ihre Tochter keine Verwöhnung und Verzärtelung entstehen ließen, sondern deren Glück im Auge hatten. In der nicht unbegründeten Furcht, gegen das einzige Kind schließlich doch zu nachsichtig zu sein, am meisten aber in weiser Erwägung, daß Kinder unter Kindern aufwachsen sollen, daß jedes zu frühe Einweihen in Verhältnisse anderer Art ihnen die echte Jugendfrische raube; in klarer Beurteilung ihrer Tochter, welche eine übergroße Lebhaftigkeit und völlige Hingebung an jeden neuen Eindruck besaß, und ferner im Hinblick auf die geselligen häuslichen Verhältnisse, die ein gänzliches Fernehalten des heranwachsenden Mädchens unmöglich machten, – hatten sie sich zu einem der größten Opfer, welches Elternliebe bringen kann, entschlossen, und die zehnjährige Eudoxia einem Institute, das ihr vollstes Vertrauen besaß, übergeben. Dieses wurde auch in hohem Grade gerechtfertigt, und bei jedem Vakanzaufenthalte im Elternhause entwickelte das Mädchen neue Vorzüge. Ihr äußeres Benehmen war anständig, natürlich, vom zarten Hauche der Sittsamkeit umgeben; eine fromme Innigkeit strömte gegen Gott und die Eltern aus ihrem Herzen; Lebensfreudigkeit und Jugendfrische, Begeisterung für alles Schöne und Erhabene leuchtete in ihren Augen; sie glich wahrhaft einem vom Morgentau erquickten Röslein. Wie freuten sich die Eltern auf jene Zeit, wo das Röslein im Hause blühen und duften würde, und diese Zeit war endlich, nach fünfjähriger Trennung, gekommen. Nun erfreuten sie sich an Eudoxiens fröhlichem Lachen und Geplauder; auch die Vergnügungen der Welt, welche ihnen bereits zur geselligen Last geworden, gewannen wieder neuen Reiz für Vater und Mutter, denn nun sollten sie mit Eudoxiens Augen sehen, mit Eudoxiens Ohren hören und mit dem jungen Herzen über die neuen Eindrücke jubeln.
Aber nicht nur eine neue Welt des Vergnügens erschloß sich dem Mädchen, es wurde auch in eine neue Welt der Pflichten eingeführt. Nun galt es, das Gelernte anzuwenden, und zwar nicht jenes Bücherwissen, das sie im Institute gewonnen, sondern weit mehr die Errungenschaften ihrer Seele.
Da war zuerst der alte Großvater, der einsam und fast gelähmt, jedoch frischen Geistes, in seinem Zimmer lebte. Ihm eine liebe, heitere Pflegerin zu sein, und sich mit den Eltern in die süße Pflicht zu teilen, ihm den Lebensabend zu erhellen, das war ein Teil von Eudoxiens neuen Pflichten. Seit den wenigen Wochen ihres Aufenthaltes im Elternhause hatte sie diese Pflicht bereits aufs lieblichste geübt. Wenn sie des Morgens leichten Trittes in die Stube des alten Mannes schlüpfte und ihn anlächelte, war's wie ein Sonnenstrahl für sein Herz. Sie schlang liebkosend die Arme um seinen Hals und jubelte: »Großpapa, ein neuer Tag! was wird er alles bringen?« – Dann sagte der Greis: »Gott gebe, nur Gutes, mein Kind;« und sie entgegnete verwundert: »Was sonst denn, Großpapa? natürlich nur Gutes!« und das zuversichtliche, strahlende Angesicht teilte seine Zuversicht dem Greise mit. Dann setzte sie sich an das Klavier und sang ihre Institutslieder; manche davon waren noch aus »seiner Zeit«, wie er sich ausdrückte, und dies verband die beiden noch inniger. Er suchte aus seinen eigenen Noten manches Lied froher Erinnerungen hervor; Eudoxia lernte es, und wenn es so recht süß zwischen ihren Lippen hervorklang, wenn sie dann vor dem lauschenden Alten kniete und schmeichelnd fragte: »War es so, Großpapa?« – dann schloß er das liebe, junge Haupt zwischen die zitternden Hände und küßte in Rührung die Stirne der Enkelin.
Zu anderer Tageszeit horchte sie mit ernster, fast andächtiger Miene, auf einem Schemel zu des Großvaters Füßen sitzend, die Hände über dessen Knieen gefaltet, auf die Erzählungen seines langen, erfahrungsreichen Lebens. Dies alles war viel schöner, als die Büchergeschichten, welche nur von fremden Personen handelten und erdichtete Begebenheiten enthielten; der Großpapa hingegen erzählte von Tanten, Onkeln, von der Mutter und der Großmama; dann öffnete er bisweilen eine Schublade des geheimnisvollen Schreibtisches und nahm alte, halbverblichene Miniaturbilder hervor. Darunter war eines mit Perlen umgeben, eine schöne, junge Frau, gar seltsam gekleidet und doch so ähnlich mit Eudoxiens eigenem Gesichte. Der Großpapa küßte es – ja, die alten Lippen zitterten vor Wehmut, als er sagte: »Sie hieß Eudoxia, wie du, mein Liebling! werde ihr gleich im Herzen, wie in den Augen.« – Sie verstand ihn und schlang wieder die Arme um ihn, schweigend, um die Erinnerung nicht zu stören.
Am Sonntagsmorgen, wenn sie von der Kirche zurückkehrte, setzte sich Eudoxia vor den Großvater, der nicht mehr ausgehen konnte, und las ihm aus einem Gebetbuche vor; beim Schlusse legte er zum Segen die Hand auf ihr Haupt.
Ein andermal plauderten die rosigen Lippen von all den frischen Eindrücken, welche ihre Phantasie erregten; dann bekam der Großvater auch ihre Institutsgeschichten zu hören, und der Greis schenkte ihr ein williges Ohr, ja, er wußte ihr viel Gutes darüber zu sagen. – Wenn der Abend kam und der Briefbote die Zeitungen brachte, war sie nicht selten die Vorleserin. Was sie nicht verstand, wurde ihr freundlich erklärt, denn er hatte keineswegs die Ansicht, es sei nichts für Frauen. Einmal, als der Vater scherzend sagte: »Aber, Papa, mache mir die Kleine nicht zu politisch!« rief er beinahe mit Begeisterung: »Lass' sie immerhin teilnehmen an den Hoffnungen und Befürchtungen unserer Tage. Auch die Frauen stehen mitten im Leben, und wenn sie auch nicht mithandeln können, so müssen sie doch teilnehmen an Schmerz und Freude.« Dann erzählte er von jener harten Zeit seiner eigenen Jugend, wo die Großmama mit starkem Gottvertrauen seinen Mut aufrecht erhalten, sich in die schwersten Opfer fürs Vaterland willig gefügt und für die Armen und Verwundeten gesorgt habe.
Dies war jedoch nur ein Teil von Eudoxiens neuen Pflichten; andere riefen sie an die Seite der Mutter. Dieselbe hegte die Ansicht, daß kein weibliches Wesen, wes Standes es auch sein möge, sich von den Geschäften des Haushaltes lossagen dürfe, wenn es den Namen einer ›deutschen Hausfrau‹ verdienen wolle. Ob auch reich und nicht an Entsagung gewöhnt, betrachtete sie jede Verschwendung als Raub an einem edlen Zwecke. Sie unterschätzte nicht den Wert des Geldes, mit welchem soviel Gutes gestiftet, so viele Not gelindert werden kann, und bedachte, wieviel weise Sparsamkeit zu erübrigen vermag. Sie sagte sich selbst: – nur ein einsichtsvolles Befehlen hat ein williges Gehorchen zur Folge; um hierzu im stande zu sein, muß man ausüben können, was man anordnet, oder wenigstens wissen, wie es geschehen soll. Zugleich hatte sie das strengste Pflichtgefühl, ihrem Gatten eine geordnete, gemütliche Häuslichkeit zu bereiten, und das sollte auch Eudoxia frühzeitig gewinnen, indem sie bei der Mutter in die Lehre ging. Zu den geselligen Thee- und Souper-Abenden mußte sie auf diese Weise ihre kleine Pflicht beisteuern und durfte nicht nur hübsch gekleidet erscheinen.
Zu diesen häuslichen und geselligen Pflichten hatte Eudoxia, wie wir am Schlusse des letzten Kapitels gesehen, ermuntert von ihrer guten, lieben Fanny, auch noch eine weitere Pflicht, die Armenpflicht, übernommen, und wir wollen nun sehen, wie sie alles dies in Einklang zu bringen wußte.
Als Eudoxia von ihren Besuchen nach Hause kam, dachte sie an diesem Tage zum erstenmale an den lieben Großpapa, den sie heute so ganz vernachlässigt hatte. Vor Tisch war nicht mehr genug Zeit, das Versäumte nachzuholen, aber dann gleich sollte es geschehen. Es kamen ein paar Besuche und so neigte sich der Tag bereits zur Dämmerung, als sie etwas langsam und schüchtern sich dem einsamen Zimmer näherte. Sie öffnete leise die Thüre, steckte das blonde Köpfchen zwischen die Lücke und fragte im schmeichelndsten Tone: »Großpapa, darf ich kommen?«
Dieser erwachte aus seinen ungestörten Träumereien und entgegnete: »Warum fragt mein Kind? ist es denn nicht immer ersehnt in dieser einsamen Stube, gleich dem Sonnenstrahl im kalten Winter?«
Diese freundliche Anrede, durch welche aber ein wehmutsvoller Ton klang, legte sich vorwurfsvoll auf Eudoxiens Herz; sie näherte sich dem Großvater, kniete zu seinen Füßen nieder, legte ihr Haupt auf dessen Kniee und flüsterte: »Großpapa, weißt du, warum ich gefragt habe?«
»Nein, mein Liebling,« entgegnete der Greis, und sie fuhr fort: »Nun, so will ich's dir beichten. – Großpapa, ich war gestern in einem Konzerte.«
Der Alte lächelte, fuhr mit der Hand zärtlich über des Mädchens Haar und sagte: »Ei, das ist freilich eine große Sünde!«
Eudoxia erhob nun das etwas erglühte Köpfchen, sah ihn treuherzig an und entgegnete: »Großpapa, du mußt nicht scherzen! ich bin sehr schlimm gewesen, ich, ich, nicht das Konzert.« Jetzt sprang sie auf und rief: »Das Konzert war herrlich! Wie das wogte und ineinanderrauschte, die Seele ergriff und das Herz bald traurig, bald jubeln machte! Und der schöne, große Saal mit den Hunderten von Lichtern, und die vielen schönen Menschen; Großpapa, es war berauschend!«
Der Alte sah auf das begeisterte Mädchen und sagte lächelnd: »Eudoxia, es scheint, du hast dein musikalisches Räuschlein noch nicht ausgeschlafen?«
Dies brachte sie augenblicklich zur Besinnung. Sie schlug sich an die Stirne, seufzte, neigte sich wieder zum Greise und flüsterte: »Nun hab ich wieder alles vergessen gehabt – meine Beichte.«
»Also, mein Kind?«
»Laß dir erzählen, Großpapa. – Am Morgen las ich Fanny's Brief. – O, du weißt noch gar nicht, daß ich einen Brief von Fanny bekam? Es ist so ein langer, prächtiger Brief; du mußt ihn von Anfang bis Ende lesen, Großpapa.«
Alle Traurigkeit war aus Eudoxiens Gesicht verschwunden; es strahlte förmlich von Freude, als sie den Brief aus der Tasche zog. Der Greis fragte nun mit einem forschenden Blicke, in welchem viel Bedeutung lag: »Gehört der Brief auch zu deiner Beichte?«
Das Mädchen errötete im vollen Verständnis dessen, was die Frage meinte, und flüsterte wieder: »Großpapa, verzeih! Ich wollte dir meine Fehler bekennen, aber nun wird mich auch nichts mehr davon abbringen. Ich las den guten Brief, der keine Sünde ist, sondern etwas viel, viel Besseres, als deine schwache Eudoxia, und dann kam Emma, wir plauderten vom Konzerte und von allerlei, – dann zog sie mich mit fort zu den neuen Freundinnen, sie konnten so schön reden und entwarfen so schöne Pläne; darüber vergaß ich dich, unsere Morgenstunde, meinen lieben, einsamen Großpapa; so blieb dein Stübchen ohne Sonnenschein, und ich ward deine Wolke. Darum getraute ich mich nicht zu dir herein und fragte erst, ob ich kommen dürfe. Und nun, Großpapa, gib mir eine gute Lehre, dann aber verzeih mir!«
Sie faltete die Hände und sah ihm treuherzig in die Augen; er aber sagte: »Das ist freilich schlimm, sogar sehr schlimm, wenn es der Anfang ist zu ...«
Eudoxia unterbrach ihn und rief mit Feuereifer: »Großpapa, ich weiß, was du sagen willst; es ist aber kein Anfang, sondern zugleich das Ende. Ich will gar nicht mehr in ein Konzert gehen, ich will nicht mehr ...«
»Oh, oh! rief der Greis; nicht so vorschnell, Eudoxia! Weißt du noch, wie du als zehnjähriges Kind toll und übermütig auf der ebenen, blumenreichen Wiese sprangst, niedersankst und den Fuß verrenktest? Weißt, du noch, wie du vierzehn Tage auf dem Sofa lagst unter Schmerzen? Dennoch bist du später unzählige Male auf der grünen, blumenreichen Wiese gegangen, nachdem du uns versprochen hattest, nicht mehr so toll zu springen, sondern nur die schönen Blumen zu Kränzen und Sträußen zu pflücken. Seit jener Zeit hat die Wiese fünfmal herrlich geblüht; ist mein Liebling inzwischen nicht weiser geworden?«
»Großpapa, ich danke dir!« Das Mädchen drückte die rosigen Lippen innig auf seine Hand und bald darauf beleuchtete der Lampenschein die beiden; Eudoxia las die Zeitung vor, blickte aber dazwischen verstohlen auf den Großvater, dessen Augen heute in noch reinerem Liebesglanze auf ihr ruhten.
Nachdem sie also am neuen Tage dem Großvater ihre sorgende Liebespflege gewidmet hatte, auch bei der Mutter in die Lehre gegangen war, um dereinst »eine deutsche Hausfrau« zu werden, verabredete sie mit derselben für Nachmittag eine Ausfahrt.
Eudoxia hatte ihr Taschengeld überzählt und berechnet, welche nötigen Ausgaben sie davon in diesem Monate bestreiten mußte, denn es oblag ihr die Sorge für den Anzug, und wieviel ihr noch zur Verfügung bleibe. Bei der ersteren Berechnung ging sie sehr genau zu Werke. Zu ihren guten Vorsätzen gehörte, sich zwar immer standesgemäß zu kleiden, aber sich keinen überflüssigen Luxus zu erlauben; ferner nichts auf Vergnügungen zu verwenden, denn (sagte sie sich) die Eltern verschaffen mir genug Vergnügungen, und es soll meine schönste Freude sein, andere zu erfreuen und Thränen zu trocknen. Da sie erst neu ausgestattet worden war, blieb ihr also eine hübsche Summe zur Verfügung, und diese wollte sie ganz und gar für ihr Armenwerk verwenden.
Mit von Begeisterung glühendem Angesichte und auch etwas stolz auf ihre eigene Weisheit, verfügte sie sich zur Mama. Ehe sie ausfuhren, forschte dieselbe freundlich: »Was hast du nun im Sinne, liebe Eudoxia? Laß einmal hören.«
Das Mädchen antwortete mit starkem Selbstbewußtsein: »Mama, wenn du so gütig sein willst, mich zu begleiten, wollen wir Strickwolle für meine Blinde kaufen.«
»Aber wieviel denkst du darauf zu verwenden?«
Eudoxia nannte eine überaus ansehnliche Quantität; die Mama meinte etwas bedenklich, es möchte doch ihre Kräfte übersteigen und fügte bei: »Ich möchte dir raten, mein Kind ...«
Aber Eudoxia hielt der Mama die beiden Hände vor den Mund und sagte schmeichelnd: »Mama, bitte, sag nichts, gar nichts! laß mich's ganz allein ausdenken. Du weißt ja, bei Armensachen ist das Geheimnis nicht nur erlaubt, sondern sogar geboten.«
Die Mutter wollte sich dem Vertrauen ihrer Tochter nicht aufdrängen, und somit fuhren sie ohne weitere Verabredung in den Kaufladen, beluden den halben Rücksitz mit Strickwolle, und dann rollte der Wagen zur blinden Alten.
Mutter Lene bewohnte ein sehr dürftig eingerichtetes, aber dennoch reinliches Stübchen; sie selbst zeigte an sich jene Wohlanständigkeit, welche stets die Begleiterin eines frommen Gemütes ist und in der »Schule Gottes« errungen wird. Als die beiden sich näherten, erkannte ihr feines geübtes Gehör sogleich ihre Wohlthäterin, denn Frau von Mayenwald hatte längst dieses dunkle Armenstübchen durch ihre Wohlthaten etwas erhellt. Die Blinde erhob sich und wollte ihr entgegengehen; dann unterschied das feine Gehör auch die nachfolgenden Schritte, und ihr Antlitz verriet die unausgesprochene Frage. Frau von Mayenwald aber sagte: »Gott zum Gruß, Mutter Lene! ich bring' Euch da meine Eudoxia, sie will meine Stelle bei Euch vertreten.«
Die Alte streckte die Rechte aus in die dunkle Leere, und sogleich ruhte Eudoxiens zarte Hand mit herzlichem Drucke in derselben. – Oh, es gibt ein so verschiedenes Darreichen der Hand! Wer hat nicht schon diese stumme Sprache kennen gelernt? – Wie manchmal zieht sich das entgegenwallende Herz zurück, wenn sich eine Hand in die ausgestreckte legt, so flüchtig, so gleichgültig, als ob ein leiser, kalter Windhauch sie berührt hätte! Oder das Herz erwärmt sich bei einem Händedrucke – fest und doch weich, der den Weg vom tiefsten Innern bis in die Finger augenblicklich zurücklegt und unbeschreiblich vieles sagt. Nur ganz warme, tiefe Naturen verstehen sich auf solches Händedrücken.
Anfangs war Eudoxia schüchtern bei der übernommenen Armenpflege; man hätte beinahe meinen können, daß sie die Empfängerin statt der Geberin sei; mit ungewöhnlichem Zittern der Stimme machte sie der Alten ihre Vorschläge; als sich aber deren Antlitz freudig verklärte, da wurde Eudoxia frisch und mutig, sie legte den leichten Mantel ab und sagte bittend zur Mutter: »Mama, erlaube, daß wir den ersten Strang abwinden, und dann können wir sogleich ans Werk gehen. Da sind auch die Nadeln, ich brauche ihr nur die Maschenzahl anzugeben.«
Frau von Mayenwald blickte mit wahrer Freude auf ihre Tochter; sie gab dem Kutscher Befehl, nach Hause zu fahren, und die beiden verweilten eine volle Stunde in der kleinen Stube. Vor ihrem Weggehen legte Eudoxia noch etwas Geld für die kommende Woche als Vorausbezahlung in die Hände der Blinden, und dann verließen sie unter lauten Segenswünschen der Alten das Stüblein mit dem Versprechen, jeden Samstag wiederzukommen.
Daheim eilte Eudoxia zum Großvater, warf sich an dessen Brust und sagte: »O Großpapa! heute bin ich glücklich! Weißt du – heute habe ich meine ganze Pflicht erfüllt.«
Die Tage verstrichen nun Eudoxien mit einfacher, doch angenehmer Abwechslung, in leichter und süßer Pflichterfüllung. Der Großvater schien sich durch ihre Nähe zu verjüngen, und wie der morsche Baum unter der Allgewalt des Frühlings, beim weichen Hauche des Zephyrs, dem lustigen Geplauder des Bächleins, noch einmal neue Triebe hervorbringt, so war es oft, als ob die jugendliche Freude auch des Greises Jugendtage erneue. Er gewann sein Enkelkind immer lieber, und sobald sie nur ins Zimmer schwebte, glänzte sein Angesicht, jede ernste Wolke entschwand. Dies wußte sie auch sehr wohl; es vermehrte ihre kindliche Hingebung und den Eifer in dieser Pflichterfüllung.
Auch die Mutter hatte ihre Freude an dem Mädchen; die häuslichen Verrichtungen, oder die Aufsicht darüber, gehörte nun zu den Annehmlichkeiten des Tages. Eudoxia ergriff all dieses Neue mit brennendem Eifer. Das Geklingel ihres großen Schlüsselbundes hatte etwas Fröhliches, und gewann sogar eine Macht übers Gesinde. Sie verstand es so allerliebst, ihre Befehle zu erteilen, etwas zu rügen, oder ihre Unkenntnis zu verstecken, daß alle für ihr gnädiges Fräulein die größte Bereitwilligkeit bewiesen.
Eudoxiens Einfluß zeigte sich auch an den ehemals so monotonen Theeabenden, wo das Gespräch zwischen Neuigkeiten und Theaterkritiken geschwankt hatte. Nun brachten die Mütter ihre Töchter mit und bald wußte Eudoxia durch ihr eigenes, naives Wesen die ganze Gesellschaft zu vereinen. Die Eltern fügten sich freundlich, als sie ihre gemeinschaftlichen Institutsspiele einführte; sogar der Papa ließ sich einmal verleiten, ein aufgegebenes Wort zu erraten, aber auch nur das eine Mal, denn er bewies sich dabei sehr ungeschickt, worüber Eudoxia in lauten Jubel ausbrach.
Eudoxia hatte nun eine ganze Schar lieber Freundinnen; sie waren alle so zuvorkommend, man vernahm nie ein derbes Wort; es waren keine Versöhnungsszenen nötig, da kein Wortwechsel entstand, und Eudoxia konnte dieselben in ihren langen, wöchentlichen Briefen an Fanny nicht genug rühmen; in jedem tauchte eine neue Freundschaft auf; bald schien Emma, bald Marie den Vorrang zu behaupten; dann wieder schwebte eine andere auf den Wogen ihres jungen Herzens. Als Fanny schüchtern mit unverkennbarem Tone der Entsagung nach der Erkorenen fragte, konnte Eudoxia nicht ins klare kommen, und im Aufwallen ihres liebevollen Herzens zerteilte sie den unauflösbaren Knoten mit dem Satze: » Fanny, alte, liebe Fanny! das bist du!«
Auch Mutter Lene spielte allmählich in Eudoxiens Leben eine mächtige Rolle. Nach den ersten Wochen, in welchen sie nur den Zweck im Auge hatte, die Blinde zu beschäftigen und zu unterstützen, indem sie ihr Arbeit und Lohn erteilte, und alle ihre Freundinnen zur »Kundschaft« machte, hatte sie sich mit Mutter Lene auf vertrauten Fuß gestellt. An jedem Samstage verweilte sie dort einige Minuten länger, bis sie endlich dafür eine Stunde festsetzte und dieselbe auf ihrer Uhr genau bemaß. Eudoxia merkte bald, daß »ihr altes Kind«, wie sie Mutter Lene im schützenden Gefühle nannte, weit mehr innere Bildung besaß, als man gewöhnlich in dieser Menschenklasse findet, und daß die Armut nicht ihr einziges Leiden war, sondern daß auf ihrem Gemüte das Dunkel des Schmerzes lag. An einem Samstage erschloß die Blinde ihr diesen dunkeln Raum. Sie erzählte von der lieben, hingeschiedenen Enkelin, welche das Licht ihres Geistes gewesen, und wie sie seit diesem Verluste erst ganz im Finstern lebe; nun werde sie nicht mehr durch all die glorreichen Beispiele gestärkt – dabei zeigte sie mit dem Finger auf das Legendenbuch, welches seit lange unberührt lag.
Eudoxia hatte mit Thränen in den Augen zugehört und gefühlt, daß die Erhaltung des Lebens solch einer Blinden nur die halbe Wohlthat ohne die Spendung des innern Trostes sei. Eilig langte sie nach dem Buche, schlug es auf, und die Blätter teilten sich bei der Lebens- und Leidensgeschichte der stillen, kranken Dulderin Lidwina. Sogleich begann sie vorzulesen, und von diesem Tage an setzte sie es bei jedem Besuche fort. Die Blinde lebte nun in sechstägiger, freudiger Erwartung dieser Stunde, und ihr Geist zehrte inzwischen an dieser Nahrung. Es trat nun wieder etwas Neues in ihre Gedankenwelt, die sich bisher nur mit dem Verluste ihrer Enkelin beschäftigt hatte. Eudoxia brachte Bücher aus ihrer eigenen Bibliothek und reihte an die fromme Lesung andere erbauliche, auch erheiternde Geschichten. Nach und nach kam wieder jenes stille Lächeln, welches das Alter so verschönt, wie der Mondschein den Abend, in das Antlitz der Blinden.
So verstrich der Herbst, und nun kamen die letzten Wochen vor Weihnachten, diese selige Zeit, welche alle Gefühle pflegt und dem Liebeswalten so reiche Gelegenheit bietet. Eudoxia erschrak ein wenig bei Ueberzählung ihrer Kasse, und jetzt fiel ihr Blick auf den überreichen Vorrat an Strickwolle. Sie tupfte sich an die Stirne und gestand sich ein, es wäre doch besser gewesen, wenn sie damals die erfahrene Mutter um Rat gefragt hätte. Für ihre Toilette brauchte sie freilich kein Geld – nur daran hatte sie damals gedacht; – aber wie sollte sie nun die lieben, herrlichen Weihnachtsausgaben bestreiten? Es half nichts, sie mußte zum Papa gehen, und mit vollem, demütigem Eingeständnisse um ein Anlehen bitten.
Der Papa nannte sie eine schlechte Haushälterin, und dies keineswegs im Scherze, sondern im vollen Ernste. Er gab ihr das Verlangte, doch mit dem Vorbehalt eines dreimonatlichen Abzuges. Etwas beschämt schlich Eudoxia sich in ihr Stübchen und schmollte sogar ein wenig. Aber die Gedanken an alle zu treffenden Vorbereitungen verscheuchten bald jene unangenehme Empfindung.
O du wunderbare Weihnachtszeit mit deinen unzähligen Geheimnissen! du Zeit der Freuden, wo die Armen und Reichen in einem Gefühle sich begegnen, du Zeit, durch welche immer noch das Gloria tönt, wo Himmel und Erde ineinanderfließen: wie jubelnd wurdest du von Eudoxia begangen! Sie war unerschöpflich in Plänen und verstand es, die geheimsten Wünsche zu erraten. Ihr Geldvorrat reichte weit, denn ein sinniges Geben verfällt nicht auf Kostbarkeiten; die kleinsten Gaben sind gleich den vergoldeten Nüssen mit dem echten Golde der Liebe umkleidet.
In Eudoxiens Stübchen waltete nun emsige Geschäftigkeit. Alle sollten beschenkt werden: der Großpapa, die Eltern, die Freundinnen, Mutter Lene, die Lieben im Institute, vor allen ihre Fanny, und dann auch das Gesinde im Hause. Oft meinte sie, den Weihnachtsabend nicht erwarten zu können, und wie die schwellenden Knospen im Frühlinge von Minute zu Minute dem Aufbrechen nahe sind, so ging es auch mit den kleinen Geheimnissen dieser menschlichen Frühlingsknospe.
In ihrem Stübchen sah es auch dem Lenze gleich. Sie übte die im Institute erlernte Kunst des Blumenmachens. Große Guirlanden sollten den Salon schmücken; jeder Name aus Blumen und Moos das Plätzchen, wo die Geschenke zu liegen kamen, bezeichnen, die ganze Dienerschaft sollte, den Hirten gleich, zur Krippe kommen.
Täglich machte Eudoxia neue Entdeckungen von heimlichen Wünschen in ihrer Umgebung. »O, wer sie alle, alle erfüllen könnte!« seufzte das liebende Herz. Als der Papa nach dem Essen im Lehnstuhle seine Siesta hielt, schlich sie herbei und sah ihn so lange an, bis er durch die geschlossenen Augen ihre Blicke fühlte und sie aufschlug, indem er lächelnd fragte: »Was hat meine kleine Hexe vor?« Da setzte sie sich schmeichelnd auf sein Knie und sagte: »Papa, weißt du, was ich dachte?« Kopfschüttelnd sagte er: »Wer wird in solch einem Ameisenhaufen stöbern! Nein, Schmeichelkätzchen, du mußt es schon selbst sagen.«
»Papa, ich dachte mir, du sehest heute gerade wie das Christkindchen aus. O Papa, ich habe eine so große Menge Wunschzettelchen!«
Und jetzt kam allerlei zum Vorscheine. Das gab ein Liebkosen und Ueberreden, bis der Papa sich wirklich für einen Weihnachtsengel hielt und alles gewährte.
Endlich erschien der selige Weihnachtsabend. Noch nie zuvor war er in diesem Hause so wonnig gefeiert worden; daran schlossen sich die letzten Tage des Jahres. Alle drei, Großpapa, Vater und Mutter, segneten ihr Kind, und alle stimmten überein, daß es ein glückliches Jahr gewesen: »Glücklich durch sie – flüsterte der Großpapa – durch sie, welche immer nur an andere – und so wenig an sich selber denkt!«
Das junge Jahr hatte bereits einen halben Monat zurückgelegt; hier und da schien die Sonne so glitzernd auf den Schnee, daß er warmen Blüten glich; dann jubelte Eudoxia: »Großpapa, der Frühling kommt! ich hab' ihn schon erblickt.«
»Wo denn?« fragte lächelnd der Alte.
»O, so von weitem!« antwortete Eudoxia geheimnisvoll und fuhr in ihrer Rede fort: »Wie freue ich mich auf den Frühling! Dann wirst du, auf meinen Arm gestützt, durch die Wiesen wandern und in blinkendem Sonnenscheine, nicht am schwarzen Ofen dich erwärmen; dann werde ich deine weißen Locken mit Blumen bekränzen, und die Vögelein werden dir vorsingen, und die leisen, zarten Winde den Blütenduft über die Wälder zu dir tragen. O wie köstlich wird das sein, Großpapa!« Und das heitere Mädchen warf sich jubelnd an die Brust des Greises; dann sah sie ihn voll seliger Hoffnung an, aber sogleich verwandelte sich ihr Ausdruck, und sie rief fast erschrocken: »Was ist dir, Großpapa? Du lächelst so wehmütig und so ungläubig, als ob der Frühling ausbleiben könnte. Und jetzt seh ich auch, deine Wangen sind bleicher und eingefallener, als gestern. O ich merke so etwas gleich; weißt du, ich besitze einen zweifachen Blick, ich sehe mit dem Auge der Liebe sogleich die kleinste Veränderung. Alter, schlimmer Großpapa, was fehlt dir?«
Der Greis antwortete, gerührt von des Mädchens Sorge: »O nichts, mein Liebling, oder doch nur ein wenig Schnupfen, gerade so, wie es dem Winter geht, wenn die Frühlingssonne ihn anlächelt. Und bist du nicht mein Frühling? Deine Heiterkeit vergoldet und erwärmt diese Stube, es sprossen rings Blumen der Erinnerung um mich, wo du weilst, und statt der Vögel singst du mir ein Liedchen.«
Nun war Eudoxia wieder beruhigt und sagte: »Ja, ich bin dein Frühling; ich blühe eigens für meinen Großpapa, und ich singe ihm lustig in die Ohren:
Hinaus, hinaus in die freie Natur,
Hinaus, hinaus in die Frühlingsflur,
In den fröhlich lächelnden Sonnenschein,
Zum Rasen voll sprossender Blümelein, – hinaus!
Kaum hatte sie das Lied jubelnd vollendet, als sich die Thüre öffnete und der kleine Bediente meldete: »Das gnädige Fräulein möchte in den Salon kommen.«
»So früh? sagte Eudoxia erstaunt und fügte bei: Am Ende ist's schon ein Frühlingsbote; sieh nur, mit welch langem, goldenem Finger er an deine doppelten Fenster pocht.« Dann warf sie dem Alten noch eine Kußhand zu und eilte zur Thüre; dort schaute sie nochmals zurück und gewahrte die zärtliche Liebe, welche ihr aus den alten Augen folgte; ein mächtiger Drang zog sie wieder zum teuren Greise, durch ihr Herz fuhr ein seltsames Abschiedsgefühl, dessen sie sich später noch oftmals erinnerte; sie küßte die beiden Hände, dann aber sprang sie fort und rief: »O ich komme gewiß gleich wieder, Großpapa.«
Im Salon befanden sich die Baronin von Grafenstein, der Papa und die Mama. Erstere sprach mit einem glückverheißenden Kopfnicken: »Was sagst du dazu, Eudoxia, daß ich bereits deinen Anwalt bei den Eltern machte und den strengen Richter mit all seinen Bedenken und Einwendungen bezwungen und überzeugt habe?«
Herr von Mayenwald verneigte sich artig und entgegnete in verbindlichem Tone: » Bestochen, Frau Baronin! Wer vermöchte auch standhaft zu sein gegen so viel Güte und Liebenswürdigkeit; bestochen, keineswegs überzeugt.«
Eudoxia sah höchst verwundert aus und fragte kleinlaut: »Was hab' ich denn Schlimmes gethan, Papa?«
Nun winkte Frau von Grafenstein sie herbei, ergriff des Mädchens Hand und sagte lächelnd: »Ei, Kind, du sollst erst etwas Schlimmes thun, du sollst in meiner großen Gesellschaft erscheinen, ein wenig, tanzen und vor allem dich an den aufzuführenden Tableaux beteiligen.«
Jetzt stand Eudoxia wie umstrahlt vom Sonnenglanze der Freude. Sie blickte auf die Eltern und rief: »Und du hast es erlaubt, Papa? Du auch, liebste Mama? O das ist hübsch, das ist nichts Schlimmes!«
Und Eudoxia ging in der Freude ihres Herzens von einem zum andern, die Hand zu küssen. Frau von Grafenstein erhob sich zum Fortgehen und sagte: »Also abgemacht! Nachmittag wird Marie kommen und sich mit dir beraten, Eudoxia. Besinne dich auf ein lebendes Bild, denn jedes soll etwas zur Auswahl vorschlagen; die Vorstellung ist am ersten Februarsonntage.«
Man schied unter den gebräuchlichen Redensarten. Als sie allein waren, schmiegte sich Eudoxia an den Papa und fragte schmeichelnd: »Aber, Papa, warum machst du ein so ernstes Gesicht, als ob es wirklich etwas Schlimmes wäre? Ist dir's denn nicht lieb, daß deine Eudoxia eine Freude hat? Und auch die Mama sieht nicht recht zufrieden aus.«
Der Vater entgegnete mit ungewöhnlichem Ernst: »Du weißt, wir gönnen dir jede Freude, aber alles zu seiner Zeit; im nächsten Jahre wäre es mir lieber gewesen. Du bist noch zu jung, um in solch großer, gemischter Gesellschaft zu erscheinen und vollends mitzuwirken. Weißt du nicht, daß die Veilchen, welche frühzeitig aus der Knospe schlüpfen, sich im vollen Blätterdache verbergen? sie wären zu zart für die drohenden Gefahren.«
Eudoxia unterbrach den Vater und erwiderte: »Aber bester Papa, wir haben im Kloster ja oftmals solche Tableaux aufgeführt in großer, großer Gesellschaft. Du siehst, es ist also nicht das erste Mal. Ich stellte die Liebe, Fanny die Hoffnung und Emma den Glauben vor. O das war schön!«
Vater und Mutter lächelten über Eudoxiens naives Geplauder, dann sagte der Vater: »Nun, ich hab' es einmal erlaubt, also sei es. Nur bitt' ich mir aus, Eudoxia, daß du dich damit begnügst und nicht weitere Anforderungen machst. Es liegt nur in deinem Vorteile. Man sollte jeden Lebensabschnitt bis zu seiner natürlichen Grenze genießen. Du aber verrückst dieselbe um ein volles Jahr; doch genug, es sei!«
Eudoxia küßte ihm dankend die Hand; sie war noch ein Kind des Augenblicks, und dieser lachte so verheißend; dann überschüttete sie ihre im Nachdenken vertiefte Mama mit freundlichen Worten und eilte zum Großpapa, um die köstliche Neuigkeit zu verkünden. Sie sah sich im Geiste schon als Jungfrau von Orleans, ihrem Ideale, und indem sie den Griff der Thüre zum Großvater umdrehte, nahm sie eine heroische Haltung an, beim Eintreten deklamierte sie mit großartigem Pathos:
Ihr Plätze aller meiner stillen Freuden,
Euch lass' ich hinter mir auf immerdar!
Zerstreuet euch, ihr Lämmer auf den Heiden,
Ihr seid jetzt eine hirtenlose Schar,
Denn eine and're Herde muß ich weiden
Dort auf dem blut'gen Felde der Gefahr.
So ist des Geistes Ruf an mich ergangen,
Mich treibt nicht eitles, irdisches Verlangen.
War es eine Ahnung, welche in diese Verse einen schmerzlichen Sinn legte, daß des Großvaters Miene immer wehmütiger wurde? Aber Eudoxia bemerkte es dieses Mal im Freudentaumel nicht; sie plauderte von dem eben Erzählten und achtete nicht einmal, wie der Greis die Lippen öffnete, um auch etwas zu sagen; sie ergoß sich in Jubel, in Plänen, in Hoffnungen und hatte dabei wahrscheinlich ihren stummen Zuhörer vergessen. Da öffnete sich wieder die Thüre, der kleine Bediente erschien mit einer neuen Abberufung, dieses Mal jedoch zur Mama in die Küche.
Zum erstenmale seit ihrer Nachhausekunft vom Institute zog ein Gefühl des Aergers und zwar gegen die gütige Mutter durch Eudoxiens aufgeregte Brust. Die glatte Stirne verfinsterte sich ein wenig; sie rief: »Die alte, langweilige Küche! kann sie mich denn nicht in Ruhe lassen?« und ohne dem Großvater Adieu zu sagen, ging sie verdrossen hinaus und zwar mit einem so hochgeröteten Kopfe, als ob sie zwei Stunden am Feuer gestanden hätte. Ohne die Mama zu begrüßen, langte sie nur schnell nach dem Speisezettel, um der Köchin das Erforderliche herauszugeben. Sie hatte bereits so gute Fortschritte in den häuslichen Kenntnissen gemacht, daß sie bei gewöhnlichen Speisen sogleich die nötige Quantität ermessen konnte. Eilig begab sie sich also in die Speisekammer, um der lästigen Pflicht bald enthoben zu sein, dabei zog es aber durch ihren Sinn:
Ihr Wiesen, die ich wässerte! ihr Bäume,
Die ich gepflanzet, grünet fröhlich fort!
Lebt wohl, ihr Grotten und ihr kühlen Brunnen!
Du Echo, holde Stimme dieses Thals,
Die oft mir Antwort gab auf meine Lieder,
Johanna geht und nimmer kehrt sie wieder.
Es ist gewiß nicht zu verwundern, daß Eudoxia die Pfefferkörner statt der Mandeln ergriff, Schmalz und Butter verwechselte, die Eier nicht abzählte, Mehl und Zucker gänzlich vergaß und in der Eile nach der Essig- statt der Weinflasche langte. Als sie ihr Durcheinander für Mandelpudding und Sauce auf die Anrichte gestellt hatte, fragte sie mit zerstreuter Miene: »Ist noch etwas nötig, Mama, oder kann ich gehen?« Dieselbe überblickte alles – schüttelte das Haupt und sagte ebenso verwundert als vorwurfsvoll das einzige Wort: » Eudoxia!«
Unserm kleinen Hitzkopfe stieg das Blut ins Gesicht, und sie rief: »Mama, du bist recht unbarmherzig! Du weißt doch, daß ich heute Wichtigeres zu thun habe.«
»Und das wäre?« fragte nun Frau von Mayenwald verwundert.
Eudoxia bemerkte in ihrem Eifer die mütterliche Satire nicht, welche in der Frage steckte und entgegnete: »Ich bin für Nachmittag, wenn Marie zur Beratung der lebenden Bilder kommt, nicht im mindesten vorbereitet. Wahrscheinlich wählen sie Szenen aus Schiller, Goethe und Shakespeare, ich aber kenne nur ein paar Monologe aus der Jungfrau von Orleans und Wilhelm Tell; da muß ich mich vor den andern schämen! Wenigstens sollte ich in aller Eile einige Schiller'sche Theaterstücke durchgehen. Ich verzichte gerne auf den Pudding!«
Die Mutter entgegnete mit etwas verstimmtem Tone: »So geh denn, ich erlasse dir heute das Weitere.«
Eudoxia verließ schweigend die Küche und begab sich in ihr Zimmer. Dort angelangt, warf sie sich in einen Lehnstuhl, kreuzte die Arme, furchte die Augenbrauen und warf die rosigen Lippen schmollend auf. Innen aber wogte es von heftigem Sturme, und die Gedanken trieben auf und nieder in der bewegten Flut. Eudoxia war im höchsten Grade ungerecht gegen ihre Mama: Was nützen mir diese niedrigen Küchengeschäfte? Was gehen sie mich eigentlich an? – In meinem Stande werde ich ihrer nie bedürfen, aber Bildung bedarf ich, und wie weit stehe ich darin meinen Altersgenossen nach! Es überfliegt mich bisweilen die Schamröte, wenn ich meine Literaturkenntnisse damit vergleiche. Die Mama ist noch aus einer alten Zeit der »deutschen Hausfrauen«, sagte Eudoxia, und ein fast spöttischer Zug legte sich um den Mund. Dann sprang sie plötzlich auf, eilte zum Bücherschranke, wo Schillers Werke im hübschen Weihnachtseinbande standen, und ohne zu denken, daß es eben ein Geschenk ihrer gütigen Mama sei – wählte sie die bekanntesten Dramen, in welche sie sich bald so gänzlich vertiefte, daß alles Vorhergegangene vergessen war, und die Mittagszeit unerwartet sie zu Tische rief. Es dünkte sie, als ob ihre Kenntnisse sich in diesen wenigen Stunden sehr bereichert hätten, und kaum war das »Amen« des Tischgebetes auf ihren Lippen verklungen, ergoß sie sich in begeisterten Ausbrüchen über das Gelesene. Die Mutter verhielt sich ungewöhnlich schweigend, Eudoxia dachte jedoch keinen Augenblick über die Ursache nach, sie bemerkte es nicht einmal und wendete sich hauptsächlich zum Papa, der ihr, mit den Vorfällen noch unbekannt, lächelnd die größte Aufmerksamkeit schenkte. Nach Tische schlug sie nicht, wie gewöhnlich, den Weg zu des Großpapa's Zimmer ein, sondern begab sich in das ihrige, wo Marie von Grafenstein und Emma von Glauchberg sie nach zwei Stunden unter ihren Büchern antrafen.
Die Mädchen begrüßten sich jubelnd; Marie und Emma überschütteten die Freundin mit Neuigkeiten; wie ein buntes Maskengewühl drängten sich Figuren an Figuren, eine prächtiger als die andere, daß Eudoxia ganz verwirrt wurde. Endlich konnte sie auch zu Wort kommen und erklärte, für sich die Jungfrau von Orleans gewählt zu haben. Kaum hatte sie es ausgesprochen, als die bleiche Marie von hoher Glut übergossen wurde, wobei ein zürnender Schatten über ihr Gesicht zog; Emma dagegen rief in wahrer Entrüstung: »Ja, was fällt dir ein, Kleine vom Lande? – Du die Jungfrau von Orleans, eine der Hauptrollen? Da sollten wir wohl deine Lämmer machen?«
Marie hatte inzwischen auch die Sprache wieder gefunden und sagte in spöttischem Tone: »Mich wundert es sehr, daß du überhaupt etwas von der Schiller'schen Tragödie weißt; ich habe geglaubt, du würdest uns aus ›Rosa von Tannenburg‹ oder aus den ›Ostereiern‹ eine Szene vorschlagen.«
Emma fiel jetzt der erregten Freundin ins Wort: »Nein, ich rechnete schon auf eine Szene aus Schiller, aber auf eine andere« und indem sie die Augen niederschlug und eine komisch-demütige Stellung einnahm, deklamierte sie:
Und auch der hat sich wohlgebettet,
Der aus der stürmischen Lebenswelle
Zeitig gewarnt sich herausgerettet
In des Klosters friedliche Zelle;
Der die
stachelnde Sucht der Ehren
Von sich warf – und die eitle Lust,
Und die Wünsche, die ewig begehren,
Eingeschläfert in ruhiger Brust.
Nachdem Emma ihrer Satire auf diese Weise freien Lauf gelassen hatte, lachte sie laut auf, umschlang die beschämte Eudoxia, drehte sie im Kreise herum und sagte beschwichtigend: »Nun, hab ich's getroffen? So ein Klosterfräulein müßte dich herrlich kleiden, ebenso passend, wie Marien deine ›Jungfrau von Orleans‹.«
Eudoxia war jedoch keineswegs besänftigt; sie empfand gar wohl den Stich, welcher auf die wunde Stelle traf. Schon oft war ihre einfache Erziehung Gegenstand von Emma's Neckereien gewesen; auch hatte sie recht wohl die Betonung der » stachelnden Sucht der Ehren« bemerkt; aber sie unterdrückte die auf der Lippe schwebende Entgegnung und sagte in ruhigem Tone: »Nun, so mögt ihr selbst mir die Rolle zuteilen; so wenig ich mich um die Teilnahme an euren Tableaux beworben hatte, geize ich jetzt nach irgend etwas.«
Die beiden Mädchen wechselten verstohlene Blicke, als wollten sie sagen: »Sie hat ihre Zurechtweisung, jetzt ist's genug« – und bald war wieder ein lebhaftes Gespräch im Gange, das sich besonders um geschichtliche Szenen oder Darstellungen aus den verschiedensten Dichtungen drehte. Dabei hatte Eudoxia Gelegenheit, deren Belesenheit anzustaunen, und sie kam sich selbst sehr armselig unterrichtet vor. Ihre Begierde, alle diese besprochenen Bücher zu lesen, steigerte sich von Minute zu Minute; sie standen ja alle in des Großvaters Bücherschranke und, eingedenk seiner Güte, hoffte sie ihm alle herauszuschmeicheln.
Anscheinend freundlicher denn je, drangen nun Marie und Emma in Eudoxia, sich für irgend ein lebendes Bild zu bestimmen; endlich gab sie dem Drängen nach, und zum Beweise, daß sie keineswegs von einer Ehrsucht gestachelt werde, machte sie den Vorschlag, ein Bild aus Wilhelm Tell zu wählen, wobei sie die einfache Hedwig übernehmen wolle; dann könnte auch Mariens kleiner Bruder den Walter mit der Armbrust darstellen.
Der Abend war bereits weit vorgeschritten, als die Mädchen für den nächsten Nachmittag eine größere Zusammenkunft bei Marien verabredeten und sich trennten. Sie schieden aufs herzlichste, aber in Eudoxiens Gemüt blieb dennoch eine Mißstimmung zurück. Der glückverheißende Tag hatte in ihrem Herzen einen ungewöhnlichen Aufruhr erregt, und die beiden Freundinnen kamen ihr im Rückblick etwas neidisch vor, o, wie ganz anders, als ihre gute, einfache Fanny!
Sie eilte nun zu ihrer Mama, um derselben Bericht zu erstatten, fand die »deutsche Hausfrau« aber vor dem Wäschschranke mit Austeilen der Wäsche beschäftigt. Da fuhr ihr ein Stich durchs Herz und sie rief: » Samstag, und ich habe die arme Mutter Lene ganz vergessen!« Dann lief sie zu ihrer Kommode, richtete eilig etwas Geld zusammen, und beorderte den kleinen Bedienten, es augenblicklich der Alten zu bringen; übermorgen werde sie ganz gewiß den versäumten Besuch nachholen.
Als Eudoxia an jenem Abende zu Bette ging, war sie gar nicht recht zufrieden; es herrschte eine Uneinigkeit im Gemüte, welche selbst das Abendgebet nicht zu verscheuchen vermochte. Wie gewöhnlich trat die Mutter noch vor ihr Lager. Da schlang Eudoxia die beiden Arme um deren Hals und flüsterte mit einem tiefen Seufzer: »O Mama, verzeih! ich war heute etwas unartig.«
»Ja, mein Kind, thue es nicht mehr, ich verzeihe dir« – lächelte segnend die gute, nur zu nachsichtige Mutter.
Als Eudoxia am nächsten Morgen erwachte, war's ihr ganz wunderlich. Eine neue, herrliche Welt schien sich vor ihr zu öffnen; freudige Hoffnungen durchwogten sie, die Pulse pochten dem neuen Tage erwartungsvoll entgegen. Endlich rang der Geist sich aus dem Zaubernetze des Schlafes und Traumes, bunte, lebende Bilder schwebten vorüber, sie kannte die Ursache des freudigen Gefühls, und rasch erhob sie sich von ihrem Lager. Wie von unsichtbaren Elfen bedient, vollendete sie dann die Morgentoilette, und dabei faßte sie die schönsten Vorsätze. Gestern war sie in ihrer Pflichterfüllung saumselig und gegen die Mutter mürrisch gewesen; das sollte nicht mehr geschehen; sie wollte ihre Freude auch verdienen und der guten Mama eine pflichtgetreue Helferin sein.
Sie eilte zum Frühstücke; dann brachte sie mit heiterm Morgengruße dem Großpapa das seinige, verplauderte aber nicht die Zeit wie gewöhnlich, sondern eilte aus freien Stücken zur Mama, und ihr Eifer war so übergroß, daß sie beinahe ungeduldig wurde, als die Mutter zögerte und zuvor verschiedene andere Dinge verrichtete. Sie dachte: »Inzwischen hätte ich einen ganzen Akt in der Maria Stuart lesen können.« Aber sie beherrschte sich tapfer, und endlich schalteten Mutter und Tochter in der Region des prasselnden Feuers. Eudoxia studierte mit wahrer Achtsamkeit den Küchenzettel, beredete sich lebhaft darüber mit der Mama und nahm sich volle Zeit, nicht nur das Gelernte anzuwenden, sondern auch ihre Erfahrungen zu erweitern. Nach diesen häuslichen Geschäften vervollständigte sie die sonntägliche Toilette und begab sich mit ihrer Mutter zur Kirche. Obgleich es ihr etwas schwer wurde, bei der Predigt die Aufmerksamkeit gesammelt zu erhalten, hätte sie doch, wie ehemals im Institute, eine Prüfung darüber bestehen können.
Auf dem Heimwege faßte sie den Plan, künftig beim Großpapa praktische Litteraturstunden zu nehmen und ihm seine ganze Bibliothek der Klassiker vorzulesen. Das mußte viel unterhaltender als die Zeitung sein. Zuerst aber mußte sie die begonnene »Maria Stuart« vollenden, und bald saß sie ganz versunken in diese Lektüre auf ihrem kleinen Sofa. Mit geübtem Gedächtnisse prägte sie sich die schönsten Stellen ein und wäre im stande gewesen, die Rolle der unglücklichen Maria ihrer Todfeindin gegenüber zu spielen; ja sie verwechselte dieselbe bereits mit Emma, welche sie gestern beleidigt hatte.
Des Nachmittags vereinte sich der vertraute Freundinnenkreis bei Baronin von Grafenstein, um die Auswahl der Tableaux, sowie auch die Herbeiziehung der Mitwirkenden zu beraten. Marie führte den Vorsitz an einem kleinen Tischlein, auf welchem auch das Präsidentenglöckchen nicht fehlte, und Emma versah das Amt einer Sekretärin. Die andern Mädchen, darunter Eudoxia, saßen im Halbkreise.
Nun begannen die mannigfachen Vorschläge, und bald erwies das Glöckchen sich als unentbehrlich, denn Gegenrede und Zwischenrede wogten in allen Tonarten durcheinander. Nur Eudoxia verhielt sich schweigend; sie hatte Emma's höhnische Bemerkung noch nicht vergessen; es war im Gegenteile, als ob dieselbe eine scharfe Spitze gewonnen hätte und ihre Brust fortwährend verwunde. Endlich sagte Emma: »Nun, Eudoxia, bleibst du bei deinem Vorschlage, Wilhelm Tells Hedwig darzustellen?«
Ehe noch Eudoxia antworten konnte, rief Maria: »Warum sollte sie auch nicht? Sie denkt gewiß, die Frau eines Helden sei ebensogut, als die Jungfrau von Orleans selbst; nicht wahr, Eudoxia, ich hab's getroffen?«
Eudoxia errötete, und alle blickten auf sie. Emma bemerkte es und sagte: »O, du brauchst nicht zu erröten über diese kleine Schwäche; die Schweizertracht ist allerdings kleidsam; wer weiß, ob du Marie am Ende nicht doch verdunkelst und eine ›bescheidene Hausfrau‹, wozu deine Mama dich mit aller Macht erziehen möchte, gefällt den Leuten ohnedies besser, als eine Kriegsheldin.«
Nun warf Eudoxiens Entrüstung in ihrer Brust die höchsten Wogen; aber wie deren Schaum erglänzt, so lächelte sie und entgegnete: »Wenigstens ist diese Verteilung für uns beide geeigneter: keines braucht sich zu schminken, einer Heldin steht die Blässe und einer Bäuerin die Röte der Wangen vortrefflich an.«
Kaum waren diese in höchster Entrüstung gesprochenen Worte Eudoxien entschlüpft, als sie selbst darüber erschrak. Sie fühlte, wie garstig es war, auf Mariens blasse, beinahe kränkliche Gesichtsfarbe, wegen deren sie die ›weiße Rose‹ genannt wurde, hinzudeuten und sich dagegen mit einer Gabe Gottes zu rühmen. Sie wurde hierauf noch röter und Marie noch bleicher. Emma jedoch lenkte das Gespräch mit Gewandtheit auf ein anderes Bild, und bald tönten die Stimmen wieder im Chore. Eudoxia fühlte die Notwendigkeit, sich zu beherrschen und nicht durch fortgesetztes Schweigen, das mit ihrer sonstigen Redseligkeit im Kontrast stand, ihren innerlichen Verdruß zu verraten. Als Emma nun erklärte, man sollte eine größere Abwechslung in die lebenden Bilder bringen und sich nicht nur auf Szenen der Theaterstücke beschränken, da man ja diese genug im Schauspielhause sähe, machte Eudoxia den Vorschlag, etwa ein biblisches Bild zu wählen, zum Beispiel Königin Esther, mit ihrem Gefolge vor Ahasverus erscheinend, um für die Juden zu bitten.
Dieser Vorschlag gefiel allgemein; wer aber sollte die schöne Esther vorstellen? Sie alle hatten bereits ihre Rollen übernommen. Wieder war es Eudoxia, welche guten Rat wußte; sie sagte: »Was haltet ihr von Aurelie Goldstern? Sie ist groß, von dunkler Haarfarbe und hat wirklich einen orientalischen Typus; sie müßte sich prächtig ausnehmen, geschmückt mit den Perlen und Diamanten ihrer Mutter.«
Ein Lächeln flog über die ganze Gesellschaft, und Emma sagte: »Hör', Eudoxia, ich hätte dem Klosterfräulein keinen so stachligen Witz zugetraut.«
»Witz! – stachlich? was meinst du damit, Emma? ich verstehe dich nicht«, – sagte Eudoxia mit unverkennbarem Erstaunen. Aber Emma entgegnete: »Laß es gut sein; wir haben dich schon verstanden. Du hast einen vortrefflichen Vorschlag gemacht; ich will als Sekretärin das biblische Bild und die Hauptperson sogleich notieren.«
Die Beratung mit Vorschlägen aus der Geschichte währte noch lange, dann setzte man für alle nötigen Besprechungen, Anfragen usw. täglich den Nachmittag fest. Jedes versprach, sogleich sein Kostüm zu besorgen und auch für gemeinnützige Dinge bereit zu sein. Man schied fröhlich und als die besten Freundinnen. Aber trotz all diesem trug Eudoxia ein verletztes und sehr unzufriedenes Gefühl nach Hause.
Daheim angekommen, wollte sie sogleich zum Großpapa, den sie heute nur wenige Minuten gesehen hatte; aber der Greis lag schon zu Bette, um seinen Katarrh zu pflegen; die Mama las ihm den Abendsegen vor, was Eudoxia schmerzte, denn es gehörte zu ihren Vorrechten. Als beim Abendessen der Papa nach der stattgehabten »Mädchensitzung« fragte, antwortete Eudoxia nur höchst einsilbig und schützte Kopfweh vor, um sich früher auf ihr Zimmer zurückziehen zu können. So endete der mit frohen Erwartungen begonnene Tag.
Abendwolken am Himmel – wohin sind sie oftmals geflohen am Morgen? Heiter und blau wölbt sich die erhabene Decke, und die Sonne durchglänzt dieselbe mit wahrem Festtagsgesichte. So geht es auch im Jugendleben, und so erging es Eudoxia, als sie am nächsten Morgen erwachte. Fröhlich erstand sie zu dem geschäftigen Tage, denn für die Jugend ist diese Geschäftigkeit schon ein Vergnügen. Wieder warf ihre Heiterkeit durch des Großvaters Krankenstube einen Lichtstreifen. Er weilte ein wenig am Lager, umschwebte holdselig das bleiche, alte Gesicht und – hierauf tanzte er weiter. Warum hätte sich Eudoxia auch stören lassen sollen durch ein wenig Schnupfen? Und bleich sah der Großvater immer aus, er war ja so alt! Wenn sie mit all ihren bunten Sachen käme und sie vor ihm ausbreitete, und wenn sie vollends als »Hedwig« vor ihn träte, o, wie würde ihn das ergötzen und die einsamen Tage beleben! Jetzt freilich durfte sie keine Zeit verplaudern. Mittags legte der gütige Papa eine wohlgefüllte kleine Börse in ihre Hand, und so war sie ausgerüstet, um mit Emma allerlei Einkäufe zu besorgen, da die Mama den Großvater nicht verlassen konnte.
Die vorangegangenen spitzen Neckereien hatten in Eudoxien keinen Stachel zurückgelassen; dennoch behielten sie eine Wirkung: sie wollte ihrem einfachen, bescheidenen Anzuge die größte Solidität verleihen und sich auf diese Weise, wenn auch nicht durch Glanz, auszeichnen. Das konnte sie nun durch des Vaters Freigebigkeit erreichen, und sie empfand etwas vom geheimen Stolze des Reichtums. Eudoxia kaufte echten Batist zu dem sogenannten Schweizerhemd, den feinsten Linon und französische Spitzen zur Schürze, schwarzen Seidensamt zum Miederchen, Goldknöpfchen, breite, schwere Seidenbänder, den schönsten, feinsten Wollstoff zum Rocke, rotseidne Strümpfe, nebst dem sonstigen Zubehör. Beim Einkaufe zeigte sie Entschlossenheit und fragte nicht eher nach dem Preise, als bis sie bezahlte. Was schadete es, wenn sie sogar aus ihrer Kasse etwas darauflegen mußte?
Der Nachmittag verging Eudoxien im Fluge und in fröhlichster Stimmung. Ward dieselbe durch keine Ahnung getrübt? Nein, sie ahnte nicht, daß in zwei verschiedenen Stübchen sehnsüchtige Gedanken, tiefe Seufzer nach ihr auszogen. Weder das Verlangen des vereinsamten Greises, noch das pochende erwartungsvolle Herz der Mutter Lene, die von Sekunde zu Sekunde auf jeden Schritt in der engen Gasse und Hausflur horchte, erweckte die Ahnung davon in Eudoxiens Gemüt. Es glich einer Burg, in deren Vorhof die irdische Lust sich tummelt und auf deren Zinnen der Wächter fehlt. Vor solch einer Burg scharen sich die geheimen Feinde mit Erfolg, und vor solch einem Herzen flüstert vergebens die Ahnung: sie wird nicht beachtet. Doch wehe, wenn sie, zur Wirklichkeit geworden, plötzlich als Trauerherold vor dem Thore steht und nicht mehr abgewiesen werden kann!
Jetzt begann für Eudoxia eine sehr beschäftigte Zeit; sie wußte oft nicht mehr, wo ihr der junge Kopf stand: es sah darin aus, wie in einem Kramladen, wo alles durcheinandergeworfen liegt und man keinen Gegenstand im rechten Augenblicke findet. Vollbrachte sie das eine, dann drängte sich das andere mahnend hervor, und das freudig wogende Herz ließ den Gedanken keine Ruhe; die unruhige Hand verdarb vieles; manches Bändchen und Spitzchen ward in der Hast zu lang, manches zu kurz geschnitten; dann reichte das Eingekaufte nicht; der Bediente mußte beständig hin- und herlaufen; die kleine Münze der gewechselten Goldstücke verschwand unter ihren Fingern, ehe sie sich's versah, und bereits mußte sie in die eigne, durch die Strickbaumwolle erschöpfte Kasse greifen. Ein anderes Mal stimmten die in Eile gewählten Farben nicht zusammen, und Marie lachte über ihre Geschmacklosigkeit; es mußten durchaus andere gewählt werden, und wenn sie die Mutter zur Beratung aufsuchte, pochte das ungeduldige Herz, da dieselbe zuerst die häuslichen Geschäfte abmachte, ehe sie ihr einige Aufmerksamkeit schenkte. Ein anderes Mal mußte sie Viertelstunde um Viertelstunde wartend vergeuden, während die Mutter dem Großvater vorlas, wo sie die beiden nicht stören durfte. Ja, sie hielt sich absichtlich von dem sonst so geliebten Zimmer ferne, um nicht selbst zur Vorleserin verwendet zu werden; jetzt hatte sie dazu unmöglich Zeit, » später« – – dachte sie, – »später will ich's einbringen; jetzt ist der Großpapa auch unwohl, da bekommt ihm die Ruhe viel besser.«
Ihr Plan, den lieben Kranken mit den bunten Einkäufen zu ergötzen, war auch mißglückt, denn das grelle Tageslicht wurde durch vorgezogene, grüne Vorhänge gedämpft; aber der Großpapa sollte sie dafür in ihrem vollendeten Anzuge sehen, und wie wohlgefällig würden dann die alten, lieben Augen auf seinem Lieblinge ruhen! Eudoxia verblieb also mit dem ganzen bunten Kram in ihrem eigenen Stübchen, und da die Mutter ihr nicht mit Rat und That beistehen konnte, wurde eine geschickte Kleidermacherin bestellt, um die kostbaren Bänder und Spitzen, den Samt und die Seide vor Eudoxiens raschzerschneidender Schere zu retten. Vor ihren Augen glänzte es noch schöner, als aller heißersehnte Frühlingsschein. Unzählige Male, weit öfter, als notwendig, lief sie vor den Spiegel, um Proben zu halten.
Wie heiter waren die hübschen Nachmittage, wo die Freundinnen sich bei Marien versammelten, um Beratung zu halten. Wenn sie dann mit übervollem Herzen nach Hause kam und vergebens die Mama zu einem ruhigen Plauderstündchen aufsuchte, oder wenn dieselbe in freien Augenblicken teilnahmslos und ermüdet zuhörte, als ob ihre Gedanken weit – weit abschweiften, ja, wenn ein Seufzer dazwischenklang: – dann verstummte Eudoxia und ging schmollend auf ihr Zimmer; sie verglich, wie teilnehmend sich Frau von Grafenstein zeigte und wie ihre Mama so gar kein Interesse für all diese Dinge habe! Auch beim guten, lieben, heitern Papa fand sie nicht die gewünschte Aufmerksamkeit; bald schweiften seine Augen ab und suchten die Mama, oder er versank in Nachdenken. Eines Abends hatte sie wieder auf des Papa's Knieen Posto gefaßt und zwar mit der Absicht, ihm eine Geldzulage abzuschmeicheln und den klaren Beweis der Notwendigkeit zu führen. Die Einleitung war aufs beste gelungen, der Papa lächelte bei ihren wichtigen Auseinandersetzungen, als plötzlich die Klingel, etwas rascher als sonst gezogen, aus des Großvaters Zimmer ertönte. Beinahe heftig schob er die Tochter hinweg und eilte hinüber. »Wohlan, so mag der Papa die Rechnungen bezahlen!« Sie erinnerte sich an eine ernste, väterliche Ermahnung, als sie zum erstenmale ihr Taschengeld ausbezahlt erhielt, niemals etwas schuldig zu bleiben, stets ihr kleines Vermögen beim Einkaufe zu Rate zu ziehen und im Notfalle es lieber offen zu sagen. Dann aber dachte sie: »Ich wollte es ja sagen; niemand hört mich an, niemand hat die geringste Teilnahme für mich; die Zeit drängt, morgen muß ich das Fehlende kaufen, Emma kommt, mich abzuholen!« und die Einrede des Gewissens verstummte.
Als Eudoxia am nächsten Morgen erwachte, überlegte sie sogleich, was alles an diesem Vormittage zu besorgen sei. Sie erwartete Emma mit Ungeduld und hatte sich zum Ausgange bereitgemacht. Als die Klingel der Hausthüre rasch gezogen wurde, wie es Menschen, die sich verspäteten, im Brauch haben, eilte sie selbst hinaus. Aber es war nicht Emma, es war der Briefbote, der mit ausgestreckter Hand den Brief darreichte und dabei las: »Fräulein Eudoxia von Mayenwald.« Eine Enttäuschung malte sich in dem zuvor so freudig erwartungsvollen Gesichte. Nicht mehr ruhte ihr Blick mit Zärtlichkeit auf dem Institutssiegel; flüchtig beschaute sie die Adresse und sagte in gleichgültigem Tone: »Von Fanny!« – Ohne ihm eine weitere Beachtung zu schenken, – sonst hätte sie wohl drei Ausrufzeichen in der Ecke neben dem kleinen Worte » eilt« entdeckt, schob sie den Brief für gelegenere Zeit in die Tasche. Sie erwartete ja auch Emma und nicht Fanny!
Endlich kam die Erwartete, und die beiden Mädchen begaben sich in die Kaufläden. Zuerst kamen alle die schönen Stoffe zum Vorscheine, es wurde ausgewählt; dann errötete Eudoxia, indem sie die Rechnung darüber bestellte; aber es verlor sich rasch, als der Ladendiener mit einer bereitwilligen Verbeugung antwortete und Emma das Gleiche that. Dann verließen sie den Laden, während zum erstenmal Eudoxiens Name in das Schuldbuch eingetragen wurde.
Vier Tage waren seit diesen Einkäufen verflossen, und das Schweizerkostüm war fertig; zugleich erschien aber auch der Nachmittag für die Hauptprobe, wo dasselbe sich zum erstenmale produzieren sollte. Eudoxia glühte vor Aufregung, während das Kammermädchen ihr Beistand leistete, und die Kleidermacherin manche Kleinigkeit ergänzte. Nun warf der Ankleidespiegel ein wirklich reizendes, anmutiges Bild zurück, und das glückliche Mädchen erwartete mit Ungeduld die Mama, damit dieselbe sie bewundere; aber Frau von Mayenwald konnte eben vom Großpapa nicht weg, der Wagen war bereits angespannt; so mußte sie leider auf dies Vergnügen verzichten und ohne der Mutter und des Großpapa's Bewunderung sich in die Versammlung begeben. Fröhlich sprang sie in der Umhüllung des Mantels die Treppe hinab, fröhlich hüpfte sie in den Wagen, und fröhlich trat sie in den Salon der Baronin von Grafenstein. Dort wogte es schon bunt durcheinander, wie bei einem Maskenballe; das Theater war aufgeschlagen, das spärliche Dämmerlicht ausgeschlossen, die Kerzen der Kronleuchter brannten, und die Stundenzeiger wiesen bereits auf die zum Beginn der Probe festgesetzte Zeit. Alles drängte zum Anfange, die Gruppen bildeten sich zu den einzelnen Vorstellungen, aber immer noch fehlte eine Hauptperson, Aurelie von Goldstern, Königin Esther, wie sie genannt wurde, auf deren gewiß prachtvolle Erscheinung jedes begierig war. Endlich sandte Frau von Grafenstein den Bedienten ab mit der Bitte, doch nicht länger zu zögern, und die ersten Tableaux wurden inzwischen gestellt. Als jedoch die Saalthüre sich öffnete, der wiederkehrende Bediente zu der Dame des Hauses trat, herrschte allgemeine Stille, und jedes Ohr vernahm die Botschaft: »Frau von Goldstern lasse bedauern, daß ihre Tochter gezwungen sei, sich von der Vorstellung zurückzuziehen.«
Nun wogte es in der Versammlung und summte, wie in einem aufgeregten Bienenschwarme; da hörte man die verschiedensten Fragen und Ausrufungen: »Wie ärgerlich! In der letzten Stunde! Ist Aurelie krank geworden?«
»Nein, nein! ich sah sie noch heute früh; das hat eine andere Ursache.«
»Sicher ist sie über etwas beleidigt – sie grüßte mich mit sonderbarer Zurückhaltung.«
Dann hieß es in einer andern Gruppe: »Ist Aurelie heute verhindert?«
»Heute? – – Sie hat sich ja gänzlich zurückgezogen!«
»Nein, das darf nicht sein! Unser schönstes Bild!«
»Was, meine Königin kommt nicht? Was soll denn aus mir werden? rief der bestürzte König Ahasverus.
»Und was sollen wir anfangen ohne die Königin?« riefen die sämtlichen Hofdamen.
»Nun werde ich wenigstens nicht gehängt! scherzte Aman.
Marie Grafenstein ging von einer Gruppe zur andern und fragte: »Wer kennt denn die Ursache dieser plötzlichen Sinnesänderung? Ich bitte euch, gebt mir Licht in der Sache.«
Emma lächelte höhnisch und erwiderte: »Da mußt du dich an Eudoxia wenden; ich denke, sie besitzt das Schlüsselchen zum Schlosse.«
Die Blicke aller richteten sich nun auf die Genannte, und bald war sie umringt. Verwundert sagte sie: »Ich? wie sollte ich Aureliens Abhaltung kennen? Ich verkehre ja beinahe niemals mit ihr.«
»O, das ist auch nicht notwendig, um die Ursache zu wissen; frag' dich nur selbst; ›die Zunge ist ein klein' Glied, sie richtet aber großes Unheil an,‹ heißt es in deinem Gewissensspiegel.«
Eudoxia wurde immer verwirrter und entgegnete mit gesteigerter Entrüstung: »Wer erklärt mir all dieses? Ich soll schuld sein an Aureliens Ausbleiben? War nicht im Gegenteile ich es, welche sie für die Königin Esther vorschlug?«
Nun unterbrach Emma sie mit einem satirischen Lächeln und den Worten: »Allerdings, und zwar mit der Bemerkung, daß sie sich ihres orientalischen Aussehens halber am besten dafür eigne. Wahrscheinlich hast du deinen scharfen, stachligen Witz weiter verbreitet, und so ist es kein Wunder, daß die Familie Goldstern, im Andenken ihres Großvaters, sich zurückzieht.« –
Nun war Eudoxiens ehrliche Entrüstung zum höchsten Grade gestiegen. Ihre Augen glänzten, die Stimme bebte, indem sie rief: »Schäme dich, Emma, mir solch eine Roheit aufzubürden, mir, deren Herz an nichts dergleichen dachte! Wenn meine arglosen Worte in schändlicher Mißdeutung und Verdrehung zu Aureliens Ohren getragen wurden, so ist das ein Verrat an mir, und ich will keinen Augenblick länger unter falschen Freundinnen weilen.«
Eudoxia wendete sich mit laut pochendem Herzen von dem Kreise, als die Thüre sich öffnete und jedes, eine neue Botschaft erwartend, dem Eintretenden entgegenblickte. Es war wieder der Diener, welcher der Frau Baronin von Grafenstein mit gedämpfter Stimme meldete, daß Fräulein von Mayenwalds Wagen unten warte, um sie eiligst abzuholen, es habe sich mit deren Großvater verschlimmert und derselbe wünsche sie zu sehen.
Die leise gesprochene Nachricht hatte dennoch Eudoxiens Ohr erreicht. Sie preßte die beiden Hände vors Gesicht, und mit den Worten: »Mein Großpapa stirbt!« eilte sie von dannen, sogar ihren Mantel vergessend. Fort rollte der Wagen – in Seelenangst verließ sie ihn vor dem Hause und eilte die Treppe hinauf. Mit Schrecken sah sie den Ausdruck der ernsten Gesichter, welche sie so mitleidsvoll anblickten, als sie zum lieben, vernachlässigten Zimmer des Großvaters eilte; – zitternd öffnete sie die Thüre und stürzte mit einem lauten Schrei nieder vor dem Lehnstuhle, an dessen Seite die Mutter kniete; denn ihre Hand umfaßte nur die eines geliebten Toten.
Eudoxia kniete vor dem Greise, in dessen Angesichte noch die Spuren des kaum entflohenen Lebens – ein schmerzlicher Ausdruck – zu erkennen waren. Während die Zähren aus den Augen der Mutter leise an den Wangen herabflossen und die zum Gebete gefalteten Hände benetzten, während die Liebe des verwaisten Herzens sich darin ergoß, blieben Eudoxiens Augen thränenleer, denn der Jammer ihres Innern, das Chaos der Selbstvorwürfe verschloß den wohlthätigen Quell; nur ein Stöhnen hob bisweilen krampfhaft die junge Brust; immer glühender wurde die Stirn auf der eiskalten Hand, bis endlich ein lauter Ton des Jammers das stille Totengemach erfüllte. Da umfaßten sie des Vaters beide Arme, hoben sie empor und zogen die Widerstandslose aus dem Heiligtum, wo die Engel ihr Amt verwaltet hatten und nur die letzte Liebessorge für den entseelten Leib den Menschen überließen.
In ihrem Zimmer angekommen, lag Eudoxia lange an des Vaters Brust, indem sie die beiden Arme um seinen Hals schlang und laut schluchzte, bis endlich der erste, gewaltsame Sturm sich legte und sie ermattet auf das Sofa sank. Dann begab er sich zu seiner Gattin, die mit all der zarten Liebe einer Tochter den Toten auf sein Lager bettete und das Haupt so sanft auf die Kissen legte, als ob es noch immer die Wohlthat der Ruhe empfände. Hierauf setzte sie sich neben den Entschlafenen und schaute mit Liebe und Dankbarkeit in das erbleichte Antlitz, während sie eine stumme Sprache redete und sich in heißem Danke für alles, was sie seit den Tagen der Kindheit von ihm empfangen, ergoß; und wenn dabei auch ihre Thränen unaufhörlich strömten, glichen sie viel eher dem geweihten Wasser, über welchem der Geist Gottes schwebt, als dem salzigen Born der Augen, in dessen Tropfen so oft eine bittere Anklage des Schicksals liegt. Gott hatte ihr den Greis so lange geschenkt, sie hatte sein Alter pflegen und erheitern dürfen; sie hatte die große Dankesschuld in der kleinen Münze täglicher Liebeszeichen wenigstens teilweise abtragen können, und in den schmerzlichen Abschied, in das Gefühl des unersetzlichen Verlustes, mischte sich der Dank gegen Gott für die Erfüllung jener Verheißung, daß die Gerechten den Tod nicht schmecken, daß sie nicht von seinem Stachel geritzt werden sollen. Das Gesicht des Erblaßten verklärte sich von Minute zu Minute, die süßeste Ruhe lagerte sich darauf, ein Lächeln umzog den Mund und – » Sieg« stand auf dem Antlitze geschrieben. Jetzt gingen die Gedanken und Empfindungen der Tochter in Gebete über; sie geleiteten den Geist in seine neue Heimat, zur Vereinigung mit der längst vorangegangenen Mutter, und dort sah sie ihn als Schutzgeist ihres ferneren Lebens, ihrer ganzen Familie.
Als die Mutter endlich den teuren Verstorbenen verließ, betrat sie leise das Zimmer ihrer Tochter und fand dieselbe hingesunken auf ihre Kniee vor dem Bette. Da umfingen die Mutterarme die Tochter, und die Lippen flüsterten: »Eudoxia, ich habe nun keinen Vater mehr, aber ich habe ein Kind, ich habe dich, meinen Liebling!«
Bei diesem letzten, süßen Worte, das so oft von den Lippen des Greises erklungen war, gewann Eudoxia die Sprache, und sie rief unter Schluchzen: »O, ich habe ihn vernachlässigt, Mama, ich habe ihm Täuschung und Schmerz bereitet in seinen letzten Lebenstagen! Er ist geschieden, ohne mich zu segnen; ich kann ihm nicht mehr sagen, wie ich ihn liebe, ich kann es nie, nie mehr gutmachen! O Mama, ich werde nie mehr seinen verzeihenden Blick sehen, ich werde nie mehr seine Hand auf meinem Haupte fühlen! O Mama, diese Qual der Reue wird mir das Herz brechen!«
Und wieder brach Eudoxia in jenes krampfhafte Schluchzen aus, das dem Weinen gleicht, wie ein Fieberschlaf dem erquickenden Schlummer. Da beugte sich die Mutter über ihre Tochter und sagte in mildem Tone: »Suche ihn jenseits, flehe zu Gott um Vergebung deiner Schuld, und der teure Verstorbene, der noch in den letzten Augenblicken nach dir liebend verlangte, der dir im Leben verziehen hat, wird dich jenseits segnen. Und nun, mein Kind, leg dich nieder, du bedarfst der Ruhe.«
Bei diesen Worten richtete sich Eudoxia empor; doch als dieselbe ihren Blick auf das bunte Gewand senkte, schauderte sie zusammen; die Mutter verstand diese Empfindung, und wie ehedem, in den Tagen der Kindheit, entkleidete sie das Mädchen und brachte es zu Bette.
Als der fiebernde Kopf nun auf den Kissen lag und die Nachtlampe ihr bleiches Licht über das Zimmer ergoß, wurden die Selbstvorwürfe zur eindringlichen Sprache in ihrem Herzen. Wie vermessen hatte sie bei ihren guten Vorsätzen auf die eigene Kraft und ihre Tugend gebaut, wie bald war jedoch ihr Pflichtgefühl erlahmt, wie rasch war an dessen Stelle die eitle Lust getreten, wie war sie unvermerkt ein Kind der Welt geworden, und dies alles – wofür? – Bei diesem Gedanken zogen die letzten Szenen im Saale der Frau von Grafenstein an ihr vorüber, und dann sah sie sich in diesem bunten Gewande, wegen dessen sie alles vergessen hatte – hingesunken vor dem geliebten Toten.
Nachdem Eudoxia am nächsten Morgen das Bett verlassen hatte, trat sie wankenden Schrittes, von der Mutter gestützt, in das einst so freudenreiche Zimmer zu den teuren Ueberresten ihres geliebten Großvaters. Als sie an dem Lager stand, vergoldete wieder ein Sonnenstrahl das erbleichte Angesicht mit dem verklärten, milden Lächeln der ewigen Ruhe. Da sank Eudoxia nieder an dem geheiligten Lager, ihre Lippen bewegten sich zu dem Worte: »O verzeih mir, lieber Großpapa!« Dann küßte sie die erstarrten Hände und weinte lang und leise. Endlich zog die Mutter sie fort, es war der letzte Abschied.
Schwere, bange Tage folgten auf diesen einen. Eudoxiens Selbstvorwürfe kamen nicht zur Ruhe, aber sie hatte im Gebete und in der Selbsterkenntnis das Richtige gefunden: – daß eine thatlose Reue ungeheiligt sei. Wenn auch unter Herzensqualen, stand sie doch der Mutter in allem bei, denn deren Wort klang beständig in ihrem Innern nach: » Eudoxia, ich habe keinen Vater mehr, aber ich habe ein Kind, dich, meinen Liebling.« Sie verstand das Vermächtnis des Verstorbenen, und sie flehte inbrünstig zu Gott um Seinen Beistand in dem, was sie sich jetzt vorsetzte.
Der Greis ruhte in seiner Familiengruft, die Trauerglocken hatten ausgeklungen, Mutter und Tochter saßen im Zimmer des Verstorbenen, das sich Eudoxia als Erbteil erbeten hatte. Aber wie ganz anders, als früher, war die Vereinigung zwischen den beiden! Sie tauschten miteinander die innersten, tiefsten Gedanken und Empfindungen, sie sprachen häufig von dem lieben Toten, und Eudoxia sagte einmal: »O, nicht allein gegen ihn habe ich gefehlt, gegen dich, Mama, ebenso. Wenn ich bedenke, daß dein Antlitz von Tag zu Tag bleicher und sorgenvoller wurde, und ich nichts davon bemerkte, so schnürt es mir die Brust zusammen und ich frage mich: wie war das möglich?« –
Die Mutter entgegnete: »Weil du den zweifachen Blick, wie du dich früher selbst ausdrücktest und dich dessen rühmtest, verloren hattest. Der eine, der Blick deiner leiblichen Augen, ruhte auf weltlicher Lust und dein geistiger Blick war gänzlich verschleiert. Nur mit der Seele schauen wir die Seele und ihre Abzeichen.«
Eine ganze Woche war seit des Großvaters Tod verflossen, als eines Abends der Bediente für Eudoxia einen Brief brachte. Kaum erkannte sie die Handschrift, so überflog dunkle Röte ihr Angesicht, denn in diesem Augenblicke gedachte sie jenes Briefes von Fanny, der bis zur Stunde gänzlich vergessen noch in der Tasche des abgelegten Kleides ruhte. Sie erbrach den eben erhaltenen, und die Röte verschwand nicht, denn was sie las, beschwor stets eine neue auf ihre Wange. Da hieß es:
» Meine arme, einziggeliebte Eudoxia!
»O nun verstehe ich Dein Stillschweigen! – Die
Zeitungsanzeige macht mir alles klar; nun weiß ich, warum unsere dringende Bitte unerfüllt geblieben. Verzeih mir, Eudoxia, verzeih mir, daß ich an Dir zu zweifeln begann. Du hast also am Krankenbett Deines heißgeliebten Großvaters gestanden, Deine Hände haben ihn gepflegt, Du hast ihn verloren, und vielleicht liegst Du jetzt, vom Schmerz überwältigt, danieder. O warum kann ich nicht bei Dir sein, um Dich zu trösten? Aber ich bin bei Dir im Gebete, ich erflehe für Dich den höchsten und einzigen Trost. O schreibe nur ein paar Zeilen Deiner mittrauernden
» Fanny.«
Wie vielfach waren die Empfindungen, welche sich bei Lesung dieser Zeilen in Eudoxiens Brust regten! Dennoch kämpfte und siegte das gedemütigte Mädchen. Sie erhob sich, reichte der Mutter den eben erhaltenen Brief und verließ ruhig das Zimmer. Bald kehrte sie mit dem früheren Brief zurück und las nun eine wichtige, fröhliche Bestellung der ganzen Institutsschar für den Geburtstag der Vorsteherin, vermischt mit all dem kindlichen Jubel, den Festplänen, zu welchen eben Eudoxia den Hauptgegenstand besorgen sollte. Dieser Zeitpunkt war seit mehreren Tagen verstrichen; während sie mitten in ihre eitlen, selbstgefälligen, egoistischen Vorbereitungen vertieft gewesen war, hatten die fernen Freundinnen vergebens von Stunde zu Stunde ihrer Sendung zu so schönem, edlem Zwecke geharrt!
Und jetzt, bei dieser neuen Mahnung an jene schlimme Zeit, fiel es ihr vollends wie Schuppen von den Augen. Der Kreis ihrer Selbsterkenntnis erweiterte sich. Mit wehmutsvoll pochendem Herzen gedachte sie der Mutter Lene, welche inzwischen ohne den lieben, tröstenden, erheiternden Besuch geblieben war, ja, ohne ihren verheißenen Beistand vielleicht gehungert und gedarbt hatte; sie gedachte ihrer leeren Kasse und der unbezahlten Rechnung; vor ihrem geistigen Auge stand nicht nur die bleiche Alte, sondern auch der zürnende Vater. Da sank sie nieder vor der Mutter und bekannte derselben alles.
Die Demut führt in sich auch den Mut. Als der Vater abends nach Hause kam, näherte sie sich ihm, nicht schmeichelnd, wie ehedem, wenn sie etwas erbitten wollte, sondern gesenkten Auges; aber mit klaren, deutlichen Worten, ohne jede Bemäntelung ihres Fehlers, bekannte sie ihm ihre jugendliche Verirrung, reichte ihm die unbezahlte Rechnung und bat, für die arme, alte Blinde statt ihrer zu sorgen und ihr Unrecht gutzumachen. Mit demütigem Herzen nahm sie nun auch des Vaters ernst strafende Rede hin und fügte sich ohne inneres Murren und Auflehnen in dessen Verfügung, künftig unter der Mutter Vormundschaft zu stehen, bis sie gelernt haben würde, mit weiser Berechnung und Beherrschung ihrer thörichten Wünsche das Geld zu verwenden.
Wie nach einem schweren Uebergange, nach Kämpfen in der Natur vom Wechsel des Sonnenscheins mit Eis und Schnee, endlich der Frühling den Winter besiegt, der Himmel sich klärt, laue, süße Lüfte wehen – so kam auch über Eudoxia der Frühling des Herzens. Als sie eines Abends vom Grabe des Großvaters heimkehrte, wo sie den Hügel zu einem Frühlingsgarten verwandelt hatte, schmiegte sie sich enger an die Mutter und flüsterte: »Mama, ich fühle es, – Gott, der Großpapa, du und der Vater, ihr habt mir vergeben, und nun weiß ich auch, daß es Frühling in mir ist und sein darf.«
Die Mutter lächelte ihr ermunternd entgegen und sagte: »Ja, mein Kind, so ist es. Deine Jugend ist ein liebliches Geschenk Gottes, genieße es, wie den Frühling da außen. Wie man bei demselben Vorsichtsmaßregeln anwendet, um nicht in der kühleren Luft des Abends zu leiden, so muß auch die Jugend ihre Freuden mit Vorsicht gebrauchen. Nicht jene Tableaux waren ein Unrecht, mein Kind, sonst hätten wir unrecht gehabt, dir die Beteiligung daran zu gestatten, sondern die maßlose Hingabe deinerseits an die eitle Lust.«
»Und Fanny bleibt meine beste Freundin! Wie anders ist sie, als jene!« rief Eudoxia mit Begeisterung, indem sie einen neuen, eben erhaltenen Brief an die Lippen drückte.
Die Mutter erwiderte: »Fanny ist ein seelenvolles Mädchen, das mit der Jugendfrische ein ernstes Streben verbindet. Ein Freundschaftsband, dessen Fäden aus guten Grundsätzen und wahrer Sympathie unter den Augen Gottes gewoben sind, verheißt Dauer für das Leben, ja für die Ewigkeit.« Dann fügte sie nach einer Pause bei: »Der Vater und ich haben beschlossen, dir eine freudige Erholung während der Osterferien bei Fanny im lieben Institute zu gestatten; es wird dir gewiß gut thun.«
Einen Augenblick lang flog das Zeichen aufwallender Freude über Eudoxiens Gesicht; aber es wechselte mit seelenvollem Ernste. Sie umschlang die Mutter mit beiden Armen und flüsterte: »Mama, laß mich bei dir bleiben; du hast keinen Vater mehr, aber ein Kind!«
Die Mutter küßte Eudoxia mit unendlicher Zärtlichkeit und Rührung auf die Stirne und sagte: » Dank, Dank, mein Liebling!«