
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
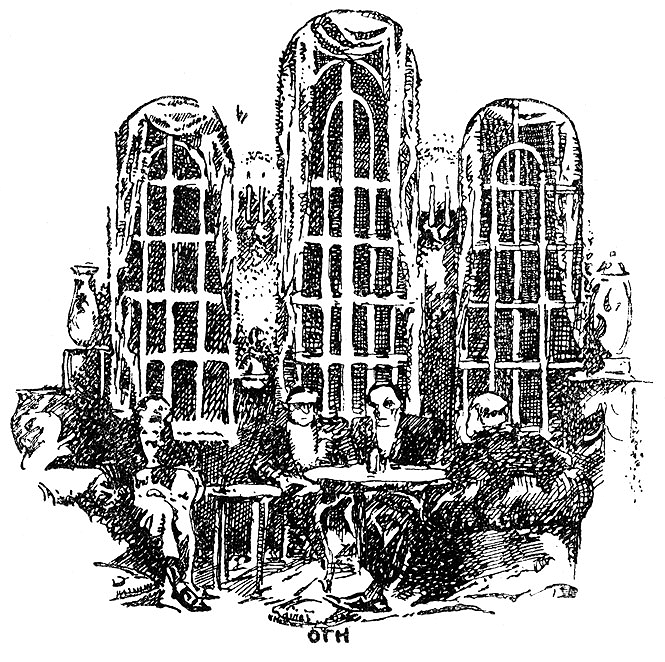
Im großen Gesellschaftsraum des Exzentrikklubs hatte sich an diesem ersten März, dem Jahrestag seiner Gründung, eine Auslese der bedeutendsten Mitglieder eingefunden. Für diesen Abend waren aber auch sämtliche Klubräume geöffnet.
Die Diener in der bekannten, enganliegenden, silbergrauen Livree mit den hohen Strümpfen und den Schnallenschuhen aus schwarzem Lack huschten geräuschlos wie auf Gummisohlen umher.
Sämtliche Herren trugen Smoking und weiße Binde; irgendwelche Uniform oder Abweichung, etwa das Tragen einer Auszeichnung, war verboten, um auch äußerlich zu zeigen, daß hier der Wert eines jeden Mitgliedes der gleiche war. Unter diesem dominierenden Schwarz der vielen Herren kontrastierten um so auffallender die farbenprächtigen Roben und Gesellschaftstoiletten der wenigen Damen, die jene außergewöhnliche Auszeichnung erlangt hatten, ebenfalls als gleichwertige Mitglieder des Exzentrikklubs zu gelten. Wenige waren es, denn die Aufnahmebedingungen waren derart, daß nur außergewöhnliche Leistungen die Voraussetzung dafür bildeten. Von diesen wenigen aber waren auch alle auffallende Erscheinungen: besonders die hohe Gestalt einer Frau in ärmellosem Abendkleid mit einem Rock aus giftgrüner, silberbroschierter Seide, der sich krinolinenartig bauschte, mit einem schneeigweißen Haar, das in einem seltsamen Widerspruch zu den noch jungen, zarten Zügen des feinen Ovals ihres Gesichtes stand, fiel am meisten auf. Daisy van Wellenthin trug nicht etwa derart gepudertes Haar, sondern die Farbe war in drei Nächten erworben, die sie während eines chinesischen Fremdenmassakers in einem Landhause zubrachte, das von den fanatischen Horden belagert und bestürmt wurde, von deren Bewohnern sie schließlich die einzige Überlebende geblieben war. Ebenso bekannt war auch Viktorienne Sellin, die als Krankenpflegerin ein halbes Jahr unter den Pestkranken Ceylons gelebt hatte.
Unter den Herren bemerkte man nicht nur Männer der Wissenschaft mit durchgeistigten, scharfmodellierten Zügen, sondern auch manche jugendliche Erscheinungen, die auf sportlichem Gebiete hervorragende Leistungen vollbracht hatten. Da plauderte der berühmte Bakteriologe Vanmeeren mit dem Gewinner des diesjährigen Marathonlaufes, neben dem Träger der Weltmeisterschaft im Tennisspiel, William Holladay, stand die gebückte, unscheinbare Gestalt des Francis Lewalter, des Erfinders der Gammastrahlen, und der Assyriologe Newton, eine ehrwürdige Apostelgestalt mit langem weißen Haar, unterhielt sich mit dem berühmten Herrenreiter Seydlitz, einer schlanken, sehnigen Erscheinung mit frischem, rosigem Gesichte.
Die großen Lüster aus blinkendem Messing, Treibarbeiten von hohem künstlerischen Wert, warfen ihre strahlenden Lichtreflexe auf das rotbraune Mahagoni der getäfelten Wände, auf das spiegelnde Parkett und auf all die vielen Gestalten, die in plaudernden Gruppen beisammenstanden und manchmal wartende Blicke nach der geschlossenen Türe eines Nebenraumes gleiten ließen, vor der zwei der Diener wie Wächter standen.
Aus der einen Fensternische klang ziemlich vernehmlich die Frage eines schlanken Herrn mit sonnverbranntem knochigen Gesicht und hellblauen Augen, die einem zweiten von untersetzter Gestalt und mit breiten Schultern galt:
»Ist es denn richtig, daß heute Professor Marschall seine Aufnahme in den Klub beantragen will?«
Der Gefragte mit scharfen, stechenden, graugrünen Augen, mit glattrasiertem Gesicht und breitem Mund antwortete zustimmend nickend:
»Natürlich!! Darauf wird noch gewartet, bis die Intimen aus dem Beratungszimmer kommen. Jedenfalls dürfte die Person des Professors Marschall nur einen Gewinn bedeuten.«
In dieser Erklärung wurde er durch die schlanke, hohe Gestalt einer jungen Dame in einem Abendkleid aus schwarzer Chinaseide mit reicher stahlblauer Chenillestickerei unterbrochen, die ihn dabei in vertraulicher Art an seinem rechten Arme faßte:
»Ist dies jener Professor Marschall, der die berühmte Forschungsreise nach dem Quellengebiet des Amazonenstroms gewagt hat?«
Ein Blick zur Seite folgte, dann ein lebhaftes Nicken:
»Natürlich, Anita! Erzählte ich dir nicht schon davon?«
»Das mag – wie schon öfters – deine Absicht gewesen sein, bei der es aber nur – genau wie schon öfters – geblieben ist. Vergeßlichkeit ist deine auffallendste Schwäche, mit der ich mich allerdings bereits ausgesöhnt habe.«
Fred Wronker, dessen Polarfahrten in Begleitung eines berühmten schwedischen Polarforschers seinerzeit großes Aufsehen erregt hatten, erwiderte lächelnd:
»Verzeihe, Schwesterchen, aber schließlich erfährst du das auch jetzt noch rechtzeitig genug. Gewiß, Professor Marschall wünscht Mitglied des Exzentrikklubs zu werden, eben jener Professor Marschall, der die ersten Nachrichten von den sogenannten weißen Indianern aus dem Innern Brasiliens brachte, die allerdings bei verschiedenen Forschern und Geographen auf ein zweifelndes Kopfschütteln stoßen.«
»Oh, es wird für mich eine besondere Genugtuung sein, Professor Marschall persönlich kennen zu lernen. Ob bei diesem Manne von den sonst erforderlichen Aufnahmebedingungen eine Ausnahme gemacht werden wird?«
Der dritte, seiner sehnigen Gestalt nach ein Sportliebhaber, entgegnete darauf:
»Ausgeschlossen. Es wurde mir von Filibert Spencer versichert, daß auch für Professor Marschall die einjährige Wartezeit bevorsteht, in der er die erforderlichen Bedingungen zu erfüllen hat.«
Fred Wronker erklärte darauf:
»Ich finde das ganz in Ordnung. Würde der Exzentrikklub nur bei einem eine Ausnahme machen, dann hätte er gar nicht mehr das Recht, sich Exzentrikklub zu nennen. Mußtest du nicht selbst die gleichen Bedingungen erfüllen wie jeder der Herren? Traf dies nicht auch für Daisy van Wellenthin zu, und auch für Viktorienne Sellin und Rita Lalang?«
Da zog Anita Wronker die weißen Schultern hoch, und über ihr schönes Gesicht mit der schimmernden Haut und dem leichten Rot der Pfirsichblüte auf den Wangen huschte ein flüchtiges Lächeln, als sie dann antwortete:
»Bei Frauen finde ich es berechtigt, daß keiner etwas erlassen wird, denn alle würden sich wohl in den Klub drängen und die Ausnahme für sich fordern. Für Frauen würde die Mitgliedschaft dann nur eine prickelnde Sensation bedeuten; gerade daß die Aufnahme erst durch eine außergewöhnliche Leistung gewonnen werden muß, verhindert den Zulauf der Vielzuvielen und schafft damit den Exzentrikklub.«
Jener dritte, Alexis Marlan, machte eine leichte Verbeugung vor Anita Wronker und erwiderte:
»Ich werde nie vergessen, mit welcher Meisterschaft Sie, gnädiges Fräulein, Ihre Aufgabe, die wirklich eine außergewöhnliche war, lösten.
Mit einem Lächeln wehrte Anita Wronker ab:
»Vergessen Sie aber dabei nicht, daß mir schon vorher der Name einer Exzentrischen anhaftete und daß mein lieber Bruder Fred schon so manche Sorgen hatte, wenn ich jeweils meinen nicht immer leicht zu nehmenden Willen durchsetzte. Mich reizte noch stets das Ungewöhnliche und auch das Gefahrvolle, womit schließlich alles erklärt ist, was absonderlich erscheinen könnte.«
Alexis Marlan stimmte lebhaft zu:
»Ich weiß, welches Aufsehen entstand, als die Nachricht verbreitet wurde, daß Sie die Verfolgung und auch die Festnahme des berüchtigten Juwelendiebes Susman aus der Downingstreet durchsetzten.«
»Das bedeutete aber wirklich nicht viel und geschah wohl mehr in Ermanglung einer lohnenswerteren Aufgabe. Am meisten würde es mich ja reizen, in unerforschte Gebiete unter Überwindung größter Hindernisse einzudringen. Bei dem Namen eines Professors Marschall empfinde ich zunächst das Gefühl eines eifersüchtigen Neides. Teilnehmen wollte ich.«
Da fragte Alexis Marlan:
»Kennen Sie Professor Marschall?«
»Nein! Ich habe wohl alles von seinen Erfolgen gelesen, aber keines der namhaftesten Journale brachte ein Bild von ihm.«
Jetzt lachte Alexis Marlan laut auf:
»Das glaube ich gerne. Es gehört eben auch zu der Persönlichkeit des Professors Marschall, daß er sich stets der Pressemeute und den vielen Photographen zu entziehen verstand. Er haßt die Popularität vor dem Photographenkasten. Es war nicht leicht für ihn, sich all den versteckten Angriffen mit den verschiedenen Kameras zu entwinden.«
Die schwarzen Augen Anita Wronkers leuchteten dunkler und begeistert auf:
»Eine Eigenschaft, um derentwillen ich diesen Forscher noch mehr schätze. Wie reich muß die Sammlung sein, die er für seine Zwecke mitbrachte.«
»Er soll diese sogar schon mit der ihm charakteristischen Zähigkeit geordnet und schematisiert haben, so daß sie wohl bald zu besichtigen sein dürfte; es kann auch sein, daß er die Ausbeute seiner abenteuerlichen Fahrt einem Museum zuweist.«
Fred Wronker antwortete darauf:
»Ich bewundere ihn fast noch mehr, daß er es verstand, sich all den sensationshungrigen Journalisten zu entziehen, die sein Hotel und dann seine Wohnung wie eine Festung belagert haben sollen, um ein Interview zu erzwingen und um ein Bild von ihm zu erlangen.«
»Gibt es wirklich keine Aufnahme von ihm?«
»Nein! Wenigstens ist keine an die Öffentlichkeit gekommen.«
»Kennen Sie ihn persönlich, Herr Marlan?«
»Gewiß! Es wird mich freuen, Sie mit ihm bekannt zu machen. Ich fürchte nur, daß Sie dabei eine Enttäuschung erleben werden, denn seine äußerliche Erscheinung entspricht so gar nicht dem Bilde, das man sich von einem Manne mit solcher Energie macht. Eine Gelehrtenerscheinung, eher von philisterhafter Harmlosigkeit. Aber ich brauche ihn gar nicht erst zu schildern, denn jetzt können Sie selbst urteilen. Die Intimen des Exzentrikklubs kommen mit dem Kandidaten aus dem Beratungszimmer. Dort, der langbärtige Herr mit der Hornbrille, das ist Professor Marschall.«
Und bei den Worten von Alexis Marlan wandten sich auch schon die Augen der meisten jener Türe zu, die eben von den beiden Dienern aufgerissen wurde.
In Begleitung von vier Herren, den sogenannten Intimen des Exzentrikklubs, die als die gewählte Vorstandschaft und Führer galten, trat Professor Marschall in den großen Gesellschaftsraum, wo ihn die vielen wartenden Augen empfingen.
Auch die schwarzen Tollkirschenaugen von Anita Wronker suchten ihn; in diesen wenigen Augenblicken, da alle nur auf die Erscheinung des berühmten Forschungsreisenden schauten, achtete kaum jemand auf Anita Wronker, die bei dem Anblick der vielbesprochenen Persönlichkeit überrascht zusammenfuhr, wie es nur dann zu geschehen pflegt, wenn man irgend jemand unerwartet wiedererkennt.
Und von ihren schmalen Lippen kamen geflüstert die erregten Worte:
»Aber das ist er, kein anderer als ...«
Fred Wronker, der etwas von dem unverständlichen Flüstern gehört haben mochte, wandte sich der Schwester zu und fragte:
»Sagtest du etwas?«
»Nein, nichts, gar nichts.«
Da war Professor Marschall auch schon von einem so dichten Kreise umringt, daß seine Gestalt vorerst entschwunden blieb.
*
»Professor Marschall, Fräulein Anita Wronker, das jüngste Mitglied des Exzentrikklubs, und Fred Wronker.«
Alexis Marlan hatte die Vorstellung übernommen. Die Gruppe stand dabei in der Nähe des Einganges zur Bibliothek, an diesem Abende ein stiller Ort, der weniger aufgesucht wurde; denn die Räume mit den vielen, eingebauten Bücherschränken, die von allen Privatbibliotheken der Stadt als die umfangreichste galt, mit den einladenden stillen Nischen mit bequemen Klubsesseln und Schreibtischen wurden meist nur zu Studien und stillen Forschungsarbeiten aufgesucht. Dieser Abend galt aber zunächst der geselligen Unterhaltung.
Leise, schmeichelnde Klänge aus dem fernen Musikzimmer verrieten, wo um diese Zeit die meisten der Mitglieder zu finden waren.
Professor Marschall, hochgewachsen, aber in der Haltung wie ermüdet leicht vorgebeugt, fast schon wie gealtert, trotzdem er nur wenig über dreißig zählte, mit hellem aschgrauen Haar mit ebensofarbenem Vollbart, der gut gepflegt bis aus die Brust fiel, mit einer großen Hornbrille, hinter der durch die graue Färbung der Gläser die Farbe der Augen nicht bestimmt einzuschätzen war, verbeugte sich vor Anita Wronker und begrüßte dann deren Bruder.
Im Verlaufe einer ungezwungenen Unterhaltung, die an Äußerlichkeiten haften blieb, zogen sich die vier mehr in die Bibliotheksräume zurück; während dieses langsamen Schlenderns wandte sich Professor Marschall direkt an Anita Wronker und erklärte mit einem liebenswürdigen Lächeln:
»Ich begrüße mit besonderem Vergnügen, daß der Exzentrikklub auch den Ehrgeiz hatte, die schönste Frau in den Reihen seiner Mitglieder zu besitzen.«
Aber schon nach den ersten Worten machte sie eine abwehrende Bewegung und unterbrach ihn dann:
»Nein, Herr Professor, das durfte nicht kommen; Komplimente dürfen Sie nicht machen, abgesehen davon, daß es für mich kein Kompliment sein kann, wenn ich nur nach dieser lediglich äußeren Packung eingeschätzt werde, die nicht einmal mein Verdienst ist, sondern die ich dem Zufall meiner Geburt allein verdanke.«
»Oh, verzeihen Sie, wenn ich eine Ungeschicklichkeit sagte; aber in den Urwäldern des Amazonas verlernt man die primitivsten Anstandsregeln. Ich dachte, etwas besonders glücklich Gewähltes gesagt zu haben, zumal Ihnen der Spiegel sicher schon oft bestätigt haben wird, daß ich dabei der Wahrheit treublieb.«
»Jedenfalls mußten Sie wissen, daß Sie auch einer Dame gegenüber solche ... Redensarten wirklich nicht nötig haben, am wenigsten aber einem Mitglied des Exzentrikklubs gegenüber.«
»Ich danke Ihnen für die Unterweisung und bitte nochmals um Verzeihung, daß ich Sie nicht anders einschätzte. Ich bin durch meine dreijährige Abwesenheit fremd geworden.«
Lächelnd hob Anita Wronker den Kopf und antwortete mit einem leichten Drohen in der Stimme:
»Auch das ist keine genügende Rechtfertigung für Sie, denn das mußten Sie unbedingt wissen, daß Sie sich hier nur geben dürfen, wie Sie in Wahrheit sind. Und mit jenem Anfang hätten Sie ein falsches Bild von sich gegeben.«
»Wirklich? Sind Sie darin so sicher? Irren nicht Sie sich, indem Sie mich wiederum zu hoch einschätzen?«
Ein heftiges Kopfschütteln folgte:
»Nein! Darin bin ich sicher.«
»Hm! Sie gestatten mir wenigstens ein zweifelndes Kopfschütteln. Kennen Sie mich so viel besser als ich mich selbst?«
»Ja!«
»Haben Sie mich überhaupt schon einmal gesehen und dabei so gründlich studiert, daß Sie so entschieden sprechen dürfen?«
»Jawohl, Herr Professor.«
»Wirklich? And wann? Das möchte ich doch erzählt hören. Darf ich Sie auffordern, in einem dieser verschwiegenen Winkeln zu einer kleinen Plauderei Platz zu nehmen?«
Anita Wronker nahm den ihr angebotenen Klubsessel und setzte sich, worauf Professor Marschall ihr gegenüber Platz nahm; Fred Wronker und Alexis Marlan blieben plaudernd in der Nähe stehen und entfernten sich aber bald, als sie bemerkten, daß die beiden in der Nische ihre Anwesenheit vergessen zu haben schienen.
»Darf ich nun erfahren, welcher Begegnung ich Ihre gute Meinung verdanke? Ich selbst kann mich nicht erinnern, Ihnen schon einmal begegnet zu sein, eine sträfliche Nachlässigkeit, wenn es der Fall sein würde, da ich Sie dann nicht vergessen haben dürfte.«
»Nicht dieser Ton, Herr Professor, denn jene Begegnung war zu ernst. Ich sah Sie an der Wellingtonbrücke, vor vier Tagen, an dem nebeligen Montagabend ...«
Kaum hatte sie die Erklärung gegeben, als der lächelnde Ausdruck aus dem Antlitz des Professors sofort verschwand; die starken Brauen zogen sich zusammen und wurden nur von einer Querfalte durchschnitten. Aber nur ein Augenblick war es, dann schüttelte er bereits wieder den Kopf und entgegnete in einem sorglosen Tone:
»An der Wellingtonbrücke? Ich kann mich nicht entsinnen. Vielleicht ließen Sie sich doch durch eine Ähnlichkeit täuschen?«
»Nein! Sie werden sich vergebens bemühen, die Tat abzuleugnen, wie Sie es damals taten. Soll ich ausführlich wiederholen müssen, wie die Wasser von schwimmenden Eisschollen erfüllt waren, wie dann die ärmliche Frauengestalt von der Brücke hinunter in die Wogen sprang und gleich von einer Eisscholle niedergedrückt wurde, wie nur Schreie des Entsetzens nachklangen, denn niemand würde den Sprung in die eisigen Tiefen mitten unter die Eistrümmer gewagt haben. So schien es, aber da sprang doch einer von der Brücke hinunter.«
Da machte Professor Marschall eine abwehrende Handbewegung und unterbrach sie:
»Das ganze sah vielleicht gefährlicher aus. Von der Ferne läßt sich nicht alles so genau beurteilen.«
»Sie weichen mir nicht aus. Waren Sie es, Herr Professor? Waren Sie es, der für ein armes, verzweifeltes Weib sein Leben einsetzte, der die Arme auch rettete, aber dann, als der Schwarm der vielen hinzukam, entfloh und weiter nichts als seine Geldbörse für die Unglückliche zurückließ?«
»Es wird doch eine Täuschung gewesen sein.«
»Nein, das war es nicht, das war der Professor Marschall, wie ich ihn bei der ersten Begegnung kennenlernte und der Sie für mich bleiben sollen.«
»Ich finde darin noch keine Veranlassung, einen Heros erkennen zu wollen. Nächstenpflicht! Hätte ich nicht schwimmen können, dann würde ich es mir überlegt haben.«
»Und die Eisschollen und die Kälte und die Börse und die Flucht, um der Neugier auszuweichen?«
»Lassen wir das! Wenn der, den Sie beobachtet haben, anscheinend entflohen ist, dann lassen Sie ihm das von ihm selbst gewünschte Inkognito. Wir können nur wünschen, daß jener Unglücklichen geholfen wurde. Jedenfalls lasse ich mich belehren, und ich werde nie mehr so zu Ihnen sprechen, wie Sie es nicht wünschen. Sie müssen mir dann aber die andere Frage erlauben, womit ich Sie unterhalten darf.«
»Erzählen Sie mir von Ihren Reisen, von Ihrer Sammlung, die Sie dabei mitbrachten, und um die ich Sie beneide. Sprechen Sie mit mir, wie Sie es mit einem Manne tun würden, den Sie als gleichwertig einschätzen.«
Da beugte sich Professor Marschall vor, als wollte er ihr näher sein, als wollte er deutlicher in das schöne Gesicht sehen, das so anders redete als die schönen Frauen, denen man sonst in der Gesellschaft begegnet. Sie fühlte diesen fragenden, forschenden Blick und fügte daraufhin hinzu:
»Sie dürfen es wagen, Herr Professor! Genau so zweifelnd beobachtete mich auch einmal Werner Tegetthoff und nahm mich dann doch mit, als er die Durchquerung von Neuseeland wagte.«
Da richtete sich Professor Marschall auf:
»Wie? Höre ich recht? Werner Tegetthoff? So waren Sie es, die ihn auf jener abenteuerlichen Fahrt begleitete?«
»Allerdings!«
»Dann verzeihen Sie noch mehr! Ich hatte nur flüchtig auf den Namen gehört, und es wurden mir heute zu viele genannt. Nun sehe ich allerdings ein, daß ich mich Ihnen gegenüber ungeschickt benommen habe. Sie also waren die Begleiterin Tegetthoffs?«
Und als nach einer halben Stunde Fred Wronker und Alexis Marian wieder nach der Bibliothek zurückkamen, da saßen Anita Wronker und Professor Marschall immer noch in der gleichen Nische; dabei lag auf den Wangen Anitas ein dunkleres Rot, und auch Professor Marschall erzählte so lebhaft, daß er das Näherkommen der beiden gar nicht beobachtete.
Wronker und Marlan blieben in der Nähe stehen und schauten ein paar Sekunden schweigend auf die beiden in der Nische. Marlan neigte sich dann flüsternd an seinen Begleiter und bemerkte mit einem Lächeln:
»Wären die beiden nicht gerade Ihre Schwester und Professor Marschall, dann würde man in ihnen nur ein Liebespaar vermuten können, das sich hierher geflüchtet hat und in Selbstvergessenheit nicht mehr daran denkt, daß es noch andere Menschen gibt.«
Fred Wronker aber spürte trotzdem den Spott aus den Worten und trat deshalb näher und machte sich dabei durch seine schweren Schritte und dann durch eine flüchtig dazwischengeworfene Frage bemerkbar.
Unwillig warf Anita Wronker dabei den Kopf mit dem schwarzen Haar in den Nacken zurück; sie fühlte, da sie ihren Bruder genau kannte, die absichtliche Störung und konnte sich im Unmut darüber nicht sofort beherrschen. Dann erhob sie sich, und auch Professor Marschall stand auf und gab auf die an ihn gerichtete Frage Antwort.
Wie zufällig fügte es sich dabei, daß die vier dann zu den anderen Gesellschaftsräumen des Klubs zurückkehrten, aber der Professor neben Anita, während die beiden Herren langsam nachfolgten.
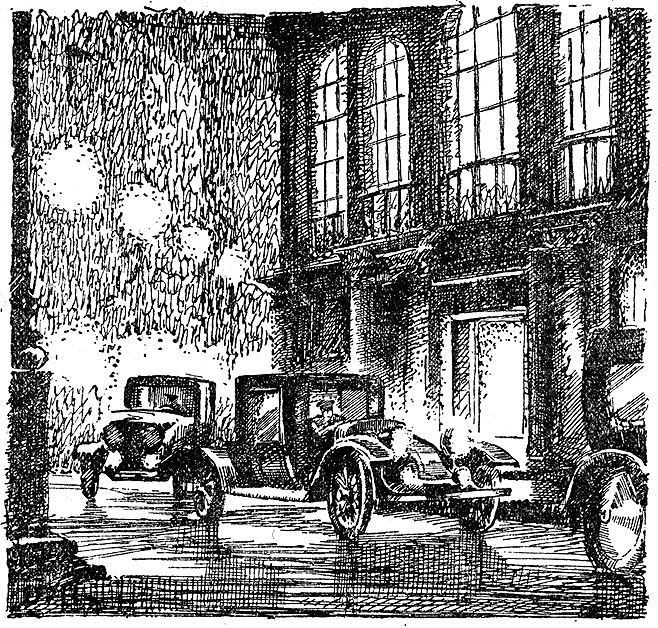
Ein geschlossenes Auto hielt vor dem hellerleuchteten Portal des Exzentrikklubs.
Fred Wronker kam mit raschen Schritten die wenigen Steinstufen herunter, öffnete den Wagenschlag und wandte sich dann mit einem fragenden Blick zurück; da folgte ihm auch schon seine Schwester, die aber nochmals unter dem Eingange stehen blieb und sich ihrem Begleiter zukehrte, der sie hierher geführt hatte. Es war dies die hohe Erscheinung des Professors Marschall, der bei diesem Abschied ihre Hand etwas länger in der seinen hielt, als es die bloße Höflichkeit erforderte.
Ein Leuchten war in den schwarzen Augen Anitas, als sie ihm noch die Frage zuwarf:
»Sie erlauben mir also, daß ich Ihre Sammlung sehen darf, ehe sie noch der Öffentlichkeit übergeben wird?«
»Mit Freuden sogar, und da ich Sie nun erst kennen und verstehen lernte, werde ich sogar besonders stolz sein, wenn diese zunächst Ihre Anerkennung findet.«
»Daß dies zutreffen wird, davon bin ich überzeugt. Ist Ihnen der kommende Donnerstag erwünscht? Ich werde gegen Mittag vorfahren.«
Da hob Professor Marschall den Kopf, als überlegte er, und für einen Augenblick huschte ein düsterer Ausdruck über sein Gesicht. Dann zog er die Schultern hoch, als wollte er damit einen Gedanken abschütteln. Und in dem gleichen Tone wie vorher gab er ihr die Antwort:
»Gewiß, ich werde die Stunde sicher nicht vergessen.«
Als sie sich dann die Hände reichten, da geschah es in der Art, wie zwei gute Freunde voneinander Abschied nehmen. Nur das Aufleuchten in den Augen der beiden verriet, daß sie schließlich gegenseitig mehr aneinander als nur freundschaftliches Verständnis gefunden hatten.«
»Auf Wiedersehen!«
Fred Wronker stand schon ungeduldig an dem offenen Wagenschlag; Anita stieg ein, Fred folgte nach, schlug die Türe zu, der Chauffeur kurbelte an, und mit einem knatternden Puffen fuhr das Auto ab; dabei beugte sich Anita nochmals zu dem Fenster hin, und ihre bereits in den Handschuh eingezwängte Hand winkte grüßend zu dem Portal hin, vor dem Professor Marschall immer noch stand und dem Auto nachschaute.
Anita Wronker lehnte sich darauf in die Wagenecke zurück und blickte mit träumenden Augen vor sich hin. Sie regte sich nicht und hatte auch für ihren Bruder keine Frage, der gleichfalls längere Zeit wortlos vor sich hinstarrte. An dem Fenster schwirrten die Häuserreihen vorbei, dann kahle Alleebäume, Wagen und Menschen. Außer dem monotonen Töfftöff des Motors und dem gelegentlichen Hupensignal des Chauffeurs war eine Weile nichts anderes zu hören, als ab und zu das unmerkliche Knistern von Seide bei einer unwillkürlichen Bewegung Anitas.
Sie hatte auch kein Bedürfnis nach irgendwelchem Gespräch, denn ihre Gedanken beschäftigten sich viel zu stark mit der Begegnung dieses Abends. Was sie bei diesem Rückerinnern fühlte, das ließ sie sogar die Augen schließen, um nicht durch nebensächliche Äußerlichkeiten abgelenkt zu werden. Dabei lag auf dem schmalen Oval ihres Antlitzes ein zufriedener Ausdruck wie der eines erfüllten Wunsches.
Fred Wronker, der diese Zeit auf die entgegengesetzte Seite hinausgeblickt hatte, wandte mit einer plötzlichen Drehung sein Gesicht der Schwester zu und erklärte dann in einem so bestimmten Tone, der deutlich fühlen ließ, daß sich vorher schon seine Gedanken mit dieser Bemerkung beschäftigt hatten:
»Es war aufgefallen und hat auch auffallen müssen, daß du dich mehr, als es für eine erste Begegnung nötig war, dem Professor widmetest. Dreiviertel Stunden wart ihr allein in der Nische der Bibliothek.«
Anita öffnete die Augen:
»So lange?«
»Das war doch nicht notwendig?«
»Hast du die Zeit mit der Uhr in der Hand kontrolliert?«
Fred fühlte den Spott, den sie ihn auch absichtlich erkennen ließ; deshalb klang auch seine Entgegnung gereizter, als es anfänglich in seiner Absicht gelegen sein mochte:
»Du kannst dir diesen Ton mir gegenüber ersparen, denn du weißt, daß ich dir in allen deinen Entschlüssen freies Spiel lasse; aber es ist doch peinlich für mich, Bemerkungen anhören zu müssen, die ...«
Anita ließ ihn den Satz nicht zu Ende sprechen und unterbrach ihn mit den rasch dazwischen geworfenen Worten:
»Wenn jemand Bemerkungen machte, kann es nur Herr Marlan gewesen sein.«
»Was ändert das an der Tatsache, daß du dich dem Professor geradezu aufdrängtest.«
»Still, Fred, vergiß nicht, daß ich eine Dame bin, auch als deine Schwester; wenn du deiner Schwester gegenüber das Recht zu haben glaubst, in einem solchen Tone zu sprechen, dann darfst du dies der Dame in mir gegenüber nicht. Du wirst dich immer damit abfinden müssen, daß ich Männern gegenüber nicht als eine aus dem sogenannten schwachen Geschlecht behandelt werden will.«
»Aber gerade so sah es aus, als wenn du mehr als jede andere zu diesem schwachen Geschlecht gehörtest. Wollte man boshaft sein, dann hätte man euch beide in der Nische mit einem Liebespaar vergleichen können.«
Sofort unterbrach ihn wieder die Frage:
»Stammt dieser Vergleich von dir?«
»Das ist gleichgültig! Jedenfalls traf er zu.«
Da richtete sich Anita mit einem Ruck steil auf; ihre Augen zeigten sich in der Erregung weit offen, und ihre Stimme bekam einen scharfen Ton:
»Und wenn es so wäre? Wenn ich diesen Vergleich sogar akzeptierte?«
»Anita!«
»Was!«
Die Blicke der beiden trafen sich in gegenseitigem Versenken; dann lachte Fred erzwungen und bemerkte daraus:
»Das antwortest du ja nur, um mich zur Opposition zu reizen. Dein Ernst kann es nicht sein.«
Jetzt zog Anita ihre Schultern hoch und ließ sich darauf wieder in die Wagenecke zurückfallen; ein paar Sekunden verstrichen, ehe sie antwortete:
»Du hast recht, es wurde zwischen uns wirklich nichts gesprochen, was man bei einem Liebespaar erlauschen würde. Aber ...«
Und nach diesem leisen, eher wie verträumt klingenden Aber schwieg Anita Wronker, ohne den Gedanken vollends auszusprechen. Die schmalen Lippen schlossen sich, und die langen, seidenweichen Wimpern senkten sich halb, als wollten sie einen zu forschenden Blick abwehren.
»Was meintest du mit dem Aber?«
»Nichts!« Doch kaum hatte sie dies geantwortet, als sie sich bereits wieder anders zu besinnen schien; ihre Augen öffneten sich wieder ganz und begegneten dem Blicke ihres Bruders wie herausfordernd: »Oder doch! Ich liebe die Wahrheit, du kannst sie auch hören; das wollte ich hinzufügen: Aber unsympathisch wäre mir der Gedanke nicht einmal, daß wir wirklich ein Liebespaar in der Nische gewesen sein könnten.«
»Wie meinst du das?«
»Wie? Ist das so schwer zu verstehen? Daß dieser Professor Marschall der erste Mann ist, den ich lieben könnte.«
»Und das sagst du so ruhig?«
»Warum nicht? Du wirst es ihm doch nicht weitererzählen; daß ich es auch nicht tun werde, wirst du mir wohl glauben. Was liegt also daran, zumal er selbst von einem ähnlichen Gedanken kaum beunruhigt werden wird? Ist es so schlimm, was ich sagte, wenn der Gedanke doch nur ein Wunsch ist und auch bleiben wird?«
»Immerhin, aber ...«
»Ich weiß jedes Wort, das du nun für mich bereit hast. Erspare dir also, was ich mir selbst sagen kann.«
»Du solltest dich wirklich nicht so gehen lassen. Natürlich wird dir viel verziehen und mit deiner Eigenart entschuldigt. Deshalb gibt es aber doch Dinge, die ...«
Fred Wronker redete noch lange auf seine Schwester ein. Diese hatte den Kopf wieder in die Wagenecke zurückgelehnt und die Lider ganz geschlossen; es war nicht zu unterscheiden, ob sie überhaupt noch auf den Bruder hörte, oder ob sie nicht anderen Gedanken nachjagte, die sie weit fortführten.
Fred Wronker jedoch sprach immer noch, bis das Auto endlich vor der kleinen Villa der beiden Geschwister hielt.
*
Professor Marschall saß an dem großen Diplomatenschreibtisch seines Arbeitszimmers. Er beugte sich über einen Briefbogen, während die Hand mit der Feder eilig über das Papier hastete; einige Male hielt er im Schreiben inne, blickte auf und schaute eine kurze Zeit wie überlegend oder träumend vor sich hin. Dabei wechselte der Ausdruck seines Gesichtes in seltsamer, sich widersprechender Art; bald zeigten sich über den Rändern der Hornbrille mehrere Falten, dann kniffen sich die Lippen zusammen und seine Hand strich über den langen Bart, als sinne er über irgend etwas nach, worauf in jähem Wechsel ein Lächeln nachfolgte.
Dann begann die Feder wieder über das Papier zu jagen.
Der große Raum entsprach in seiner Einrichtung genau der Persönlichkeit dieses Mannes; da hingen an den Wänden alte, schwere Teppiche aus Chapul und Johore in den reichen, phantastischen Mustern und in den tiefen Farben, und an den Teppichen wiederum sah man Waffen seltsamster Art, malaiische Messer, Speere der südamerikanischen Indianer, alte chinesische Gewehre und ähnliche. In den großen Schränken mit Glastüren lagen wunderliche Werkzeuge und Dinge wie tibetanische Gebetmaschinen, Hüte aus den verschiedensten Ländern, farbig bestickte Mäntel, wie sie von den Indianern der nördlichen Kordilleren hergestellt werden, gegerbte Lederhosen mit grellfarbenen Perlen und mannigfache Gefäße.
Auf einem zweiten Tische befanden sich in einem chaotischen Durcheinander verschiedene Gegenstände, die wohl zu der Ausbeute seiner letzten Reise gehören mochten und erst einer Sammlung eingereiht werden mußten.
Auf dem Schreibtische aber, an dem er schrieb, lagen verschiedene Schriftstücke, Briefe, Manuskripte, Bücher und dergleichen.
In der einen Ecke, nahe beim Fenster, stand ein ziemlich umfangreicher, gelblichbrauner Rohrplattenkoffer mit starken Messingbeschlägen, der gleichfalls noch mit Ergebnissen aus seiner Forschungsfahrt gefüllt sein mochte.
Unterdessen hatte Professor Marschall den Brief vollendet, überflog ihn nochmals mit raschen Blicken und steckte ihn dann in einen Umschlag, den er sorgsam verschloß. Nachdem er dann nach der Tischglocke für den Diener gegriffen hatte, schrieb er die Adresse auf den Briefumschlag.
Einige Minuten später trat der Diener, eine knochige, hagere Gestalt mit dünnem Haar und hellem Backenbart in das Zimmer und blieb fragend an der Türe stehen.
Professor Marschall stand auf, den nun auch noch versiegelten Brief in der Hand:
»Lassen Sie diesen Brief einschreiben; auf dem Towerpostamt; dabei können Sie dann auch meine Zeitungen abholen.«
Der Diener machte in militärischer Art eine Zustimmung und nahm den Brief entgegen:
»Jawohl, Herr Professor!«
Schon war der Diener wieder an der Türe und hatte diese bereits halb geöffnet, als ihn Professor Marschall nochmals zurückrief:
»Einen Augenblick noch! Sollte sich später ein Herr Edwin Steffen melden, so lassen Sie diesen sofort eintreten, ohne ihn erst anzumelden. Ich erwarte ihn längst.«
»Jawohl, Herr Professor!«
Und jetzt erst verließ der Diener wieder das Zimmer, während Professor Marschall wieder an den Schreibtisch trat.
In einem gemächlichen Tempo und ohne Übereilung machte sich der Diener auf den Weg nach dem Postamte; dabei las er natürlich auch die Adresse des Briefumschlages, wobei er wiederholt den Kopf schüttelte.
Fräulein Anita Wronker, Stöwerallee 35.
Der Brief war bald erledigt, aber der Diener ließ die ihm zur Verfügung gestellte Zeit nicht unbenützt und machte noch in einem Bierkeller Station, ehe er nach der Wohnung zurückkehrte.
Als er dann in das Haustor einbog und die Treppe hinaufstieg, bemerkte er, daß hinter ihm eine Gestalt nachfolgte, die schließlich bei ihm vor der Wohnungsflurtüre stehen blieb.
Als er dann den Schlüssel aus der Tasche nahm, fragte der Fremde:
»Wohnt hier Herr Professor Marschall?«
Die Augen des Dieners musterten den Fremden; es war dies eine hohe, schlanke Erscheinung mit modischem Anzuge, der elegant saß und offenbar aus einem ersten Maßatelier stammte, mit glattrasiertem Gesichte, das fast auf einen Schauspieler schließen ließ, zumal die Wangen eine feine Schicht von Puder zeigten, mit dunklem, etwas parfümiertem Haar und unruhigen Augen. Er trug einen Zylinder und einen kurzen Paletot; unter den Beinkleidern zeigten sich schmale Streifen heller Gamaschen.
Der Diener nickte:
»Allerdings! Wünschen Sie zu dem Herrn Professor?«
»Ja! Er hat mich für heute gerufen. Mein Name ist Doktor Steffen. Hier ist meine Karte!«
Dabei griff er in die Seitentasche seines Paletots und reichte dem Diener in der in einen Lederhandschuh gezwängten Hand eine schmale Visitenkarte, die dieser auch entgegennahm.
»Doktor Edwin Steffen« stand auf der Karte.
Inzwischen hatte der Diener aufgesperrt und den Besucher in den Flur eintreten lassen; während er die Türe wieder schloß, antwortete er:
»Ich weiß, der Herr Professor hat mich bereits verständigt, daß er Sie erwartet; Sie können gleich bei ihm eintreten. Es ist gar nicht nötig, daß ich Sie erst anmelde. Dort ist die Türe!«
Dabei wies der Diener auf die Türe, die in das Arbeitszimmer führte, während er langsam in sein Zimmer ging, nachdem er noch zugesehen hatte, wie der Besucher nach einem kurzen Anpochen durch die bezeichnete Türe eingetreten war.
Er wußte, daß der Professor keine Störung liebte, solange er Besucher hatte, und sein Erscheinen nur auf ein Läutsignal wünschte.
In dem Dienerzimmer beschäftigte er sich dann mit eigenen Angelegenheiten und las in den mitgebrachten Zeitungen. Inzwischen war die abendliche Dunkelheit vollends hereingebrochen, so daß er längst das elektrische Licht einschalten mußte.
Einmal blickte er auch flüchtig nach der Uhr hin und murmelte dabei halblaut vor sich hin:
»Das scheint mit diesem Doktor ...« – er sah dabei wieder auf die Visitenkarte, die er mitgenommen hatte: »Doktor Edwin Steffen eine lange Unterhaltung zu werden; schon über eine Stunde.«
Da aber Doktor Marschall selten vor zehn Uhr den Abendtisch gedeckt haben wollte, so blieb dem Diener noch freie Zeit genug. In der Küche lag ja schon alles vorbereitet, so daß es genügte, wenn er eine halbe Stunde vorher hinüberging, um den Tisch im Eßzimmer zu decken.
Doch auch diese Zeit verstrich, und der Diener wollte eben zur Küche gehen, als sich das elektrische Glockensignal bemerkbar machte, das ihn zu dem Arbeitszimmer seines Herrn rief.
Als er dann im Flur war und auf die Türe zugehen wollte, kam ihm bereits jener Doktor Steffen entgegen, der dabei eine erregte Art zeigte und den Diener am Arm faßte; mit etwas schrill klingender Stimme redete er auf ihn ein:
»Dem Herrn Professor Marschall ist ein plötzliches Unwohlsein zugestoßen; ein Unfall, ein Zusammenbruch der Nerven. Ich habe sofort ein Rezept aufgeschrieben, das sicher Hilfe bringen wird. Besorgen Sie das in der Apotheke! Sie werden allerdings auf die Fertigstellung einige Zeit warten müssen, aber es ist das für seine Erkrankung das wirksamste Mittel.«
Der Diener nahm den schmalen, beschriebenen Papierstreifen entgegen und fragte:
»Kann ich sonst noch etwas für den Herrn Professor tun?«
Dabei glitt der Blick suchend zu der nur angelehnten Türe hin.
Doktor Steffen verneinte:
»Nein! Alles was Sie tun können, ist die rascheste Erledigung dieses Rezeptes.«
Daraufhin zögerte der Diener nicht mehr länger und verließ die Wohnung.
Er mußte das bereits verschlossene Haustor aufsperren. Die Straße lag still und dunkel, und nur wenige Passanten waren noch anzutreffen. Dichter Nebel erfüllte die Luft, durch den die Lichter der Bogenlampen nur schwach hindurchdringen konnten.
Der Diener eilte mit hastenden Schritten zu der nächsten Apotheke in der Boverystraße, die aber schon geschlossen war und an der er durch einen Anschlag erfuhr, daß für diese Nacht die Apotheke in der Laudonallee Dienst hatte. Der Diener mußte daher wieder einen anderen Weg nach der Laudonallee einschlagen; dort verstrich abermals einige Zeit, bis ihm schließlich auf sein Läuten der Nachtglocke geöffnet wurde.
Ein alter, weißbärtiger, mürrischer Provisor ließ ihn in den Apothekenraum eintreten, wo er auf einer Bank bis zur Herstellung warten konnte.
Mit einem Blick auf die Uhr überzeugte er sich, daß die Zeit schneller verstrichen war, als er es gedacht hatte. Als er endlich das Rezept ausgehändigt erhielt, war es schon elf.
Rasch eilte er wieder nach der Wohnung zurück.
Als er droben dann die Korridortüre aufgesperrt hatte, kam ihm im Flur schon wieder jener Doktor Steffen entgegen und redete mit flüsternder Stimme auf den Diener ein:
»Gut, daß Sie zurückkommen. Der Herr Professor hat sich schon wieder erholt und wollte von mir in sein Schlafzimmer gebracht werden. Ich unterstützte ihn dabei und brachte ihn auch in das Bett, in dem er bald vor Erschöpfung einschlief. Dieser Schlaf ist für seine Heilung noch das Beste. Er wünschte, nicht mehr gestört zu werden. Sie werden daher am besten tun, wenn Sie ihn auch morgen früh nicht eher stören, bis er Sie selbst ruft.«
»Sonst habe ich nichts mehr zu besorgen?«
»Nein! Die Ruhe ist das Beste! Sie müssen mich nun aber hinauslassen. Morgen im Laufe des Vormittags werde ich nochmals vorsprechen.«
Doktor Steffen war dem Diener schon in seinem Paletot und mit dem Zylinder entgegengekommen.
Mit leise gegebenen Anweisungen verließ er darauf mit diesem den Flur und stieg die stille Treppe hinunter. Der Diener sperrte auf und ließ Doktor Steffen in die nächtlich einsame Straße hinaus. Er blickte auch noch eine Weile in der Richtung nach, in der sich dieser entfernte, und kehrte dann erst wieder in die Wohnung selbst zurück.
Im Flur blieb er ein paar Sekunden stehen, als überlegte er, was er tun könne.
Aber es war durch seinen Gang nach der Apotheke und das Warten doch spät genug geworden.
Auch für den Professor Marschall waren sicher ungestörte Ruhe und Schlaf am besten. Und im Arbeitszimmer ließ sich am nächsten Morgen auch noch Ordnung machen.
Der Diener ging daher gleich zu Bett; es verstrichen darauf auch nur ein paar Minuten, und er ließ bereits jene Töne hören, die einen gesunden Schlaf verrieten.
*
Schon zu wiederholten Malen hatte der Diener nach der Uhr geblickt; diese wies schon auf neun!
So spät war Professor Marschall noch nie aufgestanden, denn er gehörte zu den Frühaufstehern.
Allerdings war er in der Nacht unwohl geworden, und da mochte der lange Schlaf nur von heilendem Einfluß sein. Jedenfalls wollte der Diener seinen Herrn auch nicht stören, ehe ihn dieser nicht selbst rief, wie er ihm durch jenen Doktor Steffen erklären ließ. Aber unterdessen konnte er im Arbeitszimmer lüften, die neuen Zeitungen hineintragen und dort etwas Ordnung schaffen, wie es seine tägliche Aufgabe war.
Nach einem flüchtigen Blick in die Küche, in der schon die Eier, Butter und Honig vorbereitet lagen, die der Professor zum ersten Frühstück wünschte, suchte der Diener das Arbeitszimmer auf.
Kaum hatte er dort die Türe hinter sich geschlossen, als seine Augen sofort auf die Unordnung aufmerksam wurden, die dort herrschte.
Da lagen auf dem Boden die verschiedensten seltsamen Dinge verstreut, merkwürdige Waffen, Kopfschmucks aus bunten Federn und Kristallen, farbig gewebte Tücher, Trommeln und wunderliche Gefäße; der Diener erinnerte sich sofort, daß diese vorher in dem großen Rohrplattenkoffer aufbewahrt waren, aus dem sie anscheinend herausgeworfen worden waren.
Bei dieser Beobachtung suchten seine Augen natürlich den Rohrplattenkoffer.
Aber er fand ihn nicht; er war aus dem Zimmer fort. Was war mit dem Koffer geschehen?
Und warum waren die Dinge so wild über den Boden verstreut?
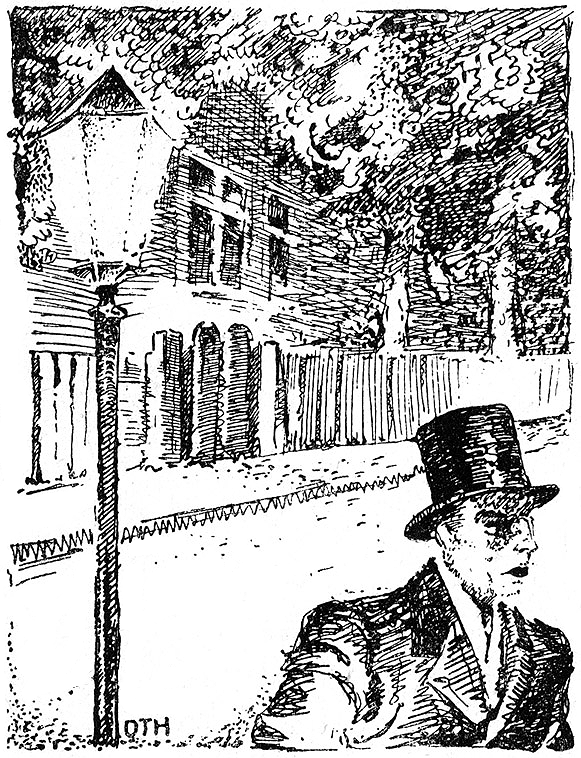
Der Diener wurde nun erst aufmerksamer. Da waren auch die Schubfächer des Schreibtisches herausgerissen, und Briefe und Blätter lagen gleichfalls zerstreut umher.
Was bedeutete das? Es schien, als habe hier irgendein Wahnsinniger gehaust.
Da entdeckte der Diener etwas, worüber er derart erschrak, daß ein Ausruf des Entsetzens über seine Lippen kam, daß er selbst wie angstvoll wieder in der Richtung zur Türe zurückwich.
Starr hafteten seine Augen auf eine Stelle am Boden.
Was war das? Er konnte sich doch nicht irren.
Blut! Das klebte nicht nur auf dem Parkett des Bodens, sondern auch auf dem großen Smyrna. Blut! Selbst von einigen Papieren leuchtete dies verräterische Rot!
Aber wessen Blut war dies, und wie kam das Blut hierher?
Dabei diese nun grauenvoll und erschreckend wirkende Unordnung?
Warum vor allem war anscheinend alles aus dem großen Koffer herausgeworfen und der Rohrplattenkoffer selbst verschwunden?
Es waren dies die entsetzten Fragen einiger Sekunden, während der Diener mit angstvoll geweiteten Augen an der Türe lehnte.
Und das Blut?
Da riß er auch schon die Türe auf, ohne sie wieder zu schließen und lief hastig über den Flur zu dem Schlafzimmer des Professors.
An der Türe zögerte er noch; aber das Erschrecken über das Geschaute wirkte so mächtig nach, so daß er die Türe aufriß, ohne erst anzupochen.
Doch hier erwartete ihn ein ebenso großes Erschrecken. Sein erster Blick fiel auf ein völlig unberührtes Bett.
Vom Professor Marschall war nichts zu sehen.
Da rief der Diener mit ängstlich klingender Stimme:
»Herr Professor! Herr Professor!«
Aber so oft und so laut er den Ruf auch wiederholte, er bekam von nirgendwoher Antwort.
Nun lief er aus dem Schlafzimmer, eilte in den Baderaum, dann in das Wohnzimmer, jagte durch alle Räume der Wohnung, als müßte Professor Marschall irgendwo doch zu finden sein.
Nur in jenes Arbeitszimmer, in dem das Blut auf dem Boden klebte, wagte er sich nicht wieder zurück.
Aber der Professor war nirgends zu finden.
Im Flur draußen blieb der Diener dann stehen.
Was war geschehen, und was sollte er tun?
Professor Marschall spurlos verschwunden, so verschwunden wie auch der große Rohrplattenkoffer aus dem Arbeitszimmer; dies kam ihm für den Augenblick in den Sinn.
Wann konnte der Professor fortgegangen sein? Er hätte dies doch hören müssen.
Und dann hatte dieser Doktor Steffen doch erklärt, er habe den Professor selbst zu Bett gebracht. Aber das Bett war unberührt.
Wie war das zu erklären?
Und dann das Blut? Und weshalb war der Koffer so vollständig ausgeräumt worden, ehe er verschwinden mußte?
Wenn ... wenn ... ein Verbrechen begangen worden sein sollte? Immer wieder mußte er an das Blut denken.
Der Diener strich sich mit dem Ärmel über das Gesicht. Immer neue Gedanken meldeten sich jetzt: Hatte jener Doktor Steffen nicht immer wieder geschickt zu verhindern gewußt, daß er selbst in das Arbeitszimmer kam? Hatte dieser ihn nicht auch veranlaßt, daß er das Schlafzimmer nicht mehr aufsuchte?
Wo aber war der Professor?
Was war mit diesem geschehen?
War es sein Blut? Doch wo war er? Und der Koffer?
Immer wieder drängte sich der Gedanke nach dem ebenso spurlos verschwundenen Koffer dazwischen.
Und dann ... warum war der Koffer vorher so vollständig ausgeleert worden?
Da ertrug der Diener die Ungewißheit und die Angst, die sich immer noch verstärkte, nicht mehr länger und lief aus dem Flur und stieß die Türe kräftig zu.
Dann blieb er tief aufatmend im Treppenhause stehen.
Was nun? Zur Polizei!
Diese allein mochte helfen! Er dachte an nichts anderes mehr, als daß ein Verbrechen begangen worden sein mußte. Aber wie? Und warum? Durch wen?
Doktor Steffen!
Und er lief, so rasch ihn seine Füße trugen, nach der nächsten Polizeistation.
*
Lebhaft gestikulierend lief der Diener neben der kleinen unscheinbaren Erscheinung des Polizeiinspektors Wendland her, den er nach der Wohnung führte, und dem er alles erklärte, was er selbst vorgefunden hatte, und was ihn so erschreckt hatte.
Inspektor Wendland gehörte zu den befähigtsten Kriminalbeamten der Stadt, so harmlos seine äußerliche Erscheinung auch war. Das hagere, bartlose Gesicht schien in der lächelnden Sorglosigkeit, die fast einfältig wirkte, eher das eines harmlosen Pastors zu sein; auch sonst wirkten die schmalen Schultern und der etwas gekrümmte Rücken schwächlich und unscheinbar; auch die graublauen Augen verliehen ihm einen gutmütigen Ausdruck. Dabei war er in allen Verbrecherkreisen am gefürchtetsten, denn unter der Maske seiner Gutmütigkeit verbarg sich eine außergewöhnliche List und ein kühl berechnender Scharfsinn.
Der Diener hatte seinen Bericht längst vollendet, aber der Inspektor schwieg immer noch, während er neben diesem herschritt.
Erst nach einiger Zeit warf er ein paar Fragen wie flüchtig und gleichgültig dazwischen:
»Wie lange war dieser Doktor Steffen mit Professor Marschall allein, bis sie gerufen wurden?«
»Fast zwei Stunden; vielleicht war es noch länger.«
»Wie spät war es, als dieser Doktor Steffen kam?«
»Gegen sieben etwa.«
»Und wann schickte er Sie in die Apotheke?«
»Da war es vielleicht halb zehn.«
»Wann kamen Sie von der Apotheke wieder zurück?«
»Nach elf. Ich war zuerst in einer Apotheke, die keinen Nachtdienst hatte.«
»In der Zeit vom Erscheinen dieses Doktors Steffen an hatten Sie Ihren Herrn nicht mehr gesehen?«
»Nein!«
»Aber Professor Marschall war auf dessen Kommen schon vorbereitet?«
»Ja! Er sagte doch, daß ich diesen, ohne ihn erst anzumelden, einlassen dürfe.«
»Hörten Sie während der Nacht kein Geräusch mehr?«
»Nein!«
»Hatte Professor Marschall früher schon einmal derartige Anfälle, wie sie dieser Doktor Steffen dann schilderte?«
»Nein! Ich weiß nichts darüber.«
Nach diesen Fragen kamen die beiden vor der Wohnungstüre an, die der Diener aufsperrte, der dann mit der Hand auf die immer noch offen stehende Türe zum Arbeitszimmer wies. Er hatte nicht den Mut voranzugehen und folgte erst zögernd hinter dem Inspektor Wendland nach.
Dieser trat nicht gleich in das Zimmer, sondern blieb in der Nähe der Türe stehen, um von dort aus alles zu überschauen. Seine grauen, hellen Augen glitten unstet im Raum umher, und den scharfen, stechenden Blicken schien nichts entgehen zu können.
Den Kopf etwas zurückgewandt fragte er:
»Scheint jener Rohrplattenkoffer nach den hier liegenden Sachen vollständig ausgeräumt worden zu sein?«
»Ja!«
Dann ging der Inspektor mit einem eigenartigen wiegenden Gang nach der Mitte des Zimmers zu und kniete zunächst vor den auffallenden Blutspuren nieder, die er mit einer Lupe eingehend prüfte.
Als er darauf die vielen Papiere, die gleichfalls den Boden bedeckten, vorsichtig beiseite räumte, entdeckte er unter diesen mehrere medizinische Instrumente, wie sie zu dem Operationsbesteck eines Chirurgen gehören. Mit einer raschen Bewegung griff er danach.
Und an dem blanken Stahl dieser Instrumente klebte gleichfalls vertrocknetes und trübe aussehendes Blut. Mit diesen blanken Operationswerkzeugen mußte hier gearbeitet worden sein. Nach dem Blute aber an einem toten menschlichen Körper.
Jäh richtete sich der Kriminalinspektor aus seiner knienden Stellung auf:
»Stammen diese medizinischen Instrumente von Ihrem Herrn?«
Überrascht schaute der Diener auf die ihm gezeigten Messer und Pinzetten und schüttelte dann den Kopf:
»Nein! Ich hätte diese doch einmal sehen müssen.«
Und nach einem kurzen, wie überlegenden Schweigen folgte die weitere Frage:
»Wie groß war denn dieser Koffer?«
»Wie groß? Immerhin so hoch und so breit.«
Dabei zeigte der Diener die Maße mit den Händen.
Und dann kam eine Frage, vor der der Diener deshalb erschrak, weil diese sich mit Gedanken kreuzte, die er selbst schon gehabt hatte:
»So war dieser Koffer groß genug, daß in diesem schließlich ein Leichnam verborgen werden konnte?«
Mit angstvoll geweiteten Augen gab der Diener Antwort:
»So groß war er wohl.«
»Nach dem Weggange dieses Doktor Steffen kamen Sie auch nicht mehr hier in das Zimmer?«
»Nein, er sagte doch, ich dürfe sofort mein Zimmer aufsuchen.«
»Konnte dieser Doktor Steffen, während Sie in der Apotheke waren und dort warten mußten, das Haus verlassen haben, um dabei den Koffer fortzuschaffen?«
»Das weiß ich nicht.«
Der Inspektor nickte darauf und setzte seine weitere Untersuchung fort.
Unter den auf den Boden hin verstreuten Papieren fiel ihm dann ein schmales, längliches Heft mit grünem Umschlag in die Hände. Er blätterte darin.
Ein Scheckbuch.
Das letzte der Formulare war offenbar sehr hastig herausgerissen worden, denn der perforierte Rand war unregelmäßig und an einer Stelle abgerissen.
Sofort nach dieser Beobachtung sprang der Inspektor aus seiner knienden Stellung auf und trat rasch an den Schreibtisch; dort galt seine erste Aufmerksamkeit der Schreibtischunterlage und dem Löscher.
Dann wandte er sich an den Diener und erklärte mit hastender Stimme:
»Hier ist nichts mehr zu erledigen, wenigstens vorerst nicht, denn ein Toter ist nirgends zu entdecken. Bleiben Sie hier und lassen Sie niemand herein; ich aber habe einen anderen Weg zu machen, der vielleicht das Rätsel des spurlosen Verschwindens erklärlich macht.«
»Ich soll alleinbleiben?« fragte der Diener ängstlich und schaute wie hilflos umher.
»In einer halben Stunde hoffe ich wieder hier zu sein und auch zu wissen, warum Professor Marschall verschwinden mußte.«
Mit dieser Erklärung verließ der Inspektor das Zimmer, ohne ein Wort darüber zu verraten, was sein Ziel sein sollte, und was er dabei erwartete.
*
Alexis Marlan, der Chef der Sicherheitspolizei, ging in seinem Amtszimmer mit langen Schritten auf und nieder, die Hände in die Seitentaschen seines Sakkos vergraben, während Inspektor Wendland seinen Bericht über das seltsame Verschwinden des Professors Marschall beendete.
Die hagere Gestalt mit dem sonnverbrannten Gesicht und den hellen Augen blieb in der Nähe des Fensters stehen und kehrte dabei dem Kriminalbeamten für ein paar Augenblicke den Rücken zu. Mit einer raschen Bewegung drehte er sich um und erklärte dann mit scharf akzentuierter Stimme:
»Wir müssen in dies Rätsel Aufklärung bringen. Professor Marschall ist eine Persönlichkeit von solcher Bedeutung, daß sein Verschwinden überall Aufsehen erregen wird. Schon deshalb müssen alle Kräfte eingesetzt werden, die uns zur Verfügung stehen.«
Mit auseinandergespreizten Beinen stand er nun vor dem Inspektor, der mit einem zustimmenden Nicken seines Kopfes die Antwort gab:
»Das Verschwinden selbst ist schließlich ja schon erklärt.«
»Ja, ja, ich weiß! Aber das genügt noch nicht.«
»Ich habe die Zeugen gleich mitgebracht; sie stehen im Vorzimmer. Sie können Ihre Aussagen wiederholen.«
»Gut! Lassen Sie diese hereinkommen; ich möchte sie selbst hören. Vielleicht habe ich auch noch eine Frage an diese zu stellen.«
Inspektor Wendland trat rasch an die Türe, öffnete diese, winkte mit der Hand hinaus, worauf sich drei Gestalten zur Türe hereinschoben und in deren Nähe mit fragenden Blicken stehen blieben.
Alexis Marlan setzte sich wieder an den großen Diplomatenschreibtisch, auf dem Akten, Schriftstücke, Bücher und Urkunden lagen, und richtete seine hellen Augen auf die drei so völlig verschiedenen Männer.
Der eine war breitschultrig, untersetzt, mit einem Stiernacken, der geschaffen schien, Lasten zu tragen; sein borstiges Haar war von roter Farbe und verriet für den Kenner den Irländer. In dem breiten Mund wiesen die großen, schaufelförmigen Zähne eine rötlichbraune Färbung von dem gewohnheitsmäßigen Tabakkauen auf. Der zweite war mit besonderer Sorgfalt gekleidet, hatte ein blasses, wie blutleer aussehendes Gesicht, und schien Bureaubeamter zu sein. Der dritte hatte derbe, große Hände, ein breites Gesicht mit Bartkoteletten und einer bläulichen Nase, die offenbar einmal erfroren worden war.
Aus diesen wies der Inspektor zuerst und sagte dabei:
»Das ist der Autoführer Machnow an der Tubalbrücke. Erzählen Sie nochmals, was Ihnen in dieser Nacht zustieß.«
Mit schwerfälligen Schritten trat dieser weiter nach vorne und begann dann mit schleppender Stimme seine Geschichte, wobei er mit den Händen wiederholt erklärende Gesten machte:
»Ich war mit Kowatsch und Herst auf dem Warteplatz, als gegen halb zehn oder zehn ein bartloser Herr mit kurzem Paletot eiligst dahergelaufen kam und in meinen Wagen sprang. Ridbergstraße 12 verlangte er, und schnell sollte es geschehen; offenbar mußte er sehr große Eile haben; dabei ist doch die Ridbergstraße von meinem Standplatz keine fünf Minuten entfernt. Im Nu hielt ich dort, aber der Fremde sprang bereits im Anfahren ab und verlangte darauf, ich möchte mit ihm in die Wohnung hinaufkommen, da ich beim Herunterschaffen eines Koffers helfen müsse. Ich ging natürlich mit, aber im Wohnungsflur mußte ich dann warten, während er allein in ein Zimmer ging, aus dem er mit einem großen, gelblichbraunen Rohrplattenkoffer wieder herauskam; diesen mußte ich dann auf die Straße hinuntertragen helfen. Nun ging es wieder in raschester Fahrt nach dem Nordbahnhof. Er sagte mir ein großes Trinkgeld zu; im Bahnhofe mußte ich ihm den Koffer wieder nach der Gepäckaufbewahrungsstelle tragen helfen, wo er ihn einstellte; dann ging es wieder zurück nach der Ridbergstraße. Mit einem reichlichen Trinkgeld entließ er mich dort. Das ist alles; der Fremde verschwand dann wieder im Hause, und ich fuhr nach der Tubalbrücke zurück.«
Inspektor Wendland richtete darauf die Frage an ihn:
»War das in der Wohnung, in die ich Sie führte?«
»Ja!«
Und mit einem Blick auf Alexis Marlan bemerkte der Inspektor:
»Es war die Wohnung des Professors Marschall.«
Der Chef der Sicherheitspolizei richtete nunmehr selbst eine Frage an den Autoführer:
»Wie spät mochte es gewesen sein, als Sie wieder nach der Ridbergstraße zurückkamen?«
»Das Ganze hatte sicher keine Stunde gedauert. Ein Viertel vor elf, wenn es spät war; ich hatte ja immer mit der ersten Geschwindigkeit fahren müssen.«
»Haben Sie dem Inspektor eine genaue Beschreibung des Fremden und jenes Koffers gegeben?«
»Freilich! Der Herr Inspektor hat alles aufgeschrieben.«
»War jener Koffer sehr schwer?«
»Das war er; er konnte ihn nicht allein tragen und zerrte ihn über den Boden schleifend aus dem Zimmer.«
»In das Zimmer selbst kamen Sie nicht?«
Durch eine Bewegung der Hand gab Alexis Marlan zu verstehen, daß er nichts mehr zu fragen habe; da wandte sich der Inspektor auch schon an den zweiten Zeugen, den roten Irländer:
»Tom Callagan, was wissen Sie von diesem Koffer?«
Mit breitspurigen Schritten kam dieser gegen den Schreibtisch zu und begann dann mit schwerfälliger Stimme zu erzählen:
»Ich bin am Nordbahnhof in der Gepäckabteilung; als ich heute früh meinen Dienst antrat, durchschaute ich die Stücke, die in der Nacht eingeliefert worden waren; da kam ich dann an einen großen Rohrplattenkoffer, gelbbraun und mit Messingbeschlägen. Wie ich den zurechtrückte, fielen mir an der oberen Kante mehrere Blutspuren auf, die noch nicht alt sein konnten; ich machte meinen Kameraden darauf aufmerksam, der aber meinte, daß vielleicht ein frisches Wild im Koffer sein könne. Das schien auch leicht möglich, so daß ich mich nicht mehr weiter darum kümmerte. Gegen elf Uhr kam dann ein Fremder und holte in Begleitung eines Kofferträgers diesen Rohrplattenkoffer mit den Blutspuren ab.«
Als Tom Callagan diesen seinen Bericht beendet hatte, wandte sich Inspektor Wendland an den Chef der Sicherheitspolizei:
»Die Beschreibung, die Herr Callagan von eben diesem Fremden gab, der den Rohrplattenkoffer abholte, stimmt genau mit der überein, die der Diener des Professors Marschall von jenem Doktor Steffen gab, und die auch mit der des Fremden übereinstimmt, von dem der Wagenführer erzählte.«
Alexis Marlan, der zu dieser Darstellung keine Frage mehr hatte, bemerkte dann nur:
»And dieser dritte Zeuge?«
Jetzt trat dieser näher heran und begann sogleich, ohne erst durch eine Frage aufgefordert zu werden:
»Mein Name ist Flachar und ich bin Buchhalter in der Diskontobank; heute um neun Uhr, kurz nach, der Eröffnung der Bank wurden wir antelephoniert, und es meldete sich Professor Marschall, der uns verständigte, er habe einen Scheck auf eine Viertelmillion ausgegeben, an einen Herrn Doktor Edwin Steffen, der bis Mittag wohl vorsprechen werde; wir möchten dafür sorgen, daß diese Summe flüssig gemacht werde; aber bereits um zehn meldete sich dieser Doktor Steffen und überreichte den Scheck mit der Unterschrift des Professors Marschall. Die Unterschrift war in Ordnung; es bestand daher für uns kein Anlaß, die Zahlung zu verweigern. Dieser Doktor Steffen erhielt also die zweihundertfünfzigtausend und verließ unser Geschäftszimmer wieder. Eine Stunde später erschien dann Inspektor Wendland und teilte uns mit, was geschehen war.«
In lebhafter Weise fragte Alexis Marlan nunmehr:
»War denn bei der telephonischen Verständigung die Stimme des Professors auch erkannt worden?«
»Die kannte doch niemand. Aber da die Geheimnummer des Kontos genannt wurde, die doch nur der Inhaber zu wissen pflegt, so konnten wir doch nicht zweifeln. Außerdem war die Unterschrift des Professors ohne Zweifel echt.«
»Überraschte Sie die Höhe des Betrages nicht?«
»Es werden oft noch größere Summen gefordert. Da wir vorher noch telephonisch darauf vorbereitet wurden, so lag kein Grund zu einem Mißtrauen vor.«
Jetzt sprach Inspektor Wendland wieder dazwischen:
»Auch in diesem Falle stimmte die Beschreibung jenes Doktor Steffen genau mit der überein, die mir bereits bekannt war.«
Die drei Zeugen wurden nach ihren Erklärungen bald wieder entlassen; da sprang aber Alexis Marlan sofort wieder von seinem Stuhle auf, um abermals die durch das Verhör unterbrochenen Zimmerpromenaden wieder aufzunehmen. Dabei rief er dem Inspektor die Frage zu:
»Was haben Sie außerdem noch erfahren können?«
Inspektor Wendland spreizte die Fingerspitzen gegeneinander und berichtete dann mit langsamer Stimme, als überlegte er jedes Wort auf seine Wirkung:
»Natürlich konnte das allein für mich nicht genügen. Ich ließ in erster Linie sofort eine chemische Untersuchung der Blutspuren auf dem Teppiche in des Professors Marschall Arbeitszimmer und an den chirurgischen Instrumenten vornehmen, die offenbar in der Hast vergessen und zurückgeblieben waren, das Urteil aber bestätigte, daß es sich bei dem Blute um Menschenblut handelte. Es war also unzweifelhaft Menschenblut vergossen worden. Jedenfalls handelte es sich bei den Blutspuren an dem Rohrplattenkoffer um das gleiche.«
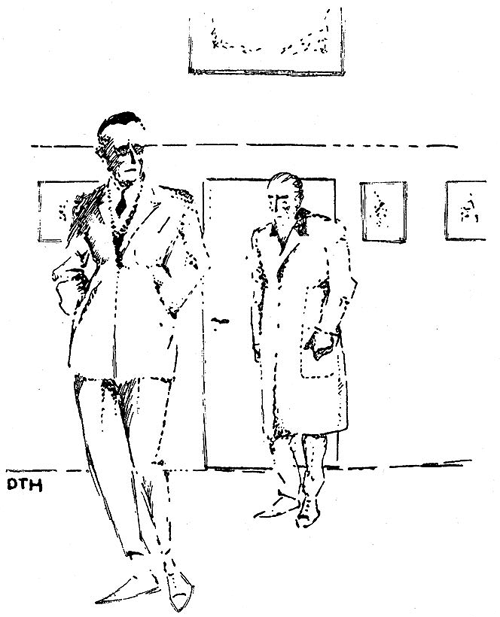
Der Chef der Sicherheitspolizei blieb nun dicht vor dem Inspektor stehen und fragte:
»Wie lautet nun Ihr Schlußurteil?«
»Das kann doch nach den Tatsachen und Beweisen nur eine Möglichkeit zulassen, daß an dem Professor Marschall ein Verbrechen begangen wurde, daß er in der Zeit von sieben bis halb zehn Uhr, während welcher nur dieser angebliche Doktor Steffen bei ihm war, von diesem ermordet wurde; um die Spuren eines Verbrechens nach Möglichkeit zu beseitigen und um den Vorfall möglichst geheimnisvoll erscheinen zu lassen, vor allem aber, um sich vor zu zeitiger Entdeckung zu schützen, brachte er die Leiche des Ermordeten in jenem vielerwähnten Koffer unter; anscheinend, wenigstens nach den blutbefleckten chirurgischen Instrumenten zu schließen, muß er bei dem Unterbringen der Leiche im Koffer diese selbst in verschiedene Teile zertrennt haben. Um dann den Koffer selbst mit dem Toten darin in Sicherheit zu bringen, gebrauchte er die List, den Diener mit einem Rezept, dessen Herstellung längere Zeit benötigte, fortzuschicken; diese Absicht ist ihm nach den Aussagen des Autofahrers und des Dieners auch vollständig gelungen. Auch die Frage, weshalb er die Tat verübte, ist nach den Erklärungen des Bankbeamten Flachar leicht zu beantworten; er erhob mittels des Scheckbuches einen Betrag von einer Viertelmillion.«
»Aber mit diesem auffallenden Koffer und dem noch seltsameren Inhalt muß er doch bald entdeckt werden.«
»Davon bin ich überzeugt; jedenfalls wird er sich des Koffers oder seines Inhaltes so bald wie möglich zu entledigen versuchen.«
»Gewiß! Aber da es sich dabei doch um einen sehr auffälligen Gegenstand handelt, wird er schließlich auf mehr Schwierigkeiten stoßen, als er annahm. Was haben Sie zunächst veranlaßt?«
»Ich ließ überallhin Depeschen mit dem Signalement dieses Doktor Steffen hinausgehen und natürlich auch mit einer Beschreibung jenes Koffers. Zudem veranlaßte ich eingehende Nachforschungen über die Persönlichkeit jenes Doktor Edwin Steffen.«
»Haben Sie in dieser Richtung schon ein Resultat erzielt?«
»Nur ein negatives! Hier in der Stadt ist ein Doktor Edwin Steffen nicht gemeldet, und in den Papieren des Professors Marschall findet sich der Name auch nie erwähnt. Die Kreise, in denen Professor Marschall verkehrte, können sich nicht entsinnen, daß dieser Name von ihm einmal erwähnt worden wäre.«
»Trotzdem muß er ihn aber gekannt und auch erwartet haben, da er sonst dem Diener nicht den Auftrag erteilt hätte, ihn unangemeldet einzulassen.«
»Allerdings! Von irgendwoher muß eine Meldung kommen.«
Und der Chef der Sicherheitspolizei wiederholte nochmals:
»Jedenfalls muß alles geschehen, was möglich ist, denn der Fall Professor Marschall, oder eigentlich der Fall Doktor Steffen, wie er nach den Ergebnissen lauten muß, wird überall Aufsehen erregen, zumal es sich bei dem seltsamen Verschwinden um eine Person handelt, die nicht nur hier in der Stadt, sondern überall bekannt ist.«
Da nickte der Inspektor und erklärte noch:
»Einmal muß der Mörder sich seiner unbequemen Last zu entledigen versuchen, und dabei wird er den Fehler begehen, den noch jeder Verbrecher machte; daß er aber die Leiche immer mit sich mitschleppen wird, das ist doch nicht möglich.«
Da hob Alexis Marlan den Kopf:
»Warum sollte auch das nicht möglich sein können? Der Täter ist, nach den chirurgischen Instrumenten zu urteilen, Arzt. Kann er als solcher die Leiche nicht so konserviert haben, daß er sie als Gepäckstück mit auf seine Flucht nimmt, bis er sich ganz in Sicherheit weiß? Der Gewinn von einer Viertelmillion ist groß genug, um ihm die Flucht überallhin offen zu lassen.«
*
Die beiden, schmalen Hände von Anita Wronker, die in den Gelenken doch wie zerbrechlich zart schienen, lenkten fest und sicher die zwei feurigen, jungen, kastanienbraunen Orlowtraber vor dem eleganten Sportwagen; unbeweglich wie eine Bronzefigur saß hinter ihr der Groom in der dunkelgrünen Livree, die beiden Arme auf der Brust gekreuzt.
Die schwarzen, lebhaften Augen Anitas übersahen nicht nur die Einzelheiten des Straßenbildes, sondern folgten auch jeder Bewegung der beiden Pferde. Dabei ließ sie sogar noch ihre Gedanken mancherlei Erinnerungen nachhängen; ihre Haltung, der entschlossene Ausdruck ihres Gesichtes, der aber doch frauenhaft zart war, ließ Folgerungen auf eine Willensstärke Energie zu.
Anita Wronker lenkte die Pferde durch den regen Verkehr der Hauptallee in die stillere Ridbergstraße ein.
Sie war auf der Fahrt nach der Wohnung des Professors Marschall, der sie erst um diese Nachmittagsstunde erwartete, wie er ihr in einem Briefe mitgeteilt hatte.
So kurz jene Nachricht auch war, Anita Wronker konnte sich auf den Wortlaut aller Sätze besinnen. Ihr war es, als klinge daraus mehr als nur die Höflichkeit, mit der man Mitteilungen zu machen pflegt.
Die beiden Orlowtraber scheuten an einem sehr nahe vorüberstreifenden Auto; der eine warf den rassigen Kopf weit zurück und schien Lust zu haben, gegen die lenkende Hand auszubrechen. Doch nur ein Augenblick war es und schon zeigten die schmalen Hände wieder die Herrschaft. Ruhig gehorchten die Pferde wieder.
Anita Wronkers Gedanken aber hatten wieder Zeit, zu jenem Brief zurückzuirren; sie hatte dabei nicht vergessen, was sie auf der Heimfahrt von dem Exzentrikklub ihrem Bruder aus der augenblicklichen Stimmung heraus zugestanden hatte; und jetzt, wenn sie wieder daran dachte, konnte sie die unwillkürlich gebrauchten Worte von damals nur wiederholen: Jener Professor Marschall erschien ihr wirklich als der Mann, zu dem sie eine tiefere Zuneigung hätte fassen können; daß seine äußere Erscheinung nicht der eines sogenannten schönen Mannes entsprach, wie vielleicht tausend andere verlangen würden, das wußte sie. Aber sie schätzte an einem Manne Energie und Wissen, vor allem den inneren Wert doch höher ein als die Äußerlichkeit einer hübschen Gestalt. Wie er ihr erzählt hatte, vor allem jenes Erlebnis, bei dem er ohne Bedenken das Leben einer Unglücklichen rettete, das Zielbewußte seines Wesens fesselte sie, und dies in einer Art, die nahe an Liebe grenzt. Da solche Empfindungen in ihr bereits lebten, hatte sie jenen Brief auch in dieser gleichen Stimmung gelesen und dabei etwas herausgefühlt, das die Hoffnung stärkte, als käme ihr ein ähnliches Gefühl entgegen.
Sie kannte den Brief in seinem ganzen Wortlaut:
»Sehr geschätztes Fräulein!
Da es nicht nur mein Interesse sein kann, daß Sie meine Sammlung besichtigen und dabei die üblichen Anerkennungsworte aussprechen, sondern da ich Ihnen alles in den Einzelheiten erklären möchte, und dazu in nicht ganz selbstloser Weise möglichst viel Zeit gewinnen will, was in der vereinbarten Stunde unmöglich ist, so erbitte ich den mir zugesagten Besuch erst in der dritten Nachmittagsstunde. Wie ich Sie kennenlernte, rechtfertigt mein egoistisches Motiv, Sie so lange wie möglich zu fesseln.
Ihr ergebenster
Professor Marschall.«
Konnte sie den Ton aus den Worten anders verstehen, als daß er aus ähnlichen Gründen ihre Nähe suchte?
And aus dieser Frage kamen dann ungewollt langsam und töricht Zukunftsgedanken.
Aber diese galt es nun abzuschütteln, denn sie war am Ziele der Fahrt, und sie mußte Professor Marschall so kühl wie möglich gegenübertreten, denn sie durfte noch nichts von dem verraten, was in ihr vorging.
Sie mußte immer stark bleiben, auch der Stimme des Herzens gegenüber, der sich alle Frauen beugen. Anita wollte auch hier nicht einen Augenblick Schwäche zeigen, trotzdem die Schwäche hierin im Liebeskampf die Stärke der Frau ist.
Mit einem Ruck brachte sie die beiden jungen Traber zum Stehen; dann warf sie dem Groom hinter ihr die Zügel zu und sprang leichtfüßig vom Wagen.
Da sie doch etwas wie ein Herzpochen verspürte, zwang sie sich, so langsam wie möglich die Treppe hinaufzugehen.
Der Diener des Professors Marschall öffnete ihr und sah sie auf ihre Frage mit erstauntem Blick an. Als sie dann die Frage nach dem Professor wiederholte, antwortete er erst:
»Aber der Herr Professor kann doch niemand mehr empfangen.«
Jetzt zeigte sich Anita Wronker überrascht:
»Nicht mehr? Warum?«
»Der Herr Professor ist doch verschwunden. Es war deshalb ja auch schon ein Herr von der Polizei da.«
»Verschwunden, sagen Sie? Wie ist denn das denkbar?«
»Er ist fort! Nicht mehr da! Nur Blut lag in seinem Zimmer, seitdem dieser Doktor Steffen bei ihm war.«
Anita Wronker fühlte bei dem Worte Blut ein unwillkürliches Erschrecken, ohne aber aus den unklaren Worten des Dieners einen Zusammenhang erfassen zu können; ungeduldig fragte sie daher weiter:
»Was für ein Blut? Welcher Doktor Steffen? Erzählen Sie doch, was geschehen ist!«
Und in der ihr eigenen Entschlossenheit trat sie an dem Diener vorbei in den Korridor der Wohnung, so daß der Diener gezwungen war, ihr nachzufolgen. Umständlich begann er dann davon zu erzählen, wie er am Morgen in das Arbeitszimmer seines Herrn gekommen war, und was er dort vorgefunden hatte. Schließlich schilderte er das Erlebnis am Abend vorher und in der Nacht, so wie er es auch dem Kriminalinspektor berichtet hatte.
Anita Wronker hörte ihm zu, ohne ihn mit irgendeiner Frage zu unterbrechen; nur die geweiteten Augen und der gespannte Ausdruck ihres Gesichtes verrieten die Erregung, unter der sie förmlich zu leiden schien. Wie sich ihre seinen Hände dabei schlossen und wieder öffneten, das ließ die seelische Anteilnahme an allem erkennen.
Als der Diener darauf das Kommen des Inspektors und dessen Erklärungen geschildert hatte, schwieg sie immer noch, als müßte sie das Ungeheuerliche erst zu begreifen versuchen.
Dann fragte sie mit mühsam beherrschter Stimme:
»Was war das letzte Urteil des Inspektors?«
Der Diener zeigte einen geheimnisvollen Ausdruck, und seine Stimme wurde auch zu einem Flüstern, als er nun die Antwort gab:
»Etwas ganz Bestimmtes sagte er ja nicht, aber so viel habe ich doch verstanden, daß der gnädige Herr von diesem Doktor Steffen ermordet worden ist und dann in dem Koffer aus dem Hause fortgeschafft wurde, während ich in die Apotheke mußte. Auch Geld muß dabei gestohlen worden sein, denn der Inspektor ging dann nach der Diskontobank, wo der gnädige Herr doch sein Geld hat, und von wo der Inspektor erst sehr spät wieder zurückkam.«
»Was war das für ein Brief, den Ihnen Ihr Herr am Abend noch zur Besorgung übergab?«
»An ein Fräulein in der Stöwerallee. Den Namen weiß ich nicht mehr genau!«
Die Lippen Anitas schlossen sich dicht zusammen.
Das konnte nur der Brief an sie selbst gewesen sein. So waren die letzten Gedanken des Professors Marschall an sie gewesen, ehe er einem verbrecherischen Anschlag zum Opfer fiel.
Am so schwerer empfand sie daher das Mitgeteilte.
Aber das allein durfte ihr noch nicht genügen. Sie mußte mehr erfahren.
Wenn wirklich ein Verbrechen, ein Mord begangen worden war, dann mußte den Täter auch die Strafe treffen. Noch erschien ihr alles zu geheimnisvoll, um sich selbst über das Geschehene ein völlig klares Bild machen zu können.
Und in dem Bedürfnis, alles zu wissen, fragte sie:
»Wissen Sie den Namen des Kriminalinspektors, der hier die Untersuchung leitete?«
»Freilich! Ich kannte ihn doch! Wendland war es!«
Und nun fragte sie nichts mehr.
Dieser Diener konnte ihr jetzt nichts mehr sagen.
Inspektor Wendland! Von diesem würde sie alles erfahren können, was noch an Rätseln und Seltsamkeiten das Verschwinden von Professor Marschall umgab.
Mit raschen, energischen Schritten stieg sie die Treppe hinunter, sprang vor dem Hause auf den Wagen und nahm die Zügel wieder in ihre schmalen, feinen Hände.
Und die beiden Orlows rissen ungeduldig an den Strängen, mußten sich aber doch der Kraft eben dieser weichen Hände fügen.
Sie wußte das Ziel.
Das Polizeipräsidium! Zu Inspektor Wendland!
*
Fred Wronker blieb dicht vor seiner Schwester stehen und erklärte mit leidenschaftlicher Stimme:
»Das geht eben nicht! Ich habe es dir schon wiederholt auseinandergesetzt und nur ein Unverstand kann dies nicht einsehen!«
»Was du Unverstand nennst, überzeugt mich nicht. Genau so hast du gesprochen, als ich mich entschloß, mit Tegetthof die Neuseelandreise zu machen, und noch heftiger hast du protestiert, als ich mir vornahm, die mir zufällig bekannt gewordene Spur des Juwelendiebes Susman zu verfolgen.«
»Wie andere noch heute darüber denken, das weißt du eben nicht.«
»Du aber solltest wissen, daß es mir völlig gleichgültig ist, was andere über mich denken. Schließlich bin ich in allem nur mir selbst Rechenschaft schuldig. Und vor mir kann ich meinen Entschluß rechtfertigen.«
Die Auseinandersetzung der beiden Geschwister fand in dem kleinen Salon der Wronkerschen Villa statt; die Fenster waren offen und ließen bereits die ersten warmen Strahlen der Frühlingssonne herein; die kahlen Bäume im Garten zeigten schon die Knospenbildungen, die an jedem Tag schon durch die Sonne zum Blühen wachgeküßt werden konnten.
Die zierlichen Möbel aus Palisander, die orange und mattgelben Tapeten, die Porzellane, Bronzen und Kristalle in den Vitrinen verrieten einen hochentwickelten, künstlerischen Geschmack und einen großen Reichtum, der sich aber nicht nur im Verschwenden, sondern in der Bevorzugung jedes künstlerischen Schaffens zeigte. Diese ließen auch die vornehm ausgewählten Originale in Aquarell und Pastell erkennen, die gerade in diesem Raum zur vorteilhaftesten Geltung kamen.
Fred Wronker stellte den Stuhl, dessen Lehne eben seine Hände umspannt hielten, etwas unsanft auf den Boden, als wollte er damit seinen Worten eine stärkere Wirkung verleihen:
»Du wirst aber trotzdem immer wieder mit diesen anderen rechnen müssen, von denen du jetzt in diesem Tone sprichst.«
»Ich werde diese anderen höchstens zwingen, mich in meiner Eigenart gelten zu lassen.«
»Eine Redensart! Du kannst doch wirklich nicht im Sinne haben, wie ein gewöhnlicher Kriminalbeamter ein Verbrechen zu verfolgen und möglicherweise in der Welt allein herumziehen. Überlasse das doch Berufeneren.«
»Haben diese Berufeneren, wie du sie nennst, schon irgend etwas erreicht?«
»Das Verbrechen, das an Professor Warschau begangen wurde, ist doch aufgeklärt.«
»Gewiß! Die Polizei fand, was jeder Stümper nach den vorliegenden Tatsachen auch hätte erraten müssen: Professor Marschall ist von einem angeblichen Doktor Steffen aus noch unaufgeklärte Art ermordet, und seine Leiche im eigenen Koffer fortgeschafft worden. Eine Tatsache, die niemand bestreiten wird. Aber wer war dieser angebliche Doktor Steffen? Wohin ist dieser verschwunden? Zwei Wochen sind nun seit der Tat verstrichen, und die Polizei weiß noch immer nichts zu melden. Ist es denkbar, daß ein Mann mit einem Koffer, den er doch nicht in einer Tasche verbergen kann, so spurlos verschwindet? Ich will beweisen, daß dies nicht gelingt, wenn mit anderen Mitteln und anderem Scharfsinn gearbeitet wird. Gerade das schematische, das größtenteils der Sicherheitspolizei anhaftet, eignet sich nicht für alle Fälle; diese Art mag gut sein, wenn es sich um Verbrecher gewöhnlicher Sorte handelt, aber nie in Ausnahmefällen. Daß dieser Doktor Steffen, der selbstverständlich einen anderen Namen führt, zu Ausnahmeverbrechern gerechnet werden muß, das wirst du doch zugeben. Ich aber will, daß dieser auch die begangene Tat sühnen muß.«
»Du, warum gerade du! Das ist nicht deine Aufgabe.«
Da warf Anita den Kopf zurück, daß er tief im Nacken lag; ihre Augen begannen in einem leidenschaftlichen Feuer zu glühen, das sich vorher schon in ihren erregten Worten verraten hatte.
»Ich könnte dir mit der Ehrlichkeit meines Wesens antworten, was ich dir schon einmal sagte, an jener Heimfahrt nach dem Abend im Exzentrikklub: Professor Warschau war der Mann ...«
Da unterbrach sie Fred mit einer unwilligen Handbewegung:
»Ich weiß, ja, ich habe es nicht vergessen. Aber wird man, wenn dein Entschluß erst bekannt wird, nicht ähnlich klingende Vermutungen aufstellen? Warum gerade Anita Wronker? So wird man fragen?«
»So mögen sie alle fragen. Gut! Ich habe mich nun einmal entschlossen, nicht früher zu ruhen, bis die Tat an Professor Marschall auch ihre Sühne gefunden hat. Und weil die Polizei viel zu machtlos ist, so will ich die Rächerin dieses Toten sein!«
Fred wiegte den Kopf ärgerlich hin und her:
»Rächerin! Allein schon dies Wort! Fühlst du dies nicht selbst, welch fataler Klang darin liegt?«
»Für Durchschnittsmenschen, ja! Ich sah, wie eben dieser Professor Marschall mit seinem Leben als Einsatz eine Arme aus dem Strom herausholte, in dem die Eisschollen trieben, und wie er sich flüchtete, als eben diese Durchschnittsmenschen, von denen keiner die Tat gewagt haben würde, neugierig geschlichen kamen. So frage auch ich nur, was ich mir selbst schuldig bin. Der Ruf einer Exzentrischen haftet schon einmal an mir, und so will ich es auch sein, aber aus gesunden Motiven.«
»Was willst du damit nur erreichen?«
»Daß ein Verbrechen die gerechte Sühne findet.«
»Bist du dafür verantwortlich, daß dies auch geschieht? Ist das die Aufgabe eines Weibes?«
»Warum nicht? Wenn eine Frau liebt, dann ja!«
»Du machst dich ja lächerlich, Anita! Willst du dies vielleicht als die Ursache deines Vorgehens erklären? Selbst wenn ich noch zugestehen wollte, daß die Liebe einer Frau das Recht gibt, selbst die Rächerin zu spielen, also bedingungsweise, dann kommt dies Recht für dich immer noch nicht in Betracht, denn der Tote liebte dich doch nicht. Du warst weder seine Braut oder gar seine Geliebte.«
Anita Wronker antwortete nichts, sondern ging langsam zur Türe hin, um den Salon zu verlassen.
Als sie schon nach der Türe griff, rief sie die Stimme des Bruders noch einmal zurück:
»Anita! Es kann doch dein Ernst nicht sein?«
Langsam wandte sich ihm ihr Gesicht zu, das die willensstarke Entschlossenheit verriet, mit der sie sich zu ihrem Vorgehen durchgerungen hatte:
»Doch, du kennst mich! Ich will, daß diese Tat auch ihre Sühne findet, ich will es, weil ich erkannte, welch ein wertvoller Mensch an Professor Marschall verloren ging, weil ich die Unfähigkeit der Stellen erkenne, die diese Aufgabe hätten, und weil ich diesen Mann von dem ersten Begegnen an liebte. Darin magst du das Hauptmotiv meines Entschlusses sehen, dessen ich mich nicht schäme. Ich kann das jetzt um so mehr erklären, da der, dem dies Gefühl meines Herzens galt, es doch nie mehr hören kann. Und die Unruhe, die in mir drängt, die mich keine Befriedigung und Stille finden läßt, wird erst zum Schweigen kommen, wenn ich die Tat gesühnt weiß. Unweiblich magst du es schließlich nennen, aber ich kann nicht über mein Ich hinaus. So bin ich! Und damit müssen sich alle abfinden, die über mich urteilen wollen.«
Hochaufgerichtet stand sie dem Bruder gegenüber, schön in diesem Stolz, der aus diesen ruhigen Zügen sprach.
Nochmals machte Fred Wronker einen letzten Versuch:
»Ich habe dich gewarnt.«
»Ja, ja! Du wirst auch nie die Verantwortung tragen müssen; ich nehme sie allein auf mich! Ich trug sie, als ich der Forschungsfahrt Tegetthoffs folgte, ich trug sie in allem, was ich tat und trage sie auch für diesen Entschluß.«
Und ohne noch einen Widerspruch abzuwarten, öffnete sie die Türe und ging hinaus.
»Ich kann Ihnen keine neuen Ergebnisse mitteilen. Was in dem Arbeitszimmer des Professors Marschall geschehen ist, das wurde wohl in allen Einzelheiten aufgeklärt, aber dann stellte sich allen weiteren Versuchen, weiterzukommen, ein undurchdringliches Dunkel entgegen. Daß dieser Doktor Steffen das Verbrechen in überlegter Ruhe ausführte, das ist erwiesen; daß er vielleicht schon in der Mordabsicht die Nähe des Professors gesucht hatte, darf angenommen werden und ganz sicher ist, daß er nur in der Absicht zu töten kam; das beweist die Geschicklichkeit, mit der er den Diener aus dem Hause brachte und von dem Zutritt in das Arbeitszimmer fernzuhalten verstand, das beweist, daß er diese chirurgischen Instrumente dazu mitgebracht haben mußte, denn zu dem Eigentum des Professors gehörten sie nicht. Wie er sich dann in den Besitz der Viertelmillion zu bringen verstand und wie er floh, beweist gleichfalls die schon bestandene Absicht zur Tat.
Alexis Marlan, der Chef der Sicherheitspolizei, saß an seinem Schreibtische und gab diese Erklärung, während seine Hand mit einem Brieföffner spielte. Seine Blicke lagen dabei mit einem bewundernden Ausdruck auf der schlanken Gestalt Anita Wronkers, die ihm gegenüber saß, und der diese Worte galten.
Durch den dünnmaschigen Schleier, der an dem braunen Velourshut, der seitlich rechts aufgeschlagen war und als Schmuck taubenblauen und braunen Reiher trug, festgesteckt war, wirkte das feingeschnittene Profil wie die einer alten griechischen Gemme. Die Bewegung des Kopfes ließ eine Ungeduld erkennen, die sich noch mehr in ihrer Antwort verriet:
»Ja, ich weiß alles, was geschehen ist. Aber wurde irgendwelche Spur dieses Doktor Steffen entdeckt?«
Alexis Marlan preßte die Hände zusammen, daß sich die Finger ineinanderschlangen, und erklärte mit einem bedauernden Hochziehen seiner Schultern:
»Was von unserer Seite aus geschehen konnte, wurde unternommen. Aber alle Versuche scheiterten. Woher diese chirurgischen Bestecke stammten, darüber ergab sich nicht der geringste Anhaltspunkt; auch die Spur jenes Doktor Steffen ging nach dem Abholen jenes verhängnisvollen Koffers auf dem Nordbahnhofe verloren, nur konnte noch festgestellt werden, daß er den Südexpreß bestieg. Dann aber enden alle Spuren. An allen Haltestationen des Expreßzuges wurden Nachforschungen angestellt, die aber nichts ergaben; niemand konnte sich entsinnen, wo ein Mann mit einem solchen Koffer ausgestiegen war.«
»Weiß man über die Person eines Doktor Edwin Steffen etwas?«
»Nein! Nur zweifellos ist erwiesen, daß es sich um einen falschen Namen handelt, denn es wurden Nachforschungen bei allen Hochschulen angestellt, aber bei keiner promovierte ein Doktor Edwin Steffen; es gingen durch die ganze Landespolizei Anfragen nach einem Doktor Steffen mit dem bekannt gegebenen Signalement, aber keine Stadt, kein Ort konnte über einen solchen irgendwelche Mitteilung machen. Wie dieser Doktor Steffen auftauchte, so spurlos verschwand er.«
»Aber der Koffer mit der Leiche?«
»Auch darüber ergab sich keine Nachricht. Es traf von nirgendsher eine Meldung ein.«
»Also ein völliges Versagen der Polizei!«
Da gab Alexis Marlan die verschlungenen Hände frei und machte damit eine bedauernde Geste:
»Es kann niemand mehr tun und erreichen als wir.«
Jetzt klang aus der Entgegnung ein leichter, aber unverkennbarer Spott:
»Sind Sie so fest davon überzeugt?«
»Gewiß! Ich weiß wohl, wie geschickt Sie damals die Spur Susmans aufnahmen, ich habe Ihnen meine Bewunderung darüber auch nie verhehlt, aber dieser Aufgabe gegenüber würden Sie auch nicht mehr erreichen können.«
Da hatte sich Anita Wronker erhoben und begann langsam die Glacés über die Finger zu streifen:
»Sind Sie so unfehlbar davon überzeugt?«
»Doch! Ich kann mich viel zu sehr auf meinen Inspektor Wendland verlassen.«
»Und wenn ich Sie von dem Gegenteil überzeugte, Herr Marlan?«
Da war auch der Chef der Sicherheitspolizei aufgestanden und trat auf sie zu:
»Das wird schwerlich gelingen, gnädiges Fräulein. Es wäre dies ja eine direkte Herausforderung an mich und meinen Inspektor Wendland. Sie würden sich mit einer solchen Zumutung nur der Gefahr einer Niederlage aussetzen. Das aber werden Sie doch nicht wollen.«
Mit einem Hochheben des Kopfes entgegnete sie darauf: »Vergessen Sie nicht, das ich Mitglied des Exzentrikklubs bin.«
Und mit einem Lächeln sagte der Chef der Sicherheitspolizei:
»Das allein genügt kaum.«
»Gut denn! Auf Wiedersehen, Herr Marlan!«
»Beim Sportfest in Kossäthen. Sie werden doch sicher dort sein.«
»Versprechen kann ich das noch nicht. Es kann sein, daß ich verreisen werde.«
»Oh, das würde niemand mehr bedauern als ich. Wohin soll die Reise gehen?«
»Auch das ist noch unbestimmt.«
»Trotzdem sage ich: Auf Wiedersehen!«
And mit diesem Gruß begleitete sie Alexis Marlan aus seinem Amtszimmer.