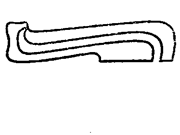|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

 Es war einmal ein frommer Einsiedler, den die Leute Bruder Klaus hießen. Im Schatten alter Eichen auf einer Waldwiese stand seine alte Zelle, und drei Kameraden teilten mit ihm den engen Raum, ein Fuchs, ein Waldkater und ein Hase. Er hatte die Tiere von ihrer frühesten Jugend an aufgezogen, und da war es ihm nicht schwer geworden, sie so aneinander zu gewöhnen, daß sie wie Geschwister aus einer Schüssel aßen und auf einem Lager schliefen. Bruder Klaus lebte gerade nicht schlecht. Die umwohnenden Bauern versorgten ihn reichlich mit Speise und Trank, und daher litten auch die drei Tiere keinen Mangel.
Es war einmal ein frommer Einsiedler, den die Leute Bruder Klaus hießen. Im Schatten alter Eichen auf einer Waldwiese stand seine alte Zelle, und drei Kameraden teilten mit ihm den engen Raum, ein Fuchs, ein Waldkater und ein Hase. Er hatte die Tiere von ihrer frühesten Jugend an aufgezogen, und da war es ihm nicht schwer geworden, sie so aneinander zu gewöhnen, daß sie wie Geschwister aus einer Schüssel aßen und auf einem Lager schliefen. Bruder Klaus lebte gerade nicht schlecht. Die umwohnenden Bauern versorgten ihn reichlich mit Speise und Trank, und daher litten auch die drei Tiere keinen Mangel.
Aber es kamen schlimme Zeiten. Mißwachs und Hagelschlag hatten die Erntehoffnung zunichte gemacht, und die Liebesgaben der Landleute flossen spärlich. Am Ende, als der bleiche Hunger durch die Dorfgassen schlich, blieben die Spenden ganz aus, und der arme Einsiedler sah sich auf die Früchte des Waldes angewiesen. Aber die Holzäpfel und die Schlehen wollten ihm garnicht behagen, und er magerte sichtlich ab.
Die Not ihres Herrn ging den drei Tieren sehr zu Herzen, zumal da sie selber unter dem Mangel schwer zu leiden hatten. Am besten noch befand sich der Hase, denn in der Umgebung der Einsiedelei wuchs Gras und Klee in Menge, aber Kater und Fuchs vermißten schmerzlich die fetten Bissen, die ihnen Bruder Klaus vordem gereicht hatte, und sie begannen den Hasen mit scheelen Augen anzusehen.
Eines Tages, als der letztere im Bergklee seine Mahlzeit hielt, traten Fuchs und Kater selbander vor den Einsiedler, und der Fuchs hob also an zu sprechen:
»Lieber Vater! So kann es nicht länger fortgehen. Allzu lange schon entbehrst du kräftiger Nahrung, und die Kutte schlottert bedenklich um deinen abgezehrten Leib. Wie wäre es, wenn wir den Langohr schlachteten und brieten. Ein saftiger Hasenrücken würde dir gut tun, und überdies ist es ja der Hasen Bestimmung, in der Pfanne zu schmoren.«
So sprach der Fuchs. Aber Bruder Klaus runzelte die Stirn und sprach zürnend:
»Mitnichten, du Arger. Der Hase hat, wie ihr beide auch, Salz und Brot mit mir gegessen. Ferne sei es von mir, das heilige Gastrecht in schnöder Weise zu verletzen. Hebet euch weg!«
Jetzt ergriff der Waldkater das Wort und sprach schmeichelnd: »Deine Rede, mein Vater, klingt lieblich wie Harfensaiten und Schalmeien. – Wie aber, wenn der Hase selbst sich erböte den Opfertod für dich zu leiden?«
»Dann freilich,« – – – sprach Bruder Klaus und zog die Schultern in die Höhe. »Aber das wird der Hase wohl bleiben lassen.« Mit diesen Worten entließ er die Tiere.
Am anderen Morgen, als der Einsiedler seine Wassersuppe genossen und das Glöcklein geläutet hatte, und ausruhend auf der Steinbank vor der Tür saß, kamen Fuchs, Kater und Hase heran, stellten sich vor der Bank auf und verneigten sich. Dann nahm der Fuchs das Wort:
»Bruder Klaus, du bist uns allezeit ein gütiger Herr gewesen und hast jeden Bissen mit uns geteilt. Darum erachten wir es für unsere Pflicht, dir jetzt, da du Not leidest, nach Kräften beizustehen und dein teures Leben zu fristen. Es ist notwendig, daß du Fleischnahrung zu dir nehmest. Vergönne mir, mein Vater, daß ich für dich in den Tod gehe. Hier stehe ich. Tu mit mir nach deinem Gefallen.
Da sprach der Waldkater: »Freund, du sprichst wie ein Tor. Weißt du nicht, daß Fuchsfleisch eine höchst ungesunde Speise ist? Willst du unseren Wohltäter vor der Zeit unter den Rasen bringen?«
Der Fuchs seufzte tief auf. Bruder Klaus aber sprach gerührt: »Lebe, du treues Tier, und freue dich deines Lebens.«
Darnach erhob der Kater seine Stimme: »Wenn schon einer von uns sein Leben lassen soll, so will ich der eine sein. Herr, nimm mein Opfer an, ich bitte dich.«
»So,« sprach der Fuchs. »Glaubst du etwas Besseres zu sein als ich, du ein fleischfressendes Krallentier? Nein, Herr, das Fleisch dieses Maushundes, dem die Knochen allenthalben hervorstehen wie die Dornen am Schlehbusch, darfst du nimmermehr genießen.«
»Geh hin, mein Freund,« sprach Bruder Klaus zu dem Kater. »Der Wille, nicht die Gabe macht den Geber Ich danke dir. Dein Opfer nehme ich nicht an.«
Jetzt, meinte der Hase, dürfe er, ohne sich den Vorwurf des Undankes zuzuziehen, hinter seinen Gesellen nicht zurückbleiben, zumal da er nicht zu befürchten habe, beim Wort genommen zu werden. Er verneigte sich also vor dem Einsiedler und sprach:
»Wenn ich auch zuletzt komme, so ist doch mein Eifer, dir zu dienen nicht geringer, als der meiner Kameraden. Nimm mich hin, ehrwürdiger Vater; ich sterbe gern für dich«
Da fuhr Bruder Klaus mit dem Ärmel seines Gewandes über die feuchten Augen, beugte sich zu dem Hasen nieder und ergriff ihn bei den Ohren.
»Dir werde dein Wille, du treues Tier,« sprach er und trug den Hasen in die Klause. Nach einiger Zeit kam er zurück und hängte den blutigen Hasenbalg auf einen Pfahl seines Zaunes zum Trocknen auf. In seinen Augen aber leuchteten Zähren der Rührung.
Am Abend gab es in der Klause Hasenpfeffer und am nächsten Mittag Hasenbraten mit Kraut, und unter dem Tisch saßen Fuchs und Kater und labten sich an den Knöchelchen, welche der Einsiedler den getreuen Tieren zuwarf.
R. Baumbach.


![]() In Dresden gingen die Blattern um, und wir drei Geschwister erkrankten gleichzeitig daran. Das war nun keine sonderliche Freude, doch hatten gerade wir Patienten die wenigste Unbequemlichkeit davon. Es ging uns in der Tat nichts ab; unsere kleinen Betten, gegen das Herausfallen mit Geländern versehen, standen gesellig nebeneinander in einem freundlichen, mit unterhaltenden Bildern versehenen Zimmer. Die pflegende Mutter war immer bei uns, der Vater ab und zu, und während das Schwesterchen mit seinen eigenen Händen spielte oder an der von Weimar mitgebrachten Kinderklapper kaute, besahen wir anderen die vom Vater mit großer Freigebigkeit gespendeten Kupferwerke, schnitten Papierfiguren aus und kneteten allerlei Blumen und Gestalten aus buntem Wachs, mit denen wir die Ränder unserer Bettstellen beklebten. Unter solchen Umständen läßt sich's schon krank sein.
In Dresden gingen die Blattern um, und wir drei Geschwister erkrankten gleichzeitig daran. Das war nun keine sonderliche Freude, doch hatten gerade wir Patienten die wenigste Unbequemlichkeit davon. Es ging uns in der Tat nichts ab; unsere kleinen Betten, gegen das Herausfallen mit Geländern versehen, standen gesellig nebeneinander in einem freundlichen, mit unterhaltenden Bildern versehenen Zimmer. Die pflegende Mutter war immer bei uns, der Vater ab und zu, und während das Schwesterchen mit seinen eigenen Händen spielte oder an der von Weimar mitgebrachten Kinderklapper kaute, besahen wir anderen die vom Vater mit großer Freigebigkeit gespendeten Kupferwerke, schnitten Papierfiguren aus und kneteten allerlei Blumen und Gestalten aus buntem Wachs, mit denen wir die Ränder unserer Bettstellen beklebten. Unter solchen Umständen läßt sich's schon krank sein.
Die angenehmsten Erinnerungen aus jener Kindheitsperiode knüpfen sich an die Abendstunden, wenn die Rouleaus herabgelassen, die Lichte angezündet waren und die Schwester schlief. Dann fand die Mutter Ruhe, sich mit ihrem Strickstrumpf zwischen uns zu setzen, und wir plauderten von allem, was uns einfiel. Am liebsten war es uns, wenn die Mutter was erzählte, namentlich von ihrer fernen Heimat, die wir auch als die unsrige betrachteten, von jenem abgelegenen estländischen Küstenlande mit seinen dunklen Wäldern und schimmernden Wiesen, mit seinen frischen Quellen und ewigen Morästen, durchirrt von Elentieren, Bären und Wölfen.
Besonders von den Wölfen wußte meine Mutter sehr eindrucksvoll zu berichten. Ob sie auch Kinder fräßen, fragten wir, und es erfolgte nachstehende wahre Geschichte.
Es war einmal ein kleiner Junge, der war vier Jahre alt und hieß Indrik. Seine Eltern waren Bauersleute und wohnten in einem abgelegenen Walddorf. Der Indrik war aber nicht so angezogen, wie sonst reiche Bauerjungen; er hatte nichts am Leibe, als ein kurzes Hemd von grober Leinwand.
Nun traf sich's, daß die Mutter Piroggen gebacken hatte. Das sind kleine runde oder viereckige Kuchen von Brotteig, gefüllt mit Speck oder Sauerkraut, wie sie die Leute dortzulande lieben. Von diesen Piroggen band die Mutter welche in ein Tuch, gab es dem kleinen Indrik in die Hand und sagte: »Geh, bring sie dem Vater auf das Feld; aber beeile dich, daß er sie warm kriegt.«
Der Kleine faßte den Knoten des Tuches fest und sprang wohlgemut in seinem Hemdchen davon. Er mußte aber durch einen großen Wald laufen, wo viele Erdbeeren wuchsen; doch weil ihm die Mutter gesagt hatte, daß er sich beeilen sollte, so rührte er keine an und kam bald zu seinem Vater. Der ruhte im Schatten am Rande des Waldes, an den sein Feld stieß. Er ruhte von seiner Arbeit und wollte eben sein Vesperbrot, die mitgebrachte saure Milch verzehren, als Indrik bei ihm anlangte. Da freute sich der Vater über den Kleinen und über die Piroggen, ließ ihn neben sich niedersetzen und gab ihm auch davon.
»Das war eine hübsche Geschichte,« sagte mein Bruder und wollte auch »Perücken« essen. Aber die Mutter bedeutete ihn, die Geschichte sei ja noch nicht zu Ende und erzählte weiter:
Als nun die Feldarbeit wieder anging, machte sich Indrik auf den Rückweg, und da er keine Eile hatte, pflückte er von den schönen roten Erdbeeren, die am Wege standen. Die schmeckten ihm so süß und immer süßer, je mehr er davon aß, daß er endlich an nichts anderes dachte, als an die Erdbeeren, und, je nachdem, wo sie wuchsen, immer tiefer in den Wald lief. Da er nun satt war, pflückte er auch noch ein Sträußchen für die Mutter und wollte dann auf den Weg zurückgehen. Aber er hatte die Richtung verfehlt und geriet in dichtes Gestrüppe, aus dem er sich nicht wieder herausfinden konnte. Da wurde er ängstlich und irrte mit seinem Erdbeerensträußchen kreuz und quer stundenlang umher, bis seine kleinen, nackten Füßchen von Dornen zerrissen waren, und er selbst so müde war, daß er nicht weiter gehen konnte. So setzte er sich denn weinend unter eine alte Eiche, und traurig und erschöpft, wie er war, sangen ihn die Drosseln bald in Schlaf.
Er hatte sich nur etwas ausruhen und dann weiter gehen wollen; aber er schlief so fest und lange, dass der Nachtwind bereits die Wipfel der Birken wiegte, als er endlich erwachte. Da fing der arme Junge bitterlich an zu weinen und rief laut nach seiner Mutter, die ihn freilich nicht hören konnte. Aber ein Paar schärfere Ohren hörten ihn.
Es war ein Morast in der Nähe, in dessen Mitte eine alte Wölfin auf dem Lager lag. Die hörte den Hilferuf des kleinen Indrik, streifte ihre Jungen von sich ab, erhob sich und zog leichten Schrittes über den bruchigen Boden hin. Plötzlich fühlte der jammernde Knabe sich von einer kräftigen Tatze zu Boden gestreckt und war fast des Todes, als er die glühenden Augen des Raubtieres dicht an den seinigen erblickte. Die Wölfin beschnupperte den Knaben, der in seiner Angst still wie ein Toter dalag. Dann faßte sie ihn mit ihren scharfen Zähnen bei seinem Hemdchen und trat den Rückzug mit ihm an.
Eilig ging's nun fort über Stock und Block, durch dick und dünn. Halb trug die Wölfin den geraubten Knaben, halb trieb sie ihn durch Peitschen mit dem dicken Schwanze zum Laufen an. Endlich legte sie ihn zwischen drei kleine Wölfe mit breiten Köpfen und kurzen Schwänzen auf ihr Lager nieder und leckte seine Füße, während die Kleinen mit ausgelassener Freude kreuz und quer über ihn krochen. Wahrscheinlich wollten sie noch etwas mit ihm spielen, ehe er gefressen würde; aber Indrik hatte dazu wenig Lust; kaum wußte er, was mit ihm vorging.
Da knackte es in den dürren Ästen, die auf dem Morast zerstreut umherlagen. Die Wölfin spitzte die Ohren, fuhr auf und schoß einem großen schwarzen Hund entgegen. Unter Geheul und Bellen entspann sich nun ein fürchterlicher Kampf: Hund und Wolf hatten sich gegenseitig gepackt, rissen sich nieder und wälzten sich blutend im Moraste, daß das Gewässer hoch aufspritzte. Unterdessen wurden Männerstimmen laut, und Bauern eilten mit Äxten herbei.
Indriks Vater war, geängstigt durch das Verschwinden seines Kindes, mit Nachbarn und Hunden ausgezogen und hatte schon seit Stunden den Wald durchsucht. Jetzt eilte er allen übrigen voran und schlug den Wolf tot.
»Der muß hier sein Nest haben,« sagten die Männer und begaben sich aufs Suchen. Da fand man das nackte Kind mit seinem Erdbeersträußchen in der Hand wie tot unter den kleinen Wölfen, die ihre dicken Köpfe ängstlich zusammengeschoben hatten. Der Vater riß sein Söhnchen an sich, schloß es an sein Herz und fing laut an zu jammern; denn er dachte, daß es tot wäre. Aber Indrik schlug bald die Augen auf, umklammerte mit seinen Ärmchen den Hals des Vaters, und sagte weiter nichts: »Ein großer Hund hat Indrik gebissen!« Die jungen Wölfe verkaufte man dem Gutsherrn, der seine Freude daran hatte und sie als Kettenhunde groß zog.
Bei der zweiten Hälfte der Erzählung war auch mein Vater eingetreten und hatte sich, die Hände auf dem Rücken, an dem Kachelofen gelehnt. Jetzt sagte er, er könne vor dem Indrik keinen rechten Respekt haben: »Ein Junge, und ganze vier Jahre alt, sollte sich was schämen! Wäre er keck aufgesprungen und hätte den Wolf mit einem fürchterlichen Blicke angesehen, so würde der sich bald aus dem Staube gemacht haben.«
Die Mutter bezweifelte, daß der Wolf sich daran gekehrt haben würde; aber der Vater blieb bei seiner Meinung: »Der kleinste Mensch kann Wunder tun, wenn er nur den Mut dazu hat. Hätte der Wolf ihn trotzdem gefressen, so wäre er wenigstens mit Ehren umgekommen.«
W. von Kügelgen.
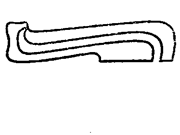

![]() In der Kirche des Alpendorfes Ratten steht links am Hochaltare eine fast lebensgroße Statue. Der Reiter auf dem Pferde ist ein stolzer Kriegsmann mit Helm und Busch und einem kohlschwarzen Schnurrbart. Er hat das breite funkelnde Schwert gezogen und schneidet mit demselben seinen Mantel entzwei. Zu Füßen des sich bäumenden Rosses kauert ein Bettler in Lumpen.
In der Kirche des Alpendorfes Ratten steht links am Hochaltare eine fast lebensgroße Statue. Der Reiter auf dem Pferde ist ein stolzer Kriegsmann mit Helm und Busch und einem kohlschwarzen Schnurrbart. Er hat das breite funkelnde Schwert gezogen und schneidet mit demselben seinen Mantel entzwei. Zu Füßen des sich bäumenden Rosses kauert ein Bettler in Lumpen.
Als ich noch ein kleiner Knirps war, führte mich meine Mutter gern in diese Kirche. In der Nähe der Kirche steht eine Marienkapelle, in welcher meine Mutter gern betete. Als oft kein Mensch mehr in der Kapelle war, und vom Turme schon die Mittagsglocke in den heißen Sommersonntag hinausklang, kniete die Mutter immer noch in einem der Stühle und betete.
Ich hielt mich lieber in der großen Kirche auf und sah den schönen Reiter an.
Einmal, als wir auf dem Wege nach Hause waren, und mich die Mutter an der Hand führte, und ich immer drei Schritte machen mußte, so oft sie einen tat, warf ich meinen Kopf auf zu ihrem guten Angesichte und fragte: »Weshalb steht denn der Reiter immer auf der Wand oben und reitet nicht zum Fenster auf die Gasse hinaus?«
Da antwortete die Mutter: »Wie du so kindisch fragen kannst! Das ist ja nur ein Bildnis, das Bildnis des heiligen Martin, der ein Soldat und ein sehr wohltätiger frommer Mann gewesen und jetzt im Himmel ist.«
»Und ist das Roß auch im Himmel?« fragte ich.
»Sobald wir zu einem rechten Platz kommen, wo wir rasten können, so will ich dir vom heiligen Martin was erzählen,« sagte die Mutter und leitete mich weiter, und ich hüpfte neben ihr her. Da wartete ich schon mit Ungeduld auf das Rasten, und in einemfort rief ich: »Mutter, da ist der rechte Platz!«
Erst als wir in den schattigen Wald hinein kamen, wo ein platter, moosiger Stein lag, fand sie es gut genug, da setzten wir uns nieder. Die Mutter band das Kopftuch fester und war still, als habe sie vergessen, was sie versprochen. Ich starrte ihr fort und fort auf den Mund, dann guckte ich wieder zwischen den Bäumen hin, und mir war ein paarmal, als hätte ich durch das Gehölz den schönen Reitersmann reiten gesehen.
»Ja, vielleicht wohl, mein Bübel,« begann meine Mutter plötzlich, »allzeit soll man den Armen Hilfe reichen um Gotteswillen. Aber so, wie der Martin gewesen, traben heutzutage nicht viele Herrenleute auf hohem Rosse umher. – Daß im Spätherbste der eiskalte Wind über unsere Schafheide streicht, das weißt du wohl, hast dir ja selbst im vorigen Jahre fast die Tatzelein erfroren.
Siehst du, gerade eine solche Heide ist's auch gewesen, über die der Reitersmann Martinus einmal an einem späten Herbstabend geritten. Steinhart ist der Boden gefroren, und das klingt ordentlich, so oft das Roß seinen Huf auf die Erde setzt. Die Schneeflöcklein tänzeln umher, kein einziges vergeht. Schon will die Nacht anbrechen, und das Roß trabt über die Heide, und der Reitersmann zieht seinen weiten Mantel eng zusammen.
Bübel, und wie er so hinreitet, da sieht er auf einmal ein Bettelmännlein an einem Stein kauern; das hat nur ein zerrissenes Jöpplein an und hebt sein betrübtes Auge zum hohen Roß auf. Hu, und wie das der Reiter sieht, hält er sein Tier an und ruft zum Bettler nieder: Ja, du lieber armer Mann, was soll ich dir reichen? Gold und Silber habe ich nicht, und mein Schwert kannst du nicht brauchen. Wie soll ich dir helfen?
Da senkt der Bettelmann sein weißes Haupt nieder gegen die halbentblößte Brust und tut einen Seufzer. Der Reiter aber zieht sein Schwert, zieht seinen Mantel von den Schulter und schneidet ihn mitten entzwei. Den einen Teil des Kleidungsstückes läßt er zu dem armen zitternden Greise hinabfallen: Habe vorlieb damit, mein notleidender Bruder! – Den anderen Teil des Mantels schlingt er so gut es geht, um seinen eigenen Leib und reitet davon.«
So hatte meine Mutter erzählt und dabei mit ihrem eiskalten Herbstabend den schönen Hochsommertag so frostig gemacht, daß ich mich fast schaudernd an sie schmiegte.
»Es ist aber noch nicht ganz aus, mein Kind,« fuhr die Mutter fort, »wenn du es nun auch weißt, was der Reiter mit dem Bettler in der Kirche bedeutet, so weißt du's noch nicht, was weiter geschehen ist.
Wie der Reitersmann nachher in der Nacht daheim auf seinem harten Polster schläft, kommt derselbe Bettler von der Heide zu seinem Bett, zeigt ihm lächelnd den Mantelteil, zeigt ihm die Nägelwunden an den Händen und zeigt ihm sein Angesicht, das nicht mehr alt und kummervoll ist, sondern wie die Sonne strahlt. Der Bettelmann auf der Heide ist der liebe Herrgott selber gewesen. – So, Bübel, und jetzt werden wir wieder gehen.«
Da erhoben wir uns und stiegen den Bergwald hinan.
Bis wir heimkamen, waren uns zwei Bettelleute begegnet; ich guckte jedem sehr genau in das Gesicht; ich habe gemeint, es dürfte doch der liebe Herrgott dahinter stecken.
Gegen Abend desselben Tages, als ich mein Sonntagskleidchen des sparsamen Vaters wegen schon hatte ablegen müssen und nun wieder in dem vielfarbigen Werkstagshöslein herumlief und hüpfte und nur noch das völlig neue graue Jöppl trug, das ich nicht ablegen wollte und mir noch für den Tagesrest erbeten hatte. Und als die Mutter auch schon lange wieder bei ihrer häuslichen Arbeit war, eilte ich gegen die Schafherde hinauf. Ich mußte die Schäflein, worunter auch ein weißes Lämmchen als mein Eigentum war, in den Stall führen.
Wie ich aber so hinhüpfte und Steinchen schleudere und damit die goldenen Abendwolken treffen will, sehe ich plötzlich, daß dort am Fels ein alter weißköpfiger, sehr arm gekleideter Mann kauert. Da stehe ich erschrocken still, getraue mir keinen Schritt mehr zu tun und denke bei mir: Jetzt, das ist aber doch ganz gewiß der liebe Herrgott.
Ich habe vor Furcht und Freude gezittert, ich habe mir garnicht zu helfen gewußt.
Wenn es doch der liebe Herrgott ist, ja, da muß ich ihm wohl was geben. Wenn ich jetzt heimlaufe, daß die Mutter komme und nachsehe und mir sage, wie ich dran bin, so geht er mir zuletzt gar unterdessen davon, und es wäre doch eine Schande und ein Spott. Ich denke, sein wird er's gewiß, just so hat derselbe ja auch ausgeschaut, den der Reitersmann gesehen.
Ich schlich einige Schritte rückwärts und begann an meinem grauen Jöppl zu zerren. Es ging nicht leicht, es saß so fest über dem grobleinenen Hemde, und ich wollte das Schnaufen verhalten. Ich meinte, der Bettelmann sollte mich früher nicht bemerken.
Ein gelbangestrichenes Taschenmesser hatte ich, nagelneu und just scharf geschliffen. Das zog ich aus der Tasche, das Röcklein nahm ich unter's Knie und begann es nun mitten auseinander zu trennen.
Ich war bald fertig, schlich zum Bettelmann, der halb zu schlummern schien, und legte ihm seinen Teil von meinem Rock zu Häupten. – Habe vorlieb damit, mein notleidender Bruder! Das habe ich ihm still in Gedanken gesagt. Dann nahm ich meinen Teil vom Rocke unter den Arm, lugte noch eine Weile dem lieben Gott zu und jagte dann die Schäflein von der Heide.
In der Nacht wird er wohl kommen, dachte ich, und da werden ihn Vater und Mutter sehen, und wir können ihm, wenn er bei uns bleiben will, gleich das hintere Stüblein und den Hausaltar herrichten.
Ich lag im Bettlein neben Vater und Mutter und konnte nicht schlafen. Die Nacht verging, und der, den ich gemeint hatte, kam nicht.
Am frühen Morgen aber, als der Haushahn die Knechte und Mägde aus ihren Nestern hervorgekräht hatte, und als draußen im Hofe schon der laute Werktag anhub, kam ein alter Mann, sie hießen ihn den Schwamm-Veitel, zu meinem Vater und brachte ihm den verschenkten Teil von meinem Rocke.
Er erzählte, ich hätte denselben abends zuvor in meinem Mutwillen zerschnitten und ihm das eine Stück an den Kopf geworfen, als er so ein wenig vom Schwammsuchen auf der Schafheide ausgeruht habe.
Darauf kam der Vater, eine Hand hinter dem Rücken, ganz leicht an mein Bett geschlichen: »Sage mir, Bube, wo hast du dein neues Sonntagsjöppl?«
Das leise Schleichen mit der Hand hinter dem Rücken war mir sogleich verdächtig vorgekommen, und jetzt ging mir schon das Gesicht auseinander, und weinend rief ich: »Ja, Vater, ich habe gemeint, dem lieben Herrgott hätte ich es gegeben.«
»Bube, du bist aber so ein Trottel, so ein Halbnarr!« schrie mein Vater, »für die Welt bist du viel zu töricht, zum Sterben bist du gar zu dumm. Dir muß man mit einem rechten Besen die Seele aus der Haut schlagen!«
Wie nun die Hand mit der gewundenen Birkenrute zum Vorschein kam, erhob ich ein Zetergeschrei.
Die Mutter eilte sogleich herbei. Sie tat sonst selten Einsprache, wenn der Vater mit mir Gericht hielt, heute aber faßte sie ihm die Hand und sagte: »Das Röckel flicke ich ihm vielleicht wieder zusammen, Alter. Geh jetzt mit, ich muß dir was sagen.«
Sie gingen beide in die Küche hinaus; ich denke, dort haben sie über die Martinigeschichte gesprochen. Sie kamen nach einer Weile wieder in die Stube.
Der Vater sagte mit fast dumpfer Stimme: »Sei nur still, es geschieht dir nichts.«
Und die Mutter flüsterte mir zu: »Ist schon recht, wenn du das Röcklein dem lieben Herrgott hast geben wollen, aber besser ist's noch, wir geben es dem armen Talmichelbuben. In jedem Armen steckt der liebe Gott. Schau, der heilige Martinus hat's auch schon gewußt. So, und jetzt, mein Bübel, steh auf und schlüpf ins Höslein; der Vater ist noch nicht allzuweit mit der birkenen Liesel.«
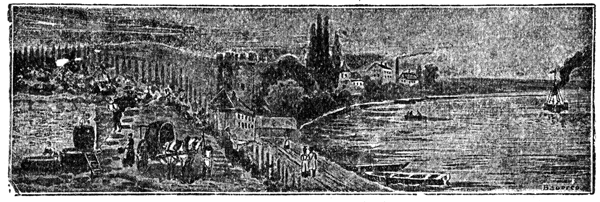
 Ein reicher und vornehmer Ritter lebte in Saus und Braus und war stolz und hart gegen die Armen. Deshalb ließ ihn Gott zur Strafe auf der einen Seite verrosten. Der linke Arm verrostete und das linke Bein, ebenso der Leib bis zur Mitte. Nur das Gesicht blieb frei. Da zog der Ritter an die linke Hand einen Handschuh, und legte ihn Tag und Nacht nicht ab, damit niemand sähe, wie sehr er verrostet sei. Darauf ging er in sich und versuchte einen neuen Lebenswandel anzufangen.
Ein reicher und vornehmer Ritter lebte in Saus und Braus und war stolz und hart gegen die Armen. Deshalb ließ ihn Gott zur Strafe auf der einen Seite verrosten. Der linke Arm verrostete und das linke Bein, ebenso der Leib bis zur Mitte. Nur das Gesicht blieb frei. Da zog der Ritter an die linke Hand einen Handschuh, und legte ihn Tag und Nacht nicht ab, damit niemand sähe, wie sehr er verrostet sei. Darauf ging er in sich und versuchte einen neuen Lebenswandel anzufangen.
Er entließ seine alten Freunde und Zechgenossen und nahm sich eine schöne und fromme Frau. Dieselbe hatte wohl manches Schlimme von dem Ritter gehört, aber weil sein Gesicht gut geblieben war, glaubte sie es gar nicht.
Nach der Hochzeit aber merkte sie es, warum er niemals den Handschuh von der linken Hand abzog und erschrak heftig. Sie ließ sich jedoch nichts merken, sondern sagte am andern Morgen nur zu ihrem Manne, sie wolle in den Wald gehen, um in einer kleinen Kapelle, die dort stand, zu beten.
Neben der Kapelle aber befand sich eine Klause, in der lebte ein alter Eremit, der hatte früher lange in Jerusalem gelebt und war so heilig, daß die Leute von weit und breit zu ihm wallfahrteten. Den gedachte sie um Rat zu fragen.
Als sie nun dem Eremiten alles erzählt hatte, ging er in die Kapelle, betete dort lange, und als er wieder herauskam, dann sagte er: »Du kannst deinen Mann noch erlösen, aber es ist schwer! Fängst du es an und bringst es nicht zu Ende, so mußt du selbst auch verrosten.
Viel Unrecht hat dein Mann sein Lebtag getan, und stolz und hart gegen die Armen ist er gewesen: willst du für ihn betteln gehen, barfuß und in Lumpen wie das allerärmste Bettlerweib, so lange bis du hundert Goldgulden der Goldgulden = 2 Mark 2½ Pfennige, etwa 1 Rubel. erbettelt hast, so ist dein Mann erlöst. Dann nimm ihn an der Hand, gehe mit ihm in die Kirche und lege die hundert Goldgulden in das Kirchbecken für die Armen. Wenn du das tust, so wird Gott deinem Manne seine Sünden vergeben, der Rost wird abgehn, und er wird wieder so weiß werden wie zuvor.«
»Das will ich tun,« sagte die junge Rittersfrau, »und wenn es mir noch so schwer wird, und es noch so lange dauert. Ich will meinen Mann erlösen, denn er ist nur auswendig verrostet, das glaube ich ganz sicher!«
Darauf ging sie fort, tief in den Wald hinein, und nicht lange, so begegnete ihr ein altes Mütterchen, welches Reisig suchte. Es hatte einen zerlumpten, schmutzigen Rock an und darüber einen Mantel, der war aus vielen Flicken zusammengesetzt; was aber die Flicken früher für eine Farbe gehabt, das konnte man kaum mehr sehen, denn Regen und Sonnenschein hatten schon viel Arbeit mit dem Mantel gehabt.
»Willst du mir deinen Rock und deinen Mantel geben, alte Mutter,« sagte die Ritterfrau, »so schenk' ich dir alles Geld, was ich in der Tasche habe und meine seidenen Kleider noch dazu; denn ich möchte gern arm sein.«
Da sah die alte Frau sie verwundert an und sprach: »Will's schon tun, mein blankes Töchterchen, wenn's dein Ernst ist. Hab' schon viel gesehen auf der Welt, auch viel Leute gefunden, die gern reich werden wollten, daß aber jemand gern arm werden will, das ist mir noch nicht vorgekommen. Wird dir schlecht schmecken mit deinen seidenen Händchen und deinem süßen Frätzchen!«
Aber die Ritterfrau hatte schon begonnen sich auszuziehen und sah dabei so ernst und so traurig aus, daß die Alte wohl merkte, daß sie keinen Scherz treibe. Sie reichte ihr also Rock und Mantel hin, half ihr sie anlegen und fragte dann:
»Was willst du nun tun, mein blankes Töchterchen?«
»Betteln, Mutter!« antwortete die Ritterfrau.
»Betteln? Nun, gräme dich nicht darum, das ist keine Schande. An der Himmelstür wird's auch mancher tun müssen, der's hier unten nicht gelernt hat.
Aber das Bettellied will ich dich erst noch lehren:
»Betteln und lungern,
Dursten und hungern
Immerdar, alle Zeit
Müssen wir Bettelleut'!
»Habt ihr was, schenkt mir was,
Ach nur ein Häppchen!
Brot in den Bettelsack,
Suppe ins Näpfchen! –
Lederne Ranzen,
Röcke mit Franzen
Tragen wir Bettelleut'!
– Was man erbettelt hat,
Wird verjuchheit!
»Nicht wahr, ein hübsches Lied?« sagte die Alte. Damit warf sie sich die seidenen Kleider um, sprang in den Busch und war bald verschwunden.
Die Ritterfrau aber wanderte durch den Wald, und nach einiger Zeit begegnete ihr ein Bauer, der war ausgegangen eine Magd zu suchen, denn es war um die Ernte und Leutenot. Da blieb die Ritterfrau stehen, hielt die Hand hin und sagte: »Habt ihr was, schenkt mir was, auch nur ein Häppchen!« Aber die anderen Verse sagte sie nicht, weil sie ihr nicht gefielen. Der Bauer sah sich die Frau an, und da er fand, daß sie trotz ihrer Lumpen schmuck und gesund war, fragte er sie, ob sie nicht bei ihm Magd werden wolle.
»Ich schenke dir zu Ostern einen Kuchen, zu Martini eine Gans und zu Weihnachten einen Taler und ein neues Kleid. Bist du damit zufrieden?«
»Nein,« erwiderte die Ritterfrau, »ich muß betteln gehen, der liebe Gott will es so haben.«
Darüber wurde der Bauer zornig, schimpfte und sagte höhnisch:
»Der liebe Gott will's so haben? he? Eine faule Haut bist du!« Darauf ging er seiner Wege, ließ sie stehen und gab ihr nichts. Da merkte die Ritterfrau wohl, daß das Betteln schwer sei.
Sie ging jedoch weiter, und nach abermals einiger Zeit kam sie an eine Stelle, wo die Straße sich teilte und zwei Steine standen. Auf dem einen saß ein Bettler mit einer Krücke. Da sie nun müde geworden war, gedachte sie sich eine kurze Zeit auf den leeren Stein zu setzen, um auszuruhen.
Kaum hatte sie jedoch dies getan, als der Bettler mit der Krücke nach ihr schlug und ihr zurief:
»Mach, daß du fortkommst, du liederliche Liese! Willst du mir mit deinen Lumpen und deinem zuckersüßen Gesicht die Kundschaft abzwicken? Die Ecke hier habe ich gepachtet! Mach flink, sonst sollst du sehen, was mein Krückholz für ein schöner Fiedelbogen ist, und dein Rücken für eine närrische Geige!«
Da seufzte die Ritterfrau, stand auf und ging so weit, als sie die Füße tragen wollten. Endlich kam sie in eine große, fremde Stadt. Hier blieb sie, setzte sich an den Kirchweg, und bettelte; und nachts schlief sie auf den Kirchenstufen. So lebte sie tagaus tagein, und es schenkte ihr der eine einen Pfennig und der andere einen Heller; manche aber auch gaben ihr nichts oder schimpften gar, wie es der Bauer getan hatte.
Es ging aber sehr langsam mit den hundert Goldgulden. Denn als sie dreiviertel Jahre gebettelt hatte, hatte sie erst einen Gulden erspart. Und genau wie der erste Gulden voll war, gebar sie einen wunderschönen Knaben, den nannte sie » Docherlöst«, weil sie hoffte, daß sie ihren Mann doch noch erlösen würde. Sie riß sich von ihrem Mantel unten einen Streifen ab, eine gute Elle breit, so daß der Mantel nur noch bis an die Knie reichte, wickelte das Kind hinein, nahm es auf den Schoß und bettelte weiter. Und wenn das Kind nicht schlafen wollte, wiegte sie es und sang:
»Schlaf ein auf meinem Schoße,
Du armes Bettelkind,
Dein Vater wohnt im Schlosse –
Und draußen weht der Wind.
Er geht in Samt und Seide
Trinkt Wein, ißt weißes Brot,
Und säh' er so uns beide,
So härmt' er sich zu Tod.
Er braucht sich nicht zu härmen,
Du liegst ja weich und warm;
Er ist ja noch viel ärmer,
Daß Gott sich sein erbarm!«
Da blieben oft die Leute stehen und besahen sich die arme junge Bettelfrau mit dem wunderschönen Kinde und schenkten ihr mehr wie früher. Sie aber war getrost und weinte nicht mehr, denn sie wußte, daß sie ihren Mann gewiß erlösen würde, wenn sie nur ausharrte.
Als aber die Frau nicht wieder zurückkehrte, ward der Ritter auf seinem Schlosse tief betrübt, denn er sagte sich: Sie hat alles gemerkt und dich deshalb verlassen. Er ging zuerst in den Wald zu dem Eremiten, um zu hören, ob sie in der Kapelle gewesen sei und dort gebetet habe. Aber der Eremit war sehr kurz angebunden und streng gegen ihn und sagte:
»Hast du nicht in Saus und Braus gelebt? Bist du nicht stolz und hart gegen die Armen gewesen? Hat dich nicht der liebe Gott zur Strafe verrosten lassen? Deine Frau hat ganz recht getan, wenn sie dich verließ. Man muß nicht einen guten und einen faulen Apfel in einen Kasten legen, sonst wird der gute auch faul!«
Da setzte sich der Ritter auf die Erde, nahm den Helm ab und weinte bitterlich.
Als der Eremit dies gewahr wurde, ward er freundlicher und sprach: »Da ich sehe, daß dein Herz noch nicht mitverrostet ist, so will ich dir raten: tu Gutes und gehe in alle Kirchen, so wirst du deine Frau wiederfinden.«
Da verließ der Ritter sein Schloß und ritt in alle Welt. Wo er Arme fand, schenkte er ihnen etwas, und wenn er eine Kirche sah, ging er hinein und betete. Aber seine Frau fand er nicht. So war fast ein Jahr vergangen, da kam er auch in die Stadt, wo seine Frau am Kirchweg saß und bettelte, und sein erster Weg war in die Kirche. Schon von weitem erkannte ihn die Frau, denn er war groß und stattlich und trug einen goldnen Helm, der weithin leuchtete.
Da erschrak sie, denn sie hatte erst zwei Goldgulden zusammen, so daß sie ihn noch nicht erlösen konnte. Sie zog sich den Mantel tief über den Kopf, damit er sie nicht erkennen sollte, und kauerte sich so eng zusammen als sie irgend konnte, damit er nicht ihre schneeweißen Füße sähe; denn der Mantel ging ihr nur bis an die Knie, seit sie den Streifen für das Kind abgerissen hatte. Als aber der Ritter an ihr vorbeischritt, hörte er sie leise schluchzen, und als er ihren zerlumpten und geflickten Mantel sah und das wunderschöne Kind auf ihrem Schoß, welches ebenfalls nur in Lumpen gewickelt war, tat es ihm in der Seele weh. Er trat an sie heran und fragte sie, was ihr fehle. Doch die Frau antwortete nicht und schluchzte nur noch mehr, so sehr sie sich auch Mühe gab, es zu verbeißen.
Da zog der Ritter seine Geldtasche hervor, in der viel mehr waren, als hundert Goldgulden, legte sie ihr auf den Schoß, und sagte: »Ich gebe dir alles, was ich noch habe, und sollte ich mich nach Hause betteln.«
Da fiel der Frau, ohne daß sie es wollte, der Mantel vom Kopf herunter, und der Ritter sah, daß es sein eigenes, angetrautes Eheweib war, der er das Geld geschenkt hatte. Trotz der Lumpen fiel er ihr um den Hals und küßte sie, und als er vernahm, daß das Kind sein Sohn sei, herzte und küßte er es auch. Doch die Frau nahm ihren Mann, den Ritter, an der Hand, führte ihn in die Kirche und legte das Geld auf das Kirchbecken. Dann sagte sie: »Ich wollte dich erlösen, aber du hast dich selbst erlöst.«
Und so war es auch; denn als der Ritter aus der Kirche trat, war der Fluch gehoben und der Rost, der seine ganze linke Seite bedeckte, verschwunden. Er hob seine Frau mit dem Kinde auf sein Pferd, ging selbst zu Fuß daneben und zog mit ihr zurück in sein Schloß, wo er lange Jahre glücklich mit ihr lebte und so viel Gutes tat, daß ihn alle Leute lobten.
Die Bettlerlumpen aber, die seine Frau getragen hatte, hängte er in einen kostbaren Schrein, und jeden Morgen, wenn er aufgestanden war, ging er an den Schrein, besah sich die Lumpen und sagte: »Das ist meine Morgenandacht, die nimmt mir der liebe Gott nicht übel, denn er weiß, wie ichs meine, und ich gehe nachher doch in die Kirche.«
R. von Volkmann.

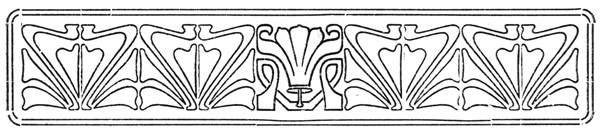
 Die schwarze Suse hütete die Gänse. Zu etwas anderem, meinten die Leute, sei sie nicht zu gebrauchen. Ihre Eltern waren früh gestorben; das Dirnlein aber war herangewachsen wie ein Schlehenbusch am Rain, dem Wind und Wetter, Frost und Schneegestöber nichts anhaben kann.
Die schwarze Suse hütete die Gänse. Zu etwas anderem, meinten die Leute, sei sie nicht zu gebrauchen. Ihre Eltern waren früh gestorben; das Dirnlein aber war herangewachsen wie ein Schlehenbusch am Rain, dem Wind und Wetter, Frost und Schneegestöber nichts anhaben kann.
Suse war gut gewachsen, und wenn sie ihre wirren Haare einmal strählte, so fielen sie ihr bis zu den Kniekehlen hinab. Aber sie hatte am Auge ein Mal, gestaltet wie eine schwarze Fliege, und das war für die Nachbarn ein Grund mehr, die Dirne zu meiden. Sie war eine Gezeichnete, und vor den Gezeichneten soll man sich hüten.
Eines Morgens, als Suse, umgeben von der schnatternden Gänseherde, auf dem Anger saß, kam die alte Barbe an ihrem Krückstock herangehinkt, blieb vor dem Mädchen stehen und sprach: »Das Mal am Auge verschändet dich. Komm nächsten Vollmond zu mir; ich will dir den Flecken vertreiben.«
Frau Barbe bewohnte ein kleines Haus an der Mittagshalde. Sie hatte ehemals bessere Tage gesehen, aber die Kinder, denen sie ihre Habe abgetreten, hatten ihr übel mitgespielt und waren schließlich in die weite Welt gezogen. Wie die Vereinsamte ihr Leben fristete, darüber zerbrachen sich die Bauern den Kopf.
Einige waren der Meinung, sie besitze einen geheimen Schatz von Gold und Silber, den sie ihren undankbaren Kindern klüglich vorenthalten, andere sagten, der fliegende Drache, des lichten Satans Diener, trage ihr Lebensmittel zum Schornstein herein, und wieder andere hießen sie geradezu eine Hexe.
So arg war es wohl nicht um die alte Barbe bestellt, aber der geheimen Künste wußte sie mehr als eine. Sie konnte das Blut besprechen, heilte kranke Kühe durch Handauflegen und vertrieb den eitlen Dorfschönen die entstellenden Sommersprossen.
Mit dem Eintritt des Vollmondes sprach Suse, die Gänsehirtin, in der Hütte der Alten vor. Diese bestrich das Mal am Auge mit einer fetten, schwarzen Waldschnecke, warf dieselbe über ihre linke Schulter und murmelte einen Segen. Dann legte sie über das Auge ein Pflaster und hieß das Mädchen nach drei Tagen wiederkommen.
Und nach drei Tagen war das Mal richtig verschwunden. Wohlgefällig beäugelte sich die Gänsemagd in dem kleinen Spiegelglas, das ihr Frau Barbe vorhielt, und auch diese schien sich über die Heilung zu freuen. Aber als Suse mit ungelenker Zunge anhob Dank zu sagen, fiel ihr die Alte zürnend in die Rede:
»Spare deine Worte! Wenn dein Dank nur einen Heller Der Heller – österreichische Münze; 10 Heller = 4 Kop.; als alte deutsche Münze hatte er verschiedenen Wert. wert wäre, hättest du ihn für dich behalten.«
Indem sie so sprach, fing die Wanduhr an zu rasseln, und aus seinem Häuslein trat der Kuckuck, bückte sich und rief die Stunde.
»Hörst du den Gauch?« fragte Frau Barbe. »Der Kuckuck ist die undankbarste Kreatur unter der Sonne. Wenn er zu Kräften gekommen ist, frißt er die alte Grasmücke, die ihn großgefüttert hat.
Die Uhr ist mein kostbarstes Hausgeräte, denn allstündlich mahnt mich der Kuckuck: Zähle nicht auf der Menschen Dank. Undank ist der Welt Lohn. – Ja, undankbar sind sie alle, jung und alt, arm und reich. Und du, Suse, bist um kein Haar besser als die andern Menschenkinder.«
Die schwarze Suse war tief gekränkt. »Mutter Barbe,« sprach sie, »Ihr tut mir unrecht. Ich habe ein dankbares Gemüt.« – Hier fuhr sie mit dem Schürzenzipfel über die Augen. – »Und wenn ich heute oder morgen das goldene Regenbogenschüsselein Dem Volksglauben nach steigt der Regenbogen an beiden Enden aus goldenen Schalen auf. Wer die Schalen findet, wird reich. finde, nach dem ich schon lange suche, so will ich den Schatz redlich mit Euch teilen. Das gelobe ich bei Gott und allen heiligen Nothelfern Die Nothelfer – Heilige, die den gläubigen Menschen in der Not helfen; es gibt ihrer vierzehn..«
Die Alte wiegte ihr graues Haupt und lachte leise vor sich hin. »Also dein Regenbogenschüsselein willst du mir zur Halbscheid geben? Du hast eine offene Hand, Suse. Am Ende bist du doch besser als die anderen. Ich hätte Lust, dich auf die Probe zu stellen. – He, mein Töchterlein, was würdest du mir geben, wenn ich dich reich und glücklich machte?«
»Ach, wenn Ihr das vermöchtet!« sprach die schwarze Suse mit einem tiefen Seufzer.
Die Augen der Magd funkelten. »Mutter Barbe,« sprach sie mit fliegendem Atem, »zieht Eure Kreise und raunt Eure Zaubersprüche, und verhelft Ihr mir zu Glück und Wohlleben, so will ich Euch zeitlebens die Hände unter die Schuhsohlen legen Die Hände unter die Schuhsohlen legen = auf den Händen tragen. und Euch wie eine Tochter pflegen bis an Euer Ende.«
Die Alte sprach kein Wort weiter. Sie entzündete das Herdfeuer und warf getrocknete Kräuter in die Glut. Dann holte sie ein großes Buch herbei, klemmte die Brille auf die Nase und begann eifrig zu lesen.
So verstrich geraume Zeit. Endlich brach Frau Barbe das Schweigen. »Gleich wird die Mittagsstunde schlagen. Tritt hierher, meine Tochter, und richte den Blick auf den Zeiger der Uhr. Sobald der Kuckuck zum erstenmal ruft, schließe die Augen und harre der Dinge, die da kommen. Hast du mich verstanden?«
»Ja.«
Die Alte warf noch ein Bund dürren Krautes in das Feuer und murmelte einen Spruch. Da begann die Wanduhr zu schnarren, der Kuckuck trat aus dem Pförtlein und rief, Suse aber schloß die Augen und stand starr und regungslos.
Plötzlich erklangen Pfeifen- und Saitentöne, und dazwischen brummte die Baßgeige. Die schwarze Suse war entrückt zu der Dorflinde Die Dorflinde war bei den Deutschen ein heiliger Baum; mitten auf dem Dorfplatz war sie der Sammelpunkt der Dorfbewohner. Der Linde klagt die Braut ihr Leid; von der Linde nimmt der Wanderbursche Abschied., um die sich das junge Volk im Reigen drehte. Sie schaute an sich hinunter und nahm mit Freuden wahr, daß sie statt ihrer dürftigen Kleider ein stattliches Festgewand auf dem Leib trug. Ein schwarzes Mieder mit Silberspangen geziert umwölbte ihren Busen, und ein blauer, faltiger Rock fiel nieder bis zu den Zwickeln der weißen Strümpfe. Auf ihren glänzenden Bänderschuhen aber prangten zwei Rosen, aus roter Wolle gefertigt.
Die Mädchen steckten flüsternd die Köpfe zusammen, als sie die geputzte Gänsemagd erblickten, und durch die Reihen der Burschen ging freudige Bewegung.
Da trat einer hervor, das war der Lukas, des reichen Dachshofbauern Der Dachshofbauer = der Bauer dem der Dachshof gehört. einziger Sohn. Der faßte die schwarze Suse bei der Hand und warf auf die Bühne der Spielleute einen Kronentaler. Der Kronentaler – eine Silbermünze mit der Abbildung einer Krone. Der Taler = drei Mark, etwa 1 Rubel 50 Kop. Die Musik rauschte auf, und der Lukas schwang die schöne Dirne, daß ihre schwarzen Zöpfe im Kreis flogen und ihr der Atem fast verging.
Als der Kehraus getanzt und die Lustbarkeit zu Ende war, führte der Lukas die Suse nach Hause. Unter der Tür küßte er sie und sprach: »Lange sollst du nicht mehr in der elenden Hütte hausen. Gute Nacht, mein lieber Schatz. Morgen sehen wir uns wieder.«
Und ein paar Tage darauf ging durch das Dorf die unglaubliche Mär: Des Dachshofbauern Lukas freit die schwarze Suse und führt sie als Bäuerin auf seinen Hof, und der alte Dachshofbauer hat Ja und Amen dazu gesagt.
Das war kein leeres Gerede. Die Gänsemagd wurde von ihrem zukünftigen Schwiegervater in einem mit Schimmeln bespannten Wagen abgeholt, und die stolzen Dorfschönen wurden vor Neid grün und gelb, als sie das Unerhörte sehen mußten. Am nächsten Sonntag ward das Brautpaar in der Kirche aufgeboten.
Der Hochzeitstag war da. Suse mit der glitzernden Krone im schwarzen Haar sah prächtig aus; das mußte ihr der Neid lassen. Und der junge Dachshofbauer schaute mit stolzem Auge auf seine schöne Braut.
Die Trauung war vorüber, und im Dachshof rüstete man die Tische zum festlichen Hochzeitsmahl. Da erschien eine Magd und rief die Braut hinaus. Eine fremde Frau begehre mit ihr zu sprechen.
Unwillig begab sich Suse in den Hof. Dort stand auf ihren Krückstock gestützt die alte Barbe. »Nun, mein Töchterchen,« rief sie freundlich der Braut entgegen, »bist du mit mir zufrieden? Ich bin gekommen, um mich an deinem Ehrentag mit dir zu freuen. Komm, führe mich hinein, du schöne glückliche Braut.«
Die Braut aber zog die Stirn kraus und sprach: »Geht in die Küche, Mutter. Ich schicke Euch Speise und Trank heraus; es soll Euch an nichts fehlen.«
»Nein,« sagte die Alte, »so war's nicht gemeint. An der Hochzeitstafel will ich sitzen, und zwar obenan. Das gebührt mir.«
»Daraus wird nichts,« entgegnete heftig die Braut, und das Blut stieg ihr heiß in Wange und Stirn. »Daraus wird nichts. Im Bettlergewand wollt Ihr unter meinen Ehrengästen sitzen? Nichts da. Steht Euch der Platz bei den Mägden in der Küche nicht an, so hebt Euch hinweg.« So sprach Suse und wies mit dem Zeigefinger nach dem Tor.
»Nimm dich in acht, du hoffärtige Dirne,« drohte die Alte, »und reize nicht meinen Zorn. Was ich gegeben habe, kann ich auch wieder nehmen.«
»Was?« kreischte Suse. »Drohen willst du mir, drohen? Heda, ihr Knechte, kommt heran und treibt mir die Hexe aus dem Hof!«
Da kicherte die Alte höhnisch, hob ihren Stab und gab der Braut einen Schlag. –
Suse fuhr empor.
Im Gewand der Gänsemagd stand sie im Stüblein der alten Barbe. Die Wanduhr schnarrte noch, und der Kuckuck ließ eben zum zwölftenmal seinen Ruf ertönen; dann verstummte er, und die Uhr tickte weiter.
Die alte Frau nahm von der Nase die Brille, legte sie auf das zugeklappte Buch und sprach zu der betäubten Dirne: »Du wirst dich wohl aufmachen müssen, schwarze Suse, um das Regenbogenschüsselein zu suchen. Ich will dich nicht länger halten. Gott befohlen!«
R. Baumbach.
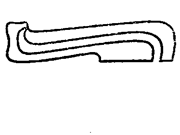
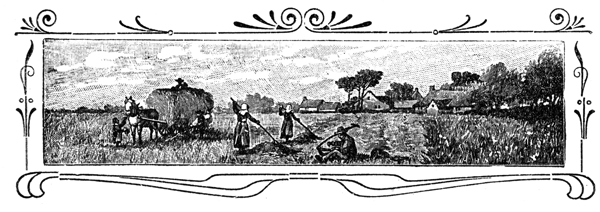
 Ein wohlhabender Bauer stand in seiner Scheune und schaute behaglich den mächtigen Segen an, welchen ihm ein günstiger Sommer gebracht hatte. Bis an den Giebel heran waren alle Scheunen mit goldenen Garben gefüllt, und das nicht allein – auf dem Felde standen noch einige stattliche Schober, die keine Unterkunft mehr hatten finden können; so reich war die Ernte gewesen. Dabei war das Stroh so lang und die Ähren so voll, wie lange nicht, ja, der Hafer hatte sogar das dritte Korn, während sonst an den einzelnen Stielchen seiner Ähre nur zwei wie kleine Kanarienvögel sitzen, und das dritte dazwischen gemeiniglich verkümmert. Als er nun so stand und an das Dreschen im Winter dachte und an die Wagen mit feisten Kornsäcken beladen, welche er in die Stadt und an den Müller liefern würde, und im Geiste schon die vielen blanken Taler in seinem Kasten klingen hörte, da raschelte es ganz leise in einem Haufen Stroh, welcher auf der Tenne lag.
Ein wohlhabender Bauer stand in seiner Scheune und schaute behaglich den mächtigen Segen an, welchen ihm ein günstiger Sommer gebracht hatte. Bis an den Giebel heran waren alle Scheunen mit goldenen Garben gefüllt, und das nicht allein – auf dem Felde standen noch einige stattliche Schober, die keine Unterkunft mehr hatten finden können; so reich war die Ernte gewesen. Dabei war das Stroh so lang und die Ähren so voll, wie lange nicht, ja, der Hafer hatte sogar das dritte Korn, während sonst an den einzelnen Stielchen seiner Ähre nur zwei wie kleine Kanarienvögel sitzen, und das dritte dazwischen gemeiniglich verkümmert. Als er nun so stand und an das Dreschen im Winter dachte und an die Wagen mit feisten Kornsäcken beladen, welche er in die Stadt und an den Müller liefern würde, und im Geiste schon die vielen blanken Taler in seinem Kasten klingen hörte, da raschelte es ganz leise in einem Haufen Stroh, welcher auf der Tenne lag.
Der Bauer glaubte, es sei eine Maus und packte seinen Stock schon fester, um ihr den Garaus zu machen, allein er verwunderte sich fast, da statt eines solchen Tierchens etwas so Leuchtendrotes wie Klatschmohn aus dem Stroh hervorkam. Nun arbeitete es sich ganz zum Vorschein und stand da, nicht größer als eine Maus, die auf zwei Beinen geht. Es war ein Zwerg in grauer Kleidung mit einem roten Käppchen auf dem Haupte. Dieses lüftete der kleine Wicht gar höflich und sprach mit einem winzigen Stimmlein: »Lieber Bauer, ich habe ein großes Anliegen an dich.«
»Nun, was willst du denn, kleiner Mann?« fragte dieser.
Das Zwerglein sprach: »Reichtum und Fülle ist bei dir eingekehrt. Willst du nun die große Güte haben, alltäglich um diese Zeit mir von deinem Überfluß eine Gerstenähre zu schenken, so soll dies nicht zu deinem Schaden sein.«
Der Bauer, welcher wohl wußte, daß man gut daran tut, das kleine Volk sich freundlich zu erhalten, sprach: »Gewiß, das soll geschehen, komm nur allezeit um die Mittagsstunde, so soll dir werden, was du begehrst.«
Damit ging er an das Getreide, zog eine schöne Gerstenähre hervor und reichte sie dem Männlein hin. Dieses wandte sich aber mit trübseliger Gebärde gegen das Häuflein Stroh, aus welchem es hervorgekommen war, und sprach: »Du hast diesen großen Berg vor unsere Höhle getürmt. So er dort liegen bleibt, vermag ich nicht mit deiner freundlichen Gabe unsere Wohnung zu gewinnen.«
»Nun, wenn's weiter nichts ist!« sagte der Bauer und schob mit dem Fuße das Stroh beiseite. Es zeigte sich nun an der Wand eine Öffnung wie ein großes Mauseloch. Das Wichtlein lüftete wieder sein Mützchen und sprach in wohlgesetzten Worten seinen Dank aus. Sodann wuchtete es unter großem Schnaufen die Gerstenähre auf seine Schulter und schleppte seine Last unter ziemlichem Gestöhne von dannen. Den Halm in das Loch hineinzubringen, ward ihm auch nicht leicht, man sah an dem Zappeln der Ähre, wie das Männlein inwendig zerrte, und wohl eine halbe Minute dauerte es, bis der letzte Zipfel in der Öffnung verschwunden war.
Der Bauer ging von nun an alle Mittage in die Scheune und gab dem Männlein seine Gerstenähre, und von dieser Zeit ab gedieh sein Vieh auf eine wunderbare Art, obwohl es weniger Pflege und Futter verlangte als sonst. Es war eine Lust, diese runden, glänzenden Schweine zu betrachten, welche so fett waren, daß sie kaum aus den Augen sehen konnten und sich nur mit Mühe an ihren Futtertrog schleppten. So blanke Kühe wie auf diesem Hofe fanden sich bald weit und breit nicht. Sie gaben ohne Ende fette, sahnige Milch aus ihren strotzenden Eutern, und um die Butter, welche die Bäuerin in die Stadt schickte, rissen sich die Leute, denn sie war frisch wie Morgentau und süß wie Nußkern. Obwohl die Pferde des Bauern nur einige Handvoll Hafer und ein wenig Heu alltäglich verzehrten, waren sie doch glänzend und schön, und fromm und feurig zugleich, schafften sie vor dem Pfluge oder dem Wagen doppelt so viel als früher.
Auch mit den Hühnern war es ein seltsames Ding. Sie legten und legten fast das ganze Jahr hindurch jedes alltäglich ein großes rundes Ei, zuweilen gar mit zwei Dottern, und niemals geschah es, wenn eine Glucke gesetzt wurde, daß auch nur eines von den untergelegten Eiern sich faul erwies, oder daß später von den Küchlein der Habicht oder der Weih eines erwischte. Dies alles gefiel dem Bauer und der Bäuerin gar wohl, und da sie recht gut wußten, wem sie diesen Segen zu verdanken hatten, so priesen sie das kleine Männlein alle Tage, und niemals ward die herkömmliche Gabe versäumt.
Eines Tages im Winter aber, als es bei hellem Sonnenschein so recht Stein und Bein fror und die Eiszapfen wie gläserne Keulen von den Dächern hingen, saß der Bauer recht behaglich in seinem Sorgenstuhl am warmen Ofen und wartete auf sein Mittagessen. Es gab sein Lieblingsgericht, Schweinsrippenbraten mit Pflaumen und Äpfeln gefüllt, und süße Düfte dieses köstlichen Gerichtes wehten jedesmal, wenn die Tür geöffnet wurde, verheißungsvoll aus der Küche herein. Da er nun in der Erwartung des Guten so behaglich in der Wärme saß, empfand er eine Abneigung, hinauszugehen in den eisigen Wintertag und die kalte Scheune, nur um der einen kleinen Gerstenähre willen. Er rief deshalb seinen Knecht und sagte ihm, was er tun solle.
Dieser, ein vorwitziger Gesell, hatte schon lange gewünscht, das sonderbare Männlein zu sehen, darüber man im Dorfe die wunderlichsten Dinge erzählte, und ging eilfertig in die Scheune, woselbst er das Wichtlein schon wartend antraf. Als er ihm den Halm nun darreichte, konnte er sich nicht enthalten, das kleine Geschöpf wie zufällig ein wenig mit den spitzen Grannen der Ähre ins Gesicht zu kitzeln, also daß es sehr prustete und wunderliche Gesichter zog. Darüber wollte sich der Knecht vor Lachen innerlich ausschütten. Als er nun aber sah, wie der kleine Mann mit schwerem Gestöhn den Halm auf die Schulter wuchtete und unter Schnaufen davonschleppte, da erschien ihm solches dermaßen lächerlich, daß er sich nicht enthalten konnte zu rufen: »Nun, sieh einer das Krabauterding, es benimmt sich, als wenn der Halm ein dicker Balken wäre!« Sodann schlug er mit den Händen mehrfach auf die Knie seiner Lederhosen und lachte unbändig. Dazwischen aber rief er, wie die Zimmerleute tun, wenn sie schwere Balken bewegen: »Holz komm! Holz komm!« und höhnte das Männlein auf jede Weise.
Dieses aber ward im Gesichte so blutrot wie seine Mütze und warf zornig funkelnde Blicke um sich. Es schleppte, so rasch es vermochte, den Halm in das Loch hinein, und an dem hastigen Hin- und Herfliegen des vorstehenden Endes konnte man wohl bemerken, mit welcher Wut es inwendig zog und zerrte, bis der letzte Zipfel verschwunden war.
Am anderen Tage aber, als der Bauer selbst kam, um dem Wichtlein die Gerstenähre zu geben, wartete er vergebens, es erschien niemand. Er rief es mit schmeichlerischen Worten und gab ihm die schönsten Namen, allein es war umsonst. Auch am folgenden Tage kam es nicht, und so oft auch der Bauer um die Mittagszeit noch sein Heil versuchte, das Männchen war und blieb verschwunden.
Wie oft hat es der Bauer noch bereut, daß er damals nicht selbst gegangen war und seinem Knechte vertraut hatte, denn von nun ab ging alles quer. Das Vieh stand an den Raufen und fraß und fraß Berge von Futter in sich hinein, und wenn alles verschlungen war, sah es mit glühenden, hungrigen Augen sich nach mehr um. Dabei ward es jedoch immer rauher und magerer, die Kühe gaben wenig dünne und blaue Milch, und den Pferden standen die Hüftknochen also vor, daß der Knecht seinen Hut dort hätte anhängen können, wenn er gewollt hätte. Die Schweine wurden hochbeinig und dünn, und wenn sie einmal aus dem Stall gelassen wurden, da rannten sie wie die Windhunde auf dem Hofe umher, was für ein Schwein eine ganz törichte Kunstfertigkeit ist. Und mit den Hühnern war's auch vorbei. Sie kriegten den Pips und legten Windeier, und wenn sie mal ein ordentliches gelegt hatten, so fraßen sie es auf.
Als der Bauer nun sah, wie alles zurückging, verlor er ganz die Lust an seinem Anwesen, und als er ein gutes Angebot erhielt, verkaufte er es. Er zog dann weit fort nach Rußland zu, wo die Polen wohnen.
H. Seidel.
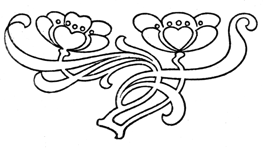
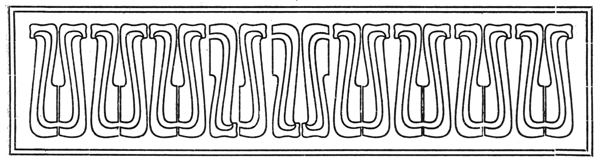
 Die schmalspurige Bahn war nur hundert Kilometer lang; sie hatte drei Lokomotivführer, und die Geschäfte standen recht ungünstig für die Aktien-Gesellschaft; der Herr Betriebsdirektor selbst ging mit glänzend geriebenen Ellbogen an seinen Rockärmeln, und seine Frau verkaufte Malmöer Handschuhe auf Provision.
Die schmalspurige Bahn war nur hundert Kilometer lang; sie hatte drei Lokomotivführer, und die Geschäfte standen recht ungünstig für die Aktien-Gesellschaft; der Herr Betriebsdirektor selbst ging mit glänzend geriebenen Ellbogen an seinen Rockärmeln, und seine Frau verkaufte Malmöer Handschuhe auf Provision.
Ungefähr mitten an der Linie lag eine kleine, kleine Stadt, in welche das Scharlachfieber zweimal jährlich pünktlich seinen Einzug hielt, die neuen Moden aber erst ein volles Jahr, nachdem sie in Stockholm alt geworden.
An der entlegensten Gasse dieser kleinen Stadt in einem freundlichen, gelbbemalten Häuschen wohnte Lindahl, einer der drei »Führer« an der schmalspurigen Bahn. Hinter den frischblühenden Geranien beugte sich das hübsche, bleiche Antlitz seiner Frau über endlose Näharbeit, und um die Füße der Nähmaschine (auf Abzahlung gekauft) spielte ihr blauäugiger, dreijähriger Gustav, und wenn Mama ins Schwungrad der Maschine griff und mit den Füßen drauf los trat, stand klein Gustav stramm und breitbeinig da, eine kleine rote Flagge in dem feisten Händchen – wie der Herr Stationsinspektor – und kommandierte: »Zug ab!«
Vier Jahre waren es her, seit Papa und Mama. »Zug ab!« gemacht in das unbekannte Leben.
Und jetzt lebten sie beide und noch ein kleiner Lindahl dazu in dem freundlichen gelben Häuschen mit den Geranien am Fenster. Gewiß – es war niedrig dort bis zur Decke und hoch, sehr hoch bis zu den Kuchen Die Kuchen waren für ihre Verhältnisse zu teuer und darum unerreichbar.; aber wenn draußen auf der Maschine die Wange rußig und die Brust im Sturm und Schnee auf der Linie kalt wurde, da brauchte Lindahl nur in sein warmes Heim hineinzutreten, um aufzutauen an der Liebe seiner Marie und seines kleinen goldgelben Lockenköpfchens, des kleinen Gustav, das sich so innig an seinen ruhigen Lederkittel anschmiegte.
Lindahl hatte den Zug jeden Tag bis zur südlichen Endstation und am Abend wieder zurück zu fahren. Dann war er bis zum nächsten Tage frei, und in seiner Sehnsucht nach dieser täglichen Stunde der Heimkehr war er immer frisch und eifrig bei der Arbeit an seiner Maschine und freute sich wie ein Kind auf die Stunde der Wiedervereinigung mit den Seinen.
Deshalb verwunderte sich auch der Stationsinspektor eines Morgens sehr, als er den Führer bleich und düster, mit breiten braunen Ringen um die Augen zu seiner Lokomotive wanken sah.
»Nicht alles klar auf der Linie, Lindahl?«
»Unser kleiner Gustav liegt im Sterben, Herr Inspektor.« – –
Und der Zug ging ab.
Es war schweres Winterwetter eine ganze Woche lang gewesen. Heute war wieder Schneewehen und stechender Sturm. Der Zug kam mit Verspätung auf der ersten Station an, und bei jedem folgenden Halt wurde die Verspätung größer. Auf der Rückreise schien es sogar ungewiß, ob man die kleine Stadt an diesem Abend überhaupt noch erreichen würde. Es ging doch; mit zwei Stunden Verspätung glitt der kleine Zug in die Station und Lindahl eilte mit einem »Gott sei gelobt!« auf der Zunge nach Hause.
»Herr Lindahl?«
»Herr Inspektor?«
»Wir sind in einer verteufelten Klemme; der Mittagszug nach Norden mußte wegen einer riesigen Schneewehe zurück – 1½ Kilometer von hier –; 50 Mann haben jetzt die Linie soweit klar bekommen, daß der Zug den Schnee vielleicht wird durchschneiden können. Er muß deshalb sofort abgehen, aber Jonson liegt krank in vollem Delirium, und der Arzt meint, er habe sich bei dem Hundewetter auf der Maschine den Typhus geholt. Sie müssen deshalb auch den nördlichen Zug führen.«
»Was? Jetzt … in der Nacht In Schweden wird im allgemeinen nur auf den großen direkten Linien in der Nacht gefahren. … Herr Inspektor, ich habe mich erkältet, überanstrengt; ich habe nicht mehr denn menschliche Kräfte …«
»Es ist hart, ich weiß es; aber – in den Dienstvorschriften steht nichts von Überanstrengung. Sind Sie so krank, daß die Passagiere Gefahr laufen, wenn Sie fahren?«
»Vielleicht doch nicht so … Aber, Herr Inspektor, mein kleiner Gustav stirbt vielleicht in dieser Nacht, wenn er nicht schon jetzt …«
»Es tut mir wirklich leid, Lindahl; aber über kranke Kinder steht schon ganz sicher nichts in der Dienstvorschrift. Können Sie fahren …?«
»Wann soll der Zug abgehen, Herr Inspektor?«
»Sieben Uhr fünfzehn Minuten!«
»Carlson heizen Sie. In zehn Minuten bin ich wieder hier!«
Daheim sah es schlimm aus. Feucht klebten die goldenen Locken an des kleinen Gustav Stirn, es rasselte im Halse, und die kleinen Hände mit den Grübchen an jedem Gelenke waren krampfhaft geballt. Die kleine Brust hob sich schmerzhaft, und der Blick war erschreckt, wie der eines verwundeten Vogels.
Mama hatte aufgehört zu weinen. Bleich, mit festgeschlossenen Lippen sah sie da und trocknete den Fieberschweiß von des Lieblings Wangen.
Doch als Papa kam, brach der Schmerz von neuem aus; bebend, schluchzend hing sie an seinem Halse und schrie: »Er stirbt, er stirbt! Der Arzt hat gesagt, es sei keine Hoffnung mehr! Aber er darf nicht sterben, er kann nicht sterben! Gott kann nicht so grausam sein! Gustav, mein Kleiner, Papa ist ja wieder hier; jetzt bleibt er die ganze Nacht bei seinem Jungen. Du erkennst ja deinen Papa, nicht wahr, Liebling …?«
Mühsam trennten sich die blutunterlaufenen Lider, das Rasseln hörte einen Augenblick auf, es flog der Schatten eines Lächelns über das fiebrige Gesichtchen, und die kleinen Lippen stammelten:
»Pappy soll an Gustavs Bettchen sitzen …«
* * *
Und wieder stand er auf der dröhnenden Maschine, und wieder ging es vorwärts durch Sturm und Schnee. Er wußte es nicht, wie er sich aus Marias Armen losgerissen, wie er auf die Lokomotive gekommen; jetzt stand er aber da, den Blick fest auf die Linie mit ihren Schneewehen gerichtet. Der Schneepflug schnitt rasch durch die weißen Hügel und warf Silberhelle Wolken auf beide Seiten. So, gerade so, unerbittlich, unwiderruflich, schnitt der scharfe Schmerz durch seine Brust. Hu, wie kalt ist es da unten unter dem tiefen Schnee in der harten Erde! … Und dort sollte sein kleiner Gustav bald tief niedergebettet werden! … Niemals mehr würde er »Zug ab« spielen, niemals mehr sollten seine kleinen, eiligen Schritte über die Diele klappern, wenn er seinen Papa an der Vorzimmertür hörte … Niemals, niemals sollte er sein »Abend, lieber Pappy!« mehr herzwitschern … Oh …!«
»Was ist's Herr Lindahl?«
»Nichts, Carlson.«
»Mir kam es vor, als hätte Herr Lindahl so unheimlich aufgeschrieen …«
»Träumen Sie nicht, Mann! Ich habe kein Wort gesagt. Heizen Sie nur drauf los!«
Bei der nächsten Station stieg er aus, der wohlbeleibte Herr, der allein im ganzen Zuge gereist war, im Biberpelz und I. Klasse. Sein Kutscher stand auf dem Perron und empfing ihn. Es war ein kurzer Zug, und der Führer hörte und sah alles, was an den Wagen passierte.
»Wie steht's zu Hause, Person?« fragte der Herr.
»Alles wohl, gnädiger Herr!«
»Meine Frau und die Kinder gesund?«
»Ja wohl, alle gesund.«
Es schnitt tief hinein in des Führers Herz. Der da mit dem Biberpelz und dem eigenen Deckschlitten eilte reich, zufrieden und vergnügt zu einem warmen, fröhlichen Heim, seine Frau und Kinder werden ihn gesund und froh mit Jubel und offenen Armen empfangen, aber für ihn selbst den armen Frierenden da oben auf der Maschine, für ihn gab es morgen nur eine vom Schmerz zerschmetterte Mutter und eine kleine, kalte Leiche im Korbwägelchen daheim …
Vorwärts wieder durch Schneewehen und Nordwind! Die letzte Station! Mehr Kohlen!
Erst den folgenden Tag sollte der Zug zurück, »um als Zug Nr. 3 die regelmäßige Fahrt nach dem Schneesturme wieder aufzunehmen,« wie es in dem telegraphischen Befehl hieß.
Die Naturkräfte hatten ausgetobt. Die strahlende Sonne schien blendend auf die weiße Schneedecke. Schneediamanten glitzerten auf dunkelgrünen, unter dem Gewichte gebeugten Tannen. Die Linie lag klar und frei, und an den Fenstern, an denen man vorüberdampfte, saßen zufriedene Menschen, die auf den kleinen Spielzeug-Zug herausschauten und ihre Freude daran zu haben schienen, daß man wieder ordentliche Eisenbahnverbindung habe.
Der Führer wandte sich plötzlich zur Seite. Zwei schwere Tränen rannen sachte über seine rußgeschwärzten Wangen. Biß der Wind heute auch so scharf? O nein! Es saß nur ein Weib mit ihrem Kleinen auf den Knien dort am Fenster ganz dicht bei der Linie und zeigte ihm die Lokomotive und den Zug …
Endlich – da! Er wollte keinen von den Kameraden an der Station fragen, wie es daheim stand, er wollte sein Urteil von den Lippen hören, die allein auf dem ganzen Erdenrund die Macht hatten, dessen Bitterkeit für ihn zu mildern, und so eilte er denn nach Hause, ohne ein Wort an die Kameraden zu richten.
Im gelben Häuschen hingen die Gardinen wie gewöhnlich rein und weiß an den Fenstern, und dahinter standen immer noch die Geranien, wie sie immer zu stehen pflegten. Ihm däuchte aber so genau, als wenn sie nickten: »Klein Gustav ist tot; klein Gustav ist tot …«
Er stürmte die Treppe hinauf und riß die Tür auf. Maria flog schluchzend aber mit Jubel unter Tränen in seine Arme und im Korbwägelchen saß klein Gustav, bleich und schwach, aber schmerzfrei, dem Leben wiedergeschenkt, und spielte mit seiner roten Flagge und kommandierte, wenn auch recht leise, recht schwach:
»Zug ab! Zug ab! Lieber Pappy!«
A. von Hedenstjerna.


 Ein junger Bauer, dem es in der Wirtschaft nicht recht vorwärts gehen wollte, saß auf seinem Pfluge und ruhte einen Augenblick aus, um sich den Schweiß vom Angesichte zu wischen. Da kam eine alte Hexe vorbeigeschlichen und rief ihm zu: »Was plagst du dich und bringst's doch zu nichts? Geh zwei Tage lang gerade aus, bis du an eine große Tanne kommst, die frei im Walde steht und alle anderen Bäume überragt. Wenn du sie umschlägst, ist dein Glück gemacht.«
Ein junger Bauer, dem es in der Wirtschaft nicht recht vorwärts gehen wollte, saß auf seinem Pfluge und ruhte einen Augenblick aus, um sich den Schweiß vom Angesichte zu wischen. Da kam eine alte Hexe vorbeigeschlichen und rief ihm zu: »Was plagst du dich und bringst's doch zu nichts? Geh zwei Tage lang gerade aus, bis du an eine große Tanne kommst, die frei im Walde steht und alle anderen Bäume überragt. Wenn du sie umschlägst, ist dein Glück gemacht.«
Der Bauer ließ sich das nicht zweimal sagen, nahm sein Beil und machte sich auf den Weg. Nach zwei Tagen fand er die Tanne. Er ging sofort daran, sie zu fällen, und in dem Augenblicke, wo sie umstürzte und mit Gewalt auf den Boden schlug, fiel aus ihrem höchsten Wipfel ein Nest mit zwei Eiern heraus. Die Eier rollten auf den Boden und zerbrachen, und als sie zerbrachen, kam aus dem einen Ei ein junger Adler heraus, und aus dem andern fiel ein kleiner goldener Ring. Der Adler wuchs zusehends, bis er wohl halbe Manneshöhe hatte, schüttelte seine Flügel, als wollte er sie probieren, erhob sich etwas über die Erde und rief dann:
»Du hast mich erlöst! Nimm zum Dank den Ring, der in dem anderen Ei gewesen ist! Es ist ein Wunschring. Wenn du ihn am Finger umdrehst und dabei einen Wunsch aussprichst, wird er alsbald in Erfüllung gehen. Aber es ist nur ein einziger Wunsch im Ring. Ist der getan, so hat der Ring alle weitere Kraft verloren und ist nur wie ein gewöhnlicher Ring. Darum überlege dir wohl, was du dir wünschst, auf daß es dich nicht nachher gereue.«
Darauf erhob sich der Adler hoch in die Luft, schwebte lange noch in großen Kreisen über dem Haupte des Bauern und schoß dann wie ein Pfeil nach Morgen.
Der Bauer nahm den Ring, steckte ihn an den Finger und begab sich auf den Heimweg. Als es Abend war, langte er in einer Stadt an; da stand der Goldschmied im Laden und hatte viel köstliche Ringe feil. Da zeigte ihm der Bauer seinen Ring und fragte ihn, was er wohl wert wäre. »Einen Pappenstiel!« versetzte der Goldschmied. Da lachte der Bauer laut auf und erzählte ihm, daß es ein Wunschring sei und mehr wert als alle Ringe zusammen, die jener feil hielte. Doch der Goldschmied war ein falscher, ränkevoller Mann. Er lud den Bauern ein, über Nacht bei ihm zu bleiben, und sagte: »Einen Mann wie dich mit solchem Kleinode zu beherbergen, bringt Glück; bleibe bei mir!« bewirtete ihn aufs schönste mit Wein und glatten Worten, und als er nachts schlief, zog er ihm unbemerkt den Ring vom Finger und steckte ihm statt dessen einen ganz gleichen, gewöhnlichen Ring an.
Am nächsten Morgen konnte es der Goldschmied kaum erwarten, daß der Bauer aufbräche. Er weckte ihn schon in der frühesten Morgenstunde und sprach: »Du hast noch einen weiten Weg vor dir. Es ist besser, wenn du dich früh aufmachst.«
Sobald der Bauer fort war, ging er eiligst in seine Stube, schloß die Laden, damit niemand etwas sähe, riegelte dann auch noch die Tür hinter sich zu, stellte sich mitten in die Stube, drehte den Ring um und rief: »Ich will gleich hunderttausend Taler haben.«
Kaum hatte er dies ausgesprochen, so fing es an Taler zu regnen, harte, blanke Taler, als wenn es mit Mulden gösse, und die Taler schlugen ihm auf Kopf, Schultern und Arme. Er fing an kläglich zu schreien und wollte zur Tür springen, doch ehe er sie erreichen und aufriegeln konnte, stürzte er, am ganzen Leibe blutend, zu Boden. Aber das Talerregnen nahm kein Ende, und bald brach von der Last die Diele zusammen, und der Goldschmied mitsamt dem Gelde stürzte in den tiefen Keller. Darauf regnete es immer weiter, bis die Hunderttausend voll waren, und zuletzt lag der Goldschmied tot im Keller und auf ihm das viele Geld. Von dem Lärm kamen die Nachbarn herbeigeeilt, und als sie den Goldschmied tot unter dem Gelde liegen fanden, sprachen sie: »Es ist doch ein großes Unglück, wenn der Segen so knüppeldick kommt.« Darauf kamen auch die Erben und teilten das Geld.
Unterdes ging der Bauer vergnügt nach Hause und zeigte seiner Frau den Ring. »Nun kann es uns gar nicht fehlen, liebe Frau,« sagte er. »Unser Glück ist gemacht. Wir wollen uns nur recht überlegen, was wir uns wünschen wollen.«
Doch die Frau wußte gleich guten Rat. »Was meinst du,« sagte sie, »wenn wir uns noch etwas Acker wünschten? Wir haben gar so wenig. Da reicht so ein Zwickel gerade zwischen unsere Acker hinein; den wollen wir uns wünschen.«
»Das wäre der Mühe wert,« erwiderte der Mann. »Wenn wir ein Jahr lang tüchtig arbeiten und etwas Glück haben, können wir ihn uns vielleicht kaufen.« Darauf arbeiteten Mann und Frau ein Jahr lang mit aller Anstrengung, und bei der Ernte hatte es noch nie so geschüttet wie dieses Mal, so daß sie sich den Zwickel kaufen konnten und noch ein Stück Geld übrig blieb. »Siehst du!« sagte der Mann, »wir haben den Zwickel, und der Wunsch ist immer noch frei.«
Da meinte die Frau, es wäre wohl gut, wenn sie sich noch eine Kuh wünschten und ein Pferd dazu. »Frau,« entgegnete abermals der Mann, indem er mit dem übrig gebliebenen Gelde in der Hosentasche klapperte, »was wollen wir wegen solch einer Lumperei unsern Wunsch vergeben. Die Kuh und das Pferd kriegen wir auch so.«
Und richtig, abermals nach einem Jahre waren die Kuh und das Pferd reichlich verdient. Da rieb sich der Mann die Hände und sagte: »Wieder ein Jahr den Wunsch gespart und doch alles bekommen, was man sich wünschte. Was wir für ein Glück haben!« Doch die Frau redete ihrem Manne ernsthaft zu, endlich einmal an den Wunsch zu gehen.
»Ich kenne dich gar nicht wieder,« versetzte sie ärgerlich. »Früher hast du immer geklagt und dir alles Mögliche gewünscht, und jetzt, wo du's haben kannst, wie du's willst, plagst und schindest du dich, bist mit allem zufrieden und läßt die schönsten Jahre vergehen. König, Kaiser, Graf, ein großer, dicker Bauer könntest du sein, alle Truhen voll Geld haben – und kannst dich nicht entschließen, was du wählen willst.«
»Laß doch dein ewiges Drängen und Treiben,« erwiderte der Bauer. »Wir sind beide noch jung und das Leben ist lang. Ein Wunsch ist nur in dem Ringe, und der ist bald getan. Wer weiß, was uns noch einmal zustößt, wo wir den Ring brauchen. Fehlt uns denn etwas? Sind wir nicht, seit wir den Ring haben, schon so heraufgekommen, daß sich alle Welt wundert? Also sei verständig. Du kannst dir ja mittlerweile immer überlegen, was wir uns wünschen könnten.«
Damit hatte die Sache vorläufig ein Ende. Und es war wirklich, als wenn mit dem Ringe der volle Segen ins Haus gekommen wäre, denn Scheuern und Kammern wurden von Jahr zu Jahr voller und voller, und nach einer längeren Reihe von Jahren war aus dem kleinen armen Bauer ein großer, dicker Bauer geworden, der den Tag über mit den Knechten schaffte und arbeitete, als wollte er die ganze Welt verdienen, nach der Vesper aber behäbig und zufrieden vor der Haustür sah und sich von den Leuten »guten Abend« wünschen ließ.
So verging Jahr um Jahr. Dann und wann, wenn sie ganz allein waren und niemand es hörte, erinnerte zwar die Frau ihren Mann immer noch an den Ring und machte ihm allerhand Vorschläge. Da er aber jedes Mal erwiderte, es habe noch vollauf Zeit und das Beste falle einem stets zuletzt ein, so tat sie es immer seltener, und zuletzt kam es kaum noch vor, daß auch nur von dem Ringe gesprochen wurde. Zwar drehte der Bauer selbst den Ring täglich wohl zwanzigmal am Finger um und besah sich ihn, aber er hütete sich, einen Wunsch dabei auszusprechen.
Und dreißig und vierzig Jahre vergingen, und der Bauer und seine Frau waren alt und schneeweiß geworden, der Wunsch aber war immer noch nicht getan. Da erwies ihnen Gott eine Gnade und ließ sie beide in einer Nacht selig sterben.
Kinder und Kindeskinder standen um ihre beiden Särge und weinten, und als eins von ihnen den Ring abziehen und aufheben wollte, sagte der älteste Sohn:
»Laßt den Vater seinen Ring mit ins Grab nehmen. Er hat sein Lebtag seine Heimlichkeit mit ihm gehabt. Es ist wohl ein liebes Andenken. Und die Mutter besah sich den Ring auch so oft; am Ende hat sie ihn dem Vater in ihren jungen Tagen geschenkt.«
So wurde denn der alte Bauer mit dem Ringe begraben, der ein Wunschring sein sollte und keiner war, und doch so viel Glück ins Haus gebracht hatte, als ein Mensch sich nur wünschen kann. Denn es ist eine eigene Sache mit dem, was richtig und was falsch ist; und schlecht Ding in guter Hand ist immer noch sehr viel mehr wert, wie gut Ding in schlechter.
R. von Volkmann


 Auf sandigem Pfad schritt ein müder Handwerksgesell durch den Wald. Um eine kurze Wegstrecke zu ersparen, hatte er, dem Rat eines Bauers folgend, die sichere Landstraße verlassen; nun irrte er bereits seit zwei Stunden durch die Kiefern, und der Wald wollte kein Ende nehmen.
Auf sandigem Pfad schritt ein müder Handwerksgesell durch den Wald. Um eine kurze Wegstrecke zu ersparen, hatte er, dem Rat eines Bauers folgend, die sichere Landstraße verlassen; nun irrte er bereits seit zwei Stunden durch die Kiefern, und der Wald wollte kein Ende nehmen.
»Gut Weg um
War nie krumm,«
murmelte er zwischen den Zähnen, aber der alte Spruch fiel ihm zu spät ein.
Die Föhrenstämme färbten sich an der Abendseite golden, und durch die Baumwipfel fuhr kühler Wind. Der Sand des Weges wurde immer tiefer, und die Knie des Wandernden immer müder.
Da kam durch das Holz ein kleiner Mann geschritten, der einen Sack auf der Schulter trug. Der Handwerksbursch nahm den mit Wachstuch überzogenen Hut ab und sprach:
»Mit Gunst, wie weit ist's noch bis zur Stadt?«
»Nach der Stadt willst du?« fragte das Männlein. »Da bist du auf dem Holzweg, Freund. Die Stadt liegt dort.« Und dabei deutete es mit dem Zeigefinger nach rechts. »Wenn du den Föhrenhügel überstiegen hast, kommst du an einen Bach, den mußt du durchschreiten, dann folgst du dem Pfad durch das Moos, bis du die Landstraße erreichst, und von da hast du noch drei gute Stunden bis zur Stadt.«
»Schön' Dank!« sprach der müde Bursch und seufzte tief auf. Dann schickte er sich zum Weitergehen an. Der Kleine aber vertrat ihm den Weg.
»Wie heißt du, und was bist du deines Zeichens?« fragte er. »Daß du ein Sonntagskind bist, weiß ich bereits, denn sonst hättest du mich nicht angesprochen.«
»Ich heiße Krispin und bin zünftiger Schustergesell,« erwiderte der Gefragte.
»Ein Schuster bist du?« rief das Männlein erfreut. »Das trifft sich gut. Komm mit mir. Ich will dir Herberge und Arbeit geben. Willst du?«
»Gern,« antwortete der Gesell, und dann gingen sie selbander in den Wald hinein. Nach kurzer Frist kamen sie an eine Lichtung, auf der ein kleines Häuschen stand. Aus dem Schlot wirbelte blauer Rauch.
»Sie sind daheim,« sprach der kleine Mann. »Tritt näher, Freund Krispin, und fürchte dich nicht, wenn du Seltsames siehst.«
Die Tür ward aufgetan. An einem Tisch saßen sechs graubärtige Zwerge um eine dampfende Schüssel herum; ein siebenter Stuhl aber stand leer. Die Männlein sprangen auf und begrüßten die Ankommenden.
»Das sind meine Brüder,« erklärte dem Wanderburschen sein Geleitsmann. »Wir schmelzen das Erz in den Bergen, kochen das Salz und schleifen die Edelsteine. Aber bei unseren Berg- und Höhlenwanderungen leidet unser Schuhwerk, und ein tüchtiger Schuster hat uns längst gefehlt. Bleib' ein paar Tage bei uns und besohle uns die Schühlein. Es soll dein Schade nicht sein. Jetzt aber komm und iß mit uns.«
Das ließ sich der müde, hungrige Gesell nicht zweimal sagen. Er warf sein Felleisen in den Winkel, rückte einen Schemel an den Tisch und setzte sich zu den sieben Zwergen. Fleisch und Mus ward ihm reichlich zugemessen. Dann schleppten sie einen gebauchten Krug herbei, aus dem floß kein Dünnbier, sondern ein Wein, wie der weit gereiste Schuster noch keinen getrunken hatte.
Es war ein fröhlicher Abend. Der Fremde mußte berichten, wie es draußen in der Welt aussehe, und dann erzählten die Männlein von einer Königstochter, weiß wie Schnee, rot wie Blut und schwarz wie Ebenholz, die vor langen Jahren bei ihnen gewohnt hatte. Der Schuster kannte die Geschichte bereits, denn seine Großmutter hatte sie ihm oft erzählt, aber um die Männlein nicht zu kränken, hörte er aufmerksam bis ans Ende zu. Dann ward ihm ein Bett angewiesen, und bevor er sein Abenteuer überdenken konnte, war er eingeschlafen.
Als Krispin am nächsten Morgen erwachte, lag in seiner Kammer ein Haufen zerrissener Schuhe. Leder, Pech und Draht war auch vorhanden, und auf einem Tischlein stand ein reicher Imbiß. Die Zwerge aber waren ausgegangen.
Er hockte zur Arbeit nieder und flickte und klopfte bis Sonnenuntergang. Da kamen die sieben Männlein zurück, und es begann wieder ein fröhliches Schmausen. So ging es eine ganze Woche lang fort.
Am letzten Abend schaute der fleißige Gesell mit Stolz auf eine lange Reihe schwarzglänzender Schuhe, und um ein übriges zu tun, nähte er in der Nacht, während die Zwerge schliefen, einem jeden einen herzförmigen Lederfleck auf das Höslein zum Schutz gegen das rauhe Gestein, auf dem sie herumrutschten.
Mit gerührten Blicken betrachteten die Zwerge am andern Morgen das Werk der Liebe, dann steckten sie die Köpfe zusammen. Krispin, der Schuster, nahm sein Felleisen auf den Rücken, scharrte mit dem Fuß und sprach seinen Scheidegruß. Dankend drückten ihm die Wichtlein die Hand, der aber, welcher ihn hierher geleitet, schulterte einen Sack und begleitete den Gast. »Ich will dich auf den rechten Weg bringen,« sagte er.
Als sie aus dem Hause traten, war die Welt in grauen Nebel gehüllt. Sie gingen eine Weile schweigend nebeneinander her, dann hielt der Zwerg an, löste das Band seines Rucksackes und entnahm demselben zwei alte Stiefel.
»Das soll dein Lohn sein,« sprach er zu dem Schuster. »Verachte das Geschenk nicht,« setzte er hinzu, als er sah, wie der Bursch den Mund verzog. »Die Stiefel sind ein Erbstück unseres Ahnherrn, des weltberühmten Däumling, von dem du sicherlich schon gehört hast.«
»Die Stiefel des kleinen Däumling?« rief der Schuster freudig aus, »die Siebenmeilenstiefel?«
»So ist es,« erwiderte der Zwerg. »Da nimm sie hin und brauche sie zu deinem Glück. Gehab dich wohl!«
Der Zwerg war verschwunden, der Nebel war plötzlich verweht, und Krispin stand auf der sonnbeglänzten, von Pappeln umsäumten Landstraße. In der Hand hielt er die Siebenmeilenstiefel.
»Das soll ein Leben werden!« jubelte er und setzte sich auf einen Steinhaufen, um die Wunderstiefel sogleich anzuziehen. »Nun marschiere ich zunächst ins Goldland,« sprach er zu sich selbst, »und fülle mir alle Taschen mit Goldsand, das Weitere wird sich dann finden.«
Schon hatte er sich seiner Wanderschuhe entledigt, da ließ er plötzlich die Arme sinken und sah nachdenklich vor sich nieder. »Wenn mir nur einer sagen wollte, in welcher Richtung das Goldland liegt.« Er reckte den Hals und drehte ihn hin und her, aber nirgends war ein buntgestreifter Wegweiser zu sehen, der mit dem Arm nach dem Goldland gezeigt hätte. Krispin kratzte sich hinter dem Ohr. »So aufs Geratewohl in die Welt hinein zu laufen,« philosophierte er, »das wäre töricht. Am Ende käm' ich, statt ins Goldland, zu den Menschenfressern. Und an Reisegeld fehlt mir's auch. Krispin, du warst drauf und dran einen dummen Streich zu machen. Es wird am besten sein, wenn ich mich in der nächsten Stadt nach Arbeit umsehe und mich nebenher auf meine große Reise gehörig vorbereite.«
Das war vernünftig gedacht. Er packte die Siebenmeilenstiefel auf sein Felleisen, schwang den knotigen Stock und wanderte wohlgemut weiter.
Es war ein sonniger Morgen. Auf den Wiesen, durch welche die Straße führte, schwangen die Mäher ihre Sensen, und Mägde mit roten Kopftüchern wandten das Heu mit dem Rechen.
»Demnächst ziehe ich durch die heißen Länder,« sprach der Schuster, »durch die Pflanzungen, wo die schwarzen Mohren Zuckerrohr schneiden und Kaffeebohnen von den Zwetschenbäumen schütteln. Ja, ihr alten Pappeln, ihr werdet mich nicht lange mehr zwischen euch wandern sehen. In ein paar Wochen gehe ich unter Palmen spazieren und schlage mir Kokosnüsse mit dem Stock ab, und statt der Sperlinge und Goldammern sitzen Papageien und Kakadus im Laub, und Affen und Meerkatzen werfen mir Kußhände zu. Kommt dann des Weges ein Löwe oder ein Tiger, der mich fressen will, eins, zwei, drei bin ich über alle Berge und lache die Bestie aus. Nein, so gut wie ich, hat's doch kein Mensch auf der Welt.«
Gegen Mittag kam der glückliche Schuster in die Stadt und fand sofort Arbeit. Von seinem ersten Lohn kaufte er sich bei einem Trödler eine Karte, auf der alle Länder der Erde dargestellt waren und dazu ein altes Buch, welches von seltsamen Reisen zu Wasser und zu Lande handelte. Wenn dann am Feierabend die anderen Gesellen in der Schenke zechten und tanzten, saß Krispin in seiner Kammer und studierte wie ein Magister.
Dem Meister aber gefiel des fleißigen Gesellen Tun und Treiben, und an einem Sonntagnachmittag lud er ihn zum Spaziergang ein. Das war eine große Ehre. Zu dritt zogen sie zum Tor hinaus; die dritte Person aber war Jungfer Anne, des Meisters schöne Tochter.
Am Abend desselbigen Tages saß Krispin nicht über seiner Landkarte, sondern er ging mit großen Schritten in der Kammer auf und ab, bis ihm sein schlafmüder Mitgesell mit barschen Worten das Nachtwandeln verwies. Da kroch auch Krispin unter sein Federbett In Deutschland bedeckt man sich mit einem Pfühl = Federbett., aber er konnte die ganze Nacht kein Auge zutun.
»Jetzt ist's Zeit, in die weite Welt zu ziehen,« sprach er und salbte die Siebenmeilenstiefel. »Ade Heimatland, ade Meister und du schöne – – – – – – – – Hier begann er zu schluchzen, daß es zum Erbarmen war. Als er sich etwas beruhigt hatte, packte er seine Habseligkeiten in das Felleisen, obendrauf die Landkarte, dann stieg er die Treppe hinunter, um sich von dem Meister zu verabschieden. »Wenn das geschehen ist,« sprach er zu sich, »so gehe ich vor das Tor, ziehe meine Siebenmeilenstiefel an, und am Abend kann ich bereits im Land der bezopften Chinesen Opium rauchen.«
Aber als der Abend gekommen war, saß er nicht im Chinesenland, sondern am Tisch zwischen seinem Meister und der schönen Anne. Er hielt ihre weiße Hand in seiner schwieligen Faust und nannte die Meisterstochter seine liebe Braut, und der Himmel hing den beiden Verlobten voll Baßgeigen. –
Aus der großen Weltreise konnte natürlich vor der Hand nichts werden, aber aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben. Der Gesell mußte sein Meisterstück machen, dann kam die Hochzeit, und das Jahr darauf stellte sich ein kleiner Schreihals ein. Wer denkt da ans Reisen?
Später sprach auch die Sorge in der Schusterwerkstatt vor. Die Zahl der Köpfe wuchs mit jedem Jahr, und Krispin mußte vom Morgen bis Abend die Hände rühren. Aber wenn er endlich sein Schurzfell abgelegt hatte, nahm er die Landkarte vor oder eine Reisebeschreibung. Die Siebenmeilenstiefel hütete er sorgfältig und erhielt das Leder durch fleißiges Salben geschmeidig.
Wenn der älteste Sohn herangewachsen ist, übergibt er ihm das Geschäft, und dann wird die lange aufgeschobene Wanderung angetreten. Geduld! –
Die Kinder wuchsen heran, und der älteste Sohn saß als junger Meister auf dem dreibeinigen Stuhl des Vaters. Aber jetzt galt es die Töchter an den Mann zu bringen und auszustatten, und die große Reise mußte wieder auf unbestimmte Zeit verschoben werden. Geduld Krispin, Geduld! –
Wieder verstrich eine Reihe von Jahren. Meister Krispin trug ein schwarzes Samtkäppchen auf dem kahlen Scheitel, und Frau Anne fing an von »der guten, alten Zeit« zu sprechen. Die Kinder waren versorgt und hielten die Eltern in Ehren. Sie hatten ihnen ein sonniges Stüblein hergerichtet, und dort saß der Alte den größten Teil des Tages im gepolsterten Großvaterstuhl und las in seinen Büchern.
An einem Sonntagnachmittag, als die runden Fensterscheiben in der Sonne blinkten, erhob sich Krispin von seinem Sitz und holte die Siebenmeilenstiefel aus der Truhe. Er hatte einen stärkenden Mittagsschlaf gehalten und fühlte sich so leicht wie zur Zeit seiner fröhlichen Wanderjahre. Jetzt wollte er endlich seine Weltreise antreten, weil er aber Einsprache befürchten mußte, so gedachte er sich ganz in der Stille fortzumachen und die Sache den Seinigen schriftlich mitzuteilen.
Als er abends nicht zu Tisch kam, sprach Frau Anne: »Er wird über seinen Büchern eingeschlafen sein,« und schickte das jüngste Enkelkind hinauf, um den Großvater zu wecken.
Plötzlich vernahmen die Zurückgebliebenen einen Schreckensruf, und als sie bestürzt in die Stube des Großvaters eilten, fanden sie ihn tot im Lehnstuhl sitzen. Auf dem Tisch aber stand mit Kreide geschrieben:
Ich habe die große Reise angetreten.
* * *
Und was ist aus dem Geschenk der Zwerge geworden? Ja, wenn ich das wüßte! Ich fürchte, der erbende Sohn hat die alten Stiefel zertrennt und das Leder zum Flicken schadhaften Schuhwerkes verwendet. Vielleicht liegen sie auch noch in einem Winkel und warten auf einen, der ihre Kraft zu nutzen weiß.
R. Baumbach.


 Es war schon spät in der Nacht. Auf den Straßen war es ganz still geworden, und der Wächter hatte die Laternen gelöscht. In dem großen, stattlichen Hause am Markt, wo die beiden steinernen Riesen an den Torpfeilern stehen und den großen Balkon mit dem sonderbar verschnörkelten, altmodischen Eisengeländer tragen, war nur das Eckzimmer neben dem kleinen Erker matt erleuchtet, und nur dann und wann sah man ein Licht wie ein Glühwürmchen die lange anstoßende Zimmerreihe durchirren, um bald wieder zu dem Eckzimmer zurückzukehren. So ging es schon seit acht Tagen.
Es war schon spät in der Nacht. Auf den Straßen war es ganz still geworden, und der Wächter hatte die Laternen gelöscht. In dem großen, stattlichen Hause am Markt, wo die beiden steinernen Riesen an den Torpfeilern stehen und den großen Balkon mit dem sonderbar verschnörkelten, altmodischen Eisengeländer tragen, war nur das Eckzimmer neben dem kleinen Erker matt erleuchtet, und nur dann und wann sah man ein Licht wie ein Glühwürmchen die lange anstoßende Zimmerreihe durchirren, um bald wieder zu dem Eckzimmer zurückzukehren. So ging es schon seit acht Tagen.
Die Nachbarn wußten alle, was es zu bedeuten hatte; denn wenn sie früh aufgestanden waren und vor die Haustür traten, oder die Köpfe zu den Fenstern hinaussteckten, um frische Luft zu schöpfen und sich guten Morgen zu wünschen, wie das in kleinen Städten der Brauch ist, fragte einer den andern regelmäßig: »Wie mag es wohl heute drüben bei Präsidentens gehen?« Meist zuckte der Gefragte dann mit den Achseln und antwortete: »Schlecht, schlecht! daß Gott erbarm!« vielleicht noch hinzusetzend: »Die alte Christel, als sie eben die Semmeln holte, hatte ganz dick verweinte Augen und sagte, es sei keine Hoffnung.«
Und dann erzählten sich die Leute, was sie sich schon hundertmal erzählt: wie die Tochter des Präsidenten, die ihrer aller Liebling war, vor vierzehn Tagen als glückselige Braut von einer Reise in die Schweiz zurückgekehrt sei, in den ersten Tagen noch allen Nachbarn freundlich aus dem Erker zugenickt habe und dann plötzlich hoffnungslos erkrankt sei.
Es ging aber heute abend wirklich ganz schlecht drüben; es ging zu Ende. Eben sah man wieder einen Lichtschein vom Eckzimmer, in dem die arme Kranke lag, ausgehn; dann wurde der alte geräumige Hausflur hell, und nicht lange, so trat der Präsident, ein Licht in der Hand, mit dem dicken freundlichen Doktor vor das Haustor. Sein weißes Haar flatterte in der nächtlichen Herbstluft, und die Kerze bestrahlte flackernd sein tiefbetrübtes Gesicht.
Er hielt die Hand des Doktors fest in die seinige gepreßt, als wolle er ihn nicht fortlassen, und lange standen beide so da. Dann zog der alte Herr den Doktor plötzlich an seine Brust, küßte ihn und ging langsam und gebeugten Hauptes wieder die große Steintreppe hinauf.
Er durchschritt die langen, öden Zimmerreihen mit den verdunkelten Ahnenbildern und den altertümlich geschnitzten Möbeln, sobald er sich dem Eckzimmer näherte, leise auf den Zehen schleichend; dann öffnete er vorsichtig und geräuschlos die Tür und stellte sich an das Kopfende des Bettes der Kranken. Neben ihr saß die alte Christel im Lehnstuhl und schluchzte. Sein Gesicht war jetzt grau und steinern wie das der Riesen am Tor, und er war wohl fast ebenso groß als sie, aber die Tränen rollten über seine bleichen Wangen und fielen auf das Kopfkissen.
Nach einer Weile schlug die Kranke die Augen auf und sah unruhig um sich, als wenn sie etwas suche.
»Was wünschst du, mein Kind, meine arme Marie?«
»Die Uhr, Vater!«
Von dem Tischchen neben dem Bett nahm der Präsident eine kleine goldene Uhr, an der eine Kette mit einem Medaillon hing, und hielt sie der Kranken unschlüssig hin.
»Auf!« flüsterte sie.
Er drückte die Feder des Medaillons auf. Es enthielt das Bild eines jungen Mannes. Aber die Kranke hatte die Augen schon wieder geschlossen, und langsam ließ der Vater die erhobene Hand mit Uhr und Medaillon wieder sinken.
Nach einigen Minuten machte das junge Mädchen abermals eine Bewegung mit ihrer blassen Hand und sagte leise: »Unter mein Kopfkissen!«
Die alte Christel bog das Kissen etwas zurück, legte die dunkeln Haare, die wirr herabfielen, der Kranken vorsichtig auf die Schultern, und der Präsident schob zögernd die Uhr an die verlangte Stelle.
Die Uhr tickte vernehmlich in der lautlosen Stille. Die Kranke atmete seufzend und unregelmäßig. Ihre weiße Brust, auf der die schwarzen Haare lagen, hob und senkte sich gewaltsam. Dann wurde sie wieder ruhiger und schien zu schlafen und zu träumen.
Doch sie lauschte ängstlich dem Ticken der Uhr. Es war ihr, als hörte sie sprechen. Feine Stimmen antworteten sich. Zuerst sehr leise, dann ganz verständlich. Aus der Uhr, unter dem Kopfkissen hervor, kamen die Stimmen:
»Lieber, bester Freund,« sagte der kleine Weiser zum großen, »willst du denn wirklich schon wieder gehen? du bist ja kaum gekommen. Ach, du läufst mir immer fort! Kaum auf Augenblicke kommst du noch nach Hause. Selbst zu Mittag läßt du dich kaum auf eine Minute sehen.«
»Herzensfrau,« antwortete der große Weiser, »du weißt, es geht nicht anders. Ich muß meinen Geschäften nachgehen, wie das einem Manne und Hausvater geziemt, und wie du im Hause deinen Geschäften nachgehst. Auch sehe ich ja jede Stunde des Tages einmal vor und schwatze mit dir.«
»Ach,« sagte der kleine Weiser, »du gibst mir immer wieder dieselbe Antwort. Die kann ich schon auswendig. Das hätte ich nicht gedacht, als wir noch in dem großen krystallhellen Laden in Genf waren, der hart am Quai liegt, und das Zifferblatt unserer Uhr gerade nach dem schönen blauen See gewandt war, und du und ich genau auf der Zwölf dicht übereinander standen. Da konnten wir miteinander schwatzen, soviel wir Lust hatten! Keinem Menschen fiel es ein, die Uhr aufzuziehen und uns fortwährend wie toll im Kreise herumzujagen, – und besonders dich, du armer Mann. Du mußt ja schon ganz außer Atem sein. Du wirst alle Tage magerer!«
»Ja, ja,« seufzte der große Weiser, »es waren schöne Zeiten! Wir sahen hinaus auf den Quai, wo die Leute spazieren gingen: wir sahen die Dampfschiffe ankommen und die Fremden aussteigen, und dann blickten wir wieder über die spiegelklare Fläche des Sees hinweg zu den schneebedeckten Bergen, und sahen ihre Spitzen im Abendrot funkeln.«
»Und als wir uns dann verheiratet,« nahm wieder der kleine Weiser das Wort, »war es anfangs noch ebenso schön; da bliebst du immer bei mir. Aber eines Tages, es sind heute gerade sechs Wochen, kam plötzlich ein junger, vornehmer Mann in den Laden und sagte zum Uhrmacher: »Zeigen Sie mir die schönsten goldenen Damenuhren, die Sie haben.«
Darauf setzte der Uhrmacher seine große Hornbrille auf, nahm eine Menge Uhren aus den Schränken und legte sie auf den Ladentisch. Der junge Herr besah sie alle hin und her und schien unschlüssig. Plötzlich ging der Uhrmacher ans Fenster und nahm auch unsere Uhr von ihrem Messinghäkchen. »Etwas ganz Feines, auf Ehre, Herr Baron!« sagte er französisch zu ihm.
»Die ist wirklich sehr hübsch,« entgegnete der junge Mann, indem er die Rückseite der Uhr betrachtete. »Da sind ja in Email die beiden Engel von der sixtinischen Madonna darauf. Das wird ihr Freude machen.«
Darauf ließ er an die Uhr eine goldene Kette knüpfen, nahm ein Medaillon aus der Tasche, hängte es an die Kette, zählte dem Uhrmacher eine große Menge Goldstücke auf den Tisch und ging.
Draußen am Quai aber waren unterdessen ein alter Herr und eine schöne junge Dame fortwährend auf und ab gegangen, und als der junge Mann endlich aus dem Laden heraustrat, gingen sie ihm entgegen. »Du bist ja recht lange geblieben, Konrad,« sagte das junge Mädchen, »und wolltest dir nur einen Uhrschlüssel für deinen verlorenen kaufen!«
Aber der junge Mann antwortete nicht und tat, als wenn er die Frage nicht gehört hätte. Er gab ihr den Arm und sie schlenderten eifrig schwatzend den See entlang. Als dann nach einer Weile der alte Herr ein klein wenig zurückgeblieben war, zog er die Uhr aus der Tasche und sagte: »Ein kleines Andenken an das schöne Genf, Marie, wo unsere glücklichen Herzen sich gefunden haben.« – –
Indem schlug die Rathausuhr auf dem Markt zwölf. Das arme kranke Mädchen seufzte tief auf und ließ den Kopf leise auf die Brust sinken. Der Präsident zuckte schmerzlich zusammen und beugte sich mit dem Ausdrucke der namenlosesten Angst über den Kopf seiner Tochter, lauschend, ob er vielleicht ihren Atem gehen, oder ihr Herz schlagen hören könne. Aber es war ganz still. Sie war tot.
Er kniete neben dem Bett nieder, nahm ihre kalte Hand und drückte sie an seine Lippen. So blieb er wohl eine halbe Stunde. Dann schüttelte er sich, wie einer, der friert, stand auf, strich der Toten die Haare glatt und rückte das Kopfkissen zurecht. Dabei glitt die Uhr ins Bett.
Er nahm sie auf, sah lange auf das Zifferblatt und sagte dann zur alten Christel, die unaufhörlich weinend immer noch auf dem Lehnstuhl saß:
»Um zwölf ist sie gestorben, und die Uhr ist gerade um zwölf stehen geblieben. Die beiden Weiser stehen genau aufeinander. Kein Mensch soll sie wieder aufziehen – wenigstens nicht, bis er kommt und ihre Sterbestunde auf ihr gelesen hat. Geh zu Bett, Christel, du hast viele Nächte nicht geschlafen; ich brauche dich nicht mehr. Gute Nacht!«
R. von Volkmann.
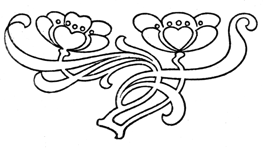

![]() Ich erinnere mich noch gar gut an jene Nacht. Ein dumpfer Knall, als wenn eine Tür zugeworfen wäre, weckte mich auf. Und dann klopfte jemand am Fenster und rief in die Stube herein: »Wer das Haus des kleinen Maxel brennen sehen will, der möge aufstehen und schauen gehen.«
Ich erinnere mich noch gar gut an jene Nacht. Ein dumpfer Knall, als wenn eine Tür zugeworfen wäre, weckte mich auf. Und dann klopfte jemand am Fenster und rief in die Stube herein: »Wer das Haus des kleinen Maxel brennen sehen will, der möge aufstehen und schauen gehen.«
Mein Vater sprang aus dem Bette, ich erhob ein Jammergeschrei und dachte fürs nächste daran, meine Kaninchen zu retten. Wenn bei besonderen Ereignissen wir anderen aus Rand und Band gerieten, so war es allemal die blinde Jula, unsere alte Magd, die uns beruhigte. So sagte sie auch jetzt: »Nicht unser Haus steht im Feuer, sondern das Haus des kleinen Maxel, das eine halbe Stunde weit von uns weg ist, und es ist auch nicht sicher, ob das Haus des kleinen Maxel brennt, vielleicht ist ein Spaßvogel vorbeigegangen, der uns die Lüge zum Fenster hereingeworfen; es ist sogar möglich, daß gar niemand hereingeschrieen hat, sondern das ist euch vielleicht nur so im Traume vorgekommen.«
Dabei zog sie mir das Höslein und die Schuhe an, und wir eilten vor das Haus, um zu sehen.
»Au weh!« rief mein Vater, »es ist schon alles hin.«
Über den Waldrücken im Tale herüber, der das Ober- und Unterland von einander scheidet, stieg still und hell die Flamme auf. Man hörte kein Knistern und Knattern, das schöne neue Haus, welches erst vor einigen Wochen fertig geworden war, brannte wie Öl. Die Luft war feucht, die Sterne des Himmels waren verdeckt; es murrte zuweilen ein Donner, aber das Gewitter verzog sich in die Gegend von Birkfeld.
»Ein Blitz« – so erzählte nun der Mann, der uns geweckt hatte, der Schaf-Gustel war's – »zuckte etlichemal hin- und her, beschrieb ein Trudenkreuz an dem Himmel und fuhr dann niederwärts. Er erlosch aber nicht mehr, der lichte Punkt an seinem untern Ende blieb und wuchs rasch, und da habe ich gleich gedacht: Schau du, jetzt hat's den kleinen Maxel getroffen.«
»Wir müssen doch schauen gehen, ob wir was helfen können,« sagte mein Vater.
»Helfen willst du da?« versetzte der andere, »wo der Donnerkeil dreinfährt, da rühre ich keine Hand mehr. Der Mensch soll unserm Herrgott nicht entgegenarbeiten, und wenn der einmal einen Blitz aufs Haus wirft, so wird er auch wollen, daß es brennen soll. Außerdem mußt du wissen, daß so ein Eingeschlagenes auch garnicht zu löschen ist.«
»Deine Dummheit auch nicht,« rief mein Vater, und zornig, wie ich ihn noch selten gesehen hatte, schrie er dem Gustel ins Gesicht: »Du bist blitzdumm!«
Er ließ ihn stehen und führte mich an seiner Hand rasch davon. Wir stiegen ins Tal hinab und gingen am Fresenbach entlang, wo wir das Feuer nicht mehr sehen konnten, sondern nur die Röte in den Wolken. Mein Vater trug einen Wassereimer bei sich, und ich riet, daß er denselben gleich am Bache füllen solle. Der Vater hörte gar nicht darauf, sondern sagte mehrmals vor sich hin: »Maxel, aber daß dich jetzt das treffen mußte!«
Ich kannte den kleinen Maxel recht gut. Es war ein behendiges, heiteres Männlein, etwa in den Vierzigern; sein Gesicht war voll Blatternarben, und seine Hände waren braun und rauh wie die Rinden der Waldbäume. Er war seit meinem Gedenken Holzhauer in Waldbach.
»Wenn einem andern das Haus niederbrennt,« sagte mein Vater, »na, so brennt ihm das Haus nieder«.
»Ist's beim kleinen Maxel nicht so?« fragte ich.
»Dem brennt alles nieder. Alles, was er gestern gehabt hat und heute hat und morgen hätte haben können.«
»So hat der Blitz den Maxel vielleicht selber erschlagen?«
»Das wäre das beste, Bube. Ich vergönn ihm das Leben, ich vergönn es ihm, – aber, wenn er vorher hätte beichten mögen, wollte ich gleich sagen, das allerbeste wäre, wenn's ihn auch selber getroffen hätte.«
»Da wäre er jetzt schon im Himmel oben,« sagte ich.
»Watschsle nur nicht so ins nasse Gras hinein. Geh näher hinter mir her und halte dich bei mir an. Von Maxel, von dem will ich jetzt dir was sagen.«
Der Weg ging sanft bergan, und mein Vater erzählte.
»Jetzt könnens dreißig Jahre um sein – da ist der Maxel ins Land gekommen. Armer Leute Kind. Die erste Zeit war er bei den Bauern herum ein Hirtenbube, nachher, wie er erwachsen war, ging er in den Holzschlag. Ein rechtschaffener Arbeiter war er und immer fleißig und sparsam. Wie er Vorarbeiter wurde, da hat er sich von dem Waldherrn das Sauerwiesel auf der Höhe ausgebeten. Das wurde ihm gern zugesagt, und der Maxel ging alle Tage, wenn sie im Holzschlag Feierabend gemacht hatten, auf sein Sauerwiesel, schlug die Stubben weg, zog Gräben, grub Steine aus, verbrannte die Wurzeln des Unkrautes – und in zwei Jahren legte er das ganze Sauergütel trocken. Es wuchs gutes Gras darauf und ein kleines Stück Korn baute er an. Wie es so weit gekommen war, probierte er auch mit Kohlkraut und sah, wie gut es den Hasen schmeckte, da kam er um Waldbäume ein. Die konnten sie ihm nicht schenken wie das Sauerwiesel, die mußte er abdienen.
Den Arbeitslohn ließ er dafür ein, fällte die Bäume, hackte sie viereckig und schnitt sie zu Zimmerholz ab – alles an den Feierabenden, wenn die anderen Holzknechte lange schon auf dem Bauch lagen und ihre Pfeifen Tabak rauchten. Und nachher fing er an, an solchen Feierabenden andere Holzhauer zu bezahlen, daß sie ihm bei den Arbeiten helfen, die ein einziger Mensch nicht machen kann, und so hat er auf dem Sauerwiesel sein Haus gebaut. Fünf Jahre lang hat er daran gearbeitet, aber nachher – du weißt ja selber, wie es dastand mit den goldroten Wänden, mit den hellen Fenstern und der Zierat auf dem Dache – war es schier vornehm anzuschauen. Ein feines Gütel ist es auf der Sauerwiese geworden, und wie lange wird es denn her sein, daß uns unser Pfarrer bei der Christenlehre den kleinen Maxel als ein Beispiel des Fleißes und der Arbeitsamkeit aufgestellt hat? Nächsten Monat wollte er heiraten; und daß er vom Waisenbuben bis zum braven Hausbesitzer und Hausvater herauf gestiegen ist – Bube, da ziehe dein Hütel! – Und jetzt ist auf einmal alles hin. Der ganze Fleiß und alle Arbeit die vielen Jahre her ist umsonst. Der Maxel steht wieder auf demselben Fleck wie vorher.«
Ich bezog damals meine Frömmigkeit noch aus der Bibel und so entgegnete ich auf des Vaters Erzählung: »Der Himmelsvater hat den Maxel gestraft, daß er so aufs Zeitliche gegangen ist wie die Heiden, und hat sich vielleicht ums Ewige zu wenig gesorgt. Seht die Vöglein in den Lüften, sie säen nicht, sie ernten nicht –«
»Sei still!« unterbrach mich der Vater unwirsch, »der das gesagt hat, ist der König Salomo gewesen, der konnte so etwas schon sagen. Unsereiner sollt's probieren! – Das sage ich, wenn's mir so geht, wie dem kleinen Maxel, dann bin ich verzagt und hebe an zu faulenzen. Wenn ein Mensch mit dem Zündholz in ein Strohdach fährt, so wird er ins Gefängnis gesteckt – ist auch recht, gehört ihm nichts anderes. Aber wenn einer –«
Er unterbrach sich. Wir standen auf der Anhöhe, und vor uns loderte die Wirtschaft des kleinen Maxel, und das Haus brach eben in seinen Flammen zusammen. Mehrere Leute waren mit Hacken und Wassereimern da, aber es war nichts zu machen, als dazustehen und zuzuschauen, wie die letzten Kohlenbrände in sich einstürzten.
Das Feuer war nicht wütend, es brüllte nicht, es krachte nicht, es fuhr nicht wild in der Luft herum; das ganze Haus war eine Flamme, und die qualmte heiß und weich zum Himmel auf, von wannen sie gekommen.
Eine kleine Strecke vom Brande war der Steinhaufen, auf welchen Maxel die Steine der Sauerwiese zusammengetragen hatte. An demselben saß er nun, der kleine braune, blatternarbige Maxel und sah auf die Glut hin, deren Hitze auf ihn herströmte. Er war halb angekleidet, hatte seinen schwarzen Sonntagsmantel, das einzige, was er gerettet, über sich gehüllt!
Die Leute traten nicht zu ihm; mein Vater wollte ihm gern ein Wort der Teilnahme und des Trostes sagen, aber er getraute sich auch nicht zu ihm. Der Maxel lehnte so da, daß wir meinten, jetzt müsse er aufspringen und einen schrecklichen Fluch zum Himmel stoßen und sich dann in die Flammen stürzen.
Und endlich, als das Feuer nur mehr auf dem Erdengrund herumleckte und aus der Asche die kahle Mauer des Herdes aufstarrte, erhob sich der Maxel. Er schritt zur Glut hin, hob eine Kohle auf und zündete sich die Pfeife an.
Ich war damals noch klein und konnte nicht viel denken. Aber daran erinnere ich mich: Als ich in der Morgendämmerung den kleinen Maxel vor seiner Brandstätte stehen sah, und wie er den blauen Rauch aus der Pfeife sog und von sich blies, da war mir in meiner Brust plötzlich heiß. Als ob ich es fühlte, wie mächtig der Mensch ist, um wie viel größer als sein Schicksal, und daß es für das Verhängnis keinen größeren Schimpf gibt, als wenn man ihm in aller Seelenruhe Tabaksrauch in die Larve bläst.
Und als die Pfeife brannte, setzte er sich wieder auf den Steinhaufen und blickte in die Gegend hinaus. Was er gedacht hat, das möchtet ihr wissen? Ich auch.
Später durchwühlte der kleine Maxel die Asche seines Hauses und zog aus derselbe sein Schlagbeil hervor. Er schaftete einen neuen Stiel an, machte es an einem Schleifsteine der Nachbarschaft wieder scharf – und ging an die Arbeit. Seither sind viele Jahre vorbei: Um die Sauerwiese liegen heute schöne Felder, und auf der Brandstätte steht ein neugegründeter Hof. Junges Volk belebt ihn, und der Hausvater, der kleine Maxel, lehrt seine Söhne das Arbeiten und die Tapferkeit des. Herzens, wenn es darauf ankommt.
P. Rosegger.

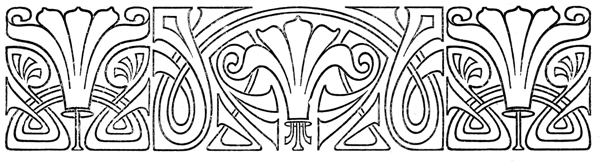
 Es war um die Zeit, wo die Erde am allerschönsten ist und es dem Menschen am schwersten fällt zu sterben, denn der Flieder blühte schon, und die Rosen hatten dicke Knospen: da zogen zwei Wandrer die Himmelsstraße entlang, ein Armer und ein Reicher, Die hatten auf Erden dicht bei einander in derselben Straße gewohnt, der Reiche in einem großen, prächtigen Hause und der Arme in einer kleinen Hütte. Weil aber der Tod keinen Unterschied macht, so war es geschehen, daß sie beide zu derselben Stunde starben.
Es war um die Zeit, wo die Erde am allerschönsten ist und es dem Menschen am schwersten fällt zu sterben, denn der Flieder blühte schon, und die Rosen hatten dicke Knospen: da zogen zwei Wandrer die Himmelsstraße entlang, ein Armer und ein Reicher, Die hatten auf Erden dicht bei einander in derselben Straße gewohnt, der Reiche in einem großen, prächtigen Hause und der Arme in einer kleinen Hütte. Weil aber der Tod keinen Unterschied macht, so war es geschehen, daß sie beide zu derselben Stunde starben.
Da waren sie nun auf der Himmelsstraße auch wieder zusammengekommen und gingen schweigend nebeneinander her.
Doch der Weg wurde steiler und steiler, und dem Reichen begann es bald blutsauer zu werden, denn er war dick und kurzatmig und in seinem Leben noch nie so weit gegangen. Da trug es sich zu, daß der Arme bald einen guten Vorsprung gewann und zuerst an der Himmelspforte ankam. Weil er sich aber nicht getraute anzuklopfen setzte er sich still vor der Pforte nieder und dachte: »Du willst auf den reichen Mann warten; vielleicht klopft der an.«
Nach langer Zeit langte der Reiche auch an, und als er die Pforte verschlossen fand und nicht gleich jemand aufmachte, fing er laut an zu rütteln und mit der Faust daran zu schlagen. Da stürzte Petrus eilends herbei, öffnete die Pforte, sah sich die beiden an und sagte zu dem Reichen: »Das bist du gewiß gewesen, der es nicht erwarten konnte. Ich dächte, du brauchtest dich nicht so breit zu machen. Viel Gescheites haben wir hier oben von dir nicht gehört, solange du auf der Erde gelebt hast!«
Da fiel dem Reichen gewaltig der Mut; doch Petrus, kümmerte sich nicht weiter um ihn, sondern reichte dem Armen die Hand, damit er leichter aufstehen könnte, und sagte: »Tretet nur alle beide in den Vorsaal ein; das Weitere wird sich schon finden!«
Und es war auch wirklich noch gar nicht der Himmel, in den sie jetzt eintraten, sondern nur eine große, weite Halle mit vielen verschlossenen Türen und mit Bänken an den Wänden.
»Ruht euch ein wenig aus,« nahm Petrus wieder das Wort, »und wartet bis ich zurückkomme; aber benutzt eure Zeit gut, denn ihr sollt euch mittlerweile überlegen, wie ihr es hier oben haben wollt. Jeder von euch soll es genau so haben, wie er sich es selber wünscht. Also bedenkt's, und wenn ich wiederkomme, macht keine Umstände, sondern sagt's und vergeßt nichts; denn nachher ist's zu spät.« –
Damit ging er fort. Als er dann nach einiger Zeit zurückkehrte und fragte, ob sie mit dem Überlegen fertig wären, und wie sie es sich in der Ewigkeit wünschten, sprang der reiche Mann von der Bank auf und sagte, er wolle ein großes, goldenes Schloß haben, so schön wie der Kaiser keins hätte und jeden Tag das beste Essen. Früh Chokolade und mittags einen Tag um den andern Kalbsbraten mit Apfelmus und Milchreis mit Bratwürsten und nachher rote Grütze. Das wären seine Leibgerichte. Und abends jeden Tag etwas anderes. Weiter wolle er dann einen recht schönen Großvaterstuhl und einen grünseidenen Schlafrock; und das Tageblättchen solle Petrus auch nicht vergessen, damit er doch wisse, was passiere.
Da sah ihn Petrus mitleidig an, schwieg lange und fragte endlich: »Und weiter wünschst du dir nichts?« – »O ja!« fiel rasch der Reiche ein, »Geld, viel Geld, alle Keller voll; so viel, daß man es gar nicht zählen kann!«
»Das sollst du alles haben,« entgegnete Petrus, »komm, folge mir!« und er öffnete eine der vielen Türen und führte den Reichen in ein prachtvolles, goldenes Schloß, darin war alles so, wie jener es sich gewünscht hatte. Nachdem er ihm alles gezeigt, ging er fort und schob vor das Tor des Schlosses einen großen eisernen Riegel. Der Reiche aber zog sich den grünseidenen Schlafrock an, setzte sich in den Großvaterstuhl, aß und trank und ließ sich's gut gehen, und wenn er satt war, las er das Tageblättchen. Und jeden Tag einmal stieg er hinab in den Keller und besah sein Geld. – –
Und zwanzig und fünfzig Jahre vergingen und wieder fünfzig, so daß es hundert waren – und das ist doch nur eine Spanne von der Ewigkeit – da hatte der reiche Mann sein prächtiges, goldenes Schloß schon so überdrüssig, daß er es kaum mehr aushalten konnte. »Der Kalbsbraten und die Bratwürste werden auch immer schlechter,« sagte er, »sie sind gar nicht mehr zu genießen!« Aber es war nicht wahr, sondern er hatte sie nur satt. »Und das Tageblättchen lese ich schon lange nicht mehr,« fuhr er fort; »es ist mir ganz gleichgültig, was da unten auf der Erde sich zuträgt. Ich kenne ja keinen einzigen Menschen mehr. Meine Bekannten sind schon längst alle gestorben. Die Menschen, die jetzt leben müssen, machen so närrische Streiche und schwatzen so sonderbares Zeug, daß es einem schwindlig wird, wenn man's liest.« Darauf schwieg er und gähnte, denn es war sehr langweilig, und nach einer Weile sagte er wieder:
»Mit meinem vielen Gelde weiß ich auch nichts anzufangen. Wozu hab' ich's eigentlich? Man kann sich hier doch nichts kaufen. Wie ein Mensch nur so dumm sein kann und sich Geld im Himmel wünschen!« Dann stand er auf, öffnete das Fenster und sah hinaus.
Aber obschon es in dem Schlosse überall hell war, so war es doch draußen dunkel, stockdunkel, so daß man die Hand vorm Auge nicht sehen konnte, stockdunkel, Tag und Nacht, jahraus jahrein und so still wie auf dem Kirchhof. Da schloß er das Fenster wieder und setzte sich aufs neue in seinen Großvaterstuhl; und jeden Tag stand er ein- oder zweimal auf und sah wieder hinaus. Aber es war noch immer so. Und immer früh Chokolade und mittags einen Tag um den andern Kalbsbraten mit Apfelmus und Milchreis mit Bratwürsten und nachher rote Grütze; immerzu, immerzu, einen Tag wie den andern. –
Als jedoch tausend Jahre vergangen waren, klirrte der große eiserne Riegel am Tor und Petrus trat ein. »Nun,« fragte er, »wie gefällt es dir?«
Da wurde der reiche Mann bitterböse: »Wie mir's gefällt? Schlecht gefällt mir's; ganz schlecht! So schlecht wie es einem nur in so einem nichtswürdigen Schlosse gefallen kann! Wie kannst du dir nur denken, daß man es hier tausend Jahre aushalten kann! Man hört nichts man sieht nichts! niemand bekümmert sich um einen. Ist das euer vielgepriesener Himmel und die ewige Glückseligkeit? Eine ganz erbärmliche Einrichtung ist es.«
Da blickte ihn Petrus verwundert an und sagte: »Du weißt wohl gar nicht, wo du bist? Du denkst wohl du bist im Himmel? In der Hölle bist du. Du hast dich ja selbst in die Hölle gewünscht. Das Schloß gehört zur Hölle.«
»Zur Hölle?« wiederholte der Reiche erschrocken. »Das hier ist doch nicht die Hölle? Wo sind denn der Teufel und das Feuer und die Kessel?« »Du meinst wohl,« entgegnete Petrus, »daß die Sünder jetzt immer noch gebraten werden wie früher? Das ist schon lange nicht mehr so!«
»In der Hölle bist du, verlaß dich darauf, und zwar recht tief drin, so daß du einen schon dauern kannst. Mit der Zeit wirst du's wohl selbst inne werden.«
Da fiel der reiche Mann entsetzt rückwärts in seinen Großvaterstuhl, hielt sich die Hände vors Gesicht und schluchzte: »In der Hölle, in der Hölle! Ich armer, unglücklicher Mensch, was soll aus mir werden?«
Aber Petrus machte die Tür auf und ging fort, und als er den eisernen Riegel draußen wieder vorschob, hörte er drinnen den Reichen immer noch schluchzen: »In der Hölle, in der Hölle! Ich armer, unglücklicher Mensch, was soll aus mir werden?« –
Und wieder vergingen hundert Jahre und aber hundert, und die Zeit wurde dem reichen Manne so entsetzlich lang, wie niemand es sich auch nur denken kann. Und als das zweite Tausend zu Ende kam, trat Petrus abermals ein.
»Ach!« rief ihm der reiche Mann entgegen, »ich habe mich so sehr nach dir gesehnt! Ich bin sehr traurig! Und so wie jetzt, soll es immer bleiben? die ganze Ewigkeit? Und nach einer Weile fuhr er fort: »Heiliger Petrus, wie lang ist wohl die Ewigkeit?«
Da antwortete Petrus: »Wenn noch zehntausend Jahre vergangen sind, fängt sie an.«
Als der Reiche dies gehört, ließ er den Kopf auf die Brust sinken und begann bitterlich zu weinen. Aber Petrus stand hinter seinem Stuhl und zählte heimlich seine Tränen, und als er sah, daß es so viele waren, daß ihm der liebe Gott gewiß verzeihen würde, sprach er: »Komm, ich will dir einmal etwas recht Schönes zeigen! Oben auf dem Boden weiß ich ein Astloch in der Wand, da kann man ein wenig in den Himmel hineinsehen.«
Damit führte er ihn die Bodentreppe hinauf und durch allerhand Gerümpel bis zu einer kleinen Kammer. Als sie in diese ein traten, fiel durch das Astloch ein goldener Strahl hindurch dem heiligen Petrus gerade auf die Stirn, so daß es aussah, als wenn Feuerflammen auf ihr brenneten.
»Das ist vom wirklichen Himmel!« sagte der reiche Mann zitternd.
»Ja,« erwiderte Petrus, »nun sieh einmal durch!«
Aber das Astloch war etwas hoch oben an der Wand und der reiche Mann war nicht sehr groß, so daß er kaum hinaufreichte.
»Du mußt dich recht lang machen und ganz hoch auf die Zehen stellen,« sagte Petrus. Da strengte sich der Reiche so sehr an, als er nur irgend konnte, und als er endlich durch das Astloch hindurch blickte, sah er wirklich in den Himmel hinein. Da saß der liebe Gott auf seinem goldenen Thron zwischen den Wolken und den Sternen in seiner ganzen Pracht und Herrlichkeit und um ihn her alle Engel und Heiligen.
»Ach,« rief er aus, »das ist ja so wunderbar schön und herrlich, wie man es auf der Erde gar nicht vorstellen kann. Aber sage, wer ist denn das, der dem lieben Gott zu Füßen sitzt und mir gerade den Rücken zukehrt?«
»Das ist der arme Mann, der auf der Erde neben dir gewohnt hat, und mit dem du zusammen herauf gekommen bist. Als ich euch auftrug, es euch auszudenken, wie ihr es in der Ewigkeit haben wolltet, hat er sich bloß ein Fußbänkchen gewünscht, damit er sich dem lieben Gott zu Füßen setzen könne. Und das hat er auch bekommen, genau so, wie du dein Schloß.« –
Als er dies gesagt, ging er still fort, ohne daß es der Reiche merkte. Denn der stand immer noch ganz still auf den Fußspitzen und blickte in den Himmel hinein und konnte sich nicht satt sehen. Zwar fiel es ihm recht schwer, denn das Loch war sehr hoch oben, und er mußte fortwährend auf den Zehen stehen; aber er tat es gern, denn es war zu schön, was er sah.
Und nach abermals tausend Jahren kam Petrus zum letzten Mal. Da stand der reiche Mann immer noch in der Bodenkammer an der Wand auf den Fußspitzen und schaute unverwandt in den Himmel hinein, und war so ins Sehen versunken, daß er gar nichts merkte, als Petrus eintrat.
Endlich legte ihm aber Petrus die Hand auf die Schulter, daß er sich umdrehte, und sagte:
»Komm mit, du hast nun lange genug gestanden! Deine Sünden sind dir vergeben; ich soll dich in den Himmel holen. – Nicht wahr, du hättest es viel bequemer haben können, wenn du gewollt hättest?« – –
R. von Volkmann.

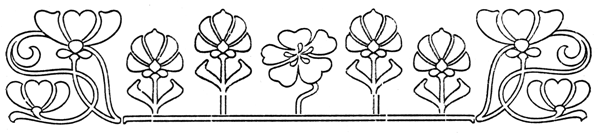
 Es stand im Wald eine alte Buche. Ihren Wipfel hatte der Blitz zerschmettert, ihre Seite war hohl, und große Schwämme wuchsen auf ihrer Rinde. Sie war die Urahne eines zahlreichen Geschlechts, aber sie hatte alle ihre Kinder, sobald sie erstarkt waren, unter den Streichen der Holzaxt fallen gesehen, und nur eine Tochter war ihr geblieben. Das war eine junge Buche mit glatter Rinde und himmelanstrebender Krone und erst achtzig Jahre alt. Das sind bei den Waldbäumen die sogenannten besten Jahre.
Es stand im Wald eine alte Buche. Ihren Wipfel hatte der Blitz zerschmettert, ihre Seite war hohl, und große Schwämme wuchsen auf ihrer Rinde. Sie war die Urahne eines zahlreichen Geschlechts, aber sie hatte alle ihre Kinder, sobald sie erstarkt waren, unter den Streichen der Holzaxt fallen gesehen, und nur eine Tochter war ihr geblieben. Das war eine junge Buche mit glatter Rinde und himmelanstrebender Krone und erst achtzig Jahre alt. Das sind bei den Waldbäumen die sogenannten besten Jahre.
Die alte Buche trieb noch in jedem Frühling Blätter und Sprossen, aber sie fühlte, daß es mit ihrem Leben auf die Neige ging, denn sie hielt sich nur noch mit Mühe aufrecht. Und weil sie wußte, daß sie sterben müsse, so verdoppelte sie ihre Liebe zu der schönen Riesentochter.
Der Frühling war im Anzug. Noch lag glitzerndes Weiß auf den Zweigen der Bäume, aber von den Wurzeln herauf quoll es wärmend, und laue Luft half von außen und leckte am Schnee. Auf den Flüssen und Bächen trieben knirschende Eisschollen, die Weide ließ ihre silbernen Kätzchen aus den Hüllen schlüpfen, und die weißen Glöckchen durchbrachen die unterwaschene Schneedecke des Waldbodens.
Da sprach die alte Buche zu der jungen: »Heute nacht kommt der ungestüme Tauwind. Er wird mich auf das Blätterlager strecken, das ich mir im Lauf der Zeit aufgeschüttet habe. Doch bevor ich heimgehe, will ich eine Gabe auf dich vererben, die mir der milde Herr der Wälder verlieben hat, als er einst vor langer Zeit auf seinem Segensgang in meinem Schatten Rast hielt. Du sollst der Menschen Reden und Tun verstehen und Anteil nehmen an ihren Freuden und Leiden. Das ist die höchste Gnade, die unsereinem zuteil werden kann. Aber sei gefaßt mehr Leid als Glück zu schauen.« – So sprach die alte Buche und segnete ihre Tochter.
In der Nacht kam der Tauwind aus der Wüste herangefahren. Er begrub Schiffe in den Wogen des Meeres, rollte riesige Schneebälle von den Bergen herab und zerstörte der Menschen Hütten im Vorüberziehen. Brausend flog er durch die Wälder und knickte, was alt und morsch war, oder was sich seiner Macht trotzig entgegenstemmte. Er streckte die alte Buche zu Boden und rüttelte an ihrer starken Tochter, aber die Kluge neigte und beugte ihr Haupt, und der Gewaltige zog vorüber. Drei Tage weinte die Tochter um die Mutter funkelnden Tau. Dann kam die Sonne und trocknete ihr die Tränen.
Und nun begann allenthalben ein Treiben und Sprossen, daß der Buche keine Zeit zum Trauern blieb. Ihre Knospen schwollen und sprangen, und eines Morgens zitterten hunderttausend zartgrüne Blättlein im wärmenden Sonnenstrahl. Das war eine Freude!
Goldgelbe Schlüsselblumen stiegen aus der Erde. Sie nahmen sich nicht einmal Zeit die welken Blätter beiseite zu schieben; sie durchbohrten sie und hoben sie noch einmal zum Sonnenlicht empor. Rotblaue Erbsen gesellten sich zu den Primeln, und der duftende Waldmeister entwickelte seine zarten Blattquirle. Das war ein Leben!
Und inmitten des blühenden Lebens stand die junge Buche wie eine Königin. Ein Fink hatte sein Nest in ihre Krone gebaut, und der Specht mit der roten Kappe stattete ihr Besuche ab. Einmal kam auch der Kuckuck, ja sogar das vornehme Eichhorn mit den Federbüschen auf dem Kopf fand sich hin und wieder ein, obwohl ihm die lenzgrüne Buche nicht mit Eckern aufwarten konnte. Aber Menschen hatte sie in diesem Jahr noch nicht gesehen, und das wären ihr die liebsten Gäste gewesen, weil sie die Gabe besaß, ihr Reden und Tun zu verstehen.
Die Menschen blieben nicht aus. Eines Morgens kam eine junge, schlanke Dirne mit langen, braunen Zöpfen durch den Wald geschritten und geradeswegs auf die Buche zu. Es hatte aber nicht den Anschein, als gelte ihr Besuch dieser. Sie betrachtete den vermodernden Baum am Boden und sprach: »Hier ist die Stelle«. Dann setzte sie ihren Korb, der mit Maiblumen gefüllt war, auf die Erde und lehnte sich an die Buche, ohne deren grüner Herrlichkeit einen Blick zu schenken. Der Baum hielt den Atem an, um etwas von der Rede des Mädchens zu vernehmen, aber die Schöne schwieg beharrlich.
Da kam von der entgegengesetzten Seite ein junger, stattlicher Bursch des Weges. Er trug ein rundes Hütlein mit einer krummen Feder wie die Jägersleute. Vorsichtig kam er herangeschlichen, so vorsichtig, daß nicht einmal die dürren Blätter unter seinen Tritten raschelten. Aber so leise er auch auftrat, das scharfe Ohr des Mädchens vernahm sein Kommen doch. Sie wandte den Kopf nach ihm, und die Buche dachte: jetzt wird sie flüchten, aber die Dirne floh nicht, sie sprang vielmehr dem Burschen entgegen und schlang ihre Arme um seinen braunen Hals.
»Mein Hans! – Meine Eva!« riefen sie gleichzeitig. Dann setzten sie sich unter den Baum und sprachen von ihrer Liebe. Der Buche war das alles neu, und sie horchte wie ein Kind, dem man ein Märchen erzählt. Es kam aber noch eine besondere Überraschung.
Der Bursch erhob sich vom Boden, zog sein Messer und begann in die Rinde des Stammes Einschnitte zu machen. Es tat zwar etwas weh, aber der Baum hielt still wie eine Mauer.
»Was soll das werden?« fragte das Mädchen.
»Ein Herz mit deinem und meinem Namen,« antwortete Hans und schnitt weiter.
Als das Werk fertig war, betrachteten es beide wohlgefällig, und der Buche war es zu Mute wie einem, dem der König eine goldene Gnadenkette umgehängt hat. – »Die Menschen sind doch prächtige Leute!« dachte sie.
Jetzt hob der Bursch zu singen an. Die Lieder der Finken und der Amseln kannte die Buche längst auswendig; nun bekam sie etwas zu hören, das klang ganz verschieden von Vogelgesang. Das Lied lautete aber so:
Ich schritt durchs Waldgehege
Auf unbetretnem Wege.
Die Mailuft wehte mild. –
Ich ließ die Hirschlein grasen
Und springen Reh' und Hasen.
Mich lockt ein seltnes Edelwild.
Nicht braucht ich lang zu suchen.
An einer grünen Buchen
Fand ich mein Liebchen stehn.
Sie tat mich fest umfangen,
Ich küßt' ihr Mund und Wangen,
Und um den Jäger wars gescheh'n.
Ein Herze will ich schneiden
Mit unsren Namen beiden
Dem Baum ins Rindenkleid,
Das soll in späten Tagen
Dem Wandrer Kunde sagen
Von mein' und deiner Seligkeit.
Höre Hans!« sprach das Mädchen, als der Bursch geendigt hatte. »Dein Lied gemahnt mich an etwas. Ich weiß – – die Leute sagen's, daß du im Herbst heimlich in den Forsten dem Wild nachgehst. Laß das Jagen sein! Der Jäger ist dir ohnehin nicht grün Der Jäger (= der Förster) liebte auch Eva und war auf Hans eifersüchtig. – – du weißt warum. Und trifft er dich als Wilderer im Wald – – dann – – Herrgott, mein Hans, wenn sie dich einst getragen brächten mit durchschossener Brust – –«
Der Bursch beugte sich nieder zu der Dirne, die sich schmeichelnd an seine Schulter lehnte, und küßte sie auf den Mund. »Die Leute reden vieles. Glaube nicht alles, was die Leute sagen, mein liebes Herzgespiel!« Dann schlang er seinen Arm um sie und schritt singend mit ihr in den Wald hinein.
Als das Paar hinter den Bäumen verschwunden war, tauchte aus den Büschen ein Mann im Jagdgewand, die Kugelbüchse auf dem Rücken, das Weidmesser an der linken Seite. Sein Gesicht war bleich und verzerrt. Er ging auf die Buche zu und betrachtete das Herz, welches Hans in die Rinde geschnitten hatte. Er lachte wild auf und zog sein Messer, um die Schrift zu vernichten, aber er besann sich anders und stieß die Klinge in die Scheide zurück. Drohend schüttelte er die Faust nach der Richtung hin, welche die Liebenden genommen hatten, und mit Zähneknirschen sprach er:
»Treff' ich dich Raubschützen einmal auf der Wildbahn, so hast du den Kuckuck zum letztenmal rufen gehört!«
Mit diesen Worten ging er ins Holz, und der Baum schüttelte unwillig sein Haupt.
* * *
Die Buche bekam im Lauf des Sommers noch manches Menschenkind zu Gesicht, arme Weiber, die Laub oder dürre Reiser sammelten, Kinder, die Beeren lasen, Weidleute und Wanderer. Am liebsten aber sah sie als Gäste unter ihrem Schattendach den Burschen und das braungezöpfte Mädchen. Die kamen allwöchentlich einmal, sprachen von ihrer Liebe, und die Buche gewann die beiden von Tag zu Tag lieber.
Eines Morgens vor Sonnenaufgang, als der Bergwald noch seine graue Nebelkappe aufhatte, kam Hans allein. Er trug am Riemen ein Feuerrohr und schritt leise durch das Unterholz, leise wie damals, als er seine Traute überraschen wollte. Diesmal aber galt sein Kommen nicht der schönen Eva, sondern dem Hirsch, der hier seinen Wechsel Wechsel = der Pfad, den die Hirsche und Rehe täglich zur Äsung und Tränke hin und zurück benutzen. (Die Äsung – [Russisch]). hatte. Am Fuß der Buche machte der Bursch Halt und stand regungslos, als wäre er selbst ein Baum. Der kühle Morgenwind kam, und der Nebel zog sich in Streifen tiefer. Die Vögel wurden munter und flogen nach der Tränke. Im Unterholz des Waldes regte es sich, und Hans hob sein Gewehr.
Da fiel aus dem Dickicht ein Schuß. Hans ließ die Büchse sinken, tat einen Sprung in die Höhe und stürzte dann zu Boden.
Aus dem Wald kam mit hastigen Sätzen ein Mann, das rauchende Rohr in der Linken tragend. Die Buche kannte ihn wohl.
Der Jäger beugte sich über den Gefallenen. »Es ist aus mit ihm,« sagte er. Dann lud er seine Büchse und verschwand im Dickicht.
Die Sonne ging auf und schien einem stillen Mann in das blasse Antlitz. Trauernd neigte der Baum seine Zweige und weinte helle Tränen. Das Rotkehlchen flatterte heran und trug dem Toten Blumen auf das Gesicht, bis die starren Augen zugedeckt waren.
Am Nachmittag kamen Holzfäller des Weges und fanden den Leichnam.
»Er ist beim Wildern erschossen worden,« sagten sie. Dann hoben sie ihn auf und trugen ihn ins Tal hinunter.
Ein alter Mann verweilte noch bei dem Baum. Er zog sein Messer und grub ein Kreuz in die Rinde. Das kam grade über das Herz zu stehen. Dann nahm er seinen Hut ab und sprach ein Gebet.
In der Krone der Buche rauschte es; der Baum betete auch nach seiner Weise.
Mehrere Sommer hintereinander kam die Braut des Erschossenen an dessen Sterbetag zu der Buche, kniete nieder und weinte und betete, und jedesmal war sie bleicher und abgehärmter. Endlich blieb sie aus.
»Sie wird gestorben sein,« sprach die Buche, und so war es auch.
* * *
Jahre waren vergangen, und die Buche war ein mächtiger Baum geworden. Ihre Rinde trug bräunliches Moos, die Ranken des Waldefeus kletterten an dem Stamm empor, und Herz und Kreuz waren vom Grün schier verdeckt.
Dann kam eines Tages ein Mann, der fügte zu den zwei Zeichen ein drittes, und die Buche wußte, was es zu bedeuten hatte. Sie war in der Rinde gezeichnet und sollte gefällt werden.
Fahr wohl, du grüner, wonnesamer Wald!
Es dauerte auch nicht lange, so kamen die Holzhauer, und die Axthiebe schnitten der Buche ins Leben. Ein finster blickender Mann im Jagdgewand mit ergrautem Bart und Haar leitete das Holzfällen.
Die Buche kannte den Mann recht wohl, und dieser schien auch den Baum zu erkennen. Er ging auf ihn zu und riß Moos und Efeugeflecht von dem Stamm, so daß Kreuz und Herz sichtbar wurden.
»Hier war's,« sagte er leise, und Schauer schüttelte seine Glieder.
»Zurück, Herr Förster, zurück!« schrieen die Holzfäller. »Der Baum will sinken.«
Der Angerufene taumelte zurück, aber es war zu spät.
Krachend stürzte die Buche zu Boden und begrub den Förster unter ihrem Geäst.
Als sie ihn hervorzogen, war er tot. Die Buche hatte ihm das Haupt zerschmettert.
Und die Männer standen im Kreis und beteten.
R. Baumbach.
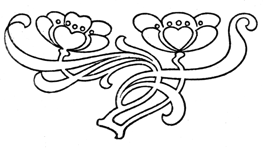

![]() In einer kleinen Stadt, nicht weit von dem Orte, wo ich wohne, lebte einmal ein junger Mann, dem alles zum Unglück ausschlug, was er anfing. Sein Vater hatte Pechvogel geheißen, und so hieß er denn auch Pechvogel. Beide Eltern waren ihm früh gestorben, und die lange, dürre Tante, die ihn damals zu sich genommen hatte, prügelte ihn jedesmal, wenn sie aus der Messe kam. Da sie nun aber jeden Tag in die Messe ging, so prügelte sie ihn eben auch alle Tage. Er hatte aber auch wirklich sehr viel Unglück denn wenn er ein Glas trug, fiel es ihm gewöhnlich hin; und wenn er dann weinend die Scherben auflas, schnitt er sich stets in die Finger.
In einer kleinen Stadt, nicht weit von dem Orte, wo ich wohne, lebte einmal ein junger Mann, dem alles zum Unglück ausschlug, was er anfing. Sein Vater hatte Pechvogel geheißen, und so hieß er denn auch Pechvogel. Beide Eltern waren ihm früh gestorben, und die lange, dürre Tante, die ihn damals zu sich genommen hatte, prügelte ihn jedesmal, wenn sie aus der Messe kam. Da sie nun aber jeden Tag in die Messe ging, so prügelte sie ihn eben auch alle Tage. Er hatte aber auch wirklich sehr viel Unglück denn wenn er ein Glas trug, fiel es ihm gewöhnlich hin; und wenn er dann weinend die Scherben auflas, schnitt er sich stets in die Finger.
So ging es in allen Dingen. Zwar starb die lange Tante eines Tages, und er pflanzte nun auf ihr Grab soviel Büsche und Bäume, als wenn er auf ihnen noch einmal alle die Stöcke ziehen wolle, die sie auf seinem Rücken zerschlagen hatte; aber sein Unstern schien mit jedem Jahre nur mehr und mehr zuzunehmen. Da bemächtigte sich seiner eine große Traurigkeit, und er beschloß in die weite Welt zu gehen. »Schlechter kann's nimmer werden,« dachte er; »vielleicht wird's besser«. Er steckte daher seine ganze Barschaft in die Tasche und wanderte zum Tor hinaus.
Vor dem Tore auf der steinernen Brücke blieb er noch einmal stehen und lehnte sich über das Geländer. Er sah in die Wellen hinab, die reißend an den Pfeilern vorbeischäumten, und es wurde ihm gar wehmütig ums Herz. Es war ihm fast, als wenn es ein Unrecht wäre, die Stadt, in der er so lange gelebt, zu verlassen. Und vielleicht hätte er noch lange so gestanden, wenn ihm nicht plötzlich der Wind den Hut vom Kopfe geweht und in den Fluß geworfen hätte. Da erwachte er aus seinen Träumen, aber der Hut war schon unter der Brücke fortgeschwommen und tanzte auf der andern Seite mitten im Strom; und jedesmal, wenn ihn eine Welle hochhob, schien er höhnisch zurückzurufen: »Adieu, Pechvogel! Ich reise; bleibe du zu Hause, wenn du Lust hast.«
So machte sich denn Pechvogel ohne Hut auf den Weg. Lustige Gesellen zogen oft genug singend und jubilierend an ihm vorüber und luden ihn ein, in Gemeinschaft mit ihnen die Wanderschaft fortzusetzen. Doch er schüttelte jedesmal traurig den Kopf und sagte: »Ich passe nicht zu euch und würde euch nicht viel Glück bringen! Außerdem heiße ich Pechvogel.« Sobald sie diesen Namen hörten, wurden die lustigen Burschen ernsthaft und verlegen und machten sich eiligst aus dem Staube.
Erreichte er abends müde ein Wirtshaus, und saß er an einer einsamen Ecke des Schenktisches, den Kopf auf die Hand gestützt und vor sich den zinnernen Krug mit Wein, der nimmer leer werden wollte, so trat wohl zuweilen das Wirtstöchterlein leise zu ihm heran, tippte ihn auf die Schulter, daß er sich erschrocken umdrehte, und fragte, warum er so traurig sei. Wenn er aber dann seine Geschichte erzählte und gar seinen Namen nannte, schüttelte sie den Kopf, ging zu ihrem Spinnrad zurück und lieh ihn allein sitzen und seinen Gedanken nachhängen. –
Nachdem Pechvogel mehrere Wochen lang gewandert war, ohne recht eigentlich zu wissen wohin, kam er eines Tages an einen wundervollen, großen Garten, der von einem hohen, vergoldeten Geländer umgeben war. Durch das Geländer hindurch sah man uralte Bäume und niedriges Buschwerk abwechselnd mit großen Rasenplätzen; dazwischen schlängelte sich ein Bach, über den eine Menge kleiner Brücken führten. Zahme Hirsche und Rehe spazierten auf den gelben Sandwegen umher, kamen bis ans Gitter, steckten ihre Köpfe heraus und fraßen ihm das Brod aus der Hand.
In der Mitte des Gartens aber sah man aus den Bäumen ein stattliches Schloß hervorragen. Die silbernen Dächer blitzten in der Sonne, und von den Türmen wehten bunte Fahnen und Banner. Er ging das Geländer entlang; endlich fand er einen großen, offenstehenden Torweg, von dem eine lange, schattige Allee gerade auf das Schloß führte. Im Garten selbst war alles still; kein Mensch lieh sich sehen oder hören.
Am Tor hing eine Tafel. »Aha!« dachte er, »wie gewöhnlich! wenn man an einem recht schönen Garten vorbeikommt, wo die Tore einladend offen stehen, dann hängt immer eine Tafel daneben, worauf steht, daß der Eintritt verboten ist.« Zu seiner großen Überraschung sah er jedoch, daß er sich diesmal täuschte; denn auf der Tafel stand weiter nichts als: »Hier darf nicht geweint werden!« »So, so,« sagte er, »eine närrische Inschrift,« zog das Taschentuch heraus und rieb sich ein wenig die Augen; denn er war nicht ganz sicher, ob nicht in einer Ecke irgendwo doch eine halbe Träne sitzen geblieben sei. Darauf trat er in den Garten ein.
Der große breite Weg, der schnurstracks aufs Schloß zulief, machte ihn beklommen. Er schlug lieber einen Seitengang mitten zwischen hohen Jasmin- und Rosenhecken ein. Den verfolgte er und gelangte in einen kleinen Wald, aus dem ein Weg mit vielen Windungen zu einem Hügel hinaufführte. Als er jetzt abermals um eine Ecke bog, lag die Spitze des Hügels vor ihm, und auf dem Hügel im Grase sah ein wunderschönes Mädchen.
Sie hatte eine goldene Krone auf dem Schoß, auf die sie fortwährend hauchte. Dann nahm sie ihre seidene Schürze, rieb die Krone mit ihr, und als sie sah, daß sie wieder ganz blank wurde, klatschte sie vor Freude in die Hände, strich sich ihre langen Haare hinter die Ohren und setzte sich die Krone wieder auf.
Den armen Pechvogel überfiel bei ihrem Anblick eine sonderbare Angst. Sein Herz klopfte so laut, als wenn es zerspringen wollte. Er trat hinter einen Busch und duckte sich nieder. Aber es war eine Berberitze, und ein Zweig legte sich ihm gerade quer übers Gesicht. Und wie der Wind den Busch leise hin und her bewegte, kitzelte ihm ein Dorn fortwähren an der Nasenspitze herum, so daß er laut niesen mußte.
Erschrocken drehte sich das Mädchen mit der Krone um und sah Pechvogel hinter dem Busche kauern.
»Warum versteckst du dich?« rief sie. »Willst du mir etwas Böses tun, oder fürchtest du dich vor mir?«
Da trat Pechvogel zitternd wie Espenlaub hinter dem Busche hervor.
»Du tust mir nichts!« sagte sie lachend. »Komm her, setze dich ein wenig zu mir; meine Gespielinnen sind alle fortgelaufen und haben mich allein gelassen. Du kannst mir etwas recht Hübsches erzählen, aber was zum Lachen! Hörst du? – Aber du siehst ja so traurig aus! Was fehlt dir denn? Wenn du kein so finsteres Gesicht machtest, wärest du wirklich ein ganz hübscher Mensch.«
»Wenn du es haben willst,« antwortete Pechvogel, »will ich mich wohl einen Augenblick zu dir setzen. Aber wer bist du denn? Ich habe ja mein Lebtag noch nie etwas so Schönes und Herrliches gesehen wie dich!«
»Ich bin die Prinzessin Glückskind, und dies ist meines Vaters Garten.«
»Was machst du denn hier so allein?«
»Ich füttere meine Rehe und Hirsche und putze meine Krone.«
»Und nachher?«
»Dann füttere ich meine Goldfische!«
»Und wenn du damit fertig bist?«
»Dann kommen meine Gespielinnen wieder und dann lachen wir und singen und tanzen!«
»Ach, was du für ein glückseliges Leben führst! Und das geht so alle Tage?«
»Ja, alle Tage! Nun sage aber auch einmal, wer du bist und wie du heißt?«
»Ach, allerschönste Prinzessin, verlangt nur das nicht von mir! Ich bin der allerunglücklichste Mensch unter der Sonne und habe den allerhäßlichsten Namen.«
»Pfui!« sagte sie, »ein häßlicher Name ist sehr häßlich! In meines Vaters Ländern gibt es einen, der heißt Entengrütze, und einen andern, der heißt Fettfleck; du wirst doch nicht etwa so heißen?«
»Nein,« antwortete er, »Entengrütze heiße ich nicht, auch nicht Fettfleck. Mein Name ist noch viel häßlicher. Ich heiße Pechvogel.
»Pechvogel? Das ist ja zum Totlachen! Kannst du denn keinen anderen Namen kriegen? Höre, ich will mir einmal einen recht hübschen Namen für dich ausdenken, und dann will ich meinen Vater bitten, daß er dir erlaubt, ihn zu tragen.
Mein Vater kann alles, was er will; denn er ist König. Aber nur unter der Bedingung tu ich es, daß du ein ganz vergnügtes Gesicht machst. Nimm doch die Hand vom Gesicht; du mußt dir nicht immer so an der Nase herumzupfen! Du hast eine ganz hübsche Nase und wirst sie noch ganz und gar verderben. Streich dir einmal die Haare aus der Stirn! So! Nun siehst du doch einigermaßen vernünftig aus. – Sage einmal, warum bist du eigentlich so traurig? Denn ich bin immer vergnügt, und jeder, mit dem ich rede, freut sich. Nur dir sieht man's gar nicht an!
»Warum ich so traurig bin? Weil ich mein ganzes Leben traurig war und stets Unglück habe. Und du bist immer lustig? Wie fängst du das an?«
»Mich hat eine Fee über die heilige Taufe gehalten, der hatte mein Vater früher einmal einen großen Dienst erwiesen. Sie nahm mich auf den Arm, küßte mich auf die Stirne und sagte zu mir: Du sollst immerdar fröhlich sein und alle Welt fröhlich machen. Wenn dich ein recht trauriger Mensch ansieht, soll er sein Unglück vergessen! Glückskind sollst du heißen! – Dich aber hat wohl keine Fee geküßt?«
»Nein, nein!« antwortete er hastig, »niemals!«
Darauf wurde die Prinzessin sehr still und nachdenklich und sah ihn mit ihren großen blauen Augen so sonderbar an, daß es ihm eiskalt den Rücken hinunterlief. Dann hub sie wieder an:
»Ob es wohl immer eine Fee sein muß? Eine Prinzessin ist auch etwas. Komm her, kniee dich einmal hin; denn du bist mir zu groß.«
Darauf trat sie vor ihn, gab ihm einen Kuß und lief lachend fort.
Ehe sich Pechvogel noch recht besinnen konnte, war sie verschwunden. Langsam stand er auf. Es war ihm, als wenn er aus einem Traume erwachte; und doch fühlte er, daß es kein Traum sein könne, denn eine wunderbare Fröhlichkeit war über sein Herz gekommen. »Wenn ich nur meinen Hut hätte,« sagte er, »daß ich ihn in die Luft werfen könnte. Vielleicht finge er an zu trillern und flöge als Lerche davon! Zu Mut ist mir's so. Ich glaube wirklich, ich bin lustig. Das wäre doch zu merkwürdig.« – Er pflückte sich noch einen großen Blumenstrauß im Garten und wanderte singend die Landstraße weiter.
Sobald er in die nächste Stadt kam, kaufte er sich ein rotsamtnes Wams mit Atlasschlitzen und ein Barett mit einer langen weißen Feder, besah sich im Spiegel und sagte: »Pechvogel heiße ich? Wir wollen sehen, ob ich nicht einen anderen Namen bekomme. Aber den schönsten, den es gibt, sonst nehm' ich ihn nicht.« Dann stieg er auf ein Pferd, gab ihm die Sporen, daß es lustig dahin tanzte, und setzte seine Reise fort.
Prinzessin Glückskind aber, nachdem sie dem Pechvogel den Kuß gegeben hatte, lief und lief. Dann ging sie langsamer und langsamer, und zuletzt setzte sie sich auf eine Bank unweit vom Schlosse und fing an bitterlich zu weinen. Als ihre Gespielinnen zurückkehrten und sie fanden, weinte sie immer noch. Sie versuchten sie zu trösten, aber es half nichts. Da liefen sie in ihrer Angst zum König und riefen: »Um Gottes willen, Herr König! Ein Unglück für das ganze Land! Prinzessin Glückskind sitzt im Garten und weint, und niemand kann ihr helfen.« Als dies der König hörte, wurde er vor Schrecken blaß und sprang eilig die Treppe in den Garten hinunter.
Da saß die Prinzessin weinend auf der Bank und hatte die Krone auf dem Schoß, und es waren auf sie so viele Tränen gefallen, daß sie in der Sonne blitzte, als wenn sie mit tausend Diamanten besetzt wäre. Der König nahm seine Tochter in den Arm und tröstete sie und redete ihr zu; aber sie weinte immer fort. Er führte sie in das Schloß und ließ ihr aus dem ganzen Lande alles, was es nur Schönes und Kostbares gab, kommen; doch sie blieb traurig; und so oft er sie auch bat, ihm doch zu sagen, welch' ein schweres Herzeleid ihr widerfahren sei, sie antwortete nicht.
Aber der König fragte immer wieder, und zuletzt mußte sie es sagen; und sie erzählte, wie sie im Garten gesessen und wie ein junger Mensch gekommen wäre, der so überaus traurig ausgesehen, und wie sie ihn geküßt hätte, um zu sehen, ob er dadurch nicht vielleicht etwas fröhlicher würde.
Da schlug der König die Hände über dem Kopf zusammen. »Einen fremden hergelaufenen Menschen; wahrscheinlich einen ganz gewöhnlichen Handwerksburschen! Mit schlechten Kleidern; und noch dazu ohne Hut! Es ist unglaublich!«
»Er dauerte mich so sehr!«
»Ein hübscher Grund für eine Prinzessin, den ersten besten Strolch zu küssen! Und Pechvogel heißt er? Unerhört! Aber den Menschen muß ich haben, und wenn ich ihn habe, wird er geköpft. Das ist die allergeringste Strafe, die ihn treffen kann!«
Darauf befahl der König seinen Reitern, das Land nach allen Richtungen hin zu durchstreifen und auf den armen Pechvogel zu fahnden. »Wenn ihr einen jungen Menschen findet, der aussieht, als hätten ihm die Mäuse das Brot weggefressen, und keinen Hut hat, der ist's! Den bringt ihr sofort hierher!« Und die Reiter stoben auseinander wie Spreu, in die der Wind fährt, und durchzogen das ganze Land. Manche von ihnen kamen auch an Pechvogel vorbei, der in seiner vornehmen Kleidung stolz auf dem Pferde sah; aber sie erkannten ihn nicht, und die meisten von ihnen kehrten unverrichteter Dinge in das Schloß zurück, wo sie der König zornig anfuhr und alberne, ungeschickte Menschen schalt, die zu gar nichts zu gebrauchen seien.
Die Prinzessin aber blieb traurig wie zuvor und kam jeden Mittag mit verweinten Augen zu Tisch; und der König tat auch weiter nichts, als daß er immer seine schöne traurige Tochter ansah und ließ darüber Suppe und Braten kalt werden.
So ging es Woche um Woche. Eines Tages jedoch entstand plötzlich ein Lärmen auf dem Schloßhofe. Alles lief zusammen, und ehe noch der König Zeit gehabt an's Fenster zu treten, um nach der Ursache zu sehen, führten schon zwei Reiter den armen Pechvogel in sein Zimmer. Sie hatten ihm die Hände auf dem Rücken zusammengebunden, aber sein Gesicht strahlte, als wenn ihm in seinem Leben noch nie etwas Lieberes widerfahren wäre. Er verneigte sich vor dem Könige und richtete sich dann stolz auf, abwartend, was er über ihn beschließen würde.
»Wir haben den sauberen Vogel gefangen, Majestät!« sagte der ältere der beiden Reiter. »Er muß sich aber inzwischen gemausert haben; denn eure Beschreibung paßt wie die Faust aufs Auge! Gewiß hätten wir ihn auch nie gefunden, wenn uns nicht der dumme Tölpel, als wir im Wirtshaus mit ihm zusammentrafen, die ganze Geschichte selbst erzählt hätte.
Und wißt ihr, was er getan hat, nachdem wir ihn gefangen und gebunden? Weiter gelacht und weiter gesungen! Und wie wir ihn auf sein Pferd gesetzt, zwischen unsere Pferde genommen und hierher gejagt? Geschimpft und gezankt, daß wir so langsam ritten! Als wenn er es nicht erwarten könne, bis er geköpft würde. Wenn das der traurigste Mensch in der ganzen Christenheit sein soll, Majestät, so möchte ich wohl den allerlustigsten sehen. Der muß sich dann zum Frühstück die Beine ausreißen und in den Kaffee tauchen. Alles andere hat der hier schon unterwegs gemacht!«
Als der König dies gehört, trat er vor Pechvogel mit gekreuzten Armen hin und sagte: »Also du bist der Mensch, der die Frechheit gehabt hat, sich von der Prinzessin küssen zu lassen?«
»Ja, Herr König! Und ich bin seitdem der allerglückseligste Mensch der Welt geworden!«
»Werft ihn in den Turm, er soll morgen geköpft werden!«
Hierauf führten die Reiter Pechvogel hinaus und in den Turm; der König aber ging mit langen Schritten in seinem Zimmer auf und ab. »Das ist ein schlimmer Handel,« sagte er. »Haben tu ich ihn, und geköpft wird er; aber davon allein wird mein Glückskind nicht wieder lustig.
Dann ging er leise bis an das Zimmer seiner Tochter, sah durch's Schlüsselloch, schüttelte den Kopf, ging wieder lange auf und ab, und ließ sich endlich seinen geheimen Rat kommen. Als dieser alles gehört, besann er sich und sagte:
»Ich weiß nicht, ob's hilft, aber man könnte es versuchen. Daß der Pechvogel vorher traurig war und jetzt lustig ist, ist sicher; ebenso, daß unsere schöne Prinzessin früher stets fröhlich war und nun fortwährend weint. Daß der Kuß daran schuld ist, ist doch sehr wahrscheinlich. Also, der Pechvogel muß der Prinzessin den Kuß wiedergeben. Majestät, das ist meine untertänigste Meinung!«
»Das ist ja ganz unmöglich,« erwiderte der König ärgerlich, »und ganz gegen die Sitte meines Hauses!«
»Ew. Majestät müssen die Sache nur als Staatsakt betrachten, dann geht es wohl, und niemand kann etwas dagegen einwenden.«
Der König überlegte sich die Angelegenheit noch etwas, dann sagte er: »Gut, wir wollen es versuchen. Rufe alle Grafen und Ritter in's Thronzimmer und laß den Gefangenen heraufführen!« Darauf legte der König seine Staatskleidung an und nahm auf dem Throne Platz.
Neben ihm stand die Prinzessin, der er gar nicht gewagt hatte zu sagen, weshalb er sie hatte rufen lassen, und um ihn herum in großem Kreise der ganze Hof; lauter vornehme Herren in goldgestickten Kleidern mit Sternen und Schärpen. Alles war ganz still. Da ging die Tür auf, und Pechvogel wurde hereingebracht.
»Du wirst morgen geköpft,« fuhr ihn der Könige an, »aber zuvor wirst du augenblicklich und vor allen diesen edlen und erlauchten Herren meiner Tochter den Kuß wiedergeben, den sie dir unüberlegter Weise gegeben hat!«
»Wenn ihr nur das wünscht, Herr König,« entgegnete Pechvogel, »so will ich es herzlich gern tun, und wenn es möglich ist, daß ein Mensch noch glücklicher werden kann, als ich es jetzt schon bin, so werde ich es gewiß werden!«
»Das wollen wir erst einmal sehen!« unterbrach ihn der König barsch. »Diesmal könntest du dich doch verrechnet haben!«
Darauf schritt Pechvogel auf die Prinzessin zu, umarmte sie und gab ihr einen Kuß. Sie aber nahm seine Hand, sah ihn sehr freundlich an, und beide blieben vor dem Throne stehen.
Bist du wieder vergnügt, meine liebe Tochter? fragte der König.
»Ein kleines Bißchen, mein Vater,« entgegnete sie. »Aber es wird gewiß nicht lange vorhalten.«
»Ja, ja!« sagte der König traurig, »ich sehe es schon. Er ist ja nicht wieder traurig geworden, wie es sein müßte, wenn's richtig wäre. Er steht ja noch immer da und lächelt, und macht immer noch das unverschämt vergnügte Gesicht! Was nun anfangen?«
Da schlug die Prinzessin die Augen nieder und sagte leise: »Ich weiß es, Vater, und will es dir sagen; aber bloß in's Ohr.«
Darauf ging der König mit der Prinzessin auf den Vorsaal, und wie sie wieder herein traten, nahm er die Hand Pechvogels, legte sie in die der Prinzessin und sagte zu allen den versammelten Herren und Grafen:
»Es ist nicht zu ändern, Gottes Wille geschehe; dies ist mein lieber Sohn, der König wird, wenn ich einmal sterbe.« –
Und Pechvogel wurde Prinz und später König. Er wohnte in dem goldenen Schlosse und gab der Prinzessin so viel Küsse, daß sie noch viel fröhlicher wurde, wie zuvor. Prinzessin Glückskind aber schenkte ihm für seinen häßlichen Namen die allerschönsten; jeden Tag einen andern. Nur zuweilen, wenn sie recht übermütig lustig war, sagte sie zu ihm: »Weißt du noch, wie du früher hießest?« und dann wollte sie sich totlachen. Er aber hielt ihr den Mund zu und sprach: »Still! was sollen die Leute denken, wenn sie es hören? Ich verliere ja allen Respekt!« –
R. von Volkmann.