
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
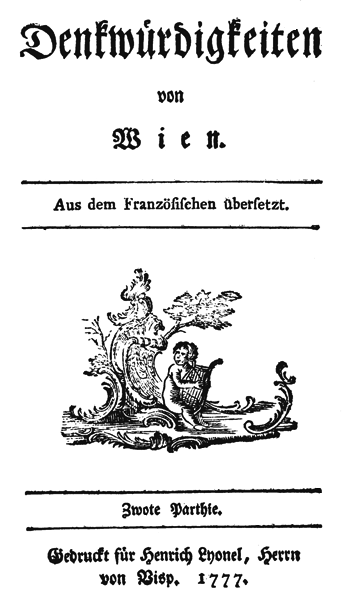
Inhalt der §§. zur zwoten Parthie.
§. 1. Sitten und Lebensart.
§. 2. Erste Fortsetzung.
§. 3. Zwote Fortsetzung.
§. 4. Adel.
§. 5. Patriotische Stiftungen.
§. 6. Vergnügungen.
§. 7. Herrenals.
§. 8. La nouvelle du jour. (Die Modeneuigkeit.)
§. 9. Ein Lokalcharakter.
§. 10. Der Schachspieler.

 Dem Himmel sey gedankt: ich bin durch die Dienstfertigkeit des Herrn Lockmann mit einer hinlänglichen Anzahl Personen von der artigen Welt bekannt, um ihnen,
Karl, eine Idee von der Erziehung, von der Lebensart und den Sitten der Wiener machen zu können.
Dem Himmel sey gedankt: ich bin durch die Dienstfertigkeit des Herrn Lockmann mit einer hinlänglichen Anzahl Personen von der artigen Welt bekannt, um ihnen,
Karl, eine Idee von der Erziehung, von der Lebensart und den Sitten der Wiener machen zu können.
Das Geblüt ist beynahe durchaus schön. Die Wienerinnen sind weder so roth und so nervicht, wie die Engländerinnen, noch so schmächtig wie die Französinnen. Sie besitzen das Gefühl einer Neapolitanerin, den Buhlgeist einer Französin und das Herz einer Deutschin. Diß ist ihre Skitze. Sie kleiden sich nach den möglichsten Gesetzen der Natur. Niemals bedienen sie sich der Kunst, als um die Natur zu verschönern. Die Sultane, die Polonaisen, die Jaquets haben sich viel länger zu Wien erhalten, als die Robbes a la Duchesse oder a la Tocque. Die Mannsbilder sind wohl gebildet und wohl gekleidet.
Man muß zum Lobe der Wiener sagen, daß sie nichts spahren, ihre Kinder für die Societät zu erziehen. Das Frauenzimmer lernt französisch, wälsch und deutsch sprechen. Wenn es die Situation zuläßt, auch wohl englisch und latein. Sie haben ihre Meister in der Zeichenkunst, in der Musik, in der Geschichte, in der Erdbeschreibung. Sie tanzen vortreflich, und verstehen die Conversationsregeln. Die Jünglinge treiben die Sprachen, sie tanzen, reuten, fechten, manövriren, malen, musiciren, voltigiren, und sind Balanceurs. In allem diesem gelingt es beeden Gattungen ausnehmend.
Uebrigens ist ihr Umgang natürlich, leicht, und ungezwungen. Ihr Witz fließt von ihrem Geiste weg. Er ist glücklich. Zwischen einer Sächsin und einer Wienerin ist eben der Unterschied, der sich zwischen einer Drehpuppe und der Natur befindet.
Diese Eigenschaften werden durch eine ohnverzeihliche Schwachheit für den Müssiggang und ein bequemen Leben ins Gleichgewicht gesetzt. Wer das Sinnbild einer Wienerin mahlen wollte, müßte sich nach der Zeichnung des Carracus richten: er müßte eine Venus mahlen, zu deren Füssen eine Schildkröte sitzt.
|
|
Ihr ganzes Leben ist Geniessen!
|
Beyde Geschlechter lieben den Pracht, den Aufwand und das Vergnügen bis zum Laster – Fehler, die bey ihnen nicht im Herzen, sondern im Blute stecken. Man hat wenig Wiener gesehen, die aus Grundsätzen ausschweifend wären.
Die Lebensart zu Wien ist auf französischem – kurz auf städtischem Fusse. Beym Herrn vom Hause ist um 10 Uhr Tag. Man wartet ihm anfänglich im Putze auf. Wenn man nähere Bekanntschaft gestiftet, oder keine Angelegenheiten hat, so darf man im Neglige erscheinen. Das Toilett seiner Gemahlin wird ungefähr um die nämliche Stunde aufgedeckt. Die folgende Zeit wird in der Kirche, oder mit Geschäften, oder mit Besuch zugebracht. Meistens pflegt man um 2 Uhr sich zur Tafel zu setzen. Der Rest des Tages ist für die Spatzierfahrt oder das Schauspiel bestimmt. Sobald der Abend eingebrochen ist, so begiebt sich jedermann in Gesellschaft. Hier wird gespielt.
Das Merite, welches man zu Wien von einem Fremden fodert, um ihn würdig zu schätzen, in ihre Häuser aufgenommen zu werden, ist diß, daß er präsentabel sey, daß er sich mit Geschmack zu kleiden, und durch seine Person zu bezahlen wisse. Nirgends gelingt es den Polissons besser als hier. Die Frau von Truft, bey welcher ich heute speißte, sagt, meine Lieblinge müssen seyn wie die Weltkugel, rund und überall gleich.
Man verehrt zu Wien die Religion noch. Sie hat sich hier länger von der Vergiftung der Philosophie erhalten als in Paris, in Berlin und London. Daher hat man es zu danken, daß Wohlthätigkeit, Treue und Ehrlichkeit, diese göttlichen Wirkungen ihrer Lehre, noch in den Charakter der Wiener geprägt sind.
Je länger ich unter den Wienern lebe; desto mehr lehren sie mich, sie kennen und schätzen. Man sage mir nichts mehr wider die Deutschen. Wenn alle Deutschen so beschaffen sind, wie diese, so sind sie liebenswerth. Hier ist ein neues Bild, das ich mir von ihnen kopirt habe.
Die Wiener besitzen alle Tugenden, welche die Bürger zu Paris so berühmt machen, und keines von den Lastern, die die Bürger zu London beschimpfen. Sie besitzen Vaterlandsliebe, Treue für den Regenten, den Ehrgeiz eines Bürgers, und den Fleiß eines Unterthanen. Nirgends ist es der Policey besser gelungen, gute Anordnungen in Stand zu bringen, als zu Wien. Es ist nicht die Schuld des Publikums, daß diese Anordnungen seltsam sind. Wenn man von auszeichnenden Verbrechen hört, so ist der Urheber beynahe allemal ein Fremder, der sich zu Wien aufhält, oder ein Kolonist worden ist. Der Charakter des ursprünglichen Oesterreichers ist bieder. Eine gewisse Weichheit der Seele, nebst dem unüberwindlichen Triebe zur Bequemlichkeit, welcher allen Wienern anklebt, lassen ihnen nicht zu, sich in merkwürdige Verbrechen zu verwicklen.
Desto leichter hingegen geschiehet, daß ein Fremdling, welchen der Zufall unvermuthet aus dem Staube erhoben, von seinem Glücke berauscht, sich übernimmt, und die Laster seines Vaterlands ausbrechen läßt, welche ihn bisher die Noth in seinem Busen zu ersticken zwang.
Diß ist das Schicksal der Wiener: wenn sie verderbt sind, so haben sie es den Fremdlingen zu danken. Denn es ist gewiß, wie Cicero sagt, daß niemand sein Vaterland verläßt, um an einem andern Orte Tempel zu errichten.
Herr von Walltron, ein geistreicher junger Mann, der ein gebohrner Wiener ist, und dessen Umgang ich aller übrigen vorziehe, erzählte mir heute ein vortreffliches Beyspiel von der Tugend der Wiener. Es ereignete sich im letztern Kriege einmal, daß über den Verlust eines Treffens ein Gemurmel in der Stadt entstund, und die Gemüther wallend zu werden schienen. Der Minister, welcher sich der Politik Alcibiads erinnerte, ließ die den Türken vor Wien abgenommene Generalszelten aufschlagen, unter dem Vorwande, sie auszulüften. Ganz Wien lief, die Zelten anzuschauen, und sich unter ihnen zu divertiren. Man sprach von nichts mehr, als von ihrer Einrichtung, von ihrem Bau, von dem Vergnügen, das man dabey genießt. Binnen drey Tagen lief Nachricht von einem vortheilhaften Streiche der Armee ein. Der Verdruß war vergessen. Ich weis nicht, ob man die Staatsklugheit des Ministers mehr bewundern soll, oder den lenksamen Charakter des Volks.
Man entschlägt sich schwer gewisser Pflichten der Gerechtigkeit und der Erkenntlichkeit. Aber unser Jahrhundert ist so verdorben, daß man die Tugend nicht loben kann, ohne sich der Satyre auszusetzen. Aus Furcht, in diesen Fall zu gerathen, erzähle ich ihnen etwas von den Schwachheiten der Wiener.
Die Heyrathen zu Wien theilen sich in zwo Gattungen: die bürgerliche Ehe, und die Konsistorialehe. ( Mariage de Convenance: Mariage par forçe.) Von den Verbindungen der Liebe, welche man mit Recht aus dem Reiche der Vernunft verwiesen, und in das Reich der Romanen gejagt hat, weis man zu Wien nichts.
Von dieser Katastrophe hängt der ganze übrige Theil des Lebens eines Wieners ab. Dann so sehr die Deutschen mit ihrer Mannheit prahlen, so geht es ihnen wie uns übrigen armen Sündern:
|
|
Durch Bitten herrscht das Weib, und durch Befehl der Mann;
|
Eine Wienerin fragt eben so wenig nach der Unlaune ihres Mannes, als die Pikdame nach dem trotzigen Gesicht ihres Gemahls.
Vielleicht läßt sich eine weitläuftige Materie durch nichts kürzer erschöpfen als durch Beispiele. Ich werde ihnen aus der Sammlung, die ich mir in jeder dieser zwo Gallerien gemacht habe, eines mittheilen.
Eine Skitze nach Brand.
Geschaben hoch 5 Schuh 2 Zoll.
Aus dem Kabinet des Baron und der Baronne S....
Dem Baron S..... einem jungen Manne von 26 Jahren, gieng nichts mehr ab, um einen vollkommenen Staat zu machen, als eine Frau. Man sah sich unter den glänzenden Parthien, die wirklich ledig waren, um. Seine Wahl fiel auf das Fräulein H.... Sie war die einzige Erbin eines Kapitals von 600,000 fl. welches ihr Herr Vater, welcher Referent bey der Hofkammer war, hinterlassen hatte. Es hinderte den Baron nichts, seine Anwerbung zu machen. Er war Titularrath bey der Regierung: das ist, er hatte das Recht, in einem Solitaire von Lacq Martin in die Regierung zu fahren, wenn es ihm beliebte.
Der Baron war bey weitem nicht so reich wie das Fräulein. Diesen Abgang aber ersetzte er durch tausend andere Verdienste. Er war der schimmerndste Maccarone seiner Zeit. Man sah die neuesten Farben, die neuesten Zeuge, den neuesten Haarputz bey ihm. Er befand sich allezeit im Mittelpuncte des Geschmacks. Als er dem Fräulein zum erstenmal aufwartete, so trug er ein Kleid, Serge d'amour, Couleur de Jasmin, und die Frisur à l'aimable Etourdi. Des andern Morgens trug er einen apfelgrünen Frack von Drap à quatre diables, und die Frisur en Conquerant decidé.
Die Familien arbeiteten indeß untereinander. Man muß gestehen, weder eines noch das andere der jungen Leute konnte sein Gegentheil leiden. Unterdessen machte man sich eine Raison. Das Fräulein schien etwas eigensinniger zu seyn. Ein Bouquet, welches aus goldenen Blumen bestund, die mit Brillianten versetzt waren, überwand sie. Es war der gustuoseste und rareste Gedanke. Der Baron überreichte es selbst. Die Vermählung gieng vor sich. Man konnte kein glücklicheres Paar sehen: die Braut war à l'Artichaut aufgesetzt, und der Baron en homme à sentiments.
Die Ehe gieng einige Wochen so ziemlich. Die Wohlstandsgesetze wurden genau beobachtet. Die Baronne, in der Meinung die Einkünfte ihres Gemahls seyen so groß als die ihrigen, beschränkte sich nicht. Man spielte, man tractirte, man gab Akademien. Endlich fühlte sich der Baron zu schwach, das Blendwerk fortzusetzen. Seine Gemahlin wurde hierüber bestürzt. Sie hatte ihn bloß geheyrathet, um zu schimmern.
Weil sie ihr Vermögen mit ihm nicht weiters theilen wollte, so bat sie um die Ehescheidung. Sie bezüchtigte den Baron, daß er an der Krankheit des heiligen Martinus laborire.
Der Baron und sein Advokat brachten ihrer Seits vor, daß seine Gemahlin Liebhaber unterhielte. Um sich ihres Vermögens zu versichern, bat er, die Baronne ins Kloster zu stecken.
Der Hof bewilligte weder das eine noch das andere. Man engagirte die Anverwandten, sich dazwischen zu legen, und die jungen Leute zusammen zu bringen. Endlich erhielt man, daß sie versprachen, das öffentliche Aergerniß zu vermeiden. Die Baronne berief den Liebhaber, den sie im ledigen Stande hatte, zurück. Der Baron erwählte sich eine Maitresse. Jede Parthey wohnt in einem besondern Stockwerk. Wenn Gesellschaft oder Tafel ist, so siehet man sie im genausten Verständnisse: und die Welt hat gar nicht Ursache zur Spötterey.
Das zweite Beispiel ist aus den Akten des Passauischen Konsistoriums gezogen ....... Schüler des Theaters, ihr spähet nach Stof zu neuen Lustspielen? – Leset!
Herr von Gänsekiel erhält, nachdem er seit sechs Jahren nach einem Amte geseufzt hatte, das Dekret zum Concipisten bey der Hofkanzley. Er hat diesen Erfolg niemand als der Jungfer Schnürnestel zu danken. Sie ist Kammerfrau bey der Gemahlin des Präsidenten. Herr von Gänsekiel machte ihr in der Verzweiflung die Amour, und versprach ihr das Heyrathen. Es gelang der Jungfer Schnürnestel auf ihr inständiges Bitten, daß der Minister sich endlich entschloß.
Nunmehr arbeitet die Jungfer Schnürnestel an ihrem Hochzeitbette. Der Herr von Gänsekiel aber thut nichts dergleichen. Er geht täglich in seine Kanzley und verrichtet seine Pflicht, wie es einem untadelhaften Beamten zukommt: übrigens befürchtet er nichts. Sechs Wochen vergehen: die Braut wird ungeduldig. Man erfährt, daß Herr von Gänsekiel sich unter der Hand um convenable Parthien erkundigt. Die Jungfer Schnürnestel dringt auf die Erfüllung seines Versprechens mit Ernst. Herr von Gänsekiel sucht Ausflüchte – – – zögert – – kurz, es zeigt sich, daß er seine Wohlthäterin zu hintergehen gedenkt. Man verklagt ihn beym Konsistorium. Herr von Gänsekiel muß sich stellen. Nichts ist gewisser, als daß er verliert. Die Konsistorialräthe zu Wien haben in der Taufe versprochen, Heyrathen zu befördern.
Indem er, voll Gedanken über ein Zufluchtmittel, sich dem Konsistorialpallaste nähert, so begegnet ihm ein Dienstmädchen mit seinem Kinde auf dem Arm. – Mensch, spricht er, willst du dir einen neuen Rock verdienen? Er überredet sie für sechs Ducaten, daß sie die Rolle übernimmt. Er führt sie mit sich ins Konsistorium. Ich wollte, sagte er zu den Richtern, der Jungfer Schnürnestel gern mein Wort halten; dann ich liebe sie zum Sterben. Aber Ew. Hochwürden und Gnaden sehen, was mich hindert. Hier ist ein Mädchen, die ältere Ansprüche macht – – – Ja, setzte die abgerichtete Dirne hinzu: diß ist das Kind, so ich von ihm habe, und er versprach mir die Ehe, als ers machte, sonst hätte ichs nicht gethan.
Die Jungfer Schnürnestel sinkt in Ohnmacht. Das Konsistorium ist betreten. Nachdem, so fällt der Ausspruch aus, die Sache in einen andern Gesichtspunkt gestellt ist; so wird die Jungfer Klägerin abgewiesen, und der Gegenperson vorbehalten, ihre rechtliche Ansprüche auf den Herrn von Gänsekiel geltend zu machen. So verlange ich nun, fährt die Dirne fort, daß man uns hier vor gesessenem Gerichte traue; damit es mir nicht gehe, wie der Jungfer Schnürnestel, und etwan eine dritte ins Spiel komme.
Herr von Gänsekiel erblaßt. So weit hatte er die Rolle mit dem Kindsmensch nicht einstudiert. Er kannte sie gar nicht, er hatte sie zum erstenmal gesehen. Es war eine von den rohesten und gemeinsten Marktdirnen. Er befand sich im verwirrtesten Falle von der Welt. – – – Ich habe mich betrogen! rief er: ich sehe die Strafe des erzürnten Himmels. Erlauben sie mir, gnädige und hochweise Richter, daß ich zu meiner Pflicht zurücktreten darf. Ich biete der Jungfer Schnürnestel meine Hand an. Er fiel zu den Füssen des Gerichts, und erzählte den abgeredeten Betrug. Erbarmen sie sich, Mademoiselle, rief er mit ringenden Händen zur Jungfer Schnürnestel; sie waren Einmal die Wohlthäterin meines Lebens: werden sie es zum zweytenmal, und erretten sie mich von dem Abgrund, an dem ich stehe.
Vergebens wand sich Herr von Gänsekiel wie ein Wurm um die Füsse der Jungfer Schnürnestel. Entfernen sie sich, versetzte die stolze Schöne; ich entlasse sie meiner Ansprüche; ich verabscheue Betrüger von ihrem Rang.
Das Konsistorium bewundert den heroischen Entschluß des Frauenzimmers. Um ihn nachzuahmen, verdammet es den Herrn von Gänsekiel, auf der Stelle mit der Dirne vermählt zu werden. Einer der Räthe stehet von seinem Stuhle auf – die Wachskerzen sind beständig brennend – und spricht das quod Deus conjunxit. – Man muß mit dem Gerichte nicht scherzen! sagt der Präsident.
Wenn mich ein Mensch, der im Begrif wäre, nach Wien zu reisen, fragen sollte, nach welchen Lebensregeln er sich richten müßte; so würde ich ihm folgendes in seine Schreibtafel diktiren.
(1.)
»Willt du dein Glück zu Wien machen,
»so lerne erst gefallen; und dann unterdrü-
»cken. Der Wiener wird gebohren, erschmei-
»chelt sich ein Amt, nimmt ein Weib, legt
»sich ins Kanapee, und stirbt. Der Fremde
»folgt eben dieser Richtung: nur mit dem
»Unterschied, daß er den Handgrif verändert.
»Wenn der Wiener von sich selbst zu gefallen
»sucht, so sucht der Fremde durch andere zu
»gefallen. Er macht so lang den Narren zu
»Wien, bis er seinen Zweck erreicht hat, als-
»denn läßt er sich, zum Ersatz, von den Wie-
»nern wiederum in dieser Art bedienen.«
(2.)
»Ich bin der Sache gewiß .... ich ha-
»be Schutz .... mein Glück ist gesichert ....
»ich werde Gerechtigkeit erhalten .... mei-
»ne Freunde lassen mich nicht stecken ....
»mein Projekt muß gelingen .... der Graf
»hat mir diß oder jenes versprochen .... es
»kann mir beym Fürsten nicht fehlen ....
»ich darf mich auf meine Verdienste verlas-
»sen .... meine Liebste ist mir getreu – –
»Worte, welche, wie ein alter Weltweiser
»spricht, ein Mensch, der in die Welt gehet,
»in seinem Wörterbuch ausstreichen muß.«
(3.)
»Willt du deine Verdienste auf die Probe
»setzen: so lege ein wollenes Kleid an, und
»setze eine ungepuderte Perücke auf, gehe aus,
»und schlage ab, dem Grafen .... Geld zu
»leihen, oder dem Präsidenten .... deine
»Maitresse abzutreten.«
(4.)
»Jüngling! fliehe vor den Wohnungen der
»Policeycommissare. Sie brüten Basilisken-
»eyer, und wirken Spinnengewebe. Das
»Orakel sagt: Isset man von ihren Eyern,
»so muß man sterben; zertritt man sie
»aber, so fährt eine Otter heraus.
Der Uebersetzer hat, um alle Misdeutung zu vermeiden, das, was in der Urschrift folget, hier unterdrückt.
Es ist ein wichtiger Theil der Etiquette, sich die Unterscheidungszeichen Herr von – und Frau von – geläufig zu machen. Ich war sehr betreten, als ich zum erstenmal bey Herrn Lockmann eintrat, und ihn von seinen Bedienten Herr von Lockmann und seine Töchter gnädige Fräuleins nennen hörte.
Sie wissen, daß Lockmann der Sohn eines honetten Gewürzkrämers in der Kreuzgasse ist. Er verließ Zürch, um sein Glück als Instruktor zu machen. Nachdem es ihm in dieser Absicht nicht gelungen war, so sah er sich in England genöthigt die Livree beym Grafen Dumbar anzunehmen. Nach verschiedenen Abwechslungen des Glücks hatte er Gelegenheit, beym Fürsten Mannsfeld zu Wien in Dienste zu kommen. Dieser erhob ihn zum Posten seines Haushofmeisters. Herr Lockmann hatte Verstand und Erfahrung genug, sich die Zeit zu nutze zu machen: er legte ein kleines Kapital zurück und begab sich mit einer Pension zur Ruhe. Von dieser Zeit an ist er gnädiger Herr.
Ich konnte mich nicht entbrechen, Herrn Lockmann meine Verwirrung über die Aufnahme seiner Ansprüche zu erkennen zu geben. Er beruhigte mich aber, indem er mich versicherte, daß dieses Wörtgen mehr nicht als einen blossen Accent bedeute, und daß die Benennung Herr von weder eine gute noch schlimme Wirkung mit sich bringe.
Der Adel theilt sich zu Wien in zween Range, in den hohen Adel, und in den kleinen. Man nennt den letztern, ich weis nicht warum, – vielleicht wegen der Aehnlichkeit der Rubriken – den leonischen Adel.
Zum hohen Adel gehören die Lichtenstein, die Kaunitz, die Colloredo, und Alles, was groß ist im Namen und Aufwande. Der leonische Adel bestehet aus Räthen, Sachwaltern, Aerzten, Negotianten, Agenten. – Man könnte noch eine Gattung Edelleute zählen, wenn man alle Köche, Kammerdiener, Schreiber, Komödianten und Pfaffen nehmen wollte, die sich gnädige Herren, gestrenge Herren, und Herren von nennen lassen. Sie sind die Polypen im Reiche der Ehre; man weis ihre Klasse nicht.
An der Spitze der ersten Gattung stehen die Lichtenstein, welches die Montmorencys von Wien sind. Man hat nicht leicht ein vollendeteres Bild eines Kavaliers gesehen, als der Fürst Karl Lichtenstein ist. Er besitzt alles, was ein grosser Herr besitzen solle: eine hohe Geburt; Güter; Schönheit; Tapferkeit; Prachtliebe; ein grosses Herz. Man kann nichts schöneres als Ihn an der Spitze einer Brigade, sehen: so wie ich ihn im Lager bey Minkendorf gesehen habe.
Der Fürst Esterhasy, welcher einer der vornehmsten Herren des Hofs, weil er Hauptmann von der Leibwache ist, hat seine eigentliche Residenz zu Esterhas, 6 Meilen von hier. Er ist der August für die schönen Künste der Leyr, des Kothurn und des Meßzirkels.
Das Haus der Fürsten Schwarzenberg ist in dem Besitze grosser Regenten verjährt. Der itzige trägt einen der schönsten Titel der Menschheit – eines Vaters der Armen.
Die Dietrichstein sind durch ihre langwierigen Dienste am Oesterreichischen Hofe berühmt. Der Obriststallmeister hat den Namen seines Hauses durch den Antheil erweckt, den er an dem Vertrauen Josephs II besitzt. Er ist nebst dem Fürsten Karl Lichtenstein der zweyte Mann zur Gesellschaft Seiner Majestät.
Lobkowitz ist ein Haus, welches seinen Degen mit den Lorbeern des Vaterlands umwunden träget. Der regierende Fürst, welcher sich wegen seiner Schönheit in Europa so berühmt machte, ist es noch mehr wegen seines Verstandes. Man begreift nicht, daß, um ein Sonderling zu seyn, ein grosses Genie dazu gehört; wenn man zu Wien die Lebensart dieses Prinzen tadelt. Der Fürst Lobkowitz hat sich seine eigene Sphäre erschaffen: in dieser lebt er, so wie ein Gott in seinem Mittelpunkte. Unabhängig von der Welt und von Vorurtheilen ist er sich selbst genug. Ohne Verbindung mit den Menschen ist er ihr Wohlthäter. Seiner höhern Würde bewußt, hat er sich aus dem Kraise der allgemeinen Wesen geschwungen.
Certe quiscunque solitudinem amat, aut deum aut bestiam esse oportet.
In Wahrheit, um die Einsamkeit zu lieben, muß man entweder ein Gott seyn, oder eine Bestie.
Plato.
Anm. d. Ueb.
Plato .
Khevenhüller, Paar, Clary , Starenberg, Harrach, Auersperg, Seilern sind unter denjenigen Häusern, die sich aus der Menge herfürgedrungen haben, die merkwürdigsten. Sie verbinden mit wahren Verdiensten ihrer Chefs einen glänzenden Staat.
Die Häuser, welche am meisten fetirt sind, sind Kaunitz und Colloredo. Wer immer in Angelegenheiten ist, oder ein Glück bey Hofe sucht, huldigt in diesen Tempeln. Sie können sich einbilden, daß die Versammlung zahlreich ist. Wer das hohe Bild des Patriotismus entwerfen wollte, müßte das Muster vom Ministerium zu Wien nehmen, und die zween Fürsten Kaunitz und Colloredo zur Hauptfigur machen.
Um unsern Faden wiederum zu ergreifen: diese zween Range des Adels zu Wien – der hohe und der leonische – beobachten zwischen einander die strengste Gränze. Man hat kein Beyspiel, daß einem Leoner jemals der Zutritt in die Gesellschaft der Nobels gestattet worden wäre. Man weis, daß eine Dame von diesem Range in der Redoute verweigerte, einer leonischen die Hand im Contretanz zu reichen.
Diese Delikatesse scheint ein wenig zu weit getrieben zu seyn. Aber die Anmaßungen des leonischen Adels sind auch übertrieben. Umsonst ersinnet der Hof Prachtgesetze: der leonische Witz übertrift sie. Ich habe insbesondere einen ihrer Kunstgriffe bemerkt, der nicht glücklicher seyn konnte. Man hat hier das Recht der Fiokki. Es ist niemand als dem hohen Adel erlaubt, die rothe Quaste zu führen. Um diesen Unterschied aufzuheben, legte sich der leonische Adel Postzüge bey. Da der grosse Adel sich dieser bedient, um in die Kirche, ins Schauspiel, in Prater, und selbst zum Besuche, zu fahren, so empfand man den Unterschied nicht mehr.
Der hohe Adel hat noch eine Untereintheilung, in den deutschen, in den böhmischen und in den hungarischen. Den deutschen und hungarischen hält man für den reichsten. Der Prinz Rohan, welcher durch den Pracht berühmt ist, womit er seine Ambassade zu Wien begleitete, pflegte zu sagen, daß es andern Nationen vielleicht zuweilen gelinge, auf der Wettbahne der Verschwendung den deutschen Adel zu überlaufen, aber daß es dem Adel keiner Nation möglich sey, den Lauf auszuhalten, wie dem zu Wien.
Es ist wahr der böhmische Adel befindet sich nicht in diesem Falle. Man schreibt es der Verfassung des Landes, und insbesondere einem gewissen ungünstigen Affect ihrer Güter zu, welchen man Leibeigenschaft nennet. Wenn man, sprechen die benachbarten Nationen, den Wohlstand unserer Felder mit den unermeßlichen Fluren vergleicht, welche in Böhmen öde liegen, so siehet man offenbar, daß die Erde nur gegen Tirannen und Sclaven zurückhaltend ist, ihre Schätze aber freywillig eröfnet, wenn sie von freyen Händen umgeackert wird, und unter dem Schutze ohnveränderlicher Gesetze stehet: denn Freiheit und Eigenthum sind die Grundstützen des Ueberflusses. Die Erde scheint unter dem Schweisse der Sclaven zu vertrocknen.
Wie? man tadelt die Verschwendung des Adels? Sie ist meines Erachtens die Pflicht eines Kavaliers. Der Himmel hat, zum Zeichen ihres höhern Vorzugs, bey ihnen mit der Geburt zugleich das Recht verknüpft, Glückliche zu machen. Der Graf Cz... welcher, weil er diese Bestimmung zu weit getrieben, von einer Million Einkünfte, die ihm sein Vater hinterließ, zum Bettelstab herunter gekommen ist, antwortete einem seiner Tadler sehr sinnreich. Der Graf hatte ihn um ein Anlehn von tausend Ducaten auf 24 Stunden ersucht. Warum leben sie nicht, wie ich? sagte der reiche Geizhalz. Wenn ich mit meinem Vermögen fertig seyn werde, erwiederte ihm der Graf mit einer verächtlichen Miene, so wird es noch Zeit genug seyn, zu leben wie sie. Wenn irgend ein vornehmer Herr durch seine Freigebigkeit und Pracht sich in Schulden setzt, so ist man verbunden, Ehrfurcht für sein Unglück zu tragen. Aber wenn ein Bürger, um die Grossen nachzuahmen, sich ins Verderben stürzt, so pfeift das Parterre.
Um ihnen von den Leonern noch etwas zu sagen: es giebt nicht leicht ein Volk zwischen den zween Angeln der Erde, welches auf seine Pergamente eifersüchtiger ist, als dieser Pygmäenadel. Die Familientheater sind eine Art Vergnügung, die man zu Wien sehr weit gebracht hat. Man hat Gesellschaften von Privatpersonen gesehen, deren Spiel so vortreflich war, daß sie würdig geschätzt wurden, es vor dem Hofe zu Laxenburg zu wiederholen. Vorgestern hatte ich die Ehre, einer Akademie in dieser Art in dem Hause des Herrn Hofrath von S... beyzuwohnen. Man führte Diderots Hausvater auf. Die Rolle der Cöcilie wurde von dem Fräulein von K... mit ausserordentlicher Anlage gespielt. Die Gesellschaft entwarf auf morgen den Westindier.
Es war natürlich, daß bey der Austheilung der Parthien Lädy Scharlotte Rusport auf das Fräulein von K.... fiel. Unterdessen machte die Frau von O.... eine von den Mitspielern, die vorgestern, als Frau Hebert, nur drey Silben auszusprechen hatte, und diese nicht herfürbringen konnte, Anspruch an die erste Rolle: indem sie zum Grunde anführte, daß sie von besserer Herkunft wäre, als das Fräulein K....
Diese hatte einen Oheim zugegen, der sich ihrer annahm. Der Streit wurde lebhaft. Man lief von beyden Seiten nach Haus, um die Belege herbeyzuholen. Die Zuschauer wurden in die wichtigste Erwartung gesetzt. Es entdeckte sich, daß der Vater der Frau von O... ein böhmischer Schlachtschütz war, und der Vater des Fräuleins von K... ein hungarischer.
Die Unglücklichen! Sie haben das berühmte Paradoxon nicht gelesen: die Geburt macht eben so wenig Unterschied bey den Menschen, als zwischen zween Eseln, wovon des einen Vater Mist trug, und des andern Vater Reliquien.
Wie kommt es, fragte ich heute den Herrn von Walltron, daß Wien mit so wenig Denkmälern patriotischer Stiftungen pranget? Was ich sehe, sind Denkmäler der Großmuth ihrer Fürsten, aber nicht ihrer Bürger. –
Was verstehen sie unter patriotischen Stiftungen? Vielleicht sind wir im Stande, ihnen einige zu Wien zu weisen. Wir haben ein großes Armenhaus, von einer Privatperson gestiftet. Der Mann nannte sich Chaos. Man sagt, daß er den Stein der Weisen besessen hätte. Es ist wahr, er war Schatzmeister des Kaiser Leopold, und hatte die Ehre mit Ihro Majestät in der Traplierkarte zu spielen. Man findet in der kaiserlichen Schatzkammer ein Stück chymisches Gold, welches zur Innschrift hat:
Exhibitum Pragae d. 15. Jan. 1658.
in Praes.
Ferdinandi III. Auth. Chaos.
und auf dem Avers:
Diva Metamorphosis.
Unsere heutigen Finanzbediente üben keine so feine Kunststückchen, ihre Reichthümer zu bedecken; dagegen stehen sie auch nicht im Verdacht, daß sie den Stein der Weisen besitzen.
Ferner, fuhr Herr von Walltron fort, haben wir eine Allee von jungen Lindenbäumen, die ihren Ursprung patriotisch denkenden Bürgern zu danken hat. Wir haben Lekturkabinette, Addreßkomtoirs und eine Pfennigpost von der Erfindung bloßer Partikuliers. Es ist wahr, es gehen uns Dämme wider die Ueberschwemmung, Getraide, und Holzvorrathhäuser, Schleusen für die Eisgänge, ein Findlinghaus, und noch einige andere Gegenstände des Gemeinnutzens ab. Aber es scheint, unsere Stunde sey noch nicht gekommen. Vor einigen Jahren entwarf ein Partikulier, ein Mann, der entweder das Herz oder den Kopf am rechten Orte hat, die Unternehmung, auf seine Kosten ein öffentliches Bad für Armen zu stiften. Nach zwey Jahren erfuhr er die Genugthuung, sein Gesuch an der zehnten Stelle auf die es gelanget war, abgeschlagen zu sehen. Der Gesundheitsrath, das Wasserbauamt, die Grundherrschaft, die Bademeisterschaft, der Holzzoll, die Regierung, die Hofkammer, die Hofkanzley, der Stadtrath, und die Sicherheit waren zur Beurtheilung des Anbringens befugt. Es hätte einen Leibnitz erfodert, so viele Meinungen zu vereinigen.
Als wir auf den Begrif verfielen, vollführte Herr von Walltron, daß uns eine Verbesserung unserer Schulen nothwendig sey, und hiezu ein Fond erfodert wurde, so entwarfen unsere Staatsverständigen den Vorschlag einer allgemeinen Sammlung unter der Inwohnerschaft. Dieses Mittel war nicht nach unserm Geschmack.
Joseph II der uns besser kennet, als diese Herren, wußte jenes anzugeben, welches für uns gemacht war. Er erschuf eine Redoute, und bestimmte die Einkünfte davon für die Schulanstalt. Dieses Mittel war würdig, uns zu rühren; wir drangen im Strome hinzu, unsern Antheil zum allgemeinen Wohl beyzutragen. Die Verbesserung gieng für sich. Es fand sich ein Mann, der uns begreiflich machte, daß die Summe der Wissenschaften in der Schreibekunst bestehe. Um, zum Beispiel, rechnen zu können, sprach er, muß man nothwendig vorher die Zahlen zu machen wissen. Seitdem können unsere Kinder glücklich lesen und Buchstaben aussprechen.
Das, mein Herr, was sie wesentliches in diesem Fache haben »so fiel ich dem Herrn von Walltron ins Wort« ist eine Wittwenkasse für die Versorgung der armen Tonkünstlerinnen. Warum errichten sie nicht mehr dergleichen Stocks? Warum errichten sie keinen für die verlassenen Mädchen, welche keine Männer kriegen konnten? Mich dünkt, man könnte ihn hier aus dem Zuschusse der Hagestolze formiren.
»Auch war es vor zwey Jahren, erwiderte Herr von Walltron, auf dem Tapet, diese Leute, deren Eigensinn dem Staate durch den Abgang der Bevölkerung schädlich ist, einer Steuer zu unterwerfen. Allein einer von den Ministern erklärte sich öffentlich dagegen. Er führte den Spruch Pauls I. Corinth. 7, v. 32. 33. an.
Spruch Pauls I Corinth. 7.
»Ich wollte aber, daß ihr ohne Sor-
»ge wäret. Wer ledig ist, der sorget,
»was dem
Herrn angehöret, wie er
»dem
Herrn gefalle. Wer aber freyet,
»der sorget, was die Welt angehöret,
»wie er dem Weibe gefalle.«
Anm. d. Ueb. Es ist das erstemal, daß Paul im Kabinette allegirt worden ist; aber er ist vielleicht nie glücklicher allegirt worden. Die Einkünfte unserer Dienste reichen nicht zu, Weiber zu erhalten. Die häuslichen Bedürfnisse vermehren sich mit dem Range. Welcher ehrliche Kerl hat Geduld genug, sich mit dem heiligen Band der Ehe an den Banquerouttirpranger schliessen zu lassen?
»Aber Vaterlandsliebe – Tugend – Walltron?
»Grosse Forderungen! ich muß bekennen; versetzte Herr von Walltron – halten sie die Beschaffenheit unsers Frauenzimmers dagegen.
»Man muß gestehen, daß zu keiner Religion mehr Glauben erfordert wird, als zur Ehe.«
»Es ist hierin Alles eben so, wie hier! ruft Colombinchen. In der That, Karl, die Vergnügungen sind überall zu Hause, wo es Geld und Menschen giebt. Vergebens bemühet man sich, sie uns zu nehmen oder, zu verbittern. Sie bleiben uns getreu. Sie theilen ihr glückliches und unglückliches Schicksal mit uns. In diesem Betracht verdienen sie, daß wir uns ihrer annehmen.
Der Duc de Richelieu schrieb an unsern Vater Voltaire ehemals:
|
|
In diesen traurigen Gegenden, in diesem barbarischen Orte
|
Heut zu Tag haben sich die Umstände geändert. Man vergnügt sich zu Wien: man fühlt sich: man findet Leute, die sich wieder fühlen. Diß erhält das Leben in Ordnung.
Eine der anziehendsten Vergnügungen für die Wiener ist der Ball. Um ihn uns zu nutze zu machen, entwarf Herr Lockmann eine Parthie auf Wahring. Diß ist einer der bevölkertsten Tanzsäle. Im Vorbeyfahren, wies mir Madam Lockmann das Haus, wo sich die berufenen Orgyen
Ein geheimer festlicher Dienst der Grazien im Tempel der Liebe zu Athen.
Anm. d. Ueb. hielten, welche die Policey allhier vor mehr als zwanzig Jahren, beunruhigten. Zu Wahring fanden wir eine Menge Gesellschaft, die in gleicher Absicht, wie wir, hergekommen war. Ich machte nützliche Bekanntschaften. Man tanzte anfangs französische Tänze. Die Bratsche, ein Kerl mit einem grossen Schmeerbauche, that einen Schlag aufs Notengestelle. Diß war das Zeichen zum deutschen Tanze. Im Augenblick schwebte die Gesellschaft in der Luft. Ich glaubte im Reiche der Sylphen zu seyn, so leichtfüssig sind die Mädchens hier. Von Wahring besuchten wir noch einige andere Säle, wo wir überall viel Welt fanden.
Die Schauspiele, worunter das Amphitheater keines der unbeträchtlichsten ist, machen den zweiten Theil der Vergnügungen des Publici aus: der dritte Theil bestehet im Spiel, und in Parthies de Plaisir.
Man ziehet zu den letztern gemeiniglich das Land vor. Die Wiener haben ein Sprichwort von der Policey:
de quelque côté qu'on tourne, on se trouve au bout de sa lunette.
Auf welche Seite man sich drehet, so befindet man sich im Sehpunkte ihres Fernglases.
Anm. d. Ueb. Wenn es wahr ist, wie man sagt, daß ein jeder Mensch in der Rechnung seines Lebens einen Zeitpunkt habe, um auszutoben, so würde ich den Vätern rathen, ihre Söhne vorzugsweise nach Wien zu schicken. Mir scheint es der Ort zu seyn, wo die Rolle am geschwindesten angefangen, und am schnellsten geendigt ist.
Diese Stadt hat vor London, vor Venedig, vor Paris und Berlin jenen Vorzug, daß man in jenen Orten durch die Zeit, hier aber durch die Umstände, gebessert wird. Es scheint, das Gesetz suche sich Ehrfurcht zu verschaffen. Sie haben einen gewissen Mann, dessen Name seinem Amte sehr analog ist. Er nennt sich Luchs. Dieser Mann ist das Schrecken des Vergnügens und der Dienstfertigkeit. Ich begnüge mich, ihnen eine Anekdote zu wiederholen, die man mir zu Wahring erzählte. Sie erschöpft alles, was in dieser Materie Angenehmes und Unangenehmes liegt.
Madam Fillon – so nenne ich die Heldin des Stücks, um sie mit dem schrecklichen Manne nicht in Verdruß zu verwickeln – ist eben so sehr wegen ihrer Mildherzigkeit berühmt als wegen ihrer Schönheit. Diß zog natürlicherweise dem Herrn Fillon eine Menge Freunde zu. Die Lästersucht bediente sich einiger Scheinzüge, um die Tugend der Madam Fillon anzuschwärzen. Das Gerüchte drang bis zu den Ohren des Keuschheitaufsehers. Bei einem schönen Mondschein kam ein Häschervorsteher mit einem Wagen vor der Thüre des Herrn Fillon an, und bat sich seine Gemahlin aus. Man erfuhr 6 ganze Wochen lang nichts von dem Schicksal der Madam Fillon. Ihre Freunde waren in der äussersten Verzweiflung, als folgendes Circular von ihr erschien.
»Man dringt aufs grausamste in mich,
»daß ich meine Freunde verrathen solle. Heute
»frühe haben mir meine Tirannen die letzte
»Wahl gegeben, ob ich euch nahmhaft ma-
»chen, oder die Ruthe gewärtigen will. Ich
»bin zu der ersten Schwachheit nicht fähig.
»Meine Denkensart ist der Welt bekannt.
»Aber werde ich mich nicht selbst verläugnen
»müssen, um den Kerker nicht zu verewigen?
»Wir müssen eine Parthie ergreifen; die Zeit
»dringet. Sie sehen, meine Herrn, daß es
»um ihren Beutel zu thun ist. Ich glaube,
»sie würden mir ihr Geld lieber gönnen, als
»irgend einem Kommissare in der Welt. Es
»muß uns nichts zu kostbar seyn, um Freiheit
»und Reputation zu erhalten. Hinterlegen
»sie, ein jeder die Summe so sie ihrem Ge-
»wissen nach zur Genugthuung des Gerichts
»schuldig zu seyn glauben, beym Herrn von
»
Avancourt, meinem Bestellten. Das
ȟbrige nehme ich auf mich. Ihr Beyspiel
»wird mich im Muthe bestärken, alles zu er-
»tragen, um die Ehre zu retten, und ihre
»Theilnehmung wird die Schmerzen der Ru-
»the lindern.
Ihre unglückliche aber getreue
Freundin
Theresie Fillon.
Es war nicht ein Einiger unter allen den Herren, die sich in die Lage der Madam Filion interessirt befanden, der, von der Großmuth ihrer Grundsätze gerührt, nicht mit Vergnügen seinen Antheil in den Stock beygetragen hätte, den der Herr von Avancourt für sie sammelte. Das Geständniß der Madam Fillon hätte für die meisten unter ihnen nachtheilige Folgen haben können. Dieses Frauenzimmer stund heldenmüthig die Ruthe aus. Nach ihrer Entlassung fand sie einen Fond von 500 Dukaten, und Freunde, die sie durch das Beyspiel einer so erhabenen Bescheidenheit unauflöslich an sich verknüpft hatte.
Man weis, daß der heilige Esel zu Verona eine der berühmtesten Reliquien dieser Stadt ist. Die Geschichte behauptet, daß der Esel, welcher Christum, den Herrn, bey seinem glorreichen Einzuge zu Jerusalem auf dem Rücken getragen, zu Verona gestorben sey.
Wenigstens siehet man in unserer Liebfrauenkirche zu Verona ein Gerippe, welches man in einer feyerlichen Procession umtrug. Dieses Gerippe, sagt man, ist das Gerippe des heiligen Esels, der nachdem er Gott getragen hatte, die Menschen für unwürdig schätzte, ihnen hinführo zu dienen.
Solchem auserwählten Thiere zu Ehren widmete die Kirche ein eigenes Fest, welches zu Verona aufs herrlichste begangen ward. Dieses Fest ahmte man hernachmals in allen christlichen Ländern nach. Die Antiphonie fieng sich mit den Worten an:
|
|
Orientis partibus.
|
Die Einwohner zu Herrenals, einem Dörfgen eine Viertelmeile von Wien gelegen, hatten einen doppelten Anlaß, dasselbe zu feyern. Erstlich, weil sie von Alters her eine christgläubige Gemeinde sind: bey ihnen findet man einen der vollkommensten Kalvariberge in Deutschland. Zweytens, weil diese Procession Vorstellung zu einer schönen Satyre auf die Türken gab, welche 1683 den Herrenalsern ihre Felder verwüsteten.
Die Türken halten, wie uns die Zeitungen versichern, alle Jahr einen ähnlichen Umgang zu Ehren der Stutte Borack, auf welcher Abraham, der allgemeine Stammvater der Glaubigen, in Himmel ritt.
Kurz, der Eselritt zu Herrenals war alljährlich ein Fest, welches ganz Wien Gelegenheit gab, herbey zu laufen, und sich einen gesellschaftlichen Tag zu machen.
Die Ordnung des Einzugs ist in der Sakristey zu Herrenals so abgemahlt:
Vermuthlich kann ein rechtglaubiger Christ diese Function nicht ohne grosse Erbauung anschauen. Was uns andern betrift, so hatten wir nicht das Glück, sie zu sehen, weil der Kaiser die heurige Procession – wie man sagt, wegen der Anwesenheit des türkischen Gesandten – einzustellen befohlen hat.
Herr Lockmann führte uns dagegen in den Park des Feldmarschall Lacy, welcher in der Nachbarschaft Herrenals liegt. Es findet sich ein schönes Haus daneben, wo der Feldmarschall einige Sommertäge zubringt. Es schien mir, als ob ich mich in den Gärten des Regulus befände. Soviel Mäßigkeit, soviel Einfalt, eine so stille Grösse, wie in dem Charakter eines Römers.
Unterdessen haben sich diejenigen sehr geirret, welche den Feldmarschall dem Regulus verglichen haben. Sein Kennzug hat weit mehr Aehnlichkeit mit dem Kennzuge des Aurelius Probus, eines andern Helden, welcher der sieben oder acht- und dreissigste römische Kaiser war.
»Der Erschaffer einer neuen Kriegszucht; zu
»gleicher Zeit von den Soldaten gehaßt und
»bewundert. Nachdem er sich in Orient als
»Kriegsheld bewiesen, und die Barbarn ge-
»zwungen hatte, die römischen Waffen zu
»ehren: so rüstete er sich zum Kriege, bloß um
»dem Reiche Friedem zu gewähren – – –
»Einen Augenblick hernach erstaunte man
»über das Unrecht, so man einem so großmü-
»thigen Manne erwiesen hatte; man er-
kannte seine Verdienste – – –
Flav. Vopisc.
Siehe da, ein sehr grosser Stof, und ein sehr heilloser Künstler! – – rief ich, als das Werk des Abbe Fromagrot in Wien ankam – – Warum hat Joseph II keinen Biographen – Er, der die Bewunderung seines Jahrhunderts, die Wollust der Nationen ist?
= = der Kaiser will nicht, daß man von ihm schreiben soll. = =
Elender! schreibt man denn die Geschichte grosser Männer um ihrentwillen, und nicht für die Nachwelt? Wie? man hat die Tagebücher der Auguste und der Ludwige? – – Es ist wahr, sie haben viel für die Künste und für den menschlichen Verstand gethan – – aber man hat noch keine Geschichte des menschlichen Herzens und der erleuchteten Vernunft?
Sie liegt in den Tagebüchern der Josephe. In der That müßte die Geschichte der Josephe ein neues, ein höchst interessantes Werk seyn. Die Vergleichung dieser zween Prinzen ist das schönste Stück in der Geschichte des achtzehnten Jahrhunderts. Joseph I verherrlichte den kurzen Lauf seiner Regierung mit einer Reihe grosser, kühner, und ausserordentlicher Thaten, welche ewige Denkpunkte in den Jahrbüchern seiner Nation bleiben werden. Joseph II that binnen drey Jahren mehr für die Menschheit als Antonin und Aurel in der glänzendsten Zeit ihrer Regierung gethan haben.
Hier ist ein Strich zur Silhouette Josephs I den der künftige Biograph nicht in den Denkregistern antrift, die man von diesem Prinzen hat. Als Clemens XI auf der höchsten Stufe seines Mißvergnügens über die beherzten Unternehmungen des Kaisers in der Napolitanischen Belehnungssache war; so fand sich Jemand, welcher dem Pabst einräumte, daß alles, was der Kaiser zum Nachtheil des päbstlichen Ansehens vornehme, eine Wirkung der gehässigen Insinuationen seines Beichtvaters, des Pater Bernhart wäre. Mehr war nicht nöthig, um den erzürnten Pabst zu bewegen, daß er den Jesuiten sogleich nach Rom berufen ließ. Sire, sprach dieser, indem er sich zu den Füssen des Kaisers warf, ich bin verlohren; der General meines Ordens fodert meine Person. Ich habe zureichenden Grund, die Folgen einzusehen. – – – Beruhigen sie sich, fiel ihm der edelmüthige Monarch ins Wort: ich werde sie beschützen.
Man schrieb dem General zurück, da Se. Majestät nicht zugäben, daß sich dero Beichtvater von ihnen entferne, so könne man den Pater Bernhart nicht nach Rom stellen. Itzt blitzte es ein Breve vom heiligen Vater selbst, worinn er den Kaiser und den Jesuiten beym Gehorsam für die Kirche aufforderte.
Joseph I verhielt sich hiebey sehr kaltblütig. Er ließ den Rektor des Collegiums zu Wien zu sich berufen. Pater Rector, redete ihn der Monarch an: der Pabst will durchaus, daß der Pater Bernhart nach Rom komme. Ich kann es Sr. Heiligkeit nicht abschlagen. Aber da der Pater Bernhart ein Mann ist, welcher um den Orden Verdienste hat, und den ich schätze; so will ich, daß seine Reise mit sicherem Geleite geschehe. In dem Augenblicke als er bereit seyn wird, sollen ihn alle Jesuiten, die sich in meinen Staaten befinden, aus dem Lande begleiten – Man kann urtheilen, daß der Pater Bernhart in Wien blieb.
Trotz dieser schönen Anekdote haben wir das Schicksal der Jesuiten erlebt. Gestern kam die berühmte Bulle Clemens XIV zu Wien an. Sie wird mit verschiedenem Beyfall aufgenommen. Der Pöbel, dessen Schwachheit darinn besteht, allezeit auf der Seite des Delinquenten zu seyn, er mag ein Missethäter oder ein Märtyrer seyn, bedauert die frommen Väter. Ihre Mitbrüder, der Clerus, jauchzen: zu ihm schlagen sich alle übrigen Idioten, Projektenmacher und Pflastertreter. Der Kenner der Geschichte, und der Philosoph betrachtet in stiller Bewunderung, die Revolution unserer Begriffe und unserer Politik.
In der That, die Geschichte des Ursprungs und des Wachsthums der Klöster, ist eine der merkwürdigsten Geschichten des Vorurtheils auf der einen Seite, und der Verstandeskraft auf der andern. Man glaubt heute zu Tag durchgängig, daß die Stiftung der Mönche, jenes Volks, auf welches in der unläugbarsten Deutung der Denkspruch anschlägt:
»Die Stunden drücken sie, und sie die liebe Erde.«
aus dem Aberglauben entsprungen sey. Ist der Aberglaube jemals mit einer schöpferischen Macht begabt gewesen? Er kann nur dasjenige erhalten und unterstützen, was schon ist.
Wenn eine falsche Meinung in Mode kommt, so hat sie eben so viel Zulauf als eine wahre. Man hat die Stiftung der Mönche nicht nur fälschlich dem Aberglauben zugeschrieben, sondern – was noch ein gröberer Irrthum ist – man hat sie dem Staate und dem gemeinen Wesen für schädlich gehalten. Lasset uns einen Blick auf ihre Geschichte werfen: lasset sie mit unserer Vernunft vergleichen; diese ists, die uns durch ihre Schlüsse auf die Natur des Wesens leiten muß.
Zwey von einem berüchtigten Kirchenvater in der Masse seiner Einbildungskraft verlohrne, und von den Politikern aufgefangene Worte gaben der Erfindung der Klöster ihren Ursprung. Es ist glaublich, daß dieser Mann, welcher aus der Schule der Stoiker war, und sich bey dieser Gelegenheit weit mehr als ein eingebildeter Fanatiker ausdrückte, als, wie ein Christ und wie ein weiser Mann, nicht an die Folgen seiner Rede gedachte. Syriacus war der erste Pabst, der ihr eine vollkommene Ausdehnung gab, indem er dem Mönchleben den Cölibat beyfügte.
Der Geist der Unabhängigkeit ist den Menschen so natürlich, daß ihn nichts als die Kraft der Leidenschaften, oder die äusserste Noth unterdrücken kann – Auf der andern Seite schmachtet jedes Oberhaupt nach einer unumschränkten Regierung.
Die Päbste, welche gewiß eine der despotischsten Monarchien der Welt besitzen, haben sich zu allen Zeiten des ersten Mittels, als des sichersten bedient, einen guten Erfolg zu erhalten. Sie haben überdiß eingesehen, daß ein Oberherrscher nicht so sehr in der Menge und Gleichheit seiner Unterthanen Sicherheit finde, als in der Absonderung eines Theils der selben, welcher seiner Person ergeben ist, und dem an seiner Erhaltung gelegen ist, weil er sein eigenes Schicksal mit ihm verknüpft hat.
Die weltlichen Fürsten hatten noch eine zwote Maxime hinzuzusetzen. Die Bevölkerung hatte ihr Maaß überschritten, und die Geschlechter wurden zu mächtig. Hier ist die Erfindung der Klöster – – Erfindung laß dich umarmen! Man weis, was sie sowohl dem einen als dem andern Theile genützt hat.
Wie? hätte sie fehl schlagen sollen? Die Liebe zur Ruhe – dieser unüberwindliche Trieb der Menschen; ein gewisses Maaß Schwärmerey, welches damals Mode war, und eine zur Nothwendigkeit gewordene Familienpolitik trieben die Menschen strohmweise ins Kloster. Einige legten eine graue, andere eine weisse, die dritten eine schwarze Kutte an. Indem sie sich auf eine so trostlose Art kleideten, daß die Natur vor ihrer Erscheinung erzittert, so kann man erkennen, wie dringend ihre Beweggründe waren.
Die Könige thaten diesen verschiedenen Stiftungen Vorschub, weil sie das Mittel, die Macht der Familien zu dämpfen, und das Uebermaaß des Volks zu schwächen, zu verschaffen schienen. Der Arme sah das Kloster als eine Zuflucht für die Grausamkeit des Schicksals, der Unempfindliche als eine Laufbahn für die Busse, der Schwärmer als ein Feld für seine Begeisterungen, und der Staat als ein Mittel an, alle diese Narren zu logiren.
Hier ist es Zeit, die Philosophie der Politik des Pabsts und der weltlichen Potentaten zu prüfen. Der Geist des Mönchstandes, so sehr er in seinen Regeln verschieden ist, lauft auf einerley Grundsatz aus:
Unterwerfung,
Aufopferung und
Kampf. Diese drey Stücke, für welche man den Namen
Gelübd erfand, stellten dem Pabst ein Heer handvester, ausgehärteter und bereitfertiger Menschen dar, die man nicht ermangelte gut zu füttern, und in der Unwissenheit zu erhalten, und die auf nichts als den Wink ihrer Generale warteten. Mitten aus diesem Heere schrieb Johann XXII. jenen merkwürdigen Brief
Den Brief Johann XXII. an Kaiser Ludwig IV. liest man bey
Aventinus Lib. 7., pag. 609. Er enthält, daß der Pabst Oberherr im römischen Reiche sey, und den Kaiser abschaffen, und die Krone vergeben könne, und daß dem Pabste alle europäischen Souverains in weltlichen und geistlichen Sachen unterwürfig seyn müssen. etc. etc.
Der Kanzler des Kaisers, Udalricus von Augspurg, setzte eine Antwort auf diesen Brief auf, welche sich in den ersten Worten mit dem Compliment anfängt:
Bestia de mari transcendens!
(Apocalyps. c. 13. V. I. Vid. Opera Trithemii. P. II. pag. 312.)
Anm. d. Ueb., welchen man eben sowohl wegen der Vermessenheit seines Inhalts anführt, als wegen seiner Seltenheit.
Und in Ansehen der weltlichen Fürsten? – – – Ist die Bevölkerung ein wesentlicher Nutzen für den Staat oder nicht? Diß ist eine Frage, die noch nicht bestimmt ist. Niemand als die Geschichte kann sie entscheiden.
Die Römer, welche unstreitig die weisesten Beyspiele auf der Erde gegeben haben, führten die Abnahme der Bevölkerung ein, sobald sie solche für nöthig fanden. Die muhamedanischen Fürsten, ihre Nachfolger, trieben diese Politik noch weiter, als sie die grausame Gewohnheit der alten barbarischen Nationen zurückruften, und die eine Hälfte der menschlichen Gattung verstümmelten, indem sie die andere Hälfte der Freyheit und Fruchtbarkeit beraubten. Die christlichen Prinzen, Erben der Gesetze und der Politik der Römer, ihrer Vorfahren, veränderten den Handgrif, je mehr sie den Vortheil der Maxime einsahen. Sie führten statt der Verstümmlung eine freywillige Aufopferung ein.
Die einstimmige Staatskunst so vieler Nationen streitet für unser Urtheil.
Allein hievon ist nicht die Rede. Es fragt sich, daß es gewiß ist, daß nicht der Geist des Aberglaubens die Stiftung der Klöster herfürbrachte. – Wie nun, wenn ihr Ursprung politisch wäre? Sind die Gründe, die ihr in euren Schriften anführt, Träumere der Staatslehre, entsprechend, uns zu bewegen, die Klöster abzuschaffen?
Wisset, daß der Grundsatz des Staats nicht darinn bestehe, Ueberfluß an Menschen zu haben, sondern dienige Anzahl, welche vorhanden ist, so glücklich zu machen, als möglich ist. Anstatt diese Unglücklichen, die ihr verfolgt, auszurotten, gebt sie der Menschlichkeit zurück. Machet sie weise, fleissig, der Gesellschaft nützlich. Lasset sie in ihren Klöstern; aber lehret sie statt der unnützen Speculationen Handwerker darinn treiben, drechslen, tischlern, Hemde flicken.
In der That, es war ein grosser Unterschied zwischen den Tempelherren, die ihr anführet, und unsern Kapuzinern. Jene waren keine gemeinen Mönche; es waren kriegerische Pfaffen, wie die Maltheser, ihre Nachkommen. Sie waren zahlreich, sie hatten bevestigte Klöster in allen Provinzen Europens. Ihre Macht war gefährlich, und ihr Reichthum dem Fiskus nützlich. Vernehmet eine Anekdote! Moderaisoneurs! um euch von der Thorheit eurer Bemühungen zu überzeugen.
Auf den Nicenischen Concilium ereigneten sich grosse Bewegungen, ob den Mönchen erlaubt werden sollte, Weiber zu nehmen. Es ist nichts geringes, den Menschen die Liebe zu rauben. Ein gewisser Paphnutius, welcher heimliche Instruktionen vom Kaiser und von den Königen in Frankreich und England in der Tasche hatte, widersetzte sich dem Entschlusse des Conciliums. Er trug vor, daß man sie entweder in der Unfruchtbarkeit erhalten oder in die Welt laufen lassen müßte.
Alle Gemüther begriffen, daß die Wohlfahrt der Staaten das erstere erfodere. Acht hundert Jahre später kam diese Frage wieder in Vortrag. Es erschien mitten aus einem Winkel in Deutschland – Bayern – ein Gesandter in der Versammlung der Väter zu Trident, welcher im Namen seines Herrn Vergünstigung der Priesterehe verlangte. Die Gründe, so er anführte, waren triftig. Zum Glück machte er zween Schnitzer in seinem Vortrage wider die Grammatik. Der Fiskal fieng sie auf; man fand seine Sache unzusammenhängend, und schickte den Gesandten wieder nach Haus, um seine Rede besser zu studiren.
Heute war unsere Caravane zu Rodau, einem eine Meile von der Stadt entlegenen Dorfe, um die Trümmern von den Oefen des Seefels, eines berufenen Schmelztieglers, zu sehen. Die Wiener erzählen Wunderdinge von diesem Mann. Man muß gestehen, wenn sie keine Goldmacher sind, so besitzen sie doch die Religion derselben. Ein Mann, der die Protokollen der Stadt genau kennet, versichert mich, daß man im Jahr 1752 dreyzehntausend und acht und vierzig Laboranten, Geisterbeschwörer, Freymaurer und Schatzgräber gezählt habe.
Was jenen Seefels betrift, so weis man nichts von seinen Lebensumständen. Er war ein terrae filius. Sein Abentheuer zu Wien, ist, von der Policey aufgehoben, und auf eine Festung begleitet zu werden. Ein Zufall, der genau die Wirkung hatte, welche sich eben so oft zuträgt, als man die Schwärmerey angreift. Das Publikum hielt den Menschen für einen Märtyrer seines Geheimnisses. In diesem Augenblick war die ganze Stadt von der Wirklichkeit der Goldtinctur überzeugt; die Laboranten kauften neue Blasbälge und Kohlen: sie setzten die Kolben auf frisches Feuer. Die Habseligkeiten des Adepten wurden im Wettstreiche als Reliquien verkauft.
Die Krankheit griff so sehr um sich, daß man Leute vom Stande davon ergriffen sah. Vor einigen Tagen besuchte mich ein Kavalier und bat mich um mein Urtheil über ein kleines Büchelgen, das er mit viel Ehrfurcht aus einem seidenen Futteral herfür zog. Es war holländisch geschrieben. Die erste Stelle die mir ins Gesicht fiel, als ich es aufschlug, war, daß der Sohn Gottes aus Quecksilber gemacht wäre. Ich bat ihn, das Buch so geschwind möglich, der heiligen Inquisition zu überliefern. Er hielt mich für unsinnig, und von dem Augenblicke an schätzte er es desto höher.
Soviel Uebels kann eine zur Unzeit ergriffene Maasregel stiften! Vergebens spähet die Policey die Schlupfwinkel der heutigen Seefelse aus. Umsonst zerschmettert man ihre Oefen, und wirft ihre Bücher ins Feuer: Man heilt die Gebrechen des Geistes nicht mit Gift. Dieser Schwärmer machte die ganze Monarchie glauben, daß er im Besitze des Geheimnisses wäre. Seine Ueberredungskunst war so groß, daß er den Officier, welchem er übergeben war, zu bewegen wußte, mit ihm von der Festung zu entfliehen. Vermuthlich bildete sich der Officier ein, mit einer Unze Arkanum sein Glück zu heften. Ich weis nicht, ob sich diß ereignet hat: aber soviel weis ich, daß eine Art Verachtung von Seiten des Policeyaufsehers besser an ihrem Platz gewesen wäre, als die Gewalt.
Nie hat die Goldmacherkunst eine grausamere Verfolgung erlitten, als unter der Regierung des van Swieten. Dieser Despot ließ alle Werke und Handschriften in dieser Materie, die er in der kaiserlichen Hofbibliothek fand, deren Vorsteher er war – Werke, die nach der Sage ihrer Anhänger unschätzbar und unwiderbringlich sind – ausheben und vergraben. Man behauptet, daß sein Lehrmeister, der berühmte Boerhave, das Geheimniß, Gold zu machen, besessen hätte ..... Es scheint deme zu seyn, wann es wahr ist, daß er seiner Tochter acht Millionen holländische Gulden hinterlassen hat ..... Nachdem van Swieten, nach dem Tode seines Lehrmeisters lange Zeit vergebens dem Geheimnisse nachgespühret hätte, so hätte er einen tödtlichen Verdruß empfunden, daß ihm seine Versuche fehlgeschlagen. Von diesem Augenblick wäre er, vom Neide und der Eifersucht angetrieben, ein abgesagter Feind der Alchymie und ihrer Günstlinge geworden. Schöne Noten in den Allmanach der Adepten, aber nicht der Philosophie.
Ohne Zweifel ist van Swieten in seinem Eifer für die Wahrheit und für die gesunde Weltweisheit zu weit gegangen. Alle Naturkündiger kommen heute zu Tag überein, daß die Kunst Metalle zu machen, möglich sey: aber sie gestehen, daß sie nur schwer zu finden wäre. Dann es gehören zwoerley Sachen dazu, welche nicht leicht sind: erstlich, das, was zugegen ist, vernichten; zweytens, etwas Neues dafür zu erschaffen. Nichts destoweniger sagt ein gewisser Töpfer, Euklid. wenn ich Plaz hätte, so wollte ich eine Welt erschaffen, so gut wie die gegenwärtige ist.
Es ist unstreitig, daß ein allgemeiner Geist über die ganze Natur herrschet, aus welchem alle vorhandenen Wesen ihr Leben, das ist ihre Seele, empfangen. Diese bewegende, erzeugende und erhaltende Materie muß in den Gränzen unseres Verstandes liegen, weil er selbst ein Antheil derselben ist. Wir können nicht läugnen, daß wir den Versuchen der Adepten die Erfindungen einiger der vornehmsten Arzneymittel schuldig sind. Der Stahlgeist, die Goldtinctur, die Natur des Quecksilbers, der Carmin, das Porcellan ist von Männern entdeckt worden, die den Stein der Weisen suchten.
Lassen wir den Goldmachern Menschlichkeit widerfahren. Diese Unglücklichen suchen niemand zu schaden als sich selbst: denn wenn man ihren Geschichtschreibern glauben darf, so ist ihre Moral gut. Wie! ihr verfolgt die Freymaurer und Goldmacher? Es ist widersinnisch, Leute um Geheimnisse plagen, welche keine besitzen.
Aus einem beynahe ähnlichen Gesichtspunkte betrachte ich ihre Sectirer, die Geisterbanner. Kaum sollte man glauben, daß es möglich wäre, daß es Menschen gebe, die von der Vernunft so sehr entblößt, und von dem Laster des Geizes so sehr unterdrücket sind, daß sie zu dem unsinnigsten unter allen Uebeln greifen. Wenn die Policey die sogenannten Adepten mit dem Arm der Gewalt verfolgt, so mag sie noch Grund haben; die Goldkünstlerey ist eine Ausschweifung des Genie: vielleicht auch ein Mittel zum Betrug. Aber das gegenwärtige Uebel ist eine Wirkung der Verzweiflung.
In der That beobachtet man, daß sich nur Leute, die in der äussersten Noth stecken, und denen die Erziehung oder das Elend den Gebrauch der Vernunft versaget hat, damit beflecken. Welcher denkende Mensch, der sich in erträglichen Umständen befindet, sollte sich in ein so verzweifeltes Unternehmen einlassen! Für diese Gattung sollte die Policey gelindere Heilmittel haben: Gebt ihnen zu leben, so werden sie dem Teufel gegen seine Bemühung danken.
Ich erinnere mich eines Zufalls, welcher beweißt, wie stark die Kraft des Elendes diese Unglücklichen wider den Eindruck der Vernunft macht. Ich befand mich auf dem Gute des Marquis Lussac, als dieser Herr von seinem Beamten den Bericht erhielt, daß sich in einem Dorfe seines Gerichtszwangs eine Gesellschaft formirt hätte, welche unter der Anführung eines gewissen Vagabonden, sich verabredet hätte, diesen Abend den Teufel zu beschwören. Der Beamte bat sich Verhaftungsbefehle aus. Der Marquis beschloß, daß man sich mit soviel Klugheit und Mäßigung als möglich wäre, des Beschwörers und der ganzen Gesellschaft versichern sollte. Ich bat den Marquis sehr inständig, zu gestatten, daß ich seinen Verwalter bey dieser Ausführung begleiten dürfte. Da er meine Beobachtungsgierde kannte: so geruhete er aufs gütigste einzuwilligen. Ich verfügte mich also mit dem Beamten an den benannten Ort.
Nachdem wir die Mitternachtstunde abgewartet hatten, binnen welcher Zeit der Beamte eine Anzahl Schergen und Wächter versammelte: so begab sich unsere Gesellschaft, aus 26 Mann bestehend, in den Keller, wo die Beschwörung im Werke war. Wir trafen einen Krais von zehen Männern an, welche auf ihren Knien lagen, den Rücken gegeneinander gewendet. Im Mittelpunkte stund der Beschwörer, in der einen Hand eine geweihte Kerze, in der andern ein kleines Büchelgen, haltend, so aus schwarzen Blättern mit blutrothen Buchstaben, bestund. Er sprach laut, als ich mich, mit dem Verwalter an der Spitze unserer Truppe, näherte. Auf einem Tischgen ausserhalb dem Kraise, einen Schritt vom Beschwörer, stunden zwo brennende Kerzen, zwischen welchen ein Todtenkopf lag, um den sich eine ausgeschoppte Schlange wand. Um dieses war ein drey Zoll breiter Zirkel von Kohle gezogen, worinn sich allerhand Züge befanden.
Sie sehen, Karl, daß die Illusion ziemlich getroffen war. Ich lauschte dem Verwalter ins Ohr, einige Augenblicke zu verziehen, um wahrzunehmen, was unsere Erscheinung – nicht bey den Ministranten, sondern – beym Beschwörer, welcher vermuthlich von dem Betrug am besten überzeugt seyn mußte, für einen Eindruck machen würde. Der Kerl fuhr mit einer Standhaftigkeit, die einer nützlichern Unternehmung würdig gewesen wäre, in seinem Monolog fort. Allein kaum hatte sich der Verwalter erklärt, so änderte er den Ton. Er fiel auf die Knie, um Gnade zu flehen. Seine Anhänger, in der Meinung, daß wir die Geister wären, welche die Geldsäcke mit sich brächten, ließen sich nicht aus dem Gleichgewichte bringen. Es war ein Absatz ihres Katechismus, daß der Böse kommen, und ihnen scharf zusetzen würde; daß er allerhand Gestalten annehme, um die Beschwörung zu verwirren; daß er sich sehr unnütze zu machen pflege, bevor er die Schätze ausfolge; alles beruhete auf ihrer Standhaftigkeit, seine Anfälle auszuhalten.
Vergebens befahl der Beamte den Bauren, sich zu erheben. Umsonst blöckten sie die Schergen an. Die Sinnen dieser Unglücklichen waren abwesend. Man mußte sie mit Flintenkolben und Wachtstöcken zu sich selber bringen. Mit Thränen in den Augen sah ich zu, wie sie sich umzerren, in die Rippen schlagen, und mit Stricken binden ließen, ohne sich zu rühren, oder einen Laut von sich zu geben. So stark ist die Einbildungskraft bey kranken Gemüthern. Der Marquis Lussac versicherte mich, daß die Bauern im Verhör eingestanden hätten, daß sie unsere Rotte für Teufel gehalten, welche sie zu versuchen kämen.
Gerichtskommissare zu Paris oder Wien! wie hättet ihr die Bauren verurtheilt? Wären Schanzkärche und Kerker genug vorhanden gewesen, die Unglücklichen zu belegen? .....
Der Marquis Lussac bestrafte nur den Anführer, indem er ihm sein Landesgebiete verboth. Die Bauren entließ er gleich nach dem Verhör, nachdem er dem Pfarrer auftrug, für die Heilung ihrer Vernunft zu sorgen, und sie zu den Erkenntnissen der Religion zurück zu bringen. Nachdem er dem Dorfrichter wegen der Vernachläßigung seiner Gemeinde einen verdienten Verweis gegeben hatte, so empfahl er ihm, für die Nahrung dieser verzweifelten Haushaltungen Mittel ausfindig zu machen.
Diese Scenen rühren das Herz, und prägen einem Gemüthe, welches das Elend der Menschen fühlt, Eckel zu leben ein.
Im Reiche der Künste besitzt Wien einige Seltenheiten vom ersten Rang. Die Maschinen des Herrn von Kempele, königlichen Raths bey der Kammer zu Preßburg, erreichen alles, wozu der menschliche Geist gelangen konnte. Sein Schachspieler, die größte Erfindung unsers Jahrhunderts in der Meßkunst, ist bekannt.
Er erschien damit im Jahr 1768. Sie bestehet aus einem Tische, woran eine menschliche Figur sitzt, welche mit jedem, der Lust hat im Schachbrete spielt, das sich auf dem Tische gestellt befindet. Man hat noch kein Beispiel, daß die Figur eine Parthie verlohren hätte. Sie hat, auch die berühmtesten Schachspieler zur Verzweiflung gebracht. Die Figur, welche in Menschenhöhe ist, scheint nachdenkend, mit dem rechten Arme auf den Tisch gelehnt, zu sitzen. Sie läßt den Spieler so lang nachsinnen, als er will. Sobald er gezogen hat, so erhebt sie ihren linken Arm, und ergreift einen ihrer Steine: ist sie im Falle zu schlagen, so berührt sie den Stein des Gegners, welchen es trift, zum Zeichen, daß man ihn wegthun solle. Thut der Mitspieler einen Zug, der wider die Regel des Schachspiels ist, so nickt sie mit dem Kopfe, und zeucht nicht, bis der Fehler verbessert, und die Ordnung des Spiels hergestellt ist.
Man erstaunt über die Unternehmung des Erfinders, wenn man dieses Spiel kennet. Was für eine Rechenkunst gehörte dazu, nur die unendliche Menge der Verhältnisse und Combinationen, welche darinn liegen, in eine Summe zu bringen, gegeneinander aufzuheben, zu vergleichen, und das Produkt auszuziehen!
Der Mechanismus des Stücks ist übrigens, wie man sagt, nicht ausserordentlich. Hievon ist auch die Frage nicht: man spricht blos vom geistigen Theile der Maschine. Gleichwohl sagte mir ein Künstler, welcher sich unter den Zuschauern befand, daß sich etwas zugegen befände, so in der Hebekunst ganz neu wäre. Es ist, sagte er, daß sich der Arm der Figur in einem Halbzirkel beweget, wenn sie nach gewissen Steinen greift. Die Mechaniker wußten bisher diese Bewegung nur triangular zu machen.
Die Maschine wirkt gänzlich durch sich selbst. Sie erhält nicht den mindesten äussern Einfluß. Niemand steckt darinn verborgen. Der Tisch, an welchem sie ruhet, hat nicht das geringste Verständniß weder mit dem Fußboden noch mit einer andern Parthie des Zimmers. Man kann sie, ohne ihr Wesen im mindesten zu verändern, selbst mitten unter dem Spiele, von einem Zimmer ins andere übersetzen. Man hatte die Gefälligkeit für uns, sie zu eröfnen, um ihren innern Bau zu sehen. Eine Menge Röllchen, worüber Saiten gespannt waren, verwirrte meinen Begrif: es kam mir vor wie eine Reihe Vernunftschlüsse, deren letztes Argument darinn bestehet, daß die Parthie gewonnen ist.
Ein Bekannter des Herrn von Kempele erzählte mir folgende Anekdote von dem Ursprung dieses Meisterstücks. Herr von Kempele befand sich in der Antichambre zugegen, als Guyot seine berühmte Handgriffe vor dem Hofe machte. Man muß gestehen, rief die Kaiserin aus, indem sie sich zum Herrn von Kempele wendete, daß uns die Franzosen in diesem Stücke bisher übertroffen haben. – – Allergnädigste Frau, versetzte der Herr von Kempele, wenn Ew. Majestät geruhen: die Deutschen könnten wohl noch bessere Dinge – aber – es fehlt an zwey Stücken – Geld? erwiderte die Monarchin – – und Zeit, setzte Herr von Kempele hinzu. Gut, ich nehme die Aufforderung an; beedes sollen sie haben. In der That gab die großmüthige und in der Beförderung der Künste nie ermüdete Prinzessin dem Herrn von Kempele ein Billiet an die Kammer zu Preßburg.
Das Versprechen desselben schien bey Hofe vergessen zu seyn, als er unvermuthet mit seinem Schachspieler erschien, und die Welt in Erstaunen setzte. Man muß gestehen, daß diese Erfindung alles übertrift, was die Franzosen und alle andere Nationen bisher in der Maschinenkunst geleistet haben. Die Gesellschaft der Wissenschaften zu Londen bot, wie man sagt, dem Herrn von Kempele 10,000 Guineen für das Modell.
Dieser Gelehrte arbeitet wirklich an einem neuen Wunderstücke, welches, wie er erklärt haben solle, seinen Schachspieler noch übertreffen wird. Man weis nicht, was es ist; dann Herr von Kempele ahmt den Göttern nach: er arbeitet so lang in der Dunkelheit, bis eine Welt fertig ist.
Ende der zwoten Parthie.
