
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Anda hermosa! Oh, anda capitana, dulce!« flüsterte der Arriero mit schmeichelnder Stimme dem zögernden Tiere zu. Auch die gehorsame Mula schien ein Grausen befallen zu haben vor dem Abgrund, der sich vor ihr auftat. Ich starrte fassungslos in die gähnende Schlucht hinab.
Jenseits stiegen dunkle Felsen jäh, fast senkrecht empor, und der Schluß lag nahe, daß die Seite, an der wir hinabklettern sollten, genau das Gegenstück zu der bildete, die wir vor uns sahen.
» Anda, valida mio! Anda capitana!« klang es wieder in weichem Tone von den Lippen des Führers.
Außer ihm war noch ein indianischer Peon vorhanden und mein Diener Heinrich, der mit sehr sorgenvoller Miene hinter mir hielt.
Zwei Saumtiere trugen mein Gepäck.
»Da sollen wir hinunter, Herr Doktor?« fragte Heinrich, und das Beben seiner Stimme verriet seine Unruhe.
Er hatte in meiner Schwadron den Krieg mitgemacht und mehr als eine tolle Attacke geritten, er war ein Mann, dessen Mut nicht anzuzweifeln war; aber angesichts dieser 3000 Fuß tiefen Barranca schien er doch ins Wanken zu kommen. Übrigens war mir auch gar nicht wohl zumute. Zwar wußte ich bereits aus Erfahrung, wie vorsichtig und zuverlässig die Maultiere des Landes auf gefährlichen Wegen sind, kannte diese Abgründe und ihre Durchquerung längst aus Beschreibungen, aber ein anderes ist es doch, sie vor sich in schreckhafter Wirklichkeit gähnen zu sehen, als von ihnen lesen.
Mit möglichster Ruhe erwiderte ich dem ehemaligen Husaren: »Es ist weniger gefährlich, als es aussieht, Heinrich. Die Tiere sind an diese Pfade gewöhnt. Überlassen Sie sich ruhig Ihrer Mula, und sie wird Sie sicher hinübertragen.«
Er murmelte etwas in sich hinein, was ich nicht verstand, und warf einen trostlosen Blick in die Tiefe.
»Anda, adelante! Capitana!« ermunterte der Führer von neuem sein zögerndes Tier, und die Mula setzte sich in Bewegung und ließ das silberne Glöckchen, das sie am Halse trug, wiederum erklingen.
Die wohlgeschulten Tiere folgten der Capitana, das meinige zunächst, dann das Heinrichs. Die zwei beladenen Mulas schlossen sich an, und der braune Peon des Arriero bildete den Schluß. Wir ließen den Tieren ruhig den Zügel; die spanischen Sättel kamen uns bei diesem Ritte wohl zustatten. Auf schmalem Fußpfade bewegten wir uns zur Tiefe, ein Rückwärts gab es für uns nicht, denn unmöglich war es, umzukehren, unmöglich für Tier und Mensch. Zu unserer Linken erhob sich schroff die kahle, dunkle Felswand, zur Rechten gähnte der Abgrund. Es kostete Energie, den Schwindel fern zu halten.
Melodisch klang vor uns die Glocke der Capitana. Vorsichtig schritt das Tier hinab, vorsichtig und gemessen. Ich heftete den Blick auf die Gestalt des Arriero vor mir, um nicht immer den Abgrund vor Augen zu haben. Von den geräuschlos mir folgenden Maultieren gab nur ihr Schnauben zuweilen Kunde. Mich umzuschauen wagte ich nicht. Das Schweigen meines sonst so munteren Begleiters ließ darauf schließen, wie ernst er gestimmt war.
Kein Land der Erde weist auf beschränktem Raume eine wechselvollere, bald anmutig liebliche, bald großartige oder schreckenerregende Bodengestaltung auf als Guatemala. Die vulkanische Tätigkeit der Vorzeit hat hier mit Gigantenkraft Fels auf Fels getürmt und Spalten zwischen ihnen gerissen von einer solch schauerlichen Erhabenheit, wie wir sie jetzt mit innerem Beben vor uns sahen.
Nachdem wir einige Minuten auf dem mählich sich senkenden Felspfad langsam uns fortbewegt hatten, klopfte das Herz weniger ungestüm, und das Auge wagte es, zur Tiefe hinabzusehen.
Drüben war die Felswand, sonnig beleuchtet, während wir im Schatten ritten; sie war wohl 300 Schritte entfernt. Unter uns die grüne Talsohle, mit Büschen durchsetzt, und Felsbrocken, zwischen denen ein glitzernder Bach sich hinwand.
Das Bild war lieblich, doch immer mußte nach einem solchen Blicke in die Tiefe das Auge wieder einen Halt in der Nähe suchen, er verwirrte die Sinne.
Tiefer und tiefer gelangten wir hinab, oftmals in Zickzackwendungen, und mit der zurückkehrenden Seelenruhe wuchs das Interesse an der Umgebung. Mächtiger und mächtiger, düsterer, himmelanstrebender stiegen die Felswände um uns empor, und die Wucht der gigantischen Massen sprach mit jedem Schritt zur Talsohle eindringlicher zu uns. Doch die grauenvolle Majestät dieser Einrahmung vermochte die Anmut des Grundes, dem wir näher und näher kamen, nicht zu beeinträchtigen. Ehrfurcht vor den Gewalten der Urzeit mischte sich mit dem Behagen an freundlicher Gegenwart.
Endlich nach einem Ritte, der länger als eine Stunde gedauert hatte, berührten die Hufe der Capitana das Gras des Tales, und dicht hinter ihr verließen wir den Felspfad, freudig aufatmend.
Der mit Blüten geschmückte, von Büschen durchsetzte grüne Teppich zu unseren Füßen, aus dem einzelne gewaltige Ceibabäume aufragten, die wir von oben für Gestrüpp gehalten hatten, zerstreute Felsbrocken, zwischen denen sich der glitzernde, murmelnde Bach durchwand, boten ein Bild, so lieblich und friedlich, daß wir die Schrecken der letzten Stunde rasch vergaßen und selbst der einengenden, finsteren Riesenmauern, über denen sich der wunderbar klare, tiefblaue Himmel der Tropen wölbte, kaum noch achteten.
»Für Jemsen eene scheene Jegend, Herr Doktor,« sagte mein Heinrich und sprang, dem Beispiel des Führers folgend, aus dem Sattel, »aber für meiner Mutter Sohn taugt et doch nich.«
»Nun, wir haben die Kletterpartie hinter uns.«
»Und die Jeschichte jeht wieder los, wenn et nach oben jeht. Et is doch eene unheimliche Sache, so janz von die Laune eenes Maultieres abzuhängen.«
»Man gewöhnt sich an alles, selbst an diese Barrancas und ihre schwindelerregenden Steige.«
»Ick jönne sie die Leute hier neidlos; ick halte et mit jlattem Boden, wenn ick im Sattel bin.«
»Nur getrost! Wir erreichen auch bald wieder die Ebene.«
Mein Führer gab die Absicht kund, die Tiere zu tränken und zu füttern, ehe wir den Weg nach oben nahmen, und ich war ganz damit einverstanden.
Man sattelte die Tiere ab, und Heinrich, der geborene Koch, der seine kulinarischen Talente oft genug in Frankreich zur Geltung gebracht hatte, zündete mit überraschender Geschwindigkeit Feuer an und brachte in unserem Blechtopfe Wasser zum Sieden. Bald hatten wir Tee in Blechbechern vor uns, Tortillas, die wir am Morgen gekauft hatten, und kalten Hammelbraten.
Es war der achte Tag, seitdem ich die Stadt Guatemala auf der Straße nach Norden hin verlassen hatte. Teobaldo, der Arriero, war mir von unserem Generalkonsul als ein zuverlässiger Mann empfohlen worden, und ich hatte ihn für meine Fahrt um so lieber in Dienst genommen, als mir der Mann, – er war ein Vollblut-Indianer – durch sein Äußeres Vertrauen einflößte und seine Tiere kräftig und wohl genährt waren.
Meine Reise über den Ozean galt den Ruinenstädten Mittelamerikas, von denen schon Cortez in seinem vierten Briefe an Kaiser Karl V. bei der Schilderung seines grauenvollen Zuges nach Honduras spricht.
Seit früher Jugend trieb mich die Sehnsucht nach diesen Resten einer eigenartigen untergegangenen Welt.
Der Krieg hatte meine Reise verzögert, doch jetzt war ich nach mancher Mühsal auf dem Wege, meinen Wunsch zu verwirklichen.
Heinrich Schmidt, mein Putzkamerad, während ich mein Jahr abdiente, 1870 mein Kriegskamerad, ein auf alle Fälle zuverlässiger Mensch, begleitete mich um so lieber, als er sehr geneigt war, ein Stück von der Welt zu sehen. Er war von Hause aus Schneider, hatte aber in Frankreich gezeigt, daß er auch die eiserne Elle recht gut zu brauchen verstand.
So waren wir beiden Deutschen, nachdem wir in San Thomas gelandet waren und von da den Weg nach der Hauptstadt genommen hatten, nach längerem Aufenthalte dort inmitten des wild zerklüfteten Teiles des Landes angelangt und ruhten behaglich auf dem Grunde einer Barranca, von deren schauerlichen Größe keine Schilderung auch nur einen annähernden Begriff zu geben vermag.
Der Feldzug hatte uns übrigens an manche Entbehrungen gewöhnt, so daß wir die Beschwerden der Reise in unwirtsamen Gegenden leichter ertrugen, als ohne diese harte Schule möglich gewesen wäre.
Wissenschaftlich war ich für meine Reise nicht übel vorbereitet, ich hatte sogar meinen Scharfsinn an den beiden geheimnisvollen Handschriften versucht, die die Bibliotheken in Dresden und in Madrid seit Jahrhunderten bewahren, und die unzweifelhaft aus Mittelamerika stammen. Freilich war auch ich dabei nicht viel weiter gekommen als meine Vorgänger.
So war ich jetzt auf dem Wege nach Palenque und Uxmal, um an Ort und Stelle meine Studien über ein Volk fortzusetzen, das uns außer seinen Bauten und Hieroglyphen keine Spuren seines Erdendaseins hinterlassen hat.
Schmidt und ich hatten die Begierde nach Speise und Trank gestillt, und mein Arriero, der mit seinem Stammesgenossen abseits von uns saß, blickte nach der Sonne und mahnte zum Aufbruch.
Rasch waren die Saumtiere mit der Geschicklichkeit dieser Leute beladen, wir im Sattel, Teobaldo ließ sein mahnendes Horn ertönen, und es begann der Aufstieg an der himmelanragenden Felsenwand.
Wir fanden ihn – es mochte das wohl daran liegen, daß man jetzt nach der Höhe zu strebte – weniger bedenklich und gefährlich als den Abstieg und erreichten nach zwei Stunden die Ebene, die der Felsspalt so jäh unterbrochen hatte.
Nach der Hitze auf dem Grunde der Barranca wehte uns die Luft hier oben, die uns am Morgen so sehr erfrischt hatte, recht kühl an, und wir hüllten uns fester in unsere Ponchos. Die Nacht brach herein, während wir den Weg zwischen Felstrümmern und Buschholz suchten, und das Haupt des gewaltigen Quezaltenango, der fern am Horizonte emporragte, hüllte sich in düsteren Feuerschein, ein warnendes Zeichen, daß die Kräfte, die einst diesen Boden erschütterten, nur schlummern, nicht erstorben sind.
Unser Führer leitete uns zu einem in einem Tale liegenden Rancho, wo wir gastliche Aufnahme und die geringen Bequemlichkeiten fanden, die ein solches Heim bieten kann. Eier, die landesüblichen schwarzen Bohnen, Schokolade und frisch gebackene Tortillas bildeten unser Nachtmahl. Wir hatten in Frankreich oft schlechter gegessen. Der Ranchero, ein freundlicher Mann, erfreute uns mit selbstgefertigten Puros, wirklichen Zigarren im Gegensatze zu Cigarritos, die unseren Zigaretten entsprechen, von vorzüglichem Tabak. Ich unterhielt mich etwas mit dem Manne, der wenig von der Welt wußte und nur von Zeit zu Zeit die Stadt Quezaltenango aufsuchte, um dort seinen Tabak und andere Erzeugnisse seiner kleinen Pflanzung zu verkaufen. Seine Frau, die uns beim Abendbrot Gesellschaft leistete, hatte die Provinzstadt nur einmal in ihrem Leben gesehen. Beide hatten von Ruinen aus der alten Heidenzeit nie etwas vernommen.
Da ich müde war vom langen Ritt, suchte ich bald meine Hängematte auf. Heinrich hatte sie, während ich mit dem Ranchero plauderte, gut angebracht.
Nach ruhig verbrachter Nacht – Moskitos gab es hier glücklicherweise nicht – erhoben wir uns bald nach Sonnenaufgang. Die Tiere hatten geruht und reichlich Futter bekommen. Schokolade, Eier und Tortillas bildeten unser Frühstück. Auch für Reisevorrat des landesüblichen Getränkes hatte die Frau gesorgt. Die anspruchslosen Leute verweigerten die Annahme von Bezahlung, doch gelang es mir, der Frau einen kleinen goldenen Ring mit einem Türkis aufzudrängen, der ihr sichtlich große Freude bereitete.
Aus dem lauschigen Tal, das sich nach Westen hin öffnete, erreichten wir wieder die Höhe, um über einen kahlen Gebirgskamm hinwegzugehen. Die Aussicht von hier war von einer Erhabenheit, daß ein andachtsvolles Gefühl sich tief im Herzen regte. Allmutter Erde zeigte ihr Angesicht hier in ihrer ganzen jungfräulichen Schöne. Hochragende Berge von malerischster Gestaltung ringsum, rötlich bestrahlt von der noch niedrig stehenden Sonne und umflattert von phantastisch geformten, langsam sich lösenden Nebelstreifen. Dazwischen waldige Hügel, Savannen mit frischem Grün und rauschende Bäche.
Weit hinaus schaute der Blick auf die zackigen Felsmassen, die den Horizont abschlossen.
Und noch mehr. Gleich darauf führte uns der hoch liegende Weg an einem See hin, der still und friedlich, wie soeben aus der Hand des Schöpfers hervorgegangen, tief unter uns lag, eingefaßt von Felsen und waldigen Hügeln. Die noch schräg fallenden Sonnenstrahlen verliehen dem Bilde einen zauberhaften Reiz.
Nur ungern verließ ich trotz der kalten Luft eine Stätte, deren landschaftliche Schönheit ihresgleichen auf Erden sucht.
Ich hatte Italien, Griechenland gesehen, ich war in den Fjorden Norwegens und auf seinen Höhen gewesen, ich kannte die Schweiz und Tirol, doch nichts von allem, was diese Landschaften auszeichnet, konnte sich dem Anblick vergleichen, den uns hier die Höhe der Cordillere Guatemalas bot.
Ganz leise und andächtig sagte Schmidt, der hingerissen war, wie ich: »Det is aber fein, Herr Doktor.«
Welch ein schönes Bild! Welch ein glückliches Land, das solch erhabene Schönheit in so reichem Wechsel birgt!
Und dazu einigt das sich aus dem Meere erhebende Land, dessen Bergriesen himmelan streben, alle Klimate der Welt in seinem Schoße; von der tropischen Glut der Niederungen an den Küsten, der tierra caliente, durch die gemäßigte Zone der tierra templata hinauf zur tierra fria der kalten, deren Winde den Wanderer eisig durchschauern.
Mit Bedauern schieden wir von dem wunderbaren Ausblick auf den Amitatlansee, um eine mit Felsbrocken überstreute und von karger Vegetation bedeckte Ebene zu überschreiten.
Nach Mittag lag wiederum eine dieser Barrancas vor uns, die wir unter ähnlichen Umständen durchqueren mußten, wie sie uns gestern Schrecken einflößten.
Doch besaßen wir, d. h. Schmidt und ich, diesmal größere Ruhe, wir hatten uns von der Vorsicht und Sicherheit der trefflichen Tiere, die wir ritten, überzeugt. Die beiden Indianer waren ganz apathisch der Gefahr gegenüber.
Der Arriero entlockte, ehe wir den Aufstieg begannen, einen weithin hallenden Ton seinem Büffelhorn und lauschte dann. Es ist das ein Zeichen, daß eine Maultierkarawane den Felspfad betreten will und wird von An- wie von Absteigenden gegeben; oftmals wird auch ein Läufer vorausgesandt, wenn die Zahl der Peons es erlaubt.
Der Untergang für alle ist es, wenn sich zwei Maultierzüge auf solchem Pfade begegnen.
Dreimal ließ der Arriero sein Horn ertönen. Keine Antwort folgte.
Darauf ritt er auf der Capitana hinab in die gähnende Schlucht, deren Wände näher aneinander gerückt waren, als jene, die wir gestern durchkreuzt hatten, und darum finsterer und drohender erschienen.
In derselben Ordnung wie gestern folgte man dem Führer, der auch auf dem Wege sein Horn noch brauchte. Langsam, oftmals nur Schritt für Schritt, hatten wir mehr als zwei Drittel des schwindelerregenden Pfades zurückgelegt, als zum Entsetzen des Arriero um einen Vorsprung, den ein hervorstehender Felszacken bildete, ein Reiter auf einem Maultier erschien, ein dunkel gefärbter Bursche, der nicht wenig erschrocken schien, als er unsere Karawane vor sich erblickte.
» Dios nos guarda!« (Gott behüte uns!) stöhnte mein Führer, der dicht vor mir ritt, auf. » Por el amor de Dios, hombre, was willst du?«
Der Mann, der vor ihm hielt, starrte mit Augen, in denen der Schrecken sich deutlich ausdrückte, zu uns her.
Auch unsere Karawane stand still, und Entsetzen durchschauerte auch mich; denn ich erkannte nur zu deutlich, daß der schmale Pfad, überragt von schroffen, nicht erklimmbaren Felsen, zur Seite eines viele hundert Fuß tiefen Abgrundes, dessen Wände ebenso steil abfielen als sie neben uns aufstiegen, nicht einmal ein Verlassen des Sattels gestattete, um wie viel weniger ein Ausweichen der Tiere, geschweige denn deren Wendung. Wir konnten stehen gleich zwei Hirschen, die im Kampf die Geweihe unlöslich miteinander verschränkt haben, bis der Tod uns erlöste.
»Um der Liebe Gottes willen, Mann, was tatest du? Hast du das Horn nicht gehört?«
Der braune Kerl, der ein häßliches, finsteres Gesicht hatte, antwortete nicht, er schien vor Schreck wie gelähmt. Die Lage, in der wir uns jetzt befanden, war furchtbar.
Sein Tier trug keine Glocke, war also kein Capitana.
Dies erkannte auch der Arriero.
»Bist du allein, Mann?« fragte er mit bebender Stimme.
»Allein!« rief der Mann jetzt.
Beide wechselten diese Worte in einem indianischen Idiome. Teobaldo sagte mir, daß der Fremde allein sei.
Dies gab Hoffnung, – war ein Zug von Mulos hinter ihm, waren wir alle rettungslos verloren.
»Du mußt über dein Mulo nach hinten abgleiten, amigo,« rief ihm der Führer zu, »es wird dir gelingen, und du wirft Fuß am Boden fassen und zurückkehren können.«
Der Mann murmelte etwas vor sich hin und warf einen Blick auf uns, der neben dem Entsetzen, das seine Lage bei ihm hervorrief, auch grimmigen Haß atmete.
Schon begannen unsere Tiere unruhig zu werden. Der hinter mir haltende Schmidt erkannte die Gefährlichkeit unserer Lage wie ich, und es war ihm nicht wohler zu Sinn als mir. Von den gewechselten Worten hatte er nichts verstanden, aber die Situation redete deutlich genug.
Schmidt war ein entschlossener Bursche.
»Wenn der Kerl mit sein Tier nich ausweichen kann, müssen wir et niederschießen – der Weg muß freijemacht werden,« sagte er, »ick habe doch keene Lust, hier runterzupurzeln.«
Wir führten zwei Karabiner, treffliche Hinterlader, mit, die mir aus besonderer Gunst für meine abenteuerliche Fahrt von der Spandauer Gewehrfabrik überlassen worden waren, und ich sowohl wie Schmidt trugen die Waffen am Riemen auf dem Rücken.
Ich sah ein, daß er recht hatte. Schon machte er auch seine Waffe fertig und schob eine Patrone in den Lauf.
Aber ob die Tiere, die wir ritten, schußfest waren?
Ein Schuß mußte in dieser Schlucht gleich einem Donnerschlage widerhallen.
»Hat der Mensch da noch andere Tiere hinter sich?«
Ich sagte Schmidt, daß dies nicht der Fall sei.
»Lassen Sie ihm sagen, det er sich salvieren soll, det Maultier muß jeopfert werden.«
Der fremde Mann sah augenscheinlich, daß Schmidt sich zum Schießen fertig machte und mochte glauben, es gelte ihm, denn er duckte sich jetzt auf den Hals seines Tieres.
Ich befahl dem Arriero, dem Burschen mitzuteilen, er solle sich zu retten versuchen, wir würden das Maultier niederschießen.
Teobaldo wiederholte seinen dem Fremden eben gegebenen Rat.
Jetzt machte dieser Anstalt, über den Schweif des Tieres hinabzugleiten.
Auch das war mit höchster Lebensgefahr verknüpft, denn der Fels bot nicht den geringsten Anhalt.
Langsam, immer seinem Tiere Schmeichelworte zuflüsternd, zog er die Füße aus den Bügeln, streckte die Beine nach hinten aus und bewegte sich vorsichtig rückwärts.
Es war ein Augenblick höchster Aufregung für uns, eine Bewegung des Mulos konnte den Mann in den Abgrund schleudern.
Ich sah sein verzerrtes Gesicht, die angstvoll weitaufgerissenen Augen – jetzt glitt er hinab –; aufatmend erkannte ich, daß er Boden gefunden hatte, er stand hinter dem Maultier.
Gellend schrie der Kerl jetzt: » Maledito gojos!« (Verdammte Hunde) und war gleich darauf um den Vorsprung verschwunden. Das Maultier stand allein; es zitterte.
Den Weg frei zu machen, gab es kein anderes Mittel, als es zu erschießen.
Teobaldo sah dies wohl ein. Er rief dem Peon, zwischen dem und Schmidt die beiden beladenen Maultiere standen, zu, daß geschossen werden würde. Mit mühsam unterdrückter Besorgnis fragte ich ihn dann, ob die Tiere schußfest seien?
Er antwortete mit der einzigen Redensart dieser Leute: » Quien sabe?« und bekreuzte sich.
Aber es half nichts, es mußte geschossen werden auf jede Gefahr hin.
Ich nahm mein Tier fest in den Zügel, ein gleiches tat der Arriero.
»Bückt euch da vorn,« sagte Schmidt mit vor Aufregung heiserer Stimme.
Teobaldo und ich beugten uns auf den Hals unserer Tiere.
»In Gottes Namen, Schmidt!« sagte ich, und im Herzen flehte ich: »Herr, erbarme dich unser!«
Der Schuß krachte.
Donnernd hallte die Schlucht wider – unsere Tiere zuckten zusammen, stemmten aber fest die Hufe gegen den Boden.
Das fremde Maultier, in den Kopf getroffen, lehnte sich an den Fels, um gleich darauf zusammenbrechend in den Abgrund zu stürzen.
Der Weg war frei.
» Oh, Dios sea labado!« (Gott sei gelobt!) murmelte der Arriero und setzte hinzu: » Mil gracias, oh santissima!« (Tausend Dank, Allerheiligste!).
Die dräuende Gefahr war vorüber.
» Nombre de Dios, adelante!« (Im Namen Gottes, vorwärts!)
Ich war von der überstandenen Todesangst zu erschüttert, um ein Wort sagen zu können, dankte aber im stillen für unsere Rettung.
Schmidt rief mir zu: »Jott verläßt keenen Deutschen nich, Herr Dokter!«
Als das Glöckchen der Capitana erklang, setzten sich alle Tiere in Bewegung. Glücklich kamen wir um den gefährlichen Vorsprung, und leichten Herzens ritten wir zu Tale, den Grund bald erreichend.
»Det war een kleenes Abenteuer, Herr Dokter. Wenn ick det nich selbst erlebt hätte, jloobte ick es nich. Wir saßen scheene in die Klemme. Der Deuwel hole diese Barrancas.«
»Wir können Gott danken, der Gefahr entgangen zu sein.«
»Jloobe ick ooch, Herr Dokter.«
»Dein Diener schießt gut, Senor,« sagte der Arriero, der äußerlich viel Gleichmut bewahrt hatte.
»Ja, er schießt gut, doch ein Glück war es, daß die Tiere den Knall ertrugen.«
»Die Allerheiligste war mit uns.«
Er hatte kaum ausgesprochen, als hinter einem Busche hervor der Mensch trat, der uns in diese Lebensgefahr gebracht hatte. Die Windungen des Felsenpfades hatten uns verhindert, ihn auf diesem zu erblicken.
Es war ein tückisch aussehender, sehniger Bursche von dunkler Gesichtsfarbe, in schmutzigem Poncho und defektem Strohhut, der im Gürtel eine breite Machete (das im Lande übliche Haumesser) trug.
Er fuhr den Arriero heftig an, machte diesem Vorwürfe und verlangte, daß man ihm eines unserer Saumtiere übergeben solle.
Mein Führer erwiderte ihm ruhig in spanischer Sprache:
»Ich werde dich dem nächsten Alkalden anzeigen, mein Bursche, du hast den Weg betreten, trotzdem ich mit dem Horn gewarnt hatte.«
»Ich habe nichts gehört. Gib mir ein Mulo, oder es geht euch schlimm!«
Des Kerls Augen weissagten nichts Gutes, und an der Seite trug er eine sehr gefährliche Waffe. Mir war das so bedenklich, daß ich zu meinem Karabiner griff. Kaum sah dies Schmidt, als er sich mit größter Schnelligkeit schußfertig machte.
»Will der Kerl wat, Herr Dokter?«
Dies machte den Indianer doch stutzig.
»Wenn du dich nicht alsbald davon machst, du piccro, du estupido du, lasse ich dich binden und nehme dich mit; du müßtest es denn vorziehen, die Kugel eines dieser Senores in den Schädel zu bekommen.«
»Aber erbarmt euch, wie soll ich ohne Mulo über die Berge kommen?«
»Das ist deine Sache. Geh jetzt aus dem Wege, oder mein Lasso fliegt dir um die Schultern.«
Der Kerl, der einen gar bösen Blick hatte, gab jetzt Raum, und wir ritten weiter, auf die gegenüberliegende Felswand zu.
»Es ist gut, daß der Bursche keine Flinte hat,« sagte mein Führer, »er könnte uns in arge Gefahr bringen, während wir nach oben reiten.«
Wir begannen den Aufstieg und erreichten glücklich die Höhe.
Eine kurze Strecke Weges hatten wir erst zurückgelegt, als uns ein Reiter, ein Weißer, entgegenkam, der eine Flinte auf dem Rücken trug und es sehr eilig zu haben schien. Als er uns erblickte, hielt er und fragte, ob wir nicht einem Indio auf einem Maultiere begegnet seien?
Wir teilten ihm unser Erlebnis mit.
Er vernahm es mit Staunen und schien sehr erfreut darüber zu sein.
»O, ist der Ladron jetzt ohne Mulo, so werde ich ihn bald haben,« äußerte er.
Ich fragte den Mann, der gut gekleidet war, nach Art der Hacienderos des Landes, welche Veranlassung er habe, den Mann zu verfolgen.
»Ich will Ihnen das sagen, Senor, da Sie mir ein Fremder zu sein scheinen. Dieser Bursche, ein gewisser Antonio Mahos, ist ein gefährlicher Aufwiegler und hat versucht, bei uns die Indios rebellisch zu machen. Es muß wieder einmal im Lande gären, daß diese Schurken sich an das Tageslicht trauen. Wir wollen ihn einfangen – ich habe noch einige Freunde hinter mir – und dem Alkalden überliefern.«
In diesem Augenblick erschienen auch noch drei Reiter, gekleidet und bewaffnet wie der, mit dem wir uns unterhielten, die rasch verständigt, ebenfalls erfreut waren, daß dem Verfolgten das Maultier getötet worden sei. Auf meine Frage, ob meine Reise etwa durch Unruhen im Lande gefährdet sein könne, wurde mir die beruhigende Mitteilung, daß zunächst keine Ursache zu Befürchtungen sei, wie ich den Männern versichern konnte, daß weder in Guatemala noch in Quezaltenango, wo ich mit den Behörden verkehrt hatte, irgendein Anzeichen bekannt gewesen sei, das auf Störung des Landfriedens gedeutet werden könne.
»Nun, Gott möge dem Lande den Frieden bewahren!« sagte der, der uns zuerst begegnet war, »und die heilige Jungfrau nehme Euch in ihren Schutz! Adio, den Mahos wollen wir bald haben.«
Sie ritten eilig davon, und wir bewegten uns nach der andern Richtung hin.
Ich schlug mir die Bedenken, die mir die Mitteilungen des Hacienderos erregt hatten, bald aus dem Kopfe, um so leichter, als mein Arriero, mit dem ich darüber sprach, keinerlei Befürchtungen hegte.
Wir gelangten bald wieder tiefer hinab zwischen duftende Wälder und blumige Auen, fanden auch wiederum Ranchos an unserem Wege, deren Eigentümer Landwirtschaft trieben. Schon neigte sich die Sonne, als wir in ein liebliches Tal einritten, das sich nach Westen hin öffnete und bereits tropische Vegetation zeigte.
Einige sauber ausgeführte Baulichkeiten und um dieselben liegende eingefriedigte Gärten mit Fruchtbäumen und Blumen stachen so sehr ab von dem, was die Ranchos des Landes gewöhnlich dem Anblick boten, taten dem Auge so wohl, daß ich unwillkürlich mein Tier zügelte, um mich des Ungewohnten zu erfreuen.
»Wir müssen noch eine Legua weiter reiten zu unserm Nachtquartier,« sagte höflich mein Führer.
»Sehen Sie sich einmal den Mann dort an, Herr Dokter,« äußerte Schmidt und machte mich aufmerksam auf die auf einer Veranda stehende Gestalt.
Ein hochgewachsener, kräftiger Mann, sauber in einen hellen Anzug gekleidet, schaute zu uns her; noch war es hell genug, um deutlich das blonde Haar und den kräftigen blonden Vollbart erkennen zu können und ein Gesicht, dessen Züge so entschieden auf nordische Abstammung deuteten, wie das meines Arrieros auf indianische.
»Wenn det nich een Landsmann is, lasse ick mir hängen,« fuhr Schmidt fort.
Ich lächelte über seine Vermutung, hier, inmitten der Berge Guatemalas, einen Ranchero von unserm Stamm zu finden, obgleich sie immerhin in dem Äußern des Mannes, das zwischen Indios und gelblichen Spaniern um so mehr auffiel, einige Berechtigung fand.
»Herr Dokter, jlooben Sie mir, det is eener von uns.«
Einer Anwandlung von Laune folgend, rief ich dem Manne, der unsern Zug schweigend betrachtete, in deutscher Sprache zu: »Freund, das Vaterland grüßt Euch durch uns.«
Der Mann, von dem ich das spanische: » Que es eso« erwartete, stand starr da, und schon wollte ich ihm spanisch einen guten Abend wünschen, als ich deutlich die mit halblauter Stimme hervorgestoßenen Worte vernahm: »Allmächtiger Gott, es sind alemans.«
Gleich darauf kam der Mann hastig auf uns zu, sah mich aus blauen Augen mit einem Blick an, der auf tiefe Erregung schließen ließ, und fragte: »Sie sind Deutsch? Richtig Deutsch?« Das kam ziemlich unbeholfen heraus.
»Ja, wir sind Deutsche, echte Deutsche, und sollten wir in Ihnen einen Landsmann begrüßen, wäre das eine große Freude für uns.«
Er sah mich, sah Schmidt an, Staunen, Freude malte sich auf seinem gebräunten, männlichen Gesicht. »O, hier bleiben, nicht gehen vorüber – bleiben, bleiben.« Dann rief er mit der Stimme Stentors zu der Veranda des Wohnhauses in spanischer Sprache hin: » Madrecilla! Muchachos! Alle herbei – Gäste, alemans! – Vorwärts, richtet das Haus her! Steig ab, Arriero, bist willkommen mit den Deinen bei Carlos Vilando. Allmächtiger Gott,« sagte er dann wieder deutsch, »Senores – willkommen, willkommen.« – »O, Deutsch alles willkommen.«
Der reckenhafte Mann war sehr aufgeregt. Ich sprang natürlich aus dem Sattel, schüttelte ihm die Hände und rief dem verblüfften Arriero zu, abzusatteln.
Auch Schmidt stieg ab und wurde von Senor Vilando begrüßt. Dann flüsterte er mir zu: »Hab ick et nich jesagt, Herr Dokter, det is eener von unsere Leute?«
Zwei bildhübsche, hochgewachsene Jünglinge stürmten herbei, und auf der Veranda erschien eine behäbig aussehende Dame, die verwundert zu uns her blickte.
»Diese sind meine Söhne Carlos und Enrique, Senor,« stellte er die beiden jungen Leute vor. »Ein aleman, ihr Jungen! Dies ist meine Frau. – O, Santissima, welch eine Freude!«
Ich schüttelte den beiden jungen Leuten die Hand und ging dann nach der Veranda, nahm den Hut ab und stellte mich der Senora als ein literato aus Deutschland vor.
Die trotz ihrer Jahre sehr gut aussehende Frau reichte mir die Hand: »Unser Haus und alles, was wir haben, ist Ihr Eigentum, Senor,« sagte sie, nach spanischer Gepflogenheit mit höflicher Wendung sofort alles zur Verfügung des Gastes zu stellen – »wir freuen uns sehr, einen Landsmann, Senors, bei uns zu begrüßen.«
»Und nun, Mutterchen,« sagte der Ranchero, der von Hause aus den gut deutschen Namen Karl Wieland führte, »gib, was das Haus vermag. Carlos, bringe die Indios unter und laß den Mulos Futter geben. Bitte, treten Sie ein, Senor, und gesegnet sei der Eintritt eines Landsmannes im Hause Carlos Vilandos! Sie sind der erste aleman, der es betritt.« Auch Schmidt wurde eingeladen, das Haus zu betreten.
Bald saßen wir um einen sauber gedeckten Tisch, der mit gebratenen Hühnern, Eiern, Schweinebraten, Brot, Früchten, Schokolade, Kaffee reich beladen war.
Der Familie hatte sich noch ein liebliches Töchterchen zugesellt, das jünger war als die beiden Brüder.
Während des Essens erzählte uns unser Wirt, daß er aus Köln stamme und vor dreißig Jahren als junger Holzhändler ins Land gekommen sei, um Mahagoni und Farbhölzer zu schlagen, daß er während eines Aufstandes von den Regierungstruppen unter die Soldaten gepreßt worden sei, den Bürgerkrieg mitgemacht habe, der zum Siege der Regierung führte, seine Gattin kennen gelernt und sich schließlich entschlossen habe, ihr zuliebe im Lande zu bleiben. Anfangs Majordomo einer großen Hacienda, hatte er sich später selbständig gemacht, Land erworben und bewohnte seit länger als zwanzig Jahren das Haus, in dem wir saßen. Er baute Kaffee und Tabak, hatte eine Cochenilleanlage, war ganz Guatemalateke geworden und fühlte sich glücklich in seinem neuen Vaterlande inmitten seiner Familie. Aber wie mächtig das Heimatgefühl in ihm lebte, das zeigte der Empfang, der uns zuteil wurde. Sein Deutsch hatte er zwar nicht verlernt, aber er dachte sicher in spanischer Sprache, deren er sich allein seit dreißig Jahren bediente, und in seinem Hause wurde nur spanisch gesprochen. Sein Deutsch klang sehr unbehilflich, hie und da fehlten ihm die Worte, und er ging in das Spanische über, während er mit uns sprach, ohne es zu wissen. Seine ganze Häuslichkeit, der Eindruck, den die Frau, die prächtigen Kinder, der Verkehr unter den Familienmitgliedern hervorriefen, ließen darauf schließen, daß er sich wirklich eine neue Heimat geschaffen habe, in der es ihm wohlging.
Aber vergessen war das Land, das ihn geboren, nicht, das fühlten wir.
Nach Tisch führte er mich in sein Zimmer. Stumm zeigte er nach der Wand.
Da hingen Bilder von Kaiser Wilhelm, dem Kronprinzen Friedrich, Moltke, Bismarck, Schlachtenbilder, meistens der gewöhnlichsten Art, viele davon illustrierten Zeitschriften entnommen, andere in Farben schillernd, wie Neuruppin sie seinen Kunstwerken mitgibt.
»Ich habe,« sagte er in seinem Spanisch-Deutsch, »hier in meiner Abgeschlossenheit erst von dem Kriege erfahren, als er fast zu Ende war. Da aber reiste ich sofort nach Guatemala, lief zum deutschen Konsul, um zu erkunden, was im alten Lande vorgegangen sei, und das da kaufte ich alles ein, die Bilder da, Schriften über den Krieg und »Die Wacht am Rhein« mit den Noten.«
Er war entschieden sehr stolz auf seinen Schatz. Als er aber erfuhr, daß ich und Schmidt den Krieg mitgemacht, daß ich den Kaiser, Bismarck, Moltke und alle die Helden gesehen hatte, da war die Freude und Bewunderung groß.
Es war ganz rührend, zu gewahren, wie in dem ganz zum spanischen Mittelamerikaner gewordenen Manne die Liebe zum Vaterlande durchbrach.
Unterdessen war die Veranda erleuchtet worden, und es wurde dort Limonade und Schokolade angeboten.
Mit nicht geringem Stolze stellte er mich und Schmidt seinen Söhnen als Krieger von 70 vor, so daß uns beide halb staunend, halb verwundert anstarrten.
Und nun mußte ich erzählen von Wörth, Sedan und Paris, und mit funkelnden Augen horchten die beiden Jünglinge.
»Nun holt die Guitarren,« sagte der Alte jetzt, »der Landsmann eures Vaters soll hören, daß ich das alte Alemania noch nicht vergessen habe.«
Flugs waren die Guitarren zur Hand. Wieland selbst, die beiden Söhne, die Tochter griffen zu dem spanischen Nationalinstrument und stimmten – »Die Wacht am Rhein« an, die beiden Jünglinge sangen den Text in schrecklichem Deutsch.
Jetzt aber fiel Schmidt ein, kräftig, und ich blieb nicht zurück; feuriger griffen alle in die Saiten, unsere indianischen Begleiter, die Arbeiter des Hauses, Dienstboten sammelten sich vor der Veranda, und nun klang es in die schweigende köstliche Nacht hinaus, in der sich Leuchtkäfer umherschwangen und Argus und Centaur vom dunklen Himmel herabstrahlten: »Es braust ein Ruf wie Donnerhall.«
Es wurden hierauf spanische Romanzen gesungen, auf die sich Carlos und Enrique besser verstanden als auf »Die Wacht am Rhein«, und wir verbrachten im Kreise dieser guten, freundlichen Menschen in dem köstlichen Tale der östlich abfallenden Cordillere einen Abend, den wir noch lange in angenehmer Erinnerung behielten. Erst spät suchten wir unser Zimmer und unsere Hängematten auf.
Am andern Morgen teilte ich unserm Wirte mit, was mich in das Land geführt habe. Er wenigstens wußte etwas von den alten Bauwerken, die in den Wäldern zerstreut lagen, wenn er auch noch nichts davon gesehen hatte. »Mein Enrique weiß mehr davon, er hat gleich Carlos das Liceo in Quezaltenango besucht und sich mit Mixtla dem Tigraro in den Wäldern herumgetrieben. Die Jungen sind sehr gelehrt. Besser wird Euch noch mein Nachbar Don Luis Moro unterrichten können, er hat indianisches Blut in den Adern und ist weit in der Welt herumgekommen. Er behauptet, daß hierzulande einst große indianische Staaten existiert hätten und ganze Städte in den Wäldern begraben lägen.« Das war mir sehr angenehm zu hören.
Als ich ihm von unserem eigenartigen Zusammentreffen mit dem Indianer Antonio Mahos erzählte und von den Verfolgern, die auf seiner Ferse waren, stimmte ihn das sehr ernst.
»Ich kenne den Namen des Schuftes wohl,« erwiderte er, »er hat bei jedem Pronunciamento seine Hand im Spiele, denn er hat Einfluß auf einen Teil der indianischen Bevölkerung. Die Heiligen mögen uns vor einem Bürgerkrieg bewahren, das Land hat genug davon gehabt.«
Nach einem glücklich verbrachten Tage, der meinen indianischen Begleitern gleichfalls sehr zu behagen schien, und nachdem mir Senor Vilando, wie er nun einmal hieß, sein Besitztum gezeigt hatte, dessen Ertrag ihn und seine Familie reichlich ernährte, nach behaglicher Nacht führte mich mein Landsmann zu seinem Nachbar, Senor Moro, dessen ausgedehnte Besitzungen wir bei der raschen Gangart unserer Mulos bald erreichten.
Ich fand in Don Luis Moro einen Mestizen Sohn eines weißen Vaters und einer indianischen Mutter. von gutem Aussehen und angenehmen Umgangsformen, der mit wahrem Vergnügen erfuhr, was mich in sein Heimatsland führte, und daß ich auf dem Wege nach Palenque sei. Er hatte als Abkömmling einer alten Mayafamilie von mütterlicher Seite ein großes Interesse für alles, was mit der Vorgeschichte des Landes zusammenhing. Reisen nach Spanien, Frankreich und Italien hatten seinen Geisteshorizont genügend erweitert, um mein Vorhaben würdigen zu können. Mit Staunen erfuhr er durch mich, daß schon in Dresden und Madrid seit 400 Jahren sich Mayahandschriften befinden, die schon die ersten Eroberer nach Europa gebracht hatten, und daß man jetzt auf dem Wege sei, deren Schriftzeichen zu entziffern.
»Das wäre ein Glück,« meinte er, »denn diese Völker, die einst hier herrschten, müssen, den baulichen Resten nach zu schließen, die uns von ihnen geblieben sind, ihren astronomischen Kenntnissen nach, die sie befähigten, die Länge des Jahres genauer zu berechnen als die damaligen Europäer, einen hohen Grad von Zivilisation besessen und gewiß wertvolle Aufzeichnungen hinterlassen haben. Ich begrüße alle Forschungen auf diesem Gebiete mit aufrichtiger Freude und nicht allein, weil ich Mayablut in meinen Adern habe. Vielleicht haben meine indianischen Vorfahren eine Idee gezeitigt, die der Nachwelt Nutzen bringt. Ich gebe Ihnen meinen alten Mixtli mit, einen Vollblutindianer, der die Ruinen kennt und voll ist von Sagen, die nur noch die echten Mayaabkömmlinge bewahren. Er dient mir als Jäger und ist erfahren in den Wäldern und zuverlässig und treu.«
Ich nahm das mit Dank an. Auch Don Luis, der uns mit großer Gastfreundschaft bewirtet hatte, nahm die Kunde von dem verfolgten Antonio Mahos ernst auf, glaubte aber doch versichern zu können, daß mir auf meiner Fahrt nach Palenque keine Gefahr drohe.
Um eine angenehme Erinnerung bereichert, verließ ich mit Wieland den braunen Haciendero, der nicht nur die Manieren des gebildeten Mannes, sondern auch etwas unendlich Gutmütiges an sich hatte.
Das letztere bestätigte Wieland, der den Halbindianer sehr hoch zu schätzen schien.
*
Am andern Tage traf der Mann, den mir Don Luis als Führer zu stellen versprochen hatte, ein alter, markiger Bursche von ernstem Wesen, auf einem guten Maultiere ein. Zum Glück sprach er, da er sich lange in Guatemala und den Küstenstädten bewegt hatte, gut Spanisch.
Nach herzlichem Abschied von unserem Landsmann und seiner Familie setzte ich die Reise fort; nicht ohne Beschwerden, denn wir waren in die tierra caliente geraten und die Hitze war groß. Einige Unterredungen mit dem im ganzen wortkargen Mixtli, eigentlich führte er einen christlichen Taufnamen, zog aber seinen indianischen vor, überzeugten mich, daß er nicht nur die Ruinen kannte, auch viel Vorliebe für sie habe und daß ihm die Vergangenheit seines Volkes nicht ganz unbekannt sei. Das war mir um so erfreulicher, als die Indios, die ich bis jetzt persönlich kennen gelernt, ganz stupides Gesindel waren. Eine Ausnahme machte mein Arriero insoweit, als er durch sein Geschäft als Maultiertreiber weit im Lande umherkam und deshalb mehr gesehen und gehört hatte, als die seiner Landsleute, die an die Scholle gebunden waren.
Wir zogen auf schmalem Pfade durch dichte, hochstämmige Waldungen, weit entfernt von jedem bewohnten Orte. Ein feierliches Schweigen war um uns ausgebreitet, herrschte bei der schwülen Hitze auch in unserer Karawane. Oft mußte die Machete den Weg bahnen, wenn Schlingpflanzen unsern Weg versperrten. Mixtli hatte hier, wo er besser zu Hause war, als mein Arriero, die Führung. Am zweiten Tage unseres Marsches hielt er vor einem kleinen Wasserlauf an, der unsern Weg kreuzte, und wir lagerten nach seiner Aufforderung. Nach kurzer Zeit forderte er mich auf zu folgen. Er rief dem Arriero einige Worte in der Mayasprache zu und sagte zu mir: »Ich will dir etwas zeigen, komm!« Als Schmidt mir folgen wollte, wies Mixtli ihn zurück mit der Bemerkung: »Allein mitgehen, Fremder, dein Peon uns stören.«
Ich sagte Schmidt, er möge bleiben.
Auf einem wenig betretenen, aber doch erkennbaren Pfade schritten wir in das Waldesdüster hinein, Mixtli voran, die Machete in der Hand und den Weg an einzelnen Stellen bahnend.
Wir waren vielleicht eine halbe Stunde gegangen, als der Indianer stehen blieb und, auf eine von Gestrüpp freie Stelle deutend, sagte: »Dort sehen.«
Ich folgte seiner Handbewegung, und jetzt erkannte mein geschärfter Blick einen Altar und hinter ihm eine hochragende Säule, beides mit Bildwerken dicht bedeckt.
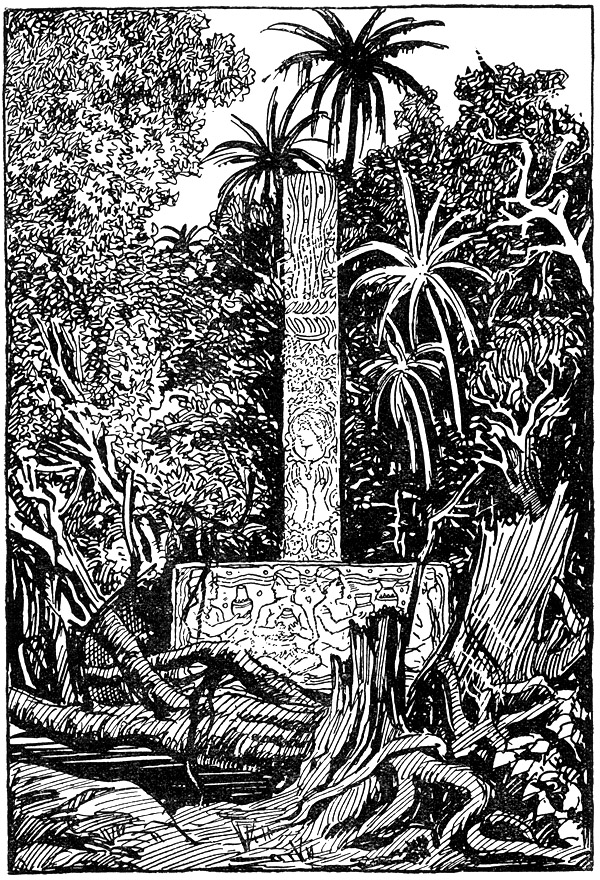
Es war das erstemal, daß ich Überbleibsel aus der Mayazeit erblickte.
Die Tropenregen hatten die Bildwerke abgespült, so daß auch die feinsten Umrisse zu erkennen waren trotz der mangelhaften Beleuchtung im Schatten des Urwaldes, dessen Halblicht diesen Resten etwas ungemein Eindruckvolles verlieh. Es war sichtlich ein Altar.
Auf vier Figuren, sitzend, mit gekreuzten Beinen, in Basrelief gearbeitet, traf mein Blick. Die ausdrucksvollen Gesichter waren alle im Profil gebildet, und auffällige, fast turbanartige Bedeckungen trugen die Köpfe. Die Körper waren augenscheinlich mit mannigfachem Schmuck bedeckt, die Hände in verschiedener Haltung – einige hielten seltsam geformte Gegenstände –; die Füße waren nackt, doch mit Spangen um die Knöchel versehen.
Nicht alle Gesichter waren durch das adlerartige Profil des Indianers gekennzeichnet, einige zeigten gerade, fast griechische Nasen und Stirnbildung.
Alles war noch wohl erhalten und mit einer Sauberkeit und Akkuratesse von den Mayabildnern gearbeitet, besonders Hände und Füße, die staunenswert waren.
Mein Blick richtete sich jetzt auf die hochragende Säule, die hinter dem Altar sich erhob.
Wunderliche Verzierungen, alles in Basrelief gearbeitet, deren Formen, deren Anordnung doch tiefere Bedeutung verrieten, bedeckten ihn und umfaßten einen Frauenkopf, von jugendlich lieblicher Form, unter dem sich zwei Hände flehend oder betend erhoben. Tiefer unten erschienen noch zwei andere kleine Frauenköpfe.
Der Altar mit seinen Figuren, die oben abgestumpfte Säule mit dem Bildnis des jungen Mädchens, einer Göttin oder einer Fürstentochter aus alten Zeiten, die alle Zeugnis ablegten von der nicht geringen Kunst eines Meisters, der vor Jahrhunderten gelebt hatte, hier im Dämmerlichte des schweigenden Urwaldes, übten eine mächtige Wirkung auf mich aus.
Endlich erhob ich mich und umschritt Altar und die Säule. Während die anderen Seiten des Altars Figuren ähnlich der Vorderseite zeigten, trugen die Seiten der Säule die gleichen geheimnisvollen Zeichen, die ich in Europa auf der Handschrift in Dresden angestaunt hatte.
Unendlicher Fleiß und hoher Scharfsinn der Gelehrten hat das bewunderungswürdige Zahlensystem der einstigen Bewohner Mittelamerikas ergründet, das unähnlich allem, was die Welt bis dahin kannte, doch die feinsten und umfassendsten Berechnungen erlaubte.
Meine Kenntnis davon ging so weit, daß ich aus einer kurzen Reihe der wohlerhaltenen, erhaben gearbeiteten Zeichen ohne besondere Mühe die Zahl 1624 herausrechnete. Da die Mayas als Anfangszahl für ihre Zeitberechnung die Zahl 3000 hatten, ergab das das Jahr 1376 nach unserer Zeitrechnung.
Als ich meinem Begleiter das sagte und auf die Zahlzeichen wies, sah er mich mit einem Erstaunen an, das dem gleichmütigen Gesicht eines Indianers durchaus ungewöhnlich ist.
»Dreizehnhundert sechs und siebzig,« wiederholte er langsam, »das war, ehe die Spanier von jenseits des Meeres in das Land kamen.«
»Ja, es war fast 200 Jahre früher.«
»Und du kannst die Zahlen der Maya lesen, Senor?«
»Die Zahlzeichen haben wir enträtselt, nun werden wir auch das andere noch ergründen.«
»Du bist ein aleman, Senor?«
»So ist es.«
»Die alemans sind klug.«
Ich nahm das Kompliment schweigend hin. Er sah mich forschend an und fragte dann: »Kann Senor auch die Namen der Königstochter lesen?«
Mein Blick war unter den Zeichen auf der Rückseite der Säule auf die Nachahmung einer Agaveblüte gestoßen, die auffällig hervorgearbeitet war.
Lächelnd über die verfängliche Frage, entgegnete ich ihm: »Die Königstochter führte den Namen, der in spanischer Sprache »die reine Blüte« bedeutet, wenn ich nicht irre.«
»O, santissima, Senor,« erwiderte er betroffen. »Du sagst es – es ist das Bild Suches, der Tochter Kukulkans, des Königs.«
Er sah mich lange an, dann sagte er: »Komm, du sollst sehen, was noch kein Weißer gesehen hat.«
Er brach den Zweig eines harzhaltigen Baumes, entzündete ihn und winkte mir, ihm zu folgen. Ich nickte zustimmend.
Er betrat ein Gebüsch, durch das wir gleich darauf auf einen von Unterholz gereinigten kleinen Platz kamen. Im Dämmerlicht sah ich Felsblöcke und zerstörtes Mauerwerk vor mir.
Auf dieses schritt der Indianer zu, und ich gewahrte eine dunkel gähnende Öffnung vor mir. Hinein schritt Mixtli, ich folgte. Im Schein der Harzfackel sah ich Mauerwerk um mich und eine wohlerhaltene Treppe, die in die Tiefe führte.
Der Indianer, mir sorgfältig leuchtend, stieg hinab. Nachdem ich zweiundfünfzig Stufen gezählt, stand ich in einer Höhle von rötlichem Felsgestein. Vor mir erglänzte im Schein der Fackel in einer sichtlich künstlich hergestellten, einem Becken gleichenden Felsaushöhlung, kristallklares Wasser.
»Das ist der Quell, den die Götter den Vätern schenkten!« sagte er leise.
Noch standen Gefäße von seltsamer Form an dem Wasser, krugartig gebildet. Die Besucher des so tief liegenden Quells hatten sie vor Jahrhunderten stehen lassen. Alles war so wohl erhalten, daß man glauben konnte, sie hätten sich soeben erst entfernt.
»Hier holten sie den frischen Trunk, wenn die Bäume und Gräser verdorrten und die Bäche versiegten oder die Stadt belagert wurde vom Feinde. Du bist der erste Weiße, der die Quelle sieht.«
Ich wollte einen der Krüge, die zu meinen Füßen standen, aufheben, um ihn genauer zu betrachten, aber der Alte verhinderte es.
»Berühre die Gefäße nicht – die Geister schweben um uns und könnten zürnen.«
Nach einiger Zeit, nachdem ich die Gefäße, die schön gearbeitet waren, betrachtet hatte, sagte er:
»Laß uns gehen, Senor! Du hast gesehen, was noch keiner deiner Farbe sah, weil du die Zeichen lesen kannst – die Zeichen der Könige und Priester – du sollst noch mehr sehen!«
Er führte mich zurück zur Oberwelt und verlöschte die Fackel.
»Du sagtest,« äußerte ich, als wir das Gebüsch verlassen hatten, »daß diese unterirdische Quelle den Bewohnern der Stadt gedient; erhob sich hier eine Stadt?«
»Ja, Senor, weit und groß.«
»O, das ist wichtig für mich – hier muß ich forschen.«
»Du suchst vergeblich – es ist alles versunken – der Tempel, die Paläste – alles im Urwald tief begraben – es ist nichts mehr übrig als das Bild der Tochter Kukulkans, des Königs – sie bewachten die Quelle, die Reine Blüte.«
»Und kennen die Mayas diese Stätte?«
»Mayas? Es gibt nicht viel Mayas, Senor.«
»Was? Sind unsere Begleiter keine Mayas?«
Mixtli machte eine verächtliche Bewegung.
»Sie stammen von Sklaven der Mayas ab. Don Luis' Mutter war eine echte Maya, in ihren Adern rollte Königsblut, und ich, Mixtli, der Sohn Zontlos, bin ein Maya, ich entstamme einem Geschlecht von Kriegern. Komm, es nützt nichts, davon zu reden, die Mayas sind tot und ihre Städte begraben!«
Wir erreichten rasch die Unsern wieder, und Schmidt, dem die Indios immer unheimlich waren, war erfreut, mich wohlbehalten wiederzusehen.
Zu meinem nicht geringen Erstaunen erfuhr ich jetzt, daß während meiner Abwesenheit der Kerl aus der Barranca plötzlich aufgetaucht war, gut beritten, und seinen Weg eilig in der Richtung fortgesetzt hatte, die auch wir verfolgten.
Er war also denen, die ihm nachfolgten, entgangen und hatte, statt seinen Weg nach Quezaltenango fortzusetzen, seine Verfolger getäuscht, indem er umkehrte.
Als man Mixtli von allem unterrichtete, äußerte der bedächtig:
»Ich kenne diesen Antonio Mahos, er ist ein Zapoteke und ein schlechtes Subjekt; schade, daß ihr ihn nicht festgehalten habt. Er wird über die mexikanische Grenze gehen wollen, der Boden in Guatemala wird ihm zu heiß geworden sein.«
»Ist er gefährlich?«
»Wenn es gilt, arme unwissende Indios aufzuhetzen und zum Kampfe zu treiben gegen die Regierung, um sie zu verraten, sobald die Sache mißlingt – ist er sehr gefährlich. Es wäre das beste, ihn zu hängen.«
»Also er ist kein Maya?«
»Zapoteke,« sagte Mixtli im Tone der Verachtung.
»Und uns droht keine Gefahr von ihm?«
»Nein, er läuft, wenn er eine Flinte sieht.«
Die Mulos waren gesattelt, und wir setzten unsern Weg unter der Führung Mixtlis fort.
Meine Gedanken waren noch immer mit dem Bildwerk, das ich gesehen, dem Besuche an der Quelle der Tiefe beschäftigt. Eine günstige Fügung hatte mir in dem alten Indianer einen wertvollen Begleiter zugesellt. Wir übernachteten in einem Pueblo und setzten, nachdem wir uns mit Proviant versehen hatten, die Reise fort. Gegen Abend erreichten wir ein auf einer Bodenerhöhung stehendes Bauwerk.
Verfallen, von Büschen umgeben, auf den Mauern von Büschen überwuchert, zeigte sein Gefüge doch noch große Festigkeit. Es war mir nicht zweifelhaft, daß diese Ruinen aus der Mayazeit stammten, und Mixtli bestätigte das, hinzufügend, es sei eines der Häuser, die die alten Herrscher für Reisende an der großen Straße einst bauen ließen.
Mir war der Vorschlag des Alten, hier zu übernachten, zusagend, nicht so dem Arriero und seinem Peon. Die Indianer gewöhnlichen Schlages betrachten die aus der Vorzeit stammenden Bauwerke des Landes mit abergläubischer Furcht. Da aber das nächste Pueblo viele Leguas entfernt war, mußten sie sich fügen; doch betraten sie das Bauwerk nicht, sondern suchten sich Lagerstätten in dessen Nähe. Wir aber betraten die in abgeteilten Räumen bestehende Ruine, in die der Himmel hineinblickte, und zündeten Feuer an. Die Nacht sank herab, und der dunkle Himmel bedeckte sich mit funkelnden Sternen, die nur unter südlichem Himmel so leuchtend zur Erde niederstrahlen. Endlich stieg der Mond empor und übergoß die Wälder mit einer Flut von Licht.
Schmidt schlief in seiner Hängematte, ich aber saß noch ferner am Feuer, neben mir der schweigsame Maya. Es mochte gegen 10 Uhr sein, als er mich aufforderte, ihm zu folgen. »Du wirst viel sehen,« beantwortete er meinen fragenden Blick, »komm!« Ich nahm mein Gewehr und folgte ihm.
Er führte mich mit erstaunlicher Sicherheit einen Pfad, der glücklicherweise von Dornen und Schlingpflanzen fast frei war. Der Wald wurde lichter, durch Mimosenbüsche vordringend, stand ich gleich darauf im Freien mit einem weiten Ausblick vor mir. Ein Hügel erhob sich unweit und auf diesem – im Mondlicht geisterhaft erglänzend – ein ausgedehntes Bauwerk, neben dem eine Pyramide hoch in die Luft ragte. Der Anblick war so überraschend, so märchenhaft, daß mir der Atem still stand. Deutlich lag im Mondschein ein umfangreicher Palast vor mir, auf hoher Terrasse sich gegen den Horizont malerisch abhebend. Zahlreiche Eingänge zeigte die mir zugekehrte Seite. Einige waren dunkel, andere erlaubten einen Blick in das vom Mondlicht erhellte Innere. Hohe Bäume, die im Innern wuchsen, überragten das Mauerwerk und auf diesem unterschied das Auge Buschwerk.
Der Mond verbreitete fast Tageshelle. Ich stand minutenlang, ohne mich regen zu können, so gewaltig war der Eindruck, den der Palast des Herrschers eines unbekannten Volkes, das seit Jahrhunderten von der Erde verschwunden war, auf mich machte. Ich hatte die Pyramiden gesehen, den Tempel von Karnak, die Akropolis Athens – doch nirgends überkam mich das Gefühl tiefer Rührung über das Vergängliche alles Irdischen mächtiger als in diesem Augenblicke, wo ich vor den letzten Resten einer zugrunde gegangenen hohen Zivilisation stand.
Endlich störte die Stimme des Indianers die feierliche Stille. »Das Haus des Königs!« sagte er in gedämpftem Tone, der Zeugnis gab, daß auch seine Seele von dem Anblick vor uns ergriffen war.
»Hier gebot einst Nima Quiché, der große Herrscher von Mayapan.« »Ist es der Palast von Palenque?« »Nein, der von Tzutuhil. Er war vergessen von allen, nur einzelne Indios blickten scheu und staunend auf die geheimnisvollen Trümmer.« »Doch wer hat ihn frei gelegt? Wer hat den Urwald entfernt?« »Der Wille der Unsichtbaren. Der Strahl der dunklen Wolke entzündete den Wald und brannte ihn ringsum nieder; das Haus des Königs lag wieder frei im Strahl der Sonne.«
Diese Mitteilungen erregten mich noch mehr. War dieses Prachtgebäude wirklich noch unbekannt? – »Komm, Amigo, laß uns zu dem Haus des Königs gehen.« »Nicht jetzt!« erwiderte er ernst, »die Geister der Toten durchschweben es, und sie möchten uns Unheil zufügen, wir müssen sie uns erst freundlich stimmen. Wir gehen morgen im Licht der Sonne dorthin.«
Kurz wandte er sich und ging zurück.
Mir blieb nichts übrig, als mich von dem zauberhaften Anblick zu trennen und ihm zu folgen.
Bald lag ich in meiner Hängematte, doch ließ der Schlaf lange auf sich warten.
Bald nach Sonnenaufgang war ich schon munter.
Gleich nach dem Frühstück ersuchte ich Mixtli, mich zu der Ruine zu führen, und befahl Schmidt, mit dem Arriero und dem Gepäck nachzukommen, nachdem der Maya sich mit Teobaldo über die Wegrichtung verständigt hatte. Wir legten denselben Pfad, den wir gestern gegangen waren, zurück, und bald lag der Palast des Mayakönigs im Sonnenlicht vor mir.
Nicht so phantastisch und märchenhaft erschien er mir als im Mondenschein, doch nicht minder ergreifend in seinem verfallenen Zustande im hellen Tagesscheine, überwuchert von tropischer Vegetation, umgeben von düstern Wäldern, die kaum je eines Menschen Fuß betrat.
Langsam schritt ich mit Mixtli darauf zu, zwischen Büschen hindurch, über verkohlte Baumstämme hinweg.
Ein mächtiges Bauwerk erhob sich auf einer Terrasse, zu der Stufen hinauf führten, die einst mit behauenen Steinen bedeckt waren. Elf Eingänge lagen vor mir in der lang hingestreckten Front.
Ich schritt hinauf und stand nun vor dem Palaste des Mayaherrschers. Genauer sah ich jetzt die gewaltigen, sauber bearbeiteten Werkstücke des Unterbaus, die reiche, phantastische Ornamentik des oberen Teiles der so ausgedehnten Fassade, deren Formen mit nichts auf der Welt, nicht mit Babylon, nicht mit Ägypten, nicht mit der antiken Welt Ähnlichkeit haben. Eine eigenartige Kunst offenbart sich hier, die auf eigenem Boden erwachsen ist und allein steht. Vieles war zerstört, hie und da Stuck herabgefallen, doch das Gesimse war meistens noch gut erhalten, ob auch auf dem Mauerwerk Strauchwerk wucherte.
Ich betrat einen der Eingänge und befand mich in einem Raume, der nach Art der Mayabaukunst mit einem Spitzbogen überwölbt war, der einen Schlußstein trug, statt daß ihm dieser eingefügt war. Die Mauern ringsum waren kahl, doch ich stand auf wohlgefügten Steinfliesen, die erhaben gearbeitete Schildkröten zeigten, – von der Menge der Füße, die einst über sie hingeschritten, halb weggeschliffen.
Ich vermag den Eindruck, den dieses alte, so groß angelegte, so reich geschmückte und so verfallene Bauwerk, in dem einst mächtige Fürsten geboten, auf mich ausübte, nicht wiederzugeben. Mir war zumute, als wenn eine unbekannte Vorzeit zu mir rede und ich verstände die fremdartigen Laute nicht.
Hinter mir ging der braune Mann, ein ferner Enkel derer, die einst diese Räume belebt hatten.
Ich schritt weiter und betrat eine weite Halle, die noch zum Teil bedeckt war.
Ringsum an den Wänden zeigten sich Bildnisse, lebensgroße, erhaben gearbeitete Bildnisse der einstigen Herrscher in ihrer phantastischen Tracht, die auch mit nichts Ähnlichkeit hat, was Vor- und Mitwelt ausweist.
Sie waren einst mit Farben bedeckt gewesen, von denen leider nur noch Spuren vorhanden waren. Bei jedem dieser Bildnisse waren auf breitem Felde Schriftzeichen eingegraben, die wohl von dem, dessen Bildnis sie begleiteten, Kunde gaben.
»Es ist der Saal der Könige,« flüsterte mein Begleiter.
Ja, es war eine lange Reihe von Königsbildnissen, die vor mir hier die Wände zierten, und kein Buch, kein Lied kündet von ihnen, denn die geheimnisvollen Zeichen können wir nicht lesen. Sie sind von ihrem Thron gestiegen, ihre Welt ist zusammengebrochen vor dem Anprall einer wilden, golddurstigen Mörderschar.
Endlich ging ich weiter und betrat einen zweiten Saal, dessen Decke, von Balken getragen, deren eisenfestes Holz den Jahrhunderten getrotzt hatte, auch nur halb erhalten war.
Die Wände, fast nur von Schriftzeichen bedeckt, und einige, wohl für den Verständigen sinnvolle Ornamente trennten die Reihen.
»Der Saal der Inschriften,« sagte der Indianer, »sie sprechen von den Königen.«
Sinnend schritt ich hindurch.
»Wird der Tag kommen, wo ihr, geheimnisvolle Zeichen, das Dunkel aufhellt, das über der Vergangenheit dieser Länder lagert?«
Ich trat in einen gewölbten Korridor und schaute durch dessen Öffnung in einen weiten Hofraum, der rings eingefaßt war von Gebäuden. Sträucher und Bäume erhoben sich hier, einige der Bäume waren von gewaltigem Umfang, und ihre Wipfel ragten hoch in die Luft. Sie mußten Jahrhunderte gesehen haben.
Ich ging weiter, schritt durch öde Gemächer, in die der Himmel hinein schaute, über schön gefügte Fliesen hinweg, und überall zeigten sich die Reste von in hartem Stuck ausgeführten Bildwerken.
Ein zweiter öder Hof dehnte sich hinter dem ersten aus, wie dieser, wie das Mauerwerk mit tropischer Vegetation überwuchert.
In einem der Flügel traf ich auf eine Reihe kleinerer Gemächer, deren Dach wohlerhalten war. Sie waren trocken und ihre Bewohner, Fledermäuse und Eidechsen, waren leicht zu entfernen.
Hier beschloß ich Wohnung zu nehmen.
O, da gab es tagelang zu tun, um photographische Aufnahmen zu machen! Einen trefflichen Apparat führte ich zu diesem Zwecke mit.
Ich befand mich in einem wahren Rausche des Entzückens, denn ich hoffte, daß diese Ruine noch undurchforscht sei. Wenigstens war sie in den mir bekannten Schriften über Mayabauten nicht erwähnt. Mein indianischer Begleiter erkannte wohl, wie groß meine Freude war, und, was bei einem roten Manne hierzulande sehr selten vorkommt, er lächelte. Unterdessen waren auch meine Begleiter mit den Maultieren und dem Gepäck angekommen. Schmidt war nicht wenig erstaunt über das, was er sah, und verlieh diesem Erstaunen wunderlichen Ausdruck: »Na, so wat, Herr Dokter, hier mang die jraulichen Wälder, det hätte ick nich jedacht. Wenn det in Berlin zu sehen wäre, da lief aber allens hin.«
Mein Arriero schien sehr ungern in der Ruine Wohnung zu nehmen.
Mixtli erkannte das.
Er forderte mich und die andern jetzt auf, den pyramidenartigen Hügel, der sich neben dem Palaste erhob, zu besteigen, und wandte sich in einigen indianischen Worten an die beiden Maultiertreiber.
Wir stiegen den mit Büschen und zerstreuten Steinen bedeckten Abhang, der Spuren zeigte, daß er einst terrassenförmig eingeteilt gewesen war, langsam hinan.
Oben, auf der mit Gras und einzelnen Büschen überwucherten Plattform, fanden wir einen steinernen Altar mit Figuren und wunderlichen Ornamenten.
Mixtli winkte uns, zurück zu bleiben, ging nach dem Altar hin, legte Blüten darauf, die er unterwegs gepflückt hatte, fügte Zweige eines harzhaltigen Baumes hinzu, und zündete diese an. Leichter Rauch stieg zum Himmel auf, und ein eigenartiger, scharfer, doch nicht unangenehmer Geruch verbreitete sich. Indianische Worte murmelnd, umschritt er dreimal den Altar.
Es war mir nicht zweifelhaft, daß er nach der Weise seiner heidnischen Vorfahren hier ein Opfer brachte. So schienen es auch meine indianischen Begleiter aufzufassen, die, ob sie gleich Christen waren, dem Vorgang mit Andacht beiwohnten.
Mixtli schien sie etwas zu fragen, worauf sie zustimmend nickten. Zu mir sagte er:
»Ich habe nach der Weise der Väter die bösen Geister verscheucht, wir können ruhig hier wohnen, Senor.«
Auf meine beiden Indianer schien sein Verfahren in der Tat beruhigend gewirkt zu haben, auch nahmen sie später bereitwillig ihre Wohnung in den Ruinen.
Jetzt erst sah ich mich um. Doch ich hatte nur Augen für das königliche Bauwerk, das zu meinen Füßen lag und in allen seinen Teilen nach den Regeln der Kunst ausgeführt war.
Ich war fast betäubt von allem, was ich gesehen, was ich sah; so mächtig waren die Eindrücke, die ich empfing. Wie ein Träumender kam ich mir vor.
Wir gingen wieder hinab und trafen nun Anstalt, Unterkommen für Mensch und Tier zu suchen. Feuerungsmaterial war nahe, ebenso Wasser, das eine vor uralten Zeiten angelegte, jetzt halbzerstörte Wasserleitung spendete, und Lebensmittel hatten wir für einige Tage mit. Während die andern sich mit den Vorbereitungen für unsern Hausstand beschäftigten, durchwanderte ich sinnend und träumend das weitläufige Gebäude mit seinen oftmals noch wohlerhaltenen Räumen. In einem kleinen Gemache, das einige Bildwerke einst geziert hatten, Frauengestalten, wie sich aus den Resten schließen ließ, fand ich einen kleinen Schmuckgegenstand aus Jadeit, einem den Mayas noch heute wertvollen Mineral, dem sie geheimnisvolle Kräfte zuschreiben. Es stellte einen Kopf vor, der den gleichen seltsamen Schmuck trug, den ich an den

Königsbildern angestaunt hatte, war sehr sorgfältig gearbeitet und sehr gut erhalten.
Während ich das seltene Fundstück, das mein Auge ganz zufällig am Boden zwischen welken Blättern entdeckt hatte, noch anstaunte, trat Mixtli zu mir.
Kaum erblickte er den Jadeitkopf in meiner Hand, als er auch eine ungewöhnliche Erregung verriet und ihn mit funkelnden Augen anstarrte.
»Wo hast du das her, Senor?«
Ich sagte ihm, daß ich das Stück eben hier entdeckt habe.
»O,« sagte er – »es steckt ein großer Zauber darin – du bist im Schlafgemach des Königs.«
Trotz der dem Indianer eigenen Selbstbeherrschung, die ihn selten verläßt, erkannte ich, wie aufgeregt der Mann durch das Erblicken des Jadeitgegenstandes war, der übrigens ja auch für mich einen hohen wissenschaftlichen Wert hatte.
Ich sagte ihm lächelnd: »So hat der König es mir geschenkt, indem er es mich nach vielen hundert Jahren finden ließ. Er weiß, daß ich seine Geschichte schreiben will, sobald ich die Buchstaben enträtselt habe.«
Der Indianer sah mich an und nickte dann. »Er ließ es dich finden,« sagte er langsam, »ich bin oft hier gewesen und habe es nicht gesehen. Möge es dir Glück bringen!«
Mit Forschungen und Ausmessungen brachte ich den Tag zu, immer mehr in Staunen gesetzt durch die Kunst des Baumeisters, der dieses Gebäude errichtet hatte, durch den geduldigen Fleiß seiner Steinmetzen.
Spät noch saß ich im Mondschein vor dem Gemache, das ich für mich hatte wohnbar machen lassen, gedankenvoll auf die so romantische Umgebung blickend, während die andern schliefen, und suchte endlich meine Hängematte auf.
Wie lange ich geschlafen, wußte ich nicht, aber ein blendender Lichtglanz ließ mich die Augen aufschlagen.
Staunend sah ich mich in einem kostbar geschmückten Gemach, auf einem schön verzierten Lager. Flammen brannten in goldnen Gefäßen und verbreiteten einen angenehmen Duft. Die Wände waren mit buntgewirkten Stoffen behangen, und dazwischen leuchteten in frischen Farben die Bildnisse von Frauen zu mir herab.
Vor mir stand ein Mann, in ein langes, farbiges Gewand gekleidet, und forderte mich höflich auf, ihn zu dem König zu begleiten, der mich erwarte.
Ich erhob mich und folgte ihm durch mehrere Gemächer, deren Türen mit langen Vorhängen bedeckt waren.
Endlich betrat ich den Hof.
Ringsum standen die so schön verzierten Mauern in alter Pracht da. Mit Bildwerk und Ornamenten in leuchtendem Schmuck verzierte Terrassen liefen an den Mauern hin, auf denen sich Männer in bunten Federmänteln und langen Gewändern bewegten. Der Boden war mit quadratischen Fliesen belegt, die originelle Muster zeigten.
Die Männer sahen freundlich auf mich und grüßten mich mit gemessener Höflichkeit.
Durch den sich quer hinziehenden Flügel führte mich mein Begleiter durch Zimmer, die eine große Pracht an schöngeschnitzten Hölzern, bunten Fellen und bunterem Federschmuck zeigten; goldene und silberne Gefäße standen umher, überall waren Malereien zu sehen, und der Fuß schritt über feine Matten hin.
So betrat ich das Hauptgebäude und in ihm den Saal, der die erhaben gearbeiteten Bildnisse der Könige enthielt. Rings an den Wänden standen dunkel gefärbte Männer in bunten Gewändern, Goldreifen um das Haupt, die lang herabwallende Federn zusammenhielten.
Auf einer Erhöhung am Ende des Saales saß der König. Langes Gewand, buntgewirkt, mit Goldfäden durchzogen und mit Edelsteinen bedeckt, hüllte ihn ein. Eine rote Binde schlang sich um seine Stirn, deren Ende lang herabfielen, und auch an seinem Haupte wallten Federn herab. Langes, dunkles Haar umgab ein ernstes, doch wohlwollendes Gesicht, dessen Züge an die der Römer erinnerten. In der Rechten hielt er einen in Blätterform auslaufenden goldenen Stab, der einem Szepter ähnlich war.
Das dunkle Auge ruhte wohlwollend auf mir, als ich vor ihn trat und mich unwillkürlich tief verbeugte.
Der Umstehenden Blicke waren neugierig auf mich gerichtet.
»Du bist willkommen, Fremdling, in meinem Lande,« sagte der König, »wir wollen dich als Gast ehren.« Ich verneigte mich dankend.
»Wie kommt es, daß deine Gesichtsfarbe weiß ist, gleich der Blüte der Agave, und woher stammst du?«
Ich erwiderte, daß ich weither von jenseits des Meeres komme, wo alle Leute meine Gesichtsfarbe trügen und mich der Wunsch, diese Länder kennen zu lernen, herübergeführt habe.
»Ja,« sagte der König nachdenklich, »ich habe gehört, daß Männer mit weißen Gesichtern und langen Bärten auf den Inseln, die unsere Seeschiffe manchmal besuchen, und an der Küste Aztlans erschienen sind. Montezuma, der Fürst der Azteken, hat mir sagen lassen, daß er die Weißen, die in sein Land gekommen sind, töten lassen werde, und mich aufgefordert, ein Gleiches zu tun, wenn sie in meinem Reiche erscheinen sollten.«
»Doch er ist ein roher, blutdürstiger Azteke. Wir heißen den Fremden willkommen und freuen uns seiner Anwesenheit. Was mein Haus und mein Land vermögen, steht zu deiner Verfügung. Du bist Nezahualpilli willkommen.«
Er neigte verabschiedend das Haupt, ich ward hinausgeführt und stand auf der großen Terrasse, die die ganze Front des Palastes einnahm, und blickte die Stufen hinab, über denen er sich erhob.
Jetzt erst erschaute ich die ganze Pracht dieses Königsschlosses, das alles an Reichtum und Geschmack der Form übertraf, was die alte Welt gebildet hatte, wenn ich von den ewig schönen Bauwerken der Griechen absah.
Ein solches Staunen hatte mich ergriffen, vermischt mit Ehrfurcht, daß ich erst nach einiger Zeit die lautlos am Fuße der Stufen harrende Menge gewahrte, die nach vielen Tausenden zählen mußte.
Über sie hinweg sah ich auf entferntere andere Gebäude, blickte in Straßen, die sich lang hinzogen, erblickte starke Steinwälle, die die Stadt umgaben, und dahinter wohlbebaute Felder.
Der Anblick war groß und doch lieblich. Aus dem Palaste traten jetzt Männer, die lange Stäbe trugen, dann kamen die Leute, die ich im Audienzsaale erblickt hatte, im feierlichen Zuge, alle köstlich gekleidet.
Ihnen schlossen sich weißgekleidete Priester an, welche Fackeln trugen, die einen angenehmen Duft verbreiteten, zahlreiche Kinder, Mädchen und Knaben, folgten mit Körbchen voll kostbarer Blumen; endlich erschien unter einem Baldachin, von Edlen in einem vergoldeten Sessel getragen, der König. Das Volk unten warf sich zur Erde nieder und begrüßte so den Herrscher.
In langem Zuge bewegten sich Krieger, Priester, Kinder jetzt die Stufenpyramiden hinan, sie im Aufsteigen umschreitend, immer höher und höher. Dabei sangen Priester und Kinder eine wohllautende, feierliche Weise.
Ein herrlicher Anblick dem Auge im leuchtenden Sonnenstrahl unter wolkenlosem Himmel! »Sie bringen dem Frühlingsgotte das Blumenopfer,« flüsterte mein Begleiter, der mich noch nicht verlassen hatte.
Jetzt bemerkte ich erst, daß alles Volk mit bunten Blüten geschmückt war.
Ein Bild des friedlichsten Glückes war das Ganze.
Das Blumenopfer war dargebracht, und schon bewegte sich der Zug die Tempelpyramide wieder abwärts, als eilig bewaffnete Leute herbeiliefen, und gellende Rufe ertönen ließen. Einige von ihnen bluteten aus Wunden.
O, wie verwandelte sich das Bild! Entsetzen, wilder Grimm scheuchten den holden Frieden. Wild durcheinander tobte alles.
Krieger sah ich zu den Wällen eilen, Schwerter, Äxte aus Kupfer tragend, Bogen in den Händen oder Stäbe, die mit eingelegten scharfen Steinen zu tödlichen Waffen gewandelt waren. Große Schilde hatten die meisten.
Schon hörte ich Gewehrfeuer und das gellende » San Jago!« der Spanier. Gleich darauf folgte zum namenlosen Schrecken der Mayas Kanonendonner; dennoch wehrten sie sich.
Ein wilder, blutiger Kampf tobte um die Mauern. Tote und Verwundete deckten die Straßen. Die Mayas kämpften todesmutig. Aber auf dem Walle erschienen die stahlbedeckten Häupter der Spanier, blitzten ihre glänzenden Schwerter. Einer kämpft voran, von oben bis unten in Stahl gehüllt, langes, blondes Haar umflatterte ihm das Haupt, ich kenne ihn, es war Alvarado, der Offizier des Cortez. Die Spanier werfen alles vor sich nieder, – sie sind in der Stadt. Da stürzt sich der Mayakönig in kriegerischer Rüstung in den Kampf, zum grenzenlosen Jubel der Seinen – ich sehe ihn fechten – unter den Schwertern der Spanier fallen. Alles ist Lärm, Wehegeschrei und Siegesjubel mischen sich in den Pulverdampf, der die Straßen füllt.
Jetzt jagen geharnischte Reiter die Straße her, Alvarado voran, und die Fliesen, mit denen sie bedeckt, dröhnen unter den Hufen der Rosse. Nie hat der Maya ein solches Ungeheuer gesehen, und Schrecken erfaßt ihn; – der König ist tot – die Stadt verloren. Alles flüchtet, was nicht niedergestoßen wird von den blutgierigen Spaniern. Feuer bricht aus, und ein blutroter Qualm hüllt alles ein. Lebende und Tote.
Da traf ein Sonnenstrahl mein Augenlid, ich erwachte und vor mir stand Mixtli, der Nachkomme derer, die einst hier fochten und starben. Ein Traum hatte mir die Vergangenheit emporgerufen und die Ruinen um mich her zu einstiger Herrlichkeit erstehen lasten.
Ernst und prüfend sah mich der braune Mann an.
»Hat Senor den König gesehen?« fragte er mit gedämpfter Stimme.
»Ja, in all seiner Pracht und Herrlichkeit und in seinem jähen Untergang, als er wie ein Held an der Spitze der Seinen fechtend unter den Schwertern der Spanier dahinsank.«
»Ich wußte, daß du ihn sehen würdest, du trugest sein Bild bei dir.«
Das kleine Idol aus Jadeit, das ich bei mir trug, fiel mir ein.
»O meinest du, daß der Besitz des Kopfes, den ich fand, mir sein Bild emporsteigen ließ?«
»So ist es. War er freundlich gegen dich?«
»Sehr gütig, er hieß mich willkommen in seinem Lande.« Der Indianer schien davon befriedigt.
»Die alemans sind nicht verwandt mit den espanioles?«
»Nein, durchaus nicht!« erwiderte ich, nicht ohne Stolz auf das germanische Blut, das in meinen Adern rollte.
»Hat Senor gegen sie gekämpft?«
»Nein, das nicht, aber meine Vorfahren wohl.«
»Aber Senor war im Kriege?«
»Ja, aber gegen die Franzosen.«
»Die Leute sagen, euer König sei der mächtigste und weiseste Herrscher der Welt?«
»Ja, das ist wahr!« sagte ich, ganz gerührt davon, daß der Ruf von unserem greisen Kaiser und seinen Taten bis zu den Indios in diese abgelegenen Täler gedrungen war. »Er ist ein gewaltiger Herrscher, jeder Zoll ein König.«
»Bueno! Auch die Mayas hatten einst solche Könige. Sie sind,« setzte er langsam hinzu, »zur Sonne gegangen.«
Die christlichen, religiösen Vorstellungen schienen bei dem Maya noch nicht genügend gefestigt zu sein, er würde sonst nicht die Seelen seiner Herrscher, entsprechend den Anschauungen seiner Vorfahren, der Sonne zugewiesen haben.
»Sind der Herr Doktor schon aus Morpheusens Armen erwacht?« ließ sich draußen Schmidts Stimme vernehmen. Er hatte, während ich noch schlief, Feuer angezündet und Kaffee gekocht.
»Sicher, ich bin zu neuem Tagwerk bereit.«
»Dann bitt' ick jehorsamst zum Frühstück zu kommen, et is allens fertig.«
Die Botschaft klang sehr angenehm. Ich verließ meine Hängematte, machte einige notwendige Toilette und trat dann hinaus in die frische, balsamische Morgenluft.
Im Schatten der Mauer hatte Schmidt eine Art Tisch hergerichtet, Blechkanne und Blechbecher aufgestellt, Tortillas hervorgeholt, eine Büchse, die Keks enthielt, geöffnet, und wir konnten uns zum Frühstück setzen.
Ich warf einen Blick nach dem tiefblauen, wolkenlosen Himmel, auf die schweigenden Ruinen, auf die derselbe Himmel schon seit Jahrhunderten herabschien, und ließ mich nieder. Schmidt und den Maya lud ich ein, mit mir Platz zu nehmen und das Mahl zu teilen, das rasch beendet wurde.
Schmidt ging dann, um nach den Tieren zu sehen, auch der Maya entfernte sich, ich saß allein zwischen den Resten des alten Königsschlosses, dessen Mauern so traurig auf mich niederschauten.
Noch fielen die Sonnenstrahlen schräg hernieder und beleuchteten hell die mir gegenüber sich erhebende Wand, so erst recht verratend, wie rauh einst die Zerstörer, wie rücksichtslos die Zeit mit ihnen umgegangen war. Und doch mußte dieses Mauerwerk von eisernem Gefüge sein, daß es den Unbillen des Wetters, der Urgewalt tropischer Vegetation so lange Widerstand geleistet hatte. Ich staunte immer von neuem, als ich mich erhob und die Mauern genauer ansah, mit welcher Kunst die Werkleute unter der Leitung geschickter Baumeister gearbeitet hatten.
Zu nicht geringer Überraschung erkannte ich auch, wie die Ornamente des Mauerwerks musivisch behandelt waren, in einer Weise, wie sie die alte Welt nicht kannte, und die ungewöhnliche mathematische Kenntnisse zur Vorbedingung haben mußte.
Auf der verfallenen Terrasse stehend, die sich wohl 40 Fuß über den Boden erheben mochte, blickte ich über die niedergebrannte Waldstrecke hin.
Zwischen den verkohlten, modernden Stämmen wucherte bereits mächtig frischer Baumwuchs empor, und in kurzer Zeit mußte jungfräulicher Urwald das seltene Bauwerk wiederum mit fast undurchdringlicher Mauer umgeben.
Während Schmidt Messungen vornahm und den photographischen Apparat zum Gebrauch herrichtete, bestieg ich die Pyramide, auf der Mixtli gestern sein Blumenopfer dargebracht hatte.
Herrlich war der Rundblick von hier oben. Fernhin gewahrte das Auge rötlich strahlende Felsengipfel, von denen sich der Morgennebel gleich flatternden, duftigen Schleiern in den seltsamsten Formen erhob, um vor Phöbus leuchtendem Strahle sich aufzulösen und dahinzuschwinden.
Prächtige Käfer und Falter durchschwirrten die Luft, glänzend und schillernd im Morgensonnenschein. Vom Walde her tönte der Papageien mißtönendes Geschrei.
Und über allem lag goldener Sonnenstrahl, und die tiefe, nur hier und da von einem Naturlaut unterbrochene Stille machte das Bild, das sich dem Auge bot, nur noch eindrucksvoller. Unter mir der verfallene Königspalast, der einst gewiß belebt war, so wie mir der Traum gezeigt hatte, während jetzt in den öden Fensterhöhlen das Grauen wohnte, ringsum der düstere Hochwald, der das Gebiet abgrenzte, auf dem das zerstörende Feuer gewütet hatte.
Zu meiner Seite erhob sich der mit halberhaben gearbeiteten Figuren geschmückte Altar, an dem einst längst verschwundene Völker ihren Göttern gedient hatten.
Sie waren wohl erhalten, diese an ägyptische Bildnerkunst erinnernden Köpfe, und als mein Auge länger auf den adlerartigen Gesichtern weilte, schien es, als ob sie Leben bekämen und den dreisten Fremdling unwillig anstarrten.
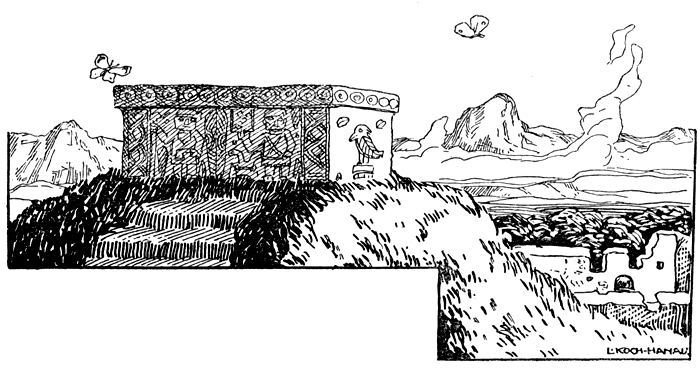
Ich wandte endlich das Auge von ihnen ab, zog meinen Krimstecher hervor und durchsuchte durch seine vortrefflichen Gläser die Ferne.
Zackige Häupter eines Ausläufers der Cordilleren streifte ich, die jetzt frei im glänzenden Sonnenschein dalagen. Über den Wald hin traf mein Auge dann auf ein Haus, ein seltsames Gebäude; doch vermochte ich nicht zu unterscheiden, ob es dem Altertume angehöre, ob der Neuzeit, es lag zu fern.
Langsam ließ ich dann das Glas über den Waldsaum streifen. Einmal sah ich ein starkes Rudel Hirsche vor mir stehen, die ruhig ästen. Weiterhin – war das nicht ein Mensch? Sicher. Im Baumschatten stand ein Mensch – und zwar ein Indianer, der nach dem Palaste schaute. Doch sah ich ihn nur kurze Zeit, dann war er im Waldesdunkel verschwunden.
Es wird Mixtli gewesen sein, dachte ich, er hatte geäußert, er wolle versuchen, uns frisches Fleisch zu verschaffen, und war mit der Büchse davongegangen.
Ich gewann von hier oben die Überzeugung, daß der Palast einst durch Festungswerke geschützt gewesen sein mußte, denn ich vermochte jetzt mittelst des Glases regelmäßig angelegtes Mauerwerk zwischen dem Buschwerk zu erkennen.
Daß der Hügel, auf dem der Palast stand, gleichwie die Pyramide, auf der ich mich befand, künstlich aufgeworfen waren, stand mir außer Zweifel.
Als ich hinabgestiegen war und über Trümmer hin die Terrasse erreichte, sah ich Mixtli vor mir, der mit der Beute seiner Morgenjagd, den besten Teilen eines Hirschkalbes, die in die Decke eingeschlagen waren, zurückgekehrt war.
»Ich habe dich am Waldrande gesehen von dem Tempelhügel aus,« sagte ich ihm, »dich und das Rudel, das du beschlichest.«
»Senor hat sich getäuscht.«
»Ich erblickte dich durch das Glas!«
»Wo hat Senor mich gesehen?«
Ich bezeichnete die Stelle, wo ich den Indianer gewahrt hatte.
Mixtli machte ein sehr ernstes Gesicht.
»Ich war dort!« Und er deutete nach der entgegengesetzten Richtung. »Hat Senor wirklich einen roten Mann gesehen?«
»Mein Glas täuscht nicht.«
Die beiden Maultiertreiber hatten die Ruinen nicht verlassen.
»Ein fremder, roter Mann hier? Das ist nicht gut!«
»Wie? Fürchtest du etwas von deinen Landsleuten hier für uns?«
»Dieser Ort ist wenigen bekannt, auch seit das Feuer ihn freilegte; aber Antonio Mahos, den du gesehen hast, kennt ihn, und er ist gefährlich.«
»Meinst du, daß er es war, den ich erblickte?«
» Quien sabe? Er hat seinen Weg nach Norden genommen.«
»Und was hätten wir von dem Manne zu fürchten?«
»Ich weiß nicht, was im Lande vorgeht; aber du darfst glauben, daß die Rancheros diesen gefährlichen Burschen mit gutem Grunde verfolgten. Es gibt bei uns immer Leute, die mit dem Präsidenten unzufrieden sind, und ihnen schließt sich gar leicht das Gesindel der Hafenstädte, schließen sich verführte Indios an. Mahos ist auf der Flucht, er kennt den Königspalast, der so einsam liegt.«
»Aber warum sollte dieser Mensch feindlich gegen uns auftreten?«
»Habt ihr nicht seine Flucht verhindert, ihn der Gefahr ausgesetzt, in die Hände seiner Feinde zu fallen? Er wird das rächen, wenn er kann, er wird uns berauben, wenn er kann, er wird die Leute am Usumacinto aufwiegeln, indem er ihnen Lügen erzählt.«
»O, das wäre ja sehr unangenehm, das würde ja meine ganze Tätigkeit hier lähmen, ja unmöglich machen.«
»Noch wissen wir nichts, sei ruhig, ich werde mich nach ihm umsehen.«
»Ich hoffte, so reiche Ausbeute für die Geschichte der Vorzeit hier zu finden.«
»Darum habe ich dich hergeführt,« sagte er freundlich. »Du bist ein aleman und ein literato , und ich weiß von Don Luis, daß du über die Häuser der Könige und das Mayavolk Bücher schreiben willst.«
Ich freute mich der Teilnahme des braunen Burschen an den Zwecken, die ich verfolgte, und sagte ihm das auch.
»Haben schon viele Europeos diese Ruinen gesehen?« fragte ich dann.
»Es müßte vor langer Zeit geschehen sein. Seit Jahrhunderten lagen sie zu tief versteckt im Walde. Ich habe dieses Haus des Königs einst als Knabe gefunden, als ich einen Jaguar verfolgte; dichter Urwald hüllte es damals ein. Es erhob sich früher eine große Stadt hier, du kannst deren Reste in den Wäldern noch erkennen.«
»Eine Stadt? In dieser wasserlosen Gegend eine Stadt? Kaum glaublich.«
»Wasser? Sähest du nicht die Quelle der Tiefe? Überall birgt der Boden hier Wasser. Sahest du nicht die Wasserleitung des Königshauses? Sie kommt weit von den Bergen hier. Auch vom Usumacinto war Wasser hergeleitet, du kannst noch die Spuren des Grabens sehen.«
Ich erstaunte über diese Äußerungen des Indianers, die ein größeres Vertrautsein mit den Resten der Vorzeit verrieten, als ich selbst bei ihm, der ein so lebhaftes Interesse dafür zeigte, vermutet hatte.
»Du hegst Teilnahme für die fernen Geschicke deines Volkes?«
»Ich bin ein Maya reinen Blutes und von altem Geschlecht, Senor. Ich diente schon dem Vater von Senora Moro, der aus Königsblut stammte, und diene jetzt Don Luis, seinem Enkel, der das Blut der Spanier in seinen Adern rollen fühlt. Ich weiß, daß die Mayas einst ein großes Volk waren, so mächtig wie Ingleses oder Franzeses, und freue mich, wenn die fremden literatos kommen, um die Häuser unserer Könige zu bewundern.«
Schmidt, der, nachdem er wissenschaftlichen Bestrebungen gehuldigt, emsig als Koch tätig gewesen war, rief zum Mittagsmahle, das er in einem Gemache des alten Königspalastes aufgetragen hatte, und machte so meiner Unterredung mit Mixtli ein Ende.
Wir speisten und hielten dann Siesta, wie es das Klima gebot.
Mein Eifer, die Ruinen zu durchforschen, war nach meiner Unterredung mit Mixtli nur noch gestiegen.
Meine Wünsche waren zunächst dahin gegangen, die alten Kulturstätten Chiapas und Yucatans, die wesentlich durch den amerikanischen Gelehrten Stephens ihrem fast unbekannten Dasein in den Urwäldern Mittelamerikas entrissen und der erstaunten Welt vor Augen geführt worden waren, zu sehen und mit ihren Schriftzeichen und Bildwerken an Ort und Stelle zu studieren. Ich hatte den Weg durch Guatemala gewählt, um auch hier Land und Leute kennen zu lernen. Daß mir das Schicksal so unvermutet auf meiner Fahrt ein allem Anschein nach bisher noch unbekanntes Bauwerk entgegenführen würde, durfte als seine besondere Gunst angesehen werden, und ich beschloß, sie auszunützen.
Gegen drei Uhr erhob ich mich, um die alten Straßen die von dem Palast ausgingen, zu untersuchen. Mixtli hatte sich schon entfernt. Meine Besorgnis wegen dieses Mahos war geschwunden. Es war eigentlich kaum anzunehmen, daß der Kerl sich hier herumtreiben sollte, wo die mexikanische Grenze so nahe lag. Wahrscheinlich hatte ich einen harmlosen Jäger oder Kautschuksucher gesehen. Am Usumacinto sollten ja Indios wohnen.
Als ich jetzt sorgfältig den Boden untersuchte, erkannte ich bald, daß von der Terrasse aus einst ein breiter fester Weg nach Osten zu geführt hatte, dessen Grundlage noch deutlich zu erkennen war, trotz der Zerstörung durch die wuchernde Vegetation.
Ich folgte dem Wege langsam und gelangte in gerader Richtung zu dem umsäumenden, hochstämmigen Urwald.
Ich trat in dessen Schatten ein, und trotz des Gewirres von emporstrebenden und niedergestürzten Baumstämmen der sie umwuchernden Schlingpflanzen erkannte ich auch hier die Straße.
Ich bahnte mir mit meiner scharfen Machete, einem großen Haumesser, das ich mir schon in der Stadt Guatemala gekauft hatte, Bahn und gelangte tiefer in den Wald.
Der Weg war sehr mühevoll, doch wollte ich die immer noch erkennbare Straße so weit, als es tunlich, verfolgen; um so mehr, als ich zu den Seiten meines Weges kurze Säulen bemerkte, von denen einige standen, andere niedergestürzt waren.
Unerwartet stand ich vor ansteigendem Boden, der sich bald als ehemalige Treppe auswies, deren Stufen durch gleiche Einwirkung der mächtigen Vegetation wie bei dem Aufgang zur Terrasse des Palastes arg aus ihrer Lage gebracht waren.
Durch das lichter werdende Laub der hier ragenden Ceibabäume erkannte ich auch hochliegendes Mauerwerk.
Ich stieg zwischen Büschen die Treppe, die doch nicht mehr als zwanzig Stufen gezählt haben mochte, hinauf und stand überrascht vor einem kleinen, überaus zierlichen Bauwerk, das sich hier auf einer sicherlich künstlich hergerichteten Erdanhäufung erhob.
Zwar war es von Pflanzen um- und überwuchert, doch dem Anschein nach noch gut erhalten. Eine breite Tür, die durch Säulenpaare eingefaßt war, führte in das Innere, das im Halblicht vor mir lag.
Schnell machte ich mit meiner Machete Raum und stand gleich darauf vor dem so verschwiegen im düstern Walde gelegenen Hause.
Zierliche Ornamentik im strengen Stile der eigentlichen Mayabauten, der sich wesentlich von denen der Nahuavölker, zu denen auch Azteken gehörten, unterscheidet, zierte die Außenwand.
Zwischen gleich Ranken verschlungenen, erhabenen Arabesken grüßte mich von der oberen Einfassung der Tür herab ein schön gearbeiteter und gut erhaltener Frauenkopf, der mich mit freundlichem Lächeln zu bewillkommnen schien.
Das Bauwerk, zierlich in seinen Verhältnissen, schien wenig Umfang zu haben; um so reicher war seine ornamentale Ausstattung, die die artigsten und originellsten Muster aufwies.

Starker Pflanzenwuchs, Lianen, Zwergpalmen, Büsche erhoben sich über dem ebenen Gesimse, versperrten zum Teil den Eingang.
Meine Machete bahnte den Weg.
Das Halblicht im Innern ließ darauf schließen, daß dort Fensteröffnungen vorhanden seien oder das Dach zerstört war.
Mir war doch ganz eigen zumute, als ich hier im düsteren Urwald einsam vor diesen Resten einer untergegangenen Zivilisation stand.
Tiefes Schweigen ringsum, nur der laue Wind rauschte leise in den Baumwipfeln und schien von vergangenen Zeiten zu flüstern.
Zögernd trat ich ein.
Steinfliesen bedeckten den Grund, der mit flach ausgeführten Ornamenten bedeckt war.
Das Dach war noch wohl erhalten, und durch eine breite Fensteröffnung fiel Licht in ein Gemach von mittlerer Größe.
Etwas wie ein Altar erhob sich mir gegenüber, der mit Figuren geschmückt war; und auf der Wand dahinter, – ein Schauer des Entzückens erfaßte mich, – sah ich Wandmalereien, die, wie mir bekannt war, so selten in diesen alten Mayabauten noch aufgefunden werden.
Schnell schaffte ich, indem ich Buschwerk, das das Fenster versperrte, beseitigte, mehr Licht in das Gemach.
Mit staunender Freude erkannte ich jetzt die noch wohlerhaltene Farbenpracht der Bilder.
Sie stellten Menschen in einer belebten Handlung dar. Blau, Rot, Grün bildeten den Grundton der Gewänder, und alles Fleisch zeigte in treuer Nachahmung das rötliche Braun, das dem Indianer noch heute eigen ist.
Das Wandgemälde mir gegenüber schien eine Opferhandlung darzustellen.
In seiner Mitte erhob sich eine fast lebensgroße Figur, das Haupt mit einer eigenartigen Mütze bedeckt, von der lange, bunte Federn herabwallten. Das Gesicht, profil gehalten, eingefaßt von langem, schwarzem Haar, zeigte römische Form und hatte einen strengen Ausdruck. Das Weiße des Auges leuchtete zu mir her. Ein blaues Gewand, mit goldenen Zieraten geschmückt, reichte fast bis zum Knie herab; ein bunter Federmantel wallte vom Rücken hernieder. Die halbnackten Arme trugen goldene Armbänder, und die rechte Hand hielt ein eigenartiges, einer Sichel ähnliches Instrument. Die Füße steckten in buntverzierten Schuhen.
Daneben stand eine junge Frau in anscheinend überaus prächtigem Gewande, das von einem goldigen, mit Arabesken bedeckten Gürtel zusammengehalten wurde und bis zu den Knöcheln herabfiel. Sie hielt ein nacktes Kind auf dem Arm, trug auf dunklem Haar einen goldenen Reif und, wie der Mann, reichen Federschmuck. Vor ihnen erhob sich ein Altar, auf dem eine Flamme brannte.
Rings um die beiden Hauptgestalten standen und knieten Krieger und Priester, unterscheidbar durch ihre Gewänder, in mannigfacher Haltung.
Der Eindruck dieses ganzen, farbenprächtigen Bildes, auf dem Kleider, Schmuck, Waffen mit der größten Treue wiedergegeben waren, während die Zeichnung der Figuren, die sämtlich dem Beschauer das Profil zuwandten, wiederum lebhaft an altägyptische Bildwerke erinnerte, nur daß sie die Körperverhältnisse richtiger wiedergab, war ganz gewaltig; ich konnte das Auge lange Zeit gar nicht davon abwenden.
Dann aber schaute ich mich um. Schriftzeichen, Ornamente bedeckten die Wände da, wo die Bilder sie freiließen.
Dort war auch eine Tür.
Ich trat hinzu und sah, daß eine wohlerhaltene Treppe nach unten führte.
Sehr begreiflich war der Wunsch, zu erfahren, welche Geheimnisse diese Tiefe berge.
Zündhölzchen und einen Wachsstock führte ich immer bei mir.
Ich setzte ihn in Brand und leuchtete hinab.
Die Treppe, deren Stufen aus wohlbearbeiteten Steinen bestanden, schien vollständig erhalten, und sie wie die gemauerten Wände waren trocken.
Ich stieg hinab, zehn Stufen; hier kam eine Wendung nach links, und zwölf weitere Stufen führten mich auf festen Grund, der mit Steinplatten bedeckt war. Vor mir lag ein Gang, der sich ziemlich weit auszudehnen schien, obgleich mein Licht ihn nur etwa 20 bis 25 Schritte weit erhellte.
An den Wänden bemerkte ich neben Nischen auch Reliefs und Malereien.
Die Luft hier unten war keineswegs dumpfig, der Gang mußte also an mehreren Stellen mit der Oberwelt in Verbindung stehen.
Meine Begierde, in diese geheimnisvolle Unterwelt einzudringen, trieb mich weiter.
Bald verzweigte sich der Gang.
Ich dachte an das Labyrinth und daran, daß ich keinen Ariadnefaden besaß, um im Notfall den Rückweg finden zu können, und wollte umkehren. Da bemerkte ich in der einen Verlängerung des Weges eine umfangreiche, jedenfalls tiefe Nische vor mir, der Weg mußte da enden. Da sie unweit dunkel gähnte, ging ich hin.
Als ich näher kam, erkannte ich, daß ich keine Nische vor mir hatte und trat gleich darauf in einen achteckigen Raum, dessen Bedachung von Säulen getragen wurde. Mayabuchstaben, Bilder und Reliefs bedeckten Säulen und Wände.
Das erste, was mir, als ich umherleuchtete, auffiel, waren die Eingänge zu acht dunklen Korridoren, die regelmäßig einander gegenüber lagen. Ich hob das Licht, um einen Überblick über den ziemlich umfangreichen Raum zu gewinnen, und dachte dann der Umkehr.
In diesem Augenblick raschelte eine der großen Eidechsen des Landes, eine Iguana, vor mir auf und huschte vorüber.
Ich erschrak so heftig, daß ich das Licht fallen ließ, es verlöschte am Boden.
Ich setzte rasch ein Streichholz in Brand und suchte mein Licht wieder von neuem anzuzünden.
Ich schaute mich um.
Wo war ich denn hergekommen?
Die acht Eingänge gähnten mich gleichmäßig von allen Seiten an.
Die kurze Dunkelheit, wohl auch einige Wendungen, die ich gemacht haben mußte, machten mich zweifelhaft in bezug auf die Stelle, wo ich hereingekommen war.
Endlich sagte ich mir: durch diesen Gang bist du hierher gelangt.
Ich schritt hinein, überzeugte mich aber bald, daß es nicht der war, der mich hierhergeführt hatte, denn ich hätte schon nach 100 Schritten auf die Gabel treffen müssen, wo ich seitab gegangen war.
Also zurück zu dem Oktogon.
Ich legte aber jetzt mein Taschentuch vor die Öffnung dieses Ganges, um ihn zu erkennen, wenn ich zum zweiten Male den falschen Weg einschlagen sollte.
Ich betrat den nächsten Korridor, erkannte aber auch hier bald, daß er nicht die erwünschte Richtung einschlug.
Also zurück!
Einer von den achten mußte es doch sein, und weit war ja der Weg nicht.
Ich suchte den nächsten auf, und hier war ich in eine Sackgasse gerannt, die zu beiden Seiten große Nischen zeigte.
Wiederum sah ich mich in dem Achteck. Nur die Geduld nicht verloren!
Ich kann nicht sagen, daß ich mich ängstigte; aber unheimlich war die Situation, in der ich mich befand, doch. Schlangen hatte ich hier kaum zu befürchten, und die großen Eidechsen, deren eine mich so erschreckt hatte, waren harmlos.
Ich drang in den nächsten Gang ein.
Wiederum vergebens.
Geduldig wählte ich den, der neben ihm sich auftat.
Bald gewahrte ich zu meiner Rechten einen zimmerähnlichen Raum, also war ich wiederum falsch gegangen.
Ich blickte in den Raum hinein und sah in einer Ecke trockenes Gras und Farrenwedel liegen, auch dürre Äste lagen da.
Dies fiel mir mehr auf, als daß auch dieser Raum Bildwerke aufwies.
Zu meinem nicht geringen Schrecken bemerkte ich jetzt, daß mein Licht fast niedergebrannt war. In meinem Eifer, den Ausgang zu gewinnen, auch abgeleitet durch die Begierde, mit der ich die Umgebung anstarrte, hatte ich es nicht beachtet.
Ich sah nach der Uhr.
Mein Gott, es war schon sieben Uhr vorbei, also draußen bereits stockdunkel, besonders im Urwald.
Durch diesen in der Nacht zurückzukehren, wo ich Gefahr lief, mich in der Dunkelheit zwischen Dornen, Gestrüpp und Stechpalmen ernstlich zu beschädigen, und durchaus nicht die Sicherheit hatte, den Rückweg zu finden, hielt ich für untunlich.
Gelangte ich an den Ausgang aus diesem Labyrinth, hätte ich freilich durch Schüsse Zeichen geben können; ich hatte ein Gewehr und ein halbes Dutzend Patronen bei mir. Vielleicht, daß man mich hörte! obgleich das bei dem den Schall brechenden Urwald auch nicht so ganz sicher war. Daß man mich bereits vermißt hatte und nach mir suchen würde, setzte ich als selbstverständlich voraus.
Bei dem letzten Scheine meines sich verabschiedenden Lichtes warf ich noch einen Blick in das Gemach, welches ich gefunden hatte.
Mir kam die Idee, da ich dürres Holz und Gras vor mir sah, Feuer anzuzünden. Rauch war kaum zu fürchten, denn die Luft in diesen unterirdischen Gängen war so gut, daß hinreichende Zirkulation vorhanden sein mußte.
Ich stöberte mit meiner Machete etwas in dem Heu und Holz herum, um allenfalls Reptilien, die sich hier eingenistet hatten, zu verscheuchen; doch war meine Befürchtung grundlos.
Rasch nahm ich eine Handvoll des trockenen Schilfes, legte es in eine Ecke des ummauerten Raumes und zündete es an.
Lustig flackerte das trockene Zeug auf, ich warf einige Äste, die ebenfalls sehr dürr waren, darauf.
Jetzt erlosch mein Licht.
Das Holz fing Feuer, brannte aber trotz seiner Trockenheit nur langsam. Der entstehende Rauch war unbedeutend und belästigte nicht.
Was nun beginnen?
Von neuem, mit brennendem Aste in der Hand, versuchen, die Vorhalle zu gewinnen?
Schwer konnte das nicht sein, denn ich wußte nun, welche Gänge ich noch zu besuchen hatte.
Ob am Tage in diesen Räumen so viel Licht herrschte, um den Weg finden zu können, war mir doch zweifelhaft. Die Nacht war lang und der Vorrat an Heu, um es so zu nennen, und trockenen Asten nicht groß, wenn ich das Feuer erhalten wollte.
Aber ich konnte es ja erlöschen lassen und morgen früh wieder anzünden. Hatte es auch nichts verlockendes, hier eine Nacht zu verbringen, so bot doch das Heu eine Art Nachtlager.
Während ich so sann, traf mein Blick auf eine Stelle unterhalb eines der mich umgebenden phantastischen Bilder, an der der Stuck, auf den sie in einer al fresco-Manier gemalt waren, abgefallen war. Mir schien es, als ob hier eine Öffnung in der Mauer sei.
Trotz der wenig angenehmen Lage, in der ich mich befand, erwachte doch der Forscher in mir.
Ich trat hinzu und erkannte in der Nähe deutlich, daß hier inmitten von Ornamenten aus Stuck eine regelmäßig gearbeitete Öffnung vorhanden war. Sie war so versteckt angebracht, daß sie auch jetzt nur durch die eigenartige Beleuchtung von unten wahrzunehmen war, als mein Blick zufällig darauf fiel. Der Stuck mußte sie natürlich gänzlich verborgen haben.
Ich leuchtete mit einem brennenden Aste hinein.
Die Öffnung war viereckig und klein.
Ich sah im Schein des Lichtes ein Häuflein Bast vor mir.
Ich griff in die Öffnung und holte es heraus, es enthielt etwas Hartes.
Ich wickelte es, dem Feuer mich nähernd, auseinander und hielt zwei Lederstreifen in der Hand und ein goldenes Armband, von jener feinen Filigranarbeit, wie sie einst die Goldschmiede Mexikos anfertigten, von der ich Proben im Museum zu Madrid gesehen hatte.
Stumm und staunend stand ich.
In dem Schmuckgegenstande ragte ferne dunkle Vorzeit lebensvoll in die Gegenwart hinein. Ein Armband, das einst von einem Großen dieser versunkenen Welt getragen worden war.
Jetzt betrachtete ich die Lederstreifen – sie waren auf der einen Seite mit Schriftzeichen bemalt, ganz ähnlich denen, die die Mayahandschriften in Madrid und Dresden zeigten.
Meine Freude war grenzenlos.
Das war ein Fund, mit dem ich vor der wissenschaftlichen Welt Ehre einlegen konnte.
Trotz meiner Erregung traf ein Geräusch mein Ohr, das mich erschreckte – ich glaubte Stimmen zu hören und gleich darauf auch die eigenartigen schlürfenden Schritte, wie sie die Alpargates, die aus Bast geflochtenen Schuhe der Eingeborenen, beim Gehen auf hartem Boden hervorbringen, zu vernehmen.
Dies rief mich aus dem Land der Träume sofort in die Wirklichkeit zurück.
Hastig steckte ich Armband und Lederstreifen in die Tasche, griff zu meinem Karabiner, den ich auf dem Rücken trug, und machte ihn mit einer Schnelligkeit schußfertig, die an die beste Zeit meiner militärischen Ausbildung erinnerte.
Das Geräusch war verstummt.
Aber ich hörte flüstern, es standen Menschen in dem Gange.
Konnte es Mixtli sein, dem jedenfalls diese Gänge bekannt waren und der mich hier suchte?
Der würde aber doch jedenfalls gerufen haben, um sich meiner Anwesenheit zu vergewissern.
Mich hier von Gott weiß wem überraschen lassen, hier in diesem mir unbekannten Labyrinth?
Die draußen mußten den aus dem Zimmer fallenden Feuerschein gesehen haben.
Wieder hörte ich flüstern, dann das Schlürfen der Alpargates.
Die Sache war unheimlich und beängstigend, denn daß es hierzulande Leute gab, die mit dem Messer rasch zur Hand waren, war mir nicht unbekannt, und ich war allein, abgeschnitten von menschlicher Hilfe.
Aber ein Ende mußte ich machen.
Entschlossen riß ich einen brennenden Ast aus dem Feuer, nahm ihn in die Linke, in der Rechten hielt ich schußfertig den Karabiner, und den Ast über dem Kopf haltend, trat ich rasch hinaus in den Gang.
Zwanzig Schritte von mir ab, nicht auf der Seite, von der ich gekommen war, standen zwei Kerle, von denen einer einen brennenden Spahn trug.
Mit einem kräftigen Alto ahi! (Stillgestanden!) donnerte ich sie an und hob den Karabiner.
Einen Augenblick schienen die Kerle, von denen ich nicht zu unterscheiden vermochte, ob es Weiße oder Indianer seien, wie versteinert. Dann aber warf der eine seinen Spahn zur Erde und beide entfernten sich mit einer Schnelligkeit, die sie gleich einer flüchtigen Erscheinung im Dunkel verschwinden ließ.
Ich hielt es für geraten, mich schleunigst nach der anderen Richtung zu entfernen, erreichte, meinen Weg mit dem brennenden Aste beleuchtend, das Achteck, sah mein Taschentuch vor der Öffnung liegen und betrat nun den Gang daneben, aber auf der anderen Seite.
Das war der Weg, den ich gekommen, und bald darauf stand ich in der kleinen Halle, die den Eingang zu dieser unterirdischen Welt bildete.
Ich trat hinaus, sah den Sternenhimmel über mir und um mich den düstern Wald, gespenstig durch die Schatten der Nacht.
Aber unendlich glücklich war ich mit den Schätzen, die mir der Zufall beschert hatte.
Da stand ich nun, ich Sohn der deutschen Erde, vor einem Bauwerk, uralt, von einem Volke errichtet, das nur in herabgekommenen Sprossen noch lebte, die kaum von der Vergangenheit ihres Stammes etwas wußten, und trug bei mir den Schmuck eines Königs, der einst hier herrschte, und Schriftzeichen, die vielleicht von ihm redeten.
Über mir die glänzenden Gestirne des Centaur und des Argus, um mich der tropische Urwald.
Ich begann zu frösteln, denn die Nacht war kalt, das rief mich zur Gegenwart zurück.
Ich beschloß, mein Gewehr abzufeuern, einmal, um möglichen Feinden Respekt einzuflößen, und daneben in der schwachen Hoffnung, daß die Schüsse von Freunden gehört werden würden.
O, Freude! zwei Schüsse, dumpf aus dem Wald hervorklingend, antworteten ihm.
»Hier!« schrie ich mit aller Kraft meiner Lunge und feuerte den zweiten Schuß ab.
»Hurra!« klang es schwach aus dem Walde hervor, »wir haben ihm, Herr Dokter.«
Wieder schrie ich.
Da sah ich auch schon Lichtschein durch die Blätter schimmern, und gleich darauf erschienen am Fuße der Treppe Mixtli, Schmidt und der Arriero, jeder in der einen Hand eine Kienfackel, in der andern die blinkende Machete.
»Ne, Herr Dokter, aber so wat. Na, et is man jut, det wir Ihnen wieder haben. Ick habe ene schene Angst ausjestanden, ick dachte, et wäre Ihnen wat passiert. Der braune Mann hier hatte aber gleich den richtigen Riecher.«
Er stand jetzt neben mir, und die Freude leuchtete dem ehrlichen Burschen aus den Augen.
Auch die beiden Indianer kamen jetzt die Treppe herauf. Mixtli ernst wie immer.
Ich sagte ihm in kurzen Worten, was meine Rückkehr verhindert habe.
»Die Unsichtbaren sind dir hold, Senor, du hast die zerstörten Ruhestätten der Könige gesehen.«
Als ich ihm dann mein Zusammentreffen mit den beiden Gesellen mitteilte, wurde sein Gesicht finster: »O, haben sich Krähen in dem Neste der Adler niedergelassen?«
» Vamos!« (Laßt uns gehen!) fuhr er kurz fort und schritt herab. Der Arriero folgte ihm, und ich und Schmidt schlossen uns an.
»Nur um Jotteswillen vorsichtig, Herr Dokter, det is keen Spazierjang in Tierjarten.«
Schweigend und des Weges, den er gekommen war, sicher, ging Mixtli voran, die Fackel hochhaltend. Teobaldo, der Arriero, folgte, dann ich, und den Schluß machte Schmidt.
Der Weg war, da die Macheten der beiden Indianer gehörig aufgeräumt hatten, weniger schwierig als ich gefürchtet hatte, und ohne große Beschwerde erreichten wir beim Scheine der Kienfackeln das Haus des Königs.
»Een bisken Appetit werden Sie wohl ooch haben, Herr Dokter, nach den Spaziergang. Na, ick habe vorjesorgt.«
Der brave Bursche, der nicht geringe Angst ausgestanden hatte, als die Nacht hereinbrach und ich nicht zurückkehrte, hatte in der Tat reichlich vorgesorgt, und wir speisten in einem der geschlossenen Gemächer des Palastes, dessen Eingang nach dem Hofe zu lag, sehr behaglich.
Schmidt suchte seine Hängematte auf, und ich saß mit dem alten Maya allein neben dem Feuer, das Schmidt angezündet hatte. Geisterhaft erschienen in seinem flackernden Schein die alten Mauern.
Bald stieg auch der Mond herauf und verbreitete sein mildes Licht.
Ich war noch erregt von meinen Erlebnissen und fühlte keine Neigung zum Schlafen.
Ich sah auf das ernste braune Gesicht des Indianers, dessen Profil viel Ähnlichkeit mit den Bildnissen aus der alten Zeit hatte, und äußerte dann:
»Du sagtest, es seien Grabstätten der alten Könige dieses Landes, in die mich ein freundlicher Zufall geführt hatte.«
»Es ist so, Senor, dort ruhten ihre Gebeine.«
»Und sind diese in die Winde verstreut?«
»Der Spanier kam, er suchte wie ein hungriger Coyote nach Gold und zerstörte die Gräber, verstreute die Gebeine und raubte den Schmuck der Leichen.«
»Nicht alles,« erwiderte ich lächelnd und zog das Armband hervor, »sieh', was mir deine Königsgeister schenkten.«
Mit einem Blick, staunend und doch scheu, schaute der Mann auf das Armband.
»Das hast du gefunden?«
Ich sagte ihm wo und wie.
»Ja, du trägst das Bild des Königs bei dir. – Willst du es behalten?«
»Ich werde der Regierung in der Stadt Kenntnis von meinem Funde geben und ihn im Interesse meines Landes zu erwerben suchen. In unserem Museum ruht das Armband sicher.«
»Du bist ein gerechter Mann, Senor. Die Unsichtbaren – die Heiligen,« verbesserte er sich, »sind mit dir, tue, was du sagst.«
»Du kanntest das Haus dort im Walde und die Gänge unter der Erde?«
»Ja, Senor, ich kannte es, kannte die Gänge in der Erde.«
»Und du meinst, daß es Begräbnisstätten gewesen?«
»Die toten Könige fanden dort ihre Ruhestatt, und die Lebenden gingen zu dem Hause mit den Gemälden, um dort zu den guten Göttern zu beten.«
»Und alles dies ist zerstört von den beutegierigen Spaniern?«
»Die Gräber, ja, doch dieser Königssitz war schon in Trümmern, als sie über das Meer kamen.«
Ich erstaunte immer mehr über die in seinem Kreise so seltene Kenntnis der Vorgeschichte seines Volkes.
»Und woher weißt du das?«
»Die Steine in den Wäldern reden davon.«
»Und wer hat diesen Palast, wer hat die Stadt zerstört?«
Finster wurde des Mannes Angesicht.
»Es waren Männer meiner Farbe, Senor, die verruchten Nahuas, die hier wie wilde Tiere hausten.«
»Bist du so genau mit der Geschichte deines Volkes bekannt, mein Freund?«
»Ich weiß alles, was Don Ignacio, der Cura, uns davon erzählt hat; er stammte von den Priestern des höchsten Gottes, den Cheles, ab und las die Zeichen, in denen die Väter schrieben.«
»Was sagst du? Gibt es einen Menschen und noch dazu einen christlichen Priester, der die Zeichen der Maya zu deuten vermag?«
»Es gab einen solchen, Don Ignacio ist tot. Doch hat er alles aufgezeichnet in der Sprache der Spanier, was die Zeichen besagen.«
»Und diese Aufzeichnungen? Wo sind sie?«
» Quien sabe? Er wird sie mit in das Grab genommen haben.«
»O, welch' ein Verlust für die Wissenschaft,« stöhnte ich mehr als ich sprach. »Und du hast seinen Mitteilungen aus der Vorzeit gelauscht?«
»Ich bin viele Jahre mit Don Ignacio gereist, als er die alten Städte, Königshäuser und Bildwerke untersuchte, und habe sie alle gesehen in Chiapa und Yukatan. Und hierher, nach Tzutuhil, der Stadt der Fledermäuse, habe ich ihn selbst geführt, sie war vergessen, als ich sie in den Wäldern fand.«
»Nun sage mir, amigo, sage mir, was Don Ignacio Euch erzählte. Wir alemans sind eifrig beschäftigt, die geheimnisvollen Zeichen eurer Denkmäler zu enträtseln, um so Licht in der Geschichte eures Volkes zu verbreiten, das eine so eigenartige Kultur hatte und solche Zeichen seines Daseins zurückließ.«
Nach einer Weile des Schweigens sagte der Alte:
»Es sind viele Jahrhunderte vergangen, seit die Väter in die Länder zwischen den beiden Meeren zogen. Sie kamen von Norden von Tula, der Stadt, wo sie lange Menschenalter glücklich gelebt und viele Häuser und Tempel gebaut hatten. Aber die Nahuas kamen heran, wilde Tiere waren sie nur, denn sie opferten ihren furchtbaren Göttern Menschen und speisten die Opfer. Und die Mayas mußten nach harten Kämpfen ihre Heimstätten verlassen und nach Süden wandern, so gebot es der Gott, den sie verehrten, so verkündeten die Priester. Sie mußten, unfähig den Wilden zu widerstehen, davon ziehen.«
»Deine Väter nannten sich damals Tolteken.«
»Nichts davon,« erwiderte er verächtlich, »die Tolteken waren Nahuas gleich Chickimeken und Azteken, und all ihr Wissen und all ihre Kunst, die Kenntnis des Laufes der Gestirne, die richtige Berechnung der Zeit hatten sie nur von uns, den Mayas. Du kannst ihre Nachkommen noch heute im Lande sehen, wie die der Mayas, und noch heute reden sie eine andere Sprache als wir.«
»Aber was erzählen eure ältesten Überlieferungen?«
»Sie erzählen mir, daß einst vor vielen Jahrhunderten ein Mann in das Land gekommen, wo damals die Mayas lebten, in langem Gewand, mit langem Bart und weißer Gesichtsfarbe. Quetzal nannte er sich, wie noch heute der heilige Vogel heißt, er kam über das Meer von Osten her und schied nach Westen hin, nachdem er uns die Götter verkündet, die guten und die bösen, und uns alles gelehrt hatte, was uns zum großen, glücklichen Volke machte.«
»So berichten die Sagen der Azteken aber auch.«
»Sie haben sie von uns entlehnt, die unwissenden Wilden.«
»Und wieviel Jahre ist das her, daß jener Wohltäter zu euch kam?«
»Es sind mehr als 3000 Jahre her,« sagte Don Ignacio, »wie die Inschriften verkünden.«
»Und dein Volk zog nach Süden, als es von den Nahuas bedrängt wurde?«
»So geboten es die Götter. Sie verließen ihre Heimat und bauten sich neue Städte in Chiapa, verwandelten das Land in einen Garten und lebten glücklich viele Jahrhunderte lang unter dem Schutze der guten Götter. Du wirst die Städte sehen, die sie dort gebaut haben. Herrlicheres, als die Stadt, die sie heute Palenque nennen, niemand weiß mehr, wie sie einst genannt wurde, gibt es auf der Welt nicht. Dicht dabei liegen andere Städte in Trümmern, Ococingo, Menché und andere. Du wirst sie alle sehen.«
»Und die Spanier zerstörten sie?«
»Nein, Herr – sie lagen als Ruinen da, als die Spanier kamen, die verruchten Nahuas zerstörten sie viele Menschenalter früher.«
»Und dein Volk verließ abermals seine Heimstätten?«
»Sie mußten, denn sie waren friedlich und des Kampfes nicht gewohnt, sie liebten die Künste, liebten die Blumen und opferten den Göttern, den guten, den sonnenhellen, die alles Glück verliehen, und den dunklen, den nächtigen, die das Unheil bringen, um sie zu versöhnen.
Aber der größte aller Mayakönige, Nima Quiché, führte das Volk hinweg, baute die Stadt, die nach ihm noch heute heißt, und gründete einen neuen großen Staat hier in Guatemala. Zweiundzwanzig Könige folgten ihm auf den Thron, du siehst ihre Bildnisse hier in dem Saale, und neben diesen liest der, der die Zeichen deuten kann, die Geschichte ihrer Taten. Aber immerfort drängten uns die Nahuas, und ihre Angriffe waren um so gefährlicher, als auch die Mayas unter sich uneins waren. Viele von uns waren nach Yukatan gewandert und hatten dort neue Reiche gegründet, mächtige Reiche, deren letzte Reste du in Uxmal und Mayapan sehen wirst. Tzutuhil, in dem wir weilen – Acxopil, der Sohn Nima Quichés, hatte es gebaut – fiel endlich vor den mörderischen Nahuas, und bald darauf eroberten die Spanier, die bereits Tenochtitlan zerstört hatten, unter dem goldhaarigen Alvarado auch Quiché und legten es in Trümmer, nachdem die Unseren unter ihrem Könige Nezahualpilli bis zum letzten Atemzuge gekämpft hatten.
Nur in Yukatan wehrten sich die Mayas noch lange gegen die Spanier, bis sie auch hier unterlagen. Und seit der Zeit ist unsere Welt versunken, und nur die Steine reden noch von ihr. Das Volk ist verdummt, und nur wenige wissen etwas von der Vorzeit und von den Bauten, die der Urwald Jahrhunderte in seinem tiefen Schoße barg. Don Ignacio, aus dem Priestergeschlecht stammend, hellte die Vorzeit auf und sprach uns von der Vergangenheit unseres Volkes, und wir lauschten mit Ehrfurcht auf seine Worte. Er war ein Mann unseres Stammes und ein Gelehrter im Sinne der Weißen.«
Mit tiefem Interesse hörte ich dem Maya zu, der so von der Vergangenheit seines Volkes sprach, dessen Zivilisation zugrunde ging, ehe sie der Menschheit Nutzen bringen konnte.
Die Behauptung Mixtlis, daß jene nördlichen Völker vom Stamme der Nahuas, wie die Azteken und deren Vorgänger, all ihre Bildung nur von den Mayas hatten, wird ja von der neueren Geschichtsforschung vollauf bestätigt. Es ist heute keinem Zweifel mehr unterworfen, daß die eigenartige amerikanische Kultur, deren Erscheinungen den Eroberern auch in Mexiko entgegentraten, ihre höchste Entwicklung doch nur in den mittelamerikanischen Staatengebilden erreichte, wie sie dort auch ihre Heimat hatte.
Mixtli ergriff einen Feuerbrand und forderte mich auf, ihm zu folgen.
»Ich habe oft und viele Tage in diesem Hause verbracht und kenne alle seine Winkel. Ich sah die Schatten der Könige durch die Gänge der Zimmer schweben, die einst hier geherrscht haben, zu einer Zeit, als die Mayas groß und glücklich waren. Sie sind dir gewogen, die Geister der Herrscher, komm mit, vielleicht sieht auch dein Auge sie.«
Ich dachte meines so lebhaften Traumes und der Welt, welche er mir erstehen ließ, und war gern bereit, dem Alten zu folgen, auch ohne die Hoffnung, einen der Königsschatten zu erblicken.
Mit dem Feuerbrand leuchtend, führte er mich durch Zimmer und Korridore. Eidechsen huschten zu unseren Füßen, Fledermäuse und Nachtfalter umschwebten unsere Häupter. Oftmals fiel das Licht des Mondes durch die zerstörte Decke auf uns hernieder, des Erdtrabanten, der schon vor Jahrhunderten diese jetzt so einsamen Hallen erleuchtet hatte. So erreichten wir den Saal, der die Bildnisse der Könige barg.
Wunderbar war der Eindruck, als wir jetzt an den Wänden hingingen und die flackernde Flamme des Astes die seltsamen Gestalten beleuchtete, die, so still und tot im Tageslicht, jetzt Leben zu bekommen schienen.
Es war ein wild-phantastischer Anblick, der sich beim unsicheren Fackelschein dem Auge bot.
Wir traten in die Mitte des Saales, und Mixtli hob den Feuerbrand, um dessen Licht weiter zu verbreiten.
Ein leichtes Geräusch machte uns beide erbeben. Ein Schuß krachte, und eine Kugel zischte zwischen uns durch und schlug an der Mauer an.
Augenblicklich warf der Indianer den Feuerbrand zu Boden und riß mich fort. Gleich darauf standen wir an einem dunklen Korridor.
»Was war das?«
»Das sind die Männer, die du unter der Erde gesehen hast, sie wollen das Armband des Königs wieder haben. Hier bist du sicher; warte, ich bin gleich zurück.«
Er eilte hinweg, und ich stand im Dunkeln allein.
Ich war doch betroffen über diesen heimtückischen Angriff, der gewiß nur mir allein galt.
Mixtli kehrte zurück, er hatte seine Büchse geholt und meine mitgebracht. Glücklicherweise hatte ich noch Patronen bei mir und lud sofort.
»So, jetzt kannst du dich wehren, Senor. Bleibe nur hier, ich will nach den Feinden sehen.«
Wiederum ging er davon.
Der Feuerbrand war erloschen, ich stand, von Dunkel umgeben, und mein Auge gewahrte nun einen Streifen Mondlicht, der durch die zerstörte Decke in den Saal fiel.
Nichts regte sich.
Draußen hörte ich einen Schuß fallen; ich hatte Neigung, hinauszueilen, aber meine Unbekanntschaft mit dem Gebäude und seinen Ausgängen hielt mich davon ab.
Schon kam auch Mixtli zurück.
»Hast du geschossen?«
»Ja.«
»Sähest du die Burschen?«
»Nein, aber sie wissen nun, daß wir wachsam sind, sie kommen nicht zurück. Vamos. «
Er ergriff meine Hand und zog mich fort, mich mit unfehlbarer Sicherheit zu meiner derzeitigen Behausung führend.
Hier fand ich den sehr erregten Schmidt, der seinen Karabiner in der Hand hatte. Der erste Schuß hatte ihn munter gemacht.
»Um Jotteswillen, wat jibt et, Herr Dokter? Kleenes Vorpostengefecht?«
Ich teilte ihm das Vorgefallene mit.
Der aus dem Hinterhalte abgegebene Schuß stimmte mich doch bedenklich, denn er deutete auf die Absicht, uns in mörderischer Weise zu überfallen, eine Absicht, die in dem umfangreichen, zerstörten Gebäude, dessen Höfe mit Bäumen und Büschen bedeckt waren, unschwer auszuführen war.
Ich deutete dies auch dem Maya an.
Gelassen erwiderte dieser: »Es ist nichts zu fürchten, sie kehren nicht wieder. Senor mag ruhig schlafen, ich werde wachen.«
Auch der Arriero und sein Peon, die abseits schliefen, waren wach geworden und kamen herbei.
Mixtli wußte auch sie zu beruhigen und ging mit der Büchse fort.
»Und nun legen Sie sich mal hin, Herr Dokter, morjen is ooch noch een Tag; ick kann jetzt, wo et jeknallt hat, doch nich mehr schlafen, ick bleibe munter, schlafen Sie man unbesorjt.«
Ich folgte ihm, suchte meine Hängematte auf und schlief auch bald ein; der Tag hatte mich doch erschöpft.
Schon stand die Sonne am Himmel, als ich erwachte. Die Vorgänge der Nacht dämmerten mir auf, die Mitteilungen des Maya, der heimtückische Schuß auf mich.
Die Erinnerung hieran war doch geeignet, mir die Freude an meiner Forscherarbeit zu verleiden.
Ich stand auf und fand draußen Schmidt mit der Bereitung des Frühstücks beschäftigt.
Kaum sah mich dieser, als er in militärischer Haltung auf mich zukam.
»Gehorsamst zu melden: nichts Verdächtiges in der Nacht vorjefallen. Ooch schonst Morjenpatrouille jemacht, nichts von Feind zu sehen.«
War ich gleich ernst gestimmt, machte mich sein militärisches Gebaren doch lächeln.
»Wo ist der Maya?«
»Der braune Mann is uff Lauerposten draußen. Belieben der Herr Dokter zu frühstücken?«
»Gleich, Heinrich, ich will nur einmal nach außen blicken.«
Ich nahm für alle Fälle meinen Karabiner und ging auf die Terrasse hinaus.
In stillem Frieden lag alles ringsum da im hellen Sonnenscheine. Ich benutzte mein Glas, doch auch dies führte mir nichts Verdächtiges vor.
Galt der mörderische Angriff wirklich, wie Mixtli angedeutet, dem seltenen Kleinod, das mir ein so glücklicher Zufall in die Hand gespielt? Oder war es nur ein gemeiner Raubanfall?
Ich ging zurück und frühstückte.
Der Arriero kam.
Der Mann schien mir trotz der Unbeweglichkeit der indianischen Gesichtszüge in bedenklicher Stimmung zu sein.
»Ich habe die Mulos versteckt, Senor,« sagte er. »Fürchtest du für sie?«
»Wenn die Ladrones (Spitzbuben, Räuber), die gestern auf dich schossen, die Tiere töten, sind wir hier gefangen, oder werden in den Wäldern erschlagen.«
»Wie? Hältst du unsere Lage für so gefährdet?«
» Quien sabe? Antonio Mahos ist ein ebenso feiger als rachsüchtiger und tückischer Bursche.«
»Also du meinst, daß der Streich von diesem Burschen ausgeht?«
»Ich glaube es, er ist ein mezquino (Schurke), zu allem fähig, und wird auch wohl Gefährten haben; denn allein würde er sich nicht an uns trauen.«
Das wurde ja immer bedenklicher.
Hier, inmitten dichter Urwälder, fern von jedem bewohnten Orte, der Rachsucht eines solchen Subjektes preisgegeben zu sein, war ein recht unangenehmes Gefühl.
Wie gefährlich er war, hatte ja der aus der Nähe abgegebene Schuß gezeigt, der wohl nur durch das flackernde Licht des Astes, den Mixtli hielt, indem es das Auge des Schützen beirrte, fehl gegangen war.
Während ich des Maya dachte, kam er angeschritten.
»Nun, mein Freund, was bringst du für Nachrichten?«
»Antonio Mahos ist, wie ich befürchtete, in den Wäldern, er hat 20 Mann bei sich, Zapoteken, die am Usumacinto wohnen.«
»Aber was wollen die Leute von uns?«
»Ich habe sie beschlichen –«
»Oh, ist dir das gelungen?«
»Ich bin seit meiner Jugend Tigrero (Jäger einer großen Hacienda, angestellt, um das Raubtier abzuschießen), bin in den Wäldern aufgewachsen, treffe den flüchtigen Hirsch wie den springenden Jaguar und bin gewöhnt, mich geräuschlos dem Wilde zu nahen.«
»Weiter.«
»Antonio Mahos hat den Leuten gesagt, daß wir hier nach Gold graben, und sie wollen sich dessen bemächtigen und weitere Nachforschungen verhindern.«
»Aber den Verdacht können wir ihnen ja leicht nehmen.«
Mit einem feinen Lächeln erwiderte der Alte: »Hast du nicht das Armband des Königs?«
»Wissen sie, daß ich es habe?« fragte ich hastig.
»Ich glaube nicht, obgleich ich nicht zweifle, daß Mahos die unterirdischen Gänge kennt und als Schlupfwinkel benutzt, und daß du ihm dort begegnet bist.«
»Aber was beginnen wir bei so drohender Gefahr? Haben die Leute Waffen?«
»Sie haben nur drei Gewehre, aber Mahos möchte gerne die unsrigen dazu haben.«
»Aber sage, Amigo, was beginnen wir?«
»Wir müssen fort von hier gehen; es sind böse Menschen, die dort im Walde lauern.«
»Werden sie uns angreifen?«
»Das wagen sie nicht, am Tage nicht – aber in der Nacht werden sie kommen.«
Das war recht wenig tröstlich.
Bei dem Chaos von verkohlten Baumstämmen und aufschießenden Nachwuchs konnten sich Schützen mit ganz sicherer Deckung dem weitläufigen Gebäude nahen, auch am Tage einen Schuß abgeben, wie es bereits in der Nacht geschehen war.

So wertvoll mir die Forschungen hier waren, mein Leben wollte ich doch nicht dafür in die Schanze schlagen.
Ich setzte Schmidt von der Gefahr, in der wir uns befanden, in Kenntnis.
»Det is ne scheene Schofe,« brummte der, »denn wird wohl nischt übrig bleiben, als een strategischer Rückzug, Herr Dokter, aus diese jefährliche Jegend.«
»Das ist mindestens ebenso gefährlich, wenn uns der alte Mixtli nicht hinweg helfen kann.«
»Hm,« meinte der furchtlose Bursche, »wenn wir die Schwefelbande, die uns an't Leben will, nur vor uns hätten, so een kleenes Schnellfeuerchen würde uns bald Luft machen.«
»Du vergissest, daß wir von undurchdringlichen Wäldern umgeben sind.«
»Ick will mir die Situation doch eenmal ansehen,« sagte er, nahm seinen Karabiner, lud ihn und ging nach der Terrasse zu.
»Sei vorsichtig.«
»Allemal. Deckung wird jenommen.«
Ich wollte eben mit Mixtli und dem Arriero eine Beratung eröffnen, was in dieser Lage zu tun sei, als mich ein Ruf von Schmidt aufschreckte.
Ich nahm eilig meinen Karabiner und lief nach der Terrasse zu, Mixtli und Teobaldo folgten mir.
Schmidt stand in einem der Eingänge.
»Sehn Sie mal dorthin, Herr Dokter, was jeht denn dort vor?« und er deutete nach Süden.
Ich sah einen Reiter, der augenscheinlich vor zwei anderen auf der Flucht war und sich mühsam auf dem rauhen Wege fortbewegte.
Ich richtete mein Glas dorthin und erkannte in dem verfolgten Reiter nicht ohne Schrecken den jüngsten Sohn unseres Landsmannes Wieland alias Vilando. Zwei Indianer setzten ihm nach, die freilich mit den gleichen Schwierigkeiten des Weges zu kämpfen hatten, wie der, den sie verfolgten.
Das scharfe Auge des Maya mußte den Jüngling auch erkannt haben, denn er sagte: » Por el nombre de Dios, Don Enrique.«
Daß der Jüngling ernstlich verfolgt wurde und sich in Gefahr befand, war augenscheinlich genug.
Jetzt erkannte ihn auch Schmidt.
»Herr Dokter, um Jotteswillen, det is der Jüngste von unsern Landsmann.«
Flucht und Verfolgung hielten an.
»Nee, an den Jungen sollen sie doch nicht ran.«
»Willst du schießen?«
»Wollen wir zusehen, wie det Jesindel den Jungen abmurkst?«
»Gut – sie sind in Schußnähe, die Entfernung beträgt nicht mehr als 700 Meter. Wir wollen kein Blut vergießen, schießen wir auf die Maultiere.«
Wir richteten die Visiere, legten die Gewehre an, zielten, während die beiden Indianer mit stummem Erstaunen unseren Vorbereitungen, um auf solche für ihre Waffen unerreichbare Entfernung schießen zu wollen, zuschauten.
Krach! Krach! Die Karabiner entluden sich, und beide hatten wir getroffen. Das eine Maultier, auf das Schmidt gezielt hatte, stürzte, während das andere in wilden Sprüngen sich umherwarf, also jedenfalls verwundet war.
Eilig luden wir wieder.
Da blitzte es dort hinter den Büschen auf, Rauch erhob sich, der Knall eines Schusses drang zu uns, augenscheinlich hatte man nun auch auf den jungen Mann geschossen, aber ebenso unverkennbar auch nicht getroffen.
Wie auf Kommando rissen Schmidt und ich die Gewehre an die Wange und schossen nach der Stelle, an der Pulverrauch aufstieg.
Ob wir mehr als Baumstämme getroffen hatten war zweifelhaft, ein weiterer Schuß auf Enrique erfolgte aber nicht.
Wir riefen ihm zu, sein jubelnder Schrei antwortete uns, und gleich darauf sprang der Jüngling vor uns von seinem Maultiere.
Ich lief ihm entgegen und umarmte ihn, tief bewegt von der Gefahr, der wir ihn so nahe ausgesetzt gesehen hatten, auf das herzlichste.
Enrique war ein auffallend schöner Jüngling, der mit dem blonden Haar und der kräftigen Körperbildung des Germanen die dunklen Augen des Spaniers und die Anmut seiner Haltung vereinte.
»Das hieß entkommen, die Allerheiligste war mit mir,« sagte er in fröhlicher Stimmung, »schießen können die Ladrones nicht, und ich konnte leider von meinem unruhigen Tiere nicht feuern.« Er trug eine Büchse auf dem Rücken.
»Um Gotteswillen, Don Enrique, wie kommen Sie hierher?«
»Gleich, Senor – ah, alter Jagdgefährte, da bist du ja!« Er reichte Mixtli die Hand und richtete an ihn, der augenscheinlich erfreut war, Enrique zu sehen, einige Worte in der Mayasprache. »Ich grüße Sie, Senor Smito,« wandte er sich dann zu Schmidt und reichte auch ihm die Hand.
Da ich fürchtete, daß einige des uns gegenüber so feindlich auftretenden Gesindels sich in gefährliche Nähe schleichen könnten, forderte ich alle auf, in das Innere des Schlosses zu treten, um vor Kugeln geschützt zu sein. Mein Arriero, der sich als besonnener, mutiger Mann zeigte, führte das Tier des jungen Wieland in das Innere und gesellte es zu den anderen.
»Mein Vater schickt mich Ihnen nach, Senor,« sagte der Jüngling, als wir sicher waren, »Don Luis,« das war Mixtlis Herr, »hat die Nachricht empfangen, daß General Flores ein Pronunciamento erlassen und den ganzen Norden in Aufruhr versetzt hat, um Krieg gegen den Präsidenten zu führen. Ich soll Sie veranlassen, schleunigst zurückzukehren.«
Ich war auf das tiefste gerührt, daß der brave Landsmann das Leben eines seiner Lieblinge gewagt hatte, um uns vor Gefahr zu bewahren.
»Und Ihr Vater sandte Sie, Don Enrique?«
»Ich allein bin mit den Wäldern vertraut, Senor, durch den alten Mixtli da, ich allein kannte den Weg zu diesem Mayaschlosse, und ich ging gern.«
»Wo trat man Ihnen feindlich entgegen?«
»Kaum als ich den Wald verlassen hatte, sah ich einige von den Schuften vor mir. Man rief mir zu, zu halten und abzusteigen – diese Estupidos – ich gab meinem Mulo die Spuren, und das Übrige haben Sie ja gesehen.«
»Ja, gesehen, wie sehr Sie in Lebensgefahr waren, in Lebensgefahr um unsertwegen.«
»Ah, bah, man muß auch einmal eine feindliche Kugel pfeifen hören. Hätte ich nur die Büchse zur Hand nehmen können, ich würde ihnen schon geantwortet haben. Aber was wollen diese Ladrones? Sie schimpften mir nach: Verruchter Gambusino! (Goldgräber), verdammter Blanco! (Weißer).«
Ich sagte ihm, was geschehen sei, und daß man uns wahrscheinlich für Leute halte, die hier nach verborgenen Schätzen graben wollten.
»Hier?« Enrique lachte. »Sie würden wenig finden. Aber das verändert die ganze Situation. Wie kommen wir hier heraus, Mixtli?«
» Quien sabe!«
»Nun, ich verlasse mich auf dich!« erwiderte der Jüngling, »du bist ein alter Jägersmann und mein Freund.«
»Wie viel von den Leuten sahest du, Don Enrique?«
»Ich denke, wohl ein Dutzend verlumpte Burschen lagen da versteckt. Aber wo kommen die Kerle hier her? Zu den Aufständischen können sie doch nicht gehören?«
» Quien sabe! Mahos ist bei ihnen, der Zapoteke. Er wird die Leute vom Usumacinto sammeln für die Motineros (Aufständische).«
»Da säßen wir also zwischen zwei Feuern, na, das hat mir den Appetit nicht verdorben. Mein Proviantbeutel ist mir bei dem tollen Ritt zwischen den Baumstümpfen entfallen, Mixtli, wie steht es mit dem Almuerzo?« (Frühstück.)
Der Indianer lächelte und erwiderte: »Don Enrique wird genug finden, um seinen Hunger zu stillen.«
Wir gingen zu unserem Speisezimmer.
Unterwegs sagte Schmidt, dem die frische, sorglose Weise des jungen Mannes ungemein gefiel: »Der Junge is jut, Herr Dokter, der hat deutsches Blut in den Adern.«
Die eben überstandene Gefahr, die sorgenvolle Lage, in der wir uns befanden, hatten auf den Appetit des jungen Wieland durchaus keinen Einfluß geübt, wie ich mit Vergnügen bemerkte.
Desto sorgenvoller war ich. Nicht, daß ich gerade Furcht gehabt hätte. Ich sowohl wie Schmidt würden uns kräftig gewehrt haben, wenn es das Leben galt, aber die Gefahr hier, der sich nun noch ein Aufstand im Lande zugesellte, war beängstigend genug.
Mixtli war auf einer Treppe im Innern zum Dach hinaufgestiegen, um von oben Ausschau zu halten.
Ich sah dann nach den Maultieren, die ich soweit gesichert fand, als unter diesen Umständen möglich war. Der Arriero hatte sie in einen Raum im Untergeschoß geführt, das wohl früher als Keller gedient haben mochte.
Dann suchte ich Mixtli auf der Zinne des Gebäudes auf.
Ich fand ihn hinter einem der dort emporschießenden Büsche versteckt vor, wo er das Terrain vor dem Schloß sorgfältig im Auge behielt.
»Fürchtest du, daß uns die Burschen angreifen werden?«
»Nein, angesichts von vier Büchsen werden sie es nicht wagen, offen anzugreifen; aber sie können sich leicht heranschleichen und vielleicht versuchen, einen Schuß abzugeben, wir müssen uns gedeckt halten.«
»Aber sage mir, wie sollen wir uns der Gefahr entziehen? Wenn wir auch dieses ausgedehnte Gebäude verteidigen könnten, was ja nicht möglich ist, so würden uns die Lebensmittel mangeln. Was denkst du, amigo mio?«
Nach einiger Zeit erwiderte er: »Wir müssen das Haus der Könige verlassen.«
»Gut, ich sehe ein, daß dieser Räuberbande gegenüber unseres Bleibens hier nicht ist. Es tut mir leid; aber wie verlassen wir das Haus ungefährdet? Die Ladrones haben auf Don Enrique geschossen wie auf mich, sollen wir uns wehrlos ihren aus dem Hinterhalte abgefeuerten Kugeln aussetzen?«
»Die Unsichtbaren sind dir hold, Senor, sie werden uns beistehen.«
»Alle Achtung vor ihnen, lieber Freund, aber ob sie imstande sind, uns vor den Kugeln zu schützen, scheint mir doch zweifelhaft.«
»Sei unbesorgt, sie werden helfen, du trägst das Bildnis des Königs bei dir.«
Er meinte den geschnittenen Jadeitstein, den ich in der Tat, wie auch das unschätzbare Armband und den Lederstreifen mit den Mayazeichnungen bei mir trug.
Das Wohlwollen der alten Mayagottheiten war mir aber doch von recht zweifelhaftem Werte.
»Glaubst du uns sicher an die mexikanische Grenze führen zu können, damit ich von da meine Reise nach Palenque fortsetzen kann?«
» Quien sabe? Weißt du, wo die Motineros stehen? Alle Zapoteken werden auf ihrer Seite sein, und in Chiapa und auf dem Wege dorthin wohnen viel Zapoteken. Wir werden sehen! Don Luis hat mir durch Sennorito sagen lassen, ich soll dich nicht verlassen; ich werde es nicht tun. Wir werden sehen!«
Damit mußte ich zufrieden sein, denn er wandte sich ab und schaute wieder aufmerksam nach dem Walde hin.
»Nimm dein Glas und blicke dort zwischen die verbrannten Ceibabäume!« – er deutete darauf hin – es war ein wirrer Haufen übereinandergestürzter mächtiger Stämme, der in ziemlich weiter Entfernung lag, ich schätzte sie auf 1000 Meter.
Ich richtete mein Glas dorthin und erkannte jetzt, daß dort 8 bis 10 Eingeborene ganz behaglich lagerten.
»Trägt dein seltsames Gewehr die Kugel so weit?«
»Ja, viel weiter noch!«
Mein weittragender Hinterlader schien ihm gewaltig imponiert zu haben.
»Die wollen wir dort aufscheuchen.«
Ich ging an den inneren Rand des Hauptflügels und rief von dort Schmidt zu, mit seinem Karabiner heraufzukommen.
Gleich darauf war er da, und ihm folgte eifrig Enrique. »Was ist im Winde, Senor?«
Ich teilte beiden mit, daß wir, Schmidt und ich, auf die lagernden Indios feuern wollten, um sie von unserer Wachsamkeit, der Fernwirkung unserer Gewehre zu überzeugen und so zu erschrecken und einzuschüchtern.
»Vergieße kein Blut, Senor,« äußerte Mixtli ernst, »es ist nicht gut.«
»Nein, gewiß nicht, nicht ohne die größte Not, wir sind nicht blutdürstig.«
»Auf diese Entfernung wollen Sie schießen, Senor?« fragte erstaunt der junge Wieland, als er das Zielobjekt erkannt hatte.
»Unsere Gewehre tragen noch einmal so weit.«
» Oh miraculoso!" rief er verblüfft aus.
»Nun komm, Heinrich, wir wollen die Burschen begrüßen, wollen aber kein Blut vergießen!«
»Verstehe, Schreckschuß, jut.«
Wir stellten die Visiere, legten die Gewehre auf, zielten und ließen knallen.
Rasch hob ich mein Glas und schaute hinunter.
Unter den Lagernden, die Kugeln mußten bei ihnen nahe eingeschlagen haben, herrschte wilde Verwirrung, und mit großer Schnelligkeit verkrochen sie sich.
Ein Kugelgruß auf solche Entfernung mußte ihnen doch recht unheimlich vorkommen.
Kaum waren unsere Schüsse verhallt, als sich dem scharfen Jägerauge bemerkbar eine Bewegung in den Büschen an der Terrasse zeigte.
Blitzschnell riß Enrique seine Büchse an die Wange und schoß.
Er mußte getroffen haben, denn ein Schrei antwortete, und einen Augenblick sah man schattenhaft die Gestalt eines Indianers auftauchen und verschwinden.
Mixtli sah ihn wohl, feuerte aber nicht.
»Es war Mahos,« sagte er ruhig, »er ist verwundet, es ist gut. Er sann uns Böses und hat nun seinen Lohn.«
Es war wirklich gut, denn der Kerl hatte doch in gefährlicher Nähe im Hinterhalte gelegen.
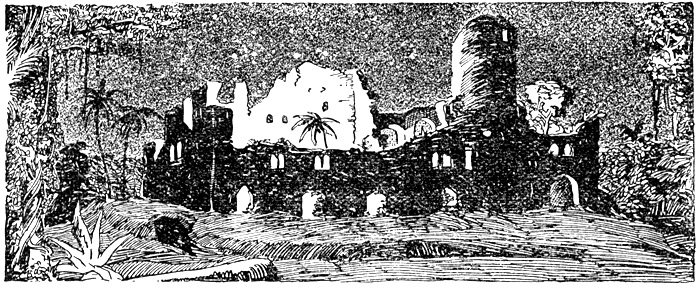
Die rasche Tat Don Enriques war also nicht zu unserm Nachteil.
Ein Geschrei vom Walde her machte uns aufmerksam; durch das Glas erkannte ich, daß dort ein ziemlich großer Haufen Indianer stand, es mußte Zuzug angekommen sein. Auch im Süden, woher wir gekommen waren, standen Männer; der Rückweg war uns also verlegt.
Auch Mixtli schaute durch mein Glas.
»Ja, sie sind stärker als vorher, aber sie haben keine Flinten. Mahos ist bei ihnen, er ist in der Tat verwundet.«
Dann verschwanden die Angreifer im Walde, auch die im Süden.
Mixtli fürchtete keinen Angriff am Tage, dennoch waren wir sehr aufmerksam, gewahrten aber von dem Feinde nichts, obgleich zu erkennen war, daß er sich auf verschiedene Seiten verteilt haben mußte.
Wir sahen in allen Himmelsgegenden Rauch aufsteigen, wie ihn Lagerfeuer erzeugen.
Am unheimlichsten war mir die Schweigsamkeit Mixtlis, der, so gut wie ich, erkannt hatte, daß wir umringt waren.
Es verging ein sehr unruhvoller Tag, auch der Arriero und sein Knecht waren sehr ernst, und mehrmals sprach Teobaldo mit Mixtli. Enrique Vilando war indessen in bester Laune, er ließ sich die Konstruktion unserer Gewehre zeigen und bewunderte sie höchlichst. Auch vom deutschen Kriege sollte ich erzählen.
Als ihm meine sorgenvolle Stimmung klar wurde, sagte er: »Oh, ganz unbesorgt, Senor, ganz unbesorgt, Mixtli ist bei uns, er bringt uns alle in Sicherheit, nur ganz unbesorgt.«
Seine Zuversicht beruhigte mich einigermaßen.
Wir hatten zu Mittag gegessen, denn Schmidt meinte: »Een juter Happen vor's Jefecht is janz jut.«
Gegen drei Uhr befahl Mixtli, der so ruhig schien wie immer, daß vor den Eingängen auf der Terrasse und vor verschiedenen, die zu anderen Teilen des Gebäudes Zutritt gewährten, Haufen von trockenem Gras und Holz aufgespeichert werden sollten.
Wir beteiligten uns alle an der Ausführung dieser Anordnung und brachten stattliches Feuermaterial zusammen. Es war klar, der wahrscheinlich in den Bürgerkriegen des Landes ausgebildete Soldat wollte das Schußfeld beleuchten.
Gegen fünf Uhr ersuchte er Schmidt und mich, unsere wenigen Habseligkeiten zu packen, was bald geschehen war, und ließ die Mulos satteln und beladen.
»Willst du uns in die Wälder führen?«
»Ja,« sagte er.
»Wir würden niedergeknallt.«
»Nein.«
»Gehen wir des Weges, den wir kamen, zurück?«
»Nein, dort sind die Zapoteken.«
»Also willst du mich nach Norden weiter führen?«
»Quien sabe?«
Weiter war nichts aus ihm herauszubekommen.
Wir waren zur Reise fertig.
Ich wanderte trotz aller Gefährlichkeit unserer Lage noch einmal durch die mit so viel interessantem Bildwerk und Inschriften bedeckten Räume mit einem Gefühl von Trauer, daß ich meine Untersuchungen so bald, ehe ich sie eigentlich begonnen, wieder einstellen mußte.
Die Nacht, die dunkle Nacht sank herab, Wolken umhüllten die Sterne, nur die Leuchtkäfer spendeten umherschwirrend ihr zauberhaftes Licht.
Jetzt befahl Mixtli die aufgestapelten Gras- und Holzhaufen anzuzünden.
Bald leuchteten die Feuer in das Dunkel hinein; ihr Licht strahlte nach außen und erhellte zugleich phantastisch die inneren Räume des Palastes.
Mixtli winkte uns, mit ihm in den zweiten Hof zu gehen, dort fanden wir die beladenen und gesattelten Mulos und ihre Treiber. Die Füße der Tiere waren mit Gras umwickelt.
»Fasse jeder sein Tier am Zügel! – Du, Teobaldo, nimmst das meinige, ich führe die Capitana. Totenstille muß herrschen, jeder Laut kann uns den Tod bringen. Folgt mir dicht auf der Ferse und beruhigt die Mulos.«
Wir standen stumm wie das Grab in der Dunkelheit da.
»Vamos!« flüsterte Mixtli und ging mit der Capitana voran.
Der Mann mußte im Dunkeln sehen können; ich, der der zweite in der Reihe war, konnte kaum die vor mir herschreitende Mula erkennen, deren Glöckchen umwickelt war.
Schritten wir zum Palaste hinaus?
Der Boden unter mir wurde abschüssig, war aber fest.
Die Hufe der Mulos machten kein Geräusch.
Einmal überschritten wir einen wirren Steinhaufen, der aber mein Maultier nicht unruhig machen konnte.
Es war absolut dunkel um uns, und nur das leichte Schnauben der Mulos ließ sich vernehmen.
Dennoch kam es mir vor, als ob wir einen Gang durchschritten.
Kommen wir nicht bald ins Freie?
Nein, nicht kühle Nachtluft umgibt uns, nicht die Sechsuhrbrise, die man auch hier im Lande verspürt, wenn die Sonne untergeht.
Totenstille, nur das leichte Geräusch der umwickelten Füße und das Atmen der Tiere, die gehorsam mit ihren Führern gehen.
Der Weg macht eine Biegung.
Wir sind nicht lange in der neuen Richtung vorgeschritten, als das silberne Glöckchen der Capitana zu läuten beginnt.
Die Tiere schnauben freudig bei den bekannten Lauten auf, die auch mir herzerfreuend dünkten.
Jetzt zündete Mixtli eine Wachskerze an, und meine Vermutung bestätigte sich, daß wir in einem unterirdischen, ummauerten Gang, mit der eigenartigen Überwölbung, die die Mayas anwandten – das eigentliche Gewölbe hatten ihre Baukünstler noch nicht entdeckt, – einherzogen.
Der Boden war fest wie die Mauern, die uns umgaben.
Alle atmeten wir freudig auf bei dem Lichtschein, mit dem uns das Bewußtsein kam, daß wir dem Feindeskreis entrinnen würden.
Eine lange Strecke schritten wir jetzt bei dem schwachen Lichtschein vorwärts, der von der Capitana herkam und wunderliche Schattengestalten an die Decke über uns warf.
Jetzt begann der Weg anzusteigen, und Mixtli löschte seine Kerze und ließ das Glöckchen der Capitana verstummen.
Aber erkennbar war, daß wir fortwährend uns auf einer ansteigenden Ebene bewegten.
Endlich gab Mixtli das Zeichen zum Halten.
Alles stand.
Ein frischer Luftzug machte sich bemerklich.
Er gab mir die Capitana zu halten und entfernte sich, wie es schien.
Erst nach einiger Zeit hörte ich seine Stimme wieder; er rief Teobaldo und dessen Peon zu sich, die ihre Tiere Enrique und Schmidt gaben, und bald danach hörten wir das Geräusch im Gesträuch arbeitender Machetas.
Die Indianer kamen dann zurück, nahmen ihre Tiere wieder am Zügel, und auf Mixtlis »Adelante!« setzten wir uns in Bewegung.

Über Schutt und Steine hinweg traten wir unter den Sternenhimmel, dessen Lichter jetzt wolkenlos zu uns niederstrahlten.
Es schien, wir standen in einem dichten Gebüsch, durch das die Machete der Indios notdürftig Bahn gehauen hatte.
Nicht ohne einige Schwierigkeiten bewegten wir uns vor, um gleich darauf, soweit bei dem Sternenlicht erkennbar war, auf einer Waldwiese zu halten, die hochstämmige Bäume umgaben.
»Wir sind den Ladrones entronnen, Senor, dank dem geheimen Gange, den einst die Könige anlegen ließen, um sich selbst vor Feinden retten zu können. Ich glaube nicht, daß ihn außer mir jemand kennt.«
»Gott sei Dank, mein Freund, doch wohin setzen wir den Fuß jetzt.«
»Du wirst es sehen, die Nachkommen Nima Quichés haben überall vorgesorgt.«
»In den Sattel.«
Wir bestiegen die Tiere, die sichtlich erfreut waren, der Dunkelheit und dem Marsche unter der Erde entronnen zu sein. Mixtli nahm die Capitana und ließ jetzt ihr Glöckchen wieder klingen.
»Adelante!«
Durch dichten Wald, aber aus einem betretenen Pfad ritten wir vorwärts, uns der Führung des alten Indianers und der Sicherheit der Mulos überlassend.
Der Ritt war rauh und setzte unseren Kleidern wie unserer Haut nicht unbedenklich zu.
Bald stieg der Weg an, und wir ritten eine Zeitlang durch eine Savanne. Vor einem Hügel, der frei lag, hielten wir, und ich erkannte im Sternenlicht auf dessen Spitze eine Behausung.
Auf Mixtlis Aufforderung stiegen wir ab und leiteten die Tiere den mit Steinbrocken bedeckten Hügel hinan.
»Dieses Haus gehörte auch einst den Königen, Senor; wir wollen hier bis zum Tage bleiben.«
Es wurden rasch in verfallenen Räumlichkeiten für die Tiere und für uns Lagerstätten gefunden.
Den Sattel unter dem Kopf, in die wollene Decke eingehüllt, schliefen wir bald ein.
Der frühe Morgenstrahl weckte uns.
Am Fuße des Hügels trat ein Quell hervor, und Schmidt mußte uns rasch Kaffee zubereiten, während der Arriero aus dem mitgeführten Mehl Tortillas herstellte.
Da Mixtli uns sagte, daß wir in vollkommener Sicherheit seien, überließen wir uns mit Behagen der köstlichen Morgenluft und widmeten uns eifrig dem Frühstück. Dennoch empfand ich ein tiefes Bedauern, auf solche Weise gezwungen zu sein, von einem Orte zu scheiden, der mir als historisches Überbleibsel aus dunkler Vorzeit so wertvoll war.
Während die Tiere getränkt und mit Gras gefüttert wurden, betrachtete ich das Bauwerk, das uns Obdach gegeben hatte. Es war wenig umfangreich und hatte trotz seiner hohen Lage den Stürmen getrotzt. An einer Ecke befand sich erhaben gearbeitet ein Riesenkopf, der über das Land hinzusehen schien. Wahrscheinlich hatte dieses Haus einst als Unterkommen für Wächter gedient.
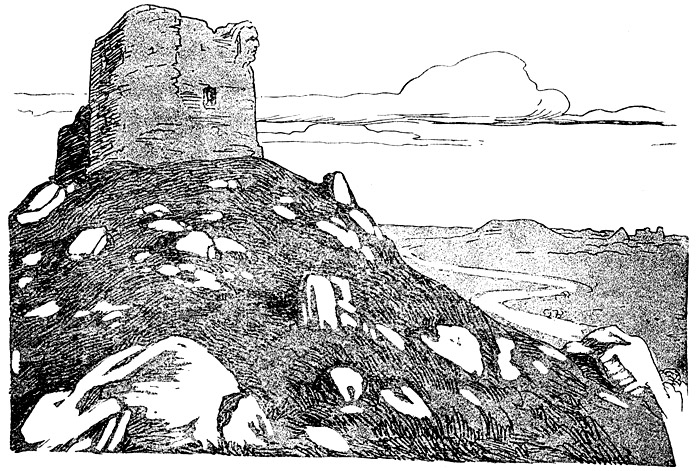
Durch mein Glas erkannte ich in weiter Entfernung die Ruine von Tzutuhil und den sie überragenden Tempelhügel.
Der junge Enrique erkundigte sich eifrig nach den Resultaten meiner Forschungen, die leider so gering waren.
»Don Luis und Mixtli kennen alle diese Bauten, Senor, sie sagen, daß auch hier große Städte gelegen hätten, die die Indios gebaut haben. Ist dem so, Senor?«
»Ja, Don Enrique, dem ist so, diese Bauten sind die letzten Überreste einer untergegangenen Welt, einer bis auf sie spurlos verschwundenen Zivilisation, die noch schöne Blüten verhieß. Wir stehen hier an dem Grabe eines hochbegabten Volkes, das einst diese Lande in einen Garten verwandelt hatte.«
»Ja, Senor, so sagt auch Don Luis, der durch seine Mutter von den Mayakönigen abstammt. Es ist herrlich in der Vorzeit forschen, und wenn ihr wieder Eure Studien fortsetzt, laßt mich Euch beistehen.«
»Gerne, aber ich bin etwas rauh darin gestört worden.«
»Ah, das nächste Mal nehmt Euch Soldados mit, da sollen die Ladrones wohl fortbleiben.«
»Wir wollen sehen.«
Nach einer ernsten Beratung mit Mixtli und meinem Arriero beschlossen wir, den Weg nach Chiapa zu wählen, wohin ich ja auch wollte, um Palenque zu sehen, obgleich Mixtli die Befürchtung aussprach, daß die dort wohnenden Zapoteken ihre Stammesverwandten in Guatemala in dem Aufstand gegen die Regierung unterstützen könnten.
Teobaldo glaubte nicht, daß wir, erst auf mexikanischem Gebiet angelangt, noch etwas zu befürchten haben würden.
Mixtli und Enrique wollten uns bis zur Grenze begleiten und dann zurückkehren.
Bald brachen wir auf und nahten uns auf dem Marsche den Bergen, die hier zu gewaltiger Höhe aufsteigen. Einmal waren wir auf ein von Indianern bewohntes Pueblo gestoßen und hatten dort Mehl und Hühner eingekauft. Von Unruhen im Lande wußte man dort nichts. Nachdem wir dort die Nacht zugebracht, setzten wir unsern Weg längs der Berge fort.
Nach kurzer Zeit begegneten uns einige mit Lanzen bewaffnete Indianer, wild aussehende Kerle, die Miene machten, uns anzuhalten, aber sehr bescheiden wurden, als wir zu unseren Gewehren griffen.
Teobaldo, der auch der Nahuadialekte mächtig war, erfuhr von den Kerlen, nachdem er ihnen etwas Tabak gegeben hatte, daß die ganze Grenze in Aufruhr sei, und uns bald größere Scharen von Bewaffneten, die zu General Flores zögen, begegnen würden.
Die Fortsetzung unserer Reise unter diesen Umständen war doch sehr bedenklich; denn ich hatte nicht die geringste Lust, unter dieses Mordgesindel zu geraten.
Der Aufstand, von dem uns Enrique Kunde gegeben hatte, mußte also doch bereits große Ausdehnung erlangt haben.
Wir beschlossen, den Weg ins Gebirge zu nehmen, um allen unangenehmen Begegnungen mit Aufständischen auszuweichen, schwenkten links ab und befanden uns bald am Fuße der Sierra Madre, deren Höhen sich im Himmelsblau verloren.
Bald gelangten wir auf schroffen Wegen, oft unter gefahrdrohenden, riesenhaften Kandelaberkakteen, deren Blätter sechs Fuß lang und einen Fuß dick, im Herabstürzen Mann und Roß zerschmettern konnten, einherreitend, ziemlich hoch in das Gebirge. Die Tierra caliente hatten wir bereits hinter uns und mit ihr die gefährlichen Riesenbildungen der Kakteen.
Als wir nach kurzer Rast unseren Weg weiter fortsetzen wollten, gewahrten wir eine Reiterschar, die von Süden kam.
Auch wir wurden natürlich erblickt.
Der Arriero erbat sich mein Glas und schaute zu der haltenden Reitergruppe hin.
»Es sind Motineros,« sagte er dann, »aber sie haben nicht viel Flinten. Es sind Weiße dabei.«
Ich sah jetzt nach den Reitern. Es waren wild aussehende Gestalten, Indianer, Zambos, Mestizen und, der Arriero hatte recht, einige Weiße. Sie ritten auf Maultieren, einige auf Pferden.
»Woran erkennst du, daß es Aufständische sind?«
»Siehst du nicht, daß sie Waffen tragen?«
Es waren in der Tat viel Lanzen dort zu erkennen.
»Was meinst du, Mixtli?« Ich reichte ihm den Krimstecher.
Aufmerksam blickte er hindurch, gab mir das Glas zurück und sagte: »Es sind sicher Ladrones und gewiß auch Motineros. Antonio Mahos ist bei ihnen und hat uns erkannt.«
Das war schlimme Kunde. War der Mensch von neuem hinter uns?
»Was beginnen wir?« fragte ich den Maya.
Dieser wechselte einige Worte mit dem Arriero, während Enrique und Schmidt nach den verdächtigen Reitern ausschauten.
Mixtli wandte sich dann zu mir: »Wir müssen ihnen zu entgehen suchen oder fechten.«
»Fechten?«
»Sonst werden sie uns töten. Sie wollen unsere Flinten haben, es fehlt ihnen ja an Feuerwaffen.«
Ich hatte durchaus keine Neigung zu fechten, obgleich in diesem zerklüfteten Terrain vier Büchsen eine nachdrückliche Verteidigung erlaubten.
»Und wie sollten wir ihnen entgehen? Sie werden bald an unsern Fersen sein.«
»Nein, es ist eine Schlucht zwischen ihnen und uns, die sie umreiten müssen. Don Teobaldo und ich, wir kennen die Sierra; wir sind weit, ehe sie hier sein können.«
»Gut, so laßt uns reiten! Ich möchte nicht fechten, wenn es nicht das Leben gilt; ich habe bei Wörth und Sedan genug gefochten. Vor allem aber will ich Don Enrique keiner Gefahr aussetzen.«
Ich blickte noch einmal zu den Reitern hinüber und sah, daß sie sich anschickten, abzureiten. Dann folgte ich den anderen, und gleich darauf ritten wir eine Schlucht hinauf, die von der Richtung, die wir bisher eingehalten hatten, in einem Winkel abbog.
»Wird et mit die Leute wat jeben, Herr Dokter?« fragte Schmidt.
»Ich hoffe nicht.«
»Denn sonst is et besser, wir fangen jleich uff 1200 Meter an.«
»Wenn es nötig werden sollte, müssen wir uns wehren, das ist alles.«
»Und det werden wir besorgen,« meinte er zuversichtlich.
Als wir in einem engen Tage Halt machten, um die Tiere zu tränken und ausruhen zu lassen, sagte Mixtli zu mir: »Senor, die Reise nach Chiapa fortzusetzen, würde jetzt, wo alle Räuber und Spitzbuben am Wege sind, gefährlich sein; Don Teobaldo ist der gleichen Meinung.«
Ich hatte den gleichen Gedanken auch schon gehabt.
»Gut, mein Freund, aber was tun wir dann?«
»Wir müssen suchen, auf die Höhe der Sierra zu gelangen und den Heimweg antreten. Ich selbst gehöre zu solcher Zeit zu Don Luis, und Don Enrique zu seinen Eltern.«
»Gut, Mixtli, ich sehe das ein; so laß uns umkehren, ich verlasse mich auf dich und Don Teobaldo.«
Es ward in gemeinsamer Beratung dann beschlossen, die Hochtäler der Sierra zu gewinnen, in südlicher Richtung weiter zu ziehen und absteigend den Weg nach Quezaltenango zu nehmen, von wo Mixtli und Enrique leicht nach Hause und ich nach der Hauptstadt gelangen konnte.
Der Aufstand kam sehr ungelegen.
Nachdem die Tiere ausgeruht, setzten wir den Weg fort.
Schon hatten wir eine andere Vegetation um uns, wir waren in der gemäßigten Zone.
Von der Bande, die uns begegnet war, fürchteten wir nichts mehr.
Während wir an einer felsigen Anhöhe, deren Gipfel mit hochstämmigem Wald bedeckt war, hinritten, stieg aus dem Tale plötzlich Nebel empor, der uns bald dicht einhüllte.
Das hemmte unser Vorschreiten, wir hielten an und verließen die Sättel, uns dichter in die Ponchos hüllend, um Rast am Wege zu halten.
Der junge Vilando, der, seitdem er erkannt hatte, welchen Umfang der Aufstand schon angenommen hatte, sich sehr nach Hause sehnte aus Besorgnis für die Seinen, nicht etwa aus Furcht vor einer kriegerischen Begegnung, und unruhig etwas auf dem Wege vor uns vorausgegangen war, tauchte plötzlich wieder aus dem Nebel auf und sagte erregt: »Sie sind unter uns, sie haben unsere Spur.«
Die Kunde wurde durch den dichten Nebel, der uns umgab, noch unheimlicher.
Schon hörten wir Hufschlag und Stimmen unter uns, auch dort mußte ein Weg an der Höhe entlang führen.
Teobaldo nahm rasch der Capitana das Glöckchen ab und zu den Waffen greifend warteten wir stumm und aufgeregt, was der nächste Augenblick bringen wird. Wir waren entschlossen, uns energisch zu wehren.
Deutlicher vernahmen wir die Stimmen.
»Sie haben Gold in dem Königsschlosse geraubt,« klang es in spanischer Sprache zu mir herauf, »viel Gold. Und dann haben die alemans wundervolle Büchsen, sie tragen eine Legua weit – die würden sehr nützlich sein.«
Die Verfolger waren uns nahe.
Ein Laut, das Schnauben eines Maultieres konnte uns verraten.
Schmidt und ich, wir standen nebeneinander, die Karabiner schußfertig in der Hand, ebenso Enrique und Mixtli.
Die Stimmen verklangen im Nebel, die Gefahr war vorüber.
Wir mußten geduldig harren; an eine Fortsetzung der Reise konnten wir nicht denken, so lange der Nebel andauerte, den Führern war der Weg unbekannt.
Aber rasch wie die Nebel in diesen hochliegenden Bergtälern aufsteigen, schwinden sie auch wieder.
Schon wurde es lichter um uns, und die Nebelwand, die uns umgab, löste sich in duftige Schleier auf, die anmutig emporschwebten.
Bald war die Aussicht freier.
Ich brauchte eifrig mein Glas, doch nichts war von den Reitern zu gewahren.
»Sie suchen uns auf dem Weg nach Norden; ich glaube, wir haben nichts mehr von ihnen zu befürchten.« sagte Mixtli.
Wir setzten den Weg fort, der nach unten führte.
Der Nebel war fort und der Himmel wieder sichtbar.
Aber welch seltsames Aussehen der Himmel hatte, statt des tiefen Blaus zog er sich in einer merkwürdig grauen Färbung über uns hin.
Schwüle Hitze herrschte in den Tälern, durch die wir zogen.
Felsen umgaben uns, die oft eng aneinander traten, und schon zeigte sich wieder tropischer Pflanzenwuchs.
Merkwürdig, wie unruhig die Vögel umherflatterten!
Die beiden älteren Indianer flüsterten miteinander und beschleunigten den Schritt der Tiere.
Wir erreichten einen Punkt, wo wir ein gewaltiges Felsenmassiv vor uns sahen, wild zerklüftet, mit Wald bedeckt. Kein Lüftchen regte sich, die Hitze wurde immer qualvoller, immer unruhiger schien die Tierwelt zu werden.
Mixtli sprang ab und riß von einem Baume einen Zweig ab, den er dem Arriero zeigte.
Dieser erschrak sichtlich.
»Was ist das? Was bedeutet das?« fragte ich Enrique.
»Sie haben einen Zweig des Wetterbaumes, die herabhängenden Blätter und deren gekrümmter Stiel deuten auf Sturm.«
»Wat jetzt denn vor, Herr Dokter, det is jerade so wie vor een Jewitter.«
»Das scheint wohl im Anzuge zu sein.«
Die beiden Indianer hatten einige Worte getauscht, und jetzt rief der Arriero mit starker Stimme: »Adelante! Celeridad, Senores, por todos santos celeridat!« (Vorwärts! Schnell, bei allen Heiligen, schnell!)
»Was gibt's?« fragte ich Mixtli, der zu mir ritt.
»El ouracan, los aguas, Senor!« (Ein Orkan, die Wasser, Senor.)
»Oh!« sagte tief erschreckt Enrique, »ein Orkan? Die Wasser?«
»Es geht um das Leben, wenn uns die Wasser hier erreichen.« Das Gesicht des Jünglings sah verstört aus.

Ich muß gestehen, daß ich diese Befürchtung für übertrieben hielt, aber die Indianer schienen die uns drohende Gefahr sehr ernst zu nehmen.
»Celeridad!« gellte es von der Spitze her, und mit aller Schnelligkeit, deren die Mulos fähig waren, jagten wir jetzt vorwärts. Die Tiere selbst waren unruhig.
Immer unheimlicher wurde das Tierleben um uns, die Vögel flatterten und kreischten, Eidechsen, Schlangen huschten über unsern Weg, Hirsche, Wildschweine. Mit gewaltigem Satze floh ein Jaguar vorüber, die ganze Natur schien in Aufruhr zu geraten, und doch regte sich kein Lüftchen.
»Schnell! Schnell! Es gilt das Leben!«
Die Indianer begannen zu beten: »Audi nos peccadoras!« (Höre uns Sünder.) Sie schienen Todesangst zu fühlen und spornten und peitschten die Tiere grausam vorwärts.
»Celeridad! O, somos perdidos somos!« (Schnell, oder wir sind alle verloren.)
Jetzt geriet auch ich in Angst, angesteckt von der augenscheinlichen Furcht der Landeseingeborenen und der Unruhe in der Tierwelt. Dennoch sah ich keine eigentliche Gefahr.
Vorn schrie es: »Celeridad, por Dios! Adelante!«
Hinter mir heulte der Peon: »Audi nos peccadores!«
Das Saumtier, das der eiligen Flucht nicht zu folgen vermochte, ließ er zurück, meine wenigen Habseligkeiten waren hin, wie das Eigentum seines Herrn.
Alles ringsum scheint mir zu zittern, die Luft, Felsen, Bäume, Pflanzen, Gräser.
Schwarz wie die Nacht steigt eine Wolkenwand vor uns auf – höher, höher mit unheimlicher Schnelligkeit.
Wir jagen zwischen Felsen ein enges Tal hinauf.
»Celeridad! Por Dios!«
Eine Minute, zwei Minuten – höher steigt die dunkle Wand, höher, schreckenvoller.
Die Tiere keuchen, sie strengen ihre ganze Kraft an, sie scheinen Todesangst zu fühlen.
Immer vorwärts, vorwärts.
Fort geht es in rasendem Laufe.
»Alto Ahi!« klingt es von vorn her. Aus dem Sattel springt der Arriero. »Bajar!« (Absteigen!) »Desensillar!« (Absatteln.)
Alle sind wir auf dem Boden, wie in Todesangst lösen wir Zäume und Sättel, gedankenlos den Befehlen nachkommend.
»Folgt mir!« Und einen schmalen Felsstieg kletterte der Arriero hinauf, wir folgen, er wirft uns den Lasso zu, um unser Emporklimmen zu unterstützen – ein dumpfes Geheul erhebt sich hoch in den Lüften – furchtbar grauenhaft – wir sind oben vor einer Höhle im massiven Fels.
Der Schoß der schwarzen Wolkenwand öffnet sich, und ein fahler, flammender Strahl zuckt über uns hin riesengroß.
Bebend, zitternd stehen wir alle. – Totenstille.
Nun aber erhebt sich ein Sausen, ein Tosen, ein Gebrüll ringsum, als ob Erde und Himmel im wütenden Kampfe lägen. Alle Mächte der Zerstörung schienen losgelassen – aus allen Ecken und Winkeln heult es, mit Riesenkraft stürmt der Orkan einher, alles vor sich niederwerfend – Waldesriesen stürzen krachend nieder – die Erde scheint zu beben. Felsen wanken, Vögel, Äste, Blätter fliegen durch die Luft, vom Sturm mit rasender Schnelligkeit dahin getragen – Blitz zuckt auf Blitz hernieder, und als ob tausend Kanonen auf einmal losgeschossen würden, brüllt der Donner durch die Berge.
Wir stehen atemlos – zitternd, totenbleich da.
Fort dauert das furchtbare Krachen der in den Wäldern niederstürzenden Baumriesen, die der Orkan wie Halme knickt.
Und nun öffnet sich der Wolkenschoß zum zweiten Male. Tropfen, groß wie ein Taubenei, fallen hernieder, ihre Berührung schmerzt wie ein Peitschenhieb. Angstvoll treten wir in die Höhle. Wasserstrahlen sausen wuchtig herab, eine unendliche Flut; ein Meer ergießt sich über die Berge, von allen Felsen, von allen Bergen stürzen wilde Wasser hernieder.
Der Hohlweg vor uns wird zum reißenden Strom, der Äste, Bäume, Steine, Tierkadaver in grausiger Wut mit fortreißt – er steigt, steigt höher und droht unsern Zufluchtsort zu erreichen.
Wir stehen stumm, regungslos, angstvoll da in diesem entsetzlichen Aufruhr der Natur.
An die Maultiere denkt niemand – sie waren dem Verderben geweiht, nachdem sie uns zu dem Zufluchtsort getragen.
Schon wird es helle – das Wasser sinkt – gewaltig, wie diese Naturerscheinungen auftreten, so rasch eilen sie vorüber.
Der Regen hat aufgehört, die dunkle Unheilswolke ist weiter gezogen.
Erst jetzt komme ich zur Besinnung; wir sind gerettet Weh uns allen, wenn der Sturm und die Wasser uns erreicht hätten! Gott sei Dank.
Jetzt war mir die Angst der Eingeborenen begreiflich.
Hell wird es, die Sonne tritt hervor, mit Wonne atmen wir balsamische Luft.
Ach, wie sehen die Wälder aus! Wie im Chaos liegen die gewaltigen Bäume durcheinander.
Das Wasser vor uns ist verrauscht – Steine, Äste, Baumtrümmer sind zurückgeblieben. Was nun?
»Na,« sagt Schmidt, der immer noch bleich aussieht, mit bebender Stimme, »det war een schönes Donnerwetterchen.«
Dies löste meiner Seele Bann – ich hatte die Tropennatur in ihrer ganzen wilden Majestät gesehen, und jetzt fühlte ich nur ehrfurchtsvolle Bewunderung für ihre gigantische Kraft. Nun dachte man auch der Maultiere. Der Arriero sah traurig aus, denn es war keine Hoffnung, noch eines am Leben zu finden.
Er äußerte das auch; doch als ich ihm sagte, ich wollte ihm seinen Verlust ersetzen, kehrte sein Gleichmut zurück.
Er ging mit seinem Peon hinab, um sich umzuschauen nach den Mulos.
Wie durch ein Wunder hatte sich das Tier Enriques gerettet. Der Instinkt hatte es einen Felsenpfad hinaufgetrieben, wo ihm Schutz ward gegen Sturm und Flut, nur nicht gegen den Regen.
Es kam freudig herab, als ihm der Jüngling zurief.
Wie der Arriero sagte, war unweit ein Punkt, wo wir Hilfe finden konnten, er kannte diesen Teil des Gebirges, hatte auch die Höhle gekannt, die uns Schutz geboten hatte, und uns rechtzeitig zu ihr geführt.
Für alle Notfälle führte ich, eingenäht in meinem Jackett, eine Anzahl mexikanischer und amerikanischer Goldstücke mit; jetzt ließ ich sie von Schmidt hervorholen, der mit der Geschicklichkeit des Schneiders die Stelle mit dem Taschenmesser auftrennte.
Wir beschlossen, daß Teobaldo auf Enriques Maultier uns Mulos und Nahrungsmittel schaffen sollte; ich gab ihm Geld, und er ritt davon.
Noch vor Dunkelwerden kehrte er mit vier Tieren und Mehl, Eiern und Fleisch zurück.
Wir verbrachten die Nacht in der Höhle, um am andern Morgen weiterzureisen.
Die Nachrichten, die wir bald über die Ausdehnung des Ausstandes empfingen, veranlaßten mich, nach der Hauptstadt zurückzukehren. Von Enrique und Mixtli trennte ich mich im Gefühle herzlicher Dankbarkeit. Ich nötigte dem Jüngling als ein Erinnerungszeichen an mich meine Uhr auf und wollte den alten Maya mit einer Dublone und einem sehr schön gearbeiteten Jagdmesser erfreuen. Zu meiner Überraschung lehnte er das Geschenk ab.
Auf meine Frage, womit ich meine Dankbarkeit bezeigen könne, erwiderte er: »Gib mir das Bild des Königs, das du gefunden hast! Es wird Don Luis große Freude bereiten; er stammt durch seine Mutter von ihm ab. Das Armband wird er dir gerne schenken, es ist auch sein Eigentum.«
Wenn auch ungern, erfüllte ich den Wunsch des Mannes und händigte ihm den geschnittenen Jadeit für Senor Moro ein.
War mir das Erbrecht des Halbindianers an der Hinterlassenschaft der Mayakönige auch nicht über jeden Zweifel erhaben, so betrachtete ich das Armband doch von nun an als mein Eigentum.
Zu meiner Freude nahm Mixtli noch mein Messer an; das Goldstück lehnte er entschieden ab.
In der Hauptstadt fand ich alles in wilder Verwirrung; und da gleichzeitig Nachrichten eintrafen, daß auch in Chiapa und Yukatan Unruhen ausgebrochen seien, dachte ich der Heimkehr.
Über San Thomas kehrten Schmidt und ich nach Deutschland zurück.
Von hier aus stattete ich dem Landsmann, Senor Carlos Vilando, und Don Luis Moro noch besonderen Dank ab, und sandte ihnen durch Vermittlung unseres Konsuls Geschenke, die sie sehr erfreut haben.
Mehr von jener versunkenen Welt jenseits des Ozeans zu sehen, haben mir die Umstände nicht vergönnt; doch sind unsere Gelehrten eifrig am Werke, die Mayaschrift zu enträtseln, und es wird ihnen gelingen.
An meine an Abenteuern so reiche Reise in den Wäldern und Bergen Guatemalas erinnert mich noch heute das Armband des Königsgrabes, das viel bewundert wird.
Schmidt, der sich längst als ehrsamer Schneidermeister niedergelassen hat, erzählt noch heute immer neue Wunderdinge von jener versunkenen Welt, die mir leider nur einen so flüchtigen Einblick gewährt hatte.
