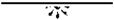|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Mittwoch den 28. Juni.
Nach einiger Zeit kam Frau Werner ebenfalls aus ihrer Wohnung zurück, und wir gingen auf die rosenumrankte Veranda vor der Gartenthür, um Kaffee zu trinken. Als wir dort so behaglich im Schatten saßen und der leise Sommerwind den Blumenduft aus dem sonnigen Garten herwehte, wo die Schmetterlinge, wie berauscht, um die Rosen flatterten, und es so still war, daß man fast das Schlagen ihrer Flügel hören konnte, sprach der Rosenkönig: »Es liegt ein eigener Zauber darin, an so einem sonnigen Nachmittage im behaglichen Schatten zu sitzen, von lieben Menschen umgeben; aber vollständig wird der Genuß erst, wenn Musik dabei ist; Marie willst du uns nicht ein Lied singen?«
Das Klavier stand nahe an den geöffneten Flügelthüren, ich saß gerade so, daß ich es sehen konnte.
Ich hatte Marie noch nie singen hören und war überrascht durch den anmutigen Klang ihrer Stimme, als sie begann:
| »Vom Berg zum Thal das Waldhorn klang, Im blühenden Thal das Mägdlein sang. Von der Rose, der Rose im Thal! Der Jäger hörte des Mägdleins Sang, Der Jäger dort oben lauschte so bang, Er zog gar stille die Berge entlang, |
Der Jäger bin ich, seit ich dies Lied gehört habe, denn immer und immer summt mir seit der Zeit der Kehrreim durch den Sinn: »Von der Rose, der Rose im Thal,« und ihre leichte Gestalt in dem hellen Sommerkleide steht mir vor Augen. Sie hatte keine sehr schöne Stimme, sie war etwas verschleiert, aber anmutig und lieblich und wie geschaffen zum Vortrag von einfachen Liedern.
»Nun singe mir mein Lieblingslied: Aennchen von Tharau,« sagte der Rosenkönig, und dabei schaute er lächelnd Frau Werner an, die ebenfalls lächelte und ein klein wenig errötete, was ihrem noch immer anmutigen Gesichte einen eigentümlichen Reiz verlieh. Und Marie begann: »Aennchen von Tharau ist's, die mir gefällt!«
»Wo ist doch diese Melodie hergekommen?« sagte der Rosenkönig, als sie geendet hatte, »es ist doch gar nicht denkbar, daß dies Lied eine andere Weise haben könne, so verwachsen ist beides miteinander. Aber das ist das Zeichen eines echten Volksliedes. Und ein Volkslied kann man dies wohl nennen, wenn der Name des Dichters uns auch noch bekannt ist. Wer kennt aber jetzt noch andere der weltlichen Lieder von Simon Dach außer diesem. Sie sind alle vergessen. Aber wo das Volk sein Eigenstes ausgesprochen findet, da nimmt es Besitz davon, wie man sein Eigentum zurücknimmt, und läßt nicht wieder davon. Das Volkslied ist – um doch einmal bei meinem Fach zu bleiben,« fügte er lächelnd ein – »wie die wilde Rose. Unter allen den prangenden künstlich erzeugten Schwestern, den üppig dunklen mit betäubendem Duft, den vornehmen gelben, den sentimental blaßroten, den weißen mit schüchtern rosig angehauchten Blättern, steht sie da, kräftig und einfach – frisch, anmutig und gesund, und wo die anderen ohne künstliche Pflege vergehen und ausarten, rankt und blüht sie, ein Kind der Natur, immer noch fort in ursprünglicher Schönheit.«
»Es muß ein eigenes beglückendes Gefühl für den Dichter sein,« meinte ich, »auch nur ein Lied geschaffen zu haben, das ihn gleichsam zu dem Munde vieler macht, da es ihm gelang, das herauszusagen, was in Millionen Herzen unausgesprochen lag.«
Marie war hinzugetreten, sie stand in der Thür und ihre helle Gestalt hob sich schön von dem dunklen Hintergrunde des Zimmers ab.
»Ich kann mir gar nicht denken, daß solche Lieder gemacht werden,« sprach sie, »ich meine, sie müßten so entstehen, wie eine Blume sich aufthut, ganz von selber.«
»Es ist auch nicht viel anders,« sagte der Rosenkönig, »der Sonnenschein der Freude oder der Regen des Schmerzes treffen des Menschen Herz, und wenn er ein Dichter ist, dann thut die Blume sich auf und das Lied ist fertig.«
Später, als schon die Sonne anfing hinter die hohen Baumwipfel am Ende des Gartens zu sinken und die Zweige und Blätter im grünen Golde erglänzten, machten wir einen Gang zu den Rosen. Diese hingen zu unseren Häupten und standen zu beiden Seiten, wo wir nur gingen; zuweilen fiel ein Sonnenlicht durch eine Baumlücke und ließ eine Rosengruppe in wärmerem Lichte erglühen. Im Hintergrunde des Gartens ward noch eine Nachtigall laut und warf ihre Jubeltöne in den sonnigen Abend. Wir gingen dem Klange nach: »Sie hat in diesem Jahr in der wilden Ecke ihr Nest,« sagte der Rosenkönig. Es war in dem weniger betretenen Teile des Gartens, wo die Rosenschule war. Wir kamen an eine mit Gebüsch gefüllte Gartenecke; es waren dort nur wilde Rosensträuche, die sich in üppiger Pracht bis auf die Mauer hinaufgezogen hatten und nun wie besäet mit zarten blaßroten Blüten ihren würzigen Duft aushauchten.
»Da steht das Volkslied!« sagte ich.
»Dies ist die unfruchtbarste Ecke meines Gartens,« sprach der Rosenkönig, »ich habe sie darum mit wilden Rosen bepflanzt, weil ich mir auf diese Weise wilde Stämme ziehe, um meine zahmen Rosen darauf zu pfropfen; unsere großen Dichter haben es ja auch so gemacht mit dem Volksliede,« schloß er lächelnd.
Marie hatte unterdes die Nachtigall gefunden, die in einem der großen Bäume hinter der Gartenmauer auf schwankem Zweige saß. Wir bewunderten den kleinen rostbraunen Vogel und gingen dann zu einer Rosenlaube, wo zum Abend der Tisch gedeckt war.
Nach Tisch war es dämmerig geworden; der Mond, der schon bei Tage als blasse Halbscheibe am Himmel gestanden hatte, gewann an Glanz, und der rote Schein, der noch in den Wipfeln der hohen Bäume träumte, verblaßte allmählich. Wir saßen in traulichem Geplauder, während die Dämmerung sich mehrte und die Schatten sich zwischen den Gebüschen lagerten.
Doch der Mond gewann noch mehr Macht und beleuchtete mit seinem Schimmer Mariens Angesicht, die mir gegenüber saß, und ließ den Schatten ihres lockigen Haares über ihre Züge fallen. Zuweilen trafen sich unsere Augen wie zufällig und sie schaute dann in den Mond, als sei es wirklich Zufall gewesen, und ich that eine sehr unbefangene Frage an den Rosenkönig oder an ihre Mutter. Manchmal verstummte das Gespräch und es war dann nur die Dämmerung zwischen uns, und ringsum das leise Weben der Sommernacht, und das Surren der Nachtschmetterlinge um die blühenden Rosen. Diese leuchteten gruppenweise vom Mond beschienen zu uns herüber, sie standen ganz still und tranken Mondschein, kein Blatt mochte sich rühren.
Dann brachen wir auf; der Rosenkönig ging mit Mariens Mutter voran, wir folgten. Wir sprachen nicht mehr an diesem Abend, nur gute Nacht wünschten mir uns, und ihre schlanken Finger fügten sich beim Abschied mit sanftem Druck in die meinen.
Wie ein Träumender schaute ich noch lang aus meinem Fenster in die Mondnacht. In stillem Frieden lagen die Gärten, fern ragten Baumwipfel in die Nacht und dunkle Häuser mit mondbeglänzten Dächern, und wie ein leises Murren klang das Rauschen des Stadtgewühls zu mir herüber. Ich sah zwischen den Bäumen, wo ihr Haus lag, einen Lichtschimmer entstehen; ich schaute nach ihm, bis er erlosch.
In fernen Häusern verschwand ein Licht nach dem anderen; Sterne tauchten dafür an dem dunkler werdenden Himmel auf.
Donnerstag den 6. Juli.
Seit ich vor acht Tagen, durchnäßt von dem strömenden Regen, nach Hause kam, fühle ich ein körperliches Unbehagen in mir, das von Tag zu Tage zunimmt. Ich kann nicht sagen, was es ist, aber es liegt auf mir wie ein Druck und umgibt mich wie ein dünner Nebel, ich kann nicht arbeiten und habe an nichts Freude. Selbst der Aufenthalt bei meinem lieben Rosenkönig ist mir drückend; er ist so einsilbig und scheint viel nachzudenken, und zuweilen sieht er mich mit eigentümlichen Blicken an. Neulich fragte er mich, ob mir etwas fehle; ich sagte: »Nein,« und dann sah er mich wieder forschend von der Seite an und lächelte so sonderbar.
Ich war so selig, so glücklich; die Tage waren mir voll Sonnenschein, ich lebte im Glücke des Tages und dachte nicht an das, was kommen wird. Aber es ist oft gleichsam, als wolle uns das Schicksal seine rosigste Seite zeigen, sein holdestes Lächeln gönnen, damit uns das Dunkle, das es schon in Bereitschaft hält, um so schwärzer und hoffnungsloser erscheinen möge.
Und was ist es denn eigentlich, was mich quält, der ich vor acht Tagen noch so unendlich glücklich war?
Muß denn Marie nicht zurückhaltend gegen mich sein, wie sie es jetzt ist, da sie jede Begegnung mit mir fast ängstlich vermeidet? – Ist es nicht an mir zu sprechen, da es so weit gekommen ist; müßte ich nicht jetzt offen hintreten und sagen: »Willst du mein Weib sein?«
Aber als mir dieser Gedanke erwachte, machte er mich zaghaft und füllte mein Herz mit Bangen. In schlaflosen Nächten habe ich erwogen und gedacht; doch ich kam nur zu dem Einen: Wie darfst du vor ihre Mutter hintreten oder vor den Rosenkönig, der gleichsam ihr Vater ist, und zu ihnen sprechen: »Gebt mir diese Blume, diese Rose, die eure beste Kostbarkeit ist;« wie darfst du das thun, der du ein Gelehrter ohne Namen und ohne Vermögen bist, der nichts hat, als seine Feder und seinen guten Willen. Ich kann es nicht erfinden und ausdenken, wie es werden soll.
O welch ein grauer Tag ist heute. Es hat einige Zeit geregnet und am Himmel schieben sich faul und verdrossen die Wolken durcheinander; zuweilen geht ein Sprühregen, den der stoßweise Wind gegen mein Fenster prickeln läßt. Verregnet und zerzaust stehen die Rosen und die Steige sind mit ihren verwehten Blättern bedeckt. Die Rosenranke vor meinem Fenster ist verblüht, nur eine halb entblätterte Blüte schlägt bei jedem Windstoß pochend an die Scheiben.
Sonnabend den 15. Juli.
Herr Grund war vor einigen Tagen bei mir, er fand mich verändert und blaß und fragte nach meinem Befinden.
»Es ist nichts,« sagte ich, und dann lenkte er das Gespräch auf den Rosenkönig.
»Na, Sie sind ja jetzt wie ein Kind im Hause dort,« sagte er, »es ist ein prächtiger Mann, der Rosenkönig, aber er schließt sich zu sehr ab, – das sollte ich nur sein, – so ein Mann wie der, wohlhabend und angesehen; wenn er sich darum bekümmern wollte, der könnte alle Tage Stadtverordneter werden. Aber der kennt nur seine Rosen – sind aber auch schön, – dieses Jahr besonders – na, die eigentliche Blütezeit ist ja nun vorbei – aber er hat immer noch bis in den späten Herbst welche.«
Herr Grund war im Zuge und da mußte man ihn ruhig gewähren lassen; es störte ihn nur, wenn man ihm antwortete. So redete er denn von vielerlei, von der großen Hitze, von der schlechten Ausdünstung der Kanäle im Tiergarten, von einem neuen Eisenbahnprojekt, dann kam er aufs Häuserbauen und mit einemmal fragte er: »Sie wissen doch, daß der Rosenkönig auch bauen will?«
»Er hat mir nichts davon gesagt,« meinte ich etwas verwundert.
»Nicht?« meinte Herr Grund, »das ist doch merkwürdig, da glaube ich doch ganz gewiß, daß etwas dahinter steckt. Bauen kann man es nun am Ende wohl gerade nicht nennen, es ist wohl kaum ein Umbau. Sehen Sie, er hat mich um Rat gefragt, weil er die obere Etage seines Hauses, die seit dem Tode seiner Tante unbewohnt ist, wieder einrichten will. Da ist nun mancherlei zu machen. Neue Tapeten, neue Fußböden, denn die sind auch schon morsch und wackelig in dem alten Kasten; eine Wand soll herausgenommen werden, um aus zwei kleinen Zimmern eins zu machen; und da hat er noch so eine phantastische Idee, er will nämlich oben einen Balkon anbringen mit einer Treppe nach dem Garten hinunter – na meinetwegen, er ist nun einmal so.«
Ich hatte ganz verwundert zugehört: »Er hat ja aber unten Platz genug,« sagte ich, »was will er denn mit allen den Zimmern noch?«
Herr Grund sah außerordentlich schlau aus in diesem Augenblicke; seine Augenbrauen zogen sich hoch und sein gutmütiges rotes Gesicht glänzte vor Vergnügen über seine eigene Pfiffigkeit.
»Erinnern Sie sich wohl noch, liebster Herr Walter, was ich früher einmal zu Ihnen sagte? Marie Werner und der Rosenkönig! Jetzt kommt es zum Vorschein, was ich immer vorausgesehen habe. Wissen Sie wohl noch, daß ich zu Ihnen sagte: Es wird! Sehen Sie, jetzt wird es! Weil er sich verheiraten will, darum baut er.« Und Herr Grund sank voll hoher Genugtuung in seine Sofaecke zurück.
So sehr ich auch immer diesen Gedanken von mir gewiesen hatte, so wenig er mir auch früher in den Sinn gekommen war, so hatte ich mich in der letzten Zeit in meiner krankhaften Aufregung schon selber damit gequält, und darum erschrak ich, von einem dritten ihn so fest und bestimmt und mit einer gewissen Begründung ausgesprochen zu hören. Ich versank in grübelnde Gedanken, und Herr Grund, der meine Zerstreuung bemerkte, erhob sich, nachdem er noch Verschiedenes gesprochen, was ich kaum gehört hatte, meinte, er wolle nicht länger stören, und ging.
Wie haben mich meine Gedanken seit der Zeit gequält, bei Tage und in schlaflosen Nächten. Ich erinnerte mich an jeden Blick, an jedes Wort des Rosenkönigs, an seinen ganzen Verkehr mit Marie, an sein eigentümliches Wesen mir gegenüber, an die Aengstlichkeit, mit der jene vermied, mit mir allein zu sein. Wenn ich mit ihnen zusammen war, beobachtete ich beide heimlich, jedes Lächeln, das sie ihm schenkte, gab mir einen Stich durchs Herz, und als sie einmal stand und ihn freundlich anschaute und er ihr das lockige Haar streichelte, wollte es mir die Brust zusammenschnüren. Ich sprach zu mir selber: »Dein Thun und Denken ist thöricht,« und erinnerte mich jener sonnigen Tage, die vergangen waren, aber es gab mir nur Grund zu neuen Quälereien; denn wenn es Wahrheit war, was ich fürchtete, fiel dann nicht ein Schatten auf Mariens Reinheit, hatte sie nicht dann ihr Spiel mit mir getrieben?
Und dazu das körperliche Unbehagen; es liegt auf mir wie die drückende Schwüle, die draußen in der glühenden Julisonne brütet. Weiße lautlose Wolken schieben sich am Himmel durcheinander und verdecken zuweilen die Sonne, ohne daß die Glut sich mildert. Am Horizont haben sie sich zu grauweißen Gebirgen gelagert, die glänzenden Gipfel schauen über den Bäumen hervor.
Die Ungewißheit wird mir unerträglich, ich glaube, ich werde krank, wenn es noch länger dauert. Ich fühle es, diese Angelegenheit muß zu Ende kommen, je eher je besser.
Je eher je besser – und warum kann es nicht heute sein? Ich will hingehen und sprechen zum Rosenkönig, wie mir ums Herz ist, da wird sich alles entscheiden. Ich will um ihre Hand bei ihm bitten, ich will meinem Schicksal ins Auge sehen. Nun mag es sich entscheiden, für mich oder wider mich. Für mich – o, ich mag das Glück nicht ausdenken! – und wider mich – Die schönste Hoffnung meines Lebens müßte ich zu Grabe tragen!
Dienstag den 12. September.
Eine lange Zeit ist verflossen, seit ich die letzten Worte schrieb, eine lange Zeit, von der ich wenig weiß, die nebelhaft verschwommen hinter mir liegt, wie ein wilder Traum, dessen man sich beim Aufwachen vergebens zu erinnern versucht.
Eines Tages war mir, als erwache ich aus langem unruhigen Schlaf, in dem mich gaukelnde Schreckgestalten geängstigt, ich fühlte mich von einer unbeschreiblichen Mattigkeit durchdrungen, und selbst die Hand zu erheben, die auf der bunten geblümten Bettdecke lag, deuchte mir eine Anstrengung. Ich verspürte wenig Verwunderung darüber, daß ich in einem hohen Himmelbette mit bunten Vorhängen von chinesischem Muster lag, und daß ich durch eine Ritze in diesen nach mühsamer Wendung des Kopfes in ein mir ganz unbekanntes Zimmer schaute. Vielleicht waren meine Geisteskräfte noch zu schwach, um sich zu verwundern. Als ich nun so dalag und die bunten Chinesen anschaute, die auf dem Vorhange Thee tranken oder mit Sonnenschirmen und Fächern in wunderlichen Gärten zwischen niedlichen Felsen und sonderbaren Pflanzen lustwandelten, hörte ich ein leises Geräusch im Zimmer, wie wenn man die Blätter eines Buches umwendet, dann ein Räuspern, das mir bekannt vorkam und eine grübelnde Bewegung in meinen geschwächten Denkkräften hervorrief. Dabei mochte ich mich unwillkürlich gerührt haben, denn ich hörte jemand aufstehen, leise Schritte nahten sich meinem Bette, der Vorhang ward sanft und vorsichtig zurückgeschlagen und herein schaute das freundliche, besorgte Gesicht des Rosenkönigs.
»Sie wachen!« rief er, »Sie sind bei Besinnung; o, der Doktor hat recht gehabt, nun ist alles gut!«
»Ich war wohl sehr krank?« wollte ich sagen, allein ich war so schwach, daß ich nur die Lippen bewegen konnte und keinen Laut hervorbrachte.
»Versuchen Sie nicht zu sprechen, seien Sie ganz ruhig, sie dürfen nur schlafen und stillliegen,« sprach der Rosenkönig.
Mir kam, während er sprach, eine dunkle Erinnerung an das, was vor meiner Krankheit war; ich fühlte es wie einen leisen Schmerz in der Gegend des Herzens.
Der Rosenkönig schien das in meinem Gesichte zu lesen, er sprach gleich darauf: Seien Sie ganz ruhig und denken Sie nicht; es ist alles gut, alles,« und dabei lächelte er mir beruhigend zu; ich mußte auch lächeln, denn es kam über mich eine unendliche Beruhigung, und indem verschwamm der Rosenkönig vor meinen Augen, die bunten Vorhänge erschienen wie ein wogendes Farbenmeer, und ich verlor wieder die Besinnung.
Gegen Abend, es mußte so in der Dämmerung sein, erwachte ich noch einmal zu einem Halbtraum, in dem es mir war, als hörte ich flüsternde Stimmen im Zimmer und darunter eine, deren Klang mich mit stiller Beseligung erfüllte, ohne daß ich recht zum Bewußtsein gelangte, weshalb; dann klangen die Stimmen ferner und ferner und verschwammen schließlich, als sich der Schlaf gänzlich meiner bemächtigte.
Mittwoch den 13. September.
Als ich an jenem Tage entschlossenen Mutes zum Rosenkönig ging, um die Entscheidung meines Schicksals aus seinem Munde zu hören, ward ich wieder ganz mutlos, als ich in sein Haus eintrat. Ich traf Herrn Grund bei ihm und war eigentlich froh, dadurch noch einige Frist zu gewinnen. Sie sprachen über den beabsichtigten Umbau. Es fiel mir schwer aufs Herz, ich hörte mit peinlicher Aufmerksamkeit zu, immer hoffend, einen Beweis für das Gegenteil meiner Befürchtungen zu hören. Herrn Grund prickelte die Neugier ganz außerordentlich, das hörte ich aus allen Bemerkungen und Andeutungen. Zuletzt vermochte er sich wohl nicht mehr zu bemeistern, denn er fragte: »Man darf wohl schließen, Herr Born, daß noch Veränderungen anderer Art in Aussicht sind, die mit diesem Bau im Zusammenhange stehen – entschuldigen Sie meine Frage –, allein das Interesse . . .«
»O ja, ich denke, daß noch Veränderungen anderer Art in Aussicht sind,« antwortete der Rosenkönig, und dabei traf mich wieder ein merkwürdiger Seitenblick, so daß ich dachte, er wolle nur nicht mehr sagen in meiner Gegenwart. Ich stand auf und ging wie zufällig in das Nebenzimmer. Dort lag eine angefangene Malerei auf dem Arbeitstische; es war wieder ein Moosrosenzweig und daneben war in Umrissen ein zweiter Blütenzweig angedeutet, den ich noch nicht erkennen konnte. Es überkam mich eine Art von Verzweiflung; ich fühlte plötzlich so scharf und drückend das Elende meiner Lage, daß ich alle meine Vorsätze vergaß, durch eine andere Thür das Haus verließ und mit eiligen Schritten ins Freie eilte. Es war eine drückende schwüle Luft dort, die Sonne war hinter dem Geschiebe und Gebraue der Wolken verschwunden und die unheimliche brütende Stille unterbrach nur zuweilen ein Windstoß, der den Staub aufwirbelte und die aus dem Tiergarten heimkehrenden Spaziergänger zu größerer Eile anspornte.
Ich gelangte ins Freie, wo sich rechts der Weg an den letzten Häusern entlang zum Tiergarten hinzieht; ich verfolgte ihn mechanisch, mir war es gleich, wohin er mich führte, wenn es nur einsam war.
Hoch in der Luft jubelte unter dem dräuenden Himmel eine Lerche; es war in dem lauernden Schweigen fast unheimlich anzuhören. Selbst unter die schattigen Kronen des Laubdaches, wo die Dämmerung schon sich lagerte, war die Schwüle geschlichen und hielt alles umfangen wie mit einem Zauberbann, wie der giftige Hauch einer Schlange, die jeden Augenblick bereit ist loszuspringen.
Zuweilen ging wie banges Ahnen ein Schauern durch die Wipfel; dann murrte und grollte es näher und näher. Plötzlich machte der Wind sich brausend auf, daß die Wipfel der uralten Bäume ächzten und die Aeste sich knirschend aneinander rieben, und nun war es da, nun stürzte der Regen, nun zuckte es leuchtend durch die grüne Finsternis und am Himmel rollte es aufpolternd und dann mit leisem Grollen verhallend dahin.
Die Spannung, der unerträgliche Zustand, in dem ich mich so lange befunden hatte, fing an sich zu lindern, und als ob die entfesselte Natur endlich den lange brütenden Sturm in meiner Brust gelöst hätte, brach ich plötzlich in einen unerbittlichen Strom von Thränen aus. Dann überkam mich, wie ich so in dem strömenden Regen dahineilte und rings um mich die gewaltige brausende Natur war, eine wilde Lustigkeit; ich jubelte in das Krachen des Donners hinein, ich riß meine Kleider auf und bot meine Brust dem Sturm und Regen dar; mir war zu Mute, als müsse das brausende All mich jubelnd in sich aufnehmen und ich im Sturm der aufgeregten Elemente verschwinden und vergehen.
Es war schon ganz dunkel geworden, und das blaue Leuchten der Blitze in den Wasserlachen des Weges und das plötzliche Auftauchen der Bäume mit ihren Stämmen und fein gegliederten Zweigen aus dem Dunkel ist die letzte Erinnerung, die ich an diesen Abend bewahrt habe. Wie man mich am Morgen in durchnäßten Kleidern im heftigsten Fieber auf meinem Sofa fand und der Rosenkönig mich sofort, als er es erfuhr, in seine Wohnung bringen ließ, das hat er mir dann selber erzählt.
Donnerstag den 14. September.
Ich bin noch etwas schwach; der Doktor hat mir verboten, so viel auf einmal zu schreiben, und gestern, als ich eben das letzte Wort schrieb, legte sich eine schöne Hand auf die meine, nahm mir sanft die Feder aus der Hand und trug sie fort, – ich litt es so gern.
Wie soll ich die Zeit schildern, die hinter mir liegt. Wie ich langsam, ganz langsam, immer kräftiger und munterer ward, wie dann die deutliche Erinnerung des Vergangenen kam und ich den Rosenkönig so unruhig ansah, daß er endlich vom Doktor die Erlaubnis auswirkte, mir alles zu sagen.
Ich erfuhr, daß ich in meinem Fiebertraume alles verraten habe, was schon längst kein Geheimnis mehr war; aber auch von meinem ganzen Mißverständnis war der Rosenkönig unterrichtet worden. Ich mußte lachen, als er von meinen sonderbaren Fieberphantasien erzählte. Herr Grund spielte darin eine große Rolle, er hatte nach meiner Ansicht eine Klappe in der Wand neben meinem Bette, aus der er, wenn es ihm beliebte, hervorschaute und mich ängstigte. Ich hatte oft gerufen: »Macht doch die Klappe zu! Nehmt den grinsenden Philister weg, er zerpflückt mir alle Rosen!« Und dann hatte ich viel von Moosrosen mit grünen Hüten und braunen Bändern gesprochen und dergleichen mehr.
»Nun ist ja aber alles gut,« schloß der Rosenkönig, »und wenn der Doktor es erlaubt, sollst du sie auch bald sehen.«
Und nun trat eines Tages Marie mit ihrer Mutter in die Thür. Das schöne Mädchen ging sanft errötend an mein Bett und reichte mir ihre Hand. Sie setzte sich neben mich; ich hielt ihre Hand in meinen beiden, und wir konnten beide zuerst nicht sprechen und sahen uns nur in die Augen. Dann saßen sie alle drei um mich her, und wir sprachen von allerlei Dingen, und der Rosenkönig und Frau Werner sahen uns mit zufriedenen glücklichen Augen an. Dann kamen die letzten Strahlen der Abendsonne durch das Fenster und beleuchteten rosig Mariens Antlitz, und ließen die bunten Chinesen des Vorhanges durchsichtig erglühen. Unser Gespräch war wie die Abenddämmerung, die nun hereinbrach, so leise dämmerte es hin und verstummte allmählich. Ich hielt noch immer ihre Hand in der meinen und streichelte sie sanft. Die beiden Alten standen auf und gingen an das Fenster, wo ich sie leise miteinander sprechen hörte; ich aber drückte die weiche schöne Hand sanft und fragte fast unhörbar, aber Marie verstand es doch: »Du weißt nun alles, liebe Marie, willst du mein eigen sein? Ich habe dich so lieb, wie nichts in der Welt.«
Sie antwortete nicht, sie zögerte einen Augenblick, dann beugte sie sich sanft über mich, die weichen Locken wallten um mein Antlitz und ich fühlte zum erstenmal den jungen unschuldigen Mund auf dem meinen. Dann richtete sie sich wieder auf und wir verharrten einen Augenblick in seligem Schweigen.
Der Rosenkönig trat mit lächelndem Gesicht zu uns und sprach: »So, Kinder, laßt es genug sein für heute; die Zeit, die der Doktor gestattet hat, ist abgelaufen, der Patient muß seine Ruhe haben.«
Sonntag den 17. September.
Es war eine wunderbare Zeit, die Zeit meiner Genesung. Wie sie alle so liebevoll um mich sorgten, mit leisem Schritte durchs Zimmer gingen und flüsternd miteinander sprachen, wenn sie dachten, ich schliefe, – wie sie darauf bedacht waren, mir Freude zu bereiten. Ich denke noch immer daran, wie Marie mir zum erstenmal Blumen aus dem Garten brachte. Was ist eine Blume doch für ein köstliches Ding, zumal eine Rose. Die zarten rötlichen Blätter, am Ende ein wenig umgebogen, in dichter Fülle sich zu einem Rund schließend und köstlichen Duft aushauchend. Wie zierlich schließt sich dann der in zarte Spitzen auslaufende grüne Kelch daran, und dann der mit seinen rötlichen Härchen besetzte Stengel und die runden, sägeförmig gezahnten Blätter, die wieder einen anderen strengeren Duft haben, – wie ist es alles schön. Ich glaube, das vermag nur ein Genesender zu empfinden, dessen Sinne erst wieder zu neuem Leben erwachen. Und Marie, meine kleine Rose, war sie nicht noch viel schöner. Der Doktor behauptete, ich würde mit einer ganz unerlaubten Geschwindigkeit gesund, er erklärte mich für einen seltenen Fall in zwei Hinsichten: erstens, weil ich überhaupt am Leben geblieben sei, und zweitens, weil ich so schnell mich kräftige. Aber warum sollte ich auch nicht, es war ja lauter Sonnenschein um mich. Marie war so schön, wenn sie in ihrem hellen Kleide durchs Zimmer ging, um mir etwas zu holen, und sich mit freundlichem Lächeln nach mir umsah, oder wenn sie neben mir saß und mir vorlas, und ich dann manchmal gar nicht zuhörte, sondern sie ansah und mit schönen hellen Farben an dem Bilde unserer Zukunft malte. Oder wenn sie des Morgens kam, frisch wie ein Frühlingsmorgen, oder wenn sie des Abends ging und mir mit einem Kuß gute Nacht wünschte.
Aber viele Stunden war ich auch allein, denn so wollte es der Doktor, da ich noch nicht viel sprechen durfte. Da lag ich denn in dem stillen Zimmer, in dem die Sonnenstäubchen webten, und horchte auf allerlei Töne von außen, oder ich studierte an meinen bunten Vorhängen, wo sich die Bilder immer wiederholten. Ich verglich die gleichen Bilder miteinander und freute mich wie ein Kind, wenn ich entdeckte, daß auf dem einen Bilde der Zopf des würdigen Chinesen etwas länger war als auf dem anderen; oder ich versuchte mathematische Figuren herzustellen, indem ich mir besonders auffallende Punkte durch gerade Linien verbunden dachte; oder ich sann nach, wie wohl die dargestellten Leute heißen möchten, und machte mir wunderliche Namen zurecht, die sehr chinesisch klangen; oder ich dachte mir ganze Gespräche aus, die die guten Leute miteinander führten, und was so Genesungsbeschäftigungen mehr sind.
Eines Tages erzählte mir auch der Rosenkönig seine Geschichte. Sie war sehr einfach und mir in anderer Auffassung allerdings durch Herrn Grund schon ziemlich bekannt. Seine Großmutter und seine Tante hatten ihn sehr geliebt, aber auch sehr verzogen und durch diese verkehrte Erziehung einen menschenscheuen Träumer aus ihm gemacht, der vor jeder Berührung mit der Außenwelt eine bange Scheu besaß. Sein einziger Umgang war die Nachbarstochter, jetzt Mariens Mutter, die einige Jahre jünger war als er. Zu dieser faßte er, als er erwachsen war und sie nicht mehr so viel zusammenkamen, eine stille, aber innige Liebe, die jedoch von ihr nicht erwidert, ja wohl kaum geahnt wurde. Das junge lebensfreudige Mädchen war es, das ihn eines Tages, als sie allein miteinander waren, im Laufe des Gespräches aufklärte über die eines jungen Mannes unwürdige Stellung, die er einnahm. Die Augen des schönen Mädchens leuchteten, wie sie ihm das Leben und Streben eines jungen Mannes schilderte, wie sie es sich dachte, in freudiger Arbeit und in beharrlichem Streben nach hohen und edlen Zielen.
Alles, was in seiner Seele schon in dunkler Ahnung gelegen hatte, erwuchs durch diese Unterredung zur Klarheit, und er fühlte schmerzlich, wie unwürdig er dieses Mädchens sei, und wie er danach mit allen Kräften zu streben habe, ihrer würdig zu werden. Daher der plötzliche Entschluß, in die Welt zu gehen, und alles andere, was mir durch Herrn Grund schon bekannt war.
Nachher, als sie den Doktor Werner heiratete, hatte es ihn nicht in ihrer Nähe gelitten, und erst nach dessen Tode war er zurückgekehrt. Nun lebten beide in einem schönen Freundschaftsverhältnis miteinander.
Dienstag den 26. September.
Wie thöricht komme ich mir vor, wenn ich an jene Zeit vor meiner Krankheit zurückdenke, wie unbegreiflich scheint mir meine damalige Verblendung. Jetzt, da mir alles klar ist, was hinter mir war, da mein froher Blick in die Zukunft sieht wie in eine schöne, sonnig klare Herbstlandschaft, wo alles in gedämpftem Golde schwimmt, wo das Nahe so schön ist und das Ferne fast noch schöner, da fasse ich kaum, wie mein Kopf ein solcher Tummelplatz von Nebelwolken und schreckhaften Einbildungen sein konnte.
Ich wohne seit einiger Zeit schon wieder in meiner Wohnung, weil der Bau in des Rosenkönigs Hause nun wirklich begonnen hat. Das ist dort ein Rumoren und Wirtschaften im oberen Stockwerk, ein Messen, Sägen, Hobeln, Kleben und Streichen, daß es eine Art hat, denn alles soll vor dem Winter noch fertig werden. Der Rosenkönig und Mariens Mutter hatten damals längst bemerkt, wie es zwischen mir und Marie stand, und da wollte der Rosenkönig ganz stille uns eine Wohnung herrichten, und dann sollten wir dort wie eine einzige Familie wohnen; so war sein Plan. Sie erwarteten immer, daß ich mich aussprechen sollte, und daher kam alles, was ich so schief aufgefaßt hatte.
Ich kann mein Glück zuweilen noch gar nicht fassen; auf einem einsamen Spaziergange im Tiergarten warf ich gestern mit einemmal meinen Hut in die Luft und fing laut an zu jauchzen, so daß ein würdiges, in einiger Entfernung lustwandelndes Ehepaar sich entsetzt umsah und mich mit verwunderten Augen betrachtete.
Freitag den 20. Oktober.
Vorgestern waren wir alle vier hinausgewandert ins Freie. Es war ein wunderschöner sonniger Spätherbsttag und wir saßen auf der Anhöhe im Tiergarten, wo man hinausschaut in die weite Ebene. Aus dem bräunlichen Grün der Bäume blinkten zierliche weiße Villen und ringsum lag der freundliche Sonnenschein. Neben mir saß Marie und lehnte ihren Kopf an meine Schulter, und wir schauten nach den weißen glänzenden Sommerfäden, die im leisen Luftzug dahinschwammen.
Und als ich am Abend nach Hause kam, saß ich in stillem Sinnen noch lange und dachte meinem Glücke nach.
Denn das Herrlichste, was der Mann auf dieser Welt erlangen kann, das ist ein liebes, schönes und getreues Weib; denn die wahre Liebe ist das Bleibende, Bestehende, der stille schöne Stern, an dessen ruhigem, mildem Schein wir uns kräftigen und trösten, wenn alles sich uns entgegenkehrt. Wohl dem, der sie gefunden. Ich aber weiß nicht, wie ich dessen würdig bin und wie ich es verdienen soll. Ich habe nie gestrebt nach dem strahlenden Sonnenglanze des Ruhmes, ich habe mir nie gewünscht, auf der blendenden Höhe des Lebens zu wandeln. Aber was ich mir wünschte, ein stilles, zufriedenes, erwärmendes Los, ich habe es gefunden – und gebe es Gott allen, die sich danach sehnen.