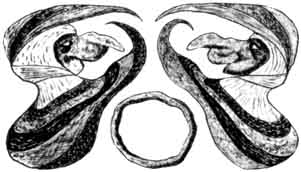|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

»Dschennan! Dschennan!«
Also hallts durch den dunklen Garten des reichen Ibn Salimba.
Mohren rufen nach der Dschennan.
Dschennan ist die alte Wirtschafterin des Ibn Salimba. Sie gebietet über ein Heer von schwarzen Sklaven und Sklavinnen. Das Mohrenvolk ist ganz bunt gekleidet, so bunt wie das große Tulpenbeet, vor dem der Herr des Hauses mit seinen Gästen speist und trinkt.
Mit Fackeln rennen die Mohren durch den dunklen Garten, sie suchen die alte Dschennan, denn sie hat wieder was vergessen: was Wichtiges, sehr was Wichtiges. Ibn Salimba ist sehr ärgerlich. Die Schwarzen sind schon ganz ängstlich geworden.
»Dschennan! Dschennan!«
Und nach einer guten Weile steht die gute alte Dschennan vor ihrem Herrn und vor dessen Gästen neben dem bunten Tulpenbeet. Das Mohrenvolk lauscht im Gebüsch. Die Augen der Schwarzen funkeln.
Ibn Salimba runzelt die Stirn, starrt seine Haushälterin an und fragt hart: »Wo liegt Kordova?«
»Dort, Herr!«
Die Alte weist mit dem Zeigefinger in die richtige Richtung hinein.
»Wo liegen die Marzipaneier?«
Die Alte zeigt auf einen großen silbernen Teller und sagt weinend: »Dort, Herr!«
»So,« erwidert nun Ibn Salimba, »Dein Gedächtnis ist also noch nicht so schwach, wie Du manchmal behauptest. Wo ist nun das Nußöl in den Eiern, das neue Nußöl – he? na? wirds bald?«
»Aber, Herr, das ist ja in die Eier hineingebacken.«
»Was?«
Ibn Salimba nimmt wütend ein Ei in die Hand und wirfts der Alten an den Kopf, trifft aber nur die Schulter seiner Haushälterin, an der das Ei auseinandergeht, wobei grünliches Nußöl herunterrinnt. Die Gäste lachen – wie sie aber das Öl sehen, sind sie still.
»Was?« schreit wieder der Hausherr.
»Ja, Herr«, sagt die Dschennan, »wenn in einem Ei kein Öl sein sollte, so haben die Mädchen schuld, wir hatten mehr Marzipan als Nußöl, und ich habe gesagt, die Mädchen sollten nichts übrig lassen. Nun meint' ich doch, sie solltens so abpassen, daß in jedes Ei auch Öl hineinkäme. Das haben die Mädchen nicht getan.«
Dschennan weint wieder, und die Gäste lachen. Schließlich lacht der Hausherr auch. Die Schwarzen ziehen sich grinsend ins Dunkel zurück.
Und die Becher klirren und klingen gegeneinander, der Wein erhitzt das arabische Blut, und die Marzipaneier mit ihrem Nußöl verschwinden hinter den weißen Zähnen der lachenden Sängerinnen, die Ibn Salimba in seinem Garten bewirtet, um seinen Freund, den Geographen Jussuf, zu ehren.
Die Springbrunnen plätschern, das bunten Tulpenbeet glüht. Chinesische Lampions durchleuchten den Garten, und im Weinkioske füllen die schwarzen Sklaven roten Wein in die neuen Schläuche. Mit den neuen Schläuchen rennt das Mohrenvolk über das Fliesengetäfel der Gartenwege. Die Sängerinnen singen, daß es laut durch die Granatbäume schallt, und die Gäste lauschen und trinken. Jussuf liegt sinnend neben dem Hausherrn auf einem dunklen marokkanischen Teppich, und der Mond geht über Kordova auf und glänzt über den Lustgarten am Qued el Kebir, über den Lustgarten, in dem Ibn Salimba ein Nachtfest feiert. Weiter hinten in dem prächtigen Landhause poltert die alte Dschennan wie eine toll gewordene Dschinne durch die Prunkgemächer, durch Küche und Keller, so daß das Mohrenvolk die schwarzen Augen verdreht und sich ärgert über das böse alte Weib.
Und als die letzten Klänge eines alten arabischen Volksliedes verklungen waren, erhob sich Ibn Salimba von seinem weichen Pfühl, ging an das Tulpenbeet, brach eine gelb und weiß gestreifte Tulpenblüte, wandte sich zurück und überreichte die Blüte dem sinnenden Jussuf – der sprang überrascht lächelnd auf, die beiden Männer flüsterten sich ein paar Worte zu und gingen dann Arm in Arm in eine Kypressenallee hinein. Auf den bunten Fliesen der Allee schwankten die langen Schatten der beiden Freunde hin und her; hinter ihnen wars hell, vor ihnen dunkel. Was die Beiden sprachen, hörten die Gäste nicht mehr. Ein paar Sklaven, die sich im Gebüsch versteckt hatten, vernahmen Worte wie »Byzanz« »Palermo« »Bagdad« »Peking« »Kairo« »Smyrna« – das Übrige verstanden sie nicht, denn die beiden Freunde sprachen persisch.
Währenddem rief hinter dem Tulpenbeet die rothaarige Aischa etwas erregt ein paar Freundinnen an ihre Seite: »Kinder,« sagte sie, »jetzt wollen wir den neuen Gassenhauer singen. Was in allen Schenken zu hören ist, muß Jussuf auch kennen lernen!« Und die anderen Sängerinnen waren lachend einverstanden, sie tranken den Männern zu und begannen – schmeichelnd, kosend, wie die warmen Wellen des Qued el Kebir:
Geh nicht fort, hehrer Held!
Laß die Welt! Laß die Welt!
Trinken könntest Du auch hier;
O, trinke mit mir!
Geh nicht fort, hehrer Held!
Hast Du Zeit, Hab und Gut,
Dann verbringst Du das auch hier;
Verbrings doch mit mir!
Morgen lacht, wer die Nacht
Nicht zum Schlaf, nicht zum Schlaf
Wie ein Murmeltier mißbraucht;
Die Reue verraucht!
Aber rennst Du mir weg,
Wird mein Bein, dieses Bein,
In die Schänke gehn allein;
Ich liebe den Wein!
Dieses Lied war unter dem Namen »Der einbeinige Trinker« bekannt und stammte von dem einbeinigen Dichter Ibn Krasim, der beim Vortrage der letzten Strophe immer sehr heftig auf sein linkes Bein (das gesunde!) zu schlagen pflegte – was ihm später auch diejenigen nachmachten, die zwei gesunde Beine besaßen.
Aber Jussuf und Ibn Salimba, die eben wieder in der Kypressenallee Kehrt machten und sich langsam dem Tulpenbeete näherten, sprachen heftiger und eindringlicher, wenn sie auch flüsterten. Ein dicker Mohr hörte im Gebüsch, wie Jussuf jetzt auf Arabisch sagte: »Aber Byzanz, ich sage Dir, Byzanz kennst Du nicht. Da nützt mir Silbergeld garnichts. Byzanz ist teuer – so teuer wie chinesische Stickereien.«
Ibn Salimba zuckte die Achseln, dann aber wandte er sich zu seinem Freunde und stand still, er flüsterte: »Durch Deine Vermittlung mache ich die großartigsten Geschäfte, das weißt Du. Ich will Dich auch anständig dafür bezahlen. Sei mein Freund. Das Gold sollst Du bekommen. Bist Du zufrieden?«
»Ja, ich danke Dir«, rief Jussuf laut. »Im Übrigen«, fuhr er fort, »muß die Aischa noch vor Morgengrauen in Kordova sein; darf ich sie in Deiner langen Barke zurückbringen?«
»Gewiß«, versetzte der Hausherr, »he, Sklaven ! Fackeln! Fackeln! Bringt einen Schlauch mit Wein in die lange Barke! Schnell!«
Die Sklaven flogen.
Der Qued el Kebir fließt im Mondenschein dem fernen Mittelländischen Meere zu. Die Wellen schaukeln sich, brechen sich an den Strudeln im Uferschilf, heben sich, senken sich, spiegeln den Mond und die Sterne, glitzern und umspülen mit gurgelnden Lauten die lange Barke, in der jetzt Jussuf und Aischa schweigend Platz nehmen.
Ibn Salimba ist ungemein aufmerksam gewesen. Die Sklaven haben auf Porzellanschalen die dicksten Weintrauben, die feinsten Nüsse und die saftigsten Früchte in den Kahn getragen. Herrliches Mandelgebäck, Marzipan und Süssigkeiten finden sich in großen, blanken Krügen vor – das ist Alles für die Aischa.
Und für die Fahrt hat der reiche Kaufmann zwei Schläuche mit Wein gesandt. Das beste Räucherwerk brennt auf kleinen silbernen Schalen – dann steht da ganz hinten im Kahn ein Topf mit heißem Wein und ein Topf mit kordovanischem Scherbet – dem köstlichen Eiswein, der sogar besser schmeckt als der Scherbet von Palermo. Ibn Salimba weiß, daß sein Freund Jussuf diese Leckereien zu schätzen versteht – Jussuf ist ein Kenner.
Die nubischen Ruderer stoßen jetzt das Boot vom Ufer ab, die Fackelträger verschwinden unter den Granatbäumen. Und Jussuf und Aischa horchen auf das regelmäßige Plätschern der langen Riemen. Sie sitzen hinten im Boot, die Ruderer sehen nichts von ihnen, denn ein Teppich teilt das Fahrzeug in zwei Teile, Teppiche hängen hinten auch an den beiden Bordseiten, doch lassen sich diese Teppiche leicht zurückziehen.
An der Spitze des Bootes sitzt der alte Steuermann mit weinrotem Turban. Wenn er steuern will, dreht er einen drehbaren Pfahl, durch dessen oberen Teil ein starker Stock durchgesteckt ist, und der Pfahl setzt dann eine Kette in Bewegung; diese Kette zieht das Steuerruder hinten entweder nach rechts oder nach links – je nachdem der alte Steuermann den Pfahl vorne dreht.
Sechs nubische Sklaven rudern.
Die lange Barke schießt wie ein Pfeil durch das Wasser. Die Sklaven rudern eifrig, denn der Weg zur Stadt ist weit, und es geht stromaufwärts.
Die Steuerkette rasselt, und Jussuf hebt den rechten Fuß auf, weil das Rasseln unter dem Fußteppich ertönt, doch er besinnt sich gleich und reicht der rothaarigen Aischa die Hand und spricht dabei: »Wir wollen erst den Glühwein und dann den Eiswein trinken, nicht wahr?«
Aischa nickt, und sie tun nun, wie er gesagt. Das Räucherwerk duftet wunderbar – und der Rothaarigen schmeckt das Marzipan vorzüglich. Eine rote Ampel schaukelt über Jussuf und Aischa, die emporschauen zu den Sternen am schwarzen Himmel. Die Ampel sieht aus wie ein herabhängender, wackelnder, roter Mond. . . .
»Hast Du Dich nicht oft nach Kordova zurückgesehnt?« Also fragt die Aischa, und Jussuf sagt zerstreut:
»Oft? Oft? Ich glaube nicht . . . zuweilen . . . ja.«
»Du bist jetzt grade sieben Jahre fort.«
»Sieben Jahre! Ja! Ja!«
»Jussuf, freust Du Dich nicht, daß Du jetzt wieder in Kordova bist?«
Sie fährt mit der Linken über sein volles, krauses Haar, und Jussuf küßt seiner Freundin die Hand. Er denkt dabei an Ibn Salimbas Gold – und lächelt.
»Ich freue mich«, sagt er nach einer Weile.
Er trinkt bedächtig den warmen Wein und fährt dann fort, indem er nach Osten deutet: »O, Du kennst aber noch nicht die Welt – die große Welt – die dort hinten – hinter dem Steuerruder – die bis in den fernen fernen Osten reicht.«
»Jussuf, Jussuf, erzähle mir!«
»Von der Welt?«
»Ja!«
Auf den Fluten des Qued el Kebir glänzt der Mond.
Jussuf schlägt den Teppich an der linken Seite des Bootes zurück. Und nun ist der Raum, in dem der Geograph mit der berühmten Sängerin weilt, von hinten, vom Steuerruder aus gesehen, auf der rechten Seite und vorn ganz dicht durch dicke, dunkle marokkanische Teppiche abgeschlossen ; auf der linken Seite ist der Teppich zurückgeschlagen, links vorn wie links hinten hängen schwere, wulstige Teppichfalten. Hinten über dem Steuerruder ist der Blick ganz frei, so daß man die Strudelfurche hinter der langen Barke leicht überschauen kann. Oben hängt an einem seltsam gewundenen Eichenast, der rechtwinklig am kurzen Maststock befestigt ist, an kurzer Leine die papierne rote Ampel.
Auf den Fluten des Qued el Kebir glänzt der Mond.
Jussuf und Aischa sitzen mit untergeschlagenen Beinen auf dem gelben, mit schwarzen Linienmustern durchwirkten Bodenteppich. Sie sitzen mit dem Rücken gegen die rechte Bordseite. Sie schauen über die linke Bordseite zwischen den zurückgeschlagenen, wulstigen Teppichfalten hindurch auf den glänzenden Strom hinaus.
Jussuf beginnt:
»Ich kann Dir nicht so geordnet berichten, wie's in Büchern zu lesen ist, auch nicht so spannend erzählen wie ein alter Märchendichter. Aber Du sollst dies und das zu hören bekommen, und – Aischa, ich möchte Dir die Welt erschließen – die große, bunte Welt. Mir ist so, als wenn ich tausend Jahre in der weiten Fremde herumgezogen wäre. Am Anfang gings über Tunis und Marokko hoch zu Kamel durch die heiße Wüste. Ich weiß noch, wie ich erschrak, als ich zum ersten Male Löwengebrüll hörte. O – und wenn nachts die Karawane langsam und schleppend durch den heißen Sand dahinzog, dann glänzten über uns die ewigen Sterne, so wie sie jetzt auch über uns glänzen. Aber das Gesumm und Gesurr – hei Aischa – Dschinnen und Ghulen mit schwarzen Gesichtern und blauen Augen – die sah ich nicht – aber gruslig wars zuweilen doch. Wir haben manches Abenteuer erlebt, und ich habe anfangs Deiner sehr oft gedacht. Von Deinen roten Haaren hab ich oft geträumt. Und Deine Küsse hab' ich oft noch gefühlt, wenn ich an kühlen Quellen tagsüber neben den Kamelen schlief – über uns schwankende Palmen – und Schatten unten – tiefblaue Schatten . . . Dann kamen wir schließlich nach Alexandria – da gabs viel zu sehen – und der Straßenlärm betäubte mich anfangs. In Alexandria kam ich oft mit Christen zusammen, die schrieben damals gerade das Jahr 972. Ich mußte des Ibn Salimba wegen mit den Christen zusammen sein – denn Du weißt ja, ich war schon damals sein Geschäftsreisender. Die Gelehrten sahen mich deswegen häufig ein wenig entrüstet an, aber ich hatte Geld und meine Zunge auf dem rechten Fleck. Ich erzwang mir die Achtung, wenn sie mir versagt wurde. Manchmal gings mir nicht allzu gut. Trocknes Brot hab' ich kennen gelernt – denn Ibn Salimba war damals noch ein Geizhals – bestreite das nicht! Heute ist ers nicht mehr. Doch hör', Aischa! Ein Abenteuer, das ich in Kairo erlebte, fällt mir gerade ein. Wir hatten in Kairo, wo's prächtige Häuser und herrliche Schänken giebt, zwei Nächte sehr kräftig in einem Olivengarten gezecht und beschlossen, am dritten Tage das Grab des alten egyptischen Kalifen Ibn Chefren aufzusuchen. Nun denke Dir aber dieses Grab ungefähr hundert Mal höher als Kordovas große Moschee, unten ganz breit und vierseitig, nach oben spitz zulaufend. Dieses Grab, eine sogenannte Pyramide, deren es dort in Egypten sehr viele giebt, steht da wie ein riesiger regelmäßiger Steinberg. Wir fahren also auf dem Nil, dem Fluß, der durch Kairo fließt, zu der großen Pyramide. Der Nil ist zwanzig Mal breiter als der Qued el Kebir. Unterwegs kaufen wir ein paar Dutzend Tauben. Wie wir nun auf die Pyramide klettern wollen, wird von einem jungen Perser der Vorschlag gemacht, die Tauben oben auf der Spitze der Pyramide zu braten und aufzuessen. Und alle sind einverstanden. Wir schleppen Holz und Feuerzeug hinauf, putzen unsere Dolche, rupfen die Tauben, braten sie, essen sie und leben da oben wie alte Götter. Wein hatten wir auch . . . und als der Abend kam, dachten wir nicht daran, hinunterzugehen. Es war ein himmlischer, göttlicher Abend. In der Ferne ringsum lag die gelbe heiße große Wüste, Kairo hinter uns, andere Pyramiden in der Nähe – die Sonne ging wie eine rote Riesenampel unter, und der Fluß, der Nil, sah ganz blutrot aus. Ich dachte an Deine Haare, Aischa, und bildete mir ein, ich könnte hinter der großen Wüste ganz klein Marokko sehen – und Kordova auch. Ich wurde deswegen ausgelacht. Aber es war einer der schönsten Abende, die ich erlebt habe – die Nacht darauf war allerdings sehr kalt – wir froren schrecklich. – Aber die Moscheen von Kairo waren auch sehr schön. O Aischa, ich war auch in Mekka, und in Bagdad und Damaskus war ich auch, dort wo unsere großen Kalifen gelebt haben. Jetzt leben dort auch noch große und reiche Kalifen. Zu Fuß bin ich da oft gewandert. Ja! Ja! Doch mir wird jetzt heiß.«
Und Jussuf ging zum Eiswein über, zu dem köstlichen kordovanischen Scherbet, der viel besser schmeckt als der Scherbet von Palermo.
Und andere Barken fuhren vorüber, indische Liebeslieder tönten über den Wassern des Qued el Kebir, Saitenklang hallte durch die Nacht, und bunte chinesische Lampen leuchteten lustig wie bunte große Käfer, so daß man des Mondscheins zuweilen garnicht achtete.

Und Jussuf sagt:
»Ah! Das ist ein vorzüglicher Scherbet! In der Heimat des großen Dichters Abu Nuwas – in Bagdad – ja, da hab ich auch mal Eiswein getrunken, der schmeckte so ähnlich. Es waren armenische Tänzerinnen dabei. Wir saßen auf einer Terrasse am Tigris, und Pechfackeln flackerten unheimlich vor den Jasminlauben. Die armenischen Mädchen waren sehr schön, und wie wir beim Morgengrauen fortgingen, waren meine Taschen leer – so leer wie ein Kirchhof im Mondschein.«
Aischa hustete, Tränen standen in ihren Augen. Die lange Barke fuhr an bunten Holzkiosken, an erleuchteten Villen und an großen Steintreppen vorüber. Harfenklang tönte aus den Laubgängen am Ufer heraus, Lichter blinkten durch die Pappeln, und schlanke Palmen ragten in den Sternhimmel hinein. Rosen dufteten, Enten flogen auf, und die Riemen der nubischen Sklaven verwüsteten das Uferschilf. Dann aber fuhr der Kahn wieder in die Mitte des Stroms hinein. Und Jussuf dachte an Bagdad – und er mußte lächeln. Ihm gings in Bagdad so schlecht, daß er sich nur selten am Tage in den belebten Straßen blicken lassen durfte, und sein Kleid war so zerrissen, Bart und Haar so struppig, daß einmal eine Schar Kinder schreiend vor ihm auseinanderstob und johlend davonrannte, als wär' er ein Spukgeist vom Demawand.
Die Erinnerung an den Demawand, einen Berg im nördlichen Persien, auf dem alle Geister des Orients nach dem Glauben des Volkes zusammenzukommen pflegten, rüttelte den Jussuf wieder aus seinen Träumen auf, denn er hatte sich, als er mal in der Nähe jenes Berges in einer Herberge einkehrte, durch ein langes Stück weißer Leinwand gräßlich erschrecken lassen – und dieser Schreck fuhr ihm jetzt abermals durch die Glieder. Aischa sah ihn mit ihren Tränen im Auge an, und Jussuf fühlte plötzlich, daß ihn Aischa wieder liebe wie einst – wie einst vor sieben Jahren.
»Warum bist du eigentlich nach Kordova zurückgekommen?« fragte die Aischa.
»Hm«, entgegnet Jussuf; er will sagen, wie's auch wahr ist, daß Ibn Salimba das veranlaßt habe, doch er besinnt sich und denkt, das könne die Rothaarige kränken, die wohl sicher glaube, daß er nur ihretwegen zurückgekommen sei. Deshalb meint er: »Ich weiß nicht.« Eifrig erzählt er dann von Persien und Indien, von Samarkand und Edelsteinen, von Elefanten und Königspalästen, von Bajaderen und Priestern, von Buddha und Mahomet, von jüdischen Weinhändlern und persischen Derwischen, vom Ganges und vom indischen Weltmeer.
Jedoch Aischa schaut mit glühenden Augen in den Qued el Kebir, dann unterbricht sie den Freund und behauptet zaghaft: »Aber die Welt ist hier doch auch so schön, warum willst Du denn immer die ferne Fremde preisen, ist Dir die Heimat garnichts mehr?«
»Ich sollte Dir doch von der ›Welt‹ erzählen«, versetzt Jussuf, und die Rothaarige erwidert schnell: »Kordova liegt doch auch in der Welt!«
»Ja! Ja!« sagt der Geograph gelangweilt, »aber für mich ist die Welt immer da draußen – dort im Osten – da hinter dem Steuerruder. O die Welt ist so groß, daß man über ihr Alles vergißt, Alles.«
»Auch die Stunden, die man im Arme der Liebe verträumt?«
Also fragt die Aischa, und ihr Freund kraut sich hinter den Ohren, dann spricht er gutmütig flüsternd: »Aischa, Du weißt wohl noch, was ich Dir damals sagte, vor sieben Jahren, als ich Dich verließ. Ich setzte Dir auseinander, daß mir die Welt mehr sei als die Liebe, daß die Welt eine größere Macht über mich habe als die Liebe. So ists auch heute noch. Vergieb mir, daß ich so offen rede, doch ich kann nicht anders. Ich liebe Dich noch immer so wie damals – wirklich – und ich habe in den sieben Jahren öfter an Dich gedacht, als ich Dirs sagen kann, aber trotzdem liebe ich die weite Welt und das lustige Wandern doch noch mehr als Dich . . . wenn auch das Wandern manchmal gar nicht lustig ist. Sieh, Aischa, ich muß nach Palermo und nach Byzanz, ich kann nicht hier bleiben – suche mich nicht zurückzuhalten. Du bist noch viel schöner jetzt als damals. Aber ich darf nicht, ich kann nicht. Meine liebe, gute Aischa!«
Sie lagen sich lange halb lächelnd, halb schluchzend in den Armen – und der Mond verschwand, und die lange Barke fuhr in Kordova hinein. Rechts und links standen jetzt unzählige Häuser, der alte Steuermann rasselte viel mit der Steuerkette, denn sie mußten vielen Schiffen ausweichen. Die nubischen Sklaven ruderten mit halbgeschlossenen Augen. Währenddem dämmerte der Morgen, und die Barke landete.
Die Rothaarige erzählte ihrem alten Freunde von Sevilla und von ihren neuen Freunden. Sie habe aber, wenn sie ihm auch nicht treu geblieben sei, ihren Jussuf nie vergessen und ihn doch eigentlich immer geliebt, er müsse sie auch lieben, so wie sie ihn liebe. Jussuf lächelte und meinte freundlich: »Kind, ich muß wieder nach China, von Spanien bis China, und von China nach Spanien, das ist mein einziges, mein höchstes Glück. O, Du kennst die Welt nicht. Du solltest nur chinesische Stickereien sehen – das ist eine Pracht, ich habe Ibn Salimba welche mitgebracht, hast Du sie nicht gesehen? O, das tut mir leid. Ich hab' ihm erzählt, daß sie fürchterlich teuer gewesen sind, das hat ihn gerührt, und deshalb hat er mir viel, viel Geld versprochen – zur Reise nach Byzanz – und die Stickereien haben mich doch nur einen alten Ring gekostet – nichts weiter – ach ja! In der Welt wird man klug, fast zu klug.«
»Bei Allah!« schreit jetzt die Aischa. »Es ist ja schon heller lichter Tag. Und wir sind ja schon in Kordova – an der Landungsbrücke. Was wird nur der alte Steuermann denken.«
Und eilig verlassen beide die lange Barke. Die Aischa drückt ihrem Freunde herzlich die Hand, ruft die Sklaven heran, die auf die Sängerin gewartet haben, läßt sie das Marzipan und die anderen Sachen aus dem Kahne schaffen und steigt in ihre Sänfte, grüßt noch einmal ihren Jussuf und verschwindet. Im Kaworraschloß, wo ein Morgenfest gefeiert wird, wartet man schon auf die große Sängerin.
Jussuf aber läßt sich die beiden Weinschläuche von zwei Packträgern nachtragen und wandelt mit ihnen zur nächsten Medrésse, wo man ihn kennt. Die Medrésse ist ein Gasthaus für die wandernden Gelehrten. In der Bibliothek und in den Lesesälen versammeln sich täglich die Gelehrten – um zu disputieren.
Als Jussuf auf seinen Weinschläuchen ein wenig ausgeschlafen, begiebt er sich zu seinen Freunden, und er wundert sich gleich über ihr Gespräch, sie sprechen gerade wieder über Abu Nuwas – genau so wie vor sieben Jahren. »Kordova liegt nicht in der Welt«, murmelt der Geograph – und er schenkt seinen Freunden die beiden Schläuche mit Wein.
An den nächsten beiden Tagen besorgt Jussuf seine Geschäfte in Kordova – und an den nächsten beiden Abenden weilt er im Kaworraschloß, der berühmtesten Schänke, in der Aischa, die Rothaarige, sehnsüchtige Liebeslieder singt.
Nach vier Wochen fährt Jussuf mitten auf dem Mittelländischen Meere nach Palermo und Byzanz. Die Wogen des Meeres brausen und schäumen. Jussuf denkt an seine Freundin und atmet wieder tief auf. Er ist ihr entflohen. Er denkt an die Eichen und Ulmen im Garten des Kaworraschlosses, er blickt nach Osten weit hinaus, sinkt auf die Kniee und ruft laut durch die Brandung: »Welt, Welt, nun hast Du mich wieder! Dir bleib' ich treu!« Das Schiffsvolk hört das und schüttelt den Kopf. Das Schiffsvolk würde den Jussuf so gut verstehen, wenns nur Arabisch verstände. Doch Arabisch kann das Schiffsvolk nicht.
Jetzt schäumen die Wellen übers Verdeck. Jussuf aber ärgert sich nicht, daß sein neues, weiß und gelb gestreiftes Leinengewand naß wird. Er blickt immer noch nach Osten – dort – nur dort liegt seine Welt.