
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
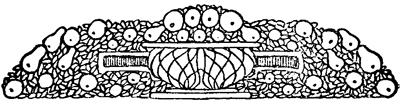
Tausende und Abertausende haben sich an ihm belustigt, bis zu Tränen ergötzt, seine possierlich ins Gehör fallenden Reime führen sie im Munde, zitieren sie immer wieder zu halbwegs passender, wohl auch zu unpassendster Gelegenheit und freuen sich, als hätten sie sie selbst gemacht, ihrer dadurch bewiesenen Überlegenheit über das Leben: einer Überlegenheit, wohlfeil erstanden und mechanisch eingewerkelt: dass er ein Dichter ist, hoch über ihren behaglichen Niederungen, das ahnen wohl die wenigsten, würden es kaum glauben, ein wenig verlegen lächelnd, wenn man's ihnen versicherte. Wilhelm Busch, der Mann dieser burlesken Verse – »Knüttelreime« lautet die technisch abfällige Bezeichnung (wir Glücklichen haben ja für alles termini!) –, Busch ein »wirklicher« Dichter? Wie Goethe und Schiller und Heine? (Höher geht's nicht.) Und was für ein feiner Künstler! Überdies gar ein Philosoph, wenn das eine Steigerung sein soll. Vor allem aber ist er unser Humorist, der deutsche Humorist, eine Prägung, die ein bisschen abgegriffen erscheint, fast ein Schlagwort (heisst ein Wort, mit dem man einen Begriff totschlägt und zudeckt, dass keiner mehr ahnt, was darunter liegt). Man nennt die Deutschen, und nicht nur bei »offiziellen« Anlässen, wo es ja überhaupt hoch hergeht, Sänger- und Schützenfesten, Vereinsjahresversammlungen und derlei bei uns so beliebtem Gemütsfreiluftturnen, noch immer gerne »das Volk der Dichter und Denker«. Könnte man sie wohl ein Volk von – humoristischen Denkern nennen? Ich glaube, wir müssten das heute leider demütig verneinen. Was man so gemeinhin als die deutschen »humoristischen Schriftsteller« einander – gähnend zeigt, ist von dem echten Humor, ihm, der, wie bekannt, Lächeln und Weinen zugleich ist, besser Lächeln aus Weinen, Lächeln eines, der einmal bitterlich in sich hinein geweint hat und – nicht mehr weint, sehr weit entfernt.

Da ist, um von den »Alten« nur die Grössten anzurühren, Wieland, dieser glatte Sardoniker, sicherlich einer unserer besterzogenen Schriftsteller und – geringsten Dichter: sein »Humor« ist Scheidewasser. Das eminent Spielerische dieses interessanten Ahnherrn unserer »Literaten« schliesst die »Unbefangenheit« des Humoristen aus. Seine Tournüre, etwas zu aufdringlich, um auf Weltläufigkeit berechtigten Anspruch zu erheben, ist der Witz, »höherer« Situationswitz, das Bonmot der nonchalanten Geselligkeit. (Eine interessante Parallele ergäbe der »ironische« Märchenerzähler Musäus, der dem lieblichen Gebilde tiefsten deutschen Volksgemütes so taktlos den Stempel des »Literarischen« auf die reine Stirne drückte. Man denke an den wunderbaren Andersen, um den Frevel ganz zu erfühlen!) Oder Jean Paul. Den »bedeutendsten Humoristen« nennt ihn die Literaturgeschichte, diese naseweise alte Jungfer! Und wir plappern's gehorsam nach seit der Schule (wo wir freilich nicht mehr von ihm zu lesen bekamen als die »Neujahrsnacht eines Unglücklichen« als höchst angemessenen Sentimentalitätslappen). O, er war ein grosser Dichter, dieser Wunsiedler »Legationsrat«, einer der reichsten und geheimnisvollsten Dichter, die wir überhaupt haben, trotz seiner gelegentlichen kleinstädtischen Leimsiedergeschmacklosigkeit. Nur kennt ihn leider heute niemand mehr. Vor allem keiner von denen, die ihn – in einem der mit Recht so beliebten, weil wieder einmal hohe Selbstachtung einflössenden Gespräche mit dem ehrfurchtgeronnenen, dürren Hauslehrer des vielversprechenden, nur nichts haltenden »Einzigen« – den »grössten Humoristen« nennen und dann in der »Humoristischen Ecke« ihres deutschen Leib-, Haus- und Familienblattes die schönen Bilderrätsel auflösen. Er war ein Dichter des Unbewussten, des Verborgensten, des Höchsten und Tiefsten, ein verzückter Seher, ein taumelnder Korybant. Aber Humor verlangt Bewusstsein. Humor hat nur einer, der zusieht, sich selbst vor allem wehmütig-belustigt, einer, der über die Achsel zurückblicken kann auf – Dichter. Dichter sind wir ja alle, selbst die Unkünstlerischsten unter uns. Uns selbst dichten wir. Nach vorwärts und zurück, in die Erinnerungen hinein. Erinnerung selbst ist Dichtung. Aber Humoristen? Blasphemiker gibt es freilich genug, Spottsüchtige, Ehrfurchtslose. Der Humorist jedoch ist ehrfürchtig (nicht gerade vor »heiligsten Gütern« freilich). Ich glaube, man verwechselt bei den Deutschen nicht nur das Jean Paulsche Schlafrockendenschleifen (die deutsche »Idylle«) mit Humor, man glaubt auch allen Ernstes, ein Professor, der gemütlich wird, sei humoristisch. Ein aufgeräumter deutscher Professor! Friedrich Theodor Vischer war »auch einer ...«
Und unsere »Klassiker«?
Klopstock, Lessing, Goethe, Schiller, Hölderlin, Platen, Kleist. Hatte einer von ihnen Humor? Weil Jean Paul von diesen allen vielleicht durch – Formlosigkeit und die kleinbürgerliche Atmosphäre sich unterschied, erfand man ihm die klingende Halsmarke. Keineswegs soll durch diese »prinzipielle« Ablehnung einer gebräuchlichen Nomenklatur der Tatsache widersprochen sein, dass Jean Paul (»Maria Wuz«, »Katzenberger«, »Flegeljahre«!) köstliche Kabinettstücke sentimentalischer Komik geschaffen hat. Man vergleiche aber um der Deutlichkeit der Unterscheidung willen etwa Sterne mit Meredith. Einer freilich besass echten Humor. Hoffmann. Aber war Hoffmann, dieser Virtuose der melancholischen Selbstironie, überhaupt ein – deutscher Dichter? Nämlich in jenen Stücken, die das unverkennbare Gepräge »Hoffmann« tragen? Und nun wage ich das Paradoxon, dem zu begegnen, alle diese Irr- und Wandelgänge angelegt sind. Der Deutsche, dem eingestandenermassen der Geist (l'esprit) versagt ist – Ausnahmen wie Lichtenberg, Sturz, Nietzsche bestätigen natürlich nur wieder einmal die Regel –, hat die Anlage zum Humor. Aber die »Literatur« hat ihn uns ausgetrieben, und der durchaus undeutsche Feuilletonismus hat den Verbannten fast verhungern lassen. Heine ist der erste, der im grossen den Feuilletonismus – auch seine geniale Lyrik (bis auf die letzten tiefen und echten Gedichte) ist eigentlich Feuilletonlyrik – in die fette, schwere deutsche Erde verpflanzt hat. Und der fremde Samen schoss auf und überwucherte die ganze weite Fläche. Wenn unsere Dichtung heute durchaus den »Literaten« ans Messer geliefert ist, ein zierliches Taschenmesserchen in koketter Perlmutterschale – wirklich schien es schon, als müsste sie sich verbluten –, ist der entartete Feuilletonismus daran schuld. Diese ganze Glitzer-»Kultur« des Feuilletonismus und seiner Bastarde, verblasener Lyrismus, impotentes Artistentum, affektierte Dekadence, Geistreichelei, arroganter Tiefsinn, Leihanstalt-Symbolik usw., müsste erst ausgerottet werden, umgegraben der reiche Boden – so reich, dass er doch nicht umzubringen war –-, auf dass sich wieder hervorwage, was bisher bescheiden abseits einsam blühte mit leisem Dufte. Und man würde dem Humor begegnen, der schon da war. Man denke im Schatten der Stettenheim, Blumenthal und Genossen, die heute bei uns die »humoristische Ader« blähen, an Fischart, Grimmelshausen, an die alten Schwänke, den wie goldiger Honig flüssig-klaren Humor deutscher Märchen und Sagen. Und gigantische Wurzeln, die sich gedrängt bisher in sich selbst verkrümmten, würden sich kraftstrotzend spreiten: Gottfried Keller, der in deutschen Landen noch so unbehauste, göttlich-reiche, fruchtbare, ein Meister vollsaftigen, körnigen Humors. Licht fiele auf den verborgenen Fleck, wo Wilhelm Raabes farnkraut-feine, lautlose Kunst grünt, Stifters, dieses wundervollen frommen Künstlers, unsäglich zart verästeltetes Rankenwerk könnte endlich sich aufrollen in vollem, warmem Sonnenschein, Fontanes prächtige, jovial-sonore Stimme käme wie ein Ereignis, wie Merlin aus der Grube. Und breitschultrig gesellte sich Wilhelm Busch zu ihnen, ewig jung und frisch wie ein sprudelnder Quell.
Ja, wir haben Humoristen, aber man hört sie nicht in dem Jahrmarktlärm der Gaukler und schwitzenden Ausrufer vor den Leinwandbuden der Cliquen. Deutsche Art aber ist nicht laut und nicht schillernd, sie ist wie Sommerwaldweben um Riesenstämme: würziger Tannenduft, kühles Schauern vom Bach, Spechthämmern in Feierstille.

Wilhelm Buschs Geburtshaus in Wiedensahl
Wilhelm Busch ist am 15. April 1832 in Wiedensahl bei Stadthagen geboren. Der Vater, ein Krämer, »heiter und arbeitsfroh«, die Mutter »still, fromm und fleissig«. Und Grossmütterlein spann schon vor Tag am Herdfeuer, Wilhelm aber liest ihr »ein paar schöne Morgenlieder aus dem Gesangbuch vor«. Sonst ist nicht gar viel zu erzählen. Wunderliche Ortschaftsnamen, »Ebergötzen«, »Lüethorst«, bezeichnen Stationen der Jugendwanderschaft. Sechzehn Jahre alt bezieht der sonnverbrannte Dörfler die polytechnische Schule zu Hannover (1848!) und erringt in der reinen Mathematik »Eins mit Auszeichnung«. Ein Maler weist dem Sinnierer, der schon frühzeitig, angeregt durch Kants krause »Kritik«, »in der Gehirnkammer Mäuse« gefangen hatte, den Weg nach Düsseldorf. Maiwein und der Antikensaal. Aber es will nicht recht. In Antwerpen macht er sich für eine Weile sesshaft. Und da geht ihm die grosse alte Kunst auf: Rubens, Brouwer, Teniers, Hals, »ihre göttliche Leichtigkeit der Darstellung malerischer Einfälle, verbunden mit stofflich juwelenhaftem Reiz; diese Unbefangenheit eines guten Gewissens, welches nichts zu vertuschen braucht; diese Farbenmusik, worin man alle Stimmen klar durchhört, vom Grundbass herauf«. Erfüllt von solchen Wundern sieht er die Heimat wieder. In den Spinnstuben singen die Mädchen, »was ihre Mütter und Grossmütter gesungen«, am Gartenzaune blühen die alten Winden, nachts tutet der Wächter die mondbeschienenen Fenster entlang. Auf den Wiesen aber tanzen die Elfen ... Über den Märchen und Sagen versäumt der »Maler«, damals übrigens mit dem kuriosen Gedanken trächtig, als Bienenzüchter (!) – der Oheim war's »im Grossen« – in Amerika sein Glück zu versuchen, nicht seine Zeit. Er liest Darwin, liest Schopenhauer »mit Leidenschaft«. »Doch so was lässt nach mit der Zeit. Ihre Schlüssel passen ja zu vielen Türen in dem verwunschenen Schlosse dieser Welt: aber kein hiesiger Schlüssel, so scheint's, und wär's der Asketenschlüssel, passt jemals zur Ausgangstür.«
Er geht nach München. Sein »flämisches Schifflein« kommt aber »nicht recht zum Schwimmen« in der damaligen akademischen Strömung. Mag »wohl auch schlecht gesteuert « gewesen sein. 1859 bringen die »Fliegenden Blätter« die erste »Zeichnung mit Text«: »zwei Männer, die aufs Eis gehen, wobei einer den Kopf verliert.« Auch fremde Texte werden illustriert. »Bald aber meint' ich, ich müsste alles halt selber machen.« Dabei ist es geblieben. Und es war gut so. »Wer sie« – sagt er selbst von seinen kunterbunten Werken – »wer sie in die Hand nimmt, etwa wie Spieluhren, wird vielleicht finden, dass sie, trotz bummelichsten Aussehens, doch im Leben geglüht, mit Fleiss gehämmert und nicht unzweckmässig zusammengesetzt sind. Fast sämtlich sind sie in Wiedensahl gemacht, ohne wen zu fragen, und, ausgenommen ein allegorisches Tendenzstück und einige Produkte des drängenden Ernährungstriebes, zum Selbstplaisier. Hätte jedoch die sorglos in Holzschuhen tanzende Muse dem einen oder anderen der würdigen Zuschauer auf die Zehen getreten, so wird das bei ländlichen Festen nicht weiter entschuldigt. Ein auffällig tugendsames Frauenzimmer ist es freilich nicht. Aber indem sie einerseits den Myrtenzweig aus der Hand übertriebenen Wohlwollens errötend von sich ablehnt, hält sie andererseits gemütlich den verschleierten Blick eines alten Ästhetikers« – Friedrich Theodor Vischer ist gemeint – »aus, dem bei der Bestellung des eigenen Ackers ein Stäubchen Guano ins Auge geflogen.« Still lebt der Alte in der Heimat, Mechtshausen bei Grossrhüden, ein Sonderling, wie er selbst zugibt. Er »liest unter anderem die Bibel, die grossen Dramatiker, die Bekenntnisse des Augustin, den Pickwick und Don Quixote und hält die Odyssee für das schönste aller Märchenbücher«, aber er ist beileibe kein Bücherwurm.
»Tief unten« steht er an der Schattenseite des Berges. »Aber ich bin nicht grämlich geworden, sondern wohlgemut, halb schmunzelnd, halb gerührt höre ich das fröhliche Lachen von anderseits her, wo die Jugend im Sonnenschein nachrückt,« schrieb er 1894.
Gelassenheit ist das Wort, das am schönsten die dichterische Manier – hier aber ist einmal eine »Manier« Natur – von Wilhelm Busch bezeichnet. Sie ist nicht durchaus Resignation, noch weniger freilich grausam lächelnde Verachtung, diese Ruhe, mit der sein klares Auge die Welt in seinem Spiegel – immerhin etwas von einem Zerrspiegel – fängt. (Fast scheint »Fangen« eine allzu bewegte Aktion für den gleichsam behaglich zurückgelehnten Dichter. Aber man denke »ein Bild weiter« und an einen Fischer ...) Dieser Wilhelm Busch ist einer, der von ganz unten kommt, und er weiss trefflich Bescheid auch um die Maschinistenräume der kleinen Weltbühne. Und ein Zeichnerauge hat seit je aus ihm geblitzt, ein mutiges, verwegenes Zeichnerauge, das lustig blinzelt, wenn es wieder was erwischt hat. Man erinnert sich E. T. A. Hoffmanns, der auch – freilich durchaus nicht ausschliesslich, und das macht einen bedeutsamen Unterschied aus, – schon als Zeichnerkind Menschen und Dinge erfasste. (Man könnte des Schriftstellers Hoffmann Werke in zeichnerische und musikalische einteilen: Kontur und Ton, Flächengrotesken und unendliche Raumgefühle.) Busch kam als Zeichner zur Dichtung und zwar als geborener Zeichner (Keller, Stifter als gelernte Zeichner). Es ist eine andere Welt, die dieses Beobachtermedium einer dichterischen Begabung entdeckt. Schafft sich doch jedes Auge, jeder Sinn die Welt, ist ja Erkenntnis nichts als mehr oder weniger rasche Präzisierung und Konzentrierung von Sinneseindrücken durch den Mittler Verstand. Aber der Zeichner im besonderen zieht immer Umrisse, zerschneidet die Welt in weisse Silhouetten, die – der Schraffierung bedürfen. Busch sind seine Verse diese flinke Schraffierung. So ergänzt er bald seine Strichaufnahmen durch das Wort.
Es gibt Künstler in Worten, die dieses Material fast nur rythmisch verwenden, also nach dem Gewicht, andere geben den Worten Stellungen, die sie funkeln machen oder matt schimmern lassen. Nur den unkünstlerischen Schreibefertigen, den im weitesten Sinne »wissenschaftlichen« Menschen sind sie nichts als Vehikel der Mitteilung. Eine Aufschrift über einem öffentlichen Gebäude ist eine Mitteilung. Viele Autoren, die sich für Dichter geben und wohl auch selbst dafür halten, sind über dieses niedrigste Stadium niemals hinausgekommen. (Man kommt auch eigentlich niemals über sich selbst hinaus, wächst nur, im Künstlersinne freilich vor allem nach innen ...) Busch, der mancherlei »mitgeteilt« hat, in zierlichen Bürgerstubenfabeln und gereimten Anekdoten, Lehrsprüchlein und Scherzen, die man gesammelt in bunten Gedichtebüchlein harmlos-behaglich als behagliche Harmlosigkeiten eines klugbescheidenen Eigenbrödlers liest, Busch hat auch eine höhere, für ihn bezeichnendere Art, die Worte zu werten: er füllt mit ihnen die Konturen seiner Umrisseindrücke aus. Und so sind diese eigentlichen Busch-Verse nicht Etiketten oder Titel, auch nicht »Texte«, die etwa gar irgend jemand sonst hätte anfertigen können (wie es andererseits »Illustrationen« gibt, die nicht dichterische Werte in Strich- und Farben werte umsetzen und so – zum Unterschied von Simultankünsten – Parallelismen der Künste schaffen, sondern sich an den allgemeinen Klischees der Wortmitteilungen zu eigenen Mitteilungen genügen lassen), seine unnachahmlichen, wenn auch mehr, als lieb sein kann, nachgeahmten Verse sind Blut und Eingeweide, Hirn und Nerven dieser virtuosen epischen Silhouetten (die graphischen Künste sind epische).
Und so sind denn hinwiederum die ebenso unnachahmlichen behenden Zeichnungen das Knochengerüste dieser »körperlichen« Verse, figurale Abbreviatur, eine hastige Notenschrift, hörbar für Musiker der Anschauung, Kinder und Künstler, nicht für »wissenschaftliche« Leute, die in ihnen »Bilder«, Themen, Anekdoten, wie andererseits in den Versen »Texte« erblicken.

Pater Filucius
Gelassenheit. Hier ist von Busch, dem Philosophen, besser – denn Philosoph ist prägnant im Lehrsinne, während es ursprünglich einen Schülersinn trug – Busch, dem Weisen, zu reden. Jede Auffassung der Welt, die über die verstandesmässige Zusammenfassung der Sinneseindrücke – ein Prozess, den geheimnisvoll und mit einem kolossalen Aufwande an Hirntätigkeit das Kind erlernt, – hinaus- und hinaufgeht, zeugt eine Weltanschauung. Irgendwie ordnet jeder Mensch seine Eindrücke, fälscht sie durch voreiliges Urteil oder adelt sie durch hohe Gesinnung. Das Gefühl hat das gewichtigste Wort in der Gärungszeit dieser Schöpferperiode. Ist man sich auch über diesen vorlauten Helfer und – Störer klargeworden, tritt Ruhe ein. Das Schütteln des ganzen Menschen hört auf: er setzt sich gleichsam, erhält eine Basis, die Essenz und Extrakt ist, wird »weise«. Busch, der Künstler in Wort und Strich, ist weise. Wir haben von ihm nichts aus der Periode der Wallungen. Nur Ergebnisse der weisen Anschauung. Allenfalls könnte man – aber man vergegenwärtige sich die Zeit der Hochflut des Liberalismus – die Tendenzsatire des »Filucius«, eine Allegorie (!) mit einem ganz ernsthaft hinten aufgeklebten »Schlüssel«, zu den Gefühlsatavismen zählen, überhaupt alles in seiner Dichtung und Zeichnung, das »Spitzen« gegen Stände, Klassen, Meinungen aufweist. Da jedoch alle solchen tendenziös-liberalen Invektiven durch das Medium der Form ins Ewige gehoben sind, kommt man von diesem Zweifel doch wieder bald weg. Nur der leidige Filucius-»Schlüssel« bleibt als ein Dokument der Doktrinenschwere, aber man sehe von ihm ab, negiere die »Allegorie« und empfinde die Kunst – hier Mittel – als Zweck, Endabsicht, und man entbehrt ihn nicht, diesen kulturhistorisch gewiss interessanten »Schlüssel«, vergisst ihn völlig: so stark ist die Macht einer künstlerischen Individualität.
Also bis auf die wenigen »Pointen« dieses reichen Lebenswerkes ist Gelassenheit seine wirklich erlebte Devise.
Neid- und wunschlos schaut ein freier, starker Künstler die Welt. Keine Fussangel der Konventionen, der Vor- und Rücksichten kann den Geflügelten zuschnappend versehren. Lächelnd bejaht er die Welt. Lächelnd baut er sie auf. Nichts von Verzeihen, von Vorwürfen, von Klagen. Kontraste sind nur verschiedene Belichtungen, das Mangelhafte kein Schaden, sondern wesentlich. Keine Pathologie der Menschlichkeiten, eine organische Chemie vielmehr, die wundervoll übersichtlich experimentiert. Keine Taschenspielerkunststückchen boshafter Parodie, sondern wohltemperierte Ironie der Tatsachen. Keine Hinterhalte, keine gestellten Perspektiven, die fixe Beobachtungsposten verlangen: eine Welt der Hautreliefs sozusagen, die herankommen lässt. Busch, so grausam, so überlegen, so ehrfurchtslos, ist im Grunde ohne Arg. Man kann das an Kindern prüfen, die ihn erleben wie ihre Stubenumgebung und den Garten, in dem es Käfer gibt, Schnecken und Spatzen, Katzengold und Schwalbenkot ...
Geht man kritisch-prüfend näher hinzu an diese Zeichnerdichtung, fällt einem freilich – sozialer Sklave des Mitleids, der man einmal ist, (Kinder sind's nicht) – eines auf:
Die Grausamkeit, mit der Wilhelm Busch seine Geschöpfe behandelt, ist haarsträubend. Sie werden glatt gewalzt von Tonnen und Mühlsteinen, gemahlen, an Spindeln aufgerollt, von Giften zerfressen, ersticken, verbrennen, ertrinken, ihre Körper werden barbarisch verstümmelt, ihre Gesichter versengt, man reisst ihnen Gliedmassen aus. Die Verwundungen, die so nebenher laufen, sind nicht minder schmerzhaft: eiserne Rechen, Angelhaken, Nägel, Beile, spitze Pfähle, Fangeisen sind die fürchterlichen Werkzeuge nicht nur der sühnenden Vergeltung, auch des barbarischen Zufalles. Menschen und Tiere, Pflanzen und Gebäude werden mit wahrer Wollust zertrümmert, geschunden, in die Luft gesprengt, verdorben. Was allein den Gerätschaften des Hausbedarfes zugefügt wird, grenzt an das Sagenhafte. Teller, Schüsseln, Gläser, Schränke, Pfeifen, Kleider, alles wird zerschlagen, zerschunden, zerrissen, versehrt durch Wasser, Feuer, Säuren, Schmutz. Mensch und Tier wetteifern mit den Elementen, vermittelst Blaserohren, Hämmern, Stiefeln oder auf dem einfacheren Wege der Hände, Füsse, Beine, Schultern, mit Absätzen und Kniescheiben, Ellenbogen, Zähnen und Zunge, einander und dem Besitztum, eigenem wie fremdem, allerhand Schabernack und Unheil, Löcher, Risse, Striemen, Beulen, Kratzer, Wunden, Schand, Schimpf, Schaden zuzufügen. Dies ist ein echt deutscher Zug, mehr ein typisch germanischer. Man denke an die englischen Grotesk-Clowns, die ihre bombenförmig vorgewölbten Schädelschalen mit Tomahawks bearbeiten, ihre unförmlichen Klumpnasen durch wuchtige Hiebe zum Erglühen bringen, einander Stuhlbeine in den Magen und Kaffeemühlen in die Sitzfläche treiben, die Ohrfeigen austeilen, dass gleich ganze Gesichtshälften mitgehen oder, wie es bei Busch so schön heisst, einem vor Husten und anderen Erschütterungen des Organismus »der Salat aus den Ohren fliegt«.
Busch hat absolut kein Mitleid. Unfug wird bei ihm immer mit der härtesten, sei es Leibes-, sei es der Todesstrafe selbst bestraft. Die bösen Buben von Korinth, die den höchst läppischen Greis Diogenes erst anspritzen durch das Spundloch seines aufreizenden Fasses, dann dieses Fass im Übermut zu schieben beginnen, werden von Nägeln an den Röcken erfasst und durch das ins Bergabrollen geratene Fass zerquetscht. Max und Moritz, die Hühner gestohlen, einem Schneider zu einem unerwünschten Freibade verholfen und einem braven Lehrer die alleinseligmachende Pfeife durch respektwidrige Pulverfüllung bedrohlicherweise verekelt, Mehlsäcke aufgeschlitzt und wahrhaft tollkühn ein paar Bretzeln entwendet haben, werden zuerst im Backofen geröstet und, da sie noch nicht »perdu« sind, in der Mühle zu Stücken geschroten, schliesslich gar vom Federvieh in diesem höchst unwürdigen Zustande verspeist. Peter, der ungeachtet aller Warnung »anno 12« bei grässlicher Kälte durchaus dem Vergnügen des Schlittschuhlaufens fröhnen zu müssen glaubte, wird in einen Stacheleisklumpen verwandelt und zerrinnt später am rettenden Ofen »zu Brei«. Dem »heiligen Franz« wird mit der Flasche der Schädel eingeschlagen, weil er seinen »Hang zum Küchenpersonal« einmal nicht lassen kann. Der betrunkene Zwiel, der seinen Hausschlüssel nicht ins Schlüsselloch zu bringen imstande war, friert auf der Regentonne sitzend elendiglich an dieser an. Dem Knaben, der das Pusterohr missbraucht zu schändlichem Spotte an ehrsamer Schlafrock-Morgenfeier, treibt der würdige Bartelmann entrüstet das Instrument der Missetat mit wuchtigem Hiebe »tief in den Kopf«. Fröhlichen Tanz beschliesst polternder Einsturz des Gerüstes, auf dem die biederen Musikanten fiedeln. Und das Unterhaltendste sind die Ketten des Missgeschickes, die Elastizität all dieser misshandelten Körper, da ein Stoss sich gleich fortpflanzt und ganze Reihen umwirft, ein die Treppe hinabstolpernder Stiefel Wasserkübel, Besen, Hund und Katze, Hausmagd und die unvermeidlichen lächerlichen Anstandspersonen zu durcheinander trubelnden Stürzen veranlasst. Geht eine jungfräulich zart empfindende Dame mit einer achtunggebietenden Krinoline spazieren, gleich fahren ihr zusammengekoppelte Tiere an die Beine, bringen sie zu Fall und schleifen sie. Hat einer einen neuen Glanzhut auf das sonntäglich geölte Haupt gestülpt, wird er ihm auch unfehlbar eingetrieben. Frackschösse werden mit dem Rasiermesser abgeschnitten, ganze Körbe Eier zerquetscht; »Hans Huckebein«, das »Laster«, setzt den schätzbaren Inhalt eines wohlbestandenen Tellerbords in rasselndes Rollen; des »tiefgekränkten« Knopp demonstrativer abendlicher Wirtshausgang endigt in einer allgemeinen Niederlage der gegen den etwas geschwächt heimkehrenden Protestler verschworenen Küchengarnitur. Flaschenscherben, Gardinenfetzen, brennende Nachtmützen und Polsterzipfel sind eine selbstverständliche Einrichtung des Weltlaufes. Und wie sinnreich sind die Qualen, die der Mitleidlose aussinnt! Stachelhecken, scharfe Fallen, Aloespitzen, das »Kaktuskraut«, in das der Elefant, dem ein Pfeil im ahnungslosen Leibe steckt, den Bösewicht von Neger wirft, der Nasenring des Schwarzen, den der Schweif des Affen erfasst, bis die Nase, zur »Qualspirale« gezerrt, aus der Wurzel gerissen wird, die Lichtschere, die dem Säugling im Wickelpolster auf den blossen Leib geschnürt wird: es ist eine wahre Orgie von Scheusslichkeiten, Torturen und Kummer, ein Konzert von Wutgeheul, Schmerzensstöhnen, Furchtwimmern und Racheschnauben.

Herr und Frau Knopp
Dem Künstler Busch ist es eine Lust, die Bühne seiner Vorgänge durch eine Explosion zu sprengen, seine Geschöpfe kaltblütig mit Kartätschen niederzustrecken, Massenmord, wie ihn die mit Bleisoldaten spielenden Knaben lieben. Stellt da so ein kleiner Junge mit unsäglicher Mühe und peinlicher Sorgfalt seine Hunderte von Kanonieren und Marineuren, Infanteristen und Zulukaffern auf, richtet dann den Lauf seiner blinkenden Blechkanone auf die ganze, nur in Profilansicht zu einiger Persönlichkeitsentfaltung gelangte Heldenschar und schiesst mit einer einzigen Papierkugel die Müheleistung einer Stunde jubelnd über den Haufen, oder er hebt gar das Tischbein auf und freut sich der zusammensinkenden lackierten Reihen.
»Der Künstler darf nicht empfinden« (Th. Mann), der Künstler hat überhaupt den Menschen auszuschalten, wenn er schafft. Solange er noch warm den Menschen hegt, ist er überhaupt gar nicht einmal fähig zu schaffen. Ungesehen vom Künstler aber schattet über sein Werk doch der verstossene Mensch. Und so erklärt sich der Zwiespalt, dass einer als Künstler so grausam sein kann und doch als ein gütiger Mensch wirkt. Es ist ein grober Irrtum anzunehmen, dass der Mensch den Künstler erst auszeichne. Aber es ist ebenso richtig, wie diese Ansicht falsch ist, dass nur ein ganzer Mensch (er mag dabei verkrüppelt sein seelisch und geistig, nur nicht – geleimt ) einen echten Künstler abgibt. So ein ganzer Mensch und mehr: ein warmer Mensch ist Wilhelm Busch. Er hat seine Geschöpfe mit Stift und Feder umgebracht, hat aber gewiss noch niemand willentlich geschadet. Das geht uns freilich gar nichts an. Wir haben hier mit dem »warmen Menschen« Busch, dem Kinder-, Tier- und Sommerfreund durchaus nichts zu tun. Aber das kleine, leise menschliche Glanzlicht sei diesem »literarischen« Portrait behutsam aufgesetzt.
Und menschlich wie der Künstler Busch ist auch sein Werk. Er hat den Menschen, diesem kribbelnden Ameisenhaufen, immer nur belustigt zugesehen. Und allmählich ist ihm unter den Künstlerfingern eine Epopöe der Menschheit, besser der »Menschlichkeit« geraten, die in ihrer Art einzig ist. Schon Kortum, schon Töpfer haben vor ihm die Krone der Schöpfung höchst komisch gefunden. Aber wie eng ist der Bezirk Kortums, wie schematisch, ja abstrakt »literarisch« die Welt Töpfers.
Busch war zeitlebens frei. Keine Veduten der »Gesellschaft« schränkten ihm das Gesichtsfeld ein. Weithin sah er über das buntscheckige Flachland. Er stand höher. Warum er höher stand? Er war gewachsen wie Bäume wachsen, die keine Nachbarn haben. Denn das Nachbartum ist unser aller Übel. Wir haben immer Vorsichten zu üben, Rücksichten zu nehmen, wir geben acht, wohin unser Schatten fällt. Das macht uns so possierlich für den freigewachsenen Busch. Da ist Herr Tobias Knopp. Er isst und trinkt und kränkt sich, dass sein Bauch wächst. Täglich lüftet ihm die »nette, gute Dorothee das Bette«, er aber geht auf die Wanderschaft nach der »Frau«, die er beim Nachbar sieht und also für notwendig befindet. Und er erlebt, ein argloser Reisender, der das Gruseln lernt, die Schicksale der Ehe in lieblichen Ausschnitten aus dem Familienleben, die an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig lassen: Sauerbrod, dem – »heissa!« – seine Frau gestorben ist, die schmutzige Idylle Küster Plünnes, Herr Knarrtje und sein ungetreues Gespons, der »Lebemann« Mücke, Rektor Debisch und sein hoffnungsvoller Sprosse. Entsetzt »begibt sich« Knopp immer wieder »weiter fort«, bis er, der endlich von Enttäuschungen wie verhagelt dasteht, mit eins entdeckt, wo seines Suchens übersehenes Endziel: der Ausgangspunkt, sein Heim und seine gute Dorothee. Und schmunzelnd geht Busch daran, die Ehe des Philisters abzuschildern (»Herr und Frau Knopp«), die kleinbürgerliche Behaglichkeit mit ihren ungefährlichen Dissonanzen und ihrem grössten Ereignisse: dem Erscheinen des Kindes. Ist in diesen beiden Büchern nicht das ganze Leben des Mittelstandes? Da ist der alternde Jüngling, der auch einmal eine Liebe im nunmehr verfetteten Busen trug und sich plötzlich aufmacht, den Hain der goldnen Zeit in hoffnungsbanger Erinnerung zu betreten. Er sieht das Ideal seiner Jugend wieder, und: »Knopp sein Schweiss der tritt zurück.« Die alte Jungfer, diese öde Repertoirnummer der bürgerlichen deutschen Witzblätter, wer hat den Typus – natürlich an der Grenzscheide der Möglichkeit (Gesetz der Karikatur) – sicherer und grausamer fixiert als der Dichter des Knopp? Das Problem der Kindererziehung in zwei Pendants rasch entworfen. Hier Debisch, der den »Hieb« als »oberflächlich« aus seiner Theorie verbannt hat und mit »des Geistes Kraft allein« – einen Bengel und Heuchler zu traitieren vergebliche Versuche unternimmt. Dort Meister Druff, dem Prügel »frisch und kregel« zu erhalten geeignet scheinen und der – ein köstlicher Gedanke – sie »vor der Tat« appliziert, wo sie sich »probat« erweisen, leider wieder nur in seinem von bürgerlichem Erziehungsdoktrinarismus angesäuerten Hirn, denn Franz gewöhnt sich eben daran, die »Tat« der unumgänglichen Einleitung unbedingt folgen zu lassen.
»Zwar man zeuget viele Kinder,
doch man denket nichts dabei.
Und die Kinder werden Sünder,
wenn's den Eltern einerlei.«
Der schlimme Knabe ist Busch ein Lieblingsthema. Es ist aus eigenstem Erleben geschöpft. Das nicht allzu harmlose Motiv hat seine Wurzeln im Allermenschlichsten. Das Kind ist ohne Mitleid. Das Kind empfindet keine Sehnsucht, hegt keine herzliche Trauer. Es ist ein robust auf seine Triebe gestelltes Vernunftwesen, ein arger Rationalist, jeder Romantik von Religion, Ethik, Pietät und »Humanismus« himmelfern.
»Sein Prinzip ist überhaupt:
was beliebt, ist auch erlaubt;
denn der Mensch als Kreatur
hat von Rücksicht keine Spur.«
Es zum Menschen heranbilden, heisst ihm ein menschliches Beispiel geben. Nicht Doktrinen und nicht Hiebe erziehen. Dem angeborenen Nachahmungstalent unauffällig und mit der Anschauungslogik der edel erfreulichen Tatsachenwirkung nachhelfen, ist die einzige grosse pädagogische Urregel. Busch zeigt nur verwahrloste oder verbildete Kinder. In diesen kuriosen und ergötzlichen Buben- und Mädelstreichen liegt eine tiefe Weisheit beschlossen, ein Ergebnis der Einsicht in den Kannibalismus der »Seelenlosen«. Alle die menschenwürdigen Verfeinerungen und Schwächungen der rücksichtslosen Betätigung des Ichtums sind Seelenarbeit. Und es ist Seelenmord in den ungeregelten Praktiken der kleinbürgerlichen Pädagogik. Die Griechen wussten, was sie mit der ästhetischen Arbeit an ihren Jünglings- und Mädchenkörpern taten: sie adelten die Seele durch den Rhythmus. Unsere – der Deutschen – barbarische Zeit aber bildet im besten Falle »gebildete« (?) Büchermenschen.
Dem Künstler Busch liegt natürlich alles Moralisieren fern. Aber die Kunst hat immer den ethischen Gehalt ihrer Ära. Und was kann der Gehalt einer Karikatur des deutschen Kleinbürgertumes der jüngsten Vergangenheit anders sein als die Schmach selbstgefälligen Barbarentums? Nur ein grosser Künstler vermag immer auch zu belehren. Und seine Lehren sind nicht eine gestaltete Formel, sondern er ist wie ein Brunnen, aus dem man reines Wasser schöpft und schöpft, das sich formt je nach dem Schöpfgefäss und aller Formen Möglichkeiten in sich birgt. So sei denn auch diese anscheinend abschweifende, tieftraurige »Kinderlehre« für nicht mehr genommen als ein Beispiel, wie man aus einem grossen Künstler schöpfen kann. Man kommt von ihm in alle Zonen des geistigen Reiches. Die Kugelgestalt unserer Erde ist mehr als eine wissenschaftliche Tatsache, sie ist ein Symbol.

Julchen
»Die Welt ist wie Brei. Zieht man den Löffel heraus, und wär's der grösste, gleich klappt die Geschichte wieder zusammen, als wenn gar nichts passiert wäre.« Wer das wirklich eingesehen hat, der nimmt nichts mehr wichtig, nicht einmal mehr – sich selbst. Und wer sogar sich nicht wichtig nimmt, der darf sich unterstehen, ganz nebenbei dem lieben Publikum mitzuteilen, dass ihm ein »wahrhaft guter Mensch« – im Traume natürlich! – nicht vorgekommen sei. »Alle Menschen, ausgenommen die Damen, spricht der Weise, sind mangelhaft«. Aber – »Entrüstung ist ein erregter Zustand der Seele, der meist dann eintritt, wenn man erwischt wird«. Und
»ein guter Mensch gibt gerne acht,
ob auch der andere was Böses macht.«
Denn:
»ausserdem und anderweitig:
liebt man sich etwa gegenseitig?«
»Ach, meine Lieben, lasset uns mit den Köpfen schütteln!« Und zum Tröste, da es sich ja bekanntlich hier um – einen Traum handelt: »Eine Ausrede zugunsten der eigenen Vortrefflichkeit stellt selbst im Traum sich ein.« Es ist immer dasselbe.
»Vortrefflich! ruft des Dichters Freund;
dasselbe, was der Dichter meint;
und, was er sicher weiss, zu
glauben,
darf sich doch jeder wohl erlauben.«
Wenn man nur will, ist das menschliche Leben eigentlich doch ganz unterhaltlich. Zwar
»ist hinieden
zu vieles viel zu viel verschieden:
der eine fährt Mist, der andere spazieren;
das kann ja zu nichts Gutem führen.«
Aber wenn man sich ein bisschen – leichter macht, kann man's schon aushalten. Und die sich durchaus nicht leichter machen können, aus angeborener Schwerfälligkeit, die schminken und kostümieren sich eben mit erklecklichen Seufzern und spielen im Übrigen genau so das ganze Leben lang – Theater.
Es ist jedoch, da eigentlich nur sehr wenige – zuschauen, ein sonderbares Schauspielhaus. Alles steht gestikulierend auf der Bühne, und im verdunkelten Parkett sitzt manchmal einer, zum Beispiel Wilhelm Busch, und schraubt, da er sich schon längst nicht mehr so recht ärgern kann über Zugluft, Lampengeruch, Instrumentengestimme, den vorlauten Souffleur, schiefstehende Kulissen und asthmatische Romeos, sehr aufgeräumt an seinem Tubus. Zuweilen aber sieht er gar nichts, weil ihm die Träne aus dem Augenwinkel wieder einmal auf das Glas gelaufen ist. Und sonst sah er doch allerlei Hochinteressantes, z. B. »das Gummibändel, womit die Frackschösse aller Dinge hinieden, kein Mensch weiss wie, am Kernpunkte der Erde haften«. »Unbefangen im Bewusstsein seiner sozusagen Nichtweiterbemerkbarkeit«, wechselt Wilhelm der Eroberer seinen Sitz, begibt sich auch unterweilen auf die Bühne selbst, spielt mit, wo Not an Mann ist, aus Gutmütigkeit und einer Art von mitleidiger Verachtung des Komödiantenpacks, das seine Auftritte – jeder natürlich nur den seinen – so hochwichtig nimmt, und sagt »nichts für ungut«, wenn ihm einer mit Nagelschuhen auf ein allzu unvorsichtig hervorlugendes Nervenende tritt. Besonders den hübschen Aktricen geht er gerne etwas näher.
»Jeder schau der Nachbarin
in die Augensterne,
dass er den geheimen Sinn
dieses Lebens lerne.«
»Denn die Summe unseres Lebens
sind die Stunden, wo wir lieben.«
Es ist immer viel zu bald – zu spät dazu. Freilich, – wo hat er doch »beim Scheine der Lampe« jüngst erst ein »altes trauliches Ehepaar« gesehen? »Fast fünfzig Jahre sind's her, dass sie sich liebend verbunden haben. Sie muss niesen. ›War das eine Katze, die da prustet?‹ fragt er. ›War das ein Esel, der da fragt?‹ spricht sie. So soll's sein! Wenn man auch früher verliebt war, das schadet nicht. Wenn man nur später gemütlich wird.«
»Kein Ding« sieht so aus, wie es ist, am wenigsten der Mensch, dieser lederne Sack voller Kniffe und Pfiffe. Und auch abgesehen von den Kapriolen und Masken der Eitelkeit«. Zuschauerresümee. Man gähnt ein wenig und sieht nach der Uhr. Wie lang soll die Komödie noch so fortgehen? Es wird nicht schaden, wenn man ein wenig selbst den Kapellmeister spielt. Die da oben merken's gar nicht. Und man guckt in die wunderlichen Noten, die man ja einigermassen lesen kann. Wozu hätte man denn den berühmten Freiligrathschen »Brand« auf der Stirne?
Der Mensch ist ein Körper mit unzähligen Flächen. In der und jener Beleuchtung spiegelt die eine, ist die andere verschattet. Und während sich die grosse Drehscheibe langsam um ihre Achse dreht, dreht sich auch jedes der angeschraubten Figürchen langsam um die seinige. Die einander jeweils eine Facette zeigen, »beurteilen« einander gegenseitig – je nach der Beleuchtung und dem Grade der Drehung. Man hat auch »ethische« Systeme festgestellt – je nach der Beleuchtung und den Augenblicksverhältnissen des »derzeitigen« Gegenüber. Und es gab immer Narren der »Wahrheit«. Ironikereinsicht, »technisches« Verständnis.

Die Rumpelscene
Aus der »Frommen Helene«
Das Menschliche in seinen Typen notieren, heisst abkürzen. Die Karikatur, nicht nur die zeichnerische, auch die in Worten, kürzt ab, indem sie übertreibt. Sie scheidet Unwesentliches aus und legt den Ton auf das Charakteristische. Sie schildert nicht, sie lässt gleichsam alle Hilfszeitwörter fallen und reiht in Frakturschrift die primitiven Redeteile aneinander. Ihr gelten die Vorsprünge viel, die Schatten werfen. Und so gelangt sie, wenn sie im Material der Worte arbeitet, zu den devisenartigen Lehrsätzen – Beobachterparagraphen, die einen Katechismus des Menschentums ergeben, – die man bei Busch sammeln kann. Indem sie alle Nuancen – die der Kontur entraten können, um geheimnisvoll sicher zu individualisieren und zu verwirren, – unterdrückt, gelangt sie zu vehementen Axiomen einer brutalen Persönlichkeitsphilosophie. Sie kennt keine Modifikationen dieser Ergebnisse, will sie gar nicht kennen. Denn das, was die moderne Schriftstellerei Psychologie nennt, ist ihr ein Hemmnis. Dem Karikaturisten ist nur zu wohl bekannt, dass Nähe nicht Umrisse ergibt. Und er hat sich – für seine Zwecke der spöttischen Mitteilung – damit abgefunden, dass zwei Menschen einander immer wie zwei Erdteile sind: sie kommen nie zusammen, »das Meer liegt dazwischen«. Der Karikaturist sagt: Ich ernenne mich zum Ordner der Erscheinungen. Sie sollen mir gehorchen und sich gruppieren, wie ich sie benötige. Vor allem hübsch im Profil und in meiner vollen Sonne. Ich kann Euch nicht brauchen als Komplexa. Ich muss Euch Euere Körperchen und Seelchen, die angefüllt sind mit tausend aparten Dingen, schon ein bisschen zurechtknacksen. So. Deine Stirnfalten sind gut, aber ich brauche nur drei, nicht dreiunddreissig. Du wirst erlauben, dass ich dafür die drei bis in Dein Gehirn hinein vertiefe. Es macht sich besser. Und das bisschen Fleisch da, das Deine Waden vom Knochen abhebt, streich' ich weg mit einem geschliffenen Worte, denn Du gefällst mir besser, wenn ich Dich ohne dieses zwecklose Portiönchen vor mir habe. »Der Magere.« Ich will. Und so misst er jedem seinen Sprachschatz zu, dem fünfzehn Worte und dem sechzig Silben, und seine »Wissenschaften« und Erfahrungen restringiert er – es ist so nicht viel daran, armer Freund! – auf zwei, drei Telegrammresultate, die er ihm fein säuberlich auf einem schmalen Bandzettel notiert. Den Bandzettel jedoch klemmt er ihm zwischen die Zähne und gibt ihm einen Schlag auf den Kopf, dass sie besser zubeissen.
Vor allem aber bereitet es ihm Spass, immer wieder Reihen aufzustellen. Zum Exempel: Eins, zwei, drei bis sieben. Schluss! Jetzt setzt Euch einer dem andern im Kreise auf die Knie und spielt Isoliertheit. Sonst ist nichts da als Ihr sieben. Und da Ihr so schön im Kreise einer auf des andern Knien sitzt, habt Ihr keinen Anfang und kein Ende – wie die Welt.
Oder er stellt sie nebeneinander und benennt sie, d. h. er nimmt den grossen Pinsel und streicht an. Dich rot und Dich gelb. Und Du bist der Bauer und Du der König. Oder er nimmt sechs gelbe und malt dem einen Kreis auf den Bauch und dem ein Kreuz auf den Rücken, und das bleibt den Akteurs, bis das Spiel zu Ende ist. Und der mit dem Kreuz auf dem Rücken hat das ganze Stück hindurch sich beileibe nicht umzuwenden.
Diese Kreise und Kreuze und diese Farben und Reihen aber – hier setzt das Wesentliche der Unterscheidung ein – sind nicht etwa blosse Willkür, sondern tief hinab leuchtende Erkenntnis, Einsicht mit Wahl, rapider Wahl. Das Kreuz auf dem Rücken ist schon da, eh' der Künstler ihm befiehlt hervorzuleuchten wie ein Brandmal, aber sein Befehl gab ihm die Domination.
Oder die Situation zwingt. Wie beim Kaleidoskop. Eine Anzahl Scherben gerüttelt kompliziert sich durch Spiegelung. Solche Spiegel rüstet der Karikaturist gern um Situationen. Und ist das menschliche Leben nicht solch eine lautlose Spiegelung von Scherben?

Der Liebesbrief
Aus der »Frommen Helene«
Das sind die rein allgemeinen Data der Menschlichkeiten. Wie viele willkürliche aber hat der »freie Wille« des kleinen Gottes der Welt nicht hinzugetan! Alle diese schrecklich lustigen Einrichtungen der notwendigen Nachbarschaft: der Staat und die sonstigen Gruppierungen der Sozietät. Ein Gaudium für den Karikaturisten. Alle diese wunderschönen »Ordnungen«, diese schnurgeraden Wände, hinter denen man schläft und isst und Kinder in die Welt setzt. Obenauf aber liegt ein feiner Deckel. Ein Schieferdach oder ein Ziegeldach oder eine »nationale Kultur«. Es kommt dem Karikaturisten auf eins heraus. Ein bemalter Deckel, federleicht: man kann Scheibenwerfen spielen damit ... Heute ist hier ein sonnenversengter Grasfleck, morgen grundiert man dort ein Haus, und übermorgen wird säuberlich – mit Dietrich und Blendlaterne eingebrochen. »Wenn ich da einbreche,« sagt der philosophische Dieb, »kann ich das ja nur darum, weil man sich halt wieder einmal – separiert hat.« Und der Karikaturist zerschneidet alle diese Ordnungen und Systeme quer durch. Es ist wie in der alten Posse von Nestroy. Rechts das Schlafzimmer der Partei ohne Vorderwand und links das Schlafzimmer des »Aftermieters« ohne Vorderwand. (Beiläufig bemerkt sollte das Theater heute nur mehr »ironisch« in künstlerische Verwendung kommen. Alle »Illusions«anstrengungen (Naturalismus usw.) sind doch eigentlich seinem Wesen zuwiderlaufend, also unvermögend und, ehrlich, ästhetische Bettelsuppe. Eine Presto»entwicklung« seit der »Schaubühne als moralische Anstalt«!) Und das Simultandasein kann losgehen – ohne Vorderwand und possierlich durch die – Scheidewand. Manchmal gefällt es dem Künstler, diese Scheidewand aus Papier herzustellen und die Insassen der beiden »Welten« gegeneinander zu hetzen. Hussa! Sie purzeln durch die papierene Scheidewand. Das könnt Ihr bei mir immer haben, sagt der Künstler, und mehr. Passt auf! und nun arrangiert er – Träume. Jetzt werden wir einmal die Mathematik beleben, diese superkluge, ausschliessliche, souveräne. Warum sollen wir nicht mit Zahlen verkehren? Wir können uns ja so klein machen, dass wir durch eine schön gerundete Null durchschlüpfen. Das kostet gar nichts. Es ist doch eigentlich langweilig in unserer »dimensionalen« Sphäre. Schwingen wir uns ein bisschen höher hinauf in andere Weltgegenden.
Es ist ein grosser Kreis, den die Schöpfung von Wilhelm Busch ausschreitet. Er hat den Zahnschmerz und das Einschlafen bei brennender Kerze, den Sonntagsreiter und den Haarkräusler, den Studenten und den politisierenden Gemeindeältesten, die prüde Gouvernante und den gereizten Elefanten, den verfolgten Frosch und den uralten Knochenstreit der Hunde, den für Publikum und Obrigkeit frömmelnden Kirchgänger und den rettungslos gestörten Badenden ebenso ein für allemal verbucht, wie er die menschlichen Leidenschaften und Irrtümer, das Reifen des Mädchens und das Welken des Greises in unverlierbaren Sätzen aufgefangen hat, er hat die »Weltkugel« auf der Fingerspitze balanciert, ja in die Tiefen des Grenzenlosen gewirbelt Alles ein Spiel. Wäre er nur der lustige Bilderredner gewesen, als den ihn die Menge hegt, hätte man von ihm nichts zu sagen als ein »technisches« Lob. Aber er ist eben viel, viel mehr. Er ist der Repräsentant der Freiheit, als die einigen tief Gläubigen die Kunst erscheint, und er ist so ganz hinter sein Werk zurückgetreten, dass wir das Schauspiel des gewichtlosen Spieles der Kunst, unbeeinträchtigt durch die menschlichen Hintergründe seiner Dichtung, wie in freier Luft betrachten. Wie bei Shakespeare hat man kein ästhetisches Bedürfnis (wenn auch ein persönliches Liebhaberbedürfnis), nach dem Leben dieser genialen Persönlichkeit zu fragen.
Es gibt Dichter, die nur durch ihre Persönlichkeit wirken, im Schatten ihres Menschendaseins für uns erst Konturen gewinnen, die wir nicht müde werden, bis in ihre Täglichkeiten auszuspähen. Sie gelangen zum Allgemeinen nur auf dem Umwege über ihre allerpersönlichsten Erlebnisse. Und sie sind gross, je mehr sich ihnen gerade dieses Individuellste auswächst zur Repräsentanz des menschlich Typischen. Andere aber sind wie das Wasser, das den Himmel und die Bäume spiegelt und sich trinken lässt und in seinen Millionen Tropfen immer dasselbe ist und doch beständig abfliesst. Oder wie ungeheure Spiegel, und hinter den Spiegeln ist nichts als die hölzerne Wand, die sie aufrecht hält. Die Maserung dieser Holzwand interessiert uns nicht, und der vollendetste Spiegel ist eine Quecksilbermasse, die aus unzähligen Atomen besteht. Aber alles, was daran vorbeikommt, ersteht seltsam anders darin und doch sich selbst gleich: wir wenigstens kennen es so und überzeugen uns von der vollkommenen Gleichheit. Das sind die »unpersönlichen« Künstler: Homer, Shakespeare, Cervantes, – Busch. Busch ist keiner von diesen ganz grossen. Das macht, seine Form ist eine – vielleicht mit Unrecht – geringer gewertete Spielart der künstlerischen Ausdrucksmöglichkeiten: der »Spiegel« Busch ist ein Hohlspiegel, aber er ist aus demselben kühl-unbewegten Material wie diese grandiosen prismatisch geschliffenen Spiegel Homer, Shakespeare, Cervantes.

Bürgermeister Mumm
Aus den »Partikularisten«
Kein Mensch – und man kann sich's beruhigt gestehen, dass die Mehrzahl wohl daran ist, – weiss, wie er eigentlich aussieht. Der Spiegel, an den wir so gewöhnt sind, trügt, denn er ist plan und reflektiert nur, fälscht auch die Farben. Ausserdem fälschen wir uns selbst immer ein wenig vor dem Spiegel durch Miene, Distanz und Beleuchtung. Die Photographie zeigt im besten Falle einen der unzähligen Momente, die in ihrer flutenden Gesamtheit unser Wesen ausmachen. Jede künstlerische Wiedergabe aber ist gefärbt vom Temperamente ihres Autors. Wir sind verdammt, von uns selbst ungekannt umherzuwandeln, während jeder Schusterjunge uns darin voraus ist, dass er z. B. sieht und, wenn es ihm gerade Spass macht, sich merken kann, wie wir von rückwärts betrachtet beim Gehen die Füsse heben. Und nicht besser steht es um die Selbsterkenntnis in bezug auf das »Innerliche«. Da fälscht die Eigenliebe oder der – Eigenhass, die Stimmung, in der wir Einkehr halten, die Ereignisse, die an der Oberfläche des tiefen Sees schwimmen, als den man sich die Seele gerne denkt.
Um all diesen Jammer weiss der jeder Eitelkeit bare Busch. Keiner ist berufener als er, ihn auszusprechen. Ist's gefällig, sagt er liebenswürdig, in meine Bude zu treten? Da denn doch alle Spiegel nichts taugen, sind hier diverse Konvex- und Konkavspiegel, ferner Seelenteleskope und dergleichen Allotria. Und innerhalb weniger Minuten kann sich jeder der hochverehrlichen p. t. Anwesenden überzeugen, wie es um ihn bestellt ist, in höchst spasshafter Weise und gänzlich ohne Hintergedanken meinerseits. Und wer's nicht glauben will, der glaube es eben nicht, oder besser, er sei inständigst versichert, dass es ein werter Verwandter ist, näheren oder entfernteren Grades, wie's beliebt. »Zum Gebrauch in der Öffentlichkeit« – sagt er – »habe ich nur Phantasiehanseln genommen. Man kann sie auch besser herrichten nach Bedarf und sie eher sagen und tun lassen, was man will.« Und: »Man sieht die Sach an und schwebt derweil in behaglichem Selbstgefühl über den Leiden der Welt, ja über dem Künstler, der gar so naiv ist.«
» Gar so naiv.« Er muss es ja wissen. Und in gewissem Sinne hat der freundlich Spöttelnde auch wirklich recht. Denn die Naivetät des »objektiven« Künstlers kommt ziemlich der nah, die man (ohne Beigeschmack von Albernheit) im Leben meint, wenn man sie entgegensetzt einer von allerhand Gefühlen, Mit- und Miss-, Neben-, Über- und Untergefühlen, geschwächten Beobachterlinse. Ein Schattenspiel ist dem objektiven Künstler alles Geschehen, Komödie der Fläche und des Lichtes. Das Belustigendste aber sind die hochtrabenden Erläuterungstitel der Ereignisse, und dass alles so hübsch auf unendlichen Bandrollen sich vorwärtsschiebt, gravitätisch wie – Bandrollen. Manchmal aber dreht der unsichtbare Maschinist rascher an der Kurbel, und die Bilder flimmern.
»Eins, zwei, drei im Sauseschritt
läuft die Zeit; wir laufen mit.«
»Und gings auch drüber oder drunter,
wir bleiben unverzagt und munter.
Es ist ja richtig: heut pfeift der Spatz,
und morgen vielleicht schon holt ihn die Katz;
und dennoch lebt und webt das alles
recht gern auf der Kruste des Erdenballes.«
Busch ist beileibe kein Pessimist.
»Was mit dieser Welt gemeint,
scheint mir keine Frage.
Alle sind wir hier vereint
froh beim Festgelage.«

Onkel Nolte
Tiefe Wehmut klingt freilich hinein:
»Halt' dein Rösslein fest im Zügel,
kommst ja doch nicht allzuweit:
hinter jedem neuen Hügel
dehnt sich die Unendlichkeit.«
Resignation ist nicht Weltverneinung. Ohne Resignation ist Humor nicht denkbar. Humoristisch betrachten heisst in Sicherheit betrachten. Und nur Resignation gewährt Sicherheit. Resignation ist nicht Wunschlosigkeit, sondern Bescheidung. Man sagt nicht nein zu der Welt, findet sich nur mit ihr ab. Was nützt das Zerren und Zagen! Stillstehen und zuwarten ist vernünftiger Und wie sich da das Weltbild klärt! Wie sich die Wellen glätten, die man selbst erregt hat durch ungestümes Schaukeln!
»Enthaltsamkeit ist das Vergnügen
an Sachen, welche wir nicht kriegen.«
Lass Dich nicht ein! predigt Busch. Ruhig Blut! »Lust und Leid des Herzens sind schraubenförmige« Bewegung. Such' lieber die Zauberhecke, »wo die abscheulichen Menschen ihre ironischen Gerten schneiden, die immer so hinten herumkommen«.
Sentimentalität aber, diese deutschbürgerliche Nationalkrankheit, ist völlig überflüssig. Drastisch geht er ihr an den verfetteten Leib. »Im wohnlichen Stübchen voll summender Fliegen steht das tätige Mütterlein. Sie sucht Fliegenbeine aus der Butter, die sie demnächst zu kneten gedenkt, denn Reinlichkeit ist die Zierde der Hausfrau.« Ahnt der Schlafrockleser des »humoristischen Hausschatzes«, dass ihm hier einer an die »heiligsten Güter« greift, die selbstgefällige Phrase, die in kilometerhoch aufgeschichteten Goldschnittbänden für »Deutschlands Töchter als Gattin und Mutter« gestapelt prunkt?
Überhaupt, der deutsche Philister! Busch hat ihm ein Piedestal errichtet, in allen Feldern reich mit »Szenen aus dem Familienleben usw.« geschmückt, ein Piedestal, das ihn hochauf und weithin sichtbar ragen lässt. Da steht er, unzählige Falten in der nachlässig geknöpften Weste, die Zipfelmütze über der schwitzenden Platte, Bartstoppeln um salbungtriefende Schmatzlippen, und zwinkert mit tränenfeuchten Schweinsäuglein breitbeinig in die Sonne. Und er weiss nicht, dass seine Tasche »im stillen ein Loch hat«, merkt es nicht, dass ihm einer mit schwippendem Deuterstäbchen die ungeheuren Nasenlöcher kitzelt. Er niest gewaltig, schneuzt sich dröhnend und ist wieder einmal mit sich sehr zufrieden. (Das Vergnügen gerade des »Philisters« an Buschs Schöpfungen ist symptomatisch für jenes Grossprechertum, das »geaichter« – Kontrebande immer gewogen ist, salbadernd Goethe, diesen gefährlichsten Relativisten, predigt und – die »Gartenlaube« meint.)
Aber dieser reiche, fröhliche Künstler Busch ist nicht stehen geblieben in den heiligen Hallen des gebenedeiten Philisteriums, er hat hellhörig-scharfäugig Umschau gehalten auf allen Gebieten menschlicher Tätigkeiten und Faulheiten, jedes Vorurteil, jede »Sitte« hat er aufgespiesst auf seine spitze Nadel, die glatt durchdringt: nur ein winzig kleiner Blutstropfen hängt an ihrem feinen Ende.
Man lasse sie nur einmal gedrängt Revue passieren, diese bewegliche Gesellschaft mit den urdrolligen, vertrauten Eigennamen: Petrine und Pauline, Pater Filucius in der Mitte, Inter-Nazi und Jean Lecaq verdächtig hinterdrein; Knopp im Kranze seiner Abenteuer: Adele, Knarrtje, Debisch senior und junior, Menage Druff, Jochen, Babbelmanns, Haus Plünne, Mücke mit Gemahlin und Kathinka, Sauerbrod und seine Selige, Piepo mit Hilda und Klotilda, Krökel im Fuselglanze; Frau Dorothee mit ihrem wechselnden Gesinde; Julchen, gefolgt von Klingebiel, Mickefett und Sutitt; Balduin Bählamm, Rieke Mistelfink und Krischan Bopp, Doktor Schmurzel; sodann Mutter Köhm, von Meister Böck, Stinkel, Körte, Mumm und Pille flankiert, Knickebieter und Fritze Jost als Nachtrab; Klecksel und seine Tafelrunde: Botel, Quast, Hinterstich und Gnatzel, das Fräulein von der Ach entrüstet im Hintergrunde; Arm in Arm darauf Vater Silen mit Meier, Bunke, Döppe, Zwiel; die Gruppe Jobs; Fipps und seine internationale Besitzerreihe: der Schwarze, Schiffer Schmidt, Krüll, Miecke, Köck, Klöhn, Jette und Elise; die fromme Helene und Onkel Nolte, Vetter Franz, Munzel und Mienzi, Schorsch Schmöck und Jean; Plisch und Plum und ihre Herrn: Schlick, Fittig samt Söhnen, Schmulchen Schiwelbeiner (»schöner ist doch unsereiner«) dazu, endlich Mister Pief; dann Knoll, Hermine, Konrad; Joseph und die »Josepher«; Dr. Alopecius: nur ein Teil ist's dieser unsterblichen Galerie von Dummheit, Übermut, Habsucht, Schlemmerei, Eitelkeit, Heuchlertum, Schmutz, Faulheit, Schwindel, Unzucht, Bosheit, Lüge, Neid, Wahn, Gebreste, Gier, Rachsucht, Rohheit, an der wir schmunzelnd vorüberschlendern, behagliche Geniesser einer wahrhaft infernalischen Tragikomödie unseres Erdenwandels.
Der Werke von Busch sind mehr, als bekannt scheint. Den meisten ist er der Dichter von »Max und Moriz« (1858) und »Hans Huckebein« (1871); die »Abenteuer eines Junggesellen« und »Die fromme Helene« (beide 1871) sind zunächst beliebt, auch »Herr und Frau Knopp« und »Julchen«, »Der Geburtstag«, »Fips der Affe« und die Jesuitensatire »Pater Filucius«(aus der Zeit des Kulturkampfes) werden immer wieder begehrt. Der mehr als kühne »heilige Antonius«, »Plisch und Plum«, die »Haarbeutel«, die »Bilder zur Jobsiade«, »Dideldum« und »Maler Klecksel« sowie »Der verhinderte Dichter Balduin Bählamm« folgen. Aber ein so köstliches Werk wie »Eduards Traum« ist wohl hauptsächlich ob des Mangels der gewohnten Bilder dem grossen Publikum verhältnismässig fremd geblieben. »Kritik des Herzens« (1871) und »Zu guter Letzt« (1904) vereinigen Fabeln und Spruchsachen, niedliche Genrebildchen und kleine Reimscherze, die sich mit wenigen Ausnahmen nicht über die harmlose Natur des in den »Fliegenden« angestammten gut deutsch-bürgerlichen Familientisch-Humors erheben. Es sind reinliche Schnitzel und Späne, nett gelockt und artig sortiert. Manchmal blitzt ein funkelnder Gedanke auf, reinen Feuers wie ein Diamant. Aber das, was Busch hier bietet, ist vor allem der Form nach das Scherz- und Ernstgedicht der braven Konvention. Den grossen Busch darf man in diesen – einmal wohl zu Vorteil energischer Auslese zu unterwerfenden – Bagatellen nicht suchen. Es ist ganz merkwürdig, wie einer so gleichsam neben sich selbst hergehen kann, und oft in den tiefsten Gleisen der lyrischen Epigonen-Fahrstrasse, vor allem den breiten Tapfen Heinrich Heines folgend (zumal wenn er ein wenig sentimental wird).
Der – schwache – »Schmetterling« und »Eduards Traum« sind nach den »Simultan«kunstwerken des sogenannten »humoristischen Hausschatzes« – eine nicht sehr geschmackvolle Vertriebsprägung – und den zwei Bändchen diverser Nebenbeilyrik eine dritte Kategorie, deren Ausläufern man heute in den burlesken Clownerien eines Scheerbart etwa begegnet. Aber die von Busch in seinen Hauptwerken angeschlagene Note hat sich trotz allerlei forciertem Getaste keinem mehr als legitimiertem Erben ergeben. Man denke nur an das Elend unserer neuen humoristischen Kinderbücher, den vielgerühmten »Fitzebutze« nicht unbedingt ausgenommen. Es ist eine durch den Erfolg widerlegte Misstrauensfrage, ob die Bilderbücher von Busch »pädagogisch« verwertbar seien. Sie sind der Phantasie des Kindes – all ihrer »sittlichen« Greuel ungeachtet – nichts weniger als gefährlich, seiner ästhetischen Erziehung nicht hinderlich. Das Kind verlangt Ungeheuerliches. Lebt es doch selbst in beständigen Übertreibungen. Eine sittsam ruhende Kuh, ein artiger Pudel: sobald der Anschauungsunterricht überschritten ist, langweilen sie unfehlbar. Busch bringt Aktion, bunte, wirbelnde Geschehnisse. Er ist vertraut mit den Abenteuern der Kinderwünsche. Soldatenspiel, Drachensteigen, Wannenbäder, Eislaufen, Eselreiten, Schlittenfahren: an diese mehr oder minder verstatteten Belustigungen knüpft er seine einfachen Anekdoten. Nur der »Struwwelpeter« – in Vers und Bild künstlerisch tief unter dem Niveau der Bilderpossen und -bogen – hat seither Bürgerrecht in der Kinderstube erworben. Fast alles andere ist (dem Alter von 3 bis 7 Jahren) in überhasteter und unberatener Produktion aufgenötigt worden. Geschmack und Takt – was für Faktoren zur Bildung der Kinderseele! – sind diesen Darbietungen nicht zu Paten gestanden. In Busch aber ist das wundervolle Schauspiel eines Künstlers gewährt, der von der frühesten Jugend bis ins höchste Alter begleitet, nie veraltend, immer packend, unausschöpfbar.

Wilhelm Busch im 70. Lebensjahr
Alle grosse Kunst ist in ihren Umrissen einfach. In den Perspektiven, den Schächten und Horizonten offenbart sich ihre Weite und Tiefe. Jedes Wort, das ein grosser Künstler zum ersten Male wieder verwendet, erfüllt er mit dem ungeheuren Gehalte seines einzigen Ichs. So wie er es stellt und an andere reiht, ist es sofort eine Macht, die aus sich selbst lebt und schafft. Herr ist der Künstler über alle Möglichkeiten dieser wahrhaft schöpferischen Beseelung.
Speziell der Humorist aber hat das Vorrecht der Zickzackschneidekunst an venerablen Gebilden des Sprachschatzes. Was für drollige Worte hat uns Busch gegeben! Da spricht er von einem »mütterlich kindischen Stoppeldeutsch«, vom »Nöckergreis«, dem »innern Durchgangsverkehr«. Ein ganzes Kapitel in der Psycho-Physiologie der Busch-Sprache gebührte den tonmalenden Ausrufsilben. Da gibt es: »Wums; hulterpulter; klacks (»da stecken sie im Drecke«); rums (»der Franz entfernt die Bank«); ratsch (»man zieht den Vorhang zu«); bratsch; knubbs; schwapp; klabum; perdatsch; kracks; autsch; schlupp (»ist man zur Welt gebracht«); schnupp; knipp (»am Ohre hat sie ihn«); schnarräng; wutschi; ruff; rabs; puff; schnupdiwup; pist; pitsch (»er löscht das Licht« – mit dem Finger); hubs; plum; phütt; radatsch; wumm; jam; plemm; zupp; schnatterratt; kiewiecks; schluppdiwutsch.« Er prägt Ausdrücke wie: »Wehmüteln, krimmeln, schruppen, pendulieren, zermatschen, witschen, mümmeln, Schniepel, dämeln, krispelig, klispern, knurschen und knatschen, die Augen vergrellen, Potzwundersatz, sich verdünnern«. Dann die originellen Wortkopulierungen, mit obrigkeitlicher Sicherheit und gleichsam unwiderruflich vorgenommen, wie »Speiseschlauch«, der »pure Kopf«, »Bettgehäuse«. Die Bilder! Knopp » strömt wohl verdeckt« (mit der »Times«) aus der Klause (»stillberühmt im ganzen Hause«), wo er nächtlicherweile eingenickt ist.
»Knopp ist etwas schwach im Schenkel,
drum so führt man ihn
am Henkel.«
Wie der Hammerschlag, mit dem Kasperle den »Juden« tötet, als ob das gar nichts weiter bedeutete, sind diese Verse (es ist vom Dichter Bählamm die Rede):
»Er möchte dichten, möchte singen,
er möchte was zuwege bringen
zur Freude sich und jedermannes;
er fühlt, er muss,
und also kann es.«
Wie er in Ehren ergraute Redewendungen verhöhnt, dass sie gleichsam nurmehr schauernd ihr elendes Dasein weiter fristen:
»morgen wird das Fleisch getötet«.
Und diese wundervolle Elastizität und Gewandtheit der Sprache, dieses Genie der Belebung des Leblosen. Seine »Knüttelverse« sind von einer wahrhaftig organischen Musik, die alle Schrauben und Räderchen der »gebundenen Rede« vergessen macht. Und wie er den gravitätischen Satzbau aufscheucht, dass er Flügel bekommt und stürmt:
Ȁngstlich schnelle, laut und helle
schwingt sie in der Hand die Schelle;«
oder die unwillig holpernden Worte wie mit Stockstreichen vorwärts treibt:
»... Welche hochheilig und teuer versprochen,
stets fleissig zu putzen, beten, backen und kochen!«
Wie er die Behendigkeit des Affen in die Verse bringt:
»Wenn wo was los, er darf nicht fehlen;
was ihm beliebt, das muss er stehlen;
wenn wer was macht, er macht es nach.«
Der Frosch »schlupft und hupft im Grün herum«.
Oder die köstliche Beschreibung des primitiven Affenfängers (drei leere Kürbishüllen):
»Für auf den Kopf die grosse eine,
für an die Hände noch zwei kleine.«
Die Wallfahrer » kommen jetzt erst angebetet«.
Und der gewichtlose Wechsel des Rhythmus, der Situationen solid basiert, Bewegungen versinnlicht (»eingeklemmt und abgeklappt«; man sägt »ritze ratze! voller Tücke | in die Brücke eine Lücke«; »rickeracke! rickeracke! | geht die Mühle mit Geknacke«), Gedanken tropfenweise fallen lässt.
Wenn es das Wesen des Rhythmus ist, dass er die – auch lautlos vernehmbare – Musik eines Vorganges, einer Stimmung, einer Erscheinung atmet, dann hat Busch, der bescheiden sagt: »Gut schien mir oft der Trochäus für biederes Reden,« wie nicht bald ein Dichter deutscher Zunge sein Gesetz in seine Natur aufgenommen. Immer ist sein souveräner Rhythmus der jetzt und hier allein richtige, kein Kleid, sondern eine Haut, kein Anstrich, sondern ein Pigment, federnd wie aus biegsamem Stahl, straff, schlank, wie eine gute Klinge läutend.

Wilhelm Busch vor seinem Alterswohnsitz in Mechtshausen bei Seesen
Prüft man Buschs berühmte Manier auf ihre inneren Wirkungsgründe, lautet das Ergebnis überraschenderweise: er macht sich eigentlich durchaus über die Grammatik lustig, indem er ihre umständliche Schwerfälligkeit unterstreicht, in weiterem Sinne über das Elend der Worte, dieser kläglichen Vorläufigkeiten, bei denen sich unsere Gottähnlichkeit so genügsam beruhigt hat. Sehen wir diese unverwüstlichen Verse näher an, fällt uns mancherlei auf. Zunächst die Gravität des Banalen (banaler Vorgang: stampfende Gravität der Worte und des Satzbaues):
»Gleichwie die brave Bauernmutter,
tagtäglich macht sie frische Butter.
So auch der Dichter ...«; verblüffende Verbindungen:
»Greten nagt die scharfe Säure
ihre Mädchenseele ab.«
»Oh, wie lieblich sind die
Schuhe
demutsvoller Seelenruhe!!«
»Erst nur
flüchtig und civil,
dann mit Andacht und Gefühl« (Eheschliessung).
»Ja, was irgend schön und lieblich,
segensreich und landesüblich . . .«;
unerwartete Reime; possierliches Enjambement (der Satzsinn schwingt sich um den Reim wie um eine festgerammte Säule herum in die nächste Zeile); unmässig betonte »tonlose« Verba. Noch einige Beispiele mögen das erhärten: Fritze Jost trägt (»Der Geburtstag«) den Korb, wohlgefüllt mit einer Kollektion »Busenfreund«; er kostet so lange, bis eine Flasche geleert ist. Nun heisst es:
»Zum Schlusse
sieht er sich genötigt,
hinwegzuschaffen, was
erledigt.«
Gänse und Schweine trinken aus der Pfütze, in die der Inhalt des verunglückten Korbes geflossen ist. »Die Gänse wackeln schon bereits.« Und:
»Viel Kurzweil treibt man
anderweitig,
sowohl allein
wie gegenseitig.«
»Mit Ruh und Würde und
zuletzt
hat Körte sich hineingesetzt.«
Lehrer Bötel (»Maler Klecksel«) erblickt sein Porträt, von Kuno kühn auf die Tafel gekreidet. Er
»schleicht sich herzu in
Zornerregung,
und unter
heftiger Bewegung
wird das Gemälde ausgeputzt.
Der Künstler wird als Schwamm benutzt.«
Und ein aus der Überfülle stracks herausgegriffenes Beispiel für das »Enjambement«, mit der Aug' und Ohr herrisch aufgenötigten lächerlichen Betonung:
»Das Fräulein freilich, mit erboster
Entsagung, ging vorlängst ins Kloster.«
Sich lustig machen über die eigene Schwerfälligkeit ist speziell niederdeutsch. Etwas von Brouwer, Ostade und Teniers ist in Busch. Dort und bei dem älteren Breughel ist seiner Ahnen behäbige Heimat. Busch ist ein durchaus nationaler Künstler. Es ist vergeblich, ihn dem Auslande mitzuteilen. In dieser geographisch-ethnographischen Beschränktheit seiner Wirksamkeit liegt ihre lokale Intensität.
Sein soziales Kulturniveau ist das des deutschen Liberalismus. So erscheint seine Polemik historisch befangen, sein bürgerlicher Horizont von massigen Hügeln umzirkt. Aber wie in Raabes und Stifters stillen Geschichten die tiefhängende Atmosphäre des Kleinstädters webt, die sie dem Mittelstande vertraut macht, und doch die ganz grosse Kunst, die von Ewigkeit zu Ewigkeit ihren Regenbogen spannt, traumhaft geheimnisvoll atmet, so lässt dieser behagliche Einsiedler hinter den wimmelnden Silhouetten einer spiessbürgerlichen Sphäre den lichtgesättigt leuchtenden Hintergrund sich vertiefen, der aus der Seele eines Begnadeten in mystischer Bläue flutet, wie das alltäglichste Wort des bedeutenden Menschen in den goldigen Dunstkreis der grossen Ferne gehüllt ist. Es ist das wahrhaft Dichterische, hier bei Busch noch verstärkt durch das eminent Zeichnerische eines also durch und durch künstlerischen Ingeniums, das diese Wirkung unfehlbar hervorbringt, ebenso unfehlbar wie andere, scheinbar mit denselben Mitteln, nur an der Oberfläche der Dinge hinstreifen mit matteren und matteren Flügelschlägen.

Ein an Richard Schaukal, auf seine das Ersuchen des Herausgebers wiederholende Bitte um einiges Material, gerichtetes Absageschreiben Buschs.
Das ist das übernatürliche Geheimnis des geborenen Künstlertums, dass es immer und auf allen Wegen uns über seine nächsten Ziele hinaus- und hinaufhebt. Mit den beschränkten Worten eines menschlichen Idioms, in den Schranken einer konventionellen Mitteilung schafft es magische Spiegel des Übersinnlichen. Etwas klingt in seinen Emanationen, das mit dem bleichen Licht der Sterne und dem berauschenden Dufte eines besäeten Feldes im Frühling und dem Glanze in dem Auge einer über ihre erste Wiege gebeugten Mutter gleichen Ursprung hat: das Göttliche.
Max und Moritz — 1865
Schnaken und Schnurren — 1867
Schnurrdiburr — 1869
Der heilige Antonius — 1870
Kritik des Herzens — 1871
Fromme Helene — 1872
Hans Huckebein — 1872
Kunterbunt — 1872
Die Müllerstochter — 1872
Bilder zur Jobsiade — 1874
50 Bilderbogen — 1875
Dideldum — 1875
Pater Filucius — 1875
Abenteuer eines Junggesellen — 1876
Der Geburtstag — 1876
Julchen — 1877
Herr und Frau Knopp — 1877
Die Haarbeutel — 1878
Fipps der Affe — 1879
Bilderpossen — 1880
Der Fuchs und die Drachen — 1881
Plisch und Plum — 1882
Balduin Bählamm — 1881
Stippstörchen — 1882
Maler Klecksel — 1883
Busch-Album — 1884
Eduards Traum — 1891
Der Schmetterling — 1895
Zu guter Letzt — 1904
