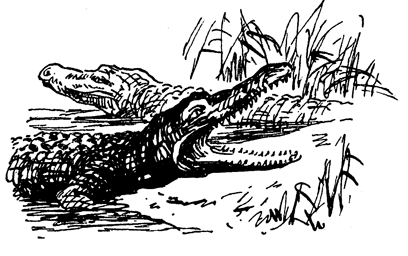|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Auf Barbados – Tobago, die Insel des Robinson Crusoe – Ankunft in Port of Spain auf Trinidad – Das Naturwunder des Asphaltsees von La Brea – Eine plötzlich neu entstandene Insel – Schlammvulkane – Im Urwald von Trinidad – Von einem Alligator überfallen
Der Inselbogen der Kleinen Antillen, in dessen Mitte Martinique liegt, stellt die östliche Begrenzung des Karibischen Meeres gegen den Atlantischen Ozean dar. Die südlichste und zugleich größte Insel der Kleinen Antillen ist Trinidad, dicht vor der Küste von Venezuela gelegen, dort wo sich der Orinoko, mit zahlreichen Mündungsarmen ein ungeheures Delta bildend, ins Meer ergießt. So nah liegt Trinidad am Festland, daß es weniger den Eindruck einer von Anfang an selbständigen Insel, als vielmehr den eines abgerissenen Zipfels des südamerikanischen Kontinents macht.
Auf der Landkarte sehen diese Inseln ziemlich unbedeutend aus, aber wegen ihrer Fruchtbarkeit und Ergiebigkeit an Bodenschätzen sind sie keineswegs unwichtig. Die südlichste Gruppe der Kleinen Antillen gehört den Engländern. Neben Trinidad kommt hauptsächlich das zwar nur kleine, aber ungemein fruchtbare Barbados in Betracht, weiter St. Vincent, Grenada, Santa Lucia, Tobago und eine Anzahl minder bedeutender Inselchen. Es herrscht auf allen Inseln echtes Tropenklima mit einer das ganze Jahr hindurch ziemlich gleichmäßigen Temperatur von 22-30 Grad. Die Regenzeit dauert im allgemeinen von April bis Oktober, unterliegt aber auf den verschiedenen Inseln starken Abweichungen. Oft treten die Regengüsse mit einer Heftigkeit auf, die auf Erden nicht ihresgleichen hat, man hat an einzelnen Punkten der Inseln eine Regenwasserhöhe von 130 cm in vierundzwanzig Stunden festgestellt. In den letzten Monaten der Regenzeit, von August bis Oktober, wüten nicht selten auch furchtbare Wirbelstürme, die umfangreiche Verwüstungen zur Folge haben. Die große Feuchtigkeit der Regenzeit ist es hauptsächlich, die den dauernden Aufenthalt auf den Antillen für Europäer so ungesund macht.
Nachdem unser Dampfer Martinique verlassen hatte, lief er am nächsten Tage Bridgetown, die Hauptstadt von Barbados, an.
Barbados, die östlichste, am weitesten in den Atlantischen Ozean hinausgeschobene Antilleninsel, wurde 1519 von portugiesischen Seefahrern entdeckt und ist seit 1605 in englischem Besitz. Die kleine, nur 430 qkm große, ziemlich flache Insel gehört zu den dichtest bevölkerten Ländern der Erde, denn es leben auf ihr rund 200 000 Menschen, zu neun Zehnteln Farbige. Es ist die am fleißigsten angebaute und verhältnismäßig auch ergiebigste Insel der Antillen. An erster Stelle steht das Zuckerrohr. Fast zwei Drittel der Oberfläche des Bodens sind mit Zuckerrohr bepflanzt, das in 500 Zuckerfabriken und 125 Rumbrennereien an Ort und Stelle verarbeitet wird. Das Klima ist sehr heiß, und die Ernte häufig durch Dürre gefährdet.
Eine so stark bevölkerte Insel, auf der man jedes nur irgendwie geeignete Fleckchen Erde ausnützt, hat dem Freunde urwüchsiger Naturbilder nicht viel zu bieten. Bridgetown, mit 25 000 Einwohnern der einzige größere Ort, ist eine freundliche Stadt von echt westindischem Gepräge mit regelmäßigen, sauberen Hauptstraßen, prächtigen Villen und Gärten der Kolonisten, unter denen es sehr reiche Leute gibt, und dem üblichen malerischen Negergassenlabyrinth an der Peripherie. Während der Dampfer sein Ladegeschäft besorgte, benützten wir die Zeit, um mit der kleinen, ins Innere der Insel führenden Eisenbahn einen Ausflug zu machen. Aber für neue »Entdeckungen« ist Barbados nicht der geeignete Platz. Außer hübschen, freundlichen Landschaftsbildern gab es nicht viel Bemerkenswertes zu sehen; Zuckerrohrfelder und immer wieder Zuckerrohr, Zuckerfabriken und Dorf an Dorf, und überall Neger und bunt gekleidete Negerinnen, geschwätzig und munter, das ist die Signatur von Barbados.
Wir lichteten abends in Bridgetown den Anker, um nun die letzte Strecke unserer Reise mit der »Undine« zurückzulegen, und kamen gegen Mittag des nächsten Tages nahe an der Küste von Tobago vorbei, einer bei Trinidad gelegenen kleineren Insel. Voll Interesse blickten wir nach dem aus vulkanischem Gestein aufgebauten, dicht bewaldeten und gebirgigen Tobago, ist sie doch der Schauplatz einer Begebenheit, der wir eines der spannendsten Bücher der Weltliteratur, zugleich das (nächst der Bibel) meistverbreitete Buch der Weltliteratur zu verdanken haben. Tobago ist nämlich die echte Insel des Robinson Crusoe, auf ihr spielten sich die Ereignisse ab, die Daniel Defoe in seinem berühmten, 1719 in London erschienenen Roman: »Das Leben und die überraschend seltsamen Abenteuer Robinson Crusoes« dichterisch verwertet hat. Defoes Buch, schon gleich bei seinem ersten Erscheinen vom Publikum förmlich verschlungen, hat in den 200 Jahren in massenhaften Übersetzungen, Bearbeitungen und Nachahmungen seinen Weg über die ganze Welt genommen, in Deutschland ist es am bekanntesten in Campes pädagogischer Umgestaltung unter dem Titel »Robinson der Jüngere«. Wieviel unzählige Tausende von Kindern hat nicht der ewig junge, unsterbliche Robinson gepackt und entzückt!
Da Defoes Original-Robinson in Deutschland wenig gelesen wird, Campes Robinson aber den Schauplatz der Robinsonade ziemlich unbestimmt läßt, ist es bei uns nicht allgemein bekannt, wo die echte Robinsoninsel liegt. Es wird immer die im Stillen Ozean gelegene, zu Chile gehörige kleine Insel Juan Fernandez als Robinsoninsel bezeichnet. Ganz unrichtig ist das auch nicht, denn es gibt eben zwei Robinsoninseln, eine echte und eine minder echte, und damit verhält es sich folgendermaßen. Der eigentliche Robinson Crusoe (die Gestalt ist von Defoe nicht gänzlich erfunden, sondern nur dichterisch frei behandelt) hat seine Abenteuer auf Tobago erlebt. Ein anderer Seemann, der Schotte Selkirk, hatte Erlebnisse ähnlicher Art auf der Insel Juan Fernandez, wohin er verschlagen wurde. Defoe aber verschmolz in seinem Roman beide Gestalten, den Crusoe und den Selkirk, zu einer Persönlichkeit unter dem Namen Robinson Crusoe. Darüber, daß Defoe als Schauplatz der Handlung nicht Juan Fernandez, sondern Tobago im Sinn hatte, kann kein Zweifel bestehen, obwohl er den Namen Tobago nicht erwähnt, sondern die Insel unbenannt läßt. Nach seiner Erzählung tritt Robinson Crusoe die verhängnisvolle Reise, auf der er Schiffbruch erleidet, von Brasilien aus an. Er gelangt in die Gegend der Orinokomündung, weiter ins Gebiet der »Englischen Inseln« (womit die Kleinen Antillen gemeint sind) und wird dort, nachdem das Schiff im Sturm untergegangen und die ganze Besatzung außer ihm ertrunken ist, an den Strand einer Insel gespült. Der Wilde, den er dort antraf und Freitag taufte, war ein karibischer Indianer. Im weiteren Verlaufe der Erzählung wird ausdrücklich gesagt, daß die große Insel, die Robinson von den Bergen seiner Insel aus sah, Trinidad war. Da es nun bei Trinidad gar keine andere Insel als Tobago gibt, kann Defoe nur dieses als Robinsoninsel im Sinn gehabt haben.
Übrigens hat Tobago für uns Deutsche auch deshalb Interesse, weil hier in alten Zeiten der einzige Versuch zur Begründung einer deutschen Kolonie in Westindien gemacht worden ist. Im Jahre 1642 hat hier ein Herzog von Kurland baltische Kolonisten angesiedelt, aber diese wurden schon 1658 wieder von den Holländern verjagt. Der Name Kurlandbai an der Nordküste Tobagos erinnert noch heute an diese baltisch-deutsche Siedelung.
Bald nachdem wir Tobago passiert hatten, tauchte die Nordküste Trinidads auf, und wir sahen mit Spannung dem Endziel unserer Reise entgegen. Hatte uns doch Don Alberto, der die Insel in allen Teilen kannte, viel Erstaunliches von ihr erzählt. »Trinidad«, so hatte er gesagt, »ist die Insel der Wunder. Es gibt dort einen Asphaltsee, Ströme von Teer, Austern, die auf Bäumen wachsen, ein Tier, das wie ein Fisch aussieht und lebendige Junge zur Welt bringt, Riesenkrabben, die auf die Palmen klettern und dort mit ihren scharfen Scheren die härtesten Kokosnüsse knacken, einen anderen Fisch, der trompetenartige Töne von sich gibt, und noch einen anderen, den Cascadura, der wie ein Ritter gepanzert ist. Dann gibt es dort die seltsamsten Vögel, Vögel mit prächtigem Federkleid, wie zum Beispiel den Campanero, dessen Ruf wie Glockenton klingt, ferner finden Sie dort den heulenden roten Affen und einen großen Ameisenbär, der mit seinen mächtigen Klauen die mutigsten Hunde in die Flucht jagt.« Übrigens hatte Don Alberto nicht im geringsten aufgeschnitten, denn alle von ihm genannten Wunderdinge und Wundertiere gibt es auf Trinidad in der Tat.

Vom Asphaltsee in Trinidad:
Abhauen des festgeronnenen Asphalts
Es versteht sich von selbst, daß dieses interessante Land, wie so ziemlich alles Begehrenswerte auf Erden, den Engländern gehört. Als südlichste der Antilleninseln, wie schon erwähnt, dicht vor dem Mündungsdelta des Orinoko gelegen und etwa fünfmal so groß wie Rügen, galt Trinidad in altspanischer Zeit für das geheimnisvolle Dorado, das Land der unermeßlichen goldenen Schätze. Die heutigen 300 000 Bewohner der Insel sind mit Ausnahme von ein paar Tausend spanischen Abkömmlingen, Chinesen und Europäern zu zwei Dritteln Neger und zu einem Drittel ostindische Hindus, die man hier, in noch größerem Maßstabe als auf Jamaika, im Laufe der letzten achtzig Jahre als Landarbeiter eingeführt hat. Noch heute ist ein beträchtlicher Teil der Insel von kaum erforschten Urwäldern bedeckt.
Ein unerträglich schwüler Tag ging zur Rüste, als unser Schiff vor Port of Spain, der Hauptstadt und dem einzigen bedeutenden Platze Trinidads, vor Anker ging. Die Landungsverhältnisse sind wegen der gefährlichen Korallenbänke schwierig, und es war deshalb schon recht spät geworden, als uns nach herzlichem Abschied von Kapitän Settekorn und seinem braven »Tramp« das Boot am Bollwerk absetzte. Es ist von eigentümlich abenteuerlichem Reiz, eine exotische Stadt zum erstenmal zur Nachtzeit zu betreten. Die Dunkelheit hüllt Menschen und Dinge in geheimnisvolle Schleier, und der Geist nimmt in solchen Stunden gesteigerter Empfänglichkeit sehr viel nachhaltigere Eindrücke auf. Natürlich lag die solide Bevölkerung von Port of Spain schon längst unter ihren Moskitonetzen im Schlummer, die minder soliden farbigen Herrschaften erfüllten die unsauberen Schankwirtschaften des Hafenviertels mit den Ausbrüchen ihrer ungezügelten munteren Laune. Auf dem Wege zu unserem Hotel hatten wir Gelegenheit, ein phantastisches Nachtbild zu sehen: schwarze Heilsarmeesoldaten veranstalteten einen großen Umzug, und bei loderndem Fackelschein, bei schmetternder Musik mit Pauken und Trompeten und näselndem Gesang hob ein Springen und Tanzen an, wie bei einer öffentlichen Lustbarkeit. So äußert sich die Religiosität der Nigger.
Am nächsten Tage konnten wir Port of Spain nach allen Richtungen durchstreifen und in aller Muße genießen.
Wer unbeschwerten Gemüts an einem Tage der schönsten Jahreszeit Trinidads Hauptstadt betritt, dem mag sie als einer der heitersten Plätze des Erdenrunds erscheinen. Wenn er in seinem blendend weißen Tropenanzug, von keiner anderen Bürde als einem gut gefüllten Geldbeutel bedrückt und allenfalls mit einem Stöckchen bewaffnet, seinen Fuß auf das Pflaster von Port of Spain setzt, umgibt ihn das farbenfrohe Gewimmel einer von weißen, schwarzen, braunen, gelben Menschen bewohnten kleinen Kosmopolis. Gut asphaltierte, schnurgerade Straßen, hier und dort von Alleen mit fremdartigen Bäumen gekreuzt, durchziehen die weitläufig angelegte, luftig gebaute Stadt. Die Häuser sind, wie überall in Westindien, ziemlich niedrig, zumeist nur einstöckig, halb aus Stein und halb aus Holz gebaut und mit breiten Altanen versehen, deren weit vorspringendes Dach die Aufgabe hat, die Sonnenstrahlen von der Hauswand abzuhalten. Denn die Sonne meint es gut auf dieser Insel, fast zu gut. Mit Ausnahme der schwersten Regentage in der Regenzeit brennt sie das ganze Jahr hindurch mit ungeminderter Glut herab. Hier gibt es keinen Wechsel von Wärme und Kälte, von Entfaltung und Erstarrung wie in den nordischen Zonen, kein Winter hüllt die Natur in ein weißes Sterbegewand, kein Frühling weckt neue Keime, neue Hoffnungen, kein rauher Herbsttag erzählt von der herben Notwendigkeit des Verwelkens und Scheidens. Es ist ewig Sommer, ununterbrochen reift die Frucht, ohne Unterlaß schüttet hier Mutter Erde ihr unermeßliches Füllhorn des Segens aus.
Unmittelbar an den Hafen von Port of Spain grenzt die Geschäftsstadt mir ihren »Stores«, den Warenhäusern, und den kaufmännischen Kontoren. In den Morgenstunden, wenn die Luft noch verhältnismäßig frisch ist, geht es hier laut und lebhaft zu. Von den 60 000 Einwohnern der Stadt besteht der weitaus größte Teil aus Negern und Mulatten. In weißen, gebauschten Kattunröcken, fabelhafte Hüte auf dem wollhaarigen Kopf, geht da die farbige Weiblichkeit ihren Besorgungen nach, dabei immer Zeit findend, nach Herzenslust zu schwatzen und zu lachen. Neger haben niemals Eile, die Arbeitshast ihrer weißen Brüder ist ihnen fremd. In Gruppen vereinigt – denn sie lieben die Geselligkeit –, lassen sich die Männer an irgendeinem schattigen Plätzchen nieder, mit irgendeinem kleinen Handel beschäftigt, der zu unendlichen Zungenschlachten Veranlassung gibt. Umherziehende Handwerker erledigen die ihnen überwiesenen Aufträge, wie Stiefel- und Kleiderausbessern, Topfflicken und dergleichen, gleich vor dem Hause des Kunden auf der Straße. »Fliegende« Köche eröffnen an einer Ecke einen kleinen Küchenbetrieb und stellen auf winzigen Herden Leckerbissen her, die dem Europäer nicht sehr appetitlich vorkommen, die aber von der minder anspruchsvollen Bevölkerung an Ort und Stelle mit Behagen verspeist werden. Frauen tragen – und zwar, wie überall in Westindien, stets auf dem Kopf – Körbe mit wundervollen Früchten, Ananas, Bananen, Melonen und die saftige »grapefruit«, ein Mittelding zwischen Zitrone und Orange; sie finden dafür überall Liebhaber, sind diese Früchte doch in dem überreich damit gesegneten Lande sehr billig.
Bei der landeinwärts gelegenen Savanna, einer prächtigen Parkanlage mit Rasenflächen und Spielplätzen, geht die Innenstadt von Port of Spain in die vornehm stille Gartenstadt über, das Wohnquartier der begüterten Handelswelt. Beneidenswerte Besitzungen gibt es hier an den von mächtigen Königspalmen eingerahmten Alleen, schöne Villen, mit allen Bequemlichkeiten eingerichtet, wie verwöhnte Menschen sie lieben. Weiterhin folgt dann der berühmte Botanische Garten, eine der größten und bestgepflegten Anlagen ihrer Art, mit einer unermeßlichen Fülle seltener Pflanzen.
Jenseits der Savanna zieht sich am bewaldeten Strande die sogenannte »Kulistadt« hin, die höchst idyllische Ansiedlung der ostindischen Hindus von Port of Spain, die alle Gewohnheiten der fernen Heimat, ihren religiösen Kultus und ihr Familienleben hierher verpflanzt haben und treu bewahren. Neger und Hindus machen aus ihrer gegenseitigen äußersten Geringschätzung kein Hehl. Es versteht sich von selbst, daß der dünkelhafte faule Nigger ebenso wie der degenerierte Spaniole die ostindischen Kulis für maßlos dumm hält, weil diese Leute anscheinend noch nie etwas von der goldenen Lebensregel gehört haben: »Ein bißchen Beschäftigung ist ja ganz nett, aber sie darf nicht in Arbeit ausarten.«
Am nächsten Tage machten wir mit einem kleinen Küstendampfer einen Ausflug nach La Brea auf dem Südwestzipfel der Insel, um eine der größten Merkwürdigkeiten von Trinidad, den Asphaltsee, kennenzulernen. Nach mehrstündiger Fahrt durch den Golf von Para, der sich wie ein großes Binnengewässer zwischen den tief eingebuchteten Küsten von Trinidad und Venezuela ausdehnt, kamen wir vor La Brea an und gingen in einem Boot an Land. Der erste Eindruck war überraschend, doch nicht erhebend. Im Gegensatz zu der überschwenglichen Üppigkeit der Natur, die sonst für Trinidad bezeichnend ist, herrscht hier eine unwirtliche, traurige Öde. Nur spärlichen Pflanzenwuchs weist der Küstenstrich auf, kein Baum spendet Schatten, kein Vogel läßt seine Stimme ertönen, kein fröhliches, bunt gekleidetes Volk drängt sich, wie sonst in westindischen Häfen, an den Fremden heran. Der Erdboden ist schwärzlich braun, wie verbrannt, und die Luft von durchdringendem Pechgeruch erfüllt. An einer hohen Drahtseilbahn gleiten unaufhörlich leere Förderkörbe landeinwärts, um mit Blöcken einer schwarzen, blasigen Masse gefüllt zurückzukehren und sich in die Frachtdampfer zu entleeren, die an dem weit ins Meer ragenden Pier liegen. Schweigend und mißmutig gehen die Neger ihrem Tagewerk nach, nur ungewöhnlich hohe Löhne können sie zur Betätigung in diesem von Gluthitze und Fieberkeimen erfüllten Gebiet verlocken. La Brea gehört zu den ungesündesten Orten der Welt.
Was aus den Förderkörben der Drahtseilbahn in die Laderäume der Schiffe rollt, ist roher Asphalt, wie er aus dem Erdboden gewonnen wird. Nach halbstündigem Marsch stehen wir an der Quelle, die den ununterbrochenen Strom der Förderkörbe speist, an dieser Goldgrube, die zugleich ein großes Naturwunder ist: dem berühmten Asphaltsee von La Brea.
Wieviel Millionen Menschen wandern wohl täglich auf dem Asphalt der Großstadtstraßen, ohne sich auch nur einmal die Frage vorzulegen, was Asphalt eigentlich ist, woher er kommt und wie er gewonnen wird. Vielleicht werfen sie aber doch einmal einen flüchtigen Blick hin, wenn Asphaltarbeiter Schäden ausbessern oder neu angelegte Straßen mit Asphalt bedecken. Sie sehen dann, wie ein dunkelbraunes Pulver auf die Unterlage geschüttet und mit heiß gemachten eisernen Rammen zu einer festen Masse gestampft wird. Dieses Pulver ist eine Mischung des reinen Asphalts mit Teer und Sand. Aber woraus besteht Asphalt? Das dem Griechischen entnommene Wort bedeutet Erdpech, ein Mineral, das in engsten Beziehungen zum Petroleum steht, weich, sehr leicht und brennbar ist. Wahrscheinlich ist es aus Petroleum unter Hinzutritt von Sauerstoff entstanden. Schon die alten Ägypter kannten den Asphalt und benützten ihn zum Einbalsamieren der Leichen; aber erst gegen Mitte des vorigen Jahrhunderts kam man auf den Gedanken, das leicht flüssig zu machende, dann aber sehr zähe und zugleich elastische Material zur Herstellung von Straßenbedeckungen zu verwenden. Asphalt kommt nur an wenigen Stellen der Erde in größeren Lagern vor, zumeist in Hohlräumen vulkanischer Gesteine. Während der in Deutschland verwendete Asphalt hauptsächlich aus Sizilien stammt, decken andere Länder, in erster Linie die Vereinigten Staaten von Nordamerika, ihren Bedarf aus den beiden großen Asphaltquellen Mittelamerikas, nämlich dem Bermudez-Asphaltsee in Venezuela und dem Asphaltsee von La Brea auf Trinidad, vor dem wir nun standen.
Der Ausdruck »Asphaltsee« ist bei den Engländern von Trinidad zwar gebräuchlich, aber muß irrige Vorstellungen erwecken. Denn in Wirklichkeit handelt es sich um keinen See, um keine flüssigen Asphaltmassen, sondern um ein riesiges, annähernd kreisförmiges Becken von 700–800 Meter Durchmesser, das bis zum Rande mit festem Erdpech gefüllt ist. Seine Bezeichnung als See verdankt das Becken dem Umstand, daß es stellenweise von seichten Wassertümpeln überzogen ist (in denen sich übrigens ein interessantes tierisches Kleinleben entwickelt hat), so daß man von weitem einen See mit darauf schwimmenden Asphaltschollen zu erblicken glaubt. Die Asphaltfläche kann überall in voller Sicherheit betreten werden, das Mineral ist zumeist schon erhärtet, bisweilen noch etwas weich, nur hier und dort quillt aus Spalten flüssiges Pech hervor. Ein widerwärtiger, Kopfschmerzen erzeugender Pechgeruch lastet schwer auf der weiten, vom Sonnenbrand durchglühten Fläche. Kein weißer Arbeiter könnte es hier auf die Dauer aushalten, nur die an Hitze gewöhnten, sehr kräftigen Neger von Trinidad und Barbados sind dazu imstande. Ein paar Hundert von ihnen haben sich über den »See« verteilt und hauen mit Spitzhacken das Erdpech von der Oberfläche ab, dann wandern die schwarzen Blöcke auf Feldbahnwagen in die Lagerhäuser am Rande des Beckens oder sogleich mit der erwähnten Schwebebahn zu den am Hafenpier liegenden Schiffen.
Man sollte nun meinen, daß das Asphaltbecken trotz seiner riesigen Größe schließlich einmal erschöpft werden müßte. Hat doch bereits Kolumbus seine Schiffe mit dem Erdpech von La Brea kalfatern lassen und sind doch seitdem und besonders in neuester Zeit ungeheure Mengen des nützlichen Stoffes dem Becken entnommen worden. Die meisten amerikanischen Städte verdanken ihre Asphaltpflaster dieser Quelle. Mit um so größerem Staunen stellt man fest, daß die ganze Fläche außer den Löchern dort, wo gerade Asphalt herausgehauen wird, gar keine Gruben und Aushöhlungen zeigt. Das ist eben das Merkwürdige, das schier Rätselhafte an diesem Riesenreservoir der Natur: wieviel Asphalt auch dem »See« entnommen wird, immer bleibt er bis zum Rande gefüllt, immer drängen über Nacht aus geheimnisvoller Tiefe neue Massen halbweichen Erdpechs nach, füllen die ausgehauenen Löcher und erstarren sofort. Über die Kräfte, die hierbei in Tätigkeit treten, ist sich die Wissenschaft nicht klar. Der beständig vorhandene Vorrat von Asphalt in dem Becken wird auf fünf Millionen Tonnen geschätzt. In seiner rohen Form, wie er gewonnen wird, ist der Asphalt noch nicht brauchbar, man muß ihm zuerst den hohen Wasser- und Erdölgehalt sowie einige andere Beimischungen entziehen. Wie sich nach alledem leicht vorstellen läßt, ist der Asphaltsee von La Brea eine wahre Goldgrube, und man wird sich deshalb nicht weiter darüber wundern, daß die ausbeutende Gesellschaft dem englischen Gouvernement von Trinidad dafür die Pachtsumme von ein paar Millionen Goldmark im Jahre zu zahlen hat – und trotzdem reichliche Gewinne erzielt.
Wie aus dem ganzen geologischen Aufbau Trinidads hervorgeht, war die Insel früher ein Stück des südamerikanischen Festlandes und ist durch vulkanische und neptunische Katastrophen vom Festland abgetrennt worden. Die drei parallelen Bergketten, die Trinidad durchziehen, sind zweifellos eine Fortsetzung des karibischen Gebirges in Venezuela. Obwohl die Insel heute keine vulkanische Tätigkeit aufzuweisen hat, zeigen sich die unterirdischen Kräfte doch noch immer lebendig. Das geht nicht nur aus dem unaufhörlichen Nachwachsen des Asphaltsees von La Brea hervor, sondern wird auch durch ein Naturereignis bewiesen, das sich kurz vor meiner Anwesenheit in Trinidad, im Sommer 1912, dort abgespielt hat. Unweit von Port of Spain stieg dort eines Tages aus dem Gewässer des Golfes von Para Rauch empor, der sich beständig vermehrte und zu einem dunklen Gewölk zusammenballte. Bald wurde in den Rauchmassen auch Feuerschein sichtbar, und das Meer, das vorher völlig ruhig gewesen war, begann zu kochen und zu schäumen. Als sich die Rauchwolken etwas verzogen hatten, sah man vom Lande aus mit Staunen, daß dort im Golf von Para eine neue, ziemlich umfangreiche Insel entstanden war, deren höchster Punkt sich etwa fünf Meter über dem Meeresspiegel befand. Anfangs wagte sich niemand zu diesem neuen Landgebilde hinüber, nach ein paar Tagen aber, als es noch immer in anscheinend voller Festigkeit beharrte und neue vulkanische Erscheinungen sich nicht mehr bemerkbar machten, wurde die auf so seltsame Weise entstandene neue Insel von ein paar mutigen Leuten besucht und durchforscht. Sie bestand aus Land und Morast, dem an die Meeresoberfläche emporgehobenen Meeresgrund, und wies zwei sogenannte Schlammvulkane auf, wie sie an mannigfachen Stellen der Erde, auch in Sizilien und auf dem italienischen Festland, vorkommen. Diese Schlammvulkane in Gestalt niedriger Kegel haben gewöhnlich einen Durchmesser von nur einigen Metern, sind mit wässerigem Schlamm gefüllt und lassen Kohlenwasserstoffgase und Dampf entströmen, werfen auch von Zeit zu Zeit unter explosionsartigem Geräusch Schlamm und Steine aus. Die Gase, die den Schlammkratern der neuen Insel bei Port of Spain entströmten, rochen nach Schwefel und Petroleum. Wie vorauszusehen war, bedeutete die neue Insel keine dauernde Bereicherung des Landgebietes der Erde, denn sie ist bald nach ihrem Entstehen über Nacht wieder im Meere versunken. Übrigens befinden sich auch in Nähe des Asphaltsees von La Brea Schlammvulkane in größerer Anzahl. Die Neger meiden das Gebiet, weil es nach ihrer Ansicht von bösen Geistern unsicher gemacht wird.
Die nächsten Tage verbrachte ich als Gast im Landhaus von Martinis Onkel, des Herrn H., der unweit der kleinen, am Golf von Para gelegenen Hafenstadt San Fernando eine Zucker- und Kakaopflanzung, und weiter landeinwärts, in dem von Urwäldern bedeckten, erst wenig kultivierten Hügelland Waldungen und ein Sägewerk besaß.
Es waren ein paar schöne Tage, in denen es viel zu erzählen und manches Interessante zu sehen gab. Bevor ich von meinem Reisekameraden Abschied nahm, um meine Westindienfahrt allein zum Abschluß zu bringen, sollte noch ein Jagdausflug in den Wald unternommen werden. Um dort gleich in aller Frühe an Ort und Stelle zu sein, fuhren wir drei in Begleitung eines schwarzen Dieners schon nachmittags mit einem Wagen nach dem kleinen Unterkunftshaus, das sich Herr H. am Rande des Waldes neben seinem Sägewerk errichtet hatte, und verbrachten dort die Nacht.
Noch war es beinahe ganz dunkel, als wir uns morgens vom Lager erhoben, aber die Stimmen der Nachttiere, die heulenden, klagenden, schrillen Töne, die nachts aus dem Urwald erklingen, waren bereits verstummt, und von Osten her zog als Vorläufer der Sonne ein zartes violettes Dämmerlicht über den Himmel. Während wir uns ankleideten, und Hippolyt, der schwarze Diener, den Frühtrunk bereitete, wurde es mit der den Tropen eigentümlichen Schnelligkeit bald hell; noch eine Viertelstunde, und der strahlende Tag brach an.
Ein paar Minuten später befand sich unsere kleine Gesellschaft samt Hippolyt, der den Proviantkorb betreute, auf der Fahrt nach dem Sägewerk. Die H.schen Forsten lieferten Nutzhölzer von erlesener Art. Außer dem edlen Mahagoni und dem harten Kampescheholz, das in den Färbereien Verwendung findet, aber auch dem Schreiner ein geschätztes Material bietet, gab es da herrliches purpurrotes Korallenholz, das duftende Holz der westindischen Zeder, kohlschwarzes Ebenholz und andere kostbare Hölzer, die wegen ihrer schönen Farben und Maserungen in der Kunsttischlerei gebraucht und hoch bezahlt werden. Die Stämme werden im Sägewerk zugehauen und zerschnitten und die Bretter dann mit einer Feldbahn nach San Fernando befördert, von wo sie zu Schiff die Reise nach Nordamerika und Europa antreten.
Da der fahrbare Weg beim Sägewerk zu Ende war, mußten wir von hier zu Fuß weitergehen, zuerst in schwer passierbaren, mit Baumstubben und Abfallholz bedeckten Schneisen, dann auf einem schmalen, gewundenen Pfad, der sich gleich einem Engpaß durch das Dickicht des Urwaldes zog.
Der erste Eindruck beim Vordringen in den Urwald von Trinidad ist ein seltsames Gefühl der Bedrücktheit, der Verwirrung, ja einer gewissen Beängstigung – so stark wirkt das Gewaltige und Geheimnisvolle einer Natur von unerhörter Schöpferkraft. Nicht daß die Bäume hier durchweg von ungewöhnlicher Größe wären. Sie sind zwar im allgemeinen sehr kräftig, es gibt auch Riesen darunter, aber sie können sich nicht mit solchen Ungeheuern der Flora messen, die, wie die berühmten Mammuttannen des Yosemitetales in Kalifornien, unbeschränkte Entwicklungsfreiheit haben. Gerade daran, fehlt es im Urwald. Hier rückt ein Baum dem andern eng an den Leib, alle sind viel zu sehr von wucherndem Unterholz und von der mörderischen Umschlingung der Schmarotzergewächse bedroht, als daß sie zu ungehinderter Entfaltung gelangen könnten. Nur vereinzelten, besonders kräftigen Exemplaren ist das möglich oder solchen, denen ein Zufall freieren Spielraum verschafft hat. Die Jugend, die ewig in neuen Gestalten nachdrängende Jugend ist es, die im Urwald einen unaufhörlichen, erbitterten Kampf mit den älteren Bäumen, aber auch miteinander führt, einen Kampf um Ellbogenfreiheit, um Raum und Luft. Hier gilt nur das Naturrecht des Stärkeren: alles, was nicht widerstandsfähig genug ist, wird erstickt, muß verkümmern und stirbt, und die Tausende von Dahingesunkenen tragen nun mit ihrem modernden Leib dazu bei, den ohnehin schon von Keimkraft strotzenden Boden noch mehr zu düngen.
Wir machten einen Augenblick halt und starrten in das chaotische Dickicht. Obwohl es ein leuchtender, sonneglühender Tag war, konnte man das im Wald herrschende Licht höchstens als fahle Dämmerung bezeichnen. Das eng verflochtene Laubdach über unseren Köpfen hielt jeden Sonnenstrahl fern, dämpfte die Grellheit des Tageslichtes. Was am meisten auffiel, war das Gewirr von kabelförmigen Ranken, die von den Baumkronen herabhingen oder sich um Aste und Stämme wanden, als ob sie diese mit ihrer Umschlingung erdrücken wollten. Zwar waren mir die Lianen und Luftwurzeln schon von Ceylon und Java her wohlbekannt, aber ich hatte sie selbst in den dortigen üppigen Wäldern nicht in solcher Fülle gesehen wie hier. Dazu gesellten sich die phantastischen Gebilde der Ficus religiosa, des Baumwürgers, einer Feigenart, die sich mit ihren zahlreichen Haft- und Nährwurzeln um die Stämme windet und sie ganz verhüllt, ferner das in langen zottigen Bärten von den Ästen herniederhängende Moos der Tillandsia. Nicht minder erstaunlich war die wuchernde Üppigkeit des Untergehölzes, das es in seinem Wachstum nur bis zu einer gewissen Höhe bringt und mit seinem dichten, zottigen Gestrüpp dem Eindringling unüberwindliche Hindernisse bereitet. Dazwischen wieder Farne von doppelter Mannesgröße mit Blättern wie Palmenwedel, und die unentwirrbare Fülle kleinerer Pflanzen, die für den ungeschulten Blick nur eine einzige, fest ineinander versponnene Masse darstellt, während das Kennerauge Hunderte von Arten zu unterscheiden vermag.
Wie es nur möglich wäre, als erster in solchem Dschungel vorzudringen, sich da einen Weg zu bahnen, fragten wir.
»Ja, das ist auch ein hartes Stück Arbeit, dazu kann man nur geübte Leute verwenden, die aus jahrelanger Gewohnheit wissen, wie sie dem Urwald am besten beikommen,« sagte der Pflanzer. »Mit großen Hiebmessern bahnen sie sich ihren Weg und mehr als einmal versinken sie in den tückischen Löchern des weichen, sumpfigen Bodens. Ich lasse meine Leute immer nur höchstens vierzehn Tage hintereinander in der dunstigen Fieberluft des Waldes arbeiten, dann kommen sie wieder für ein paar Wochen in ein gesünderes Revier. Um sich hier auf die Dauer wohl zu fühlen, muß man schon ein weinender Klammeraffe oder roter Heulaffe sein. Ja, wirklich, diese Affen gibt es bei uns und sie führen genau diese Namen,« fügte unser Führer hinzu, als wir ihn etwas verwundert ansahen.
»Die tierischen Bewohner des Waldes scheinen sich nur nachts bemerkbar zu machen, dann sorgen sie aber gehörig für Ohrenschmaus,« meinte Martini, dem das Waldorchester in der vergangenen Nacht unliebsam den Schlaf verkürzt hatte.
»Unsere Urwaldtiere sind durchgängig sehr scheu und vorsichtig, halten sich zumeist in den dichten Baumkronen auf und erweisen sich insofern als gute Menschenkenner, als sie dem Menschen gern aus dem Wege gehen,« sagte Herr H. »Ich bin deshalb auch gar nicht sicher, ob wir zufällig etwas vor die Büchse bekommen. An interessanten Vertretern der Fauna fehlt es in unseren Wäldern nicht. Außer den beiden schon erwähnten, sehr musikalisch veranlagten Affen haben wir das friedliche Aguti oder Ferkelkaninchen und das ebenso harmlose Oppossum, ferner das Gürteltier und das Pekari, ein kleines, aber sehr mutiges, bissiges Wildschwein, vor dem man sich in acht nehmen muß, weiter ein Stachelschwein, das auf die Bäume klettert, und einen großen Ameisenfresser, der mit seinen mächtigen Klauen den Jagdhunden gefährlich wird und deshalb bei den Eingeborenen Mataperro oder Hundetöter heißt. Unter den Vögeln tut sich der Campanero oder Glockenvogel mit seiner wundervollen Stimme besonders hervor.«
Wir hörten also die Bestätigung dessen, was uns schon Don Alberto erzählt hatte. Leider tat uns der Campanero nicht den Gefallen, sich vernehmen zu lassen; große Sänger haben bekanntlich ihre Launen. Und auch die anderen eben genannten Tiere waren unliebenswürdig genug, in ihrer strengen Zurückgezogenheit zu verharren, obwohl wir gern das eine oder andere als Jagdtrophäe mitgenommen hätten.
Nach einstündiger Wanderung auf dem schmalen, gewundenen Waldpfade gelangten wir zu einer weiten, von einem Fluß durchströmten Lichtung. Palmen, Bambus und dichtes Mangrovengebüsch umsäumten die Ufer, aber der ortskundige Farmer führte uns durch das Dickicht zu einer freien Stelle am Fluß.
»Wir wollen uns in Ermangelung anderer Jagdbeute wenigstens einen Wildentenbraten holen,« sagte er. »Bitte um möglichst ruhiges Verhalten. Die Enten sind sehr scheu und wachsam, so daß man schwer zu Schuß kommt.«
Hinter dem Schilf in Deckung liegend, bekamen wir bald eine Entenschar zu Gesicht. Die Tiere hatten sich in einiger Entfernung von uns auf einer Kiesbank des seichten Flusses niedergelassen. Martini und sein Onkel nahmen die gefiederte Gesellschaft aufs Korn. Da flogen die Wildenten, Unheil witternd, auf. In demselben Augenblick drückten meine Begleiter ab, und zwei Enten fielen getroffen auf die Kiesbank nieder, während die anderen entkamen.
Da wir keinen Hund mitführten, erbot sich Martini, der lange Jagdstiefel anhatte, zur Kiesbank hinüber zu waten und die Beute zu holen.
Gesagt, getan. Als er sich aber halbwegs zwischen dem Ufer und der Kiesbank befand – das seichte Wasser reichte ihm noch nicht bis ans Knie – sahen wir zu unserem Schreck in nächster Nähe von ihm plötzlich einen Alligator auftauchen, einen Kaiman von annähernd fünf Meter Länge. Auf dem Lande sind diese Reptile, wie alle Alligatoren und Krokodile, schwerfällig und feig, im Wasser aber sehr angriffslustig. Vermutlich war es ein Kaimanweibchen, das auf der Kiesbank seine Eier vergraben hatte und sie vor dem Jäger schützen wollte.
Auch Martini hatte den seitlich neben ihm auftauchenden Kaiman bereits bemerkt und griff zum Gewehr, das er glücklicherweise bei sich führte und über der Schulter trug. Aber im selben Augenblick fiel ihm ein, daß er keine Kugelpatrone in seiner Büchsflinte hatte, und zum Laden war keine Zeit. Ebensowenig konnte er daran denken, in schleuniger Flucht die Kiesbank oder das Ufer zu erreichen; die Entfernungen waren zu groß, und schon in den nächsten Sekunden mußte das Tier an ihn herangekommen sein.
Nachdem ihm das – wie er uns später erzählte – blitzschnell durch den Kopf geschossen war, nahm er, so gut es eben ging, den Kampf mit dem unheimlichen Riesenreptil auf, einen gefährlichen Kampf, dessen Aussichten für das Tier weit günstiger waren als für den Menschen. Er packte das Gewehr mit beiden Händen am Lauf und hob es empor. Die Bestie richtete den Oberkörper auf und vollführte mit der hechtähnlichen Schnauze eine schnappende Bewegung nach den Beinen des jungen Mannes. Alle Muskeln straffend, ließ Martini den Kolben auf den Schädel des Reptils niedersausen, dann sprang er, so rasch wie es im Wasser möglich war, ein paar Schritte zur Seite.
Inzwischen waren wir beide, Herr H. und ich, in den Fluß gewatet, und der Farmer hatte in aller Schnelligkeit sein Gewehr schußfertig gemacht. In demselben Augenblick, als sein Neffe auf den Alligator einschlug, feuerte der Farmer auf das Tier.
Der Kolbenhieb hätte den Unhold wohl höchstens vorübergehend ein wenig verwirrt, aber der Schuß mußte gut getroffen haben, denn der Kaiman wandte sich von seinem Opfer ab, drehte sich um sich selbst und peitschte wütend das Wasser mit seinem Schwanz, so daß Martini inzwischen Zeit fand, einige weitere Meter Raum zwischen sich und die Bestie zu bringen.
Der Farmer feuerte jetzt aus größerer Nähe zum zweitenmal, direkt auf den Vorderkopf des Tieres zielend. Anscheinend in die Augen getroffen, wandte sich der Kaiman zur Flucht. Aber er kam nicht weit, denn wir sahen, wie er bald darauf, entweder im Verenden begriffen oder bereits verendet, wie ein Baumstamm auf dem Wasser trieb und von der Strömung davongetragen wurde.
»Das war ein knappes Entkommen!« rief Martini, als wir drei wieder am Ufer vereint waren. »Ohne deinen raschen und sicheren Schuß, Onkel, hätte es beinahe eine kleine Katastrophe gegeben. Von ganzem Herzen besten Dank.«
»Du solltest mir lieber Vorwürfe machen,« erwiderte der Farmer. »Es war wirklich leichtsinnig von mir, daß ich dich in den Fluß hineinwaten ließ. Zwar hatten sich hier seit langem keine Alligatoren gezeigt, aber man muß doch immer mit der Möglichkeit des plötzlichen Auftretens einer solchen Bestie rechnen. Seien wir froh, daß das Abenteuer noch glücklich verlaufen ist.«