
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Der kleine Malte war ein herziges Kind, er hatte die Augen seines Vaters.

 Strahlend blau wölbt sich der Himmel über Rügens schneeweißen Kreidefelsen. Durch die leise plätschernden Wogen ziehen majestätische Dampfer mit lustig flatternden Fähnchen. Jauchzende Kinderstimmen tönen hinauf zu den alten Buchen. Wie lustig ist's, über Steine zu hüpfen, zwischen denen die sanften Wellen mit der gleichmäßigen Würde einer alten Kindermuhme Verstecken spielen, manchmal ein naseweises Füßchen beleckend wie in plötzlichem Mutwillen, und dann weiter rauschend in gleichmäßigem Takt, als sei nichts geschehen. Bunte Kleider schimmern überall hervor: zwischen den ernsten Buchen und am Strande, aus den kleinen Segelbooten, welche die alten Seebären mit phlegmatischer Ruhe durch die Wogen lenken, und von den Balkonen der Villen und Hotels. Mit einem Gemisch von Freude und Verachtung sehen die Einheimischen diesem bunten Treiben zu. Sie lieben die Stille und den Kautabak, ihre kurzen Pfeifen, einen tüchtigen Sturm und einen wärmenden Schnaps. Sie hätten besser in die alten Zeiten gepaßt, wo man den Dänen und Schweden zeigte, was eine tüchtige Faust ist, wo die Piratenschlucht Schätze barg, die man sich
nicht durch schöne Villen und andere Kunstgriffe erwarb, mit denen man heute fremde Städter auf die Insel lockt. Aber das half nun einmal nichts, die alten Zeiten waren vorüber, und durch Fischfang allein kann man nicht leben. Wenn die Herbststürme heulend über die Insel fahren, dann zählen die Rügener ihre Schätze, machen es sich mit Weib und Kind recht breit und behaglich in den leer gewordenen Zimmern und freuen sich der Ruhe.
Strahlend blau wölbt sich der Himmel über Rügens schneeweißen Kreidefelsen. Durch die leise plätschernden Wogen ziehen majestätische Dampfer mit lustig flatternden Fähnchen. Jauchzende Kinderstimmen tönen hinauf zu den alten Buchen. Wie lustig ist's, über Steine zu hüpfen, zwischen denen die sanften Wellen mit der gleichmäßigen Würde einer alten Kindermuhme Verstecken spielen, manchmal ein naseweises Füßchen beleckend wie in plötzlichem Mutwillen, und dann weiter rauschend in gleichmäßigem Takt, als sei nichts geschehen. Bunte Kleider schimmern überall hervor: zwischen den ernsten Buchen und am Strande, aus den kleinen Segelbooten, welche die alten Seebären mit phlegmatischer Ruhe durch die Wogen lenken, und von den Balkonen der Villen und Hotels. Mit einem Gemisch von Freude und Verachtung sehen die Einheimischen diesem bunten Treiben zu. Sie lieben die Stille und den Kautabak, ihre kurzen Pfeifen, einen tüchtigen Sturm und einen wärmenden Schnaps. Sie hätten besser in die alten Zeiten gepaßt, wo man den Dänen und Schweden zeigte, was eine tüchtige Faust ist, wo die Piratenschlucht Schätze barg, die man sich
nicht durch schöne Villen und andere Kunstgriffe erwarb, mit denen man heute fremde Städter auf die Insel lockt. Aber das half nun einmal nichts, die alten Zeiten waren vorüber, und durch Fischfang allein kann man nicht leben. Wenn die Herbststürme heulend über die Insel fahren, dann zählen die Rügener ihre Schätze, machen es sich mit Weib und Kind recht breit und behaglich in den leer gewordenen Zimmern und freuen sich der Ruhe.
Sie sind kernige Gesellen, die braven Fischer, und die kleinen Buben stehen schon gerade so breit und phlegmatisch da wie ihre Väter, die Mädels aber so sauber, ehrbar und mit etwas sorgenbedrücktem Ausdruck in den frischen Gesichtern, gerade wie ihre Mütter. Sie sind treu und rechtschaffen, sie haben sich ihre eigenen Gesetze gemacht, die zwar nicht unbedingt zu dem heiligen Gesetz Gottes passen, aber ihnen doch ganz vollkommen und allen göttlichen und menschlichen Ansprüchen genügend erscheinen. Sie hatten auch ein Kirchlein, das lag höher als alle andern Häuser. Nicht oft, aber doch manchmal pilgerten sie da hinauf und ließen ihre Stimmen an die Kirchenwände und des Pastors Stimme an ihre Herzenswände schallen, und dann hatten sie einen Gottesdienst gehabt, der für lange Zeit reichte. Daß der alte ehrwürdige Pastor den Heiland Jesum Christum predigte, das war gewiß sehr schön für die Fremden – ihnen, den braven Einheimischen half es ungefähr gerade so wenig, wie es ihnen half, daß sie einen berühmten Badearzt hatten, der seine Sache praktisch verstand und für all die bunten, bleichen Stadtkinder gewiß ein großer Trost war. Sie brauchten ihn nicht – wozu? sie waren ja ohne ihn braun, kräftig und gesund. Und wenn der Herr Pastor sagte, was der Herr Jesus Christus für Sünder tut, dann verneigten sie sich bei seinem heiligen Namen, aber sie wußten sich in ihrer Verwandtschaft auf keinen so groben Sünder zu besinnen, für den er extra etwas tun müßte.
Vor Jahren einmal – da hatte einer unter ihnen gelebt, der hatte so über Religion seine eigenen Gedanken gehabt. Er hatte diese Gedanken schön ausdeuten können, – wenn er aus der Bibel vorlas, dann mußten sie sich immer wundern, daß dieser Malte Ethé einer der Ihren war, ein echtes Rügener Kind. Wo kam ihm das nur alles her? Wenn er so geredet hatte über Sünde und Gnade – ach, du großer Gott! dann konnte es einem darinnen im Herzen ganz sonderbar werden – der alte Clas Ralfsen hatte einmal gesagt, »als wenn der Malte mir all meine Ballaststeine geradeswegs ins Herz hineingepackt hätte.« Herr, wenn das so ist, wer kann dann selig werden? Und wenn einer so fragte, dann hatte Maltes Gesicht geleuchtet, und er hatte dann erst recht losgepredigt und vom Herrn Jesus so erzählt, daß die Frauen geweint hatten und die Männer ihre Pfeifen halten ausgehen lassen, weil etwas in ihnen zu reden anfing: »Ja, ja, der Malte hat recht.«
Damals war es für den Herrn Pastor gute Zeit gewesen. Die Kirche war immer voller geworden, und wenn er manchmal bei Maltes Bibelstunden dabeigesessen, dann hatte er oft mit dem Kopf genickt und hatte so glücklich dabei ausgesehen, wie man die Gesichter der lieben Engel malt, wenn sie sehen, wie der arme Sünder, der verlorene Sohn, wieder bei seinem Vater angekommen ist.
Und dann! Dann war die grausige Geschichte geschehen, die Geschichte, die jedes Kind auf der Insel kannte – die Geschichte von Malte Ethés Sterben.
Es war ein wonniger Sommertag gewesen. Eine frische Brise ließ die Wellen lustig springen, und mitten in den springenden Wellen funkelte es hell wie von Myriaden Sternlein, weil die lachende Sonne die lustigen Wellen küßte. Die Schiffer saßen am Ufer, einige wuschen ihre Netze, andere sahen auf die schaukelnden Boote oder starrten hinaus in die weite Ferne.
»Sieh mal, Jentsch,« sagte plötzlich der alte Ohlerich und zeigte mit dem Daumen nach Süden, »is dat en Schipp?«
Jentsch schwieg und kuckte. Dann stand er auf, steckte die Hände in die Hosentaschen und ging schwerfällig ein Stück näher ans Wasser heran. »Rook seh ick, weeder nicks,« sagte er langsam, aber nicht ohne Erregung.
Schweigend sahen beide auf die kleine Rauchsäule. Plötzlich schlug aus der schwarzen Wolke eine rote Lohe.
»Gott stah uns bi! Jung! dat brennt! Du kannst mi glöwen!« Ohlerichs Stimme schwoll in wachsender Erregung, wie das Meeresbrausen anschwillt im Sturm. »Dat is'n Unglück – dat is'n Schippsbrand! Dat Boot kloar! Roop de annern! wi heww keen Tied!«
Nein, da war wahrhaftig keine Zeit. Unheimlich zuckte der rote Feuerschein übers Wasser. Die braven Schiffer sind schnell im Boote, sie rudern mit Macht, aber werden sie nicht zu spät kommen?
Pfeilschnell schießt der Feuerball ihnen entgegen. Die da drinnen im Schiff haben den Kessel mächtig geheizt, sie wissen ja, daß sie um ihr Leben fahren. Am Steuer des brennenden Schiffs steht Malte Ethé (ach, der gerettete Kapitän hat es später unzählige Male erzählt), der Wind treibt die Flammen gerade auf das Steuer zu. Die Passagiere drängen sich alle ans andere Ende des Schiffes, schreiend, weinend, betend, niemand von ihnen denkt an den Mann, der da allein steht, unbeweglich das Steuer in der Hand. Nur der Kapitän auf der hohen Kommandobrücke blickt auf den treuen Mann.
»Malte, wirst du aushalten?«
»Mit Gottes Hilfe, ja!«
Immer dichter hüllt der Rauch ihn ein.
»Malte, kannst du aushalten?«
Eine heilige Ruhe liegt auf Maltes Zügen: »Mit Gottes Hilfe, ja!«
»Malte,« ruft der Kapitän nach einer Weile, »halt aus! es kommt Hilfe – ich sehe sie!«
Maltes Augen schauen nach oben.
»Ich sehe auch Hilfe! Meine Hilfe kommt von dem Herrn.«
Nun beginnt der Boden unter Maltes Füßen zu brennen. »Kapitän,« ruft er, und seine Stimme klingt erstickt, »mein Weib – mein Kind!«
»Sie sollen keinen Mangel leiden, so Gott uns rettet!« schreit der Kapitän. »Kannst du aushalten?«
Malte sah ihn an und lächelte. Seine Kleider brannten, aber er stand unbeweglich, die Hand am Steuer. »Und ihr sollt auch das Leben für die Brüder lassen!« hört der Kapitän. Es muß Malte gewesen sein, der das rief, aber seine Stimme klang so anders, so fremd, so feierlich – wie aus weiter Ferne.
»Malte, rette dich! Laß das Steuer los! Sie sind da. Wir sind gerettet! Malte, Malte! wo bist du?« schreit der Kapitän mit bebender Stimme.
Malte stand nicht mehr am Steuer. Ohne einen Schrei war er zusammengesunken. Der Kapitän sah nichts mehr als Rauch und Flammen um das Steuer her! Er war der letzte, der das Schiff verließ. Sie waren alle gerettet – nur einer nicht, einer, der das Leben ließ für seine Brüder! –
Es war viel Klagens und Weinens gewesen um den Malte Ethé. »Gott sei uns gnädig, es ist keiner von uns wie er!« So ging es damals von Mund zu Mund. Ja damals! – –
Sie vergaßen den Malte nicht; sie mußten die Geschichte ja immer wieder erzählen, und die dankbaren Geretteten hatten ihm auch ein Denkmal gesetzt, das stand den Schiffern ja immer vor Augen, aber daß sie arme Sünder waren, das vergaßen sie allmählich wieder, und daß Maltes Heiland ihr Herz bewegt hatte, das vergaßen sie auch. So ward allmählich alles wie früher, nur daß Malte fehlte und niemand mehr Steine ins Herz packen konnte.
Sein Junge wuchs unter ihnen auf, und obgleich er ein feines Kind war, das seiner Mutter glich, so hatten sie ihn doch lieb. Sie nannten ihn: »Unser Prinz,« und jedermann verzog ihn. Er trug feine Kleidung wie die Stadtkinder, Matrosenröckchen mit blanken Knöpfen und himmelblauen oder weißen Kragen. Unter den Geretteten waren reiche, vornehme Leute gewesen, sogar ein leibhaftiger Prinz, – die zeigten sich alle dankbar. Darum brauchte Frau Ethé sich nicht mit Arbeit zu quälen und konnte ihr Kind prinzlich kleiden. Für sie war das vielleicht ein Glück, denn sie war kränklich, aber ob auch für das Kind? –
Der kleine Malte war ein herziges Kind, er hatte die Augen seines Vaters, die so blau waren wie das Meer, wenn der Himmel sich darin spiegelt und die Sonne lacht. In Malte Ethés Augen hatte auch immer Sonnenschein gelacht, sogar als er mitten im Feuer stand. Das kam wohl, weil in seinem Herzen das große Licht brannte, das alle Menschen erleuchtet, die aufgestanden sind vom Schlaf der Sünden und den Heiland Jesus Christus gesucht und gefunden haben. In des kleinen Maltes Augen lag eine große fragende Traurigkeit, und daher kam es vielleicht, daß sich so manche Augen mit Tränen füllten, wenn das Prinzlein sie ansah, und mancher rauhe Seebär den Fluch hinunterschluckte und unwillkürlich die Stimme dämpfte, wenn das Kind bei ihm stand.
»Das kommt von seines Vaters Sterben. Das Entsetzen ist ihm im Herzen sitzen geblieben,« sagte Kaven Doodt, die allgemein für die klügste Frau auf der Insel galt. Dann streichelte man ihn, und das Büblein hörte, daß niemals ein Schiffer aus ihm werden würde, dazu sei er zu fein und zu fromm. Ein Pastor müßte er werden, weil sein Vater doch solch ein Heiliger gewesen war.
Durch solche Reden kam es vielleicht, daß Malte das blonde Köpfchen allmählich etwas hoch trug und in seinem kleinen Herzen dachte, daß es für alle Welt doch gar von großer Wichtigkeit sei, was aus ihm, dem Malte Ethé, einmal werden würde. Wenn er auf den Steinen am Strande im Sonnenschein lag, dann konnte er stundenlang träumen und denken, und in all den Träumen war, bewußt oder unbewußt, er, Malte Ethé, der Held. Es muß doch noch etwas Besseres geben, als viel studieren und im schwarzen Rock auf der Kanzel stehen. Er blickte den weißen Möwen nach, wie sie hin- und herflogen, mit ihren Flügeln das Wasser berührend, das in silbernen Tröpfchen aufblitzte, und dann wieder schwebten sie hoch und höher – ja, hoch und höher wollte auch er umherfliegen und gut und fromm sein, schneeweiß wie die Möwen, ein Himmelskind, über das Gott sich freuen und die Menschen sich wundern sollten. Wie sein Vater dagestanden hatte, mitten in den Flammen, ganz allein, so, ja, so wollte auch er dastehen, ganz allein, anders wie alle andern. War er nicht schon jetzt anders als alle andern?
»Wer ist das Bübchen?« fragten die Badegäste, »auch ein Seemannskind?« Und wenn sie dann die Geschichte seines Vaters gehört hatten, dann streichelten sie ihn, schenkten ihm Bonbons und Spielsachen, und törichte Damen flüsterten etwas von »wunderbaren Augen« und küßten ihn.
»Mußt nicht soviel mit den andern Jungen sein,« sagte die Mutter, »sie sind wild und roh, und das paßt nicht für dich.«
Jeden Morgen las die Mutter mit Malte ein Kapitel aus des Vaters Bibel, und dann knieten sie nieder und beteten. Sie waren die einzigen auf der ganzen Insel, die beim Beten knieten. Die Mutter tat das, weil der Vater sie das so gelehrt hatte, nicht aus einem inneren Bedürfnis, nicht weil sie fühlte, daß das für eine Sünderin die einzig passende Stellung ist vor dem, dem alle Kniee sich beugen sollen, auch die der Heiligen und Seligen, der Cherubim und Seraphim. Es hatte in Frau Ethés Leben nie eine Stunde gegeben, in der sie selbst sehr klein und sündig geworden war und der Heiland –? nun, er war ihres Malte Heiland gewesen und darum natürlich auch ihrer. Warum er ihren Malte nicht aus dem Feuer errettet hatte, wie damals die drei Männer aus dem Feuerofen, das war eine Frage, über die seufzte sie, so oft ihr Herz sie stellte. Malte würde nimmer erlaubt haben, daß ein Laut des Murrens wider den Heiland aus seinem Hause aufstieg, darum seufzte sie, und dies Seufzen war wie eine Klappe, unter die sie solche Fragen fest verschloß – aber ein Freund war er ihr nicht, der Heiland, der ihren Mann wohl herrlich und selig gemacht, aber ihn nicht für sie gerettet hatte.
»Schweig still, Malte! Gott ist Gott und kann tun, was er will!« So hatte sie ihrem kleinen Sohn geantwortet, als die stille Frage ihres Herzens plötzlich aus seinem Munde an ihr Ohr schlug. Und Malte schwieg und schlich sich hinaus auf den Kirchhof, wo zwar des Vaters Leiche nicht ruhte, die war versunken, nicht wie sonst die Leichen der Schiffer versinken, im Sturm – nein, still und friedlich; tiefblau war das Meer gewesen, das ihn aufnahm, heraus zwischen den häßlichen schwarzen, qualmenden Schiffstrümmern, die noch wochenlang das Ufer umtanzten. Auf dem Kirchhof stand nur das Denkmal, das dankbare Liebe dem Vater gesetzt hatte. Hoch ragte das Kreuz von schwarzem Granit über all die weißen Holzkreuzlein herüber, und leuchtend funkelte es in großen Goldbuchstaben: » Dem treuen Schiffer Malte Ethé, der sein Leben ließ für seine Freunde.«
An dieses schwarze Kreuz lehnte Malte der Kleine gern sein Kinderköpfchen, und sein Herz schwoll in Liebe und in unbändig knabenhaftem Stolz zu dem Vater, dessen er sich kaum erinnerte. Wo wird man ihm sein Denkmal setzen?
Einstweilen lebte der kleine Inselprinz wie die Lilien auf dem Felde, niemand zu Nutz, aber vielen zur Freude. Es kam ihm nicht im entferntesten in den Sinn, daß er sein sorgloses Leben, seine schönen Röcke und seine bevorzugte Stellung einzig und allein dem Umstand dankte, daß sein Vater das Leben gelassen hatte für die Brüder. Er nahm das alles selbstverständlich hin ohne Nachdenken und ohne Danken. »Danke« sagen, das konnte er zwar, und einige mütterliche Rippenstöße erinnerten ihn, wenn er es vergaß – denn so nachsichtig Frau Ethé sonst mit ihrem Jungen war, auf »gute Manierlichkeit« hielt sie etwas. Zwischen danken und »danke sagen« ist aber bekanntlich ein tiefer Unterschied: das eine können nur demütige Herzen, das andere kann auch der Papagei lernen.
Jeden Sonntag ging Frau Ethé mit ihrem Malte in die Kirche – natürlich, denn das hatte ja auch der Vater getan. Malte trug dann sein bestes Röckchen mit Samthosen und hielt des Vaters Gesangbuch würdevoll unter dem Arm. Er ging gern in die Kirche, was man von seiner Mutter nicht unbedingt behaupten konnte. Es war so feierlich da drinnen. Seine großen blauen Augen hingen unverwandt an den Lippen des ehrwürdigen Pastors, nur manchmal wanderten sie langsam weiter zu dem großen Altarbild, wo der Herr Jesus dastand mit den aufgehobenen Händen, mit denen er den kleinen Malte segnen wollte. O, er wollte sich gern segnen lassen und ganz gewiß immer gut und fromm sein. Mit Wasser aus der schönen, silbernen Taufschale war er ja getauft, wie schön war der Engel, der die Schale hielt – das war gewiß sein Schutzengel. Wenn man getauft ist, dann ist man ja ein wahrhaftiges Gotteskind und geht direkt ins Himmelstor hinein, wenn's ans Sterben kommt.
»Mutter,« sagte der kleine Malte einmal, als sie aus der Kirche kamen, »warum sind die Menschen nicht alle wie wir und wie Vater war?« Frau Ethé wußte im Augenblick nicht, ob sie darüber schon mal nachgedacht hatte, und darum schwieg sie. »Sie gehen nicht zur Kirche wie wir, und sie beten auch nicht wie wir. Warum tun sie das nicht, Mutter?«
»Weil sie es nicht mögen,« sagte die Mutter gleichgültig, »sie sind roh und gottlos.« Sie dachte nicht viel bei dem, was sie sagte, sie hatte schon in der Kirche immer darüber nachdenken müssen, daß sie morgen nach Stralsund fahren und sich ein neues Kleid und für Malte ein Mützchen besorgen wollte. Als sie jetzt in ihres Kindes Augen blickte, die so fragend und traurig sie ansahen, da fügte sie erklärend hinzu: »Es hat immer mehr Gottlose gegeben, als fromme Leute.«
»Für die Gottlosen starb der Herr Jesus, nicht wahr, Mutter?«
»Ja, mein Sohn.«
»Waren das auch Gottlose, für die Vater starb?«
»Ich weiß nicht, mein Sohn – ich kenne sie nicht. Aber sie haben sich dankbar gezeigt, und das war doch schön von ihnen.«
Malte hielt sein Köpfchen schief und schwieg. Nach einer Pause fing er wieder an: »Aber das mußten sie doch, Mutter?«
»Was, Malte?«
»Wenn Vater doch starb und sie nun nicht starben, dann muß es doch so sein, daß sie uns Geld geben und daß sie ihm das Denkmal gemacht haben! Sonst kann das ja nicht jeder lesen, daß Vater für sie starb, wenn sie kein Denkmal machten.«
»Ja, ja, Malte!«
»Wenn einer für mich stirbt, dann muß ich auch Geld geben und ein Denkmal machen. Ja, Mutter?«
»Man muß immer dankbar sein,« sagte Frau Ethé kurz und schritt dann rascher vorwärts. Es ward ihr plötzlich so heiß im Herzen. In ihrem Zimmer hing ein Kruzifix, das hatte ihr Mann ihr zur Hochzeit geschenkt. Sie sah eigentlich nie danach hin, aber sie erinnerte sich in diesem Augenblick deutlich, wie Malte oft still davor saß und mit gefalteten Händen darauf hinblickte. »Das tat ich für dich! Was tust du für mich?« hatte sie ihn einmal flüstern hören. Ihr Malte war kein Gottloser gewesen, nein, wahrhaftig niemals, so lange sie ihn kannte, aber er hatte sich immer einen Sünder genannt, und was ihr kleiner Malte sie heute gefragt hatte, das war ihres großen Malte Trost gewesen, den er sich und andern aus der Bibel herauslas: daß Jesus Christus für Gottlose gestorben ist. »Für »Gottlose« – was half ihr das? War sie nicht fromm? Hielt sie sich nicht zur Kirche und zum Sakrament, wie keine andere auf der Insel? Warum schrie denn ihr Herz und Gewissen in diesem Augenblick so weh und wund? Was fehlte ihr noch?
»Bubi,« sagte sie an jenem Abend und packte fest des Jungen Hand, »hast du auch den Heiland lieb?«
»Ja, Mutter, den Heiland und die Englein und den Himmel, wenn er so blau ist und so rein, und die kleinen weißen Möwen, die sind auch rein und fromm. Nicht, Mutter?«
Da nickte die Mutter und küßte ihn. »Mein frommes Kind, Gott segne dich!«
Da freute das Bübchen sich und lachte sie an. Er will nimmer wild sein wie die andern Buben. »Ich bin klein – mein Herz ist rein, soll niemand drin wohnen als Jesus allein.«
Das war Maltes tägliches Abendgebet, und die Mutter wischte sich eine Träne aus dem Auge, wie er es heute betete. Es paßte doch gar zu schön auf ihren herzigen Jungen.
![]()
Die gute Frau Ethé hatte gewiß keine Ahnung davon, daß sie bei der Erziehung ihres Malte schnurstracks das Gegenteil erstrebte von dem, was Gott der Herr wollte. Unser Gott will seine Kinder klein machen und fein demütig. Frau Ethé aber tat ihr Bestes, ihr Kind groß zu machen und – »stolz«. O nein! vor dem Wort würde sie erschrecken, und doch, ist es nicht Stolz, wenn eins sich mehr dünkt als alle andern? Ach, der Widersacher, der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe, und wo er ein Kinderherz sieht, das umwehrt und ummauert ist wider die Gemeinheit, dem ein Stück Himmel ins Herz gebetet ist und ein Odem der Gottesliebe das Herz durchweht, da umschleicht er solchen Weinberg des Allerhöchsten, bis er das Unkraut hineingebracht, das alles überwuchert und verdirbt, den schlangengiftigen Hochmut. Und da findet er Helfershelfer ohne Zahl. Die bösen Buben konnte er nicht gebrauchen bei dem kleinen Malte, um ihn auf schlechte Wege zu locken – aber die Verachtung, mit der das Prinzlein die bösen Buben ansah, die war ein guter Nährboden für all den Hochmutssamen, den der törichten Mutter stolzer Ehrgeiz und tote Frömmigkeit auf diesen Boden schüttete. Der braven Fischer ehrfürchtige Behandlung aber war wie die Sonne, die das Ganze wachsen macht. Niemand sah das, auch der Herr Pastor nicht, der doch der einzige war, der des kleinen verwaisten Maltes Seelenleben in tiefem Ernst bedachte und in herzlichem Gebet vor Gott brachte. Aber wie schon der Vater Malte die Freude seines alten Herzens gewesen war, so war es nun auch der Sohn. Er sah nichts an dem Jungen wie lauter Licht und las den offenen Himmel aus seinen herzigen Augen und die stumme Bitte: »Behüte mich!« Darum holte er ihn auch oft in seine Stube, nahm ihn auf seine Kniee und erzählte ihm von dem Heiland, der ihn segne und liebe, und von dem Vater, der nun im Himmel auf ihn warte und ab und zu eins von des kleinen Malte goldigen Englein fragte, ob denn sein Büblein auch fromm sei und gut. Das hörte Malte gern. Er fand es auch ganz natürlich, daß der Heiland ihn lieb hatte, hatten ihn doch alle Menschen lieb, nur etliche böse Buben nicht, die schlecht und gottlos waren und es nicht leiden mochten, daß er fromm war und gut.
»Und wenn die Englein dem Vater erzählen, dann freut sich Vater, nicht wahr, du, Herr Pastor, du?«
Ein paarmal, wenn der Kleine so fragte, waren dem Pastor die Tränen in die Augen gekommen, weil das so süß und unschuldig klang, dann hatte er genickt und »Ja, ja, mein Bübchen,« gesagt und ihn fest an sich gedrückt.
Als Malte größer und ein Schulbube geworden war, da fragte der Pastor ihm den Katechismus ab, und er wußte ihn am Schnürchen, dafür sorgte Frau Ethé, da konnte der Pastor doch wieder nicht anders als sagen: »Gut, gut, mein Bübchen!«
Sonst gefiel Malte das Lernen nicht sonderlich, und der Herr Lehrer sagte nicht immer: »Gut! gut!« Ja, er sah manchmal ganz griesgrämlich aus und faßte den kleinen Malte unsanft ans Ohr. Dann lachten die andern Jungen und freuten sich, daß es dem Prinzlein auch einmal nicht besser ging als ihnen allen. Malte aber stand in solchen kritischen Augenblicken da, stolz wie ein leibhaftiger Prinz; er weinte nicht, er biß die Lippen fest aufeinander, und die blauen Augen sahen den Lehrer so traurig und vorwurfsvoll an, daß dieser den Blick nicht lange ertragen konnte, seine Finger sanken sachte herab, und bei der nächsten Gelegenheit bekam Malte ein freundliches, viel bedeutendes Kopfnicken. Dann fühlte Malte, daß dem Lehrer seine »Grobheit« leid war, und sein Herz regte sich in großmütigem Verzeihen.
Malte wäre gern in der Schule Erster gewesen, und er gab sich alle Mühe. Mit brennenden Backen saß er stundenlang zu Hause über seinen Arbeiten, aber es half nun einmal nichts, Maltes Köpfchen konnte die trockenen Zahlen und andere Langweiligkeiten, die man von der Jugend fordert, nun einmal nicht behalten. Für Frau Ethé war das sehr enttäuschend, sie teilte die allgemeine Ansicht, daß Malte Pastor werden müsse, aber an des Jungen Unbegabtheit scheiterte ja dieser schöne, hohe, fromme, ehrgeizige Plan. Es gab mürrische Stunden, in denen Frau Ethé ihrem Kleinen harte Dinge sagte. Warum nur, warum hatte der große Gott da oben, der alles Gute schafft, ihrem Sohn keinen hohen Lernverstand geschenkt? Das war wieder so ein Warum, das Frau Ethé unbeantwortet unter einer Klappe ehrfurchtsvollen Schweigens verbarg, aber so oft der kleine Malte sich ungelehrig zeigte, kam dieses Warum wieder herausgeschlüpft und hinterließ allemal einen häßlichen Widerschein auf Frau Ethés hübschem, gelangweiltem und dann recht mürrischem Gesicht. Malte fühlte sich traurig und unbehaglich, wenn die Mutter so mürrisch war, und die heiligen Englein taten das ganz sicher auch. Malte hatte ein feines Empfinden für das, was Gott und die Engel betrübt, nur seines eignen Herzens wachsenden Hochmut, den spürte er nicht. Wie kam das nur? Ach, der kleine Malte wußte noch nichts von dem »Betrug der Sünde«, vor dem das heilige Bibelbuch warnt, ebensowenig wie Frau Ethé jemals daran dachte, daß das Murren wider Gott eine Sünde ist, die dem Volke Israel das Land Kanaan verschloß.
Es gab unbehagliche Stunden, in denen es sich Frau Ethé schwer aufs Herz legte: »Was soll aus dem Jungen werden? Zum Seemann taugt er nicht, zum Pastor auch nicht!« Dann bekam Malte die bittere Anklage zu hören, daß er sicher ein Taugenichts und Nichtsnutz werden würde, wenn er sich weiter in der Schule so dumm anstelle, dummer wie die dümmsten Schifferjungen. Das mochte das Prinzlein nicht hören, aber er machte ein solch gleichgültiges Gesicht und blickte vorwurfsvoll traurig auf die mürrische Mutter, dann ging er still hinaus, legte sich weit abwärts an den Strand, wo kein Mensch ihn sah, und weinte. Es waren brennende Tränen brennenden Stolzes. Niemand verstand ihn, selbst die eigene Mutter nicht. »Vater, Vater! warum hast du sterben müssen – für fremde Menschen! Komm doch zu deinem Malte, den niemand versteht!« Die weißen Möwen fuhren mit unhörbarem Flügelschlag hin und her, und das Meer rauschte, das tiefe, tiefe Meer, das Maltes Vater begrub. Niemand sah seine Tränen, und aus dem Herzen des Kindes, das auf den Händen getragen ward wie wenige Kinder, quoll es heraus heiß und bitter: »Mich hat niemand, niemand lieb!«
In Maltes weichem Herzen wohnte ein brennender Hunger nach Liebe, aber es durfte niemand etwas von diesem Hunger wissen. Warum nicht? O, der Hochmut ist ein harter Kerkermeister. Wer sein Herz in dessen Gewalt gibt, der wundere sich nicht, wenn es blutet und schreit.
Zu Füßen eines mächtigen Kreidefelsens lag das winzige, kleine Menschenkind und kam sich mit seiner eigenen kleinen Person gar wichtig vor. Er hätte sonst vielleicht etwas verstanden von der stummen Sprache der stummen Kreatur. Sein Fuß stieß an einen mächtigen Stein, der war in der letzten großen Sturmflut samt Kalk und Erde heruntergestürzt. Damals hatte er seiner Mutter den Spruch zugeflüstert, den er gerade für die Schule lernen mußte: »Es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber – –.« Warum denkst du nicht an das selige »Aber« der Gnade, du dummer Junge, wenn dein Herz so verlassen ist? – Vielleicht weil man ein demütiges Herz braucht, um Gnade suchen und lieben zu können.
![]()
Der alte Lehrer war ein leidenschaftlicher Raucher, und die pietätlosen Jungen, die immer auf böse Streiche sannen, mochten nichts lieber, als ihm seine Pfeifenköpfe zertrümmern. Es war niemals gelungen, einen der Übeltäter zu erfassen, denn er wußte sich immer behende aus dem Staube zu machen. Malte war der einzige, der sich an diesem fortdauernden Unfug nicht beteiligte, und der die innere Belustigung, die sich auch bei ihm regte, unter einer Miene stolzer Mißbilligung verbarg. Das reizte die andern gegen den »dummen Prinzen,« und Fritz Breunlich war der erste, der es vor einigen der ungezogensten Jungen auszusprechen wagte, daß er an Malte Ethé mal ordentlich Rache nehmen werde.
Als dieser eines Tages allein im Schulzimmer war – er wollte in der Zwischenstunde noch etwas überlernen – da flog plötzlich durch das offene Fenster des Lehrers Pfeife herein und lag gerade zu des erschrockenen Maltes Füßen in Scherben da. In demselben Augenblick stürzte auch der Lehrer vor Zorn bebend ins Zimmer. »Habe ich dich endlich, du infamer Schlingel du?« schrie er, und ehe noch Malte ein Wort herausbringen konnte, hatte der Lehrer ihn gepackt und hieb mit seinem langen, dünnen Schulstock unbarmherzig auf ihn ein. Wenn die boshaften Jungen draußen gedacht hatten, Malte weinen und schreien zu hören, so irrten sie sich. Kein Laut kam über seine Lippen, und als der Lehrer ihn endlich losließ, sah Malte ihn so stolz und ruhig an, daß es dem alten Mann ganz unbehaglich unter dem Blick der großen blauen Augen ward. Einen Augenblick dachte Malte daran, seine Unschuld zu beteuern, aber da strömten die Kinder ins Zimmer, und unter ihren teils lustigen, teils ängstlichen Blicken schloß sich Maltes Mund. »Die Feiglinge lügen ja doch,« dachte er verächtlich, »und wenn der Lehrer mir dergleichen zutraut – meinetwegen! mag er's tun!« Er warf den Kopf zurück, biß seine zitternden Lippen aufeinander und setzte sich schweigend auf seinen Platz.
In dem Herzen des Lehrers stiegen unterdessen beim Blick auf Malte bange Zweifel auf, er bereute seine Heftigkeit, fürchtete sich auch ein wenig vor Frau Ethé, und als die Schule aus war, hielt er Malte fest.
»Malte, wie konntest du das tun?«
»Ich habe es nicht getan.«
»Aber du warst doch allein im Zimmer?«
»Ich habe Ihre Pfeife nicht angerührt.«
»Malte,« rief der Lehrer erregt, »wer hat es denn getan?«
Malte schüttelte den Kopf. »Ich würde niemals einen Verräter und Angeber sein, Herr Lehrer!« – Das klang sehr stolz.
»Es tut mir leid, wenn du unschuldig bist,« sagte der Lehrer mit unsicherer Stimme – »aber der Schein war gegen dich. Du mußt es selbst zugeben. Malte.«
Dieser aber sagte kein Wort mehr, und der Lehrer ging langsam, den Kopf traurig gesenkt, fort. Er mußte an Maltes Vater denken, wie er, mitten in den Flammen stehend, keinen Schrei ausgestoßen hatte – er besann sich darauf, daß er diesem kreuzbraven Mann diesem Helden Gottes, manche schwere Stunde gemacht hatte. Seine pietistische Richtung war ihm nicht lieb gewesen, in den Versammlungen hatte er oft widersprochen, und nun – nun hatte er seinen Sohn geschlagen – und: »Er ist gerade wie der Vater. Warum schrie er nicht, wie andere Kinder schreien? Es steckt auch ein Gottesheld in ihm.«
Von dem Tage an behandelte auch der Lehrer den kleinen Prinzen mit Hochachtung und Sanftmut. Maltes Herz aber erhob sich immer mehr. Die Schmerzen hatte er verbissen und der Mutter nichts gesagt, und als Fritz Breunlich ihn etwas verlegen fragte: »Malte, du Dummkopf, warum hast du dir das gefallen lassen, wenn du unschuldig bist?« da antwortete Malte: »Es ist besser, unschuldig leiden, als schuldig sein.« Da ward Fritz rot, und schweigend ging er davon.
Malte aber lag an jenem Tag lange am Strande, obwohl die See aussah, als habe ihr jemand einen grauen Sack über den Kopf geworfen, und am Himmel die grauen Wolken dahinfuhren wie jagende Ungeheuer. Malte fühlte es nicht, daß es kalt und naß war – er war so stolz, so stolz auf sich selbst. Gott der Herr im Himmel droben konnte sich freuen, daß es auf der Insel solch einen Malte Ethé gab. Und wenn er nun Ostern konfirmiert wird – was dann? –
»Junge, was soll nur aus dir werden?« hatte gestern noch die Mutter geseufzt. Aber sie wird es schon noch sehen, es wird was Famoses – was Großes aus mir. Ich werde auch tun können, was der Vater tat – – vielleicht noch mehr – vielleicht –
O, gib acht, Malte, gib acht! Als der Turm zu Babel wuchs und wuchs und man von einer Spitze träumte, die bis in den Himmel ragte, da gab es einen großen Krach und Schrecken ohne Ende. Träume nicht zu hohe Dinge – die gewaltige Hand Gottes ist höher als deine Hirngespinste sind.
![]()
Der feierliche Tag der Konfirmation war herangekommen. Tief bewegt stand der alte Pastor zwischen der festlich gekleideten Kinderschar, den Lämmern Jesu Christi. » Siehe, ich sende euch wie die Schafe mitten unter die Wölfe.« Das war ein ergreifender Text. Wie ein heiliger Schauer ging es durch die Kinderherzen, und auch in manchem bärtigen Männergesicht zuckte es in verhaltener Rührung. Malte Ethé war eines Hauptes länger, wie der größte unter seinen Kameraden, aber heute trug er das Haupt nicht hoch. Es gibt Gnadenstunden, die werden mächtig auch über stolze Herzen. Tränen schimmerten in Maltes blauen Augen, und eine Flut guter Vorsätze stürmte durch Kopf und Herz. Die segnende Hand des Pastors ruhte sehr schwer auf des Jungen Haupt. » Gott widerstehet den Hoffärtigen, aber den Demütigen gibt er Gnade,« das war Maltes Konfirmationsspruch.
Sie hielten alle ihre Konfirmationssprüche hoch und heilig, obwohl sie nicht ahnten, wie ernst der Pastor es beim Auswählen derselben nahm. Über jedes einzelnen Kindes Namen faltete er die Hände und nahm dann die Sprüche, wie Gott sie gab, wie sie ihm während des Gebetes in den Sinn kamen.
»Den Demütigen Gnade!« das wollte Malte auch gern für sich nehmen, obwohl er weder recht wußte, was Demut, noch was Gnade war.
Malte hatte viele Geschenke bekommen, darunter sogar eine goldene Uhr, eine schön gebundene Bibel und eine größere Geldsumme. Die anderen Buben sahen noch einmal mit etwas Neid auf den kleinen Inselprinzen, er aber wußte, daß dies die Schlußgabe war, das letzte, was dankbare Liebe für den Sohn des Vaters tun wollte.
»Die Summe genügt, um ein Handwerk zu lernen,« sagten die guten Freunde, der Herr Pastor aber hatte gleich einen praktischen Vorschlag. In Stralsund wohnte ein Schneider, der war ein gottesfürchtiger Mann und verstand dazu sein Handwerk aus dem Grunde. Er war dem Herrn Pastor gut befreundet und verfertigte ihm seine gesamte Garderobe, dazu hatte er auch Maltes Vater gekannt und ab und zu dessen Zusammenkünften beigewohnt, – darum wird Schneider Rolaf den Jungen gern in die Lehre nehmen, wird es nicht zuviel kosten lassen und den Malte nach Leib und Seele versorgen.
Frau Ethé und ihr Sohn fühlten sich beide ein wenig gekränkt bei diesem entschieden sehr guten Vorschlag. Sie sagten das beide nicht, Frau Ethé sagte vielmehr nur etwas sehr Gutes und sehr Frommes, nämlich, daß sie des Herrn Pastors hochschätzbaren Rat noch vor dem Herrn bedenken müßte, damit sie klar erkenne, ob es Gottes und ihres seligen Mannes Wille sei, daß ihr einziges Kind ein Schneider würde. Es fiel dem Pastor bei dieser Rede auf, daß Frau Ethés Stimme hart und erregt klang, und er fragte daher mit einer ihm ungewohnten Strenge im Ton, ob Frau Ethé das Schneiderhandwerk nicht gut genug erachte und welche Pläne sie denn sonst etwa für ihn habe? Darauf hatte Frau Ethé viel zu klagen über die sorgenbeschwerte Lage einer Witwe im allgemeinen und über ihr Leben insbesondere, seit ihres guten Mannes Tode sei dasselbe nichts gewesen als eine Kette von Enttäuschungen. Der Pastor war Menschenkenner genug, um zu wissen, welcher Quelle dieser Klagestrom entsprang, und als er jetzt in Maltes Gesicht sah, da fuhr durch seine Seele jener Schreckensruf, den der Heiland im Gleichnis vom Unkraut unter dem Weizen seinen Knechten in den Mund legt: »Herr, hast du nicht guten Samen auf deinen Acker gestreut? woher hat er denn das Unkraut?«
An jenem Abend mußte Malte noch einen langen Spaziergang mit dem Herrn Pastor machen. Er fühlte sich darüber sehr geehrt und erfreut. Er mußte den treuen alten Freund seines Vaters bis an dessen Lieblingsplätzchen führen zu den hohen Steinen, unter denen das Wasser spielte, an die steilen schneeweißen Kreidefelsen, zu deren Füßen die uralten Buchen rauschten. Da setzten die zwei sich hin, und Malte bekam zu seinem Konfirmationsspruch noch eine Textauslegung, die er nie wieder vergaß. Das Meer war so still, so still, fast als hielte es den Atem an. Der Widerschein der versunkenen Abendsonne goß einen rosigen Schimmer über Himmel und Meer, daß es dalag wie ein müdes Kind, das sich über sein wildes Brausen und brüllendes Schäumen schämt und nun still sein will und artig, fromm und gut, ein folgsam stilles Friedenskind.
Malte hatte den Kopf gesenkt, und stille Tränen fielen auf seine gefalteten Hände. Es war ihm selber ganz wunderbar, daß er sich dessen gar nicht schämte, er, der seine Tränen sonst herunterzwang mit der ganzen Kraft seines hochmütigen Jungenstolzes; er, der sich am Kaffeetisch seiner Mutter noch so stolz, groß und mannhaft gefühlt hatte in seiner konfirmierten Würde, er betrug sich wie ein Kind, er weinte, weil er gescholten ward, er versprach, Demut zu lernen, und schämte sich über das alles nicht; nur darüber schämte er sich, daß er so ein dummer, hochmütiger Junge war, dem deshalb Gott widerstehen mußte. Er hätte vielleicht ein Pastor werden können, – aber Gott widerstand ihm, daß er im Lernen nicht vorwärts kam.
»Und glaube mir, mein Sohn, das war Gnade von Gott. Ein hochmütiger Pastor ist ein Greuel vor Gott. Er kann nicht für Gott arbeiten, sondern nur für sich selbst, denn er sucht nur ›seine Ehre‹.« So hatte der alte Pastor gesagt, und scheu hatte Malte in sein ehrwürdiges Gesicht geblickt, in dem tiefer Schmerz zuckte. O, wie schrecklich muß der Hochmut sein!
Still gingen sie nebeneinander nach Hause. Die rosigen Wolken waren verschwunden, aber leuchtend stand der Mond am nachtschwarzen Himmel und warf einen goldigen Schein über die düstere Tiefe.
Dem Pastor tat das Herz weh, weil das Kind an seiner Seite noch immer weinte. Er hätte es gern getröstet, aber ein Etwas in ihm hielt ihm den Mund. »Wir haben zu viel aus ihm gemacht,« sagte er sich, »wir haben das vaterlose Kind verdorben mit unserer Liebe. Ich auch, du armes Bübchen – ich auch!«
Des Mondes goldiger Strahl huschte wie segnend über Maltes Haupt, in des Jungen Herzen aber ward ein Bild lebendig, ein Haupt voll Blut und Wunden, und zum erstenmal zitterte die Frage durch seine Seele, ob der Heiland, der für Gottlose starb, auch für seinen – Malte Ethés Hochmut gebüßt habe?
![]()
Frau Ethé war recht übler Laune, und ihr »Warum?« flog gleich vergifteten Pfeilen immer wieder durch ihre Seele. Ihr Gesicht trug denselben mürrischen Ausdruck gekränkter Würde, ob sie sich von den Knien erhob oder am Herde hantierte, ob sie Maltes Sachen in Ordnung brachte oder sich zum Nachmittagsschläfchen in den großen Lehnstuhl setzte. Malte mußte einen Schild haben gegen alle diese Pfeile. »Demut und Sanftmut,« dachte er seufzend, aber er mußte sich wohl vergriffen haben, denn sein beharrliches Schweigen, mit dem er fort und fort an der Mutter vorübersah, glich dem Hochmut, dem Gott widersteht, auf ein Haar, hat aber von Demut und von dem Lichtschein, den Gnade um sich verbreitet, nichts, gar nichts an sich.
So war Malte denn innerlich erleichtert, als alles abgemacht war, Schneider Rolaf zustimmend geantwortet hatte und er mit Sack und Pack an der Seite der Mutter auf dem Bahnhof stand.
»Geh' mit Gott, mein Sohn, und mache mir keinen Kummer. Sieh nur zu, daß du wenigstens ein tüchtiger Schneider wirst. Du weißt ja, ich wünschte anderes für dich –«
»Ja, ja,« erwiderte Malte, und es war schwer zu erkennen, ob Rührung, Abschiedsweh, Zerknirschung oder Ungeduld hinter diesem »ja, ja!« steckte.
»Ich wollte dir zu etwas Größerem emporhelfen. Gern hätte ich Opfer gebracht, wenn –«
Da fuhr rasselnd der Zug in den Bahnhof. »Adieu, Mutter, adieu!«
So sauste Malte Ethé ins Leben hinein. »Zu Größerem« hatte die Mutter ihn bestimmt gehabt. »Zu Größerem! zu Größerem!« so schienen die Räder der Eisenbahn zu rufen. Nun, er wollte der Mutter und den andern schon zeigen, was er kann, wenn er nur erst auf eigenen Füßen stehe.
»Zu Größerem! zu Größerem!« immer hastiger klang es, immer dringlicher, des Jungen große Augen leuchten und glühen. Was will er werden? Was Großes! Also ganz gewiß kein Schneider!
Schneider Rolaf war ein kleines, verwachsenes Männchen mit großem Kopf, einem runden, wohlwollenden Gesicht und klugen Augen. Er begrüßte Malte sehr herzlich, er gab ihm sogar einen Kuß, was er sonst bei seinen Lehrlingen nicht tat, und dazu hätte er sich auf die Fußspitzen stellen müssen, wenn sein langer Lehrling sich nicht freundlich zu ihm herabgeneigt hätte. Dann sah Meister Rolaf ihn mit seinen klugen Augen prüfend an. »Du gleichst deinem Vater, Gott hab ihn selig, was die Augen anbetrifft, sonst hast du deiner Mutter Gesicht. Hm, hm! Nun, wir werden ja sehen.« Malte ward rot unter den prüfenden Blicken, und dazu nickte Rolaf wohlgefällig mit dem Kopf. Er war noch aus der alten Schule, und deshalb nannte er die »forschen« Jungens, die »alles zu können meinen«, Grünschnäbel, und die nie rot wurden, die waren ihm »verdächtig.«
Er nickte also wohlgefällig und sagte dann: »So, nun iß und trink, mein Sohn, und dann komm her und zeig uns, was du kannst. Der da sitzt, das ist Fritz, fängt gerade an, das Schneider-ABC zu können, aber es sitzt noch viel Wind in seinem Kopf, das macht wohl, weil er aus Berlin ist. Der da« – und er wies auf ein blasses Bübchen zu seiner Rechten, »ist Anton, mein Eigener.«
In diesem Augenblick steckte auch die Frau Meisterin den Kopf zur Tür hinein. Sie hatte ein derbes, frisches, fröhliches Gesicht, und ihr: »Schön willkommen!« klang herzlich genug.
Dies war Maltes neues Heim, und es hätte jedem vernünftigen Jungen wohl sein müssen in dieser Luft des Frohsinns und der Liebe. Aber das Unglück war, daß Malte weder ein Heim haben, noch Schneider werden wollte, das: »zu Größerem, zu Größerem!« klang noch immer in ihm fort und füllte den Kopf so mit neuen Plänen, daß die einfache Weisheit des alten Schneiders keinen rechten Raum mehr darin fand. Wenn sie abends allein miteinander waren, dann mußte Fritz dem Malte von Berlin erzählen. Fritz war ein lustiger Strick, und als er merkte, daß sein Kamerad »von nichts nich« wußte, da log er zu allen Berliner Herrlichkeiten noch eine tüchtige Portion zu. Er riet ihm, »mal hin zu machen« nach Berlin. »Wenn der Kaiser dir sehen duht, dann steckt er dir gleich mang die Garde – oder wenn du bei's Wasser bleiben willst, dann kommst du zu die Marine, und da wird man schnell ein großes Tier, so'n Admiral oder so was.«
Malte glaubte nun zwar dem Fritz nicht alles, aber vieles glaubte er ihm doch, und darüber ward ihm das Schneidern immer verdrießlicher und verächtlicher.
Der kluge kleine Schneider beobachtete unterdessen seinen Lehrling schärfer, als dieser es ahnte. Er hatte den Jungen lieb, und darum war er oft recht betrübt. »Verzogenes Bürschchen! lernt nichts – hat guten Verstand, aber schlechten Willen. Der Kopf sitzt voll Hochmutsfliegen, die brummen ihm Tag und Nacht etwas vor, daß er nichts sieht von all der Güte Gottes und der Menschen.« So lautete das Zeugnis, das nach etlichen Wochen der Meister seinem Lehrling ausstellte. Der Herr Pastor, der dieses Zeugnis in einem längeren Schreiben bekam, seufzte, und dann tat er das beste, was ein Mensch tun kann, er fiel auf seine Kniee und betete: »Menschen haben es böse gemacht und mit falscher Liebe den Schlingel so groß werden lassen, nun mache du es gut, lieber Herr und Gott! Stelle dich ihm in den Weg mit deiner starken Heilandsliebe, daß er zu den Kleinen gehören möge, denen du Gnade schenken kannst.«
Ob der Malte etwas spüren wird von der Macht heiliger Fürbitte?
Er saß am Hafen mit dem lustigen Fritz und starrte ins Wasser. Der mürrisch herabhängende Mund paßte schlecht zu dem hübschen Gesicht und dem friedlichen Abend. Malte hatte Ärger gehabt und aus diesem Ärger heraus erst auf den kleinen Schneider, seinen Lehrherrn, und dann auf das Schneiderhandwerk im allgemeinen gescholten. Sein Ärger war aber nur daher gekommen, daß die Nadel stets anders lief, als er sie haben wollte, und daß die Stiche so verschieden ausfielen wie Riese und Zwerg, daß Fritz und Anton stets früher fertig waren als er und der Meister ihm in aller Ruhe versichert hatte, er stelle sich dummer an als alle dummen Jungen, die er bisher unter Händen gehabt hätte, zusammen genommen. Weil Fritz dazu gelacht und ein ganz klein wenig die Zunge ausgesteckt hatte, fand Malte, daß es seine Ehre fordere, eine patzige Antwort zu geben; der alte Rolaf aber fand, daß zu solcher Antwort eine Ohrfeige passe, und diese Ohrfeige brannte wenig auf Maltes Backe, aber wie Feuer in Maltes Herzen. Das Abendessen rührte er kaum an, und dann bat er, mit Fritz zum Hafen hinuntergehen zu dürfen. Da saßen sie nun, die zwei. Maltes Toben hatte Fritz amüsant gefunden, sein mürrisches Schweigen fand er unerträglich langweilig. »Na, nu hör auf mit dem Gemurkse. So 'ne Ohrfeige ab und an kriegt ja jeder Lehrling einmal,« sagte er endlich gutmütig. »Was ist denn groß dabei los? Man paßt dann mal ein bißchen forscher auf –«
»Das ist es ja gerade, daß ich ein Lehrling bin, das ist das Pech. Aber halt's auch nicht lange aus. So ein krummbeiniger Schneider werde ich doch mein Lebtage nicht.«
»Was willst du denn?« fragte Fritz spöttisch.
Darauf antwortete Malte nicht. »Zu Größerem,« hatte die Mutter gesagt, »zu Größerem!« Aber was war das?
Nach einer langen Pause stand Fritz auf. »Mensch, wie bist du langweilig!« sagte er, reckte die Arme und gähnte. »Merkst wohl gar nicht, wie schön der Abend ist?«
Ja, freilich war der Abend schön, und Malte hatte das auch wohl gemerkt. Aber die spiegelklare Flut und das stille, goldig leuchtende Abendlicht tat seinem Herzen weh. Er mußte an jenen Abendspaziergang mit dem Pastor denken und an alles, was damit zusammenhing. Gott widersteht den Hoffärtigen – was Malte auch für Pläne zu machen versuchte, er wußte in diesem Augenblick, daß alles, alles scheitern und fehlschlagen würde, wenn Gott ihm in den Weg tritt. O, Malte weiß doch, wie es den kleinen Schiffen geht, wenn der wilde Sturm sie schleudert, der Fels steht unbeweglich, er weicht nicht eines Haares Breite, das Schifflein muß zerschellen, wenn's seinen Kurs verliert und auf den Felsen trifft.
»Wir wollen nach Hause gehen,« sagte Malte plötzlich, »ich bin zu nichts zu brauchen. Der grobe Alte hat mich aus dem Kurs gebracht.«
»Laß gut sein, Malte, der Alte ist nicht schlecht. Sieh' nur nicht so aus wie drei Essiggurken – weißt du, ich kenn' ihn. Er kann das nicht vertragen, wenn man mault.«
»Und ich kann Grobheiten nicht vertragen,« sagte Malte hochmütig.
Wenn Malte sich der Hoffnung hingegeben hatte, daß der alte Rolaf am andern Tage besonders freundlich sein würde, so irrte er sich. In den alten Augen schimmerte ein sehr energischer Ernst, daß es Malte doch geraten schien, wirklich einmal mit angestrengtem Fleiß zu arbeiten. Der Meister paßte ihm dabei scharf auf die Finger und ließ ihn ohne Erbarmen auftrennen, was nicht ganz nach der Schnur genäht war. Malte fühlte sich dabei zwar recht gedemütigt, hatte aber kaum Zeit, sich darüber klar zu werden, weil der Alte ihn so drängte.
»So, mein Sohn, nun einen Augenblick Pause,« sagte der Meister, und Malte ließ die Hände sinken, in der stillen Hoffnung eines Lobes. Prüfend musterte der Alte die Arbeit, dann gab er sie schweigend zurück.
»Du möchtest ein Lob hören?« sagte er dann beim Blick in Maltes Augen, dessen Gesicht sich glühend rot färbte. »Nun, du hast dir heute zum erstenmal Mühe gegeben. Zum erstenmal! verstehst du, daß das eine Schande für dich ist? – Ruhig, ruhig!« fuhr er fort, als Malte zornig aufsprang, »setz' dich nur hin, mein Sohn. Nicht gleich so zornmütig und empfindlich. Wer nichts leistet und doch die Nase hochträgt, ist ein Narr. Hüte dich davor, Malte Ethé!«
Malte hütete sich ein paar Tage, denn er fürchtete sich vor den Augen seines Meisters, aber wenn er mit Fritz allein war, dann mußte dieser ihm die Welt beschreiben, die große, schöne Welt, in der man frei ist, frei wie der Adler, der zu den höchsten Höhen fliegt. –
Eines schönen Morgens trat Malte im Sonntagsstaat vor seinen Meister. »Meister,« sagte er mit leisem Beben in der Stimme, »ich möchte fort von hier.«
»So, hm!« sagte der Meister, und in seinen Augen blitzte ein Etwas, vor dem Malte seine Augen schnell niederschlug.
»Zum Schneider tauge ich nicht!«
»So! Wer hat dir das gesagt? Ich etwa?«
»Nein,« sagte Malte und blickte seinem Meister mit innerer Anstrengung fest in die klugen Augen. »Ich möchte ein Seemann werden, wie –« er stockte – »wie mein Vater es war.«
Über des Meisters Gesicht lagerte sich ein Zug tiefen Mitleids: »Gott steh' dir bei, mein Junge! Willst du werden, was dein Vater war, so bekehre dich zu deinem Heiland, und laß dir ein Herz schenken, wie dein Vater es hatte, demütig, stark und treu. Dein Vater stand auf seinem Posten, Malte, bis – bis in den Tod! Und du? Du willst jetzt schon davonlaufen, weil das Arbeiten dir nicht gefällt und dein alter Meister dir zu scharf ist!«
»Arbeiten will ich schon,« sagte Malte kleinlaut, »aber – nicht hier! Laßt mich fort, Meister! Ich tauge nicht zum Schneider!«
Nun aber ward der Alte zornig, und Malte bekam harte Dinge zu hören. Meister Rolaf hatte sein ganzes Leben lang eine tiefe Verachtung vor den »Windbeuteln« und »Wetterfahnen« gehabt. »Ein Mann soll wissen, was er will, und ein dummer Junge soll tun, was er soll. Erst frage Gott den Herrn um Rat, dann gehe vorwärts und kehre niemals um. Die Dornen schaden nichts, und über die Berge kommt man herüber an Gottes Hand. Wer aber vor jedem Schatten ausweicht, der fällt, und wer jeden Schweißtropfen fürchtet, der wird ein Taugenichts.« Das war Meister Rolafs Lebensgrundsatz gewesen, danach hatte er gehandelt und hatte es, in aller Demut konnte er es sagen, unter Gottes Segen zu etwas gebracht.
»Deine Lehrzeit hältst du aus – verstanden? Und daß du arbeiten lernst, dafür laß mich nur sorgen, Bruder Faulpelz!« Das war das Ende der Unterredung, Malte aber stürmte in seine Kammer und weinte, auf seinem Bettrand sitzend, Tränen ohnmächtiger Wut. Er redete sich ein, daß er den Alten haßte, und wußte im Grunde doch, daß er ihn achtete und liebte. Er machte die wildesten Pläne, wie er sich rächen wollte für alle »Härte und Grobheit« und hätte doch viel darum gegeben, wenn die grauen Augen ihn einmal so freundlich angesehen hätten, wie gestern den kleinen blassen Anton und er auch einmal das Lob: »Brav, brav, mein Sohn!« hören könnte.
Malte gab sich am andern Tage viel Mühe. »Er soll mich nicht wieder so anknurren.« Meister Rolaf nickte auch zweimal mit dem Kopf, aber bis zu einem: »Brav, brav, mein Sohn!« kam es nicht. Er war aber fröhlich und freundlich und erzählte mancherlei aus seiner eigenen Lehrzeit, von der schmalen Kost und den vielen Schlägen, von der kalten Kammer, wo das Wasser zu Eis fror.
»Warum liefen Sie denn nicht weg?« fragte Fritz erstaunt, während Malte dachte: Wie kann man so etwas erzählen, ohne sich zu schämen, daß man es sich gefallen ließ!
»Weglaufen?« wiederholte der Alte auf Fritzens Frage. »Warum ich nicht weglief? Weil ich ein Mann werden wollte und kein Taugenichts, und weil ich Gott fürchtete und meine Eltern liebte.«
![]()
»Weglaufen!« – Wie doch einzelne Worte den Bremsen gleichen. Man verscheucht sie, aber sie sind immer wieder da. Es ist wie eine böse Macht in ihnen, als hätte der Teufel etwas hineingehaucht, was Schmerz bereitet und nach Blut dürstet.
»Weglaufen!« Als ob Malte keinen Schmerz empfand bei den Plänen, die ihm keine Ruhe ließen und immer festere Gestalt gewannen. Er wußte nicht, was ihm das Schrecklichste war: die Furcht vor dem Mißlingen, oder der Gedanke an seiner Mutter Jammer, des alten Pastors Betrübnis, oder – eine dunkle Glut färbte seine Wangen – an seines alten Meisters Verachtung. Schrecklich war die ganze Sache und doch –
»Weglaufen! Weglaufen!« schrie es mit immer dringender Allgewalt. Aber wie? Die Sache war so schwierig – fast unausführbar! Infolgedessen war es auch sehr forsch und ein Zeichen von Tüchtigkeit, wenn es gelang. Das fachte Maltes Lust mächtig an. Auf dem Schneidertisch sitzend, starrte er mit solch energischer Entschlossenheit ins Weite, daß Meister Rolaf ihn unsanft in die Seite stieß. »Machst ja ein Gesicht, als könntest du ein Kriegsvolk bezwingen! Probier's mal erst, die Faulheit zu verjagen, Prinz Kuck-in-die-Luft!«
Hastig fuhr Maltes Nadel durch das Zeug. »Wie fang' ich das Weglaufen an? Der Alte ist zu klug und –« Da tauchte eine unheimliche Gestalt in Maltes Herzen auf, er erschrak vor ihrem Flüstern. »Nein, nein, das nicht! Ich habe noch nie gelogen!« Eine glühende Röte brannte auf seinen Backen, und der Faden zerriß, so mächtig hatte er angeruckt. »Nein! nein! – Aber Sonntag ist Vaters Todestag – er würde mir Urlaub geben! – Die Arbeit drängt, aber er täte es doch. Er hat ein gutes Herz, der alte Grobian. Wenn ich ihn bitte, so läßt er mich eine Nacht fortbleiben, – und das wäre Zeit genug, ich könnte bis Hamburg kommen – auf einem Schiff mich verstecken – und fort – gleichviel wohin. Erst nur einmal frei sein – und dann –« Malte reckte sich und holte Atem, dann aber bückte er das Haupt tief auf die Arbeit.
»Pfui, Malte! Pfui! Pfui!«
Woher kam die Stimme? Woher die heiße Angst? So Schlechtes nur zu denken! Pfui! Pfui!
»Meister,« sagte Malte demütig und blickte ihn mit seinen großen treuherzigen Augen an, »ich möchte doch ein braver Mann werden – und kein Taugenichts.«
»Gott segne dich, Junge! Das war ein vernünftiges Wort!« und weil Maltes Augen so traurig und so fragend ihn ansahen, mit diesem herzbewegenden Ausdruck, den er von frühester Kindheit an gehabt, so lächelte der Alte, nahm ihm die Arbeit aus der Hand, nickte und sagte freundlich, nachdem er sie sorgsam geprüft: »Hm! hm! macht sich, wird schon werden. Nur brav voran, mein Sohn!«
Das war das erste Lob! Heiße Tränen sammelten sich in Maltes Augen, und unversehens tropfte eine auf die Arbeit, hastig fuhr Malte mit der Hand über die Augen – das durfte niemand sehen, nein, niemand! Meister Rolaf nähte auch eifrig und tat, als habe er nichts gemerkt, aber in seinem Herzen dachte er fröhlich: »Der kann doch noch werden. Gott sei Dank!«
![]()
Die nächsten Tage lag eitel Sonnenschein über der Schneiderstube. Malte hatte eine Weste mit allen Knopflöchern glücklich fertig bekommen, und sein Meister hatte: »Brav, brav, mein Sohn,« gesagt. Darüber war Malte sehr glücklich, und daß der lustige Fritz einen Ärmel an den Kopf bekam mit dem Ausruf: »Fuscherei! Trenn auf!« das erhöhte Maltes Glück, und das war ganz gewiß nicht hübsch von ihm. Er sah seinen Kameraden mit einem so überlegenen Lächeln an, wie es den richtigen Hochmutspinseln eigen ist. Niemand hatte das gesehen, selbst der wachsame Alte nicht – aber einer triumphierte, der Erzbösewicht, der Teufel. Er weiß, daß auch die winzig kleine Wunde Gift faßt, und daß das Gift vergiftend um sich frißt. Ach, Gott weiß, welche Schmerzen das schafft.
»Heute ist Freitag,« fuhr es Malte durch den Kopf, als sie beim Abendessen saßen. Er hatte das den ganzen Tag gewußt, aber jetzt plötzlich ward diese einfache Tatsache zu einer klopfenden Unruhe. »Sonntag ist Vaters Todestag, ja! Es ist das die einzige Möglichkeit. Ein ganzes Jahr lang ist dann alles abgeschnitten – – er wird nicht immer so freundlich sein! Er hat mir ja sogar schon mal mit der Elle gedroht. – O, lügen! Pfui, nein, ich lüge nicht – noch dazu an Vaters Todestag! Aber – aber! – Ach weg, du graues Gespenst. Weg, du widerliche Lüge!«
Als Malte abends seine Glieder ins Bett streckte, da war er trotz aller Müdigkeit in fieberhafter Erregung. Er hätte weinen können, daß er solch ein schlechter Junge war, er hätte bitten mögen, daß Gott ihm verzeihe – aber er konnte das nicht, es kam ihm dann immer in den Weg, daß er ja doch besser war als viele andere, die sich um eine Lüge nicht viel grämen, und er weinte doch über den bloßen Gedanken zu lügen – war das nicht fromm, gut, mußte das Gott nicht gefallen – sehr, sehr wohlgefallen? Malte weinte. Warum eigentlich? Er betete nicht vor lauter Weinen, Müdigkeit, Verwirrung.
»Malte,« sagte Frau Rolaf am andern Morgen, »wie sehen deine Augen aus? Du hast geweint, Junge – was? Hat der Meister dich gescholten? Laß gut sein, er meint's doch gut mit euch.«
»Ich weiß, Frau Meisterin, es hat auch nichts gegeben gestern. Es ist nur – es kam mir so –« er stockte und errötete, dann sah er sie an mit seinen rührenden Augen, die voll Tränen standen. »Sonntag ist meines Vaters Todestag, und da –«
»Da kommt dir's Heimweh an?« Malte nickte.
»Bist ein guter Junge,« sagte sie mütterlich, »wir wollen mal sehen. Geh nur, der Kaffee steht schon auf dem Tisch.«
»Wie gut sie sind,« dachte Malte dankbar.
Nach der Andacht winkte Frau Rolaf ihren Mann in die Küche, und sie mußte ihre Fürsprache gut verstanden haben, denn es lag eine Bewegung der Teilnahme in seinem ernsten Gesicht, als er nach wenigen Minuten in die Schneiderstube kam. Er legte die Hand auf Maltes Schulter. »Du hast Heimweh?«
Malte nickte nur, er konnte kein Ja über die Lippen bringen. Es war ja eine Macht in ihm, die kämpfte wider die Lüge. Der Alte sah ihn forschend und schweigend an.
»Es ist morgen Vaters Todestag,« sagte Malte mit zitternder Stimme und klopfendem Herzen.
»Morgen nach der Kirche darfst du nach Hause, aber morgen abend kommst du wieder!«
»O danke!« rief Malte lebhaft, und eine Feuerglut schoß ihm ins Gesicht, »aber Meister, bitte, darf ich bis Montag bleiben?«
Erstaunt zog der Alte die Augenbrauen in die Höhe. »Bis Montag? Warum? die Reise ist nicht weit. Ein paar Stunden sind genug, sollte ich meinen.«
Aber Malte verstand das Bitten, wenn er wollte. »Eine Nacht, lieber Meister, darf ich –« er stockte – darf ich nicht eine Nacht zu Hause sein?« Die Lüge war heraus und damit die Furcht vor der Lüge. »Dann braucht Mutter nicht allein zu sein in der Nacht – sie weint so oft in der Nacht, wenn sie an das alles denkt – und – und – sie hat ja niemand wie mich!«
O Malte, Malte, hörst du es denn nicht, wie ein leises Weinen durch den Himmel geht? Spürst du es nicht, wie deine Engel das Haupt verhüllen? – Malte preßte die Hand aufs Herz. »Vorwärts, vorwärts, nun hilft nichts mehr!« – Wer flüstert das in sein Ohr? – O, das klang wie Schlangenzischeln.
Die Erlaubnis ist erteilt. Malte hat dem Alten die Hand gedrückt. »Danke, Meister! danke vielmals!«
Der Sonntag kam, und der Himmel hing voll dicker, grauer Wolken. »Gott widersteht – –« fuhr es wie ein Schrecken durch Maltes Herz – aber Unsinn! Was geht mich ein bißchen Regen an? Die Mutter hat ihm ja des Vaters Gummirock geschenkt, den hängt er um, darunter kann er ein Bündelchen Sachen bergen – das paßt famos.
In die Kirche mußte er noch mit, der Alte fragte ihn nicht, ob er Lust hatte. Gehört hat er aber nichts von der ganzen langen Predigt. Die ganze Zeit tobte eine wilde Jagd von Gedanken durch des Jungen Herz, Gedanken, die sich untereinander verklagten und entschuldigten. Der Sturm rüttelte an den Kirchenfenstern. Nur zu! nur zu! Er will ein Held werden wie sein Vater. Er will lernen ein Steuer lenken und ein Rettungsboot durch die schäumenden Wellen treiben. Er sieht schon im Geist die angstschreienden Menschen, die auf sinkendem Schiff keine Hilfe mehr sehen, und dann kommt er – er – Malte Ethé, als Retter. Kühn steht er im Boot – furchtlos und stark. Nur – ja, was war es, was ihm auf einmal übers Herz kroch wie eine lähmende Angst? Sie waren alle aufgestanden, auch Malte, denn der Pastor sprach den Segen. »Der Herr segne dich und behüte dich –« Malte faltete die Hände. Ach ja, einen Segen auf die weite Reise, das könnte er brauchen, aber nicht wie milder Tau, wie Sturmesheulen und Wogenbrausen ging es über sein gesenktes Haupt. Der heilige Herr dort oben, er segnet nicht nur, er widersteht, er straft – still, still! Die Kirche ist ja aus – »endlich!« seufzte Malte. –
»Adieu, Meister, und ich danke auch noch einmal!« So stand er eine Stunde später vor seinem Meister.
»Schon gut! schon gut! und grüß' die Mutter. Morgen ein Uhr bist du pünktlich wieder hier!«
»Ja, Meister!«
Es lag etwas in Maltes Gesicht, was den Alten veranlaßte, noch einmal zu sagen: »Pünktlich! verstanden?«
»Ja, gewiß!«
Gewiß! Malte, was hast du getan? Wie gejagt rennt er durch die Straßen. Der Wind reißt ihm die Mütze vom Kopf. Weiße Schaumköpfe tanzen auf der farblos grauen Flut, der Regen schlägt ihm ins Gesicht. Nur zu! Es ist ihm ganz recht so. Er will sich alles um die Ohren schlagen lassen, vergessen will er die stillen Stunden, wo rosige Wölkchen das spiegelglatte Wasser zauberhaft färbten, wo des Heilands heilige Nähe so spürbar war; vergessen will er, wie er unter dem blauen Himmel den Möwen nachsah und von Reinheit träumte und von Himmelsglück.
»Vierter Klasse Hamburg!« Das Geld reicht. Er behält noch 2 Mark 30 Pf. in der Tasche. Er hat Glück, der Zug geht in einer halben Stunde schon. Wenn nur kein Bekannter ihn sieht und der alte Rolaf Wind von der Sache bekommt. Bei jedem nahenden Schritt blickt er scheu um sich. O, wer hätte das gedacht, daß Malte Ethés Sohn sich verbergen müßte wie ein Dieb!
Endlich! endlich pfeift die Lokomotive, langsam setzt der Zug sich in Bewegung. »Gott sei Dank!« seufzte Malte erleichtert, ohne doch seinem Gott zu danken! Wie könnte er auch?
Es ist schon Nacht, als der Zug endlich in Hamburg einläuft. Malte fühlt sich wie gerädert von der langen Fahrt, nun steht er verwirrt mit seinem Bündelchen mitten auf der Straße. Es schwindelt ihm zwischen den rasselnden Wagen und hastenden Menschen. »Wo komme ich wohl zum Hafen?« fragte er endlich ein blasses Bübchen, das mit einem Korb am Arm schlaftrunken auf einer Türschwelle hockt.
Verständnislos starrt der Junge ihn an. »Schwefelhölzer, mein Herr,« ruft er dann in sanftem, klagendem Ton, »ich habe nichts verkauft.«
»Bring' mich zum Hafen, und du sollst dreißig Pfennige haben!« rief Malte halb mitleidig, halb verzweifelt.
Das half. Der Junge schüttelte die Schläfrigkeit ab und trottete schweigend neben Malte her, einen weiten Weg.
Endlich waren sie am Hafen. Geisterhaft hoben sich die Riesendampfer von dem schwarzen Nachthimmel ab. Wie drohende Finger eines Riesen schienen Malte die zum Himmel ragenden Masten. Still und menschenleer war es am Hafen, der Regen fiel immer dichter, bittend blickte das vor Nässe zitternde Bübchen zu seinem langen Begleiter empor und rannte dann spornstreichs davon, als er die drei Geldstücke in der Hand hielt. Malte blickte ihm nach, die kleine Gestalt war schnell verschwunden – ach, er mag ein elendes Zuhause haben, aber der einsame Malte dachte es sich doch herrlich, so nach Hause zu rennen.
Der kalte Regen und die düstere Nacht wirkten sehr ernüchternd auf Maltes Pläne. Was sollte er anfangen? Fritz lag jetzt schon im süßen Schlummer. Eigentlich war das Lehrlingskämmerchen doch sehr sauber und behaglich. An der Wand hing ein Christusbild und darunter der Spruch: »Der Herr segne dich!« Malte sah das sehr deutlich vor sich und wußte in diesem Augenblick ganz gewiß, daß Gott ihn strafen und nicht segnen wird. Unwillkürlich schauderte er zusammen. Soll er hier in der Nähe eine Schlafstelle suchen und morgen herumfragen bei den Kapitänen, ob einer einen Schiffsjungen brauchen kann? Ja, am klügsten wäre es – aber Malte scheut das Tageslicht. Es scheint ihm möglich, daß auch in Hamburgs Riesenhafen ein Rügener Seemann auftauchen und ihn erkennen könnte. Horch, da nahen Schritte, und lautes Lachen tönt durch die düstere Stille. Ein Haufen junger Burschen ist's, die aus einer der nahen Seemannskneipen kommen. Sie achten nicht auf Malte, aber er hört, wie einer sagt: »Ja – um drei Uhr lichtet die ›Hertha‹ die Anker.« – »Und wohin?« Malte hat die Antwort nicht verstanden, aber sein Herz klopft. »In drei Stunden schon!« Das würde ihm passen. Fort! nur fort! schreit ja alles in ihm. Um 3 Uhr ist noch Dämmerlicht, sie würden ihn vor der Abfahrt nicht bemerken, und wenn das Schiff dann nur erst in voller Fahrt ist, dann – – ja, was dann? Wie wird der Kapitän ihn ansehen, wenn er vor ihn tritt! O, Malte weiß, daß die alten Seebären roh sein können und sehr hart, aber – Malte hebt stolz den Kopf, gegen ihn sind sie es niemals gewesen, sie haben die rauhen Stimmen gedämpft um seinetwillen! Der Kapitän wird schon merken, daß er kein gewöhnlicher Junge ist. »Zu Größerem, zu Größerem!« Da ist es wieder, das alte Feuer. Nur nicht gefaßt werden, nur nicht zurücktransportiert werden, und vor des alten Meisters ernsten Augen stehen. Malte fürchtete den braven Schneider mit dem goldenen Herzen in diesem Augenblick mehr als den Zorn des unbekannten Kapitäns.
O Malte, du törichter Junge, wie kann dir der Erzlügner so den Kopf benebeln und die Wahrheit verdrehen!
Leise und gewandt wie eine Katze hatte Malte das Schiff erklettert und zwischen großen Säcken und Tonnen einen sicheren Versteck gefunden.
»Hoi – ho!« Es war noch nicht drei Uhr, als der bekannte Matrosenruf ertönte. Die Segel fielen – der Wind war günstig.
»Hoi – ho!« Das Schiff schwankte auf und nieder, eilig liefen unbekannte Gestalten an Malte vorüber. Laut und rauh klang das Kommando des Kapitäns. Malte regte sich nicht. Zwei Stunden mochten vergangen sein, und allmählich taten dem Jungen in der unbequemen Lage die Knochen sehr weh. Er reckte sich sachte ein bißchen, und dabei ragte sein Kopf über die Säcke hervor.
»Halloh! was haben wir da noch für Überfracht?«
Im Nu war Malte von kräftigen Fäusten gepackt und vor den Kapitän gebracht. Der tobte und fluchte. Einen Augenblick fing Malte an zu glauben, daß man ihn allen Ernstes über Bord werfen würde, und dieser eine Augenblick genügte, ihm klar zu machen, daß eine tiefe, schauerliche, ewige Kluft lag zwischen ihm und seinem Vater. Er schrie zu Gott in wilder Angst, während rauhe Fäuste ihn über den Rand des schwankenden Schiffes hoben – wahrhaftig, es war nur ein Schritt zwischen ihm und dem Tode.
Was den Kapitän bewog, plötzlich »Halt« zu rufen, war ihm wohl selber nicht klar. Erbarmen war es nicht. Das Herz dieses Mannes war in Tiefen hinabgetaucht, in denen es längst solche Regungen verloren halte. Er hatte schnell herausgefühlt, daß Malte von feinerem Stoff und edlerem Herzen, daß er stolz war und den Kopf voll hoher Pläne hatte. »Warte, Bürschchen, dich wollen wir klein kriegen,« dachte er höhnisch.
Malte erfuhr nun, was das heißt, wehrlos und in den Händen rohester Gewalt sein. Es gab Augenblicke, in denen die Verzweiflung ihn mit einer sinnverwirrenden Macht überfiel. Grauen und Ekel vor der ihn umgebenden Roheit und ein Heimweh, das ihm fast das Herz zerriß, jagte und plagte ihn Tag und Nacht. Die Tränen seiner einsamen Mutter, der Zorn des alten Rolaf, die Betrübnis des Pastors quälten ihn in den Stunden, wo sonst niemand ihn quälte. Und was werden die alten Schiffer sagen, die seinen Vater kannten, die Jungen, die sich oft über die Frömmigkeit und Tugend des Inselprinzen geärgert hatten? O, er kann sich ja nie, nie wieder vor ihnen sehen lassen, nie – es sei denn – daß er einst heimkehrte, nach Abenteuern und Schiffbrüchen, reich an Heldentaten, vielleicht, vielleicht würden sie dann vergessen – vergeben – und – und – »bewundernd zuhören!« –
Mitten in seinem Elend machte Malte immer noch hohe Pläne. Er schämte sich, ja, aber nicht wie die Liebe und Wahrheit sich schämte; er schämte sich, aber mitten in den Wogen der Angst und Beschämung stand sie noch, die alte, stolze Hochmutsburg, um die man Lügenschanzen bauen und Schilde der Täuschung verfertigen kann, daß die Pfeile der Wahrheit nicht so wehe tun.
»O, wenn sie zu Hause wüßten, wie es mir geht, – ich überlebte es nicht! Nein, sie sollen es nie erfahren, daß sie mich ersäufen wollten, wie man eine Katze ersäuft!« Und wenn er noch still und stolz gewesen wäre wie ein Held – nein, niemand darf das wissen, daß er geschrieen und gefleht hat, wie ein Feigling es tut. »O, Mutter, Mutter!« schluchzte Malte. Ach, er merkte jetzt erst recht, wie sehr er seine Mutter liebte und die Heimat. Ach, wie gut sie doch alle zu Hause waren! Heute in der Nacht, da hatte er einen schönen Traum gehabt. Er war daheim gewesen, er hatte die weißen Kreidefelsen gesehen und sich in des Vaters kleinem Boot geschaukelt, die Mutter hatte am Ufer gestanden, aber sie hatte krank und blaß ausgesehen. »Was ist dir, Mutter?« hatte er gefragt. Da hatte sie geseufzt: »Ich bin so müde vom Suchen.« – »Was suchst du, Mutter?« – »Die Krone suche ich – Vaters Krone – du sollst sie tragen, mein Sohn! – aber sie war so klein, und du bist so groß. Malte, Malte! wenn du bis in den Himmel wächst, muß ich so lange suchen!« – »Du sollst nicht suchen, Mutter, ich will nicht wachsen. Ach, für die kleine Krone muß man wohl sehr klein sein?« –
Es war ein schöner Traum, die Heimat zu sehen, aber eine rauhe Hand schüttelte ihn wach. »Wach auf und marsch 'rauf ins Takelwerk. Aber schnell!«
Schlaftrunken torkelte Malte aus dem Bett. Ein kalter Wind blies scharf aus Osten. Die süße Heimat und das blasse Gesicht der Mutter standen ihm vor Augen, wie sein Traum sie ihm gemalt. Bleischwer lag ihm die Müdigkeit in den Gliedern, und bei jedem Schritt fühlte er ein scharfes Stechen in der Seite. Ihm war, als könne er kaum vorwärts, aber es half nichts, er mußte den hohen Mast hinaufklettern. »Ich bin krank – ich kann nicht mehr – ach, lieber Gott, hilf mir!« Oben angelangt, legte Malte beide Arme fest um den Mastbaum, legte den Kopf daran und weinte bitterlich. Er besann sich darauf, daß er lange nicht gebetet hatte, und wie war er doch von Hause her so ein frommes Kind gewesen! Mitten in seiner großen Verlassenheit sehnte er sich nach Gott. Er war krank – ach, seine Mutter sah das nicht, aber Gott – Gott sah es doch, er mußte sich doch erbarmen über sein krankes, verlassenes Kind. Er muß? wirklich? Was muß denn Gott? Weggelaufene Buben schützen? Gott droht zu strafen – fester umklammerten Maltes Arme den Mast. Wen droht Gott zu strafen? » Alle – alle, die seine Gebote übertreten! Ach ja! ja! aber ich habe doch meine Strafe schon gekriegt, lieber Gott! Jede Stunde auf diesem vermaledeiten Schiff ist ja schreckliche Strafe. Und wenn ich auch weggelaufen bin – doch – doch –« Malte fand keinen recht schicklichen Ausdruck, dem lieben Gott klar zu machen, daß er doch noch viel tausendmal der beste war von der ganzen Schiffsbemannung und besser als die meisten andern Menschen.
Wir begehen so oft die Torheit, daß wir dem großen Herrn droben etwas klar machen möchten, während wir uns lieber wie weiland die Leute zu Ninive still in Sack und Asche hüllen und begreifen sollten, daß er uns etwas klar zu machen hat und nicht wir ihm.
Mit dieser Torheit war auch Malte auf seinem Mastbaum so angelegentlich beschäftigt, daß er das Zorngebrüll des Kapitäns, der ihm zuschrie, ob er oben eingeschlafen oder festgebackt sei, nicht hörte. Als er unten ankam, fühlte er, daß er wirklich krank war, zugleich aber fühlte er auch eine mächtige Ohrfeige von der Hand des Kapitäns.
»Ich bin krank!« schluchzte der erschrockene Malte, »die Brust tut mir weh, und ich habe Fieber!«
»So, und den Mast da oben hieltst du wohl für einen Luftkurort? Wenn du krank bist, so merke dir, daß es hier an Bord nur eine Arzenei für faule Schlingel gibt. Wenn du nach der Appetit hast, dann melde dich nur noch einmal krank bei mir!« höhnte der Kapitän. »Übrigens sind wir bald in New-York, dann laden wir die Tonnen und Säcke aus und dich dazu, dann magst du sehen, welches Hospital dich aufnimmt.«
Einen stummen Blick der Verachtung warf Malte auf seinen Peiniger und wandte sich dann langsam um. In seinem Kopfe sauste es, und Fieber brannte in seinen Augen und jagte seine Pulse. »O, wenn ich unter diesen Teufeln sterben müßte! Sie würden mich ins Wasser werfen wie einen toten Hund! Ach, lieber Gott, denke doch an meinen Vater – und hilf mir!«
![]()
Lange weiße Wolken zogen sich über den Himmel; die See, die bis dahin still gerauscht und so friedlich wie ein schlafendes Kind dagelegen hatte, machte plötzlich ein faltiges Gesicht. Die Sonne versteckte sich ein wenig, als möchte sie das graue Unbehagen nicht sehen, das über das Wasser huschte. Ein leises Pfeifen nahenden Sturmes! Immer erregter sprangen die Wellen auf und nieder. Laut tönten des Kapitäns Kommandorufe über das auf- und abtanzende Schiff. Malte hörte nichts. Halb betäubt lag er in einer Ecke. Mochten sie ihn schlagen, treten, schimpfen, ihm wäre alles gleichgültig gewesen. Aber niemand kümmerte sich um ihn. Nur ein paar ängstliche Möwen flatterten dicht über seinem fieberheißen Kopf dahin. Wollten sie ihm einen Gruß bringen von der fernen Heimat? Wollten sie ihm erzählen von der Mutter, die stundenlang auf den Knieen lag? »Herr, habe Erbarmen! Meinen Mann hast du mir genommen, rette mein Kind!« Wollten sie ihm erzählen von dem alten Pastor, der lange auf Maltes Lieblingsplatz, dem großen Stein, gesessen hatte? Seine weißen Haare wehten leise hin und her, und die Hände waren gefaltet. Sein Herz redete mit seinem Gott von dem treuen Malte Ethé, der ihnen sein Bübchen hinterlassen mußte, als er sein Leben ließ für seine Freunde. »Wir haben ihn schlecht bewahrt,« flüstert der alte Mann leise, »sehr schlecht, – aber du –« mehr sagt er nicht, es liegt aber eine starke Macht der Zuversicht in diesem »aber du« des alten Pastors. Er weiß es und hat es in seinem langen Leben oft erfahren. Es sind unaussprechlich große Dinge, die der Heiland tut.
Hu–i! Wie der Wind pfeift! Die Möwen können nichts erzählen, sie fliegen nur unruhig über dem Wasser hin und her. Malte liegt noch immer auf demselben Fleck. Seine Hand hat den Fuß einer Bank umklammert, das Schiff rollt gewaltig hin und her.
Da! ein gellender Schrei! ein Krach! der große Mast ist gebrochen, und unter seinem Takelwerk begraben liegt einer von Maltes Hauptfeinden: der Steuermann.
Schnell ist ein anderer ans Steuer gesprungen; aber was nützt das Steuer in solchem Sturm? Malte ist aufgesprungen. Er fühlt nicht mehr, daß er krank ist, er fühlt nur noch, daß er seines Vaters Sohn ist. Er weiß, was sein Vater dem Feinde tun würde, den Gott gestraft hat. Aber es ist nicht leicht, auch nur einen Schritt zu gehen. Eine mächtige Welle fährt über das Deck und schleudert Malte gegen die Wand der Kajüte. Aber er rafft sich auf, er kniet bei dem stöhnenden Mann. Er kann den schweren Mast nicht heben, aber das Takelwerk beiseite schieben, das kann er und den Verwundeten ansehen mit seinen teilnehmenden freundlichen Kinderaugen, das kann er auch.
» Wie kann ich helfen?« fragt er.
Der Mann stöhnt. »Mir kann nur Gott helfen, und der tut's nicht!«
»Doch, Steuermann, doch!« schreit Malte, in großer Angst alles vergessend, auch sich selbst und nur eines wünschend – zu helfen. »Jesus starb für Gottlose.«
»Für Gottlose,« wiederholte der Sterbende. »Junge,« schreit er dann wie in großer Qual, »was geht's dich an, ob ich sterbe wie ein Hund. Weiß Gott, ich hab' nichts Gutes um dich verdient.«
Malte lächelte. »Mein Vater starb für seine Freunde, und der Heiland starb für seine Feinde –«
»Weiß Gott,« stöhnte der Sterbende, »der Bengel ist ein Heiliger!«
Malte beugte sich tief zu ihm herab, er wischte mit seinem Taschentuch das Blut fort, das aus des Sterbenden Nase quoll – er fühlte dabei ein Glück, wie er es noch niemals gefühlt, Gott läßt keinen Becher Wasser unbelohnt, und sein Wort ist wahrhaftig nicht nur zukünftig, wie manche glauben, sondern gegenwärtig. Malte wußte das und fühlte es mit tiefer, dankbarer Beschämung, daß Gott auch weggelaufene unnütze Jungen nicht unbelohnt läßt. Aber auch in Maltes Brust wohnten zwei Seelen. Neben der Beschämung regte sich nun auch mächtig der Löwe – Hochmut. »Ein Heiliger.« Ja! ja! Liebet eure Feinde! Ja, siehst du, lieber Heiland, der Malte Ethé kann's – der Malte –
Donnernd fuhr eine Welle übers Schiff, da noch eine – das kracht! »Herr Gott, wir sind verloren!«
Das Schiff neigt sich zur Seite, tiefer und tiefer – Todesschreie erfüllen die Luft. Jede Hand greift nach etwas, jeder möchte das Leben retten – aber nichts Festes ist da! Wasser – nichts als Wasser! Da halt, ja! ein kleines Brettchen – da ein größeres – eine Schiffsplanke ist's. Greif zu, Malte! halt fest! und schrei zu deinem Gott. Er ist nicht schwer, die Planke trägt ihn! Aber da – noch eine Hand streckt sich nach derselben Planke aus. »Nein! nein! laß los: für uns beide ist's zu schwach« – aber die Hand hält fest. »Laß los!« schreit Malte. Er schlägt nach der Hand, – er schlägt, so stark er kann. Es war eine große, braune Seemannshand, aber die Fingern lockern sich, eine schwere, dunkle Gestalt sinkt herab – aber den Blick der zwei starren Augen wird Malte nie vergessen. Der sinkende Steuermann weiß es nun, daß Malte Ethé kein Heiliger ist.
![]()
Die gute Schwester im New-Yorker Seemannshospital konnte es gar nicht begreifen, was doch das deutsche Bürschchen mit dem Kindergesicht und den blauen traurigen Augen Schreckliches auf dem Gewissen haben konnte. Wochenlang hatte sein Leben, wie man so sagt, an einem Haar gehangen, und in seinen Fieberphantasien war er oft im Schrecken zusammengefahren, hatte er sich verfolgt geglaubt und dann versucht, aus dem Bett zu springen – aber mehr hatte das Fieber ihr nicht verraten. Schwester Helene liebte den jungen Deutschen, und sie besann sich, wo sie doch einmal vor langen Jahren ganz ähnliche Augen gesehen hatte, die so tief und klar und von so reinem Blau waren. Viel fragen mochte sie den jungen Kranken nicht, er seufzte dann immer so schwer und bekam so rote Flecken auf den schmalen Backen. Er sagte ihr nur, daß er Malte heiße, und daß er Heimweh habe, und daß sie gar nicht so gut gegen ihn sein müsse, weil ihm davon das Herz so weh tue.
Eines Tages bat Malte seine freundliche Pflegerin um eine Bibel. Er durfte aber noch nicht selbst lesen, der Herr Doktor hatte das verboten. So las Schwester Helene ihm, was er gern hören wollte, und das war die Geschichte vom Propheten Jonas.
»Er floh vor Gott aufs Meer!« flüsterte Malte leise, als die Schwester geendet hatte. »Schwester,« fragte er dann nach einer Pause, »warum läßt Gott die Menschen, die vor ihm fliehen, nicht sterben und verderben, wie sie's verdient haben?«
Sie sah ihn mit ihren sonnigen Augen freundlich an. »Warum nicht? Weil Gott die Liebe ist.«
Malte schloß die Augen, und die Schwester ging leise davon. Als sie nach einer Weile wieder in den Saal kam, da sah sie, daß Malte das Gesicht mit dem Taschentuch bedeckt hatte. Einen Augenblick stand sie schweigend neben ihm. »Malte,« sagte sie dann, »weinen Sie darüber, daß Gott die Liebe ist?«
Mit einem Ruck riß Malte das Taschentuch vom Gesicht. »Nein, Schwester, aber darüber weine ich, daß ich Liebe mit Füßen trat und daß ich –« er stockte – »nein, ich kann's nicht sagen, Schwester, ich kann nicht.« Die Hand, die aus der Tiefe des Meeres emporragte, Hilfe suchend – sie schien sich auf Maltes Mund zu legen, und eine heisere Stimme flüsterte: »Nicht Heiliger – Mörder!« O, es ist schrecklich, ein Mörder zu sein!
Als die Schwester jetzt freundlich seine Hand nahm, da zuckte er zusammen. Einen Augenblick war's, als wollte er sie ihr entreißen, dann ließ er sie schwer niedersinken.
Die Schwester setzte sich zu ihm. »Ich möchte Ihnen eine Geschichte erzählen, Malte, eine Geschichte von treuer Liebe. Wollen Sie sie hören?«
Er nickte.
»Da habe ich Augen gewonnen für das, was Liebe ist. Man kann Liebe nicht mehr mit Füßen treten, Malte, wenn man sieht, wie Liebe das Leben läßt für – eine leichtsinnige Welt.«
Maltes Augen waren sehr groß geworden und richteten sich gespannt auf die Schwester.
»Ich war ein leichtsinniges, junges Ding, achtzehn Jahre alt. Das Leben hatte mir nichts gebracht als Sonnenschein. Von Liebe umgeben und getragen, hatte ich noch niemals darüber nachgedacht, was eigentlich Liebe ist. Meine Eltern wollten mir die Schönheiten der Welt zeigen. Wir reisten weit umher, und endlich kamen wir auch nach Schweden und wollten von da nach Rügen, wo ein Verwandter meiner Mutter lebte. Wir benutzten einen schwedischen Dampfer, der uns nach fünfstündiger Seefahrt nach Saßnitz bringen sollte. Die See war spiegelglatt, die gefürchtete Seekrankheit konnte uns nichts anhaben. Das machte uns sehr übermütig. Sonderlich mein Bruder und ich konnten des Lachens und Neckens kein Ende finden. Da traf mich plötzlich ein Blick des Steuermanns. Seine Augen waren so blau und klar, wie ich sie selten sah« – sie stockte und blickte einen Augenblick vor sich hin. »Es lag viel Sonnenschein in den Augen,« fuhr sie fort, »und tiefer, tiefer Friede. Unser Lachen verstummte, und ich setzte mich nach einer Weile ganz an das Ende der Bank, die dicht am Steuer war.«
»Es ist ein schöner Abend,« sagte ich, »und ein schönes Land.«
Der Steuermann drehte an seinem Rad, nickte und lächelte.
»Es ist ein langweiliger Posten, immer da am Rad stehen,« fing ich nach einer Pause wieder an.
Er schüttelte den Kopf. »Es ist nichts langweilig, was man für Jesus tut.«
Ich fühlte, daß ich rot ward, weil mir die Antwort so ganz überraschend kam. »Sie steuern doch nicht für Jesus,« sagte ich fast ärgerlich, »sondern für den Kapitän, für das Schiff und für uns.«
Ich vergesse nie den Ausdruck der blauen Augen, in denen es wunderbar leuchtete. »Lasset euch dünken, daß ihr dem Herrn dient und nicht den Menschen. Alles für Jesus!«
Er sprach das mehr zu sich selbst als für mich. Dann aber sah er mich voll an. »Jesus liebt Sie, kleines Fräulein. Er starb für Sie und für mich!«
Erschreckt fuhr ich zusammen. Ein gellender Schrei: »Feuer! Feuer!« Aus dem Boden des Schiffes stieg dichter Rauch empor. Ich blickte entsetzt auf den Steuermann. »Gehen Sie nach vorn, kleines Fräulein,« sagte er in sanftem, beruhigendem Ton, »der Wind treibt die Flammen hierher.«
Ich sprang mit einem Schrei auf, um zu fliehen, aber ich mußte mich noch einmal nach dem Steuermann umwenden. »Und Sie?« schrie ich.
Seine Augen waren groß und ernst, aber er nickte mir zu: »Ich bleibe hier, kleines Fräulein. Alles für Jesus – auch das Leben. Für Jesus und die Brüder.«
Ein qualvoller Schrei ließ Schwester Helene plötzlich schweigen.
»Malte, um Gottes willen, was ist Ihnen?«
»Schwester! – der Steuermann war mein Vater. Er starb für Jesus und die Brüder, und ich – ich bin ein Mörder!«
![]()
»Armes Kind, armer Junge!« sagte Schwester Helene und legte ein kühles Tuch auf Maltes Stirn. Die Erregung war zu viel für ihn gewesen. Es waren nun schon acht Tage vergangen, und er lag noch immer im Fieber. Mit dem Ausdruck flehenden Schreckens hatten seine großen, fieberglänzenden Augen sie oft angestarrt, sie, die einzige, die sein schreckliches Geheimnis kannte. Daß sie es kannte, fühlte er halb als Qual und halb als Erleichterung. »O, wie war es möglich, daß ich das Schreckliche über die Lippen brachte!« stöhnte er und sehnte sich doch danach, ihr mehr, ihr alles zu bekennen. Sein ganzes Herz mußte sie kennen mit allem Stolz und aller Sünde. Würde sie sie nicht vielleicht wegbeten können, die gräßlichen Schatten? Würde sie ihn nicht loslassen, die schreckliche Hand, die in den dunkeln Nachtstunden oft seinen Hals umkrallte? – Aber was würde die Schwester sagen? Wie müßte sie ihn verachten, wenn sie alles wüßte! Ach, Malte konnte sich ja in Wahrheit nicht denken, daß dieses sanfte, sonnige Gesicht jemals entstellt werden könnte durch den Zug harter, kalter Verachtung, wie – eine heiße Glut schoß in Maltes Gesicht, und er stieß mit dem Fuß gegen die Bettkannte – wie sie aus seinen Augen geleuchtet haben mußte, wenn er andere verachtete – er, der Mörder! In diesem Augenblick war es, wo Schwester Helenes fühlendes Tuch seinen Kopf und ihre einfachen Worte innigsten Erbarmens sein Ohr trafen.
»Schwester,« flüsterte Malte, »ich will Ihnen –« er stockte. Er konnte den Satz nicht aussprechen, denn eine eiserne Gewalt des Stolzes schloß ihm die Lippen.
Es ist ein wunderbares Geheimnis des Teufels, daß er ein Herz mitten in den verzweifelten Reuequalen doch gefangen halten kann in den eisernen Ketten des Hochmuts. Die Zellen des Zuchthauses würden bald etwas spüren lassen von der Lichtesnähe heiliger Engel, wenn die Leute, die ihre Schuld dort büßen müssen, demütige Sünder wären. Daß einer weiß, daß er ein Mörder ist, macht ihn von keiner einzigen Satanskette frei, auch nicht vom Hochmut. Die Gefangenen werden durch nichts anderes losgegeben, als durch das Blut des Lammes.
»Was wollten Sie, Malte?« fragte Schwester Helene, »kann ich irgend etwas für Sie tun?«
Er schwieg, aber es lag etwas in seinem Blick, das sie bewog, an seinem Bett niederzuknieen und zu beten.
Malte schloß die Augen und faltete die Hände. Er glaubte, eine süße, ferne Musik zu hören, halb klang es wie das leise Rauschen der See, wenn sie im rosigen Sonnenschein dalag und unter seinen Füßen hindurch zwischen den Steinen spielte, halb wie die ferne Musik, die er niemals gehört hat, und die er auch niemals hören wird, wenn das: »Vater, ich habe gesündigt in den Himmel und vor dir« nicht zu einer Macht wird, die ihn den großen Sprung wagen läßt in die Retterarme Jesu: »Hier kommt ein armer Sünder her, der gern ums Lösgeld selig wär'!«
»O Schwester,« flüsterte Malte, und die Tränen standen in seinen Augen – »könnte ich doch wieder ein Kind sein! Rein und fromm und gut!«
Sie sah ihn traurig an. »Rein und fromm und gut! O Malte, waren Sie das jemals? Ich nicht! Aber das Blut Jesu Christi, des Sohnes Gottes, ist da für Sie und für mich.«
Sie sagte nichts weiter. Sie nickte ihm nur zu und ging still davon.
»Für Sie und mich, hat sie gesagt, hat sie denn vergessen, daß ich ein Mörder bin?«
![]()
Wochen waren vergangen, und noch immer war Malte im Hospital. Der Doktor wunderte sich darüber, daß seine Kräfte sich so langsam hoben. Er durfte ein paar Stunden täglich auf sein. Dann saß er müde auf seinem Stuhl oder schlich ganz langsam ein wenig in der Sonne umher.
Schwester Helene beobachtete ihren Schützling mit Sorge. Er las viel in der Bibel, aber kein Friedensschein kam in seine düsteren Züge. »Wenn nur erst ein Brief von seiner Mutter kommt!« dachte Schwester Helene. Sie hatte ja längst an Maltes Mutter geschrieben, und ein Brief des Sohnes war dem ihren gefolgt. Endlich kam die Antwort, und sie war herzlich und voll vergebender Liebe, aber Sonnenschein brachte sie nicht in Maltes Herz.
»Sie weiß ja nicht, daß ich ein Mörder bin!« dachte Malte.
Schwester Helene betete viel für Malte, und je länger sie das tat, je klarer ward es ihr, daß ein Bann auf seiner Seele lastete, der herunter mußte. So rief sie ihn eines Tages in ihre Stube. Er kam sofort, aber sein Gesicht war ungewöhnlich blaß und sein Schritt sehr müde. Er hielt die Bibel noch in der Hand und hatte den Finger zwischen die Seiten gelegt, wo er eben gelesen hatte.
»Ich habe Sie gestört,« sagte Schwester Helene freundlich, »aber ich habe gerade Zeit und möchte Ihnen doch die Geschichte zu Ende erzählen, die Geschichte von Ihres Vaters Sterben und wie ich dadurch den Heiland fand. Aber erst setzen Sie sich und lesen Sie nur, was Sie gerade lasen, als ich Sie rief.«
Malte mußte sich schnell setzen, denn seine Kniee zitterten und auch die Hände, die das heilige Buch hielten. Jetzt schlug er es aus: »Da ich es wollte verschweigen, verschmachteten meine Ge –« weiter kam er nicht.
»Malte,« sagte Schwester Helene ruhig, »warum fürchten Sie sich vor mir? Ihr Vater starb für mich, das gibt Ihnen ein Recht an meine Liebe. Und mehr als das: Jesus starb für Sie und für mich. Ich kann niemand verdammen, für den Jesus starb. – O Malte! – ist es denn so schwer, demütig zu sein?«
Schwester Helene wunderte sich später, wie sie darauf kam, das von der Demut zu sagen, und doch war gerade das der kleine Schleuderstein, der den großen Riesen zu Boden warf. Sie wunderte sich und begriff es doch.
»O Herr, wenn du Worte in meinen Mund legst, so hilf mir, daß ich ein treuer Bote sei, der nichts dazu tue oder abtue, sondern weiter gebe, was du mir gabst!«
Der Riese Hochmut lag am Boden, und Malte bekannte seine Schuld, nicht nur in Summa Summarum, sondern auch im einzelnen. Ach, der gefallene Riese regte manchmal die gewaltigen Glieder, und Malte stockte.
Es ist wunderbar, wie leicht wir uns oft großer Schuld schuldig geben, aber die kleinen Verzweigungen der großen Schuld zu bekennen, weigert sich der Stolz.
Ja, Malte, nun fange nur an bei dem kleinlichen Hochmut deines albernen Jungenstolzes, den du plötzlich so klar vor dir siehst, fast so klar, wie dir einst in der spiegelklaren, himmelswahren Beleuchtung der Ewigkeit alles erscheinen wird. Da lag die Wurzel – und die Früchte? O wie stolz hatten die Früchte ausgesehen, die seine Phantasie ihm einst malte – und nun, wie häßlich sah sein Leben aus im Licht der Wahrheit! Nichts gelernt in der Schule und doch voll hochmütiger Prinzenwürde – nur in Religion »gut« – und warum denn das? Malte hätte aufschreien können vor dem traurigen Blick der freundlichen, mitleidigen Augen.
»Ein scheinfrommer Pharisäer war ich – Lippenwerk war mein Gebet – tote Form alles!«
»Armer Malte,« kam es leise von Schwester Helenes Lippen.
Malte warf den Kopf zurück, aber nur einen Augenblick – der Riese hatte sich wieder geregt.
»Ich muß noch mehr sagen – alles, alles – es wird immer schlimmer!«
Ja, immer schlimmer, bis zu dem Augenblick, wo sein Herz sich erhob, weil der sterbende Feind ihn einen »Heiligen« genannt – und – und – dann –
»O Schwester Helene, nun wissen Sie, wie ich bin!« rief Malte, »und Gott sei Dank, daß Sie's wissen.«
Schwester Helene gehörte zu den mitleidigen Seelen, die wirkliches Erbarmen kennen. Sie machte nichts klein, was groß war, sie hatte die richtigen, klaren Namen für die Schuld, so richtig und klar, wie die Bibel sie hat. Und weil sie das tat, so ward Maltes Herz immer kleiner und immer friedensstiller. Sie las ihm die altbekannte Geschichte, wie Jesus, das stille Lamm, das Kreuz hinaufträgt nach Golgatha – zwei Übeltäter mit ihm – und der eine – –
Malte hatte das Gesicht mit den Händen bedeckt.
»O Schwester,« unterbrach er dann plötzlich, »der zur Rechten des Heilands hing, der war, o Schwester, der war doch – –«
»Ein Mörder,« antwortete sie leise.
»O Jesus, mein Heiland!« Mehr konnte er nicht sagen. Es war auch genug. Er war ja allein mit ihm, der ins Verborgene sieht, der zerbrochene Herzen heilt und den Gedemütigten Gnade gibt.
![]()
»Der Malte ist wieder da!«
Das gab eine große Aufregung unter den Schiffern.
Aber war das wirklich der Malte? Er war so blaß und still geworden und trug den Kopf gar nicht mehr hoch.
»Er schämt sich!« ging es flüsternd von Mund zu Munde. Und wieder dämpften die Alten ihre rauhe Rede und meinten gutmütig: »Laß man gut sein, lütt Prinz. Einmal ist keinmal, und es macht ja jeder mal seinen dummen Streich im Leben.«
Frau Ethé weinte Freudentränen und drückte ihren Jungen ans Herz, aber dann kam der bittere Nachgeschmack. Sie besann sich darauf, daß er ihr Arger und Schande gemacht, und es ward ihr klar, daß sie nichts Hohes mehr von ihm zu erwarten hatte.
»Ich will zu meinem alten Meister gehen, Mutter, vielleicht vergibt er mir.« Ein spöttischer, harter Zug legte sich um Frau Ethés Mund. »Und dann?«
»Dann will ich ein Schneider werden, so Gott will.«
»Ein frommer Schneider!« dachte sie. Ach, es begräbt ja kein hochmütiger Mensch seine eiteln Träume ohne etliche grimmige Spatenstiche galligen Ärgers.
Malte sah es und verstand sie. Ach, er verstand seine Mutter nur allzu gut.
»Mutter,« sagte er bittend, »laß mich recht klein und niedrig bleiben und – von Gnade leben.«
Sie wußte es selbst nicht, wie verächtlich der Blick war, mit dem sie ihren Sohn ansah. »Erst werde wie dein Vater!« schrie sie leidenschaftlich, dann –« sie stockte, denn das Andenken an ihren Mann war doch eine Macht über ihr Herz – »dann rede, wie er es tat!« sagte sie dann kurz und ging hastig aus der Stube.
![]()
Nach etlichen Tagen wanderte Malte zu seinem alten Meister. Das Herz klopfte ihm, und ganz sachte nur rührte sein Finger an die wohlbekannte Tür.
»Herein!« Mit einem Freudensprung war der Alte vom Tisch herunter. »Junge! Mensch! Gelobt sei Gott!«
»Meister,« sagte Malte mit zitternder Stimme, »vergebt mir und laßt mich wieder auf Eurem Schneidertisch sitzen – um meines Vaters – und um Jesu willen!«
Da schlang Meister Rolaf die Arme um Maltes Hals und küßte ihn, wie er damals getan, als Malte zum erstenmal in sein Haus kam, nur ganz anders noch.
An jenem Abend konnte Malte lange nicht einschlafen, er mußte sich immer wundern, was das Wörtchen »Gnade« für selige Tiefen hat, und wie der Widerschein der großen, warmen, sonnigen Heilandsliebe auch Christenherzen so warm macht und so barmherzig.
![]()
Malte Ethé ist ein tüchtiger Schneider geworden. Als der alte Meister Rolaf zu seinem Heiland heimgegangen war, da hat er das Häuschen und auch den größten Teil seiner Kundschaft übernommen. Dem alten Herrn Pastor hat er noch den letzten Chorrock arbeiten dürfen, in dem dieser dann auch später begraben ist. Der ehrwürdige alte Herr hat dem jungen Schneider immer eine sonderliche Liebe bewahrt. Als er aber einst in Stralsund zu tun hatte und da dem Schneider Ethé einen Besuch machte, da fand er, daß die große Wohnstube ganz voll Besuch war. Meist waren es junge Burschen, die um den Schneider her saßen, dieser aber hatte eine aufgeschlagene Bibel auf den Knieen, seine Augen leuchteten. – »Ganz wie der Vater!« dachte der alte Herr, und seine Augen füllten sich mit Tränen. »Bleibt stille sitzen, Kinder,« sagte er freundlich, »ich möchte mit euch hören, was unser Heiland uns sagen will.«
Malte aber stand auf und legte die Bibel in des alten Pastors Hände. »Darf ich Ihnen einen Text geben?« bat Malte, und als der alte Herr nickte, da schlug er die Stelle auf: » Gott widerstehet den Hoffärtigen, aber den Demütigen gibt er Gnade.«
Es war schon spät, als man sich trennte. Die jungen Burschen schüttelten dem Pastor die Hand und gingen still davon. »Wie sind sie zu dir gekommen, Malte?«
Dieser errötete. »Ich gehe oft am Hafen entlang, Herr Pastor, und denke an damals. Sie wissen wohl. Und wenn ich dann ein Bürschchen sehe, das so in die Welt sieht, wie ich damals –«
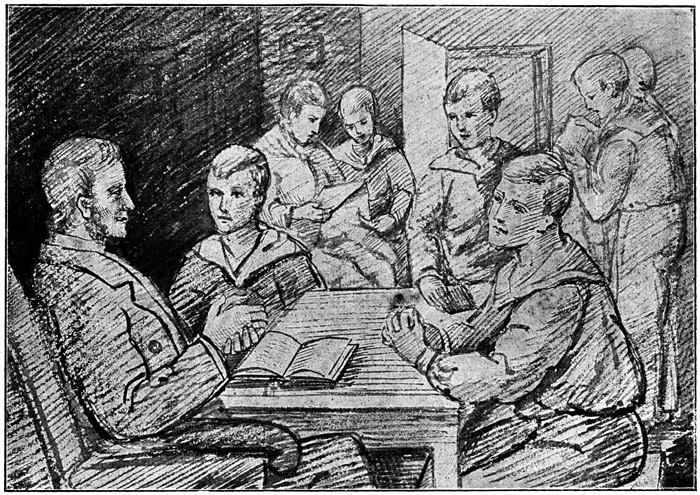
Meist waren es junge Burschen, die um den Schneider her saßen, dieser aber hatte eine aufgeschlagene Bibel: seine Augen leuchteten.
»Dann nimmst du es mit?«
»Ja,« antwortete lachend Malte, »wenn es mitkommen will. Sie wollen nicht alle, mancher lacht und flucht ganz grob, aber mancher ist auch wiedergekommen. Und wenn ich ihm dann mal erzählt habe, wie Gottes gewaltige Hand mich geschüttelt und seine starke Liebe mich gerettet hat, dann hat's doch mal ein Herz begriffen, daß es gut ist, sich der gewaltigen Hand zu beugen und Gnade zu suchen.«
Der Pastor nickte: »Gott segne dich, mein Sohn!«
Nun war der ehrwürdige alte Freund daheim, und mit Tränen ist Schneider Ethé seinem Sarge gefolgt.
Gott hat ihn reich gesegnet. Er hat ihm ein Weib zugeführt, die seines Sinnes war, und sein Haus mit Kindern gefüllt. Die Meisterin wohnte bis zu ihrem Tode bei ihnen im Oberstübchen und ward von der Kinderschar mehr geliebt als die Großmutter Ethé, die so leicht unzufrieden war.
Manch junger Schiffer hat in Sturm und Wetter den Malte Ethé gesegnet, der so ein warmes Herz hat für junge Taugenichtse und nicht losließ mit seiner Liebe, bis er ihnen den Heiland ins Herz geliebt hatte.
So ist auch einst ein junges deutsches Bürschchen in New-York gelandet und hat gleich vom Schiff aus ins Hospital gemußt. Da ist es wieder Schwester Helene gewesen, die ihn zu pflegen hatte, war sie doch die einzige im Hospital, die der deutschen Sprache mächtig war. Als sie ihn dann eines Tages fragte, ob er vielleicht einen Schneider Ethé in Stralsund kenne, da hat des Jungen ganzes Gesicht gestrahlt. »Den Malte Ethé, der uns Schiffsjungen liebt? O Schwester, wenn ich den nicht kennte, so kennte ich auch meinen Heiland nicht.«
Da hat Schwester Helene vor Freude geweint. »Gelobt sei Jesus Christus, der aus Sündern selige Leute macht. Es ist keine größere Liebe als die, daß Er das Leben ließ für eine Sünderwelt.«

Lehmann & Bernhard, Hofbuchdrucker,
Schönberg i. Meckl.