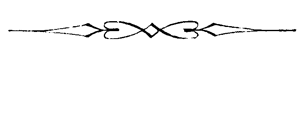|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
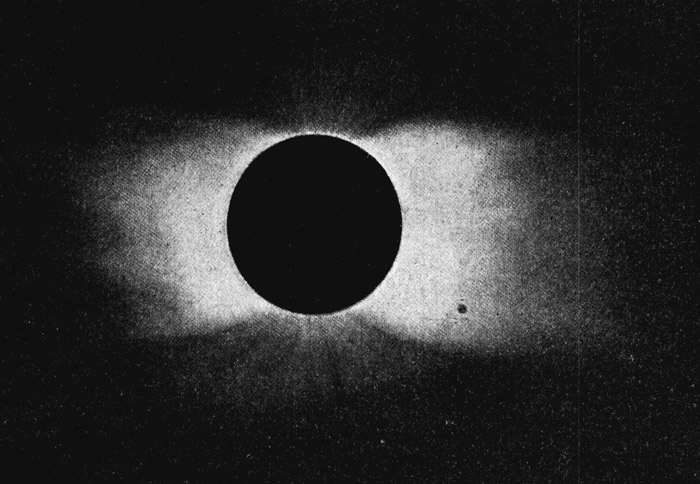
Sonnencorona während einer totalen Finsternis.
Es muß doch Frühling werden.« Jede Menschenbrust empfindet das in jeder Wintersnot. Es kann nicht aufhören Tag und Nacht, Sommer und Winter; es muß ein ewiges Kreisen sein von Aufgang zu Untergang und immer wieder zu neuer Auferstehung. Und wenn es dann sproßt und blüht im neuen Frühling, dann erstehen aus der dunklen Erde, aus Luft und Wasser Millionen Wesenheiten, wie hervorgezaubert aus dem Nichts. Als wollte sich nun alles neu beleben, so zwingt das unscheinbare Samenkorn das tote Erdreich ringsumher, sich mit ihm zu vereinigen, um mitzusprossen, mitzublühen und für das eine Samenkorn deren Tausende mitzuerzeugen. Wieviel Millionen wunderbar organisierter lebendiger Welten entstehen in jedem neuen Frühling wieder, nachdem der Winter mit eisiger Faust Millionen erwürgt hatte!
Wird es wirklich immer so sein? In einem früheren Bändchen dieser Sammlung habe ich gezeigt, wie die Welten einst untergehen, und wie auch auf unserer Erde einstmals Tag und Nacht, Sommer und Winter aufhören müssen. Aber wie für unzählbare allerkleinste Lebewesen, deren Dasein nur nach Stunden oder Minuten zählt, ein einziger Tageskreislauf einer ganzen Weltschöpfungsperiode entspricht, hinter und vor der ewige Nacht und Regungslosigkeit zu liegen scheint, so dürfen wir wohl vermuten, daß zwischen der Entstehung und dem Untergang der Welt, wie wir sie kennen, auch nur ein Tag eines größeren Kreislaufes liegt, von dem wir Infusionstierchen auf dieser Erdkugel ebensowenig etwas wissen können, und daß also Tag und Nacht, Sommer und Winter in weiterem Sinne doch nicht aufhören, wenn wir auf immer höhere Stufen der Weltentwicklung emporsteigen.
Die Entstehung einer Welt ist nur wie ein neuer Frühling, der in die Materie ausgelebter Weltsysteme mit erneutem Schöpfungsdrange eingreift, der Welten sprossen und aufblühen läßt, wie wir es entzückt hier rings um uns her in unserer schönen Erdennatur wahrnehmen.
Da fragt es sich nun, wenn wir die Entstehung einer Welt mit unsern geistigen Augen verfolgen wollen, wo unsere Betrachtungen den Anfang zu machen haben. Unser Erdenfrühling ist eine ungeheure Weltenschöpfung. Man stelle es sich nur vor, daß jedes Molekül, das sich in jedem aufstrebenden Keime an das andere setzt, ein Weltsystem von Atomen ist, komplizierter in seinem Aufbau und seinen Bewegungen wie unser ganzes Sonnensystem. Das alles formt sich, von unsichtbaren Kräften getrieben, aus den toten, einfach zusammengesetzten Stoffen des Erdbodens und bildet wunderbare Organisationen. Unergründliche Geheimnisse schließen diese Weltenschöpfungen der lebendigen Natur in sich.
Aber wir verstehen unter einer Welt die viel rohere Zusammenfügung von Materie, die unsere Erdkugel, das Sonnensystem oder schließlich jene uns bekannte größte Ansammlung von Welten zusammensetzt, welche wir als System der Milchstraße in der Folge noch näher kennen lernen werden. Wie also sind diese Welten entstanden? Das ist die Frage, welche wir in dieser Schrift beantworten wollen.
Entstanden – woraus? Aus dem Nichts kann nichts entstehen. Die Materie der Welt müssen wir als vorhanden annehmen seit aller Ewigkeit; nur stellen wir uns vor, daß sie zu Anfang in einem völlig chaotischen Zustande war, ohne alle Organisation, so daß jedes Materieteilchen ohne allen Zusammenhang mit seiner Umgebung war, sich unabhängig von jedem andern im wirkungslosen leeren Raume bewegte. Dieser Zustand stellt dann die denkbar unterste Stufe einer Weltentwicklung dar, wo diese sich zugleich berührt mit der letzten Phase jener anderen Hälfte eines Weltenkreislaufes, der zum Untergange führt. Ein mächtiger Zusammenstoß zweier ausgelebter Welten muß einmal alle Organisation ihrer Materie auseinandergerissen haben, so daß selbst die Atomsysteme des Chemikers in die allerletzten Uratome zerfielen. Das plötzliche Aufleuchten des neuen Sternes im Perseus, das wir im Februar 1901 beobachteten, gab uns ein Beispiel dafür. Dort waren zwei oder mehr dunkle Weltkörper mit einer Geschwindigkeit von etwa 1000 Kilometer in der Sekunde aufeinandergestoßen, und darauf ging eine leuchtende Nebelmaterie von dem Mittelpunkte des Zusammenstoßes aus, die sich mit Lichtgeschwindigkeit spiralförmig im Raume verbreitete. Nur die geheimnisvollen Vorgänge, die wir vom Radium ausgehen sehen, geben eine Erklärung für jene Erscheinung in den fernsten Himmelsräumen, wo sich im Laufe weniger Monate ein Gebiet mit Materie in ihrer allerfeinsten Verteilung wieder angefüllt hatte, das dasjenige unseres Sonnensystems mindestens um das 150fache an Ausdehnung übertrifft. Vom Radium gehen gleichfalls allerkleinste Materieteilchen mit Lichtgeschwindigkeit aus, die sogenannten Elektronen, die ohne Zusammenhang miteinander in den Raum hinausschwirren und, wäre nur das Radium in genügenden Mengen vorhanden, ebenso einen leuchtenden Nebel bilden würden, wie er um jenen neuen Stern entstand.
Wir dürfen also zum mindesten vermuten, daß die Uratome oder Elektronen, die den Raum um jenen Stern, wenn auch in ungemein dünner Verteilung, erfüllten, wirklich die allereinfachsten Bausteine sind, aus denen sich die Welt der chemischen Atome und Moleküle sowohl, wie schließlich auch die der Himmelskörper aufgebaut haben muß. Hier haben wir also jene unterste Stufe vor uns, bei der unsere Betrachtungen anheben sollen.
Wir nehmen an, daß jene Welt, welche sich so in ihren Urzustand aufgelöst hat, einstmals bessere Tage sah, ehe sie diesem Untergange verfiel. Wie kann es nun wohl kommen, daß dieselben Naturkräfte dieselbe Materie, welche sie langsam oder plötzlich der Zerstörung entgegenführten, von diesem Augenblicke an wieder zu neuem Leben emporheben? Wie kann das Weltgeschehen sich in seiner Richtung so völlig umkehren? Die Erscheinungen des irdischen Lebens, wie verschieden sie auch äußerlich von jenen Weltvorgängen sind, geben uns eine zutreffende Antwort auf diese Frage. Unsere Körper gehen nach dem Höhepunkte ihrer Entwicklung, eben wie alles Geschaffene, einer langsamen Auflösung entgegen. Allein, aus sich selbst heraus hätten sie niemals die Kraft, ihr Geschlecht zu erhalten. Es würde mit allen unaufhaltsam abwärts gehen, wenn nicht ein unwiderstehlicher Drang je zwei dieser Wesenheiten zusammenführt. Im Augenblicke ihrer Verschmelzung beginnen Teile der verbundenen Wesenheiten ihre Entwicklungsrichtung im aufsteigenden Sinne zu ändern. Ein neuer Organismus keimt und wächst in einem andern, der seinerseits nicht mehr im Wachstum war. Die allgewaltige Liebe ist es, die die Welt des Lebens schafft; aber auch in der sogenannten toten Natur sind die schaffenden Kräfte jener Liebe vergleichbar. Millionen von Weltkörpern eilen scheinbar ziellos durch den Raum. Wir sehen sie am Himmel ihre Straße ziehen nach allen Richtungen, soweit sie als Sonnen uns überhaupt sichtbar werden können. Andere Millionen werden längst erloschen sein, aber ihren Weg weitergehen durch die Leere und Dunkelheit des Weltraumes, scheinbar ohne Regel und Gesetz, ohne Bestimmung. Sie haben sich, soviel wir sehen, keiner besonderen Gruppe von Welten angeschlossen, wenn wir auch annehmen müssen, daß sie dem allergrößten System der Milchstraße mitangehören. Niemals könnte aus ihnen selbst heraus ein Impuls entstehen, der sie einem neuen Aufschwunge entgegenführte. Sie müssen, von einem unbestimmten Drange getrieben, in den Welträumen ihresgleichen suchen. Und finden sich dann zwei solche ebenbürtige Weltenwesenheiten und durchdringen sich in wildem Werdedrange, dann durchglüht es übermächtig ihre Körper, und ein neues Weltwesen, zusammengesetzt aus Myriaden Weltkeimen, die von den älteren dabei ausgeschleudert wurden, befruchtet aufs neue den leeren Raum: Ein neuer Stern flammt auf.
Am Himmel kommen solche Ereignisse nur selten vor, aber auch nur die allergrößten werden auffällig in unsern Gesichtskreis treten. Die beiden großartigsten Erscheinungen der Art ereigneten sich 1572 und 1901. Die erste dieser Erscheinungen war der Tychonische Stern, die letztere jener vorerwähnte neue Stern im Perseus. Aber seit man den Himmel durch häufig wiederholte photographische Aufnahmen genauer zu kontrollieren imstande ist, bemerkt man immer häufiger unter der millionenfachen Schar von Sternen einen, der auf älteren Platten nicht aufzufinden ist, der also inzwischen neu geboren sein mußte. Auffällig ist es dabei, daß gerade in den Gebieten des Weltraumes, wo die Sterne sich bereits am dichtesten zusammendrängen, die meisten neuen Sterne erscheinen. Hier können sie sich ja auch am leichtesten finden zu dem gewaltigen Akte der Welterneuerung. Das ist also nicht merkwürdiger, als daß es da die meisten Geburten geben muß, wo die Volksdichtigkeit am größten ist.
Nicht nur bei dem neuen Stern im Perseus, sondern auch bei dem 1892 im Sternbilde des Fuhrmann erschienenen sah man um den neuaufgetauchten Lichtpunkt sich einen leuchtenden Nebel verbreiten, aber nur bei erstgenanntem konnte man die ungeheuere Geschwindigkeit bestimmen, mit der diese Ausbreitung stattfand. Diese Schnelligkeit war es, welche zu der Vermutung führte, daß der ausgeschleuderte Stoff Radium oder vielmehr seine Emanation sei. Ich kann es mir hierbei nicht versagen, einen Gedanken zu wiederholen, den ich schon einmal anderswo ausgesprochen habe. Das Radium gehört bekanntlich zu den schwersten Stoffen, die wir kennen. Deshalb und auch noch aus andern Gründen ist es sehr wahrscheinlich, daß die Erde und die andern Himmelskörper von diesem wunderbaren Stoffe in ihrem Innern größere Mengen beherbergen. Hier mag er sich erst unter dem ungeheuern Drucke, der dort herrscht, im Laufe der Jahrmillionen bilden. Wenn nun zwei Weltkörper zusammenstoßen und sich gegenseitig zertrümmern, so ist es, als wenn im Frühling eine dicht mit Samenkörnern gefüllte Fruchtkapsel zerspringt, die den langen Winter überdauerte und nun die Keime rings um sich her ausstreut, aus denen neues Leben aufblühen wird.
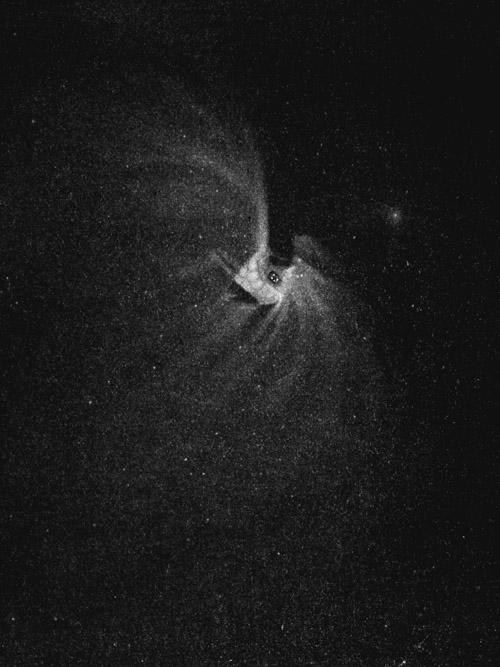
Der Orionnebel. Nach einer auf der Sternwarte in Washington hergestellten Zeichnung.
Solcher Nebelgebilde, wie sie sich um jene neuen Sterne ausbreiteten, gibt es eine große Zahl am Himmel; sie erscheinen uns unveränderlich. Aber man muß dabei wohl bedenken, daß uns unermeßlich große Räume von ihnen trennen, so daß Bewegungen, die mit der ungeheuern Lichtgeschwindigkeit von 300 000 Kilometer in der Sekunde stattfinden, im Falle des Nebels um den neuen Stern im Perseus uns nur noch so klein erscheinen, daß selbst auf den bereits vergrößerten Photogrammen der Weg, welchen das Licht in Monaten zurücklegt, nur wenige Millimeter ausmacht. In jenen permanenten Nebeln mag deshalb die Materie immer noch mit sehr großen Geschwindigkeiten, von Hunderten von Kilometern, durcheinanderwirbeln, ohne daß wir in der kurzen Zeit, in der wir das Aussehen dieser Gebilde durch die empfindliche Platte sicher festgelegt haben, davon etwas bemerken könnten. Aber dieses Aussehen allein beweist in sehr vielen Fällen, daß sie ganz ähnlichen Katastrophen ihr Dasein und ihre Form verdanken, wie wir sie beim Aufleuchten jener neuen Sterne sozusagen vor Augen sahen. Das größte Gebilde dieser Art, das wir am Himmel kennen, der Orionnebel, hierneben abgebildet, ist in dieser Hinsicht besonders interessant. Wir sehen, wie hier der leuchtende Stoff wild durcheinandergewirbelt worden ist, und doch wieder, wie er eine gewisse Ordnung zeigt, die deutlich etwas von einer Katastrophe verrät, durch welche diese Verteilung der Materie verursacht wurde. Von oben her dringt ein dunkler Raum in die Nebelmasse, die nach ihm hin recht scharf begrenzt ist. Vor dem dunklen Raume, den man das Löwenmaul genannt hat, ist im Innern des Nebels die Materie besonders stark verdichtet, als ob sie hier durch einen eindringenden Körper zusammengeschoben worden wäre. In der Tat sehen wir hier gerade eine Ansammlung kleiner Sterne, welche wohl diese Eindringlinge gewesen sein könnten. Um das Löwenmaul herum gruppiert sich nun die übrige Materie, als flammte sie von hier aus in den Weltenraum hinaus. Setzen wir einmal den Fall, wir hätten eine Wolke von Tabaksdampf in die Luft geblasen und ließen nun, nachdem der Dampf einigermaßen zur Ruhe gekommen, einen kurzen Luftstoß auf einen Teil der Wolke wirken, dann würde diese Lücke des Löwenmauls entstehen und zugleich die übrige Dampfmasse um sie herum in aufwirbelnde Bewegung geraten. In der Tat hat nun die Photographie gezeigt, daß von dem eigentlichen Orionnebel noch ein äußerst schwacher, spiralig gewundener Nebelstreif ausgeht, der in ungeheuerer Windung das ganze Sternbild des Orion einnimmt. Man kann es sich kaum anders vorstellen, als daß wirklich eine Stoßwirkung diese Wirbelbewegung hervorgerufen habe.

Spiralnebel in den Jagdhunden.
Photographische Aufnahme der Yerkes-Sternwarte.
Derartige spiraligen Gebilde, die sich noch viel deutlicher als solche darstellen, trifft man am Himmel noch in ziemlicher Anzahl an, namentlich seit die photographische Platte immer tiefer in seine Geheimnisse eindringt und, bei vielstündiger Belichtungszeit, mehr Einzelheiten in diesen mattschimmernden Lichtwolken entdeckt, als die riesigen Fernrohre dem Auge jemals direkt zu zeigen vermöchten.
Der berühmteste unter diesen Spiralnebeln ist der in den Jagdhunden, welchen die obige Abbildung nach einem Photogramm der Yerkes-Sternwarte bei Chicago darstellt. Man sieht hier am Ende der Spirale einen Nebelballen, von dem man wohl annehmen könnte, daß sein einstmaliges Eindringen die Ursache der wirbelnden Bewegung gewesen sei.

Nebel in der Andromeda.
Photographische Aufnahme der Yerkes-Sternwarte.
Natürlich sehen wir nicht alle diese Objekte gerade in der Fläche ihrer größten Ausdehnung, sondern oft nur in starken Verkürzungen. So erscheint uns zum Beispiel der hier weiter abgebildete große Nebel in der Andromeda, dessen spiralige Natur man erst auf den Photogrammen erkannte, als flache Linse, die man in der Richtung ihrer Kante von uns aus beobachtet, und man sieht verkürzt, wie hier mehrere Windungen der Nebelmasse ineinander liegen. Auch hier schwebt ein Nebelballen etwas außerhalb der Windungen.
Nach all diesem können wir es wohl kaum bezweifeln, daß der erste Impuls zu jener kreisenden Bewegung von Weltmassen, die wir später sich zu Sonnensystemen zusammenballen sehen, ein Zusammenstoß zweier Weltkörper oder Nebelmassen oder Ansammlungen von Materie in ihren verschiedensten Aggregatzuständen gewesen ist.
Auch bei dem Nebel um den neuen Stern im Perseus zeigte die Bewegung der ausgeschleuderten Lichtknoten eine spiralige Natur. In ihm steht offenbar ein Weltkörper-Embryo vor uns, von dessen allererster Empfängnis wir Zeugen waren. Wie schade, daß wir so kurzlebig sind und der Entwicklung dieses neuen Weltwesens nicht weiter zuschauen können; denn es werden nun wohl Hunderttausende von Jahren vergehen, bis sich neue Stufen seines Wachstums zeigen.
Was aber in dieser Hinsicht an einem Weltwesen nicht zu beobachten ist, läßt sich an einer ganzen Reihe derselben, die wir am Himmel wahrnehmen, verfolgen, indem wir die einzelnen Objekte nach ihren Entwicklungsstufen ordnen. Es ist deswegen schon wiederholt der Vergleich gemacht, daß wir doch die Entwicklung des Hühnchens vom Ei bis zum ausgebildeten, fortpflanzungsfähigen Tier ebensogut aus den gleichzeitig auf dem Hühnerhofe vorhandenen Altersstufen studieren können, als wenn wir ein und dasselbe Hühnchen im Laufe der Zeit in seinen verschiedenen Erscheinungen beobachten.
Wir finden nun am Himmel in der Tat alle Entwicklungsstufen vertreten, die von jenen ersten allerfeinsten Verteilungen der Materie, wie sie zuerst der Nebel um den Stern im Perseus zeigte, bis zu fertigen Sternen- und Sonnensystemen führen. Wir wollen sie nach und nach Revue passieren lassen, doch so, daß wir die Notwendigkeit ihrer Entwicklung auf diesem Wege aus den uns bekannten Kräften und Zuständen in der Natur erkennen.
Da müssen wir abermals zurückkehren zu jenem allerersten Stadium der Weltbildung, welches uns die immer wieder als klassisches Beispiel herangezogene »Nova Persei« vor Augen stellt. Wir wollen uns dabei, wie hypothetisch es auch sei, auf den vorhin angenommenen Standpunkt stellen, die Materie habe sich wirklich dort in ihren allertiefsten Urzustand, den der Uratome, der »Elektronen«, zurückverwandelt, denn dies gibt uns Gelegenheit, die Entstehung einer Welt in unserer Vorstellung wirklich auch von ihren allerersten Anfängen zu verfolgen, während in Wirklichkeit wohl viele untergehende Welten nicht völlig wieder zu diesem Urzustand zurückgekehrt sind, wenn sie den Impuls zu einem neuen Aufschwung erhalten.
Wo nehmen wir nun die Naturkräfte her, welche diese völlig chaotisch durcheinanderschwirrenden, ganz und gar frei gewordenen Atome neu gruppieren bis hinauf zu den wunderbaren Organisationen, die unsere blühende Welt aufbauen? Nach einem Weltuntergang der beschriebenen Art haben wir nur noch jene allerkleinsten Bausteine, die Uratome, zur Verfügung, die wir mit ungeheuren Geschwindigkeiten geradlinig und gleichmäßig schnell den Raum durcheilen sehen. Es ist die Aufgabe der Naturwissenschaften, aus jenen einfachsten Eigenschaften der Uratome diesen gewaltigen Aufbau verstehen zu lernen. Wie weit sind wir noch davon entfernt! Aber gerade in dieser Welt der Atome, von der wir emporschreiten müssen zu der der Himmelskörper, wenn wir ihre Entstehung und Organisation recht begreifen wollen, beginnt es in jüngerer Zeit sich vor unsern erstaunten Augen zu klären, immer deutlicher sehen wir, wie bis in dieses allerfeinste Gefüge der Materie hinein dieselbe große allgemeine Ordnung herrscht, die auch die gewaltigen Weltkörper zusammenhält, daß wir die Welt der Atome an der der Himmelskörper verstehen lernen können und umgekehrt erkennen, wie Sonnen in dieser Einheit wieder zu Atomen werden. Indem wir den Aufbau der Atomwelten verfolgen, lernen wir auch den der Himmelskörper kennen. Wir wollen deshalb wenigstens einen kurzen Überblick der Organisation dieser Atomwelt widmen, wie sie sich der modernen Forschung darstellt.
Es hat sich gezeigt, daß die Körper, welche der Chemiker und Physiker Atome oder gar Moleküle nennt, bereits sehr komplizierte Weltsysteme sein müssen. Früher zwar hatte man die chemischen Atome als etwas Unteilbares angesehen, wie es ja auch ihr Name besagt. Für unsere derzeitigen experimentellen Mittel sind auch die chemischen Atome wirklich nicht in noch kleinere Teile zu zerlegen. Aber das Verhältnis ihrer Gewichte, welches man sehr genau bestimmen konnte, verriet deutlich einen systematischen Aufbau der Atome der verschiedenen Elemente. Diese Atomgewichte steigern sich nämlich stufenweise in ganzen Zahlen, sodaß man hieraus schon vermuten mußte, die Atome bauten sich derart aus einem Uratom auf, daß sich von diesen immer eine bestimmte Anzahl zusammenfügte, um ein Atom eines bestimmten Elementes zu bilden. Man hätte sich zum Beispiel denken können (wenngleich die Sache sicher nicht so einfach liegt), daß das Atom des Heliums genau aus vier Atomen Wasserstoff aufgebaut sei, weil ersteres gerade viermal schwerer ist als letzteres, oder daß ein Schwefelatom aus zwei Sauerstoffatomen besteht, die für uns unzertrennlich zusammengefügt sind, denn Schwefel ist eben genau noch einmal so schwer wie Sauerstoff. Ähnliche Beziehungen herrschen auch unter den Atomgewichten aller anderen chemischen Elemente, und es zeigt sich, daß von diesen Atomgewichten alle ihre chemischen und physikalischen Eigenschaften abhängen. Allein nur dieses Atomgewicht und die Gruppierung der Atome bestimmt alle Eigenschaften der Materie. Ein doppelt so schweres Atom ist auch doppelt so träge in seinen chemischen Wirkungen, wenn die Gruppierung dieselbe ist. Kurz, es wird immer wahrscheinlicher, daß wir alle physikalischen und chemischen Erscheinungen, also schließlich die ganze Welt in unserer näheren Umgebung, nur durch Zusammenfügen von Uratomen zu immer größeren und verschiedenartigeren Gruppen einmal zu erklären vermögen werden.
Wir würden also die Welt der Atome mit allen ihren Eigenschaften nur dadurch entstanden denken können, daß sich die Uratome mannigfaltig zusammenfinden. Wie dies geschehen kann, würden wir auch unschwer begreifen. Wir haben ja gesehen, wie diese kleinsten Materieteilchen nach dem letzten Weltuntergange chaotisch durcheinanderfliegen. Dabei muß es doch geschehen, daß hier und da einmal zwei von ihnen derart zusammentreffen, daß sie ganz oder doch nahezu zusammenbleiben müssen. Es entsteht dann aus dem Urstoff schon ein zusammengesetzter, zweiatomiger Körper mit anderen Eigenschaften; solche Körper können dann abermals zusammenstoßen oder sich für uns unzertrennlich verbinden zu einer Gruppe, die aus vier Uratomen besteht und so fort bis zu den schwersten Atomen hinauf, die wir kennen. Das leichteste chemische Atom aber, das des Wasserstoffs, ist nach dieser Voraussetzung bereits mindestens aus 2000 jener Uratome zusammengesetzt, und das schwerste bekannte Atom, das des Radiums (nach Runge und Precht 254mal schwerer als Wasserstoff), wäre danach aus nicht weniger als einer halben Million von Einzelkörpern aufgebaut, die nicht etwa wie die Steine in einem unserer Bauwerke, dicht nebeneinander liegen können, sondern durch verhältnismäßig große Zwischenräume getrennt sein und um ein gemeinsames Zentrum schwingende oder kreisende Bewegungen ausführen müssen. Dies schließen wir aus dem Verhalten dieser Atome in den Molekülen, die ihrerseits aus einer Gruppierung der Atome entstehen, aber wieder für uns trennbar sind. Wir können also an den Molekülen Art und Eigenschaften dieser Gruppierungen experimentell studieren. Solch ein Molekül ist hiernach bereits ein außerordentlich verzweigtes Weltsystem im kleinsten Maßstabe; es enthält unter Umständen Millionen von einzelnen Weltkörpern. Die Atome sind den Planeten mit ihren Systemen von Monden zu vergleichen; aber unter den Planeten unserer Sonne brachte es keiner zu mehr als acht (vielleicht beim Saturn neun) Monden, solch ein Atomplanet kann aus Tausenden von Einzelkörpern bestehen, und im Molekül wieder können Tausende von derart zusammengesetzten Atomen kreisen.
In diesen ewig unsichtbar kleinen Räumen wurzelt recht eigentlich das ganze Weltgeschehen. Was wir davon vor uns sehen, ist nur eine vergrößerte Wiederholung aus einer tieferen Stufe, freilich für uns vielfach gänzlich verhüllt durch die Eigenart unserer Sinneswerkzeuge, die eine ganze Reihe von Vorgängen zu einer Gesamtwirkung vereinigen, die mit jenen Einzelvorgängen keine Ähnlichkeit mehr hat. So hören wir einen Ton als etwas Einheitliches, während er doch aus einer großen Zahl von Einzelschwingungen besteht.
Um die Vorgänge in dieser Welt der Atome zu verstehen, würde es in letzter Linie nötig sein, auch alle Naturkräfte, welche die Gruppierung etc. dieser Atomwelten bewirken, die Schwerkraft, welche sie zusammenhält und die Einzelkörper auch in den Molekülen und Atomen um ein gemeinsames Zentrum führen muß, wie die Himmelskörper im Makrokosmos, die Elektrizität, durch welche wahrscheinlich einmal auch alle chemischen Vorgänge erklärt werden können, die Erscheinungen der Wärme, die die Geschwindigkeiten und Bahnumfänge jener molekularen Weltsysteme nach den modernen Anschauungen der Wärmetheorie regelt, und alle die andern Erscheinungen aus einfachsten Prinzipien zu erklären, wie etwa jener geradlinigen gleichförmig schnellen Bewegung der sonst eigenschaftslosen Uratome. Inwieweit dies heute schon möglich oder denkbar ist, habe ich in einem größeren Werke » Die Naturkräfte«, ein Weltbild der physikalischen und chemischen Erscheinungen«, darzustellen versucht. Es ist darin zum Beispiel wenigstens anschaulich gemacht, wie man die Anziehungskraft zwischen zwei größeren Massen durch die Stoßwirkung allerkleinster geradlinig fortschreitender Massenteilchen erklären könnte. Besteht deshalb der sogenannte Weltäther etwa aus jenen Uratomen, die mindestens mit Lichtgeschwindigkeit den Raum durcheilen, so würden die Zusammenstöße dieser Ur- oder Ätheratome mit den kleinsten Teilen der Weltkörpermassen, also den chemischen Atomen oder Molekülen, deren scheinbare gegenseitige Anziehungskraft und alle Gesetze ihrer Bewegungen umeinander unter Umständen erklären, sodaß also eine wirkliche Anziehungskraft, die geheimnisvoll von der Materie ausstrahlen sollte, nicht mehr angenommen zu werden brauchte.
Solche einfachst bewegte Uratome erfüllen, wie wir wissen, unsern Urnebel, aus dem eine neue Welt werden soll, und wir erkennen deshalb unter jenen Voraussetzungen, wie die sich bildenden und beständig wachsenden Atome sich scheinbar gegenseitig anziehen und durch ihre Vereinigung jene kleinsten Weltsysteme mit ihren kreisenden Bewegungen unter dem beständigen Einfluß der freigebliebenen Uratome formen müssen.
So sehen wir also diese allerkleinste Welt, die unserer Forschung, längst nicht mehr unsern Sinnen, zugänglich ist, entstehen und sich immer vollkommener organisieren, je mehr der kleineren Gruppen von Einzelkörpern sich zu größeren Zusammengehörigkeiten vereinen, die eine gemeinsame Aufgabe im Getriebe ihrer Weltstufe verfolgen.
Aber jedem Individuum, den Atomen, den Molekülen, den Lebewesen, den Weltkörpern, sind Grenzen ihres Wachstums gestellt. Alles Geschaffene hat seine Zeit der aufstrebenden Kindheit und Jugend, des beständigen Mannesalters und des Greisentums, bei dem sich die Organisation auch schon vor dem Eintritt des Todes wieder langsam zurückbildet. In neuester Zeit hat man Anhaltspunkte dafür gefunden, daß selbst die Atome des Chemikers, die man bisher für das Unveränderlichste gehalten hatte, das die Natur aufzuweisen hat, etwas Werdendes und Vergehendes sind, also nicht nur einmal in jener ersten Zeit der Weltbildung geschaffen wurden, sondern noch beständig, wenn auch sehr langsam, sich verändern. Aus dem Atom des einen Stoffes würde deshalb auch jetzt noch ein Atom eines andern Stoffes werden können. In einem Falle hat man dies wirklich beobachten können. Er betrifft wieder das in jeder Richtung wunderbare Radium.
Das Atom des Radiums ist, wie es scheint, unter den abnormen Druckverhältnissen im Innern der Erde bereits zu einer Größe gewachsen, die es unter bei uns normalen Verhältnissen nicht mehr bestandfähig bleiben läßt. Im Innern jenes größten Atoms scheinen fortwährend Zusammenstöße seiner umschwingenden Einzelkörper stattzufinden, denn wir nehmen wahr, wie von ihm ein ununterbrochener Hagel von jenen allerkleinsten Körperchen ausgeht, die wir Elektronen genannt haben; und auch größere, die aber immer noch sehr viel kleiner sind als das kleinste chemische Atom, werden von ihm ausgeschleudert, und zwar mit Geschwindigkeiten, die sich von der größten, der des Lichtes, abstufen, je nach der Größe der Teilchen. Wir haben im Radium eine zerfallende Atomwelt vor uns, die geradeso, wie wir es bei dem neuen Stern im Perseus sahen, seine Umgebung mit seinen Zerfallprodukten, bis zu den Uratomen herab, wieder ausfüllt. Und nun hat man wirklich beobachtet, daß aus diesen Zerfallprodukten des Radiums sich neue größere Atome bilden. Ramsay schloß jene »Emanation« des Radiums, die ein leuchtendes Gas von so ungemeiner Feinheit ist, daß man das Gewicht seiner Atome nicht mehr zu bestimmen vermag, in eine Glasröhre ein, und da vollzog sich das Wunder, daß dieses unbekannte Gas sich nach wenigen Tagen langsam aber stetig in Helium verwandelte, jenem zweitleichtesten von allen bekannten Stoffen. Es hatten sich also unter den gemachten Voraussetzungen, so zu sagen vor unsern Augen, Atome von unbekannter Kleinheit zu Heliumatomen zusammengefügt, es waren neue Atomwelten entstanden.
Wenn aber auch das Atom, das Lebewesen, der Weltkörper als Einzelwesen über eine gewisse Größe nicht hinauswachsen können, so ist es ihnen doch gegeben, sich ihrerseits immer wieder zu neuen, größeren Organisationen zusammenzuschließen: Aus Atomgruppen werden Moleküle, aus Molekülgruppen die sichtbaren Körper unserer Umgebung, aus Einzelzellen baut sich der lebendige Körper auf, und die Gesamtheit der Lebewesen unseres Erdballes können wir in ihren ineinandergreifenden Wirkungen wieder als einen einheitlichen immer noch werdenden Organismus auffassen. Endlich werden aus Ansammlungen von Molekülen Weltkörper und aus Sonnenschwärmen Milchstraßensysteme. Wir steigen aus unserm unsichtbaren Mikrokosmos der Atomwelten wieder empor zu dem Makrokosmos der Himmelsräume, der wegen seiner unermeßlichen Größe unsern Sinneseindrücken wieder ebenso unfaßbar ist, wie jene kleinste Stufe der Weltbildungen. Der Entwicklung der Himmelskörper innerhalb dieser obersten Stufe wollen wir nun weiter folgen.
In der ursprünglichen Nebelmasse wird bei jener weltschöpferischen Vereinigung, von der unsere Betrachtungen ausgingen, die Materie nicht gleichmäßig über den betreffenden Raum ausgebreitet worden sein. Auch bei dem Nebel um die Nova Persei sahen wir ja sehr deutlich die getrennten Lichtknoten. Es bilden sich ungleichmäßig verteilt besondere Zentren der Verdichtung, und die ganze Masse zerfällt deshalb allmählich in einzelne Lichtpunkte, wenn sie etwa noch weiter leuchtet. Gebilde dieser Art gibt es auch wirklich am Himmel, Nebel, die bei schärferer Betrachtung in eine Unzahl von einzelnen Sternen zerfallen, aber doch im Spektroskop unzweifelhaft den gasförmigen Zustand der ganzen Masse verraten. Es sind dies also sternartige Nebelverdichtungen, keine eigentlichen Sterne oder Sonnen, die wenigstens an ihrer Oberfläche flüssig sind.
Aber solche Nebelmassen müssen nun allmählich aufhören zu leuchten. Diese Eigenschaft, zu leuchten ohne zu glühen, ohne also einen hohen Hitzegrad zu besitzen, kommt ja nur der Materie in jenem Zustande zu, in welchem sie Partikelchen mit Lichtgeschwindigkeit ausstößt, entweder wie beim Radium oder wie bei gewissen elektrischen Erscheinungen, den Kathoden- und Röntgenstrahlen unter ganz bestimmten Umständen. Unsere weltbildende Nebelmasse muß aber die Temperatur des Weltraumes besitzen, die nahe am absoluten Nullpunkte (-273 Grad) liegen wird. Je mehr Atome und überhaupt Materieteile sich bei jener Verdichtungsarbeit zusammenfinden, desto mehr müssen sie von ihrer ursprünglichen Geschwindigkeit verlieren. Jeder Zusammenstoß muß einen Bewegungsverlust hervorbringen. In unserem Falle wird es zwar kein eigentlicher Verlust sein, denn die sich miteinander vereinigenden Massenteilchen legen sich ja, wie wir schon wissen, nicht unbeweglich dicht gegeneinander, sondern beginnen sofort im Atom, im Molekül oder schließlich auch in den zusammenwirbelnden Weltenmassen, die wir zu Spiralnebeln werden sahen, eine kreisende Bewegung. Es geht also nur die geradlinig fortschreitende Bewegung in eine Kreisbewegung über. Jene konnte nach außen hin wirken, zum Beispiel durch Zusammenstoß mit einer andern Masse, diese zweite kreisende Bewegung aber ist eine innere, die sich nach außen hin nicht ohne weiteres kundgeben kann; sie bedingt die innern Eigenschaften der Materie. Der Physiker würde sagen, es geht lebendige Kraft, oder »kinetische Energie« in latente Arbeitskraft, in »potentielle Energie« über.
Mit der Abnahme der kinetischen Energie unserer Nebelgasmasse hört also ihr Leuchten auf, und unser Weltenembryo verschwindet den Blicken, die sich bei seinem plötzlichen Aufleuchten von allen Teilen des bewohnten Universums auf ihn gerichtet hatten, wie der unsrige auf jenen neuen Stern im Perseus. Aber die Verdichtungsarbeit dauert fort. Jede im freien Raume sich selbst überlassene Masse verdichtet sich mehr und mehr; sie sucht sich unter ihrer eigenen Schwere auf einen immer kleineren Raum zusammenzuziehen, soweit nicht Umlaufsbewegungen dieser Schwerkraft das Gleichgewicht halten, wie bei der Bewegung der Planeten um die Sonne. Diese Verdichtung führt immer weiter die kinetische Energie in potentielle über. Der Physiker zeigt nun, daß von einer gewissen Geschwindigkeit dieser innern umschwingenden Bewegungen der Atome im Molekül an zuerst die Erscheinungen der strahlenden Wärme, dann die des Lichtes auftreten. Das geschieht durch Beeinflussung des den Weltraum überall erfüllenden sogenannten Äthers. Dieser Äther, der nach unsern vorangehenden Betrachtungen aus jenen gleichförmig und geradlinig fortbewegten Uratomen besteht, überträgt die Schwingungen der Atome durch den Weltenraum auf andere Körper und teilt uns auf diese Weise die Empfindung der strahlenden Wärme und des Lichtes mit.
Unser junger Weltkörper oder die Schar von Weltkörpern, in die wir die Nebelmasse zerfallen sahen, erwärmt sich also mehr und mehr, je dichter sie wird. Sie beginnt zu glühen und zu leuchten, letzteres nun unter ganz anderen physikalischen Bedingungen, als es bei der ursprünglichen auf das äußerste verdünnten Nebelmasse der Fall war. Da im Innern des Weltenballes der Druck am stärksten sein muß, weil hier am meisten Materie auflagert, so ist auch das Innere der Weltkörper immer wesentlich heißer als ihre Oberfläche, wie wir es ja auch von unserer Erde wissen. Nun kann aber die Verdichtung nicht fortdauernd in gleichem Maße fortschreiten. Ein bereits ziemlich dichter Körper läßt sich nicht mehr so stark zusammenpressen wie ein lockerer. Deshalb hört nun auch allmählich die Wärmeentwicklung des Weltkörpers aus sich selbst heraus infolge seiner Zusammenziehung auf. Der Körper strahlt zunächst ebensoviel, dann mehr Wärme in den kalten Weltraum hinaus, als er selbst wiedererzeugen kann. Er kühlt sich ab. Das wird natürlich an seiner Oberfläche zuerst geschehen, die in unmittelbarer Berührung mit dem kälteren Raum ist, und es tritt hier nun in einem bestimmten Augenblicke der Übergang eines Teiles der bisher noch immer gasförmigen Masse in den flüssigen Zustand ein. Das geschieht prinzipiell auf dieselbe Weise, wie sich in den höheren Atmosphärenschichten der Wasserdampf zu Wolken und zu Regentropfen kondensiert. Der aus den tieferen wärmeren Schichten der Atmosphäre aufsteigende Wasserdampf kommt auch hier dem kalten Weltraum so nahe, daß er sich zu flüssigem Wasser verdichten muß. Die Wolken bestehen ja eigentlich schon aus flüssigem Wasser, das in äußerst fein zerteilter Form niederzufallen beginnt. Aber die Tropfen erreichen in vielen Fällen niemals die Erdoberfläche, denn sie gelangen im Herabfallen bald wieder in wärmere Luftschichten, wo sie immer wieder in Dampfform aufgelöst werden. Es regnet eigentlich also aus jeder Wolke, nur kommt der Regen nicht immer bis zu uns herab. Hätte die Erde noch keine feste Hülle, auf der sich das Wasser niederschlagen und sammeln kann, so würde dennoch ein beständiger Kreislauf des Wassers stattfinden. Es würden in einer ganz bestimmten Entfernung vom Mittelpunkte des Erdkörpers sich unter der Wirkung der eindringenden Kälte des Weltraumes Wolken zu bilden beginnen, die dem sich zwar ganz allmählich in den Weltraum verlierenden Gasballe doch für den Anblick von außen eine deutliche Begrenzung geben. Aus dieser Wolkenhülle würde es beständig niederregnen, aber in einer bestimmten Tiefe würden die Regentropfen immer eine Temperatur finden, unter der sie sich wieder in Dampf auflösen müssen. Der so wieder heißer und also leichter gewordene Dampf steigt nun wieder empor, bis an die Grenze, wo er sich abermals zu Wolken und zu Tropfen verdichten muß, einen neuen Kreislauf einleitend. Es findet also innerhalb bestimmter Grenzen ein beständiges Auf- und Niedersteigen des Wassers in jenen beiden Aggregatzuständen statt. Obgleich also die Wolkenoberfläche des gedachten Himmelskörpers sich fortwährend erneuert, so wird sie doch einen leidlich beständigen Eindruck machen, während darüber wie darunter ein gasförmiger Zustand herrscht, dessen Dichtigkeit, allmählich fortschreitend, von innen nach außen abnimmt.
In diesem Zustande befindet sich zweifellos gegenwärtig unsere Sonne, nur daß wir jene Kondensationserscheinungen sich nicht mit Wasser-, sondern mit Metalldämpfen abspielen sehen und innerhalb Temperaturen, die zwischen 6000 und 10 000 Graden liegen müssen. Wir sehen die ganze Sonnenoberfläche von Wolken überzogen, die, von uns aus gesehen, etwa den Schäfchenwolken gleichen, die ja auch in unserer Atmosphäre die höchsten Regionen einnehmen. Unsere untenstehende Abbildung stellt diese sogenannte Granulation der Sonnenoberfläche dar. Um einen Begriff von den Dimensionen dieser Wölkchen zu geben, füge ich hinzu, daß der ganze Durchmesser der Erde auf unserm Bilde etwa einen Zentimeter groß sein würde. Die Schicht, in welcher diese Sonnenwolken auftreten, ist die sogenannte Photosphäre, von der das intensivste Licht ausgeht. Die Analyse dieses Lichtes zeigt, daß es namentlich von Metalldämpfen ausstrahlt; aber auch noch eine ganze Reihe anderer uns bekannter Elemente befindet sich dort in Gasform. Das Spektroskop lehrt uns weiter, daß diese Gase über einer Schicht glühend flüssiger Massen lagern, ganz wie wir es oben aus rein physikalischen Gründen voraussetzten. Über jener Photosphäre befindet sich die Chromosphäre, sogenannt wegen ihres schön rosenfarbenen Aussehens. Sie besteht größtenteils aus Wasserstoff und Helium, den beiden leichtesten der uns bekannten Elemente. Es bestätigt sich also, daß der die Sonne bildende Gasball sich über seiner leuchtenden Oberfläche weiter fortsetzt. Über der Chromosphäre nehmen wir nun noch in den Augenblicken der Verfinsterung der Sonne die sogenannte Corona wahr, die sich, wie es die Abbildung (S. 5) zeigt, in mehr oder weniger strahlenförmiger Gestalt ganz allmählich in den Raum verliert. Die Sonne ist also, ganz wie wir es vorhin entwickelten, keineswegs ein kugelförmig umgrenzter Körper, sondern eine Ansammlung von Gasen, bei der nur in einem ganz bestimmten Abstande vom Mittelpunkte jene Kondensationen stattfinden, deren leuchtende Produkte inmitten des Gasballes nur scheinbar eine Begrenzung des Sonnenkörpers bilden.
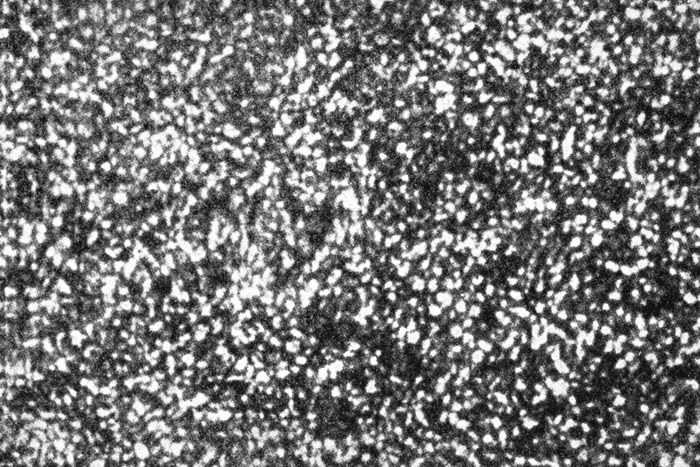
Granulation der Sonnenoberfläche. Photographische Aufnahme des Observatoriums von Meudon.
Unser Weltkörper ist also nun zur Sonne geworden. Aber nicht nur eine einzige Sonne wird aus dem ursprünglichen Nebelballen werden. Wir haben ja gesehen, wie in ihm naturgemäß eine große Menge von Knotenpunkten entstand, von denen jeder der Keim zu einer neuen Sonne wird. Unser weit ausgedehntes Nebelgebilde wird zu einem Sternhaufen, wie sich deren viele Hunderte am Himmel befinden, bei denen die einzelnen Sterne sich im Spektroskop wirklich als Sonnen erweisen, das heißt, als Weltkörper, die unter einer Atmosphäre von glühenden Gasen bereits flüssige Kondensationen besitzen. Umstehend ist solch ein Sternhaufen abgebildet. Es ist der im Zentauren. Er gehört zu den schönsten seiner Art. Es kann in der Tat kaum einen wunderbareren Anblick in einem guten Fernrohr geben, als solch ein Gewimmel von Sonnen, die sich von der abgrundtiefen Himmelsdecke abheben wie eine Hand voll funkelnder Diamanten. Der hier abgebildete Sternhaufen zeigt nach seiner Mitte hin eine starke Zunahme der Sternenzahl. Man sieht deutlich, daß ein ursprünglich im großen und ganzen einheitlicher Nebelballen sich zunächst nach seiner Mitte hin im allgemeinen verdichtete, während sich zugleich die Verdichtungen der einzelnen Sterne bildeten. Wir haben hier ein System von Sonnen vor uns, die durch ihren gemeinsamen Ursprung miteinander in Beziehung stehen und jedenfalls auch gemeinsame Bewegungen um das gemeinsame Zentrum ausführen.
Das größte solcher Systeme von Sonnen ist unsere Milchstraße selbst. Nach den neuesten Forschungen ist es sehr wahrscheinlich geworden, daß sie nicht nur scheinbar in ihrem den ganzen Himmel umfassenden leuchtenden Ringe, sondern in Wirklichkeit das ganze unsern schärfsten Fernrohren überhaupt zugängliche Universum umfaßt und erfüllt, so daß also alle anderen Gebilde, die Tausende von Nebelflecken, Sternenhaufen und einzelnen Sonnen, mit Einschluß unserer Sonne und darum auch unserer Erde, als Teile dem großen System der Milchstraße angehören. Wir müssen uns mit dem Zustande dieser größten aller Welten etwas eingehender beschäftigen, deren Entstehungsweise uns alsdann nach dem Vorhergehenden unmittelbar verständlich sein wird.

Sternhaufen im Zentauren.

Milchstraße bei 6 Unseris.
Photographische Aufnahme von Prof. Wolf in Heidelberg.
Schon in kleineren Fernrohren löst sich bekanntlich der allgemeine Schimmer des gewaltigen Himmelsgürtels in eine Unzahl von kleinen Sternen auf, aber ganz überwältigend ist die Sternenfülle, wenn man nur einen kleinen Teil der Milchstraße in Daueraufnahmen auf der photographischen Platte festhält. Die vorstehende Aufnahme einer Stelle der Milchstraße im Sternbilde der Gans ist von Wolf in Heidelberg bei einer etwa siebenstündigen Belichtung hergestellt worden. An dieser Stelle befindet sich überhaupt kein dem unbewaffneten Auge sichtbarer Stern, und auch im Fernrohr würde man hier vielleicht nur wenige hundert zählen. Wer aber zählt die Sterne, die die photographische Platte uns allein auf diesem kleinen Himmelsfleckchen enthüllt?
Bereits in diesem kleinen Umkreise sehen wir die Sterne sehr ungleich verteilt, aber doch nicht ganz und gar chaotisch und ohne Regel. Es ist, als ob sie an gewissen Stellen perlschnurartig in Reihen geordnet wären, an andern Stellen ziehen dunkle, sternarme Kanäle durch die Sternenschwärme, als ob hier die Materie durch einen Eindringling zur Seite geschoben worden wäre. Wieder an andern Stellen gehen von einem größeren Sterne Sternzüge strahlenförmig aus, einen inneren Zusammenhang der ganzen Gruppe verratend. Dann sieht man sich nebelhafte Regionen ausbreiten, die nun wieder in dem vom Fernrohr aufgelösten Bilde der Milchstraße eine neue Milchstraße bilden. Hier wird ihre Sternenfülle unergründlich selbst für die lichtempfindliche Platte, die, wie bemerkt, viel tiefere Einblicke in die letzten Fernen des Himmels gewährt als selbst das stärkste Fernrohr. Solcher Nebelgebilde inmitten der Milchstraße hat die Himmelsphotographie noch eine große Menge enthüllt, wie zum Beispiel den hier weiter unten (S. 29) abgebildeten » Amerikanebel«, so genannt wegen seiner frappanten Ähnlichkeit mit jenem Kontinent. Nicht mehr ein bloßes Spiel des Zufalls ist hier die auffällige Erscheinung, daß sich rings um den Nebel herum eine Zone deutlicher Sternarmut befindet, die eben jene Form des Nebels hervortreten läßt. Man sieht es deutlich, daß sich die Materie, welche dieses Gewimmel von Sternen schuf, mehr und mehr zusammenzuziehen trachtet. Aus der Allgemeinheit, der Gleichförmigkeit, beginnt sich ein Weltindividuum auszuscheiden, wenn es auch noch aus Tausenden von Einzelsonnen besteht, wie unser Körper sich aus Zellen aufbaut, von denen jede, abgesehen von ihren gemeinsamen Aufgaben, ebenfalls eine gewisse Individualität bewahrt hat. Dieser Amerikanebel ist bereits ein Organismus im Organismus, und wenn wir uns vorstellen, daß jeder der Tausende von Sternen in ihm eine Sonne ist wie die unsrige, und vielleicht auch von Planeten umkreist wird wie sie, und wir nun erkennen, daß dieses Gebilde nur ein ganz kleiner Teil in dem großen Organismus der Milchstraße ist, so wird man sich ein Bild machen können von der Größe und Erhabenheit des Weltganzen, das, überall von den gleichen Gesetzen zusammengefügt, einer gleichen wunderbaren Ordnung entgegenstrebt.

Der »Amerikanebel«. Photographische Aufnahme von Prof. Wolf in Heidelberg.
Wie hier auf einem kleinen Gebiete, so sehen wir überall im großen Zuge der Milchstraße die Sternmaterie sich zu Wolken zusammenballen, in die sich bei näherer Betrachtung der gewaltige Ring auflöst. Die allgemeine Ordnung ist überall in der Natur nur in den allgemeinen Zügen vorhanden, im einzelnen läßt sie den Sternen wie uns Menschen ihre individuelle Entwicklung, soweit diese sich ihren großen Aufgaben anpaßt.
Schon bei oberflächlicher Betrachtung sieht jeder, daß die Milchstraße nicht in gleichmäßigem Zuge den Himmel umfaßt. An gewissen Stellen ist sie besonders breit, dafür aber recht mattleuchtend, an andern schmäler, aber ihre Sternenfülle unergründlich. Dort wieder teilt sie sich in zwei Arme, die später zusammenfließen. Auf der südlichen Halbkugel befindet sich gerade mitten im hellsten Striche ein großes dunkles Loch, der sogenannte Kohlensack. Dafür schweben ziemlich weit abseits von dem leuchtenden Gürtel zwei große Lichtballen, die Magelhanischen Wolken, die sich offenbar von dem großen Zuge einmal losgetrennt haben.
Neben diesen Unregelmäßigkeiten zeigt es sich nun, daß von der Milchstraße eine wunderbare Sternenordnung ausgeht, die sich über den ganzen Himmel ausbreitet. Zählt man nämlich die Sterne von der Milchstraße beginnend, indem man senkrecht zu ihr am Himmel fortschreitet bis zu den beiden Punkten, die überall gleich weit von dem Gürtel entfernt sind, den Polen der Milchstraße, so nimmt man mit Verwunderung wahr, daß dabei in regelmäßiger Stufenfolge die Sterne immer seltener werden. Dies gilt von den schwachen sowohl wie von den ganz hellen; alle gruppieren sie sich in einer allgemeinen Ordnung um die Milchstraße. Man muß sich hiernach die Form dieses ungeheuren Sternenkomplexes wie eine Linse vorstellen, die mit Millionen von Sternen ungefähr gleichmäßig ausgefüllt ist, wenn auch die Mitte etwas sternenärmer zu sein scheint als der sie umgebende Sternenring. Unsere Sonne befindet sich in dieser Mittelregion etwas außerhalb des Mittelpunktes selbst. Nach neueren Untersuchungen ist die Milchstraße aber doch kein eigentlicher Ring, sondern eine ungeheure, mehrfach gewundene und an mehreren Stellen zerrissene Spirale.
Das allergrößte Weltgebilde, das alles uns Bekannte überhaupt einschließt, besitzt also dieselbe spiralige Form, die wir an seinen Teilen durch den Zusammenstoß mit einer andern Masse entstehen sahen. Dürfen wir also auch hier von der gleichen Wirkung auf die gleiche Ursache schließen, so muß es jenseits des unserer Beobachtung noch zugänglichen Universums ein anderes Universum geben, aus welchem jener zweite Körper kommen konnte. Vielleicht haben wir in den Magelhanischen Wolken diesen Eindringling von außerhalb der bekannten Welt vor uns. Würden wir etwa aus der Richtung eines Pols der Milchstraße einen Blick auf dieses unser Universum werfen können, so müßte es uns offenbar ganz ähnlich dem vorhin (S. 12) abgebildeten Nebel in den Jagdhunden erscheinen, der auch außerhalb seiner Spiralen seine »Magelhanischen Wolken« hat. Vom Allergrößten bis zum Allerkleinsten wiederholt sich also dieselbe Anordnung der Materie, vom Milchstraßensystem bis herab zu den Atomen: Getrennte Ansammlungen von Masse, hier Sonnen, dort Atome, zwischen denen weite leere Räume liegen, dann ungefähr ringförmige Ordnung der Massenzentren um einen Mittelpunkt und kreisende Bewegung derselben um diesen. Alle Sterne unseres Himmels zeigen solche Bewegungen, deren Ordnung man zwar noch nicht genügend erkannt hat, weil dazu Tausende von Beobachtungsjahren gehören werden; aber schon die spiralige Anordnung der Milchstraße beweist ja, daß ihre Sonnen solche kreisenden Bewegungen ausführen müssen.
So haben wir also den allergrößten Weltkomplex entstehen sehen und begreifen die besondere Anordnung der Materie, die wir an ihm beobachten. Da seine Einzelteile, die Nebelflecke, die Sternenhaufen und schließlich die Einzelsonnen selbst, in ihrer Anordnung jenem größten System in allen bezüglichen Punkten gleichen, so verstehen wir zugleich auch deren Bildung. Aber es wird doch, ehe wir zu unserm Sonnenkörper zurückkehren, den wir schon bei seiner ersten Kondensationsarbeit verfolgten, gut sein, uns eine Vorstellung davon zu machen, wie nun aus jenem Spiralnebel, der in einzelne Materieknoten zerfiel, ein Sonnensystem gleich dem unsrigen mit seinen in festen Bahnen kreisenden Planeten werden muß.
Damit sich ein derartiges Sonnensystem bilden kann, muß sich im Mittelpunkte seine größte Masse vereinigt haben, woraus der vorherrschende Zentralkörper, die Sonne, entstehen konnte. Um ihn winden sich, zunächst noch ohne besonders hervortretende Ordnung, die Spiralen, die bereits in eine Unzahl von Einzelkörpern in allen Größen zerfallen sind. Das ganze Gebiet, das so mit Materie angefüllt ist, hat ungefähr die Form einer flachen Linse, aus der jedoch hier und da die Spiralwindungen hervortreten, wie wir denn überhaupt annehmen müssen, daß bei dem die Wiedergeburt dieser neuen Welt anregenden Zusammenstoße nicht alles in schönster Ordnung herging. Wir wollen die Welt aus dem Chaos neu bilden. Aber das Chaos ist eben die völlige Unordnung. Es ist unstatthaft bei der Entwicklung einer Weltbildungsidee von einem Urzustande auszugehen, in welchem die Weltmaterie in völlig gleichmäßiger Verteilung den Raum erfüllt als ein Nebelfleck ohne alle Differenzierung. In einem solchen müßten alle Atome gleichartig sein, gleich weit voneinander abstehen und eine gleichartige Bewegung besitzen. Dies wäre aber ein Zustand vollkommenster Ordnung, vollkommensten Gleichgewichtes, den jemals zu verlassen die Materie an sich keine Veranlassung haben würde. Man bedarf also auch hier eines äußeren Anstoßes, um frische Entwicklungskraft in diese ausgeglichene Massenansammlung zu bringen. Bei unserm Weltkörper-Embryo war eine ungleiche Verteilung der Massen und Bewegungen schon von vornherein vorhanden; sie bestimmte die zukünftige Anordnung des werdenden Weltsystems.
Seine linsenförmige Gestalt ist durch den Zusammenstoß gegeben, der die spiraligen Ausläufer in der Stoßrichtung hinauswirft. Nach diesem Impuls müssen sich nun alle Bewegungen notwendig so ordnen, daß sie dem allgemeinen Anziehungsgesetze Folge leisten. Bei einigen Materieteilen wird der Anstoß so stark gewesen sein, daß sie ganz aus der Anziehungssphäre der Gesamtmasse hinausgeschleudert wurden, solche Massen werden zu Meteoriten, die gelegentlich in andere Sonnensysteme eindringen. Wenn solche Körper unsere Atmosphäre durcheilen, so geschieht dies oft mit Geschwindigkeiten, die keinen Zweifel darüber lassen, daß sie außerhalb unseres Sonnensystems ihren Bewegungsimpuls erhalten haben. Alle andern Massen beginnen nun um das Zentrum der Gesamtmasse elliptische Bahnen zu beschreiben. Die meisten werden außerordentlich langgestreckt sein, wie die Kometenbahnen in unserm System. In diesen Bahnen laufen oder vielmehr fallen diese Schweifsterne mit zunehmender Geschwindigkeit gegen die Sonne hin, umkreisen sie dann in scharfem Bogen oft in großer Nähe, um darauf wieder in die unbekannten letzten Fernen des Systems hinaus zu wandern, aus denen sie gekommen waren. In jenen ersten Stadien der Weltbildung existiert noch keine Sonne. An ihrer Stelle erfüllt den ganzen innern Raum des Spiralnebels ein Konglomerat verschiedenartigster Massen, die gleichfalls um das allgemeine Zentrum kreisen, aber in nahezu kreisförmigen Bahnen, weil sie sich ja sonst nicht in dieser Mitte halten könnten. Durch diese eilen diejenigen Körper, welche jene langgestreckten Bahnen beschreiben, und müssen hier notwendig häufiger mit Massen zusammentreffen, die ihnen mehr und mehr von ihrer Bewegungsgeschwindigkeit nehmen, so daß ihre Bahnen immer weniger exzentrisch, das heißt also Kreisbahnen ähnlicher, und an Umfang kleiner werden. Noch heute beobachten wir ähnliches an manchen Kometen. Sie werden von den großen Planeten, namentlich dem Jupiter, denen sie zu nahe kommen, »eingefangen«, in enge Bahnen gezwungen und dadurch zu periodisch wiederkehrenden Kometen.
Solche Bewegungshemmungen ordnen im Verein mit den allgemeinen Gesetzen der Massenanziehung die Bahnen aller Körper oder besonderen Massenansammlungen irgendwelcher Art in dem Urnebel zu Ringen um das Zentrum an, zwischen denen der Raum sich mehr und mehr von Materie befreit. Aus diesen Ringen sollen sich nun Planeten bilden. Seit Laplace dachte man sich die Sache ganz einfach so, daß sich die Materie der Ringe nach und nach um ihre dichteste Stelle zusammenballte und zu einem besondern Körper verdichtete. Laplace selbst hat seine Schöpfungsidee niemals einer strengeren mathematischen Prüfung unterworfen und sie auch niemals als etwas anderes hingestellt als eine wissenschaftliche Mutmaßung, die durchaus der Berichtigung unterworfen werden könne. Das hat sich nun inzwischen wirklich immer mehr als notwendig erwiesen. Erst wieder in ganz jüngster Zeit hat ein Analytiker gefunden, daß Körper, welche in derselben Kreisbahn ein Massenzentrum umkreisen, ganz und gar nicht das Bestreben haben, sich einander zu nähern, sondern sich im Gegenteil so zu ordnen trachten, daß sie möglichst niemals in Kollision miteinander geraten. Die unveränderte Existenz der Saturnringe, welche aus einer unermeßlichen Zahl von solchen Einzelkörpern bestehen, beweist auch praktisch die Richtigkeit dieser theoretischen Rechnung. Anders werden freilich die Bedingungen, wenn ein kleinerer Körper in einem solchen Ringe sich einem sehr großen so weit nähert, daß er in den Bereich seiner besonderen Anziehungskraft kommt und diese die Anziehung des Zentralgestirns überwiegt, wie es mit den Sternschnuppen und Meteoriten gegenüber der Erde der Fall ist; dann müssen sie natürlich auf den größeren Körper fallen. Wir sehen also wieder, daß das Überwiegen einer größeren Masse in jedem Ringe, der einen Planeten bilden soll, notwendig ist, wie sie ja auch in vielen Spiralnebeln angetroffen wird. Wir haben dann die eigentliche Ringbildung gar nicht mehr nötig, sondern lassen gleich aus jener ursprünglich vorhandenen Verdichtung in jeder Spiralwindung einen Planeten entstehen. Die übrigbleibende Masse in der Spiralwindung bildet sich dann zu einem Ringe aus. Es scheint in der Tat, daß heute noch unsere Erde in solch einem Ringe schwebt, der die Erscheinung des Tierkreislichtes dadurch hervorbringt, daß von den sehr kleinen Körpern, die hier mit der Erde die Sonne umkreisen, das Sonnenlicht reflektiert wird. Der Ring der kleinen Planeten zwischen dem Mars und dem Jupiter ist nach dieser Ansicht dadurch als solcher bestehen geblieben, weil hier niemals eine vorherrschende Verdichtung im Urnebel vorhanden war.
Auf dieselbe Weise, wie hier die Planeten der Sonne entstanden, gruppieren sich nun auch Monde um die Planeten aus größeren Massen, die sich von vornherein in der Nähe der letzteren befanden. Recht betrachtet, sind die Monde eigentlich selbständige Planeten, die sich, da sie sich ebensoweit von der Sonne entfernt befinden wie ihre Hauptkörper, auch ebenso schnell um die erstere bewegen müssen; ihr Lauf wird nur periodisch von der besonderen Anziehungskraft des Planeten beeinflußt. Die Bahn unseres Mondes um die Sonne wird dadurch nur zu einer leicht gewellten Linie und bildet nicht etwa Schlingen, wie man es aus der doppelten Kreisbewegung vermuten sollte.
Ebenso kann man sich die Umdrehung der Planeten um sich selbst durch die Vereinigung der Massen entstanden denken, die sich in der Anziehungssphäre des Planeten in seinem Ringe mit um das allgemeine Zentrum bewegten. Ursprünglich muß die Bewegungsgeschwindigkeit in dem Nebel von innen nach außen zugenommen haben, umgekehrt wie heute bei den Planeten, weil in einem mit Masse angefüllten Körper seine Anziehungskraft in seinem Innern mit der Entfernung von seinem Mittelpunkte zunimmt, wie es auch im Innern unseres Erdkörpers der Fall ist. Je tiefer wir in denselben hinabsteigen, desto geringer wird die Schwerkraft, und im Erdmittelpunkte ist sie gleich Null, weil dort nach allen Seiten hin gleichviel Masse nach außen anziehend wirkt. Die äußeren Teile des Ringes bewegten sich also schneller als die innern, und es mußten bei der Vereinigung zu einem Planeten die äußeren, von der Sonne entfernteren Teile desselben in der Bahn vorauszueilen suchen. So entstand die Rotation in dem Sinne, daß die Planeten auf ihren Bahnen gewissermaßen rollen.
Kurz, alle Bewegungsverhältnisse, wie wir sie in unserm Sonnensystem wahrnehmen, lassen sich aus den oben entwickelten Beziehungen erklären; und wir können nun zu unserer Einzelsonne zurückkehren, die wir bereits in ihrem ersten Entwicklungsstadium betrachteten. Auch die Verdichtungen, welche später zu Planeten werden, wurden zuerst zu strahlenden Sonnen, die nur wegen ihrer geringeren Masse, die weniger Wärme entwickeln und festhalten konnte, schneller erkalten mußten wie der Zentralkörper, wenn ein solcher, wie in unserm System, vorherrschte, was durchaus nicht überall der Fall ist. Die vielen Tausende von Doppelsternen am Himmel beweisen, daß in einem System zugleich mehrere Sonnen existieren können. Einige unter diesen Doppelsonnen sind verschiedenfarbig, die eine leuchtet zum Beispiel rötlich, die andere grün. Wie wunderbar müssen die Farbenspiele auf Planeten sein, die vielleicht diese Sonnen gemeinsam umkreisen! Wir können uns die Schönheit einer solchen Natur kaum vorstellen. Auch unser System hat einstmals solche Tage gesehen. Der große Planet Jupiter muß die zweite Sonne gewesen sein. Schneller erkaltend als das Zentralgestirn, mußte er in Rotglut übergehen zu einer Zeit, als unsere Sonne vielleicht noch in höherem Hitzegrade mehr bläuliche Strahlen aussandte, während ihr Licht heute bei genauerer Untersuchung bereits einen Stich ins Gelbliche zeigt. Auch gegenwärtig scheint der Jupiter noch etwas eigene Wärme auszustrahlen und unter den Wolken seiner für uns sichtbaren Oberfläche eine noch schwach glühende Kruste zu bergen.
Wir hatten unsern werdenden Sonnen- oder Planetenkörper verlassen, als er noch im Zustande eines Gasballes schon eine glühendflüssige Oberfläche zu bilden begann, indem durch die eindringende Kälte des Weltraumes sich die dichtesten Stoffe zu Wolken kondensierten, aus denen es herabregnete. Freilich mußten sich dann die glühenden Regentropfen im Herabfallen bald wieder verflüchtigen, weil die tieferen Schichten des Gasballes eine höhere Temperatur besaßen als die oberen, in denen die Kondensation stattfand. Es entsteht also eine fortwährende Zirkulation zwischen den oberen und unteren Schichten, wie in unserer Atmosphäre, und auch sonst müssen auf dem Sonnenkörper trotz seiner so viel höheren Temperatur prinzipiell ganz ähnliche Verhältnisse in bezug auf die »Meteorologie« seiner obersten Luftschichten eintreten wie bei uns. Er bewegt sich ja gleichfalls um eine Achse, und deshalb müssen zum Beispiel an seinem Äquator die oberen Luftschichten mehr zurückbleiben als gegen die Pole hin; regelmäßige Passatwinde, Einteilung in meteorologische Zonen sind die Folge davon. Es muß wie auf der Erde ein Ausgleich der allgemeinen Windströmungen zwischen Pol und Äquator stattfinden, und diese Strömungen müssen sich irgendwo in einer mittleren Zone treffen und hier Wirbel bilden, Zyklone, in denen, ganz und gar nach denselben physikalischen Gesetzen wie auf der Erde, die Kondensationen sich mehren. Deshalb sehen wir auf der Sonne in gewissen mittleren Zonen, nicht am Äquator und nicht an den Polen, die Sonnenflecke entstehen. Schon der bloße Anblick kennzeichnet sie als Wirbelbewegungen, und wenn sie durch die Rotation der Sonne gegen ihren Rand hintreten, sieht man auch deutlich, daß sie Vertiefungen in der Lufthülle sind. Es ist ferner durch die direkte Beobachtung nachgewiesen worden, daß von den Sonnenflecken nur etwa die Hälfte der Wärmestrahlung ausgeht wie von der übrigen Sonnenoberfläche. Die Ähnlichkeit der Verhältnisse mit denen auf der Erde geht so weit, daß diese Sonnenzyklone zweifellos auch von elektrischen Erscheinungen von ganz unvorstellbarer Gewalt begleitet sind. Diese elektrischen Entladungen teilen sich sogar über die 150 Millionen Kilometer, welche uns von der Sonne trennen, hinweg der Erde in der allerfühlbarsten Weise mit, indem sie in deren elektro-magnetischem Zustande gewaltige Schwankungen hervorbringen. Wenn die Sonnenstürme sich mehren, so werden alle Magnetnadeln rings um die Erde herum besonders unruhig, Erdströme eilen unter der Oberfläche hin und dringen in die mit der Erde verbundenen Telegraphenleitungen. Die Sonne greift dann über den leeren Raum hinweg in unsere Apparate ein und macht uns durch diese drahtlose Telegraphie in gewaltigsten Dimensionen Mitteilungen über den ungeheuren Kampf der Elemente in ihrem noch so überaus jugendlichen Körper. Zu gleicher Zeit leuchten in den höchsten Schichten unserer Atmosphäre die geheimnisvollen Polarlichter auf, die von Pol zu Pol ihre roten Strahlenbündel schießen lassen, um die elektrische Störung wieder auszugleichen. Diese Polarlichter haben große Ähnlichkeit mit den Glimmentladungen in den sogenannten Geislerschen- oder Kathodenröhren. Solche Glimmentladungen finden nur in sehr verdünnten Gasen statt, wo blitzartige Erscheinungen nicht mehr möglich sind. Auch in der außerordentlich dünnen Sonnenluft, in welcher jene Revolutionen vor sich gehen, können nur solche Glimmentladungen stattfinden, die man ohne weiteres als solche in der intensiven Strahlung der Umgebung begreiflicherweise nicht erkennen kann. Aber oft sieht man über den Sonnenrand mächtige rote Flammenzungen schlagen, die sogenannten Protuberanzen, die sich mit einer so ungeheuren Geschwindigkeit verbreiten, daß man Zweifel daran erhoben hat, es würde hier wirklich Materie in diesen Augenblicken ausgeschleudert, und vielmehr glaubt, diese Gebilde seien schon vorher dort vorhanden gewesen und nur durch elektrische Entladungen, die sich in jenen aus Wasserstoff und Helium gebildeten Wolken so schnell verbreiteten, sichtbar geworden. In neuerer Zeit hat man die Vermutung ausgesprochen, die Sonne schleudere uns aus ihren Flecken jene Elektronen zu, die vom Radium beständig mit Lichtgeschwindigkeit ausgehen; diese bringen dann sowohl auf der Sonne selbst wie auf der Erde abnorme elektrische Zustände hervor.
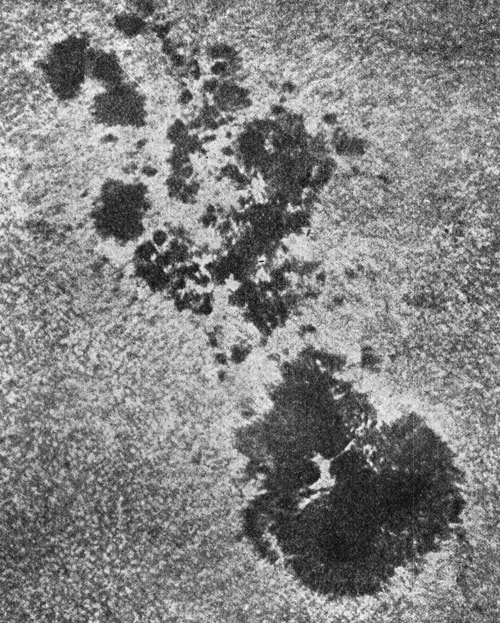
Sonnenflecken.
Nach dem photogr. Sonnenatlas der Meudoner Sternwarte.
Nach dem gigantischen Kampfe der Elemente tritt wenigstens vorübergehende Ruhe ein, denn der Kampf sucht ja den Ausgleich. Die unausgesetzte Arbeit der Verdichtung geht dann in ruhigerer Weise fort. Die Kondensationsprodukte der oberen Schichten beginnen in etwas größerer Tiefe eine glühendflüssige Haut um den Gasball zu erzeugen, die in beständigem Werden und Vergehen ist, aber doch jetzt nur selten von innen heraus durchbrochen wird, weil eben der ganze Prozeß gleichmäßiger verläuft. Aber die weitere Verdichtung, das Zusammenziehen des Sonnenballes erhöht, wie wir wissen, seine Gesamttemperatur, ganz besonders in seinem Innern. Diese wird sich deshalb mit der Zeit so weit steigern müssen, daß sie die flüssige Haut nicht mehr bestehen lassen kann; die Flüssigkeit wird an ihren schwächsten Stellen und da, wo die allgemeine Zirkulation der Sonnenmasse es durch die vorhandenen Gegenwirkungen am leichtesten macht, durchbrochen: Eine neue Sonnenfleckenperiode beginnt. Es ist bekannt, daß nach etwa 11 Jahren bei unserer Sonne solche Perioden größerer Unruhe ihrer strahlenden Atmosphäre eintreten, zwischen denen Zeiten besonderer Reinheit ihrer Oberfläche liegen. Wir haben hier die physische Notwendigkeit dieser Pulsationen erkannt. Die Erscheinung selbst hat in physikalischer Hinsicht viel gemein mit dem Geiserphänomen, bei dem auch in bestimmten Intervallen nur durch die allmähliche Zufuhr von Wärme aus dem Erdinnern plötzliche Eruptionen eintreten. Wir werden später noch darauf zurückzukommen haben.
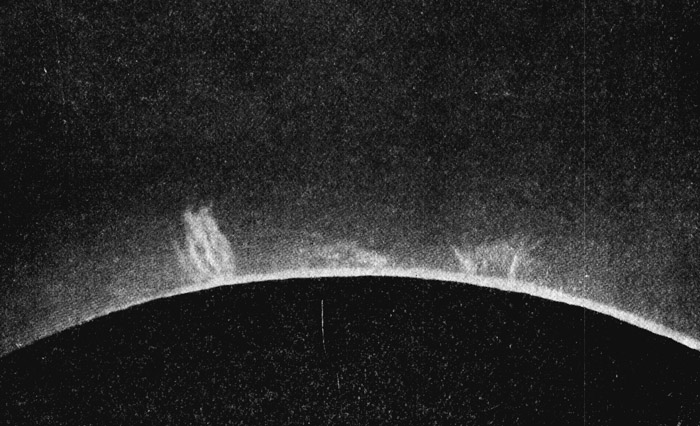
Protuberanzen am Sonnenrande.
Die Sonne selbst ist durch den Mond verfinstert.
Mit dem zunehmenden Abkühlungsprozesse werden sich nun auch die Sonnenflecke mehren und periodisch unsere werdende Sonne immer stärker verdunkeln. Auch für dieses Entwicklungsstadium finden wir Repräsentanten am Himmel; es sind die veränderlichen Sterne von langer und etwas unregelmäßiger Periode, denn auch die Sonnenfleckenperiode ist Schwankungen um einen Mittelwert unterworfen. Der charakteristischste Stern dieser Art ist Mira im Walfisch. Dieser Stern gehört zeitweise zu den hellsten, sein Glanz liegt dann zwischen der ersten und zweiten Größenklasse. Darauf nimmt er stufenweise ab, bis er etwa siebzig Tage nach seinem Maximum für das bloße Auge verschwindet. Im Fernrohr sieht man ihn dann noch während drei oder vier Monaten bis zu einem Stern zwischen der neunten und zehnten Größenklasse weiter abnehmen, worauf er merklich schneller, als er abnahm, wieder heller wird. Nach durchschnittlich 333 Tagen vom letzten Maximum ist das nächste wieder erreicht; die Zunahme vom ersten Sichtbarwerden mit dem bloßen Auge bis zur größten Lichtstärke dauert gewöhnlich nur 40 Tage gegen 70 für die Abnahme. Diese Eigenschaft des kleineren Zeitintervalles vom Maximum zum Minimum, wie von diesem zurück, teilt der wunderbare Stern gleichfalls mit der Sonnenfleckenperiode. Aber alle diese Zeiten werden nur ungefähr innegehalten und können gelegentlich selbst um einen Monat schwanken, ebenso wie der Stern zuweilen im Maximum kaum die fünfte Größenklasse erreicht und also für das bloße Auge nur schwer sichtbar wird. Das Spektroskop verrät bei diesem und andern Sternen seiner Art, daß zur Zeit des Maximums hellleuchtender Wasserstoff aus dem Innern des Sternes dringt. Wir erkennen hieraus den eruptiven Charakter der Erscheinung.
Allmählich wird nun die flüssige Haut unseres Sonnenkörpers dicker und widerstandsfähiger, so daß sie dauernd bestehen bleibt und höchstens hier und da einmal vom gasförmigen Innern gewaltsam durchbrochen wird. Es mag auf den ersten Blick unmöglich erscheinen, daß eine flüssige Schicht auf einer gasförmigen dauernd ruhen könne, wie es hier vorausgesetzt wird. Aber man muß sich wohl vorstellen, daß bei diesen Weltkörperdimensionen ganz andere Verhältnisse eintreten, als man sie in unsern Laboratorien erzeugen kann. Durch den Eigendruck der Massen eines solchen Körpers werden die Gase in seinem Innern so stark zusammengepreßt und dennoch wegen der sehr hohen Temperatur gasförmig erhalten, daß sie schwerer sind als die Flüssigkeiten, welche sich über ihnen kondensiert haben. Sollten sich aber wirklich unter den Kondensationsprodukten schwerere Flüssigkeiten finden, so sinken sie eben in die Tiefe und werden, wie es schon oben beschrieben wurde, in den Gluten des gasförmigen Kerns wieder aufgelöst. Es wird so von selbst eine Auslese unter den verschiedenen Stoffen stattfinden, durch welche die Flüssigkeitsschicht Bestandfähigkeit erhält.
Unser Weltkörper hat also nun eine dauernde glühendflüssige Oberfläche erhalten. Wir wissen, daß unsere Erde sich einstmals in diesem Stadium befand, denn, wo wir auch genügend tief in ihre Kruste eindringen mögen, da finden wir kristallinisches Urgestein, jenen Granit und Urgneis, der auch den Kern der meisten großen Gebirgsstöcke bildet. Dieses Urgestein hat in allen wesentlichen Punkten dieselbe Zusammensetzung wie die Laven, welche durch die Vulkane aus den Tiefen der Erde hervorbrechen; die ganze Erdoberfläche muß deshalb einmal aus flüssiger Lava bestanden haben. Und wie damals muß auch heute noch das darunter befindliche Innere der Erde gasförmig sein, denn an den betreffenden Verhältnissen konnte sich durch die nun weiter fortschreitende Abkühlung nichts ändern. Dabei wissen wir, daß das Erdinnere wesentlich schwerer ist als durchschnittlich die Massen der Oberfläche. Das spezifische Gewicht der gesamten Erdmasse ist etwa gleich dem des Eisens; die Gesteine der Erdkruste aber sind wesentlich leichter als Eisen. Gleichzeitig konstatieren wir, daß die Temperatur der Erdschichten mit je 30 Meter größerer Tiefe etwa um einen Grad zunimmt. Da kommen wir dann bei gar nicht so beträchtlichen Tiefen zu Hitzegraden, bei denen kein uns bekannter Stoff anders als im gasförmigen Zustande mehr existieren kann. Also auch von diesen Erfahrungstatsachen aus kommen wir zu dem gleichen Schlusse, wie aus unserer Weltbildungsansicht heraus, daß die Weltkörper in ihrem Innern gasförmig sein müssen.
Die fortschreitende Abkühlung läßt nun auf der glühendflüssigen Haut unseres Gasballes feste Schlacken entstehen, ebenso wie auf den Lavaströmen. Die Schlacken sind als kristallinische Produkte in den meisten Fällen leichter wie die Flüssigkeiten, auf denen sie erstarrten; sie schwimmen auf ihnen wie das Eis auf dem Wasser. Freilich gibt es auch viele Stoffe, die im festen Zustande schwerer sind als im flüssigen. Sie werden dann untersinken und ganz ebenso, wie wir es in dem Spiele zwischen der flüssigen Haut und dem innern Gaskern beobachteten, sich in den heißeren Schichten der Tiefe wieder auflösen. So muß also notwendig die Flüssigkeitsschicht schwerer bleiben als die sich über ihr bildende feste Hülle. Die schwimmenden Schlacken mehren sich und werden von den Strömungen gegeneinander getrieben. Sie reiben sich gegenseitig ihre scharfen Kanten ab, legen sich aneinander und verschmelzen so, nach und nach feste Schollengebiete von kontinentaler Ausdehnung bildend. Ein solcher Weltkörper hat also dunkler und heller leuchtende Stellen, und da er sich um eine Achse dreht, muß er abwechselnd diese verschiedenen Stellen nach bestimmten Richtungen des Weltalls kehren. Aus großer Entfernung gesehen, die ihn nur noch als durchmesserlosen Stern erscheinen läßt, wird er also sein Licht in bestimmten Intervallen wechseln, die sich im allgemeinen gleich bleiben, oder die höchstens insoweit langsamen Änderungen unterworfen sein werden, als die dunklen Schollengebiete auf der glühendflüssigen Oberfläche noch keine ganz feste Lage haben, sondern von den Strömungen noch langsam getrieben werden. Wir gelangen so zu einer besonderen Kategorie von veränderlichen Sternen, die im allgemeinen wohl dem Typus der Mira entsprechen, deren Licht aber regelmäßiger und in kürzeren Intervallen schwankt und bei manchen dieser Himmelskörper auch sekundäre Minima zeigt, die vielleicht darauf schließen lassen, daß über den rotierenden Stern verschieden ausgedehnte Schlackenfelder verteilt sind. Abermals haben wir damit eine gegenwärtig am Himmel wahrnehmbare Erscheinungsform als ein Glied der großen Kette der Weltentwicklung erkannt.
Während sich die Oberfläche des Weltkörpers mehr und mehr überkrustet, stuft sich seine ursprüngliche Weißglut allmählich zur Rotglut ab. Die Farbe eines flüssigen oder festen Körpers im Glutzustande drückt unmittelbar seinen Hitzegrad aus. So beginnt die Rotglut bei 525 Grad, ein hell kirschrot glühender Körper, gleichviel aus welchen Stoffen er besteht, hat eine Temperatur zwischen 800 und 1000 Grad. Ein gelbstrahlender etwa 1200, und die Weißglut beginnt bei 1500 Grad. Wir treffen nun am Himmel Sterne von allen Farbenabstufungen an, vom tiefen Rubinrot bis zu den bläulichen Färbungen, die den höchsten Hitzegrad anzeigen. Es gibt also in der Tat im Weltgebäude Körper von allen Temperaturgraden, und es ist sehr bedeutungsvoll für unsere Anschauungen, daß sich gerade unter den veränderlichen Sternen die meisten roten befinden, weil jene Ursachen der Veränderlichkeit, von denen wir oben sprachen, ja nur in den letzten Stadien des Erkaltungsprozesses der glühenden Oberfläche eintreten können.
Der Körper überzieht sich allmählich mit einer festen Kruste, die nur noch wenig eigenes Licht ausstrahlt. Über ihr lagert sich eine dichte Atmosphäre von Rauch und Gasen, die von der Schlackenoberfläche ausgestoßen werden oder auch aus dem Innern immer wieder hervorbrechen müssen. Häufig wird auch ein größeres Schollengebiet wieder aufbrechen und von der glühenden Lava überflutet werden. Es entsteht ein See aus glühendflüssigem Gestein, der sich erst nach langer Zeit langsam wieder überkrustet. Ein solcher Körper wird, aus entsprechender Ferne gesehen, durchaus den Eindruck machen wie für uns der Planet Jupiter. Von ihm sehen wir nur die obersten Schichten seiner Atmosphäre, ebenso wie von der Sonne. Da Jupiter sehr schnell um seine Achse rotiert, so trennen sich die Wolken sehr deutlich in Zonen. In einer dieser Zonen erschien in den siebziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts ein großer roter Fleck, der sich anfänglich nur durch einen matten Schein verriet, dann aber schnell intensivere Färbung annahm, um sehr langsam wieder zu verblassen; er ist heute noch nicht gänzlich verschwunden. Während der Dauer seines Bestehens zeigte er eine verschieden schnelle eigene Bewegung auf der Jupiteroberfläche, und zwar blieb er sehr langsam gegen die normale Umschwungsbewegung zurück. Man kann die Erscheinung nur so deuten, daß Jupiter sich in dem oben geschilderten Stadium der Erkaltung befindet und jener rote Fleck der in den Wolken sichtbare Widerschein eines solchen Lavasees von kontinentalen Dimensionen ist, der sich auf irgend eine Weise einen Durchbruch verschaffte (siehe auch »Weltuntergang« etc. S. 65). Infolge der schnellen Umdrehung des Planeten blieb die Lava zurück und überflutete das der Umschwungsbewegung folgende Ufer des Sees, während auf der entgegengesetzten Seite die Überkrustung leichter fortschreiten konnte; daher die zurückweichende Bewegung des Fleckes auf der Oberfläche.
Auf der Erde besitzen wir selbst gegenwärtig noch einen oder auch zwei solcher Lavaseen, auf Hawai im Krater des Kilauea und im kleineren Maße nach meiner Ansicht auch im Stromboli auf einer der Liparischen Inseln nördlich von Sizilien. Jener Lavasee des Kilauea überzieht sich beständig mit Schollen, die sich dicht aneinanderlegen, so daß man in der Nacht ein hellleuchtendes Netzwerk von feinen Linien über der rotglühenden Fläche in beständiger Bewegung sieht. Die Schollen können aber niemals dazu kommen, hier aneinander zu schmelzen, weil aus dem Innern von Zeit zu Zeit eine mehrere Meter hohe Fontäne flüssigen Gesteins zwischen den Schollen emporgeschleudert wird, die immer wieder alles überflutet und auflöst. Viele Umstände machen es sehr wahrscheinlich, daß man es hier wirklich noch mit einem letzten Reste der ursprünglich feuerflüssigen Oberfläche unseres Planeten zu tun hat.
Ganz ebenso, wie wir es bei den Gas- und Dunstmassen der Atmosphäre gesehen haben, muß auch die feuerflüssige Oberfläche bestimmte Strömungen aufweisen, die einerseits in der Rotation des Weltkörpers ihre Ursache haben, andererseits in der Zirkulation, welche der Wärmeausgleich der unteren mit den oberen Schichten bedingt. Auch hier müssen Strömungen mit Gegenströmungen kämpfen, und in den betreffenden Gebieten werden die Schollen so gewaltig gegeneinander gedrängt, daß sie sich gelegentlich hoch auftürmen. Sind diese Schollen bereits von kontinentaler Ausdehnung, so werden sich mächtige Rippen auf der Oberfläche bilden, Gebirgszüge, die einen großen Teil des Planeten umspannen, wie zum Beispiel auf der Erde die Anden, die sich fast vom Nordpol bis zum Südpol erstrecken und in ihrem Kerne wirklich aus jenem Urgestein bestehen, aus welchem sich unser Planet seinen ersten festen Panzer aufbaute. Sind die Anden aber aus der Zusammenstauung von Schollen infolge großer widerstreitender Strömungen entstanden, so muß zur Zeit ihrer Bildung die Lage des Erdäquators eine fast diametral entgegengesetzte gegen die heutige gewesen sein; denn solche Strömungsdifferenzen, wie wir sie hier voraussetzen, werden immer nur parallel zum Äquator stattfinden. Wir wollen uns dies merken, da wir später noch von einer Reihe von Tatsachen zu reden haben werden, die nur durch eine langsame Verschiebung der Erdachse im Raume erklärt werden können.
Sind die Gebirge wirklich durch ein solches Aufwerfen gegeneinander gedrängter Schollen entstanden, so ist unter ihnen die Erdrinde keineswegs stärker, sondern eher noch schwächer als in den Ebenen, die Gebirge bedeuten also kein Plus an fester Masse, was durch die Beobachtung bestätigt zu werden scheint. Mit einem ganz ähnlichen, nun aber fest werdenden Netzwerk zwischen den Schollen, wie es der Lavasee des Kilauea zeigt, mußte sich jetzt auch unser ganzer Weltkörper überziehen, also mit Linien geringster Widerstandsfähigkeit der Kruste, auf denen das glühendflüssige Innere, das Magma, leichter durchbrechen konnte, und wo sich die wenn auch schon verfestigten Schollen doch noch immer etwas gegeneinander zu bewegen vermochten, wenn etwa später, beim weiteren Ausbau des Weltkörpers, den wir nun in der Folge als die Erde bezeichnen können, ausgedehnte Verschiebungen seiner Oberflächenteile notwendig wurden. Wir erkennen auf der Erde noch heute solche großen Bruchlinien, wo die » tektonischen Erdbeben« am häufigsten angreifen und weitausgedehnte Ländergebiete zugleich in zuckende Bewegungen versetzen. Eine solche Bruchlinie verläuft zum Beispiel ziemlich senkrecht zu den Anden, an der Antillengruppe vorbei quer durch den Atlantischen Ozean und weiter bis über den Kaukasus hinaus. Namentlich seit der Katastrophe von Martinique ist längs dieser alten Bruchlinie die Erdkruste wieder in beständiger Unruhe; die Erde will hier einen weiteren Schritt in ihrer Entwicklung vorwärts tun.
Mit der Bildung einer festen Kruste tritt unser Weltkörper in sein vulkanisches Zeitalter, in welchem unsere Erde noch heute steht. Zuerst beherrschte der Vulkanismus die ganze Erde; seine Äußerungen waren überall verbreitet, doch eben deshalb zugleich wohl auch weniger heftig, weil sich die Spannungen überall noch leichter befreien konnten. Wir wollen die Entwicklung dieser vulkanischen Erscheinungen durch die Zeitalter weiter verfolgen, bevor wir alle die andern Einflüsse ins Auge fassen, welche dem Antlitz der Erde ein so vielartiges Gepräge gegeben haben.
Wir verstehen es nach dem Vorangegangenen, daß das Innere der Erde beständig nach außen hin weiter reagieren muß. Das Spiel der Naturkräfte, durch welches wir die Sonnenflecken in bestimmten Zwischenräumen durchbrechen sahen, besteht ja eigentlich unausgesetzt fort. Es bleibt immer der Widerstreit bestehen zwischen dem Wärme erzeugenden Druck der Massen und der eindringenden Kälte des Weltraums. Diese packt den festen Panzer natürlich viel kräftiger an als früher die feuerflüssigen Massen und sucht ihn zusammenzupressen. Die Hülle wird dem Erdkörper zu eng; sie birst und läßt das glühende Magma überfluten. Die Schollen sinken tiefer, indem sie meistens nur da noch festgehalten werden, wo die Gebirgsrippen Widerstand leisten. Es entstehen Mulden zwischen denselben, die zukünftigen Meeresbecken. Immer unsicherer hängen bei diesem Niedersinken die Schollen an jenen aufgeworfenen Verbindungsstellen, und schließlich reißt eine Scholle auf ihrer ganzen Länge los. Sie rutscht längs der alten Bruchlinie ab, während gegenüber die andere Scholle stehen bleibt und eine Gebirgsmauer bildet, die gegen das entstandene Becken schroff abfällt. Eine solche Abrutschung hat einstmals längs der ganzen Andenkette stattgefunden, allerdings zu einer Zeit, als diese Mulden schon längst von ausgedehnten Meeren erfüllt waren.
Als noch zu jener ersten Zeit der Krustenbildung solche größeren Durchbrüche stattfanden, mochten wohl ganze Meere von Magma überfluten und über einem aus feuerfesteren Materien geformten Boden lange bestehen bleiben. Es entstanden also ausgedehnte Becken aus feuerflüssigen Massen, die durch feste Erdkrustenteile von dem eigentlichen Magma des Erdinnern getrennt waren. Auch diese feuerflüssigen Meere überkrusteten sich nun allmählich, wie ein See sich mit einer Eisdecke überzieht. Es bildeten sich so kristallinische Schichten, die eine horizontale Lagerung und Struktur besitzen, wie sie im Urgestein oft in ganz merkwürdiger Weise hervortritt und schon an sich vermuten ließ, dieses Gestein sei, wie die über ihm ruhenden »Sedimentschichten,« doch wohl durch Ablagerung aus eigentlichen Meeren entstanden. Nach der Meinung der Pariser Mondforscher Loevy und Puiseux sind die weiten Mare-Ebenen des Mondes auf diese Weise gebildet worden. Auch dieser Trabant unserer Erde muß ja ein entsprechendes Entwicklungsstadium durchlebt haben, und da auf ihm wahrscheinlich niemals das Wasser und die Wirkungen der Verwitterung eine sehr bedeutsame Rolle bei der Ausgestaltung seiner Oberfläche gespielt haben, so hat diese im großen und ganzen die Form bewahren können, welche sie nach ihrer Erstarrung annahm, während das Antlitz der Erde seitdem unter so viel verschiedenartigen Einwirkungen seine Charakterzüge wesentlich ändern mußte, wovon wir noch zu sprechen haben werden.
Bekanntlich ist die Oberfläche des Mondes mit »Kratern« ganz erfüllt. Man schätzt ihre Zahl auf 100 000. Der Vulkanismus müßte also auf unserm Begleiter ganz unvergleichlich mächtigere Wirkungen geübt haben, als wir sie wenigstens gegenwärtig auf der Erde kennen, denn auch die Ausdehnung der einzelnen Mondkrater ist eine ganz erheblich größere als die unserer größten Vulkane. Sie besitzen meist noch besondere Eigenschaften, die es zum mindesten unwahrscheinlich machen, daß sie echte Vulkane sind. Vergegenwärtigen wir uns nun unsere Auffassung von der Entstehung der Himmelskörper aus zusammenstürzenden Massen, die sich längs eines Ringes geordnet hatten, so können die Ringgebirge des Mondes wohl durch den Aufsturz jener kleineren Monde des ursprünglichen Ringes entstanden sein. Sie durchbrachen dabei die feste Kruste und verschwanden im feuerflüssigen Innern, indem sie selbst wieder feuerflüssig wurden. Die so gebildete Öffnung wurde dadurch selbstverständlich zu einer Art von Vulkan und erzeugte in ihrer Umgebung weitere vulkanische Erscheinungen, die vielleicht heute noch nicht gänzlich auf unserm Begleiter erloschen sind.
Daß die Erde solche Spuren einstmaliger Zusammenstürze mit den Einzelmassen des Weltkörperringes auf ihrer Oberfläche nicht bewahrt hat, erklärt sich daraus, daß sie weit längere Zeit brauchte, um einen festen Panzer zu bilden. Inzwischen waren längst alle großen Massen des Ringes mit ihr vereint, während vielleicht mancher Meteorit, der heute noch in unsere Atmosphäre schlägt und dort verpufft, zu den übrig gebliebenen Massen dieses Urringes gehört. Die Atmosphäre der Erde war zu Urzeiten jedenfalls noch ganz wesentlich dichter als heute und hielt auch dadurch den direkten Aufsturz kosmischer Massen auf die Oberfläche ab, was beim Monde niemals in ähnlichem Maße der Fall gewesen sein kann, schon deshalb nicht, weil ein kleinerer Körper immer nur eine viel kleinere Lufthülle festhält.
Die vulkanische Tätigkeit mußte nun auf der Erde und den ihr verwandten Weltkörpern mit ihrem zunehmenden Alter eine andere werden. Die Dicke der festen Kruste nahm ja beständig zu; sie leistete einen immer größeren Widerstand; die Vulkanausbrüche wurden seltener, aber katastrophenartiger. Wir machen diese Beobachtung heute im kleinen an den einzelnen Vulkanen, daß sie um so gewaltigere Eruptionen zeitigen, je länger sie geruht hatten. Das Beispiel des Mont Pelée auf Martinique hierfür ist noch in Aller Erinnerung. Die Katastrophe von Pompeji ereignete sich, als man den Vesuv überhaupt nicht mehr als einen Feuerberg kannte. Gegenwärtig ist dagegen von ihm kein vernichtender Ausbruch zu erwarten, da er beständig kleinere Eruptionen ausweist.
Wir erkennen aus dem Vorangegangenen auch, daß sich getrennte Herde vulkanischer Tätigkeit bilden mußten, die den abgesonderten Becken der ehemaligen feuerflüssigen Meere und Seen entsprechen. Vielleicht steht heute überhaupt kein Vulkan mehr in direkter Verbindung mit dem feuerflüssigen Innern der Erde, oder doch nur wenige. Bedeutungsvoll ist in dieser Hinsicht das Beispiel der beiden Vulkane Mauna Loa und Kilauea auf Hawai. Der erstere ist 4170 Meter hoch und überhaupt der größte tätige Vulkan der Erde. In seinem gewaltigen Krater steht die Lava beständig in feuerflüssigem Zustande und wird in riesigen Fontänen aus dem Erdinnern hervorgesprudelt. Ganz dasselbe geschieht auch im Krater des 3000 Meter tiefer liegenden Kilauea, der am Fuße des Mauna Loa liegt und für einen Parasitkrater des letzteren gehalten werden könnte. Nichtsdestoweniger haben die Eruptionen der beiden Vulkane nichts Gemeinsames. Ihre beiden Lavaseen können unmöglich in ein und dasselbe Reservoir, etwa gar das feuerflüssige Erdinnere, münden, weil die Niveaudifferenz nach den Gesetzen der Hydraulik nicht zu erklären wäre. Es ist nicht möglich, daß in kommunizierenden Röhren, als welche sich jene beiden Kraterschlünde herausstellen müßten, eine Flüssigkeit auf verschiedenem Niveau steht. Vielleicht aber ist einer der beiden Vulkane doch noch in direkter Verbindung mit dem Magma, der andere aber mündet in ein abgetrenntes unterirdisches Lavabecken.
Geologische Untersuchungen haben gezeigt, daß nach einer verhältnismäßigen Ruhe die vulkanische Tätigkeit der Erde plötzlich um die Mitte der Tertiärzeit in geradezu erschreckendem Maße zugenommen hat. Damals riß sich die Erdscholle des pazifischen Beckens los und ließ die Vulkane der Andenkette hervorbrechen, die zu jener Zeit an Zahl und Größe viel bedeutender waren wie heute, aber in ihrer gegenwärtigen Tätigkeit sehen wir immer noch die Nachwehen jener wilden Epoche der Erdentwicklung, die auch die Alpen gebar und dem Antlitz der Erde im wesentlichen erst seine heutige Gestalt gegeben hat.
Die Ursache dieser über die ganze Erdoberfläche verbreiteten gewaltigen Veränderungen kann nur in einer starken Gleichgewichtsverschiebung des Erdkörpers gesucht werden, welche die alten, inzwischen miteinander mehr oder weniger fest verkitteten oder, besser gesagt, verlöteten Schollen wieder teilweise auseinanderriß oder auftürmte. Solch eine Gleichgewichtsstörung aber konnte nur von außen her, durch kosmische Gewalten, hervorgebracht werden. Vielleicht war es ein einstmals vorhandener kleinerer Mond der Erde, ein letzter großer Massenknoten des Urringes, der damals auf die Erde stürzte und dadurch die Lage ihres Äquators verschob. Am Äquator befindet sich bekanntlich infolge der Achsendrehung der Erde eine Anschwellung, die den Erdball zu einem »Rotationsellipsoid« macht, das heißt, ihn an seinen Polen abplattet. Wäre die Erde ein absolut starrer Körper, der sich durch die Wirkungen der eingreifenden Naturkräfte in keiner Weise mehr kneten ließe, so wäre die gegenwärtige Übereinstimmung der Äquatoranschwellung mit dem wirklichen Umdrehungsäquator ein Beweis dafür, daß die Erdachse seit jenen Urzeiten, als sich die festen Schollen um den flüssigen Leib unseres Planeten schlugen, ihre Lage im Erdkörper nicht mehr verändert hätte. Man hat deshalb lange diese Abplattung selbst für den sichersten Beweis angeführt, daß wirklich die Erde einmal feuerflüssig war. Heute aber hat man theoretisch wie praktisch nachweisen können, daß es nichts absolut Starres gibt, daß auch das festeste Gestein sich unter starken anhaltenden Wirkungen formt, plastisch wird, so daß also, abgesehen von einem gewissen Zeitunterschiede zwischen Ursache und Wirkung, die Erde schließlich immer die Gestalt haben muß, welche sie als flüssiger Körper besitzen würde. Sind deshalb die Pole gewandert, so muß auch die Äquator-Anschwellung ihre Lage beständig entsprechend geändert haben das heißt, ein rings um die Erde herum gehendes Gebirge von 20 Kilometer Höhe wanderte über ihre Oberfläche hin. Zwar geschah dies wohl fast unendlich langsam, aber wir können es uns wohl vorstellen, daß dadurch immer wieder an den Schollen gerüttelt werden mußte, die sich stets nur notdürftig zusammenschließen konnten.
Eine sehr bedeutende Verschiebung der Erdachse mußte begreiflicherweise der Aufsturz eines Mondes hervorbringen, wenn auch dessen Masse nicht bedeutend gewesen sein mag. Man kann sich die Wirkung an einem Kreisel vergegenwärtigen, der sogleich stark ins Schwanken gerät, wenn er auch nur einen verhältnismäßig kleinen Stoß erhält. Aus den eigentümlichen Verhältnissen der Eiszeit, mit denen wir uns später noch beschäftigen müssen, geht nun mit großer Wahrscheinlichkeit hervor, daß damals eine Polverschiebung von etwa zwanzig Grad stattgefunden hat, die man eben nur aus kosmischen Einflüssen erklären kann. Kurz, es spricht wirklich sehr viel dafür, daß zur Tertiärzeit in der Tat die Erde eine Katastrophe getroffen hat, die einem Weltuntergange durch einen Zusammenstoß beinahe gleichkam, und von der ich deshalb schon eingehender in meinem betreffenden Bändchen dieser Sammlung gesprochen habe. Diese Katastrophe aber bedeutete gleichzeitig einen wesentlichen Fortschritt der Entwicklung, und namentlich trat dadurch wieder der Vulkanismus der Erde in eine neue gewaltige Phase, in der wir jetzt noch leben, ebenso, wie auch noch ein Nachzittern der Erdachse beobachtet wird.
Erst nach Jahrmillionen beruhigte sich wieder einigermaßen die auf das tiefste erschütterte Erdfeste. Die meisten damals aufgerissenen Vulkanschlote haben sich inzwischen wieder geschlossen; die gegenwärtige vulkanische Tätigkeit der Erde ist nur noch ein schwacher Rest der damaligen. Vielfach ist die einstige Wut der feurigen Ausbrüche ausgeklungen in wohltätigen Erscheinungen, wie in den heißen Quellen, die mit wenigen Ausnahmen aus vulkanischem Boden strömen. Der Karlsbader Sprudel ist der vornehmste und bedeutsamste dieser »Nachklänge.« Man kann ihn einen beständig speienden Vulkan heißen Wassers nennen. Früher standen auf der gleichen tiefen Spalte im Erzgebirge viele wirkliche Vulkane.
Zu den Nachwirkungen der eigentlichen vulkanischen Erscheinungen gehört auch das entzückende Spiel der Geiser, das uns noch viel vollkommener als der Karlsbader Sprudel eine wirkliche Vulkantätigkeit in einer Stufe der Erdentwicklung darstellt, in der die einst feuerflüssige Erdrinde völlig erstarrt ist, während das Wasser die Rolle des Magmas übernimmt. Die Geiser entstehen auf noch heißem, vulkanischem Boden, zum Teil wohl auch in erloschenen Vulkanschloten selbst. Das Wasser der atmosphärischen Niederschläge dringt in das heiße Erdinnere und füllt die Schlote aus. In der Tiefe kann das Wasser, wegen des Druckes der überliegenden Wassersäule, viel höhere Temperaturen als 100 Grad annehmen, ohne zu sieden. Weiter oben aber wird durch die Abkühlung der Siedepunkt nicht erreicht. Das Sieden beginnt deshalb bei der beständigen Zuführung überhitzten Wassers aus dem Erdinnern in einer ganz bestimmten Tiefe des Schlotes. Das über der Siedestelle lagernde Wasser wird dabei herausgeworfen, wodurch das tiefer im Schlote stehende von dem Drucke befreit wird und nun gleichfalls sieden kann. Das Spiel des kochenden Springbrunnens setzt sich also fort, bis alles Wasser herausgeschleudert ist, und hört dann plötzlich auf, um erst wieder ebenso plötzlich zu beginnen, wenn in jener bestimmten Tiefe die Temperatur wieder entsprechend gestiegen ist. Diese Geisertätigkeit hat, wie wir schon Seite 39 andeuteten, eine gewisse physikalisch begründete Ähnlichkeit mit den Ausbrüchen der Protuberanzen und Flecken aus dem Innern der Sonne und auch mit den eigentlichen Vulkanerscheinungen. Stellen wir uns vor, daß einmal alle Meere mit einer kilometerdicken Eiskruste überdeckt sein werden, in welcher aber ganz ebenso, wie in unserer gegenwärtigen festen Erdkruste, viele tiefe Brüche und Spalten vorhanden sind, so wird an einzelnen Stellen das Wasser eruptiv aus dem Innern der Erde hervorbrechen wie jetzt das Magma.

Ein Geysir im Yellowstonepark (Felsengebirge).
Wir haben inzwischen immer mehr Einzelheiten sich in unserm Weltbilde entwickeln sehen, aber es ist doch noch öde und leer gegenüber der wundervoll vielseitigen Naturentfaltung, die uns auf unserm schönen Planeten heute umgibt. Im Antlitz unserer Erde spielen gegenwärtig die vulkanischen Erscheinungen nur noch eine untergeordnete Rolle. Die meisten Gebirge besitzen ja bekanntlich überhaupt keine Vulkane, weder tätige noch erloschene.
Wie diese Gebirgsrippen einstmals als sich auftürmende Schollenränder wenigstens in ihrem Kern entstehen mußten, haben wir bereits gesehen. Aber eben nur dieser Kern besteht heute noch aus jenem Urgestein, das sich einst auf der feuerflüssigen Oberfläche absetzte. An das granitene Massiv lagern sich dagegen Schichten, die sich nur aus dem Wasser abgesetzt haben können, und das Wasser hat auch sonst an der Ausgestaltung des gegenwärtigen Gebirgsbildes den hauptsächlichsten Anteil. Zu den Kräften des Feuers, die uns bisher beschäftigten, tritt nun der Kreislauf des Wassers, dessen so ungemein vielseitige Wirkungen wir rings um uns wahrnehmen.
Wir haben schon gesehen, wie die Kondensierung des Wassers aus der Atmosphäre durchaus zu vergleichen ist mit der Bildung der ersten feuerflüssigen Hülle des Weltkörpers, nur entwickelt sich von dieser nach oben hin eine umgekehrte Reihenfolge der Aggregatzustände, wie bisher: Über der feuerflüssigen Hülle breitet sich eine ausgedehnte Atmosphäre, wie sie ja auch die Sonne besitzt; das Feuerflüssige ist also oben und unten vom Luftförmigen umgeben, und durch das erstere hindurch nährt sich beständig die Atmosphäre über ihm, wie es auch heute noch durch die Vulkanschlote geschieht. Aus jener dichten Atmosphäre mag es ungezählte Jahrtausende lang herabgeregnet haben, ohne daß ein Tropfen jemals die heiße Oberfläche erreichte. Endlich aber konnten in den Senkungen Ansammlungen kochenden Wassers bestehen bleiben; der wütende Zweikampf des Wassers mit dem Feuer begann, der heute noch nicht zu Ende geführt worden ist, wie sicher wir auch den Ausgang vorhersehen. Aus heißen Tümpeln und Seen werden Meere, und schließlich ist der ganze Planet von einer Wasserhülle umgeben. Die Reihenfolge der Zustände in unserm Weltkörper erfährt also nun von seiner festen Kruste an eine vollständige Umkehrung: Sein Kern ist gasförmig geblieben, über ihm breitet sich eine feuerflüssige Schicht, über dieser die feste Kruste, darüber wieder folgt eine flüssige Schicht, das Meer, und endlich abermals eine luftförmige, die Atmosphäre. Wir dürfen aber zum Verständnis dieser eigenartigen Ordnung nicht vergessen, daß trotz der wechselnden Aggregatzustände die Dichtigkeit und Schwere der aufeinander folgenden Schichten von außen nach innen beständig zunimmt.
Aus den heißen Meeren mochten von jeher einige Rippen der Urgebirge hervorragen; die Geologen unterscheiden Gebirge, an denen man seit den ältesten Urzeiten keine Wirkungen des Meeres zu erkennen vermag. An diesen Gebirgen brandeten die heißen Wogen und lösten von dem Gestein so viel wie möglich auf. Die Meere sättigten sich mit mineralischen Produkten. Aber je kälter das Wasser, desto weniger kann es an löslichen Stoffen behalten. Es geschieht also bei dem fortschreitenden Abkühlungsprozesse auch in den Meeren das gleiche, wie wir es am Gasball der Sonne und an unserer Atmosphäre wahrnahmen: es gibt Niederschläge, Schichten setzen sich auf dem Grunde des Meeres ab, auch solche, die aus Erdreich bestehen, das nur durch die mechanischen Wirkungen des brandenden Wassers oder infolge der Abtragungen der auf dem Lande entstandenen Flüsse ins Meer gelangten. Solche Ablagerungen finden auch heute noch statt. Man nennt sie Sedimentschichten. Ursprünglich den Meeresgrund ausfüllend, werden sie durch die Bewegungen der Erdrinde, deren Ursachen wir vorhin kennen lernten, im Verlaufe der geologischen Zeitalter aus ihrem nassen Grabe wieder emporgehoben. Oft sieht man sie in unsern Gebirgen ganz horizontal gelagert; so, wie sie einst entstanden sind, findet man sie heute noch vor, doch gelegentlich mehrere tausend Meter über dem gegenwärtigen Meeresspiegel. Weit öfter aber noch sind die Schichten stark verschoben, zusammengedrückt, oder auseinandergerissen und zeigen dadurch mit aller Deutlichkeit, wie auch die Erdrinde im Laufe der Zeitalter auf und nieder wogt, wie es nichts Beständiges im ewigen Werdeprozesse der Welten gibt. Sehr schön erkennt man diese Faltungen des Gesteins am romantischen Urnersee, wenn man an seinem Steilufer die Axenstraße bis Fluelen hin wandert. Unsere Abbildung auf S. 54 zeigt die Stelle.
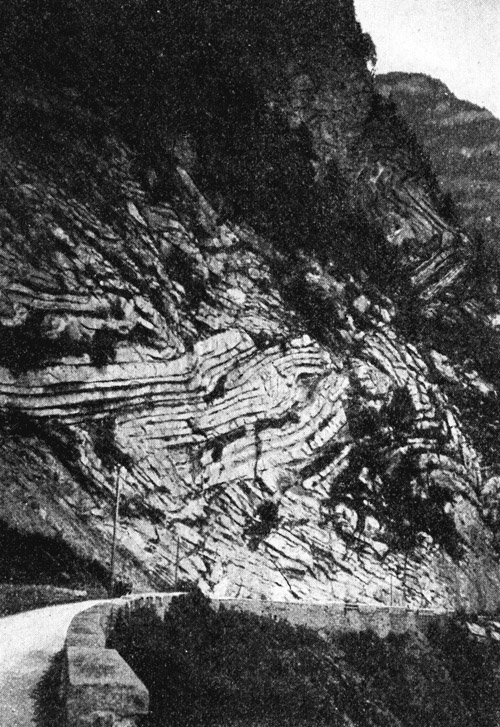
Gesteinsfalten an der Axenstraße (Schweiz).
Wie konnten aber solche Faltungen entstehen? Nun, wie ein Stück Tuch sich faltet, wenn man es zusammenschiebt! Bei der fortdauernden Abkühlung mußte die Erde kleiner werden, wie jeder Körper, der kälter wird. Da wurde ihr die zähe Haut zu groß und legte sich in Falten. Langsam wurden die sich aus den Meeren erhebenden Sedimentschichten an den Massiven der Urgebirge emporgeschoben, wie Wogen am Gestade, und oft türmten sie sich so hoch auf, daß sie sich überschlugen wie Wellenkronen; sie legten sich in umgekehrter Ordnung der Schichtenfolge übereinander. Ganz neue Gebirgsformen mußten auf diese Weise entstehen. Dazu kam noch die abtragende Wirkung der atmosphärischen Niederschläge. Diese vermochten die einstmals aus dem Wasser abgelagerten Erdschichten viel leichter anzugreifen als die im Urfeuer gehärteten Kerne der Gebirge, deren Häupter sich deshalb mehr und mehr von den einstmals über ihnen ruhenden Sedimentschichten wieder befreiten. Die meisten Hochgebirge bauen sich deshalb heute so auf, daß ihre höchsten Erhebungen aus Urgestein, Granit, Gneis ec. bestehen, woran sich dann zu beiden Seiten abgewaschene »Schichtenköpfe« von Sedimentgesteinen in der Reihenfolge ihrer Ablagerungszeit, die ältesten immer dem Urgebirge am nächsten, anschließen. Aber nur in den seltensten Fällen liegen jene Schichten zu beiden Seiten des Gebirgskernes symmetrisch. Während zum Beispiel bei den Alpen von Norden her die Sedimentschichten nur ganz allmählich in ausgedehnten Voralpen ansteigen, bricht dagegen das granitene Massiv nach Süden hin namentlich, gegen die Poebene, die noch vor verhältnismäßig kurzer Zeit ein Meeresbecken war, steil ab. Hier fand ein Abrutsch der Scholle statt, wie an den pazifischen Küstenrändern, und deshalb war auch dieses Gebiet seinerzeit vulkanisch. Nur schmale Bänder von Sedimentschichten lagern hier am Fuße der mächtigen Gebirgsmauern aus Urgestein.
In jene Sedimentgesteine schnitten sich nun die Flußtäler ein. Sie wandelten die zunächst einfachen Formen der Gebirge durch Längs- und Querfurchen in ein vielverzweigtes Kettengebirge um. Das Wasser hilft so den Kreislauf auch der festen Bestandteile der Erdrinde vollenden: Es trägt sie wieder ins Meer zurück, wo sie entstanden waren und aus dem sie die gebirgsbildenden Mächte einst emporgehoben hatten. Aber dem granitenen Oberbau der Hochgebirge kann das Wasser als solches nur wenig anhaben. Nicht aus ihm geboren, widersteht er seinen lösenden Wirkungen. Hier müssen kräftigere Mittel angewendet werden, um auch diese trotzigen Riesen schließlich zu Falle zu bringen. Die sprengenden Wirkungen des Eises, denen nichts widersteht, zermalmen auch sie. Die Hochgebirge bedecken sich mit Firnschnee und Gletschern, die auch den härtesten Granit zu Rundhöckern abschleifen oder, wo die Eisströme einst bis zum Meere herabstiegen, tiefe Fjorde einschneiden. Unendlich vielseitig mußte sich unter der wechselnden Wirkung der aufbauenden Gewalten der Gebirgsbildung und der Abtragung durch das Wasser nach und nach das Bild der starren Erdoberfläche gestalten. Unausgesetzt geht heute noch dieses Wechselspiel fort. Daß die Flüsse weiter und weiter die Berge in die Tiefe tragen, sehen wir ja vor Augen, aber Penck hat andererseits deutliche Anzeichen dafür gefunden, daß die Alpen sich noch gegenwärtig beständig heben. Der »ewige« Schnee auf diesen starren Gipfeln ist für einen Geist, der, geologische Weltalter überblickend, Jahrtausende gleich Sekunden an sich vorüberziehen läßt, nichts als der Schaum auf sich überstürzenden Meereswogen.
In jenen Urzeiten der Erdgeschichte, in denen sich die Kontinente, die Gebirge und Meere bildeten, lag noch eine schwere, dicke für alles Himmelslicht undurchdringliche Atmosphäre über dem Planeten, und nur die Vulkanausbrüche, die überflutenden Lavamassen erleuchteten schauerlich die öde Landschaft, die aus dampfendem Land und Wasser bestand; noch kein lebendes Wesen konnte hier aufkommen. Die Luft war noch von den erstickenden Dünsten erfüllt, die den Vulkanen entströmten, und jedenfalls sehr reich an Kohlensäure, die allen Tieren tödlich ist. Freilich für die Pflanzen ist im Gegenteil die Kohlensäure das eigentliche Lebenselement wie für uns der Sauerstoff. Aber die Pflanzen bedürfen außerdem unbedingt des Lichtes, das in diesen Urzeiten für die Erde noch nicht geboren war. Vielleicht gab es damals noch gar keine Sonne, oder sie leuchtete in ihrem noch nebelartigen Urzustande sehr schwach; jedenfalls konnten ihre Strahlen die dichte Atmosphäre nicht bis zur Erdoberfläche durchdringen. Wir müssen bedenken, daß nach geringem Maß fünfhundert Millionen Jahre verflossen sind, seit unser Planet dieses Zeitalter sah, und wir wissen nicht, in welchem Zustande die Sonne und die andern Teile ihres Systems in diesen Vorzeiten sich befanden. Nach dem Vorausgegangenen ist es wahrscheinlich, daß die Sonne wohl größer war wie heute, aber noch nicht so stark leuchtete und auch weniger Wärme aussandte. Das Zentralgestirn, dem wir heute alles danken, was die Natur uns bieten kann, war damals für die Erde noch ohne große Bedeutung. Mochte auch die im Mittelpunkte des Systems vereinigte Masse den Planeten bereits zu einem Umschwung um diese zwingen, der heute unser Jahr ausmacht, in Wirklichkeit war in der Finsternis dieses wüsten Zeitalters davon nichts zu bemerken. Die Erde brauchte die Sonne noch nicht; sie selbst besaß noch zu viel eigene Wärme, sie selbst war eine erlöschende Sonne. Keine Jahreszeiten, keine Zonen, keinen Wechsel von Tag und Nacht gab es in dieser Erdepoche, die von den Geologen die archaische Zeit genannt wird. In ihr entstanden jene Urgesteine, von denen wir so oft geredet haben, und die überall zu unterst in der Erdrinde aufgefunden werden rings um den Planeten herum. Man hat in diesen Gesteinen niemals eine Spur ehemaligen Lebens entdecken können.
Diese Urgesteinslager gehen an einigen Orten ganz unmerklich in geschichtete Gesteine über, die also unter der Wirkung des Wassers abgelagert worden sein müssen, und diese sogenannten kambrischen Schichten enthalten nun zuerst Reste eines sehr dürftigen Lebens. Die Formen desselben, ganz verschieden von den heute in der lebendigen Natur vorgefundenen, gehören zum größten Teil denen der Tiefsee an, so daß man meinen sollte, das Leben habe zuerst auf dem finstern Grunde der Urmeere begonnen.
Wie konnte es dahin gelangen, wie konnte es überhaupt auf dem neugeborenen Weltkörper entstehen, den kurz zuvor wilde Feuersgluten überfluteten, die auch die letzten Keime jedes Lebens, wenn solche irgendwie in der Urmaterie enthalten gewesen sein sollten, unrettbar vernichtet haben müssen?
Durch Urzeugung? Es ist dies die schwierigste von allen Fragen, die uns hier beschäftigen können. Wir wollen sie an dieser Stelle nur streifen. In dem Bändchen dieser Sammlung von der Abstammung des Menschen hat sie Bölsche bereits meisterlich behandelt. Er steht auf dem Standpunkt, daß eine Urzeugung, das heißt die Entstehung einer ersten organischen Zelle aus den sogenannten unorganischen Stoffen, wirklich auf der Erde in dem Augenblicke stattgefunden hat, in welchem sie möglich war, wo also die Bedingungen organischen Lebens, eine bestimmte Temperatur, Wasser, Luft ec., vorhanden waren. Die große Schwierigkeit, welche hierbei besteht, ist die, daß wir dem Lebendigen bisher eine Grundeigenschaft zuerkannten, die es von den Gebilden der sogenannten toten Natur, wie es wenigstens vielen scheint, ganz unüberbrückbar unterscheidet, das Prinzip der Empfindung. Wir können alle äußeren Erscheinungen der lebendigen Natur aus Bewegungen, chemischen Prozessen ec. ableiten oder sehen doch die Möglichkeit dazu, aber die Empfindung, das Bewußtsein, welches notwendig schon im allerniedrigsten Lebewesen in entsprechend elementarer Weise vorhanden sein muß, diese lassen sich nie und nimmer aus Bewegungen erklären. Bölsche hilft sich nun mit andern dadurch, daß er auch dem Leblosen schon von Anfang an die Möglichkeit der Empfindung beimißt, so daß es also eigentlich gar nichts Lebloses in der Welt gibt. Nur gewinnt das Leben, die Empfindung erst unter jenen ganz bestimmten Bedingungen die Form, in der wir es kennen. Also auch der Stein, den ich trete, empfände diese meine schlechte Behandlung in gewissem, sehr geringem Maße. Nur besitzt er noch keinerlei Organe, diese Empfindung zu erkennen zu geben, wie denn die Pflanze, das Zwischenprodukt der Lebensentwicklung in diesem Sinne, nur unvollkommene Organe dafür besitzt, so daß man auch sie lange für gänzlich empfindungslos gehalten hat. Es ist dieser Behauptung nichts entgegenzuhalten; die Möglichkeit ist ihr zum mindesten nicht abzusprechen. Man kann aus diesem Wege noch weiter gehen, wie es jener phantasiereiche Schriftsteller tat, von dem ich zu Anfang meines Kosmos-Bändchens über den Weltuntergang sprach, der alle Weltkörper für richtige Lebewesen erklärte, für Zellen in einem größeren Körper; der sogenannte tote Stoff ist das Knochengerüst, und wir Lebewesen, die kleinen Menschlein allzumal, sind die Zellen, welche sich an den großen irdischen Zellkern legen, und so fort.
Mißlich an Bölsches Meinung ist nur, daß sie, so wenig sie widerlegt werden kann, auch nicht zu beweisen ist. Sie sagt ja ausdrücklich, daß wir niemals eine Lebensregung an dem Stein erkennen werden, und so können wir also niemals erfahren, ob er wirklich Empfindung besitzt. Es ist wahr, wie es ja auch Bölsche sehr schön dartut, daß man eigentlich unwiderstehlich zu dieser Lösung der großen Frage gedrängt wird, wenn man erwägt, wie sich sonst alles aus dem Einfacheren zum Vollkommeneren entwickelt hat, die Weltkörper und die Lebewesen, die Empfindung, soweit wir sie wirklich beobachten, das Bewußtsein, das Geistesleben im Menschen, kurz alles und jedes. Da sollte nun mit einem Male ein Sprung stattgefunden haben, ein Wunder geschehen sein zu jener Zeit, als die Erde sich genügend abgekühlt hatte; der Geist, aus dem Nichts entsprungen, denn er war vorher nicht auf der ausgebrannten Erde, soll plötzlich in den toten Stein gefahren sein, aus einem Erdenkloß wurde die erste Amöbe, der erste Keim des Lebens, der sich nun frei bis zum Menschen emporentwickeln konnte! In der ganzen Entwicklung der Welten bedurfte es nur dieses einen Wunders, alles andere, was vor und nachher geschah, erweist sich wenigstens erklärungsfähig, wenn es auch noch zum großen Teile erklärungsbedürftig ist. Mit jener Annahme, daß auch im Steine schon ein minimales Bewußtsein stecke, haben wir auch die Notwendigkeit dieses Wunders beseitigt, und der ganze Bau der Welt erscheint noch einheitlicher als zuvor.
Es handelt sich hier um etwas wie ein Glaubensbekenntnis. Beweise kann man auf der einen Seite so wenig wie auf der andern bringen. Es ist richtig, daß wir alle die großen Entwicklungsprinzipien, die die Welt des Lebendigen geschaffen haben, auch in der sogenannten toten Natur wiederfinden. Die Welt ist nicht nur nach den naiven Anschauungen der Alten entstanden durch der Elemente Lieben und Hassen. Die Anziehungskraft der Materie, die unwiderstehliche Liebe des Steines zu seinesgleichen, hat aus dem Chaos diese schöne, wunderreiche Ordnung der Planetenreiche geschaffen, und, wollte man sich hier, wo eben nichts zu beweisen ist, mit poetischen Vergleichen begnügen, so könnte man in der Welt der Atome die mannigfaltigsten Züge von abgestuften Sympathien und Antipathien auffinden, die den Äußerungen einer Art von Seelenleben in frappanter Weise parallel gehen.
Das alles aber sind selbstverständlich reine Phantasiegebilde. Mir scheint, daß das Erklärungsbedürfnis gar nicht dadurch befriedigt würde, selbst wenn diesen Phantasien eine Art von Wirklichkeit zugrunde läge. Das Wunderbare der Eigenschaft des Selbstempfindens und des Geistes, die die mit ihnen sichtbar Begabten so himmelweit von den übrigen Naturprodukten unterscheidet, ist damit nur eine Stufe tiefer und in einen latenten Zustand übergeführt, den wir uns ebensowenig erklären können, wie den wirksamen Geist.
Aber müssen wir denn überhaupt eine Schöpfung des Geistes annehmen? Kann er nicht ebenso von Anfang an dagewesen sein, wie die Materie und ihre ewige Bewegung? Wenn wir anerkennen, daß Bewegung niemals Geist sein kann, daß also die willkürlichen Bewegungen, die die Materie in den Lebewesen und durch sie ausführt, eben nur die Äußerungen dieser höheren Macht des Geistes sind, der die an sich zwar unabänderlichen Naturkräfte nach seinem Willen zu lenken versteht, so haben wir in ihm ein drittes Element für die Weltschöpfung, mit dem allein sie ihre höchsten Aufgaben erfüllen kann und das ebenso von allem Anfang vorhanden gewesen sein muß, wie die beiden andern, die Materie und ihre Bewegung.
Daß vielen sonst so vortrefflichen Denkern der Umstand Schwierigkeiten bereitet, daß eben dieses Wunder der Geistwerdung der toten Materie auf der Erde einmal stattgefunden haben müßte! Das ist doch nur der Fall, wenn man unsern Planeten allein, isoliert vom übrigen Weltgebäude, betrachtet. Wir begegnen hier immer noch Resten der vorkopernikanischen Weltanschauung, die die Erde im Mittelpunkt des Weltalls glaubte, während alles um sie her bedeutungslos, ohne wesentlichen Einfluß auf ihre Schicksale war. Heute ist die Erde ein verschwindendes Pünktchen in einer endlosen, innig zusammenhängenden Welt, die in allen Teilen nach einem einheitlichen Plane aufgebaut ist. Aber nur wenige, die sich intensiv mit diesem all unser Dichten und Trachten unter ganz neue Gesichtspunkte stellenden Gedanken unserer Unterordnung unter ein großes allgemeines Prinzip beschäftigt haben, vermochten sich bisher wirklich völlig loszureißen von jenem vorkopernikanischen Standpunkte. –
Ziehen wir seine Konsequenzen in bezug auf die Frage der Entstehung des Lebens auf der Erde, so gelangen wir nicht nur zu der Möglichkeit, sondern zu der unbedingten Notwendigkeit, daß die Lebenselemente, die, ebenso wie alle anderen Ausgestaltungen der Natur und des Entwicklungsprozesses der Welten, schon von allem Anbeginn im Weltall vorhanden gewesen sein müssen, sich von Weltkörper zu Weltkörper, sie befruchtend, ausgebreitet haben. Muß dies aber geschehen, so wird die Erledigung sowohl der Frage, ob eine Urzeugung einstmals stattgefunden habe, als auch der andern, ob im Stein bereits ein latentes Leben schlummere, überflüssig. Die Anhänger dieser Meinungen mögen deshalb trotzdem recht haben. Jedenfalls brauchen wir die Urzeugung nicht mehr.
Wir haben also nur die beiden Voraussetzungen zu beweisen, daß erstens Leben auf andern Weltkörpern existiert, und daß zweitens dieses Leben zu uns gelangen kann. Die erste Voraussetzung läßt sich niemals streng beweisen, denn unsere optischen Hilfsmittel werden wohl niemals ausreichen, um Lebensäußerungen wirklich unzweifelhafter Art jenseits der Erde zu entdecken. Die Marskanäle und ähnliche Dinge werden in dieser Hinsicht immer zweifelhafter Natur bleiben. Es ist doch aber unter keinen Umständen anzunehmen – außer von einem völlig vorkopernikanischen Standpunkte – daß die Erde im weiten Universum, ein Atom in der Unendlichkeit, nur allein diese unfaßbare Bevorzugung genossen haben sollte, Leben zu erzeugen und zu beherbergen. Außerdem können wir beweisen, daß die Erde umgekehrt das Universum bevölkert haben muß, wenn es wirklich vorher tot gewesen sein sollte. Die Keimsporen unserer niedrigsten Lebewesen, die Bakterien, sind so klein, daß sie, in die höchsten Regionen der Atmosphäre getragen, gelegentlich unsern Planeten und seine Anziehungssphäre verlassen müssen, um frei im Welträume umher zu schwärmen. Nachweislich kann dann der Druck des Lichtes allein sie von einem Weltkörper Zum andern tragen. Es ist ferner gezeigt worden, daß diese Keime und selbst die Samen viel höher stehender Lebewesen die Kälte des Weltraums überstehen, ohne ihre Lebensfähigkeit zu verlieren, sobald sie eben die Bedingungen dafür vorfinden. Gelangen sie also nach unermeßlich langen Zeitläufen in den Bereich eines ihrer eigenen Geburtsstätte verwandten Weltkörpers, so müssen sie ihn befruchten. Es ist damit unsere zweite Frage von der Übertragbarkeit des Lebens von Weltkörper zu Weltkörper bejahend beantwortet. Den lebenweckenden Einfluß aber, den die Erde auf andere Weltkörper ausüben kann und muß, muß sie auch andererseits von ihnen empfangen haben. Das Leben muß aus dem Himmel zu uns herabgeregnet sein.
Das geschah zu allen Zeiten und geschieht auch heute noch. Nur können unter normalen Umständen nur die allerkleinsten Keime von dort zu uns herüberkommen, wie wir sie überall in der Luft antreffen. Niemand könnte ihre Herkunft nachweisen, und in jedem mikroskopischen Präparate dieser Art können sich Hunderte von solchen Einwanderern aus den entlegensten Regionen des Weltgebäudes befinden.
Solange die Oberfläche der Erde und ihre Lufthülle noch zu heiß waren, mußten diese Keime getötet werden. Zuerst bevölkerten sie alsdann die höchsten Luftregionen, die dem kalten Weltraum am nächsten liegen, und aus diesen wurden sie vom Regen zur Erdoberfläche hinabgeführt. Wo diese aus den Meeren hervorragte, mußte sie in der ersten Zeit noch zu heiß sein, um selbst diesen ersten anspruchslosesten Keimen eine Lebensentwicklung zu ermöglichen. Dagegen besaßen die Meere selbst an ihrer Oberfläche allgemein eine tiefere Temperatur, weil sie ja durch die atmosphärischen Niederschläge immer wieder abgekühlt wurden. Am kältesten war auch schon damals wie heute der Meeresboden, den das kältere Wasser aufsucht, weil es schwerer ist. Deshalb mußte auch die Erdrinde unter den Meeren sich am schnellsten abkühlen und dadurch eine größere Dicke erreichen als die kontinentalen Schollen. Der Meeresboden wurde bald widerstandsfähiger gegen den Durchbruch der vulkanischen Eruptionen, und es traten also hier zuerst ruhigere Verhältnisse ein. Hier, auf dem Grunde des Meeres, waren deshalb, wider alle Vermutung, die Bedingungen des Lebens zuerst vorhanden. Diese Tiefen des Meeres sind heute noch so finster, wie sie es damals waren, und man hat deshalb lange nicht geglaubt, daß hier Leben überhaupt existieren könnte, weil alles Leben, auch das allererste, auf jedem Weltkörper, der eine der Erde auch nur entfernt vergleichbare Organisation besitzt, des Lichtes mittelbar oder unmittelbar bedarf. Alle Tiere, auch die des Meeresgrundes, können in letzter Linie ja nur von Pflanzen leben, und keine Pflanze wächst ohne Licht. Aber in die dunkeln Tiefen des Meeres trägt die pflanzliche Nahrung das » Plankton«, das sind kleinste im Meere freischwimmende Lebewesen, unter denen in den vom Lichte noch getroffenen Schichten sich auch schwimmende Algen, also Pflanzen, befinden. Keines dieser Wesen ist vom Lande her ins Meer gelangt, alle gehören ihm unmittelbar an. Wenn nun damals die ersten Lebenskeime aus dem Weltall herabgekommen sind, so fanden sie in den oberen Luftschichten ähnlich dem Plankton des Meeres alle Bedingungen zu ihrer Entwicklung vor, wenn damals schon eine Sonne existierte. Dieses »Luftplankton« sank mit dem Regen in die tieferen Atmosphärenschichten hinab und verbreitete hier das Leben weiter, auch wenn bis dorthin kein Sonnenlicht mehr vordringen konnte, und schließlich gelangte es so auf den Meeresgrund. Selbst auf der Erdoberfläche vermochte sich ein tierisches Leben auszubreiten, als es hier noch völlig finster war, nur die Temperatur mußte bereits erträglich sein.
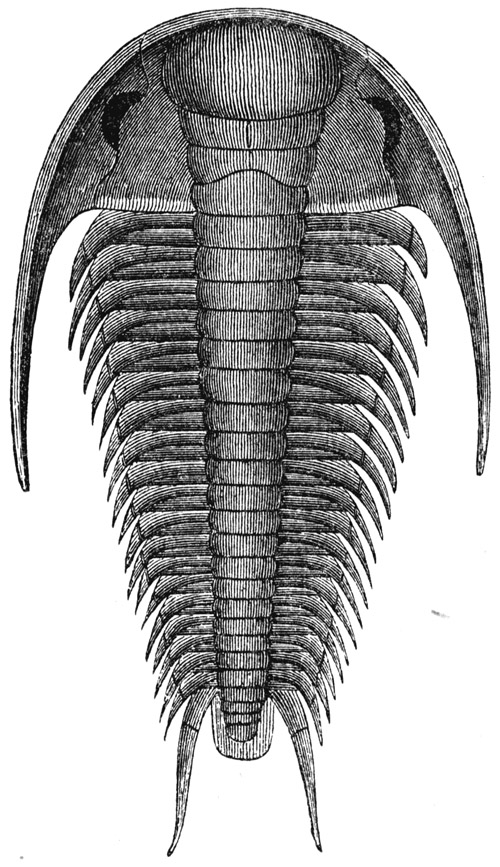
Kambrischer Trilobit.
Entsprechend diesen Voraussetzungen finden wir nun in denjenigen Schichten der Erdoberfläche, die aus den Urmeeren unmittelbar über den kristallinischen Gesteinen abgelagert sind, zuerst nur ganz zweifelhafte Spuren eines niederen Tierlebens, dann aber etwas höher deutlich ausgeprägte Tiefseeformen. Alle diese ersten Tiere waren blind: In ihrer Welt gab es noch kein Licht, und auch das Selbstleuchten, das den Wesen unserer Tiefsee eigen ist, hatte die Tierwelt, wie es scheint, noch nicht erfunden. Die höchst entwickelten Wesen dieser sogenannten » kambrischen Formation«, der untersten Stufe der » Paläozoischen Periode«, sind die Trilobiten, Tiefseegeschöpfe, die zu den Krebsen zu rechnen sind, aber Asseln ähnlicher sehen. Dieses häßliche Geschöpf muß, zunächst in sehr wenig verschiedenen Arten, die Urmeere wimmelnd angefüllt haben, denn an vielen Stellen findet man es in den betreffenden Gesteinsschichten massenhaft vor. Die harte Kruste dieser Urkrebse und der eigentümliche Vorgang des Versteinerns hat sie uns über Zeitläufe hinweg erhalten, die zweifellos nach Hunderten von Millionen Jahren zu bemessen sind. Solche Trilobiten aber existieren längst nicht mehr in unsern Meeren. Fische gab es zu dieser Periode noch nicht. Das Leben, in häßliche Formen geprägt, bewegte sich kriechend auf dem finstern Grunde der Urmeere. Von Tieren oder gar Pflanzen des Landes ist noch keine Spur zu entdecken. Bewohnbares Land gab es also wohl noch nicht.
Je höher wir aber in den Gesteinsschichten emporsteigen, desto höher entwickelten Lebensformen begegnen wir, und desto reichhaltiger gliedert sich der wachsende Lebensbaum. Das war ja auch gar nicht anders möglich; da es einstmals auf der Erde noch gar kein Leben gab, so konnte es sich nur schrittweise verbreiten, gleichviel, auf welche Weise dies geschah. Mögen sich nun die Lebewesen im Kampfe ums Dasein mit ihresgleichen, wie es der Darwinismus annimmt, zu immer höheren Arten entwickelt, oder mögen sich nach Lamarck die Geschöpfe den fortschreitenden Veränderungen der äußeren Lebensbedingungen, der abnehmenden Temperatur, der Vergrößerung der Landflächen und ihrer verschiedenartigen Ausgestaltung, angepaßt haben, immer war nur ein schrittweises Emporstreben möglich.
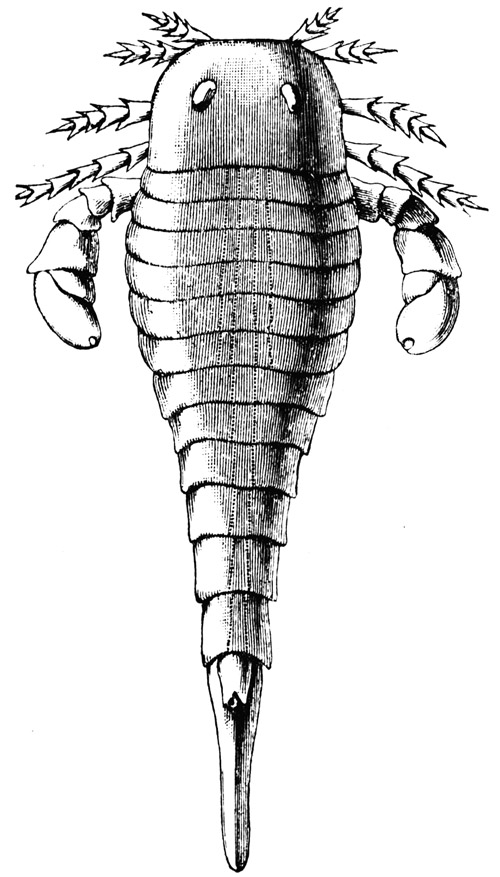
Krebs aus dem Silur.
Natürliche Größe. Nach Fraas.
So sehen wir in der Silur-Formation, die wir unmittelbar über den kambrischen Schichten finden, zunächst viel mehr verschiedene Arten von jenen Trilobiten als in der kambrischen Formation, und die Formen selbst sind entwickelter. Sie zeigen die Anlage zum Auge, wenn auch noch keine Augen selbst. Das Leben wurde blind geboren, wie viele Tiere auch heute noch, aber es wurde zum Sehen vorbereitet. In den mittleren Schichten dieser Formation kommt dann bereits ein richtiger, wenn auch noch recht ungeschlachter Krebs mit großen Augen vor. Wohl ist das noch kein Zeichen, daß das Himmelslicht bis zu diesen Geschöpfen vordrang, aber es wird sich nun die leuchtende Fauna der Tiefsee entwickelt haben: Wir sehen Glasschwämme und Seelilien auftreten, wie wir sie ähnlich auch heute noch in der Tiefsee vorfinden; die verschiedensten Weichtierarten, Schnecken, die tintenfischartigen Nautiliden, dann Seesterne, Seeigel erscheinen und in den obersten Silurschichten sogar schon Fische. Seegewächse, Algen, gibt es auch bereits, und Spuren von Landpflanzen trifft man an, die uns beweisen, daß um diese Zeit auf der Erdoberfläche das erste Licht aufgedämmert war. Neben allen diesen höheren Wesen erfüllen diese Schichten die Kalk- und Kieselpanzer der Radiolarien und Foraminiferen, die auch heute noch den Hauptbestandteil des Plankton ausmachen, das, aus der Welt des Lichtes nieder regnend, jene geheimnisvolle Welt in den finstern kalten Tiefen des Meeresgrundes zu ernähren hat.
Über dem Silur liegt das Devon, in dessen Gesteinsablagerungen sich wohl abermals Reste vollkommenerer Geschöpfe vorfinden als in den tiefer liegenden, die aber doch von einer noch immer recht armseligen Welt erzählen, die uns in seltsam fremden Formen entgegentritt. Nicht eine jener Formen gleicht völlig einer heute noch lebenden. Die Fische, noch sehr spärlich im Silur, entwickelten sich sehr kräftig im Devon. Das Leben stieg vom Meeresgrunde, von der Fläche, sich räumlich, dreidimensional, ausbreitend, in das freie Meer empor, aus dem es, gewissermaßen als befruchtender Keimregen, hinabgestiegen war; der Meeresgrund war so der Mutterschoß alles Lebens. Unter den Fischen tritt damals schon der Hai auf, der, der niederen Gattung der Knorpelfische angehörend, sich durch alle Zeitalter der Schöpfung hindurchgefressen hat. Solch einem räuberischen Geschlechte ist schwer etwas anzuhaben. –
Das Land muß nun nach und nach etwas wohnlicher geworden sein. Landpflanzen treten spärlich auf; unter ihnen tummelten sich einige Insektenarten, aber nur solche, die auch heute noch die Dunkelheit und Wärme lieben wie unsere Schaben. Die Atmosphäre muß also noch sehr trübe und dick gewesen sein.
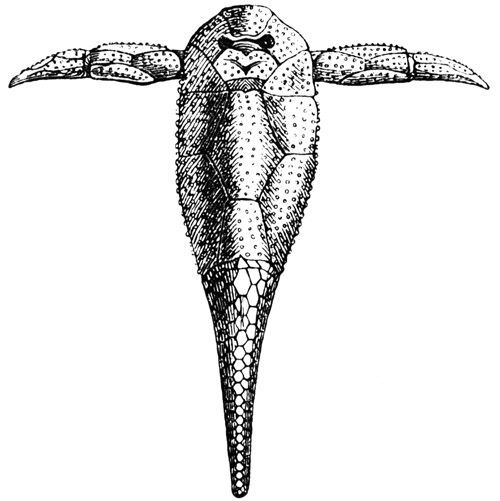
Panzerfisch aus dem Devon.
Nach Zittel, Palaeozoologie.
Da aber erfolgte mit einem Male ein ganz gewaltiger Aufschwung. Wir treten in die Steinkohlenformation ein mit ihren riesenhaft aufschießenden Unkrautgewächsen, die sich rings um die Erde herum in jener massenhaften Entfaltung vorfinden, welche zur Bildung der mächtigen Kohlenflöze führte. Diese wucherische Entwicklung der Pflanzenwelt fand offenbar sehr schnell statt. Die jungen bis dahin noch so öden Kontinente überzogen sich plötzlich mit einer urwalddichten grünen Decke. Wir können uns das wohl erklären. Der junge Erdboden war noch warm, und über ihm lagerte bisher eine schwere Atmosphäre, die wie ein mit trübem Glase gedecktes Dach jene Bodenwärme nur sehr langsam in den Weltraum hinausließ. Es herrschten durchaus Treibhausverhältnisse, bis auf das mangelnde oder bis dahin noch ungenügende Licht. Ohne Licht aber kann keine Pflanze gedeihen, es ist die erste unerläßlichste aller Lebensbedingungen für sie. Das Licht allein vollbringt ja bekanntlich das Wunder, die tote Materie zum Leben zu erwecken; aus den regungslosen Atomen des unorganischen Erdreichs baut es ein empfindendes Lebewesen auf, sobald dieses Erdreich vorher mit einem jener geheimnisvollen Lebenskeime in Berührung gekommen war, die wir das Weltall durcheilen sahen, um die Glückseligkeiten der Empfindung im weiten Universum auszustreuen. Das Leben will das Licht. Mag es auch, wie wir gesehen haben, Wesen geben, die für sich allein des Lichtes nicht bedürfen, so leben sie doch mittelbar alle von den Pflanzen. Jenes lebenweckende Licht fehlte bisher der Erdoberfläche. Sobald sich aber endlich die Erdrinde mehr und mehr schloß, so daß das flüssige Erdinnere keine allzu großen Mengen von verfinsterndem Rauch und Asche in die Atmosphäre schickte, konnte das Sonnenlicht durchdringen, und nun bildete in der Tat die Erdoberfläche plötzlich ein ungeheures Treibhaus, und das Aufwuchern der Pflanzen wurde auch dadurch ganz besonders begünstigt, daß die Luft damals offenbar weit mehr Kohlensäure enthielt als jetzt, ein Gas, das bekanntlich dem Erdinnern auch heute noch durch die Vulkane entströmt. Die Pflanzen vermögen diesem für die Tierwelt giftigen Gase unter dem Einflusse des Lichtes den Kohlenstoff zu entnehmen und den Sauerstoff, das Lebenselement der Tierwelt, freizumachen. Ist auch in den Pflanzen der Kohlenstoff noch an andere Elemente gebunden, so wurden diese doch wieder durch einen langsamen Destillationsprozeß beim Vermodern im Sumpf, worin jene Unkrautgewächse damals hauptsächlich gediehen, wieder frei. Auf diese Weise wurden die Sümpfe nach und nach zu Lagerstätten fast reinen Kohlenstoffs, der uns heute, nach vielen Millionen Jahren, die Kraft des ersten Sonnenlichtes verwerten läßt, welches die junge Erde traf. Damals hatte dieses schöne Licht zunächst nur die Aufgabe, die damalige Pflanzenwelt wuchern zu lassen, denn nur verhältnismäßig wenige Landtiere existierten damals, vielleicht, weil ihnen die noch zu stark kohlensäurehaltige Luft schädlich war. Die Pflanzen vollzogen also einen für die spätere Entwicklung eines höheren Landtierlebens außerordentlich wichtigen Luftreinigungsprozeß.

Landschaft aus der Steinkohlenzeit.
Jene Pflanzenwelt der Steinkohlenzeit bestand in der Hauptsache aus riesenhaft entwickelten Farnkräutern, Moosen, Schachtelhalmen, die auch heute noch als armselige Epigonen einer Zeit, in der ihre gewaltigeren Vorfahren die Erde beherrschten, in sumpfigen Gegenden vorkommen und überall nach Möglichkeit das direkte Sonnenlicht meiden. Es muß also wohl auch damals erst nur ein dämmerndes Licht durch die immer noch trübe Atmosphäre gedrungen sein. Kein Gewächs der damaligen Zeit brachte Blüten hervor, deren vielfarbige Schönheit nur im hellen Sonnenschein geboren werden kann. Die Steinkohlenpflanzen gehörten ausschließlich der niederen Klasse der Kryptogamen, der Verdecktsamigen, an, die, zum Beispiel bei den Farnen, ihre Früchte unter der Blattfläche, vor dem Lichte möglichst geschützt, dagegen umsomehr der aus dem Erdboden kommenden Wärme ausgesetzt, reifen lassen.
Neben diesen Krautgewächsen, die zu Riesenbäumen wurden, treten nun auch zuerst die Nadelhölzer auf, also wirkliche Bäume, die sich, wenn auch in anderen Arten, gleichfalls bis auf den heutigen Tag erhalten haben, ja, noch immer die weit vorherrschenden Baumarten sind. Palmen oder gar blätterabwerfende Laubgewächse waren noch nicht vorhanden.
In diesen Urwäldern aus Riesenkrautwerk lebte eine noch sehr wenig entwickelte Tierwelt, die meist aus Insekten bestand. Namentlich die Termiten, jene großen ameisenartigen Geschöpfe, welche auch heute noch die Tropen bewohnen, bauten damals schon ihre kunstvollen Wohnungen in der grünen Dämmerung dieser merkwürdigen Zeit. Es schien, als ob die Intelligenz, die sich im allgemeinen mit den Tierformen selbst weiter entwickelte, in der Klasse der Insekten ihren höchsten Gipfel erreichen sollte, denn wir wissen ja, wie ungemein vielseitig begabt bereits die Ameisen, die Bienen und andere Insekten sind. Aber in der Folge stellte es sich doch heraus, daß dieser Zweig des vielästigen Lebensbaumes, so verhältnismäßig hoch er auch emporgeschossen war, nicht weiter entwicklungsfähig war, daß vielmehr ein anderer Zweig ihn überflügelte und zur herrlichen Krone emporwuchs.
Neben diesen Termiten und andern Insekten, die heute noch mit Vorliebe in Dunkelheit und schlechter Luft leben, kamen auch schon einige höher stehende Sumpfbewohner, Molche (die Stegocephalen), vor. Diese hatten sich offenbar allmählich aus Fischen entwickelt: Das Leben des Meeres kroch langsam zum Lande empor, zunächst in Formen, die zugleich in beiden Elementen zu leben vermochten, hauptsächlich aber noch das Wasser liebten, also in denen der Amphibien. Echte Reptilien kennt dagegen diese Zeit noch nicht. Alle diese Formen waren unscheinbar. Die Tierwelt spielte immer noch eine sehr untergeordnete Rolle auf dem Lande, während sie dagegen die Meere mit immer vollkommeneren Formen ausfüllte. Neue Klassen von Meerestierformen konnten nun schon gar nicht mehr hervorgebracht werden; die Meeresfauna hat, wenn man von den Meeressäugetieren absieht, deren Stammväter offenbar auf dem Lande lebten und erst nachträglich ins Meer zurückgedrängt wurden, nach den Fischen nun keinen neuen Zweig mehr getrieben, sondern nur die vorhandenen weiter entwickelt. Überhaupt wird nun die Meeresfauna sehr viel schneller als die des Landes der gegenwärtigen ähnlich. Das ist leicht daraus zu verstehen, daß die Lebensbedingungen im Meere sich seit jenen Urzeiten viel weniger verändert haben, als die auf dem Lande, also auch nicht mehr die Notwendigkeit vorlag, durch neue Anpassungen neue Formen hervorzubringen.
In dieser Lebensentfaltung der Steinkohlenzeit tritt aber noch etwas ganz Geheimnisvolles auf. Wir finden Steinkohlen in allen Breiten der Erde, von den südlichsten bis zu den nördlichsten, und überall sind es dieselben Gewächse, die damals sowohl unter unsern heutigen Tropen wie in der Polarzone mit gleicher Üppigkeit gediehen. Das scheint aber angesichts der jetzigen Erdverhältnisse völlig unmöglich. Mag damals wegen der vorhin geschilderten Umstände auch rings um die Erde eine Treibhaustemperatur geherrscht haben, die im Erdinnern, nicht in der Sonne, ihren Ursprung hatte; immer bedurften doch diese Gewächse des noch so trüben Sonnenlichtes, und das mußte so wie heute in den Polargebieten monatelang ausbleiben, wenn die Lage der Erdachse damals eine ähnliche wie heute war, woraus hervorgeht, daß dort eine Vegetation wie die der Steinkohlenzeit auf keine Weise bestehen konnte. Wir finden aber tatsächlich Steinkohlen auf Spitzbergen in schönster Entwicklung, und auch in der Südpolnähe hat jüngst die belgische Expedition versteinerte Reste einer einstmals sehr üppigen Vegetation vorgefunden. Wir mögen die Erdachse drehen, wie wir wollen, wir kommen über die Schwierigkeit nicht hinaus, wenn wir ihr eine feste Lage geben, denn immer bleibt ein zeitweise oder gar dauernd unbestrahltes Gebiet übrig, immer ist eine Gliederung in Zonen die notwendige Folge, die eben damals scheinbar nicht vorhanden war. Man hat zur Erklärung schon daran gedacht, daß damals, vor zweifellos mehreren hundert Millionen Jahren, das ganze Sonnensystem einen völlig verschiedenen Bau besessen habe; es konnten zum Beispiel damals noch mehrere Sonnen vorhanden gewesen sein. Nun, solche Voraussetzungen, die durch nichts zu beweisen oder zu widerlegen sind, kann man natürlich immer machen. Daß das Sonnensystem damals anders beschaffen war als heute, ist in der Tat wohl anzunehmen. Die Astronomen haben ihm zwar in seiner jetzigen Beschaffenheit eine fast unendliche Bestandfähigkeit zugesprochen. Es ist eben heute in nahezu stabile Verhältnisse übergegangen, die in früheren Entwicklungsepochen noch nicht vorhanden waren. Auf diesem Wege verlieren wir uns indes gar zu sehr ins Unbekannte.
Gehen wir von einigermaßen bekannten Dingen aus, so bleibt nur eine Möglichkeit, die vorzeitlichen Temperaturverhältnisse, die in den späteren Erdgeschichtsperioden noch größere Rätsel aufgeben, zu erklären: Die Erdachse hatte damals eine ganz andere Lage wie heute, und die Pole befanden sich in Gebieten, die wir geologisch bisher noch nicht untersuchen konnten. Wenn der Nordpol zum Beispiel zur Steinkohlenzeit im Innern von China gelegen hätte, das wenig untersucht wurde und in dem man jedenfalls noch keine Kohlenflöze gefunden hat, so hätte auch der Südpol in unerforschlichen Gebieten gelegen. Dann müssen also inzwischen die Pole gewandert sein, um schließlich ihre gegenwärtige Lage anzunehmen. Das kann nun entweder allmählich oder ruckweise geschehen sein. Wir haben vorhin schon wiederholt von der Möglichkeit plötzlicher gewaltsamer Verlegungen der Erdachse durch aufstürzende kosmische Körper gesprochen, aber auch eine langsame Verschiebung ist möglich, die, in Spirallinien fortschreitend, nach und nach die Pole über die ganze Erdoberfläche hinweg getragen haben kann. Zwar hatte man noch bis vor einigen Jahrzehnten gerade die Lage der Erdachse im Erdkörper als das einzige unbedingt Konstante angesehen, das die Natur aufzuweisen habe. Aber seitdem hat man bekanntlich Schwankungen dieser Achse durch die Beobachtung ganz unzweifelhaft nachgewiesen. Die Ursache derselben kann man heute nur in langsamen Massenverschiebungen auf der Erdoberfläche suchen, wie sie etwa durch Vulkanausbrüche und Erdbeben, oder im allgemeinen durch die tektonischen Bewegungen der Erdschollen hervorgebracht werden. In der Tat scheint die Größe der gegenwärtig beobachteten Polschwankungen mit der jeweiligen Heftigkeit der vulkanischen Erscheinungen im Zusammenhange zu stehen. Solche Massenverschiebungen waren in jenen Urzeiten jedenfalls ganz wesentlich größer als heute, und sie können wohl eine lange Zeit hindurch in einem derartigen Sinne erfolgt sein, daß eine solche fortschreitende Bewegung der Pole die Folge davon war. Dadurch wären alle Teile der Erdoberfläche nach und nach in alle Zonen versetzt worden, und kein Gebiet wäre in der ewigen Starre des Pols dauernd davon ausgeschlossen geblieben, dem Leben zu dienen. Solch ein ewiger Kreislauf des Geschehens ist ja auch das oberste Prinzip aller Naturregungen. Die Wanderung der Pole über die ganze Erdoberfläche hin ist die einzige natürliche Lösung des großen Problems der vorzeitlichen Temperaturverhältnisse.
Solchen Lageveränderungen ist vielleicht auch die merkwürdige Tatsache zuzuschreiben, daß auf die so überaus üppige Zeit der Steinkohlenbildung eine allgemeine Verarmung der gesamten Natur folgte, die wir als die Permformation bezeichnen. Wohl wuchs der Baum der Lebensentwicklung auch in dieser Zeit weiter: nach den Amphibien der Steinkohle treten nun, wenn auch noch wenig entwickelt, Reptilien auf. Aber der Baum selbst entblätterte sich, es war, als wollte eine Winterszeit hereinbrechen, als kargte plötzlich die Natur mit ihren Gaben. Wir werden sehen, wie solch eine Periode des Niedergangs noch einmal verhältnismäßig kurz vor der Jetztzeit, in der Glazialperiode, eintrat. Im Perm kam es zwar noch nicht zu einer allgemeinen Vereisung, aber Spuren davon sind doch zu bemerken. Die damals wohl noch immer auf der Oberfläche merkbare Eigenwärme der Erde verhinderte eine ausgebreitete Eisentwicklung selbst an den damaligen Polen. Man hat längst vermutet, daß die Ablagerungen, welche man aus dieser Zeit kennt, das Rottotliegende, der Zechstein ec., mehr zufällig nur diese Verarmung zeigen und ungünstigen Erdstrichen angehörten, während es wohl möglich sei, daß man in bisher geologisch noch nicht erschlossenen Gebieten einer reicheren Natur auch aus dieser Zeit begegnet. Vielleicht wanderte eben damals der Pol nicht weit von den Gebieten vorüber, in denen man heute jene an Lebensresten armen Schichten findet.
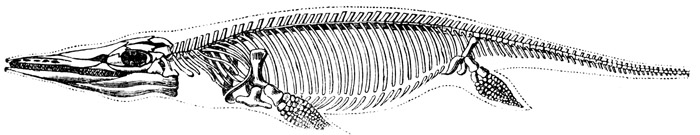
Ichthyosaurus aus dem englischen Lias. (Nach Owen).
Mit dem Perm endet die paläozoische Periode, und wir treten nun mit der sogenannten Triasformation in die mesozoische Periode ein. Auch diese Formation beginnt im »Buntsandstein« noch mit ärmlichen Verhältnissen, die aber den Beginn eines neuen Aufschwungs nicht verkennen lassen. In den beiden oberen Schichten der »Dreiteiligen«-Formation, dem Muschelkalk und dem Keuper, zeigt sich dann wieder eine starke Emporentwicklung. Die Reptilien wachsen mächtig, an Artenzahl, an Individuen und an Körpergröße. Die gewaltigen Saurier erscheinen, jene Ungeheuer wie die Ichthyosaurier, Plesiosaurier ec., welche dann in der folgenden Jurazeit zu ihrer größten Entfaltung gelangen. Es sind zum Teil Zwischenwesen vom Fisch zur Eidechse, und manche unter ihnen hatten noch die gewaltigen Augen der Tiefseefische, die darauf hinweisen, daß das Sonnenlicht immer noch nicht recht durchzudringen vermochte, oder die Meere noch recht trübe waren. Denn eigentliche Tiefseegeschöpfe konnten diese Tiere sicher nicht sein. Die Reptilien haben ja bekanntlich bereits Lungen, durch welche sie Luft atmen müssen, wenn sie auch sehr lange ohne dieselbe auskommen können.
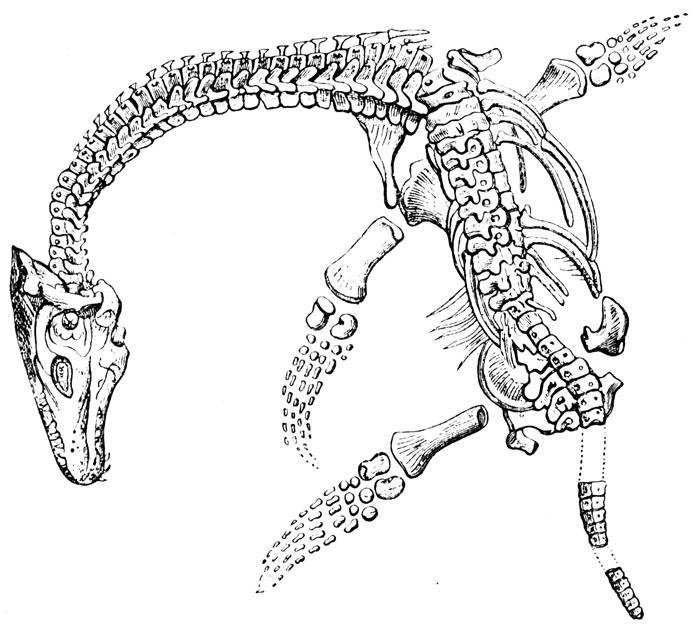
Skelett des Plesiosaurus aus dem engl. Lias. Nach Fraas.
Es zeigt sich nun auch das erste Säugetier; der höchste, schönste Zweig der irdischen Lebensentwicklung begann in dieser Zeit zu keimen, noch klein und unscheinbar, so daß man damals gewiß seine hohe Bedeutung nicht hätte erkennen können: Einige kleine Beuteltiere treten auf; sie stehen auf der untersten Stufe der Säuger.
Die Pflanzenwelt hat sich in ihren Formen gegen die der Steinkohlenzeit nicht eben sehr auffällig geändert, nur hat sie ihre Üppigkeit eingebüßt. Immer noch gibt es keine Blütengewächse und keine im Laufe der Jahreszeiten ihren Blattschmuck wechselnden Bäume, aber schon herrschen die Farne, Schachtelhalme ec., die wohl noch vorhanden sind, nicht mehr vor im Landschaftsbilde. Die Nadelhölzer entwickeln sich dagegen kräftiger, und immergrüne Gewächse, Palmen, erscheinen. In ihrer Verbreitung erkennt man immer noch keine Abgrenzung in Zonen: Versteinerte Reste von Palmen findet man auch in unserer gegenwärtigen Polarzone. Jedenfalls herrschte über die ganze Erde hin eine höhere Temperatur als gegenwärtig.
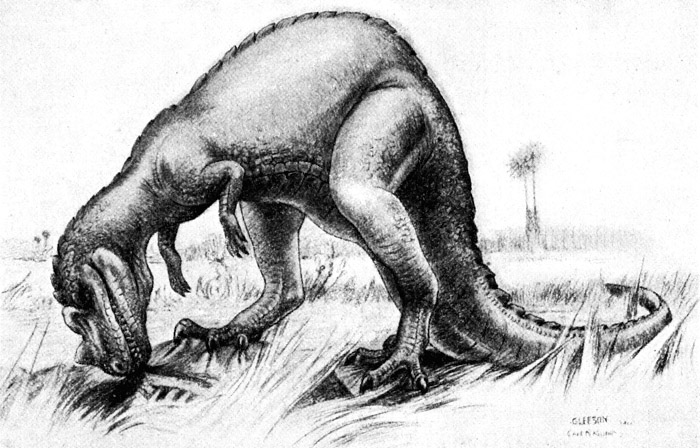
Ceratosaurus, eine Rieseneidechse aus dem Jura. Restauriert von Gleeson in den Smithsonian Reports.
Steigen wir nun zu der nächsthöheren Formation, dem Jura, empor, so gelangen wir wieder zu einem Höhepunkte der Naturentwicklung, der die schrecklichsten Ungeheuer unter den Reptilien schuf, die uns wie die Ausgeburt einer wüsten Phantasie erscheinen. Man sehe sich die hier abgebildete Nashorneidechse an! Das Tier, äußerlich nicht unähnlich einem riesigen Känguru, erreichte aufgerichtet eine Höhe von sieben Metern, also fünffache Manneshöhe! Unter den Reptilien dieser Zeit nimmt jener wahrhafte geflügelte Drache, der Pterodaktylus, die Flugeidechse, einen hervorragenden Platz ein. Bereits in den damals längst vorhandenen geflügelten Insekten hatte die Natur begonnen, wenn auch, wie immer, zunächst nur in ganz schüchternen Versuchen, sich das Gebiet der freien Atmosphäre für ihre Entfaltung zu erobern, ebenso, wie sie es so erfolgreich vom Grunde des Meeres aus in dem flüssigen Elemente getan hatte. Aber diese Insekten wagten sich nicht über einen engen Bereich hinaus, und es waren nur unscheinbare Geschöpfe. Jetzt machte der schöpferische, unaufhaltsam aufstrebende Geist der Natur einen weit kühneren Vorstoß in das luftige Element hinaus. Er versuchte, ein Wesen zu schaffen, das in allen drei Elementen, in allen drei Bewegungsarten gleich gut zu Hause war, als Schwimmer im Wasser, als Kriecher auf dem Erdboden und als Flieger in der Luft. Sollte ein großes Tier das Fliegen lernen, so mußte es auch zugleich schwimmen können. Denn mißglückten die ersten Flugversuche auf dem Lande, so konnte sich dort ein schwerer Körper leicht zu Tode stürzen. Auch die Menschen, welche heute Flugversuche machen, tun es häufig über der Fläche eines Sees, damit das nachgiebige Element des Wassers sie im Sturze aufnehmen kann. Wollte die Natur also einstmals die Vögel schaffen, nachdem bisher nur Reptilien als höchste Lebensstufe existiert hatten, so konnte sie eben nichts Besseres tun, als zunächst diese das Fliegen zu lehren. Es entstand jene entsetzlich anzusehende Flugeidechse, die in der Tat der Schrecken jener ohnehin von schleichenden gierigen Ungeheuern erfüllten Zeit gewesen sein muß. Wir haben das Skelett dieses Untiers hierneben abgebildet. Zwischen dem Körper und einem seiner mit scharfen Klauen bewaffneten mehr als meterlangen Finger breitete sich die Flughaut, wie bei einer Fledermaus, und zwischen diesen unheimlichen Flügeln reckte sich an einem langen Halse ein fürchterlicher Kopf mit dem Rachen eines Krokodils. Dazu kommt noch bei einzelnen Arten ein langer Schwanz, der die grauenhafte Gestalt vervollständigte. Man stelle es sich vor: Ein fliegendes Krokodil, das wie eine riesenhafte Fledermaus oder der sagenhafte Vampyr auf sein Opfer aus den Lüften niederstürzt und es mit seinen scheußlichen feuchtkalten Flughäuten einhüllt!
Und doch vermochte dieses schrecklichste aller Tiere, welches die Natur geschaffen hat, und das in allen Elementen raubgierig wüten konnte, in keinem dieser Elemente die Oberhand zu gewinnen. Die Natur schien hier zuviel auf einmal erreichen zu wollen, und es ist ja eine bekannte Lebenserfahrung, daß jemand, der mehrere Ziele zugleich verfolgen will, niemals so viel in einer Richtung zu erreichen vermag wie eben ein Spezialist in dieser letzteren. Die Flugeidechse und überhaupt fliegende Reptilien waren scheinbar mißglückte Schöpfungsversuche, die Natur setzte diese Richtung nicht weiter fort; sehr schnell verschwinden sie wieder in den folgenden Schöpfungsperioden.
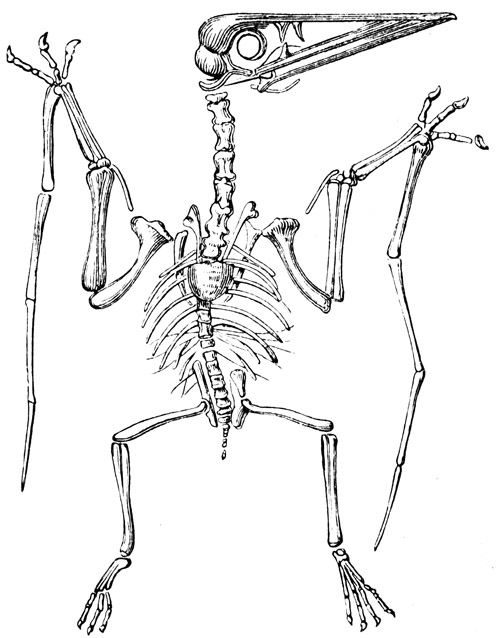
Pterodaktylus aus dem Solnhofer Schiefer Nach H. v Meyer.
Aber diese abenteuerliche und häßliche Form war dennoch ein notwendiger Übergang zu dem schönen, heitern Geschlechte der Vögel, den Bewohnern der Lüfte. Wir haben ja gesehen, wie die Natur die Tiere das Fliegen nur über dem Wasser lehren konnte. Im Kampf ums Dasein erworbene Eigenschaften vererben sich, und so formte sich das fliegende Reptil allmählich in einen reptilartigen Vogel um: Den Archäopteryx, der sich bereits mit Federn schmückte und doch noch einen reptilienartig gebauten Kopf mit Zähnen besaß. Nur zwei Exemplare dieses Urvogels sind bisher versteinert aufgefunden worden. Eine Abbildung des einen im Berliner Museum für Naturkunde befindlichen Exemplars ist hier beigefügt.

Archäopteryx aus Solnhofen, jetzt im Berliner Museum.
Nach Zittel, Palaeozoologie.
Sollte aber ein wirklicher Vogel sich in den Lüften tummeln, so mußte die Atmosphäre bereits verhältnismäßig rein und klar sein. In trüber Luft, wie etwa im Nebel, kann sich kein Vogel ohne Gefahr, gegen zu spät gesehene Gegenstände zu fliegen, bewegen. Immer mehr nähern sich jedoch nun alle Naturverhältnisse den unsrigen; sie werden ihnen in den großen Zügen ähnlich, während die Einzelformen immer noch sehr von den heutigen verschieden und namentlich organisch unentwickelter sind. Auch aus dieser Jurazeit sind Überreste nur sehr unscheinbarer Säugetiere gefunden worden. Ebenso gibt es weder Laubbäume noch Blütengewächse.
Es herrschte auch damals in den Gebieten, die wir daraufhin erforschen konnten, eine gleichmäßige, tropische Temperatur. Wie man noch keine Zonenunterschiede fand, so zeigten sich auch noch keine Andeutungen eines Jahreszeitenwechsels. Die noch fehlenden laubwerfenden Gewächse sind eine notwendige Anpassung an solche Jahresschwankungen der Temperatur. Das gleiche gilt von den noch fehlenden Warmblütern. Daß man nämlich die Reptilien ec. kaltblütig nennt, ist eigentlich falsch; sie besitzen die Temperatur ihrer Umgebung, die bei uns allerdings meist bedeutend unter unserer Blutwärme liegt. In den Tropen aber erreicht auch die der Reptilien nahezu die unsrige. Zu jener Zeit, in der allgemein tropische Temperatur herrschte, waren also eigentlich alle Tiere warmblütig. Da nun aber von einer bestimmten Temperatur an das Eiweiß im Körper erstarrt, so hört der Stoffwechsel dann auf; die Tiere, welche keine Vorrichtungen haben, aus sich selbst heraus die Körperwärme über dieser Temperatur zu erhalten, werden bei zunehmender Kälte träge und schließlich regungslos; sie fallen in Winterschlaf, eine todesähnliche Starre. Die Reptilien der damaligen Zeit wie die unserer Tropen kamen niemals in diese Lage und konnten sich deshalb so überaus üppig entwickeln. Als nun aber ein Jahreszeitenwechsel eintrat, mußten neue Formen geschaffen werden, die auch den Winter in lebendiger Betätigung überstehen konnten, und diese Formen überflügelten dann notwendig die andern. Der Jahreszeitenwechsel, durch die fortschreitende Erkaltung der Erdrinde und die Klärung der Atmosphäre mehr und mehr hervortretend, war es, der die Warmblüter, die Säugetiere, schuf, aus denen schließlich der Mensch als Krone der Schöpfung hervorging. Ihnen, den weniger schrecklich Bewaffneten, fiel die Vorherrschaft zu, weil der hereinbrechende Winter jene Ungeheuer unter den Reptilien ihnen wehrlos überantwortete.
Aber noch ehe dieser große Umschwung eintrat, schob sich eine andere Formation dazwischen, die der Kreide. Die Schichten derselben bestehen zum größten Teil aus gewaltigen Ablagerungen jener kleinen Lebewesen, die als Foraminiferen, Radiolarien ec. im Meere frei schwimmen, und deren Kalk- oder Kieselpanzer auch heute noch den größten Teil des Meeresschlammes ausmachen. Wir sehen aus den Überresten aus dieser Zeit, daß das Leben auch im Meere in steter Weiterentwicklung war. Die Fische, welche zuerst nach Art der Krebse, aus denen sie entstanden waren, einen Krustenpanzer besaßen, während ihr Leib im Innern nur durch Knorpel, kein eigentliches Knochengerüst, befestigt war, bekamen immer mehr den Innenbau unserer gegenwärtigen vollkommensten Fischarten, wie denn überhaupt das Meerestierleben viel früher als das des Landes sich dem der Gegenwart näherte, weil, wie schon erwähnt, die Lebensbedingungen des Meeres sich viel weniger geändert haben als die des Landes. Ja, nachdem einmal durch die Abgrenzung der Zonen die Erdpole beständig mit Eis bedeckt blieben, mußten die Verhältnisse des Meeresgrundes überhaupt unveränderlich werden, denn nun floß beständig vom abschmelzenden Eise der Pole das dichteste Wasser, das bekanntlich 4 Grad über Null besitzt, über den Grund aller Meere hinweg und erhielt ihn ungefähr auf dieser Temperatur rings um die Erde herum. Es gibt also seitdem in den Meeres tiefen keinerlei Zonenabgrenzung, wie sie dort wohl auch vorher nicht bestanden hat. Wir haben Grund anzunehmen, daß spätestens zur Kreidezeit solche beständigen Eiskalotten sich um die Erdpole gelegt hatten, weshalb die Tierwelt des Kreidemeeres bis zu der unserer Meere keine wesentlichen Veränderungen mehr erfuhr. So meint man, daß noch immer in den Tiefen unserer Ozeane einige der Riesensaurier leben, die wir in der Kreide versteinert finden. Die berüchtigte Seeschlange sei keine bloße Phantasie; die wiederholten Wahrnehmungen des Meerungeheuers zeigten untereinander zu große Übereinstimmung und deuteten auf solch ein Reptil aus grauen Vorzeiten hin, das sich in der Finsternis der Meerestiefe bis in die Gegenwart gerettet habe.
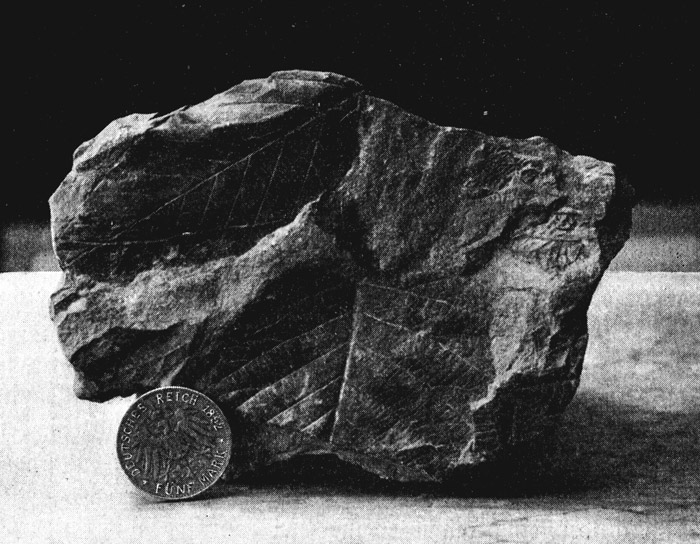
Versteinerte Blätter, in Spitzbergen gefunden.
Nach einer photographischen Aufnahme des Verfassers.
Vom Auftreten markanter Jahreszeiten zeugt auch die Tatsache, daß in diesen Ablagerungen nun zum erstenmal echte Laubgewächse gefunden werden, ein außerordentlicher Fortschritt im Vegetationsbilde der Erde zur Gegenwart hin.
Daß man in der Kreide gar keine Säugetierreste gefunden hat, beweist zwar nicht ihr völliges Fehlen, weil, wie erwähnt, diese Ablagerungen meist von den Meeren jener Zeit herrühren, aber es zeigt doch, daß sie jedenfalls noch ohne Bedeutung im Gesamtbilde der damaligen Schöpfung waren und gegen die früheren Zeiten keinen merklichen Schritt vorwärts getan hatten.
Nun aber bricht, wie beim tropischen Aufgang der Sonne, mit einem Male die Morgenröte unserer heutigen Schöpfung an. Wir treten in eine neue Periode, die känozoische, ein, die sich mit großer Schärfe von der vorigen, der mesozoischen, abhebt.
Das erste Glied derselben nennen wir die Tertiärformation, und man hat sie wieder in vier Unterabteilungen, das Eozän, eben die Zeit der Morgenröte, das Oligozän, Miozän und Pliozän, getrennt.
Es war um diese Zeit, daß auch jene gewaltigen Verschiebungen der Erdschollen stattfanden, von denen wir vorhin gesprochen haben, daß die meisten großen Gebirgszüge des heutigen Erdballs, zum Teil unter Ausbrüchen ganzer Reihen von Vulkanen, geboren wurden und sich auch das geographische Bild unserer Erdoberfläche dem der Gegenwart zu nähern begann.
Im Kampfe mit so einschneidenden Revolutionen mußte auch die lebendige Natur sich wesentlich umgestalten. Unter den Pflanzen sehen wir nun die Blütengewächse sich kräftig entfalten, zum Beweise, daß es Sonnenschein und einen Frühling gab. In den ersten Abschnitten des Tertiärs kamen diese heute hauptsächlich der gemäßigten Zone angehörenden Gewächse noch gemischt mit tropischen vor; es herrschte in unsern Gegenden noch ein mindestens subtropisches Klima, das sich weit über die Grenzen des gegenwärtigen Polarkreises erstreckte. Ich habe aus tertiären Ablagerungen auf Spitzbergen, wo drei Monate des Jahres die Sonne nicht aufgeht und als einziger Repräsentant der Laubgewächse eine sich unter Moos versteckende, zum unscheinbaren Kraut verkümmerte Birke vorkommt, selbst das schöne große Blatt gesammelt, welches auf S. 80 abgebildet ist. Aber aus den Überresten in den höheren Ablagerungen des Tertiärs geht deutlich hervor, daß die Temperaturverhältnisse und die Zonenabgrenzungen immer mehr den gegenwärtigen ähnlich wurden. Alles drängte unserer schönen Zeit entgegen.
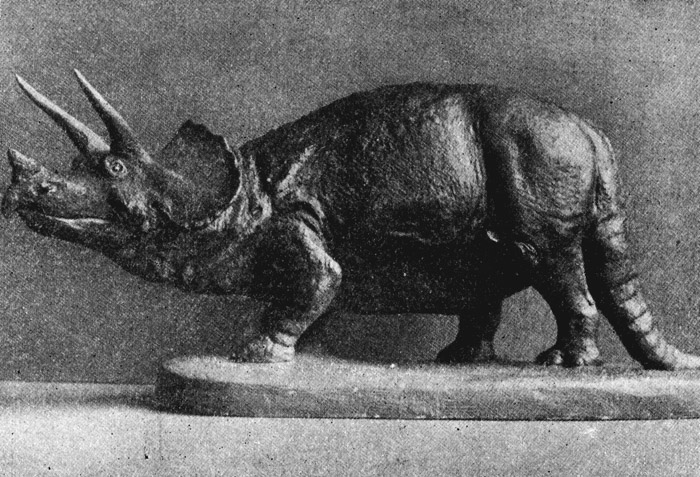
Triceratops, ein Dickhäuter der Tertiär-Formation.
Nach einer Statuette von Ch. R. Knight im Washington-Museum.
Entsprechend unsern Betrachtungen auf Seite 79 trat nun das schreckliche Eidechsengeschlecht stark zurück, und die Warmblüter entwickelten sich dafür sofort bis ins Riesenhafte. Unter diesen ersten Säugetieren begegnen wir deshalb zunächst nicht minder entsetzlichen Ungeheuern, wie die des Jura waren. Man sehe sich die auf S. 82 u. 85 abgebildeten fürchterlichen Gestalten an! Sie haben zunächst noch wenig Ähnlichkeit mit Geschöpfen der Gegenwart, aber auch hier sieht man in den höheren Abteilungen des Tertiärs Schritt für Schritt die Annäherung an dieselben.
Unter diesen vorweltlichen Gestalten erscheint nun auch, zugleich mit noch unentwickelten Affen, ein Wesen, aus dem einmal der Mensch geworden sein kann; hierüber hat Wilhelm Bölsche in seinem schon Seite 58 erwähnten Bändchen dieser Sammlung ausführlich berichtet.
Mitten in diese kräftigste Aufwärtsentwicklung der gesamten Ausgestaltung unseres Planetenlebens schnitt nun die geheimnisvolle Eiszeit mit ihren wiederholten Temperaturschwankungen ein, von deren vermutlichen Ursachen wir schon auf Seite 72 gesprochen haben. Aber ebenso, wie der zur Tertiärzeit eingetretene Jahreszeitenwechsel zur Auslese der vollkommeneren, anpassungsfähigeren Formen führte und das vielseitige Geschlecht der Säugetiere schuf, so wandelte nun im noch viel erbitterteren Kampfe mit diesem Jahrzehntausende umfassenden Jahreszeitenwechsel der Eiszeiten am Rande der vordringenden Gletscher das Tier sich zum Menschen um. Keine Anpassung durch wesentliche Körperumformung konnte hier genügen, nur die wachsende Intelligenz, die die Natur selbst, welche dem Leben feindlich wurde, zum eigenen Nutzen zu meistern verstand, konnte diesem Umschwung der Verhältnisse trotzen.
Wir sind auf der höchsten Stufe der Lebensentfaltung angelangt: Der Mensch wurde geboren. Er eroberte sich die Erde, und sein Geist erweiterte sich mit wunderbarer Kraft, daß er das ganze Universum umfassen lernte. Eine völlig neue Schöpfungsrichtung ist mit ihm eingeleitet. Wir stehen noch auf einer der untersten Stufen derselben, wir sind die Protozoen unter den geistbegabten und die Naturkräfte beherrschenden Wesen. Der Anfang des Weges zu ungeahnten herrlichen Zielen ist betreten! –
Nach Penck gab es mindestens vier große Eiszeiten, die ihrerseits wieder in kleinere Wellen von Temperaturschwankungen zerfielen. Zwischen den Eiszeiten lagen wärmere Perioden, wo durch die abschmelzenden Gletscher in den feuchten Tälern sich ein üppiger Wiesenwuchs entfaltete. Deshalb konnten in diesen Interglazialzeiten sich namentlich die Pflanzenfresser ganz besonders gut entwickeln. Wir stoßen daher in den Ablagerungen dieser Quartär-Periode, welche die Eiszeiten einschließt, und in denen des Diluviums, das der letzten allgemeinen Vergletscherung folgte und von dem unsere Zeit eine unmittelbare Fortsetzung ist, auf jene gewaltigen Dickhäuter, namentlich das Mammut, dessen Reste wir oft noch mit Fleisch und Haaren im Eise Sibiriens eingefroren vorfinden. Selbst diesen Riesen wagte der Mensch sich schon im Kampfe gegenüberzustellen, und er ging aus ihm schließlich als Sieger hervor.
Wir sind am Ende unserer Darstellung einer Entstehung der Welt angelangt, indem wir aus chaotischen, dunklen Urzuständen die schöne Gegenwart aufblühen sahen. Blieben wir dabei in der ganzen letzten Hälfte unserer Betrachtungen zwar immer nur auf unserer kleinen Erde, so war es, weil wir diese spezielleren Entwicklungsphasen eben nur an ihr kennen. Aber es ist, angesichts der überall, wo es möglich war, konstatierten Gleichheit der weltbildenden Materie und der Universalität der die Materie regierenden Naturkräfte, endlich bei der fast völligen Übereinstimmung aller großen Züge der Weltbildung, die wir am Himmel wahrzunehmen vermögen, kein Zweifel darüber, daß es im weiten Weltgebäude noch Millionen von Erdenwelten gleich der unsrigen geben muß, wenn wir auch keinerlei Kunde von ihnen haben. Dagegen werden gerade die Geschwister der Erde, die übrigen Planeten unseres Systems, die wir allein etwas näher ins Auge zu fassen vermögen, diejenigen charakteristischen Unterschiede von unserer Erde aufweisen müssen, wie etwa Geschwister in sehr verschiedenen Altersstufen, und wir dürfen uns deshalb nicht wundern, wenn wir gerade auf ihnen keinen sicheren Spuren eines Lebens begegnen, das dem unserer Erde ähnlich wäre. Auch Mars mit seinen Kanälen bleibt hier zweifelhaft, wovon ich vielleicht in einem späteren Bändchen dieser Sammlung einmal ausführlicher erzählen darf.
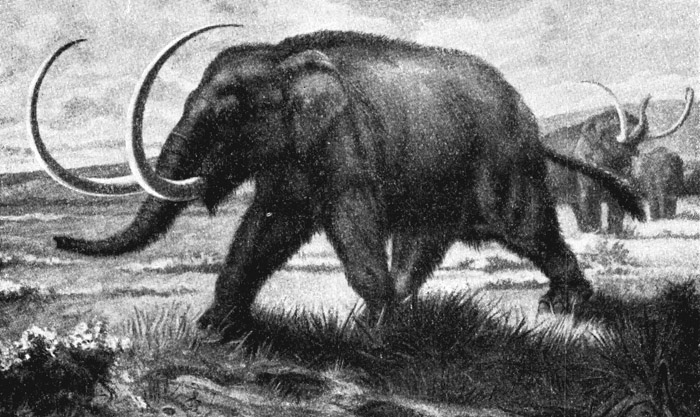
Mastodon, (restauriert) aus dem Diluvium.
Nach den Smithsonian Reports.
Sehen wir zum gestirnten Himmel mit seinen Millionen von Sonnen empor, so können wir sicher sein, den Blicken intelligenter Wesen zu begegnen, die zu unserm Tagesgestirn hinaufschauen, wie wir zu ihnen, um dort geistesverwandte Brüder zu suchen. Vielleicht sind wir der Zeit gar nicht mehr allzufern, in der die Bemeisterung der Naturkräfte, die alle Fernen des Weltgebäudes überbrücken, so weit gelungen ist, daß wir nicht nur unsern Blick, sondern auch unsern sehnsuchtsvollen Ruf nach verwandten Wesen weit über unsern Erdball hinaus in das Weltgebäude hinausschicken und – Antwort erhalten. Wie das Leben einst – wir können es uns wenigstens nicht anders denken – aus dem Weltall zu uns herabgekommen ist und mit allerkleinsten Anfängen sich über die Erde verbreitete, wie schließlich der Mensch den engen, nur das Nächstliegende, Greifbare umfassenden Horizont des Tieres erweiterte bis zur Beherrschung seines ganzen Planeten, und wie sein Geist nun wieder hinauseilt in dieses Universum, aus dem die Elemente desselben kamen, so wird er vielleicht auch einmal in eine höhere Geistesgemeinschaft zu treten verstehen mit den Bewohnern fremder Welten und Können und Wissen mit ihnen austauschen, wie es auf unserer Erde die Geister ja auch vermögen, ohne jemals körperlich miteinander in Berührung zu kommen.
Dem Geist, unserm Wissen und Können gehört die Welt.
Aber, zu welchen ungeahnten Höhepunkten sich auch unsere und die andern Welten des Universums noch emporschwingen werden, sie müssen einmal wieder herabsteigen von dieser Höhe. Der Kreislauf der Weltentwicklung muß sich schließen zwischen Aufgang und Untergang.
Der Kreislauf! Ist diese Bezeichnung richtig? Waren es wirklich Kreisläufe, zwischen denen das Weltgeschehen beständig hin und her pendeln mußte, so hätte man wohl ein Recht, unmutig oder gar verzweiflungsvoll zu fragen, wozu wir uns denn immer in diesen Kreisen drehen müssen, und wozu wir eigentlich leben, da wir alle und alle Welten, die wir kennen, doch einmal wieder zu Grunde gehen werden, so daß all unser Tun und Denken, mit dem wir unablässig, getrieben von einem unwiderstehlichen Streben nach der niemals erreichbaren Vollkommenheit, uns mühen, ganz vergebens war. Ist dieser unwiderstehliche Drang zur Emporentwicklung, der nicht nur in uns und nicht nur in allem Lebendigen, sondern überall in der Natur lebt, in der es sich unablässig regt, um die Materie zu immer höheren Organisationen zusammenzuführen, vom wachsenden Atom bis zu den Milchstraßensystemen, ist der Wille zum Guten, der als schönste Blüte dieses Dranges im Menschengeiste keimte und wächst, nicht die fürchterlichste Ironie des Weltgeistes, der dies alles schuf, nur um es wieder zu zerstören? Ist unser Dasein nicht zwecklos und der Schmerzen nicht wert, die wir im Kampfe mit all den Unvollkommenheiten beständig zu ertragen haben, wenn die ganze Welt, in der wir leben, zwecklos ist?
Und welchen Zweck könnte die Welt wohl haben? Damit wir uns darin freuen? Oder, um mit den Pessimisten zu empfinden, die ihre Verzweiflung über das Dasein aus solchen Betrachtungen nahmen, damit wir darin ewig leiden müssen? Das konnten wir so lange meinen, als der Mensch noch mit der Erde im Mittelpunkte der Welt stand. Kopernikus aber, so sagt man, hat uns in unser Nichts zurückgewiesen. Wir wissen, daß wir weniger sind als die Infusionstierchen, die zu Tausenden in jedem Tropfen Meerwasser wimmeln, und daß das Weltgeschehen und der Weltzweck sich so wenig um unser Leid, um unsere Verzweiflung und auch um unser Glück kümmern kann, wie wir es tun, wenn unser Fußtritt Tausende jener kleinsten Wesen unbewußt tötet.
Ja, ist denn dieser Gedanke nicht noch schrecklicher, noch erdrückender, daß wir nichts weiter sein sollen als Stäubchen an einem ungeheuren gefühllosen Räderwerke, das durch den endlosen leeren kalten Raum dahinrast, ziel- und zwecklos, soweit wir denken können? Weshalb denn ist gerade diesen paar Stäubchen Empfindung beigegeben und dieser Geist, der bei seiner verschwindenden Kleinheit doch das Unermeßliche umfassen oder ahnen kann, nur um uns diese unüberbrückbare Kluft des Weltenraums erkennen zu lassen, die uns Zellengefangene auf dem winzig kleinen Erdkreise rings mit schauerlicher Öde umgibt?
Wie kleinlich aus ihren engen Gesichtspunkten heraus denken die Menschen, welche solche Fragen stellen! Sie messen Klein und Groß, und Nichtig und Wertvoll nur mit ihren selbstgemachten Maßstäben. Kann denn das körperlich Kleine nicht ebenso wertvoll ja unendlich wichtiger sein im Getriebe des Ganzen, wie das Große mit seinen ungeheuren schwerfälligen, oft mehr zerstörenden als aufbauenden Wirkungen? Wir haben vorhin einen Blick in die Welt der Atome getan und sahen, wie hier in unsichtbar kleinen Dimensionen ein unergründlich vielseitiges Geschehen mit gewaltigen Kräften am Weltbau unablässig arbeitet, während die greifbare Materie, die aus diesen molekularen Weltsystemen zusammengesetzt ist, träge daliegt. Nur allein aus den Kräften dieser allerkleinsten Welten wird die Wärme, das Licht, die Elektrizität und werden all die chemischen Wirkungen geboren, die das Werden und Vergehen der sichtbaren Welt bedingen, und der wundervolle Teppich der lebendigen Natur wird gewoben mit diesen allerkleinsten Maschen der Atomgruppierungen.
Wir können doch nicht leugnen, daß wenigstens in dem Teile der Welt und der Zeitspanne, die wir zu überblicken vermögen, ein Aufstreben zu immer höherer Ordnung, zu immer verzweigterer Organisation allgemein beobachtet wird. Dieses Streben zeigt uns den Zweck unseres Weltausschnittes deutlich: Aus dem Einfacheren soll das Verzweigtere, das organisch Zusammengesetztere geschaffen werden. Hierdurch haben wir einen Maßstab für die Frage nach dem wirklich, nicht nur für den Menschen, Wertvolleren gewonnen. In diesem Sinne ist ein einziges Eiweißmolekül unermeßlich wertvoller als ein ganzer Berg aus einfach aufgebauten elementaren Stoffen, sagen wir aus Kalkstein. Die Moleküle des Kalks bestehen aus je einem Atom Calcium und Kohlenstoff und drei Atomen Sauerstoff. Das Eiweiß setzt sich aus fünf Elementen, den vier Organogenen, Kohlenstoff, Wasserstoff, Sauerstoff und Stickstoff, mit einem noch geringen Prozentsatz Schwefel zusammen. Aber viele Tausende von diesen Atomen gruppieren sich im Eiweißmolekül in einer festen, außerordentlich vielseitigen und deshalb immer noch nicht völlig erforschten Ordnung und umschwingen als ein Weltsystem ihren Mittelpunkt, gegen das die Organisation unserer Sonnenwelt unendlich einfach genannt werden muß. Wieviel wertvoller wird deshalb ein Kohlenstoffatom, wenn es auf der Stufenleiter des Weltgeschehens aus dem Molekül des Kalksteins zu dem des Eiweiß emporgestiegen ist! Wertvoller ist das Eiweißmolekül, weil die Natur mehr mit ihm anzufangen weiß, es vielseitiger arbeiten lassen kann an ihrer weiteren Entwicklung. Und deshalb muß auf der Erdenwelt wenigstens die höchste Aufgabe der Atomwelten darin bestehen, ein Eiweißmolekül in dem Hirn eines Menschen zu bilden, mit dessen Hilfe dieser die Naturkräfte selbst wieder zu leiten vermag und sie zwingt, an der Weiterentwicklung der höchsten Organisation, die sie bei uns hervorgebracht hat, der Menschenwelt, schneller weiterzuarbeiten, als ohne die intellektuelle Führung.
Und deshalb ist auch das Hirn eines einzigen Menschen in Wirklichkeit, nicht nur nach menschlicher Wertschätzung, mehr wert als ganze Sonnenschwärme, in denen die Elemente noch in der groben Ordnung der Himmelskörperstufe roh nebeneinanderliegen. Die Weltentwicklung schreitet, nachdem sie erst aus dem Kleinen das Große in roher Weise zusammengelegt hat, mehr und mehr vom Großen zum Kleinen vor, wie ein Bildhauer mit seiner Schöpfung, und macht das Kleine schließlich unendlich wertvoller als das Große. In diesem geläuterten Sinne sind wir Menschen doch das Wertvollste auf unserer Erdenschöpfung, freilich nur, wenn wir zugleich erkennen, daß wir nur Wert haben, wenn wir die uns durch diese wunderbare höchste Organisation der Materie innewohnenden Kräfte wieder zum Fortschritt des Ganzen verwenden, denn dieser Wert bemißt sich ja nach der Nützlichkeit der Einzelorganisationen für die höheren Stufen. Der Egoist, der nur an sich und sein Wohl denkt, wird für das Ganze wertlos oder selbst schädlich, und die Gemeinschaft isoliert ihn mehr und mehr, oder stößt ihn gar aus. In dieser notwendigen Reaktion fühlt der Egoist sich von seiner umgebenden Welt beeinträchtigt und gekränkt, er haßt sie mehr und mehr und wird zum Pessimisten. Für diesen hat die Welt wirklich keinen Zweck, sowie er zwecklos in derselben ist.
Ja, aber alle diese Betrachtungen bringen uns doch nicht über die Tatsache hinweg, daß dies alles einmal aufhören muß, daß selbst das komplizierteste Eiweißmolekül in dem Hirn des größten aller Denker einmal wieder zerfallen muß in seine Urstoffe und alle Gedanken, die einst in ungezählten Jahrtausenden aufblühten, und alle Schöpfungen der Menschen und der gesamten Natur zusammensinken in das Chaos, aus dem sie kamen: Kein Schritt vorwärts ist wirklich, für immer und ewig wertvoll, geschehen. Alles muß wieder zurück, woher es kam.
Und wenn es nun wirklich so wäre, dürften wir uns ernstlich beklagen? Birgt nicht dieses Streben nach dem Vollkommenden, das in allem Geschaffenen wohnt, mindestens für uns empfindende Geschöpfe der Freuden unermeßlich viele? Wären wir wirklich glücklicher, wenn uns das Glück ohne Kampf in den Schoß fiele?
Diese Fragen sind wohl hier nicht am rechten Orte. Aber eine Frage haben wir hier doch zu beantworten. Gehen wirklich die Kreisläufe des Weltgeschehens immer wieder auf denselben Nullpunkt zurück? Bleibt nach einem Weltuntergange nichts, gar nichts übrig von der Organisation der zerstörten Schöpfung? Ist das Fazit alles Weltgeschehens wirklich gleich null?
In den einzelnen Stufen des Weltbaues ist das sicher nicht der Fall. Nach den vorhin entwickelten Ansichten werden und vergehen auch die Atome innerhalb ihrer Weltsysteme. Aber indem wir das Atom des Radiums zum Beispiel, das einem Entwicklungshöhepunkte jener Atomstufe entspricht, wieder zerfallen sehen, erkennen wir doch, daß nicht nur allein jene allerkleinsten uns bekannten Materieteile, die Elektronen, von ihm abgesprengt werden, sondern zugleich auch eine ganze Stufenfolge von größeren Körpern: Die zerfallende Atomwelt kehrt nicht völlig auf ihren Urzustand zurück. Um die größeren Kerne aber muß die neuerstehende Welt schneller wachsen, eher zum nächsten Höhepunkte emporsteigen, als wenn alles sich wieder aus den Uratomen aufbauen müßte. Ganz denselben Verhältnissen begegnen wir in der größten Stufe der Himmelskörper. Auch ihnen ist nur eine bestimmte Lebensdauer zugewiesen. Aber in der weltschöpferischen Vereinigung zweier ausgelebter Himmelskörper bleiben größere Materieknoten zurück, die die Organisation des wieder daraus entstehenden Systems in den großen Zügen vorbestimmen. Und in den Zwischenstufen nehmen wir dasselbe wahr. Jedes sterbende Individuum repräsentiert ja einen Weltuntergang, aber jede Generation, wenn sie auch von Kindesbeinen wieder neu emporwachsen muß zum Mannesalter, fügt doch dem elterlichen Erbe etwas Neues hinzu, sowie der im Winter sich entblätternde Baum doch im nächsten Sommer mehr Blätter trägt als im vorangegangenen. Freilich nur, bis auch er altert und Zweig um Zweig abmorscht. Aber dann sind ja inzwischen für ihn die jungen Bäume aufgewachsen und streben höher und höher empor.
Und die Organisationen in allen Stufen des Weltgeschehens verzweigen sich beständig mehr. Aus Uratomen werden die Atome des Chemikers, und wenn diesen selbst auch eine maximale Größe gesetzt ist, so können sie sich doch wieder zu Molekülen vereinigen. Mit zunehmender Kälte werden die Bahnen, welche die Atome im Molekül beschreiben, enger, die Stoffe verdichten sich, und dieser Prozeß kann so weit fortschreiten, daß die in der betreffenden Stufe verfügbaren Kräfte nicht mehr ausreichen, um jemals eine Trennung der Atome aus den Molekülen zu bewirken. Dadurch ist das Molekül zum Atom geworden. Wir können uns vorstellen, daß solche Vorgänge es waren, die die für uns untrennbaren chemischen Atome aus noch kleineren Teilen entstehen ließen. Nun gruppieren sich die Moleküle zu Systemen höherer Ordnung, wie wir es in der Tat nachweisen können. Ein Kristall besteht aus praktisch unendlich vielen Molekülen, die, zu einer wunderbaren Ordnung zusammengefügt, ein neues Ganze bilden. Und so können wir die Weltkörper wieder als eine Art von Kristallen allergrößter Dimensionen auffassen, oder auch als Atome, und die Milchstraße als ein Molekül der größten Weltordnung, die wir kennen. Wir haben dann gesehen, wie auch die Weltkörper sich einander beständig nähern müssen, wie auch dort die Sonnenatome, die sich zu Milchstraßenmolekülen zusammenfanden, neue größere Atome bilden, die für eine höhere Stufe untrennbar sind. So wachsen die Welten aus einer Stufe in die andere empor; aus Atomen werden Sonnen, und Sonnen sind nur Atome für ihre Stufe. Wir kennen weder Anfang noch Ende dieser Stufenfolge der Weltentwicklungen. Nichts hindert uns zu glauben, daß in Wirklichkeit die chemischen Atome Weltkörper sind, an ihrer Oberfläche belebt wie unsere Erde, und daß der Erdkörper nur das Skelett ist zu einem Lebewesen, für welches wir Menschen nur die Bedeutung von Zellen haben, die, den Blutkörperchen gleich, geschäftig hin- und herschwirren um am Aufbau und an der Erhaltung des Ganzen nach Vermögen mitzuwirken.
Und da wir keine Grenze, weder nach unten noch nach oben, in dieser Stufenfolge der Naturentwicklungen sehen, so gibt es auch, soviel wir erkennen können, keine Grenze für ihre Emporentwicklung selbst. Man hatte früher gesagt, daß das ganze Weltgeschehen einmal ein Ende haben müsse, weil in dem fast absolut kalten Weltraume die spärlich verteilten Massen endlich selbst diese extreme Kälte angenommen haben werden. Das bedeutet, daß einmal alle die kreisenden Bewegungen der Atome in den Molekülen, welche mit der Wärme auch alle die andern chemischen und physikalischen Erscheinungen mitbedingen, aufhören müssen, daß also ein völliger Ausgleich aller Kräfte und deshalb völlige Ruhe und Starrheit eintreten müsse. Man nannte diesen Zustand die Entropie der Welt, der, einmal erreicht, ewig dauern muß. Die Welt ginge also einem Tode entgegen, von dem es kein Auferstehen mehr gibt.
Wir können vom Standpunkt unserer Weltanschauung diese Meinung nicht mehr teilen. Müssen auch sicher einmal die innern Bewegungen der gegenwärtig als solche bestehenden Atome in ihren Molekülen aufhören, wenn sie den absoluten Nullpunkt der Temperatur erreicht haben, so sind dann eben die Moleküle zu Atomen einer höheren Entwicklung geworden, zu der die Welt, weit entfernt davon, einen ewigen Tod gefunden zu haben, emporgestiegen ist. Und muß auch selbst einmal die Materie des ganzen Sonnensystems sich zu maximaler Dichte zusammengefügt haben, so daß kein kleinstes Teilchen sich mehr innerhalb dieses Weltkörperatoms bewegen kann, so hat es doch noch eine fortschreitende Bewegung im Raume, wie es eben die Uratome auch hatten, und wird einstmals ein gleiches Weltkörperatom finden, mit dem es ein neues Molekül bilden kann, vielleicht, indem es durch einen fürchterlichen Anprall sich wieder teilweise auflöst in seine Uratome, wie es bei dem neuen Stern im Perseus geschah.
Ein wirkliches Ende des Weltgeschehens kann deshalb nur eintreten, wenn die Welt der Materie etwas Endliches ist, wenn es nicht unendlich viele Welten gibt, die sich immer wieder zu neuen größeren Organisationen zusammenschließen können. Soweit wir sehen und forschen und denken können, ist die Welt unermeßlich groß, ob auch wirklich unendlich, das wissen wir nicht und werden wir niemals wissen. Nur der unendlich große Geist kann das vollendet unendlich Große fassen.
Genug, daß, soweit unsere Erkenntnis reicht, der beständigen Emporentwicklung der Welt als Ganzes keine Grenzen gesetzt sind. Freuen wir uns unserer Mitarbeit an dieser ewig werdenden Vollendung, die nie erreicht wird, damit des beglückenden Strebens kein Ende sei.
Und wie kein Atom aus der Welt verschwindet, so verschwindet auch nie der Wert unserer Arbeit im Kampfe um das Gute. Wir haben nicht umsonst gelebt.