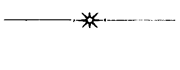|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
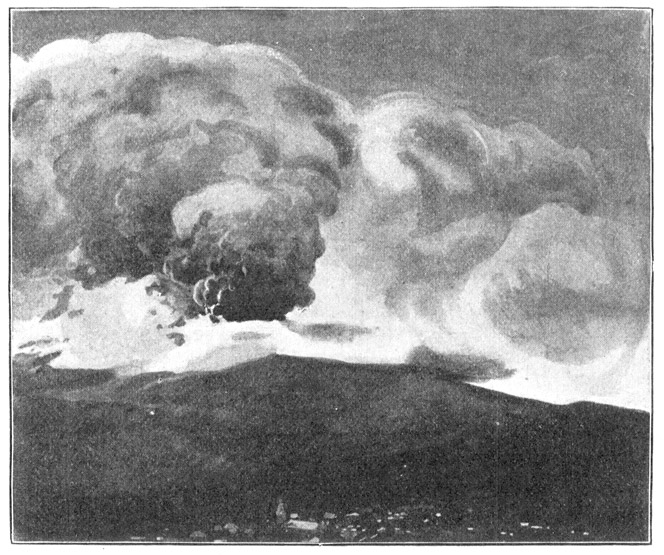
Ein phantasiereicher Schriftsteller hat unlängst alles Ernstes behauptet, die ganze Erde sei nur ein einziges lebendes Wesen. Der Mann kann deshalb recht haben, weil es wirklich schwerer ist, als man es glauben mag, zwischen Lebendigem und Totem eine strenge Grenze zu ziehen. Man weiß schon, daß der Stein tot ist und daß wir leben. Aber woran erkennen wir dies? Man antwortet gewöhnlich, an der willkürlichen Bewegung, an der Empfindung, am Bewußtsein. Der größere Teil unseres Körpers besteht nun aber aus Knochen; die können sich allein nicht willkürlich bewegen, sie haben keine Empfindung und kein Bewußtsein. Der Knochenbau des Erdwesens ist die Erdkugel selbst, und an diese setzen sich rings die lebenden Wesen als zunächst einzeln bestehende Zellen, die sich, namentlich seit der Mensch auftrat, mehr und mehr zu einem innerlich zusammenhängenden Organismus vereinigen. Ganz ähnlich wachsen in der Tat aus einem Zellkern alle lebenden Wesen auf; erst nach und nach differenzieren sich die Funktionen der zunächst gleichgearteten Zellen: es entsteht ein Zellenstaat ebenso, wie die Menschen Staaten bilden, und ebenso, wie in diesen Staaten der einzelne nur zum Teil durch die der Gemeinsamkeit zugute kommenden Verpflichtungen unfrei wird, so hat auch jede Zelle unseres Körpers eine gewisse Freiheit bewahrt, ja Millionen derselben, wie die Blutkörperchen, scheinen völlig frei zu sein, nur getrieben von dem allgemeinen Impuls des Blutkreislaufs. Sie wimmeln in den Adern hin und her, geradeso wie die Menschen in den volkreichen Straßen einer Stadt, und hier und da setzt sich ein Individuum fest, wo es nützlich sein kann am Aufbau des Ganzen. Kurz, der Vergleiche ließen sich Tausende anführen.
Aber, es sind schließlich doch eben nur geistreiche Vergleiche. Nach den ewigen, unveränderlichen Gesetzen der Natur wird sich das Tote wie das Lebendige unablässig organisch zusammenfügen müssen; es kann das Schädliche nicht auf die Dauer bestehen, weil es ja als Schädliches den Organismus, in dem es auftritt, vernichten muß und damit sich selbst auch. Deshalb muß auch das Nützliche sich immer höher entwickeln, immer mehr Ausdehnung und Macht gewinnen, weil es das Bestandfähigere ist. In diesem Sinne ist also kein Unterschied zwischen der lebendigen und der toten Natur. Überall, in den Weltsystemen ebenso wie in den allerkleinsten Stoffvereinigungen, zu denen sich die chemischen Atome gruppieren und mitten inne, bei den Systemen der Zellen, die die lebendigen Körper aufbauen, herrscht ein ewiger Kampf um das Bessere, muß das weniger Gute schließlich jenem Platz machen. Deshalb gibt es auch in allen diesen Stufenfolgen der Natur ein Gebären, ein Auswachsen, ein Blühen und auch ein Verblühen, einen Tod. Sterne und Weltsysteme kommen und gehen unter.
Auch die Erde. Wie glücklich und sorglos das Leben sich auch über sie hin entfaltet hat, seit Jahrmillionen aufwärtsstrebend, es muß einmal wieder abwärts gehen. –
Wie mag das wohl geschehen können? Wir setzen unsere Pläne auf Jahre hinaus, Staatsmänner auf Jahrzehnte und Jahrhunderte. Die uns umgebende Natur, auf Jahrmillionen der ununterbrochenen Entwicklung stehend, hat Lebenskraft für weitere Jahrmillionen. Wie sollte man es glauben können, daß dies je ein Ende hätte? Wozu dieser offenbare Drang zur rastlosen Emporentwicklung, der alles, selbst das Leblose beseelt, wenn dieses alles einmal wieder zunichte werden soll? Weshalb müssen wir alle sterben? Wir können mit Mephisto antworten: Weil alles, was besteht, wert ist, daß es zugrunde geht.
Wert ist: das heißt, daß es nicht wert war, ewig zu leben. Wir leben nicht in einer vollkommenen Welt, und deshalb muß das Alte sterben, damit das Junge, Vollkommenere, oder doch einer größeren Vollkommenheit Fähige, leben könne. So wird also der Tod etwas Notwendiges, Nützliches, im Werdeprozesse des Ganzen, und der Untergang einer Welt muß dein Fortschritt der übrigen Welten im Universum dienen.
Wie aber wäre dies wohl möglich? Bestehen denn über die Hunderte von Millionen Kilometer hinweg, die selbst die nächsten Weltkörper voneinander trennen, dennoch Beziehungen zwischen ihnen, die auf etwas mehr als ihre Bewegung und allenfalls ihre Beleuchtung hinauszielen? Würde am Getriebe des Sonnensystems irgend etwas geändert werden, wenn die Erde mit allem, was auf ihr ist, zermalmt würde, daß sie nur noch als organlose Staubwolke ihre Kreise um die Sonne zöge?
Fragen, die freilich nicht mit zwei Worten erledigt werden können! Fragen, die vielleicht den meisten als recht müßig erscheinen mögen, denn was kümmert uns das übrige Sonnensystem und alle die anderen Welten, wenn die unserige zugrunde gehen mußte! Was kümmert es den Sterbenden, wie die Welt nach ihm aussehen wird!
Nun, unsere irdische Welt ist offenbar nicht im Sterben, sondern in jugendlichstem Aufblühen begriffen, und da mag es uns doch wohl interessieren, darüber nachzudenken, welche Schicksale ihr noch bevorstehen mögen, ganz ebenso, wie wir uns gelegentlich fragen, ein wie langes Leben uns persönlich wohl noch beschieden sein und wie es einst einmal mit ihm zu Ende gehen könne. Das sind wohl ernste Stunden, in denen wir uns solchen Betrachtungen hingeben, wir fühlen uns in ihnen weihevoll umweht vom Flügelschlage der Ewigkeit, von der die Zeitspanne, die an uns vorüberrauscht, ein verschwindender Teil ist.
Die Welt! Ja, was ist die Welt, über deren zukünftige Schicksale wir nachdenken wollen? Wie weit umgrenzen wir diesen Begriff? Eigentlich bedeutet »Welt« alles, was vorhanden ist, das Universum in seinem ganzen Umfange. Das aber kann nicht untergehen. Was in ihm ist, kann sich nur wandeln, kann auf- und abstreben. Nur ein Teil dieses Ganzen kann untergehen. Und dann, was heißt untergehen? Vernichtet werden kann auch dieser Teil nicht. Er kann aufhören, das zu sein, was er war, und etwas anderes werden. Wir sagen nun, daß er untergehe, wenn die bisher in ihm vorhandene Ordnung aufhört, wenn die Elemente, die bisher am Aufbau einer Organisation dort bauten, wieder auseinanderfallen. Aufbau wie Zerfall geschehen durch die Naturkräfte, die in ihrer Art und ihrer Wirkung ewig und unveränderlich sind. Wie wäre es möglich, daß sie, nachdem sie Jahrmillionen am Aufbau einer Welt gearbeitet hatten, nun ihre Richtung, ihre Tendenz sozusagen, völlig umkehren könnten, indem sie nun zerstörend arbeiten, während sie doch selbst, ebenso wie der Stoff, den sie zu Bausteinen nahmen, absolut unverändert blieben? Wieder kommen wir zu dem Schlusse: Es gibt keinen wirklichen Untergang, auch nicht in dem Sinne einer allmählichen Zerstörung einer Organisation in einem besonders betrachteten Gebiete des Universums, vorausgesetzt, daß diese zerstörende Wirkung allgemein gedacht wird und der Zerstörung auf der einen Seite nicht ein aufbauend wirkender Einfluß auf der andern gegenübersteht. Die Naturkräfte können nur auf dem Wege, den sie von Anfang gingen, hier und da eine Organisation zerstören, die ihnen hemmend in den Weg trat. Die Natur zertrümmert nur, um besser wieder aufzubauen. Wäre es anders, wäre nicht die allgemeine Bilanz ein Fortschritt der Ordnung, so würden ja die Naturkräfte, die nichts ändern können an sich selbst, seit der unendlichen Zeit, die sie am Werke der Weltentwicklung arbeiten, schon längst alle Ordnung, so wie wir sie kennen, zerstört haben; es würde eine andere Ordnung bestehen, die wiederum im Einklange mit diesen Naturkräften stehen müßte. Noch einmal: Die Natur kann nicht vernichten, was sie aufgebaut hat, wenigstens nicht im Ganzen; sie läßt untergehen, damit es einen schöneren Aufgang gibt.
Wir alle, die wir sterben müssen, opfern unser Leben dem allgemeinen Fortschritte. Wir müssen diese Wahrheit näher erkennen, damit sie uns die Schrecken jenes unvermeidlichen Überganges mildern. Wir wollen uns mit dem Untergange einer Welt beschäftigen, um die großen Entwicklungsprinzipien näher kennen zu lernen, die diese Welt geschaffen haben.
Wir haben gesagt, daß wir einen Teil des Ganzen herausgreifen müßten. Da wir unsere Erde am besten kennen und ihr Untergang uns selbst in Mitleidenschaft zieht, ist es selbstverständlich, daß wir sie und ihre Umgebung wählen. Aber wir dürfen dabei nicht vergessen, daß sie eben nur ein Teil ist, dessen Schicksale nicht ohne seinen Zusammenhang mit dem Ganzen verständlich sein können.
Und weiter, wenn wir von einem Untergange der Erde reden, so meinen wir, die wir uns nun einmal in den Mittelpunkt des Interesses stellen, zunächst darunter nur Katastrophen oder Vorgänge, die dem Menschengeschlechte den Untergang bereiten. Wenn ein besonders heftiges Unwetter über uns hinrast und an unsern Häusern rüttelt, als wolle es alle Menschenwerke vernichten, so sagen wir »die Welt will untergehen«, und doch wird die Gewalt des vernichtendsten aller Stürme, verglichen mit der Bewegungsgewalt der kosmischen Mächte, die die Erde regieren und deshalb auch unter Umständen vernichtend wirken können, zur Geschwindigkeit einer Schnecke. Man bedenke, daß bei den allerheftigsten Stürmen die Luftbewegung etwa 40 m in der Sekunde erreicht, während ein Punkt der Erdoberfläche nur in seiner täglichen Bewegung um den Erdmittelpunkt am Äquator 464 m, die Erde selbst in ihrer Bahn dagegen rund 30 km zurücklegt. Würde die Erde nur eine Sekunde lang plötzlich stille stehn, so müßte in dieser einen Sekunde alles, was auf ihr geschaffen wurde, in Trümmer fallen.
Die Menschen wissen von großen Unwettern zu erzählen, die ganzen Ländergebieten und Hunderttausenden den Untergang bereiteten, und für diese war, was geschah, ein wirklicher Weltuntergang. Die Sagen fast aller Völker erzählen von Sintfluten, die alles hinwegrafften. Diesen Sagen liegen zweifellos wirkliche Ereignisse zugrunde. Immer werden dabei alle Elemente in grausigem Aufruhr geschildert. Können solche Ereignisse nicht wiederkehren und sich dann in ihrer Gewalt so steigern, daß alle Ordnung der irdischen Natur dadurch zerstört würde?
Solche Fragen sind natürlich nicht exakt zu beantworten. Alle Zukunft liegt verschleiert, und nur die Astronomen sind so glücklich, auf lange Zeitspannen im vorhinein natürliche Ereignisse zu verkünden, und des Eintreffens unter allen Umständen absolut sicher, wenn bis dahin – nicht die Welt untergeht. Alle unsere Forschungen und Betrachtungen, die auf Schlußsicherheit Anspruch erheben, können sich doch immer nur auf den normalen Verlauf der Dinge beziehen, aber wir wissen nur zu gewiß, daß im Getriebe alles Geschehens Abnormes, Unvorhergesehenes eintritt, welches alle unsere Vorausberechnungen zuschanden machen kann. Wir müssen also unsere Frage wieder zergliedern in die, ob wir etwas darüber wissen, wie im normalen Verlaufe dem Menschengeschlechte oder der gesamten irdischen Natur schließlich der Erde als Himmelskörper ein Ende bereitet werden kann, und dann, welche Wahrscheinlichkeiten wir etwa angeben können für ein abnormes Ereignis, das solche Folgen nach sich zu ziehen imstande sei.
Für den letzteren Fall stehen unserer Phantasie zunächst alle Wege offen. Zum Beispiel wissen wir ja aus täglichen Erfahrungen, wie unberechenbar das Wetter ist. Wer könnte mit aller Sicherheit verneinen, daß etwa schon morgen ein Orkan über die Erde hinwegfegt, der uns alle unter unseren Kartenhäusern begräbt, oder daß die Erdoberfläche rings herum in jene Zuckungen gerät, die wir als die schrecklichsten Äußerungen der irdischen Naturgewalten fürchten, vor denen es kein Entfliehen gibt, oder daß aus den Himmelsräumen ein kilometergroßes Felsstück niedersaust und in seinem Falle den Luft- und Wassermantel unseres Planeten in so fürchterlichen Aufruhr versetzt, daß keine Lebenskraft ihm widerstehen könnte; wer dürfte es ferner für unmöglich erklären, daß es im Weltraum besonders heiße oder kalte Stellen gibt, durch welche unsere Erde mit dem ganzen Sonnensystem geführt werden könne, so daß in solchen Temperaturextremen abermals das Leben zugrunde gehen müßte? Tausend solcher Möglichkeiten liegen vor, ebenso wie tausend Möglichkeiten sind, daß durch völlig unvorherzusehende Zufälle unser eigener Lebensfaden in der nächsten Minute jäh durchschnitten wird. Auch die Welt der Himmelskörper ist nicht vollkommen, auch sie ist nicht völlig vor verhängnisvollen Zufällen geschützt.
Deshalb aber beständig in Todesangst zu schweben oder gar dem Weltuntergange entgegenzusehen, wäre töricht. Wir rechnen mit der Wahrscheinlichkeit eines Lebens von bestimmter normaler Länge. Wenn wir das nicht dürften, so könnte keine Lebensversicherungsgesellschaft bestehen. Auch die Wahrscheinlichkeit ist festen Gesetzen unterworfen; in der Tausendfältigkeit der Ereignisse verwischt sich das Zufällige, und die stetige Kraft, die allen diesen Vorgängen zugrunde liegt, tritt vor Augen. Ein Beispiel, das scheinbar gar nicht hierher gehört, illustriert dies sehr schön. Jeder hat wohl schon einmal bei elektrischen Anlagen den Strommesser beobachtet und gesehen, wie der Zeiger während des Betriebs beständig in großer Unruhe hin und her schwankt, weil da oder dort Strom aus- oder eingeschaltet wird. Vielleicht sollte man nun meinen, daß, je größer der Betrieb wird, desto unruhiger müßte sich auch der Zeiger erweisen. Gerade das Gegenteil findet statt: In der Zentrale der Berliner elektrischen Straßenbahnen bewegt sich der Stromzeiger fast gar nicht mehr oder doch nur sehr langsam, indem er nur die durchschnittlichen Tagesschwankungen des Stromes angibt: Die ganze Unruhe des ungeheuren Betriebs hat sich hier im großen ausgeglichen. So wie mit diesem elektrischen Strome geht es auch mit dem Strome der Menschheit und mit dem ewigen Fluten im Meere des Weltgeschehens. Wird irgendwo eine Wirkung ausgeschaltet, so tritt an anderer Stelle eine andere dafür ein. Alles gleicht sich aus, auch die Folgen eines Weltunterganges.
In diesem Sinne können wir auf wissenschaftlicher Grundlage Wahrscheinlichkeiten für oder wider das Eintreten von verheerenden Katastrophen entwickeln, so etwa, wie wir bestimmen, in welchem Umfange Hagelschläge durchschnittlich Schaden anrichten werden, und in diesem Sinne kann man auch in der Frage eines partiellen Weltunterganges Ähnliches tun.
Leider nun beobachtet man die Natur erst seit einem Jahrhundert ziffernmäßig einigermaßen genauer. Wüßten wir z. B., um wieviel größer wir jedesmal die Zeitspanne nehmen müßten, innerhalb der ein bestimmtes Wetterereignis, Sturm, Gewitter, Überschwemmung, je einmal einen um eine gegebene Größe bedeutenderen Umfang angenommen hatte, so könnten wir etwa ausrechnen, wieviel Tausende von Jahren nötig sind, damit sich je einmal eine Sintflut ereignet, die etwa ganz Europa umfaßt. Wenn dann seit dem letzten betreffenden Ereignisse bereits so viele Jahre vergangen sind, so dürften wir dann sagen, daß wir für eine neue Sintflut reif seien. Ob sie dann wirklich auch kommt, ist freilich eine andere Frage. Ich habe diese Art von Schlüssen angeführt, weil damit in vielen Fällen, wo man die eigentlichen Gesetze des Geschehens noch nicht kennt, selbst in Gebieten der exaktesten aller Wissenschaften, der Astronomie, erfolgreich gearbeitet worden ist.
Wenn auch die Annalen der Wissenschaft mit ihren genauen Angaben nicht weit genug zurückreichen, so hat doch die Menschheit selbst wenigstens die gewaltigsten Ereignisse im Gedächtnis behalten, die sie in Mitleidenschaft zogen. Und da zeigt es sich nun, daß alle Erinnerungen an Katastrophen, welche die jeweilig bekannte »ganze Welt« umfaßten, in graue Vorzeiten zurückreichen, als die Menschheit selbst erst einen sehr kleinen Teil der Erdoberfläche kannte. Man hat keinerlei Anhaltspunkte darüber, um wieviel Jahrtausende zurück z. B. die biblische Sintflut stattfand und wie groß in Wirklichkeit der Umfang ihrer Verwüstungen war. Mit allen ähnlichen Sagen anderer Völker ist es begreiflicherweise nicht besser bestellt. Da wir aber die ziffernmäßige Zeitrechnung, bis auf für unsere Betrachtungen verschwindend kleine Unsicherheiten, bei mehreren alten Kulturvölkern, bei den Chinesen, Ägyptern, Babyloniern, um mindestens fünf Jahrtausende zurück verfolgen können und sich innerhalb dieser Zeit kein Ereignis in ihrer Geschichte verzeichnet findet, das etwa als ein wie oben charakterisierter Weltuntergang hätte gelten können, so dürfen wir getrost annehmen, daß innerhalb solcher Zeitspannen, in denen ganze Völkerschaften aufkeimen und wieder vergehen, die unsere Erdoberfläche beherrschenden Naturgewalten sich genügend ausgeglichen haben, um keine weltzerstörenden Katastrophen zuzulassen.
Vielleicht ist es also den Naturkräften, soweit sie unter irdischen Verhältnissen arbeiten, also keine kosmischen Einflüsse stattfinden, überhaupt nicht möglich, so große Wirkungen zu üben, wie wir sie hier voraussetzen. Da wir die Naturkräfte ziemlich genau studiert haben, so können wir jedenfalls dieser Frage näher treten.
Stürme wüten ja oft über die halbe Erde hinweg. Man kann ihren Weg verfolgen zwischen Kontinenten. Die Sturmwarnungen, die uns das transatlantische Kabel von Amerika bringt, sind selten umsonst gegeben. Könnte solch ein Sturm nicht einmal ganz Europa verwüsten? Wir müssen zur Beantwortung dieser Frage die andere stellen, wie denn die Stürme überhaupt zustande kommen.
Ich kann bei dieser Gelegenheit natürlich hier nicht eine meteorologische Vorlesung halten, aber jedermann weiß wohl, daß die Bewegungen der Atmosphäre dem Ausgleich der Wärmeverteilung auf der Erdoberfläche dienen. Die Sonne sendet uns mit gewissen leisen Schwankungen, auf die ich noch zurückkomme, immer dieselbe Wärmemenge zu, aber durch die Ungleichheiten der Oberfläche erhalten ihre einzelnen Teile sehr verschiedene Mengen davon. Die Lage der Achse der Erde zu ihrer Bahn um die Sonne bedingt die Verschiedenheit der Zonen. Wäre die Erdoberfläche ganz eben und besäße keine ungleich verteilten Meere, so würde durch diese Verschiedenheit der Zonen eine gleichmäßige Luftbewegung zwischen dem Äquator und den Polen unterhalten werden, die wir im großen und ganzen auch wirklich beobachten. Außerdem bedingt die Umdrehung der Erde um ihre Achse ein Zurückbleiben der Luftschichten, wodurch in den Äquatorgegenden ein beständiger Ostwind in der Höhe hervorgerufen wird. Alle diese Verhältnisse müßten konstant bleiben, wenn nicht besondere Einflüsse die Gleichmäßigkeit dieser Bewegungen störten, und nur diese besonderen Einflüsse könnten es deshalb sein, die wir zu befürchten haben. Ich sagte, daß diese von der Gestaltung der Erdoberfläche herrühren. Wäre diese völlig starr und unveränderlich, so müßten es auch ihre Einflüsse sein, und ein Gleichgewichtszustand müßte sich längst hergestellt haben. Aber ebenso wie ein Pendel, dem man nur einmal einen Anstoß gegeben hat, eine Zeitlang um seine Ruhelage hin und her schwingt, so kommt die Luftbewegung, einmal aus ihren gewöhnlichen Bahnen gestört, nicht so bald wieder zur Ruhe; hier sieht man deshalb Einflüsse sich summieren, an anderen Orten dagegen ausgleichen, und es kann gelegentlich zu recht heftigen Äußerungen kommen. Aber wir erkennen wohl, daß angesichts der konstanten Faktoren, die die Ursache sind, ihre größtmögliche Summe, das heißt also das Maximum ihrer Wirkung, eine bestimmte Grenze haben muß. Diese Grenze muß in der langen Zeit, die wir in dieser Hinsicht bis in die prähistorischen Perioden überblicken können, schon einmal eingetroffen sein, und da die Welt dabei nicht zugrunde gegangen ist, so haben wir also von einem Sturm, soweit die Sonnenbestrahlung und irdische Verhältnisse ihn veranlassen können, nichts Ernstliches zu fürchten. Auch die den Sturm gelegentlich begleitenden Erscheinungen, Gewitter, Wolkenbrüche, Hagelschlag, Sturmfluten, können aus denselben Gründen ihre Kraft nicht über ein bestimmtes Maximum hinaus steigern. Alle diese Wirkungen verhalten sich etwa so wie die Wirbel an den Ufern eines stetig fließenden Stromes.
Wie steht es aber mit jenen furchtbaren Äußerungen des Erdinnern, die wir als Vulkanerscheinungen und Erdbeben kennen, und die namentlich wieder in den letzten Jahren unsere Aufmerksamkeit in grauenerregender Weise beständig wach erhalten haben? Wir wissen, wie am 8. Mai 1901 ein unscheinbarer und als gänzlich ungefährlich geltender Vulkan in weniger als einer Minute an 50 000 Menschen erwürgte. Das war ganz gewiß ein Weltuntergang für jene unglückliche Stadt Saint Pierre auf der Insel Martinique, denn nichts blieb bestehen, nicht ein einziges Hälmlein wurde geschont. (Vergl. die Abbildung am Anfange des Buches: die Vulkanwolke des Mont Pelée.) Was die Natur, was die Menschen gebaut hatten in Jahrhunderten, die Millionen von wunderbaren Organismen, die hier zu einem aufblühenden Ganzen ineinandergriffen, in einer Minute waren sie zu einem wüsten Chaos zusammengewürfelt. Tief ergriffen von solchen ungeheuren Kraftäußerungen der Natur und schaudernd stehen wir vor derartigen Ereignissen, die in den Annalen der Geschichte nur zu vielfach verzeichnet werden mußten. Kaum achtzehn Jahre vor dem Untergange von Saint Pierre, 1883, kamen durch einen ebenfalls nur kleinen Vulkan in der Sundastraße, den Krakatoa, 40 000 Menschen um, und noch mehr wie auf Martinique mag man hierbei den Eindruck eines wahrhaften Weltunterganges gehabt haben. Der Vulkan selbst lag auf einer kleinen unbewohnten Insel, auf der er kein Unheil hatte anrichten können. Seine schrecklichen Äußerungen unterschieden sich aber von denen jenes Mont Pelée auf Martinique durch bis dahin beispiellose Fernwirkungen. Der Vulkan barst während seines Ausbruchs mitten durch und ließ die Meeresfluten in seinen glühenden Schlot strömen. Explosionen waren die Folge davon, deren Schallwirkungen man über einen Raum größer als ganz Europa vernahm. Auf der Karte S. 37 sind die betreffenden Wirkungsgebiete eingezeichnet. Der Luftwellenberg, der dadurch entstand, ging sechsmal um die ganze Erde und brachte rings herum alle Barometerangaben in beträchtliche Schwankungen. Ebenso lief die Meereswelle, die bei dem Rückstoß der Wassermassen durch die entwickelten Gase hervorgebracht wurde, mehrere Male um die Erde herum. An den Ufern der umgebenden Sundainseln aber brandete die Flut über ganze Ortschaften und Städte hinweg: eine plötzliche Sintflut, weit schrecklicher als die biblische, die man herannahen und wachsen sah, und ertränkte 40 000 Menschen. Die Hälfte der Insel wurde, zu Staub zermalmt, in die höchsten Regionen der Atmosphäre geschlendert. Mehrere Tage lang wurden Java und andere Teile des Sundaarchipels in völlige Nacht gehüllt; schreckliche Gewitter mit heißem Regen, gemischt mit widerlichem Schlamm und Asche, gingen nieder. War wohl einer, der diese schrecklichen Tage miterlebte und bei dem markdurchdringenden Krachen jener Explosionen nicht geglaubt hätte, die ganze Erde berste auseinander und stiebe zerfetzt in das Weltall hinaus?
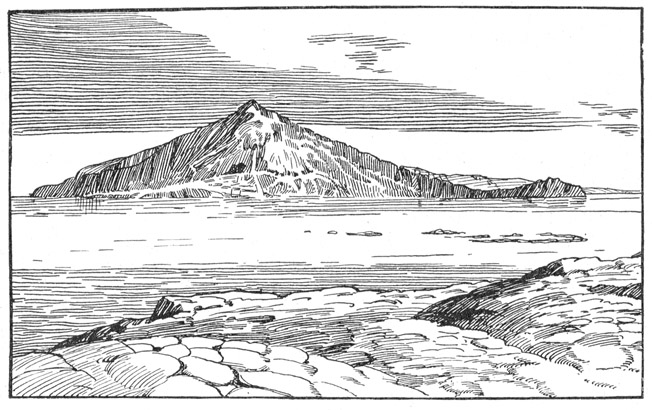
Die stehengebliebene Hälfte des Krakatoa-Vulkans.
Jene Vorgänge in der Sundastraße haben wirklich die ganze Erde in Mitleidenschaft gezogen. Noch jahrelang blieben die Nachwirkungen fast überall sichtbar. Ein großer Teil jenes allerfeinsten vulkanischen Staubes wurde in den oberen Schichten der Atmosphäre dauernd festgehalten. Zunächst erzeugte er dadurch eigentümliche Lichtbrechungen, die rings um die Erde herum die herrliche Erscheinung des sogenannten Nebelglühens, der farbenprächtigen Sonnenauf- und Untergänge verursachten, wie wir sie auch bei Gelegenheit der Katastrophe von Martinique wahrnahmen, nur in weit schwächerem Maße. Einige jener Staubwolken aber waren in den Bereich jener beständig die Erde umkreisenden Stürme an der Grenze des Luftmantels geraten und umkreisten nun mit ihnen die Erde. Wenn dann wegen ihrer großen Höhe die Sonnenstrahlen sie zur Nachtzeit noch trafen, so erschienen sie uns noch nach Jahren als sogenannte leuchtende Nachtwolken, deren sehr große Höhe messend zu bestimmen war. Jener scheinbare Weltuntergang klang also aus in entzückenden Farbenspielen.
Konnten also die Wirkungen eines solchen Vulkanausbruchs sich über unseren ganzen Planeten ausbreiten, so wäre es wohl auch denkbar, daß sie einmal alles vernichtend auftreten. Oder können wir auch in diesem Falle, wie bei den Stürmen, auf eine maximale Grenze ihrer Kraft schließen? Leider sind unsere Kenntnisse über das Wesen der Vulkanausbrüche noch sehr im argen. Wir wissen nicht, wie es im Erdinnern aussieht, woher diese übermächtigen Wirkungen kommen. Wir wissen nur sicher, daß wir über einem ungeheuren Glutherde wohnen, einer ehemaligen Sonne, die nur an ihrer oberflächlichsten Oberfläche genügend erkaltet ist, um dem Leben eine Stätte für seine Entfaltung darzubieten. Nähme man der Erde ihre Kruste weg, so würde sie zu einem weithin in das Universum hinausstrahlenden Stern werden, denn überall dort unten herrscht zweifellos eine Hitze, in der alles Gestein in weißglühenden Fluß oder in leuchtende Wolken verwandelt werden müßte, wie sie heute die Sonnenatmosphäre bilden. Es läßt sich physikalisch zeigen, daß allein schon der ungeheure Druck der überlastenden und zusammendrückenden Erdschichten genügt, um den Erdkern bis auf eine verhältnismäßig dünne Kruste nicht nur flüssig, sondern gasförmig zu machen. Die Theorie verlangt es unbedingt, daß die Erde in der Hauptsache eine Gaskugel ist, nicht viel mehr wie eine Seifenblase, ebenso wie diese außen von einer Flüssigkeit umgeben, und über diese erst hat sich die feste Kruste seit einiger Zeit geschlagen.
Seifenblasen platzen alle einmal. Kann das nicht schon morgen, ganz plötzlich, unerwartet auch mit unserem irdischen Wohnsitze geschehen, dem wir uns so sorglos anvertrauen? Nun, von innen heraus ist das wohl nicht möglich. Der Umstand, daß sich in jahrmillionenlangem Abkühlungsprozesse diese feste Kruste überhaupt bilden konnte, ist auch eine genügende Gewähr dafür, daß sie durch das Andauern dieser selben Wirkungen nicht wieder zerstört werden kann. Alles, was langsam arbeitet, arbeitet auch solide, für die Dauer, das ist nicht nur für die Arbeit der Menschen gültig. Wären Wirkungen vorhanden, die den Panzer nicht bestandfähig machten, so hätten sie ihn eben nicht entstehen lassen. Man könnte sich allerdings wohl denken, daß von dem Augenblicke an, wo der Panzer sich allseitig schloß, innere Spannungen dadurch entstehen mußten, daß die sich schneller abkühlende Kruste sich auch schneller zusammenzuziehen trachtete als das Innere, und solche Spannungen müßten sich in der Tat immer weiter häufen bis zur Katastrophe. Man könnte sich auch sagen, daß solche Katastrophen in der ersten Zeit wohl häufiger, aber weniger heftig, dann immer seltener und um so gewaltiger werden müßten, je dicker und widerstandsfähiger eben die Kruste wird. Wir würden demnach jetzt in einem Stadium leben, in dem eine explosive Zertrümmerung der Erdkugel durch diese Zusammenziehung jeden Augenblick zu befürchten wäre.

Eine recht bedenkliche Illustration zu dieser Ansicht gibt uns unser nächster Nachbar im Sonnensystem, der Mond. Es sieht wirklich ganz so aus, als ob er einmal wie eine Glaskugel zerplatzt wäre. Bekanntlich ist die uns sichtbare Hälfte des Mondes mit unzähligen Kratern besetzt, von denen ich zwar nicht glaube, daß sie alle durch eine Tätigkeit entstanden, die mit der irdischer Vulkane ohne weiteres zu vergleichen ist; wir kommen darauf noch zurück. Von einer Reihe dieser Kraterberge gehen nun sogenannte Strahlensysteme aus, Risse, die sich radial um diese Ringberge ordnen. Vom » Tycho«, einem großen Ringgebirge in der Nähe des Mondsüdpols, reichen diese Risse fast bis über die ganze Mondhälfte herum. Unsere Abbildung des Mondes, die nach einem vortrefflichen Pariser Original angefertigt wurde, zeigt sie unverkennbar. Aber es sind heute keine eigentlichen Risse mehr, keine auseinanderklaffenden Erdspalten, denn sie sind bei schräger Sonnenbeleuchtung gar nicht sichtbar, während sie als Vertiefungen doch dann gerade am deutlichsten schwarz hervortreten müßten. Nur wenn die Sonne senkrecht auf sie scheint, also zur Vollmondzeit, wo alle Reliefgestaltungen der Mondoberfläche verschwinden, weil alles schattenlos wird, sehen wir diese Streifen helleuchtend, eben als Strahlen, und ganz so wie solche um jene Krater geordnet. Würde unsere Erde in ähnlicher Weise plötzlich zerplatzen, so müßte aus den Erdrissen sofort das flüssige Erdinnere hervortreten und die Risse wieder ausfüllen. Was davon etwa überfließt, verbreitert die strahligen Streifen auf der Oberfläche, ohne jedoch merkliche Erhöhungen hervorzubringen. Wenn nun aus unseren Vulkanen die Lava besonders plötzlich hervorgetrieben wird und also sehr schnell erkalten muß, so erstarrt sie oft zu einem schwarzglänzenden Glasfluß, zu Obsidian. Bei einem so plötzlichen Zerspringen, wie wir es hier voraussetzten, sind die Bedingungen zur Obsidianbildung vorhanden, und wir können uns deshalb die Strahlensysteme des Mondes gar nicht anders erklären, als daß er wirklich einmal, oder selbst zu wiederholten Malen, da es ja verschiedene solcher voneinander unabhängiger Strahlensysteme dort gibt, zersprungen ist, und daß dann die Risse sich sofort wieder mit glänzendem Obsidian, oder einem anderen Glasfluß ausgefüllt haben.
Der Mond ist aus demselben Teig gemacht wie die Erde, er ist ein Teil von ihr und ihr ähnlich in den Grundzügen ihrer Entwicklung, wie Mutter und Tochter. Was dem Monde passiert ist, das kann auch der Erde zustoßen, und deshalb ist es jedenfalls für uns von bedeutsamem Interesse zu erfahren, wie der Mond wohl diese Risse erhalten haben kann. In dieser Hinsicht haben einmal zwei englische Mondforscher, Nasmyth und Carpenter, ein Experiment mit einer Glaskugel gemacht, die sie ganz mit Wasser füllten und dann zuschmolzen. Als sie die Kugel nun erhitzten, mußte sich das Wasser im Innern mehr ausdehnen als das umschließende Glas; es zersprengte deshalb das letztere, und es entstanden Systeme von Rissen auf der Glaskugel, die in ganz frappanter Weise denen auf dem Monde glichen. (Siehe die Abbildung.) Nun müssen wir wohl zugeben, daß das eben beschriebene Experiment durchaus den Verhältnissen entspricht, die bei der Abkühlung einer Weltkugel eintreten, die einen festen Panzer um einen flüssigen Kern geschlagen hat. Es muß ja offenbar denselben Effekt hervorbringen, ob nun das Innere sich mehr auszudehnen strebt als die Hülle, wie bei der erhitzten mit Wasser gefüllten Glaskugel, oder ob die Hülle sich mehr zusammenzuziehen strebt als der Kern nachgeben kann. Wir haben auch gesehen, daß die Gefahr dieses Auseinanderplatzens eines Weltkörpers unter den gemachten Voraussetzungen um so größer wird, je fester die Kruste bereits geworden ist, ein je höheres Alter er also erreicht hat. Der Mond ist nun relativ wesentlich älter als die Erde. Auch bei den Himmelskörpern gilt die Regel, daß das Kleinere eine kürzere Lebensdauer hat als das Größere. Bei den Himmelskörpern ist dies eine physikalische Notwendigkeit, weil jeder kleinere Körper schneller erkalten muß als ein größerer. Der Mond hat ausgelebt. Nur unsichere Spuren einer erlöschenden Lebenstätigkeit beobachtet man auf ihm. Alles dies scheint also wohl den Schluß zuzulassen, daß unser Begleiter wirklich einstmals solche Katastrophen durchgemacht hat, durch die seine ganze Oberfläche beinahe von Pol zu Pol zersprengt wurde.
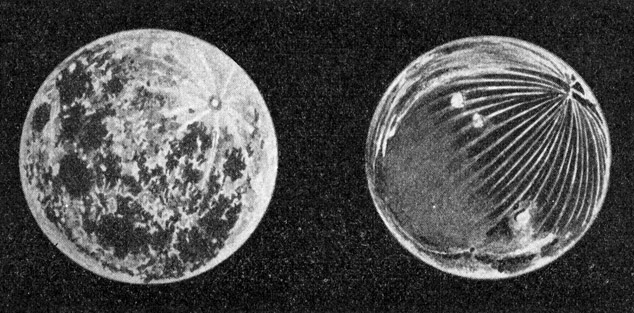
Der Mond mit dem Krater Tycho und dessen Strahlensystem und eine gesprengte Glaskugel nach Nasmyth und Carpenter.
An dem Eintritt der Katastrophe selbst kann beim Monde überhaupt nicht gezweifelt werden; der Augenschein lehrt es. Alle anderen Erklärungsversuche der Strahlensysteme sind angreifbar. Freilich vertreten die Pariser Mondforscher Loewy und Puiseux immer noch die ältere Ansicht, wonach diese Strahlen Ausstreuungen heller Aschen der Vulkane seien, die vom Winde soweit getrieben wurden. Ich habe dagegen geltend zu machen, daß solche Winde, die halb um einen rotierenden Weltkörper herumgehen, unmöglich diese völlig ungestörte Richtung beibehalten konnten. Das spricht gegen alle Erfahrungen und auch gegen die Theorie. Eine andere Frage aber ist es, ob es nicht noch andere Ursachen für diese Katastrophe gibt als ein Zerplatzen durch innere Spannung. Wenn unsere Engländer z. B. einen Stein gegen ihre Glaskugel geworfen hätten, so würden ganz genau dieselben Rißsysteme entstanden sein. Und solche Steine können nun wirklich auch gegen eine Weltkugel fliegen. Wir werden uns damit bald noch eingehender zu beschäftigen haben.
Aber wir haben ja vorhin die Notwendigkeit solches Zerplatzens dargetan. Gewiß! Unter der Voraussetzung, daß die Erdkruste wirklich hart, unnachgiebig sei. Das ist sie nun aber erwiesenermaßen nicht. Es konnte experimentell nachgewiesen werden, daß unter selbst sehr geringem Druck das härteste Gestein biegsam wird, wenn man ihm die Zeit dazu läßt. In Marmorplatten, die auf Pfählen ruhen, drücken sich diese wie in eine weiche Masse ein, nur durch ihr eigenes Gewicht. Sie biegen sich krumm wie etwa eine Bleiplatte, wenn sie aufrecht stehend schräg belastet werden, freilich immer nur nach Jahrhunderten. Dabei gehört gerade Marmor zu den sprödesten Gesteinsarten. Diese Nachgiebigkeit erhöht sich noch wesentlich, wenn man die betreffenden Materien erwärmt. Unter solchen Bedingungen aber gestaltete sich die Erdkugel. Wo sich auf ihr Gebirge aufgetürmt haben, sehen wir, daß Schichten, die einst als Meeresschlamm horizontal abgelagert wurden, sich in Falten geworfen haben wie Tuch, das man zusammenschiebt. Dies geschah unter Drucken, die die Gebirge entstehen ließen; diese Drucke können aber noch lange nicht so gewaltig sein, als ein Spannungsdruck, der schließlich im stande wäre, die ganze Erdrinde über Tausende von Kilometern hin zu zersprengen. Die Erdrinde wird also in allen Fällen nachgiebig genug sein, um einem langsam wirkenden Drucke sich anzupassen. Höchstens mag hier oder da, wo die Druckrichtungen sehr verschieden auftreten, ein Zerreißen stattfinden. In so hohem Maße »plastisch« zeigt sich der Erdball, daß er, wie theoretische Betrachtungen erwiesen haben, sich heute noch entsprechend der Schwungkraft, die aus seiner täglichen Umdrehung resultiert, an den Polen abplatten müßte, wenn er vorher eine feste vollkommene Kugel gewesen wäre. Die gegenwärtig beobachtete Abplattung der Erde beweist also keineswegs, wie man es früher geglaubt hatte, daß die ganze Erde einstmals glühend flüssig gewesen sei. Die Verhältnisse, die wir im kleinen bei der Glaskugel antrafen, sind also durchaus nicht auf Weltkörpergröße und Weltkörperentwicklungszeiten ohne weiteres anwendbar. Es würde auch allen sonst in der Natur gemachten Wahrnehmungen widersprechen, wenn im normalen Verlaufe der Dinge eine Entwicklung irgendwelcher Art katastrophenhaft enden sollte. Man wolle wohl bemerken, daß ich betone: Im normalen Laufe der Dinge. Daß in besonderen Fällen Katastrophen leider häufig genug eintreten, wissen wir alle ja zur Genüge.
Aber wir haben gleichzeitig gesehen, daß wegen der fortschreitenden Abkühlung der Erde ihre Oberfläche in beständiger Bewegung erhalten wird, damit sie sich schrittweise den fortwährend sich verändernden Verhältnissen anpassen kann. Durch diese Abkühlung ebenso wie durch ihre eigene Schwere, die ihre Massen immer weiter zusammendrückt, verkleinert sich beständig ihr Durchmesser. Ihre Haut, die Oberflächenkruste, wird ihr deshalb zu groß, sie schrumpft zusammen ebenso wie die Haut eines alternden Menschen. Alle diese Wirkungen lassen die Erdkruste niemals ganz zur Ruhe kommen, und diese Bewegungen, an sich für die Dimensionen des Erdkörpers im einzelnen unbedeutend, nehmen wir als Erdbeben wahr, die in wenigen Sekunden über ganze Landschaften Entsetzen und Verberben bringen können.
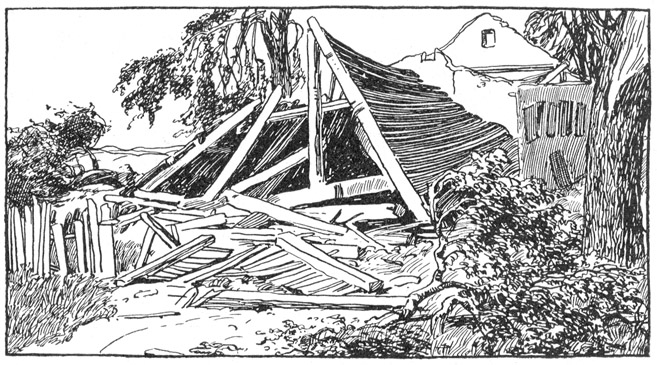
Zerstörung durch Erdbeben.
Keine die Menschheit bedrohende Naturerscheinung macht so unmittelbar den Eindruck, als ob plötzlich alle Ordnung der Dinge zerstört sei, als dieses schreckliche Erzittern der Grundfesten, die wir nächst den Sternen des Himmels als das Unveränderlichste kennen, was die Natur geschaffen hat. Aus diesen festen Boden bauen wir ja alle unsere Hoffnungen. Plötzlich, ohne alle Vorzeichen, wenn rings umher die Landschaft im herrlichsten Sonnenscheine lacht, zuckt der Boden unter unseren Füßen, oft nur eilt einzigesmal einen Bruchteil einer Sekunde lang, und nur wenige Millimeter beträgt die eigentliche Verschiebung des Erdbodens nach der Seite hin; viel geringer noch ist meist die Bewegung nach oben. Aber sie hat dabei eine so ungeheure Kraft, daß lose Gegenstände dadurch um Zehner von Metern fortgeschlendert werden können. Es ist so, als wenn man auf ein Brett, das sich selbst nicht bewegen kann, von unten her einen Hammerschlag ausübt; Sand und sonst leichte Gegenstände auf dem Brette können dadurch hoch emporgeschnellt werden. Die Mächte, die diese Erdbeben erzeugen, sind bei weitem die gewaltigsten, die wir auf der Erde überhaupt wahrnehmen. Man stelle sich vor, daß ganze Kontinente gleichzeitig erschüttert worden sind. Und gerade bei solchen ausgedehnten Beben muß man den eigentlichen Ausgangspunkt der Kraft in einer großen Tiefe, bis zu zehn und mehr Kilometern unter der Erdoberfläche, suchen. Ein Oberflächenstück also von Zehnern von Kilometern Dicke und Hunderttausenden von Quadratkilometern Oberfläche rütteln diese unheimlichen Mächte hin und her. Das große Erdbeben von Lissabon im Jahre 1755, dem 60 000 Menschen zum Opfer fielen, und das die ganze Stadt, die zu den reichsten der Welt damals gehörte, in einen Trümmerhaufen verwandelte, bestand nur aus drei starken Stößen, die innerhalb fünf Minuten erfolgten. In diesen fünf Minuten war aus heiterem Himmel ein Weltuntergang hereingebrochen über diese Tausende. Im ganzen nordwestlichen Europa hat man dieses Erdbeben gespürt, auf den Britischen Inseln, in Deutschland und der Schweiz und im südlichen Skandinavien. In unseren Tagen, wo wir auf die Naturerscheinungen mehr achten, auch wenn sie nicht unmittelbar uns in Mitleidenschaft ziehen, sind Erdbeben, nicht nur in unseren superempfindlichen Instrumenten, sondern auch selbst »makroseismisch«, als deutliche Erschütterungen in noch viel größerem Umfange beobachtet worden, ja, bei dem großen Erdbeben, das 1895 in Argentinien sein Zentrum hatte, erzitterte deutlich der ganze Erdball. In Japan sowohl wie in Italien waren seine Wirkungen zu verspüren. Man stelle sich einmal vor, welcher Kräfte es bedürfen würde, um einen Berg um einen Millimeter zu heben. Die Masse ausgedehnter Gebirge aber ist klein gegenüber solchen kilometerdicken kontinentalen Schollen, die wir hierbei in Bewegung sehen. Wenn wir dann erfahren, daß bei einem Beben vom Jahre 1891 in Japan eine Viertelmillion Häuser zerstört worden sind, so können wir uns wohl fragen, ob diese tückischen Gewalten nicht einmal den ganzen Erdball derart zu erschüttern vermögen, daß alle Menschenwerke vielleicht in einer einzigen Sekunde zerstört würden.
Diese Frage bedingt ebenso wie bei unseren vorangegangenen Betrachtungen über die Stürme die nach der Ursache der Erdbeben. Wirken auch hier konstante Faktoren, mit denen man, wenigstens für den allgemeinen Verlauf der Dinge, rechnen kann? Leider müssen wir auch hier, wie bei den Vulkanerscheinungen, antworten, daß unsere Kenntnisse von den Ursachen der Erdbeben noch außerordentlich unsicher sind. Erst seit kaum mehr als zehn Jahren verfolgt man die Erdbeben systematischer und mit genügend feinen Instrumenten, erst so jung ist die Wissenschaft der »Seismologie«, die bisher kaum mehr tun konnte, als ein umfassendes Beobachtungsmaterial zu sammeln und einigermaßen zu sichten, mit dem man nun versuchen wird, wissenschaftlich begründete Theorien aufzubauen. Zunächst zeigt sich leider nur, daß gerade diese entsetzlichsten von allen Naturerscheinungen auf der Erde zugleich auch die unberechenbarsten von allen sind. Selbst in den Launen des Wetters kennen wir heute mehr Gesetz und Regel, wie in den Erdbeben. Dennoch sind einige große Züge ihres Wesens auch heute schon zu erkennen, und diese vermögen uns immerhin einige Anhaltspunkte in unserer Sache zu geben.

Zerreißen des Bodens durch Erdbeben.
Zunächst sehen wir deutlich, daß es bestimmte Gebiete der Erdoberfläche gibt, wo die Beben häufiger und kräftiger auftreten wie in anderen, die zum Teil sogar als erdbebenfrei, oder doch sehr arm daran, gelten können. So sind z. B. in der norddeutschen Tiefebene nur sehr selten Erdbeben wahrgenommen worden, und wenn deren einmal auftraten, so zeigte es sich, daß es nur Fernwirkungen größerer Beben außerhalb dieses Gebietes waren. Dann ist fast ganz Afrika erdbebenfrei, bis auf die Mittelmeerküsten und Ägypten. Die bebenreichen Gegenden dagegen sind meist, doch nicht ausschließlich, auch reich an Vulkanen. Die Westküsten beider Amerika, die ganz besetzt sind von den Riesenvulkanen der Anden, von Alaska hin bis zum Feuerlande, sind auch von Beben besonders häufig heimgesucht. In Mittelamerika gibt es ein Gebiet, wo fast beständig der Boden in Bewegung ist, so daß die Eingeborenen es die »Hängematte« genannt haben. Dagegen ist die atlantische Küste Amerikas erdbeben- und vulkanarm, mit Ausnahme der Umgebungen des Alleghani-Gebirges, das freilich nicht vulkanisch ist.
Es lag hier natürlich nahe, an einen unmittelbaren Zusammenhang der Erdbeben mit den Vulkanerscheinungen zu denken. Beim Ausbruch eines Vulkans wird ja fast immer die Umgebung mehr oder weniger stark erschüttert, wie das bei den begleitenden explosiven Erscheinungen ja auch gar nicht anders möglich ist. Aber man hat diese Ansicht doch bald dahin abändern müssen, daß die Vulkanausbrüche keineswegs die allgemeine Ursache der Erdbeben sein können, sondern daß beide Erscheinungen, die des Vulkanismus und der Erdbeben, eine tiefer liegende gemeinsame Ursache haben müssen. Wir haben vulkanische Beben von solchen streng zu trennen, die von keinerlei vulkanischen Erscheinungen verursacht oder begleitet werden; man nennt sie »tektonische«, d. h. erdbildnerische Beben. Die letzteren sind immer die ausgedehntesten, und zu ihrer Auslösung ist deshalb eine ganz wesentlich größere Kraft erforderlich als zu den durch die Vulkanausbrüche verursachten Erderschütterungen, die wohl in der nächsten Umgebung der vulkanischen Explosionen an Heftigkeit jene tektonischen Erdstöße übertreffen können, aber dann stets auf diese beschränkt bleiben. Beim Ausbruch des Santa Maria in Guatemala im Oktober 1902 war das Beben während eines Tages in »ein einziges fortwährendes Schütteln verwandelt, das ein Gefühl erweckte wie an Bord eines Schiffes bei hoher See«. (Siehe das Buch des Verfassers »Von Saint Pierre bis Karlsbad«, Studien über die Entwicklungsgeschichte der Vulkane. Zweite Auflage. Berlin 1904. S. 45.) Aber schon wenige hundert Kilometer vom Zentrum dieses schrecklichen Ausbruchs entfernt, war von diesem Beben nichts mehr zu verspüren. Bei der furchtbaren Katastrophe von Saint Pierre waren die Bebenerscheinungen von untergeordneter Bedeutung. Wenn trotzdem die äußerst feinfühligen seismographischen Instrumente Erderschütterungen von mikroskopischer Größe selbst noch in Potsdam anzeigten, so hat dies seinen Grund in durchaus sekundären Wirkungen. Oft lösen die plötzlichen Schwankungen des Luftdrucks, die solche Explosionen hervorbringen, auch Erdbebenerscheinungen aus. Die Luft repräsentiert bekanntlich ein sehr großes Gewicht; gerade so groß ist ihr Druck auf die Erdschichten der Oberfläche, wie ein rings die Erde umflutendes Meer aus Quecksilber von dreiviertel Meter Tiefe. Man begreift, daß, wenn von diesem Meere über einer Strecke von Tausenden von Quadratmeilen auch nur die Höhe eines Zentimeters nach anderen Orten abfließt, die Erde unter dem verminderten Druck aufzuatmen, sich zu dehnen strebt. Man beobachtet es ja selbst in Steinbrüchen, daß die Schichten, nachdem sie von oberen Lagen befreit wurden, sich emporblähten, Falten bildeten, wie wir sie im großen in den Gebirgen antreffen. In diesem Sinne existiert also doch der seit alters her behauptete, inzwischen stark angezweifelte Zusammenhang des Barometerstandes mit den Erdbeben. Bekanntlich findet man auf alten Barometern unter der Stufe »Sturm« oft »Erdbeben« angezeigt. Bei sehr tiefem Barometerstande ist in der Tat eine Neigung zu Erdbeben physikalisch begründet.
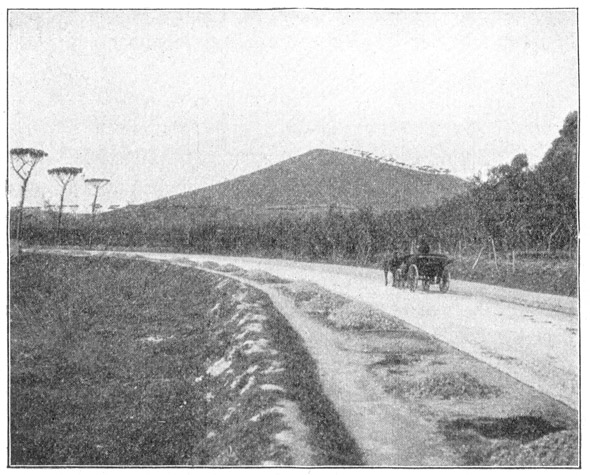
Der Monte Nuovo in den phlegräischen Feldern bei Neapel.
Ein weiteres sehr eindringliches Beispiel eines verheerenden und doch lokal sehr beschränkten Erdbebens ist das von Ischia vom Juli und August 1883. Nachdem einige Tage vorher leichte Erschütterungen auf dieser Insel wahrgenommen wurden, geschah mit großer Plötzlichkeit ein starker Stoß von unten nach oben, der am 28. Juli die Stadt Casamicciola in einen Trümmerhaufen verwandelte, unter dem mehr als tausend Menschen begraben wurden. Nachher folgten noch schwache Wellenbewegungen des Bodens, dann trat wieder völlige Ruhe ein. Nur ganz vereinzelt stieß das geheimnisvolle Etwas dort in der Tiefe im August und September noch einmal immer weniger heftig gegen die Erdrinde, und dann war es verschwunden. Ischia liegt vor dem Golf von Neapel als eine Fortsetzung der phlegräischen Felder, wo die vulkanische Tätigkeit fast noch unheimlicher haust wie unter dem Vesuv selbst. Denn sie pflegt hier gelegentlich an ganz unerwarteten Stellen auszubrechen. So stieg im Jahre 1538 mitten aus den blühenden Ufergestaden plötzlich unter Donner und Blitz und wilden Ausbrüchen glühender Asche ein neuer Vulkan auf, der nur diesen einen Ausbruch hatte und heute friedlich als »Neuer Berg« (Monte Nuovo) dasteht. Der Hauptgipfel Ischias besteht gleichfalls aus einem erloschenen Vulkan, dem Epomeo; der hatte 1302 seinen letzten Ausbruch, welcher den heute noch unfruchtbaren Lavastrom »del Arso« erzeugte. Seitdem aber war der Vulkan ruhig geblieben, bis er sich zuerst 1881 wieder durch ein Erdbeben in Erinnerung brachte, dem erst zwei Jahre später jener verhängnisvolle Stoß folgte. Der Vulkan selbst blieb allerdings dabei ruhig; nur die Schwefelquellen seiner Umgebung stoßen kräftiger und wurden heißer, die Fumarolen, aus der Erde strömende Dampfstrahlen, verdoppelten ihre Kraft, und es wird erzählt, daß an einigen Orten der Erdboden wenige Fuß unter der Oberfläche stark erhitzt gefunden wurde. Wir müssen annehmen, daß in nicht allzugroßer Tiefe die nur in Fesseln geschlagene aber durchaus nicht erstorbene vulkanische Tätigkeit sich durch eine Explosion zu befreien suchte, ohne jedoch sich diesmal bis zur Oberfläche durchringen zu können. Solche Beben sind schon häufig verhängnisvollen Ausbrüchen einige Jahre vorausgegangen, so namentlich in Pompeji, das bereits 16 Jahre vor der im Jahre 79 unserer Zeitrechnung stattgehabten berühmten Katastrophe durch ein Erdbeben teilweise zerstört wurde. Auch der Vesuv, der die Ursache beider Vorgänge war, mußte damals zu den erloschenen Vulkanen gezählt werden, wie heute der Epomeo auf Ischia. Es ist deshalb durchaus möglich, daß jene Insel einmal ganz plötzlich von einem ähnlichen Geschick ereilt wird wie Pompeji oder Martinique.
Weil jenes Beben von Casamicciola also auf zwar nicht bis ganz zur Oberfläche vorgedrungene vulkanische Tätigkeit zurückzuführen ist, blieb es auch auf die Insel durchaus beschränkt. Die Instrumente des Observatoriums am Vesuv hatten sich dabei überhaupt nicht geregt, und auch sonst ist in den umliegenden vulkanischen Gebieten keinerlei Wirkung beobachtet worden.
Es gibt nun eine Methode, nach der man mit einiger Wahrscheinlichkeit die Tiefe, in der die verhängnisvolle Stoßwirkung ausgeübt wird, bestimmen kann. Jeder auf einen elastischen Körper ausgeübte Stoß muß ihn in Schwingungen, in eine Wellenbewegung versetzen, wie die Luft durch den Schall, wie der Weltäther durch das Licht. Die Gesteine der Erdrinde sind aber auch elastisch, mehr oder weniger, je nach ihrer Art. Solche Wellenbewegung muß sich nun immer kugelförmig ausbreiten, und wenn deshalb ein Stoß auf die Erdrinde aus einer gewissen Tiefe ausgeübt wird, so muß er, wie es die beistehende Zeichnung veranschaulicht, auf der Oberfläche um so später eintreffen, je weiter der betreffende Ort von demjenigen abliegt, der gerade über dem in der Tiefe liegenden Stoßpunkte sich befindet, dem sogenannten Epizentrum, M, des Bebens. Ist der Stoß ursprünglich in senkrechter Richtung aus dem Punkte 0 im Erdinnern erfolgt, so wird er auch im Epizentrum noch senkrecht erscheinen, also etwa Gegenstände auf der Erdoberfläche auf die Höhe a b erheben, aber um so seitlicher wirken, je weiter der Beobachtungsort auf der Oberfläche vom Epizentrum entfernt ist. Zum Beispiel wird in der Richtung 0 B die Stoßwirkung senkrecht auf c d stattfinden, für 0 C aber auf e f und so fort. Die Vergleichungen der Zeit des Eintreffens und der Richtung der »Erdbebenwelle« geben also die Elemente her, welche die Lage des eigentlichen Stoßpunktes unter der Oberfläche zu ermitteln vermögen.
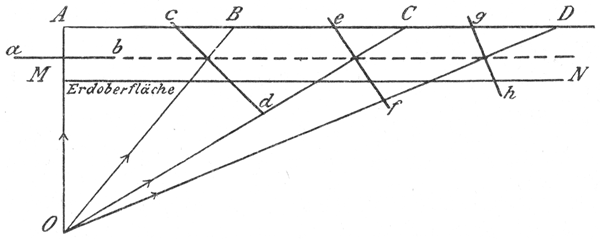
Während nun auf diese Weise für die stärksten Beben oft nur eine sehr geringe Tiefe des Ausgangspunktes gefunden wird, so zum Beispiel für das von Ischia sicher nicht mehr als 500 m, so steigen dagegen viele sehr ausgedehnte, aber oft durchaus nicht an sich bedeutende Beben aus vielen Kilometern Tiefe zu uns auf. Man hat bis zu 40 km gefunden. Welch eine ungeheure Kraft muß da gearbeitet haben, um aus solcher Tiefe herauf ganze Kontinente zum Erzittern zu bringen! Da ist nun unsere beängstigende Frage: Kann diese Kraft nicht auch einmal alles über den Haufen werfen, was wir erarbeitet und erdacht haben? Ist ein menschlicher Weltuntergang durch ein Erdbeben möglich?
Woher entspringen diese Kräfte? Sie können offenbar nicht irdischen Ursprungs sein, denn wir kennen keine aus den Beziehungen der Dinge auf der Oberfläche unseres Planeten resultierenden Gewalten, die auch nur annähernd solche Taten vollbringen könnten. Gegenüber den kosmischen Kräften aber sind die bei den stärksten Erdbeben beobachteten Bewegungen nur gering. Welche kosmischen Gewalten also greifen die Erde gelegentlich so unsanft an? Hemmungslos schwebt die Erde um die Sonne durch den leeren Raum, und wenn auch nach astronomischem Sprachgebrauch alle anderen Planeten ihre Bewegung »stören«, so kann dies doch nicht anders als in völlig stetiger Weise geschehen; plötzliche Hemmungen des himmlischen Uhrwerks aus sich selbst sind undenkbar. Aber wir haben bereits oben eine andere Wirkung kennen gelernt, der wir ja sogar die Möglichkeit zuschrieben, einen ganzen Weltkörper zu zersprengen: die Wärmeausstrahlung. Wenn auch jener Spannung zwischen den oberen und unteren Teilen des Erdkörpers durch Plastizität selbst der scheinbar härtesten Gesteinsschichten entgegengearbeitet wird, so muß doch schließlich die sich schneller abkühlende Haut dem Planetenkörper zu klein werden. Risse werden unvermeidlich, und solche Risse sieht man in der Tat sehr häufig bei Erdbeben entstehen: Der Erdboden öffnet sich plötzlich und verschlingt mit weitaufklaffendem Rachen, was ahnungslos sich hier erging. Steintrümmer und Erde kollern nach in das aufgerissene Grab von Hunderten. Mitten durch Ortschaften hindurch haben sich schon solche Spalten gebildet, oft von mehreren Metern Breite und meilenweiter Länge. An anderen Orten hat man dagegen wieder erhebliche Zusammenschiebungen des Erdreichs, Verkürzungen und Aufwerfungen, Drehungen des Erdbodens nach einem Beben konstatiert. Man sieht also, wie hier überall ungeheure Mächte an den Erdschollen schieben und zerren, um sie in eine neue Lage zu bringen, die dem möglichsten Ausgleich widerstreitender Naturgewalten besser entspricht. So kann die Oberfläche einer Tonschicht in viele Risse zerspringen, während das Innere seine Plastizität völlig bewahrt.
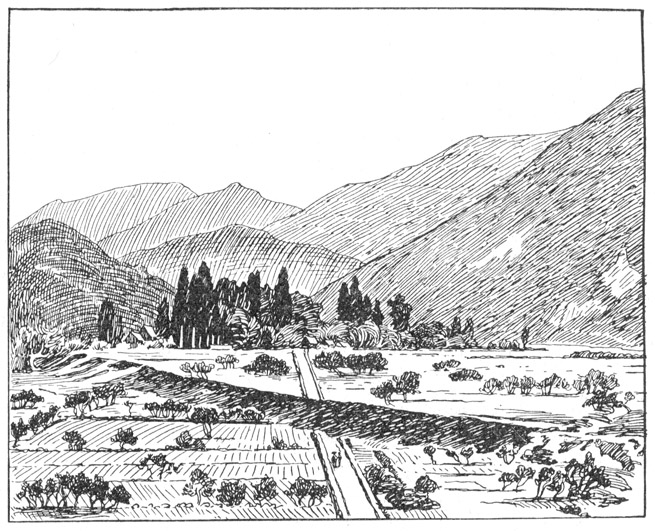
Erdspalte bei Midori entstanden beim großen japanischen Erdbeben von 1891.
Aber es tritt noch eine Reihe anderer Ursachen zu dem Abkühlungsprozeß, die Verschiebungen der Erdrinde erzeugen. Der ganze Erdkörper muß sich nicht nur, weil er Wärme ausstrahlt, verkleinern, sondern namentlich auch durch seine eigene Schwere. Durch dieses Zusammenpressen unter der eigenen Last seines Körpers wird viel der ausgestrahlten Wärme wieder ersetzt. Bei Sonnenkörpern ist sogar die Wärmeerzeugung durch Zusammenpressung bedeutender als die Ausstrahlung, wie ungeheuer groß auch diese gerade bei diesen Weltleuchten ist. Nachdem freilich die Materie eines Weltkörpers bereits stark zusammengedrückt ist, wie bei der Erde, wird die Wärmeerzeugung dadurch immer geringer. Aber unser Erdkörper ist ganz gewiß noch längst nicht auf dem Maximum der Dichte angelangt; er besitzt bekanntlich ungefähr im Durchschnitt die Dichtigkeit des Eisens. Platin ist beinahe dreimal dichter. Der Druck in einer Kugel nimmt nun aber nach dem Mittelpunkte hin zu; dieser wird also mehr zusammengepreßt als die Oberfläche, und infolge dieser Differenz muß ganz umgekehrt wie bei der Ausstrahlungswirkung dem Planeten seine Haut zu groß werden. Es müssen Aufwerfungen entstehen, Falten, wie die der Gebirge. Hier wird es nun vorkommen können, daß längs einer solchen Gebirgsfalte die Erdoberfläche nicht genügend folgen kann: Sie reißt ab, und es entsteht ein Abrutschgebiet, ein jäher Absturz nur auf der einen Seite eines Faltengebirges, das von der anderen Richtung her mit langsam ansteigenden Wellenlinien sich aus einer Ebene erhebt. Die Alpen sind ein Beispiel hierfür. Von Norden her beginnt ihre Erhebung nur ganz allmählich mit einer Reihe vorgelagerter Voralpenketten, nach der italienischen Seite hin aber fallen sie schroff ab zur Ebene des Po und weiter nach Westen hin bis ins Meer. Auch die Alpenabhänge nach der oberitalienischen Ebene hin umspülte einst das Meer. Wir begreifen es, daß, wo eine solche Scholle tief genug abstürzt, das Meer sich über diese ergießen muß, das ja die tiefsten Stellen der Erdoberfläche ausfüllt. Deshalb begegnen wir häufig solchen Steilküsten, hinter denen unmittelbar sich hohe Gebirgsmauern türmen. Die imposanteste ist die Pazifische Küste beider Amerika, hinter der sich die ungeheure Gebirgsrippe der Anden erhebt. Mit einigen Unterbrechungen umkreist sie die halbe Erde, von Alaska bis über den Südpol hinweg, denn es ist nach den neuesten Ergebnissen der Südpolarforschung kaum mehr zweifelhaft, daß das Viktorialand der Antarktis mit seinen beiden großen Vulkanen Erebus und Terror eine in allen Zügen verwandte und der gleichen Ursache entspringende Fortsetzung der Andenkette bildet.
Es gibt noch andere Ursachen, die eine langsame Verschiebung der Erdrinde notwendig machen. Eine davon ist die allmähliche Verlangsamung der Umdrehungsdauer des Erdkörpers um seine Achse. Wie wunderbar auch das himmlische Uhrwerk organisiert ist (wir werden uns im Laufe dieser Betrachtungen noch eingehender damit zu befassen haben), es arbeitet doch nicht ohne Hemmungen, die sich in den Jahrhunderttausenden bemerkbar machen. Es geht ihm in dieser Hinsicht nicht anders wie den von Menschenhand gebauten: Es verstaubt mit den Jahren. Denn auch im Weltall treibt sich verhältnismäßig sehr viel Staub herum, der beständig auf die Erde niederfällt und dabei ganz langsam, aber stetig, ihre Bewegungen hemmt. Wir sehen es auch an den anderen Planeten, daß sie um so schneller um ihre Achse schwingen, in einem je jüngeren Entwicklungsalter sie sich befinden. Nun muß, bei der Plastizität des Erdkörpers, seine Abplattung an den Polen immer im genauen Verhältnis zu der Schwungkraft stehen, die die Teile des Äquators vom Zentrum hinwegtreibt und dadurch die Abplattung hervorgerufen hat. Bei der notwendigen steten Abnahme der Umdrehungsgeschwindigkeit muß also die Erde langsam immer weniger abgeplattet, immer genauer kugelförmig werden, und es findet deshalb ein beständiger Schub von Erdmassen vom Äquator zu den Polen hin statt. Dieser Schub ist ganz gewiß nur sehr gering innerhalb menschlicher Zeitdimensionen, aber er ist durchaus von derselben Größenordnung wie derjenige, welcher durch die vorhin angegebenen Faktoren bewirkt wird, und beide wirken stetig. Auch durch diese langsame Wanderung der Äquatoranschwellung nach den Polen hin können deshalb Spannungen entstehen, die sich gelegentlich durch Erdbeben befreien. Eine andere, mit der Erdachse in Verbindung stehende Ursache der Bewegung von Erdschollen ist die erst seit etwa zwei Jahrzehnten bekannte Tatsache, daß die Pole langsam in spiraligen Windungen über die Erde hin wandern. Mit diesen Polschwankungen muß aber auch die ganze Wulst von drei Meilen Höhe am Äquator wandern. Ist der Betrag auch innerhalb der kurzen Zeit, in der wir ihn beobachten, sehr gering (der Endpunkt der Erdachse bewegte sich auf der Oberfläche bisher nur um wenige Zehner von Metern), so ist es doch nicht unmöglich, ja sogar wahrscheinlich, daß solche Schwankungen einstmals viel größer waren. Selbst heute schon sind Anzeichen vorhanden, daß die spiralige Bewegung des Erdachsenendes sich vergrößert.
Alle diese Ursachen packen offenbar sehr große Schollen der Erdoberfläche zugleich an, und deshalb zeigen sich auch gerade die hierdurch hervorgerufenen tektonischen Beben am ausgedehntesten. Es ist wohl verständlich, daß sich auf unserer Erdkugel Gebiete größerer allgemeiner Festigkeit von anderen auszeichneten, die leichter nachgiebig, dem Bruch eher ausgesetzt sind. Jeder Körper, jedes Wesen hat solche »Achillesferse«, an der er angreifbar ist. Auf der Erde entstanden Bruchlinien, wo die Schollen von kontinentaler Ausdehnung sich aneinander vorbei oder übereinander schoben, oder wo die eine Seite absank, die andere stehen blieb. Da, wie wir sahen, alle Ursachen, die solche Verschiebungen hervorbringen, stetig und sehr langsam wirken, und andererseits auch die Erdschollen nicht unendlich widerstandsfähig sind, so ist es offenbar nicht möglich, daß die Stauungen und Spannungen, die sich schließlich als Erdbeben ausgleichen, zu unbegrenzter Größe anwachsen. Auch die Katastrophen, die von Erdbeben zu befürchten sind, müssen ihr Maximum haben, wie die der Vorgänge in der Atmosphäre.
Es fragt sich nur, wie weit dieses Maximum über den Wirkungen liegen kann, die wir von dieser Seite her kennen. Diese Frage läßt sich aber nicht einmal durch einen rohen Überschlag beantworten. Daß diese Kräfte mit der Zeit ganz gewaltige Veränderungen der Erdoberfläche hervorbrachten, zeigen ja die Gebirge. Auf der Westseite der Anden ist eine Scholle, so groß wie der Pazifische Ozean, mehrere Kilometer tief abgerutscht. Ist dies einmal plötzlich geschehen, so war es ein Weltuntergang erschreckenster Art. Auf der anderen, der asiatischen Seite, sind gleichfalls alle Anzeichen dafür vorhanden, daß das Landgebiet dort tief in das Meer gesunken ist, und hier ist die Bewegung offenbar noch im Gange. Wir dürfen annehmen, daß der Meeresgrund des ganzen Pazifischen Ozeans einmal Landgebiet war, und daß also eine Scholle, größer als alle unsere Kontinente zusammen, sich so tief herabsenkte, daß das vorher an anderen Stellen vorhandene Meer sie überflutete. Vielleicht war vor jener vorausgesetzten Katastrophe alles, was heute Kontinent ist, Meer, und beide Horizonte der Lebensentwicklung, der der Luft und des Wassers, haben sich vertauscht. Alle Erdschichten, auf denen heute das Landleben sich tummelt, waren ja jedenfalls einmal Meeresgrund, bis auf wenige Inseln, die aus den Urmeeren aufragten, es sind »Sedimentgesteine«, aus verhärtetem Meeresschlamm bestehend, in dem wir versteint Meeresgeschöpfe eingebettet finden. Solch eine Vertauschung von Land und Meer mußte, wenn sie plötzlich eintrat, eine Vernichtung alles Lebens herbeiführen.
Fassen wir die Folgeerscheinungen, die die Bildung eines neuen Ozeans durch das Abrutschen einer kontinentalen Erdscholle heraufbeschwören müßte, zunächst einmal näher ins Auge, da wir daran Betrachtungen knüpfen können, die uns nach verschiedenen Seiten hin interessieren.
Die Gipfel der Andenkette steigen bis über 6000 m empor, und nahe an ihrem Absturz liegt der Meeresgrund noch tiefer unter der Fläche des Ozeans als jene gewaltigste Gebirgsrippe der Erde sich über ihn erhebt. Die Höhe des Abrutsches betrug also 10 km und noch darüber. Nun zeigt es sich, daß das Erdreich durchschnittlich immer um einen Grad wärmer wird, wenn wir um 30 m tiefer unter die Erdoberfläche hinabsteigen. Man nennt diesen in den verschiedenen Örtlichkeiten etwas schwankenden Wert von 30 m die geothermische Tiefenstufe. Bei einer Tiefe von 10 km erhalten wir also eine Temperaturerhöhung von etwa 300 Grad. Bei diesem Wärmegrade beginnen schon eine Reihe von Metallen wenigstens weich zu werden. Setzen wir nun den Fall, eine Erdscholle rutschte plötzlich um diesen Betrag ab, so würde das unten freigelegte Erdreich außerordentlich plastisch sein und den gewaltigen Drucken, die bei solchen Vorgängen kontinentale Schollen bewegen, nicht mehr widerstehen können. Es würde aus der Spalte hervorquellen und schließlich jedenfalls an einigen Stellen den noch tieferliegenden feuerflüssigen Stoffen, dem sogenannten » Magma«, den Weg nach oben freimachen. Das bedeutet aber nichts anderes, als daß auf diesen Spalten, diesen »Bruchlinien«, sich Vulkane aufsetzen müssen. Das ist nun in Wirklichkeit geschehen. Längs der ganzen Andenkette, von den nordpolaren Gebieten bis zum Südpol, haben sich auf die Gebirgsfalten, die an sich nicht vulkanisch sind, Feuerberge von gigantischen Dimensionen gesetzt, deren Höhenzahlen zwar ihre Bedeutung als Vulkane eben deshalb nicht richtig beurteilen lassen, weil sie auf dem gewaltigen Sockel der Andenkette hervorgewachsen sind. So ist z. B. als Vulkan der Ätna mit seinen 3300 m viel bedeutender als fast alle Andenvulkane, die Höhen bis über 6000 m erreichen, von denen aber oft 4000 m als nichtvulkanischer Unterbau abzuziehen sind, während der Ätna sich vom Meere ab aus seinen eigenen Produkten aufgebaut hat. Eine Folge jener Bildung der Vulkane über Spalten ist ihre reihenweise Anordnung, die nicht nur bei den Andenvulkanen, sondern in allen größeren Vulkangebieten deutlich hervortritt. Überall müssen also hier, unserer Voraussetzung entsprechend, Bruchlinien vorhanden gewesen sein, die das aus der Rißwunde hervorströmende Magma wie das Blut aus einem lebenden Körper wieder zu verstopfen trachtet. Rings um den Großen Ozean herum steht ein ungeheurer Kranz von Feuerbergen, und danach ist also, wie wir es schon vorhin vermuteten, dieses ganze Meeresbecken eine niedergegangene Erdscholle.
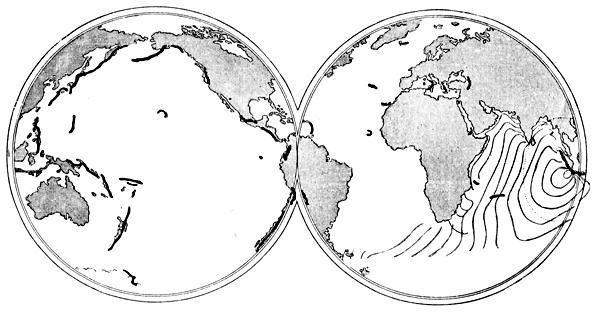
Erdansicht mit den Vulkanreihen. Die um einen Punkt des Indischen Ozeans gruppierten vollen Linien geben den Ort der Flutwelle von Stunde zu Stunde an, welche sich beim Ausbruch des Krakatoa ausbreitete. Das letzte, an der Südspitze Amerikas befindliche Kurvenstück besagt demnach, daß die Flutwelle dort bereits 17 Stunden nach dem Ausbruch noch mit merklicher Stärke ankam. Die den Ausbruchsort umschließende feinpunktierte Linie bezeichnet das Gebiet, über welches sich die Schallphänomene des Ausbruchs verbreiteten.
Wir verstehen nun auch den Zusammenhang zwischen den Vulkanerscheinungen und den Erdbeben. Letztere sind als tektonische, weit ausgedehnte Beben die primären Erscheinungen. Noch immer rütteln und schieben die geheimnisvollen Mächte an den Schollen, wo die Erdrinde früher schon einmal aufgerissen war. Gelegentlich reißt eine alte Wunde wieder auf. Bei den in der Tiefe vor sich gehenden Verschiebungen können auch plötzliche Druckverminderungen eintreten, durch die vorher fest zusammengepreßt gehaltenes Erdreich wieder flüssig, ja vielleicht sogar gasförmig wird, und gewaltige vulkanische Explosionen sind die Folge davon. Wir sehen also, daß die Vulkanerscheinungen nur immer Folgen, nicht die Ursachen jener weitverbreiteten Beben sein können, während man noch vor wenigen Jahrzehnten meist das Umgekehrte glaubte und also jedes Erdbeben für eine vulkanische Folgeerscheinung hielt, indem die Vulkanherde unterirdisch gedacht wurden, wo an der Oberfläche keine Vulkanausbrüche die Beben begleiteten. Unsere neue Anschauung erklärt es auch, daß die tektonischen Beben wohl vorzugsweise in vulkanischen Gebieten auftreten, ohne jedoch völlig auf diese beschränkt zu sein. Da, wo die Bruchlinien sich bildeten, greifen eben die Kräfte an, die die Schollen verschieben und dadurch die Erdbeben verursachen; aber gelegentlich kann deshalb auch die ganze Scholle in Bewegung geraten. Man versteht auch, daß in bestimmten Gebieten Beben jahrelang sich unausgesetzt wiederholen können, wo eine Scholle sich mehr und mehr befreit und den auf sie wirkenden Kräften nun schrittweise nachgibt. Am berühmtesten oder vielmehr berüchtigsten ist in dieser Hinsicht das Beben der griechischen Provinz Phokis geworden, wo drei Jahre hindurch, von 1870 bis 1873, die Erde fast fortwährend bebte, von unterirdischem Donner und Felsstürzen begleitet. Es gab Tage, wo überschläglich 29 000 Einzelstöße erfolgt sind, d. h. alle 3 Sekunden einer. Dabei wechselten sehr heftige, verwüstende Stöße ganz unregelmäßig mit unbedeutenderen ab. Die unglückliche, ohnedies arme Bevölkerung jenes Gebietes wurde dadurch in so nervenzerrüttenden, anhaltenden Schrecken versetzt, daß Wahnsinn und Fallsucht epidemisch wurden. Dann hörte, so wie sie gekommen war, die Erscheinung auf. Abgesehen davon, daß dort sich keine Vulkane befinden, hat man von letzteren kein Beispiel, das solche anhaltenden und unregelmäßig auftretenden Erschütterungen erklären könnte. In jüngster Zeit, Winter und Frühjahr 1903, bebte es, wie auch schon früher einmal, fast beständig, wenn auch nicht stark, im Vogtlande, also in der Umgebung der Spalte, auf der sich die Thermen des Erzgebirges als Nachklänge früher recht bedeutender Vulkanerscheinungen befinden. An diesen Thermen selber geschahen dagegen keine Veränderungen, die auf unterirdisch neu erwachte Vulkantätigkeit hätten schließen lassen. Hier rüttelten die erdbildnerischen Gewalten an einer ungeheuren Scholle, die uns sogar mit den Antillen verbindet. Hierüber muß ich den Leser bitten, sich eventuell näher in meinem bereits Seite 27 erwähnten Buche zu orientieren.
Bei dem bloßen Herausquellen der Lava aus den aufbrechenden Spalten oder den sich aufbauenden Vulkanschloten und damit verbundenen gelegentlichen Explosionen hat es nun aber noch keineswegs sein Bewenden, wenn ein so tiefer Abrutsch stattfindet. Das hinzuströmende Meer beginnt einen urgewaltigen Kampf mit den aus der Tiefe brechenden Mächten des Feuers. Längs der ganzen Spalte werden Katastrophen wie die von Krakatoa zur Tagesordnung. Die Sonne wird verfinstert. Ungeheure Wasser- und Staubmassen werden beständig in die Atmosphäre befördert. Bei jenem einzigen Vulkan, der in einer ähnlichen Weise wie es hier vorausgesetzt wird, ins Meer versank, war die Nachwirkung der in die Luft beförderten vulkanischen Produkte jahrelang zu verfolgen. Hier aber handelt es sich um Vorgänge längs einer die Erde halb umspannenden Senkungsfläche, auf der gewiß Jahrtausende lang die vulkanische Tätigkeit in unvorstellbar gewaltiger Weise gewütet haben muß. Daß dabei in den zuströmenden Meeresteilen alles Leben getötet werden mußte, ist unzweifelhaft, und wenn auch wohl nicht über alle vorhandenen Ländergebiete direkt von den Vulkanschlöten, die vielleicht zu Tausenden hier zugleich aufbrachen, Verderben gebracht wurde, so mußten doch notwendig die nachfolgenden meteorologischen Verhältnisse verhängnisvoll werden. Der Feuchtigkeitsgehalt der Luft stieg und vergrößerte die Niederschlagsmengen um so mehr, als die das Sonnenlicht abhaltenden Staubmassen die zur Erde kommende Wärmemenge wesentlich verringerte. Je wärmer die Luft ist, desto mehr Wasser kann sie bekanntlich in Dampfform festhalten. Die vermehrten Niederschläge, der beständig bewölkte Himmel hielt immer noch mehr die Sonnenstrahlung ab. Der ganze Kreislauf des Wassers in der Atmosphäre geriet in eine absteigende Bewegung. Eine völlige Veränderung des allgemeinen Klimas der Erde mußte eintreten. Nach sintflutartigen Regen blieb es beständig feucht und kalt. Vom Hochgebirge wälzten sich die Gletscher tiefer und tiefer in die Täler herab, denn die Sonne konnte nicht mehr die oben unablässig niedergehenden Schneemassen auflösen, und so wurden selbst Gebiete, wo sonst während des Sommers noch eine Temperatur über Null geherrscht haben würde, von den Eisströmen dauernd überflutet, ebenso wie die Gletscherzungen auch heute in den Alpen wesentlich unter die Grenze des ewigen Schnees herabreichen. Schließlich wurde auch ein großer Teil der Ebenen am Fuße der Gebirge von einer immer höher sich türmenden Eisdecke überzogen. Die allgemeine Eiszeit brach herein, deren Spuren wir in der Tat überall auf der Erde verfolgen können. Es ist namentlich das Verdienst des Weltreisenden Professors Hans Meyer in Leipzig, sowohl am Kilimandscharo wie erst ganz neuerdings an den Kordilleren Südamerikas nachgewiesen zu haben, daß auch überall in den Tropen zu jener Zeit die Gletscher wesentlich tiefer herabreichten als heute. Den hier erörterten Zusammenhang zwischen jener ungewöhnlichen Vulkantätigkeit und dem Hereinbrechen der Eiszeit haben die Brüder Sarasin in Basel zuerst vermutet.
In unserer Frage läßt sich an der Hand strenger Forschung folgendes nachweisen. Die Andenkette hat sich in ihrer ganzen Länge nach geologischem Maß, das freilich nach Jahrhunderttausenden und Jahrmillionen zählt, gleichzeitig gebildet, und ihre Vulkane sind die Folgen dieser großartigsten Gebirgsbildung des Erdballs gewesen. Um diese Zeit herrschte fast über die ganze Erde hin eine nahezu tropische Temperatur, die aber sehr bald nachher einer starken allgemeinen Abkühlung weichen mußte. Penck, der gegenwärtig bedeutendste Forscher auf betreffendem Gebiete, konstatierte, daß es mindestens vier größere Eiszeiten gegeben hat, zwischen denen wärmere Zeitperioden eingeschlossen waren. Es scheint aber, daß sich diese großen Eiszeitperioden noch in eine größere Zahl kleinerer Zeitabschnitte gliedern, in denen geringere allgemeine Temperaturschwankungen stattfanden. Man sieht, wie unruhige Zeiten die Erde hinter sich hat, die namentlich das Luftmeer in beständiger Aufregung erhalten mußten. Wie lange diese Zeit währte, läßt sich nur sehr annähernd angeben. Man hat berechnet, daß ihr Beginn etwa eine halbe Million Jahre zurückliegen mag. Die letzte kleinere Eiszeitperiode aber liegt vielleicht nur 10 bis 20 Jahrtausende hinter uns, und wir leben heute wahrscheinlich nur in einer jener »Interglazialperioden«, wie sie auch vor der letzten allgemeinen Vergletscherung unserer Heimatgebiete herrschte. Mitten durch diese Eiszeiten hindurch ziehen sich Spuren eines sich aus tierischem Ursprung entwickelnden Menschengeschlechtes. Die Sintflutsagen, die uns aus der Vorzeit überliefert sind, mögen mit den oben geschilderten Vorgängen in Verbindung stehen. Die persische Sage deutet fast unverkennbar auf vulkanische Erscheinungen hin, die den Beginn der großen Flut einleiteten. Man möge mir erlauben, eine bezügliche Stelle aus meinem Buche »Die Entstehung der Erde« (V. Aufl. 1904, S. 367 ff.) zu wiederholen, das auch über jene vorzeitlichen Temperaturschwankungen Ausführliches enthält. Die persische Sage schildert die große Flut wie folgt: »Von Süden her stieg ein großer feuriger Drache auf. Alles wurde durch ihn verwüstet. Der Tag verwandelte sich in Nacht. Die Sterne schwanden. Der Tierkreis war von dem ungeheuren Schweife bedeckt, nur Sonne und Mond konnte man am Himmel bemerken. Siedend heißes Wasser fiel herab und versengte die Bäume bis zur Wurzel. Unter häufigen Blitzen fielen Regentropfen von der Größe eines Menschenkopfes. Das Wasser bedeckte die Erde höher als die Länge eines Menschen beträgt. Endlich, nachdem der Kampf des Drachen 90 Tage und 90 Nächte gewährt hatte, wurde der Feind der Erde vernichtet. Es erhob sich ein gewaltiger Sturm; das Wasser verlief, der Drache versank in die Tiefe der Erde.« Dieser Drache war nach der Ansicht des berühmten Wiener Geologen Sneß ein ausbrechender Vulkan, der seine Feuergarbe wie einen langen Schweif über den Himmel breitete. Alle anderen in der Sage geschilderten Erscheinungen entsprechen dann durchaus denen nach einem großen Vulkanausbruch.
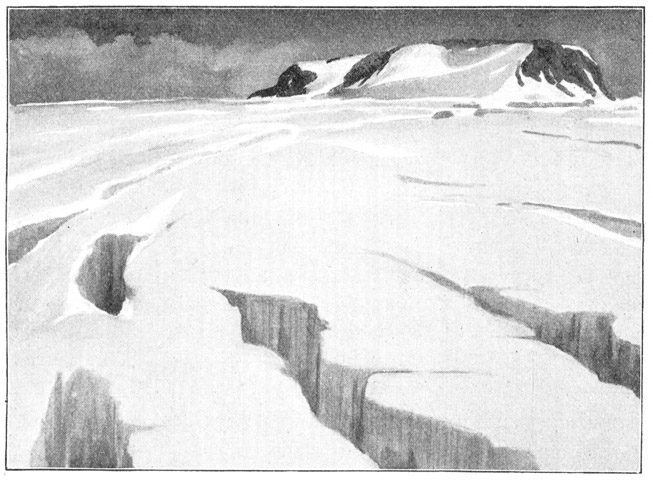
Grönländisches Inlandeis als Bild der Eiszeit.
Auf der einen Seite haben wir jetzt also dargetan, daß nach der Aufspaltung und Abrutschung einer kontinentalen Erdscholle reihenweise Vulkanausbrüche stattfinden müssen, denen Sintfluten und Eiszeiten folgen. Auf der anderen Seite sehen wir vor Augen die Reihenvulkane der Anden, dicht an dem ungeheuren Absturz der Pazifischen Küste, und weisen nach, daß bald nach der Entstehung dieser Vulkanreihen Eiszeiten eintraten; und die Sintflutsagen ergänzen noch weiter das Bild dieser unruhigen Entwicklungsperiode unseres Planeten. Bei dem Ausbruch des Krakatoa haben wir die Folgen des Zusammenbruches eines Vulkans unter den Meeresspiegel in allen diesen Richtungen im kleinen beobachtet. Wir dürfen, indem wir alles dies zusammenhalten, deshalb kaum mehr daran zweifeln, daß der Zusammenhang der Dinge wirklich so war, wie wir es hier hypothetisch annahmen, daß also der Große Ozean in seinem ganzen Umfange durch Abtrennen und Abrutschen seines gegenwärtigen Grundes entstand, der vordem ein ungeheurer Kontinent war.
War dies ein Weltuntergang in unserem Sinne? Wenn der Absturz plötzlich geschah, so war es gewiß die schrecklichste und umfassendste Katastrophe, die die Erde jemals gesehen hat, seit Leben auf ihr atmete. Diese Frage ist nun freilich schwer zu beantworten. Aber wir können doch folgendes sagen. Wenn der Abrutsch auf der pazifischen Seite nur ganz allmählich stattgefunden hätte, so wären so ungeheure eruptivvulkanische Erscheinungen nicht erklärlich, wie sie zu Ende jener » Tertiärzeit« längs der ganzen Andenkette eintraten, und von denen die heute dort noch beobachteten nur ganz schwache Nachwirkungen sind. Wäre das Küstengebiet dort etwa so langsam niedergesunken, wie wir es gegenwärtig noch an einigen Küsten wahrnehmen, wozu Jahrhunderte gehören, um diese Bewegungen sicher nachzuweisen, so hätte sich im Innern der Erde alles ebenso langsam danach einrichten können, und nur ganz vereinzelt wäre es einmal zu einem Ausbruch gekommen. Wir haben allerdings gesehen, daß Widerstände gegen jene erdverschiebenden Gewalten vorhanden sind, sonst könnten ja die plötzlichen Zuckungen der Erdbeben nicht stattfinden. Aber wir haben uns auch sagen müssen, daß die Stauungen, die infolge dieser Widerstände eintreten, nicht allzugroß werden können, weil eben die Erdrinde für große, aber langsam angreifende Kräfte sich als plastisch, nachgiebig, erweist. Alle diese Erwägungen machen es uns wahrscheinlich, wie sehr wir uns auch dagegen zu sträuben versuchen mögen, daß doch eine plötzliche Gewalt hier eingegriffen haben muß.
Wir sind genötigt, kosmische Kräfte hinzuzuziehen. Während selbst sehr spröde Massen sich bei langsamen Wirkungen als nachgiebig erwiesen, zerreißen dagegen nachgiebige Massen bei plötzlicher Einwirkung. Unsere vorangeschickten Betrachtungen drängen also zu der Überzeugung hin, daß ein plötzlicher starker Stoß einstmals die Erdoberfläche von Pol zu Pol aufgespaltet haben muß, und da erinnern wir uns an das stets vor uns am Himmel stehende Beispiel der Strahlensysteme des Mondes, zu denen wir die Stoßpunkte als mächtige Vertiefungen in der Rinde des Mondes deutlich vor Augen sehen. Es darf nun zwar nicht unerwähnt bleiben, daß es eine ganze Reihe von namhaften Forschern gibt, die auch diese Strahlensysteme mit allen äußerlich unseren Vulkanen ähnlichen Bildungen auf dem Monde aus wirklichen vulkanischen Erscheinungen, also von unten her wirkenden Kräften, erklären zu können glauben. Auch der Mond besitzt in seinen »Mareebenen« im Verhältnis zu seiner Größe ebenso gewaltige Einbruchgebiete, wie sie der Große Ozean aus unserem Planeten darstellt. Ich meine aber, daß ich an dieser Stelle gar nicht tiefer auf diesen Widerstreit der Meinungen einzugehen brauche, denn es ist für unsere Betrachtungen so ziemlich gleichgültig, ob die Gewalten, die einen Weltkörper zersprengen können, so wie wir es am Monde und auch bei der Andenkette an unserer Erde selbst sehen, aus dem Innern dieser Weltkörper kommen konnten oder von draußen, dem Kosmos her. Was wir bisher hierüber sagten, machte die erstere Annahme jedenfalls unwahrscheinlich. Wir wollen uns nun den Möglichkeiten zuwenden, die vom Kosmos her solche Katastrophen verursachen können.

Der große Komet von 1843.
In dieser Hinsicht sind von jeher die Kometen gefürchtet worden, und das ist wohl verständlich. Die Sterne schienen unwandelbar an eine feste Himmelsdecke geheftet, die Sonne zog alljährlich in ehernen Bahnen ihre Kreise; ihren Weg, wie den des Mondes und der Planeten hatte man schon frühzeitig vorauszuberechnen gelernt, und um keines Haares Breite wichen sie jemals von ihren vorausbestimmten Wegen ab. Diese konnten offenbar mit der Erde niemals zusammentreffen, es sei denn, daß das ganze Firmament und alle Ordnung der Welt aus den Fugen ginge. Aber die Kometen kamen und gingen, man wußte nicht, woher und wohin. Ihre Wege unter den Sternen waren scheinbar ohne Gesetz und Regel, und oft wuchsen sie im Laufe weniger Tage so mächtig an, daß man wohl glauben konnte, sie seien im Begriff, auf die Erde niederzustürzen. Dabei war ihre Gestalt so ungewöhnlich, daß sie an sich schon Schrecken erregen konnte, und ihr Schweif, oft von Horizont zu Horizont sich über den ganzen Himmel breitend, hatte etwas wesenlos Gespenstisches, denn wie sie auch hell leuchteten, durch ihren Leib hindurch schienen doch alle Sterne wie durch ein Nichts, wie durch einen »Astralleib« würde man mit den modernen Spiritisten sagen. Kein Wunder also, daß zu den Zeiten der Sterndeuterei allein schon das Erscheinen eines Kometen Unglück nach den verschiedensten Richtungen hin bedeutete, Krieg, den Ausbruch von Epidemien, Wassers- und Hungersnot, den Tod großer Männer, und was alles noch. Solange man vom Wesen der Kometen gar nichts wußte, konnte man natürlich auch alles Schreckliche und Gewalttätige von ihnen für möglich halten. Erst vor etwa zweihundert Jahren, als Newton die Gesetze der Bewegungen aller anderen Himmelskörper aus dem einen Prinzip der gegenseitigen Anziehung aller Masse abgeleitet hatte, gelang es auch nachzuweisen, daß die Kometen diesen selben Gesetzen gehorchten, also in Kegelschnitten um die Sonne laufen. Während man bis dahin, einige vorläuferische Ansichten ausgenommen, die Kometen für »sublunaren« Ursprungs hielt, etwa für entzündbare Ausdünstungen der Erde, die Vulkanen entsteigen mochten, so war nun ihre kosmische Herkunft und auch ihre materielle Natur erwiesen. Eine ganze Reihe von Befürchtungen mußte damit fortfallen. Man konnte ihre Bahnen im Raume berechnen und fand dabei, daß sie immer viel weiter als der Mond von uns entfernt bleiben, wenn sie sich allerdings uns auch mehr zu nähern pflegen als irgend ein Planet. Daß sie aus solchen Entfernungen keine Wirkung auf unsere irdische Natur auszuüben vermochten, ließ sich wohl einsehen.
Aber es trat nun eine andere Befürchtung an die Stelle der verscheuchten, und diese konnte sich sogar auf eine wissenschaftliche Begründung stützen. Man fand, daß die Bahnen der Kometen die der Planeten, also auch der Erde, in allen erdenklichen Richtungen kreuzten, während doch die Bahnen aller anderen bis dahin bekannten Körper des Sonnensystems in so weiten Abständen ineinandergelegt waren, daß sie unter keinen Umständen zusammenkommen konnten. (Auf Ausnahmen unter der Schar von kleinen Planeten kommen wir zurück.) Von den Kometenbahnen aber kam eine ganze Anzahl mehreren Planetenbahnen recht bedenklich nahe, ja, einige davon kreuzten sich sogar fast genau, so daß, wenn einmal beide Himmelskörper, Planet und Komet, in ihrem Laufe zugleich in diesem Kreuzungspunkte einträfen, es unrettbar ein Renkontre geben müßte, dessen Folgen doch unter Umständen recht bedenklich werden könnten. So hat die Erdbahn an der Stelle, die unser Planet alljährlich Ende November passiert, einen Punkt mit der Bahn des Bielaschen Kometen gemein. Letzterer gehört zu den jetzt anderthalb Dutzend sogenannten periodischen Kometen, die, abweichend von der nach vielen Tausenden zählenden Schar der unerwartet durch ihre Sonnennähe gehenden, in bekannten kurzen Zwischenräumen wiederkehren, der Bielasche immer nach 6½ Jahren. Unsere Zeichnung veranschaulicht schematisch diese Lageverhältnisse. Die Erdbahn a b c befindet sich auf der Ebene des Papiers. Über derselben erhebt sich die Bahn des Bielaschen Kometen a e g, und beide haben also den Punkt a gemein. Gleichzeitig ist noch die Bahn eines anderen periodischen Kometen, des Enckeschen, bei d e f eingezeichnet. Diese hat ihrerseits mit der Bahn des Bielaschen Kometen den Punkt e gemein, wo also diese beiden Gestirne einmal zusammentreffen könnten. Innerhalb je eines seiner Umläufe von 6½ Jahren kreuzt der Bielasche Komet also immer einmal die Erdbahn.
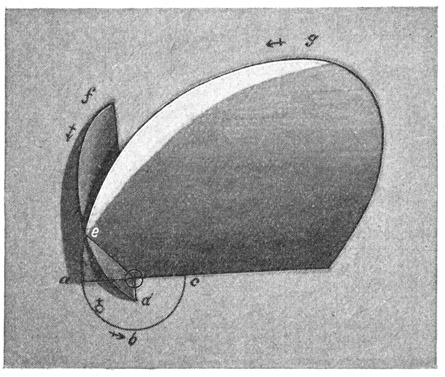
Bahnen der Erde, a b c, des Bielaschen Kometen a e g und des Enckeschen Kometen d e f.
Geschähe dies Ende November, so befände sich also auch die Erde in diesem Punkte, und der Zusammenstoß wäre unvermeidlich. Besteht nun der Komet aus größeren festen Massen, so könnten diese wohl leicht bei ihrem Niederstürzen mit einer relativen Geschwindigkeit von 10 oder mehr Kilometern in einer Sekunde die irdische Natur in eine so große lang anhaltende Unordnung bringen, daß man eine solche Katastrophe einen Weltuntergang nennen müßte. Man stelle sich solch ein Bombardement mit kilometergroßen Felsblöcken vor, die durch die Atmosphäre schlagen, indem sie die Luft und sich selbst durch die Reibung zur Gluthitze bringen und glühende Wirbelstürme mit rasender Geschwindigkeit alles vernichtend über die Oberfläche fegen lassen. Ins Meer stürzend würden solche Weltkörperbomben eine gewaltige Flutwelle erzeugen, die über alle Kontinente Sintfluten ergießen müßte, denen nichts zu entrinnen vermöchte. Oder wenn die feste Erdrinde von solchen kosmischen Projektilen getroffen würde, so müßte die entstehende Hitze beim Aufprall das Erdreich in seiner unmittelbaren Umgebung zum Schmelzen bringen, ein ungeheures Loch eingrabend bis zum glutflüssigen Innern: ein Vulkan mit kilometergroßem Auswurfschlunde wäre entstanden. Die Erschütterung der Erdrinde, die einem so plötzlichen Stoß nicht nachzugeben vermag, würde sie in Spalten zerreißen, die sich um den neuen Krater radial gruppieren, ganz so wie wir es vorhin am Monde vorhanden gesehen haben, und längs dieser Spalten würden sich nun noch ganze Reihen weiterer Vulkane auftun. Wir hätten eben die Katastrophe vor uns, von der uns die Annalen der Erdgeschichte aus ihrer Tertiärzeit zu erzählen scheinen.
Unsere Fragestellung spitzt sich immer kritischer zu: Daß ein Komet mit der Erde zusammenstoßen kann, ist unzweifelhaft, ja wir werden gleich sehen, daß solch ein Zusammenstoß vor unseren Augen vor gar nicht langer Zeit wirklich stattgefunden hat. Mit ebenso mathematischer Sicherheit kann man die ungeheure Geschwindigkeit in jedem besonderen Falle angeben, mit der die beiden Massen zusammenstoßen müßten. Es fragt sich also nur noch, ob die Kometen genügend große feste Körper in sich bergen, die solche allgemein verwüstenden Wirkungen hervorbringen können.
Diese Frage ist nicht so leicht zu erledigen. Das bloße Aussehen vieler Kometen, nach dem man freilich niemals urteilen soll, ist ja wahrlich gewaltig genug, so daß man bei einem Zusammenstoß das allerschlimmste für möglich erklären müßte. Aber den ganzen ungeheuren Schweif müssen wir doch zunächst einmal abrechnen. Wir können ganz genau bestimmen, daß in seinem Querschnitt allein der Durchmesser der Erde oft viele Male enthalten ist. Aber das Licht der Sterne leuchtet hindurch, als befände sich hier nichts im Raume. Wie sehr dagegen beispielsweise unsere Luft das Sternenlicht abschwächt, sehen wir daran, daß die Sterne mehr und mehr erblassen, je näher sie dem Horizonte rücken. Die Kometenschweife können nur aus einem so sehr verdünnten Stoffe bestehen, wie er etwa noch in unseren Röntgenröhren zurückbleiben mag, wo die sogenannten Kathodenstrahlen ihre Wunder entfalten, und von dieser Art oder der des Radiums wird auch das von den Kometenschweifen ausgehende Licht sein. Diese Schweife also können uns gewiß nichts anhaben. Aber sie gehen von einem Kerne aus, der mit seiner Umhüllung als »Kopf« des Kometen schon einen solideren, kompakteren Eindruck macht. Die meisten kleineren Kometen, also bei weitem ihre größere Zahl überhaupt, besitzt nur diesen Kopf, oder es entwickelt sich nur ein ganz kleines Schweifanhängsel, das bekanntlich immer von der Sonne abgewendet ist. Dieser Kopf sieht meist aus wie eine verschwommene kleine Lichtwolke, die auch bei den Kometen mit großen Schweifen, soweit unsere sicheren Beobachtungen reichen, niemals große Dimensionen annimmt. Zwar sind uns aus früheren Jahrhunderten Zeichnungen von Kometen mit großem runden Kopf überkommen, in dem Massen wild durcheinander gewirbelt sein sollen, aber wir wissen nicht, inwieweit die Furcht vor diesen Himmelswesen damals zu Übertreibungen führte. Meist, doch nicht immer, sieht man ungefähr in der Mitte des Kometenkopfes eine hellere Stelle, die zuweilen selbst wie ein scharfer, heller Stern erscheint, den Kern. Dieser macht oft durchaus den Eindruck einer festen Masse, die dann nicht so unbedeutend sein könnte. Von ihr gehen, zunächst immer der Sonne zugewandt, mächtige Dampfausströmungen aus, wenn der Komet sich dem Zentralherde unseres Systems mehr und mehr nähert, und erst wegen ihrer Gleichnamigkeit mit der elektrischen Strahlung der Sonne wird jener Dampf abgestoßen und fliegt in weitem Bogen hinter den Kern zurück, um so den Schweif zu bilden. Man hat durch das Spektroskop sogar die Art der ausströmenden Kometengase bestimmen können, es sind Kohlenwasserstoffe, wie sie unser Petroleum bilden, Natrium, das im Kochsalz enthalten ist, und in selteneren Fällen auch Eisendampf. Alle diese Gase hätten sich auf der jahrtausendelangen Reise, die den Kometen vorher durch die leeren Räume führte, ehe er der Sonne nahe kam, längst in den Weltraum verflüchtigen müssen, wenn der Komet nur aus ihnen bestände und nicht zugleich aus einem festen Kerne, dessen Anziehungskraft sie entweder als Atmosphäre oder in fester Form zusammenhielte. Die Kometenkerne müssen feste Massen enthalten.

Ausströmungen des großen Kometen von 1881. Nach einer Zeichnung von M. Thury.
Es fragt sich, wie groß diese wohl sein können. Es gibt nun eine Methode, durch die man das Gewicht aller Himmelskörper bestimmen kann, ebenso, als wenn man sie aus eine Wagschale legte. Man hat so die Erde selbst und die große Sonne, den Mars und die anderen Planeten abgewogen nach Kilogrammen. Die Methode ist absolut sicher. Man legte einen Kometen in diese Wagschale, aber die Zunge schlug nicht aus. Es war, als ob nichts darin läge. Freilich ist es mit solcher himmlischen Wagschale so wie mit den menschlichen. Man kann nicht verlangen, daß eine solche, die Wagenlasten abzuwägen bestimmt ist, auch als Goldwage brauchbar sei. Ein paar Millionen Tonnen wären für diese himmlische Abwägung auch noch ein Nichts. Für kosmische Dimensionen wird eben verschwindend, was für irdische ungeheuer ist. Die Gefährlichkeit der Kometen wird also hierdurch in unseren Augen nicht vermindert. Haben wir nicht noch andere Erfahrungen über sie?
Ich habe schon vorhin gesagt, daß wirklich einmal ein Komet mit uns zusammengestoßen ist. Das war am 27. November 1872. Was ist dabei geschehen? Ich habe den Zusammenstoß selbst mit eigenen Augen gesehen auf der Sternwarte zu Göttingen, wo ich damals Student im ersten Semester war. Zwar hatte ich keine Ahnung davon, was ich eigentlich sah. Es war aber das entzückendste Himmelsschauspiel, das ich in meinem Leben genossen habe: Ein großartiger Sternschnuppenfall. Es regnete Raketen vom Himmel herab, oft mehrere in einer Sekunde zogen sie lautlos in majestätischem Bogen vor den unwandelbaren Sternbildern dahin. Zeichnete man ihre Spuren in eine Karte ein, und verlängerte ihren Lauf nach rückwärts, so sah man, daß sie alle von ein und demselben Punkte aus der Unendlichkeit gekommen waren, der im Sternbilde der Andromeda lag. Klinkerfues, mein damaliger Direktor, gab mir an, auf welche Weise ich nach dieser Kenntnis des »Radiationspunktes«, woher die Sternschnuppen gekommen waren, ihre wirkliche Bahn um die Sonne berechnen könnte. Ich rechnete die ganze nächste Nacht, und als ich am Morgen die Bahn wirklich herausbekommen hatte, lief ich damit zum Direktor, der gerade seinen Kaffee trank. Er schmunzelte, als er meine Schlußzahlen sah, und sagte, daß ich ganz richtig gerechnet hätte, er habe die Aufgabe jetzt eben beim Morgenkaffee auch erledigt, und es sei der lang vermißte Bielasche Komet, der uns mit diesem himmlischen Feuerwerk überrascht habe. Auf der entgegengesetzten Seite, als von der er gekommen sei, müsse man ihn deshalb wohl jetzt noch sehen können. Diese Himmelsstelle aber war bei uns nicht sichtbar. Klinkerfues telegraphierte deshalb nach Madras, wo man wirklich an dem angegebenen Orte ein kometenartiges Objekt entdeckte. Man zweifelte lange an der Richtigkeit dieser Rechnungen und Schlußfolgerungen, die wegen gewisser Unvollkommenheiten des Beobachtungsmaterials auch wirklich nicht ganz stichhaltig waren. Als sich aber nach genau 13 Jahren, am 27. November 1885, dasselbe herrliche Schauspiel vorhergesagterweise wiederholte, war an jenen Schlußfolgerungen nicht mehr zu rütteln. Diese 13 Jahre sind nämlich gleich zwei Umläufen unseres Kometen, er mußte also um diese Zeit wieder an derselben Stelle sein wie damals, während er nach nur einem Umlauf von 6½ Jahren doch schon ein halbes Jahr vor der Erde die Kreuzungsstelle passieren mußte.
Dieser Bielasche Komet also bestand aus Sternschnuppen. Können Sternschnuppen uns gefährlich werden? Wir sind so glücklich, mit einem bestimmten Nein antworten zu können. Es läßt sich nachweisen, daß selbst recht helle Sternschnuppen nur wenige Gramme zu wiegen brauchen. Bei der kosmischen Geschwindigkeit, mit der sie in unsere Atmosphäre dringen, geraten sie durch Reibung an der Luft in eine so große Hitze, daß sie nicht nur weißglühend werden, sondern sofort verdampfen. Dieser Auflösungsprozeß beginnt oft schon in einer Höhe von 200 km über der Erdoberfläche, und selten hat sich eine Sternschnuppe auf mehr als 100 km uns nähern können, bevor sie nicht längst in ein kleines Dampfwölkchen verwandelt worden wäre, das sich im Luftmeere verliert. Es dürfte uns also ein Komet selbst mit einem dichten Hagel von Sternschnuppen beschießen, so würde er doch nicht einmal eine Fliege damit töten können. Gerade die ungeheure Geschwindigkeit, die die unserer Geschosse ja mindestens um das Zehnfache übertrifft, bietet uns vollkommenen Schutz vor ihnen, weil sie es ist, die dieses Verpuffen bewirkt. Unsere gute Erde ist gegen diese Gefahr durch ihren Luftmantel völlig geschützt, der sie undurchdringlicher umhüllt, wie die stärksten Stahlpanzer ein Kriegsfahrzeug.
Bestehen nun aber alle Kometen nur aus solchen Sternschnuppen? Wie können wir das erfahren? Nur noch ein anderer bekannter Komet kreuzt die Erdbahn und konnte deshalb in derselben Weise geprüft werden wie der Bielasche. In der Tat hat auch dieser zweite Komet uns glänzende Sternschnuppenschwärme geliefert, die der Leoniden, die bisher regelmäßig in der zweiten Novemberwoche auftraten und alle 33 bis 34 Jahre, der Umlaufszeit des zugehörigen Kometen, ganz besonders reich erschienen. Aber diese beiden Kometen waren kleine lichtschwache Kerlchen, kosmische Wölkchen mit kaum oder gar nicht zu erkennendem Kern. Außerdem wissen wir gar nicht, ob wir wirklich durch die eigentlichen Kernregionen in jenen Renkontrefällen gekommen sind. Es ist durchaus nicht anzunehmen, daß auch die Kerne der größeren Kometen nur etwa aus besonders dichten Sternschnuppenwolken beständen; es müssen sich notwendig größere feste Massen darin befinden.

Meteorit, beobachtet am 27. Juli 1894 in Kalifornien. Nach einem für die Lick-Sternwarte angefertigten Aquarell.
Bietet der Luftpanzer auch Schutz gegen das Eindringen solcher größeren Körper? Bis zu einem gewissen Grade, ja. Häufig genug sehen wir Feuerkugeln in unsere Atmosphäre eindringen, aus denen mit fürchterlichem Krachen zentnerschwere Steine glühend heiß zu uns herabfallen. Der Luftpanzer vermag wohl selbst noch bei diesen größeren Eindringlingen ihre ungeheure kosmische Geschwindigkeit zu vernichten; man sieht sie in ihrem Fluge innehalten, wenn sie selbst noch mehr als 100 km über uns stehen. Aber die durch die Reibung erzeugte Wärme vermag doch nur einen kleinen Teil der eingedrungenen Masse zu verdampfen, das übrige stürzt nun, als ob es erst in diesem »Hemmungspunkte« seinen Fall gegen die Erde beginnen würde, also mit keiner allzu ungewöhnlichen Geschwindigkeit, zu uns herab, doch meist in zersplittertem Zustande, denn der Körper, der aus dem etwa – 200 Grad kalten Weltraum plötzlich auf 1000 und mehr Grad erwärmt wurde, zersprang dadurch wie allzuschnell erhitztes Glas. Die Splitter kommen mit einer Schmelzkruste und eigentümlichen Schmelzlöchern überdeckt als Meteoriten herab. Aus älteren Zeiten wird mehrfach berichtet von großen Schäden, die solche Steinfälle und ganze Steinregen, die aus dem heiteren Himmel niedergingen, angerichtet haben. Ganze Dörfer sollen davon in Brand gesteckt und friedlich weidende Herden vernichtet worden sein. Zwar kennt man nur einen wirklich verbürgten Fall, daß ein Mensch durch ein solches kosmisches Geschoß getötet wurde. Aber jüngst (Dezember 1903) wäre beinahe ein Schiff auf offener See im Meerbusen von Biscaya durch einen Meteorstein zugrunde gegangen. Während eines Gewitters, das hier plötzlich, im Dezember, wo sie sehr selten sind, aufgezogen war, schlug zunächst der Blitz in die Masten, und einige Minuten später stürzte mit einem eigentümlich sausenden Ton eine große Masse in unmittelbarer Nähe des Schiffes ins Meer, daß es turmhoch aufspritzte. Alle diese vom Himmel gefallenen Steine haben eine eigentümliche Zusammensetzung, wenn sie auch keine Stoffe enthalten, die etwa nicht auch auf der Erde vorkämen. An dieser Zusammensetzung, auf die ich hier leider nicht näher eingehen kann, erkennt man deshalb auch den kosmischen Ursprung solcher Steine, wenn sie nicht vor unseren Augen aus dem Himmel herabfielen. Der größte unter diesen letzteren wiegt 325 kg; er ist am 12. März 1899 in Finnland niedergefallen, aber aufgefundene unzweifelhafte Meteorsteine sind an hundertmal schwerer. Solch ein niederstürzender Felsblock von 30–40 t Gewicht muß die Erdoberfläche schon bis auf weite Strecken gewaltig erschüttern, und es ist durchaus nicht unmöglich, daß unter den Erdbeben, die unsere feinen Instrumente oft über ein großes Gebiet hin anzeigen, hier und da sich auch eines befindet, das von einem herabstürzenden Meteorsteine herrührt, der, von uns ungesehen und unentdeckt, in unbekannten Erdstrecken niederging.
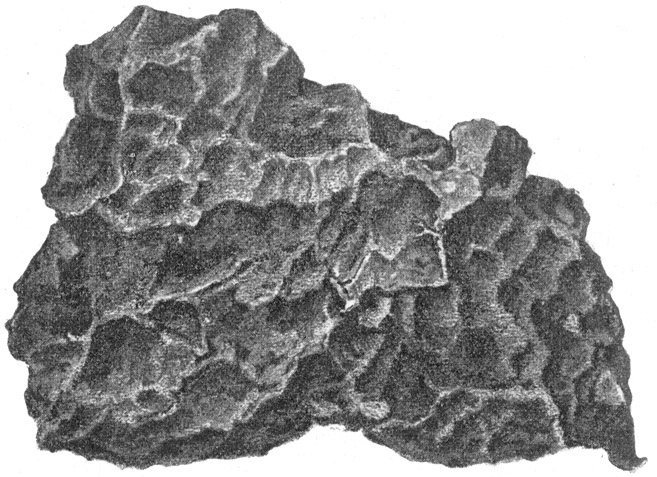
Eisenmeteorit von Hraschina.
Die gemachten Erfahrungen lehren uns, daß auch am Himmel das Kleinere entsprechend häufiger anzutreffen ist wie das Größere. Sternschnuppen fallen in jeder Nacht mehrere Millionen herab, wenn man von dem sehr kleinen beobachteten Teil des Himmels auf die ganze Erde schließt, und man kann rechnen, daß fast jeden Tag ein größerer Meteorstein vom Himmel fällt, wenn auch kaum je der hundertste unter ihnen beobachtet wird. Es steht nun keinerlei Beobachtungstatsache der Überzeugung im Wege, daß es nur einer entsprechend langen Zeitspanne bedürfen würde, nur einmal einen Meteoriten von Weltkörpergröße mit der Erde zusammentreffen zu sehen. Man wird aber begreifen, daß die schützende Kraft der Lufthülle hier einmal eine Grenze haben muß. Die kleineren läßt sie in sich verpuffen, die etwas größeren hemmt sie wenigstens in ihrem allzuschnellen Fluge und zersplittert sie; werden aber die Eindringlinge kilometergroß, so hört ebenso die hemmende Kraft des Luftwiderstandes auf, wie bei einer fallenden Kanonenkugel gegenüber einer Feder. Der Weltkörpermeteorit prallt mit kosmischer Geschwindigkeit gegen die Erdoberfläche und muß nun bei dem plötzlichen Übergang seiner lebendigen Kraft in Druck so große Wärmemengen erzeugen, daß er zum großen Teil dadurch seine Masse in Schmelzfluß bringt. Zu den Lavafluten, die das aufgerissene Kraterloch aus dem Erdinnern ergießt, mischen sich seine flüssig gewordenen Massen. Beim ersten heftigsten Anprall wird auch viel Masse sofort in Gasform verwandelt worden sein, die in explosiven Expansionen im Verein mit den vulkanischen Eruptionen einen anderen Teil der herabgestürzten Masse wieder zurückstößt, vielleicht sogar teilweise in den Weltraum zurück, aus dem sie kamen. Andere Teile fliegen in gewaltigem Bogen wieder herab und wiederholen, rings sich um das große neue Kraterloch verstreuend, dieselben Erscheinungen in kleinerem Maßstabe, wie sie beim primären Ausstoß stattfanden; es entstehen kleinere Kraterlöcher im Umkreise um das größte herum, die also nicht, wie die auf vulkanischen Spalten entstandenen, sich perlschnurartig aneinanderreihen.
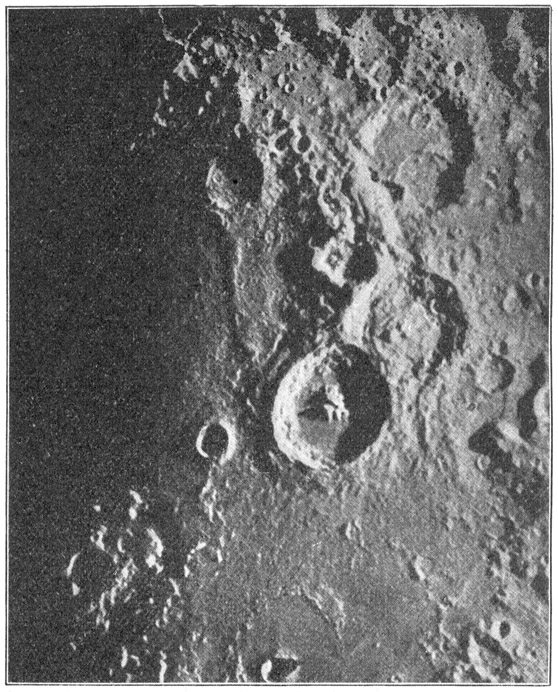
Mondpartie mit Kratern (Theophilus).
Was wir nun hier als eine Folge gemachter Voraussetzungen bisher nur theoretisch für möglich erklären konnten, sehen wir ganz deutlich auf dem Monde eingetreten. Auf seiner Oberfläche mußten sich derartige Katastrophen viel häufiger ereignen, weil ihm der schützende Luftmantel fehlt. Die kosmischen Projektile erreichen ihn mit unverminderter Kraft. Sie haben Löcher von Hunderten von Kilometern Durchmesser in seinen festen Panzer geschlagen. Wir kennen schon die strahlenförmigen Risse, die er dabei bekam, und die, entweder durch die aus dem Innern tretende Lava oder auch durch die flüssig gewordene Masse des aufgestürzten Körpers, sich sogleich wieder füllten, und endlich sehen wir nun auch viele dieser Krater von Hunderten kleinerer Löcher umgeben, die ganz und gar wie Spuren von Regentropfen in weichem Ton aussehen; es sind, soweit man es von uns aus sehen kann, rund ausgehöhlte Gruben, keine Krater mit flachem Boden und steiler Umwallung, wie die primären Löcher. Angesichts der vorangegangenen Betrachtungen kann man, wie ich meine, wirklich nicht mehr daran zweifeln, daß die geschilderten Oberflächenbeschaffenheiten auf dem Monde durch den Aufstoß großer kosmischer Massen und nicht durch innere Vorgänge entstanden sind. Hier haben wir also die Folgen wirklicher Weltuntergangskatastrophen deutlich vor Augen an dem nächsten aller Weltkörper. Der Erde kann nicht nur, es muß ihr einstmals ähnliches geschehen. Das ist nur eine Frage der Zeit.
So haben wir also die Ursache eines Weltuntergangs sicher erkannt, der in jedem Augenblicke katastrophenartig über uns hereinbrechen kann, ohne daß wir irgend etwas auch nur wenige Minuten vorher davon wissen könnten. Ein Körper von 10 km Durchmesser erscheint aus 5000 km Entfernung noch immer etwa viermal kleiner als der Mond und würde uns bei seinem Erscheinen gewiß nicht gleich allzusehr erschrecken; und doch kann er in weniger wie einer Minute auf die Erde gestürzt sein und dann im Laufe weniger Stunden alle Ordnung auf derselben zerstört haben für Jahrhunderttausende. Es wird uns also auf das Lebhafteste interessieren, etwas Näheres über diese Körper zu erfahren.
Zunächst haben wir uns zu fragen, ob diese Feuerkugeln, die so plötzlich am Himmel aufzuleuchten pflegen, in einem nachweisbaren Zusammenhänge mit den Kometen stehen, ob sie vielleicht Teile davon sind, wie die Sternschnuppen. Diese Frage müssen wir nun verneinen. Unter den Sternschnuppenschauern treten eigentliche Feuerkugeln nur sehr selten auf. Häufig hat man die Bahn eines Meteors sehr genau berechnen können und niemals eine Übereinstimmung mit der eines Kometen gefunden. Dabei zeigen die meisten Meteorbahnen eine Eigentümlichkeit, die uns beweist, daß diese Eindringlinge in unsere irdische Welt aus noch viel entfernteren Regionen des Weltalls kommen wie die Mehrzahl der Kometen.
Zwar auch die letzteren kommen schon von sehr weit her. Es wird uns im weiteren Verlaufe unserer Betrachtungen noch besonders interessieren, die Stellung dieser nur vorübergehend in unserer Nähe auftauchenden Himmelskörper innerhalb des Weltorganismus unseres Sonnensystems näher kennen zu lernen. Es ist doch wichtig, über die Herkunft dieser Wesen etwas zu wissen, die in so bedenkliche Beziehungen zu uns treten könnten.
Wir wissen, daß die Erde rund 150 Millionen Kilometer von der Sonne absteht, und daß der letzte der Planeten, Neptun, noch etwa dreißigmal weiter entfernt ist. Alle Planeten umkreisen die Sonne in festen Bahnen und in ein und derselben Richtung. Die Bahnen sind nahezu kreisförmig und mit wenig Abweichung um eine bestimmte Ebene geordnet, so daß der Raum um die Sonne herum, in dem die Planeten sich tummeln können, einer flachen Linse gleicht. Diese Ordnung allein schon nötigt uns die Überzeugung auf, daß Sonne und Planeten einen gemeinsamen Ursprung gehabt haben müssen. Anders steht es mit den Kometen. Sie kommen aus allen möglichen Richtungen und allen Entfernungen weit jenseits der Neptunsbahn her. Man hatte deshalb bis vor kurzer Zeit geglaubt, sie gehörten unserem System überhaupt nicht an, sie seien verlorene Massen im Weltraum, die ziel- und zwecklos zwischen den Sonnensystemen umherzögen; nur, wenn sie einmal einer dieser Sonnen zu nahe kämen, würden sie von ihr angezogen, wie auch alle übrige Masse. Sie müssen dann gegen die Sonne hinfallen. Viele Kometen werden wirklich in den glühenden Zentralherd, an dem die Planeten sich wärmen, geradeaus hineinstürzen. Wir haben es zwar noch niemals beobachtet, aber es konnte rechnerisch gezeigt werden, daß solche schnurstracks auf die Sonne losgehenden Kometen fast niemals von der Erde aus gesehen werden können. Die meisten Kometen aber bringen schon an den Grenzen der Sonnenanziehungssphäre eine kleine seitliche Bewegung mit, und dadurch fliegen sie mit zunehmender Geschwindigkeit an der Sonne vorbei, die sie dann zur Umkehr zwingt und nun wieder zurückwirft in den Weltraum, woher sie gekommen waren. Aus der Geschwindigkeit, mit der sie hierbei um die Sonne herumfliegen, kann man nun durch die Rechnung mit voller Schärfe auf ihre Anfangsgeschwindigkeit schließen, mit der sie in den Bereich der Sonnenanziehung gelangen, und da findet man nun, daß bei der bei weitem größten Anzahl diese Geschwindigkeit gerade gleich Null ist. Die Kometen halten also an der Grenze der Sonnenanziehungskraft still, ob sie nun erst zur Sonne hinfallen wollen oder von ihr zurückkommen; hier wenden sie nur und pendeln so immer hin und zurück auf einer »parabolischen« Bahn oder doch in sehr langgestreckten Ellipsen, in Intervallen, die sich zweifellos nach vielen Tausenden von Jahren bemessen; man kann sie in den wenigsten Fällen auch nur noch annähernd berechnen. Die Kometen verlassen also das Sonnensystem doch nicht ganz, sie müssen ihm von Anfang an, wenn auch nur sehr lose, angehört haben. Wir haben sie als Überbleibsel des Urstoffes zu betrachten, aus dem sich die übrigen Teile unseres Systems geformt haben. Wie dies vermutlich geschehen ist, davon gedenke ich in einem anderen Bändchen dieser Sammlung mehr zu erzählen. Aber Untergang und Entstehung sind eben zwei Extreme, die sich berühren.
Anders steht es nun mit den Feuerkugeln. Ihre Bahnen verraten oft ziemlich beträchtliche Anfangsgeschwindigkeiten, die uns beweisen, daß sie wirklich von anderen Weltsystemen in das unserige geschleudert worden sind. Gerade diese Himmelskörper, von denen wir Teile in unseren Händen halten, in jenen Meteorsteinen, kommen von unergründlichen Fernen des Weltgebäudes her, die uns fremder sind als die unerreichbaren Schwesterwelten unserer Erde, die Planeten, und doch bringen sie uns aus diesen letzten Tiefen feine unbekannten Stoffe herüber. Nichts kann deutlicher als dies von der großen Einheit des Weltganzen uns überzeugen.
Die Meteoriten sind also Überläufer aus anderen Weltreichen, und wir können deshalb von ihnen in betreff unserer Frage, ob ihre Weltstellung uns irgend etwas über den Grad ihrer Gefährlichkeit auszusagen vermag, nichts ermitteln. Wir wissen nichts darüber, ob ihrer Größe und ihrer Geschwindigkeit eine obere Grenze gesetzt ist, und wir können nichts angeben, was etwa die Erde vor einem verderbenbringenden Zusammenprall mit einem solchen Eindringling schützen könnte, wenn er Weltkörperdimensionen annimmt. Auch haben wir, wie erwähnt, keinerlei Mittel, solche Katastrophen vorherzusehen.
Etwas günstiger stehen diese Dinge bei den Kometen. Man sieht ja selbst die kleineren unter ihnen meist schon, wenn sie noch mehrere Millionen Kilometer von uns entfernt sind, und wenn man ihren scheinbaren Lauf nur drei Tage hintereinander beobachtet hat, so kann man in wenigen Stunden ihre wahre Bahn im Raume bestimmen und also vorhersagen, wo sich der Neuling in den nächsten Wochen und Monaten befinden wird, also auch, ob seine Bahn etwa die der Erde kreuzt. Da den Kometen der ganze Weltraum zur Verfügung steht, so wird dieser Fall etwa so selten vorkommen, als wenn z. B. unter tausend ziellos in allen Richtungen abgeschossenen Kugeln eine im Umkreise ihrer Tragweite einen ausgespannten Faden treffen sollte. Wenn zwar jahraus, jahrein immerzu geschossen wird, so kann endlich doch dieser Fall einmal eintreffen, und wir haben ja schon gesehen, daß es wirklich einige Kometenbahnen gibt, die die der Erde kreuzen. Damit nun aber ein Zusammenstoß stattfindet, muß noch viel Unwahrscheinlicheres dazukommen. Wir müßten uns in unserem vorigen Beispiele denken, daß wir längs jenes Fadens Kugeln abschossen und diese von den anderen im Fluge zufällig getroffen würden. So ungemein gering ist also die Wahrscheinlichkeit eines Zusammentreffens der Erde mit einem Kometen.
Freilich haben wir schon erfahren, daß trotzdem der Fall einmal vorgekommen ist. Zunächst ist hier zu sagen, daß es sich dabei um einen recht kleinen Kometen handelte, und solche sind sehr viel häufiger als die großen, von denen man eventuell etwas zu fürchten haben könnte, wenn ihr Kern genau auf uns zustürzen würde. Im vorliegenden Falle kommt aber noch etwas anderes hinzu. Jener »Bielasche Komet« gehörte zu den sogenannten periodischen, deren es, wie schon oben gesagt, bisher nur 18 gibt, und die in kurzen Perioden regelmäßig zur Sonne zurückkehren, also wie die Planeten geschlossene Bahnen beschreiben, die nur viel mehr langgestreckt, elliptischer sind. Wir wissen ja schon, daß jener Komet alle 6½ Jahre durch dieselbe Kreuzungsstelle mit der Erdbahn ging. Bei so häufiger Wiederkehr wird ein Zusammentreffen natürlich entsprechend wahrscheinlicher. Diese periodischen Kometen interessieren uns deshalb ganz besonders.

Der zweigeteilte Bielasche Komet.
Von ihnen ließ sich nachweisen, daß sie von den Planeten, und zwar meistens von dem großen Jupiter, »eingefangen« worden sind, das heißt durch dessen Einwirkung erst nachträglich unserem System dauernd einverleibt wurden. Ursprünglich kamen sie, wie die anderen Kometen, in parabolischen Bahnen aus unermeßlicher Ferne; aber die Richtung, aus der sie kamen, stimmte ungefähr überein mit derjenigen, in welcher sich der Planetenraum, wie oben näher auseinandergesetzt wurde, linsenförmig ausbreitet. Solche Kometen müssen sich deshalb viel länger in diesem Bereiche der Planeten aufhalten als diejenigen, welche die Linse von ihrer flachen Seite her durchkreuzen. Die ersteren sind offenbar in unserem Sinne gefährlicher, weil sie eben länger in dem Gefahrraume verweilen. Kommt nun ein solcher Komet einem Planeten einigermaßen nahe und laufen beide in derselben Richtung, so werden sie ziemlich lange beieinander bleiben, und der Planet wird durch seine dauernde Anziehungskraft den Kometen beträchtlich aus seiner ursprünglichen Bahn lenken. Auf diese Weise sind die elliptischen Bahnen jener periodischen Kometen entstanden. Es scheint hier auf den ersten Blick, als ob dieser Einfluß verhängnisvoll werden könnte, der ja gerade diese gefährlicheren Kometen nun dauernd in den Planetenraum bannt. Aber bei näherer Prüfung zeigt es sich ganz im Gegenteil, daß dieser Umstand gerade eine Schutzvorrichtung gegen diese gefährlichen Subjekte bedeutet. Es ließ sich nämlich theoretisch nachweisen, daß die doch zweifellos mehr oder weniger losen Massen, aus denen die Kometen bestehen, bei größerer Annäherung an die Sonne oder auch einen Planeten mehr und mehr in die Länge gezogen, oder auch selbst gewaltsam auseinandergesprengt werden müssen. Wird nun solch ein Komet gezwungen, häufig zur Sonne zurückzukehren, indem durch den »störenden« Einfluß eines Planeten seine Bahn in eine kleine Ellipse verwandelt wird, so muß er sich allmählich auflösen, seine Masse breitet sich, auseinanderbröckelnd, längs seiner ganzen Bahn hin und bildet aus diese Weise die Sternschnuppenringe, von denen wir vorhin sprachen. Sie werden dadurch völlig unschädlich gemacht. Bei jenem Bielaschen Kometen hatte man es sozusagen vor Augen gesehen, daß er sich in zwei Teile spaltete, die sich immer mehr voneinander entfernten; darauf hatte er sich so verstreut, daß er als Komet völlig verschwand und nur noch durch jene Sternschnuppenschauer seine Existenz verriet. Andere Kometen, die der Sonne ganz besonders nahe kamen, haben sich in mehrere Teile gespalten, und von anderen sieht man, daß sie heute in sehr beträchtlichen Zwischenräumen dieselbe Straße durch den Weltraum ziehen, also auch einmal durch Zersplitterung eines einzigen Kometen entstanden sein müssen. Es findet also hier im großen etwas ganz Ähnliches statt wie mit den Meteoriten, die in unsere Atmosphäre schlagen und dabei zertrümmert werden, wenn es hier auch eine andere Naturkraft ist, die dafür sorgt, daß solche gefährlichen Eindringlinge, soweit es möglich ist, zerkleinert, d. h. ungefährlicher gemacht werden.
Es ist ganz wunderbar zu sehen, wie selbst in diesem Bereiche der toten Natur Schutzvorkehrungen anzutreffen sind, die die allgemeine Ordnung aufrecht zu halten streben, ganz so, wie wir es bei den Organismen so vielfach finden. Ich habe es in meinem Buche » Der Untergang der Erde und die kosmischen Katastrophen«, das dem Gedankengange des vorliegenden Büchleins im ganzen parallel läuft, aber wesentlich ausführlicher ist, zum ersten Male versucht, diesen Schutzvorrichtungen für den Bestand der Weltsysteme nachzuspüren.
Solch ein eingefangener Komet muß nun notwendig in bestimmten Zwischenräumen zu derselben Stelle zurückkehren, wo der Einfluß des einfangenden Planeten stattfand, und also kann auch dieser aufs neue mit ihm zusammentreffen. Aber die dadurch hervorgebrachten neuen Störungen werden nun meist ganz anders wirken, wie das erstemal und dem Kometen also abermals eine ganz andere Bahn erteilen, und gelegentlich wird dadurch solch ein Störenfried wieder völlig aus dem Planetenreiche hinausgeworfen. Ein erst im letzten Jahre (1903) wieder erschienener Komet ist für uns ein lehrreiches Beispiel. Er stellt so recht den Typus jener ewig unstet ihre Form und Bewegung ändernden Weltenbummler dar. Als Komet Brooks wurde er 1889 entdeckt, aber er zeigte sich damals in eine ganze Zahl einzelner Teile zersplittert, die darauf hindeuteten, daß er nicht lange vorher ein böses Abenteuer gehabt haben mußte. In der Tat konnte Chandler rechnerisch nachweisen, daß der Komet 3 Jahre vorher, also 1886, sich dem mächtigen Jupiter ganz außerordentlich genähert hatte, so daß er jedenfalls mitten durch das System seiner Monde flog, oder auch mit ihm selbst in Kollision geraten sein könnte. Dem Jupiter merkte man dabei durchaus nichts an, er hat seinen Weg auch nicht um eines Haares Breite verlassen, aber der Komet ist dabei nicht nur in Stücke gegangen, sondern auch in eine kurze Umlaufszeit von 7 Jahren gezwungen, in der er 1896 und 1903 vorschriftsmäßig zurückkehrte. Aber jener Rechner fand nun weiter, daß vor dem Renkontre von 1886 der Komet eine Umlaufszeit von 27 Jahren besessen hatte, die ihn nicht in beobachtbare Nähe der Erde brachte. Nun machen vier solcher Umläufe von 27 Jahren bereit 108 aus, das ist ebensoviel wie neun Umläufe des Jupiters, der etwa 12 Jahre gebraucht, um die Sonne zu umkreisen. 108 Jahre von 1886 zurück, also 1778 oder 1779, denn um so viel ist die Rechnung unsicher, mußte also der Komet schon vorher einmal mit dem Jupiter zusammengetroffen sein und dabei diese Bahn von 27 Jahren erhalten haben. Dies führte nun zu einem anderen Kometen hinüber, der schon vor mehr als 100 Jahren die astronomischen Rechner hat weidlich schwitzen machen, dem Kometen Lexell, der 1770 entdeckt wurde und eine Umlaufszeit von nur 5½ Jahren rechnerisch besaß, während er doch vorher oder nachher niemals gesehen werden konnte. Nun ergab schon damals die Rechnung, daß jener Komet Lexell in dem vorhin für unseren Kometen Brooks gefundenen Renkontrejahre 1779 ebenfalls mit dem Jupiter zusammengekommen sein mußte, und daß dies zwei Umläufe des Kometen vorher, die damals nahe gleich einem Umlauf des Jupiter waren, also 1767, gleichfalls geschehen sei. Es ist demnach sehr wahrscheinlich, daß unser Komet Brooks identisch mit jenem Kometen Lexell oder doch wenigstens ein Teil davon ist. Zusammengestellt ergibt sich folgendes: 1767 kommt der Komet aus unbekannten Fernen des Universums auf den Jupiter los und wird von ihm in eine Bahnellipse von 5½ Jahren gezwungen, in der er nur zwei Umläufe macht, dann von jenem Planeten in eine Bahn von 27 Jahren verwiesen, die er viermal ungestört durchläuft, weiter seit 1886 wieder in eine kurze Umlaufszeit von 7 Jahren zurückgedrängt, die er seitdem zweimal ziemlich korrekt durchlief; nachdem er aber fünf Umläufe gemacht haben wird, die wieder nahezu gleich drei Umläufen des Jupiter sind, muß er diesem 1921 abermals zu nahe kommen und wird aufs neue in eine andere Bahn geschleudert werden, bis der Störenfried endlich wieder ganz aus dem Planetensystem geworfen sein wird.
Das Beispiel dieses merkwürdigen Kometen zeigte, wie die Annäherung zwischen Komet und Planet nur für den ersteren verhängnisvoll wurde; er wurde zerrissen und seine Teile unstet umhergeworfen. Auch im Kampfe ums Dasein der Weltkörper gilt das Recht des Stärkeren: wagt ein Schwächerer auf ihn einen Angriff, so wird er zertrümmert in sein Nichts zurückgestoßen.
Freilich ist dies bloß für den größeren Weltkörper im ganzen der Fall. Wenn aber auch bei einem solchen Zusammentreffen dem Planeten als Weltkörper nichts geschehen mag, was wir ihm von unserem Standpunkt aus ansehen könnten, so ist es dabei doch nicht ausgeschlossen, daß auf seiner Oberfläche alles in Trümmer gegangen sei, der Komet also doch nach menschlichen Begriffen die Ursache eines Weltunterganges war. Beim Jupiter im besondern sehen wir ja überhaupt nichts von seiner Oberfläche. Er ist von einer ganz wesentlich höheren und dichteren Atmosphäre umgeben wie die Erde. Wir sehen nur die Wolkenzüge der obersten Luftschichten. Diese dichtere Atmosphäre ist natürlich auch ein um so größerer Schutz gegen jene Eindringlinge. Dennoch scheint es, als ob Ende der siebziger Jahre des vorigen Jahrhunderts eine Katastrophe von der Art, wie wir sie hier ins Auge faßten, in der Tat auf dem größten der Geschwister unserer Erde sich ereignet hat. Es erschien in den Wolkengebilden der oberen Atmosphärenschichten des Planeten Jupiter ein roter Fleck, größer wie ganz Europa, und nahm in den ersten Jahren an Ausdehnung und Helligkeit noch zu, während er dann allmählich wieder erblaßte, aber heute noch nicht gänzlich verschwunden ist. Er besaß eine in der Richtung des so sehr schnellen Umschwungs des Planeten langgestreckte Form, wie beim auch alle anderen Wolkengebiete dort unter dem deutlichen Einfluß dieser schnellen Achsendrehung stehen: Jupiter zeigt uns deshalb im Fernrohr sichtbare Parallelkreise und Zonenabgrenzungen, die durch die von seinen Passatwinden erzeugten Wolkengürtel markiert werden. Also in noch weit höherem Maße wie auf der Erde bleiben bei der schnellen Rotation des Riesenplaneten die Luftschichten gegen die Geschwindigkeit der etwa darunter befindlichen festen Oberflächenteile zurück. Nun beobachtete man, daß der »rote Fleck« im Laufe der Jahre ganz langsam hinter den übrigen uns sichtbaren Gebilden zurückblieb, er hatte eine rückläufige Bewegung auf der Oberfläche des Planeten. Alles in allem konnte man die Gesamtheit der Erscheinungen an ihm nicht anders deuten, als daß unter den uns allein sichtbaren Wolkenschichten Jupiter vermutlich eine noch dünne feste Kruste besitzt, die an der Stelle des roten Flecks aufgebrochen ist und das feuerflüssige Magma hervorbrodeln ließ; davon wurden die Wolken über ihm rot beleuchtet. Das Aufbrechen geschah nicht auf dem ganzen Gebiete zugleich, und wir können uns nach irdischen Erfahrungen vorstellen, daß der geologische Prozeß des Niedersinkens einer größeren Scholle allmählich, wenn auch im Laufe weniger Jahre, stattfand. Dabei wurde ebenso wie die Luft nun auch das hervorquellende Magma, nur viel langsamer, in der der Umschwungsbewegung des Planeten entgegengesetzten Richtung zurückgedrängt.
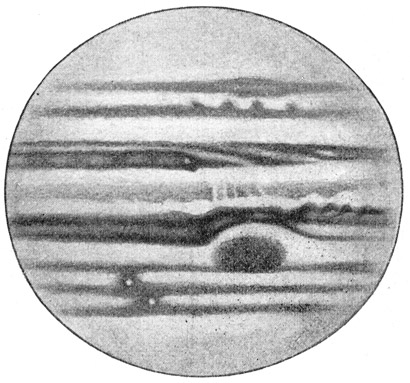
Jupiter mit dem roten Fleck.
Ist nun die erste Ursache, der Anstoß zu dieser großartigen geologischen Umwälzung auf dem Jupiter, deren Zeugen wir waren, solch einem Aufsturz einer fremden kosmischen Masse zuzuschreiben, oder können auch innere Kräfte, aus dem Planeten selbst entsprungen, sie hervorgebracht haben? Die Antwort auf diese Frage ist im Vorangehenden bereits enthalten; für den großen Jupiter, der sich jedenfalls noch in einem sehr jungen Stadium der Weltenbildung befindet, ist es noch wesentlich unwahrscheinlicher wie für die Erde, daß sich auf seiner Oberfläche so bedeutende Spannungen aufsammeln könnten, die zu solchen Katastrophen von innen heraus führten. Es bleibt uns kaum eine andere Erklärung, als daß wirklich ein größerer Körper von außen her auf die dünne Kruste stürzte und sie zum Bersten brachte. Die Überflutung der zwischen den Rissen liegenden Schollen mit dem glühend flüssigen Magma geschah dann nur sehr allmählich, so daß wir den Widerschein in den Wolken noch eine ganze Weile immer heller werden sahen. Wie dem aber auch sei, ob die zerstörenden Mächte von innen oder von außen angegriffen haben, jedenfalls sehen wir hier eine Katastrophe von der Art vor uns, wie wir sie uns mit Ende der Tertiärzeit über die Erde hereingebrochen denken müssen. Wäre Jupiter bereits von lebenden Wesen bewohnt, was nicht wahrscheinlich ist, so müßte dieses Ereignis für sie verhängnisvoll geworden sein.
Will man aber diesen roten Fleck auf Jupiter nicht als vollgültigen Beweis für den Zusammensturz von Weltkörpern ansehen, so kann doch die astronomische Wissenschaft deren ganz unzweifelhafte vorbringen. Sogar ganz in unserer Nähe bewegt sich durch den Raum ein permanenter Weltkörper unseres Systems, der ein Trümmerstück einer durch einen Zusammenstoß zersplitterten Welt sein muß. Es ist der erst 1898 von Witt auf der Urania-Sternwarte in Berlin entdeckte kleine Planet » Eros«. Er gehörte offenbar einst zu der Schar von winzigen Weltkörpern, die zwischen Mars und Jupiter die Sonne umkreisen. Aber durch eine Katastrophe muß er aus diesem Gürtel herausgeschleudert worden sein, so daß er nun in einer sehr langgestreckten Bahnellipse sich der Erde mehr nähern kann als irgend ein anderer Planet. Nur ein kleiner Teil der Bahn liegt für uns jenseits der des Mars. Ein unglücklicher Zufall hätte es bei solcher Katastrophe, die einen Weltkörper von immerhin einigen Kilometern Durchmesser um viele Millionen von Kilometern aus seiner Bahn zu schleudern vermag, fügen können, daß der Weg des versprengten Weltkörpers statt nur in die Nähe wirklich schnurstracks auf unsere Erde geführt hätte, wenngleich die Wahrscheinlichkeit dafür begreiflicherweise sehr gering ist.
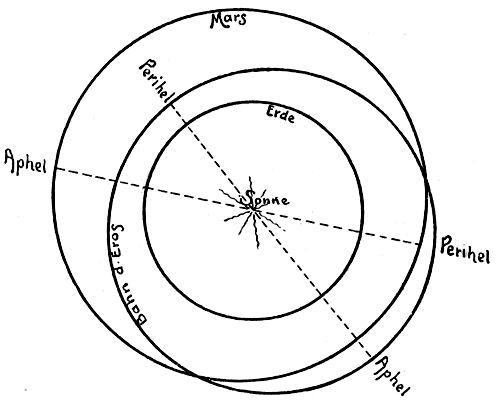
Bahn der Erde, des Eros und des Mars.
Eine sehr merkwürdige Beobachtung am Eros charakterisiert ihn nun wirklich als einen Weltsplitter, der keine Kugelgestalt wie alle normalen Weltkörper besitzt, sondern irgendwie eckig aneinander stoßende Flächen haben muß. Man hat bei ihm nämlich regelmäßig wechselnde Helligkeitsschwankungen wahrgenommen, die gar nicht anders gedeutet werden können, als daß der Planet sich wohl in gleichmäßigem Umschwunge in 5 Stunden und 17 Minuten je einmal um eine Achse dreht, dabei aber uns abwechselnd verschieden stark das Sonnenlicht reflektierende Seiten zukehrt.
Vielleicht ist jene Katastrophe, die einen Weltkörper in unserer nächsten Nähe zersplitterte, vor gar nicht langer Zeit geschehen, denn man wundert sich darüber, daß jener Planet, der bei seiner regelmäßig wiederkehrenden größten Annäherung zur Erde ein ziemlich helles Objekt wird, erst jetzt entdeckt wurde. Der dabei mit Eros zusammengestoßene Körper wird übrigens vermutlich kein Komet oder Meteorit gewesen sein, sondern ein anderer Planet. In jenem Gürtel zwischen Mars und Jupiter wimmelt es ja offenbar von kleinen Weltkörpern, und die bisher von uns gesehenen fünfhundert find ganz gewiß nur ein kleiner Teil der dort wirklich vorhandenen.
Man hat bereits vor langer Zeit die Vermutung ausgesprochen, alle diese kleinen Körper seien die Trümmer eines größeren Planeten, dem ein Unglück zugestoßen sei. Aber es kam dann eine Zeit, in der man auf der ganzen Linie der Naturforschung gegen jede Katastrophe in der Natur, ja sogar gegen jede Ungleichmäßigkeit ihres Entwicklungsganges war. Diese Ansicht hatte sich als Gegenwirkung gegen eine vorher herrschende »Katastrophentheorie« offenbar zu extrem nach der anderen Seite hin entwickelt, in der man jede Schöpfungsperiode der Erde durch eine Weltkatastrophe eingeleitet und beschlossen dachte, so daß immer wieder ein neuer allgemeiner Schöpfungsakt erfolgen mußte. Heute ist man davon überzeugt, daß es ebenso wie im Menschenleben auch bei der Entwicklung der großen Natur nicht immer so ganz glatt abgegangen ist, während wohl im allgemeinen ein ruhiges Aufwachsen stattfand; und mehr und mehr kommt man weiter zu der Überzeugung, daß solche teilweise zerstörenden oder auch nur hemmenden, oppositionell zurückdrängenden Wirkungen in jeder Entwicklung eine Notwendigkeit sind, wie eben überhaupt der Kampf ums Dasein. Wir werden noch in der Folge deutlicher erkennen, wie für die Neugeburt der Weltkörper Katastrophen ganz unvermeidlich sind; auch hier wie in der organischen Natur ist jede Geburt von Schmerz begleitet und besitzt etwas Katastrophenartiges.
Wir sind deshalb nach dieser Läuterung unserer Ansichten heute wieder viel mehr geneigt, die Schar der kleinen Planeten wirklich aus der Zertrümmerung eines einzigen hervorgegangen zu denken, und unter diesen Splittern kommen nun noch immer Kollisionen vor, die zu weiteren Zersplitterungen führen. Auch noch bei anderen kleinen Planeten hat man ähnliche Lichtschwankungen bemerkt wie bei Eros, die ihre Trümmergestalt verraten.
Sehen wir hier überall nur Folgen eines Zusammenstoßes zweier Weltkörper, so fand dagegen vor unseren Augen ein solcher erst vor drei Jahren statt, dessen Gewaltigkeit jeder Beschreibung spottet und bei weitem das überwältigend großartigste aller Ereignisse im ganzen Umfange des Universums war, von denen jemals das Licht uns die Kunde brachte. Das Ereignis kündigte sich uns durch das Erscheinen eines neuen Sternes im Sternbilde des Perseus au, der am 21. Februar 1901 plötzlich aufflammte, oder vielmehr unter den übrigen festen Sternen gesehen wurde, während er in der vorangegangenen Nacht, jedenfalls für das bloße Auge, und zwei Tage vorher selbst in größeren Fernrohren nicht sichtbar war. Zufällig hatte man nämlich zwei Tage vorher auf einer amerikanischen Sternwarte die betreffende Gegend photographiert, aber auf der Platte keine Spur des Sternes entdecken können. Nach der Entdeckung nahm der Stern noch immer weiter an Glanz zu, und in der nächsten Nacht war er zum hellsten Sterne an unserem Himmel, Sirius ausgenommen, geworden. Von da ab verblich sein Glanz wieder, erst schneller, dann nur noch ganz langsam, aber er flackerte verschiedentlich noch einmal heller auf und zwar die erste Zeit in einer Periode, die deutlich einen Umschwung von helleren und dunkleren Partien innerhalb etwa vier Tagen verriet.
Was war hier geschehen? War hier ein Weltkörper zerplatzt, daß sein weißglühendes Innere, dem Blute eines Erschlagenen gleich, herausspritzte? Etwas Ähnliches mußte es wohl gewesen sein. Immer wieder könnte, wären keine anderen Zeugnisse vorhanden, dann die Frage aufkommen, ob solche Zertrümmerung durch äußere oder innere Kräfte hervorgebracht worden sei. Im Fernrohr sah man, zunächst wenigstens, nur jenen einen Stern, scharf und durchmesserlos wie die anderen Fixsterne, nicht etwa zwei Körper, deren furchtbarer Zweikampf zu dieser Katastrophe geführt hätte. Aber wir besitzen noch ein viel wunderbareres Instrument als das Fernrohr und den photographischen Apparat, das Spektroskop, das uns nicht nur die chemische Zusammensetzung der entferntesten Weltkörper, sondern auch ihre Bewegungen verrät, die auf ans zu oder von uns hinweg gerichtet sind, also auch im schärfsten Fernrohr niemals gesehen werden könnten. Dieses lichtanalysierende Instrument zeigte nun bei der Erscheinung im Perseus unzweifelhaft an, daß sein Licht von zwei getrennten Körpern ausging, die sich mit sehr verschiedenen Geschwindigkeiten im Raume bewegten. Der eine Körper hatte eine normale Geschwindigkeit, wie sie alle übrigen Sonnen mit Himmel besitzen, von etwa 20 km in der Sekunde. Für kosmische Begriffe ist das nicht viel. Aber der andere Körper raste durch den Raum mit einer mindestens 50mal größeren Geschwindigkeit, also etwa von 1000 km in der Sekunde; in 40 Sekunden würde solch ein Körper um die Erde fliegen. Die Bewegungen der beiden Körper waren entgegengesetzt, mit so unausdenklicher Gewalt waren sie gegeneinander gerannt: Alles mußte dabei in glühenden Staub zermalmt, zu helleuchtenden Gasen verpufft werden.
Nach einer anderen Ansicht war jedoch die ursprüngliche Geschwindigkeit der aufstoßenden Masse nicht so beträchtlich. Man denkt sich in diesem Falle, daß ein dunkler, ausgelebter Körper mit einem Schwarm von kleineren Massen, etwa einem in einen Sternschnuppenschwarm oder eine Meteoritenwolke aufgelösten Weltkörperkomplex gefahren sei, wie es bei anderen »neuen Sternen« aus gewissen Umständen zu schließen war, und daß nun diese kleineren Massen, von der größeren, in die Wolke eindringenden, angezogen, nach und nach eine so gewaltige Fallgeschwindigkeit gegen die letztere erhalten hatten. Dadurch entstand dann zugleich eine Umlaufsbewegung eines Teiles des Schwarmes, die sich durch jene vorhin erwähnte periodische Lichtschwankung zu erkennen gab. Der Vorgang muß uns nach dieser Deutung indes wohl kaum weniger furchtbar erscheinen, wenn man bedenkt, daß unter diesen Umständen gegen den dunklen festen Körper ein tagelang andauerndes Bombardement von Milliarden kleiner Weltkörper mit einer Wurfkraft von 1000 km in der Sekunde stattfand.
Nun aber geschah abermals etwas ganz Wunderbares mit dem so plötzlich aufgeloderten Sterne: Er umgab sich nach einigen Monaten mit einer Nebelhülle, die sich ganz deutlich schrittweise immer mehr um ihn verbreitete, immer größere Räume einnahm. An sich wird man dies zwar noch nicht sehr erstaunlich finden, nachdem man sich über die ungeheure Gewalt jenes Zusammenstoßes klar geworden war. Jene Nebelmassen waren eben die Gase, in welcher die beiden Weltkörper bei ihrem Zusammenprall wenigstens zum Teil verwandelt wurden. Aber es kam hinzu, daß die Geschwindigkeit der Ausbreitung dieses Nebelgebildes um den immer noch als schwacher Lichtpunkt sichtbaren neuen Stern nun selbst nach kosmischem Maße ganz unerklärlich war. Ich bin in der Lage, den Leser selbst von diesem Unglaublichen zu überzeugen. Die umstehenden Abbildungen geben zwei Aufnahmen jenes Nebels wieder, auf denen man deutlich die Fortbewegung der besonders in ihm hervortretenden Lichtknoten in der Zwischenzeit, welche die einzelnen Aufnahmen trennt, erkennen kann, wenn man sie mit der Lage der in der Nähe befindlichen Fixsterne vergleicht. Das betreffende Gebiet ist auf beiden Aufnahmen mit einem Kreise umgeben. Merkt man sich die Sterngruppen innerhalb jedes Kreises, so kann man durch den Vergleich die Größe der Bewegung, wie sie scheinbar von uns aus gesehen, stattfand, auf den Bildern ablesen. Hieraus kann man natürlich auch ohne weiteres die wirkliche Bewegung in Kilometern per Sekunde berechnen, sobald man die wahre Entfernung des Sternes von uns kennt. Für diese hat man nun aus sehr genauen Messungen einen so großen Wert gefunden, daß das Licht sicher mehrere Jahrhunderte gebraucht, um von dorther zu uns zu gelangen, so daß also das Ereignis, das wir 1901 wahrnahmen, in Wirklichkeit schon in längst verflossenen Jahrhunderten stattfand. Für solche Entfernungen werden zwar unsere Messungen selbst sehr unsicher, aber man kann doch immer eine untere Grenze bestimmen und also sagen, mindestens so und so weit muß der Stern von uns entfernt sein; er kann sich dann durchaus nicht näher, aber vielleicht ganz wesentlich weiter von uns befinden. Deshalb können wir also auch aus der scheinbaren Bewegung jener Lichtverdichtungen in dem neu um den neuen Stern entstandenen Nebel einen Mindestbetrag für die wirkliche Geschwindigkeit finden, der von der unbekannten Wirklichkeit nur noch übertroffen werden kann. Da ergibt sich nun das erstaunliche Resultat, daß diese Lichtauswürfe mit wirklicher Lichtgeschwindigkeit, 300 000 km in der Sekunde, monatelang in den Weltraum hinausgeschleudert wurden. Sie füllten dabei bald Räume aus, die die unseres ganzen Sonnensystems mit mehr als das Tausendfache übertrafen.

Nebel um den neuen Stern im Perseus, aufgenommen am 8. und 11. Dezember 1901 auf der Licksternwarte in Kalifornien.
Man hatte lange an die Realität dieser Dinge nicht glauben wollen. Sie lagen wirklich gar zu weit von aller bisherigen Erfahrung. Diese Ausbreitung mußte ja dreihundertmal schneller erfolgt sein wie die Geschwindigkeit jenes Körpers selbst, der mit seinem Aufprall die Katastrophe verursacht hatte, eine Geschwindigkeit, die selbst schon zu den durchaus ungewöhnlichen im Weltraum gehört. Man hatte deshalb gemeint, diese Ausbreitung sei nur eine scheinbare gewesen, der Nebel habe schon immer existiert, nur sei er vorher dunkel gewesen und nun erst, als der Stern in ihm durch die Katastrophe so hell aufflammte, allmählich beleuchtet worden. Wir hätten also aus diesen ungeheuren Entfernungen die Lichtstrahlen mit ihrer Geschwindigkeit von 300 000 km ganz langsam, täglich nur um Haaresbreite, über den Nebel hinkriechen sehen, denn alles verjüngt sich ja aus der Ferne, und die Wellen des Lichtes, die sich für unser Auffassungsvermögen zeitlos über unermeßliche Räume ausbreiten, scheinen fast still zu stehen, Nichts ist wohl imstande, die gewaltige Größe der Welt, die unseren Sinnen noch zugänglich ist, so eindrucksvoll zu veranschaulichen, als jenes Hinkriechen des Lichtes über den neuen Nebel im Perseus.

Nebel um den neuen Stern im Perseus, aufgenommen am 31. Januar und 2. Februar 1902 aus der Licksternwarte in Kalifornien.
Wenn einerseits an jener Ausbreitung mit Lichtgeschwindigkeit durchaus nicht gezweifelt werden kann, so sind doch in jüngster Zeit wieder gewichtige Zweifel an der soeben vorgetragenen Deutung der Erscheinung aufgetreten. Die Art der Lichtverteilung auf dem Wege senkrecht zur Gesichtslinie führte zu theoretischen Bedenken, und man hatte auch zu deutlich bestimmte Lichtknoten sich immer weiter entfernen sehen, sogar auf einem entschieden spiralig gewundenen Wege. Es war doch, trotz aller inneren Unwahrscheinlichkeit, nicht davon abzukommen, daß hier wirkliche Materie nach der ganz unausdenkbar gewaltigen Katastrophe mit Lichtgeschwindigkeit vom Zentrum des Stoßes in den Raum hinausgeschleudert wurde.
In das bis dahin völlig Unerklärliche dieser Weltuntergangsvorgänge beginnt nun in allerneuester Zeit aus einem ganz anderen Forschungsgebiete ein klärendes Licht zu fallen, freilich nur, indem ein noch ungelöstes Rätsel ein anderes zu lösen sucht. Die Wundererscheinungen des Radiums könnten hier im Spiele sein. Nach den neuesten Forschungen sind die Atome des Radiums ganz ebensolche der Zerstörung preisgegebene Weltkörper allerkleinster Dimensionen, wie jener neue Stern im Perseus. Es ist erwiesen, daß von jedem Atom Radium kleinste Körperteile, Korpuskeln mit Lichtgeschwindigkeit ausgeschleudert werden, wobei sie alles in ihrer Umgebung, was sie treffen, leuchtend machen. Sie verbreiten also einen leuchtenden Nebel um sich, ganz genau so wie jener rätselhafte Stern. Jene Korpuskeln, wegen ihres elektrischen Charakters auch Elektronen genannt, sind noch etwa zweitausendmal kleiner als das kleinste Atom des Chemikers, das des Wasserstoffs, und es ist damit die längst schon vermutete Tatsache bewiesen, daß die chemischen Atome ihren Namen als unteilbare Körper nicht mehr verdienen, auch die Atome sind wie die aus ihnen aufgebauten Moleküle Weltsysteme kleinster Art, in denen sich die einzelnen Teile genau so bewegen, wie die großen Himmelskörper im Weltraume. Diese wunderbaren Beziehungen und Parallelismen zwischen den Atomen und den Weltkörpern habe ich in meinem größeren Werke, » Die Naturkräfte, ein Weltbild der physikalischen und chemischen Erscheinungen« (Leipzig 1903), in allen Hauptzügen der Naturvorgänge allgemein verständlich darzustellen versucht. Das Radium scheint nun unter diesen Weltsystemen auf der Größenstufe der Atome ein bestandunfähiges zu sein, in dem die Bahnen der einzelnen Weltkörperelektronen durch irgendwelche Umstände in Unordnung geraten sind, so daß die Körper beständig gegeneinander stoßen und dabei aus dem System geschleudert werden. Das Radiumatom ist der Zerstörung verfallen, in seinen Strahlungen sehen wir einen Weltuntergang in jener untersten Stufe der Organisation der Materie, in die unser forschender Geist, niemals mehr unser Auge, zu dringen vermag. Das Radiumatom gehört zu den größten, die wir kennen. Es muß aus etwa einer halben Million jener Elektronen, also jener allerkleinsten Weltkörper, bestehen, und jedes dieser Atome stellt sich also als ein allerkleinstes Milchstraßensystem heraus, in dem die Weltkörper, hier die Atome, dort die Sonnen, sich wimmelnd zusammendrängen. Deshalb gibt es auch die meisten Zusammenstöße unter jenen Sonnen immer in der Nähe des Milchstraßengürtels, dort erscheinen jene »neuen Sterne«, von denen wir als den größten und wunderbarsten Repräsentanten seit dem »Tychonischen Sterne« von 1572, jenen im Perseus, kennen lernten. Vielleicht sind die Atome des Radiums unter unbekannten Umständen zu einer solchen Größe angewachsen, daß sie eben unter den auf der Erdoberfläche normalen Bedingungen nicht mehr dauernd bestehen können und sich deshalb wenigstens teilweise in ihre Uratome wieder auflösen müssen. Auch die Atome werden also nicht unveränderlich sein, wie wir denn bisher überhaupt nichts Unveränderliches wirklich nachweisen konnten. Auch die Atome werden einen Entwicklungsprozeß in auf- und absteigender Stufenleiter durchzumachen haben, auch die Atome haben ihre Schöpfungszeiten und ihre Weltuntergänge.
Bekanntlich ist das Radium der allerseltenste Stoff, den wir kennen. Es findet sich einigen anderen seltenen und gleichfalls sehr schweren Stoffen in sehr kleinen Mengen zugesellt, wie namentlich dem Uran. Die schwersten Stoffe sinken am tiefsten herab, und schon deshalb könnte man vermuten, daß im tiefsten Innern der Erde, wohin wir längst nicht mehr gelangen können, vielleicht mehr von diesem Wunderstoffe zu finden wäre. Manches spricht in der Tat hierfür. So zeigt sich in Bergwerken die Luft mehr als gewöhnlich erfüllt von dem Leuchtstoff, der von dem Radium ausgeht, oder vielmehr, in den es zerfällt. Es ist also zu vermuten, daß aus der Tiefe beständig eine »Radiumemanation« ausgeht, die sich aber sofort, wegen der ungemeinen Leichtigkeit dieser Zerfallprodukte, verflüchtigt, ja selbst unsere Atmosphäre verlassen muß. Nach Ramsays neuesten Untersuchungen zerfällt das Radium langsam in Helium, dem zweitleichtesten Stoffe überhaupt, der gleichfalls auf der Erde sehr selten ist, eben weil seine Atome zu leicht sind, um noch von der Anziehungskraft der Erde festgehalten werden zu können. Gerade deshalb aber zeigt das zwar geringe, aber doch dauernde Vorhandensein von Helium in unserer Atmosphäre, daß es sich von irgendwo her immer wieder erneuern muß. Auf der Sonne stehen die Verhältnisse dagegen ganz anders; deren Anziehungskraft ist wesentlich größer als die der Erde; deshalb bestehen die obersten Schichten der Sonnenatmosphäre fast ganz aus jenem Helium, das ja daher seinen Namen erhalten hat. Es wurde dort bekanntlich wegen einer Spektrallinie, die allen irdischen Stoffen fremd war, entdeckt, weit bevor man es auch in Spuren auf unserem Planeten fand. Diese Heliumatmosphäre der Sonne spricht also gleichfalls für die Vermutung, daß das Innere der Weltkörper größere Mengen von Radium enthält, welches vielleicht nur unter dem ungeheuren Druck, der dort herrschen muß, aus den Uratomen entstehen kann und sich deshalb auch, höher kommend und also von jenem Drucke befreit, wieder auflöst.
Wenn nun in fürchterlichem Zusammenstoße zwei Welten zerschellen, so daß ihr Innerstes in den Weltraum hinausstiebt, so muß das dort nach unserer Ansicht bis dahin verborgen gehaltene Radium sofort seine wunderbare Strahlung beginnen und damit die Materie jener Weltkörper in ihre Uratome auflösen, wie es das Radium auch bei unseren Experimenten tut. Gleichzeitig breitet sich die Materie mit Lichtgeschwindigkeit weit über den Raum aus. Ein neuer Nebelfleck, wie man deren zu Tausenden am Himmel sieht, entsteht vor unseren Augen, und er ist angefüllt mit Urmaterie, mit den allereinfachsten, allerkleinsten Atomen, von denen keines in irgendeiner Beziehung zum anderen steht: Der Urzustand ist wieder hergestellt, ein Weltuntergang allerradikalster Art hat stattgefunden, eine Auflösung aller Ordnung bis in das kleinste Atomgefüge hinein. Und wir sind Zeugen einer solchen Auflösung gewesen, als der neue Stern im Perseus aufflammte. Hier haben wir die allerbestimmteste Antwort auf unsre Fragen: Kann ein Weltuntergang stattfinden und wie kann das geschehen? Die Sterne zertrümmern sich in fürchterlichem Zusammenstoß, daß keiner der kleinsten Bausteine, eben jener Atome, aufeinander bleibt. Und das alles ist geschehen innerhalb weniger Stunden, unvermutet, mit einer Plötzlichkeit, die unser Schaudern wohl erregt, aber doch eigentlich nur wohltätig wäre, wenn solche Katastrophe eine mit Leben erfüllte Welt wie die unserige treffen würde.
Angesichts dieser Tatsachen wird die Frage für uns brennend, ob unserem Weltsystem ähnliche Katastrophen begegnen können. Eine gänzliche Zertrümmerung durch Zusammenstoß kann ein Weltkörper natürlich nur von seinesgleichen erfahren: Die Massen und Geschwindigkeiten müssen groß sein. Unserer Erde ebenbürtige Massen besitzen in unserer Kenntnis nur die übrigen Planeten, die Millionen von Kilometern weit von uns entfernt feste Bahnen beschreiben, in denen sie niemals miteinander in Berührung kommen können. Die nächste Sonne aber, der erste Stern im südlichen Sternbilde des Kentauern, ist mehr als 40 Billionen Kilometer von uns entfernt, so daß das Licht 4½ Jahre gebraucht, um von ihm zu uns zu gelangen. Den Weltsystemen sind ungeheure Räume zur Verfügung gestellt, um sich darin ungestört entwickeln zu können. Von diesen in unserer Kenntnis befindlichen Weltmassen ist also so bald keine Kollision zu befürchten. Aber es ist nicht daran zu zweifeln, daß sich im Welträume auch noch sehr viele dunkle Massen befinden, die für unser Auge ewig unerkennbar sind. Die Meteoriten beweisen uns dies ja augenfällig. Wir sehen, daß wir auf der Suche nach den Möglichkeiten eines Weltunterganges, der uns zustoßen könnte, immer wieder in das Unbekannte gedrängt werden.
Freilich könnten größere Massen, selbst wenn sie völlig dunkel wären, sich unserer Kenntnis nicht auf die Dauer entziehen, falls sie sich uns etwa aus den Fernen des Weltgebäudes nähern würden. Sie würden sich durch ihre Anziehungskraft verraten, und auf dieselbe Weise, wie in den vierziger Jahren des verflossenen Jahrhunderts Leverrier den Neptun nur aus seiner Anziehung auf den Uranus entdeckte, würde man schon aus sehr großer Entfernung eine herannahende Sonne rechnerisch wittern. Davon ist nun vorläufig keine leiseste Spur zu entdecken, und wir können uns also vorderhand wenigstens noch ruhig schlafen legen.
Aber wie wird die Sache in der Folge stehen, nach Jahrtausenden oder Jahrmillionen? Alle Sonnen, auch die unserige mit ihrem ganzen Gefolge von Planeten, bewegen sich im Raume vorwärts, und zwar, soviel wir in der kurzen Zeit ermitteln konnten, in gerader Linie. Der helle Stern Wega, der auch zu den uns näher stehenden gehört, würde uns schon in etwa 50 000 Jahren erreichen, wenn die an ihm wahrgenommene Bewegung gerade auf uns zu gerichtet wäre. In Wirklichkeit ist dies nicht der Fall. Es ist kaum ein Zweifel, daß alle Sonnen des großen Milchstraßensystems, das deutlich eine Anordnung nach einem gemeinsamen Bauplane verrät, von dem wir mehr erfahren werden, wenn wir uns in dem dieser Sammlung zugehörigen betreffenden Bändchen mit der Entstehung der Himmelskörper zu beschäftigen haben werden, auch ähnlich geordnete Bewegungen ausführen, wie die Planeten in ihrem System, so daß Zusammenstöße unmöglich sind, solange diese Ordnung erhalten bleibt. Also leicht ist es den Sonnen jedenfalls nicht gemacht, sich gegenseitig zu zerstören.
Aber die Erscheinungen der neuen Sterne zeigen ja, daß solche Zusammenstöße dennoch stattfinden. Diese Ereignisse erweisen sich nicht einmal so sehr selten, als sie es früher zu sein schienen. Seit der Himmel namentlich durch die photographische Platte so außerordentlich scharf zu beobachten ist, bemerkt man viel häufiger als früher unter dem Gewimmel der anderen ein vorher nicht vorhanden gewesenes Lichtpünktchen. Überall treten sie da am häufigsten auf, wo die Sterne sich auch scheinbar am nächsten zusammendrängen. Freilich hat man sich zu sagen, daß es ja Millionen von unverändert leuchtenden Sternen gibt, und daß also, wenn unter diesen, sagen wir, im Jahre einmal ein neuer auftaucht, wir rückzuschließen haben, daß einem einzelnen jener Millionen Sterne solch ein Schicksal auch nur in Millionen Jahren einmal zustoßen wird. Aber immerhin geschieht es doch, wie der Augenschein lehrt, und auch der Umstand, daß die schon dem bloßen Anblick nach am dichtesten mit Materie besetzten Weltregionen am häufigsten die Erscheinung eines neuen Sterns zu verzeichnen haben, beweist, daß es sich wirklich hier um Zusammenstöße handelt und nicht um innere Vorgänge, die mit der Sterndichtigkeit ja nichts zu tun haben könnten.
Unsere Sonne gehört nun zwar auch zum System der Milchstraße, die nach den neueren Ansichten überhaupt alle für uns sichtbaren Sterne in sich schließt, aber sie befindet sich in den inneren, dünner mit Materie angefüllten Teilen der ungeheuren Spirale aus Sonnenschwärmen. Hier scheint die schöne Ordnung, unter deren Schutze unser spezieller Wohnsitz aufblühte und sich weiter entwickelte, für eine weitere Ewigkeit gesichert zu sein.
Aber wirklich ewig ist nichts Geschaffenes. Gönnen wir der Fortentwicklung unserer Sonnenwelt auch noch ungezählte Millionen von Jahren, einstmals muß auch sie altern und hinsterben. Und dann muß es auch für sie eine Wiedergeburt geben, denn einen ewigen Stillstand kennt die Natur nicht. Wie wird nun unsere Erde und unser System einmal ein normales Lebensende finden?
Wir wissen, daß die Erdoberfläche einst wesentlich heißer war. Ihr Abkühlungsprozeß ist ein normaler Vorgang, den wir bei allen heißen Himmelskörpern antreffen müssen, weil sie in einem sehr kalten Raume sich befinden, dessen Temperatur wahrscheinlich bei 200° unter Null liegt. Wir haben zwar auf der anderen Seite gesehen, daß bei Weltkörpern, die noch eine geringe Dichte besitzen, sich also noch wesentlich zusammendrücken lassen, der Druck der eigenen Schwere eine lange Zeit hindurch sogar mehr Wärme erzeugen kann, als sie in den Weltraum hinausstrahlen, so daß diese Körper, wie vermutlich heute noch unsere Sonne, aus sich selbst heraus immer heißer werden. Dauernd kann dies aber begreiflicherweise nicht fortgehen. Je dichter die Körper infolge dieser inneren Gravitationsarbeit werden, desto weniger können sie sich weiter zusammenziehen, desto mehr wächst also die Wärmeausgabe gegen die Einnahme, und nach Eintritt einer maximalen Dichtigkeit wird eben nur noch Wärme ausgegeben. Treten also keine anderen Einflüsse hinzu, so müssen alle Weltkörper sich einmal bis auf die Kälte des Weltraums abkühlen, was natürlich auf ihrer Oberfläche, die das Leben trägt, zuerst eintritt. Auf dem Monde sind solche Verhältnisse bereits nahezu eingetreten. Gewisse Untersuchungen ergaben die Durchschnittstemperatur der Mondoberfläche zu etwa 85° unter Null, während die der Erde bei +15° liegt. Der Mond hätte sich danach also bereits um etwa 100° mehr abgekühlt als die Erde. Freilich fällt für ihn die vor dem direkten Eindringen der Kälte des Weltraums schützende Luftumhüllung fort, ohne die es auch auf der Erde wesentlich kälter sein würde. Dafür wirkt die Sonnenbestrahlung um so stärker direkt auf die Gesteine der Oberfläche ein, und da diese Strahlung ohne Unterbrechung vierzehn Tage lang auf dem Monde anhält, so wird die Temperatur zur Zeit des Mondmittags sich wohl über Null erheben können, und es wäre nicht unmöglich, daß sich alsdann ein karges Leben an vereinzelten, tief gelegenen Stellen, wo sich auch noch etwas Luft erhalten mag, jedesmal wieder entwickeln kann. Man hat in jüngerer Zeit wirklich Spuren davon zu erkennen geglaubt. Aber wir sehen in dem Monde jedenfalls das Beispiel einer durch das Eindringen der Kälte des Weltraums fast oder ganz abgestorbenen Welt. Der Mond als kleinerer Körper mußte seine natürliche Wärme schneller abgeben wie die größere Erde, ihm war deshalb nur ein kürzeres Leben beschieden. Aber es ist kein Zweifel, daß der Erde bei normalem Lebenslauf ein ähnliches Ende bevorsteht. Mit Verwunderung sehen wir, wie die Natur die Lebewesen langsam auf diese Entwicklung der Dinge vorzubereiten scheint, indem sie in die letzten Schöpfungsperioden Eiszeiten einschob, wie um eine immer bessere Anpassung der lebendigen Welt an die unerbittlich vordringende Kälte des Weltraums herbeizuführen, soweit dies überhaupt möglich ist. Es ist in neuester Zeit, seit man Kältegrade bis zu -250° künstlich erzeugen kann, nachgewiesen, daß Kälte an sich die Lebensfähigkeit von Keimen und von Mikroorganismen überhaupt nicht vernichtet. Muß die Lebens tätigkeit mit zunehmender Kälte sich auch mehr und mehr einschränken, so hört damit doch die Lebens fähigkeit nicht auf. Die Kälte kann eine Weltorganisation niemals vollständig töten, sondern ihre Lebensregungen nur einschränken und schließlich latent machen. Ist es also zwar ganz unzweifelhaft, daß jene grausige Kälte des Weltraums einstmals den ganzen Erdball und die anderen Weltkörper umklammern muß, wenn sie vor Katastrophen geschützt wurden, die ihnen einen unnatürlichen Tod bereiten, so mögen dabei wohl in allzugrimmigen Eiszeiten, die kommen und gehen, nach und nach Untergänge von ganzen Weltgenerationen stattfinden, das Menschengeschlecht und vielleicht noch viel vollkommenere Wesen, die ihm folgen mögen in der Stufenreihe der Entwicklung, mögen ein für allemal hinweggerafft werden vom Erdball, aber ein vollkommener Weltuntergang, in dem alle Organisationen zerstört werden, wie wir es bei jenem neuen Sterne im Perseus sahen, kann durch die Kälte nicht herbeigeführt werden. Sie konserviert ganz im Gegenteil die allerfeinsten Organismen, alle diese wunderbaren physiologischen Maschinen in vollkommenster Weise. Schließlich wird die ganze Erde oder der betreffende Weltkörper wie zu einem einzigen großen Keime werden, der in den winterlichen Boden gesenkt ist, um seiner Auferstehung zu harren, wenn ein neuer Frühling kommt. –
Bevor dies aber eintritt, wird das unendlich erfindungsreiche Leben noch eine Fülle von Auswegen gefunden haben, um der immer mehr kargenden Natur immer wieder neues Terrain abzugewinnen. Gerade jener Kampf mit den Unbilden der Natur hat die Intelligenz aufwachsen lassen, die die unerschöpflichen Kräfte der Natur mehr und mehr in den Dienst des Lebens zu zwingen weiß. Das Menschengeschlecht hat es längst gelernt, sich in Erdstrichen häuslich niederzulassen, wo die Wintertemperatur nicht viel über dem Durchschnittswärmegrade des ausgestorbenen Mondes steht. Man kann es sich ferner wohl vorstellen, daß die Lebensentfaltung durchaus nicht immer an die Existenz von Wasser in seinen drei Aggregatzuständen und an Luft in der Zusammensetzung unserer Atmosphäre gebunden zu sein braucht, wie es auf der gegenwärtigen Temperaturstufe der Erde der Fall ist. Bei wesentlich höheren oder tieferen Durchschnittstemperaturen können ganz andere chemische Elemente in eine ganz ähnliche Wechselwirkung zueinander treten, wie sie bei uns die Lebensentfaltung bedingen. Eine ganz neue Wett von Lebensformen wäre die Folge davon. Wir dürfen hier den Gedanken nicht weiter verfolgen. Es genüge uns zu wissen, daß die Keime des Lebens auf jeden Fall bei einer langsamen Temperaturabnahme bis selbst zum denkbar tiefsten Kältegrade, der bekanntlich bei -273° liegt, erhalten bleiben. Hier können wir also nicht nur mit hoher Wahrscheinlichkeit wie bei unseren vorangehenden Betrachtungen, sondern mit voller Gewißheit sagen: Es gibt bei normaler Entwicklung keinen absoluten Weltuntergang, soweit die Abkühlung der Weltkörper dabei in Betracht kommt.
Was aber geschieht nun? Wer bringt den neuen Frühling, wenn rings umher die Welten in den starren Banden der Kälte zur andauernden Leblosigkeit verdammt wurden? Ist das nicht dasselbe, als wenn ein ewiger Tod sie erreicht hätte? Auch die Sonne muß ja schließlich mehr und mehr erkalten. Wo nehmen wir eine neue Quelle von Licht und Wärme her, die eine unbedingte Notwendigkeit für jede Lebens entfaltung sind?
Die Natur ist unerschöpflich in ihren Hilfsmitteln. Für die kleineren Körper, die größere umkreisen, die Monde, scheinen zunächst die Meteoriten eine wichtige Rolle für die Erzeugung neuer Wärme auf ihren Oberflächen zu spielen, wie unser Mond uns nahelegt. Je mehr die Weltkörper altern und also kälter werden, desto mehr verbrauchen sie auch durch chemische und Lebensprozesse ihre Lufthüllen, desto leichter können also die Meteoriten die Oberfläche wirklich erreichen, wie wir schon gesehen haben. Denken wir uns nun auf die heute ausgelebte, aber wahrscheinlich doch mit Lebenskeimen aus vergangenen Entwicklungsperioden erfüllte Oberfläche des Mondes einen größeren Meteoriten schlagen, so wissen wir zunächst, daß er die Oberfläche teilweise zertrümmert und sie ebenso wie sich selbst feuerflüssig macht. In der nächsten Umgebung des Ausstoßes muß deshalb allerdings jeder Lebenskeim vernichtet werden, denn die Hitze löst, anders wie die Kälte, alle Organisation, sogar die der Atome, auf. Aber das Magma verbreitet sich über die Oberfläche, es schmilzt das Eis, das sie überzogen hat, und stößt Gase aus, die eine neue Atmosphäre bilden, wo sie schon längst aufgezehrt war, kurz alle Lebensbedingungen werden wieder neu geschaffen, alle Keime, die noch lebensfähig blieben, können sich wieder entwickeln. Es ist deshalb vielleicht in diesem Sinne zu deuten, daß man gewisse Farbenveränderungen der Mondoberfläche, die man für eine um die Mittagszeit aufwachsende Vegetation hält, nur in den Kraterböden wahrnimmt, also dem einstmaligen Zentrum des Ausstoßes, wo noch die größte damals erzeugte Wärmemenge sich erhalten haben muß. Außerdem kann sich in diesen Kraterböden das Wasser am besten ansammeln. Jener so sehr als Ursache eines Weltuntergangs gefürchtete Aufsturz eines kleineren Weltkörpers wird also für eine ersterbende Welt zur Ursache eines neuen Lebens, und es ist wunderbar zu sehen, wie die Natur es eingerichtet hat, daß dieses Ereignis gerade jenen sterbenden Himmelskörpern, denen es Vorteil bringt, in vollem Umfange zugute kommen kann, während sie diese Eindringlinge den noch in voller Blüte stehenden Weltkörpern, deren Organisation dadurch in weitem Umfange zerstört werden müßte, so viel als möglich vom Leibe hält.
Ein anderes Hilfsmittel der Natur, um die zur Verfügung stehende Wärme so viel als möglich auszunutzen, besteht in der allmählichen Annäherung der Planeten an ihre Sonnen und der Monde an ihre Planeten. Zwar folgt aus den Gesetzen der allgemeinen Massenanziehung, die alle Bewegungen der Himmelskörper regieren, daß auf viele Tausende von Millionen Jahren hin die Ordnung unseres Sonnensystems erhalten bleiben muß, und sich insbesondere die mittleren Entfernungen der Planeten voneinander oder von der Sonne nicht ändern können, solange nur diese bekannten Gesetze gelten und keine fremden größeren Massen von außen her in unser System eindringen.
Aber der Weltraum ist nicht leer. Meteoriten, Sternschnuppenwolken, Nebelmassen erfüllen ihn und müssen den Bewegungen der Himmelskörper Hindernisse entgegenstellen. Auch das auf die Ewigkeit berechnete Uhrwerk des Himmels verstaubt allmählich, und eine notwendige Folge davon ist das zwar sehr langsame aber stetige gegenseitige Aneinanderrücken der Weltkörper. Die Monde müssen sich ihren Planeten, diese ihren Sonnen und schließlich selbst die Sonnen einander immer näher kommen. Die Komplexe von Weltkörpern, die großen Sternsysteme, verhalten sich ebenso wie ein einzelner Körper, der ja in seinen Molekülen und Atomen gleichfalls ein kompliziertes System weit voneinander getrennt sich gesetzmäßig bewegender Massen ist, wie ein Milchstraßensystem. Alles verdichtet sich allmählich.
Dieses Aneinanderrücken der Weltkörper ist also eine Kompensierung für die Abnahme der strahlenden Kraft der Sonne für die Planeten. Ein ganz ähnliches Verhältnis besteht zwischen den Planeten und ihren Monden. Wenn diese kleineren Weltwesen bereits so weit abgekühlt sind, daß auf ihnen sich ein Leben nach unseren Begriffen entfalten kann, so sind jedenfalls in den meisten Fällen die Oberflächen ihrer Planeten noch glühend, sie sind also die Sonnen in diesen sekundären Systemen. In schwachem Maße ist dies heute noch der Fall für das System des Jupiter.
Noch eine andere geradezu raffinierte Vorrichtung hat die Natur getroffen, um die dunkeln Weltkörper so viel als möglich von der strahlenden Wirkung ihres Hauptkörpers aufsaugen zu lassen, wenn es damit zu Ende zu gehen droht. Nachdem die Monde sich ihren Planeten oder diese ihrer Sonne bereits beträchtlich genähert haben, beginnen die größeren Körper die sie umlaufenden kleineren derart zu beeinflussen, daß sie deren Umschwung um ihre Achse immer mehr verlangsamen, bis dieser ebensogroß geworden ist, wie ihre Umlaufszeit; dann wendet also der betreffende sekundäre Körper dem Zentralkörper immer dieselbe Seite zu, wie es heute für die Erde beim Monde und wahrscheinlich auch entsprechend bei allen anderen Monden der Fall ist. Solange also die Strahlung des Zentralkörpers noch sehr groß ist, dreht sich der abhängige Körper sehr schnell um seine Achse und läßt deshalb jeden Teil seiner Oberfläche nur kürzere Zeit dieser allzustarken Strahlung ausgesetzt, damit nicht unter der anhaltenden Sonnenglut alles Leben immer wieder vernichtet werden könne. Je mehr aber mit der Zeit die Strahlung abnimmt, desto länger läßt sich auch der Sekundärkörper bestrahlen, desto größer wird seine Tageslänge, und schließlich wendet er dem Lebenswärme spendenden Zentralherde nur noch ein und dieselbe Seite zu, damit wenigstens die Hälfte seiner Welt noch genügende Strahlung empfange, ehe alles zugrunde gehen muß. Bei den beiden sonnennächsten Planeten Merkur und Venus scheinen solche Verhältnisse jetzt schon eingetreten zu sein, doch hat man die Realität der betreffenden Beobachtungen in jüngerer Zeit wieder angezweifelt.
Bei dieser fortdauernden Annäherung wird nun der Aufsturz der Monde auf ihre Planeten und dieser auf ihre Sonne das Ende sein. Zuerst müssen die Monde sich mit ihren Planeten vereinigen, weil ihr Weg bis dahin der geringere ist. Alle Planeten außer der Erde und dem am entferntesten stehenden Neptun haben mehrere Monde, wenn sie deren überhaupt haben. Mars hat zwei, Jupiter fünf, Saturn acht, Uranus vier Trabanten. Es ist kaum zu zweifeln, daß auch Neptun mehrere Monde besitzt, die wir nur wegen der großen Entfernung nicht mehr sehen können. Fällt nun der innerste dieser Monde eines Systems zunächst auf seinen Planeten, so wird das für ihn ein Weltuntergang sein, wenigstens wenn der Mond nicht allzuklein ist. Solcher Weltuntergänge stehen also allen Planeten noch so viele bevor, wie sie Monde besitzen; der Erde ist einer sicher.
Aber dieser Aufsturz wird nicht so ohne weiteres geschehen. Die Natur bereitet ihn von langer Hand vor und hat auch hier wieder Schutzvorkehrungen erfunden, um die Katastrophe nach Möglichkeit zu mildern. Je mehr sich der Körper seinem Anziehungszentrum nähert, desto schneller umkreist er ihn in immer engeren Bahnen. Da muß nun, wenn der Körper einen etwas größeren Durchmesser hat, dasselbe eintreten, was wir bei den der Sonne zu nahe kommenden Kometen schon verfolgt haben, die durch den Widerstreit der verschiedenen Anziehungskraft zwischen den näheren und entfernteren Partien auseinandergerissen werden. Wie fest der Körper auch sein mag, er wird allmählich zerbröckeln müssen, und die Brocken verteilen sich ebenso wie die Sternschnuppen längs der Bahn des zerfallenden Trabanten. Erwägen wir alles genau, so ist es kaum zweifelhaft, daß wir in den Ringen des Saturn solch ein Produkt der auflösenden Kraft der Massenanziehung vor uns haben, zerbröckelte Monde des Saturn. Daß sie aus einzelnen kleinen, für sich beweglichen Trümmern bestehen, ist nachgewiesen worden. Im Innern des Systems der leuchtenden Ringe sieht man einen »Schleierring«, der wahrscheinlich aus versprengten Stücken des ersteren besteht, die in Kollision geraten sind, dabei einen Teil ihrer Bewegungskraft verloren haben und nun in spiraligen Bahnen auf den Saturn stürzen, als eine besondere Art von Meteoriten, die ihm wahrscheinlich bei seiner noch sehr dichten Atmosphäre keinerlei Schaden tun. Es ist wohl möglich, daß mit der Zeit die Masse des ganzen Ringes auf diese Weise langsam sich wieder mit dem Saturn vereinigt, ohne daß es überhaupt zu irgendeiner Katastrophe kommt.
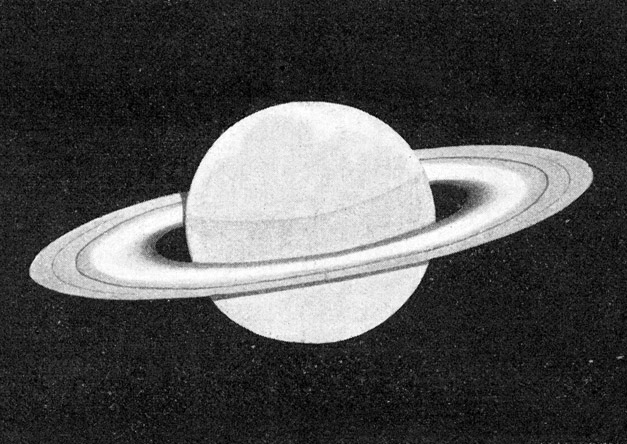
Saturn mit seinen Ringen.
Ist aber der betreffende Mond nur klein, so findet jene zerbröckelnde Wirkung der Anziehungskraft, die im Prinzip mit derjenigen Anziehung vergleichbar ist, durch die der Mond bei uns Ebbe und Flut erzeugt, nicht mehr, oder doch nur in zu schwachem Maße statt. Kleinere Monde können also auf ihren Planeten auch als solche herabfallen. Immerhin kann ein solcher Mond noch groß genug sein, um nicht nur alles Leben auf seinem Planeten zu vernichten, sondern ihn auch so hell aufleuchten zu lassen, daß er fernen Welten als ein neuer Stern erscheint, der plötzlich aufflammt, um erst nach Monaten oder Jahren wieder zu erlöschen. Mit der Lichtstrahlung hört aber noch lange nicht die der Wärme auf, die nun den anderen Monden des Systems wieder zugute kommt. Durch seinen eigenen Untergang erhält jener Mond die Lebensfähigkeit seiner Geschwister. Nicht vergebens wurde eine Welt geopfert. Und ebenso muß auch die Sonne ihre eigenen Kinder, die Planeten, wieder verschlingen, um die überlebenden zu erhalten, solange es irgend möglich ist.
Eine ganze Reihe von Umständen spricht nun dafür, daß die Erde einstmals noch einen zweiten kleineren Mond besessen hat, der auf sie stürzte, und daß es dieser war, der alle jene Umwälzungen hervorbrachte, die in jener Tertiärzeit vor sich gingen, wo der Absturz der Andenkette und die Vertiefung des Großen Ozeans eintrat, die Erdachse verschoben wurde, deren nachwirkende Erzitterungen wir heute noch beobachten, und endlich als letzte Folgeerscheinungen die wechselnden Eiszeiten ihre 1000 m dicken Kristallpanzer über weite Länderstrecken Leben erwürgend hinausschoben. Jupiter besitzt augenblicklich noch einen derart kleinen Mond, der sich ihm sehr nahe befindet; auch dieser muß einmal auf den großen Planeten stürzen, wenn auch noch Jahrmillionen darüber hingehen können. Die Astronomen kommender Geschlechter auf Erden werden einmal den Zeitpunkt vorhersagen können, und die Erde wird dann Zeuge einer Katastrophe sein, die einer benachbarten Welt vorhergesehenermaßen zustößt und dort eine geologische Umwälzung hervorzurufen bestimmt ist. Aber auch dieser Mond würde nicht imstande sein, alles Leben auf einem Weltkörper wie Jupiter zu vernichten, wie es ja auch jener vermutete Erdmond nicht vermochte. Er schnitt nur eine mächtige Cäsur in die Wellenbewegung der allgemeinen Weltentwicklung ein, und es scheint, wie wir oben sahen, daß diese Wiedervereinigung der Monde mit ihren Planeten zu allzu radikalen Katastrophen gar nicht oder doch nur in Ausnahmsfällen führen könne, da eben von einer bestimmten relativen Größe des Mondes zu seinem Planeten an seine vorherige Zerstückelung und Umbildung zu einem Ringe stattfindet. So wird es nicht möglich sein, daß unser gegenwärtiger Mond einmal als solcher auf die Erde stürzt, wodurch allerdings wohl ein so bedeutender Hitzegrad erzeugt werden müßte, daß alles Leben auf ihrer Oberfläche dadurch vernichtet würde; außerdem würde ja schon allein die allgemeine Erschütterung beim Aufprall eines solchen Körpers alles zertrümmern. Der Mond muß sich längst vorher in einen Ring aufgelöst haben, der dann die Erde umfaßt, um ihrem Himmel ein ganz eigenartiges Aussehen zu verleihen: So wunderbaren Wandlungen unterliegt im Laufe geologischer Zeitalter selbst der Himmel, der uns Eintagsfliegen im Werdeprozesse der Welten so ganz unveränderlich erscheint! Einen Anfang zu einer solchen Umbildung zeigt der Mond schon jetzt. Er ist in der Richtung nach der Erde hin verlängert, so daß er etwa Eiform besitzt; an dieser Verlängerung hält ihn die Erde gewissermaßen fest, so daß sie nur ein wenig um die Richtung nach uns hin und her pendelt. Bei weiterer Annäherung des Mondes muß diese Verlängerung immer größer werden, und schließlich beginnt dann von der zugespitzten Stelle sich nach und nach etwas abzubröckeln, Sand, Staub, Felsstücke, und das alles breitet sich langsam auf dem Bahnumfange ans. Also auch in diesem Stadium des Lebens der Weltkörper sehen wir, wie die Natur überall für die Erhaltung der geschaffenen Organisationen sorgt, solange es nur irgend möglich ist.
Dieses selbe Spiel muß nun zwischen der Sonne und den Planeten stattfinden. Einer nach dem anderen muß sich mit ihr wieder vereinigen. Mag dies nun durch einen einmaligen Aufsturz geschehen, oder mag die Masse des Planeten, in einen Ring aufgelöst, ganz allmählich herabfallen, immer muß dabei eine beträchtliche Wärmemenge freigemacht werden, die der zu jenen fernen Zeiten im Erlöschen begriffenen Sonne neue Lebenskraft zuführt, entweder plötzlich, indem sie als neuer Stern aufflackert, oder in ganz langsam zufließenden Raten.
Aber endlich muß doch einmal der letzte Planet auf seine Sonne gestürzt und die letzte dadurch erzeugte Wärme in den Weltraum hinausgestrahlt sein. Alle Materie, die einst das reiche Sonnensystem aufgebaut hatte, ist zu einer ungeheuren kalten, dunklen Masse geworden, die, innerlich regungslos, sich durch den leeren Weltraum wälzt, ohne Aufgabe, ohne Ziel. Das ist das letzte, das allerletzte Ende einer Welt. Was könnte sie jemals wieder zum Leben erwecken, nachdem alle Kraftquellen der Natur versiegten?
Alle Massen bewegen sich rastlos durch den Raum. Keine Sonne am Himmel steht still. Mit ungeheuren Geschwindigkeiten rasen sie weiter und weiter, was auch sonst mit ihnen geschehen mag. Auch die ausgelebte Sonne setzt ihren Weg fort. Die gewaltigen Kräfte, die sie treiben, sind ihr durch alle Weltuntergänge erhalten geblieben. Aber sie kann dieselben nicht für sich selbst verwerten, denn nur Differenzen von Bewegungen können innere Wirkungen erzeugen. Zu jeder Änderung einer Bewegung aber gehört eine Kraft, nicht mehr zu ihrer Fortdauer, wie das Gesetz des Beharrungsvermögens besagt, das oberste von allen, die das Weltall regieren. Diese Kraft aber fehlt, es sei denn, daß voll außen her noch andere Körper eine wechselnde Wirkung auf jene tote Masse übten.
Wir wissen nun, wie unermeßlich große Zwischenräume wenigstens in den Teilen des Milchstraßensystems, dem unsere Sonne zugeteilt ist, die einzelnen Sonnen voneinander trennen. Es werden sicher Tausende von Millionen Jahre vergehen müssen, bis zwei von ihnen sich einander so sehr nähern können, daß ihre gegenseitige Anziehung nun wieder besondere und wechselnde Bewegungen ihrer Massen erzeugen. Aber schließlich muß der Fall doch einmal eintreten. Führt ihr Weg die beiden Sonnen nicht sehr nahe aneinander vorbei, so werden sie gegenseitig nur ihre Bahn ein wenig beeinflussen und sich dann auf immer wieder voneinander entfernen. Es war nur eine Episode in ihrem Dasein. Anders dagegen, wenn die Sonnen einander so nahe kommen, daß sie in den Bereich etwa noch vorhandener Planeten der einen oder der anderen geraten. Dann wird die Ordnung dieses Systems natürlich völlig zerstört, und es kann sich ereignen, daß die größere der beiden Sonnen die kleinere ebenso zwingt, zu ihrer Vasallin zu werden, wie unsere Sonne mit Hilfe ihrer Planeten Kometen einfängt. Es entsteht ein System von Doppelsonnen, in dem die eine meist in sehr langgestreckten Bahnellipsen die andere umkreisen muß; aus gleichen Gründen müssen ja auch die Bahnen der periodischen Kometen im allgemeinen so langgestreckt sein. Solcher » Doppelsterne« gibt es nun eine große Anzahl am Himmel, und alle haben sie dieses Kennzeichen der sehr langen Bahnellipsen, das zeigt, daß beide Sterne eigentlich nur lose zusammengehören, nicht so wie etwa Jupiter zur Sonne.
Viele dieser Sternpaare befinden sich wenigstens scheinbar ganz ungemein nahe beieinander, und es gibt eine ganze Reihe, die selbst in den besten Fernrohren nur wie ein Stern erscheinen, während man im Spektroskop an ihren Liniensystemen, die sich gegeneinander in bestimmten Perioden verschieben, erkennt, daß es in Wirklichkeit zwei Sterne sind, die einander in unmittelbarer Nähe meist sehr schnell umkreisen. Andere, wie der berühmte Stern Algol im Perseus, nehmen so regelmäßig an Helligkeit ab und zu, daß man dies nur durch die Annahme erklären kann, ein dunkler Körper bewege sich mit einen hellen und verdecke dadurch teilweise sein Licht für uns, wie es der Mond bei einer Sonnenfinsternis tut. Dabei folgte dann weiter, daß beide Körper nicht sehr verschieden an Größe sein konnten und sich einander sehr nahe befinden mußten, so daß sie sich beinahe berühren. Hier liegen zwei Sonnen, eine dunkle, ausgelebte, und eine noch leuchtende, in fürchterlichem Zweikampfe, indem sie, miteinander ringend, sich enger und enger umschließen. Zwei fast ebenbürtige Rivalinnen kamen einander zu nahe, und in dem allzugleichen Kampfe müssen beide unterliegen, um ein Neues aus ihrer unvermeidlichen Vereinigung zu bilden. Der Zusammensturz ist unvermeidlich. Auch hier mag das Vorhandensein von Ringen um die eine Sonne, die durch den Zerfall von Planeten entstanden sind, und in welche die andere Sonne bei jener großen Annäherung gerät, den Fall beschleunigen.
Diese Vereinigung bedeutet das Ende zweier Welten und den Anfang einer neuen größeren. Alle Lebenskeime, die auf der einen von ihnen vielleicht noch latent enthalten sein mochten, sind ein für allemal zerstört, und, wenn die oben vertretene Deutung der Erscheinungen an dem neuen Stern im Perseus das Rechte treffen, so werden auch alle chemischen Verbindungen, alle Atome, aufgelöst in die letzten Uratome, in die Elektronen. Mit maximaler Geschwindigkeit, der des Lichtes, eilen sie in den Raum hinaus und haben nun wieder ihre größte lebendige Kraft gewonnen, mit der sie die neue Welt aufzubauen imstande sind, wie sie die beiden zerstörten ja auch allein aus dieser lebendigen Kraft heraus geschaffen haben müssen. Hier enden unsere Betrachtungen und müssen die über die Entstehung der Welten beginnen, die in einem anderen Bändchen dieser Sammlung verfolgt worden sind Dr M. Wilh. Meyer, Weltschöpfung. (Stuttgart, Franckh'sche Verlagshandlung. M1.-..
Aber eine Betrachtung kann ich mir hier nicht versagen, wie hypothetisch sie auch sein mag. Bis eine ausgelebte, wenigstens an ihrer Oberfläche völlig ausgekühlte größere Masse, die sich aus der Wiedervereinigung eines Systems von Weltkörpern gebildet hat, einer anderen großen Masse begegnet, die in der geschilderten Weise ihre Wiederbelebung bewirken kann, vergehen zweifellos auch nach kosmischen Begriffen ungeheure Zeitläufe. Nach alledem, was wir über die betreffenden Dinge schon weiter oben erfahren haben, ist es nun sehr wohl möglich, daß die Natur diese lange Zwischenzeit von vielleicht Tausenden von Millionen Jahren, während der diese Massen starr und untätig durch den dunklen Weltraum ziehen müssen, keiner Organisation der Natur mehr dienend, dazu benützt, um diese Massen auf den neuen Kreislauf der Weltentwicklung, dem sie entgegengehen, innerlich vorzubereiten, etwa so wie hinter dem abfallenden Blatte sich bereits die neue Knospe vorbildet, die den ganzen Winter hindurch längst fertig unter der schützenden Rinde ruht, der Auferweckung durch den Frühling harrend. Wir wissen ja, daß ein Weltkörper noch eine mächtige Glut in seinem Innern bergen kann, wenn seine äußere Schale längst felsenstarr geworden ist. Selbst, wenn auf der Oberfläche bereits die maximale Kälte herrscht, kann der Kern eines Weltkörpers noch im Zustande heißer, allerdings stark zusammengepreßter Gase sein. Je mehr aber solch ein Körper durch die Kälte und seine Eigenschwere zusammengepreßt werden muß, desto vollkommener sind die Bedingungen für die Bildung jener schweren Radiumatome vorhanden, die nur unter starkem Drucke oder sonst abnormen Bedingungen, die im tiefsten Innern der Weltkörper herrschen, entwicklungs- und bestandfähig zu sein scheinen. Es ist also wohl möglich, daß jene lange Zwischenzeit zwischen dem Absterben eines Weltkörpers und seiner Wiedergeburt in einem neuen Weltfrühling, dazu angewendet wird, in seinem Innern Radium und ähnliche Stoffe zu bilden, deren befreite kleinste Teile sich in ihre Uratome verstäuben. Es formt sich im Innern des im Winterschlafe liegenden Weltkörpers eben gewissermaßen die Knospe, deren Hülle bei der stürmischen Vereinigung zweier Weltkörper gesprengt wird, daß sie nun den Samen einer neuen Welt, die Uratome, verstreuen kann.
So kommen wir auch auf den Anfang unserer Betrachtungen zurück, wo wir die Weltkörper mit lebendigen Organismen verglichen. Wir sahen, wie auch jene einer Lebensentwicklung unterworfen sind, wie sie geboren werden, emporwachsen, Samen und Früchte treiben, wie sie im Kampfe ums Dasein, der auch ihnen nicht erspart ist, Unfälle erleiden und eines unnatürlichen Todes sterben können, aber wie die Natur auch für sie mütterlich sorgt und sie durch alle erdenklichen Vorsichtsmaßregeln gegen solche vorzeitigen Unfälle schützt. Wir erkannten weiter, indem wir namentlich die Verhältnisse auf unserer Erde dabei ins Auge faßten, daß ein Weltkörper aus sich selbst heraus in seiner natürlichen Entwicklung alle Bedingungen in sich trägt, die einem ruhigen Auswachsen dienen, wenn auch im Kampfe der schaffenden Elemente miteinander manche Katastrophe unvermeidlich bleibt. Eingriffe von außen her in diese ruhige Weiterentwicklung werden zwar stets stattfinden, weil ja die Erde wie jeder Weltkörper kein für sich abgeschlossenes Wesen ist, aber wir haben auch gesehen, wie solche Einwirkungen, soweit sie von bekannten Körpern ausgehen, eine Weltkatastrophe nicht hervorrufen können. Die unbekannten Dinge aber, deren Vorhandensein wir wohl anerkennen müssen, zu fürchten, wäre ebenso töricht, als wenn wir wegen jeden Ziegelsteins um unser Leben bangen wollten, der vom Dache fallen kann. Ebenso sicher, wie wir sagen konnten, daß einer wohlorganisierten Welt wie unserer Erde, nicht leicht ein verderblicher Unfall zustoßen kann, so sicher erfuhren wir, daß im normalen Laufe der Dinge ihnen allen ein Ende bevorsteht, wie allem Geschaffenen. Aber auch hier ist, wie in der Welt der lebenden Organismen, der Tod nicht vollkommen. Die Atome geben nur die Art von Vereinigung, in der sie ihre Kraft verbraucht hatten, auf, um eine neue andersartige Vereinigung zu bilden. Jeder Tod ist zugleich eine Auferstehung, und aus den Gräbern blüht das Leben.
Muß auch oft im schweren Kampfe um die materiellen oder idealen Güter der Welt der Einzelne unterliegen, so daß die verhängnisvolle Katastrophe für ihn der Untergang seiner Welt ist, so war er doch immer nur ein Atom im Weltganzen, und die Zerstörung der kleineren Organisation diente dem Aufbau einer größeren.
Alles dient allem. Auch das Unglück und im höchsten Maße der Tod, ist etwas Notwendiges, Heilsames, das der Emporentwicklung des Ganzen dient. Wir sollten, in höherer Erkenntnis, den Tod mehr und mehr seiner Schrecken entkleiden.