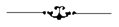|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Meiner Frau
Auf Anordnung der Königlichen Staatsanwaltschaft zu Hannover wurde Abu Becker am 8. Januar 1888 nachmittags vier Uhr in Altona bei Hamburg festgenommen.
Damit fand die Tätigkeit eines vielgewandten und weitbekannten Mannes ihren vorläufigen Abschluß.
Joseph von Heidenstamm war einer der ersten, der in Hannover von der überraschenden und zunächst fast unglaublich klingenden Nachricht Kenntnis erhielt. Es war abends zehn Uhr, als er vom Hotel Kasten her über die Georgstraße ging, ganz in seinen Pelz gewickelt, die Mütze tief ins Gesicht gedrückt und so von dem Schneegestöber eingehüllt, daß Franz Zestow, der ihm entgegenkam, ihn auf den ersten Blick nicht erkannte.
»Joseph?«
»Ja.«
»Bist du's?«
»Natürlich.«
»Weißt du das Neueste?«
»Was denn?«
»Sie haben Abu heute nachmittag verhaftet! In Hamburg.«
»Rede keinen Unsinn.«
»Auf Wort. Er sitzt. Den lassen sie vor zwanzig Jahren nicht wieder los. Was sagst du dazu?«
»Das ist gar nicht möglich.«
»Ich sage dir, es ist Tatsache. Wieviel schuldest du ihm?«
»Zehn Mille.«
»Dann gratuliere ich dir, mein lieber Joseph. Die zehn Mille kriegt Abu im Leben nicht wieder. Er hat dich begaunert, mich begaunert, die halbe Christenheit begaunert. Mit diesem Abu wird eine Abrechnung gehalten!«
Joseph war stumm vor Ueberraschung. Er hatte verschiedene »Geschäftsfreunde«, die ihm mit ihren Quälereien das Dasein verbitterten, aber Abu übertraf alle. Sowohl durch die Höhe der Schuldforderung als auch durch die außerordentliche Zähigkeit, mit welcher er die Rechtsmittel des preußischen Gesetzbuches in Anwendung brachte. Seit einem Jahre beabsichtigte Joseph zu heiraten, aber Abu hätte das unter keinen Umständen gelitten. Er äußerte wiederholt, daß er über eine vernünftige, gut fundamentierte Ehe sich freuen würde, aufrichtig, aber er könnte unmöglich in eine Heirat willigen, die Herrn von Heidenstamms finanziellen Ruin herbeiführen mußte.
Hannover ist eine sehr hübsche Stadt. Sie hat zweimalhunderttausend Einwohner und führt den Namen einer Königlichen Residenzstadt. Sie besitzt große Theater, eine Rennbahn, Wälder, Parks, eine exquisite Meute und das beste und berühmteste Reitgelände der Monarchie. Sie ist das Paradies der Kavallerie-Offiziere, und was Heidelberg für die Studenten, das ist Hannover mit seiner Militärreitschule für die Leutnants.
Joseph gebrauchte eine kleine Weile, um die zwei Dutzend Konsequenzen von Abus Verhaftung zu überdenken, dann packte er den kleinen Zestow im Schneegestöber um die Schulter:
»Wenn das wahr ist, Franz, dann geb' ich eine Sektbowle, heute nacht noch. Bei Kasten. Donnerwetter, wenn das Faktum ist!!«
»Das ist Faktum!«
»Dann stell' ich ganz Hannover auf den Kopf! Bei Gott, das tu' ich!«
Er hieb mit seiner Faust im weißen Lederhandschuh dem andern so derb auf die Schulter, daß der Husar fast in die Kniee kam.
»Verdammt, Joseph, gewöhn dir das ab! Das ist eine verdammte Manier. Deine Pfote ist nicht von Watte!«
Joseph lachte ausgelassen. »Dann reiß' ich Bäume aus der Erde, wenn das wahr ist.« Er reckte die Arme, daß der Schnee von seinem Mantel stiebte. Aber plötzlich wurde er ernst.
»Herrgott, wenn das meine Braut erfährt! Wenn Marie das hört morgen früh!«
»Was?«
»Das mit Abu. Daß der Schuft mich nicht mehr quälen kann! Wie spät ist es? – Viertel elf. Ob ich noch hin kann? Zu Marie? Ob das Haus noch offen ist?«
»Wie kann das Haus noch offen sein!«
»Vielleicht schläft sie auch schon.«
»Natürlich schläft sie schon. Mach jetzt keinen Unsinn, sondern komm zu Kasten. Wir müssen Sporleder treffen und Rochus Rohrbeck und die andern.«
»Ja, ja. Es ist zu spät, natürlich. Aber schade! Das Gesicht, das Marie machen wird – hm – das hätte ich gern heut noch gesehen.«
. . . In dieser Nacht gab es im Hotel Kasten zu Hannover ein Bacchanal. Es hielt schwer, jeden einzelnen der durch Eilboten citierten und nach und nach eintreffenden Schuldner Abus von der Wahrheit der Tatsache zu überzeugen; jeder hielt es für Ulk, für einen schlechten Scherz, bis jedesmal von neuem der Sachverhalt unter einem Getose von Lachen und Zwischenrufen erzählt war, und der Ungläubige zu glauben begann.
Es war eine Sensation, ein Ereignis.
Oben an der Tafel saß Heidenstamm mit seinem liebenswürdigen, famosen Jungengesicht, das wie Feuer glühte. Neben ihm saß sein Freund Graf Rochus Rohrbeck, der Kürassier. Seine dicken, blonden Haare, die über Tag nur durch die große Kunst des Friseurs in Ordnung gehalten wurden, hingen dem Ostpreußen in Strähnen über Stirn und Schläfen. Mit seiner Bärenstimme, die durch den tollen Lärm über den langen Tisch fortschallte, rief er den Kellner:
»Heda, Karl!«
»Herr Graf?«
»Papier und Tinte, aber fix!«
»Rochus will einen Brief schreiben!«
»Nein, Kinder, aber addieren. – Joseph, du schreibst, du kannst besser rechnen. – Sporleder, du fängst an. Wieviel schuldest du Abu?«
»Sechstausendfünfhundert.«
»Schreib, Joseph: sechs, fünfhundert. – Krosseck?«
»Drei.«
»Mille?«
»Natürlich.«
»Heinrich?«
»Fünf.«
»Fünf!« rief Joseph. Und mit der Laune eines Schuljungen, der irgend einer heillosen Affaire glücklich entronnen ist, schrieb er sein Register. Eine horrende Summe kam da zusammen, so groß, daß kurze Zeit selbst die Ausgelassensten stutzig wurden.
»Donnerwetter, ja!«
Abu Becker hatte sich da ein niedliches Conto zusammengewuchert, alle Achtung. Aber freilich, er war immer ein Spezialist gewesen, der das Feld seiner Tätigkeit auf die harmlose, geldbedürftige, lebenslustige und höchst unwirtschaftliche Reitschule beschränkte.
Natürlich unterließ man nicht in dieser Nacht, die allerwichtigste Frage zu diskutieren: »Was wird nun werden?« Sehr seltsame juristische Gutachten wurden dabei zu Tage gefördert.
Nicht einer zweifelte daran, daß Abu Beckers Macht ein für allemal gebrochen sei. Eine gerechte Justiz, so kalkulierten die Leutnants, hat sich von Abus Gemeinheiten überzeugt, und da sie verpflichtet ist, über das Wohl aller Staatsbürger, also auch der Reitschüler, zu wachen, hat sie kurz entschlossen ihn eingesperrt.
Jemand, der hinter Schloß und Riegel sitzt, kann keine Mahnbriefe schreiben, keine Zinsen einziehen, niemand auflauern und keinem Menschen die Pferde abpfänden. John Becker aus Hamburg, den die Leutnants seit undenklichen Zeiten »Abu« nannten, existierte nicht mehr.
Vielfach wurden Wetten über die Frage abgeschlossen, wie lange Abu dem öffentlichen Leben ferngehalten werden würde, ob auf Monate, ob auf Jahre oder vielleicht gar auf Lebenszeit. Diese letztere Hoffnung, so über alle Maßen schön sie auch sein mochte, schien natürlich auch der naivsten Seele unwahrscheinlich. Aber die Insassen der Reitschule gehörten nie zu den Leuten, die in grüblerischer Selbstquälerei sich um fernliegende Zeiten sorgen.
In dieser Nacht tauten eingefrorene Leutnantsseelen zu neuem Leben auf, gequälte Herzen fanden zum ersten Male wieder Freude an einem guten Glase; und während Abu in seiner einsamen Zelle zu Altona schlaflos auf einer jämmerlichen Pritsche lag, feierten seine guten Bekannten zu Hannover ein Freudenfest. Nie wurde die Inhaftnahme eines Geschäftsmannes von seinen Klienten durch ein gleich großartiges und kostspieliges Gelage quittiert.
Nicht einer an der tollen Tafelrunde ahnte, daß Abus Einsperrung das erste dumpfe Grollen eines aus weiter Ferne heranziehenden Gewitters bedeutete, eines Unwetters, das im Mai desselben Jahres sich über die arme Reitschule mit sehr schweren Schlägen entladen sollte.
*
Die Stadt Hannover ist berühmt durch ihre hübschen Mädchen. Sie sind groß und gut proportioniert, ähnlich dem englischen Typ, nur von etwas derberem Bau. Der niedersächsische Stamm kommt in diesen Mädchen, allerdings durch die städtische Kultur und fremde Einflüsse einigermaßen verfeinert, ausgezeichnet zur Geltung.
Am hübschesten sind sie zwischen fünfzehn und achtzehn. Die eckigen Formen und das Ungraziöse in der Haltung der jüngeren Dinger, das einigermaßen an die täppische, wenn auch niedliche Ungelenkigkeit der Füllen erinnert, ist mit einem Schlage verschwunden, und große, schöne Mädchen mit gerader Haltung und festen Schritten wandeln über die breite Georgstraße. Mit sechzehn lassen sie noch die langen blonden Zöpfe über den Rücken fallen, aber mit siebzehn sind sie junge Damen geworden, die ihre schweren Flechten unter den Hut stecken. Sie haben nicht die Grazie der Französin oder der Polin oder ihrer Schwestern im Süden des Reiches, aber sie haben die Grazie der Jugend. Sie machen den Versuch, sehr kleine Handschuhe und sehr kleine Stiefel zu tragen, weil das im übrigen Europa Mode ist, sie schnüren auch ihre junge Taille mit allen Mitteln einer fremden Kunst, aber Hände und Füße und Taille setzen diesen Verschönerungsabsichten einen unbesieglichen Widerstand entgegen.
Jedesmal, wenn der alte Kavalleriegeneral von Dewitz, Excellenz, nach Hannover kam, um die Reitschule zu inspizieren, ging er mittags zwischen zwölf und eins vor dem Hoftheater spazieren, nicht um das Promenadekonzert anzuhören, sondern um diese großen blonden Mädchen wieder einmal zu beobachten.
»Das ist Rasse, lieber Freund,« sagte er zu seinem Adjutanten, »Mädels, an denen man seine Freude haben kann. Das ist nichts Halbes, nichts Zimperliches, das sind Mütter. Garantie für ganze Generationen. Sehen Sie mal die da, da drüben, die Hellblonde. Die roten Backen und der Schritt! Jeder Schritt einen Meter zwanzig! Das ist für einen alten Soldaten ein Labsal und eine Erquickung.«
Aber wenn er abends kurz vor der Abfahrt bei seiner Cousine Frau von Schulenberg den Tee genommen und von ihr und Marie sich verabschiedet hatte und saß wieder in dem Coupé erster Klasse und war kurz vor Oebisfelde mit seiner ersten langen Henry Clay zu Ende, dann gab er sich einen kurzen Ruck und unterbrach das lange Schweigen, indem er dem Adjutanten auf die Schulter klopfte:
»Wissen Sie, welches die Hübscheste war?«
»Jawohl, Excellenz.«
»Nämlich?«
»Fräulein von Schulenberg.«
»Sehr richtig.«
Und wenn er in der Nähe von Rathenow seine zweite Zigarre verpafft hatte, nun schon nahe bei Berlin, das er so wenig liebte, und in dem er doch drei Viertel seines Lebens hatte zubringen müssen, dann unterbrach er zum zweiten Male das Schweigen und klopfte dem Rittmeister zum zweiten Male auf die Schulter:
»Ich war ihr Pate.«
»Ich weiß, Excellenz.«
»Geboren siebzig, am Tage von Marie-aux-Chênes, wo ihr Vater totgeschossen wurde.«
»Ein jammervolles Verhängnis,« sagte der Adjutant, der diese Geschichte auswendig wußte, aber notgedrungen sich jedesmal so stellte, als ob die Schicksale der Schulenbergs ihm absolut unbekannt seien.
Dann, kurz vor der Einfahrt in Berlin, wenn man schon Charlottenburg passiert hatte und der Rittmeister das Handgepäck zusammenlegte, kam die Excellenz zum dritten und letzten Male auf Fräulein Marie zu sprechen.
»Ist verlobt. Seit Sommer. Joseph Heidenstamm, famoser Reiter. Verlobung mir viel Freude gemacht. Guter Junge. Gibt 'ne Prachtehe.«
Und der Rittmeister, der nach einer zehnjährigen Erfahrung an Prachtehen durchaus nicht mehr glaubte, nickte apathisch:
»Gewiß, gewiß!«
*
Welche weithin rollende Freudenwellen, seltsam zu sagen, Abu Beckers Festsetzung emporwarf, und wie diese Wellen sogar in die Kreise stiller Familien sich fortpflanzten, dafür war der Glückstaumel des jungen Fräulein von Schulenberg ein wunderliches Beispiel.
Sie wollte es nicht glauben und hielt ihre beiden schlanken Arme so fest um Josephs Nacken gepreßt, daß er fast erstickte.
»Es ist ja gar nicht möglich. Dann wären wir ja aller Sorgen ledig. Du, Joseph?! Dann können wir ja heiraten, du?!«
»Natürlich. Aber um Gottes willen, laß los! Ich kann nicht atmen.«
»Sollst du auch nicht!« Und sie zog ihn mit ihren kräftigen Händen einen Moment noch dichter an sich.
»Wir heiraten im Mai, sag ja!«
»Ja, gewiß!«
»Joseph, eins schwörst du mir!«
»Was?«
»Du spielst nie wieder Karten. Dadurch ist alles Unglück über uns gekommen. Denke dein ganzes Leben an diese letzten sechs Monate, wie ich mich um dich geängstigt und gesorgt habe. Jede Nacht habe ich geweint, wahrhaftig, Joseph.«
Er lachte ausgelassen: »Das hätte ich sehen mögen!« und sie lachte auch: »Aber es ist wahr.«
Sie holte Hut und Mantel und ging mit ihm die Georgstraße entlang, auf der Hunderte von Menschen beschäftigt waren, mit Schaufel und Besen den fußhoch liegenden Schnee beiseite zu räumen. Joseph im Pelzmantel und mit den hohen, sporenklirrenden Stiefeln sah brillant aus, lebenslustig wie nie, das etwas schmale, aber derbgesunde Gesicht von Frost und Freude gerötet. Hier auf der Georgstraße kannte ihn jeder Mensch:
»Da geht Joseph Heidenstamm, da drüben, mit seiner Braut.«
Er hatte von Frühling bis Herbst 1887 alle Reiterrekords der preußischen Armee geschlagen und sogar seinen berühmten Bruder weit hinter sich gelassen. In keiner Stadt der Welt werden dergleichen Bravourstücke höher taxiert und besser gewürdigt als in der alten Reiterstadt Hannover.
»Joseph hat siebenundsechzig Rennen gewonnen, darunter die ›Armee‹. Er reitet oft miserable Pferde und gewinnt doch. Er kann alles.«
Das wußte in Hannover jeder Straßenjunge, und jeder Straßenjunge sprach von dem Baron von Heidenstamm nie andere als von »Joseph«.
Jeder Mensch hätte Marie Schulenberg um einen solchen Bräutigam beneidet, wenn sie nicht eben – Marie Schulenberg gewesen wäre.
So aber – und darüber war jedermann sich einig – war Joseph derjenige, den man zu beneiden hatte.
Ein solches Mädel! Ein famoses Mädel! Die Perle der Stadt!
Da ging sie in ihrer Pelzkappe und dem grünen, pelzbesetzten Jackett, das alle Welt kannte, weil Marie es schon im vorigen Winter getragen hatte; eine junge Dame ihres Standes konnte sich mit dem besten Willen nicht einfacher kleiden. Nur vorn an der Brust im dritten Knopfloch trug sie ein kleines Veilchenbouquet, das Joseph ihr mitgebracht hatte, das war ihr einziger Schmuck.
Niemand sah auf Joseph oder nur ganz flüchtig, jeder wandte sich um nach seiner schönen Braut. Sie sah strahlend aus, ganz von Glück übersonnt.
Seine hagere, sehnige Reiterfigur präsentierte sich neben Marie fast klein, obwohl er gut eine Handbreit größer war. Aber ihre schlanke Mädchengestalt mit den runden, weichen Linien ließ den Begleiter beinahe dürftig erscheinen. Er ging immer etwas vornübergebeugt, in nachlässiger Haltung, was ihm beim Regiment, namentlich in den ersten Jahren, manches Donnerwetter eingetragen hatte. Vielleicht fehlte ihm die Energie, sich das abzugewöhnen, und vielleicht war diese Haltung für sein ganzes Wesen charakteristisch. In entscheidenden Momenten besaß er die Fähigkeit, seinen scharfen Verstand oder die herkulischen Kräfte seines sehnigen Körpers auf das höchste Maß zu konzentrieren; in hundert andern Fällen ließ er sich gehen. Er war dann von einer Lässigkeit, die an Schwäche streifte.
»Joseph, halt dich gerade.«
»Ja, ja.«
Sie sagte ihm das alle paar Minuten, und wenn er sich dann einen Ruck gab, sah er mit einem Schlage wie verwandelt aus.
Auf der Georgstraße, die mit ihren breiten Parkanlagen, ihren monumentalen Gebäuden und dem großstädtischen Verkehr vielleicht die schönste deutsche Straße ist, flanierte um diese Mittagsstunde die ganze elegante Welt. Man sieht da die bunten Offiziersuniformen aller preußischen Kavallerieregimenter, dazwischen immer wieder das vornehme Weiß-Blau der hannoverschen Königsulanen, die nach ihren unzähligen Siegen auf der Rennbahn den Anspruch erheben, das beste Reiterregiment der Armee zu sein. Man sieht die Studenten der Hochschule in bunten Mützen, hübsche Jungen mit zerprügelten Gesichtern, und man sieht die eleganten Damen dieser reichen Industrie- und Beamten- und Offizierstadt, die alle auf der rechten Seite der Straße auf und ab wandeln und der Regimentsmusik lauschen, die vor dem Königlichen Theater konzertiert.
Das Brautpaar wurde von allen Bekannten liebenswürdig gegrüßt; man hatte die beiden gern, wie man die hübschen Leute überhaupt gern hat. Und dann lag über dem Paar ein so eigenartiger Zug von Zusammenpassen, der jedem, auch Fremden, unwillkürlich den Gedanken eingab: diese beiden gehören zusammen, »sie sind füreinander,« wie man trivial und ach! so oft unsinnig sagt, »wie geschaffen«.
Wer mit den Verhältnissen des Paares Bescheid wußte, und das wußte in Hannover ungefähr jeder Mensch, freute sich außerdem über diesen feinen Hauch von Romantik, der Joseph von Heidenstamm und seine Braut umgab. Denn erstens: sie waren beide so lächerlich jung, sie achtzehn und er kaum fünf Jahre älter, und zweitens. sie hatten sich aus wirklicher Liebe zusammengefunden. Ein junger Offizier mit einem notorisch nur minimalen Vermögen und ein Mädchen, das in geradezu kärglichen Verhältnissen groß geworden war! Und alle beide hätten die glänzendsten Partien machen können, ganz ohne Frage, ganz selbstverständlich.
Wem das strahlende Glück der beiden allzusehr in die Augen stach, und leider gab es solche Leute, mochte sich mit dem Gedanken trösten, daß die Zukunft auch diesen auserwählt Glücklichen mit unfehlbarer Sicherheit das notwendige Teil irdischer Lasten bringen werde.
»Sie bleibt nicht immer so hübsch, und er bleibt nicht immer so jung. Dann kommen die Kinder, dann kommen die Sorgen, und von der ganzen Herrlichkeit ist in zehn Jahren nichts übrig als eine kümmerliche, kleine Offiziersehe.«
Aber Joseph und seine junge Braut hörten nichts von solchen Reden. Sie gingen die Georgstraße entlang, bis das Gewühl der Spaziergänger weit hinter ihnen lag und der Schnee auf den Fußsteigen am Herrenhausener Tor, ungeschaufelt und ungefegt, sich vor ihnen türmte.
»Wollen wir weiter, Mieze?«
»Ja, natürlich.«
Sie ließ seinen Arm los und schürzte mit beiden Händen das einfache Kleid, daß ihre hohen derben Stiefelchen unter dem weißen Unterkleid sichtbar wurden.
»So, nun vorwärts. Geh du voran, Joseph, ich trete in deine Fußspuren.«
So gingen sie eine Weile unter Lachen, weil es nicht leicht war, immer genau in seine Schneespur zu treffen. Oft trat sie fehl und versank dann so tief, daß ihr der Schnee die Strümpfe durchnäßte. Bis sie die Sache satt hatte, mit ein paar Sprüngen ihn einholte und sich an seinen Arm hing.
»Dummes Zeug! Ich laufe nicht hinter dir her, ich gehe neben dir. Ist das herrlich hier draußen! Der Schnee! Die Menge Schnee! Schade, daß wir keinen Schlitten haben!«
»Wir wollen zurück in die Stadt und einen mieten. Weißt du, das wäre eine Idee!«
Aber sie schüttelte den Kopf:
»Ach, Torheit! Immer Geld ausgeben. Außerdem; einen solchen Schlitten meine ich nicht. Ich meine einen kleinen, niedrigen Schlitten wie der, den ich damals zu Weihnachten bekam. Als ich sieben Jahre alt war und du Kadett warst, weißt du nicht mehr?«
»Natürlich. Ja, den müßten wir hier haben.«
»Du würdest mich ziehen als Pferd bis nach dem Georgengarten, und nachher würde ich dich ziehen. Ach, daß man schon so groß ist und darf so was alles nie mehr machen. Es war so schön, als man klein war, nicht wahr?«
»Na ja.«
»Meinst du nicht?«
»Doch, natürlich, aber ich finde, es ist jetzt hübscher.«
»Weil wir verlobt sind?«
»Ja, deshalb.«
Sie stampften durch den Schnee zwischen den weißbeschneiten Büschen des Georgengartens, die im Frühling in roter Fliederpracht duften und blühen, und an einem dieser Büsche blieben sie eine lange Weile stehen, um sich zu küssen.
Es war ganz still ringsum. Alles lag weiß, tot, nur die endlose Linie der Herrenhausener Allee zeichnete sich jenseits der Büsche scharf gegen den Himmel ab, und aus dieser Allee klang von Zeit zu Zeit das Glockengebimmel eines Schlittens herüber.
Mit der eigentümlichen Zähigkeit, die ihre Umgebung bisweilen ernstlich in Aerger versetzen konnte, kam Marie auf das Thema noch einmal zurück.
»Es war doch schön, Joseph, damals. Und lieb gehabt haben wir uns damals auch schon. Ich meine nicht nur so als Vetter und Cousine.«
Er zog sie an sich:
»Weißt du noch, wie wir uns geküßt haben? In den Osterferien, als ich nach Sekunda versetzt war? Wie lange ist das her? Mein Gott, schon sieben Jahre!«
»Schon sieben Jahre?«
Sie waren beide erstaunt über diese Riesenspanne Zeit, und es kam ihnen plötzlich vor, als seien sie Leute von gereiftem Alter, die auf eine sehr ferne Kinderzeit zurückschauen.
Nach einer Weile begann sie von neuem, und sie schmiegte sich im Vorwärtsschreiten enger an Joseph:
»Ich kann weit zurück denken, ich glaube, weiter als du. Ich weiß noch genau den Tag, als Albrecht mit dir nach Bensberg fuhr und dich zur Kadettenschule brachte. Wie alt warst du damals? Zwölf Jahre und ich sieben. Wir hatten dir eine Reisedecke gekauft, schwarz und mit gelben Streifen wie ein Tigerfell. Hast du die noch?«
»Gott bewahre.«
»Albrecht war damals noch Artillerie-Offizier, ich erinnere mich ganz genau; ich hatte Angst vor ihm, vielleicht weil er die schwarze Uniform trug.«
Joseph lachte, aber sie ärgerte sich darüber.
»Lach nicht. Lach überhaupt nicht immer, wenn ich erzähle. Ich habe vor deinem Bruder immer Angst gehabt. Und wenn –«
Sie brach ab. Sie hatte niemand, auch Joseph nicht, erzählt, daß Albrecht von Heidenstamm im Herbst vorigen Jahres um sie angehalten und sie ihn abgewiesen hatte. Von Kindheit an stand sie zu dem viel älteren Vetter in einer Art von Respektsverhältnis; Albrecht hatte sie und seinen eignen Bruder Joseph stets bevormundet. Sie war noch ein halbes Kind, als er um sie anhielt, und sie hatte ihren ganzen Mut zusammennehmen müssen, um ihn abzuweisen.
Als sie wenige Monate später sich mit ihrem Jugendgespielen Joseph verlobte, nahm sie zitternd Albrechts Glückwunsch entgegen, den er mit seinem starren, kalten Gesichte abstattete. Sie fürchtete ihn, sie fürchtete ihn wirklich.
»Du brauchst vor Albrecht keine Angst zu haben,« sagte Joseph mißmutig. Er haßte dieses Thema, das er mit Marie Dutzende von Malen durchgesprochen hatte. Sie kam immer wieder darauf zurück, mit einer unbegreiflichen Beharrlichkeit, wie jemand, der von ängstlichen Dingen am liebsten spricht.
»Du fürchtest ihn auch,« sagte sie.
»Ich?!« Er lachte. »Lächerlich! Ich möchte wissen, weshalb?!«
»Du hast dich schon als Junge vor ihm gefürchtet.«
Joseph blieb stehen: »Marie, ich will das nicht! Ein für allemal. Albrecht und ich haben uns nie besonders nahegestanden, einfach deshalb, weil er zehn Jahre älter ist und fast nie mit mir zusammengelebt hat. Wir haben keine gemeinsamen Interessen, das ist alles.«
»Er hat es nie gut mir dir gemeint. Er hat dich von uns fortgeholt und dich auf die Kadettenschule gebracht.«
»Weil er das für das beste hielt.«
»Nein.«
»Ich spreche kein Wort mehr über das Thema.«
Sie gingen stumm nebeneinander durch den Schnee, vorbei an dem alten Palais der hannoverschen Könige, immer in der Richtung auf Herrenhausen. Erst nach einer langen Pause begann Marie von neuem zu sprechen, aber ihre Stimme klang jetzt weich: »Den Tag vergesse ich nie, Joseph, als er dich fortholte zur Kadettenschule. Er saß mit Mama im Nebenzimmer, und wir beide spielten noch. Sonst mußte ich immer schon um acht ins Bett, aber ihr wolltet um elf Uhr nachts abreisen mit dem Schnellzug nach Köln, und da durfte ich noch mit dir spielen. Weißt du's nicht mehr?«
»Doch.«
. . . Ob er's noch wußte!!
Das war, alles in allem betrachtet, der jammervollste Tag seines Lebens gewesen. Denn mit diesem Tage hatte Josephs schöne Kinderzeit ihr Ende erreicht.
Von seinem fünften Jahre an – seit der Major von Heidenstamm nach Frankreich zog und nie wieder kam – war Joseph im Hause seiner Tante, der Frau von Schulenberg zu Hannover, erzogen. Er saß ganz still in seinem Zimmerchen, als am Tage von St. Marie-aux-Chênes ein zweites kleines Lebewesen ins Haus kam, und wenige Tage nachher war dieses Neugeborene und wenige Wochen später Joseph selbst Waisen geworden.
Er erinnerte sich an das alles nur noch ganz undeutlich, auch nicht mehr an die düstere Taufe mit Trauerkleidern und weinenden Frauen, bei der das kleine Mädchen, in jammervoller Bezugnahme auf den Todeskampf der Garden, den Namen Marie erhielt.
Marie.
Marie-aux-Chênes.
Eine halb vergessene Zeit, bald ganz vergessen.
Die Witwe, deren Kraft und Lebensmut in einer einzigen Stunde für immer gebrochen waren, konnte für den wilden Jungen keine gute Erzieherin sein.
Es gab in allen drei Vorklassen des Lyceums und später in Sexta und Quinta kein zweites Beispiel von Faulheit und Unaufmerksamkeit wie das des kleinen Heidenstamm. Man hatte da allerlei Strafen, um ihn zu bessern, aber er ertrug sie mit großer Geduld und änderte sich nicht. Die Hauptschuld an dem Bummelleben jener sieben Jahre hatten die Offiziere, die alle ohne Ausnahme den kleinen Burschen protegierten. Er wußte selbst nicht, wie er sie kennen gelernt hatte, aber er kannte sie alle. Sie nahmen ihn mit auf ihren Pferden, in der großen Ulanenkaserne am Königsworther Platz lief er aus und ein, und wenn er aus der Schule kam und sah seine großen Freunde, so riefen sie ihn in ihre Mitte und machten sich einen Spaß daraus, mit dem kleinen Bengel auf der Georgsstraße zu promenieren.
Kam ein fremder Offizier nach Hannover, so wurde Joseph ihm vorgestellt:
»Das ist unser Zukunftsreiter. – Komm mal her, Junge, aufs Pferd. – Sie werden sich wundern, wie der Schlingel reitet.«
Und man ging in die Rennbahn und ließ Joseph seine verwegenen Kunststücke produzieren.
»Der Alte war Major bei der Garde – totgeschossen bei St. Privat. Was sagen Sie zu dem Bengel?«
Diese reichen Kavaliere steckten ihm bei jeder Gelegenheit Geld in die Hand: »Da, Joseph, kauf dir was,« Talerstücke, Goldstücke, mit einer Leichtfertigkeit, die jeden ernsten Pädagogen entsetzt hätte.
Natürlich war er das beneidete Ideal aller seiner Mitschüler. Er verteilte das Geld, dessen Wert er nie kennen lernte, unter sie mit vollen Händen, sie bewunderten ihn, wenn er zwischen den Kavallerie-Offizieren aus der Stadt ritt. Seine wissenschaftlichen Mißerfolge waren nicht im geringsten im stande, Josephs Ansehen bei seinen Altersgenossen zu schmälern, im Gegenteil, und die unvergleichliche Körperkraft des hageren, zähen Burschen sicherte ihm die unbedingt erste Rolle.
Aber einen hatte er doch, der ihn erzog, das war die kleine Marie. Oft, wenn die andern Jungen draußen noch spielten und niemand ihn gezwungen hätte, heimzukommen, ging er aus freien Stücken nach Hause, weil er wußte, daß das kleine Ding allein war. Er paßte mit den fünf Jahren Altersunterschied absolut nicht zu dem Mädchen, aber er besaß eine merkwürdige Fähigkeit, auf ihre kleinen Wünsche und den Ideengang des Kindes einzugehen. Er ließ ihre Puppen marschieren und baute ihr aus den Holzklötzen und alten Spielkarten Häuser. Er war ihr Pferd, ihr Jagdhund, der auf allen vieren lief und bellte, er saß als Löwe in einem Käfig von Stühlen, aber als ein guter Löwe, der sich streicheln ließ und die feierliche Versicherung gab, er werde nie beißen.
Sie wollte immer Geschichten hören, mit einer unermüdlichen Passion; aber die Mama lehnte in dem Trauerkleide, das sie nie mehr ablegte, am Fenster und starrte hinaus. Bisweilen sah sie wohl nach dem Kinde und sagte: »Spiele, Mariechen, oder geh zu Anna in die Küche;« dann schaute sie wieder mit einem teilnahmlosen Blick in die Weite.
Ihre Bekannten sagten mit einer sentimentalen Deutung dieses ewigen Hinausstarrens:
»Sie schaut immer noch nach der Ecke, um die das Regiment verschwand, als sie 70 fortmarschierten; sie denkt vielleicht immer noch, ihr Mann kommt wieder.«
Und vielleicht gab es wirklich eine solche vage Idee in dem müden Kopfe der einsamen Frau.
Quälte das Kind gar zu sehr: »Mamachen, erzähle mir eine Geschichte,« so gab sie sich wohl einen Ruck, raffte sich auf und nahm die Kleine auf den Schoß.
Mit einer weichen, leeren Stimme erzählte sie dann, was Marie wollte: »Schneewittchen« oder »Dornröschen«, aber sie kam selten mit einer Geschichte zu Ende. Ihre Worte wurden langsamer, stockten, schliefen ein.
»Und was kam dann, Mamachen?«
»Dann –?«
Was war denn? Was hatte sie denn erzählt? Sie wußte es nicht mehr. Ihre Gedanken waren beim Sprechen so fern gewesen, in Frankreich, bei ihm, auf dem kleinen Kirchhofe von St. Marie.
»Geh, Kind, spiel.«
Und Marie spielte wieder. Sie war noch zu klein, um nach der Uhr zu sehen oder die dumpfen Töne der Stundenschläge zu zählen, aber wenn es zwölf Uhr mittags war, wurde sie unruhig, weil sie instinktiv wußte, daß der lange, einsame Vormittag ohne Joseph nun zu Ende sei.
Oft kam er erst spät, vielleicht weil er hatte nachsitzen müssen oder sich umhergetrieben hatte, aber mittags kam er wenigstens pünktlicher als nachmittags, wo sie bisweilen stundenlang auf ihn warten mußte. Einmal war er abends um halb neun noch nicht zu Hause, und die unerbittliche Anna steckte die Kleine ins Bett. Da geriet sie in eine so furchtbare Aufregung, daß die Mama aus ihrer Lethargie erwachte und – das einzige Mal in den sieben Jahren – den endlich heimkehrenden Joseph mit zwei wohlverdienten Ohrfeigen empfing.
Der Junge war darüber mehr erstaunt als erschreckt, denn erstens war er an dergleichen von der Schule her gewöhnt, und zweitens hatten diese Ohrfeigen keine besondere Kraft; die Kleine aber geriet außer sich.
Diese Schläge hatte er um ihretwillen erhalten, nur weil sie so geweint und die Mama aufgeschreckt hatte! Joseph selbst mußte sie beruhigen und ihr hundertmal versichern, daß es nicht weh getan hätte; erst dann schlief sie endlich ein, seine magere Jungenhand im Schlafe noch krampfhaft festhaltend.
Seitdem kam er nie mehr so unpünktlich, er nahm sogar in der Schule – wenn auch nur für kurze Zeit – einen energischen und alle Lehrer in maßloses Erstaunen versetzenden Anlauf zur Besserung.
Sie war wirklich seine Erzieherin, die kleine Cousine, seine einzige.
Unermüdlich erzählte er ihr Geschichten, aber sie hatte ein gutes Gedächtnis und liebte es nicht, wenn ein Märchen, das sie schon kannte, wiederholt wurde.
Er hatte da allerlei Kniffe, alte Geschichten in ein neues Gewand zu kleiden, vielleicht nur durch Veränderung der Namen, oder indem er aus dem Riesen eine Riesin machte. Immerhin mußte er dabei vorsichtig zu Werke gehen, weil sie andernfalls die List sofort merkte.
Nach Beendigung einer Geschichte gab sie ihr Urteil ab:
»Das war schön« – »das war sehr schön« – »das war nicht so schön« – aber unweigerlich fügte sie hinzu: »Nun eine andre!«
Es war schwer, diesen kolossalen Anfordernden, die sich jahraus jahrein, Tag für Tag wiederholten zu genügen. Sie kannte alles: Grimms Märchen, Bechsteins Märchen, Hauffs Märchen, den Robinson, Gulliver, die Erzählungen aus Tausend und eine Nacht: so mußte Joseph seinen eignen Kopf anstrengen und selbst Geschichten erfinden.
Merkwürdig: das wurden die schönsten. Man konnte sie beliebig ausdehnen und ins Ungewisse erweitern, indem man den Helden in immer neue und immer tollere Abenteuer verwickelte, und so saßen die beiden oft im Kinderzimmer zusammen, erzählend und horchend, bis es draußen dunkel wurde.
Aber die Anforderungen, die das Gymnasium in Quinta und Quarta an seine Besucher stellt, litten unter alledem so intensiv, daß der Zusammenbruch über kurz oder lang fraglos erfolgen mußte. Er kam Ostern 1877, als Joseph zum zweiten Male in seinem jungen Leben sitzen blieb.
»Der Junge verkommt hier,« sagte sein Bruder, »er muß lernen Ordre parieren und arbeiten. Er kommt zur Kadettenschule, da wird man ihn anders herannehmen.«
Und so geschah es.
Der General von Dewitz, Excellenz, Josephs Vormund, war dagegen, er liebte die Kadettenschulen nicht, aber Albrecht mit seiner kühlen Energie setzte die Sache durch:
»Ich bin selbst fünf Jahre im Corps gewesen, ich verdanke meiner Kadettenzeit alles. Für Joseph ist das Corps das einzige und letzte Mittel.«
Was Joseph selbst betrifft, er widersprach nicht. Die bunte Uniform hat noch jeden Jungen verlockt, und wie die kleine Marie die Trennung ertragen würde, daran dachte er nicht in der Hast, mit der die ganze Frage Hals über Kopf erledigt wurde.
Uebrigens, sie war ja auch nicht mehr die »kleine« Marie. Sie war ein großes Mädchen geworden von sieben Jahren, das in die Schule ging, Freundinnen hatte, Stickereien anfertigte und durchaus nicht mehr auf ihn als einzigen Spielgefährten angewiesen war.
So trennten sie sich.
. . . Ob er noch an den Tag dachte!!
Noch jetzt, wo diese fürchterliche Zeit längst hinter ihm lag, geschah es ihm, daß er nach einem durchzechten Abend aus schwerem Traume nachts auffuhr. Im Schlafe kamen die verfluchten Erinnerungen immer wieder. Die großen, düsteren Schlafsäle im Kadettenhaus, das kleine Arrestlokal, in das er immer und immer wieder gesperrt wurde, die brutale Kraft der älteren Kameraden, die ihn niederschlugen, malträtierten, verhetzten, ihn fälschlich anzeigten. Dann das Weihnachtsfest, wo alle zweihundert Kadetten Urlaub erhielten, nur er nicht! Wie er nachts über die Mauer kletterte, zwanzig Fuß hoch herabsprang und in die Nacht hinauslief nach der Rheinebene, nur von dem einen Gedanken getrieben: »Heim!«
Natürlich holten sie ihn wieder, schon am nächsten Morgen, natürlich, natürlich. Sie holten ihn immer wieder. Er war wie ein wildes Tier, das mit heißen Eisen gebrannt werden muß, ehe es ruhig wird.
Aber wie sein Bruder richtig prophezeit hatte: er lernte Ordre parieren.
Er wurde Schablone wie die andern.
Das Beste, die Energie, hatten sie zu drei Vierteilen in ihm getötet.
Von nun an bekam er Urlaub wie alle.
Niemand, auch Marie nicht, erzählte er in den Ferienwochen von seinen Leiden, die zum größten Teil nun ja auch aufgehört hatten.
Ob er noch an jenen Tag dachte!!
*
»An was denkst du, Joseph?«
»An nichts.«
Er fuhr sich hastig mit der Hand über die Stirn; es war ja unsinnig, immer noch an diese längst vergangene Zeit sich zu erinnern. Jetzt, da alles in Erfüllung gegangen war, was er einst als Junge erträumt hatte! Er trug den Offizierssäbel an der Seite, die kleine Marie war seine große, schöne, geliebte Braut geworden, und was ihm seine einstigen Freunde prophezeit hatten – die jetzt bejahrt, Rittmeister oder Stabsoffiziere waren und sich seiner wohl kaum noch recht erinnerten –, war in Erfüllung gegangen: der beste Reiter der Armee, zum wenigsten einer der besten! Berühmt im ganzen Lande, der großen Menge besser bekannt als alle Obersten und Generale zusammengenommen.
Es lohnte sich wirklich nicht, um die sechs grauen, finsteren Jahre der Kadettenzeit noch nachträglich sich zu erregen.
»Wollen wir umkehren, Joseph?«
»Aber nein. Wir gehen bis Herrenhausen. Vorausgesetzt, daß du Lust hast und es dir nicht beschwerlich fällt.«
»Rede nicht so feierlich!«
Er lachte, und Marie lachte auch.
»Wenn wir jetzt nur den Schlitten hätten!«
Im Park von Herrenhausen, der von dem Königsschlosse aus sich im Stile von Versailles weit hinzieht mit Rasenflächen, Fontänen und glatt geschnittenen Baumhecken, waren sie die einzigen Spaziergänger. Alles lag weiß beschneit, und nur ganz vorn am Schloß hatten die Gärtnerburschen Wege gekehrt.
Marie schüttelte den Schnee von den Kleidern und stellte einen Fuß nach dem andern auf den Sandsteinsockel einer Juno, um sich mit dem Taschentuch den Schnee von den Strümpfen zu schlagen; aber als sie damit fertig war und eben Miene machte, den Arm ihres Bräutigams zu nehmen, um mit ihm sittsam am Schloß vorbei in das Dorf zu gehen und von dort aus mit der Pferdebahn heimzufahren, überkam sie plötzlich beim Anblick der weiten, glatten Schneefläche eine unbezwingliche Lust:
»Fang mich, Joseph!«
Und mit einem Satz war sie von dem sauber gekehrten Wege wieder mitten drin im Schnee, der bei ihrem hastigen Lauf um sie her wirbelte.
»Aber Marie!«
Er zögerte ein paar Augenblicke.
»Fang mich!« und schon war sie eine Strecke weit fort, lief mitten über die erhöhte Rasenfläche und war im Nu hinter der ersten Hecke verschwunden. Sie flog wie ein Reh. Joseph hatte Mühe, so rasch er sich auch an die Verfolgung machte, sie nicht aus dem Auge zu verlieren. Sie bog im Lauf hinter eine immer andre Hecke, und plötzlich sah er sie überhaupt nicht mehr.
Sie hatte sich versteckt, natürlich, mit ihrer lustigen Harmlosigkeit hinter einer Antinousstatue, die frierend und nackt, wie alle Götter und Göttinnen ringsum, wehmütig in den nordischen Winter starrte.
Aber die Schneespuren waren deutliche Verräter, so daß Joseph leichte Mühe hatte, sie hinter dem Antinous hervorzuziehen.
Sie war noch so außer Atem, daß sie seine ersten zwei Küsse eben noch duldete, aber gegen die andern sich verzweifelt wehrte:
»Ich ersticke, ich ersticke!«
»Sollst du auch. Ich mache es mit dir ebenso, wie du heute morgen mit mir.« Sie hatte so heftiges Herzklopfen, daß Joseph erschrak, aber das verging bald, und dann war sie wieder ganz außer Rand und Band.
»Jetzt stellen wir uns vor: du bist der König und ich die Königin. Wir gehen ganz allein in unserm Park spazieren, niemand darf herein. Die Hofdamen stehen draußen hinter dem Gitter und brennen ordentlich vor Neugier: ach, wenn sie das doch sehen könnten, wie der König und die Königin im Parke sich küssen! Küsse mich, König!«
In dem Amphitheater, wo vor hundert Jahren der hannoversche Hof mit dem Prinzen von Wales und allen englischen Vettern die lustigen Sommerfeste gefeiert hatten, wo die Damen im Reifrock neben den gepuderten Herren auf den Steinstufen Platz nahmen, um das Schauspiel auf der gegenüberliegenden Bühne zu betrachten, setzte sich Marie auf eine der beschneiten Steinbänke. Joseph protestierte: »Du weißt, was der Arzt sagt: Du sollst dich in acht nehmen!«, aber sie lachte leichtsinnig: »Es ist nicht kalt, Schnee wärmt, ich erkälte mich nicht, durchaus nicht.« – Aber Joseph zwang sie, aufzustehen, und nun schmiegte sie sich dicht an ihn.
»Es ist so seltsam, Joseph, daß wir heute so lustig sind. Und eigentlich nur, weil dieser Abu Becker im Gefängnis sitzt und du damit deine Schulden los wirst. – Es ist kein schöner Gedanke.«
»Aber ein angenehmer Gedanke,« sagte er mit einem schwachen Versuche, den Wechsel ihrer Stimmung zu verhindern.
»Nein.« Sie schüttelte den Kopf. »Gefängnis ist für mich die furchtbarste Vorstellung, die ich kenne. Lieber möchte ich sterben, als in ein Gefängnis gebracht werden. Wenn man sich nicht mehr bewegen kann, wenn man nichts mehr sieht, nicht einmal die Sonne!«
Joseph zog ein verdrießliches Gesicht; er wußte, daß Marie, wenn sie einmal einen solchen Gedanken erfaßt hatte, sich darauf festbiß und ihn mit ihrer bizarren Gründlichkeit nach allen Seiten hin erörterte.
Und während sie weiter sprach, verfertigte er Schneeballen und warf von dem erhöhten Sitze aus nach der gegenüberliegenden Bühne.
Das war ein ungewollt glücklicher Einfall, denn als er mit seiner enormen Schleuderkraft und Treffsicherheit zweimal dem Bronzefechter an der rechten Heckenkulisse einen Ball mitten ins Gesicht appliziert hatte, wurde Marie aufmerksam und vergaß, Abu Beckers Schicksal weiter zu erörtern.
»Laß mich auch mal werfen.«
Joseph drehte ihr einen ausgezeichnet schönen, glatten, runden Ball, aber so weit sie sich auch in der Taille rückwärts bog und so energisch sie ausholte, sie brachte ihr Wurfgeschoß nicht einmal bis an den Rand der Bühne.
»Nochmal!« – dasselbe Resultat.
»Nochmal!« – aber es war wieder nichts.
Währenddessen setzte Joseph dem Fechter Ball auf Ball auf die Backe, und zwar mit solcher Wucht, als müßte der Bronzefigur der Kopf vom Rumpfe fliegen.
Marie verfolgte jeden Wurf mit einer förmlichen Aufregung. Sie beobachtete Joseph, wie er sich rückwärts lehnte, zielte und mit einer eigentümlichen blitzschnellen Armbewegung den Schneeball schleuderte. Jede Muskel in ihm straffte sich, da war nichts von seiner gewöhnlichen lässigen Haltung.
»Halt, Joseph!«
»Was?«
»Wenn du jetzt zwölfmal triffst, Joseph, der Reihe nach, dann – dann –«
»Was dann?«
»Dann soll das für uns eine Vorbedeutung sein, ein Zeichen, daß uns alles gelingen wird, was wir uns wünschen, daß wir zusammen glücklich werden.«
»Dummes Zeug,« sagte er und warf dem Fechter gegen die Nase, daß der Schnee drüben nach allen Seiten stiebte.
»Numero eins.«
»Mit so was muß man nicht spielen,« sagte er und traf von neuem.
»Numero zwei.«
»Das ist doch nicht dein Ernst, Mieze?« Er knetete einen neuen Ball und blickte sie erstaunt an. »Lieber höre ich auf.«
»Wirf weiter.«
»Du bist doch nicht abergläubisch?«
»Ja, ich bin abergläubisch.«
»Komm her, Marie, wir gehen jetzt. Außerdem, es wird bald dunkel. Wahrhaftig, es ist bald vier Uhr.«
Sie trat nahe an ihn heran mit einem ängstlichen Ausdruck im Gesicht: »Ich bitte dich, Joseph, wirf weiter, und schnell, ehe es Dämmerung wird, solange du noch gut sehen kannst.«
Schweigend blickte er sie an, in ihren Zügen war etwas Fremdes, Starres. Ueber die Sonne am Himmel hatte der sinkende Tag graue Winterwolken gebreitet, durch die langen Heckengänge pfiff ein kalter Wind, die ganze Szenerie ringsum hatte plötzlich einen blassen, unheimlichen Zug von Oede.
Er zielte sorgfältiger als sonst und traf. Sie sprachen beide nicht und zählten leise. Sie schauten sich nicht an, sondern blickten nur nach dem Fechter drüben, der vor der dunkeln Heckenkulisse in seiner schwarzen Erzfarbe immer undeutlicher sich abhob.
»Elf.« Sie sagten es beide gleichzeitig und blickten sich gleichzeitig an.
»Nun der zwölfte.«
»Nein, ich werfe nicht weiter. Komm, Marie. Wenn es auch nur Unsinn ist, man soll es doch nicht tun. Ich kann fehlen, ich sehe nicht mehr ordentlich, und mein Arm ist müde. Und wenn ich nicht treffe, dann bist du im stande, die alberne Geschichte ernst zu nehmen. Ich kenne dich. Sei gut, Liebchen, komm.«
Er legte den Arm um ihre Taille, aber sie machte sich frei.
»Wirf!«
Sie war sehr blaß, und die fahle Dämmerung zeichnete auf beide Gesichter graue Schatten.
Joseph beugte sich nieder und knetete auf seinem Knie den Schneeball. Dann nahm er ihn, um die Hände frei zu bekommen, zwischen Oberarm und Mantel und streifte die ledernen Handschuhe ab.
Zweimal beugte er sich rückwärts und zielte lange, aber jedesmal behielt er den Ball in der Hand und richtete sich wieder empor, um seine Fußstellung zu ändern.
Dann bog er sich tief auf das rechte Knie, so daß seine Hand fast den Boden berührte, und dann, nach einer sekundenlangen Pause, schnellte er mit einer vehementen Bewegung den ganzen Körper vorwärts.
Wo war der Ball?
Einen Moment sahen sie ihn beide nicht, es flimmerte ihnen vor den Augen.
Jetzt sahen sie ihn!
Da flog er! Drüben schon –
Und jetzt –
»Bravo!!«
Mitten dem Fechter ins Gesicht!!
Joseph atmete tief auf und lächelte, und einen Augenblick fuhr er sich mit der schneefeuchten Hand über die Stirn, auf der Schweißtropfen perlten.
»Joseph!«
Stürmisch umschlang sie ihn, den Kopf an seiner Brust in dem Pelz des Mantels vergrabend. Er fühlte, wie sie zitterte, aber er zerbrach die feierliche Stimmung mit einem Scherz:
»Du bist und bleibst ein albernes Mädel. Das wäre eine nette Art, sich mit Schneeballwerfen über das Schicksal zu vergewissern.«
Sie lachte nun auch, aber sie zitterte immer noch.
»Natürlich war es dumm und albern, aber es war doch schön. Das hätte dir keiner nachgemacht, Joseph: so sicher zu werfen, wenn so viel auf dem Spiele steht.«
»Gar nichts stand auf dem Spiele.«
»Doch, doch, rede nicht, wir wollen gar nicht mehr davon sprechen. Ach, ich bin glücklich. Du wirst immer treffen, wenn Not an Mann ist. Du fürchtest dich vor nichts, du bist ein ganzer Mann. Lach nicht! Das ist mein heiligster Ernst, Liebster!«
Sie standen aneinander gepreßt und küßten sich leidenschaftlich. Einmal sagte sie: »Komm, wir müssen nun gehen,« und dann sagte nach einer Pause Joseph: »Komm, wir müssen nun gehen,« aber der andre hatte jedesmal noch eine Umarmung und einen Kuß, bis endlich die hereinbrechende Dunkelheit sie aufschreckte.
»Wenn jemand uns hier jetzt fände!«
»Weshalb nicht!«
»Nein, das geht nicht. Wir müßten längst zu Hause sein. Aber wenn wir verheiratet sind, gehen wir oft hierher, dann darf uns niemand mehr hineinreden. Es war zu schön heute.«
Sie gingen die Stufen des Amphitheaters hinab, und als sie unten standen und durch den Heckengang links zum Schlosse zurück wollten, zögerten beide, als ob ihnen der Abschied von dem kleinen verschneiten Königstheater schwer fiele.
Marie fand noch ein letztes Auskunftsmittel, diesen Abschied zu verlängern.
»Wir müssen dem armen Fechter adieu sagen.«
Sie kletterten auf die Bühne, um das Opfer ihrer Schneebälle zu betrachten; er stand in seiner athletischen Erzmuskulatur schwarz und dunkel vor ihnen, aber Kopf und Hals waren wie von einer weißen Haube überzogen. Und ehe Joseph es verhindern konnte, hatte sich Marie auf das Steinpostament geschwungen, hielt die Bronzefigur umklammert und fuhr dem Fechter mit ihrem Pelzhandschuh über das Gesicht, bis die letzten Spuren der Schneebälle verwischt waren.
»Der arme Kerl, ihm brummt der Kopf gehörig! – So, nun sieht er wieder nett und sauber aus!«
Ueberrascht, schweigend sah Joseph ihr zu. Das Mädchen mit seinen raschen Bewegungen neben der toten, kalten Figur, ringsum Winternacht, beide oben auf dem Postament in tiefem Schatten, und rechts, links, vorn, auf allen Seiten andre Erzgestalten, die durch das Dunkel herüberstarrten, – die Scene hatte etwas Gespenstisch-Unheimliches.
Als Marie aber wieder neben ihm ging, ihr warmer Arm in dem seinen lag und ihre weiche Gestalt die seine berührte, war der kurze, seltsame Eindruck verwischt.
Hinter den Hecken tauchte das Königsschloß auf, stumm und finster, ein verlassener Zeuge vergangener Pracht. Nichts mehr von englischen Königen, die hier in ihrer hannoverschen Heimat mit den Cambridges und Cumberlands und Yorks alte Erinnerungen auffrischten; nichts mehr von den Hannoverschen Königen selbst, die vor zwanzig Jahren in die Verbannung gingen; nichts mehr von Garden, Reitern, Equipagen, von Dienern mit Windlichtern, von schönen Damen, die durch den Park huschten; keine fröhlichen Klänge, keine Ballmusik, keine erleuchteten Fenster und keine Königsstandarte, die nachts hoch oben im Winde wehte.
Joseph hatte Mühe, in dem kärglichen Lichte der wenigen Laternen den Ausgang zu finden.
Am Tore wandte Marie den Kopf über die Schulter und blickte noch einmal in den Garten zurück. Sie hatte ein Gefühl der Dankbarkeit für die schönen Stunden dieses Nachmittags und für das Liebesglück, das der stille, verschwiegene Park ihr und Joseph geschenkt hatte. Als sie aber die tote Finsternis hinter sich sah, ging es durch sie hin wie ein Frösteln.
Kam sie wirklich von dort her? Aus dieser lichtlosen, unheimlichen Tiefe?
»Joseph, halt mich fest!«
»Wie?«
»Halt mich fest dein ganzes Leben lang. Bei dem ersten schweren Erlebnis würde ich zusammenbrechen, das fühle ich, wenn ich nicht dich dabei zum Schutze haben würde.«
Er lächelte gutmütig: »Du brichst nicht zusammen, du großes, starkes Mädchen, du am allerletzten.«
»Ich am allerersten.«