
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Mutig ragt auf roter Heide eine Fichte in die Höhe. Mutig und einsam! Kein Nordwind konnte ihre Äste bisher verbiegen oder zerbrechen. Die leicht sich wiegenden Zweige bilden sich ein, daß sie immer aufwärts gestreckt von würzigen Wohlgerüchen umspielt sein werden. Ja, genau so hoffnungssicher ist diese Fichte, wie junge Menschen, die noch nichts von Wintersnot und Lebensschicksalen erfuhren. –
Durch die sonnige Stille klingt leises Krähen. Vergebens versuchen die frohen Äste sich abwärts zu neigen; denn gerade neben ihrem Stamm erhebt sich ein Stimmchen. Vogelsang, Sturmgebraus oder menschliches Lachen und Weinen vermögen sie nicht mit Sicherheit zu unterscheiden.
Über den Rand einer grob zusammengezimmerten Holzkiste, die hier verlassen stehen geblieben – welches mag ihr früherer Inhalt gewesen sein? – krallt sich ein rotes, winziges Fäustchen. Es kann nur einem Erdenbürger gehören, der noch nicht lange in der Welt Aufenthalt genommen hat.
Kinderwagen kosten Geld, aber eine alte Holzkiste und starker Bindfaden sind leicht gefunden, und kleine Mädchen sind gern auch öfter mal Pferd oder Kutscher. Ann-Gret hat zuerst fein behutsam gezogen. Nur Trin und Dortchen hätten nicht kommen dürfen. Im Staube liegt die Leine. –
Betrachtete jemand das krähende Geschöpfchen etwas genauer, so wüßte er, dies Bübchen ist nicht fürs Traurigsein geschaffen. Es lacht und hätte doch so manchen Grund zum Weinen: große Schweißperlen tropfen von seiner Stirn; ein Krüstchen Brot, an dem die roten Lippen mit Behagen gesaugt hatten, ist seinem Mündchen entglitten. Auf des Kindes Nase sitzt eine Fliege, die fast halb so groß ist wie die ganze kleine Nase. Ungemach genug für das Menschlein, und doch kräht Jachl vor Lust. Es bekümmert ihn wenig, daß Ann-Gret, die Wagenlenkerin, ihn schmählich hier verlassen hat.
Niemand ist in der Nähe. Nur ein Hase hockt auf der Heide und spitzt die Ohren. Er wagt sich nicht hervor, hat er doch hier, nicht weit entfernt, Furchtbares entdeckt. Wieder einmal sah er etwas Riesenhaftes, das die Menschen »Haus« nennen. Ein Haus ist für den bebenden Hasen fast so schlimm wie ein Gewehrlauf. Häusern darf man, wenn man seines Lebens froh bleiben will, nie zu nahe kommen. Dem Hasen erscheinen alle Gebäude in gleicher Weise gefährlich. Doch vor diesem Hüttchen – Mutter Bohn haust in ihm – brauchte er wahrlich nicht Reißaus zu nehmen. Das Häuschen steht nicht. So stolz ist es nicht. Es hat sich nur auf die Erde gekauert, bescheiden dicht an einen Heidehügel hingeduckt. Sonne umhuscht sein morsches Gemäuer; auf braune Balken hat sie schillernde Funken gestreut. Das gefällt den Menschen. Es tut ihnen wohl, wenn die karge Wirklichkeit ein bißchen trügerisch überflammt ist. Dann können sie vergessen, daß die Sonne untergehen muß, und daß Not und Sorge Alltagsgäste auf Erden sind. –
In dieser Stunde leuchtet alles im Umkreise in schimmerndem Reichtum. Auch der seichte Bach funkelt. Drei pausbäckige Dirnchen umspringen ihn. Ann-Gret tappt mit den Fußspitzen ins Wasser. Sie hat Mut: sogar an Baden denkt sie, an Kleiderausziehen und weit ins Wasser springen. Lustig, lustig ist alles auf Erden auch für Trin und Dortchen. Beide haschen vergeblich nach dem winzigen Getier im Tümpel, das so leicht zu fangen scheint, und das doch immer wieder behend davon schlüpft. Dann wieder bespritzen sich die Freundinnen gegenseitig und laufen voreinander davon. Keine denkt in ihrem Vergnügen an den, der unter der hochästigen Fichte kräht. –

Endlich sind die Kinder am Bache des Spielens müde; Hunger erinnert sie ans Nachhausegehen. Nun wird auch der Jachl in seiner Wagen-Kiste nicht vergessen. Ann-Gret fürchtet ihn nicht; sie kennt seine Langmut. Drei Mädchen, drei Pferdchen ziehen jubelnd die Leine.
Über Stock und Stein rast die Jagd mit dem Jungen, dem immer Vergnügten. Einmal nur, als das Gefährt umfällt, und Jachl sich eine tüchtige Beule schlägt, schreit er auf. Aber nur wenig Zureden ist nötig, und wieder strahlt Lachen auf seinem runden Gesichtchen. –
Scheltend steht Mutter Bohn vor ihrem Häuslein, als die lustige Gesellschaft angaloppiert kommt. Ein bißchen vorsichtiger hätte Ann-Gret wohl sein sollen. Ist der Jachl auch nur ein Bauernjunge, aus Eisen ist er deshalb doch nicht. Zärtlich streichelt ihn Mutter Bohn. Wieder und wieder summt sie: »Wo will di dat noch gähn?«
Kein anderes Lied paßt wie dieses für das Bübchen. Nur immer die eine Melodie kommt Mutter Bohn über die Lippen, für die ihr hochdeutsche Worte unmöglich erscheinen:
»Putt, putt, putt min Höhneken,
Wat deist in minen Hof
Und pflückst mi all min Blömeken?
Du makst mi dat to grow.
Un's Mudder schall di schilln (schelten),
Un's Vadder schall di slahn,
Putt, putt, putt min Höhneken,
Wo will di dat noch gähn?«
Hastig muß der Jachl (viel zu warm und viel zu schnell) seinen Mehlbrei schlucken. Sein Magen darf nicht empfindlich sein; er ist es auch nicht. Kaum hat er die Mahlzeit beendet, da fallen ihm schon die Augenlider zu. Trotz der Wärme wird er unter ein schweres Federbett gesteckt.
Mutter Bohn muß in den Stall. Neben Jachl wacht der alte Schäferhund. Nichts regt sich Stunde um Stunde. – –
Tief seufzt Mutter Bohn bei ihrer Arbeit. Vor sechs Wochen ist ihr der Kleine ins Haus geschneit. Was blieb ihr übrig, als ihn hier zu behalten? Vor die Türe konnte sie ihn doch nicht setzen. Ihre Trude wußte nicht »wohin« mit ihm. Nur gut, daß der Ohm einverstanden war. Er murrte bloß: »Nich früh genug können se hier fort in die große Stadt, aber wenn se sich »sowas« da geholt hab'n, find'n se mit'n Mal wieder 'n Weg ins Dorf zurück.« –
Gewundert hat sich niemand; solche Überraschungen kennen hier Eltern. Zum Glück hat Mutter Bohn nur ihre Eine; da ist das Unglück nicht so schlimm. Und als Schande betrachtet sie es überhaupt nicht, nur ist sie selber schon recht mürbe von mancherlei Lebens-Ungemach. Mit ihren verfurchten Zügen sieht sie zwanzig Jahre älter aus als sie ist. Längst mußte ihr Mann, unter dem von ihr als Braut gewebten Sarglaken, den Weg zum Friedhof geleitet werden. Schon als sie mit ihm nur »ging«, war er auf der Brust nicht fest. Nun haust sie mit dem Ohm, ihrem einzigen Anverwandten; beide mürbe, gelassen, arbeitssam, wenig gesprächig. –
Für den kleinen Joachim – den Jachl – hat niemand Zeit. Der Bauer muß auf die Heide oder in den Stall, und die Frau, die mitarbeitet, findet selten eine Viertelstunde, in der sie den kleinen Eindringling auf dem Arm tanzen lassen kann. Zum Herzen und Küssen kommt's fast nie; Zärtlichkeit ist in dem niederen Hüttchen nicht heimisch, wenigstens keine äußerlich sichtbare. Nur am Sonntag Nachmittag, da hat's auch der Jachl gut. Mutter Bohn hebt ihn, der sonst in irgendeinem Stubenwinkel herumkriecht, auf den Schoß, läßt ihn tanzen und springen und sich von ihm die dünnen, grauen Haare zerzausen.
»Die sind zu zählen, die hier im Dorf mit'n Myrtenkranz in die Kirche kommen,« tröstet sie sich, wenn ihr schwer ums Herz wird. Ihre Trude hat sich damals auch zu früh eingestellt, aber Bohn hat sie bei sich behalten und ihr einen ehrlichen Namen verschafft. Wer weiß dagegen, mit wem die Tochter in Berlin gegangen ist? Kein Wort hat sie vom Heiraten gesprochen, als sie den Jachl nach Hause brachte. Mutter Bohn dankt Gott, daß es bei ihr nur bei der Trude geblieben ist; mehr Kinder hätten ihr wohl leicht auch mehr solcher Überraschungen ins Haus geschleppt. Was kann man tun als stillehalten?
Wenn nur nicht alles so knapp wäre! Bis jetzt kostet der Jachl ja noch nicht viel, aber wenn er größer sein wird, wie soll ihm dann das hungrige Mäulchen gestopft werden?
— — — — — — — — —
Zwischen Mühsal und Dürftigkeit gedeiht der Kleine wie ein bestgehegtes Kind. Längst schon traben seine dicken Beinchen durch den Sand der Heide. Nicht einmal krumm sind sie, die doch so viel Entschuldigung hätten, nicht kerzengrade zu wachsen.
Immer ist der Jachl vor Tau und Tag draußen. Die hellen Haare stehen ihm stets zu Berge. Den Inhalt seines grauen Frühstücksbeutels stopft er, sobald er unterwegs, schleunigst in das rote Mäulchen. Eifrig sucht er, je nach der Jahreszeit, Blätter jeder Art und Heidekraut, violettes oder purpurgefärbtes oder silbergraues Moos. Die schönsten Kränze im Dorf winden seine dicken Finger. Stundenlang sitzt Jachl geduldig bei der Arbeit. Förmlich schwer wird ihm die Trennung von seinen Kunstgebilden. Das darf er aber nicht merken lassen, wenn der Händler, der wöchentlich einmal ins Dorf kommt, sie abholt. Mutter Bohn braucht Geld, und Jachl, der kleine Mitverdiener, weiß, daß er sich nicht zu oft an den Indianer- und Kriegsfahrten der anderen Jungen beteiligen darf. –
Heute ist er nicht allein bei der Arbeit. Neben ihm sitzt Lieschen, das große Lieschen. Zwei Jahre ist sie älter als er. Achtlos hat sie die Schultasche neben sich ins Gras geworfen. Auch sie versucht eifrig mit Bindfaden allerlei Heideblumen zum Kranz zusammen zu binden. – Bis zur Schule muß sie eine Stunde laufen. Die kleinen, nackten Füße sind mit Staub überweht; denn Lieschen trägt ihre festen Holzpantoffeln öfter in der Hand als auf den Füßen. Jene Staubschicht gehört zur Rotwangigen, wie die Uniform zum Soldaten. Zwar steckt ihre Mutter sie allabendlich ins große Regenfaß unter die Rinne, und auch mit Seife spart sie nicht, aber in der Frühe, mit dem ersten Schritt vor die Hütte, ist das kleine Mädchen gleich wieder wie in Sand und Staub getaucht. –
Während Lieschen sich an ihrem Kranze quält, reibt sie des öfteren mit einem derben, rotgewürfelten Taschentuch, das sie umständlich aus der Tasche ihres blauleinenen Röckchens holt, große Schweißtropfen von Stirn und Näschen. Manch wohlgepflegtes Stadtkind dürfte die kleine Dörflerin um ihre tiefschwarzen Haare, ihre blauen Augen, ihre frischen Farben beneiden, auch um die fein geformten Füße, die noch nie in beengendem Schuhwerk sich verstecken mußten.
Staunend folgt Lieschens Blick einem vorübersausenden Auto. So ein Wunderwagen kam ja nicht einmal in den Märchen vor, die ihr das Stadtfräulein erzählte, welches hier im Dorf gesund werden wollte. Ja, die! War die drollig! Bloß um Luft und Sonne war sie hergekommen? Luft und Sonne hat Lieschen doch immerfort, was soll denn das bedeuten? Alle haben sie die doch im Dorfe. Warme Luft und kalte Luft und Schnee, ach, wieviel Schnee und Eis und Schlittenfahren und eisigen Wind! Auch rote Nasen und halberstarrte Fingerspitzen, in denen man die Schulmappe gar nicht lange tragen kann. Man muß sie oft von einer Hand in die andere nehmen auf dem Wege zur Schule. –
Daß der Weg nicht kurz ist, bemerkt Lieschen gar nicht. Gewöhnlich gesellen sich ihr auf der Landstraße andere Kinder zu. Munter schreitet dann die kleine Schar vorwärts, heiter ohne beredt zu werden. Wortkargheit haftet fast allen Dorfkindern an, von der ihre Lebenslust aber nicht beeinträchtigt ist. Zu Haus, bei Vater und Mutter, hören sie selten viele Worte, daher kommt wohl auch ihre Einsilbigkeit. –
Heut eilt es Lieschen nicht mit dem Pünktlichkommen zur Schule, heut ist ganz etwas anderes im Schulhause »los«. Dem Herrn Kantor ist gestern die Frau gestorben. Für sie windet Lieschen den Kranz. Ihr will sie ihn schenken. Und vor allem: sie ist heute von Neugier erfüllt, sich die anzusehen, die sie jetzt »die Leiche« nennen. –
Lieschens Eltern sind von früh bis spät auf dem Acker beschäftigt. Um Kindererziehung sorgen sie sich trotz der wachsenden Zahl ihrer Schreihälse nicht. »Lieschen wird schon werden,« brummelt der Vater, wenn der oder jener über seine Kinder seufzt. Ihre Mutter denkt oft ebenso, während sie gebückt beim Bauern arbeitet. –
Der Kleinen Kranz ist fertig: Heidekraut, Kamillen und Blätter, viel grüne Blätter in buntem Gemisch, nicht kunstvoll gebunden, aber doch als Kranz erkenntlich. Hurtig schüttelt sie die Schürze ab. Geschwind läuft sie weiter. Manchmal bleibt sie stehen und guckt sich ringsum. Irgendwo muß ja Jachl stecken; er ist ihr eben davongelaufen; auf irgendeinem Baume wird er sitzen.
»Ju–hu, ju–hu!«
Vor die Füße ist er Lieschen gesprungen. Breitbeinig steht er da, die Hände in den Taschen seiner braunen Hose.
»Ju–hu, ju–hu!« Einen richtigen Jodler bringt Jachl nicht zustande, aber Fröhlichkeit klingt doch aus seinem Ju–hu. –
Auch Mutter Bohn gehört zu denen, die sich um Erziehung nicht sorgen. »Die Bäume wachsen ja von selbst, und mit kleinen Jungen wird es nicht anders sein«. – Niemand hat eigentlich je für diese zwei Kinder Zeit. Aber beide merken es gar nicht. Sie entbehren weder väterliche noch mütterliche Fürsorge. –
Jachl bewundert zuerst nochmal Lieschens Kranz. »Och, is der aber schön.« Dann holt er wieder aus der Tasche die große Muschel hervor, die bereits seit vier Tagen Lieschens höchste Sehnsucht ist. Aber das Tauschgeschäft, das die zwei Kinder erörtern, führt zu keinem befriedigenden Endziel. Jachl gibt seinen kostbaren Fund nicht nur für drei Griffel her. Im Augenblick ist Lieschen auch nicht ordentlich bei der Sache, sie ist von ganz anderen Vorstellungen erfüllt; kaum sieht sie ordentlich hin, kaum hört sie wirklich Jachl's Versicherung, daß er »so dumm nich is wie sie denkt«. Ihr ganzes Verlangen richtet sich nur auf die Leiche. Wenn Jachl ihr doch ordentlich Bescheid sagen könnte, aber er hat nicht mehr Erfahrung mit dem Tode als seine Freundin. Ihre dürftigen Häuschen liegen vereinzelt abseits; so sind die Kleinen bisher weder mit Werden noch Vergehen auf Erden in enge Berührung gekommen. –
Sorglos marschieren sie bis ans Kantorhaus. Alle Fenster sind dort weit geöffnet. Viele Leute aus dem Dorfe strömen hinein. Lieschen möchte gern erst mal von draußen in die Stube sehen. Sie hebt sich auf Zehenspitzen, aber die Augen reichen nicht bis ins Fenster. Da nimmt Jachl sie ein wenig in die Höhe. Doch erschreckt stößt Lieschen einen leisen Schrei aus. So richtig gesehen hat sie eigentlich nichts, aber ängstliche Scheu hat sie gepackt. Zögernd bleibt sie mit ihrem Kranz auf dem Arm vor der Türe stehen. Ihre Holzpantoffeln hält sie in der andern Hand. –
Erwartungsvoll und bedrückt schieben sich endlich beide Kinder zwischen die Erwachsenen durch die Tür. Unbewußt haben sie einander zum ersten Male, seit sie sich kennen, fest an die Hand genommen. Kräftig halten sich die runden Fäustchen umschlossen. Immer weiter treten sie vor.
Auf die flackernden Kerzen, die zu Häupten der Toten brennen, richten sich zuerst Lieschens Blicke. Von diesen gleiten sie hernieder auf die Frau, welche sie frisch und beweglich täglich gesehen hat. Noch vorgestern ist ihr Lieschen im Schulgarten begegnet. Nun sieht sie ein Gesicht, bekannt und doch fremd, das rührt sich nicht und bewegt sich nicht, und die Hände liegen lang ausgestreckt auf einer weißen Decke und halten weiße und rote Astern.
Dem lustigen Lieschen drückt etwas in der Kehle. Sie möchte davon stürzen, aber ihre Füße zittern. Die Blumen, der starke Duft, das Licht, die Stille, die schwarzen Gestalten, das murmelnde Beten der andern und die Frau, die stumm und starr, und doch als ob sie lächle, ausgestreckt daliegt – – wie ein schaurig Schönes umfängt es die Kinder.
»Tot« – denken sie – »tot? Das ist tot?«
Lieschen hat ja öfter mal von Leuten reden hören, die gestorben sind, aber wirklich beschäftigt hat sie sich nie mit dem Tode. Wohl ist ihr Kätzchen gestorben, aber das war doch ganz anders.
Niemand beachtet die Kinder. Niemand führt die Kleinen liebevoll hinaus. Niemand empfindet das jähe Erschrecken der Seelen.
— — — — — — — — —
Jachl stößt Lieschen leise an. Auch ihm ist so seltsam. Gern liefe er davon, aber allein? Nein, das geht nicht. Doch, was tun? Lieschen steht wie angenagelt. Da zieht er scheu ein wenig an ihrem Rock, bald ein wenig mehr, ein wenig stärker. Noch hält Lieschen ihren Kranz auf dem Arm. Ihr fehlt der Mut ihn niederzulegen, ihn der Toten zu schenken; sie wagt sich nicht ganz nahe heran. –
»Lieschen,« hört sie es leise flüstern. »Lieschen, komm.« Gleichzeitig zieht der Junge sie – zieht und zieht sie langsam bis zur Tür. Noch ein scheuer Blick fällt zurück auf die Tote, aber plötzlich jagen beide – immer noch Hand in Hand – durch die Tür, durchs Haus auf die Straße. Atemlos laufen sie, rasen durch die Heide, durchs Dorf, rasch, so rasch ihre Kräfte es zulassen, weiter, nur weiter. Jedes trägt in der freien Hand seine Pantoffel. Anfangs wagen sie gar nicht zurückzublicken. Sie müssen laufen; sie selbst wissen gar nicht weshalb. –
Zuerst dreht Jachl sich um. Nein, nichts jagt hinter ihnen her, wirklich, die Straße ist leer, nichts zu sehen, nur ein paar Hähne stolzieren über die Heide. Da guckt auch Lieschen zurück. »Nichts, gar nichts«, bestätigt sie. Allmählich verlangsamen die Flüchtenden ihren Lauf. Endlich bleiben sie erhitzt und staubbedeckt stehen.
»Och –«
»Ah –«
Tiefauf seufzen beide. –
Unter dem ersten Baum sinken sie förmlich atemlos zusammen. War das schrecklich! Sie fühlen sich wie befreit. Von Sterben und Tod und Leiche wagen sie gar nicht zu reden. Nie wieder wollen sie eine Leiche sehen – nie – nie wieder. – – –
Jachl holt einen vergessenen Apfel aus der Hosentasche. Lieschen fängt eifrig an ihr Frühstück zu verzehren. Schmausend sitzen sie nebeneinander; enger als sonst sind sie zusammengerückt.
Sonne und Helle und Vögel erheben ihre Stimmen.
Nur solange sie ihn sahen, war der Tod für Lieschen und Jachl auf Erden. Rasch trennt das frohe Leben die Kinder von ihrem großen Erlebnis. –
Zuerst fängt Jachl von etwas anderm an. Seine Gedanken sind schon wieder beim heut früh unterbrochenen Tauschhandel. Aber die kurze Zwischenzeit hat seine Forderungen sonderbar beeinflußt: am liebsten schenkte er Lieschen jetzt die schöne Muschel. Zwar schämt er sich dieser Dummheit (wie sollte er sich solche Weichheit erklären können?), dennoch legt er ihr sein Kleinod wortlos in den Schoß. Und merkwürdig, das kleine Lieschen, das beim Tauschen immer gern ein bißchen betrügt, hat längst freiwillig alle gelben Zigarrenbänder aus ihrer Tasche hervorgezogen, die Jachl zum Fuhrmannspielen so oft vergeblich erbettelt hat. –
Von der Gewalt des Todes haben die Kinder nichts begriffen. Vielleicht haben sie ihn vorübergehend, wie eine dunkle Macht geahnt, vor der ihnen in der Erinnerung grauen wird. Aber sie werden sich nicht oft erinnern.
Drüben – fern – in der stillen Stube – beim Kerzenschein – dort, wo die stille Frau gelegen – dort, ja dort war der Tod. Hier ist ganz etwas anderes, hier ist Bewegung, ist Leben. Nicht nur die Füßchen sind vor dem Tode davongerannt, rasch auch entfloh ihm die Kinderseele. –
Lieschen und Jachl sind aufgestanden. Am Graben entlang schlendern sie weiter; die Kleine voran und Jachl, wie immer, etliche Schritte hinterher. Vor des Jungen Hütte wird heute haltgemacht. Schnell holt er seinen Hund und spannt ihn vor das kleine Wägelchen, mit dem er öfter Gras heimholt. Jetzt soll Lieschen es gut haben! Ein Sprung, und die Kleine thront in der Karosse. Der halbwelke Kranz ist ihr auf die Schulter geflogen, das dunkellockige Köpfchen ist ganz von Blumen umgeben. Stolz schwenkt Jachl seine Peitsche mit den rasch angeknüpften gelben Bändern durch die Luft. Wie ein richtiger Fuhrmann schreitet er neben seinem Gespann dahin. »Hü – hü – Karo zieh an.« Lieschen lacht. Jachl streichelt den Hund. Von Staub umhüllt, von Sonne überstrahlt entschwinden beide Kinder dem Blick. –
— — — — — — — — —
Nur wenige Tage später und Jachl windet Kränze für eigenen Bedarf. Mutter Bohn ist gestorben. Der Junge wagt nicht wie sonst laut aufzutreten. Zwar lag Mutter Bohn wochenlang zu Bett, aber das war doch ganz, ganz anders. Jachl besorgte nach ihrer Anweisung die Wirtschaft. Jeden Augenblick rief sie seinen Namen. Zuletzt – Jachl glaubte, sie schlafe – sagte sie immer dieselben Worte: »Wo wart di dat noch gahn, wo wart die dat noch gahn.« Dann kamen der Herr Pastor und der Doktor. Jachl schlich aus der Stube. Er wußte gar nicht, wohin. Lieschen war in der Schule. Niemand dachte an ihn. Weit fort wollte er nicht laufen. Mutter Bohn würde ihn gewiß bald rufen. Aber sie rief ihn nicht. Da fing er an zu weinen, ohne zu wissen weshalb. –
Eingeschüchtert trat er ins Haus zurück, ans Bett der Großmutter.
Alle Nachbarn haben sich entfernt. Nur zwei dünne Lichte brennen in der engen Stube. Auf seinem großen, morschen Korbstuhl sitzt der Ohm. Er ruft den Kleinen zu sich heran und streichelt ihm mit der hagern, faltigen Hand über die hellen Haare. Jachl wagt kein Wort zu sprechen. Vielleicht hat er wieder ein bißchen Angst vor der Leiche. Nahe preßt er sich an den Alten, ein Verlassener an den andern. –
Ein Brief nach Berlin, der Herr Schulmeister hat ihn geschrieben, welcher Trude den Tod ihrer Mutter melden soll, kommt mit dem Vermerk zurück: »Unbekannt verzogen!«
Welch Glück für Mutter Bohn, daß sie dies »Unbekannt verzogen« nicht mehr miterlebt. Für sie diente Trude immer auf ihrer ersten Stelle. Die Harmlose hatte sehr unklare Vorstellungen von Berlin und seinen Gefahren. Von einem »Palais de danse« hörte sie nie, und wenn sie von ihm gehört hätte, dann stellte sie sich gewiß keine Autos vor und keine Füße, die in seidenen Strümpfen und feinen weißen Schuhen vom Trittbrett springen. Nein, es wäre unmöglich gewesen, daß sich Mutter Bohn ein Bild solchen Glanzes hätte machen können. Das Beste ihres Lebens war vielleicht ihre Ahnungslosigkeit bezüglich des Abgrundes, in dem ihre Trude längst untergegangen. Aber dieses Beste konnte sie ja nicht dankbar empfinden. Und niemand sonst liebt die Trude genug, um an ihrem: »Unbekannt verzogen« zu leiden.
— — — — — — — — —
Jachl, der noch nicht zur Schule geht, drückt sich beständig um den Ohm herum. Er folgt ihm überall hin wie ein Hündchen; ob's schneit oder ob die Sonne scheint, das macht den beiden keinen Unterschied.
In seiner arbeitsfreien Zeit spielt der Junge mit allem, was er in des Alten Nähe entdeckt. Und er findet beständig Neues und Schönes. Da stehen z. B. in der Stube, wie Soldaten aufmarschiert, viele Tabakspfeifen, ganz lange und ganz kurze. Schmauchen zu können wie der Ohm, das wäre fein! Jachl wird es auch lernen! Er muß es nur mal versuchen.
Vom Herde holt er Streichhölzer. Alles will er genau nachmachen.
Wahrhaftig! Die Pfeife brennt und das – das ist ja richtiger Rauch und Dampf.
Stolz und strahlend geht der Jachl auf und ab in der engen Stube. Je mehr Qualm, desto stolzer wird er. Die Augen brennen ihm; er muß sie fest schließen. Er kann nicht sehen, daß nicht nur aus der Pfeife, sondern auch aus des Ohm Bett Qualm kommt. Ein Fünkchen nur ist aufs Stroh geflogen. Jachl zwinkert ein bißchen mit den Augen: Ist da nicht eine große, große Flamme?
Schnell reißt er die Tür auf und läuft davon. –
Auf demselben Heidefleck, der einst die Kiste mit dem ganz winzigen Jachl beherbergte, macht er halt. Ängstlich duckt er sich unter die Fichte. Schneelast und Stürme drückten deren Krone schon flacher. Sie recken sich nicht mehr ganz so grad und siegessicher in die Wolken, diese Äste, die meinen Jachl bereits kennen. – –
Etwas Furchtbares muß er getan haben! Etwas, wofür sie ihn prügeln werden und schimpfen, wie niemals vorher. – Nach einer Weile streckt er seinen schlanken Bubenhals in die Höhe und klettert auf einen hohen Steinhaufen. Aus des Ohm kleinem Häuschen sieht er große Flammen züngeln, und alle Leute laufen mit Wassereimern durch die Straßen. –
Jachls Herz klopft. Ganz kalt sind seine Finger. Er hört wie der Ohm und die Nachbarn ihn rufen: »Jachl – Jachl!«
Soll er sich melden?
Je später sie ihn finden werden, desto besser für ihn. Das ahnt er. Aber immer lauter ruft die heisere Stimme, die er so genau kennt: »Jaachl – Jaachl – Ja – achl!« –
Alle sind sie zusammengelaufen: der Gendarm und der Schullehrer und der Dorfschulze, die Bauern und die Knechte. Sie alle jammern: »Ist der Jachl verbrannt? Wo ist Jachl?« – Der Ohm sorgt nicht um sein bißchen Hab und Gut; nur an den Jungen denkt er. –
»Ja-a-chl!«
Endlich macht sich Jachl auf den Rückweg. Ganz behutsam schleicht er heran –
Wenn sie ihn nur nicht gleich sehen! – –
Es ist geschehen!
Des Müllers Knecht hatte die besten Augen. –
»Halloh – halloh – –«
Der Ohm weint, weint wie ein kleines Kind. Er hört gar nicht auf zu schluchzen. Den Stock haben nur die Nachbarn bei der Hand. »Der verfluchte Bengel!« hört sich Jachl nennen. »Brandstifter!« ruft eine andere Stimme. »Unglückswurm – von Gott Verlassener!«
Jachl rührt sich nicht; er weiß nicht, was das ist: »Brandstifter« und »von Gott Verlassener«. Dicht zum Ohm hat er sich gestellt; vermutlich – er ahnt es dunkel – wird der es nicht erlauben, daß die andern zu toll losschlagen. Püffe und Stöße hageln aber doch reichlich auf ihn nieder. –
Endlich steht der Sünder schluchzend allein neben den Mauerresten im Rauch. Jachls Tränen gelten nicht so sehr den Püffen, als der verworrenen Ahnung des Unheils, das er angerichtet hat. Alles, was der Ohm und er besessen und lieb gehabt haben, sieht er verdorben. Das meiste ist verbrannt. –
Abend ist's geworden. Beide merken es kaum. Ohne sich erst noch nach einem anderen Asyl umzusehen, wenden sie sich dem verfallenen Ställchen zu, das ihre einzige Schnucke beherbergt. Platz genug werden sie finden, um sich auszustrecken. Jachl fegt mit einem dicken Strauchbesen die Schlafstelle sauber, bevor er ein paar alte Tücher, die Nachbarsleute herbeischleppten, auf den Boden wirft. Wenige Minuten nur und beide schlafen. Sie besitzen nichts, auch nicht Nerven, die sie ruhe- und schlaflos machen könnten.
Durch die kleine Luke fällt ein Mondstreifen. Friedlich schnarchen Ohm und Jachl. Sie scheinen zu lächeln: der Kleine vielleicht, weil er weiß, daß er einen Beschützer hat, und der Alte, weil er fühlt, daß er auf Erden noch jemandem nötig ist. –
Erst der nächste Morgen zeigt ihnen deutlich, was sie verloren haben. Wie in die Trümmer eines Palastes schauen sie auf ihre vernichtete Hütte.
Ohne langes Besinnen fängt Jachl an mit einem Beil zwischen dem Schutt zu rühren. Zu heiß ist er noch für seine Hände. Jeden Scherben, den er aus der glühenden Asche holt, begrüßt er glückselig. Behutsam legt er ein Stück auf das andere. Einen ganzen Berg schichtet er rasch auf; wie ein Schatzgräber jubelt er bei jedem Fund.
Im Dorf wundern sie sich sehr über soviel Schlechtigkeit. Sie wissen ja nichts von der Seele eines Kindes; auf so Kostbares verstehen sie sich nicht. Höchstens meint der eine oder der andere entschuldigend: »Er is ja noch zu klein«, oder: »Er weiß doch nicht, was er angerichtet hat«, oder: »Gott sei Dank, daß er nicht meiner is.«
Mittags, als der Ohm von der Arbeit heimkehrt, gräbt Jachl immer noch so eifrig, wie wenn er sich die schönste Burg baue. Trotz allen Bemühens bleiben die beiden aber von jetzt ab Stallbewohner. Zum Wiederaufbauen der kleinen Hütte langt des Alten Beutel nicht. So voll wird seine Kasse auch niemals werden. Der Ohm ist schon zufrieden, etwas Ähnliches wie eine Stube an den Stall geklebt zu haben. Eine Kochgelegenheit töpfert er auch zurecht.
Um den Jachl haben alle ein paar Tage einen weiten Bogen gemacht. Rasch ist der Bogen kleiner geworden. Seine Freunde wissen eine Weile nicht, ob sie ihn nun als Helden, Indianer oder Bösewicht behandeln sollen. Jedenfalls rufen sie den Stallbewohner nur noch neckend »Scheper«. Und weil sie wissen, daß dieser Schäfer nichts zu hüten hat, brüllen sie höhnend:
»Scheper, Scheper, dudeldei,
Lät de Schap in unse Wei (Weide).«
Jachl hat aber nicht lange Zeit, sich über ihr Gebrüll zu ärgern. Er wird in die Schule geschickt. Ein anderes Leben beginnt. –
— — — — — — — — —
Solche große Stube, wie die Klasse ist, hat Jachl noch nie betreten. Er berichtet dem Ohm, daß da alle stillsitzen müssen, und daß er nun »Joachim« heiße, ganz großartig: »Joachim«. Zuerst habe er, der doch der »Jachl« ist, gar nicht gewußt, daß er gerufen sei. Aber gefallen tue es ihm, und wehe dem, der ihn von jetzt ab anders nenne; bloß der Ohm, der darf, weil er doch schon so alt ist, weiter »Jachl« rufen.
Joachim malt in stiller Begeisterung Buchstaben. Niemand kümmert sich um seine Schularbeiten, wie sich niemand um seine Spiele bekümmert hat. Er buchstabiert eifrig; nicht, weil er fleißig zu sein für nötig hält, sondern weil er neugierig ist, »was kommt«. Bevor er ein halbes Jahr zur Schule geht, kennt er sein Lesebuch auswendig, jedes Gedicht und jede Geschichte. Immer hat er an dem Ohm einen geduldigen Zuhörer. »Verstehste auch, Ohm?« fragt er fortwährend. Jachl hat das nicht unbegründete Empfinden, daß das Nicken des Alten mehr der Gewohnheit, als dem Verständnis entspringe. Furchtbar laut muß er sprechen; der Ohm ist im Laufe der Jahre recht taub geworden. Sehen kann er auch schlecht. Daß man einen Arzt fragen könnte, fällt beiden nicht ein. Fürs »doktern« war der Alte nie. Auch nicht fürs Nachdenken. –
»Ohm, wo bleib' ich, wenn du tot bist?« fragt ihn der Junge.
»Ich leb' schon noch, Jachl.«
»Aber, wenn du sterbst?«
Ein bißchen Angst irrt manchmal durch Jachls Kopf; nur ein schwaches Ahnen, daß es Kinder besser haben könnten als er. Vielleicht nicht besser, nur anders. –
Wenn Freiheit wirklich immer eine köstliche Gabe wäre, so müßte Jachl zu den Großgrundbesitzern gezählt werden. Sicher ist, daß er sich solchen Besitzes nicht bewußt ist, und daß er zu jung ist, um nicht oft durch ihn gefährdet zu werden. –
Kein Auge ist da, für das sein Anzug zu schlecht oder zu dünn ist. Vor drei Jahren erbte Jachl seinen jetzigen von des Schulzen Sohn. Damals schlotterte er ihm um die hageren Glieder. Nun strecken sich schon lange seine Arme weit aus den kurzen Ärmeln hervor. Entgegen dem Brauch, daß zuerst die kurzen Hosen an die Reihe kommen und später die langen, hält's der Jachl umgekehrt. Nur noch bis knapp über die Knie lassen sich die Hosen, deren Farbe längst unergründlich geworden ist, ziehen. –
Jachl kennt kein Kranksein. Einmal hat er Zahnschmerzen gehabt. Der Ohm erbot sich sofort zum Ausziehen. Ohne lange Vorbereitung – trotz unsicheren Erkennens – riß der Alte wirklich den richtigen Missetäter heraus. Jachl brüllte eine Minute auf, aber er zweifelte nicht, daß das Ausziehen eines Zahnes immer so, nur so erledigt werden könne. –
Nach einer Keilerei auf der Dorfstraße kommt eines Tages der Achtjährige mit der Frage auf den Alten zugesprungen:
»Du, Ohm, wo is'n eijentlich mein Vater?«
»Weiß Gott, wo sich der in die Welt rumtreiben tut!«
»Un meine Mutta?«
»Weiß ich auch nich –, unbekannt verzogen'!«
Die Hütte, in der die Beiden wohnen, hat allmählich einen sonderbaren Wandschmuck bekommen. Zu Beginn der Osterferien bringt Jachl immer ein großes, bedrucktes Blatt heim, auf dem von Rosen bekränzt die Worte zu lesen sind:
»Weil du von jeder bösen Sache
Dich ferne hieltst und sittsam bliebst
Und aufmerksam in jedem Fache
Dir möglichst alle Mühe gibst,
So nehme hier zum Angedenken
Dies Ehrenblatt als Zeichen an,
Daß du in allen Gegenständen
Nach Möglichkeit genug getan,
Und trag' es heim als Augenweide
Zu deiner Eltern Trost und Freude.«
Behutsam klebt Jachl seine Ehrenblätter an die Wand, eines und noch eines und wieder eines dazu. Längst kennt er die roten Tintenstriche, mit denen der Herr Lehrer durch das: »Zu deiner Eltern Trost und Freude« fährt, und die gleichmäßigen Buchstaben, die dafür seines Ohmes Trost und Freude verkünden. Ihm erscheint der schöne Vers deshalb nicht weniger schön. Nur – Trost? Der Ohm hat gar keinen Trost nötig, und von zuviel Freude ist ihm beim Anschauen des Ehrenblattes auch nichts anzumerken.
Gar soviel Wissenschaften werden vom Herrn Lehrer nicht gefordert. Nur die nötigsten Fächer beschweren die Köpfe seiner Bauernjungen. Wieviel Jachl trotz guten Aufpassens nicht begreift, kommt in der Schule nie ans Tageslicht. Da ist in der Religionsstunde oft von sittlicher Kraft die Rede. Kraft zum Puffen und Stoßen, die ist den Jungen in der Schule nichts Unbekanntes, aber sittliche Kraft ist nur mangelhaft in ihren dicken Schädel zu bringen. Ohne Stocken hat Jachl in der Christenlehre die Worte aufgesagt: »Der Gottlosen Rotte beraubt mich, aber ich vergesse deines Gesetzes nicht.« Zwar weiß er nicht, wann der Gottlosen Rotte ihn beraubt hat, aber alles, was der Herr Lehrer aus der Bibel verkündet, das soll wohl stimmen. Also bemüht sich der Schuljunge auch an diese Beraubung zu glauben.
Je länger ich meinen Jachl kenne, je mehr neige ich der Vorstellung zu, man sollte ihn eigentlich zu den Glückskindern zählen. Immer nimmt er die Dinge, wie sie sind. Dahin haben ihn nicht Überwindung oder mühseliges Überlegen gebracht, sondern angeborene Veranlagung. Vielleicht ist's ein glücklicher Instinkt mit dem er gesegnet wurde; Rebellion steht nicht in seiner Lebensliste, und doch kann man ihn nicht temperamentlos nennen.
Wüßte ich nur, wer sein Vater gewesen! Ich wollte mich gern dem Jachl zulieb tief in alle Vererbungsmöglichkeiten versenken. – Von seiner Mutter konnte ich auch nicht viel erforschen. Ich habe wohl ihr Kleid gesehen, aber nicht ihr Herz kennen gelernt.
— — — — — — — — —
Der Dreizehnjährige ist eigentlich schon der »Ernährer« der Familie. Winzig genug ist zwar ihr Verbrauch, trotzdem darf er sich vor keiner Arbeit scheuen, wenn sie immer satt werden wollen. Geld verdienen erscheint Jachl das Allererste, gleichgültig wie alt einer ist.
Die Schule erlaubt ihm nur Nebenbeschäftigungen. Ställe kann er bei den Bauern scheuern, Kühe melken, Schweine füttern. Jachl findet all diese Arbeiten wundervoll. Er kommt sich sehr wichtig vor. Die braunfleckige Kuh kennt ihn sicherlich, und jedes Schwein grunzt gerade ihn besonders liebevoll an. Der Ohm hat in den wenigen Augenblicken, die Jachl beim Essen neben ihm verbringt, immer nur zu nicken, wenn der Junge von all seinen wunderschönen Erlebnissen berichtet.
Was ist der Jachl doch für ein Seltsamer! Gar keine Anzeichen von »Verwahrlosung« sind an ihm. Wie ein Heidebusch kommt er mir vor, dem kein Wetter leicht Schaden antut. Er kennt es nicht anders, daß allerlei Ungemach über ihn dahingeht. »Was soll man dabei tun? Das ist doch so.« –
Die Heide mit allem, was auf ihr blüht und grünt und atmet, erfüllt beständig seine Gedanken. Zum Stehlen oder Betrügen läßt sie ihn gar nicht frei. Im Winter, im Sommer, immer ist viel Lebendiges auf ihr und gerade das Lebendige lockt Jachl. Er kennt in der Nähe jede krüpplige Fichte, jeden Heideweg, jeden schwarzen Machangelbusch, jeden Schnuckenstall und jeden Scheper. Vor den jungen Maibäumen steht er und betrachtet sie, als könne er sie wachsen sehen. Kein Naturgeschichtsbuch ist in seinem Besitz, aber er hat so gut aufgepaßt, wenn der Ohm und die Schäfer und die Knechte erzählen, daß er schon jetzt richtig mit Tier und Pflanzen umzugehen versteht.
Jachl rechnet seit Monaten die Tage nach, die noch vergehen müssen, bis ihm – ihm ganz allein – die Schnucken oder die Gänse oder die Kühe anvertraut werden. Er schwankt, welche Herde ihm die liebste sein würde. In Gedanken lebt er sich abwechselnd mit Schnucken, Gänsen und Kühen ein. Jede Art erfordert andern Verstand. Das weiß Jachl.
Über einen Beruf sich den Kopf zu zerbrechen, bleibt ihm erspart. Vor eine Wahl wird er nicht gestellt. Was sollte er wohl anders werden als Schäfer? Wär's nur schon Ostern! Bis dahin hat der Jachl noch viel Sorgen, aber nachher – dann – ja dann hört doch sicher alle Mühsal auf! Einem in der Heide umherwandernden Hütejungen kann doch wohl nichts mehr fehlen!?

Noch gehen dem Jachl aber in buntem, wirrem Durcheinander tausend Dinge durch den Kopf: Ein nicht vorhandener Einsegnungsanzug, dann der Konfirmationsspruch: »Auch wenn mein Vater und meine Mutter mich verlassen, nimmt der Herr mich auf«, dazu die Ermahnungen, die der Pfarrer an diesen Satz knüpft, ferner die Sorge, ob der Bauer auch keinen andern zum Hütejungen aussuchen wird, und die Frage, wann das Luftschiff, von dem der Urlauber Schulze gesprochen, wirklich und wahrhaftig im Sommer hier über Lüttersloh fliegen werde?
Augenblicklich steht Jachl tief nachdenklich vor des Ohms Sonntagshose. Der Alte kann sie entbehren; er hat sie ihm geschenkt. Wenn die schlechtesten Stellen herausgeschnitten würden? Sie könnte fein werden. Schneider Kiekebusch gibt sich aber bei der Arbeit gewiß keine Mühe. Jachl dreht die Hose hin und her. Ob er selbst sie zu ändern probiert? Zuerst fängt er an, sie mit Wasser und Seife zu reiben. Vor Eifer wird er feuerrot. Während der Schulstunden hängt er sie zum Trocknen auf eine Stange, die draußen vor dem Stall in die Erde gerammt ist.
An diesem Tage ist das Aufpassen in der Klasse sehr schwer. Wie wird er sein Kleinod wiedersehen? Unverändert speckig und fleckig oder schön rein? Im Galopp läuft er nach Schulschluß die Treppen herunter. Einige Minuten später zeigt er dem Ohm triumphierend seinen Schatz. Er findet die Hose fast so schön wie eine nagelneue. –
Abends spät quält sich Jachl sie enger zu machen. Das kann doch nicht so schwer sein! Zwei Nähnadeln sind aber bereits zerbrochen und noch ist nichts erreicht! Was tun? Mädchen verstehen so etwas besser. Welches sollte er bitten? Einem zu kleinen möchte er seine »schöne« Hose nun doch nicht anvertrauen, und an eine große wagt er sich nicht recht heran. – Es muß aber wohl sein. Lieschen fällt ihm ein. Er hat sie jahrelang kaum gesprochen. Mit Mädchen hat ein Junge doch nichts zu reden. Gerade jetzt lernt sie nähen; zufällig erfuhr er es. Gräßliche Furcht hat er vorm Ausgelachtwerden. Wer weiß, wie Mädchen sind! Aber er faßt Mut. Es geht nicht anders. Marsch los! Am besten ist's, er versucht sofort sein Heil.
Leise schleicht er sich unters Fenster, um zu hören, ob die Maschine noch klappert. Ja, Lieschen näht. Sie scheint allein in der Stube zu sein. Jachl klopft ans Fenster.
»Was is?« ruft eine junge Stimme.
»Komm mal ans Fenster.«
Lieschen erhebt sich flink. Obgleich sie zwei Jahre älter als der Junge ist, überragt er sie bedeutend. Ginge jemand vorüber, er würde ein Stelldichein vermuten.
Stotternd bringt Jachl sein Anliegen vor. Noch nie hat er mit Mädchen wirklich zwanzig Worte gesprochen. Die Hose hält er Lieschen dicht vor die Augen, um recht genau erklären zu können, wo und wieviel sie abgenäht werden muß. Bereitwillig verspricht sie ihre Hilfe. »Wenn ich sie nur nicht verderbe,« setzt sie unsicher hinzu. Am nächsten Abend soll Jachl sein Eigentum wieder in Empfang nehmen. Klapp! Das Fenster ist zugeflogen. Erleichtert und beglückt springt er nach Hause. –
So nah hat Jachl Mädchen noch nie gesehen. Was sie bloß für Augen haben! Sie leuchten ja toller wie 'ne Stallatern'! –
Jachl, der keine Nacht bisher schlaflos verbrachte, wirft sich unruhig hin und her. »Wird sie sie verderben? Was für feine Hände hat Lieschen, und wie waren ihre Haare? Wahrhaftig, schwarz wie Kohle.«
In Jachls Kopf hat sich Lieschen hineingeschlichen! Ganz breit macht sie sich und treibt ihm alles andere aus der Brust. –
Am nächsten Morgen erhebt es ihn nicht so wie sonst, daß seine Anwesenheit im Stall für jede Kuh eine Freude ist. Er denkt nur an seine Hose und an den Abend. –
Gegen 9 Uhr klopft er an das Nachbarfenster. Strahlend hält ihm Lieschen ihr Werk hin, dabei fragt sie ihn besorgt: »Wo is denn dein Rock? Und hast du einen Hut zur Einsegnung?«
Ja, Rock und Hut und Stiefel! Jachl erzählt, daß ihm der Bauer einen Rock versprochen hat. Noch sehr gut soll er sein, bloß zu groß. Und einen Hut darf er sich neu kaufen, richtig ganz neu. Aber Stiefel? Von der Großmutter stehen noch zwei Paar da; gar nicht schlecht sind sie. Wenn Lieschen sie mal ansehen wollte?
Sie will. Gleich begleitet sie ihren neuen Freund in seine Kammer. Der Ohm schnarcht. Jachl probiert die Stiefel. Je, schon jetzt sind seine Füße größer, als die der Großmutter waren! Wenn er aber tüchtig zieht, bekommt er doch vielleicht die Stiefel an. Das Auftreten ist zuerst sehr schwer, aber nach ein paar Minuten tut's schon weniger weh. Und Stiefel »an« werden wohl nie ein Vergnügen sein.
Lieschen entscheidet: Jachl kann die Stiefel ruhig tragen. Niemand werde sie wieder erkennen.
Zum Hutkauf will sie auch mitgehen, und den Rock wollen sie, wie die Hose, gemeinsam herrichten. –
»Na, denn bis morgen, Jachl!«
In den nächsten Tagen lernt Jachl zum ersten Mal in seinem Leben Kranksein kennen. Er mag nicht essen, nicht schlafen, ein furchtbares Brennen in der Brust hat er und ganz lautes Herzklopfen. Seine Beine zittern manchmal, und alles tanzt ihm vor den Augen. Wenn er mit Lieschen etwas bespricht, ist die Krankheit am schlimmsten.
Von dem Ohm hat Jachl die Abneigung gegen die »Dokters« geerbt. Er versucht also allein mit seinem Leiden fertig zu werden. Furchtbar schwer ist's: Schweine zu füttern, Kühe zu melken, Ställe zu scheuern, Konfirmationsunterricht zu nehmen, Schularbeiten zu machen, Garderobennöte zu durchleiden und dabei noch eine Krankheit loswerden zu wollen!
Jachl kocht sich Tee; denselben Tee, welchen auch die Kuh bekommt, wenn sie zuviel brüllt. Ein bißchen hilft er, aber hat Jacht denn überhaupt Zeit krank zu sein? –
Während er neben Lieschen in die nächste kleine Stadt trabt, zittert er wohl noch, aber sie reden doch vergnügt von allem möglichen. Auf dem Heimweg wird er fast gesund. Seinen steifen Hut trägt er gut verpackt unterm Arm. Er hat ihn vor einem langen, breiten Spiegel aufprobiert, der nicht ein bißchen zerbrochen gewesen ist. Zum ersten Mal sieht Jachl sich selber. »Der hellhaarige, lachende, große Mensch – bin ich der? Wahrhaftig?«
Eine Sekunde durchfährt ihn unbändige Freude.
»Wonach siehst du denn noch immer?« fragt Lieschen, »ein Hübscher bist du, daß du's weißt.«
Jachl hört noch lange: »Ein Hübscher bist du – ein Hübscher bist du.«
Schneider Kiekebusch muß zur Umwandlung des Rockes doch hinzugezogen werden. Er ist nicht zu umgehen. Lieschen allein wagt sich nicht heran. Jachl bittet erst auch gar nicht lange, denn: »sicher ist sicher«. Hat er doch beim Anpassen der »schönen« Hose mit Schrecken bemerkt, daß Lieschen ein wenig zu viel abgenäht hat, und daß der Hose Straffheit durchaus nicht angenehm ist. – Großartig paßt aber dann am Einsegnungstage nach Lieschens Urteil der ganze Anzug. Niemand weiß ja, wie sehr Jachl die Schuhe drücken, wie knapp er sich in die »schöne« Hose gepreßt hat, und daß die schwarzen Handschuhe (sie stammen auch noch von der Großmutter) schon die Krümmung eines Fingers zur Qual machen.
In der sicheren Voraussetzung, vom nächsten Tage ab »ein gemachter Mann« zu sein, überwindet Jachl alles Ungemach. –
Einige Minuten lang hat er gehofft, der liebe Gott, von dessen Güte er besonders viel in den letzten Wochen hörte, werde ihn vielleicht gerade an diesem Tage mit Vater oder Mutter überraschen. Es war aber nichts damit. –
Heute sind alle in Lüttersloh wie die Stadtherren angezogen. Jachl kommt sich auch furchtbar nobel vor.
Seine Gedanken sind aber nicht soviel, wie es vorgeschrieben ist, beim lieben Gott. Während des sehr feierlichen Augenblickes des Niederkniens, fällt ihm ein – ach, es ist schändlich, – daß ihm ein Regenschirm fehle, und daß gerade ein Schirm in der Hand einen gut angezogenen Burschen immer erst »komplett« mache. –
Am Nachmittag dieses Tages fühlt Jachl wieder sehr die Krankheit. Das kommt daher, weil er von Lieschen Abschied nehmen muß, die sich nach der Stadt vermietete.
— — — — — — — — —
In den Wochen ihrer Freundschaft hat Jachl möglichst oft die Nähe seiner einzigen Freundin gesucht. Einmal – es ist zum Lachen – als er sich derb gestoßen hatte, und Lieschen ihre Hand vorsichtig auf die blaugewordene Stelle legte, hat Jachl sich versprochen und »Mutter« zu ihr gesagt. Beide haben tüchtig gelacht! Mutter! Nie hat der Junge diesen Namen vorher so zärtlich über die Lippen gebracht. –
Also nach Lüneburg will Lieschen, dorthin, wo die Mädchen statt der Kappen Hüte über die dicken Haarflechten stülpen. In Jachls Vorstellung ist Lüneburg erschreckend groß: groß etwa wie Newyork oder London für erfahrene Reisende. So weit in die Welt wird er wohl nie kommen! Was sollte er auch in Lüneburg? Schäfer werden sie dort mehr haben als sie brauchen, und Jachls Sinnen und Trachten geht ja nur nach dem Schäferstand. –
Bis zur nächsten Bahnstation hilft er Lieschens Korb tragen. Jeder von ihnen hat einen der festen Seitengriffe gefaßt. Im Vergleich zu seinem eigenen Hab und Gut erscheint Jachl Lieschens Besitz an Kleidern und Wäsche riesengroß. Er weiß nicht, wie froh ihre Eltern sind, daß nun wieder eines aus der großen Kinderschar flügge wird und in die Fremde ziehen kann. –
Durch hohen Wacholder schreiten sie in erster Tagesfrühe. Vieles möchte Jachl noch sagen. In Lüneburg, in solch großer, großer Stadt, haben sie gewiß alle einen Schatz. Da stehen ja auch womöglich Soldaten! Diese Vorstellung macht Jachls Krankheit wieder viel schlimmer. Noch einsilbiger als sonst marschiert er weiter. Lieschen verspricht zu schreiben und Jachl zu antworten. Beim Gehen fangen sie zu singen an. Durch den feinsilbrigen Nebel, der sie umzieht, tönt es weniger schön als laut:
Wenn die Hoffnung nicht wär',
So lebt' ich nicht mehr;
Denn die Hoffnung allein
Kann lindern die Pein.
Und wie ging es denn hin,
Und wie ging es denn her –
Und wie ging es denn her – –
Wenn die Hoffnung nicht wär'?!
Im Winter muß man
Große Kälte ausstahn; –
Und im Sommer da ist's
Eine grausige Hitz! – –
Und wie ging es denn hin,
Und wie ging es denn her –
Und wie ging es denn her – –
Wenn die Hoffnung nicht wär'?!
Zehn-, zwanzigmal wiederholen sie mechanisch die gleiche Weise:
Und wie ging es denn hin,
Und wie ging es denn her –
Und wie ging es denn her – –
Wenn die Hoffnung nicht wär'?! – –
Lieschen ist in Gedanken schon weit fort. Jeder Schritt bringt sie ja dem neuen Leben näher.
»Schade, daß der Jachl Trübsal bläst,« denkt sie. »Was hat er nur, warum starrt er mich heute immer so an? Er weiß doch, wie ich aussehe.«
Ja, weiß er es denn wirklich? Weiß er, daß er neben einem blitzsauberen Mädchen dahingeht? Ich glaube es nicht. In Lüttersloh haben sie alle rote Backen, lange Zöpfe und lachende Augen. Nur, daß Lieschens ein wenig anders sind als die der meisten, das fühlt er unklar. Aber, wenn sie auch nicht anders wären, der Jachl hätte sich doch mit all seiner unverbrauchten Zärtlichkeit an sie geklammert. Jemand, der für ihn Zeit hat! Jemand, den sein Wohl und Wehe mitberührt! Muß dieser Jemand nicht sein ganzes Herz in Aufruhr versetzen? –
Nur zu rasch taucht der kleine Bahnhof aus dem Nebel auf. Sie kommen eine Stunde zu früh. Solche Reisenden wie diese kommen immer wenigstens eine Stunde zu früh. –
Gemächlich dampft die Lokalbahn heran.
»Na, denn mach's gut,« ruft Lieschen beim Händeschütteln.
Jachl schiebt geschickt den Korb in die IV. Klasse, und Lieschen springt nach. Ehe er es noch recht begreift, steht er allein auf dem Steig. –
Jungen weinen bekanntlich nicht. Wenn Jungen weinen, ist es eine Blamage. Auf der ganzen Welt gilt das. Jachl holt nur sein buntes Taschentuch hervor, schneuzt sich laut und fährt bei der Gelegenheit über die Augen. Einmal und noch mehrmals. Dann stopft er das Tuch langsam wieder in die Tasche, dreht sich um und trabt den Weg zurück nach Lüttersloh. –
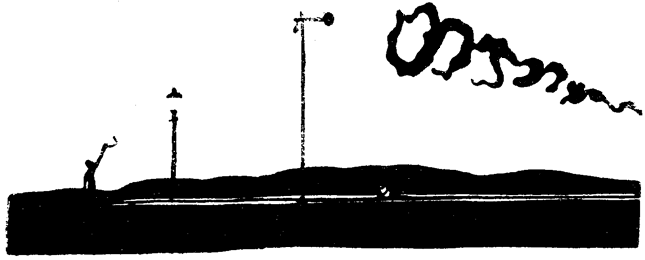
Viel Zeit zum Grämen bleibt ihm nicht. Auch er muß tags darauf in seinen Dienst. Nicht die Kühe, nicht die Gänse, sondern die Heidschnucken werden seiner Obhut übergeben. –
Der Ohm macht nicht erst viel Aufhebens von Jachls Amtsantritt. »Einer nach dem andern wird unbrauchbar, dann kommt der Nächste an die Reih'; heut ist Jachl dran – wird auch nicht ewig dran bleiben« –
Wie es Brauch ist, zieht der Schäfer mit hinein in den geräumigen Stall. Nur ein Gitter trennt Hirt und Herde. Auf verlassener Steppe liegt der Stall; denn die Schnucken brauchen weite Flächen. Nicht rasch wächst das abgegraste Heidekraut nach. –
Nie hat Jachl zu den beredsamen Leuten gehört. »Maulfaul« schelten ihn seine Freunde. Wer es nicht besser versteht, der kann ihn wohl so nennen. Seine Gedanken sind aber um so fleißiger. Jetzt ist es wohl ein Glück, daß er nicht von vielen Worten ist, sonst liefe er spornstreichs zurück nach Lüttersloh. –
Viele der Gebräuche und der Vorschriften, die sein neuer Stand erfordert, sind ihm nichts Unbekanntes. Aus einem Ställchen ist er in einen Stall gezogen; das ist sein Wohnungswechsel. Den fünfjährigen Jachl lockte bereits jede glockenklingende Schnuckenherde. Leidenschaftlich hängt er an Tieren, und von jeher beneidete er die Hütejungen. Sehnsüchtig folgte ihnen sein Blick. –
Der ihm nun anvertraute Stall erscheint ihm besonders wertvoll. Uralte Eichen und hohe Fichten umrahmen ihn. Man sieht, wenn man flüchtig hinschaut, kaum mehr als ein struppiges, schwärzliches Dach, dessen Ränder fast den Boden berühren. Der Platz vor diesem niederen Dach ist kahl genagt und ganz zertreten. –
Erprobte alte Schäfer sind ein »rarer« Artikel. Schlechte richten leicht großen Schaden an. Manchmal können Geld und gute Worte keinen guten Schäfer verschaffen. Leichter ist ein Professor ersetzt als ein Schnuckenschäfer.
Jachl fühlt sich geradezu für dieses Amt geschaffen. Kein anderer Stand dünkt ihm so herrlich. Ein reeller Schäfer muß wohl ebensolche Gedanken haben, wie sie in seinem Kopf rumoren. Und solche Liebe für alles, was kreucht und fleucht. Und so wenig Neugier auf alles das, was sonst in der Welt vorgeht. –
Viele, viele tausend kleine, blaugraue Heideschafe sind in Jachls Stall im Laufe der Jahre eingepfercht gewesen. Ordentlich andächtig stimmt den Jungen diese Vorstellung. Wenn er die doch bloß alle gesehen hätte!
Wenige Schritte entfernt von Jachls Schnuckenstall ist ein Kreuz errichtet. Unzählige Male hat er die Mär gehört, wie einst ein alter Schäfer an eine Birke gelehnt, stehend eingeschlafen ist. Das Nicken des Schlummernden habe der Bock als Herausforderung zum Kampf betrachtet und sich so rasend auf den Schäfer gestürzt, daß der Unglückliche mit zerschmettertem Schädel zu Boden sank. Jachl wirft immer einen scheuen Blick auf das Kreuz, wenn er daran vorüber muß. –
Seine Einführung in den Dienst unterbricht er ziemlich respektlos sehr oft mit den Worten: »Weiß schon – weiß schon.« An ihm soll es nicht liegen, wenn Krankheit in der Herde ausbricht, oder wenn ihr sonst ein Mißgeschick begegnet. Ihm wird nicht, wie er es nennt, »die Puste« ausgehen, muß er auch stundenlang hinter den Heidschnucken herlaufen. Er weiß, daß sie sich am liebsten Tag und Nacht, Winter und Sommer in unsteter Hast draußen bewegen. Vor naßkalter Nachtluft will er sie gewiß bewahren. Jedes Tier wird er wie seinen Augapfel hüten.
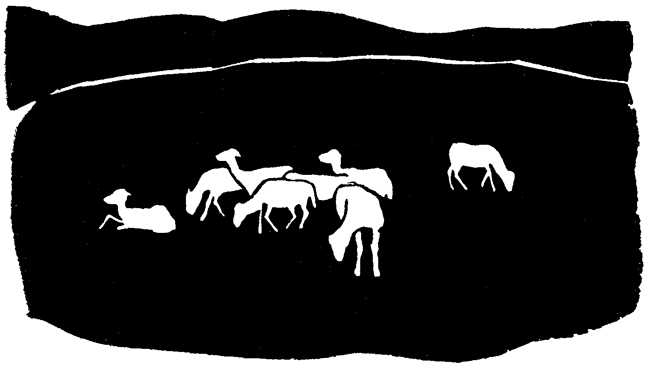
»Weiß schon – weiß schon! Sogar im Winter rennen sie, die Köpfe gebeugt, gleitend und trippelnd durch den Schnee. Keine Furcht ist vonnöten! Jachl paßt auf, Jachl, der Schäfer.« –
Während der ersten Wochen ist er fast nur mit Zählen beschäftigt. Kaum hat er eine Schar richtig durchgezählt, so läuft sie plötzlich wirr durcheinander, und die Mühe des Zählens beginnt von neuem. Schnucken zu zählen ist nichts Leichtes. Allmählich lernt er's. Immer besser gelingt ihm die Übersicht. Verlaufene Tiere fängt er bald geschickt wieder ein.
Nach einigen Wochen schon darf er sich auch einmal ein wenig Ruhe gönnen ohne Angst, daß die Schnucken jede Minute etwas Furchtbares anstellen könnten. Sein Dienstherr läßt nicht mit sich spaßen. –
Zum ersten Mal, seitdem er Schäfer geworden ist, dehnt Jachl in der Mittagssonne faul die Glieder. Er versucht, ob er jodeln kann. Komische Töne werden hörbar. »Na, denn nicht,« denkt er.
Nein, ein Jodelkünstler ist mein Jachl nicht. Schadet nicht, es gibt vielerlei Schäferkünste. –
Heute sieht er über die weite Landschaft, die in sonnigem Licht ruht. In der Geschäftigkeit seines Kinderlebens hat er Kohl und Rüben genau kennen gelernt, aber von Schönheit und Glanz ist nie etwas bis in seine Seele gedrungen. Stets hastete er von der Arbeit zur Schule und von der Schule zur Arbeit. –
Heute ist es ja hier wie in der Kirche. Und solch Gotteshaus steht Jachl nun immer offen! Seltsame Empfindungen erwachen in seiner Brust. Bis hierher dringen nicht die derben Redensarten, die im Dorf üblich und selbstverständlich sind. Hier ist er nicht mehr nur ein Bauernjunge. Hier ist – trotz Arbeit und Mühe – immer sowas wie Ostern oder Weihnachten.
Vielleicht fühlt Jachl, während geheimnisvoller Mittagszauber ihn umleuchtet, zum ersten Mal, daß auch er ein Mensch ist. Geburtstag hat er und weiß es selbst nicht. – –
— — — — — — — — —
Täglich liebt er die kleinen Heideschnucken zärtlicher. Ohne sie wäre er ja nie hierhergekommen. – –
»Jachl!«
Dröhnend schallt es über die Heide: »Jaachl –«
Hans Detel, der Landbriefträger, ruft's.
Jachl springt auf. Nicht fest wie sonst steht er auf den Beinen. Ein Brief aus Lüneburg! Hastig greift er nach dem ersten Schreiben, das im Leben an ihn gelangt. –
So fliegen einem also die Finger, wenn man einen Brief erhält! Er bekommt ihn so schwer auf, als erbräche er einen eisernen Kasten. Schweiß tritt ihm auf die Stirn. Da endlich:
»Lieber Jachl!
Wie geht es Dir? Mir geht es sehr gut. Ich bin Stubenmädchen im Hotel, wo Fremde kommen, die sich unsere Heide ansehen wollen, wenn sie blüht. Wir haben sie doch immer gesehen, das lohnt ja gar nicht. Lüneburg ist sehr groß, es soll aber viel, viel größere Städte geben. Ich möchte gern dahin. Schreibe mir bald einen Schreibebrief. Bist Du gesund? Ich denke alle Abende an Dich.
Dein herzliches Lieschen.«
Da ist schon wieder Jachls Krankheit: Herzklopfen und komisches Gefühl, bei dem man nicht weiß, soll man laufen oder sich still hinsetzen oder lachen oder weinen.
Die Zeit auf der Heide hat die Krankheit gebessert, und nun ist sie doch wieder gekommen. Es ist beinahe, als habe der Brief sie gebracht. Jachl dreht ihn hin und her, und dabei muß er wieder denken, ob wohl Lieschen sich schon einen Schatz angeschafft hat.
»So ein Stückchen Papier,« sinnt er, »kommt von ganz weit her, nicht anders als ein Vogel angeflogen.« Und eben solchen Vogel wird er nun auch fliegen lassen. Schreiben war ja immer seine Lieblingsstunde. Davor hat er keine Angst. Der Lehrer lobte ihn dabei und sagte, die andern Jungens sollten es auch so propper machen. Ja – ja – das war aber nur Abgeschriebenes oder Diktat; etwas, was man sich allein ausdenken soll, das versuchte Jachl noch nie.
Schreibpapier hat er nicht; das müssen ja wohl Bogen sein. Aber auf der hellgelben, sauberen Düte, die er schön zusammengelegt bei sich hat, kann er's probieren. Zwischen tausend Krümeln und Gerätschaften findet er in der Hosentasche einen kleinen Blaustift. Gerade als er sich einen guten Platz zum Anfangen ausgesucht hat, bellen Pitt und Pott, die Hunde, heiser und wütend. »Was ist denn los?« Jachl stolpert über die am Boden sich lang hinwindenden Kiefern. Friedlich grast die Herde. Pitt und Pott scheinen Jachl das Briefschreiben nur nicht zu gönnen, »Na wartet, ihr – –«
Von neuem bereitet er sich zum Anfang vor. Den Tisch ersetzt ein kurzer, glatter Baumstumpf. Ohne langes Überlegen malt er kauernd Buchstaben nach Buchstaben:
»Liebes Lieschen, ich weiß keinen Anfang. Er kommt aber doch. In der Schule konnte ich gut Rechtschreibung, aber ein Brief ist wohl ganz etwas anderes. Einmal hatten wir einen auf: Einen Ferientag beschreiben. Ich hatte sehr gut darunter. Ich wußte bloß zuerst nicht, an wem schreiben, da schrieb ich an meine liebe Mutter. Heute weiß ich doch gleich, an wem dieser Brief geht. Ich kann hier nur aufschreiben, was ich denke, sonst passiert hier nichts. Es ist doch nicht wie Lüneburg. Du bist da zwischen viele Leute, ich habe schon manchen Tag keinen gesehen wie Pitt und Pott und meine Schnucken. Das ärgert mich gar nicht, bloß nach Dir habe ich Heimweh, wenn mir mal so traurig zumute ist. Ich habe nicht mehr solche Arbeit wie früher. Mehr mit dem Kopf muß ich bedenken; das ist sehr schön, aber beschreiben kann man es nicht. Und denn die Heide, Lieschen. (Du kennst sie ja gar nicht, so wie ich sie jetzt immer um mich habe). Die Fremden sollen man ruhig herkommen, es ist viel zu sehen; ich sehe immer und immer was neues. Jeden Tag ist was anderes. Von hier weg möchte ich nicht; es ist, als müßte ich dabei eingehen. Hans Detel spricht, ich bin wie ein langer Stock. Und ebenso dünn. Und die Hosen sind wieder viel zu kurz geworden. Wenn sie doch auch mitwachsen könnten wie ich oder die Bäume; das sparte viel Geld. Ein Kuwerr hab' ich nicht, das bringt Hans Detel morgen und dazu richtige Bogen. Meine Schulbücher habe ich alle mit hergebracht, da lese ich drin und verstehe alles jetzt viel besser wie früher. In der Schule ist einer noch sehr dumm. Der Lehrer hat oft gesagt, wir sollen uns bilden, damit wir in der Welt weiterkommen, aber für die Welt hier bin ich gebildet genug, ich lese für mich, und damit Du mir nicht soweit vorkommst. Behalte Jachl lieb.
Dein treuer Freund Jachl.«
Nachschrift: Knütten tu ich nicht (Du nennst es ja wohl stricken?), das ist für alte Schäfer; ich sehe lieber mich ordentlich um, und dann horch ich, da ist auch viel bei zu lernen. Die Amsel pfeift und die Krähe quarrt, und sonst hör ich noch sehr viel, was Du in Lüneburg nicht zu hören bekommst. Nochmal Dein treuer Freund Jachl.«

Zum ersten Male quält Jachl an diesem Abend seine Einsamkeit. Bis zu ihm verlaufen sich seine Schulfreunde nur mal des Sonntags. Johann Peter lernt beim Schreiner und Hein Gird beim Schmied. Sie mögen es hier draußen nicht sehr. Wenn sie Sonntags kommen, bringen sie richtige Zigarren mit. Jachl soll sie durchaus probieren. Ihm wird gräßlich, aber sagen muß er: »Fein schmecken Zigarren!« Die Gäste brüllen vor Lachen, als sie sehen, wie grün Jachl wird: »Das is am Anfang immer so,« schwört Johann Peter. Sie prahlen furchtbar. Hein Gird sagt, er habe Trin Durt, seine Meistertochter, richtig laut geküßt. Johann Peter ruft: »Quatsch!« Er hat noch viel was Größeres vollbracht: Hans Joachim bei einer Keilerei unterbekommen. Noch heute hat Hans Joachim blaue Flecke. Ja, die hat er. –
Nicht keilen und nicht küssen kann Jachl, der Schäfer, das ist wahr.
Er bewirtet die Gäste mit Backbirnen und Buchweizenpfannkuchen. Zuerst sind ihm die Kuchen immer verbrannt. Fein bekommt er sie jetzt fertig, so fein, daß Johann Peter sagt: »Ich platze.« Vier Teller hochgehäuft voll hat der verschlungen. Nachher blieb er zwischen den warmen Kräutern vor dem Stall eine Stunde wie tot liegen, nicht rücken und rühren konnte er sich.
Erst wenn die Dunkelheit herabzufallen beginnt, greifen Hein Gird und Johann Peter nach ihren Spazierstöcken. Nach was für welchen! Jachl hat solche feinen Stöcke noch nie gesehen. Er besieht sie nicht ohne Neid; das Oben sieht ja beinahe wie echtes Silber aus. Und an ihren Uhren haben sie auch was Blankes hängen. –
Ein Stück Weges gibt er den Freunden das Geleit. Rasch verschwinden sie in den feuchten Schatten, welche über die Wiesen gleiten. –
Bei den Schnucken gefällt es Jachl besser wie bei den Freunden; das ist keine Schande. –
Abends holt er immer seinen Brief hervor und besieht ihn. Ihn zu lesen, das ist nicht nötig; längst kennt er ihn Wort für Wort auswendig. Manchmal sagt er ihn sich richtig wie ein Gedicht, das er in der Schule lernen mußte, auf.
Viermal ist noch so ein Briefvogel zu ihm geflogen. Nicht öfter. In Lüneburg kann eine wohl leicht Lüttersloh vergessen. Was soll Jachl dabei tun?
Sonntag Abend, wenn die Schnucken schlafen und Jachl allein ist, dann ist ihm immer »nicht ganz richtig«. Er weiß, daß um diese Zeit die Burschen auf dem Dorfplatz tanzen, und daß ihn seine Länge, wenn er auch noch jung ist, nicht mehr vom Hopsen und Springen ausschließt. Er kennt die heißen, vollgestopften Stuben, in denen sich Männer und Mädchen schweißtriefend drehen, und die heimlichen Winkel kennt er, in denen sie sich drücken und küssen. Bisher jagt ihn kein Verlangen, sich ihnen zuzugesellen. Manchmal nur kommt das Heimweh nach Lieschen, aber die Traurigkeit ist ganz anders wie die, welche er heut fühlt, als der Lehrer extra zu ihm kommt, um ihm mitzuteilen, daß der Ohm »eingegangen« ist. –
— — — — — — — — —
Jachl zieht stumm sein bestes Zeug an und wandert mit der Herde ins Dorf. Da er so rasch keinen Stellvertreter findet, ist es am besten, er nimmt die Schnucken mit.
Zwei Tage läuft er hin und her. Sein Kopf ist ganz wirr. Er ist doch der Erbe. Erbe sein ist nicht so leicht. Es ist nicht viel dabei zu beneiden. –
Jachl muß, während noch die Leiche dicht neben ihm liegt, kramen und räumen und sein Hab und Gut besehen, denn so rasch darf er nicht wieder vom Schnuckenstall fort. – Mehrmals rollt seine Karre, die hochbeladen ist, durch die Heide, ehe er die Erbschaft draußen untergebracht hat. Vielerlei Gartengerät hat der Ohm noch besessen; dazu eine uralte Schwarzwälder Wanduhr, einen großen kupfernen Kessel, viele irdene Töpfe und Pfannen und Tiegel und eine große braune, tannene Truhe. Bis an den Rand ist die Truhe mit alten Bauernkleidern angefüllt. Obenauf liegt des Ohms Zipfelmütze. –
Nachdem Jachl den Leiterwagen, auf dem er den toten Ohm ins Kirchdorf gefahren hat, leer zurück kutschierte, hat er nichts mehr mit ihm zu tun. Er nimmt nur noch des Ohms Katze auf den Arm, ehe er sich auf den Heimweg macht. –
Mondschein erhellt die Heide. Der Schall der eigenen Tritte und das Zirpen von Heuschrecken einigen sich zu einer geheimnisvollen Musik, die den jetzt völlig Alleinstehenden auf seiner nächtlichen Wanderung begleitet. – Nun der Ohm tot ist, merkt Jachl erst, wieviel es doch bedeutet, ein »Stückchen Anhang« zu haben. –
Das erste Heidejahr ist vorüber. Der Schäfer hat sich so an das schwärzliche Tiergewimmel neben sich gewöhnt, daß er sich das Leben gar nicht mehr anders vorstellen kann. Er begreift nicht, wie Leute sich wohl fühlen, die allein ihres Weges gehen ohne immerfort aufpassen zu müssen, die nicht pfeifen, nicht nachzählen, nicht He-He-Rufe ausstoßen, die also nichts zu hüten haben.
Er kennt jedes seiner zweihundert Tiere ganz genau. Von jedem könnte er, würde es gefordert, eine Biographie herausgeben: Dort das kleine, ganz dunkle Schaf ist sehr anfällig; jenem schaden Wind und Wetter nicht; das da gehorcht nie, rennt immer vor, und dies mit den dünnen Beinen, bleibt zurück. Ja, es ist nicht einfach, zweihundert »Individualitäten« zu erfassen, von denen die eine zu viel säuft, (wenn's auch nur Wasser ist), und die andere sich zu oft den Magen voll Gras stopft; Individualitäten, deren manche geduldig Pitt und Pott folgen, und von denen andere nur dann zu bändigen sind, wenn sie gejagt werden. – Jede Schnucke hat »ihren Kopf für sich«, aber die Fremden, die manchmal an Jachl herantreten, um ihn ein bißchen auszuhorchen, merken das nicht. Sie denken, Tiere sind dumm und eines ist wie das andere. Das ist ganz falsch. Aber wozu Leute klug machen? Sie können ja Bücher auch durchstudieren wie er. –
Jachl lernt jetzt richtig von Grund auf Schäfer. Das ist nicht so leicht. Er merkt es erst, während er seitenlang auswendig lernt: »Was ein guter Schäfer wissen muß«. Oft genug brummt ihm der Schädel. Da steht zu lesen: »Ein verständiger Schäfer muß die verschiedenen Grün- und Winterfuttermittel hinsichtlich ihrer Nährfähigkeit, Zuträglichkeit oder Schädlichkeit für die Schafe kennen und muß nicht minder vertraut sein mit der Verderbnis derselben und deren nachteiligen Wirkungen auf die Schafe.«

So ähnlich geht es durch das ganze dicke Buch. Aber Schafmeister oder Oberschäfer kann einer nicht werden, ohne all die Gelehrsamkeit über: Paarungsmethoden, Wollbeschaffenheit, trächtige Mutterherde, sorgfältige Weideführung und über noch sehr, sehr viel mehr. Manches liest Jachl dreimal durch, aber verstehen tut er es auch dann nicht. Wirklich in Jachl »drin« ist das Buch: »Anforderungen an einen Schäfer« noch lange nicht, aber so nach und nach behält er doch vieles. –
Immer noch ist Lieschen seine einzige Bekanntschaft und – wie es im Leben meist der Fall ist – solch eine, die deshalb immer mehr gilt, weil sie nicht in der Nähe ist, und weil nichts anderes dazu und dazwischen kommt. Denn die Schnucken, so viele es auch sind, und so ganz sie Jachls Leben beherrschen, kommen doch erst nach Lieschen. –
Zu Weihnachten hat sie eine Photographie geschickt. Jachl mußte erst sehr lange hinsehen, bis er genau wußte, wer das sein sollte. Was hat sie bloß auf'm Kopf!? Und Handschuhe an! Wozu zieht sich der Mensch überhaupt Handschuhe an? Jachl läuft es noch kalt über den Rücken, wenn er an die schwarzen denkt von seiner Einsegnung her. Aber, na, Lieschens Augen sind ja doch mit auf dem Bild, deshalb kommt Jachl über den Hut weg, soviel lieber sie ihm in ihrer altgewohnten Kappe wäre. – Zuerst nagelte Jachl das Bild im Schnuckenstall in einem Winkel an. Nach ein paar Tagen wickelte er es in viel Papier ein und vergrub es tief in die Hosentasche, ganz tief nach unten, weil die andern Sachen, die in seine Taschen gehören, es sonst wohl leicht schmutzig machen könnten. –
Johanni will Lieschen noch weiter in die Welt. Bis nach Hamburg will sie! Jachl begreift das nicht. Ist Lüneburg denn noch nicht groß genug, wenn eine durchaus die Welt sehen will?! Lange sitzt Lieschens Unternehmungslust quälend in seinem Kopf. Erst gegen das Frühjahr hin treibt die Sonne sie mehr fort. Jachl wirft seine Bücher weg; zum ordentlichen Schäfer wird einer nicht bloß mit studieren. Das weiß er. –
— — — — — — — — —
Durch hohe Schichten Fallaub traben wieder Hirt und Herde. Ihre Schritte zerbrechen knisternd zu Boden gesunkene morsche Äste. Sie zerstampfen auch viele unter der Eisdecke ertrunkene Frösche, die in Mengen auf den grauen Moosflächen jetzt herumliegen.

Schon die erste Märzsonne tut Wunder. Und dann der April! Aber erst der Mai! Jachl ist sicher, jede Schnucke freut sich wie er über die silbrigen Knospen der Kriechweiden und über die gelbleuchtenden Ginsterblüten. Jeder Monat dünkt ihm der allerbeste, mag er ihm Sand in die Augen fegen oder ihm mit Regen die Haut durchnässen. –
Julischwüle brütet über der Heide. Jachl meint heute wiedermal bestimmt, diese Juliglut sei ihm am liebsten, gerade sie. Winzige Tiere rennen über seine bloßen Füße. Nur vollständig trostlose Wetterverhältnisse zwingen ihm Stiefel auf. Strümpfe trägt er nie. Wer sollte sie ihm stopfen? Im März schleudert er stets endgültig für Monate die Stiefel in einen Winkel, dann springt er dreimal in die Höhe. Sein Sommer hat dann begonnen, was immer der Himmel auch noch in den nächsten Monaten herunterschütte. –
Heute aber ist er wirklich da, der Sommer. Die Menschen merken ihn, und Jachl genießt ihn auch. Durch dichte Brombeerranken drängt er sich, wilde Rosenbüsche schlagen ihm um die Stirn. Unbezwingliche Sommermüdigkeit überfällt ihn. Er will sich auf den Boden strecken; schon beugt er sich hernieder – da – was ist denn das? Welch nie vernommenes Rauschen in der Luft? Er sieht in die Höhe. Im Kreise dreht er sich. Nichts ist da als Himmel und Argusfalter, die blau durch die Luft schweben.
Einförmige Schläge einer Holzart schallen über die Heide. Jachls scharfem Gehör entgeht auch nicht das leise Rinnen einer Quelle, die in die Wiese hinab will. –
Hat er sich getäuscht? Rauscht es nur im welligen Heidekraut? In den Hängebirken?
Nein. Es kommt aus der Höhe. Bestimmt aus der Luft.
Da – jetzt – was schwebt da heran? Ein großer Vogel? – – Nein.
Jachl reißt die Augen auf, so weit als möglich, weil er glaubt, dadurch besser sehen zu können.
Schmal und lang ist das Unbekannte, mit Flügeln, die rennen wie Mühlräder, und die brausend immer näher heran kommen.
Feuerrot wird Jachl. Niemand ist da, der mit ihm das Wunder studieren könnte. Nur die Schnucken. Sie haben sich eng aneinander gepreßt; das Rauschen ist auch ihnen nicht geheuer. Aber schon durchzuckt es Jachl: Ein Luftschiff – das muß ein Luftschiff sein! –
Zuerst bleibt er wie angenagelt stehen; dann fängt er an zu rennen. Ohne Überlegung läuft er in brennender Gluthitze dem Luftschiff stundenlang nach – es muß ja noch wieder sichtbar werden, – und mit ihm laufen all seine Schnucken wie von Furien verfolgt. –
Jachl ist wie von Sinnen. Es treibt ihn weiter, nur weiter. Er fühlt nicht die Hitze; er hört nicht Pitt und Pott bellen; er merkt nicht, daß er auf harte Stauden tritt, die ihm die Füße zerstechen. Kreuz und quer läuft er, immer mit den Augen das Wunder suchend, das rauschend dahinsegelte. Die Arme streckt er in die Höhe, als wolle er das Luftschiff vom Himmel reißen; dabei reckt er den Hals, der doch nicht zu einem Schwanenhals auszudehnen ist. – – –
Jacht, mein Jachl, steh still! Lauf nicht in die Weite so unklug! Was kümmert dich das Luftschiff? Du gehörst nicht zu den Fliegern – du nicht. – Aber du hörst meine Stimme nicht. Armer Jachl. –
In unstetem Zickzack läuft der Schäfer stundenlang. Vielleicht, daß er es nochmals erspähe! Rasch, immer noch rascher! Die Schnucken hat er vergessen. Er merkt nicht, daß Schweiß ihm und ihnen die Körper bedeckt. An Hitze ist der Jachl gewohnt; nachts ist er seit Monaten oft wie in Schweiß gebadet. –
Gegen Abend bricht er in einem Sandloch zusammen. Das macht nichts. Rasch will er sich erheben. Etwas Warmes quillt ihm aus dem Munde. Er faßt mit der Hand danach. Die Hand ist rot geworden. Ist das Blut? Ach ja, Blut. –
Jachl erschrickt nicht. Er will es abwischen, aber immer mehr, immer rascher fließt es ihm rot und warm über die Lippen. Die Augen fallen ihm zu: Heide, Luftschiff, Herde sind entschwunden. –
Eine Viertelstunde vergeht, da stößt etwas dem Jachl ans Bein. Noch kann er sich nicht bewegen. Seine Schnucken sind es, die über ihn dahinrennen, tripp – tripp, hin und her, als gefalle es ihnen ganz besonders auf diesem unebenen Stück Heide. – Wütend bellen Pitt und Pott. Ja, sie haben recht, sich über den Schäfer zu ärgern, der erst zu rasch lief, und der nun faul im Sande liegen bleibt. – –
Endlich macht Jachl sich langsam auf den Weg. Wie weit ist er denn fort von seinem Stall? Er kann sich gar nicht zurecht finden. Recht hell ist es auch nicht mehr. Und auf den Beinen ist er ganz schwach. Er sucht Büsche und Stämme, an denen er sich halten kann. Immer wieder muß er verschnaufen. Den Schnucken fehlt ihr Stall nicht, aber heute fehlt er dem Hirten. Ausstrecken möchte der sich und sich warm zudecken und schlafen, nichts als schlafen. –
Nachtfalter taumeln durch die Luft. Fledermäuse huschen in den Wacholderbüschen. Sterne funkeln. Überall ist Licht und Lust trotz der Nachtzeit, die doch zum Schlafen vom lieben Herrgott eingerichtet ist, wie Jachl immer gemeint hat. Noch nie hat er draußen eine Nacht so ganz durchwacht. –
Langsam streicht im Osten Röte am Himmel empor. Jachl fällt auf einen Baumstumpf. Er muß eine Weile ausruhen; er kann nicht weiter.
Seine Gedanken sind ihm selbst fremd. Was wollen sie denn diese anderen Gedanken?
Erfahrene Leute nennen das Gefühl, welches dich, mein Jachl, in diesen Minuten beklemmt: Sehnsucht. Wie aber solltest du es kennen oder nennen?
Du fassest nur tief in deine inhaltsreiche Hosentasche und suchst, bis du etwas Eingewickeltes herausgefunden hast. Behutsam nimmst du ein Bild, siehst es an und versenkst es wieder zwischen Schlüsseln und Streichhölzern und Taschenmesser und Schere und Bindfaden und all den vielen andern Dingen, die du auch notwendig gebrauchst. –
Gegen 10 Uhr vormittags sieht Jachl endlich, endlich von weitem seinen Stall. In der Freude, wieder daheim zu sein, versinkt jedes andere Gefühl. Er ist sicher, daß das bißchen Bluten rasch vergessen sein wird, wenn er sich nur von dem wilden Lauf, warm zugedeckt, ausruhen kann. Das Zähneklappern kommt vom Frühwind und vom leeren Magen. Der Atem ist ihm ganz kurz geworden. –
Müde folgen die Schnucken den Hunden. Jachl lacht, wie eifrig manche von ihnen sich gleich wieder in die kleinen Kiefern vor dem Stall festbeißen. Wie sollen sie in die Höhe wachsen, die armen Kiefern, bei der Behandlung?
Rasch kocht er sich einen festen Buchweizenbrei; der tut gut! Dann wickelt er sich fest in seinen groben Schäfermantel. Einige Minuten später schallt lautes Schnarchen durch den Schnuckenstall. – – –
— — — — — — — — —
»Tee hilft immer«, hat der Ohm Jachl gelehrt. Bei schwacher Brust tut auch ausgebratenes Hundefett Wunder. Ob dies nun eigentlich »schwache Brust« ist? Jachl glaubt es. Zuerst versucht er eine Roggenbreikur. Der bräunliche Brei mit frischer Milch übergossen, ist nicht übel. Und »Fledersaft«, aus getrockneten Beeren des Flieders gepreßt, kann auch nicht von Schaden sein. –
»Bloß nich mit die Doktors anfangen.« So oft hat es der Jachl gehört, daß er »die Doktors« unmöglich Gelehrsamkeit zutrauen kann. –
Jagten die Schnucken ihren Schäfer nur nicht immer über Stock und Stein! Mit dem Laufen will's gar nicht wie früher werden. Auf sandverwehtem Heidewege kommt einer oft ins Stolpern, und gerade beim Stolpern sticht's dem Jachl immer in der Brust.
Geholfen haben ja Fliedersaft und Roggenbrei und Hundefett, ja, das haben sie, aber so recht ist dem Jachl doch noch nicht. –
Am liebsten hockt er und flicht Körbe, ja, sogar das bisher von ihm so verachtete »Knüttzeug« nimmt er zwischen die Finger. Lang sind die Finger und so weiß die Haut, als fühlten sie niemals die Sonne, die doch wahrlich genug auf ihnen gebrannt hat. – – –
Heide, du taufrische, braune Heide, die du melancholisch oder jubelnd dahinfließt, weißt du, daß du – (ach, lächle nicht) Persönlichkeiten bildest? Du bist nicht ruhmgierig wie die große Stadt. Du biegst und zerrst nicht absichtlich an Tier und Pflanzen und Menschen. Du breitest nur deinen Himmel über sie – unabsehbar weit; in deine große Stille nimmst du auf. In deine schimmernde Stille, und du lässest gewähren. Du mahnst ganz leise, daß es nicht lohnt (daß es vielleicht nur lächerlich ist) gewichtig auf etwas Großes loszustürmen, weil du weißt, wie klein auch das Große in der Nähe wird, wie es Farbe und Form verändert. Du prahlst nicht mit großen Zielen. Du verschwendest ganz einfach nur dich selbst, du einsame Schöne. Verschwendung ist deine Beredsamkeit, ist deine Bildnergabe, ist der Same, den du ausstreust.
Jachl, der nichts ist als der Scheper, als der Bauernjunge, ist dennoch vielleicht durch die Heide »auch einer« geworden! Nicht allein durch die Heide, aber mit ihrer Hilfe. Ja, das ist er! Ganz bestimmt! Er hat nicht nötig, sich vor einem Stadt-Lehrling oder vor einem Studenten oder vor einem Prinzen zu schämen, obwohl er doch nur eine blaugefärbte Leinenweste mit zwei Reihen blanker Knöpfe trägt und eine schirmlose Mütze, die aus der Haut eines jungen, schwarzen Schnuckenlammes genäht ist. Von Lackschuhen und gestickten Chemisetts und von all dem »Nötigen«, welches ja wohl ein junger Mann haben muß, ahnt er gar nichts. Aber – nein – verstecken braucht er sich doch nicht, mein Jachl. Besonders wegen seiner Gedanken, meine ich. Und Gedanken sind ja wohl die Hauptsache.
Woran Jachl eigentlich denkt? Nie an Großartiges, immer nur an Gewöhnliches; etwa an Vieh oder an Weide oder an Wollhandel oder an Torfstechen oder an Runkelrüben oder an Kleinknechte oder Großknechte und was dergleichen mehr ist, – aber, ja, ein Aber ist dabei.
Welch ein Aber? Man muß es wohl fühlen, glaube ich. Zu erklären ist es kaum.
Gedanken haben auch ihren Schein und ihren Schimmer.
Vielleicht habe ich meinen Jachl nur so gern, weil ihm nie die Vorstellung kommt, daß es auf Erden Menschen gibt, die es viel, viel besser haben als er. Er läßt Dornen, Dornen sein und Rosen, Rosen; er sucht gar nicht immer nach den Bergen; er sieht viel Schönes auch im Tal. – –
— — — — — — — — —
Lieschen hat in einem ihrer Briefe erklärt: »ein Schäfer, der immer nur auf der Heide rumsitzt, ist was Langweiliges«. Na, denn muß Jachl doch auch mal einen Sonntagstanz im nahen Kirchdorf probieren. Was sein muß, muß sein! Lieschen wird es wohl verstehen! Mädchen verstehen sich auf so was besser. – Von Jachls mangelhafter Gesundheit weiß sie nichts. Wäre sie in seiner Nähe, so hätte sie ihn längst von sich und seinen Schnucken fortgelockt. Wie sang sie doch immer:
»Komm, tanz mit mir, tanz mit mir,
Ich hab' 'ne bunte Schürze für« – –
und angesehen hat sie Jachl dabei immer! Nun sie fort ist, merkt er erst, was für eine Mordsdirn sie ist.
Frauensleute sind so schwer zu kennen wie Schnucken. Sie haben auch so was Unsicheres wie die. Man muß eigentlich auf beide den ganzen Tag aufpassen; plötzlich sind sie weg, wenn man auch noch so gut zu ihnen gewesen ist. Hat sich eine verlaufen, so weiß man auch nie, wie und wo man sie wieder zu sehen bekommt. –
Jachl beugt vieler Unzufriedenheit im Leben mit einem leicht Geseufzten: »Was soll man dabei tun?« vor. Sobald er bis zu dem Gedanken gekommen, ist er auf dem Wege sich abzufinden.
Was soll man dabei tun? Wie Sonne und Regen kommen, ohne daß man sie holt, so überläßt er dem lieben Gott auch alle anderen Schwierigkeiten, an denen er, der Schäfer, allein doch nicht viel ändern könnte.
Jachl beginnt die Vorbereitungen für seinen Vergnügungsgang, indem er sich in die Spiegelscherbe sieht, die er noch im Stall vorgefunden hat, als er einzog. »Spack« sieht er aus; das ist wahr. Wer weiß, ob ihn eine zum Tanzen mag. Er hat ordentlich Angst. Schließlich trösten ihn die vielen Stoppeln, die auf seiner Oberlippe sitzen, die müssen Eindruck machen und das Helle, welches sogar schon an seinem Kinn sproßt, auch. –
Der Stallstellvertreter ist für einen Tag gekommen. Jachl summt wie ein Alter:
»Morgen is Sündag!
Dor smitt de Bur de Plünn' (die Lumpen) ab.«
Großartig kann er sich herausstaffieren. Lang genug hat er des Ohms alte Truhe durchsucht. Er fand Stulpenstiefeln und ein rotes Halstuch und eine rote Weste mit Messingknöpfen. Lieschen würde Augen machen. Schad', daß sie nicht im Kirchdorf, oder daß nicht eine andere Dirn dort, die auf ihn wartet. –
Schon von weitem hört Jachl das Karussell. Ordentlich springerig wird ihm. Er sieht sich um, ob er allein ist, dann schießt er mehrmals Purzelbaum. Zuerst kommt er bei dem Bandhändler vorüber, der seine Waren auf einer Scheunendiele ausgelegt hat. Jachl klappert zwar mit den wenigen Münzen in seiner Tasche, aber beim Klappern läßt er es bewenden. –
Im Weitergehen hört er in verschiedenen Gastwirtschaften »Mesik« Er weiß nicht recht, kann er tanzen oder kann er nicht tanzen. Er glaubt, daß er es kann. Aber mit »welcher« soll er gleich stundenlang, wie es Brauch ist, zusammen bleiben? Musternd tritt er in das erste beste Gasthaus ein. Nicht eine Dirn ist da, mit der zu hopsen es ihn gelüstet. Rasch trinkt er einen Kümmel, ehe er in einer anderen Wirtschaft weiter nach einer Tänzerin sucht. – Hier nimmt er ein Bier und dort einen Schnaps und immer so weiter, bis er in allen Häusern gewesen ist und auf den Beinen so unsicher, wie wenn er ein Mädchen im Arm einen halben Tag ohne Unterbrechung herumgeschwenkt hätte. –
»Wie sieht der Jung' aus«, sagen die Bauern.
»Käsig, na ja, das kommt von's Vergnügen«, setzen sie verständnisvoll hinzu, stoßen sich an und kichern.
Gelangweilt drückt Jachl sich von einem Platz auf den anderen. Längst ist er mit seinen Lieblingsgerichten durch. Er kann doch nicht immer weiter Rauchfleisch essen und Quetschkartoffeln mit ausgebratenem Speck und Weizenklöße mit getrockneten Zwetschen. – Anfangs fallen ihm seine verlassenen Schnucken ein, bei denen hat er es doch am besten. Je mehr Branntwein er trinkt, je rascher laufen die Gedanken von den Schnucken fort zu Lieschen. Dideldumdei! Dideldumdei!
Niemand wirft besorgte Blicke auf meinen Jachl. Sein helles Haargestrüpp, das er so fein mit Wasser fest zusammengeklebt hatte, steht ihm längst wieder richtig hoch zu Berge. Das Halstuch hat er abgerissen, es hängt halb aus der Hosentasche hervor. Ihm ist heiß geworden und übel, gräßlich übel, und der Kopf schmerzt nicht wenig. Die schöne, rote Weste ist begossen, zwei ihrer Metallknöpfe hat er verloren. – Keiner hat mit ihm Mitleid. Weshalb sollte auch hier einer mit einem großen Bauernjungen Mitleid haben, der halb betrunken ist? Solchen Luxus gewähren die Heidjer einander nicht. Mitleid hat man mit einem, der sich den Kopf blutig geschlagen hat; was sonst innen im Kopf schmerzt, darum kümmern sie sich gegenseitig nicht.
Jachl bleibt wie ein Stück Holz in einem Winkel der Gaststube liegen. Er wird gezupft und gerufen, bis er die Augen aufreißt, so weit aufreißt, als ihm möglich. Gottes Donnerwetter! Wie brummt ihm der Schädel!
»Na, warte Lieschen, das nennst du Vergnügen?«
Vorsichtig stellt er sich auf die Beine. Er gibt sich einen derben Ruck. Vorwärts! Es geht! –
Der erste leichte Frost liegt auf der Heide. Nichts rührt sich über dem Moor. Ein wenig taumelt Jachl. Wohin sind bloß alle lustigen Vögel geflogen? Die frechen Meisen und die ängstlichen Goldhähnchen, der Buntspecht und der Reiher, die Drosseln und die fröhlichen Finken? Sie alle scheinen in Jachls Schädel zu rumoren. Gewiß wollten sie nichts mit dem kalten Nordostwind zu tun haben, der den Schäfer jetzt umpustet, und der ihn wieder lebendig macht, ihn fest aufrecht auf die Beine stellt. »Je, je,« stöhnt Jachl von Zeit zu Zeit vor sich hin, »is sowas Vergnügen?«
Wütend stampft er über das heut nacht ganz weiße Moor. Hart gefroren ist es noch nicht; man überschreitet es, als wäre man leicht gewiegt.
Groß und grau läuft Jachls Schatten neben ihm dahin. Eine Eichkatze springt über den Weg. Ehe er es noch richtig merkt, trabt er zwischen großen Flocken weiter. Der erste Schnee! Rasch, immer rascher fällt er herab. Nach einer Viertelstunde hat er jedem Baum und jedem Busch und jedem Hügel ein funkelnagelneues Gewand angezogen. Gar nicht zum Wiedererkennen sind sie. Jachl lacht. Breit und dick geworden sind alle miteinander. Ganz putzig sehen sie aus, Bäume beinah wie Berge. –
Kein Schritt des einsamen Wanderers schallt mehr in die Weite hinein; nur seine Fußtapfen sind zu sehen; zu hören ist nichts von Jachl. – Vor einem kleinen Sumpf bleibt er einen Augenblick stehen. »Wie braunes Bier«, denkt er und schüttelt sich. Bier und Branntwein sind noch nicht aus Jachls Kopf heraus. Keinen Tropfen bringt er so rasch wieder über die Lippen. Das nimmt er sich vor.
In der weißen Stille ist sein Schnuckenstall schwer zu finden. Verschwunden scheint er zu sein, fortgehert. So genau der Schäfer auch Weg und Steg kennt, in dieser Nacht geht er in der Irre. Alles ist weiß; alles hat Form und Farben verändert. Vorsichtig tastet Jachl von einem Baum zum andern. Jetzt aber greift er ins Leere. Seine Hand faßt nur Luft. Er überlegt: Stehenzubleiben ist das Klügste. Und abzuwarten. Das Wetter hat sich ja immer wieder geändert, wird es auch in dieser Nacht. Wenn nicht in der Nacht, so doch am Morgen oder am Vormittage. Nur Geduld muß einer haben, dann kann ihm hierbei nichts passieren. –
Jachl weiß nicht, ist's der weiche Schnee, der nachgibt oder ist das Moor auf diesem Fleck noch so weich und schwankend. Schwankt der Jachl oder das Moor?
»'s wird noch immer der Kümmel sein«, entscheidet er selbst, geärgert über seine Vergnügungsreise. Er schwört, nie mehr eine zu machen, höchstens mal mit Lieschen; da paßt denn einer auf den andern auf.
Im Eifer des sich Gelobens merkt Jachl anfangs gar nicht, daß er bedenklich tiefer in das weiße Moor gerutscht ist. Bis über die Knie steckt er darin. Jähes Entsetzen packt ihn. Fürchterlich wird ihm zumute. Das Leben kommt ihm plötzlich so munter vor und der Tod so traurig.
»Nein – nein – nicht sterben,« schreit er, »nicht sterben«; ohne aufzuhören, gellend nur die beiden Worte – kreischend – brüllend, dann leiser, immer leiser werdend – wimmernd »nicht sterben – nicht sterben – nicht sterben« –
Gleichgültig und lautlos fällt der dichte Schnee hernieder. –
Jachl kennt die Gefahr, in der er sich befindet. Rührt er sich, so geht's vielleicht noch rascher in die Tiefe. – Heiße Lebensgier foltert ihn. Was tun? Was tun? In Todesangst fängt er plötzlich an zu flöten, so laut und schallend, wie er nie bisher im Leben geflötet hat. Vielleicht geht ein Mensch in der Frühe durch die Heide und lauscht und sucht, woher der Schall kommt. Jachl kann nicht mehr schreien, nicht mehr brüllen, nicht wimmern; all seine Kraft hat sich ins Flöten umgesetzt. Er flötet, er flötet, als sei das Aufhören sein sicherer Tod.

Am Moorgraben entlang gehen zwei Heidejäger durch die weiße Wüste. Erwartungsvoll halten sie Umschau. Sie lauschen. Sie stieren auf einen Punkt, und sie erkennen, daß da im Schnee etwas steckt, etwas, das man retten muß. Behutsam wagen sie sich näher heran. Sie halten dem Jachl einen langen, festen Speer hin, den sie bei sich tragen. Vorsichtig greift er zu, fest, ganz fest; dabei hört er nicht zu flöten auf. Ja, wahrhaftig: der Schäfer hat flötend dem Tode den Rücken gekehrt.
Kehrte Jachl dem Tode wirklich den Rücken? Sicher ist es nicht.
Zuerst hat der Viehdoktor den Kopf geschüttelt. Weshalb sollte der es nicht auch verstehen? »Vieh ist Vieh«, sagt er, wenn er mal statt eines Ochsen einen Knecht zu behandeln bekommt.
Monate sind seit Jachls Tanzreise vergangen. Längst lagert er wieder mit seinen Schnucken in der Sommerglut; längst schwätzen wieder allerlei Vögel im Schilf und in den Büschen.
Die Mücken sind ein wenig zu dreist gewesen. Sie haben einigen Schnucken große Wunden beigebracht. Vergeblich hat sie Jachl mit Teer und Wagenschmiere eingerieben. »Vielleicht haben giftige Schnaken das Unheil angerichtet«, denkt er. Gegen die kommt er wohl doch nicht allein an. Den Tierarzt muß er holen. Für ihn, den Schäfer, ist's wie halbe Schande. –
Komisch geht es wohl auf der Welt zu! Wohin wäre mein Jachl ohne den Tierdoktor gekommen?–
Stolz ist der Schäfer, daß der gelehrte Mann seine Herde lobt. Dem Erfahrenen sind die gut abgerichteten Hunde ein Beweis, daß er es mit keinem zu tun hat, der beschränkt oder nachlässig oder kenntnislos ist. Er würdigt Jachl langer, intimer Gespräche über Heidekrautweide und ihres Wertes für die Lämmer. Jachl antwortet wie ein alter Schäfer; er weiß, daß er hierbei mitreden kann. Aufs »Zufüttern« kommen sie und auf »Lebendgewicht«. Dabei sieht der Viehdoktor Jachl an und meint, »du hast nicht viel mehr wie deine beste Schnucke, sorg' lieber zuerst für dein eigen Lebendgewicht«.
Jachl ist in der Freude über das fachmännische Gespräch ganz erregt, seine Backen brennen. Das bißchen Husten hat er ganz vergessen. Der Viehdoktor aber denkt, als er davonfährt, »dem schick ich unsern Landarzt, der hat ihn nötig«.
Und er tut's.
So kommt es, daß Jachl, der doch nichts von »die Doktors« hält, ihnen in die Finger fällt. –
»Na, denn zieh dich mal aus«, sagt der Arzt freundlich.
Was macht der Mann bloß alles! Er klopft auf Jachls Brust, er klopft auf Jachls Rücken, er legt sein Ohr dicht auf Jachls Herz. Als er fertig ist, setzt er sich gemütlich auf einen Schemel im Stall hin und sagt seelenruhig nur ein einziges Wort: »Lungenheilstätte.«
Woher soll ein Schäfer wissen, was das ist? Im Lehrbuch für Schafzucht stand nichts davon.
Der Doktor erklärt, aber Jachl versteht nur so viel, daß er von den Schnucken fort soll.
Das ist doch gar nicht möglich! Zuerst ist er stumm, und dann fängt er an auseinanderzusetzen, weshalb er hier bleiben muß. Aber der Doktor, der zuerst so freundlich war, sagt grob: »Papperlapapp, dann stirb man hier.«
Fürs Sterben ist Jachl aber immer noch ebensowenig wie damals, als er im Moor beinah erstickt wäre.
Unruhig dreht er sich an diesem Abend auf seinem Lager hin und her und denkt wieder kläglich: »Nicht sterben – nicht sterben.« – –
Eine umfangreiche Schreiberei beginnt. Papiere müssen beschafft werden. Der Landarzt sorgt dafür, daß alles ordnungsgemäß angebahnt wird. Wochen vergehen aber doch, bis Jachls Abreise nichts mehr hindert.
Ach, diese letzten Wochen! Wieviel muß Jachl ausstehen! Sein Herz ist nicht krank, es ist sogar riesenstark, daß es soviel Kummer aushält. Ja, es ist wahr: Jachl läßt keine Mutter zurück, keinen Vater, keine Geschwister, keine Braut, er hat gar keine Ursache sich zu grämen. Aber fragt ein Herz nach Ursache, wenn es sich bedrückt und beengt fühlt? Sind da Grund und Ursache entscheidend?
An die große Stadt, in deren Nähe das Rote Kreuz seine Heilstätten hat, mag er gar nicht denken. Da sollen doch soviel schlechte Leute leben! Und neumodische Gewohnheiten werden sie haben! Wohl alle mit Hüten auf'm Kopf. Mützen und Kappen sind da nicht angesehen. Das hat Jachl ja auf Lieschens Bild gemerkt. Überhaupt: Stadtmenschen mögen ja auch ganz ordentliche Menschen sein, aber man muß sich erst sehr an sie gewöhnen. Ein Schnuckenschäfer wird wohl in Berlin gar nicht estimiert sein. Das ahnt Jachl schon im voraus. Sie sollten ihn aber nur mal fragen, wie schwer ein ordentlicher, zuverlässiger aufzutreiben ist. – Seinen Nachfolger hat er schon vier Wochen einstudiert. Jachl will nichts Schlechtes von Jochem sagen, aber soviel steht fest: Schäferverstand hat der nicht! Immer ist Jochem gleich mit der Schäferschaufel bei der Hand, wirft mit ihr Erde zwischen die Herde und beunruhigt die armen Tiere. Jachl regiert sie mit einem einfachen Zuruf. Jochem aber jagt sie bald zusammen, bald auseinander, ohne Sinn und ohne Verstand. Was wird das bloß werden, wenn Jachl erst fort ist? So jung er noch ist, diesem geringen Hütejungen ist er haushoch »über«. Das weiß auch der Dienstherr. »Jachl,« hat er gesagt, »Jachl, deinen Posten kannst du immer wieder haben, aber du wirst das Zurückkommen auch vergessen, wie die Jungens alle aus'm Dorf.«
Ja, das hat er gesagt.
Heute packt Jachl. Zuerst kommen alle alten Männer- und Frauentrachten aus des Ohms Truhe heraus, und dann kommen Jachls Schätze hinein. In den hochgewölbten Deckel der tannenen Truhe hat er die feinsten Bilder geklebt. Ein Jesusknäblein wird ihn jedesmal anlächeln, wenn er aus der Truhe etwas herausnimmt, und der feingepinselte Spruch, den Lieschen einst gleichgültig am Boden hat liegen lassen: »Fürchte dich nicht, glaube nur!« Nie hat Jachl über den Sinn der Worte nachgedacht, aber es kommt ihm vor, als könnte es gut für ihn sein, ihn mir auf die Reise zu nehmen. –
Auf das Gespann seines Dienstherrn ladet Jachl sein Gepäck. Er darf nicht, wie er wollte, es allein schleppen. Ganz streng hat es der Doktor verboten. Seitdem er krank sein soll, reden sie ihm in alles rein. Jachl war das gar nicht gewöhnt. Seinen Schnucken war doch alles recht. Was soll man aber dabei tun?
Am letzten Abend haben sich die Schnucken wie immer um ihren Schäfer gedrängt. Jachl klopft und streichelt jede besonders freundschaftlich. Keine merkt etwas von dem Verlust, der ihr bevorsteht. Überhaupt, keiner ist da, von dem Jachl wirklich Abschied zu nehmen hat mit Küssen und Drücken, bevor er auf den Wagen klettert. Und doch drehte er am liebsten wieder um, nachdem er ein Stückchen zugefahren ist. Aber er weiß, hier ist seines Bleibens nun nicht mehr. Was hätte Umkehren für Sinn?
Er heult ein bißchen, wirklich nur ein bißchen, als er nichts mehr von Jochem und den Schnucken sieht.
Zuletzt, ehe der Leiterwagen in die Stadt rasselt, sieht Jachl, wie ein Dummerjan, nur in die Höhe, immer in den Himmel, grad‹ wie damals, als er wie besessen nach dem Luftschiff sah. Er fühlt plötzlich, von wem er jetzt Abschied zu nehmen hat: vom Himmel! Ja, wie sie auch mit Berlin prahlen mögen, so viel Himmel wie hier kriegt er nun nicht mehr zu sehen. So viel Himmel haben sie da nicht. So viel Himmel können sie sich für all ihr Geld nicht kaufen. –
Noch in der Eisenbahn drängt Jachl sich vor, steckt den Kopf so weit als möglich heraus und sieht hoch nur in den Himmel. Nachher wischt er etwas Feuchtes aus den Augen. – –
Ich will hier gleich berichten, daß sich mein Jachl, obwohl er ungeschickt und unerfahren ist, in dem neuen Leben nicht wie ein Dümmling anstellt. Er merkt rasch, sein Heideverstand gilt schon auf der Reise nicht mehr viel.
So unterschiedlich hat er sich die Menschen doch nicht vorgestellt! Welche, die in die vornehmste Klasse steigen, sehen ganz komisch aus mit all dem Zeug, was sie auf‹m Leib tragen. Müssen die viel Geld haben! So viel Geld kann sich Jachl gar nicht vorstellen. Warum kaufen sie aber nicht mehr Zeug für ihre Röcke? Sie sind doch viel zu eng; ganz ausgewachsen sehen sie aus, grad‹ so wie Jachl in seinem Anzug. Und was schleppen sie nicht alles an sich herum, was schwer sein muß, besonders auf'm Kopf.
Auch die in der IV. Klasse sind anders wie Leute in Lüttersloh, aber ganz so schlimm wie die Feinen sind sie nicht. Je länger Jachl reist, je mehr anders werden sie.
So oft der Zug hält, glaubt er: das ist Berlin! Jede Stadt kommt ihm beklemmend groß vor mit ihren vielen Schornsteinen, mit Soldaten und Droschken und Straßenbahnen. Noch größer und höher soll ja aber Berlin sein.
Endlich, endlich, Gott sei Dank, ist es da.
»Berlin! Alles aussteigen«, ruft der Schaffner um 6 Uhr 1 Minute frühmorgens.
Jachl folgt seinen Bahngenossen. Er läßt sich bis zur Sperre mit durchschieben. Draußen studiert er nochmals den Zettel, auf dem ihm die Weiterfahrt genau aufgeschrieben ist. – Einige Stunden muß er sich wohl Berlin ansehen. Das geht doch nun nicht anders. Wird das eine Arbeit sein!
Mit dem wenig Himmel – er sieht es gleich – das stimmt! Solch Gewimmel ist immer zwischen den hohen Häusern, wie wenn Schnucken sich zusammendrängen. Jachl kommt es immer so vor, – er weiß wohl, das ist nur Dummheit von ihm – als wackelten die Häuser mit den vielen, vielen Fenstern. Vor einem Fleischerladen bleibt er stehen. Die Hammel, die er prüfend betrachtet, sind das erste Vernünftige, was er in Berlin sieht. Am liebsten rührte er sich hier nicht vom Fleck. Der Lärm der Straße ist ja, wie wenn immerfort Gewitter wäre.
Was haben die Leute bloß alles erfunden! Und wie halten so viele es aus! Wenn Jachl zu Hause über das Feld geht, dann weiß er doch, ihm kann nichts passieren, aber hier mögen wohl jeden Tag welche ums Leben kommen. Das kommt nur von dem vielen Erfinden. Wozu ist das nötig? Jachl hat zwar seinen Husten, aber sonst sind doch die meisten stärker und gesunder, die gar nichts mit Berlin und all seiner Erfinderei zu tun haben. Dazu haben sie solche Eile; alle rennen immer so, wie Jachl mal ausnahmsweise hinter einer verlaufenen Schnucke. Ja, das Laufen haben sie raus. Einer sieht nicht nach dem andern. Wie kann es hier Lieschen so gefallen?
In Hamburg ist sie nicht lange geblieben. Freiwillig fuhr sie nach Berlin.
Jachl weiß, daß es viel auf der Welt gibt, wobei er nicht mitreden kann, aber wundern kann er sich. Das darf ihm keiner wehren. Also tüchtig wundert er sich mal zuerst darüber, daß ein Mensch freiwillig nach Berlin reisen kann.
Ordentlich leichter wird ihm während des Wunderns. Beinahe wie Verachtung ist es. Doch das unterscheidet mein Jachl nicht. –
Obwohl ihm der Magen knurrt, tritt er nicht in eine Kneipe ein. Er wagt es nicht. Lieber hungern und dursten.
Was alles muß ein Mensch wissen, der vor Berlin keine Angst hat. Jachl ist gewiß kein Feigling. Wie ist er zu Haus allein hinter dem Bock hergerannt, als ihn die Wespen wild gemacht hatten! Und auch sonst scheute er keine Gefahr. Aber hier in Berlin muß man von ganz anderer Wissenschaft sein. Es kommt ihm vor, als ob sie alle zu stolz sind und Augen hinten und vorne haben. Viele Jahre mögen wohl dazu gehören, bis einer soviel Augen bekommt, daß er zwischen all dem Neumodischen nicht zu Schaden kommt. –
Wohl zehnmal hat Jachl seine Uhr hervorgezogen, um nachzusehen, ob er immer noch nicht weiterfahren kann.
Wenn er wenigstens das Haus wüßte, in dem Lieschen wohnt. Aber in dem letzten Brief hat sie ihm eine Straße aufgeschrieben, die kennt hier kein Mensch. »Berlin, postlagernd«. Die Leute lachen, so oft er fragt: »Bitte, wo komme ich nach der Straße postlagernd?« –
So entschließt sich Jachl ruhig vor dem Fleischerschaufenster auszuharren, bis es Zeit ist, abzufahren. Er beobachtet die Mädchen, die zum Einkauf das Geschäft betreten. Sauber sind sie alle. Das ist wahr! Man merkt gleich, keine hat mit Mist oder mit Melken zu tun. Die Augen gehen ihnen rundum. Jachl sieht nur nach dem Fleisch, das sie in ihren Körben haben, sie aber sehen ihm grad‹ ins Gesicht, so lange und so grade, daß ihm heiß wird. –
Schließlich vergeht aber auch in Berlin die Zeit, wenn sie Jachl auch viel, viel langsamer weitergekrochen ist, als zu Haus beim Schnuckenhüten. –
Wieder sitzt er im Zuge; diesmal hat er es rascher geschafft. Schon nach zwei Stunden muß er aussteigen.
Gott sei Dank! Ein bißchen mehr Himmel haben sie hier, wenn er sich auch nicht – wie Jachl glaubt – dem unabsehbar vielen über der weiten Heide vergleichen kann.
»Volksheilstätte« heißt Jachls Reiseziel. Ja, es gibt viele Völker, das weiß er von der Schule her. Ganz tief holt er Atem, dann spuckt er aus und reibt sich die Hände sauber, ehe er beim Pförtner die Glocke zieht.
Solcher Anmeldung bedurfte es nicht, wollte jemand ihn in seinem Schnuckenstall aufsuchen. – Freundlich wird ihm der Weg ins Haus gewiesen. Er sieht fünf, sechs, nein, acht Häuser, nicht solche Riesen wie in Berlin. Das Eintreten wird ihm gar nicht schwer. Sein Mut kehrt zurück. Tapfer stellt er sich vor: Joachim, der Schäfer. –
Auf der Heide hat er sich nie anders rufen hören wie: »Schäfer«. Nicht: Joachim; lange schon nicht mehr: Jachl. Daß er einen richtigen Vatersnamen hat, kommt bei ihm, dem Schäfer, gar nicht in Betracht. –
»Sie heißen Joachim Bohn?« fragt die Oberin freundlich. Noch nie hat jemand Jachl »Sie« genannt.
Sie! Sie! Er muß sich erst besinnen, ehe er nickt.
»Gut, also treten Sie näher, lieber Joachim Bohn.« –
Hätte Jachl nicht trotz seiner Krankheit eine kräftige Natur, so wäre er von der Fülle des Überraschenden, das er in den nächsten Tagen erlebte, »kopfschwach« geworden.
Auf der Heide hat er wohl das liebe Vieh gebadet, aber daß der Mensch auch in einen Bottich, der mit warmem Wasser angefüllt ist, gelegt wird, das hat Jachl nicht geahnt. Früher hat er einmal ein Märchenbuch gehabt. »Aus tausend und einer Nacht« hieß es. So staunt er immerfort hier. –
Die Volksheilstätte ist Bildungs- und Erziehungsanstalt ersten Grades für den Schäfer. Ja, Jachl hat wohl seinen Stall auch sauber gehalten, er hat ihn gefegt und gescheuert, aber – aber – hier sieht es ja sogar in der Küche wie in einem verzauberten Schloß aus: Blaue Fliesen bis zur halben Höhe der Wand, und darüber ist die Wand noch schön mit blanker Farbe gestrichen. Der Milchkochkessel läßt sich überhaupt gar nicht beschreiben; 250 Liter gehen auf einmal hinein. Zum Essen versammeln sich alle in dem »Speisesaal«. Der Name ist an die Tür geschrieben. Jachl bringt zuerst vor lauter Staunen sein Essen kaum herunter; es bleibt ihm in der Kehle stecken. Allmählich faßt er sich. Nach einiger Zeit weiß er, daß das helle Licht durch »Glühlampen« entsteht, daß die bunten Glasscheiben »farbige Bleiverglasung« genannt werden, daß das auf dem Fußboden »gemusterter Linoleumbelag« ist.
Ja, das hört sich einfach an, aber bis ein Schäfer das alles in seinen Kopf bekommt, davon kann er geradezu krank werden, aber nicht gesund. Das Fieber ist ganz sicher nur von dem vielen Verwundern gekommen. Jachl denkt sich sein Teil. Der Fahrstuhl hat ihm solchen Schreck eingejagt, daß er sich ganz fest an die Pflegeschwester geklammert hat, sonst wäre er hingestürzt. – Zum Erschrecken ist viel in der Volksheilstätte; aber an das Feine und Großartige gewöhnt sich einer wohl auch. Und gesund wird es wohl sein, das will Jachl ja nicht bestreiten. –
Immer kommt alles anders, wie man sich‹s vorstellt. Jachl hat an viel große Medizinflaschen gedacht, die er auszutrinken bekommen wird. Seine Kur ist rein zum Lachen. Nur liegen, schön eingepackt. Nichts wird eingerieben, nichts wird eingenommen. Er hat wenig Vertrauen. Wie soll das helfen? Luft hat er ja immer gehabt; nur gelaufen ist er, nicht gelegen. Na, die Dokters müssen es ja verstehen. –
Mehr, viel mehr wie ein Student auf der Hochschule, lernt mein Jachl in dieser Heilschule. In seinem Dorf werden sie es nicht glauben und ihn Aufschneider und Prahler schimpfen. Manches wird er auch gar nicht ordentlich beschreiben können. Viele Worte sind nicht leicht zu verstehen: Wasserklosett, Ausgußbecken, Operationszimmer, Dunkelkammer, Lichtbad und viele, viele Worte sonst noch! Aber Jachl hat Zeit sie zu lernen, viel Zeit. Nein, keinem wird er es in Lüttersloh übelnehmen, der nicht glauben kann, Jachl, der Schäfer, schläft in einem Schlafhaus, in einem Haus, das nur allein zum Schlafen gebaut ist, in dem nichts sonst gearbeitet werden darf. Wahrhaftig, nur geschlafen! Und dann – das mit der Zahnbürste! Jedermann hat eine. Es ist auch zu verschwenderisch und schwer zu glauben. Jachl wußte zuerst nicht, wozu die kleine Bürste dalag; dann hat er nachgemacht, wie es die andern machten. Überhaupt am weitesten kommt einer mit Nachmachen. Manches Ding hat er hin und her gedreht, aber wozu es sein könnte, fiel ihm nicht ein. Wenn er aber ein bißchen rechts hinschielte und links hinschielte, so wußte er es. Menschen sind wohl eigentlich wie Schnucken. Was der eine macht, macht der andere nach. Schnucken sind doch grad auch so fürs Nachmachen. –
Nahe am Heulen ist Jachl immer an den Besuchstagen. Zu fast jedem kommt einer. Vorher sehen sie immer nach der Tür, oder – wenn sie in der Liegehalle sind, – auf den Weg hinaus. Redet man mit ihnen, so passen sie nicht auf; sie denken: »Wer wird heute kommen? Onkel oder Tante, Vater oder Mutter, Bruder oder Schwester?« Jachl hat von diesen allen keinen. Bloß Lieschen, und die ist in dem Jahr nicht ein einziges Mal gekommen. »Es geht wirklich nicht! Ein Dienstmädchen kann nicht wie es will; es muß wie die Herrschaft will,« entschuldigt sie Jachl. Er weiß längst, daß es mit der Straße »Postlagernd« unklug war. Gern setzte er sich für zwei Stunden auf die Bahn und besuchte Lieschen in der Lothringer Straße. Berlin ist ihm aber streng verboten, und gehorchen muß einer in einer Volksheilstätte immer, daran hat er sich längst gewöhnt. –
Jachl hofft an jedem Mittwoch von neuem. Könnte Lieschen ihn nicht überraschen? Weshalb nicht? In seiner Phantasie ist ihre Freundschaft riesenhaft gewachsen. Einen Menschen muß wohl der Mensch haben, an den er sein Herz hängt. Jachl hat keine andere ausprobiert. Er weiß nicht, wie sie sind, die Mädchen; seine eigenen Gefühle setzt er einfach bei Lieschen auch voraus. Und daß sie nicht schreibt, ist nicht ihre Schuld. Wer weiß, wie streng ihre Herrschaft ist. –
Um drei Uhr nachmittags kommt der Zug an. Sein Pfeifen ist, wenn man gut aufpaßt, schwach zu hören. Alle legen oder setzen sich dann rasch in Positur. Wer einen Spiegel hat, sieht noch schnell hinein. Einigen treten vor Freude Tränen in die Augen. Wenige Minuten später kommen schon die ersten. Jeder Besucher hat eine Tüte in der Hand, darin sind Weintrauben oder Apfelsinen oder Kuchen. Manche bringen ein paar Blumen mit. Im Winter gibt es in Berlin auch Rosen, Tulpen, Veilchen. In Lüttersloh gibt es die bloß im Sommer. Zu manchen kommen sogar mehrere auf einmal. So Unverschämtes wünscht sich Jachl gar nicht.
Wenn das Hereinströmen aufhört, wird die Tür zugemacht. Jachl nimmt dann immer ein Buch vor die Nase, aber er spitzt doch die Ohren. Ihm ist es ganz egal, was sie reden, bloß Streicheln oder Küssen, das kann er nicht vertragen. Dabei wünscht er: »Wenn sie erst nur alle wieder draußen wären.« – Es kommt ihm vor, als sähen sie ihn ein bißchen mitleidig an oder ein bißchen verächtlich: »Wie kann ein Mensch aber auch gar keinen Besuch bekommen?« –
Bekanntschaften hat Jachl mit der Zeit genug gemacht. Da sind zuerst seine zwei Nachbarn. Der eine ist Malerlehrling. Er hat dieselbe Krankheit wie Jachl. Gleich als Jachl den Platz neben ihm angewiesen bekam, eröffnete der kleine Maler die Bekanntschaft mit der Versicherung: »Du wirst gewiß auch nie wieder gesund.« Jachl fragte kleinlaut: »Woher weißt du das?«
»Von mei'm Vater; der sagt, ich bin ›chronisch‹, und das heißt doch soviel wie: ›nie wieder ganz werden‹. Vater hat es aus einem Medizinbuch rausgelesen. Und ›chronische‹ hast du auch, Jachl, darauf kannst du dich verlassen.«
In Jachls Kehle kommt etwas Schweres in die Höhe, er muß ordentlich schlucken, bis er's runtergepreßt hat: das ist Schreck. – Später hat's Jachl seinem Nachbarn nicht mehr geglaubt. Das war Unsinn mit »chronisch«. –
Der kleine Maler weiht Jachl – trotz »chronisch« – in die Geheimnisse von Berlin ein; nicht in die allerschlimmsten, aber doch in Dinge, von denen ein Hütejunge, wenn er auch schon ein richtiger Schäfer ist, nichts wissen kann. An seiner Krankheit, versichert der Nachbar, sei die Schlafstelle schuld; na, was da alles passiert! und seine Braut, die hat's auch auf der Lunge. –
Daß in Berlin mit sechzehn und achtzehn Jahren jeder eine Braut haben muß, leuchtet Jachl wieder nicht ein. In Berlin sind sie doch wohl viel weiter.
Am liebsten erzählt der kleine Maler vom Theater. Theater ist sehr schwer zu begreifen, wenn es einer noch nie gesehen hat. Jachl will nicht streiten, aber, was kann an all dem Vorgemachten, was doch alles nur ausgedacht ist, sein? Ihm gefällt nur, was wahr ist. Auf der Heide sind ihm die Wolken und der Wind und der Schnee und die bunten Farben am Himmel Theater genug. Aber erzählen läßt sich Jachl gern von all den Dingen, dann ist das Stilleliegen nicht so langweilig. –
Der Nachbar zur Linken sollte vor Jahren in »Fürsorge«; er fing aber an zu husten, und so haben sie ihn hier eingesperrt. Für den »langen August« ist die Heilstätte zuerst dasselbe wie ein Gefängnis gewesen. Er zeigt Jachl einen Zettel, den er mal stibitzt hat, auf dem steht:
»Durch den freiwilligen Erziehungsbeirat geschickt, erscheint bei uns die Großmutter eines 14 jährigen ehelichen Knaben. Seine Mutter ist vor einigen Monaten an der Schwindsucht gestorben. Der Vater lebt mit einer Wirtschafterin zusammen. Der Knabe soll von beiden schlecht behandelt werden.«
Schwarz auf weiß ist es also geschrieben, daß die Schuld nicht an August allein lag, daß er »so« geworden ist. Er findet, Jachl kann überhaupt noch nicht mitreden, denn Rumtreiben, ohne Obdach sein, Stehlen, das alles kennt er nicht. – Der lange August hat in den drei Jahren seines Aufenthaltes hier auch eingesehen, daß man weiter mit Ehrlichsein kommt, als mit Schlechtsein. Sein Husten hat sich gebessert. August soll so lange als möglich in der Anstalt festgehalten werden.
Den Zettel, welchen er Jachl zeigte, hat er von einem Bogen abgerissen, auf dem lauter Sachen von schlechtgewordenen Kindern zu lesen sind. August borgt Jachl den Bogen, damit er sieht, wie es in Berlin zugeht. Das hat Jachl wirklich nicht gewußt! In Lüttersloh gibt es auch eklige Mädchen und Jungen, die stehlen und betrügen, aber daran ist Lüttersloh nicht schuld. In Berlin sind die vielen schlechten Beispiele und die vielen Kleider und Ringe und all die Sachen, die sie sich auf den Leib kaufen möchten. Ja, das ist wohl zu glauben, daß sie da einen »Kinder-Rettungsverein« brauchen. –
Nicht weit von Jachl liegt ein kleiner Junge, dessen einziger Wunsch darin besteht, an seinem Geburtstag bei Vater und Mutter zu sein und bei all seinen Geschwistern. Gar keine Geschenke will er haben, nur den einen Tag zu Hause sollen sie ihm schenken. Als Jachl dem Kleinen erzählt, daß er nie einen Geburtstag mit Vater und Mutter gefeiert habe, meint der: »Das lügst du; ein Junge muß doch Vater und Mutter zum Geburtstagfeiern haben, sonst ist er ja gar kein Kind.« –
Erst in der Heilstätte fängt Jachl allmählich zu fühlen an, daß er zu niemandem gehört. »Das traurige Simulieren kommt bloß vom Nichtstun,« denkt er, »beim Arbeiten merkt man von allen Schmerzen nichts.« –
Auch er hat einen Wunsch, einen riesengroßen, wie der kleine Geburtstagsjunge. Er lautet: zur ländlichen Kolonie! Sie gehört auch zur Volksheilstätte. Wenn er dorthin überwiesen würde! Sie wäre für ihn das gelobte Land. Jedes Mal, während der Untersuchung beim Doktor, faßt er sich ein Herz und fängt davon an. –
Seitdem er kurze Spaziergänge machen darf, wählt er stets den Weg zum Schweinestall. Die dorthin gelieferten Küchenabfälle betrachtet er prüfend; und die Frage, »wie Schweine fettgemacht werden?« verursacht ihm Herzklopfen. Schließlich wäre er aber auch schon froh, wenn er in die Abteilung: Puten, Gänse, Enten und Truthähne käme. Durch den hohen Drahtzaun beobachtet er das Geflügel so innig und so hingebend, daß der kleine Malernachbar immer wieder rufen muß, wenn die Stunden für den Aufenthalt in der Liegehalle herangerückt sind.
Endlich kommt Jachls großer Tag.
»Gartenbauschule« heißt das Paradies, das er betreten darf. Ein neues Leben beginnt: Jäten, Harken, Begießen! Mit dem Herumliegen ist es vorüber.
Von seiner Krankheit wissen die Ärzte wohl mehr als er selbst. Hin und wieder mal ein bißchen Husten. Das ist doch nicht Krankheit?
Die Gartenarbeit bringt all sein Denken zurück zu seinen Schnucken und zu Lieschen. Die Heide, die Schnucken und Lieschen kommen immer bei ihm dicht zusammen.
Lieschen ist doch seine Freundin; vielleicht sollte er sie nur ein bißchen daran erinnern. Vor Ostern schreibt er ihr deshalb:
»Liebes Lieschen, wenn Du nicht kommst, reise ich zu Dir. Erlauben werden sie es hier jetzt bald. Komme doch an einem Feiertag. Ich bin bald gesund. Vielleicht mache ich auch nach Berlin, aber zuerst will ich doch mal nach meinen Schnucken sehen. Ich schicke Dir das Reisegeld; so viel kann ich noch an Dich wenden. Ich stehe am ersten Feiertag am Gitter und warte und am zweiten wieder und am dritten auch wieder. Dein alter Jachl.«
Zu den meisten von den »Großen« kommt eine Braut. Jachl ist entschlossen, mit Lieschen die Sache mal zu bereden. Sein Mut wird täglich größer; bloß kommen muß sie, dann wird die Sache schon werden. –
Besuchsstunde! Sonnenschein! Feiertag! Noch viel mehr Gutes ist den kleinen und großen Menschen in der Heilstätte kaum beschieden. –
Jachl steht pünktlich am Zaun. Ein Veilchensträußchen dreht er in der heißen Hand. Mit ihm warten Scharen von Leuten auf die Besucher. –
Wie gut es die Kranken auch haben mögen, immer fühlen sie sich als Verbannte, fern dem flutenden Lebensgetriebe. Zank und Streit zwischen Angehörigen hat hier aufgehört; ein Gefühl verbindet die Besucher und ihre Erkrankten: Liebe.
Heute strömen besonders viele im Sonnenschein der Heilstätte zu. Jachls scharfer Blick irrt suchend umher: dort die Eine könnte es sein. Genau weiß er es nicht. Die städtische Kleidung macht die Menschen ganz anders. Er sucht weiter und sieht doch rasch wieder zurück. Sein Herz klopft wie ein Hammer. –
Das Fräulein im grauen Paletot, das ihm bekannt vorkam, tritt mit durch die Pforte. Zögernd hält es Umschau. –
So groß war Lieschen nicht; sie kann ja aber noch gewachsen sein. Also los: »Fräulein« –
Das Fräulein bleibt stehen.
»Wäre sie es doch nicht«, denkt Jachl eine Sekunde lang, aber schon fragt eine bekannte Stimme: »Wo finde ich hier Herrn Bohn?«
Gott, Gott! Jachl kann nur stottern. Da lacht das Fräulein und sagt: »Ich war wohl blind, daß ich – ich – (sie bekommt das: »Du« auch nicht leicht über die Lippen) – daß ich Sie, nein, daß ich Dich nicht gleich erkannte.«
So rasch faßt Jachl sich nicht. Verlegen steht er da, so verlegen, als wäre er nur noch der Schäfer und hätte Berlin und die Heilstätte nie gesehen.
Aber reden muß man, wenn einer zu Besuch kommt! Was nur, was?! Jachl hat sich doch vorgenommen zu zeigen, wie viel er hier gelernt hat. Nun benimmt er sich recht wie ein ganz dummer Bauer! Ja, die Herren in Berlin werden wohl anders reden können! Lieschen fängt aber auch gar nicht an mit Erzählen! So war sie doch früher nicht! Sie hat doch sonst immer das Wort geführt.– –
Weshalb Lieschen nicht redet?
Wenn Jachl nicht blind ist, muß er »es« doch merken. Bei dem Gedanken wird ihr glühend heiß. Was gäbe sie darum, wenn ihr »das« nicht passiert wäre! In diesen Augenblicken ist für sie das große Berlin versunken. Sie hat Jachl ja nie vergessen, aber es gibt da zu viele Herren und zu viele Tanzlokale und zu viele Warenhäuser, in denen Sachen ausgestellt sind, die man haben möchte!
Dunkel empfindet sie: sie ist ja gar nicht mehr das Lieschen, welches mit Jachl gemeinsam den Reisekorb vor Jahren zum Bahnhof schleppte. –
In Berlin war Lieschen beinah stolz auf ihre Umwandlung, aber Jachls gute, blauen Augen haben ganz rasch etwas in ihr geweckt, das lange schon schlief. Man könnte es mit dem unbequemen Wort »Gewissen« bezeichnen. Sie wehrt sich zwar: »Geht es nicht den meisten ebenso?« »Jugend hat keine Tugend« und »Berlin ist nicht Lüttersloh«. Aber so recht überzeugen kann sie sich von ihrer Tugendhaftigkeit doch nicht mehr. Wie konnte sie das nur tun? Wenn's noch einer zum Heiraten gewesen wäre! Aber ein Studierter, der gar nicht an Heiraten denken kann. Das hat sie doch gewußt. Bis heute, inmitten der Großstadtluft, nannte es Lieschen nur »ihr Pech«; heute, während sie den treuen Landsmann wieder trifft, nennt sie es zum ersten Mal »ihr Unglück«. – Ganz stolz stellt sie fest: groß und stattlich ist Jachl! Von der Krankheit ist ihm nichts anzusehen. Seine Augen kommen ihr noch blauer vor als früher. Immer hat er sowas »Sinnierendes« in den Augen, »sowas Anständiges« hat er an sich – sowas – worüber sie in Berlin lachen. Warum hat Lieschen ihn nur nicht früher besucht?! Sie war wohl ganz von Gott verlassen? Behext muß sie gewesen sein, ja, den Kopf haben sie ihr gründlich in Berlin verdreht. Das fühlt sie erst hier! –
Langsam kommen sie endlich in ein Gespräch. Manchmal sagt Jachl die Worte nicht in richtiger Ordnung, und Lieschen geht es nicht viel besser. Sie wissen selbst nicht deutlich, daß das, was sie ganz in Unordnung bringt, Rührung ist. Wie Pferde, die schwer anziehen, und dann im Galopp weiter wollen, so ringen sich ihnen zuerst die Worte mühevoll aus den Herzen.
Schreckhaft durchfährt es Jachl sofort: »Nur drei Stunden – dann ist er wieder allein – dann ist er wieder Einspänner.« Lieschen hat sich ja sehr verändert, aber ihre Stimme, die ist noch genau wie früher, wenn sie auch berlinisch redet.
Vielleicht ist allein diese Stimme die Ursache, daß Jachl, den Schäfer, plötzlich ein fressendes Heimweh überfällt: Heimweh, wie er es nie gehabt hat, nach seinem Himmel und seiner Heide und seinem Stall und seinen Schnucken – nach den Wolken, die auch seine Wolken sind. –
Je mehr ich meinen Jachl kennen lerne, je öfter grüble ich, wess' Standes und Geistes sein Vater gewesen sein mag. Der Möglichkeiten gibt es wohl wie Sand am Meer. Blut von dessen Blut ist ja in seinen Adern, deshalb wüßte ich so gern, wie dieses Blut beschaffen war. Jung, denke ich, muß Jachls Vater gewesen sein, nicht gar weit vom Knabenalter entfernt, als ihm der Sohn geboren wurde. Das Leben wird noch nichts in ihm zertreten haben; die große Erwartung mag noch hell in ihm geleuchtet haben. Er war ein Vornehmer, wie immer sein Rock beschaffen sein mochte. Vielleicht war er vor der Welt nur »ein gewöhnlicher Mann«. Aber der Welt trauen ist ein unsicherer Glaube. Lauschen und tief schauen ist ihr nicht eigentümlich. Gewöhnliche Leute! Sie hausen nicht immer in Dachkammern. – Beseligt wird der junge Träumer ein frisches Ding, das noch ganz vom Hauch der Heide umströmt war, umfangen haben – –
Dann – ja dann kam die Wirklichkeit. Sie hieß: Joachim Bohn und schien nicht mehr als ein Bauernjunge.
Ja, so denke ich manchmal, wenn ich meinen Jachl ansehe und fühle, wie er derb und doch voll Gemüt ist, wie Ursprünglichkeit und ungebundene Natürlichkeit ihn gegen alles Gemachte und Übertriebene feien.
Lieschen, die trotz aller raschen Lebenserfahrung ein großes Kind geblieben ist, weiß gar nicht, was für einer da neben ihr geht. Daß Berlin mit seinem Lärm und Halloh verwandelt, glaubt sie wohl, aber vom Einfluß der Einsamkeit und ihrer eindrucksvollen inneren Beredsamkeit ahnt ihr Gemüt nichts. – –
Zuerst nach der Ankunft hat Jachl Lieschen stolz durch die Heilstätte geführt. All die vorzüglichen Einrichtungen soll sie bewundern, und dabei will Jachl den andern zeigen, daß auch zu ihm Besuch kommen kann. Weshalb sollte gerade zu ihm niemand kommen? –
Nachdem Lieschen alles gesehen hat, schlägt Jachl einen Spaziergang vor. Lange reden sie darauf vom Wetter; wie schön der April und wie die Heide jetzt wohl aussehen mag. Immer aber ist es, als ob etwas Schweres auf Jachl läge. Am liebsten finge er an zu heulen. Das wäre doch aber eine furchtbare Schande.
Lieschen wischt immerfort mit dem Taschentuch über ihr Gesicht. Ihr ist glühend heiß, nicht nur weil die Sonne so wärmt, sondern weil innere Angst ihr Schweißtropfen erpreßt. –
Jachl fragt nach ihrem Dienst, und wo sie Sonntags immer hingehe, aber er hört gar nicht, was sie antwortet. Wie macht er es bloß, daß er ihr gefällt? Wie wird er Bräutigam?
Allmählich fängt Lieschen an, mitteilsamer zu werden. Durch viel reden möchte sie ihre innere Verwirrung verdecken.
Sie merkt wohl, daß Jachl etwas überlegt, und daß seine Gedanken nicht hier und nicht in Berlin sind. Sie weiß selbst nicht, was sie herausschwatzt von Konzert – Cafés und Kino und Landpartien und Tanzvergnügungen und von all dem dummen Zeug, das mit daran schuld ist, daß es soweit mit ihr gekommen ist. Jachl nickt beinah ebenso mechanisch wie der Ohm damals, als er ihm seine ersten Schulabenteuer erzählte.
Ja, die Herren in Berlin sind klüger als die aus Lüttersloh. Die wissen besser, wie sie rasch zu einer Braut kommen. Jachl ist nur von einem Gedanken erfüllt. Immer und immer summen die Worte in ihm: »Alles hängt von Lieschen ab – alles hängt von Lieschen ab« – –
Wie er das meint, könnte er selber nicht erklären. Denkt er dabei nur an diesen Augenblick oder an sein ganzes Leben? –
Er möchte gern nach des Mädchens Hand greifen, angefaßt mit ihr gehen – nur angefaßt. Ob er wohl solche Tat zustande bringt? Solche Tat könnte ja wohl einen Brautstand beginnen? Wenn er doch rasch den kleinen Maler um Rat fragen könnte.
Von winzigen Knöspchen sind die schwärzlichen jungen Zweige besät, neben denen sie dahin schlendern. Lieschen bleibt stehen und sucht, ob sie nicht einen Zweig findet, dessen Grün bereits etwas größer ist. Den möchte sie dann mit nach Haus nehmen. »Zum Andenken«, wie sie sagt. Ein paar Augenblicke sehen beide in die Büsche, dann holt Jachl sein Messer aus der Tasche, schneidet ein paar herrliche, frühlingsfrische Zweige und reicht sie Lieschen. Ja, er reicht sie ihr und – mutvoll hält er ihre Hand ganz fest. Und nun gehen sie wirklich noch eine halbe Stunde, wie zwei artige Kinder angefaßt, ihres Weges. Manchmal sieht Jachl sich um. Er weiß nicht, wünscht er, daß andere ihn sehen oder wünscht er es nicht. –
Der Duft der knospenden Pflanzen tut Lieschen wohl. Weit, weit fort von Berlin fühlt sie sich. Hätte sie nur nicht ihr Mieder so fest zusammengeschnürt. Sie möchte gern wieder mal tief, ganz tief Atem holen, aber das geht nicht, das ist ihr unmöglich. Der Druck von Jachls warmer Hand durchströmt sie wie Feuer. Am liebsten fiele sie ihm um den Hals und gestände ihm ihre Not. –
Sie staunt: hier muß etwas Berauschendes in der Luft sein; wie können Leute hier gesund werden; hier wird man eher wie von Sinnen.
Den Zug haben beide vergessen, an seine pünktliche Abfahrt gar nicht mehr gedacht. –
Im Fluge haben sich Jachls Gefühle verändert. Ihm genügt nicht mehr das Handhalten: einen Kuß, einen einzigen, möchte er Lieschen geben. Unermeßlich schwer erscheint ihm das, und er weiß doch, wie viele Menschen dies Schwere vollbringen.
Eigentlich ist er wütend auf Lieschen. Weshalb fängt sie nicht mit Küssen an. Sie weiß doch immer rasch Rat. Sie kommt doch aus Berlin!
Wieder werden sie beide einsilbig. Zuletzt verstummen sie ganz. – – »Jetzt – jetzt,« denkt Jachl, während Lieschen ihn ganz bekümmert ansieht – »jetzt«. – Seine roten Lippen pressen sich glühend auf die ihren – »Lieschen, liebes Lieschen –«
Gellend schrillt der Pfiff der Eisenbahn durch die Luft.
»Ich muß weg«, schreit Lieschen auf – »das ist der Zug – meine Herrschaft erwartet mich.« Eilig reißt sie sich los.
Jachl begreift, da gibt es kein Festhalten. Daß auch gerade jetzt der Zug kommen muß, jetzt in dem Augenblick, der ihn gelehrt hat, daß das Küssen gar nichts Schweres ist! Welch ein Jammer!
Beide laufen atemlos zum Bahnhof. Noch rechtzeitig kann Lieschen sich in das Gewühl auf dem Bahnsteig mischen. Schwatzend drängen Hunderte in die Wagen. Lieschen sitzt eingeengt zwischen singenden Burschen. Nicht einmal mehr mit ihrem Taschentuch kann sie Jachl zuwinken. –
Lange noch bleibt er auf dem Bahnsteig stehen, nachdem vom Zuge nichts mehr zu sehen ist. Langsam dreht er sich um. So viel Freude war wohl noch nie in ihm! Beinahe wie Schluchzen hört sich sein glückliches Aufatmen an. –
»Joachim Bohn ließ sich doch in der Arbeit so gut an,« meint der Obergärtner, »aber in letzter Zeit ist er wie auf'n Kopf gefallen« –
Ja, das ist Jachl. Verliebtsein ist aber auch ein Zustand, bei dem man nicht weiß, hat man noch einen Kopf oder hat man keinen. –
Wenn die andern von einer Braut reden, beteiligt Jachl sich jetzt zwar, aber immer nur kleinlaut. War jener Kuß ein Verlobungskuß? Woher soll er das bestimmt wissen? Fort kann er hier nicht so plötzlich, und seinen langen Brief hat Lieschen bisher nicht beantwortet. Das Warten auf diese Antwort ist schlimmer wie eine Krankheit. Jachl wundert sich, daß die Ärzte von solcher Heimwehkrankheit nichts merken. Ihn überfällt sie meist ruckweise. Seit Lieschens Besuch hat er sie fast täglich ein paar Stunden. –
Liebe, Sehnsucht, Heimweh sind für ihn dasselbe. Nie stellt er sich Lieschen in Berlin vor, immer nur auf der Heide. Zum Dichter macht sie ihn: mit Lieschen hört er in seiner Vorstellung die Rotkehlchen singen und die Märzdrosseln flöten; mit ihr steht er unterm Kirschbaum, und sie freuen sich an der reichen, roten Ernte. Er steckt ihr eine Kirsche in den Mund, die so sauer, daß sie das Gesicht verzieht. Darüber lachen sie beide. Jachl verspricht, nur noch mit süßen Kirschen zu kommen. –
Lieschen kennt Lüttersloh, aber nicht die weite Heide, auf die Jachls Schnuckenstall gesetzt ist; sie wird es bald selber merken. Viele Tage werden notwendig sein, um ihr die Herrlichkeiten zu zeigen, zwischen denen sie nun wieder immer und immer leben darf. Berlin ist rascher gezeigt, als die Heide. Teure Blumen gibt es dort wohl in Massen, aber wer hat in Berlin solchen Haselbusch für sich allein oder solchen Walnußbaum? Jachls Grasgarten ist eine Pracht. Wieviel Buntes blüht da nicht je nach der Jahreszeit: Schneeglöckchen, Pfingstrosen, Studenten- und Ringelblumen. Wenn im Rasen gelbe Butterblumen leuchten, wird Jachl immer besonders lustig zu Sinn. Lieschen wird erst im Grasgarten glauben, daß Berlin beim Vergleichen schlecht fortkommt. Jachl kann sich kein Leben unterhaltsamer vorstellen, wie das auf der Heide. –
Pfingsten wird er einen Tag Urlaub erbitten und die Sache in Berlin in Ordnung bringen. Oktober soll er aus der Heilstätte entlassen werden. Er zählt die Tage. –
»Unser Paradepatient! Ist gar nicht mehr zum Wiedererkennen,« sagt der Doktor, während er Jachl den fremden Ärzten präsentiert. »Der hat's erreicht.« Dann redet der Doktor noch etwas von »geordneter Nahrungszufuhr, wohltuender Wirkung körperlicher Bewegung, von gut gelüfteten Schlafhäusern und von planmäßig in Angriff genommenem Kampf gegen Tuberkulose«. Jachl hat das fremdländische Wort so oft aussprechen hören, daß es ihm selbst ganz glatt, ohne Stottern, auch über die Lippen geht. –
Kurz vor Pfingsten schreibt Lieschen endlich. Jachl traut sich gar nicht den Brief aufzumachen. Gut, daß er allein beim Begießen ist; niemand kann sehen, wie lange er das Papier zwischen den Fingern hin und her dreht. –
Also mit seiner Reise nach Berlin ist es nichts. Lieschen muß ihre Herrschaft in einen Badeort begleiten; sie bleibt lange fort, viele Monate. –
Schriftlich möchte »es« Jachl nicht mit ihr abmachen. Er ist hierbei mehr fürs Mündliche. Nach Pfingsten vergeht die Zeit wohl rascher. Vielleicht bekommt er ein paar Tage im September Urlaub.
Ordentlich in die Glieder ist ihm der Schreck gefahren. Aber »was soll man dabei tun?« – –

Zwischen den Genesenden der Heilstätte werden alle Gespräche jetzt zu Plänen. Nur Worte wie: »Zu Hause, bei Muttern, Stellung, Arbeit, Vorwärtskommen« sind zu vernehmen.
Der lange August versichert Jachl unzählige Male, »daß er viel zu schade ist, um als Schäfer zu versauern.« Hundert Stellen kann er ihm in Berlin besorgen. Kinderspiel! Bei der Figur!
Am frohesten ist der kleine Maler, daß er mit seinem Nachbarn zusammen fortkommt. Solche Jungen wie Jachl hat er in Berlin nie kennen gelernt. –
Jachl sagt wenig. Ich glaube, seine Seele bebt. Immer ist ihm, als schiene ganz hell die Sonne.
Zuerst will er – gleich wenn er ankommt – in Berlin die Verlobungsringe besorgen, aber nein, das geht nicht, er muß das Maß von Lieschens Finger haben. – Ganz elend ist ihm manchmal vor Freude und Sehnsucht. Manchmal weiß er selbst nicht mehr, freut er sich am meisten auf Lieschen oder auf die Schnucken. Es ist schwer zu unterscheiden. Ordentlich wie Fieber ist es, aber mit der Lunge hat es nichts mehr zu tun. – Ja, die Schnucken! Ob die wohl einer vergessen kann, der mit ihnen zusammen gewohnt hat, und der ihre Leiden und Freuden genau kennt?
Jochem, der nun schon so lange Jachls Schnucken in Behandlung hat, kann eigentlich überhaupt nicht schreiben. Mühsam, sehr mühsam buchstabiert Jachl aus den Zetteln, die von Zeit zu Zeit ankommen, was in »seinem« Stall passiert. Immer bleibt der Schnuckenstall »seiner«. Dem würde er schön grob kommen, der an diesen seinen Rechten zweifelte. –
Nun er heute allen Lebewohl sagt, gibt es ihm doch einen Stoß; einen ganzen Tag hat er nur mit Bedanken zu tun. Schreiben wird er und nie vergessen, wie gut hier alle waren, und immer so leben, wie er es hier gelernt hat. Ja, das wird er. Darauf können sie sich verlassen.
Mit ihm treten zwanzig junge Menschen die Reise an; nicht nur die Fahrt in eine andere Stadt, sondern gleich auch die Fahrt in die Mühsal des Lebens. Alle sind frohbewegt, erwartungsvoll und siegessicher. –
Diesmal erscheinen Jachl die Häuser der Hauptstadt lange nicht mehr so hoch, wie zur Zeit seiner ersten Ankunft. Er findet aber noch, daß der Himmel zwischen den Dächern wie eingepfercht ist. Die breiteste Straße kommt ihm luftlos vor. Vor Fleischerläden bleibt er zwar noch stehen, aber nicht mehr sehr lange. – Ganz ruhig betritt er eine Kneipe, als er Hunger verspürt. Der kleine Maler hat Jachl in seine Schlafstelle »eingeführt«. Erst am folgenden Morgen wollen sie nachsehen, ob Lieschen wieder zurück ist. –
Geschrieben hat sie nicht mehr. Er wiederholt sich immer, daß sie im Dienst schwer Zeit für Briefschreiben findet.
Ermüdet begibt Jachl sich am ersten Tage auf die Schlafstelle. Der Unterschied zwischen dem schlechtgelüfteten, engen Raum und dem Schlafhaus, das er so lange bewohnte, ist doch sehr groß. Nur die unruhige Erwartung des nahen Wiedersehens, die ihm das Blut rascher als sonst durch die Adern jagt, macht ihn unempfindlich gegen den Lärm, der von der Straße hereinschallt und gegen das laute Sprechen in der Stube. In ihm selbst mag wohl an diesem Abend der Lärm am größten sein. –
Ob auch ein Schäfer Nerven hat? Dieweil er ein Mensch ist: Ja!
Mein Jachl besitzt niemanden, der ihm Schreck und Kümmernis aus dem Wege räumt. Nicht immer wird er in der großen Stadt aufrecht stehen. Manchmal werde ich mich seiner ein wenig schämen müssen, obwohl ich verstehe, daß ein trauriges Herz ein unguter Begleiter ist. –
An diesem ersten Abend in Berlin sind wieder nur die paar Worte in ihm: »Von Lieschen hängt es ab – von Lieschen hängt es ab.« –
Schliefest du doch recht lange, mein Jachl. Wann wirst du noch einmal so erwartungsfroh erwachen wie am kommenden Tage?! –
Der kleine Maler ist pünktlich als Begleiter zur Stelle. Zuerst müssen die nötigen Einkäufe für Jachls Verschönerung gemacht werden. Er selbst wundert sich: ganz sicher geht er über die Straßen. Den Automobilen weicht er ohne Furchtsamkeit aus. Im großen Warenhaus stellt er sich beim Anprobieren seines Anzuges so gelassen vor den Spiegel, als habe er von jeher auf diese Weise den Eindruck festgestellt, den er und ein neuer Anzug hervorrufen. –
Der kleine Maler ist ein guter Führer. Schon früh gegen zehn Uhr sitzen die beiden und stärken sich im großen Kaufhause. – Jachl ist nun wie ein richtiger Stadtherr angezogen, aber für den heutigen Besuch ist die Verschwendung unbedingt nötig. –
Vor dem Haus: »Schaperstraße 24« verabschiedet sich der Maler. –
Joachim Bohn betrachtet erst jedes Fenster des Hauses, bevor er beim Portier klingelt. Vielleicht putzt Lieschen gerade die Scheiben. Nein, zu sehen ist sie nicht. Langsam steigt er die Treppen hinauf. Drei hohe Stiegen. »Links«, hat der Portier ihm noch nachgerufen. –
»Dr. Marwitz«, liest Jachl. Er klingelt. Dauert es immer so lange, bevor jemand öffnet?!
Endlich hört Jachl Schritte. Sie könnte es sein. Die Tür wird geöffnet.
»Ach, bitte, ich möchte zu Fräulein Lieschen.« Leicht lächelnd sieht das Stubenmädchen Joachim prüfend an: »Ach, die – die ist schon seit fünf Monaten hier fort – –«
Ehe Jachl noch etwas fragen kann, steht er vor der geschlossenen Tür. –
Nie ist ihm der Gedanke gekommen, Lieschen könnte die Stelle gewechselt haben. Genau so arglos wie Großmutter Bohn scheint der Jachl zu sein. Nur hatte sie es besser wie er. Sie brauchte sich nicht suchend aufs Einwohnermeldeamt zu begeben; sie erfuhr nie, wie oft Trude die Stelle gewechselt hatte, bis sie überhaupt mit »Stellenannehmen« fertig war. – –
Etwas Furchtbares ist ein Einwohnermeldeamt. So ruhig Jachl sich bis dahin in Berlin bewegt hat, auf den langen Korridoren des Polizeipräsidiums wird ihm doch ganz schwindlig. Zweimal muß der kleine Maler, der noch vor dem Hause Schaperstraße 24 stand, als Jachl herunterkam, erinnern, daß die Auskunft fünfundzwanzig Pfennige koste. Dann sucht Jachl so lange in seinem Portemonnaie, als könne er nicht mehr eine Mark von zehn Pfennigen unterscheiden. –
»Sie suchen Lieschen Müller?«
Der kleine Maler bejaht die Frage.
Minutenlanges Blättern.
»Lieschen Müller, zurzeit im Mütterheim, Akazienallee.« –
Erledigt! Fertig!
Jachl steht auf der Straße. Er hört nicht, was sein Führer redet. Er hat so furchtbares Sausen im Kopf, als führen alle Autos geradeswegs durch seinen Kopf, immer nur durch seinen Kopf.
Hin zu ihr muß er. Dabei ist nichts zu besinnen.
Gegen vier Uhr hat er sich bis zur Akazienallee durchgefragt. Der Weg war lang. Jachl wünschte, er wäre noch viel länger gewesen. –
Ein ganz kleines Schild ist am Eingang angebracht. »Mütterheim« steht darauf.
Die erste, die ihm auf dem Hofe des Gebäudes begegnet, ist Lieschen. Sie trägt ein Kind auf dem Arm, das genau ihre Augen und ihre Nase und ihren Mund hat. Sofort erkennt das Jachl, obwohl er eigentlich alles wie durch Nebel sieht. –
In einen Winkel des Hofes sind sie getreten. Lieschen ist kalkbleich geworden. Sie weiß nicht, was sie sagen soll.
»Es ist ja gar nicht sowas Schlimmes«, begehrt sie endlich fast zornig auf. –
Wut, Schmerz, Eifersucht reißen an Jachl. Zorn übermannt ihn. Sein Arm zittert. Er möchte die Hand heben und sie schlagen; er möchte sie erwürgen. –
Das Kind schützt Lieschen. So viel Verstand hat er behalten: dem Kinde will er nicht weh tun. –
Stumm, grollend stehen die alten Freunde einige Sekunden voreinander. –
Jachl hat gewußt, daß Mädchen Liebhaber haben, und daß sie Kinder bekommen, aber Lieschen, sein Lieschen! Er fühlt, etwas Gefährliches tobt in ihm. »Bin ich das denn? Wovon ist mir so rot vor den Augen? Nur fort, hier fort,« denkt er.
Als habe er ein Verbrechen begangen, läuft Jachl davon. – –
Herz, du weißt nichts von Schäfer und König. Du weißt nur von Menschenleid und Menschenlust. – –
Schon nach einer Viertelstunde verlangsamt Jachl seine Schritte. Nicht lange, und er schleicht nur noch. In der Brust tut ihm etwas furchtbar weh. Von einer Straße in die andere schiebt er sich ohne Ziel, ohne klare Gedanken. –
Grelles elektrisches Licht erinnert ihn, daß der Abend längst hereingebrochen sein muß. Ohne zu wählen betritt er eine Kneipe, einen Keller, der laut Aufschrift bis früh acht Uhr geöffnet bleibt. An einen langen Tisch setzt er sich neben halbtrunkene Männer.
»Jauersche und Kartoffelsalat«, hört er eine Stimme rufen.
»Mir auch«, schreit Jachl.
»Und ‹ne Weiße.« –
Er ißt und trinkt, hört zu und trinkt, bis aller Jammer schwindet; nicht nur schwindet, sondern einer hellen Lustigkeit gewichen ist. Von Lieschen und ihrem Kinde weiß er bald gar nichts mehr. Was gehen die ihn an? Da sitzt ja ein dralles Fräulein neben ihm; eins, das kaum siebzehn ist, mit gekrausten roten Haaren und vielen Ringen auf den Fingern und einem Mund, der so rot ist, wie Jachl noch nie einen Mund sah. Eine weiße Bluse ist über ihre Brust gespannt; deutlich erkennt man rosa Bändchen darunter und ein Hemd, das ganz mit Spitzen besetzt ist. »Wie kommt solche Feine in'n Keller?« simuliert Jachl. »Und weshalb drängt sie sich gerade an mich? Darüber muß man staunen! Schade, daß der kleine Maler nicht mit hier ist, der wüßte sicherlich Bescheid zu geben.« –
Unsicher erinnert sich Jachl, daß er noch gestern in der Heilstätte gewesen, daß er fest versprochen, alles Gute, was er dort gelernt hat, weiter einzuhalten: schlechte Luft zu meiden und schlechte Gesellschaft und Rauch und Hitze und Alkohol und noch viele, viele Dinge, auf die er sich jetzt gar nicht mehr besinnt. Schon heute nicht mehr besinnt! –
Immer lustiger wird es in dem halbdunklen, von Fuseldunst erfüllten, überhitzten Raum. Jachl hört Schimpfworte gemeinster Art. Taumelnde Gestalten verlassen den Keller. Andere, auch taumelnd, fallen die Stufen herab. Johlend erheben sich Männer, deren Gesichter dunkel gerötet und schweißtriefend sind. Sekundenlang wundert sich Jachl immer noch, woher er hier zwischen diesen sitzt. Dann aber hört auch das Wundern auf. –
Alle haben ein Mädchen am Arm. Sie streiten oder sie küssen. –
Mit vielen zusammen steht Jachl endlich auf der Straße. Er merkt, auch er hat eine untergehakt; er glaubt, es ist die mit dem spitzenbesetzten Hemd. Genau weiß er es aber nicht. –
Bezahlen kann Jachl nichts mehr. Die rote Jule hat ihm ihr gefülltes Portemonnaie gegeben. Ist das schwer und dick! Er wiegt es bewundernd in der Hand. »Weil du mir gefällst,« hat sie gesagt und ihm laut schmatzend einen Kuß versetzt. »Sapperment,« lacht Jachl, »der schmeckt, der schmeckt, so was gibt's bloß bei euch hier in Berlin.«
Für einige Minuten hat ihn die frische Luft klar im Kopf gemacht. Er merkt, um die rote Jule beneiden ihn andere. »Ja, das ist Meine,« schreit er, »mir gehört die.« Dabei stößt er mit den Ellenbogen um sich. »Keiner ran – keiner ran,« wiederholt er unzählige Male, ebenso brüllend wie die anderen.
Die rote Jule streichelt ihn und versucht ihn zu beruhigen. Ihre Freundinnen gönnen ihr den hübschen, starken Jungen nicht. Rasch stößt sie einen schlafenden Kutscher an. »Heda, Männeken, 'ne Fuhre.« –
In weiche Polster sinkt Jachl. Zum erstenmal in seinem Leben fährt ihn eine Droschke.
Wohin die schöne Jule mit ihm fährt, weiß er nicht. –
Erst am nächsten Vormittag, als er vors Haus tritt, studiert er: »Körnerstraße«. Er dreht sich rundum. Wo ist er? In dieser Gegend war er vorher nicht. Aber das ist ja alles egal jetzt. Wie gestorben kommt er sich vor.
»Auf Wiedersehn« hat die rote Jule gerufen und ihn gestreichelt und ihn geküßt und »Schatz« gesagt und »Liebster«. –
Er lebt also doch. Das ist gewiß. Aber krank ist er! An so viel Leid und Liederlichkeit ist mein Jachl nicht gewöhnt. Nicht mal an seine Schnucken denkt er. Gleichgültig sind sie ihm, ganz gleichgültig. Kein bißchen Verlangen hat er nach ihnen. Er muß ja nun auch in Berlin bleiben. Ja, das muß er. Geld zum Weiterreisen besitzt der Schäfer nicht mehr. Schadet nicht. Ob Berlin oder Lüttersloh ist nun egal. Alles ist egal, alles, alles. –
Schmunzelnd empfängt ihn der kleine Maler. Gar nicht erstaunt. Ja, Berlin! Hat er nicht vorher gesagt, wie's da zugeht? Na, Rat zu schaffen ist nicht schwer. Den neuen Anzug, ja, den müssen sie versetzen. In die alte Kluft muß Jachl zurück, »'s ist kein Unglück; auf'n Leib bekommt man schon wieder was,« tröstet der Freund.
Jachl, der allmählich wieder zu Verstand kommt, setzt eine gottesjämmerliche Miene auf bei der Vorstellung an die rasche Trennung von dem besten Anzug, den er im Leben besessen hat.
Tapfer steht der kleine Maler ihm in aller Not bei. Versetzt ist rascher wie gekauft. Dann gehen sie in die Jägerstraße. »Mietskontor« heißt es. Jachls große Figur gefällt. Nach zwanzig Minuten ist er angestellt, oder, wie der kleine Maler es nennt, »verkauft«; so rasch geht alles, daß Jachl gar nicht mehr zur Besinnung kommt. –
Jachl heißt plötzlich nicht mehr Joachim, nicht mehr Jachl, er heißt: Karl. Und Schäfer ist er auch nicht mehr, sondern Hausdiener. Schäfer werden in Berlin nicht gebraucht.
Der kleine Maler versichert, Joachim habe das große Los gezogen: Hausdiener mit Livrée in solchem vornehmen Hotel! Gleich möchte er tauschen! Die Hauptsache ist aber, in Berlin muß einer »was vorstellen«. Ja, und beim »Was vorstellen« kommt der kleine Freund nicht mit. –
Von früh bis spät hört Karl-Jachl seinen neuen Namen rufen. Immer kommandiert ihn einer, manchmal gleich zwei. Er kommt sich nur noch wie eine Schnucke vor; hier hat er gar nichts mehr zu rufen, hier wird er bloß immer gerufen. Am Abend ist er so müde, daß er sofort einschläft. Während des ganzen Tages muß er sehr aufpassen, damit er nicht grob angeschrieen wird. –
Zuerst war ihm immer, als habe ihn ein Schlag auf'n Kopf getroffen. Das muß wohl vom Schreck im Mütterheim gekommen sein. Nach einer Woche ward es besser. – Nicht einmal so viel Zeit bleibt Jachl zum ruhigen Überlegen. Und auch nicht so viel Ruhe; denn, was war die Volksheilstätte gegen die Pracht, zwischen der Jachl jetzt zu arbeiten hat. Seide und Samt, Gold und Silber, wohin er sieht. Seine Gedanken muß einer dazwischen beisammen haben, sonst können sie ihn nicht gebrauchen. An die vielen großen Spiegel überall im Haus muß man sich auch erst gewöhnen. Und dann die feinen Leute! Jachl gefallen sie gar nicht und Berlin auch nicht, aber er weiß wohl, der wird ausgelacht, der das eingesteht. In Berlin ist sich verstellen die Hauptsache, das merkt er rasch. –
Nie wäre Jachl hier geblieben, hätte Lieschen nicht sein Leben ganz verdreht. Er geht ja mit der roten Jule, das ist wahr, aber mit einer gehen und an eine andere denken, das kann passieren. –
Manchmal kommt es Jachl so vor, als nähme einer, der nicht zu sehen ist, jeden Tag einen großen Sandsack und schütte ihn über Berlin aus. Jedes Sandkorn ist ein Kind oder ein Eingewanderter, und nachher soll jedes Sandkorn allein aufpassen, daß es nicht in die Erde gestampft wird. Das ist wohl dumm gedacht, aber wenn Jachl sich in Livrée noch so fein in den Hotelspiegeln sieht, immer und immer fällt ihm das von den Sandkörnern ein. – Ja, auf der Heide! Da war er wohl eher etwas wie ein festgewurzelter Baum! Ganz leise haben sie sich wieder in ihn eingeschlichen, die Gedanken an die Schnucken und an den Grasgarten und an die Heidewege und an die schwarzen Machangelbüsche, an die braunen Farren, an die roten Eichen, an die weichen Moosdecken, an die scheuen Rehe, an die Spitzmäuse und an die bunten Schnirkelschnecken. Immer sind sie alle auch mit hier in diesem feinen Hause. –
Das Beste im Hotel ist ein Landsmann, sogar einer, dem Berlin auch nicht gefällt. Richtige Feiertagsstunden verleben beide im geheimen, wenn sie von »ihrer« Gegend sprechen. Zuerst sehen sie sich immer ängstlich um; sie wissen, gleich heißt es, einer ist ein Dummkopf, wenn er an Berlin kein Gefallen hat. Dann aber beginnen sie. Schwatzhaft wie sonst nie wird Jachl. Anfangs ist das Gespräch ein rasch sprudelnder Quell, dann verlangsamt es sich, bis jeder mit einem müden Seufzer aufsteht.
»Jetzt, wie sieht es jetzt auf der Heide aus?,« sagt Karl-Jachl. »In brennender Sonnenglut werden die Schnuckenwege liegen – ein Mann wird im Sonnenbrand am Heidemoor stehen und Torf stechen, er wird die schwarzen Stücke zum Trocknen hoch aufbauen. Keiner ist wie hier in der Nähe, der immerfort ruft.« Oder vom Wacholderfeld reden sie. Oder Jachl schwärmt von den hellen Nächten, in denen es heller ist wie hier mit allem elektrischen Licht. Und wie anders der Regen herabrieselt als hier, wo er immer nur stört, und wo kein Mensch auf ihn gewartet hat und Tag und Nacht ihn herbeisehnt und »Gott sei Dank« bei den ersten Tropfen sagt und sich auch noch weiter freut, wenn er stundenlang wie in Mollen von oben herabgeschüttet wird. Hier denken sie bloß an die Kleider, die verdorben werden, nicht an den dürren Erdboden, der getränkt werden muß. Ja, was wissen sie hier überhaupt von der Welt!? Die Heide haben die wenigsten gesehen, und wenn sie sie sahen, konnten sie sie wieder vergessen. Ja, wie kann ein Mensch die Heide vergessen? Er muß ja gar kein Herz haben. Vor den Schaufenstern, wo es blitzt und blinkert, stehen sie, und das ist doch rein nichts gegen das Silber des Wollgrases oder das Gold des blühenden Postes oder das Kupferrot vieler Büsche!
Die beiden Hausdiener reden immer nur halblaut. –
Längst hat Karl-Jachl Geld genug zur Heimreise. Er wartet aber: eines Tages könnte Lieschen kommen und nach ihm fragen, dann muß er doch da sein. Je länger er hier arbeitet, je weniger böse ist er ihr. Hier werden sie nun doch mal so – die Mädchen. – –
Ein Glücksjäger bist du, mein Jachl, nicht, du Scheuer, du Reiner! Hinter deinen Schnucken verstehst du herzulaufen, aber nicht hinter deinem Glück! Was du auch tust, mir kommt es vor, du sähest in die Wolken. Ja, und »in die Wolken sehen« ist ein unsicherer Glücksweg.
Jeden zweiten Sonntag geht Karl-Jachl mit der roten Jule aus. Sie schwärmt fürs Kabarett. Beim erstenmal traute er sich gar nicht richtig hinein. Manche hatten ja gar nichts an. Was sie sangen und worüber alle lachten, verstand er kaum. Aber schließlich gewöhnt sich auch ein Schäfer daran. Das bunte, wechselnde Licht gefällt Karl-Jachl und die Studenten- oder Soldatenlieder, bei denen zuletzt alle lustig mitsingen.
Am liebsten geht er in den Zirkus. Pferde, die sind was! Die lohnen anzusehen. Hat er einmal einen freien Abend, so steht er auf der Galerie im Zirkus und wendet keinen Blick von den Schulreitern. –
Das »nach dem Himmel sehen« hat Karl-Jachl sich abzugewöhnen versucht. Wozu auch? Fabrikschlote jagen ihren Rauch in die Höhe; die langen Häuserreihen verderben alles. And dann ist der Weg auch vom Stiefelputzen und Koffertragen bis zum Himmel zu weit; so hoch kann Karl-Jachl nicht sehen, so scharf seine Augen auch sind. –
Einige Monate ist Karl-Jachl sehr hinter Zeitungen hergewesen. Mit einmal sind sie ihm ganz »über« geworden.
Politisches! Das geht ja, wenn es einer ordentlich versteht. Dagegen ist nichts zu sagen. Aber sonst! Wozu steht alles drin von Jank und Mord und Betrügerei und all den Schlechtigkeiten, die so leicht zum Nachmachen sind? Damit mag Karl-Jachl lieber gar nichts zu tun haben. Zuerst dachte er, sowas stehe nur selten mal drin. Ja, prost Mahlzeit! Wie zum Bäcker Semmel gehören, so gehören in die Zeitung Mord und Totschlag. Darum sieht er nicht mehr hinein. Und auch weil sie ein‹n immer zum Geldverschwenden bringt. Besser ist, wenn man gar nicht weiß, wo es furchtbar billige Hosen oder Hüte oder allen möglichen Krims-Krams gibt. Zeitunglesen kostet mehr Geld als einer glaubt.
Wer meinen Jachl nicht kennt, der könnte ihm nicht mehr den Heidjer anmerken. Er hat sogar aufgehört, sich, wie er es anfangs immerfort tat, zu wundern. Er weiß, in Berlin kommen wohl täglich tolle Sachen vor. Was erlebt er nicht allein in seinem Hotel, seitdem er nicht mehr ganz blind ist!
Aus der weiten Welt steigen sie ab; Damen sind dazwischen, die so fein aussehen wie Prinzessinnen. Der Staat der roten Jule ist nichts dagegen. Manche betrachten den Hausdiener in der hellblauen sauberen Uniform so freundlich, daß Karl-Jachl das Blut in den Kopf steigt. Was haben sie an ihm zu besehen? Einmal ist eine mit einem Grafen gekommen, die hat ihn angesehen und gesagt: »Sie sind Ihrer Sprache nach wohl nicht aus Berlin?« Karl-Jachl hat natürlich vor ihr stramm gestanden und ganz stolz geantwortet: »Joachim Bohn aus Lüttersloh.« Da ist die Dame – ganz jung ist sie nicht mehr gewesen – wie Schnee geworden; aber gefragt hat sie nicht weiter. Karl-Jachl wußte nichts wodurch er es mit ihr verdorben hatte. Am selben Abend sind der Graf und die Gräfin weg, ganz plötzlich. – (Karl-Jachl merkte schon oft, daß Herrschaften sehr veränderlich sind.) Die Dame hat ihm einen Briefumschlag gegeben, als sie klingelte, damit er das Gepäck herunterschaffe, ja – und da hat sie gesagt: »Behalten Sie das für sich« – aber so undeutlich hat sie geredet, daß Karl-Jachl fragen mußte, erst dann hat sie deutlich wiederholt: »Für Sie.«
Ja, Karl-Jachl hat es längst gemerkt: Tolle Sachen passieren in Berlin.
Also in dem Briefumschlag haben fünf Scheine gesteckt, jeder ist 100 Mark wert.
Soviel Geld für gar nichts! Karl-Jachls Schreck ist nicht klein gewesen. Große Damen haben wohl ihre Launen. Wenn sie nicht so plötzlich fortgereist wäre, hätte Jachl sie angesprochen, weshalb sie ihm das geschenkt? Doch nicht weil er aus Lüttersloh ist? Erzählt hat er es keinem. Wozu? In Berlin traut einer dem andern immer rasch Schlechtes zu. Womöglich hätte man ihn noch für 'nen Dieb gehalten und in die Zeitung gebracht. Beschwören kann Karl-Jachl: Das Geld ist ihm richtig geschenkt worden. –
Wenn er zurück nach Lüttersloh kommt, will er mal rumhorchen, ob von da eine Gräfin gebürtig ist. Kann wohl möglich sein. Von überall kommen Barone und Grafen. –
In den gewölbten Truhendeckel hinter die heilige Genoveva steckt Karl-Jachl die Scheine. Da sind sie sicher aufgehoben. Er gebraucht sie nicht. –
Allmählich ist Berlin ja ganz leidlich und wäre zum Aushalten, wenn es auf der Welt keine Heide gäbe. Aber wie der eine immer aufs Wasser will und mit seinen Gedanken auf den großen Schiffen ist, so muß es Jachl wohl in die Heide zwingen. Er kann nichts dafür. Und wenn Lieschen auch das Kind hat, mit soll sie doch.
Gerade als Jachl beim überlegen ist, wann er hier aufhören will, bekommt er einen Brief von seinem früheren Dienstherrn. Der schreibt ihm:
»Lieber Jachl, Du bist so wie die andern auch und kommst nicht zurück, aber ich will Dich fragen, ob Du als Oberschäfer hier bei mir annehmen willst. Ausstehen tust Du nichts, das weißt Du. Hier sind die Schäfer sehr knapp, ein ordentlicher Mann ist versorgt für Lebenszeit. Zu Johanni geht meiner. Es grüßt Dein Dienstherr Klas Hinnerk.«
Nun ist es also soweit. Karl-Jachl hat nichts erst zu überlegen. Er ist mit sich einig: »Viele passen besser nach Berlin und manche besser nach Lüttersloh.« –
Komisch ist es: Zweimal müssen sie ihn heut rufen: Karl! Karl! Für sich selber heißt er schon in diesem Augenblick wieder nur noch: Jachl. Den eigentlichen Namen nehmen sie einem in Berlin auch ohne viel zu fragen. Das braucht sich wohl eine anständige Kreatur nicht gefallen zu lassen.
Noch zwei Wochen bleibt er in der hellblauen Livrée. Daß er nur den einen Platz in Berlin gehabt hat, ist selbstverständlich. »Was nützt verändern? Fehler sind überall, man weiß nie, was man eintauscht. Schäfer sein, ist auch nicht immer ein Vergnügen. Was können einem nicht die Schnucken zusetzen mit Bocken und Krankheit und dazu Wind oder Nebel oder Nässe.«
Jachl weiß wohl, »alle soewen Johr ännert sik de Natur, aber nein, so verändern kann sich seine Natur nicht, daß er je Verlangen nach Berlin bekommt. Stadtmensch ist Stadtmensch und Heidjer ist Heidjer. Es ist gut, daß wenige die Heide mögen! Was wäre sonst wohl für'n Gedränge auf ihr.« –
Bald kommt Jachl hierher nicht zurück. Er sieht sich deshalb an seinen freien Nachmittagen gründlich den »Zoologischen« an. Bis zur Dunkelheit geht er herum. Am meisten staunt er über die vielen Sorten Schafe. So verschieden hat er sie sich denn doch nicht vorgestellt! Bücher kauft er auch noch, in denen man nachlesen kann von Rassen und Wolle und Krankheiten, und wie man sie behandeln muß. Und dann ein Buch, das ganz vollgeschrieben ist vom »Leben der Bienen«. Schäfer und Schäfer ist nicht immer dasselbe. –
Erst zuletzt will er im Hotel von seiner Abfahrt erzählen. Lachen werden sie nur und »dummer Schäfer« sagen. »Dumm! Dumm! Ja, wer ist denn eigentlich der Dumme? Rasch ist das wohl gar nicht ausgemacht. In Berlin halten sie sich ja für furchtbar klug. Wenn man aber ordentlich hinsieht, dann find't man nicht viel, was sie von ihrem Klugsein haben. Viele sind kränklich, viele haben kein Geld, viele Schulden, liederlich sind viele, und die, die ordentlich sind, müssen sich furchtbar quälen, wenn sie weiter kommen wollen. Jachl weiß, weshalb er nicht in Berlin aushält: Zu viel Ungerechtes muß der Mensch da hinnehmen oder mit ansehen. Auf der Heide ist mehr Gerechtigkeit und weniger Gerede und Großtun.«
Stillvergnügt lächelt er. Ihm ist bei seiner Dummheit wohler, wie denen bei ihrer Klugheit.
Wenn bloß die Sache mit Lieschen erst richtig im Gang wäre. Wohl hundertmal wollte er hin zu ihr, aber vor lauter Angst ging er nie. Angst wovor? Ja, das kann er selber nicht sagen. Er ist ihr furchtbar gut, und doch traut er sich nicht hin zu ihr. Das muß wohl von der Liebe kommen. Immer wurde er ganz kopfschwach, weil sein Herz toll zu klopfen anfing, so oft er mit ihr zusammen war. –
Jetzt kann er es aber nicht länger aufschieben. Hin zu ihr muß er, gleich heute, nun er nicht mehr Karl ist, sondern schon Jachl, Jachl, der Schäfer! –
Wieder sucht er Lieschens Adresse auf dem Einwohnermeldeamt. Diesmal blättert der Beamte länger als das erste Mal, bevor er fragt: »Verehelichte Schütze?« Und hinzusetzt er: »Hören Sie denn nicht?«
Jachl schluckt, bis er leise herausbringt: »Kann wohl sein.« –
So dunkel ist ihm noch nie vor Augen geworden. Aber, daß er in die Ackerstraße gehen muß, das steht fest. Ohne Lieschen nochmal gesehen zu haben, kann er doch nicht abfahren. –
Fünf Treppen hoch, dicht unterm Dach wohnt Frau Schütze. Laute Stimmen sind zu hören. Jachl klopft. Ein halb Trunkener reißt die Tür auf. In eine enge, halb dunkle Kammer tritt er.
Wieder hat Lieschen ein ganz kleines Kind auf dem Arm. Ein zweijähriges hockt am Boden. Ihr Mann zankt weiter, er schimpft »auf das fremde Biest, das er mit satt machen soll«. Gleich aber wirft er sich auf den Strohsack und schnarcht schon nach einigen Minuten laut.
Leise streichelt Jachl Lieschens Arm; am liebsten streichelte er sie immer weiter und sagte gar nichts. Aber ohne Reden geht es doch nicht. Beide stehen dicht nebeneinander vor der Dachluke. Lieschen erklärt, daß es zu schwer gewesen allein mit dem Kinde, daß sie kränklich war und nicht mehr ordentlich hat verdienen können. Und egal sei ihr auch alles gewesen, weil Jachl nie mehr was hat von sich hören lassen. Zu wütend ist er damals weggestürzt. – Ihr Mann war nicht immer »so«. Erst seitdem er arbeitlos geworden, trinkt er. Zuerst ging alles ganz gut. Sie haben eine ordentliche Wirtschaft anschaffen können. Maurer verdienen nicht schlecht, wenn sie Arbeit haben. Nur mit Matten, dem Jungen, fing bald der Ärger an; den Matten kann der Mann nicht ausstehen.
Während Lieschen das alles erzählt, hebt Jachl den Jungen auf. Zutraulich greift ihm der gleich nach der Nase.
Jachl ist noch immer nicht für viel Worte, er hat sich darin auch in Berlin nicht verändert.
»Ja, denn gib ihn mir man mit, Lieschen; da ist gar nichts bei zu besinnen.« –
Zusammen gehen sie die Treppe herunter. Lieschen schluchzt. Das Kleinste übergibt sie einer Nachbarin. Für den kümmerlichen Matten ist es wohl Glück, aber auch Glück kommt – besonders für Mütter – oft wie Schmerz und ist nicht immer gleich zu erkennen. –
Lieschen hat ihren Jungen auf den Arm genommen. Zwischen vielen Menschen kommt er auf seinen eigenen Beinen schlecht vorwärts. Jachl geht wie ein richtiger Ehemann neben ihnen.
Bis zum Abendzug kann er noch viel besorgen. Er will gleich noch heute fort. Wohin sollte er hier mit dem Kinde? Und für Lieschen und ihn ist langes Hinziehen unklug. –
Zuerst gehen sie in ein Warenhaus und kaufen Matten ein bißchen Zeug. Lieschen muß sich auch ein fertiges Kleid aussuchen. Jachl besteht darauf.
Was hätten sie sich alles zu sagen! Wochen würden nicht ausreichen. Aber in solchen Stunden ist Reden das Schwerste. Zwischen Klugen und Dummen hört da jeder Unterschied auf. Allen liegen Steine auf den Herzen und Schlösser vor den Lippen, und die schöne Zeit geht unbenützt vorüber. –
Ohne es erst zu verabreden, bleiben sie bis zur Abfahrt beisammen. Viel Stunden sind es nicht. Eine Woge, die ihm fast Schwindel verursacht, geht Jachl durch die Brust. – –
Lieschen kniet vor der altersgrauen Truhe. Sie packt alles schön ordentlich zusammen. Die heilige Genoveva klebt so fleckenlos im Deckel, als habe sie nicht schon vor Jahren Jachl auf die Reise ins Leben begleitet. Aber mit dem schönen Spruch: »Fürchte dich nicht, glaube nur!«, der auch noch unbeschädigt im Deckel befestigt ist, mit dem hat es doch nicht seine Richtigkeit gehabt. Der Vers ist mehr für den Himmel geschrieben, als für die Erde. Und für Berlin überhaupt nicht.
Später sitzen sie einsilbig in einem Gasthaus nebeneinander. Essen muß der Mensch. Eisbein und Sauerkraut ist doch Lieschens Lieblingsgericht. Ein gehäufter Teller steht vor ihr. Es schmeckt ihr aber nicht. Die mitgeschluckten Tränen drücken zu sehr auf den Magen.
Um sechs Uhr sind sie am Bahnhof. Wieder viel zu früh; genau wie damals, als Lieschen die Fahrt nach Lüneburg antrat. Jachl hat Lieschens Hand genommen. Angefaßt mit ihr zu gehen, war ja immer sein höchster Wunsch. Fest hat sie seine Finger umklammert.
»Wenn die Zeit doch nicht so rasch herum wäre.« Nur das können sie denken. Haben aber Denken und Wünschen schon je einen Zug aufgehalten? Auch der für Jachl bestimmte braust unbarmherzig heran. Zwei Hände fallen auseinander – schwer und langsam – –
Rasch ist ein Abteil gefunden. Lieschen langt Matten hinein. Noch einmal steigt Jachl aus und küßt ruhig die Frau, die, fast so lang erdenken kann, zu ihm gehört, und die doch nie wirklich sein gewesen. –
Fahrplanmäßig geht alles weiter – auf Bahnhöfen und im Leben. –
Kerzengrade sitzt Jachl all die Stunden auf der Bank. Matten schläft in seinem Arm. Er darf doch Matten nicht stören. Vom Kinderpflegen hat Jachl bisher nichts gelernt, deshalb stellt er sich nicht gerade geschickt an.
Ganz steif sind seine Glieder, als der kleine Schläfer sich endlich regt. Ordentlich recken muß er sich und strecken, bevor er die Knochen wieder in Ordnung bekommt. –
Die letzte Fahrstunde bringt Jacht stehend am Fenster zu. Alte Häuschen tauchen auf; kleiner und grauer scheinen sie geworden, aber so lichtumflutet liegen sie da, als wolle die Natur ihn feierlich empfangen und beweisen, daß vor ihr Unterschiede nicht bestehen. – –
»Vater!«
Jachl hört's und hört's doch nicht.
»Vater!« –
Fast erschrocken dreht er sich um. Daran hat er gar nicht gedacht, daß er wohl nun der Vater ist. Rasch verwandelt sich sein erstes Fühlen in Dank. Er drückt Matten einen Augenblick fest an seine Brust. »Wir wissen nu beide, wohin mit uns, mein Jung‹; wir haben nu 'nen Platz für alle Liebe.« Um sich gleich wie ein erfahrener Vater einzuführen, fragt Jachl seinen Sohn: »Kannst du reiten?« (Etwas Besseres fällt ihm nicht gleich ein.) Schnell hebt er Matten auf seine Kniee und läßt ihn reiten, bis sie beide ganz außer Atem kommen.
Die letzte Haltestelle ist erreicht. Jachl übergibt einem Fuhrmann seine Sachen, nimmt den Kleinen an die Hand und wandert mit ihm auf wohlbekannten Heidewegen weiter. –
Der Schäfer weiß: Manch einer wird fehlen, der dahin gehen mußte in den Jahren, während denen er in der Fremde gewesen ist. Aber der kleine Heidefluß hier, neben dem sie eben schreiten, der ist ebenso still-fröhlich geblieben wie früher. Und gegen den rosigen Schein, der gerade auf den Heidbergen liegt, kommt keine Illumination auf, wenn sie in Berlin auch eine Menge Geld dafür hingeben. –
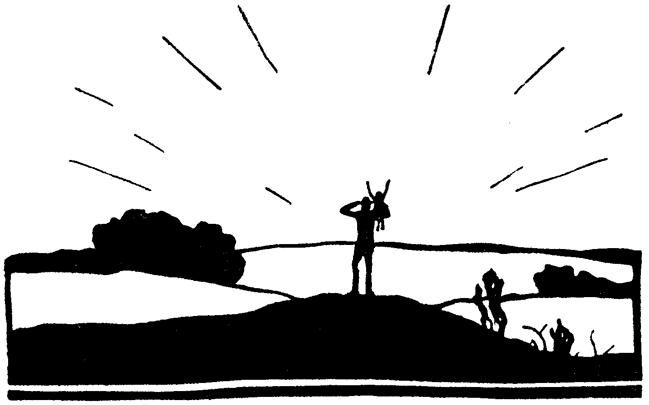
Jachl, der doch selten für viel Worte war, muß von der Heimatluft wie betrunken sein; er redet an diesem Morgen zu Matten, als könne er ihm nicht eilig genug von allem erzählen, was die Heide für sie beide in Bereitschaft hält.
»Gewiß, wir sollen hier nur geringe Leute sein, Matten, aber du sollst mit der Zeit selbst sehen, wo die Geringen sind; zu vielen Vergleichen wirst du aber nicht kommen, denn du bleibst ja hier bei mir – du und ich gehören nun doch zusammen. Gut sollst du's haben, Matten. Ich bin so leidlich geworden, ja, das bin ich; aber du mußt anders werden, ganz anders, dafür bin ich da; ich weiß jetzt auch, was 'nem Menschen guttut an Ordnung und Reinlichkeit und wie er sich benehmen soll. Wenn zu uns Leute aus der Stadt kommen, sollen sie sich wundern, wie du hier zwischen die Schnucken kommst.«
Matten verstünde nichts von diesem allen, auch wenn er aufpaßte. Das tut er aber gar nicht. Er ist mit den Gräsern und den Blumen und den Moosen beschäftigt, die er am Boden sieht. Sonst ist er auf harten, kahlen Dielen in lichtlosen Hofräumen herumgerutscht. Wie sollte er hier nicht gucken und lachen und mit beiden Händen in die Luft greifen, so oft er in die Höhe sieht. Das Helle droben, das will er sich herunter holen. Jachl begreift's und lacht auch und möchte ebenso nach dem Hellen fassen.
»Ja, Matten, greif du nur in die Luft. So viel Luft hast du doch in deinem ganzen Leben noch nicht gehabt. Recht hast du zu lachen, ganz, ganz laut zu lachen, mein Jung'. Von allem Bösen sind wir jetzt fort. Solche Jungen wie dich machen sie in der großen Stadt krüpplig. So oder so! Nachher kommen sie mit ihrem »Kinder-Rettungsverein« und tun sich groß, aber was sie vorher alles ruhig geschehen lassen, davon reden sie nicht. Hier haben wir Frieden und Segen und Gesundheit für dich. Und reich sind wir auch, Matten, dir kann ich‹s anvertrauen: Fünf blaue Scheine haben wir. Mit der Zeit bauen wir uns ein kleines Häuschen, ein blitzblankes Häuschen neben unserm Schnuckenstall. Mitbauen mußt du helfen, Matten, dabei kann ich dich nicht schonen. Für das ganze große Hotel mit allem Gold und Silber tausch' ich es nicht ein, unser Häuschen. Hör' doch ein bißchen zu, mein Jung', was Vater red't – –«
Jachl sagt's, aber in Wahrheit verlangt er gar nicht, daß Matten aufpaßt. Was kümmert es einen Trunkenen, ob ihn jemand anhört! Jachl wird weiter reden, bis sein glückseliges Herz zur Ruhe kommt und rasch, ach zu rasch veratmet ja solch bißchen Glückstrunkenheit.
»In die Schule wirst du müssen, Matten, das gehört sich, aber wir haben ja noch ein paar Jährchen Zeit. Immer will ich dir ein Stückchen Weg entgegenkommen. Die Schnucken müssen auch mit. Und wenn du nachher sagst: Lehrer möcht' ich werden, Dorfschullehrer, werd' ich‹s überlegen. Ein bißchen hoch hinaus, das schadet nicht. Und das sag' ich, Matten, solch Prämienblatt wie Vater, das mußt du Ostern auch immer mitbringen und es ganz von weitem auch durch die Luft schwenken, und eingerahmt soll es werden, nicht bloß so angeklebt an der Wand hängen, wo Fliegenschmutz und Staub drauf sitzen. Und, Matten, diesen Sonntag gehen wir in die Kirche; mir ist so nach Betenmüssen. In Berlin ist der liebe Gott viel weiter weg; – ich weiß ja, daß das Unsinn is, und es kommt Vatern bloß so vor, ja, das weiß er, aber hin wollen wir, Matten – du brauchst nicht bloß allein einen Vater–ich auch.«
Die Stille und der Duft der Heide treiben Jachl in diesen Minuten nur immer stärker in einen seltsamen Rausch hinein. So leicht und frei hat er sich noch nie gefühlt. Wie kann ihm so wohl sein ohne Lieschen? Die schmerzliche Sehnsucht ist nicht mehr in ihm. Vielleicht kommt sie wieder, die Sehnsucht. Wie soll er das wissen? Aber heute, heute ist sie verflogen.
Wohin, mein Jachl, wohin ist sie verflogen?
Mit der Hand beschattet er wieder und wieder die Augen, um deutlicher erkennen zu können, wenn eine wohlbekannte Kuppe in der Ferne emportaucht oder eine Waldeswand, deren Bäume sich wohl doch nicht wenig verändert haben. Breiter und höher sind sie geworden, grad wie der Schäfer. Aber dieselben sind sie doch geblieben; bei ihnen ist es bloß von außen, das Verändern.
So oft Jachl Verändertes sieht, sagt er dasselbe, nein, er ruft es: »Matten, Matten, haben wir es gut! In Berlin kommt einer beim Verändern selten gut fort. Zum Bessern verändert er sich nich, mehr zum Schlechten bei allem Zeitungslesen und Großtun und Geldverbrauchen und Nichtshaben. Matten! Matten! Um uns brauch‹ sich keiner mehr zu ängstigen.« –
— — — — — — — — —
Genau wie Jachl bei der Trennung von der Heide unglücklich gewesen ist, obwohl keiner da war, dem der Abschied von ihm schwer wurde, so ist heute niemand da, der seine Seligkeit mitempfindet. Kein Mensch. Das ist wahr. Aber an Menschen hat Jachl auch gar nicht gedacht, so oft seine Gedanken nach Hause flogen. Zu Hause ist er unter diesen zitternden Zweigen, die verlangend nach ihm zu greifen scheinen, wie Mutterhände. Und sonst hat er hier noch hundert »zu Hause«, ohne Vater oder Mutter oder Geschwister. –
Zuerst ist Jachl ganz langsam gegangen. Jetzt plötzlich hebt er seinen Jungen auf, um rascher weiter zu kommen. Nicht wegen Klas Hinnerk, dem Dienstherrn, hat er Eile, dem kommt er früh genug auch eine Stunde später. Und die Schnucken können auch noch ein bißchen warten. Nur Freude jagt ihn; zu sprechen hat er aufgehört. Ein paar Minuten hat er flöten müssen. Auf der Heide ist niemand, der Flöten verbietet. Nach dem Flöten ist das Singen gekommen und dann – das Schweigen.
Hügelauf, hügelab gehen sie. Jedesmal, wenn sie aufwärts steigen, scheint es Jachl, als käme er seinem Himmel wieder ein wenig näher.
Mit dem Himmel ist es ja wohl immer nur Einbildung, aber – wer an ihn glaubt, der hat ihn. –
