
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Berkenhagen, am 5. Mai
 Heute ist mein Geburtstag, mein siebzehnter Geburtstag! Von heute ab werde ich meine Erlebnisse aufzeichnen, Vater schenkte mir zu dem Zweck dieses Tagebuch. Ob ich wohl in diesem Jahre etwas erleben werde, etwas Großes, Herrliches? Was es eigentlich sein könnte, weiß ich zwar noch nicht recht; aber ich bin nun doch erwachsen, und Rose Timm, die rote Rose, wie Heinz sie ihrer rötlichen Haare wegen immer nennt, ist kaum ein Jahr älter und hat schon so viel erlebt. Sie hat sogar schon einen Heiratsantrag gehabt!
Heute ist mein Geburtstag, mein siebzehnter Geburtstag! Von heute ab werde ich meine Erlebnisse aufzeichnen, Vater schenkte mir zu dem Zweck dieses Tagebuch. Ob ich wohl in diesem Jahre etwas erleben werde, etwas Großes, Herrliches? Was es eigentlich sein könnte, weiß ich zwar noch nicht recht; aber ich bin nun doch erwachsen, und Rose Timm, die rote Rose, wie Heinz sie ihrer rötlichen Haare wegen immer nennt, ist kaum ein Jahr älter und hat schon so viel erlebt. Sie hat sogar schon einen Heiratsantrag gehabt!
Sie ist aber auch sehr hübsch, hat goldene Haare, eine Haut, weiß wie Schnee, rot wie Blut, dazu wunderschöne Aurikelaugen; ich bin eine dunkle Zigeunerin, die kein Mensch beachtet. Zu uns, auf unser stilles Berkenhagen, kommen auch so wenig Leute. Mama – ich nenne sie immer so, zu meiner Mutter, welche nun schon seit fünf Jahren im Himmel ist, sagte ich Mütterchen oder Mutting – Mama also ist immer sehr beschäftigt und hat keine Zeit zu müßiger Geselligkeit, wie sie sich ausdrückt. Sie ist aber sehr gut zu mir und giebt sich viele Mühe mit meiner Erziehung. Von morgen an will sie mich in die Geheimnisse des Haushaltes einweihen, um fünf Uhr früh soll ich bereit sein. Ach, ich fürchte, das Erwachsensein hat doch seine großen Schwierigkeiten! Nicht, daß ich etwa um meinen Morgenschlaf trauerte; nein, ich bin sehr gern zu früher Stunde auf. Aber ich wandere dann nicht gern durch Küche und Keller, sondern viel lieber durch Flur und Wald.
Wie herrlich war es heute draußen! Die Bäume und Sträucher hatten sich mit zarten, grünen Schleiern geschmückt, zwischen denen es überall von großen Diamanten blitzte und funkelte. Und wie sie flüsterten und sich tief vor mir neigten! Aurikeln, Veilchen und Maienglöckchen hatten sich erschlossen und sandten mir duftende Grüße; Schmetterlinge gaukelten auf mich zu, und eine Lerche stieg in die Höhe, grade über meinem Kopfe, und sang und trillerte.
Es war große Gratulationskur; ich nickte denn auch nach allen Seiten und rief erfreut: »Ich danke, ich danke recht schön!« Was sich nur Hektor, unser großer Bernhardiner und mein beständiger Begleiter, gedacht haben mag? Er sah mich höchst verwundert an und bellte herausfordernd nach allen Seiten.
Und wie lustig der kleine Bach plätscherte, welcher aus dem Park in den Wald führt, wie verlockend das klang, wie heimliches, neckisches Zureden! Ich mußte ihm folgen und war denn auch richtig bald mitten im frühlingsfrischen, duftenden Walde. Wie lange ich dort umherstrich, und was ich alles dabei dachte und träumte, weiß ich nicht mehr; aber plötzlich, ich glaube, es war mitten in einem Märchen, welches mir die Blätter zuflüsterten, merkte ich, daß ich Hunger, ganz prosaischen Hunger hatte, und machte mich auf den Heimweg.
Zu Hause im Eßzimmer war niemand; aber der Kaffeetisch stand noch gedeckt. Ich zündete den Spiritus unter der Wiener Maschine an, und während die Flamme lustig brannte, schrieb ich auf ein zufällig dort liegendes Blatt Papier ein paar Verse, die mir vorhin durch den Sinn geschwirrt. Ich war noch nicht weit gekommen, als sich die Thür öffnete.
»Da haben wir ja den Ausreißer,« rief Vater, »wo stecktest Du denn?« Er warf einen Blick auf meine Schuhe und drohte lächelnd mit dem Finger. »Wieder mal halb Berkenhagen an den Sohlen? War's nicht zu feucht draußen, Kleine, und hattest Du auch Hektor mit? Nun komm aber, kleine Landstreicherin, laß Dir endlich Glück wünschen zum Geburtstage und sieh Dir Deine Geschenke an!«
Er küßte mich, schlang seinen Arm um meine Schulter und führte mich so in das Nebenzimmer, wo auch Mama meiner bereits harrte. Dort war für mich aufgebaut. Die Blumenkrone mit wohlgezählten siebzehn Lichtchen, eine wunderhübsche kleine Uhr, verschiedene praktische Dinge, ein Kleid aus großgewürfeltem Stoff, welches anspruchsvoll über der Stuhllehne hing und mehrere schöngebundene Bücher! Ich griff zuerst nach letzteren: Heines Buch der Lieder; Geibels Gedichte; eine herrliche illustrierte Frithjofssage; und dieses reizende Tagebuch mit dem silbernen Vorhängeschlößchen.
Mama wehrte meinen stürmischen Dank ab. »Das ist Papas Geschenk, Hanna, von mir sind die nützlichen Sachen. Du weißt, Deine Mutter ist praktisch!«

Sie sprach die letzten Worte schon im Nebenzimmer, wo sie den Kaffeetisch abräumte, kam aber gleich wieder, einen Zettel in der Hand. »Dacht' ich's doch, Georg, die Hanna macht Gedichte!«
Ich wollte das unglückselige Blättchen an mich reißen, doch Vater hatte es schon in der Hand und las halblaut:
Sonne schrieb mit goldnem Strahl
Nun es hin auf Berg und Thal,
Lerche sang ins Herz es mir:
»Frühling, Frühling ist jetzt hier!«
Maienblumen dort im Garten
Wollen nun nicht länger warten,
Läuten all im Freudenchor:
»König Lenz zieht ein ins Thor!«
Bächlein, von der Haft befreit,
Ist zum Wandern gleich bereit,
Hat nun weder Rast noch Ruh,
Rauscht und flüstert immerzu:
»Bleibe nicht in enger Klause.
Grillen nur, die laß zu Hause,
Sonnenschein und junges Blut,
Ei, das taugt zum Wandern gut!«
Vater hob den Blick und drohte lächelnd mit dem Finger.
»Ei, ei, Kleine, der ganze Frühlingsapparat in Thätigkeit!
» Laß' sie nur gewähren, Dorchen,« wandte er sich dann an Mama, die ungeduldig daneben stand. »Das ist eine Kinderkrankheit, die wir alle überstanden haben!«
Mama schüttelte sehr entschieden den Kopf.
»Ich nicht; mich bitte ich auszunehmen. Ich würde Dir auch raten, Hanna, laß den Unsinn! Spaß kann es Dir nicht machen, es muß doch auch recht mühsam sein, immer grade den richtigen Reim zu finden, und wenn Du ein hübsches Gedicht lesen willst, hast Du die ›Blüten und Perlen‹ von der Polko und die neuen teuren Gedichtbücher da. Übe lieber fleißiger auf dem Klavier; es ist doch hübsch, wenn ein junges Mädchen zum Tanz aufspielen kann oder ein Lied begleiten. Du könntest ja auch später Lieschen und Grete darin unterrichten.«
Ich muß wohl ein sehr erschrecktes Gesicht gemacht haben, denn Vater zog mich zu sich heran und sagte: »Na, laß nur, Kleine, wir werden uns die Sache noch überlegen! Mit dem Klimperkasten stehen wir auf etwas gespanntem Fuße, was?«
Ich nickte energisch, und Mama meinte vorwurfsvoll: »Fräulein Meier kündigte ja auch deswegen!«
»Ja, sie war so empfindlich,« versuchte ich mich zu entschuldigen, »und nahm es so sehr übel, daß ich nicht das richtige Verständnis für ihre geliebte Musik hatte. Ich kann aber doch wirklich nicht dafür, daß ich regelmäßig einschlief, wenn sie mir in der Dämmerstunde irgend etwas von ihren Kompositionen vortrug; sie hatten alle so etwas Einlullendes.«
Mama schien die Wahrheit meiner Worte einzusehen; wenigstens sagte sie: »Im Grunde ist Dir das auch nicht zu verdenken, Hanna, und schließlich sind Musik und dergleichen Allotria doch sehr zu entbehren. Eine Hausfrau und jede, die es werden will, muß vor allen Dingen praktisch sein, und dabei sind Sonaten und Gedichte ganz überflüssig. Ist man erst verheiratet, hängt man doch all das unnütze Zeug an den Nagel; eine gute Suppe ist dem Manne lieber als das schönste Gedicht, und eine Hausfrau, welche ihre Zeit am Klavier oder gar am Schreibtisch vertrödelt, ist eben keine.«
Vater sah plötzlich sehr ernst aus, und ich mußte an mein Mütterchen denken. Auch bei ihr war der Haushalt stets wie am Schnürchen gegangen, und sie hatte doch immer Zeit gehabt zu heiterer Geselligkeit, zu einem Buche, zu einem Liede, vor allem aber zur Liebe für ihre kleine Hanna. Meine Mutter, mein liebes, schönes Mütterchen!
Vaters Blicke und meine trafen sich. Waren auch seine Augen feucht, oder schien es mir nur so durch die Thränen, welche mir heiß ins Auge stiegen?
Es klopfte. Der alte Briefbote brachte einen Brief und ein Packet für Fräulein Hanna von Berken auf Berkenhagen. Für mich? Wirklich für mich? Mama öffnete die Schachtel vorsichtig – der Bindfaden darf bei Leibe nicht zerschnitten werden – und ein wunderschöner Strauß kam zum Vorschein. Rosen in allen Farben und frisch und duftend, wie eben vom Strauch gepflückt. »Für Hans von Heinz!« stand auf dem Kärtchen, welches zwischen den Rosen hervorlugte.
Es ist doch zu lieb von Heinz, daß er an mich gedacht. Nur »Hans« sollte er mich nicht mehr nennen, das schickt sich nicht für meine siebzehn Jahre.
Der Brief war aus Rostock, von Rose Timm. Sie meldet sich für die nächsten Monate bei uns an. Das ist reizend! Rose ist allerliebst, voller Geist und Witz, und hat eine herrliche, sorgfältig geschulte Stimme. Ich kann ihrem Gesange stundenlang lauschen. Und alle haben sie gern bei uns; vom Vater, bis zu den »Druwäppeln«, wie sie Lieschen und Gretchen, meine kleinen Zwillingsschwestern, nennt, freut sich alles ihrer Ankunft. Es schlägt 10 Uhr, und ich bin so müde! Ach, morgen um 5 Uhr!
* * *
Am 28. Mai. Drei ganze Wochen sind vergangen, seit ich zuerst in diesen Blättern schrieb. Was sollte ich aber auch der Mit- und Nachwelt von mir berichten? Vielleicht, daß ich nun wirklich und wahrhaftig Mamas Adjutant geworden bin und als solcher zum Schrecken von Menschen und Tieren den halben Tag umherlaufe? Ich denke dabei nicht etwa an die schreckliche, blaue Schürze, die ich nun, »der Not gehorchend«, trage, sondern nur an meine hausfrauliche Thätigkeit. Ich bin nun in der That zum Perpetuum mobile, wie Heinz mich längst nannte, geworden; wenigstens repräsentiere ich »das Ding, das sich bewegt«, vom frühen Morgen bis zur vierten Nachmittagsstunde. Daß mir von da an der Tag allein gehört, hat mir Vater ausbedungen.
»Überall bin ich zu Hause, überall bin ich bekannt.«
Bald bin ich im Kuhstall und sehe dem Füttern der Kälber zu, bald handhabe ich, zum Entsetzen von Mamsell Minchen, den Kochlöffel, bald stehe ich mit weiser Miene inmitten klappernder Webestühle, bald auf der Bleiche, wo der schimmernde Lein so langweilig gerade wie ein endloser Gedankenstrich daliegt; fünf Minuten später klettere ich die Hühnerstiege hinauf, um gewissenhaft nachzusehen, ob nicht etwa eine der braven, ehrwürdigen Hennen aus Versehen einen Basilisken oder ein anderes schreckliches Fabeltier ausgebrütet hat, anstelle der süßen, goldgelben Küchlein. Ich glaube, Mama ist ziemlich zufrieden mit mir; sie hat mich wenigstens noch nie ernstlich getadelt, ausgenommen das eine Mal, als ich dem schwarzweißen Kälbchen, welches mir wie ein Hund nachläuft, den Kranz aus unsern schönsten Gartenblumen um den Hals gehängt hatte. Es sah zu possierlich aus, Lieschen und Gretchen waren ganz wild vor Vergnügen; Mama hat aber recht: das sind Kindereien, für die ich zu alt bin. Ich werde auch nicht mehr auf die alte Kastanie im Park klettern, um dort zu lesen.
Gestern wäre ich fast hinunter gefallen. Ich las in meinem Geibel und war so der Welt entrückt, daß ich meinen luftigen Sitz und die nötige Vorsicht ganz vergaß. Ich lese zu gern Gedichte und spreche sie gern laut vor mich hin. Mama darf es aber nicht hören, ihr ist meine poetische Schwärmerei sehr unangenehm.
Auch daß ich fast täglich mit Vater ausreite, findet sie nicht in der Ordnung. Eine Frau zu Pferde hätte immer etwas Unweibliches und würde früher oder später emanzipiert. Vater winkt mir dann aber gewöhnlich lustig mit den Augen zu, und ich schlüpfe in mein Reitkleid, lasse mir auf meinen Darling helfen, Papa schwingt sich auf seinen Braunen, und fort gehts in die schöne, weite Welt. Diese täglichen Spazierritte sind das schönste, was ich mir denken kann.
Vater ist dann ein ganz anderer wie zu Hause. Er ist so klug und weiß so wunderschön über Natur, Kunst und Wissenschaft zu sprechen; ich lerne in solchen Stunden mehr, als früher im ganzen Monat bei Fräulein Meier.
Gestern begegneten wir dem Oberamtmann Wagner, dem Vater von Heinz. Er war auch zu Pferde und begleitete uns eine Strecke.
»Na, Schwiegerdöchting,« rief er mir schon von weitem schallend entgegen – er nennt alle jungen Mädchen auf zehn Meilen in die Runde so – »wie schauts? Wieder ein Ende in die Höhe geschossen? Wird ganz wie Ihre Selige, Nachbar, genau dasselbe schmale Gesichtchen mit den dunklen Blitzaugen darin!«
Ich und meine schöne Mutter! Wo Onkel Wagner nur seine Augen hat! – Vater sah mich mit einem seltsamen Ausdruck an und strich hastig über seinen langen, blonden Bart, wie immer, wenn er erregt ist, und Herr Wagner beugte sich vor und klopfte ihm auf die Schulter.
»Na, lassen Sie, Nachbar, haben für guten Ersatz gesorgt. Musterfrau, das: das erste Gemüse, die ersten jungen Hühner und Enten giebts in Berkenhagen, und die meiste Butter geht von dort nach Berlin. Apropos Berlin! Da schreibt mir heute der Junge, der Heinz, daß er in diesem Sommer seine Ferienzeit nicht bei uns verleben wird. Will auf Reisen gehen, Berge sehen, auf die Alpen klettern, nach Italien, was weiß ich? Na, meinetwegen, auf ein paar Hundert Thaler soll es mir bei meinem Einzigen nicht ankommen. Die Trude hat mehr gekostet und geht mir auch jetzt als Frau Leutnant nicht von der Tasche. Er reist mit einem Freunde, Egon Tesmer oder Mesner, so wars doch? Es ist ein Studiengenosse, den er für den Rest der Ferien mit heimbringen will. Na, was sagst Du dazu, Schwiegerdöchting?«
Onkel Wagner wartete meine Antwort dieses Mal ebensowenig ab wie sonst und vertiefte sich mit Papa in die Vorzüge seiner neuen Dreschmaschine. Ich ritt schweigend daneben und schaute geradeaus in die Sonne, welche soeben blutrot hinter dem Walde unterging. Ich weiß nicht: kamen mir davon die Thränen ins Auge, oder von dem Gehörten? Ich fand es sehr unrecht von Heinz, daß er nicht kommen wollte, ich hatte mich schon so sehr darauf gefreut, und geradezu rücksichtslos fand ich es, daß er noch gar beabsichtigte, einen Freund mitzubringen. Wir waren doch immer wie zwei gute Kameraden durch Feld und Wald geschweift, hatten auf dem Teich im Walde gerudert und Wasserrosen gepflückt, zu Fuß und zu Pferde weite Ausflüge macht, – was sollte nun der Dritte dabei? Ich nahm mir vor, recht unfreundlich gegen diesen Herrn Tesmer oder Wesner zu sein, und Heinz sollte auch schon merken, wie abscheulich ich sein Benehmen finde. Aber nein, mir fiel plötzlich ein, daß ich nun doch erwachsen bin und unmöglich nach alter Art mit Heinz verkehren darf. Mama hat schon, als er das letzte Mal hier war, bedenklich den Kopf geschüttelt. Wenn Herr Tesmer uns denn doch nicht stört, kann er getrost erscheinen, meine gütige Erlaubnis hat er.
In den nächsten Tagen kommt nun auch Rose. Ihr Vater, Herr Justizrat Timm in Rostock, Papas Jugendfreund, geht wie alle Jahre ins Bad, und da er Witwer ist, so ist es ihm sehr lieb, Rose für diese Zeit stets bei uns zu wissen.
* * *
Den 10. Juni. Heute kam meine Freundin, ich war selbst mit den Ponnies zur Bahnstation gefahren, sie zu empfangen. Rose ist größer geworden, seit ich sie zuletzt gesehen, größer und voller, und sah in der eleganten, grauen Reisetoilette mit dem lichtgrauen Schleier, welchen sie phantastisch um den Kopf geschlungen, bildschön aus. Ich sagte ihr das auch, als wir erst im Wagen und auf dem Heimwege waren.
Sie sah mich verstohlen an, stieß mich leicht mit dem Sonnenschirm in die Seite und fragte: »Du, Hanna, muß ich das Kompliment sofort zurückgeben?«
Ich lachte. Sie hat etwas ungemein Drolliges in ihrem Wesen. »Mir, Rose? Ach nein, belaste meinetwegen Dein Gewissen nicht mit einer Lüge; ich weiß recht wohl, welch Aschenbrödel neben Prinzessin Wunderhold sitzt.«
Sie fuhr in die Höhe, daß die dicken Ponnies einen erschreckten Seitensprung machten, »Hanna! Hanna von Berken auf Berkenhagen, – wie wunderbar feudal das klingt – kannst Du mir schwören, daß Deine soeben gesprochenen Worte der wahre Ausdruck Deines jungfräulichen Herzens sind?«
Ich nickte lachend, und sie schaute mit gefalteten Händen starr in die Höhe, »habt Ihr's gehört, Ihr Himmlischen? Da sitzt nun eine Jungfrau neben mir, was sage ich, eine Huldin, mit Augen wie ein unergründlicher See, mit Zähnen wie eine Perlenschnur zwischen Rosen, mit den schwersten, glänzendsten Zöpfen von der Welt – daß sie letztere in einen abscheulichen Knoten geflochten, dazu einen Hut trägt, den meine Großmutter, unbeschadet ihrer Würde, aufsetzen könnte, und ihre tannenschlanke Gestalt in dieser entsetzlichen, blau und grün gewürfelten Hülle birgt, verzeihe ihr, Aphrodite, Göttin der Schönheit! – und erklärt mir mit dem ernstesten Gesicht von der Welt, daß sie nicht wisse, wie schön sie sei! Ach, und ich armes, kleines, hintergangenes Geschöpf! Ahnungslos komme ich hier an, ohne Furcht vor Rivalinnen, die mir meine schönsten Triumphe rauben werden. O, Hanna! Hanna von Berken, daß Du mir das anthun konntest, so schön zu werden! Es ist Verrat an alter Freundschaft!«
Ich hörte ihr lachend zu. »Beruhige Dich nur, Röslein! Ich begebe mich hiermit feierlich aller Ansprüche auf Deinen Herrscherthron, bezaubere nur Du nach wie vor alles und alle.«
Sie bog sich vor und schaute mir von unten auf mit ihren lachenden Augen ins Gesicht. »Alle, auch Deinen Heinz, Deinen Ritter sans peur et sans reproche, und die edlen Söhne des Mars, die bald einen Ansturm auf unsere armen Herzen unternehmen werden? Du weißt doch, daß in nächster Zeit das große Manöver hier in Eurer Gegend abgehalten wird?«
Freilich wußte ich's. Wir haben viel Einquartierung zu erwarten, es wird viel Wirrwarr und Arbeit für Mama und Mamsell Mienchen geben; an die Herren Offiziere aber, mit denen wir dabei in Berührung kommen könnten, hatte ich noch gar nicht gedacht.
Rose schaute mich verwundert an, als ich ihr das gestand.
»Na, hör' mal, Hanna,« sagte sie, »das muß ich sagen, du bist ein merkwürdiges Exemplar der Spezies Femina. Mir schwirren schon allerhand Pläne durch den Kopf, wie ich mich des schönsten Jünglings, der jemals Epauletten trug, versichere, die entzückendste Toilette begleitet mich in Erwartung eines etwaigen Tanzfestes,« – aha, daher die beiden Riesenkoffer, die auf der Bahnstation der Abholung harren! – »und Du hältst ganz gelassen die Zügel und sagst: Daran dachte ich nicht. Woran denkst Du denn? An Deinen Heinz? Wie gehts denn dem Herrn Professor in spe? Er kommt doch nächstens?«
»Leider nein! Denke Dir, Rose, er wird die Schweiz besuchen oder Italien, und später bringt er seinen Reisegefährten, einen Studienfreund, mit nach Hause.«
Rose klatschte in ihre weißen, kinderkleinen Hände.
»Das ist ja reizend, das ist vernünftig von dem Heinz! Nun habe ich doch auch einen Kavalier! Im Vertrauen, Liebchen, man kommt sich bei Euch beiden immer etwas überflüssig vor, nun ist dem Uebel abgeholfen! Euer Boot ist doch gut imstande, ein funkelnagelneues Croquetspiel bringe ich mit. Und für die Zwillinge Puppen, Hanna, entzückend sag ich Dir! Wie gehts denn Mining und Lining, den Druwäppeln? Sind sie noch immer so dick und so blond und so rosig, die possierlichen kleinen Dinger? Für Dich habe ich auch etwas, kühne Amazone, für Dich und Deinen armen Darling: eine Reitpeitsche mit silbernem Griff; aber bitte, vergiß es bis morgen, wo ich auspacken werden. Und die heilige Cäcilie, Deine alte, langweilige Meier, hast Du richtig weggegrault? Das hätte ich Dir gar nicht zugetraut, Tugendspiegel Du, dafür verdienst Du einen Extrakuß!«
So sprudelte es immer weiter von Roses roten Lippen, bis unser Haus in Sicht war. Vater stand auf der Terrasse und schwenkte grüßend den Hut, die Zwillinge hielten ihre großen Rosensträuße in die Höhe, und Mama zündete den Spiritus unter der Wiener Kaffeemaschine an. Alle freuen sich Roses Ankunft, ich aber doch am meisten.
* * *
Den 20. Juni. Schade, daß Rose so wenig konsequent ist. Es war zu hübsch in der ersten Woche ihres Hierseins, als sie meine Wirtschaftspflichten mit mir teilte. Sie hatte sich ein blaues Leinenkleid mit kurzen Ärmeln, eine große weiße Schürze und ein Paar derbe Schuhe mitgebracht und präsentierte sich in diesem Kostüm, welches sie allerliebst kleidete, am Morgen nach ihrer Ankunft.
»Ik wull Sei bidden, gnä Fru, wat Sei nich'n Käksch gebruken känen?« fragte sie mit tiefem Knix und zupfte so verlegen an den Krausen ihrer Schürze, daß wir alle hell auflachten.
»Eine Köchin gerade nicht,« antwortete Mama, »aber wenn Sie sich mit Hanna zusammen ein wenig der Wirtschaft annehmen wollen, soll es mir recht sein. Sie haben keine Mutter, liebe Rose, welche Sie auf Ihren zukünftigen Beruf als Hausfrau vorbereitet, ich will es recht gern thun.«
Rose hatte wohl die Sache nicht so ernst gemeint, mehr als eine angenehme Abwechselung betrachtet; aber Mama versteht nun einmal in solchen Dingen keinen Spaß und hielt sie tapfer an. Vorerst mit dem schönsten Erfolge.
Ihre neue Elevin stürzte sich mit Feuereifer in die Wirtschaft; es war merkwürdig, mit welchem Geschick, wie flink und leicht ihr alles von der Hand ging. Mama war entzückt, aber leider nicht auf lange. Mit dem Frühaufstehen ging es immer schlechter, und schon nach einer Woche erklärte mir meine Freundin, daß man sie hinfort »früh morgens, wenn die Hähne krähen«, nur tot aus ihrem Bette bekäme, von selbst würde sie vor 9 Uhr nicht aufstehen, das schwöre sie hiermit feierlich bei Morpheus und allen anderen Göttern des Himmels und der Erde.
»Und Dein Leinenkleid, Rose, und die Zukunftshausfrau?« versuchte ich, ihr Gewissen zu wecken.
»Beides macht mir keine Sorge, mein getreuer Eckhardt! In dem Kleid mag Dürten ihren Schatz bezaubern, und was die Hausfrau in futuro anbetrifft, so hoffe ich, ihr einstiger Herr und Gebieter ist so vernünftig, einzusehen, daß diese meine beiden Hände durchaus nicht für Kasserollen und Kochlöffel geschaffen sind.« Dabei betrachtete sie ernsthaft ihre schlanken, zarten Händchen und rieb die rosigen Nägel mit dem Battisttüchlein. »Nur eins ist mir fatal bei der Sache. Ich weiß nicht, wie ich mich bei Deiner Mama entschuldigen soll, sie nimmt alles, was mit dem Haushalt zusammenhängt, so ungeheuer tragisch.« Sie fuhr in die Höhe und schlug ein Schnippchen. »Ach, ich hab's! Ich leide an Migräne, das Frühaufstehen schadet meiner zarten Gesundheit!« Sie sah mich frohlockend an, hielt sich dann aber plötzlich beide Ohren zu. »Nur keine Moralpredigt, Hänschen! Ich vergaß ganz, zu wem ich spreche. Sag' mal, Schatz, ist Dein Gewissen noch immer so rein und zweifelsohne wie früher, oder hast Du bereits vom Baume der Erkenntnis gekostet und siehst ein, daß man ohne ein bischen Flunkerei durchaus nicht fortkommt in dieser bösen Welt? Mach' doch nicht so strenge Augen, Kind! Gestehe selbst, ist es nicht hübscher, wenn ich mir ein wenig Kopfschmerz andichte, als wenn ich heute vor Deine Mama trete: Frau von Berken, es ist sehr schön von Ihnen, daß Sie mich in die Mysterien Ihrer Küche nun einweihen wollen; aber ich muß ergebenst danken, die Sache ist nun einmal nicht nach meinem Geschmack.«
Ich mußte lachen, man kann ihr nicht böse sein. Ich glaube übrigens, sie ist glücklicher daran, als ich mit meiner pedantischen Ehrlichkeit; aber ich fürchte, ich ändere mich darum doch nicht und behalte diesen Widerwillen gegen alles, was nur die Lüge streift. Rose hält aber Wort; bis zur zehnten Morgenstunde bleibt sie unsichtbar und geht unserer Küche so ängstlich aus dem Wege, als wenn nicht unsere alte, brave Mamsell darin schaltete und waltete, sondern Cerberus, der achtköpfige Höllenhund, ihre Schwelle bewachte. Mama war anfangs erzürnt über die Treulose und stellte ihr ein durchaus nicht schmeichelhaftes Prognostikon für die Zukunft; doch ficht Rose das wenig an, sie ist lustig und ausgelassen, tollt mit den Zwillingen umher, die wie die Kletten an ihr hängen, liegt stundenlang in der Hängematte oder läuft ans Klavier und singt und jodelt mit ihrer süßen Stimme, daß man ihr wie verzaubert lauschen muß. Ich höre sehr gern ernste Lieder von ihr. Sie singt dieselben mit einer Kraft des Ausdrucks, mit einer Leidenschaft, die bei ihr frappiert, so sehr steht diese im Gegensatz zu ihrem sonstigen lachenden Wesen. Vater hörte ihr neulich zu, als sie das herrliche: »Am Meer« von Schubert sang, und fragte, als sie geendet: »Welches ist nun eigentlich Ihr wirkliches Gesicht, kleine Rose? Das des lustigen Pucks, welches wir sonst erblicken, oder dasjenige, welches soeben mit düsteren Augen zwischen den Klängen des herrlichen Liedes auftauchte?«
Sie schwieg einen Augenblick, dann glitten die schlanken Finger wieder über die Tasten, und ein langgezogener Jodler klang so hell und melodisch durch das Zimmer, daß Vater wie elektrisiert in die Hände klatschte: »Bravo, Rose, das Gesicht behalten Sie!«
* * *
Den 4. Juli. Seit einer Woche ungefähr sind unsere militärischen Gäste im Hause: außer einer kleinen Schar Gemeiner, der Oberst mit seinem Adjutanten. Letzteren betrachtete ich anfangs mit kollegialischen Blicken – ich bekleide ja dieselbe Charge, wenn auch nur unter Mamas Fahne – doch, wie ich gestehen muß, ohne daß es den geringsten Eindruck auf Herrn Leutnant Linke hervorbrachte.
Er hat nur Augen für Rose, meine schöne Freundin. Auch der Oberst, ein Baron von Scholten-Wenkheim, ein älterer, unverheirateter Herr mit gelichtetem Scheitel, aber strammer, soldatischer Haltung, scheint nicht unempfindlich für ihren Liebreiz zu sein; wenigstens folgte er schon vom ersten Tage an jeder ihrer Bewegungen unablässig mit seinen etwas hervorstehenden, wasserhellen Augen. Sie achtet wenig darauf, sie unterhält sich fast ausschließlich mit dem bildschönen, jungen Offizier, dessen treuherzige, braune Augen sich immer tiefer in die ihren senken, und ist bei allen Ausflügen, welche wir zu Wagen, zu Pferde und zu Fuß unternehmen, fast immer an seiner Seite. Die beiden schönen jungen Menschen sind aber auch wirklich wie für einander geschaffen. Röslein, rotes Röslein, sollte Dich hier Dein Geschick ereilen?
Ich spiele eine sehr bescheidene Rolle in den Stunden, in welchen die Herren unserm kleinen Kreise angehören. Wenn man sich auch aus Höflichkeit hin und wieder an mich wendet, verstehe ich nur einsilbig und schüchtern zu antworten; desto mehr aber bewundere ich Roses Grazie, ihren Geist und sprudelnden Witz, der sich jetzt im Verkehr mit den beiden Herren erst recht offenbart.
* * *
Den 10. Juli. Was nur Rose haben mag! Sie ist seit einigen Tagen, seit einer Gondelfahrt, welche sie in des Adjutanten Begleitung unternahm, wie ausgetauscht. Bald fieberhaft lustig, bald sanft und weich, wie ich sie nie gesehen. Aber warum weicht sie plötzlich jeder Annäherung des Leutnants aus und ist eine so interessierte Zuhörerin bei den Schilderungen des Barons? Letzterer hat große Reisen gemacht, viel gesehen und erlebt, und weiß gut darüber zu sprechen; aber mir wäre es doch kein angenehmes Gefühl, ihn nur meinetwegen so angeregt plaudern zu hören, und seine kalten, hellen Augen so unverwandt auf mich gerichtet zu sehen. Gestern abend hatte Rose mit Leutnant Linke, welcher einen klangvollen Bariton besitzt, Duette gesungen. Ich saß wie gewöhnlich in meinem Winkel, dem Flügel gegenüber, und hatte bemerkt, wie glühend seine Blicke während des Singens auf dem schönen Gesicht seiner Partnerin ruhten. Auch Rose hatte es gesehen, sie war für einen Moment wie in rosige Glut getaucht; dann wurde sie plötzlich ganz blaß, stand auf und erklärte, aufhören zu müssen: sie sei ermüdet. Den Rest des Abends unterhielt sie sich dann aber doch lebhaft mit dem Obersten und streifte nur hin und wieder mit scheuem Blick den jungen Offizier, der auffallend bleich und still daneben saß. Ich fragte sie später, als wir wie gewöhnlich vor dem Schlafengehen plauderten, wer ihr denn eigentlich sympathischer wäre, der ältere oder der jüngere unserer Gäste. Sie wurde purpurrot und senkte die Augen.
»Wie Du nur so fragen kannst, Hanna; ist Linke nicht das Ideal eines Mannes?«
Ich sah sie erstaunt an. »So bezaubert bist Du, Rose? Das vermutete ich nicht, ich glaubte vielmehr in den letzten Tagen, der Oberst hätte seinem Adjutanten auch in Deinem Herzen den Rang abgelaufen.«
Sie schob mich mit beiden Händen von sich und sah mich durchdringend an. »Bist Du denn wirklich so harmlos, großes Mädchen?« fragte sie. »Im Walde, in ihren Büchern weiß sie Bescheid, aber nicht in solchem kleinen Mädchenherzen!«
Sie küßte mich zärtlich und schlüpfte in ihr Bett. Einmal lachte sie noch auf: »Baron von Scholten lieben!« und dann war sie still; aber als ich nach einer Stunde aus festem Schlafe auffuhr, weil der Hofhund aus irgend einem Grunde angeschlagen, war es mir, als klinge leises Schluchzen von ihrem Lager. Ich hatte mich aber wohl getäuscht, es blieb alles still auf meinen Zuruf, und andern Morgens war Rose frisch und rosig wie immer.
* * *
Den 15. Juli. Es giebt einen Ball, trotz 20 Grad Reaumur im Schatten einen richtigen, großen Ball, die Offiziere wollen sich, bevor sie scheiden, mit demselben ihren Gastfreunden in Stadt und Land erkenntlich zeigen.
Ich freue mich kindisch darauf, ich habe so viel von dem Zauber des ersten Balles gehört, von diesem Meer von Licht, Duft und Tönen, ich denke es mir reizend, auch einmal darin umherschwimmen zu dürfen.
Wenn nur Rose gerade jetzt nicht so eigentümlich wäre! Stundenlang kann sie, ohne ein Wort zu sprechen, im tiefsten Winkel einer Laube sitzen, um plötzlich aufzuspringen, mit den Kindern umherzujagen, zu lachen und zu scherzen. Von dem, was in ihr vorgeht, spricht sie nie; nur heute, als sie meinen besorgten Blick fühlen mochte, legte sie mir stürmisch die Hand über die Augen und flüsterte mir ins Ohr: »Sieh mich nicht so an, Hanna, Deine Augen thun mir weh!« Auch von dem Tanzfest spricht sie nie, und ich weiß doch, wie leidenschaftlich gerade sie Musik und Tanz liebt.
* * *
Den 18. Juli, 2 Uhr morgens. Mein erster Ball! Wie lebhaft, wie freudig hat er meine Phantasie beschäftigt, und nun wünschte ich, ich könnte ihn aus meinem Gedächtnis streichen, könnte vergessen, wie unglücklich ich mich in den jüngst verflossenen Stunden fühlte!
Ob mir das wohl jemals gelingen wird? Vielleicht einst nach vielen, vielen Jahren, vorläufig erscheint es mir unmöglich.
Aber ich will mich zwingen, ordentlich zu berichten. Vater sagte neulich, man müsse gerade das Unangenehme mutig ins Auge fassen, unter halb geschlossenen Liedern sähe alles doppelt trübe aus.
Daß mich der Gedanke an den Ball durchaus nicht kalt ließ, habe ich bereits geschildert; ich hatte rechtes, echtes Ballfieber. Trotzdem hatte ich mich um die Toilettenfrage wenig gekümmert.
»Weißer Battist ist in der Mode und haltbar, nicht so empfindlich wie Tüll oder Gaze, worin man schon nach dem ersten Tanze unordentlich aussieht,« lautete Mamas Ausspruch. Eine grüne Schärpe und dazu passende Schleifen besaß sie noch aus ihrer Mädchenzeit, und Blumen zum Kranz bot der Garten in Hülle und Fülle. Ich hatte allerdings im Stillen allerlei Bedenken. Solch bläuliches, hartes Weiß erschien mir nicht passend für meinen blassen, dunklen Teint, grüne Schleifen ebensowenig; aber Mama mußte doch schließlich dergleichen besser verstehen als ich Neuling in solchen Dingen.
Sie gab sich auch sehr viel Mühe mit mir. Den Kranz band sie selbst mit großer Sorgfalt, und als es gestern, am Ballabende, dämmerte, rief sie mich in ihr Zimmer, wo sie mich selbst zurechtstutzen wollte. Meine Toilette dauerte lange. Mein Haar ließ sich so schwer bändigen; besonders die kurzen Löckchen, welche sich stets so eigenwillig um Stirn und Nacken kräuseln, wichen erst nach langem Widerstand den sehr energischen Angriffen von Bürste und Pomade. Endlich war auch das überstanden. Mama warf mir das Kleid vorsichtig über, befestigte den Kranz mit unzähligen Nadeln, steckte, zupfte und strich an mir herum und atmete endlich befriedigt auf.
»So, Hanna, nun ist alles in Ordnung! Ich wette, Du bleibst bis zum Schlusse des Balles so, es sitzt wie angenagelt. Ich kenne aber auch nichts Häßlicheres, als eine Tänzerin, die nach dem ersten Walzer den Kranz verliert und sich nach dem zweiten die Zöpfe feststecken muß. Hoffentlich macht sich auch Rose sehr ordentlich, ich werde doch einmal nach ihr sehen müssen.«
Vater steckte den Kopf ins Zimmer. »Kinder, hoffentlich seid Ihr so weit, es ist angespannt!« Er zog sich wieder zurück, und ich half Mama in ihr Blauseidenes, als Rose hereintrat.
Sie sah märchenhaft schön aus. Ein seegrünes Kleid von durchsichtigem Stoff mit langer Schleppe, die schimmernden Haare in wehenden Locken, aus denen wie verloren ein paar halberschlossene, weiße Rosen hervorblühten, die schneeweißen Schultern und Arme entblößt. Als sie mich sah, stutzte sie und wurde dunkelrot.
»Hanna, was hat man aus Dir gemacht? Aber Frau von Berken, so kann Hanna doch unmöglich bleiben, die Frisur entstellt sie, und der schwere, dicke Kranz – Geschwind, Herz, setze Dich, wir wollen gut machen, was noch gut zu machen geht. Dein Prachthaar bringen wir in zwei Zöpfe, statt des Kranzes ein paar rote Rosen –«
Sie hatte bereits die langen, durchbrochenen Seidenhandschuhe abgestreift und wollte die Nadeln aus meinen Flechten nehmen, doch Mama hinderte sie daran.
»Aber, Rose, was fällt Ihnen ein? Dazu habe ich mir so viele Mühe mit dem Kinde gegeben? Hanna sieht sehr ordentlich und sauber aus, und das ist die Hauptsache.«
Fritz knallte schon zum dritten Male mit der Peitsche, Papa erschien von draußen am Fenster und hielt wortlos seine Uhr dagegen. Ich legte rasch den Mantel um. Vorher freilich hätte ich noch gern einen Blick in den Spiegel geworfen, doch Mama stand davor, um den Spitzenaufsatz mit den blauen Federn auf dem Kopfe zu befestigen.
Bevor wir das Zimmer verließen, schloß mich Rose heftig in ihre Arme. »Verzeih, Hanna, Du bist so gut, und ich eine erbärmliche Egoistin. Wie konnte ich nur leiden, daß man Dich so herausstaffiert!«
»Ist es so schlimm, Rose?«
Sie nickte traurig, und ich saß beklommen da in meinem, bei der geringsten Bewegung laut rauschenden Kleide.
Endlich hielt der Wagen im Nachbarstädtchen, und endlich konnte ich in der Garderobe einen Blick in den Spiegel werfen. Ich fuhr zusammen: so arg hatte ich's mir doch nicht gedacht. Mein Gesicht hob sich dunkel ab von dem bläulich weißen, hoch am Halse geschlossenen Kleide, welches mir überall zu groß und zu lang war; der gleichmäßig dicke Rosenkranz saß in der That wie angenagelt auf dem straffgezogenen, pomadeglänzenden Haar. Ich biß die Zähne zusammen und folgte, wie im bangen Traume, an Roses Seite den Eltern in den festlich geschmückten, hell erleuchteten Saal.
Ach, wenn ich doch entfliehen könnte, wenn ich doch zu Hause wäre in meinem Stübchen oder im Park hoch oben auf der alten Kastanie! Was sollte ich denn hier unter all den schönen, geputzten Mädchen und Frauen?
»Darf ich um die Polonaise bitten, mein gnädiges Fräulein?«
Der Adjutant bot mir seinen Arm, wir gingen unweit hinter dem Obersten, der Rose führte. Mein Kavalier wandte keinen Blick von letzterer. Er sprach wenig mit mir, sein Gesicht war blaß, und seine Hand glühte förmlich durch den weißen Handschuh.
Als der Tanz beendet, und er mich zu meinem Platz geführt, wandte er sich sofort zu Rose. Er mußte sich den Weg zu ihr förmlich bahnen: Herren, ältere und junge, in Uniform und Civil, bildeten eine Mauer um sie. Zu mir fand niemand den Weg. Zwei junge Leutnants, die Oberst von Scholten mir zuführte, tanzten mit schlecht verhehlter Verdrossenheit ein paar Mal mit mir herum, ohne wiederzukehren, ebenso einer oder der andere der mir oberflächlich bekannten Gutsherren der Umgegend.
»Also das ist Hanna von Berken,« hörte ich ein junges Mädchen in meiner Nähe sagen, »so häßlich hätte ich mir sie doch nicht gedacht.« – »Aber Geschmack scheint sie zu besitzen,« lachte eine andere spöttisch. »Sieh nur die Toilette! Wie duftig und kleidsam!«
Ich kam mir wie eine Ausgestoßene vor, ich hätte sterben mögen vor Scham und Traurigkeit. Wenn doch Heinz hier wäre! Doch der ist ja in weiter Ferne, und wäre er hier, würde er auch nicht mit dem großen, häßlichen Mädchen tanzen wollen, welches niemand beachtet.
Meine Mutter stand mir plötzlich vor Augen. Sie war auch einmal zum Balle gefahren, in weißer Seide, mit Perlen in den dunklen Flechten. Wie schön sie ausgesehen hatte! Ich wußte es noch, als hätte ich sie gestern erblickt. Sie sagen alle, ich sehe meinem toten Mütterchen ähnlich. Ob ich wohl auch so aussehen könnte, wie sie damals?
Vater stand vor mir. »Nun, meine Kleine,« fragte er etwas unsicher, »wie gefällt es Dir? Ist es hübsch hier?«
Ich sah ihn traurig an. »Ach nein, Vater, ich bin so häßlich, niemand mag mit mir tanzen.«
Ihm stieg das Blut ins Gesicht, seine Hand strich hastig seinen blonden Bart. »Du bist nicht häßlich, mein Liebling, nur Dein Anzug ist es!«
Er setzte sich neben mich – fast alle meine Nachbarinnen tanzten – und nahm meine Hand. »Sieh nicht so traurig aus, mein kleines Mädchen, der nächste Ball wird desto fröhlicher, glaub's sicher. Wollen wir jetzt nach Hause?«
Ich sah dankbar zu ihm auf. »Ach ja, lieber Vater!«
Der Tanz war zu Ende, und Rose eilte auf uns zu. »Lieber Herr von Berken, wollen wir nicht nach Hause? Ich sah vorhin im Vorübertanzen: Ihre Frau hat schon ganz kleine Augen, und wir sehnen uns auch nach unserm Stübchen, nicht wahr, mein Liebling? Ich mache mir Deinetwegen solche Vorwürfe,« flüsterte sie mir ins Ohr, »Du hättest hier die Schönste sein müssen, wenn ich nicht so schlecht gewesen wäre! Aber es ist schon so,« murmelte sie wie zu sich selbst, »ich bringe Unglück denen, die mich lieben.« Dabei flog ihr glühender Blick durch den Saal und wandte sich im jähen Erschrecken ab, als Linkes Augen sie trafen.
»Komm, Hanna,« sagte sie rauh, »wir wollen uns bereit machen.«
Am Wagen warteten bereits, außer Vater, der Oberst und sein Adjutant, um sich von uns zu verabschieden; da sie zu den Gastgebern gehörten, durften sie nicht mit uns zugleich das Fest verlassen. Im Einsteigen hörte ich Linke sagen:
»Also um 7 Uhr, Rose? Ist es eine rote, bin ich der seligste aller Menschen!«
Wir legten die einstündige Heimfahrt schweigend zurück. Mama war sofort eingeschlafen, und Rose lehnte lautlos in ihrer Ecke.
Zu Hause angekommen, begab sie sich sofort zur Ruhe, und ich warf mein Morgenkleid über, ging ins Nebenzimmer und schrieb bis jetzt, wo die goldenen Sonnenstrahlen neckisch über die Blätter hüpfen. Ich stehe auf, ziehe die Vorhänge auseinander und öffne das Fenster. Eine Wolke von Blumenduft schwebt eilig, als hätte sie nur um die Erlaubnis dazu gewartet, ins Zimmer; ein vielstimmiges Zwitschern, Flöten, Trillern und Jubilieren dringt an mein Ohr, und die Sonne steht strahlend am blauen Himmel und lacht mir zu, als wollte sie sagen: »Thörichte, kleine Hanna, sieh Dich doch um, wie schön Gottes Welt ist, wie der Schöpfer sie geschmückt hat zum Entzücken der Menschen! Und Du willst klagen, willst unglücklich sein, weil Deine kindischen Erwartungen sich nicht erfüllten, Deine Eitelkeit einen etwas harten Stoß erlitten?«
Ich kann nicht anders, ich muß die Feder hinlegen und hell auflachen.
Ja, mein Gott, warum hielt ich mich denn noch eben für ein so unglückseliges Menschenkind? Weil mein Kleid nicht hübsch, mein Kranz angenagelt war, und infolgedessen die schmucken Leutnants nicht mit mir tanzen wollten? Ach, war mir denn aber an einem dieser Herren etwas gelegen, oder an Herrn Otto Hofer, Herrn von Malwitz, und wie unsere jungen Gutsnachbarn sonst noch heißen mögen? Ja, wenn Heinz mit dabei gewesen, wenn auch er seinen kleinen Kameraden verleugnet hätte; aber so –? Jetzt habe ich aber gewissenhaft genug Väterchens Rat befolgt. Mit offenen Augen habe ich mein erstes, so sehr mißlungenes Debüt im Ballsaal betrachtet, mehr kann ich mir nicht zumuten, ohne daß mir die Augen zufallen. Geschwind also zu Bett, um die versäumte Nachtruhe einzuholen!
Guten Morgen und schönsten Dank, Frau Sonne! Guten Morgen, ihr Bäume und Sträucher, Blumen und Vöglein! Auf fröhliches Wiedersehen in ein paar Stunden!
* * *
Am Abend desselben Tages. Wie schnell ich heute morgen einschlief! Viel schneller als es einem vor ein paar Stunden noch höchst unglückseligen Mauerblümchen von Rechts wegen zukam.
Ich hätte wahrscheinlich den halben Tag verschlafen, wenn nicht ein böser Traum für das Erwachen gesorgt hätte. Ich fuhr mit Rose in der Gondel auf unserm kleinen See, der verschwiegen mitten im Walde liegt. Sie trug noch das meergrüne, durchsichtige Gewand, in welchem ich sie zuletzt gesehen, und pflückte Wasserrosen, mit denen sie ihre Locken schmückte. Plötzlich wurde das Wasser unruhig, wogte und wallte, zwei Hände griffen daraus hervor über den Rand des Kahnes und zogen Rose zu sich hinab in die Wellen. Sie schrie laut, wimmerte dann noch leise und – dann war alles still.
Gottlob, der Alp löste sich von meiner Brust, ich erwachte.
Aber träumte ich denn wieder, oder war es wirklich ein unterdrücktes Schluchzen, welches jetzt an mein Ohr drang.
Ich öffnete weit die Augen – was war das?
Mitten im Zimmer stand Rose im langen, weißen Nachtkleide, das bis auf die kleinen, nackten Füße fiel, in der Hand den Blumenstrauß, den ich gestern, wie alle Tage, in unser Zimmer gestellt. Eine vollerblühte, rote Rose hatte sie daraus hervorgezogen und drückte sie wild, unter leidenschaftlichem Schluchzen wieder und wieder an ihre Lippen, plötzlich aber warf sie dieselbe mit einer Geberde, die ihr schönes Gesicht entstellte, zur Erde, löste langsam eine weiße Rose aus dem Strauß, stellte sie in ein Glas und schob dasselbe zwischen die dichten Vorhänge des Fensters.
Ihre letzten Bewegungen waren wie die einer Nachtwandlerin gewesen; nun richtete sie sich auf, warf einen scheuen Blick durch die Spalte des Vorhanges, taumelte zurück, sank in die Kniee und verbarg ihr Gesicht in den Händen.
»Rose! Um Himmelswillen, Rose, was ist Dir?« schrie ich auf.
Sie fuhr in die Höhe, schaute mit irrem Blicke um sich und kam langsam, schleppenden Schrittes näher. Ich schaute in ein so leichenhaft blasses Gesicht, in zwei so erloschene Augen, daß ich in meiner Angst laut zu weinen anfing. Rose sah mich erst groß an, dann setzte sie sich müde auf den Rand meines Bettes.
»Warum weinst Du, Hanna? Mir ist nichts; ich habe nur soeben meine Liebe begraben.«
Mir fielen des Adjutanten Abschiedsworte ein. »Linke? Die rote Rose!« stammelte ich.
»Ja, er wollte endlich eine Antwort auf die Frage haben, die er damals auf dem See, weißt Du, an mich richtete. Ich sollte ihm die rote Rose ans Fenster stellen, nun ist es eine weiße geworden. Er hat sie bereits gesehen, er stand soeben drüben am Pavillon; wie ein Gespenst starrte er herüber.«
Wieder schlug sie die bebenden Hände vors Gesicht. Ich zog sie sanft hinunter. »Rose, liebe Rose, liebst Du ihn denn nicht?«
Sie glitt von dem Bette, sank in die Knie und schluchzte, daß ihr zarter Körper, wie vom Sturm geschüttelt, bebte. Nach einer Weile richtete sie sich auf. »Verzeih, Hanna, ich ängstige Dich!«
Sie lehnte ihren Kopf an meine Schulter. »So, nun will ich sprechen! Er liebt mich, Hanna, – und ich? Kannst Du Dir vorstellen, daß ein Blick, der erste Blick aus fremdem Auge wie ein Blitzstrahl in Deine Seele fällt, daß Du fortan in seinem Banne bist, nur ihn siehst, nur an ihn denkst bei Tage und bei Nacht?«
Ein rosiges Licht flog über ihr Gesicht, um es, verlöschend, desto farbloser zu machen. »Deine Augen sprechen zu mir, Hanna, sie fragen: Warum hältst Du es denn nicht fest, Dein Glück, warum tritt Dein eigener Fuß darauf?«
»Ja, Rose, das frage ich!«
Sie wandte sich ab und murmelte: »Sie wird mich nicht verstehen, ich werde auch sie verlieren.« Dann sprach sie – welch harter fremder Klang war plötzlich in ihrer Stimme! – »Linke ist arm, und ich besitze wenig, wahrscheinlich kaum die Kaution, deren er als Offizier benötigt. Und ich kann nicht in kleinen Verhältnissen leben, nicht Mägdearbeit thun, gewaschene Handschuhe tragen und meines Mannes Strümpfe stricken.«
Ich unterbrach sie. »Mein Gott, Rose, träume ich denn? Sagtest Du nicht soeben, Du liebst Linke?«
»Ja, ich liebe ihn, werde ihn ewig lieben; aber seine Frau kann ich nicht werden, es wäre sein und mein Unglück.«
Ich schlang den Arm um ihre Schulter und sah ihr bittend ins Gesicht.
»Rose, liebe Rose, wenn Du doch irrtest! Sieh, ich bin jünger als Du, mein Herz ist noch nicht berührt von dem Zauberstab der Liebe, und doch möchte ich Dich fragen: Handelst Du auch recht, Rose? Ist die Liebe nicht ein zu edles Gefühl, um abgewogen zu werden gegen Wohlleben und äußeren Tand? Wird nicht einst die Zeit kommen, in der Du diese Stunde bereust, in der Du hundertmal lieber ein schlichtes Kleid tragen möchtest, als im Überfluß leben mit einem unbefriedigten Herzen?«
Sie wurde dunkelrot und sah mich unsicher an. »Foltere mich nicht, Hanna, ich kann nicht anders. Ich bin nicht geschaffen, nicht erzogen für die Misere des Daseins, für Entbehrungen und Armut.«
Ich schwieg und kleidete mich an. Sie folgte meinem Beispiel; doch als ich hinuntergehen wollte, fiel sie mir um den Hals.
»Laß mich heute hier oben, Hanna, ich kann ihn, kann keinen Menschen sehen! Nur Dich! Oder soll ich Dich auch verlieren?«
Sie sah mich so flehend an, daß ich mich zu ihr neigte und sie küßte.
»Ich habe Dich lieb, Rose; nur verstehe ich Dich nicht.«
»Da ist ja die kleine Langschläferin!« rief Vater, als ich in das Zimmer trat, in welchem er sich in Baron Scholtens Gesellschaft befand. Er küßte mich, und ich flüsterte ihm ins Ohr:
»Du darfst Deine Hanna gar nicht so forschend ansehen, Väterchen, sie hat die Augen vor dem Gespenst ihres ersten Balles nicht geschlossen, sondern groß aufgemacht, und das war ihr sehr heilsam.«
Wie leichte Rührung zuckte es in seinem Gesicht, er behielt meine Hand fest in der seinen. Der Oberst, der mit schlecht verhehltem Mißmut dabei gestanden, trat jetzt näher.
»Wie Ihnen, gnädiges Fräulein, der gestrige Abend bekommen, bedarf keiner Frage; Sie sehen wie ein Frühlingsmorgen aus. Aber wie geht es Ihrer Freundin, Fräulein Timm? Werden wir nicht bald den Vorzug haben, sie zu sehen?«
Ich wurde etwas verwirrt unter seinen stechenden Blicken.
»Rose wollte heute unsichtbar bleiben,« antwortete ich verlegen.
Sein hageres Gesicht wurde dunkelrot, die Hand zerrte nervös an den starren Spitzen des starken, graumelierten Schnurrbartes.
»O, das bedaure ich! Das Fräulein ist doch hoffentlich nicht leidend? Ich hätte mich ihr gern persönlich empfohlen, in einer Stunde muß ich fort.«
»Die jungen Damen scheinen keine Freundinnen von Abschiedsscenen zu sein,« meinte Vater. »Auch Herr Leutnant Linke mußte sans adieu von Euch gehen, Hanna. Ihr wußtet doch, daß die Herren uns schon heute verlassen müssen. Er empfiehlt sich übrigens Dir und Deiner Freundin angelegentlich. Sagen Sie mir aber, Herr Oberst,« wandte er sich plötzlich an den Baron, »was war das heute mit Ihrem Adjutanten? Der Mann sah ja bleich wie der Tod aus und schien mir ganz konfus.«
Der Angeredete lachte hart auf. »Katzenjammer wahrscheinlich, mein bester Herr von Berken! Solche jungen Leute verstehen nun einmal nicht, Maß zu halten; sie meinen, alles was schön und begehrenswert, sei eigens für sie geschaffen, ihrer kecken Hand erreichbar. Da ist denn der unausbleibliche Rückschlag doppelt empfindlich.«
Er wich Vaters fragendem Blick aus und stand rasch auf.
»Jetzt aber, mein verehrter Herr von Berken, muß ich eilen, die Pflicht ruft gebieterisch. Der gnädigen Frau habe ich bereits meinen ergebenen Dank und ein herzliches Lebewohl aussprechen dürfen, beides,« er wandte sich mit verbindlichem Lächeln zu mir, »sage ich auch Ihnen, mein gnädiges Fräulein, die Sie so liebenswürdig dazu beitrugen, dem fremden Eindringling den Aufenthalt in Ihrem Hause zu einem unvergeßlichen zu machen.«
Er verbeugte sich tief vor mir und reichte dann Vater die Hand.
»Auf Wiedersehen, Herr von Berken! Hoffentlich ist es mir in nicht zu ferner Zeit vergönnt, Ihnen Revanche für Ihre Gastfreundschaft im eigenen Hause zu geben.«
Kein Wort für Rose? Was war das?
Als ich nach einer Stunde etwa bei ihr saß und sie zu bereden suchte, wenigstens einen Bissen von dem unberührten Frühstück zu genießen, kam Dürten mit einem kostbaren Strauß und einem Billet, welches der Bursche des Obersten soeben für Fräulein Rose Timm aus der Stadt gebracht.«
Roses Finger bebten, als sie das Couvert öffnete und eine Karte hervorzog. Sie überflog dieselbe, zerknitterte sie in der Hand, um sie dann wieder sorgfältig zu glätten und mir zu reichen. Sie enthielt folgende Worte:
»Mit tiefem Bedauern scheide ich, gnädiges Fräulein, ohne Sie noch einmal gesehen zu haben. Hoffentlich bin ich glücklicher, wenn ich in einigen Wochen Ihrem Herrn Vater meine Aufwartung mache. Auf Wiedersehen, glückliches Wiedersehen also, Fräulein Rose!«
Ich schrie laut auf und faßte ihren Arm. »Rose, das wirst Du nicht thun, Du wirst den alten Mann mit den harten Augen nicht heiraten! Sage nein!«
Sie schüttelte mit schwachem Lächeln meine Hand ab.
»Kindskopf Du,« sagte sie, »was liest Du da heraus. Weiß ich denn, was er von Papa will?«
Sie nahm ihren Gartenhut und schritt der Thür zu.
»Komm, Hanna, die Klausur hat ein Ende. Ich muß hinaus, Sonne, Menschen sehen, es ist so unheimlich hier drinnen!«
* * *
Den 10. August. Rose ist mir ein Rätsel. Ihr Wesen zwar ist wie früher, oft munter bis zur Ausgelassenheit. Wenn nicht die dunklen Schatten unter ihren Augen wären, und ich sie manchmal nachts leise weinen hörte, würde ich denken, ich habe die aufregende Scene an jenem Morgen geträumt. Sie selbst rührt mit keinem Wort an letzterer, und ich danke es ihr, ich wüßte ihr nichts mehr zu sagen. Ich habe sie lieb wie früher, und doch ist sie mir fremd geworden; es liegt eine Kluft zwischen uns, über die hinüber ich ihr nicht die Hand reichen kann. In den nächsten Tagen fährt sie heim. Ich werde sie sehr vermissen, und doch ist es besser, sie geht. Vielleicht verständigen wir uns aus der Ferne leichter.
* * *
Den 13. August. Heute begleiteten wir, Vater und ich, unsern Gast zur Bahn. Wieder griffen die Pferde wacker aus, und die Sonne stand hoch oben am blauen Himmel und bezeichnete den Weg ihrer Strahlen durch Goldfunken, die sie verschwenderisch in das dunkle Grün des Waldes, auf die blühenden Felder und in das Wasser des kleinen Flusses warf. Es war alles wie damals, als ich Rose abholte, und doch – wie anders. Heute flatterte der Reiseschleier um ein schmales, blasses Gesicht, und die Lippen, die damals so fröhlich plauderten, öffneten sich nur zu einer flüchtigen Bemerkung, zu einem erzwungenen Lächeln; die Augen, die sonst so strahlenden, lachenden Augen thaten mir weh, wenn ich hineinsah. Als wir in das kleine, wie gewöhnlich menschenleere Wartezimmer eintraten, schloß mich Rose in ihre Arme.
»Ich will Dir hier Adieu sagen, mein Liebling, und Dir danken für alle Geduld, welche Du in letzter Zeit mit mir hattest. Ich habe so sehr gelitten, Hanna, und leide noch.«
Sie lehnte ihr kleines, weißes Gesicht an meine Wange, und ich umschlang sie innig. »Besinne Dich, Rose! Noch ist es Zeit! Linke wird zu Dir zurückkehren, wenn Du ihn rufst.«
Sie schüttelte müde abwehrend den Kopf. »Es geht nicht, Hanna, ich kann nicht!«
Vater, welcher die Sorge für das Gepäck übernommen, trat herein; der grelle Ton der Signalglocke ertönte, noch ein Händedruck, ein Winken, und Rose fuhr davon.
Ob dem Glück entgegen? Ob sie dem Baron ihre Hand reicht, wenn er kommt, sie zu fordern? Ob Reichtum und Glanz wohl Ersatz zu geben vermag für ein wundes Herz, für eine verlorene Liebe?
Ich saß so von meinen Gedanken eingenommen im Wagen, daß ich erst nach geraumer Zeit merkte, daß wir den Weg zu dem benachbarten Städtchen einschlugen.
»Hast Du dort zu thun, Papa?« fragte ich.
»Ja, meine Kleine, und etwas, wozu ich Deine Hilfe brauche.«
Ich sah ihn fragend an und er lachte: »Nicht neugierig sein, Kleine.«
Ich war es aber doch und daher sehr froh, als der Wagen über das holprige Pflaster der Stadt rollte. Vor dem größten Modewarengeschäft hielt er, Fritz öffnete den Schlag, und Vater trat mit mir ein.
»Bitte, zeigen Sie meiner Tochter etwas von Ihren Sachen, sie wünscht einige Roben zu kaufen.«
Der Kaufmann stürzte diensteifrig hinter den Ladentisch, und Vater flüsterte mir zu: »Das ist der Lohn für mein tapferes, kleines Mädchen. Nimm, was Dir gefällt, ich will Dich nicht mehr so entstellt sehen, wie bisher.«
Ich wurde rot vor Vergnügen, rief Herrn Müller aber doch noch vorsichtig zu: »Bitte, keine Carreaus und keinen weißen Battist,« und wählte dann nach Herzenslust unter all den hübschen Sachen. Dann fuhren wir zu Fräulein Arnold, der Putzmacherin, wo ich an Stelle meiner braunen Kiepe, welche die Arnold übrigens höchst verächtlich behandelte, einen reizenden Florentiner Strohhut mit einem entzückenden Feldblumenkränzchen erhielt. Er wurde mir zur Probe vor dem großen Pfeilerspiegel aufgesetzt, und ich ertappte mich auf höchst wohlgefälligen Blicken dabei.
»Weißt Du, Väterchen,« sagte ich, als wir wieder im Wagen saßen, »ich fürchte, Du machst mich eitel; ich glaube sogar, ich bin es schon ein wenig in der letzten Stunde geworden.«
Er ging auf meinen Scherz nicht ein, sondern sagte ernsthaft: »Das sollte mir leid thun, mein Kind, denn ich kenne nichts Unangenehmeres als eine Putznärrin, die täglich ihre stundenlange Andacht vor dem Spiegel verrichtet. Gewöhnlich sind es hohle, geistlose Frauen – wenn nicht schlimmeres – die ihren Körper auf Kosten des Gemütes schmücken. Aber wiederum ganz gleichgültig sollte keine Frau gegen ihre äußere Erscheinung sein; davor müßte sie schon der ihrem Geschlecht besonders eigene Schönheitssinn bewahren. Der köstlichste Wein verliert im unedlen, plumpen Gefäße, die erhabensten Gedanken durch trivialen Ausdruck, die schönste Frau durch schreiende Farben, geschmacklose Gewänder. Der edle Inhalt will auch eine edle Form.«
Vater schwieg ein paar Minuten und fuhr dann fort: »Deine Mutter, mein Kind, hatte auch in dieser Beziehung den richtigen Takt. Ihre Erscheinung war stets dem Auge wohlthuend, stets edel und harmonisch.«
Er sprach in dem weichen Tone, den er stets für unsere geliebte Heimgegangene hat. Ich schmiegte mich fest an ihn, und so saßen wir schweigend, bis der Kutscher die Braunen mit kräftigem Ruck vor der Thür des Hauses anhielt. Mama kam uns entgegen, und heute zum erstenmale fiel mir auf, wie einfach, bis zur Unschönheit, ihre äußere Erscheinung ist. Ihr fast farbloses, blondes Haar trägt sie in langen, glatten Scheiteln über die Ohren gekämmt, das staubgraue Kleid fällt in starren Falten zur Erde und zeigt außer einem schmalen Leinenstreifen am Halse und an den Händen nicht den geringsten Ausputz. Dabei ist Mama von Hause aus sehr vermögend; mein Mütterchen war eine mittellose Waise.
* * *
Den 20. August. Heinz kommt in diesem Sommer nicht nach Hause. Seine Reise hat sich weiter ausgedehnt, als er anfangs geplant, und ist in Gesellschaft seines Freundes so fesselnd und interessant, daß er die ganze Ferienzeit dazu benutzen will. Vater meinte, als Onkel Wagner es uns heute mitteilte, es wäre vernünftig von Heinz, daß er das letzte Jahr seiner fröhlichen Burschenzeit so ausnütze; später, wenn er als ehrsamer Philister irgendwo in Amt und Würden säße, verböte es sich wahrscheinlich von selbst. Ich mußte mir aber doch heimlich ein paar Thränen wegwischen. Ein paar Tage hätte er doch wohl für die Heimat und die alten Freunde haben können.
* * *
Den 26. August. Wir saßen heute beim Morgenkaffee in der Geisblattlaube, als Fritz mit der Posttasche kam.
Vater erbrach einen Brief nach dem andern, plötzlich rief er:
»Da haben wirs!« und reichte mir eine große, goldgeränderte Karte über den Tisch. »Rose Timm – Baron von Scholten-Wenkheim, Verlobte,« las ich. Ich fühlte, wie ich blaß wurde, die Thränen stürzten mir aus den Augen, und ich schluchzte: »Die arme Rose!«
»Erlaube, Hanna, ist das nicht ein etwas sonderbarer Glückwunsch für Deine Freundin?« rief Vater erstaunt.
»Ach, Vater, ich weiß es gewiß, sie wird unglücklich. Er ist so alt und sieht so hart und grausam aus. Ich fürchte mich vor ihm.«
»Bei unserer kleinen Rose scheint letzteres aber nicht der Fall zu sein,« meinte Vater etwas spöttisch, »wenigstens ist es mir nicht aufgefallen, als die beiden zusammen hier waren.«
Er stand auf und strich mir im Davongehen über das Haar.
»Beruhige Dich nur, Töchterchen, und glaube, Deine rote Rose ist augenblicklich nichts weniger als unglücklich. Ich denke, das hübsche, kleine Persönchen weiß im Gegenteil sehr wohl einen Freiherrntitel, noch dazu einen vergoldeten, zu schätzen. Scholten ist sehr vermögend, sein Vater war einer der größten Grundbesitzer Vorpommerns.«
»Nun also,« nahm nun auch Mama das Wort, »da hättest Du Deine Thränen sparen können, Hanna! Ich glaubte übrigens, Rose interessiere sich für den Adjutanten. Sieh, sieh, da ist sie doch vernünftiger gewesen, als ich dachte. Ihr Vater wird auch froh sein, daß sie eine so brillante Versorgung gefunden, sie ist sehr verwöhnt und konnte nur einen reichen Mann gebrauchen.« Ich ging in mein Zimmer, um der jungen Braut Glück zu wünschen, ich mußte mich aber sehr in acht nehmen, daß keine Thräne auf meinen Brief fiel.
* * *
Den 20. September. Wie schwer dem scheidenden Sommer der Abschied von der Erde wurde! Wieder und wieder küßte er sie mit warmem Strahl, strich leise mit sanftem Hauch über die Köpfchen ihrer Kinder, der Spätrosen, bunten Astern und duftenden Nelken. Es hielt mich nicht länger im Hause, ich hing meinen Hut über den Arm, pfiff Hektor und wanderte mit ihm hinaus ins Freie. Im Walde auf meinem Lieblingssitz unter der Rotbuche, an deren mächtigem Stamm Heinz das Bänkchen für mich gezimmert, machte ich Halt.
Wie still es hier war, wie heimlich und friedlich. Die Blätter flüsterten geheimnisvoll miteinander, abgebrochene Vogellaute erklangen, trocknes Laub raschelte unter meinen Füßen und weiße Fäden, das Garn, welches in Mondnächten die Elfen spinnen, wehte auf mich zu und umspann mich mit magischem Netz. Ich mochte nicht lesen, das mitgebrachte Buch glitt ins Moos, und ich schaute durch die dichten Zweige hinauf zu den wandernden Wolken, zu den Vöglein, die mit ihnen ziehen, weiter, immer weiter. Wohin nur, wohin? Ich hob die Arme, als konnte auch ich mich aufschwingen in den blauen Äther, als müsse ich ihnen folgen, weit fort über Berg und Thal. Wohin nur, wohin? Ich wußte es nicht! Was wollte denn dieses heimliche Sehnen in mir, diese leise, süße Traurigkeit?

»Herbst ist es nun, Stürme des Winters wollen nicht ruhn«, flüsterte ich leise vor mich hin, aber dann lächelte ich über mich selbst. Die Winterstürme ruhten noch sehr fest, und einen Frithjof, nach dem ich ausschaute, nach welchem ich mich sehnte, wie die arme Ingeborg, hatte ich auch nicht.
Plötzlich regte sich der Hund, der still zu meinen Füßen gelegen, spitzte die Ohren, stand auf, wedelte mit dem Schweife und – stürzte in wilden Sätzen auf eine Gestalt zu, die ich jetzt erst mir gegenüber, halb verdeckt von breiten Eichenstämmen, bemerkte. Meine Augen waren noch von dem Sonnenlicht geblendet, ich sah nur einen blonden Bart, eine hohe, schlanke Gestalt, an der Hektor wie rasend in die Höhe sprang.
Der Fremde wehrte ihn ab, trat näher und – »Heinz, lieber Heinz!« schrie ich auf. Er war es wirklich, sonnengebräunt und bärtig – wie hatte ich nur dem stattlichen Herrn so kindisch entgegen jubeln können?
»Nun, Hanna, bekomme ich keine Hand,« sagte er endlich, »sind wir uns so fremd geworden?«
Ich sah befangen zu ihm auf. »Entschuldige, Heinz, Du bist so – so anders geworden, ich erkannte Dich kaum.«
Er hielt meine Hand fest und schaute mir tief in die Augen.
»So erging es auch mir, Hanna. Du saßest hier inmitten des schweigenden Waldes, die Sonnenstrahlen huschten verstohlen über Dein Gesicht, Deine Augen sahen so sehnsüchtig in die Ferne, dazu der riesige Hund zu Deinen Füßen, – ich glaubte, die Königstochter zu sehen, welche böser Zauber in Waldesnacht gebannt.«
War das Heinz, der so sprach, dessen Augen mit so seltsamem Ausdruck die meinen suchten? Ich senkte den Blick, mein Herz klopfte ungestüm, ich glaubte seine lauten Schläge zu hören. Was war mir nur? War ich denn wirklich verzaubert?
Plötzlich lachte ich hell auf. Heinz hatte als Knabe meine geliebten Märchenbücher stets so verächtlich behandelt, mich noch bei seinem letzten Besuch so viel mit meiner Schwärmerei für Poesie geneckt, und nun sprach er selbst wie ein Dichter.
»Heinz, Du bist ja ein Poet!« rief ich.
Er war erst bei meinem Lachen zusammengezuckt, nun lächelte auch er. »Ich ein Poet!« Wieder sah er mich so eigen an und dann sprach er leise: »Und doch, Du hast im gewissen Sinne recht. Es kommt wohl für eines jeden, selbst des Blödesten Auge ein Moment, in dem er die blaue Blume schimmern sieht. Man muß nur das rechte Wort zur rechten Stunde sprechen, um ihren Zauberkelch geöffnet zu sehen.«
Er sah meinen verwunderten Blick und warf das volle Blondhaar, von welchem er den Hut genommen, aus der Stirn.
»Doch nun komm, Hanna, es wird kühl im Walde, ich geleite Dich heim.«
Ich ging Hand in Hand mit ihm den Weg zurück. Die untergehende Sonne tauchte alles in Gold und Purpur, die Wipfel der Bäume lohten wie feurige Flammen gen Himmel, die tanzenden Mückenschwärme sahen wie Goldregen aus, und der kleine Bach trieb Feuer zwischen seinen Ufern.
»Wie schön, wie wunderschön ist doch die Welt!« rief ich. »Bevor Du kamst, Heinz, war mir so bang, so traurig zu Mute, ich hatte schon Herbstesahnen, und nun bin ich so froh, als bliebe es immer Sommer, schöner, lachender Sommer, als könne gar kein langer, einsamer Winter kommen.«
»Liebe Hanna, mein lieber, kleiner Hans!« murmelte Heinz, und plötzlich bückte er sich, nahm eine meiner Flechten, die fast den Saum meines Kleides streiften, und preßte sie an seine Lippen.
Wieder wollte die alte Befangenheit über mich kommen; aber jetzt sah mich Heinz mit seinen alten, treuherzigen Augen an.
»Du bist mir ein kurioser Kamerad, Hänschen! Fragst nicht einmal: Woher des Weges und wohin?«
Ich errötete lebhaft, »Wirklich, Heinz, ich habe es in der großen Freude, Dich so plötzlich wiederzusehen, vergessen. Du bleibst doch recht lange hier?«
Er zuckte mit drolliger Miene die Achseln. »Ja, wenn das ginge, Hänschen! Morgen gehts wieder fort; ich wollte nur die Eltern und meinen kleinen Kameraden sehen, ehe ich mich der alma mater wieder in die sehnsüchtig geöffneten Arme werfe.«
Ich sah ihn ernstlich gekränkt an. »Das ist nicht schön von Dir, Heinz; für die Alpen und Deinen Freund hattest Du Monate, wir bekommen nur einen Tag. Ich mag ihn auch gar nicht, diesen Egon Tesmer,« fuhr es mir heraus, »um den Du die alten Freunde so vernachlässigst!«
Was Heinz doch für merkwürdige Augen hat, und warum er plötzlich so warm meine Hand drückte.
»So böse bist Du meinem Freunde? Da bleibt ihm doch nichts übrig, als stehenden Fußes herzueilen und um Gnade zu bitten.«
Ich hob abwehrend die Hand. »Ach nein, Heinz, lass' ihn nicht kommen!«
Er lachte hell auf. »Das müßte Egon hören, unser Troubadour, der Liebling der Götter und der – Damen. Ich wette, er setzt sich sofort an seinen Schreibtisch und klagt in flammenden Versen, wie grausam die schnöde Welt ihn behandelt, wie ihre Dornen ihm das Herz wund stechen. Er ist nämlich ein Dichter, der Egon, und sollte darum gerade bei Dir schon von vornherein einen Stein im Brette haben. Nun, nun, schau nur nicht wieder darein wie Rotkäppchen, als es den bösen Wolf spürte; vorläufig denkt er noch nicht ans Kommen. Wir müssen beide bis zum nächsten Frühjahr tüchtig pauken, um nicht mit Glanz durchs Examen zu fallen. Doch nun erzähle mir von Dir. Die rote Rose hat also richtig einen Goldfisch im Netze ihrer roten Locken gefangen; aber Du, Hanna, wollte Dich niemand von den tapfern Kriegern entführen?«
»Mich?« Ich lachte hell auf und dann schilderte ich ihm mein glorreiches Debüt im Tanzsaal. »Da saß ich wirklich wie die verwunschene Prinzessin im Märchen, Heinz. Ritter waren genug zur Stelle; aber keinem fiel es ein, mich zu erlösen.«
Wenn ich still gehofft, mein Zuhörer würde empört über die mir widerfahrene Unbill sein, so hatte ich mich gewaltig geirrt. Freund Heinz sah merkwürdig zufrieden aus und plauderte noch angeregter als vorhin. Er erzählte von seiner Reise, von den Bergriesen, die er hoch oben in ihrer Einsamkeit besucht, den Weihestunden, die er so nahe am Herzen der Natur gefeiert.
»Wie schön, wie herrlich muß es da sein!« sagte ich aufatmend, als er schwieg. »Da ist es wirklich kein Wunder, wenn Du die übrige Welt und die alte Heimat vergaßest.«
Er sah mir tief in die Augen. »Und doch habe ich ihrer oft gedacht, sehr oft. Immer, wenn es mir die Brust schwellte vor Entzücken, wenn mich die Herrlichkeit, welche ich schauen durfte, verstummen ließ, habe ich gewünscht, jemand – ein schlankes, braunes Mädchen war es, mit großen, geheimnisvollen Augen – an meiner Seite zu sehen, mein Entzücken mit ihm zu teilen.«
Ich sah ihn ungläubig an. »Wirklich, Heinz, Du hast an mich gedacht, an mich inmitten der Wunder, die Dich umgaben?«
Er sah mich lächelnd an und entnahm seiner Brieftasche ein zusammengefaltetes Papier, welches er mir reichte.
»Für Hanna, soeben drei Uhr morgens, auf dem Wetterhorn gepflückt,« stand darauf. Ich schlug das Blatt auseinander, ein Zweig mit sammetartigen, leuchtend weißen Sternenblüten lag darin.
Ich reichte Heinz freudig dankend die Hand, er hielt sie fest.
»Bewahre das Edelweiß zum Andenken an diese Stunde; willst Du, Hanna?«
Wir hatten mittlerweile Wald und Park durchschritten und näherten uns dem Wohnhause. Vater stand auf der Freitreppe und schaute, die Augen mit der Hand beschattend, – das verglühende Abendrot blendete ihn, – uns entgegen.
»Nun, Kinder, da seid Ihr ja. Hatte ich nicht recht, mein lieber Heinz, daß Sie mein Waldvögelchen in seinem Revier finden würden?«
Heinz sprang die Stufen hinauf und ergriff Väterchens Hand. »Besten Dank, Herr von Berken! Ihren Wunsch habe ich getreulich befolgt, obgleich es mir, offen gestanden, nicht leicht geworden ist.«
Mein scharfes Ohr hatte die leisen Worte vernommen; nun flüstert Vater etwas und schaut dabei lächelnd auf mich. Was haben die beiden nur?
Nur ein Stündchen noch blieb Heinz bei uns, dann begleiteten Vater und ich ihn hinaus auf den Hof, wo sein Pferd schon lange ungeduldig mit den Hufen scharrte. Noch einmal drückte er mir warm die Hand, noch ein: »Auf Wiedersehen im nächsten Frühjahr!« und fort war er. Den ganzen Winter will er fern bleiben, nicht einmal zum Fest in die Heimat kommen! Das werden traurige Weihnachten sein, die ersten, so lange ich denken kann, die ich ohne ihn verlebe. Mir war plötzlich so bang, so einsam zu Mute, ich mußte in mein stilles Zimmer, um mich auszuweinen.
Was ist mir nur heute? Bin ich denn wirklich verzaubert?
* * *
Den 19. Oktober. Gestern kehrte ich von Roses Hochzeit zurück. Sie hatte mir geschrieben: »Du darfst es mir nicht anthun, Hanna, und an meinem Ehrentage fehlen. Wenn Deine Hand den Brautkranz in mein Haar flicht, will ich glauben, daß er mir Glück bringt!« Diese Worte bestimmten mich zu der Reise, zu der ich anfangs wenig Lust verspürte. Rose ist mir als Braut des Baron von Scholten fremd geworden, und fremd erschien sie mir, als sie uns – Vater hatte mich begleitet – in ihrer Vaterstadt auf dem Bahnhof, am Arme ihres Verlobten, entgegentrat. Sie trug eine kostbare, dunkelblaue Herbsttoilette, ihr Gesicht war frisch und rosig wie sonst; aber die Aurikelaugen schienen das Lachen verlernt zu haben, kühl und gleichgültig glitten sie über Dinge und Menschen und machten das junge Antlitz um Jahre älter. Der Baron sah in der Civilkleidung – er hat seit seiner Verlobung den Dienst quittiert – und wohl auch im Gegensatz zu der jugendschönen Braut nicht eben vorteilhaft aus. In seine Augen ist etwas Rastloses gekommen, das schlecht zu seinem vornehm gemessenen Wesen paßt. Als Rose mich mit alter Herzlichkeit begrüßte und glückselig wieder und wieder für mein Kommen dankte, ließ er, trotzdem er Vater mit ausgesuchter Höflichkeit begrüßte, keinen Blick von seiner Braut, und plötzlich nahm er ohne ein Wort ihre Hand und legte sie fest in seinen Arm.
Von ihrem Gesicht war der Frohsinn geschwunden.
»Der arme Axel, er ist so eifersüchtig,« flüsterte sie mir spöttisch zu, als wir der eleganten Equipage, die unserer harrte, zuschritten.
Es war der Tag vor der Hochzeit, der Abend brachte die übliche Vorfeier. Ich überreichte der Braut den Kranz mit ein paar schlichten Versen, welche mir für sie aus dem Herzen gekommen.
Ihr Gesicht war blaß wie Marmor, als ich vor ihr stand; aber ihr Auge blieb trocken, kein Tropfen fiel auf die glänzenden Zweiglein der Myrtenkrone, welche ich in ihre Hand legte.
Ihre Freunde hatten sich zusammengethan, den Abend heiter und überraschend zu gestalten, reizende Festspiele waren arrangiert worden und das Brautpaar wurde in Wort und Bild gefeiert.
Rose klatschte gleich den andern Beifall, sprach den Darstellern in liebenswürdigster Weise ihren Dank aus; aber ihre Augen, ihre sonst beim geringsten Anlaß lachenden Augen, behielten auch jetzt ihren kühlen Ausdruck.
»Sie jubeln mir alle zu,« flüsterte sie mir zu, als sich der Vorhang zum letzten Male unter lautem Beifall senkte. »Als wenn ich ihr wahres Gesicht nicht kennte, nicht wüßte, wie sie nach einem Schatten auf meiner Stirn forschen, wie sie die Köpfe zusammenstecken und höhnisch flüstern über das ungleiche Paar: den 60jährigen Mann und seine 18jährige Braut. Aber es ist doch nur Neid, der aus ihnen spricht, sie alle möchten an meiner Stelle sein und neiden mir mein Glück. – Mein Glück!« wiederholte sie noch einmal wie herausfordernd, und dann neigte sie sich ihrem Verlobten mit strahlendem Lächeln zu.
Am Tanz beteiligte sie sich nicht; sie ziehe es vor, mit ihrem Bräutigam zu plaudern, versicherte sie auf jede Anfrage.
Ich war eine viel begehrte Tänzerin, doch ohne rechtes Vergnügen dabei zu empfinden. Ich wußte mit den eleganten jungen Herren, die mich so angelegentlich unterhielten, wenig anzufangen. Sie hatten fast alle dieselben Phrasen, und mir erschien es recht überflüssig, im Laufe weniger Stunden einige Dutzend Mal zuzugeben, daß die Aufführungen höchst gelungen, der Straußsche Walzer brillant und die Hitze kolossal sei. Ich dachte in all der Fröhlichkeit des jungen Adjutanten und seiner treuherzigen, flehenden Augen. Der arme Leutnant Linke! Ob er wohl traurig ist und unglücklich?
Der Tanz dauerte lange, fast bis zum Morgen, und ich war froh, als ich endlich den Kopf in die Kissen legen durfte. Rose, deren Zimmer ich teilte, schien aber keine Müdigkeit zu spüren. Sie saß auf dem Rande meines Bettes und plauderte mit fieberhafter Lebendigkeit von diesem und jenem, von den reichen Geschenken, welche sie erhalten, und von Paris, dem Ziel ihrer Hochzeitsreise, welche morgen, bald nach der Trauung, angetreten werden sollte.
Ein funkelnder Sonnenstrahl stahl sich bereits ins Zimmer, als sie sich erhob. »Verzeih, Liebling, Dir fallen die Augen zu.« Sie küßte mich, halb im Schlafe fühlte ich einen heißen Tropfen auf meiner Stirn, und dann nahm mich der Traumgott in seine Arme.
Als ich nach einigen Stunden erwachte, saß Rose schon vor ihrer Toilette. »Endlich, Du Langschläferin,« rief sie mir zu, »es ist bereits zwölf Uhr, in einer Stunde ist meine Trauung!«
Sie sah beim Sprechen nicht auf und hantierte eifrig vor dem großen Spiegel weiter. Im Nu war ich im Morgenkleide und neben ihr, ich hatte gebeten, sie heute bedienen zu dürfen.
Sie hielt ein zierliches Porzellanbüchschen in der Hand, welches eine rote Substanz enthielt, und prüfte dieselbe aufmerksam.
»Was hast Du da, Rose?« fragte ich erstaunt.
Sie wandte sich um und sagte ruhig: »Es ist rote Schminke. Sieh nur, Hanna, wie blaß ich bin, ich habe so wenig geschlafen in dieser Nacht.«
Ich erschrak, ihr Gesicht war farblos; breite, bläuliche Schatten lagerten unter den Augen.
»Nicht wahr, so kann ich nicht bleiben? Was soll Axel, was sollen seine Verwandten denken, die mich heute zum erstenmal sehen werden? Vielleicht, daß ich nicht glücklich bin? Ich bin aber glücklich, sehr glücklich!«
Sie stieß die letzten Worte hervor, als gelten sie einem unsichtbaren, erbitterten Gegner; dann starrte sie einen Augenblick vor sich hin.
»Sehr glücklich!« wiederholte sie. »Wenn auch das thörichte Ding da drinnen in der Brust so oft weint und klagt, und es anders wissen will. Aber das giebt sich, nicht wahr, Hanna, das giebt sich?«
Es klopfte. Eine Dienerin brachte einen wunderzarten Strauß von weißen Rosen und blühenden Myrthen, dazu einen länglichen Kasten von Ebenholz mit silbernen Beschlägen, das Hochzeitsgeschenk des Barons für seine Braut. Der silberne Schlüssel steckte im Schloß, Rose öffnete und stieß einen Laut des Entzückens aus. Auf dem blaßblauen Samtpolster des Kastens lag eine dreifache Schnur großer, weißer, märchenhaft schimmernder Perlen, ein Schmuck, einer Fürstin würdig.
Roses blasses Gesicht hatte sich leise gerötet, ihre Augen strahlten, und als sie nun die Kette um den schneeweißen Hals schlang, hing mein Blick wie gebannt an dem schönen Bilde. Trotzdem hielt ich die Hand zurück, die das diamantenbesetzte Schloß zusammenfügen wollte.
»Du siehst wie ein schönes Königskind aus, Rose; aber bitte, lege das Kollier heute nicht an, Perlen sind kein glückbringender Schmuck.«
Sie lachte hart auf. »Ich weiß: Perlen bedeuten Thränen; aber ich bin keine Fatalistin und lasse es darauf ankommen.«
Sie stand auf und schob dabei die Schminke weit von sich.
»Der erborgten Frische bedarf es aber doch wohl nicht; eine Braut hat ja auch das Privilegium der schmachtenden Blässe.«.
Ich half ihr schweigend bei ihrer Toilette. Sie überließ sich ziemlich teilnahmslos meinen Händen; erst als der weiße Atlas an ihr herniederrieselte, und ich den grünen Kranz auf ihr schimmerndes Haar drückte, ging ein Schaudern durch ihre Glieder.
Sie machte eine Bewegung, als wolle sie ihn herunterreißen, eine wilde Angst sprach aus ihren Augen.
»Hanna, Hanna,« rief sie, »sage Du mir, daß ich recht thue, daß ich glücklich sein werde!«
Meine Augen füllten sich mit Thränen.
»Ich will Gott von Herzen darum bitten, wenn Du heute vor dem Altare stehst, Rose!«
»Thue es, Hanna,« sagte sie flehend, und nun löste sie doch die Perlen von ihrem Halse.
Eine Stunde darauf war alles vorüber, war Rose Freifrau von Scholten-Wenkheim. Ich konnte bis zu ihrer Abreise nur noch wenige Worte mit ihr sprechen; ihr Gemahl, die Verwandten desselben, die heute erst erschienen waren, ihr Vater, dessen rotes, volles Gesicht vor Glück strahlte, eine ältere Verwandte, welche Mutterstelle bei der früh Verwaisten vertreten, nahmen sie vollständig in Beschlag.
Nach einem kurzen Mahl vertauschte die junge Frau das Hochzeitskleid mit dem Reiseanzug und bestieg an der Hand ihres Gatten den Wagen, der sie zum Bahnhof bringen sollte. Noch einmal winkte sie lächelnd mit dem kostbaren Kamelienstrauß, welchen sie in der Hand hielt, nach allen Seiten, der Baron schwenkte grüßend seinen Hut, und dann waren sie unsern Blicken entschwunden.
Wir, Väterchen und ich, hielten dann noch an demselben Abend unsern feierlichen Einzug in Berkenhagen, wo es mir viel besser gefällt, als in der lauten Stadt mit ihrem Hasten und Jagen, mit dem Haschen nach dem Glück, welches sich oft so trügerisch erweist.
* * *
12. September. Die letzten Wochen waren durch die Ungunst des Wetters sehr einförmig. Selbst so wetterfeste Geschöpfe, wie Hektor und ich, mußten uns bescheiden; wir wagten gar nicht, an ein Herumschweifen im Freien zu denken. Denn der Spätherbst ist gekommen, und dieses Mal noch grämlicher, noch verstimmter als sonst. Den dichten, grauen Regenmantel, in welchem er seinen Einzug hielt, legt er nie ab, und lüftet er ihn wirklich ein wenig, flugs zieht er ihn zusammen, so wie die Sonne nur Miene macht, hindurch zu scheinen. Desto lustiger sind aber seine Begleiter, die wilden Stürme. Fast unausgesetzt erklingen ihre lauten Lieder; sie peitschen die Regentropfen klatschend an die Scheiben, holen die letzten gelben und roten Blätter von den Bäumen, um sie im tollen Tanze umherzuwirbeln.
So trieben sie es auch gestern, die unholden Gesellen; trotzdem aber stand nachmittags Schlag 4 Uhr, wie befohlen, unsere große Kutsche – nebenbei die Wonne meiner Kinderjahre – vor dem Hause, um uns nach Birkenfelde, wohin wir zu dem Geburtstage des Hausherrn, des Oberamtmann Wagner, gebeten waren, zu bringen.
Wir nahmen vollzählig, mit Kind und Kegel, auf den weichen, dunkelblauen Polstern Platz. Auch die Zwillinge waren zu ihrem Entzücken ausdrücklich eingeladen worden und schauten nun mit glücklichen Gesichtern aus ihrer Vermummung hervor.
Auf dem Birkenfelder Gutshof war bereits reges Leben, als wir nach kaum halbstündiger Fahrt anlangten. Wagen aus allen vier Himmelsgegenden rollten heran, Peitschen knallten, Hunde bellten, und alles übertönte die Stimme des Hausherrn, der schallend seine Gäste, darunter zahlreiche »Schwiegerdöchtings«, willkommen hieß.
Die erste Person, die uns in dem weiten, mit Hirschgeweihen geschmückten Vorflur entgegentrat, war zu unserer freudigen Überraschung Frau Gertrud Wilke, die seit einigen Jahren verheiratete Tochter des Hauses. Sie führte ihr kleines Töchterchen Ilse, ein allerliebstes, blondlockiges Fräulein von drei Jahren, an der Hand, und zu possierlich war es, wie letzteres meinen kleinen Schwestern gegenüberstand, wie alle drei wie auf Kommando die rosigen Zeigefingerchen in den Mund steckten und sich von unten herauf musterten. Sie schienen aber nichts Verdächtiges an einander bemerkt zu haben; als wir, unserer Hüllen entledigt, dem Zimmer zuschritten, folgten sie uns bereits Hand in Hand, in inniger Vertraulichkeit.
Drinnen empfing uns Kaffeearoma und Kuchenduft, Tassen- und Tellerklirren, Durcheinandersprechen und Lachen. Tante Wagner kam mit wehenden Haubenbändern und hochgeröteten Wangen hinter einem der langen, mit schneeweißem Damast bedeckten Tische hervor.
»Herzlich willkommen, meine liebe Frau von Berken!« rief sie schon von weitem. »Gott sei Dank, daß Sie endlich erscheinen! Wir sind nämlich bereits mitten im schönsten Kochen und Backen, Liebste; Frau Sellin will meine Räuchermethode nicht gelten lassen, kommen Sie, geben Sie den Ausschlag!«
Ehe sie Mama mit sich fortzog, küßte sie mich herzlich. »Wie schaut's, Hanning? Immer frisch und rosig? Ja, ja, die liebe, goldene Jugend! Was sagst Du aber nur zur Trude? Kommt uns heute ins Haus geschneit und bringt noch gar das Fräulein Tochter mit! Wir waren natürlich bitterböse, besonders der Großpapa. Von meinem Jungen soll ich auch schön grüßen – Du weißt, das vergißt er nie. Er muß fleißig arbeiten; aber zu Pfingsten haben wir dann, so Gott will, unsern Doktor hier.«
Sie nickte mir noch einmal glücklich zu und verschwand mit Mama in einem Kreise lustig schwatzender Damen.
Mich führte Gertrud zu einem großen, runden Tische, an welchem sie präsidierte, und schob mir einen Stuhl neben den ihren. Meine andere Nachbarin war Hildegard Trutenau, eine junge Dame aus der Nachbarstadt, mit der ich früher häufig zusammengetroffen, und die erst vor kurzem aus ihrer Dresdner Pension heimgekehrt war. Sie sah mich starr an, als ich sie freudig begrüßte; erst nach ein paar Minuten sprudelte sie in ihrer alten, raschen Weise hervor:
»Na, höre, Hanna, das muß ich sagen, Du verstehst es, die Leute zu überraschen. Meinem cher cousin werde ich aber den Standpunkt klar machen. Mir so etwas aufzubinden! Du und Wandverzierung! Solch ein Unsinn!«
Mir ging ein Licht auf. Herr Otto Hofer, der bewußte » cher cousin«, war auch auf meinem ersten glorreichen Balle gewesen und hatte seinem Bäschen von meinen Triumphen gesprochen.
Ich lachte hell auf. »Geh nur nicht zu strenge ins Gericht mit Deinem armen Vetter, Hilde, er hat Dir vollständig wahrheitsgetreu berichtet.«
Sie wurde dunkelrot und gab sich einen schallenden Klaps auf den Mund. »Hilde, Hilde, sagte sie kopfschüttelnd, »was bist Du doch für eine dumme Dirn geblieben, trotz der feinen Dresdener Pension. Aber wenn ich mich denn doch schon so weise verraten, so will ich nur gestehen, daß Du ganz richtig kombiniert hast. Otto und die andern müssen blind gewesen sein.«
Sie lachte, daß ihr die Thränen in die Augen traten.
»Du, Hanna, ich fing schon an, Dich zu bemitleiden. Ich bitte Dich, ich mit meiner kleinen, rundlichen Figur, der Stumpfnase und dem Sattel von Sommersprossen darüber.«
Gertrud bog sich vor, um den Grund unserer Heiterkeit zu erfahren.
»Ah, die Ballgeschichte, die kenne ich, die hat mich schon kostbar amüsiert, als Heinz sie vortrug!«
»Heinz hat Dir davon gesprochen, Trudchen?«
Die junge Frau sah mich neckisch an. »Wann spricht Heinz nicht von Dir? Klingen Dir nicht oft die Ohren, Hänschen? Seit wir als Premiers nach Potsdam versetzt sind und Heinz unser beständiger Sonntagsgast, wird Dein Name oft bei uns genannt. Selbst Herr Tesmer, Heinzens Freund, zeigt bereits ein bedenkliches Interesse für Dich.«
»Sehr schmeichelhaft für das gewiß vortreffliche Wesen, welches in Herrn Tesmers Phantasie spuckt; aber ich kann die Liebenswürdigkeit nicht erwidern.«
»Wenn Du nur nicht später – Pfingsten wird er Heinz hierher begleiten – anders denkst, Hanna! Tesmer ist ein gefährlicher Mensch. Kinder, er hat so etwas Byronhaftes, der moderne Rattenfänger von Hameln! Schlanke, geschmeidige Figur, geniale Stirn, ein paar wunderbare, blaue Augen, ebenso gefährlich, wenn sie Weltschmerz blicken, als wenn sie lächeln, goldblondes Bärtchen über schneeweißen Zähnen, singt wundervoll, reimt bezaubernd auf Herzen und Schmerzen, Sonne und Wonne, kurz, wenn ich nicht meinem Walter so närrisch gut wäre hätte ich mich schon längst Hals über Kopf in ihn verliebt.«
»Na, letzteres können wir ja prompt besorgen,« meinte Hilde. »Also Pfingsten kommt er? Ich muß doch gleich morgen an meine Buchhandlung um Duette schreiben. Können Sie mir vielleicht etwas recht Wirksames empfehlen, gnädige Frau?«
Die Angeredete drohte ihr lachend mit dem Finger.
»Spielen Sie nicht mit dem Feuer, Fräulein Hildegard, Sie könnten sich die Finger daran verbrennen.«
»Kein Feuer, keine Kohle kann brennen so heiß, als heimliche Liebe, von der niemand nichts weiß!« deklamierte Hilde schmachtend, wurde aber gleich darauf purpurrot, als hinter ihrem Stuhle ein lachendes »Bravo!« laut wurde, und Herr Hofer, dessen Kommen wir nicht bemerkt, mitleidig sagte:
»Mein aufrichtigstes Beileid, Cousinchen! Hm, hm, unglückliche Liebe! Scheint aber bis jetzt Deiner Gesundheit nicht geschadet zu haben, Du siehst für Deinen traurigen Gemütszustand merkwürdig frisch aus.«
Hildes Witz schien plötzlich abhanden gekommen zu sein. Wirkte das Erscheinen des Vetters so eigentümlich? Ich schaute ihn darauf prüfend an: Hühnengestalt, rotblondes Haupt- und Barthaar, bemerkenswerte Hände und Füße. Sollte er für sie »der Herrlichste von allen« sein? Er war durch meinen Blick aufmerksam geworden, stutzte und verbeugte sich dann.
»Pardon, gnädiges Fräulein, wenn ich Sie jetzt erst begrüße! Sie sind soeben gekommen? Ich bemerkte Sie wenigstens nicht vorhin hier am Tische.«
Also schon zum zweitenmal macht Herr Hofer seine Aufwartung in diesem Zimmer? Die anderen Herren waren nicht so mutig, sie kamen höchstens bis an die Schwelle, um sich dann sofort kopfschüttelnd zurückzuziehen. Es war aber auch ein Summen und Brausen in dem großen Zimmer, welches den bitteren, grimmigen Neid einiger Bienenschwärme hätte erregen können.
Alles plauderte, lachte, rief durcheinander. Tassen klirrten, Löffelchen klapperten, Seide rauschte, Bänder flatterten, und ab und zu erschien die Herrin des Hauses bei dieser oder jener Gruppe und rief ihr bittendes: »Aber, Liebste, schmeckt der Kaffee nicht? Ihre Tasse ist ja stets gefüllt!«
Aber endlich fanden die Lieben mit den schneeweißen, breiten Schürzen und eben solchen Häubchen keine Abnehmer mehr; die wie durch Zauberei immer aufs neue gefüllten Kuchenteller blieben unberührt, und man erhob sich, um im Saale die Zeit mit Spiel und Tanz auszufüllen. Hilde hatte ihre gute Laune wiedergefunden und war unermüdlich im Arrangieren von mehr oder minder geistreichen Gesellschaftsspielen.
Selbst auf lebende Bilder verfiel ihr erfinderischer Geist und erzielte großartige Erfolge mit roten Tischdecken als Königsmänteln, Gardinen als Braut- und Nixenschleiern, Küchenbeilen, Ofenschürern und dergl., welche als Attribute für Pagen und Ritter verwendet wurden.
Nach dem Abendessen wurde getanzt; ich war viel begehrt, besonders Hildes hünenhafter Vetter nahm mich sehr in Anspruch.
Aus Rücksicht auf die Kinder blieben wir über Nacht in Birkenfelde und fuhren erst heute vormittag nach Hause. Von Gertrud und ihrer hübschen, kleinen Ilse nahmen wir auch gleich Abschied, sie reist schon morgen heim. Heinz habe ich natürlich viele Grüße gesandt, ärgerte mich aber, daß ich dabei errötete. Es war natürlich nur, weil Trudchen mich gerade so sonderbar anblickte.
* * *
Den 8. Dezember. Ein Wintersonntagnachmittag auf dem Lande! Wenn ich ein Maler wäre, hätte ich am letzten Sonntag das Bild gezeichnet, welches in der dritten Nachmittagsstunde unser Wohnzimmer bot, und es unter obiger Bezeichnung der Nachwelt überliefert. Ob man es wohl ohne Gähnen hätte ansehen können?
Mama war mit ihrem Strickzeug in der Hand eingeschlafen, Vater lag auf der Chaiselongue, um seine Zeitung zu lesen, ich stand mit den Zwillingen, die ihre kleinen Nasen platt an die Scheiben drückten, am Fenster. Es schneite, der Himmel war einförmig grau, die Flocken fielen lautlos, gleichmäßig hernieder, eine nach der andern. Wie monoton das war, wie einschläfernd. Ich drehte mich nach dem Zimmer herum. Väterchens Zeitung nickte, schwankte, verbeugte sich höflich, fiel auf den Teppich, und als hätte ihr Besitzer nur darauf gewartet, stieß er ein paar gurgelnde Töne aus, hielt erschreckt inne, fing wieder an und – schnarchte schließlich ganz regelrecht.
Ich setzte mich auf den Fenstertritt und gähnte, die Kinder schmiegten sich rechts und links an mich an.
Plötzlich fing Lieschen an: »Bitte, bitte, Hanna, eine Geschichte!«
Auch Gretchen hob den Kopf: »Ach ja, Hanna, vom Aschenbrödel und vom Dornröschen!«
Sie kannten zwar die wunderbaren Schicksale der beiden jungen Damen längst auswendig, doch fing ich geduldig an. Es ging trotz des Schnarchakkompagnements recht gut von statten: Aschenbrödel war im Sternen-, Mond- und Sonnenkleid zum Tanze gegangen, ohne viel Formalitäten Frau Königin geworden, die Tauben hatten ihren sanften Charakter vollständig verleugnet und den beiden bösen Schwestern, wie recht und billig, die Augen ausgehackt. Dornröschen erblickte das Licht der Welt, wurde getauft, wobei sich die eine Fee zu Lieschens immer neuem Entsetzen höchst unschicklich benahm, und dem armen Prinzeßchens, welches doch wahrlich nicht verantwortlich für die Unterlassungssünde der Frau Mama war, so Abscheuliches wünschte.
Bis hierher ging es, wie gesagt, prächtig, aber – o Jammer! – im Erkerstübchen der Uralten ereilte auch uns das Verhängnis. »Was ist das für ein wunderbares Ding? fragte Dornröschen, so etwas habe ich ja noch niemals gesehen. Kaum aber hat es die tanzende Spindel berührt, wird es gestochen, fällt um und schläft auf der Stelle ein. Und alles im Schlosse verfällt in einen tiefen, tiefen Schlaf, der König hält das Scepter fester, schiebt die goldene Krone ein wenig zur Seite, lehnt den Kopf an die gepolsterte Wand seines Thronsessels und schläft ein,« – Gretchen gähnte leise – »die Königin zog rasch den teuren Hermelinmantel glatt, lehnte ihr Haupt auf die Schulter des Gemahls und schläft«. – Lieschen sah mich mit verschleierten Augen an und gähnte laut. »Die Minister schliefen« – Grete nickte beifällig – »die Hofdamen und die Pagen schlafen« – auch Lieschen nickt – »der Koch, der eben dem Küchenjungen eine Ohrfeige geben will, schläft ein« – Gretchen folgt seinem Beispiel – »die Pferde, die Hunde, die Hühner und die Tauben« – Lieschen wartet ihr Verhalten nicht ab, ihr Kopf sinkt auf meinen Schoß, – »die Pferde, die Hunde, die Tauben« – was thaten sie doch? Ich konnte mich nicht besinnen – ach ja, sie schliefen, alle schliefen! – Ich träumte, ich selbst wäre Dornröschen, aber keine undurchdringliche Hecke umgiebt meine Zauberburg, das Thor ist einfach verschlossen, und davor steht der Königssohn und zieht sittig und bescheiden an der Glocke. Niemand öffnet, wir schlafen ja alle! Er zieht stärker, immer stärker; wenn er nur nicht den Glockenzug abreißt!
Voller Besorgnis öffne ich die Augen, wo ist er denn, mein schöner Prinz?
Ich springe auf, die Zwillinge reiben sich die Augen, stürzen gleich mir zum Fenster und jubeln laut auf:
»Besuch! Besuch! Mutting, sollen wir Mamsell Minchen sagen, daß sie Waffeln bäckt?«
Mama fährt entsetzt in die Höhe, sieht uns mit starren Blicken an, greift nach ihrem Strumpf, strickt ein paar Maschen und sagt:
»Was wollt Ihr, Kinder? Hanna, was ist denn los?«
Auch Vater schweigt plötzlich und setzt sich gerade. »Kommt da nicht ein Schlitten? Sollten Wagners –?«
Ich habe indessen die Näherkommenden erkannt und winke ihnen lebhaft zu: »Hilde Trutenau mit ihrer Mutter und dem Vetter!«
»Der Louisenhofer? Das ist ja eine famose Idee von ihm!« ruft Vater erfreut. Er bürstet sein Haar glatt, nimmt die Pelzmütze vom Ständer und geht hinaus. Ich folge ihm, und während er Frau Major – Eveline, Freifrau Schenk von Trutenau, geb. Schenk von Trutenau steht auf ihrer Visitenkarte – den Arm reicht und sie ins Haus geleitet, Herr Hofer Mama, die auch in der Thür erscheint, begrüßt, führe ich Hilde in mein Zimmer.
»Ich muß mich ein wenig zurechtstutzen,« hat sie mir zugeflüstert. »Nicht wahr, ich sehe schrecklich aus, wie die Windsbraut selbst? Ich habe kutschiert.«
In der That, ihr blondes Kraushaar ist arg zerzaust und dort, wo das kecke Pelzmützchen es nicht genügend schützte, dicht mit weißen Flocken bestreut; aber es steht ihr allerliebst zu dem frisch geröteten Gesicht und den braunen, blitzenden Augen. Ich sage es ihr, und sie küßt mich stürmisch.
»Findest Du das wirklich? Aber ich weiß, Du sprichst immer die Wahrheit, selbst in solchen Bagatellen! Was Du für wunderschöne Märchenaugen hast, Hanna! Ich habe immer an sie denken müssen, und ein gewisser Herr wahrscheinlich auch, wenigstens ging er merkwürdig begeistert auf die Idee zu dem heutigen Überfall bei Euch ein.«
»Ob er nicht begeistert war, weil die Idee von seinem liebenswürdigen Bäschen ausging?«
Sie schüttelte heftig den Kopf. »Ach nein, Schönste, das weiß ich besser. Doch nun komm, noch verführerischer kann ich mich beim besten Willen nicht machen.«
Frau von Trutenau, eine große, hagere Dame mit feinen Zügen und leicht ergrauten Lockenpuffen an den Schläfen, saß kerzengerade – ich habe sie nie anders oder gar angelehnt sitzen sehen – neben Mama im Sopha, als wir eintraten.
Sie streckte mir freundlich die aristokratisch schmale, weiße Hand entgegen.
»Wie Sie gewachsen sind, liebe Hanna, und wie gut Sie sich halten!«
Sie seufzte leise und blickte auf Hilde, welche sich soeben zur Begrüßung der Zwillinge auf den Fenstertritt kauerte.
Herr Hofer, der sich sofort bei unserm Eintritt ins Zimmer in seiner Unterhaltung mit Vater unterbrochen, kam auf mich zu und erkundigte sich sehr angelegentlich, wie mir neulich die Gesellschaft in Birkenfelde bekommen, und ob man nun öfter das Glück haben würde, mich zu dergleichen Festen zu sehen.
Nach dem Kaffee musizierte Hilde, die sehr talentvoll ist, und sang mehrere Lieder. Ihre Stimme hat nicht den Umfang, auch nicht den leidenschaftlichen Klang, wie die von Rose, quillt aber so frisch und ursprünglich von innen heraus wie ein Bergquell. Besonders ihre Art, Volkslieder vorzutragen, ist entzückend. Das scheint auch Herr Hofer zu finden; er schlägt die Notenblätter um und läßt kein Auge von der Sängerin. So wie der letzte Ton verklungen ist, wendet er sich aber wieder zu mir und unterhält mich aufs eifrigste. Hilde stört ihn nicht darin, sie ist am Flügel sitzen geblieben und spricht lebhaft mit Vater über ihre Lieblingskomponisten.
Ich bin froh, daß Vater gleich nach dem Abendessen den Spieltisch herrichten, Herrn Hofers Ausflüchte nicht gelten läßt und ihm die Karten in die Hand drückt. Auch Frau von Trutenau, die sich erst sehr sträubt, wird herankomplimentiert und das Spiel beginnt. Mama sitzt strickend daneben, wir Mädchen schauen zu, doch als Herr Hofer selbst im kritischsten Moment mehr auf uns als auf seine Karten blickt, erklärt Väterchen, daß wir höchst störend auf die Spieler wirkten und darum besser thäten, ihnen unseren sinnverwirrenden Anblick zu rauben.
Wir gehorchen lachend; ich werfe im Nebenzimmer den roten Schleier über die Lampe und ziehe Hilde zu mir aufs Sofa.
»So, nun wollen wir ein gemütliches Plauderstündchen halten!«
Sie ist gegen ihre Gewohnheit ein paar Minuten schweigsam, dann fragt sie plötzlich: »Wollen wir Freundinnen sein, Hanna? Ich habe niemand in der Stadt, zu dem ich mich hingezogen fühle, und Du bist mir sympathisch.«
Es wird mir nicht schwer, ihr eine bejahende Antwort zu geben, und sie küßt mich stürmisch. Dann sagt sie ernsthaft:
»So, und nun wollen wir uns kennen lernen.«
Bei mir hat sie ihre Absicht bald erreicht, mein Leben ist vorläufig noch ein ziemlich leeres Blatt, das Schicksal hat noch wenig hinein gezeichnet. Mit Hilde ist das, wie ich jetzt erst erfahre, anders; trotz ihrer Jugend und ihrer lachenden Augen gehört sie nicht zu denen, die auf der Sonnenseite des Lebens wandeln.
»Wenn ich es recht bedenke, stand das graue Gespenst, die Sorge, schon an meiner Wiege. Wir sind arm, Hanna, haben außer Mutters Pension nur noch geringe Zuschüsse. Trotzdem könnten wir beide bequem davon leben, wenn nicht Mama eine Trutenau, eine Schenk von Trutenau wäre. Standesgemäß! Das schreckliche Wort verfolgte mich von Kindheit an, beschränkte meinen Verkehr, meine kleine Freuden, schickte mich trotz meines Sträubens in das kostspielige Pensionat und bindet mir noch heute die Hände. Wie gern verwertete ich meine Kenntnisse, meine kleinen Talente, sorgte, wie tausend andere für meinen Unterhalt. Aber wenn solche revolutionären Wünsche nur irgend laut werden, entsteigen sofort sämtliche Schenk von Trutenaus ihren Gräbern, schlagen dröhnend an ihr Wappenschild und schwingen drohend die Hellebarden gegen mich, das entartete Reis am edlen Stamme.«
Hilde lachte hell auf. »Und wenn ich noch wenigstens etwas Aristokratisches in meinem Aeußern hätte, wie Mama oder Du, schlanke Hanna; aber sage selbst, sieht man es mir auch nur im entferntesten an, daß ich in gerader Linie von den Trutenaus – nicht von der Nebenlinie, der z. B. Otto entstammt, Gott bewahre! – sondern von den echten, aus dem fünfzehnten Jahrhundert, abstamme? Aber ich schlage ihnen doch ein Schnippchen, meinen erlauchten Vorfahren«, flüsterte sie mir ins Ohr: »Ich habe in Dresden heimlich das Musterzeichnen erlernt, und abends in meinem Stübchen oder früh morgens entwerfe ich Stickmuster, zeichne Kissen, Decken und dergleichen, die mir ein auswärtiges Geschäft gut bezahlt. Mama ahnt natürlich nichts, wundert sich nur, wie billig ich stets einkaufe, und daß noch immer etwas zu einer Flasche guten Weines, dessen sie so sehr bedarf, übrig bleibt.«
Ich drückte ihr herzlich die Hand und sprach ihr aus, wie ich sie bewundere, und wie stolz ich auf solche Freundin bin.
»Aber habt Ihr denn niemand,« fragte ich, »keine Verwandten, die Euch zur Seite stehen?«
Hilde errötete tief. »Außer ganz entfernten nur noch Otto, dessen Mutter auch eine Trutenau gewesen; aber Mama behandelt ihn stets so sehr von oben herab, die bürgerliche Verwandtschaft ist ihr unbequem. Vor kurzem hätte sie fast gänzlich mit ihm gebrochen. Er hatte uns etwas in die Küche gesandt: frische Butter, ein paar Hühner und einen Korb Äpfel, und das fand sie empörend unzart, plebejisch von ihm.«
Ihre Augen füllten sich mit Thränen. »Er ist so gut, er hat ein goldenes Herz; aber die arme Mama ist so sehr von ihren Vorurteilen befangen, sie läßt nur denjenigen Gerechtigkeit widerfahren, welche das kleine Wörtchen »von« vor ihrem Namen haben.«
Unser tête-à-tête wurde unterbrochen. Nebenan wurden Stühle gerückt, Frau Major, die sich nicht so spät der Winterluft aussetzen durfte, wünschte die Heimfahrt. Als sie sich von mir verabschiedete, bat sie mich freundlich, Hilde recht bald zu besuchen, ihre arme Tochter wäre so schlimm daran, es gäbe in dem kleinen Städtchen durchaus keinen standesgemäßen Umgang. Herrn Hofers lebhaft gefärbtes Gesicht wurde noch dunkler bei den Worten seiner Verwandten. Er streifte sie mit einem halb finsteren, halb spöttischen Blick und verabschiedete sich dann auffallend rasch von uns.
* * *
Am 24. Dezember. Der Weihnachtsabend ist vorüber, und die lieben Gäste, die ihn mit uns verlebten, Frau von Trutenau und ihre Tochter, haben sich soeben in ihr Schlafzimmer begeben. Hilde und ich sind Freundinnen geworden. Der Verkehr mit ihr macht mir viele Freude, obgleich oder weil, wie sie mir in ihrer originellen Weise auseinandersetzt, unsere Naturen grundverschieden sind. » Les extrêmes se touchent, ma chère! Du bist die leichtbeschwingte Himmelstochter Poesie, ich die hausbackene Prosa. Du residierst hoch oben in Deinem Traumreich, von dem aus gesehen die Menschen fast alle Ideale sind, hast einen Ueberschuß von Phantasie, ergo bist Du dem wirklichen Leben fremd; ich sehe mich mit offenen Augen in der Welt um, rücke den Dingen resolut näher und nehme sie nicht besser und nicht schlechter als sie sind. Du folgst, wenigstens im Verkehr mit Fremden, dem alten Weisen, der da sagt, daß Reden Silber, Schweigen aber Gold sei; ich bin schwatzhaft, lache gern und habe eine entschiedene Neigung zu schlechten Witzen. Meine Hausthür steht gewöhnlich sperrangelweit offen, vor der Deinen hängt ein goldenes Schlößlein, zu welchem selbst ich nicht den Schlüssel habe.«
Doch zurück zu dem eben verlebten heiligen Abend, den ich durchaus nicht mit Stillschweigen übergehen will.
Die große Bescherung für die Gutsleute und ihre Kinder war vorüber, und wir waren eben dabei, unsere Geschenke in Augenschein zu nehmen, als es von draußen erklang: »Julklapp! Julklapp für Fräulein Hanna von Berken!«
Seit vor einigen Jahren durch diese etwas stürmische Art des Schenkens eine kostbare Vase zerbrochen wurde, hat Mama die alte, liebe Sitte des Julklappwerfens für unser Haus in Acht und Bann gethan; umsomehr überraschte mich der Ruf.
In der Thür erschien eine unförmlich vermummte Gestalt, bei deren Anblick die Kinder blitzschnell zum Vater flüchteten, schob einen umfangreichen Ballen ins Zimmer und verschwand lautlos, wie sie erschienen. Ich löse neugierig die vielfach verschlungenen Schnüre, entferne einen Bogen Packpapier nach dem andern, die Zwillinge helfen mit großer Wichtigkeit, und halte endlich nach angestrengter Thätigkeit – fast das ganze Zimmer ist mit Emballage bedeckt – ein kleines, flaches Kistchen in der Hand. Es zeigt den Poststempel Berlin, Heinz' Hand hat die Adresse darauf geschrieben.
»Aha, Fräulein Hildegard von Trutenau! Darum das erschreckte Zusammenfahren, das eilige Davonschleichen, als ich Sie heute im traulichen tête-à-tête mit dem Postboten überraschte!«
Hilde lacht vergnügt und sieht gespannt zu, wie ich die Schachtel öffne. Ein großes Couvert liegt darin und in demselben eine Kabinettphotographie. Heinz' Bild! Wie ähnlich, wie sprechend ähnlich! Die treuherzigen, guten Augen, die breite Stirn, das gewellte, üppige Haar, der Mund, um den der Ausdruck starken Willens so sichtbar hervortritt! Und doch können diese festverschlossenen Lippen so fröhlich scherzen, so weich, so herzbewegend flüstern: Liebe Hanna, mein lieber, kleiner Hans!
Sind meine Gedanken laut geworden? Hilde umarmt mich plötzlich und flüstert mir ins Ohr: »Danke, Hanna! Endlich einmal die Herzensthür geöffnet!« Während ich fühle, wie mir das Blut heiß ins Gesicht steigt, bringt mir Gretchen triumphierend ein kleines, rotgebundenes Buch, welches sie soeben bei näherer Untersuchung des Kistchens entdeckt hat.
Ich schlage das Titelblatt auf. »Von der Alm. Lieder eines fahrenden Schülers, von Egon Tesmer« steht darauf.
»Aber Hanna, was ist Dir?« fragt Hilde und fleht mich erschreckt an. »Du wirst ja bleich bis in die Lippen!«
Das seltsame, bange Gefühl, welches einen Moment mein Herz umklammerte, schwindet; ich bin heiter und glücklich, wage aber das liebe Bild nur noch verstohlen zu betrachten. Ich fürchte Hildes schalkhaften Blick. Erst als sie sich mit ihrer Mutter zurückgezogen, und ich hier in meinem einsamen Stübchen bin, nehme ich es wieder hervor. Dann bringe ich es in einen Rahmen – Roses Bild, welches derselbe bis jetzt umschloß, muß weichen – und stelle es auf meinen Schreibtisch, neben meiner Mutter Bild. Heinz hat mein Mütterchen sehr geliebt und sich nicht gescheut, mit der kleinen Hanna zu weinen, als der Tod ihr das Liebste entriß. Als man sie hinaustrug zum ewigen Schlummer, Vater sich in starrer Verzweiflung in sein Zimmer einschloß, da blieb er bei mir, wartete den Ausbruch meines Schmerzes geduldig ab und redete mir sanft und trostreich zu. Vor Erschöpfung war ich dann auf seinen Knien eingeschlafen; als ich erwachte, lagen meine Arme noch um seinen Hals; er hatte sich stundenlang nicht bewegt, um mich nicht zu wecken. Und wie mitleidig seine Augen mich ansahen, wie weich seine Stimme klang, als er sagte:
»Nicht wieder weinen, mein armes, kleines Hänschen! Deine Mutter ist im Himmel; aber Dein Vater bedarf seines Kindes. Komm, wir wollen zu ihm gehen!«
Ich kann nicht anders, ich muß die guten Augen, die da auf mich herablächeln, leise küssen. Gute Nacht, Du lieber Heinz; Gott segne Dich!
* * *
Den 26. Dezember. Gestern abend, im Begriff zur Ruhe zu gehen, fiel mein Blick auf ein kleines rotes Büchlein auf meinem Schreibtisch, die Lieder des fahrenden Schülers! Ich hatte sie in der Freude über Heinz' Bild vergessen, auch am folgenden Tage ihrer nicht gedacht.
Wir hatten Gäste bekommen; zuerst Hofer, später Wagners. Ersterer überreichte Hilde und mir frische Veilchensträuße, eine zarte Aufmerksamkeit, die ich ihm kaum zugetraut.
Hilde hat übrigens recht; trotz einer gewissen linkischen Schüchternheit, die im seltsamen Kontrast zu seiner Erscheinung steht, muß man ihren Vetter liebgewinnen: der große, kraftvolle Mann trägt ein Herz, gut und weich wie das eines Kindes, in der Brust.
Seine Bekannten sprechen mit Achtung, seine Untergebenen mit Begeisterung von ihm. Wenn er sich nur mir nicht so ausschließlich widmen wollte! Ich fürchte, ich war gestern etwas unhöflich zu ihm, besonders nach unserer anderen Gäste Erscheinen. Ich hatte aber so unendlich viel mit Tante Wagner zu plaudern! Ich mußte ihr doch erzählen, welche Freude mir ihr Sohn bereitet, und daß auch ich an eine Weihnachtsüberraschung für ihn gedacht: einen selbstgemalten Edelweißzweig, der sogar Gnade vor Hildes Künstleraugen gefunden. – Ich hatte wirklich keine Zeit für Herrn Hofer.
Als unsere Gäste uns zu später Stunde verlassen, griff ich, wie bereits gesagt, endlich zu Egon Tesmers Gedichten.
Schon die ersten Verse fesselten mich. Ich las weiter, immer weiter, bald mit lächelndem Munde, bald durch einen Thränenschleier; ich war wie in einem Zauberbann, welcher mich auch nicht losließ, als ich tief aufatmend das Büchlein schloß. Welche Sprache, wie berauschend, wie feurig und doch wie zart und innig! Wie das jubelt und klingt, singt und lacht, und doch – tönt's nicht wie leises Klagen hindurch, wie tiefes Sehnen?
In der Nacht schlief ich wenig, und wenn es geschah, quälten mich wirre Traumbilder. Ich war inmitten einer öden Wildnis, himmelhohe Berge umgaben mich, das Rauschen von Gießbächen klang an mein Ohr und eine schaurig gähnende Schlucht hemmte meinen Fuß. Wie im Nebel sah ich eine Gestalt mir gegenüber.
»Heinz!« schrie ich laut, »Heinz, komm' zu mir, ich fürchte mich!«
Aber er sah mich nicht an, er wandte sich und schritt langsam weiter.
Noch am Morgen nach dem Erwachen konnte ich mich eines seltsam bangen Gefühls nicht erwehren, wenn ich an das Traumbild dachte. Es ist kindisch, aber ich habe das Buch, dessen Lektüre mich so erregte, ganz unten in meinen Schrank gethan, ich mag es vorläufig nicht sehen.
* * *
Den 20. Januar. Herr Otto Hofer, der blonde Hüne, fängt an, mir fürchterlich zu werden. Mein ängstliches Zurückweichen hilft mir nichts, er ist mein Kavalier bei allen Gesellschaften, Schlittenfahrten und Eisfesten der letzten Zeit. Wir sind durch Hilde und ihn in einen wahren Strudel von Vergnügungen geraten, und er tanzt, plaudert, läuft Schlittschuh mit mir, führt mich zu Tisch, als ginge es gar nicht anders.
Man macht mir bereits lächelnde Andeutungen, und Mama vor allen preist ihn in allen Tonarten. Er wäre der tüchtigste Landwirt weit und breit, sein schönes Rittergut schuldenfrei, sein Charakter tadellos, überhaupt – und das ist gewöhnlich des Pudels Kern – ein Ziel, aufs innigste zu wünschen für jedes heiratslustige Jungfräulein.
Wie oft höre ich: »Solch ein Mann ist nun einmal die beste Partie für ein Mädchen, das lasse ich mir nicht ausreden. Ein Studierter, z. B. ein Doktor, ist ja auch nicht zu verachten; aber Du wirst zugeben, Hanna, er ist nicht zu vergleichen mit ihm. Solch reicher Grundbesitzer sitzt auf seiner Scholle wie ein König, kann thun was ihm beliebt, darf nur anordnen, befehlen; der Doktor muß bei Nacht und Nebel hinaus, muß aufspringen, wenn Hinz und Kunz ihn rufen. Und wie störend ist das für die Hausfrau! Von richtiger Zeiteinteilung keine Rede, von regelmäßigen Mahlzeiten noch weniger. Bedenke nur, wenn man nun z. B. Fische hat, oder eine Mehlspeise, die so leicht zusammenfällt, und der Mann kommt statt um eins, um sechs Uhr nach Hause.«
Das alles ist höchst unangenehm für mich, wäre es aber noch viel mehr, wenn Hilde, die ein unleugbares Herzensinteresse an ihrem Vetter hat, die Sache von der für sie tragischen Seite nähme, wie sie anfangs geneigt schien. So ist sie aber heiter wie sonst und streift höchstens, wenn er sich gar zu hingebend um mich bemüht, Herrn Hofer mit einem sonderbaren, aus Schalkhaftigkeit und Mitleid gemischten Blick. Hoffentlich kommt der Abtrünnige nun bald zur Besinnung und kehrt zu ihr zurück. Denn sie ist trotz alledem und alledem die Erwählte seines Herzens; das verraten seine Augen immer wieder, wenn er ihren Liedern lauscht.
* * *
Den 4. Februar. Von Rose habe ich diesen Blättern lange nichts anvertrauen können; erst heute kam, abgesehen von flüchtigen Grüßen, die bald aus Wien, München oder einer anderen Großstadt zu mir geflattert waren, ein Lebenszeichen von ihr.
Es ist aus Paris datiert und lautet:
»Zum ersten Male in Paris sein, noch dazu auf der Hochzeitsreise, und doch Briefe schreiben, ist das nicht wert, unter die Weltwunder aufgenommen zu werden? Ermesse daraus, chérie, wie lieb ich Dich habe ... Paris ist die Schönheit, das Juwel, die Auserkorene unter den Städten, eine Sirene, die herzbethörend so lange lockt und winkt, bis alles rettungslos in ihrem Strudel untersinkt. Dieser Strudel ist aber reizend, Kleine, das kannst Du mir, die nun schon seit 6 Wochen munter darin umherschwimmt, glauben. Axel hält tapfer mit; keiner meiner Einfälle – und ich habe deren recht viele – ist ihm zu toll, für alle hat er ein bejahendes Lächeln. Er meint, er wäre durch mich noch einmal jung geworden, und ich muß es glauben, wenn ich bedenke, welch guter Kamerad er ist und wie wenig ihn meine Quecksilbernatur ermüdet. Hoffentlich hält diese seine zweite Jugend recht lange vor; ich bin noch gar nicht ruhebedürftig und verspüre nicht die mindeste Sehnsucht nach unserem home an der Ostsee, in welches ich noch immer zeitig genug als sittsame Schloßfrau einziehe. Axel freilich schwärmt von seinem alten Ahnenschloß. Es soll sehr schön liegen, einsam und wogenumrauscht; aber ich mag keine Schlummerlieder, selbst wenn Najaden sie singen, ich brauche Sirenensang: Musik, Gläserklirren, Lockenwehen, Fächerrauschen. Vorläufig tönt das alles recht oft an mein Ohr. Axel hat hier viele und glänzende Verbindungen von einem früheren Aufenthalt, welche er jetzt wieder aufgenommen. Ich habe bereits manchen, durch Luxus und Esprit gleich ausgezeichneten Salon kennen gelernt, in welchem ich mich vortrefflich unterhalte; nur schade, daß wir ihn gewöhnlich gerade dann verlassen, wenn es am interessantesten wird, d. h. wenn die Huldigungen für la belle allemande – Deine rote Rose, Kleine! – ihren Höhepunkt erreichen.
Mein Gatte hat bei seinen sonst sehr schätzenswerten Eigenschaften ein ausgesprochenes Talent zum Othello.
Hu, das Lächeln, mit dem er neulich dem jungen, bildschönen Vicomte, der so dringend um einen Tanz, eine einzige kleine Quadrille, bat, sagte: »Pardon, mein Herr, die Baronin hat sich jedenfalls ungeschickt ausgedrückt, sie wünscht nicht zu tanzen!« Ich tanze nie, so sehr es mir auch oft in den Füßen zuckt und prickelt; die Desdemona, welche ich im Berliner Schauspielhause sah, ist mir noch in zu schreckensvoller Erinnerung.
Du weißt doch, Hanna, daß wir auch die Reichshauptstadt besuchten, ehe wir hierher gingen.
Axel hat eine Schwester dort, Baronesse Alice, ein altes, bigottes Fräulein, welches mir sehr herablassend entgegenkam. Sie änderte aber bald ihr Benehmen. Ihr Bruder hat die richtige Art, seiner kleinen Frau Achtung zu verschaffen, selbst einer so hochmütigen, verdrehten Person gegenüber, wie diese süße Alice.
Du siehst, meine besorgte Freundin, mein getreuer Eckhard, Deine rote Rose ist in guter Hut. Sorge Dich nicht um sie; aber behalte sie lieb, denn Deine Liebe kann sie nicht entbehren.
Bringe mich durch freundliche Grüße bei Deinen Eltern und den Druwäppeln in Erinnerung und versprich mir schon jetzt, mich im Frühling auf Schloß Scholten zu besuchen. Willst Du?
Mit den Lerchen halten wir unsern Einzug dort, und dann kommst Du bald, recht bald zu Deiner Dich wirklich nicht länger entbehren könnenden
Rose.«
Ich sprach mit dem Vater von ihrem Wunsch. Er lachte. »Ei, ei, kleine Freifrau, das sieht nicht sehr nach ehelichem Glück aus!«
Ich mußte ihm im stillen recht geben; ist es nicht, als ob Rose sich vor dem Alleinsein mit ihrem Manne fürchtet? Ihrer Einladung werde ich aber keineswegs so bald folgen. Was würde denn mein alter, lieber Wald sagen, wenn ich ihn nicht im Lenzesschmuck begrüße, und was Heinz, wenn er seinen Hans nicht findet?
Wenn es doch nur nicht so lange bis Pfingsten wäre!
Dann kommt er aber sicher, hoffentlich für recht lange; auch sein Freund, Herr Tesmer, wird zu der Zeit in Birkenfelde erwartet. Ich habe übrigens die Poesien des letzteren wieder aus ihrem Versteck geholt, es war kindisch, sie zu verbannen, weil ich zufällig eine schlechte Nacht hatte. Vater las sie auch, war aber nicht so begeistert wie ich.
»Recht hübsch,« meinte er, »ein unleugbares Talent; nur schäumt der junge Most vorläufig noch zu sehr. Zu viel Schwärmerei, zu großer Bilderreichtum; weniger wäre mehr gewesen.«
* * *
Den 25. Februar. Als ich heute um die zwölfte Mittagsstunde, mit einer Handarbeit beschäftigt, hier oben in meinem kleinen Reich saß, trat Mama, hastiger als es sonst ihre Art ist, herein.
»Da bist Du ja, Hanna! Ich suchte Dich überall. Herr Hofer ist unten.«
Ich sah verwundert von meinem Stickrahmen auf. »Du kommst selbst, Mama, und läßt Deinen Gast allein? Oder ist Vater schon aus der Stadt zurück?«
Sie verneinte, strich mein Haar glatt, nestelte an meiner Kragenschleife und sagte dazwischen: »Es ist ein großes Glück für Dich, Hanna, das bedenke! Wer weiß, ob sich jemals etwas Ähnliches für Dich findet, also sei vernünftig und greife zu. Das schöne Gut, der beste Weizenboden breit und weit und dann –«
Ich wollte mich erschreckt losmachen, doch sie hielt meine Hand fest, ging mit mir die Treppe hinunter und schob mich ohne weiteres in das Besuchszimmer, dessen Thür sie hinter mir zuzog.
Herr Hofer, der am Fenster gestanden, wandte sich bei meinem Eintreten um und kam auf mich zu. Er war sorgfältig gekleidet, die Hand, welche er mir reichte, steckte im gelblichen Lederhandschuh.
So standen wir uns wortlos ein paar Sekunden gegenüber, beide gleich verlegen und erregt. Endlich brach Herr Hofer das Schweigen.
»Sie wissen, warum ich Sie allein zu sprechen wünschte, Fräulein Hanna?«
»Ich ahne es,« war meine beklommene Antwort.
Er trat näher zu mir heran. »Fräulein Hanna, ich kann nicht viele Worte machen, aber ich habe Sie lieb, von ganzem Herzen lieb, und ich bitte Sie, mein zu werden, mein Weib.«
Ich schwieg verwirrt, und er fuhr freier fort: »Ich weiß, Fräulein Hanna, ich verlange viel. Ich bin ein schlichter, unbeholfener Gesell, der die Hand nicht gerade nach der holdesten Blume ausstrecken sollte; aber wenn Sie es dennoch mit mir versuchen wollten, sollte es Sie bei Gott nicht gereuen. Ich würde Sie auf Händen tragen, Hanna, Ihnen jeden Wunsch von den Augen ablesen.«
Der warme Ton, der gute, ehrliche Blick, mit dem seine Augen die meinen suchten, that mir weh. Ich entzog ihm leise meine Hand. »Sprechen Sie nicht weiter, Herr Hofer,« bat ich leise, »ich kann Ihren Wunsch nicht erfüllen!«
Er atmete schwer und wurde totenblaß, dann schoß ihm das Blut jäh ins Gesicht.
»Also doch,« rief er rauh, »Sie lieben einen andern!«
Ich sah erschreckt, fast zornig zu ihm auf, ich hatte das Gefühl, als ob eine täppische Hand an etwas Heiligem rüttle.
»Nein,« sagte ich, während eine heiße Blutwelle mein Gesicht erglühen ließ, »ich liebe keinen andern, aber ich liebe auch Sie nicht! Und auch wenn ich es thäte,« setzte ich ruhiger hinzu, »Ihre Frau könnte ich darum doch nicht werden.«
»Meine Frau könnten Sie doch nicht werden?« wiederholte Herr Hofer. Maßloses Staunen sprach aus seinen Zügen.
Ich legte leise meine Hand auf seinen Arm und sah ihn bittend an:
»Darf ich es Ihnen erklären, Herr Hofer? Werden Sie mir nicht zürnen?«
»Ich Ihnen zürnen, wenn Sie mich mit diesen Augen ansehen?«
Ich senkte den Blick, und obgleich mein Herz fast hörbar klopfte, sprach ich schüchtern, dann immer mutiger:
»Ich weiß, Herr Hofer, ich bin ein junges, unerfahrenes Mädchen, das in so ernsten Dingen kaum eine Meinung haben sollte; aber eins weiß ich doch ganz genau, das nämlich, daß Sie sich in mir täuschen, daß ich nicht die Macht besitze, Sie glücklich zu machen, so glücklich, wie es ein so braver Mann verdient.«
Er wollte auffahren, mich unterbrechen, doch ich fuhr rasch fort:
»Ich passe nicht für Sie. Schon der Gedanke, an der Spitze eines so großen Haushaltes zu stehen, wie des Ihrigen, ängstigt mich, und dann, ich fürchte, Herr Hofer, ich bin auf die Dauer sehr langweilig, ich besitze keine anregenden Talente und habe noch nicht oft in meinem Leben einen Menschen zum herzlichen Lachen gebracht. Und ich weiß, Sie lachen gern, lieben fröhliches Plaudern und Scherzen. Sie müssen eine Frau haben mit klugem Köpfchen und rührigen Händen, eine Frau, die so anmutig zu plaudern versteht, daß die langen Winterabende zu Feststunden werden, die ein süßes Lied in Bereitschaft hält, wenn Sie ermattet aus Feld und Wald heimkehren, und die Sie in erster Reihe liebt, so recht von Herzen liebt!«
Ich wunderte mich selbst, wie mir die Worte flossen; aber ich dachte an Hilde, an ihr Glück, und das gab mir Mut.
Herr Hofer hatte mir anfangs mit zusammengezogenen Brauen zugehört; nach und nach trat eine dunkle Röte in sein Gesicht, und seine Augen wandten sich unsicher ab. Ich sah, wie es in ihm arbeitete, und störte ihn nicht.
Endlich sah er auf. Seine Züge hatten einen weichen Ausdruck, den ich nie in ihnen bemerkt, in seinen Augen schimmerte es feucht.
»Sie haben mir einen schönen Traum zerstört, Fräulein Hanna,« sprach er weich, »aber ich darf Ihnen deswegen nicht zürnen. Sie sind ein braves, edles Mädchen. Meine Liebe darf ich Ihnen nicht mehr anbieten, Sie wollen sie nicht; aber meine Freundschaft, meine treue, ergebene Freundschaft, darf ich sie Ihnen darbieten fürs Leben?«
Ich reichte ihm freudig die Hand, welche er an seine Lippen zog.
»Und nun erlauben Sie, daß ich Ihnen Lebewohl sage. Ich bin nicht in der Stimmung, über Gleichgültiges zu sprechen. Bei Ihrer Frau Mutter entschuldigen Sie mich wohl.«
An der Thür kehrte er noch einmal um. »Ich gehe für die nächsten Wochen nach England, Fräulein Hanna. Ein neues Unternehmen, welches ich plane, verlangt diese. Reise; darf ich, heimgekehrt, mich nach Ihrem Befinden erkundigen?«
»Das ist sogar Ihre Schuldigkeit,« erwiderte ich warm, »wir sind ja jetzt Freunde!«
Er lächelte mühsam, und ehe ich es verhindern konnte, neigte er sich wieder über meine Hand. »Leben Sie wohl, Hanna! Es wird mir schwer, sehr schwer werden, diese Stunde zu vergessen, doch Gottes Segen über Sie!«
Ich stand noch in tiefen Gedanken mitten im Zimmer, als Mama eintrat.
»Was hat das zu bedeuten?« rief sie aufgeregt. »Er ist fort? Seid Ihr denn nicht einig?«
Ich umschlang ihre Schulter. »Ach, Mamachen, er liebt mich ja gar nicht; er liebt seine Cousine Hilde und sie ihn!«
Sie wich ein wenig zurück und sah mich mißtrauisch an.
»Hildegard liebt er, und Dich will er heiraten?«
Ich machte ein ungeheuer wichtiges Gesicht. »Ja, Mama, das ist schon so! Diese weisen Herren der Schöpfung, die so vieles wissen, wissen manchmal nicht einmal, wie es in ihrem eigenen Herzen ausschaut. Da muß man ihnen denn ein wenig zu Hilfe kommen, ihnen ein Spiegelchen vorhalten. Das that ich soeben bei Herrn Hofer, und denke Dir, Mama, da sah er dann sofort, daß nicht ich, sondern Hilde tief drinnen in seinem Herzen wohnt.«
Mama schüttelte mißmutig den Kopf. »Du bist ein Kindskopf, Hanna, und hast höchst unvernünftig gehandelt. Wenn Du es nur nicht später bereust; solch schönes Rittergut mit Brennerei, Brauerei und allem, – zum zweiten male wird Dir so etwas nicht geboten werden. Und gänzlich schuldenfrei hat er's!« Sie seufzte tief auf, dann schob sie mir einen großen Schlüssel in die Hand. »Nun aber gehe nur selbst nach dem Weinkeller und trage die Flaschen vom Büffet zurück, sie gehören linker Hand in die Ecke. Die Mamsell und Dürten brauchen es nicht zu wissen, daß ich vorhin so eilig vom Besten herauf holte.«
* * *
Den 26. Februar. Vater war erst am späten Abend heimgekehrt, erst heute beim Morgenkaffee sah ich ihn. Ich flog auf ihn zu und flüsterte ihm ins Ohr: »Bist Du sehr böse, Väterchen, daß ich nicht Frau Otto Hofer werden will?
Er setzte eine ernste Miene auf, die ihm aber schlecht gelang. »Gewiß bin ich das! Und darf man fragen, weshalb das Fräulein den ehrenhaften Antrag ausschlug, auf wen es warten will?«
»Du böser, böser Vater! Sieh nur, wie rot ich geworden bin! Muß ich denn durchaus auf jemand warten, wenn ich Hilde nicht ihren zukünftigen Herrn und Gebieter fortnehmen will? Gewiß, Väterchen, Du wirst sehen, sie wird seine Frau, ich aber bin und bleibe Beider treue Freundin, und so ist es für alle Teile am besten.«
»Ein Salomonischer Ausspruch,« lachte Vater amüsiert, »nun: qui vivra, verra!«
* * *
Den 15. Mär7. Seit Wochen hatte ich Hilde nicht gesehen. Sie ließ sich nicht blicken, und ich konnte nicht von Hause fort, weil Papa stark erkältet war und über Gliederschmerzen klagte. Ich pflegte ihn, so gut ich es vermochte, las ihm vor, fing Kissen und Decken, die fortwährend Meinung zum Desertieren von dem Sofa zeigten, ein und trank sogar statt seiner mit heroischer Selbstüberwindung verschiedene Tassen Kamillenthee, Mamas Universalheilmittel. Das alles half so vorzüglich, daß Vater heute feierlich erklärte, den anziehenden Feind, den bösen Rheumatismus, aus dem Felde geschlagen zu haben, und folglich meiner Samariterdienste entbehren zu können.
Eine Stunde darauf stand bereits der Wagen vor der Thür, der mich zu Hilde bringen sollte, nach deren lustigem Geplauder ich schon lange große Sehnsucht verspürte. Ich traf Frau von Trutenau noch blasser als sonst. Die arme Frau kränkelt viel, wenn auch nie ein Wort der Klage über ihre Lippen kommt; Hilde aber erschien mir glücklich, zerstreut und aufgeregt. So bald wie thunlich, zog sie mich in ihr bescheidenes Stübchen.
»Denke Dir nur, Hanna,« rief sie, kaum als sich die Thür hinter uns geschlossen, »das große, wunderbare Glück! Du weißt, ich habe mich an der Gewerbeausstellung in L. beteiligt, es kam mir ja selbst dreist vor, aber ich schickte doch die Zeichnung zu der Portiere, welche Dir so sehr gefiel, ein.«
»Das reizende Laubegewinde mit den Schwälbchen und den flatternden Insekten, Hilde, und es hat einen Käufer gefunden?«
Sie nickte glückselig: »300 Mark, liebes Herz! Heute kamen sie an, lauter blanke, schöne Stücke, mein ganzer Tisch war damit bedeckt.« Sie umfaßte mich und wirbelte jauchzend mit mir durchs Zimmer. »Und zum Frühling, wenn erst die linden Lüfte erwacht sind, gehe ich mit Mama nach Reichenhall, wohin sie der Arzt schon längst senden wollte. Da will ich mir mein Mütterchen schon gesund pflegen!«
»Hast Du ihr denn nun gebeichtet?« fragte ich teilnehmend. »Du mußtest es wohl? Wie solltest Du sonst Deinen plötzlichen Reichtum erklären?«
Hilde wurde plötzlich ernst. »Wo denkst Du hin, Hanna? Mama darf die Wahrheit nicht ahnen, sie rührte sonst keinen Pfennig von dem Gelde an. Ein Lotteriegewinn, das war der Einfall, der mich rettete, als das Geld ankam.«
Sie hielt mühsam ihre Thränen zurück. »Mama ist so gut, hat ein so edles Empfinden, ein so mildes, gerechtes Urteil; aber alles bis zu einem gewissen Punkte. Wo ihr Standesbewußtsein in Frage kommt, erkenne ich sie nicht wieder.
Es wundert mich nur, daß wir nicht noch mehr damit anstoßen, wie es bereits geschieht, vor allem, daß sich Otto nicht ganz dadurch verscheuchen läßt. Für die nächste Zeit freilich verbietet sich sein Besuch von selbst. Du weißt doch, Hanna, daß er schon seit einiger Zeit in England, in Hull, weilt?«
Ich hielt ruhig ihren aufmerksam forschenden Blick aus.
»Gewiß, Hilde, er hat uns ja einen Abschiedsbesuch gemacht. Allerdings nur flüchtig, Vater war nicht zu Hause.«
Sie lächelte etwas gezwungen. »Als wenn Dein Papa ihn nach Berkenhagen zöge! Ich glaube übrigens, er sprach davon, daß er bei Euch gewesen. Er war den ganzen Nachmittag vor seiner Abreise bei uns; ich mußte ihm alle seine Lieblingslieder singen und ihm versprechen, viel mit ihm zu musizieren, wenn er heimgekehrt sein wird. Mama freilich wird das keineswegs recht sein; sie hat so unendlich viel an ihm auszusetzen und geht nie aus ihrer vornehmen Reserve ihm gegenüber heraus. Bald ist seine Ausdrucksweise zu schlicht, sein Lachen zu laut, seine Bewegungen zu wenig beherrscht, dann wieder sein Gesicht zu rot, sein Haar nicht gepflegt genug und seine Hand zu plebejisch geformt.«
Die Thränen wollten sich nicht zurückhalten lassen, Hilde weinte bitterlich. »Als wenn die Form der Hände in Betracht käme gegen ein so kindergutes, goldtreues Herz.«
Ich suchte sie zu trösten, »Weine nicht, Hilde,« bat ich, »Du wirst sehen, es wird noch alles gut. Schließlich wird Deine Mutter dem Glück ihrer Tochter nicht im Wege sein. Und schlimmsten Falles stecken wir uns hinter meinen Vater; Deine Mama giebt viel auf ihn.«
Sie wurde rot wie ein Pfingströslein. »Was Du nur denkst, Hanna! Otto würde Augen machen, wenn er Dich hörte!«
Sie war sichtlich froh, als das eintretende Mädchen, welches uns zu Frau von Trutenau beschied, unser Gespräch unterbrach.
Ich blieb noch ein Stündchen, dann fuhr ich zufriedenen Herzens in dem leise herabrieselnden Regen heim.
Es wird Frühling. Überall rinnen die Wasser, plätschert es von fallenden Tropfen, schmilzt Eis und Schnee. Nun sprengt die Erde die Bande, welche der Winter um sie gelegt, wie lange noch, und sie schmückt sich mit grünem Gewande, mit duftendem, leuchtenden Blütenkranz, den jungen Herrscher, den schönen König Lenz würdig zu empfangen.
Und auch mein Herz ist froh und jubelt ihm entgegen. Ist es so glückerfüllt, weil es ein wenig zu Hildes Herzensglück beitragen durfte, oder hofft es, daß der nahende Frühling auch ihm etwas bringen könnte, vielleicht sein eignes Glück?
* * *
Den 5. Mai. Mein heutiger Geburtstag brachte mir neben strahlendem Sonnenschein, den ich als gutes Omen für mein neues Lebensjahr betrachten will, viel Schönes; als Schönstes aber eine Schnur echter Perlen, welche ich als Kind öfter an dem schlanken Halse meiner Mutter bewundert hatte.
Als ich sie umlegte, durchzuckte es mich eigentümlich.
»Perlen bedeuten Thränen!« hatte ich damals zu Rose gesagt.
Aber dann lächelte ich über mich selbst. Was sollte mir Schlimmes begegnen? War ich nicht jung und gesund, behütet von der Liebe des besten, gütigsten Vaters, und war nicht Pfingsten, das liebliche Fest, nahe, das mir meinen guten Kameraden, meinen treuesten Freund, bringen würde? Ach, das Leben ist so schön, so sonnig, wie kann man da nur trübe Gedanken haben! Heute erhielt ich wieder Rosen von Heinz, dieses Mal glühend rote, dazu nur die Worte: »Auf frohes Wiedersehen!«
Noch ein paar kurze Wochen, dann ist er hier!
Wie schade, daß Vater gerade dann nicht zu Hause ist, er muß nach Teplitz, um dem Rheumatismus, welcher vor einiger Zeit seine Visitenkarte bei ihm abgab, das Wiederkommen zu verleiden, wie unser Hausarzt kategorisch erklärte. Auch Hilde ist mit ihrer Mutter dann bereits in Reichenhall, sie gehen schon in den nächsten Tagen dorthin.
Von ersterer erhielt ich heute ein liebenswürdiges Geschenk, eine reizend ausgeführte Zeichnung, welche meinen jetzt wieder fast täglich besuchten Lieblingsplatz im Walde, die alte Rotbuche darstellt. Sie hat mir eine große Freude damit bereitet, wenngleich meine scharfen Augen sofort das zierliche Herz mit Heinz' und meinen Initialen auf dem rissigen Stamm entdeckten.
Hilde kann das Necken nicht lassen; besonders seitdem Herr Hofer heimgekehrt und häufiger Gast bei Trutenaus ist, sprudelt sie vor Uebermut.
Mit letzterem traf ich schon mehrere Male in ihrem Hause zusammen. Anfangs konnte er sich einer leichten Befangenheit nicht erwehren; nach und nach aber gab ihm meine Ruhe seine Sicherheit wieder, wir verkehren jetzt wie alte Freunde miteinander. Ein prächtiger Strauß aus seinem Treibhause schmückt heute meinen Geburtstagstisch; daß Herr Hofer ihn mir aber selbst überreichte, freute mich am meisten.
* * *
Den 25. Mai. Pfingsten ist gekommen und dieses Mal in Wahrheit als liebliches Fest, wie es der Dichter besingt.
Wie blau heute der Himmel strahlte, wie der Flieder duftete und wie die Nachtigall sang! Sie saß tief drinnen im Syringengebüsch und schmetterte, jauchzte und schluchzte, als wolle es ihr die kleine Brust zersprengen vor Weh und Seligkeit. Ich ging leise näher und lauschte wie verzaubert, ich hätte stundenlang so stehen mögen.
Aber meine kleinen Schwestern waren anderer Meinung, schlichen an mich heran und zupften an meinem Kleide, an meinen lang herabhängenden Zöpfen, um mich an die Wirklichkeit, vor allem an ihre eigenen, kleinen Personen zu erinnern. Ich hatte ihnen diese Stunde vor Tisch versprochen, da half kein Nachtigallensang, kein Zauberbann; mein Wort mußte ich halten.
»Haschen, Hanna, bitte, bitte!« So jagten wir denn die sauber geharkten Parkwege auf und ab. Die Kinder hatten es sich in den Kopf gesetzt, die große Schwester zu fangen, waren voll Eifer und kamen mir oft so nahe, daß ich Ursache hatte, für die flatternden, granatroten Schleifen meines hellen Sommerkleides zu fürchten. Endlich sollten sie das heißersehnte Ziel erreichen – Gretchens rote Unterlippe zuckte bereits bedenklich – nur noch einmal den breiten Hauptweg hinunter, die Siegesfreude zu erhöhen.
Eine blitzschnelle Wendung, die Flechten fliegen mir um den Kopf, eine Schleife löst sich daraus und flattert weit ab, gerade auf einen Herrn zu, der soeben zwischen den blühenden Fliederbüschen sichtbar wird, »Heinz? Wirklich Heinz?« –
Er bleibt stehen, und nun wird eine schlanke Gestalt hinter ihm sichtbar, zwei große, strahlende Augen leuchten mir entgegen, senken sich in die meinen, immer tiefer und tiefer, bis in das Herz hinein. Wie weh sie thun, und wie es zuckt und sich windet, das arme Herz!
»Hanna, mein Gott, was ist Dir? Du wirst ja totenblaß!«
Das ist Heinz' Stimme, und nun ist es vorüber!
Ich atme tief auf, das Blut kehrt vom Herzen zurück und steigt mir glühend in Gesicht.
»Du hast Dich zu sehr angestrengt, Hanna! Wie kann man nur so wild laufen!«
Ich kann schon wieder lächeln und dem mich besorgt Anschauenden die Hand reichen. »Es ist nichts, Heinz, wirklich nichts! Und nun: Willkommen zu Hause!«
Er sieht mich lieb an und hält meine Hand fest.
»Herzlichen Dank, liebe Hanna, und nicht wahr,« – er wendet sich halb zu seinem Begleiter, dessen unbedecktes Haar in der Sonne goldig funkelt – »Dein freundlicher Gruß gilt auch zugleich meinem Freunde und unserem lieben Gast, Herrn Egon Tesmer? Fräulein von Berken, lieber Egon, welche Dir dem Namen nach keine Fremde mehr ist.«
»Und welche Ihnen außer einem herzlichen ›Willkommen in Berkenhagen!‹ noch vielen Dank für Ihre schönen Gedichte schuldet, Herr Tesmer,« sage ich freundlich.
Des Fremden Augen strahlen zu mir auf, während er sich tief verneigt.
»Vielen Dank Ihnen, mein gnädiges Fräulein, für Ihre gütigen Worte. Fast zürnte ich Heinz, daß er Ihnen das schlichte Büchlein gesandt, es schien mir solcher Ehre nicht würdig; aber nun, da es Ihnen ein wenig gefallen, reut es mich nicht, und erhöht seinen geringen Wert in meinen Augen.«
Seine Stimme klingt tief und weich, ich muß unwillkürlich an die Glocke der Dorfkirche denken, deren Klang zu uns herübertönt an stillen Abenden. Ich will die Herren bitten, mir ins Haus zu folgen, doch die Zwillinge unterbrechen mich. Erst hatten sie scheu von weitem gestanden – die fremde Erscheinung hatte sie eingeschüchtert, nun kamen sie näher, Schritt für Schritt.
»Guten Tag, Onkel Heinz, Du siehst uns wohl gar nicht?« fragte Gretchen zaghaft. »Lieschen ist auch da!«
Letztere Bemerkung war im Grunde genommen höchst überflüssig, die Genannte hatte sich bereits Heinz' linker Hand bemächtigt.
»Du, Onkel Heinz, hast Du uns auch was mitgebracht?«
Das klang sehr gedämpft und zögernd, hatte aber doch zur Folge, daß der Befragte sofort eine große Düte hervorzog und in die begehrliche, kleine Hand legte. Herr Tesmer folgte lächelnd seinem Beispiele.
»Holder Frauen Gunst kann man nie früh genug erringen! Hier, meine kleinen Damen; bekomme ich nun auch ein Händchen?«
Gretchen reichte ihm entzückt ihren kleinen, roten Mund, und während er sich lächelnd zu ihr herabbeugte, zupfte Lieschen:
»Du, Onkel, wie heißest Du?«
»Onkel Egon, mein Fräulein!«
Die Düten wurden mit beiden Händen fest ans Herz gedrückt, und nun rannten die glücklichen Besitzerinnen vor uns her, dem Hause zu.
»Mutting, Mutting, Onkel Heinz ist gekommen und Onkel Egon, und zwei große, große Zuckerdüten!«
Mama tritt den Herren gemessen freundlich, wie es ihre Art ist, entgegen, spricht ihr Bedauern aus, daß der Hausherr abwesend, gratuliert Heinz zum glücklich bestandenen Staatsexamen, blickt dabei aber doch mit leichtem Staunen in das schöne Gesicht des Fremden.
»Der Dichter, nicht wahr?« fragt sie, nachdem wir alle im sonnendurchfluteten Salon Platz genommen.
Herr Tesmer verbeugte sich lächelnd und Mama fuhr fort:
Ist das denn nun Ihr eigentlicher Beruf, Herr Tesmer; ich meine das Schreiben und Versemachen?«
Ich bleibe Heinz die Antwort auf eine Frage schuldig und sehe interessiert auf. »Ja, Herr Tesmer, werden Sie nun ganz Ihrem schönen Talente leben?« frage auch ich.
Heinz beugt sich in seinem Sessel vor und lacht lustig auf. »Und Themis, die strenge Göttin, zu deren Fahne er geschworen? Der arme Egon, schwer genug ist's ihm bisher geworden, ihr die Treue zu halten.«
»Und wird ihm auch in Zukunft schwer fallen, fürchte ich. Aber ich werde es wohl müssen, gnädige Frau, mein gnädiges Fräulein. Der Weg zum Parnaß ist steil und mühsam, ohne Schatten und Ruhepunkte, mit Dornen und spitzen Steinen reich besät. Viele, gar viele betreten ihn dennoch, erzwingen sich mühsam Schritt für Schritt, lassen sich von den Dornen blutig stechen, von den Steinen verwunden, von Wind und Wetter zerzausen – um schließlich doch auf halbem Wege ermattet stehen zu bleiben oder gar, begleitet von dem Gelächter einer schadenfrohen Menge – denn woran übt die stumpfe Masse lieber ihren Witz, als an unverstandenem Geistesmühen? – das Gleichgewicht zu verlieren und hinabzustürzen.«
Und da ist es denn wenigstens ein Trost, sich auf dieser schnöden Erde als wohlbestellter Richter, Anwalt und dergl. wiederzufinden. Das wolltest Du doch sagen, Egon?«
Der Angeredete lächelte, schneeweiße Zähne blitzen unter dem goldblonden Lippenbärtchen hervor.
»So ungefähr, Heinz! Doch habe ich noch ein geheimes Hoffen für die Zukunft. Von jeher war die Themis dem Apollo hold. War sie es doch von all den strahlenden Göttinnen, die ihm, als er, freudig begrüßt von Himmel und Erde, ans Licht trat, die Schale reichte mit Nektar und Ambrosia, der Götterspeise. Und sie ist ihrer Neigung treu geblieben! Schon mancher ihrer Jünger hat neben ihr dem schönen Gott der Lieder huldigen dürfen, hat mitten im Aktenstaube seine Leier gestimmt zu so hellem Klang, daß ihr Widerhall noch heute tönt in vieler Menschen Herzen. Und ich bete zu ihr, der hehren Göttin, und hoffe, auch mir gestattet sie solche Gunst!«
Er schwieg, ein Sonnenstrahl streifte seine weiße, schwärmerisch erhobene Stirn. War es ein Gruß der Göttin, die ihm Gewährung winkte?
Mamas Stimme unterbrach das sekundenlange Schweigen. Sie hatte Herrn Tesmer kopfschüttelnd zugehört, nun sagte sie trocken:
»Also, Sie meinen wirklich, Herr Tesmer, ein ernstes Amt, und solche Allotria – ich verstand doch recht, Sie wollen neben Ihrem Amt das Dichten weiter betreiben? – ließen sich so ohne Weiteres unter einen Hut bringen? Wenn Sie sich da nur nicht irren, mein lieber Herr, wenn nur nicht eins neben dem andern Schaden erleidet. Ich gestehe Ihnen ganz aufrichtig, ich für mein Teil würde z. B. einem Rechtsanwalt, der Gedichte macht, bei Leibe keinen Prozeß anvertrauen; ich würde fürchten, daß ihm das Interesse für meine prosaische Sache fehlt. Und wie ich, dürften viele Menschen denken. Und nehmen Sie 'mal an: Sie schreiben da einen Roman, oder eine Ballade, oder ein Theaterstück, und man platzt Ihnen da mitten hinein mit Grenzstreitigkeiten oder mit einem verwickelten Erbschaftsprozeß, – wem wollen Sie da zuerst gerecht werden, Ihren Phantasiegestalten oder Ihren Klienten?«
Herr Tesmer war zuerst nervös zusammengezuckt, nun verbeugte er sich artig. »Gnädige Frau nehmen Anteil an meinem Ergehen, und ich bin dankbar dafür. Sollte es aber in der That so schwer sein, in der wirklichen Welt zu arbeiten und in der idealen zu leben? Ich glaube es nicht, und die Literaturgeschichte aller Nationen giebt mir recht. Platens Wort: »Morgens zur Kanzlei mit Akten, abends auf dem Helikon,« klingt längst nicht mehr spöttisch. Muß ich Sie erst erinnern, gnädige Frau, an Männer, wie –«
Mama unterbrach ihn abwehrend. »Geben Sie sich keine Mühe, Herr Tesmer, ich bin eine praktische Frau und in diesem Punkte schwer zu überzeugen. Meiner Tochter habe ich auch stets von dem Versemachen und dem Gedichtelesen abgeraten – es kommt im Leben keine rechte Hausfrau dabei heraus! Aber ich fürchte, sie läßt es noch immer nicht. Ihre Lieder, die ja auch soweit ganz nett sind, muß sie längst auswendig können, so oft hat sie dieselben gelesen.«
Ich war dunkelrot geworden und senkte den Blick vor den leuchtenden, blauen Augen, welche die meinen suchten. Während dessen heftete Mamas Blick sich forschend auf mein Kleid oder meine Flechten.
»Du hast eine Schleife verloren!«
Gretchen, die auf einem Fußkissen hockt, schiebt einen großen Bonbon in den Mund, schreit aber nichtsdestoweniger sehr deutlich durch das Zimmer: »Hab nur keine Angst, Onkel Heinz, ich sag es nicht, daß Du sie hast, dort in der Brusttasche!«
Heinz wird rot wie das Stückchen Band, welches an der bezeichneten Stelle hervorlugt, und lacht ein wenig verlegen:
»Gott behüte mich vor meinen Freunden! Herrenloses Gut übrigens, Grete, es kam mir durch die Luft zugeflogen!«
Er thut, als merke er Mamas forschenden Blick nicht, erkundigt sich nach Vaters Ergehen und plaudert seelenruhig von allem Möglichen. Nach einer Stunde erhebt er sich. »Und nun, bevor wir aufbrechen – unser Urlaub ist bereits abgelaufen, Freund Egon – noch eine Bitte, welche mir die Eltern warm ans Herz gelegt. Dürfen wir für morgen auf Sie und Hanna rechnen? Geben Sie mir ums Himmelwillen keinen Korb, Frau von Berken, Mama wäre trostlos, sie erwartet noch mehrere Gäste, Sie beide aber als die liebsten.«
Ich möchte Heinz gerne freudig zunicken, doch sein Freund hält die tiefblauen Augen fest auf mich gerichtet und das verwirrt mich.
»Und darf der fremde Eindringling bitten, wiederkommen zu dürfen?« fragt er, während Heinz sich von Mama verabschiedet.
»Gewiß, Herr Tesmer, Heinz' Freunde sind uns stets willkommen.«
»Also nur unter der Flagge,« sagt er gedämpft, und es liegt wie traurige Enttäuschung in seinen Augen.
Sonst begleitete ich Heinz stets durch den Park zurück, heute trat ich nicht einmal ans Fenster, als er und sein Freund gegangen.
* * *
Den 26. Mai 1 Uhr nachts. Soeben kehrten wir von Birkenfelde heim, aber ich fürchte, ich finde trotz der späten Stunde noch keinen Schlaf. Die geöffneten Fenster haben ganze Wolken Blumenduft ins Zimmer gelassen, und die Nachtigallen da draußen schmettern ihre sehnsüchtigen Klagen in die schweigende Nacht.
Und dazu bin ich so unruhig und verwirrt; wie ein lähmender Druck liegt es auf meiner Seele. Macht das nur der schwüle, weiche Duft, der mich umweht? In Birkenfelde war doch alles wie sonst, dazu das lachende Pfingstwetter, die vielen, fröhlichen Menschen. Herr Hofer gehörte auch zu den Geladenen. Er trat sofort bei meinem Erscheinen auf mich zu, um mir Grüße von Hilde zu sagen. Er steht mit seiner Cousine im schriftlichen Verkehr, die Art, mit welcher er ihrer gedenkt, läßt mich das beste für die Zukunft der beiden lieben Menschen hoffen. Ich sah ihm befriedigt nach, als er mich nach längerer Unterhaltung verließ, und bemerkte darum Heinz nicht eher, bis er vor mir stand und die Hand auf die Lehne des eben frei gewordenen Sessels legte.
»Ist es erlaubt, Hanna, oder gebührt dieser Platz nur Auserwählten?«
Ich lachte zu ihm auf. »Nur Auserwählten, nur meinen Freunden, und darum, mein Herr Doktor, sei es Ihnen gnädigst gestattet, ihn einzunehmen.«
Er folgte der Aufforderung nicht, seine Hand legte sich nur fester auf den braunen Plüsch des Sessels.
»Otto Hofer ist Dein Freund? Bist Du so freigebig mit dieser Bezeichnung? Seit wann kennst Du denn diesen Herrn?«
Ich sah ihn groß an: »Das war nicht recht von Dir, Heinz,« sagte ich leise.
Er neigte sich zu mir und sprach dicht an meinem Ohr:
»Sie sagen alle, er bemühe sich um Dich, er wäre den ganzen Winter hindurch Dein getreuer Schatten gewesen, und Du plaudertest so vertraut mit ihm und nennst ihn Deinen Freund.«
Ich mußte ihn wieder freundlich ansehen und leise auflachen.
»Das ist ja alles wahr, Heinz; aber auch eben so wahr, daß es nur geschieht, weil ich zufällig die Freundin von Hildegard Trutenau bin, welche Herr Hofer liebt.«
Dieser unbesonnene Heinz, wenn uns jemand beobachtet hätte! Blitzschnell hatte er meine Hand ergriffen und sie an seine Lippen gedrückt.
»Verzeih, Hanna, ich war ein einfältiger Bursche, trotz meines Doktorhutes. Es war mir zu Kopf gestiegen, daß Du dem blonden Riesen so holdselig zulächeltest und noch jemand außer mir Deinen Freund nennst. Und dabei bin ich's, genau genommen, nicht einmal. Du weißt, Hanna, ein Freund muß ergeben sein, treu, aber auch selbstlos, nichts für sich verlangen, bescheiden zurücktreten, wenn es sein muß. Und letzteres könnte ich nicht, Hanna, ich –«
Vom Klavier, welches in der Mitte des großen Raumes stand, war seit ein paar Minuten ein zartes Vorspiel herübergetönt; jetzt klang eine herrliche Männerstimme durch die plötzlich eingetretene, lautlose Stille: »Horch, horch, die Lerch' im Ätherblau!«
Ich hielt den Atem an, mein Ohr trank die süßen, berauschenden Laute, meine Pulse klopften vor Entzücken.
»Der Maienblume Knospe schließt
Die holden Augen auf,
Bei allem, was da reizend ist,
Du süße Maid, steh auf!«
Jetzt mußte ich den Blick heben – welche Macht zwang mich dazu? – und ihn anschauen, der dort am Klavier saß, und dessen flammende Augen wie ein Blitz die meinen trafen.
Ich hatte ihn heute nur flüchtig gesprochen, den Freund von Heinz. Als wir erschienen, bildete er bereits den Mittelpunkt eines lebhaften Kreises; besonders Else Meinhard, die schöne Schwester eines unserer Gutsnachbarn, schien bereits recht vertraut mit ihm. Sie saß unweit von meinem Platz; jetzt nach Beendigung des Liedes erhob sie sich lebhaft, die brennendroten Schleifen ihres gelblichen Spitzenkleides flatterten um sie her, trat zu dem Klavier und flüsterte dem noch Davorsitzenden etwas zu. Er neigte lächelnd den schönen Kopf, die schlanken, weißen Finger glitten wieder über die Tasten:
»Und setzt Ihr zwischen mich und sie
Auch Berg und Thal und Hügel,
Gestrenge Herr'n, Ihr trennt uns nie,
Das Lied, das Lied hat Flügel!«
Wie das jauchzte und jubelte, und doch, wie es mein Herz umklammerte mit einer großen, unbestimmten Angst! Es litt mich nicht länger im Zimmer, ich mußte hinaus.
»Wohin willst Du, Hanna?« fragte Heinz leise.
»Hinaus, es ist so schwül hier!«
»Aber gerade jetzt,« sagte er verwundert, »es ist ein schlechter Lohn für Egon!«
Ich hörte ihn kaum, ich war schon draußen, mein Platz war dicht an der Glasthür gewesen, die von dem Saal unmittelbar in den Garten führte. Heinz war mir gefolgt, wir gingen schweigend unter den blühenden Kirschbäumen, die uns beim geringsten Windhauch mit ihrem Blütenschnee überrieselten.
»Dein Freund sollte Sänger werden,« sagte ich endlich, »Bühnensänger, er würde Tausende durch seine Stimme bezaubern.«
»Das haben ihm schon viele geraten, und er schwankte vor nicht gar langer Zeit ernstlich zwischen Kunst und Wissenschaft. Eine Gesangsautorität hatte ihn zufällig gehört und wünschte ihn durchaus auf die weltbedeutenden Bretter zu bringen. Glücklicher Egon! Die Musen streiten sich, welche von ihnen den Lorbeer um seine Schläfe winden darf!«
Du sagst das so eigen, Heinz. Ist es denn nicht ein Glück, zu den Auserwählten zu gehören?«
»Bei denen nur manchmal das Herz verkümmert!«
Heinz hatte es leise, mehr zu sich selbst gesprochen; als er meinem fragenden Blick begegnete, sagte er eifrig: »Gewiß, Egon ist ein seltener, herrlich begabter Mensch, und es freut mich, daß auch Du das so bald anerkennst. Doch nun lassen wir ihn, Du hast mir noch so wenig von Dir, vom vergangen Winter gesprochen.«
Wir waren in ein angeregtes Plaudern gekommen, schließlich auch auf Weihnachten und die Art, wie sein Bild damals an mich gelangte.
»Und willst Du wissen,« fragte Heinz, »wie ich den Abend verlebte? Wilkes in Potsdam erwarteten mich, ich war reisefertig, da wurd mir Dein Festgruß gebracht. Ich betrachtete ihn so lange, bis es zu spät war, und ich den Zug versäumt hatte.«
»Und da verlebtest Du den Abend ganz allein?«
»Nicht doch, Hanna, die kleinen, weißen Blütensterne, die Deine Hand für mich geschaffen, waren mir gute Gesellschaft, sie wußten so lieb zu plaudern, mir so herzige Märchen zu erzählen von Glück und Sonnenschein, daß ich ihnen gern lauschte.«
»Ich habe Dich lieb, Du Süße,
Du meine Lust und Qual,
Ich habe Dich lieb und grüße
Dich viele, viele Mal.«
klang es aus den offenen Fenstern des Saales, und gleich darauf, während laute Beifallsrufe erschallten, ergoß sich ein bunter Strom durch die Thüren in den Garten. Wir gingen weiter; an der nächsten Biegung des Weges trafen wir auf Fräulein Meinhard, welche an Herrn Tesmers Arm hing. Fräulein Else sah sehr erhitzt aus, ihre dunklen Augen glühten förmlich unter dem schwarzen, tief in die Stirn gekämmten Kraushaar zu ihrem Begleiter auf. Letzterer hatte sich tief zu ihr herabgebeugt und flüsterte ihr etwas zu, erhob aber sofort den Kopf, als er uns erblickte. Auch das Fräulein sah, aufmerksam gemacht durch sein Verstummen, auf. Sie warf einen fast feindseligen Blick auf mich und rief mit ihrer lauten, dreisten Stimme:
»Ah, da sind Sie ja, Sie kleine Barbarin! Wie konnten Sie nur Ihrem Kunstsinn ein solches Armutszeugnis ausstellen und mitten in Herrn Tesmers bezauberndem Vortrag das Zimmer verlassen? – Es hat Sie natürlich gestört, Herr Tesmer, ich merkte es wohl, wie Sie für einen Moment stockten.«
Ich wandte mich verlegen an den Angeredeten: »Das bedauere ich unendlich! Aber es war so heiß im Zimmer, und man hörte hier draußen den schönen Gesang ebenso deutlich.«
Fräulein Meinhard verzog die vollen, roten Lippen spöttisch. »Und noch dazu in so angenehmer Gesellschaft, nicht wahr, Kleine? Nun, nun, werden Sie nur nicht rot, in Ihren Jahren hat man das Recht, seine Gefühle unverhüllt zu zeigen; da wird das naiv genannt, was man später –«
»Nach zehn Jahren vielleicht und dann mit Recht mit einem andern Namen bezeichnen würde. Nicht wahr,« fragte Heinz lächelnd und sah von ihr auf seinen Freund, auf dessen Arm sie noch immer hingebend lehnte, »so wollten Sie doch sagen, gnädiges Fräulein?«
Sie warf ihm einen Dolchblick zu, den ich wohl bemerkte, obgleich sie sich mit den Schleifen ihres Kleides zu schaffen machte, und zog ihren Begleiter mit sich fort.
»Kommen Sie, Herr Tesmer, wir wollen gut sein und nicht länger stören; ich lese in gewissen Augen die inständige Bitte darum. Wir waren ja auch soeben in einer höchst interessanten Auseinandersetzung!«
Was sie nur gegen mich hat? Ich kannte sie wenig, wußte nur, daß Herr Hofer vor Jahren für sie geschwärmt, sich aber noch in der elften Stunde zurückgezogen hatte, ihr gefallsüchtiges, kokettes Wesen hatte ihn abgeschreckt.
Oder hatte sie vielleicht recht, war ich wirklich zu vertraut mit Heinz?
Wir plauderten weiter, konnten aber den richtigen Ton nicht mehr finden, und ich sah es nicht ungern – zum ersten Male in meinem Leben – als er mich verließ. Sein Vater rief nach ihm, es sollte eine allgemeine Promenade nach dem nahen Walde veranstaltet werden, und der Sohn des Hauses hatte die Pflicht, die nötigen Anordnungen dazu zu treffen.
Bevor dieselben erledigt, war Herr Tesmer zu mir getreten und hatte mir seinen Arm geboten. Er hatte mich suchen müssen, und so kam es, daß wir das letzte Paar einer langen Reihe bildeten, welche im sinkenden Sonnenschein dem Walde zuschritt. Ich war ziemlich schweigsam, Fräulein Meinhards Worte klangen noch immer in mir nach, und es störte mich, daß sie oft den Kopf wandte und mich – oder meinen Begleiter? – mit ihren brennenden Augen streifte. Im Walde, wo die Sonnenstrahlen durch die Kronen der grünen Buchen flimmerten und goldene Lichter über den Weg warfen, schwand endlich meine Befangenheit.
Maiblumen nickten am schwankenden Stengel, Veilchen und Anemonen lockten, und ich folgte meiner Gewohnheit und pflückte hier und dort im Weiterschreiten. Ich kenne nichts Liebreizenderes als einen Waldblumenstrauß mit seinen schlichten, zarten Blümlein und den darüber zitternden grünen und braunen Gräsern.
»Wie Anmutiges Sie mit dem bescheidenen Material zustande bringen!« meinte Herr Tesmer. »Sie lieben den Wald sehr, nicht wahr, gnädiges Fräulein?«
»Ja, so sehr, daß ich mir ein Leben ohne ihn kaum denken kann! Ich bin darin fast groß geworden; schon als Kind verstand ich seine Sprache, war er doch der Vertraute meiner kleinen Leiden und Freuden. Und dabei weiß ich kaum, wann er mir am liebsten ist! Wie jetzt im Schmucke seines jungen Laubes, durchtönt von süßen Vogelstimmen, im Herbst, wenn der Sturm sein wildes Lied darin singt, die schlanken Stämme sich neigen und beugen, oder im Winter, wenn er glitzernd und blitzend im Märchengewande zu schauen ist.«
»Wie warm sie bei seinem Lobe werden, gnädiges Fräulein, und wie zart Sie empfinden. Ich wünschte, ich könnte Ihnen einmal meine Heimat zeigen, die Rheingegend. Ihre Augen möchte ich aufstrahlen sehen bei der Pracht des grünen Stromes, seiner Ufer, seiner Schlösser und Burgen.«
Er pflückte ein Farrenblatt zu einem Strauße und überreichte es mir halb knieend. »Sie haben keine Touristenaugen, gnädiges Fräulein, welche die Natur kritisch mit dem Bädeker in der Hand betrachten, Ihnen würde Vater Rhein seine uralten Sagen murmeln, Ihnen die Lurlei singen und Ihnen die Heldengestalten einer großen Vergangenheit lebendig werden. – Und wie würde erst der Zauber der Schweiz Sie gefangen nehmen! Sie wissen, daß ich dieselbe im vergangenen Jahre kennen lernte.«
Ich bejahte, und er schilderte mit begeisterten Worten die Eindrücke, welche er dort empfangen. Wie schön er sprach, wie wunderschön; wie nur eines Dichters Mund zu sprechen vermag, mußte ich denken. Und wie er mich mit sich fortriß! Mir war's, als ginge ich nicht neben dem Sprechenden über heimischen Waldboden, sondern hinauf, höher, immer höher, wo ewiger Schnee lagert, der Adler seine Kreise zieht, und der Gießbach tosend zu Thale rauscht. Von den grünen Matten klingt das Geläute der Herden, der Kuhreigen ertönt und weckt schlummerndes Echo von Berg zu Berg, langezogene Jodler erklingen aus der Ferne; die Dämmerung zieht herauf und wirft ihre Schleier über das Land. Da färbt sich leise die Felsenstirn des Gebirges, wärmer und wärmer wird der rote Hauch, die Schneekuppen leuchten und glühen wie feuriger Purpur, violett strahlt die nahe Felsenwand, selbst das grüne Wasser des Gebirgsees schimmert stahlblau, rot und golden. Das ist das Alpenglühen, der Kuß, mit dem die Sonne von den Bergen scheidet, und das kein menschliches Auge, welches es einmal geschaut, je vergißt. ... Langsam verlöschten die Tinten, nur hier und da noch ein rosiger Hauch. Auch er erblaßt, die Abendschatten klimmen höher und höher, und nun steigt langsam der Mond herauf und leuchtet mit silberner Fackel über Berg und Thal. Nun beginnt ein geheimnisvolles Leben und Weben in Höhen und Tiefen. Von den Felsen winken die Nebelgestalten der »seligen Fräulein«, die Eiskönigin mit dem Mantel von schimmernden Schneesternen, die bläulich glitzernde Krone auf dem Haupt, erhebt sich vom eisigen Lager, die Nixen steigen aus den krystallenen Fluten der Seen und Gießbäche und reihen sich zum Tanz auf grüner Alm. Wehe dem Wanderer, der sich ihnen naht! Sie locken ihn in ihren Reigen, und der Morgen findet ihn zerschmettert tief unten in grausiger Schlucht!
Ich lauschte mit glühenden Wangen – ich war der Wirklichkeit entrückt – und fuhr darum erschreckt zusammen, als plötzlich mein Name gerufen wurde. »Wollen Sie nicht ein wenig rascher gehen, Fräulein Hanna?« rief Else Meinhard spöttisch, »wir verlieren Sie sonst!«
»Edle Fürsorge,« murmelte mein Begleiter ironisch, beschleunigte aber gleich mir seine Schritte, um gleichzeitig mit der andern Gesellschaft am Ziel, einer großen, mit dichtem Gras bewachsenen Lichtung einzutreffen.
Durch die rasche Bewegung entfiel meinem Strauße ein Vergißmeinnicht. Herr Tesmer bückte sich danach. »Darf ich es behalten, gnädiges Fräulein, zum Andenken an diese Stunde?« Ich wollte abwehrend antworten, da trafen zwei strahlende, lächelnde Augen die meinen, ich schwieg verwirrt.
Als ich aufschaute, stand Heinz vor mir. Sein Blick überflog den Strauß in meiner Hand, das blaue Blümchen, welches Herr Tesmer soeben sorgfältig in seiner Brieftasche barg, und mit etwas bedeckter Stimme sagte er: »Man ordnet sich zu einem Spiel, und Du siehst so erhitzt aus, Hanna; möchtest Du erst ein wenig ausruhen?«
Der gute, alte Heinz! Ich schüttelte lächelnd den Kopf und gesellte mich an seiner Seite den bereits geordneten Paaren zu. Bald entspann sich ein fröhliches Leben, ein lustiges Jagen und Haschen im grünen Walde.
Heinz' Freund und Fräulein Else hatten das Arrangieren der Spiele übernommen, besonders letztere war unermüdlich lebhaft.
Wie eine schöne Bacchantin sah sie aus mit den wilden, schwarzen Locken, den brennenden Augen und den weißen Zähnen, die fast immer durch die roten Lippen hindurchschimmerten. Und wie vertraut sie bereits mit dem Fremden war, wie sie ihn anlächelte, mit ihm flüsterte und ihre Hand auf seinen Arm legte!
Als es kühler wurde, und die älteren Herrschaften zur Heimkehr mahnten, wurde er noch von allen Seiten um ein Lied bestürmt. Er folgte der Aufforderung, und es waren reizende, warm empfundene Strophen zum Lobe des Waldes, welche er vortrug.
»War es so recht?« fragte er mich leise, als er geendet hatte. »Ich sang es für Sie.«
Ich konnte ihm nicht antworten; Fräulein Else stand vor ihm, ein grünes Gewinde in der Hand. »Der Dank des Waldes für seinen Sänger!« Er ließ sich lächelnd auf ein Knie nieder und reichte der Sprechenden den leichten Hut für ihren Kranz, dann stand er auf und bot ihr seinen Arm zum Heimweg.
Ich ging mit Heinz, der auffallend schweigsam neben mir herschritt.
»Woran denkst Du, Heinz?« fragte ich endlich.
Er sah mich mit einem seltsamen Blicke an. »Ich grübele darüber nach, was beglückender ist: ein vor aller Augen dargereichter Kranz oder ein in der Stille gegebenes Vergißmeinnicht?«
Seltsam, ich wollte Heinz zürnen, mich stolz von ihm wenden, statt dessen sagte ich leise: »Das Blümchen war mir entfallen, Heinz, Dein Freund hob es für sich auf.«
Er wandte mir rasch sein plötzlich erhelltes Gesicht zu, dann lachte er so lustig auf, daß die Paare vor uns sich erstaunt umschauten. »Und das verbirgt er mit solcher Ostentation in seiner Brieftasche?« Er hatte seine gute Laune wiedergefunden und plauderte heiter und angeregt mit mir.
Beim Abendessen saßen wir seinem Freunde und Fräulein Meinhard gegenüber. »Sie scheint ihm sehr zu gefallen,« sagte ich unwillkürlich.
»Schon möglich,« meinte Heinz leichthin, »er ist bald begeistert und macht jeder süße Augen.«
Ich wollte über die »süßen Augen« lachen, aber es gelang mir schlecht, ich war abgespannt, die letzten Stunden hatten mich müde gemacht. Am Tanz beteiligte ich mich später nicht, so sehr ich auch, besonders von Herrn Tesmer, darum gebeten wurde; ich hätte nicht, wie die andern, in seinem Arm dahinfliegen mögen, um alles nicht.
Mein Gott, schon drei Uhr, der Morgen dämmert, und ich fühle noch immer nicht das Bedürfnis nach Ruhe!
Im Bereiche meiner Hand liegen die »Lieder des fahrenden Schülers«, vielleicht singen sie mich in den Schlaf.
* * *
Einen Tag später. Die vergangene, schlaflose Nacht hat mich arg mitgenommen. Ich sah blaß aus, hatte bläuliche Schatten unter den Augen, und sträubte mich nicht, als Mama mich gleich nach Tisch kategorisch zur Ruhe schickte.
Unter dem alten, breitästigen Birnbaum war's schattig und kühl, dort befestigte ich meine Hängematte, schwang mich hinein, die Zwillinge bedeckten mich sorgsam mit der leichten Seidendecke und liefen dann davon, mir Hektor als Wächter zurücklassend.
Wie müde ich war! Ich hatte kaum den Arm unter den Kopf geschoben, ein paar Mal durch die blütenschweren Äste nach dem strahlenden Himmel geblinzelt, als meine Gedanken sich schon durcheinanderschoben und ich einschlief. Erst nach Stunden öffnete ich die Augen und schaute verwirrt um mich. Wie war mir denn? War nicht eben meine Mutter bei mir gewesen, hatte sich über mich gebeugt und mir liebe Worte zugeflüstert. Liebe Hanna, mein lieber, kleiner Hans! Aber so hatte sie mich doch nie genannt! Ich hatte es aber doch ganz deutlich vernommen, und hier auf meinem Haar fühlte ich noch den Kuß, den sie darauf gehaucht. Ich sah mich um, nichts rührte sich, nur Hektor saß neben mir und wedelte leise mit dem buschigen Schweife.
Ich rief ihm zu und streichelte seinen dunklen Kopf. »Das war ein schöner Traum, Hektor, und ein süßer, erquickender Schlaf! Nun wollen wir aber auch wieder heiter sein und all die dummen, thörichten Gedanken vergessen, nicht wahr, mein alter Hund?«
Er leckte mir stürmisch Gesicht und Hände, ich wehrte ihn lachend ab und sprang auf. Aus der Hollunderlaube klang Tassenklirren, lebhaftes Lachen und Sprechen. Das ist Heinz Stimme, ich erkenne ihn sofort, wer lacht denn außer ihm so harmlos, so von innen heraus? Ob sein Freund mit ihm ist? Nein, nur Heinz ist dort, er sitzt zwischen den Zwillingen, Mama gegenüber, und neckt sich mit den Kindern. Ich muß ihn noch ein wenig durch eine Lücke in den Ranken betrachten. Er ist nicht so schön wie Egon Tesmer, hat nicht so große, strahlende Augen wie jener, seinem blonden Haar fehlt der goldige Schimmer, seine Hände sind nicht weiß und gepflegt wie die einer Frau, – und doch, wie er jetzt die braunen Augen so voll aufschlägt, ist er tausendmal schöner als jener. Des Fremden leuchtende blaue Augen machen unruhig und verwirren; wen die seinen so lieb und treuherzig anschauen, der fühlt sich beschützt und behütet, geborgen, wie ein Kind im Arm der Mutter.
Als ich endlich näher trete und Heinz mich erblickt, fliegt es rot über seine Stirn, und seine Augen schauen mich lächelnd, doch ein wenig unsicher an. Was er nur hat? Auch ich erröte unwillkürlich.
»Nun, endlich ausgeruht, kleine Langschläferin?« fragt er.
»Ganz prächtig, Heinz, ich hatte einen so schönen Traum; meine Mutter war bei mir!« – Er sieht mich mit einem eigentümlichen Blick an, seine Finger umschließen die meinen mit warmem Drucke.
Während ich mich setze und Mama mir meine Tasse herüberreicht, erscheint Fritz mit der Posttasche. Ein Brief von Vater ist darin mit einer Einlage für mich. Ich soll mich rüsten; sowie er zu Hause ist, was in vierzehn Tagen ungefähr der Fall sein wird, und ein wenig Umschau gehalten hat, nehmen wir den Wanderstab zur Hand.
»Hier ist auch ein Gruß für Dich, Heinz, und ob Du uns auf der Reise begleiten willst!« Ich hänge an seinen Lippen, ich denke es mir herrlich, mit den beiden hinauszuflattern in die schöne, weite Welt. Er sieht mich lächelnd an. »Wünschest Du meine Begleitung, Hanna?«
»Welche Frage, Heinz, es könnte mir nichts Lieberes geschehen!«
Und nun laufe ich ins Haus, komme mit Karten und Reisehandbüchern wieder, und dann sitzen wir beide mit glühenden Gesichtern und machen Pläne.
Plötzlich fragt Mama – ich glaube, wir sind gerade mitten in Tirol –: »Wo haben Sie denn Ihren Freund, lieber Heinz, und warum haben Sie ihn nicht mitgebracht?«
Wir haben beide, Heinz und ich, seinen Namen heute noch nicht genannt und sehen uns nun unwillkürlich an.
»Ja,« sage ich mechanisch, »warum hast Du ihn nicht mitgebracht?«
»Fräulein Meinhard hat ihn befohlen, er ritt schon vormittags hinüber. Er wollte übrigens nachkommen, wenn er zeitig entlassen wird.«
In demselben Moment fiel ein dunkler Schatten in die Laube, und der, dessen wir soeben gedacht, stand vor uns. Heinz reichte ihm die Hand: » Quand on parle du loup, Egon! Die Damen erkundigten sich eben nach Dir.«
Der Angeredete verbeugte sich tief: »Verbindlichsten Dank, meine Damen! Es trieb mich her, um zu sehen, wie Ihnen das gestrige Fest bekommen!«
»Ließest Du Dich nicht länger von der schönen Else fesseln?« fragt Heinz und sieht seinem Freund lachend ins Gesicht.
Dieser, der noch immer im Eingang der Laube lehnt, richtete die schlanke Gestalt höher. »Ich mich fesseln lassen gegen meinen Willen?« frug er stolz. »Übrigens hatte das Fräulein durchaus nicht so freiheitberaubende Gelüste, wie Du ihr zutraust, Heinz; sie plant ein großes Fest, eine Wald- und Wasserpartie und wollte sich dazu meines Beistandes sichern.«
»Aha,« lacht Heinz, »sie arrangiert schon wieder! Das ist ein Kompliment für Dich, Freundchen! So wie nämlich ein bemerkenswerter Fremder in ihrem Gesichtskreis auftaucht, trommelt sie die Umgegend zusammen um ihn und – sich zu amüsieren.«
»Das ist aber keine unangenehme Eigenschaft der Dame,« lächelte der Belehrte. »Finden Sie nicht auch, gnädiges Fräulein?«
»Gewiß nicht, Herr Tesmer, und wenn die Frage nicht verfrüht ist, was haben Sie beide für das allgemeine Wohl beschlossen?«
»O, Fräulein Meinhard hat großartige Pläne: einen Ausflug zu Wagen nach einem, wenn ich nicht irre, eine Meile von Birkenfelde gelegenen Eichenwald, mehrstündige Rast auf grünen Matten, dann Gondelfahrt im Mondschein auf dem benachbarten See und schließlich Tanz mit Musik, bengalischer Beleuchtung und sonstigem Zubehör. Ich hoffe, das Programm erfreut sich Ihres Beifalls.«
Mama, der Dürten soeben geheimnisvolle Winke gegeben, erhebt sich und bittet uns zum Abendessen ins Haus. Nach demselben singt Herr Tesmer wieder einige Lieder, doch, einen so wunderbaren Klang auch seine Stimme hat, bewegt sie mich nicht in demselben Maße wie gestern. Mein Herz ist voll Glück und Reisejubel, und meine Blicke suchen immer wieder Heinz, um ihm verstohlen zuzunicken. Welche herrliche Zeit liegt vor mir, das Leben ist doch zu schön!
Schon in der zehnten Stunde brachen die Herren auf, sie waren zu Fuß, und der Himmel hatte sich in der letzten Stunde mit dunklen Wolken bezogen.
* * *
Den 30. Mai. Die letzten zwei Tage waren trübe und regnerisch, doch schon gestern gegen Abend klärte sich der Himmel auf, heute sandte er mir schon zu früher Stunde so strahlende Sonnenschimmer ins Zimmer, daß ich mich rasch erhob, mich ankleidete und, von Hektor begleitet, hinaus ins Freie wanderte.
Heute mußte ich wieder einmal meine Morgenandacht im Walde halten. Bald war ich am Ziel, nun umfing mich Waldesodem, Blätterrauschen, vielstimmiger Vogelsang, und mein Herz öffnete sich weit in all der wunderbaren Frühlingspracht, die es umgab. Und in nicht ferner Zeit sollte ich noch Schöneres sehen, und Heinz würde mit dabei sein, mit mir genießen, mit mir jubeln. »Wie bist du doch so schön, o du weite, weite Welt!« sang ich leise vor mich hin.
Da knurrte Hektor, der bedächtig neben mir trabte, leise, und bald darauf hörte ich leichte, rasche Tritte. Vielleicht ein Forstgehilfe, ein Holzschläger oder ein Veilchen suchendes Kind, ein Fremder verirrt sich so selten in diesen, weit von der Fahrstraße gelegenen Wald.
Ich hielt Hektor, der Miene machte davonzustürzen, am Halsband fest, der mächtige Hund kann Fremden leicht gefährlich werden, und erwartete stillstehend den Näherkommenden. Die breiten, dichten Baumstämme verdecken ihn noch, aber jetzt tritt er hervor, stutzt und eilt dann auf mich zu. »Sie, gnädiges Fräulein, wirklich Sie! O, dank den guten Geistern des Waldes, die meine Schritte leiteten! Ich konnte der Lockung des herrlichen Morgens nicht widerstehen, ich wanderte plan- und ziellos umher, ohne auch nur im entferntesten zu ahnen, daß mir die Waldfee selbst in ihrem grünen Reich erscheinen könnte. Aber ich habe Sie erschreckt, Fräulein Hanna, Sie sehen blaß und ängstlich aus. Befehlen Sie, daß ich gehe?«
Ich neige mich zu Hektor, der noch immer dumpf knurrt und sich meiner Leitung entreißen will; ich streichle begütigend seinen schönen Kopf. »Aber wie kann man nur so unartig sein, Hektor, und so unhöflich, der Herr ist ja Heinz' Freund und zu Gast bei uns in unserm Walde!«
Herr Tesmer stutzt. »In Ihrem Walde, gnädiges Fräulein? Ich hatte keine Ahnung.«
»Das konnten Sie auch nicht, Herr Tesmer, dieser Wald stößt an den Birkenfelder; nur Eingeweihte wissen, wann sie Berkenhagener Terrain betreten.« Ich hatte meine Fassung, die des Fremden plötzliches Erscheinen etwas erschüttert, wiedergefunden und schlug, begleitet von demselben, den Heimweg ein. Ob ihm Heinz von unserer projektierten Reise gesprochen?
Nein. Er war überrascht zu hören, daß ich so bald schon seine Heimatprovinz kennen lernen sollte.
»Wenn ich Ihnen doch die Honneurs meiner Heimat machen könnte,« sagte er, »aber ich gehöre ihr nicht mehr an seit meines Vaters Tode.« Er nahm den leichten Strohhut vom Kopfe und warf das in der Morgensonne flimmernde Haar aus der Stirn.
»Wein Vater war ein höherer Beamter, Fräulein Hanna,« fuhr er fort, »er starb vor einigen Jahren und seitdem lebt meine Mutter mit mir vereint in Berlin; es ist das am zweckmäßigsten für uns beide. O, wäre das nicht, diese Kette an meinem Fuß, wie gern wendete ich dem vielgerühmten Spreeathen den Rücken und kehrte heim in meine schöne, frohe, sangeskundige Heimat.«
Wie schmerzlich das klang, es bewegte mir das Herz.
»Der Genius ist nicht an den Ort gebunden,« sagte ich leise, »ihn tragen rasche Schwingen, wohin er es verlangt.«
Er hob den Kopf und schaute mich schwärmerisch an.
»Dank für diese Worte aus Ihrem Munde!« rief er. »Wie wohl sie thun, wie eine linde Hand, die sich auf kranke Herzen legt! Und Sie haben recht, mich zu mahnen, mich auf meine eigene Kraft zu stellen. Ja, ich will etwas erreichen, Ihren Glauben an mich zu verdienen suchen, und jetzt weiß ich: ich kann und werde es!«
Er ging ein paar Schritte schweigend neben mir, dann hob er den Kopf. »Darf ich Ihnen ein Geständnis machen, Fräulein Hanna? Sehen Sie mich nicht so erschreckt an, Sie haben nichts zu fürchten! Nicht Egon Tesmer, der Rechtsgelehrte, oder derjenige, den Sie auf dem Parkett der Salons sehen, spricht zu Ihnen, sondern Egon Tesmer, der arme, unbekannte Poet mit dem Herzen voll heißer, verworrener Wünsche und Träume, und was ein solcher spricht, pflegt nicht eben schwer in die Wagschale zu fallen, verweht die nächste Stunde. Oder darf ich trotzdem nicht sprechen? Gebieten Sie mir Schweigen?«
Ich fand vor Herzklopfen kein Wort der Entgegnung und er fuhr fort: »Seit ich denke, schon in meiner Knabenzeit, zwang es mich, das, was mir Kopf und Herz erfüllte, in Worte zu kleiden und dem Papier anzuvertrauen. Zuerst that ich's mit bebender Hand, schüchtern, verstohlen; dann wurde ich kühner, man sagte mir, ich habe dichterisches Talent, und ich hörte es gern, es fachte meine Willenskraft und meinen Mut an. Und doch, wenn ich im einsamen Zimmer weilte oder allein am Herzen der Natur und das, was so zauberisch in mir gährte und wogte, nach Ausdruck, nach Gestaltung rang, vermißte ich eins, das Höchste: den Weihekuß der Muse. Wohl hatte sie mich schon verstohlen angeblickt mit den dunklen Zauberaugen, mir flüchtig die Hand auf die Stirn gelegt; aber ihr Götterantlitz, nach dem ich schmachtete, nach dem ich mich verzehrte im geheimen Sehnen, war mir verhüllt geblieben. – Da, Fräulein Hanna, lassen Sie mich es aussprechen, sah ich Sie! Sie flogen, nein Sie schwebten mir entgegen, wie dunkle Fittiche wallten Ihre Haare Ihnen nach, Ihre Augen sahen mich so seltsam, so weltfremd an; da wußte ich's, mein Traum war erfüllt, meine Bitte erhört: ich hatte meiner Muse ins Antlitz geschaut!«
Ich hörte das alles wie im Traume, ich wagte nicht, die gesenkten Lider zu heben, der Hut, welcher an meinem Arm hing, schwankte leise. Tesmer bemerkte es.
»Habe ich Sie erschreckt? Hätte ich das nicht sagen dürfen?« fragte er traurig.
Ich suchte mich zu fassen, ein Lächeln auf meine Lippen zu zwingen.
»Ein wenig verwirrt hat es mich, Herr Tesmer, ich gestehe es offen, und auch in Staunen gesetzt. Es ist ja auch keine Kleinigkeit, so plötzlich vom schlichten Landmädchen, welches ich in Wirklichkeit bin – in der That nichts anderes, Herr Tesmer! – zur Muse erhoben zu werden.«
Er neigte das Haupt wie demütig. »Sie finden mich dreist, Sie zürnen mir!« – Ich bewegte verneinend den Kopf. »Nein, Herr Tesmer, aber –«
Er sah mich bittend an. »Fräulein Hanna, als ich vorhin so einsam durch den Wald wanderte, hatte ich meine Schaffensstunde. Ideen, die seit längerer Zeit unklar in mir wogten, nahmen Gestaltung an, sonderten sich scharf von einander, um dann wieder zu einem harmonischen Ganzen zusammenzufließen. Darf ich Ihnen – nicht jetzt, wo ich die Dächer ihres Heim bereits durch die Bäume schimmern sehe und umkehren muß, solch früher Gast würde Frau von Berken sicher nicht genehm sein – darf ich Ihnen also später über das Poem, welches ich plane, mitteilen? Ich fordere jetzt keine Antwort,« wehrte er ab, als ich sprechen wollte, »ich will geduldig harren, bis ich Sie wiedersehen darf.«
Er zog tief seinen Hut. und war im nächsten Augenblick verschwunden.
* * *
Am 2. Juni. Es war heute ein so windstiller, warmer Nachmittag. Die Kinder baten und quälten so lange, bis Mama sie mir überließ, und wir alle drei in der Gondel auf dem spiegelklaren See, der so verschwiegen mitten im Walde liegt, dahinglitten. Ich hatte den Hut abgenommen, bewegte langsam die Ruder und überließ mich einem Gefühl süßen Wohlbehagens. An meiner Brust dufteten ein paar Maienrosen, die ersten im Jahre, die mir Heinz heute mit einigen Zeilen gesandt. Ein Bruder seines Vaters, ein alter Herr, ist mit seiner Gattin seit einigen Tagen in Birkenfelde zum Besuch; da er nun nicht selbst kommen kann, sendet er mir den blühenden Gruß. Seitdem Heinz mit seinem Freunde bei uns gewesen, habe ich ihn nicht gesehen; es scheint mir eine Ewigkeit her zu sein. Während ich so vor mich hin träumte, waren die Kinder desto lebhafter, schwatzten und lachten und hatten tausenderlei zu schauen und zu entdecken. Bald war es ein silberner Fisch, der dicht am Kahne vorüberschoß, bald eine voll erschlossene, weiße Wasserrose, dann wieder ein Häschen oder gar ein schlankes Reh, welches am Waldessaum, der den See begrenzt, vorsichtig herausäugte.
Plötzlich schauten sie angestrengt geradeaus und winkten und riefen gleich darauf lebhaft: »Onkel Egon, Onkel Egon!«
Wir waren unweit vom jenseitigen Ufer, dort wo die Fichtenallee hinabführt zum See, und jetzt erblickte auch ich Herrn Tesmer, der uns den Hut entgegenschwenkte, Ich wollte umkehren, fliehen, doch meine Hände gehorchten nicht, sie bewegten die Ruder, bis der Kahn hart aufstieß auf den Kies des Ufers.
»Tausend Dank, gnädiges Fräulein! Darf ich kommen?«
Ich nickte wortlos, und Tesmer schwang sich leicht in die Gondel, setzte sich mir gegenüber und nahm mir die Ruder aus den Händen.
»Welch glücklicher Zufall,« sprach er, »und wie dankbar bin ich ihm. Ich war im Walde, in Ihrem Walde, Fräulein Hanna! Ich wagte nicht, auf Ihr Erscheinen zu hoffen, ich ging planlos kreuz und quer, bis ich hierher kam, geleitet von den freundlichen Geistern des Waldes.«
Er wandte sich und bewegte die Hand, als sende er dankende Grüße zurück, dann strahlten seine Augen zu mir auf. »Darf ich zu meiner Muse sprechen?« sagte er leise.
Ich hob wie in unwillkürlicher Abwehr die Hand. »Verzeihen Sie, Herr Tesmer, ich – ich fürchte, ich kann dem Fluge Ihrer Gedanken nicht folgen, wie ich möchte, und das –«
Eine dunkle Röte überflog sein Gesicht. »Ich verstehe, gnädiges Fräulein,« unterbrach er meine stockende Rede, »an mir ist es, um Verzeihung zu bitten.«
Wir saßen schweigend da, bis es den Kindern zu viel wurde und Lieschen ihre Hand auf Tesmers Knie legte. »Wir hören sehr gerne Geschichten, Onkel Egon, willst Du uns nicht eine recht hübsche erzählen?«
Er fuhr, wie aus einem Traum geweckt, in die Höhe und starrte die kleine Sprecherin an. »Eine Geschichte, Lieschen?« sagte er wie sich besinnend.
»Ach ja, bitte, bitte, ein Märchen!«
Er legte den Strohhut neben sich, fuhr mit der schlanken Hand ein paarmal über Stirn und Augen und begann:
»Es war einmal ein armer Knabe, der hatte weder Vater noch Mutter, weder Bruder noch Schwester, nicht Haus noch Hof, noch Gut und Geld. Um ihn herum sprachen die Menschen vom Glück; sie priesen es als das Schönste und Herrlichste, und niemand war unter ihnen, der nicht verlangend die Arme danach ausbreitete. Da erfaßte den Knaben eine große Sehnsucht, ein mächtiges Verlangen, und er zog aus, das Glück zu suchen. Er kam in eine große, große Stadt, es war ein Häusermeer und darin fluteten die Menschen gleich den Wogen rastlos hin und her, drängten und stießen sich und merkten es kaum, wenn der arme Knabe neben ihnen herlief, sie mit flehenden Augen ansah und fragte:
»Kennt Ihr das Glück? Sagt mir doch, wo wohnt es?«
Niemand antwortete ihm, und er ging in die Häuser der Reichen, in die glänzenden Paläste und Schlösser. Hier mußte er es finden, das Glück – aber man wies ihn traurig fort und zeigte auf die Vorstadt, auf die abgelegenen Straßen, wo die Hütten der Armut stehen. Dort lachten sie höhnisch, die hohläugigen Männer und Frauen, die blassen Kinder mit den welken, alten Gesichtern, und schickten ihn zurück, woher er gekommen, zu den Reichen.
So wurde er umher gejagt, verhöhnt, gestoßen, bis er wieder sein Ränzel auf die Schulter hob und weiter wanderte.
Er ging geradeaus, immer weiter und weiter und ließ sich im Mondenschein nieder an den grünen Ufern eines großen Stromes. Die Nixen schauten neugierig aus den Wellen auf den Fremdling, sie kamen näher, schwebten dicht vor ihm auf und nieder und sangen und lockten mit süßen Stimmen. »Was willst Du da draußen, Du blasser Knabe mit den sehnsüchtigen Augen, da draußen auf der kalten, harten Erde? Komm zu uns hinab in die kristallenen Fluten, wir wollen Dich schmücken mit Wasserrosen und Perlen, mit Dir tanzen und gleiten im Mondenlicht!«
Der Knabe stand auf und breitete ihn seine Arme entgegen.
»Ich komme! Ich komme! Bei Euch wohnt das Glück, das ich suche! Nicht wahr, Ihr kennt es?«
Sie sahen ihn verwundert an, schüttelten die nassen Locken, und als das erste, rosige Wölkchen am Himmel stand, tauchten sie unter und verschwanden.
Der arme Knabe schaute ihnen traurig nach, dann erhob er sich und zog weiter. Dieses Mal ging es bergan, immer höher und höher, bis die Welt dort unten klein erschien wie das Spielzeug eines Kindes, und kein Laut mehr aus ihr hinaufdrang in die schweigende Einsamkeit. Wie still es war, wie feierlich! Den Knaben durchrieselten heilige Schauer! Hier mußte er es finden, das Glück. Er trat an den Rand des Berges, schaute hinauf zum strahlenden Himmel, hinunter in das grüne Thal und rief laut: »Wohnt hier das Glück, das Glück!« »Zurück!« antwortete das Echo, »zurück!« Er gehorchte erschreckt, kehrte stehenden Fußes um und kam todesmatt unten im Thale, im schattigen, grünen Walde an. Er legte sich ins Moos, die Blätter über ihm flüsterten geheimnisvoll, die kleinen Blumen neigten sich an seine Wange und sahen ihn mit unschuldigen Augen an, das Bächlein rauschte eilig, als wenn es näher kommen und ihm etwas verkünden wolle. Er war so müde, der arme Knabe, er konnte nur noch leise fragen: »Kennt Ihr das Glück? Wollt Ihr mir verkünden, wo ich es finde?« und dann fielen ihm die Augen zu.
Plötzlich verstummte das Rauschen und Flüstern im Walde; die Blätter und der kleine Bach hielten den Atem an, die Blumen und Gräser neigten sich tief, denn aus dem Waldesdunkel schritt eine Fee auf den Schläfer zu. Sie hatte Augen, die strahlten wie zwei dunkle Sonnen, langes, glänzendes Haar, welches hinter ihr herflatterte wie Fittiche, und einen leichten, schwebenden Gang.
Der Knabe fuhr erschrocken auf, kniete nieder, schaute in die Sonnenaugen und rief schluchzend: »Du bist es! Sage, daß Du es bist, das Glück, das süße Glück, das ich ersehne, das ich rastlos suche, so lange schon! Und nicht wahr, nun verläßest Du mich nicht wieder, ich darf bei Dir bleiben – immer – immer!«
Sie lächelte mit ihren roten Lippen, bewegte die Hand, als wolle sie dieselbe auf seine wirren Locken legen, da schmetterte im Gebüsch ein Fink und – der Knabe erwachte.«
»Und der Knabe erwachte,« sagte Gretchen mit einem tiefen Atemzug und sah den Erzähler erwartungsvoll an. »Und die Fee, was that sie nun?«
»Die Fee, Gretchen?« Die hatte er ja nur geträumt, der arme Knabe.
Als er erwachte, rieb er sich die Augen, schnitt sich einen Stab vom nächsten Gebüsch und wanderte weiter. Er wandert wohl noch immer, ohne Rast und Ruh, und wird wohl nie finden, was er sucht: »das Glück.«
Die Kinder saßen nachdenklich da, dann hob Lieschen trotzig den Kopf.
»Du, Onkel Egon, Dein Märchen gefällt mir nicht, das ist ja gar kein richtiges Märchen! Die schöne Fee muß den armen Knaben mitnehmen in ihren goldenen Wagen, und die blauen Libellen müssen sie davonführen durch die Lüfte. Und da, wo das große Schloß aus Gold und Marmelstein steht, müssen sie aussteigen, und alle Leute die Tücher und Hüte schwenken und rufen: Heil dem König, Heil der Königin! Und dann müssen sie sich auf den Thron setzen und regieren bis zu dem heutigen Tage! – Nicht wahr, Hanna, so ist's richtig!«
Ich sah die Schwester verwirrt an. Ich wollte sagen: »Nein, Gretchen, denn die Fee hat schon einen König, der ihren Thron mit ihr teilt, lange, lange schon!« aber ich öffnete die Lippen und sprach langsam: »Die arme Fee! Wer weiß, ob sie das durfte!«
Was hatte ich denn nur gesagt, daß Egon Tesmer plötzlich einen leisen Jubelruf ausstieß und mir mit wieder auf strahlenden Augen ins Gesicht sah? »Nicht durfte? O, Dank, Fräulein Hanna, Dank für dieses Wort!«
Wir waren an der Landungsstelle, er sprang aus dem Kahn, half uns heraus und reichte mir die Hand.
»Ich kehre zurück, Fräulein Hanna, ich muß jetzt allein sein!«
Die Kinder sahen ihm erstaunt nach, als er rasch zwischen den Bäumen davonschritt, ich stand wie im Traum und hob erst das Haupt, als es aus der Ferne jubelnd klang:
»Ich hab Dich lieb, Du Süße,
Du meine Lust und Qual,
Ich hab Dich lieb und grüße
Dich tausend, tausendmal!«
* * *
Den 5. Juni. Zur festgesetzten Stunde erschien Heinz, um uns zum heutigen Waldfest zu geleiten.
»Wir fahren direkt in den Wald, nicht wahr, Frau von Berken? Es ist zwar allgemeines Rendezvous angesagt bei Meinhards in Schönau, aber mit Ihrer Erlaubnis dispensieren wir uns davon!«
Mama war es recht, sie hatte nur noch einige letzte Anordnungen zu treffen, dann konnten wir den Wagen, der, mit grünen Zweigen geschmückt, unserer bereits harrte, besteigen. Als wir allein waren, trat Heinz näher auf mich zu und faßte meine Hand:
»Du siehst so bleich aus, Hanna, bist Du krank gewesen?«
Ich fühlte, wie ich unter seinem besorgten Blick erglühte, und schüttelte mühsam lächelnd den Kopf. Konnte ich es ihm denn sagen, daß es mich getroffen wie böser Zauber, daß mich zwei blaue, strahlende Augen verfolgten bei Tag und bei Nacht, daß ich sie immer zu hören meine, die leise, klangvolle Stimme des armen Knaben, der da auszog, das Glück zu suchen? Und doch kann ich es ihm nicht geben; klopft doch schon bei dem Gedanken daran mein Herz so qualvoll, so todesbang!
Warum darf ich meinen Kopf nicht an Heinz' Brust legen, warum umschlingen mich seine starken Arme nicht und bergen mich sicher und fest an seinem treuen Herzen? Ich weiß, dort ist Ruhe und Frieden, nur dort finde ich, was der andere so rastlos sucht: das Glück.
»Warum bist Du so lange nicht hiergewesen, Heinz?« fragte ich vorwurfsvoll.
Ueber sein Gesicht fliegt es wie Sonnenschein.
Du mich vermißt, Hänschen? Der alte Oheim ist erst heute abgereist, ich konnte darum nicht gut früher fort von Hause. Egon war darum auch in den letzten Tagen viel auf sich selbst angewiesen.«
Er sah mich aufmerksam an, und ich schwieg. Ich war so feige, ich hätte ihm nicht von der Kahnfahrt sprechen können, um alles nicht, noch weniger aber davon, daß ich gestern im Walde auf meinem Plätzchen unter der Buche ein Sträußlein von wilden Rosen und Vergißmeinnicht erblickt, ein weißes, zusammengefaltetes Blatt daneben. Ich war in rasender hast heimgeeilt – klang es nicht wie von leichten Schritten, wurde nicht zwischen den Bäumen eine schlanke, geschmeidige Gestalt sichtbar? – und war dann fast ohnmächtig in meinem Zimmer zusammengebrochen.
Mein alter, lieber Wald, auch Dich entfremdet er mir, nicht eher wirst Du mich wiedersehen, bis ich sicher bin, ihm nicht in Deinem Schatten zu begegnen!
»Worüber sinnst Du, Hanna?« fragt Heinz. »Du siehst in Deinem weißen Kleidchen mit dem Veilchenstrauß im Gürtel wie der Frühling selbst aus; nur Deine ernsten Augen wollen nicht recht zu dem Bilde passen.«
Seine Hand berührt liebkosend mein Gesicht, ich halte sie fest und drückte – einen Moment nur – meine Wange daran.
»Ach Heinz, wenn doch Vater erst hier wäre! Ich sehne mich so nach ihm und komme mir so verlassen vor!«
Er hebt meinen Kopf in die Höhe und sieht mir in die Augen, die sich unter seinem warmen, treuen Blick langsam mit Thränen füllen.
»Und ich gelte Dir gar nichts, Hanna?« Und dann spricht er mir zu, wie einem Kinde, plaudert von Vaters baldiger Heimkehr, von unserer geplanten, gemeinsamen Reise. Wie Nachtgespenster vor dem Sonnenlicht fliehen alle thörichten und doch so herzbeklemmenden Gedanken, mit lächelndem Munde und frohem Herzen höre ich ihm zu und sitze ihm bald darauf ebenso im Wagen gegenüber.
Wir waren die ersten am Ziele und konnten ungestört dem herrlichen, weit und breit berühmten Eichenwalde unsere Huldigung darbringen. Bald nach uns langte in einer fast endlosen Wagenreihe die übrige Gesellschaft an. In einem der ersten Wagen saß Else Weinhard, neben ihr, mitbeschattet von dem roten Futter des großen Sonnenschirmes, den seine Hand sorglich über ihrem Haupte hielt, Egon Tesmer. Fräulein Else sah heute geradezu blendend aus. Der große, weiße Strohhut mit dem Kranz von Flatterrosen paßte vorzüglich zu dem dunklen, pikanten Gesicht mit den blitzenden Augen und den vollen, brennendroten Lippen; ein luftiger Stoff von der Farbe der Blüten auf ihrem Hute bauschte sich um ihre, bei aller Fülle zierliche Gestalt.
Ich trat unwillkürlich hinter einen Baumstamm; ich fürchtete ihre spöttischen Blicke für mich und mein einfaches Kleid.
Tesmer hatte Mama erblickt, und während er tief seinen Hut zog, flog sein Blick spähend, wie erschreckt umher.
Galt das mir, vermißte er mich trotz seiner strahlenden Nachbarin? Ich trat vor und neigte grüßend den Kopf. Sein Gesicht erhellte sich, er hörte wohl kaum, was Fräulein Else ihm lachend zuflüsterte, er half ihr aus dem Wagen und trat dann rasch auf mich zu.
»Ich grüße die Nymphe des Waldes,« sagte er halblaut, »und hoffe, sie entzieht sich uns armen Sterblichen heute nicht!«
Er wartete meine Antwort nicht ab, Heinz war mit seiner Mutter am Arm zu uns zurückgekehrt; er wandte sich begrüßend zu ihnen. – Bald war die ganze fröhliche Gesellschaft vereint, und man begab sich tiefer in den Wald zu einem freien, von uralten Bäumen beschatteter Platze, von welchem eine sanfte, dann immer voller anschwellende Melodie zu locken schien.
Am Ziele begrüßte uns eine schmetternde Fanfare, ein um so wirkungsvollerer Willkommengruß, weil diejenigen, welche ihn brachten, unsichtbar blieben, und dann erbat Egon Tesmer für ein paar Minuten die Aufmerksamkeit der Versammelten.
In der Mitte des Platzes stand eine hohe, dicht belaubte Eiche, daran lehnte er, und während die Sonnenstrahlen durch die Zweige blickten, seine weiße Stirn, sein Haar streiften, flogen seine Augen leuchtend über die Gesellschaft, hieß sein Mund sie in beredten Worten willkommen.
»Und nun genießen wir frohen Herzens die frohe Stunde!« schloß er. »Ein Hoch dem Walde, der uns so gastlich aufgenommen! Ein Hoch den Baumriesen, die so majestätisch auf uns herabblicken! Ein Hoch dem Frühling und dem Sonnenschein, der Jugend und der Schönheit, dem Frohsinn und der Liebe!«
Alles stimmte jubelnd in den Ruf ein, die Herren schwenkten die Hüte, die Damen ihre Tücher, und während sich alles auf dem schwellenden Moosboden lagerte, flüsterte und schwirrte es um mich herum.
»Welch ein entzückender Mensch!« – »Kinder, habt Ihr die wunderbaren Augen gesehen und das üppige Blondhaar?« – »Nein, braun ist es, es schimmert nur so goldig!« – »Und die schlanken, weißen Hände! Ich fange wirklich an, mich meiner eigenen zu schämen!«
»Ob es wohl ernst wird mit der Else Meinhard? Sie sollen ja sehr vertraut sein, zusammen ausreiten, lesen und Duette singen!« – »Sie ist aber auch wunderhübsch; was sie heute wieder für Farben hat!« – »Du Unschuldsschaf,« kicherte eine andere, »als wenn Farben immer echt wären!« – »Ja, wie die versteht es auch niemand! Sieh nur, Hanna, Schön-Rotraut und der Page!«
Ich folgte der bezeichneten Richtung. Fräulein Else hatte sich malerisch ins Gras gelagert, die kleinen Füße in den hohen Hackenschuhen sahen kokett unter dem Saum des roten Kleides hervor, der Kopf lehnte an dem knorrigen Stamm eines Baumes, die wilden, schwarzen Locken streiften beinahe die schwankenden Gräser am Fuße desselben.
»Wie sie zu ihrem Anbeter aufschaut,« flüsterte es wieder in meiner Nähe, und lachend fügte eine andere Stimme hinzu: »Was schaust Du mich an so wunniglich? Wenn Du das Herz hast, küsse mich!«
Ich sprang auf und eilte zu den älteren Damen, die sich bereits anschickten, für den programmgemäßen Kaffee zu sorgen.
Die Herren holten trockene Reiser herbei, entzündeten sie und suchten sich, im Verein mit mehreren jungen Damen, welche meinem Beispiele gefolgt waren, nützlich zu machen.
Während ich ein schneeweißes Damasttuch über einen der langen Tische deckte, folgte Tante Wagner, die neben mir beschäftigt war, mit den Augen Fräulein Meinhard, welche sich soeben an Tesmers Arm in einem der schattigen Laubwege verlor. »Guck nur, Kind,« meinte sie kopfschüttelnd, »die Else zeigt Euch jungen Mädels wieder mal, wie Ihr nicht sein sollt! Ist das ein Gehabe und Gethue mit dem jungen Menschen, dem Tesmer, siedend heiß kann es einem vom bloßen Zuschauen werden. Fast täglich Billetdoux, Blumengrüße und dergleichen, und dazu dieses Anschmiegen, diese Blicke! Ob er sich wirklich für sie interessiert, Heinz?« fragte sie ihren Sohn, der unweit von uns mit dem Zurechtrücken einer Bank beschäftigt war.
Er warf das starke, blonde Haar aus der Stirn und lachte.
»Was uns das angeht, Mutter! Das ist seine Sache!«
»Ja, was uns das angeht!« wiederholte ich mechanisch.
Nach einer halben Stunde, als das duftende Getränk bereits in den Kannen dampfte, trat Tesmer zu mir, ein zierliches Sträußchen in der Hand. »Sie gestatten, gnädiges Fräulein, der Wald entbietet Ihnen durch mich seinen Gruß.«
Ich wollte die Blumen dankend entgegennehmen, als Fräulein Else dazwischen trat. Sie stellte sich dicht vor den jungen Mann und schaute ihm dreist und lachend in die Augen.
»Ein Gedicht, wirklich, ein ganzes Gedicht!« rief sie spöttisch.
Er sah sie verwundert an. »Wo, mein Fräulein?«
Sie lachte noch stärker, »Welche Frage? In Ihren Augen, Herr Tesmer! Soll ich es der Kleinen verdolmetschen? Sie wissen, ich bin gern gefällig!«
Sie wandte sich zu mir und citierte pathetisch:
»Der Strauß, den ich gepflücket,
Grüßt Dich viel tausendmal,
Ich hab mich oft gebücket,
Ach, wohl eintausendmal –
Und ihn ans Herz gedrücket
Wohl hunderttausendmal.«
»Das ist aber nicht von Herrn Tesmer,« fuhr sie ironisch fort, »sondern von einem andern großen Dichter, von Goethe, damit Sie es auch recht zu würdigen wissen.«
Ich erwiderte ruhig ihren Blick. »Ich weiß, Fräulein Meinhard, von demselben, der da sagt: »Willst Du genau erfahren, was sich ziemt, so frage nur bei edlen Frauen an!«
Sie warf mir einen dämonisch funkelnden Blick zu, lachte aber scheinbar belustigt auf. »Ah, sieh da, doch nicht so ganz Gänseblümchen, wie es den Anschein hat! Im übrigen aber, ma petite,« sie trat dicht an mich heran und schob einen blitzenden Goldreif an ihrem vollen, bis zum Ellenbogen entblößten Arm spielend auf und nieder – »scheinen Ihre Begriffe von dem »was sich ziemt« und »den edlen Frauen«, die Sie so allerliebst betonten, doch etwas verworrener Natur zu sein, sonst –«
Tesmer trat einen Schritt näher, sein Gesicht war totenblaß, seine Augen flammten. »Fräulein Meinhard!« kam es drohend von seinen Lippen. Sie drehte sich um und sah ihn lächelnd an.
»Ich bin ja schon artig, Herr Tesmer, man muß nur solchen kleinen Mädchen –«
Ich drehte ihr den Rücken, Heinz trat näher, und ich ergriff seine Hand. »Komm, Heinz, wir suchen uns dort drüben einen Platz; ich fühle mich hier nicht behaglich!«
Mag sie nun noch ärger über mein Benehmen zu Heinz, über meine »verworrenen Begriffe« von Schicklichkeit spotten, mag sie mit ihrem Nachbar flüstern und sich so dicht zu ihm neigen, daß ihre flatternden Locken immer wieder sein Gesicht streifen, was geht es mich an?
Heinz hatte von der kleinen Scene vorhin nichts gemerkt; er saß neben mir, offenbar froh, mich heiter und gesprächig zu sehen. Ich wollte lustig sein, und es gelang mir. Sie soll nicht glauben, daß es ihr geglückt ist, mich in Gegenwart ihres Anbeters zu demütigen, ihres Anbeters, der mich seine Muse genannt. Ich hätte aufspringen mögen und es ihr zurufen. Ob sie dann noch »das Gänseblümchen« so verächtlich ansehen würde?
Dabei hörte ich aber jedes Wort, welches Heinz zu mir sprach. Der berühmte Naturforscher Gebhardt, dessen Famulus er längere Zeit aus Liebhaberei für Botanik gewesen, hatte vor einigen Tagen an ihn geschrieben und ihm den Vorschlag gemacht, ihn auf einer Studienreise nach dem Süden Amerikas zu begleiten. Acht Tage hatte er ihm gegeben, sich zu entscheiden. Heinz las mir den Brief vor und fügte dann hinzu: »Ich muß gestehen, daß im ersten Augenblicke der Vorschlag etwas Berauschendes für mich hatte. Die heißesten Wünsche meiner Knabenzeit würden sich durch ihn erfüllen und –«
Ich unterbrach ihn, indem ich meine bebenden Finger auf seinen Arm legte, »Heinz, Du willst fort,« sprach ich atemlos, »und für so lange Zeit? Mindestens auf ein, wahrscheinlich aber auf zwei Jahre, schreibt Professor Gebhardt!«
Er sieht mich an, etwas wie freudige Rührung schimmert in seinen Augen. »Wie erschreckt mich mein kleiner Kamerad anschaut! Nein, Hanna, ich folge der Lockung nicht. Ich weiß es ja seit lange: nicht in den Urwäldern Amerikas, nicht in seinen Steppen, auf seinen Bergen blühet mein Glück, sondern hier auf heimischem Boden. Wenn die Zeit dazu gekommen, pflücke ich es und berge es fest und sicher an meinem Herzen!«
Mich durchrann ein süßer Schauer, meine Lider senkten sich vor seinen seltsamen, tief in die Seele dringenden Blicken.
»Wann kommt Dein Vater, Hanna?« fragte er plötzlich ganz unmotiviert.
Ich sah ihn verwundert an. »Du weißt es, in vierzehn Tagen ungefähr!«
»Noch ganze vierzehn Tage,« seufzte er ungeduldig, »die Zeit wird mir lang werden!«
Die junge Welt war indessen aufgestanden, um sich in Paaren zu einem Spiele zu ordnen; wir schlossen uns ihnen an.
Endlich kam die Reihe des Mitwirkens auch an uns. Tesmer, welcher an der Spitze des Zuges stand, klatschte in die Hände, wir trennten uns, liefen nach rechts und links, wie es das Spiel vorschreibt, auseinander, um uns wo möglich wieder zu vereinen. Doch Egon Tesmer war ein flinker Läufer, und so sehr ich eilte, seine schlanke Gestalt näherte sich mir blitzschnell; schon berührte mich sein Atem, streckte er mir seine Hand entgegen. Aber ich legte die meine nicht hinein, ich wich zurück und ließ so Heinz Zeit, mich zu erreichen.
»Das war aber gegen die Spielregel, gnädiges Fräulein!« rief sein Freund unmutig. »Sie durften nicht wenden, eigentlich bin ich der Sieger!«
Heinz zog meinen Arm durch den seinen und drückte ihn fest gegen seine Brust. »Du irrst, Egon; auf allen anderen Gebieten gönne ich Dir Deine Siege; hier lasse ich sie Dir nicht!«
Für einen Scherz klangen die Worte merkwürdig ernst, auch Tesmer mochte es fühlen, er wurde dunkelrot und grub die weißen Zähne tief die Lippe. Im Verlauf des Nachmittags näherte er sich mir wenig, er war immer von einem Kreis junger Damen umringt, aus welchem Else Meinhards Stimme am lautesten hervortönte. – – Als die Sonne blutrot hinter den Bäumen versunken war, und an ihrer Stelle der Mond voll und glänzend am Himmel schwamm, wanderte alles dem nahen See zu, um die dort bereits in Stand gesetzten Gondeln zu besteigen. Heinz und sein Gast thaten noch Ritterdienste bei den älteren Damen, ich saß bereits in einem der kleinen Boote, zu welchem Heinz mich vorhin geführt, Fräulein Else, wie ich bemerkte, in einem zweiten, ganz in meiner Nähe, soeben erhob sie sich ungeduldig.
»Nun, Herr Tesmer, wie lange soll ich denn noch auf meinen Gondelier warten? Eilen Sie, sonst kommt Ihnen ein anderer zuvor und Sie haben das Nachsehen!«
»Pardon, gnädiges Fräulein!« rief es zurück. »Nur noch ein paar Worte zu den Leuten, des Feuerwerkes wegen!«
Er rief einem der im Gebüsche stehenden Kutscher etwas zu, dann eilte er mit raschen Sprüngen vorwärts und – war es Absicht oder täuschte ihn die Dämmerung? – im nächsten Augenblicke saß er mir gegenüber und bewegte hastig die Ruder. Ich war vor Schreck wie erstarrt, erst nach ein paar Minuten machte ich eine hastige Bewegung. »Herr Tesmer!«
Er beugte sich vor und ließ das Ruder sinken. »Fräulein von Berken, Sie? Mich hat Dunkelheit in der Nähe des waldigen Ufers getäuscht. Soll ich zurückfahren? Aber nein, es wäre ein schlechter Dank für den glücklichen Zufall!«
Er wandte den Kopf und rief zum Ufer zurück.
»Pardon, Heinz, ich habe mich in der Dunkelheit geirrt! Du vertrittst mich wohl bei Fräulein Meinhard?«
Ob ihm geantwortet wurde, weiß ich nicht, das laute Pochen meines Herzens übertönte jedes Geräusch. Der kleine Kahn flog pfeilschnell dahin, Tesmer bewegte gewandt und schweigend die Ruder.
Ich saß wie in bangen Träumen und fuhr erst erschreckt zusammen, als leise meine Hand berührt wurde.

»Fräulein Hanna,« klang es an mein Ohr, »warum zürnen Sie mir? Warum haben Sie mir heute kaum einen Blick geschenkt?«
Ich zog meine Hand zurück und richtete mich höher auf.
»Es thut mir leid, Herr Tesmer, daß Sie bei mir die dem Fremden schuldige Höflichkeit vermißten.«
»Die dem Fremden schuldige Höflichkeit,« wiederholte er bitter. »Eine noch sichtbarere Schranke hätten Sie in der That nicht zwischen sich und mir aufrichten können!«
Er schwieg ein paar Augenblicke, dann brach er leidenschaftlich aus:
»Aber warum, Fräulein Hanna, warum? War es denn wirklich solch Vergehen, daß ich Sie meine Muse zu nennen wagte, daß ich Ihnen im Walde ein paar Blumen auf ihren Lieblingsplatz legte? Sie hingen die Köpfchen, als ich sie wiedersah, und flüsterten mir traurig zu, daß das schlanke, stolze Mädchen sie verschmäht, weil eines armen Dichters Hand sie gebrochen. Oder fürchteten Sie das weiße Blättchen, welches daneben lag? Sie hätten es ohne Scheu entfalten können, es enthielt freilich Verse, Verse an meine Muse, aber sie hätten Ihr Empfinden, Ihren Stolz nicht verletzt. Ich war seitdem täglich in Ihrem Walde,« fuhr er fort, als ich schwieg, »erschrecken Sie nicht, ich wollte mich nicht zu Ihnen drängen, Sie nur von weitem sehen, dieselbe Luft mit Ihnen atmen.«
War das Else Meinhards Freund, ihr glühender Bewunderer, der so zu mir sprach? Er hatte in meinen Augen gelesen.
»Sie wundern sich meines jetzigen Wesens, welches dem vorhin gezeigten so unähnlich ist«, sagte er. »Aber wer giebt sich der gleichgültigen Menge, wie er ist, wer enthüllt ihr sein innerstes Sein und Wesen?«
»Der gleichgültigen Menge?« fuhr es mir heraus. »Zählt auch Fräulein Meinhard zu derselben?«
Kaum hatte ich es ausgesprochen, als ich heftig erschrak. Tesmer hatte meine Hand ergriffen und seine glühenden Lippen fest darauf gepreßt. »War es das, Hanna, glaubten Sie, diese stände meinem Herzen näher als meine Muse?« Er lachte leise auf.
»Für solch einen Thoren konnten Sie mich halten, für so blind, daß ich die holdeste Natürlichkeit vergessen könnte neben raffinierter Künstelei, die taufrische Rosenknospe neben der duftlosen, bunten Tulpe? Frauen wie Fräulein Meinhard amüsieren uns, helfen über müßige Stunden fort; eine Hanna von Berken aber füllt ein Leben aus – muß man ewig lieben!«
Er schwieg, eine der Gondeln war hart neben uns, die Insassen riefen ihm lustig zu. »Unser Troubadour so still? Gehört zu solcher Mondscheinfahrt nicht vor allem ein Lied?«
Der Angeredete wehrte etwas ungeduldig ab, doch man ließ nicht ab. »Sie werden sich doch nicht zieren wie ein junges Mädchen!« lachte ein Herr, und eine der jungen Damen erhob wie ein Kind die weißen Hände und flehte: »Bitte, bitte, liebster, bester Herr Tesmer.«
Er zog die Ruder ein, wie flüssiges Silber rann es von ihnen, und dann erklang die wunderbare Stimme:
»O, willst mich nicht mitnehmen,
Klein Anna-Kathrein?
Du kannst ja wohl fahren,
Du kannst ja wohl reiten –
Oder willst an meiner Seite geh'n,
Klein Anna-Kathrein?
Was scheert mich Dein Vater,
Sein Haus und sein Feld,
Was scheert mich Deine Muhme,
Ihr Stolz und ihr Geld!
Sag bloß, Du willst mitgehn,
Sag bloß, Du bist mein,
Und komm im leinwollenen Röcklein,
Klein Anna-Kathrein!«
Hatten es auch die andern gemerkt, wie des Sängers Augen die meinen suchten, daß es mein Name gewesen, den er zum Schlusse hinausjubelte über den mondbeschienenen See, den schlafenden Wald? Während von nah und fern laute Beifallsrufe erschallten, flogen die Ruder wieder in seinen Händen und ließen die andern weit hinter uns zurück.
Erst dann klang seine Stimme wieder an mein Ohr.
»Hanna, verstanden Sie, warum ich gerade das Lied wählte?«
Ich schwieg, meine Kehle war wie zugeschnürt, und er sprach leise weiter: »Hanna, süßes, erträumtes, endlich gefundenes Glück, fleht der arme Knabe vergebens zu Dir?«
Er zog die Ruder wieder ein, ergriff meine beiden Hände und beugte sich weit vor, seine flammenden Augen in die meinen senkend. Ich saß regungslos, es war ein schrecklicher Alp, der auf mir lastete, mein Körper war wie gelähmt, nur mein Herz pochte in wilden, angstvollen Schlägen.
Da entflammt plötzlich am Ufer ein helles, rotes Licht, es wirft seinen Schein weit über den See, ihn grell beleuchtend.
Ich sah verwirrt um mich, waren das nicht soeben Heinz' Augen gewesen, die mich mit so seltsamem, unerklärlichem Ausdruck getroffen? Das Licht verlosch, ich zog erschauernd meine Hände aus den sie noch immer heiß umschlingenden und richtete mich hoch auf.
»Ich will nicht fragen, Herr Tesmer, was Ihnen das Recht verleiht, so zu mir zu sprechen, wie es soeben geschah; nur eins will ich Ihnen erwidern: Sie haben keinen Teil an meinem Herzen; ganz und voll, mit jedem Atemzuge, mit jeder Faser gehört es einem andern an, und wird ihm ewig gehören!«
Ruhig und klar hatten die Worte geklungen, und tief atmete ich auf. Nun war es heraus, nun gestand ich es mir und einem Zweiten zum ersten Male in Worten, was ich bis jetzt nur unklar empfunden: ich liebe. Und diese Liebe ist mit mir gewachsen, ist groß mit mir geworden und läßt sich nun nicht mehr von mir trennen, ohne daß ich zu Grunde gehe.
»Heinz!« sprach ich lautlos, bebend vor mich hin. »Heinz!«
Tesmer saß unbeweglich und schweigend da, der Mond beleuchtete sein blasses Gesicht, seine festgeschlossenen Lippen. Er war Heinz' Freund, und er that mir leid. Ich reichte ihm die Hand hinüber. »Ich habe Ihnen wehe gethan, Herr Tesmer! Verzeihen Sie mir!« Er berührte meine Hand nicht, hob kaum den traurigen Blick.
»Ja, sehr wehe, und ich weiß nicht, ob ich jemals diese Stunde vergessen werde! Ich war so glücklich in meinem stolzen Hoffen, ich wollte Großes erreichen, um Ihrer wert zu sein!«
Ich wollte ihn so gern trösten, das Glück, welches wie Sonnenschein meine Brust durchflutete, machte mich weich und mitleidig.
»Herr Tesmer, Sie sprachen von einem poetischen Werk, welches Sie begonnen. Wollen Sie es mir bringen und versuchen, ob ich Verständnis für den Flug Ihrer Gedanken habe?«
Er ließ die Hand, welche er über die Augen gelegt hatte, sinken. »Brosamen von der Fürstentafel!« sagte er bitter. »Aber was habe ich mehr zu verlangen? Gewiß, ich werde erscheinen; wann befehlen Sie?«
Ich sann nach, am besten war es in den ersten Nachmittagsstunden, wo Mama ihre Siesta hielt und durch Herrn Tesmers »Allotria« nicht belästigt wurde. »Morgen um 2 Uhr, bitte ich!«
Er neigte stumm den Kopf, und auch ich saß schweigend da. Blaue, grüne und rosige Flammen zuckten am Ufer auf und ergossen märchenhaftes Licht über Wald und See; Raketen und Schwärmer schwirrten hoch gen Himmel, um niederfallend in einen Funkenregen zu zerstäuben, doch so viel ich auch bei ihrem Schein forschte, Heinz erblickte ich nicht. Auch als wir endlich ausstiegen, war es nur Fräulein Else, die mit einigen Herren am Ufer stand und uns entgegen sah.
»Mein Kavalier ist mir bereits untreu geworden,« rief sie uns mit ihrer lauten, kecken Stimme zu; »er begleitet seine Mutter nach Hause, kommt dann aber sofort zurück nach Schönau. Er hat mir versprochen, recht flott zu tanzen. Übrigens ein sehr liebenswürdiger Herr, dieser Doktor Wagner, wir haben uns vorzüglich unterhalten.«
Ihre Augen glitten dabei funkelnd über mein Gesicht; ich zuckte zusammen, als hätte mich der Blick einer Schlange getroffen.
»Sie kommen natürlich auch mit uns, Fräulein von Berken,« fuhr sie fort, »Sie wissen doch, daß ein Ball in Schönau das reizende Fest, welches gewiß auch Ihnen unvergeßlich sein wird, beschließen soll. Ihr Kavalier hat sich sicher schon verschiedene Tänze bei Ihnen gesichert und Doktor Wagner wäre gewiß trostlos, wenn er Sie vermissen sollte.«
Ich verneigte mich kühl. »Verzeihen Sie, Fräulein Meinhard, aber ich glaube, Mama würde ein Opfer bringen, sollte sie mich begleiten. Viel Vergnügen für den heutigen Abend!«
Mama war sehr zufrieden, daß ich an dem Balle nicht teilzunehmen wünschte, und während die andere Gesellschaft lachend und plaudernd die Wagen bestieg, um nach Schönau zu gelangen, fuhren wir in entgegengesetzter Richtung heimwärts. Mama war bald in ihrer Ecke entschlummert, und ich gedachte nicht des vergangenen Tages, nicht der Erlebnisse der letzten Stunde, sondern seiner, dem mein Herz gehört. Ich sah hinauf zum Himmel, zu dem bleichen Monde und den glitzernden Sternen, und unwillkürlich faltete ich die Hände und sprach leise: »Schütze Dein Kind, Mutter, und seine junge Liebe!«
* * *
Den 23. Juni. Mit welchem glückerfüllten Herzen schrieb ich zuletzt in diesen Blättern, und wie nehme ich sie wieder zur Hand! Mein Gott, ist es denn möglich, daß ich das Schreckliche erlebte? Lasse es einen Traum sein, einen furchtbaren, schreckensvollen Traum, und lasse mich erwachen!
Heinz hat mich verlassen, er ist von mir gegangen – auf immer!
Ich war. an dem Morgen nach dem Waldfest so glücklich aufgestanden; sicher würde er heute kommen, und ich schmückte mich für ihn. Mit der Erkenntnis meiner Liebe war die Eitelkeit des Weibes in mir erwacht; ich wollte schön sein für den Geliebten.
Als ich hinunter kam in dem gelblichen, mit Rosenknospen bestickten Mousselinkleide, welches er so liebt, die Haare nach seinem Geschmack in zwei schweren Zöpfen herabfallend, sah mich Mama erstaunt an, und Mamsell Minchen, welche eben anwesend war, flüsterte ihr zu:
»Sehen Sie nur unser Fräulein, gnädige Frau! Sieht sie nicht aus wie eine Braut?«
Mein Blick traf in dem Spiegel ein rosiges Gesicht, zwei glücklich strahlende Augen, die sich verschämt senkten. Ich lief hinaus in den Garten, zuerst an den Moosrosenstrauch, dessen eine grünumhüllte Knospe sich gestern bereits zu öffnen versprach, Heinz hatte das Bäumchen für mich vor einigen Jahren selbst gepflanzt, die ersten seiner Blüten gehörten stets unwiderruflich ihm. Noch gestern hatte ich ihm gesagt, daß ich sie heute für ihn brechen würde.
Richtig, sie hatte sich prächtig erschlossen, und ich neigte mich und berührte ihre zarten, duftenden Blätter leise mit meinen Lippen.
Wenn er doch erst käme! Statt seiner, ich saß gerade mit einem Buche, über dessen aufgeschlagene Blätter hinweg ich in den flimmernden Sonnenschein hineinträumte, im Garten, erschien Herr Tesmer.
Ich hatte völlig vergessen, daß er heute kommen wollte, und sah erstaunt auf, als er plötzlich vor mir stand.
»Ah, Herr Tesmer, Sie und ohne – ohne Ihren Freund?« sagte ich errötend.
Er preßte unmutig die Lippen zusammen.
»Sie bestimmten diese Stunde, gnädiges Fräulein! Und Heinz? Ich habe ihn heute nicht gesehen!«
»Nicht gesehen? Heinz ist doch etwa nicht krank?«
»Aber gewiß nicht,« sagte er leichthin, »er ist wohl nur müde, er hat gestern in Schönau unermüdlich getanzt, war überhaupt der Lustigsten einer!«
Heinz, der nichts weniger als ein passionierter Tänzer ist, unermüdlich getanzt und ohne mich!
Ich sah seinen Freund mit großen Augen an, er bemerkte es nicht und fuhr fort: »Er that wirklich des Guten fast zu viel, ich wunderte mich durchaus nicht, daß er sich bei der Heimfahrt stumm in die Ecke drückte und sofort einschlief, wenigstens war kein Wort aus ihm herauszubekommen .... Wie Ihnen, mein gnädiges Fräulein, der gestrige Tag bekommen, darf ich nicht fragen, Ihr Aussehen ist die beste Antwort.«
Ich senkte vor seinen Blicken die Augen und griff nach einer Papierrolle, welche er vor sich auf den Gartentisch gelegt hatte.
»Ihr Poem, nicht wahr? Wollen Sie mich mit demselben bekannt machen?«
»Wie Sie befehlen, Fräulein!«
Es war ein eigenartiges, reizvolles Werk, dessen Anfang er mir vortrug. Der Stoff behandelte eine schwermütige Sage unserer Gegend, der Wald mit seinem Blätterrauschen und geheimnisvollem Schatten war der Schauplatz derselben. Herr Tesmer war der denkbar beste Rezitator für sein Gedicht, er sprach die klangvollen Verse meisterhaft, mit hinreißender Glut. Trotzdem mußte ich mich hin und wieder zur Aufmerksamkeit zwingen, weil ich an Heinz dachte, der so lustig in Schönau getanzt. Ob ich ihn heute noch sehen würde?
Eben, als Herr Tesmer seinen Vortrag beendet, erschien Mama, wir unterhielten uns noch ein Stündchen, und dann empfahl er sich. Ich sah seiner schlanken Gestalt noch ein paar Augenblicke nach, an meinem Moosrosenstrauch blieb er einen Moment stehen – gewiß freute er sich an der herrlichen Blüte – und dann war er verschwunden. Auch ich erhob mich, nahm meinen Hut und ging tiefer in den Park, ich hatte so vieles zu denken, ich wollte allein sein.
Ich war noch nicht weit gekommen, als von dem Waldwege rasche Schritte erklangen und gleich darauf Heinz sichtbar wurde.
Ich wollte ihm entgegeneilen, ihn begrüßen, aber ich blieb stehen und sah ihm mit glühenden Wangen entgegen. Warum aber schwieg auch er, warum stand er mir so stumm gegenüber? Das Sonnenlicht konnte nur gedämpft durch die dichten Zweige, die sich über uns zu einem grünen Dach vereinten, lugen, sah er darum so fremd, so bleich aus? Aber die festgeschlossenen Lippen, der harte, strenge Zug um dieselben!
»Guten Tag, Heinz,« sagte ich beklommen, »ich freue mich, daß Du gekommen bist. Herr Tesmer meinte –«
»Also kam er von Dir, wirklich von Dir?« unterbrach er mich mit belegter, rauher Stimme, »und um diese Stunde?«
»Ja, Heinz, er wollte mir eine poetische Arbeit vorlesen, und da dachte ich, es wäre die geeignetste Zeit dazu, wenn Mama ihre Mittagsruhe hält.«
Er schlug mit dem Stöckchen, welches er in der Hand trug, gegen die Zweige eines Rotdornbäumchens, daß die Blüten wie roter Regen herabrieselten. »Natürlich,« lachte er dabei, »natürlich!«
Ich trat näher auf ihn zu und sah ängstlich zu ihm auf.
»Heinz, was hast Du? Habe ich etwas nicht recht gemacht?«
Er wandte sich ab. »Diese Augen,« murmelte er, »auch diese Augen können lügen! Aber nein,« sprach er laut, »Du bist wahr! Oder bist Du auch das nicht mehr?«
Er sah mich strenge an. »Hanna, einst kannte ich ein kleines Mädchen, dessen größter Reiz ihre Wahrhaftigkeit war. Ist der Erwachsenen diese Eigenschaft, dieser Abscheu vor der Lüge geblieben?«
Ich antwortete nicht, ich stand totenblaß, mit auf der Brust gefalteten Händen vor ihm und erwiderte seinen Blick.
»Wirst Du mir antworten auf alles, was ich jetzt fragen werde?«
»Sprich, Heinz!«
Er öffnete ein paarmal die Lippen, ehe ich Worte vernahm. »Du hast Egon Tesmer öfter allein gesprochen? Zu früher Stunde im Walde? Sprich, Mädchen,« murmelte er heiser, als ich nach Worten rang, »mach' es kurz!«
Ich erschrak vor seinem Aussehen, vor den Tönen seiner Stimme. »Ja, Heinz!« sagte ich tonlos.
»Und dann auf dem See, wo nur die Kinder Zeugen waren?«
Es biß sich auf die Lippe, daß ein roter Tropfen daraus hervorsprang. »Also wahr! Alles wahr! Und die hochpoetische Scene gestern im Kahn, die ich mit eigenen Augen sah, und eben jetzt das Stelldichein, wo man vor Störung sicher ist!«
Ich wollte sprechen, ihn aufklären, aber er bewegte hastig die Hand.
»Wozu das, Hanna? Ich brauche keine Erläuterungen und auch kein Mitleid. Kein Mitleid, Mädchen! hörst Du's?« wiederholte er drohend, als ich mit bittend erhobenen Händen auf ihn zutrat. »Ich bin auch deswegen nicht gekommen, ich wollte Dir nur sagen, daß ich noch heute abreise, um rechtzeitig mit Professor Gebhardt die Studienreise, zu der er mich aufgefordert, anzutreten. Und dann wollte ich Dir Lebewohl sagen und« – es zwängte ihm etwas die Kehle zusammen, die Worte klangen kaum verständlich – »Dir Glück wünschen für Deine Zukunft!« Er reichte mir nicht die Hand, er verbeugte sich wie vor einer Fremden und ging raschen Schrittes zurück.
Ich stand wie erstarrt, ich wollte ihm nachstürzen, seinen Namen rufen, aber kein Ton kam über meine Lippen, ich taumelte, griff mit beiden Händen ins Leere und stürzte bewußtlos zu Boden.
Als ich erwachte, lag ich auf meinem Bett, und Mama beugte ihr besorgtes Gesicht über mich. »Gott sei Dank, daß Du endlich erwacht bist, Kind! Wir fanden Dich bewußtlos im Laubengang. Was hat Dich denn so erschreckt, Hanna, sprich doch?«
Ich bewegte matt den Kopf, ich konnte nicht denken. »Ich weiß nicht, Mama, ich möchte schlafen.« Ich fiel in einen unruhigen Schlaf; als ich erwachte, war es dunkel und Dr. Hermann, unser Hausarzt, saß vor meinem Bette und faßte meine Hand.
»Ein starkes Fieber ist im Anzuge,« sprach er halblaut zu Mama, »möglichste Ruhe und Schonung, gnädige Frau!«
Von den nächsten zwei Wochen weiß ich wenig; ich entsinne mich nur, daß mich unablässig schreckliche Bilder und Vorstellungen quälten und ich laut nach Heinz um Hilfe rief. Doch der war längst fern, wie man mir sagte, als ich aufstehen durfte, er schwamm jetzt bereits auf weitem Meer und dachte mit keinem Gedanken des blassen Mädchens, welches so thöricht war, sich von ihm geliebt zu glauben. Ich hatte die Freundlichkeit, welche er stets für das mutterlose Kind gehabt, seine brüderliche Zuneigung für Liebe genommen, nun mußte ich dafür büßen. Wenn er mich geliebt, wie hätte er mich so leicht aufgeben, mich so grausam von sich stoßen können!
»Heinz,« murmelte ich oft, wenn ich im warmen Sonnenschein in meinem Sessel lag, »warum hörtest Du nicht, warum durfte ich nicht zu Dir sprechen?«
Und dann gedachte ich des andern, seines Freundes, der so viel Leid über mich gebracht, und der mir gesagt daß er mich liebe. Er ist noch früher als Heinz abgereist, er hat mir ein schriftliches Lebewohl gesandt und mir geschrieben, daß er mich wiedersehen wird.
Heinz hatte kein: Auf Wiedersehen! für mich.
* * *
Zwei Tage später. Heute kam Vater. Unser Wiedersehen war anders, als ich geträumt. Auf meinen Wunsch, den ich auch während meiner Krankheit stets in lichten Augenblicken wiederholt, hatte Mama ihm nichts von derselben mitgeteilt, ich wollte ihn nicht erschrecken und hoffte, er würde mir die letzten Wochen nicht anmerken.
Aber mein Aussehen war doch wohl sehr verändert, er stutzte, als er mich sah, und schloß mich mit heißer Zärtlichkeit in die Arme. »Hanna, mein Liebling, was ist Dir?«
Mama kam meiner Antwort zuvor. »Es ist nicht meine Schuld, Franz, daß Du es nicht früher erfahren hast; Hanna wollte durchaus nicht, daß ich Dir schrieb. Sie war recht krank, und ich bin nur froh, daß es so abgelaufen ist.«
Vater hielt meinen Kopf zärtlich an seiner Brust. »Aber wie kam es nur, mein kleines Mädchen? Warst Du unvorsichtig, hattest Du Dich zu sehr erhitzt? Und wann wurdest Du krank?«
Mir stieg das Blut glühend ins Gesicht. »Ich weiß es wirklich nicht genau, Väterchen, es mögen so ungefähr vierzehn Tage her sein!«
»Nein, das weiß ich besser,« berichtigte Mama, »es fehlen noch fünf Tage an drei Wochen; es war an dem Tage, als der junge Wagner seine große Reise antrat.«
Papa hob aufmerksam den Kopf. »Heinz ist verreist?«
»Ja, Vater,« antwortete ich leise, »für lange Zeit. Er ist naturwissenschaftlicher Studien wegen nach dem Süden Amerikas gegangen.«
Vaters Gesicht wurde blaß wie Marmor.
»Heinz, Heinz Wagner nach Amerika?« rief er fassungslos. »Aber, mein Gott, wie kam das?«
»Ich weiß nicht, Vater! Professor Gebhardt hatte ihn um seine Begleitung ersucht, und da konnte er wohl der Lockung nicht widerstehen. Er war ja von jeher ein leidenschaftlicher Forscher auf solchem Gebiet!«
Ich lächelte schmerzlich, ich dachte daran, wie oft ich ihn vor Jahren mit meiner kleinen, grünen Botanisiertrommel auf dem Rücken begleitet hatte, und wieviel Mühe ich mir gegeben, meine ängstliche Scheu vor den eingefangenen Käfern und Fröschen zu überwinden.
Vater war den ganzen Tag still und in sich gekehrt, gegen Abend ritt er hinüber nach Birkenfelde. Ich hing an seinen Lippen, als er zurückgekehrt war; er sprach nur von gleichgültigen Dingen, ließ aber dabei meine Hand kaum einen Augenblick aus der seinen.
* * *
Anfang Juli. Heute waren Otto Hofer und Hildegard Trutenau, ein glückliches, seit einigen Tagen verlobtes Brautpaar, bei uns. Schon in Reichenhall, wo Herr Hofer seine Verwandten besucht, war der Herzensbund geschlossen worden; es hatte manche Thräne, manchen Kampf gegeben, ehe Hildes Mutter ihn segnete. Sie mochte doch wohl fühlen, daß ihre Jahre gezählt seien, und daß es sündhaft wäre, dem Glücke ihres Kindes noch länger Widerstand entgegenzusetzen. Welches Mutterherz vermag das wohl auch auf die Dauer? Und daß Hilde glücklich ist, verrät jeder Blick, jedes Wort, die zärtliche Umarmung, mit welcher sie mich in ihre Arme schloß. Herr Hofer hat wahrscheinlich gewissenhaft gebeichtet, denn sie flüsterte mir beim Wiedersehen zu: »Wenn Du einmal im Leben Freunde gebrauchst, Hanna, so denke an Otto und mich, Du hast keine besseren!«
Das liebe, tapfere Mädchen, wie gönne ich ihr ihr Glück!
* * *
Mitte September. Der Sommer ist vergangen, ohne daß ich die Feder zur Hand nahm. Was sollte ich schreiben? Wein Leben verfließt glatt und einförmig, ein Tag wie der andere. Von Heinz höre ich selten etwas. Unser Verkehr mit Wagners ist nicht so lebhaft wie früher, und bin ich mit ihnen zusammen, will sich der alte, herzliche Ton nicht finden. Was zwischen uns, besonders Heinz Mutter und mich getreten, weiß ich nicht, auch nicht, warum ihr Blick mich so oft vorwurfsvoll streift. Ihr Sohn hat damals die Reise übers Meer gut zurückgelegt, das Klima und das Nomadenleben behagen ihm, er ist gesund und hofft, von dieser Reise gute Früchte für die Zukunft. Für mich keinen Gruß, kein Wort! Von seinem Freunde Tesmer hatte ich vor kurzem ein Lebenszeichen erhalten. Er sandte mir sein, jetzt bereits im Druck erschienenes, kleines Werk, welches ich im Entstehen kennen lernte. »Seiner Muse« stand mit zierlichen Schriftzügen auf dem Titelblatt. Das Gedicht erscheint mir sehr gelungen, ein sehnsüchtiger Ton klingt durch das Ganze, der seinen Eindruck auf Frauenherzen nicht verfehlen wird.
* * *
Den 10. Oktober. Jetzt, wo die Abende bereits länger werden, lese ich viel, mit Vorliebe naturwissenschaftliche Werke. Ich habe mir schon verschiedene von meinem Taschengeld – diese Studien sind mein eigenstes Geheimnis – angeschafft, am meisten erfreut mich ein sehr fesselnd geschriebenes Werk über die Flora Südamerikas. Ich weiß doch immer so ungefähr, wo Heinz sich gerade aufhält; dann begleite ich ihn mit Hilfe meines lieben Buches auf seinen Wanderungen. Ich kenne sie alle, die himmelhohen Bäume, die großblättrigen Schlingpflanzen, die wunderbar geformten Sträucher, die sein Staunen, sein Entzücken erregen; ich beuge mich mit ihm zu den fremd duftenden, farbenglänzenden Blüten, schaue gleich ihm bewundernd den in tausend Farben schillernden, zierlichen Vögeln nach, den großen, prächtig gefärbten Schmetterlingen, und weiß sie alle beim Namen zu nennen. Ob er wohl ahnt, wenn er einsam durch die dichtverschlungenen Pfade des Urwaldes, über weite Steppen wandert, daß sein kleiner Kamerad mit geht, ihn begleitet auf Schritt und Tritt?
Und dabei zieht langsam Zufriedenheit und ein stilles, bescheidenes Glück in mein Herz. Meine Wangen röten sich wieder, und Vater sieht seine Älteste nicht mehr so oft mit besorgten Blicken an.
* * *
Den 3. November. Mama und die Zwillinge sind verreist, für eine volle Woche. Eine von Mamas Schwestern feiert ihre silberne Hochzeit, das bestimmte erstere, die schon seit Jahren geplante Reise endlich auszuführen. Vater und ich sind nun allein, und ich bemühe mich, ihm die Hausfrau zu ersetzen und diese Tage zu angenehmen zu gestalten.
Es wird mir auch nicht schwer, heiter zu sein, seitdem ich die Ruhe meines Herzens wiedergefunden. Ist es, weil tief drinnen eine leise Hoffnung schlummert, ein schwaches, zartes Pflänzchen, welches oft völlig zu verkümmern scheint und dann plötzlich wächst und grünt, und duftende, berauschende Blüten trägt?
* * *
Zwei Tage später. Am vergangenen Abend saßen Vater und ich im behaglichen, wohldurchwärmten und erleuchteten Zimmer und horchten auf den Sturm, der heulend ums Haus fuhr, an den Läden rüttelte und ganze Ballen von Schneeflocken dagegen warf.
Mich überkam ein wohliges Gefühl von Sicherheit und Geborgensein, ich ließ die Arbeit aus meinen Händen gleiten und träumte mit halbgeschlossenen Augen vor mich hin. Als ich aufblickte, begegnete ich Vaters Augen, sie hatten wohl schon seit Minuten so weich und innig auf mir geruht.
»Woran dachtest Du, Hanna? Du lächeltest, während Deine Augen geschlossen waren.«
Ich errötete heiß und antwortete ein wenig unsicher: »Wahrscheinlich an den Kontrast von außen und innen; wie heimlich und geborgen es sich gerade bei solchem Wetter im traulichen Zimmer sitzt.«
Vater erwiderte nichts, er war aufgestanden und ging ein paarmal lautlos auf dem weichen Teppich durch das Zimmer. Ich sprang auf und hing mich an seinen Arm, ich liebte es von jeher, so eng an ihn geschmiegt neben ihm herzuschreiten. Wir mochten wohl schon zehn Minuten so gewandert sein, als Vater sich in einer nur schwach vom Lampenlicht beleuchteten Ecke auf dem Divan niederließ und mich neben sich zog.
»Komm, mein Kind,« sprach er weich, »Dein Vater wünscht in dieser Stunde in Dein Herz zu schauen; wirst Du es ihm öffnen?«
Ich nahm seine Hand und legte meine Wange daran. »Lieber Vater,« murmelte ich, »muß das sein, kannst Du es mir nicht ersparen?«
Er hob meinen Kopf in die Höhe und schaute mir tief und zärtlich in die Augen. »Armes Kind,« sagte er, »so weh thut schon das bloße Berühren der Wunde?«
Ich nickte; doch während sich meine Augen mit Thränen füllten, lächelte ich ihm zu. »Aber es ist schon viel besser, Väterchen, und bald bin ich wieder die Alte, glaub's sicher!«
Er drückte meinen Kopf gegen seine Brust. »Sprich, Hanna, verschweige mir nichts, was ist zwischen Dir und Heinz geschehen?«
Ich gehorchte, ich schilderte getreulich die Wochen seines Fernseins, keinen Gedanken meiner Seele verschwieg ich ihm, keine Regung, die mein Herz damals bewegte. Als ich glühend, bebend schwieg, hob Vater meinen Kopf in die Höhe und sah mir mit ernstem Forschen in die Augen.
»Und Du bist Deiner ganz sicher, Hanna, Dein Herz fühlt für den Fremden nichts?«
Ich hielt ruhig seinen Blick aus. »Nein, Vater. Zuerst blendete und verwirrte er mich. Er ist ein Dichter und sehr schön, und beides machte Eindruck auf mein junges, schwärmerisches Gemüt; aber als er das Wort Liebe zu mir aussprach, da wurde es klar in mir, da wußte ich, daß mein Herz von dem Taumel nicht mitergriffen war, daß es ihm nichts zu geben hatte.«
Vater hatte sich erhoben und ging erregt im Zimmer auf und nieder. »Armes Kind,« sagte er endlich, vor mir stehen bleibend, »es ist ein herbes Weh, das Dein junges Herz getroffen, und ich bin nicht frei von Schuld dabei. Heinz liebte Dich seit langem, er hat es mir bereits vor Jahresfrist ausgesprochen – was ich freilich auch ohne das wußte – und nur auf meinen Wunsch hielt er seine Erklärung Dir gegenüber zurück. Du warst so jung, ein halbes Kind noch, er hatte seine Studien noch nicht beendet; ich glaubte das Richtige zu treffen. Dann reiste ich ins Bad und bat ihn – Du weißt, daß ich ihn in Berlin gesprochen – sich Dir nicht früher zu erklären, als bis ich heimgekehrt. Ich war egoistisch, nur aus meiner Hand sollte er mein Kleinod empfangen, das Ebenbild meines geliebten, mir so früh entrissenen Weibes. – »Zürnst Du Deinem Vater, Hanna?« fragte er, als er geendet, und ich noch immer schwieg.
»Ich Dir zürnen?« fragte ich und sah glückstrahlend zu ihm auf. »Dir zürnen, nachdem Du mir gesagt, daß Heinz mich liebt? Nun ist ja alles gut, Vater, nun kommt er wieder und mit ihm das Glück!« Ich sprang auf, warf meine Arme um seinen Hals und flüsterte schluchzend an seinem Ohr: »Sie sprechen alle so viel von Mädchenstolz, Vater, in jedem Buche finde ich das Wort; aber ich habe keinen für ihn, nur Liebe und Sehnsucht, ach, so große, unendliche Sehnsucht, Vater!«
Er ließ mich geduldig ausweinen, nur ab und zu streichelte seine Hand leise mein Haar. Wir saßen noch lange bei einander, von Vergangenheit und Zukunft plaudernd. Es waren reiche Stunden, nie vorher hatte mir Vater sein Herz, sein innerstes Denken und Empfinden so rückhaltlos erschlossen wie jetzt.
Auch von meiner Mutter sprach er, er mußte sie namenlos geliebt, und nur durch widrige Verhältnisse gezwungen, ihr eine Nachfolgerin gegeben haben.
In der Nacht schlief ich süß und fest, wie lange nicht. Ich träumte, Heinz wäre heimgekehrt, Vater, den ich aber nicht gewahrte, hätte ihn gerufen. Heute, obgleich es nun bereits später Nachmittag ist, habe ich letzteren noch nicht gesehen. Als ich am Morgen, etwas später als gewöhnlich, hinunterkam, war er bereits in die Stadt geritten. Er sprach mir schon gestern davon, daß er Geschäfte dort habe und erst in der Dämmerstunde zurück sein könne, aber ich bin so ungeduldig, ich laufe alle fünf Minuten ans Fenster, um nach ihm auszuschauen. Wenn er doch erst hier wäre, der gestrige Abend hat uns noch inniger als sonst vereint, ich empfinde eine fast quälende Sehnsucht nach ihm.
* * *
Den 5. Mai. Wieder ist mit Blütenduft und Vogelsang mein Geburtstag herangenaht, der dritte, seit ich in diesen Blättern schreibe, doch keine Freude konnte er mit sich bringen, nur altes Weh lebendig machen. Ich sitze im schwarzen Trauerkleide an meinem Schreibtisch, ich traure um mein Liebstes auf Erden, meinen Schirm und Schutz, meinen Vater. O, Vater, geliebter Vater, warum bist Du von mir gegangen, warum ließest Du Dein Kind allein zurück auf der fremden, kalten Erde? Ich kann das Schreckliche noch immer nicht fassen! Ich hatte an jenem Herbsttage nach unserer abendlichen Unterredung unzählige Male nach ihm ausgeschaut, ich schalt mich thöricht, meiner kindischen Unruhe wegen. Vater war doch oft halbe Tage lang abwesend, warum erschien mir das gerade heute so besorgniserregend? Draußen dämmerte es, dichte, weiße Flocken fielen herab – wie ein Leichentuch, mußte ich denken, welches sich langsam auf alles Leben, jede Hoffnung legt. Zusammenschauernd floh ich vom Fenster. Ich ließ die Vorhänge herab, zündete die Lampe an und holte meine geliebten Bücher herbei. Ich errötete dabei. Was wird Vater zu meinen Studien sagen? Aber er weiß es ja jetzt, daß ich Heinz liebe, daß ich immer an ihn denke! Heinz! Wo er jetzt sein mag, ob er ahnt, daß in dieser Stunde meine Gedanken über Länder und Meere zu ihm eilen, daß mein Herzschlag ihn grüßt? Ob er wohl noch manchmal meiner denkt, oder ob er die Erinnerung an mich mit starker Hand aus seinem Herzen gerissen? Ich stützte den Kopf in die Hand und lächelte leise vor mich hin. Nein, ach nein, das kann er nicht! Vater hat mir gesagt, daß er mich liebt, und Liebe läßt sich nicht aus dem Herzen reißen, es müßte denn selbst in Stücke gehen.
Die kleine Stutzuhr auf Vaters Schreibtisch schlug. Sieben Mal klang der schwirrende Silberton durch das Zimmer.
Und Vater noch immer nicht hier? Wieder sprang ich auf und irrte durch das Gemach. Am Schreibtisch blieb ich mechanisch stehen und blätterte gedankenlos in den darauf verstreuten Papieren. »Mein lieber Heinz!« las ich unwillkürlich auf einem derselben. Das war alles, Vater hatte wohl noch gestern an ihn schreiben wollen, es aber bis heute verschoben, aber es genügte, mein Herz froh zu machen; Vater wird ihm schreiben, ihm alles sagen, nun ist alles, alles gut. Ich horchte auf, was war das? Ein Wagen fuhr langsam über den Hof vor das Haus. Eine Eiseskälte durchrieselte mich, ich sprang auf, wollte nach der Thür, blieb aber mitten im Zimmer stehen. Was erschreckte mich denn so furchtbar, was war mir nur heute? Ich wollte mich zur Ruhe zwingen, mich wieder an den Tisch setzen, da flogen rasche Schritte über den Korridor, und die Mamsell steckte ihr blasses, entstelltes Gesicht ins Zimmer.
»Fräulein! Fräulein Hanna! Sind Sie hier? Um Gotteswillen, kommen Sie hinweg, das ist kein Anblick für Sie.«
Sie sah mich verstört an und wollte mich mit sich fortziehen. Ich riß mich los und starrte sie mit schreckgeöffneten Augen an.
»Was ist Ihnen? Was ist geschehen?« kam es heiser von meinen Lippen.
Sie rang nach Worten, sie murmelte etwas. Klang es nicht wie: »Armes Kind?«
Vor meinen Augen wurde es Nacht. »Vater! Vater!« schrie ich gellend auf. »Wo bist Du?«
Gleich einer Antwort ertönte von draußen vielstimmiges Murmeln, langsam schleifende Tritte, man trug einen schweren Gegenstand hierher nach der Richtung des Zimmers.
»Der arme Herr,« schluchzte die Mamsell, »er ist mit dem Pferde gestürzt, fremde Leute haben ihn gefunden und heimgebracht!«
Mich verließen die Sinne nicht, keine Ohnmacht erbarmte sich meiner, ich flog nach der Thür, sie weit öffnend für den stummen Ankömmling. Die Männer, der alte Inspektor unter ihnen, stutzten, als sie mich erblickten, einige fingen laut zu schluchzen an, und so, geleitet von mir, seine erstarrte Hand in der meinen, trugen sie meinen Vater durch das Zimmer und legten ihn daneben in seinem Schlafgemach auf das Bett. Er sah aus, als ob er schliefe; wie konnte er auch tot sein, er war ja frisch und gesund erst heute morgen von mir gegangen! Ich schrie das den weinenden Leuten zu, dann warf ich mich über ihn, seine geschlossenen Augen, seinen kalten Mund, seine Hände mit Küssen bedeckend.
»Vater,« wimmerte ich leise, »wache doch auf, Dein Kind, Deine Hanna ist bei Dir! Vater, lieber Vater, geh' doch nicht fort, bleibe bei mir, ich bin ja sonst ganz allein, ganz verlassen in der Welt!« Aber er rührte sich nicht, er war schon dorthin gegangen, von wo es kein Wiederkommen giebt. Ich sah es nicht, wollte es nicht sehen!
»Wenn nur erst der Arzt käme, Minchen! Es ist ja nur eine Betäubung, eine Ohnmacht! Die Wissenschaft hat Mittel dagegen, nicht wahr, Minchen?« Sie schwieg, und ich wandte mich zu dem Inspektor, wild den Arm des alten Mannes schüttelnd.
»Sagen Sie doch »ja,« schrie ich.« »Hat denn keiner Mitleid mit mir?« Er bewegte kummervoll den Kopf und auch der Arzt, welcher bald darauf erschien, hatte keinen Trost für mich. Das Pferd war in der Dunkelheit vor irgend etwas gescheut und hatte seinen Reiter in rasendem Laufe abgeworfen. »Er war sofort tot,« sagte der Doktor, »er hatte einen leichten, von keinem Kampfe erschwerten Tod.« Ich hörte nicht die Trostesworte, welche er zu mir sprach, merkte nicht, daß die Männer leise mit ihm das Zimmer verließen, ich lag neben dem Lager auf den Knieen, mein Gesicht an die kalte Wange des Toten pressend. Stundenlang hatte ich so zugebracht, regungslos, nur manchmal aufschreckend und: »Vater, lieber Vater!« murmelnd, als mich zwei weiche Arme umfingen und ich, verwirrt aufblickend, in Hildes verweintes Gesicht sah.
Der Arzt hatte ihr die Trauerbotschaft übermittelt, sie war sofort zu mir geeilt. Ich wollte aufstehen, aber ich taumelte, meine Glieder waren steif und kalt, und ich mußte es dulden, daß Hilde und die Mamsell mich fast tragend ins Nebenzimmer geleiteten und dort auf das Sofa betteten. Hilde deckte mich sorglich zu und saß die ganze, lange, schreckensvolle Nacht bei mir, meine Hand in der ihren haltend.
Sie blieb auch bei mir, als Mama mit den Kindern kam, und als man dann mein Teuerstes in die kalte Erde bettete.
Nun blühen bereits die Blumen auf Vaters Grabhügel, er ruht neben meiner Mutter, die er so sehr geliebt, und ich wünsche, ich könnte mit ihnen schlummern tief unten, unter grünem Rasen.
Ich bin so fremd, so verlassen in der Welt, nichts Besseres als ein aus dem Nest gefallenes Vöglein. Meine Stiefmutter, obgleich wir nach alter Weise nebeneinander herleben, und ich über nichts zu klagen habe, ist mir mehr als je innerlich fremd, meine kleinen Schwestern sind das einzige Band, welches mich an sie fesselt. Und auch mein einziger, schwacher Trost sind die Kinder; stundenlang hören sie mir geduldig zu, wenn ich ihnen von unserem Vater spreche.
Mama hat keine Zeit dazu, sie hat nun auch die Außenwirtschaft in das Bereich ihres Wirkens gezogen und ist rastlos thätig.
Alles blickt mit Bewunderung auf sie, nur ich wünschte, es wäre anders. Ich möchte so gern manchmal eine weiche Hand auf meinem Scheitel fühlen, eine sanfte Stimme hören, die mich tröstet, mich aufrichtet, die ein Wort des Mitleids mit mir hat. Einmal in der Dämmerstunde, es war bald, nachdem Vater von uns gegangen, kniete ich neben Mama nieder und barg meinen müden Kopf in ihrem Schoß. Sie sah verwundert auf. »Was willst Du, Hanna, ich habe keine Zeit!« Seitdem versuche ich Ähnliches nicht mehr.
* * *
Den 10. Mai. Oberamtmann Wagners haben ihre Besitzung verkauft und sind zu ihren Kindern nach Potsdam übergesiedelt.
Heinz' Mutter weinte bitterlich, als sie mir Lebewohl sagte.
»Ich hatte einst gedacht, Hanna, Du solltest Tochterrechte in unserm Hause haben! Weiß Gott, wie freudig ich sie Dir eingeräumt hätte, aber es sollte nicht sein! Meinen Sohn, meinen einzigen, hat es in die Fremde gejagt – ich weiß es, wenn er auch zu stolz war, sich seiner Mutter zu eröffnen – und auch Dir ist es nicht zum Segen geworden. Denk aber an mich, Hanna, wenn Du Dich einmal nach einem mütterlichen Herzen sehnst, ich habe Dich trotz alldem lieb wie mein eignes Kind, und bin stets für Dich da, wenn Du mich rufst!«
Sie sah mich an, als erwarte sie eine Antwort, eine Aufklärung, aber ich schwieg. Ich bin so stumpf, so gleichgültig gegen alles; mit meinem Vater ist mir jedes Glück, jede Hoffnung gestorben; ich bin noch so jung, aber mein Herz schläft schon.
* * *
Am 2. Juni. Soeben komme ich aus der Stadt, wo ich in der Kirche ungesehene Zeugin von Hildes Trauung war. Die Braut sah in dem langschleppenden, schimmernden Atlaskleide mit dem grünen Kranz in dem krausen, blonden Haar liebreizend aus, am schönsten aber erschien sie mir, als sie nach der weihevollen Feier so strahlend und doch so demütig zu dem stattlichen Manne an ihrer Seite aufsah. Es war eine glückliche Stunde auch für mich, niemand konnte inniger für das Glück der beiden lieben Menschen beten, als ich es that. Mama, welche mit mir war, sah mich einige Male forschend von der Seite an; ob sie sich wunderte, nichts von Reue oder Bedauern in meinen Zügen zu lesen?
* * *
Am 12. Juni. Als ich heute die Zeitung zur Hand nahm, fiel mein Blick auf die Namen: Professor Gebhardt und Dr. Heinz Wagner. Es war nur eine kurze Notiz, sie berichtete im trockenen Zeitungsstil von den Erfolgen der wissenschaftlichen Expedition, welche der berühmte Forscher leite, daß die Ausbeute der Reise im zweiten Jahre noch größer und wertvoller zu werden verspreche, als im vergangenen, und daß die Wissenschaft sich glücklich schätzen könne, in Dr. Wagner eine so bedeutende Kraft gewonnen zu haben. Sicher würde der junge, strebsame Gelehrte noch viel von sich reden machen, seine kürzlich veröffentlichte Arbeit über die Insektenwelt Südamerikas habe gerechtes Aufsehen in fachwissenschaftlichen Kreisen erregt. So wenig es war, so trocken der Ton, mir erschien es wie eine Himmelsbotschaft. Die erste Nachricht über Heinz, seitdem seine Eltern die Gegend verlassen; ich lachte und weinte, drückte das Blatt an meine Lippen und war zum erstenmal nach langer Zeit froh und glücklich. Ich vergaß, welch Leid er über mich gebracht, daß er auch nach Vaters Tode kein armes Wort für mich gehabt hatte; ich war so stolz auf den Gefährten meiner Kindheit, der »noch viel von sich reden machen würde,« ich hätte es allen Menschen zurufen mögen.
* * *
Stralsund, Ende November. Schon vor Wochen hat sich der Todestag des geliebten Vaters gejährt, die Kinder sind wie bunte Schmetterlinge aus ihren dunklen Hüllen geschlüpft, und wenngleich ich mein Trauergewand noch nicht abgelegt, entschloß ich mich doch, Roses Einladung zu folgen und sie hier in Stralsund, wo Scholtens ihr Winterdomizil haben, zu besuchen. Sie waren beide im vergangenen Herbst zum Begräbnis meines Vaters nach Berkenhagen gekommen und hatten mich schon damals mit sich nehmen wollen. Mir war diese Aufforderung, der Gedanke, mich von dem frischen Hügel zu trennen, unfaßbar, wie ein Frevel erschienen; jetzt folgte ich der erneuten Bitte gern. Meine Jugend verlangte ihr Recht, sie hatte lange unter grauen Schleiern geschlummert, nun erhob sie das Haupt und drängte hinaus aus dem engen, kleinen Kreise, welcher sie einzwängte, unter andere Menschen, andere Verhältnisse.
Rose empfing mich jubelnd, ihr Gatte freundlich.
»Ich bin Ihnen sehr dankbar, Fräulein von Berken,« begrüßte er mich, »daß Sie endlich unserer Einladung Folge leisteten. Meine kleine Frau verlangte so sehr nach Ihnen, und mir ist es eine Beruhigung, Sie hier zu wissen.« Er sah meinen fragenden, erstaunten Blick und fuhr fort: »Ich bin durch mancherlei Geschäfte – Sie wissen, gnädiges Fräulein, ich habe ausgedehnte Besitzungen – viel in Anspruch genommen, muß oft für ganze Tage fern sein; da war es mir stets ein beunruhigender Gedanke, Rose allein zu wissen. Aber das wird sich nun ja ändern! Nicht wahr, die Damen werden viel zusammen sein, Sie werden Ihre Freundin stets begleiten, Fräulein von Berken?«
Er sah mich gespannt an und zerrte nervös an den Spitzen des jetzt völlig ergrauten Schnurrbartes. Rose enthob mich einer Antwort, sie lehnte sich zärtlich an ihren Gatten und rief lachend: »Merkst Du, Hanna, daß wir noch immer in den Flitterwochen leben? Axel ist in beständiger Furcht, ich könnte mich ohne ihn langweilen!«
Es war ein gewisses Etwas in den Worten, das dem Baron eine jähe Röte über die hageren Wangen trieb; ich weiß nicht warum – aber der alte Mann that mir plötzlich leid.
»Der Sorge ist ja nun vorläufig abgeholfen,« wandte ich mich freundlich an ihn, »daß ich Rose in einsamen Stunden Gesellschaft leiste, ist ja selbstverständlich.«
Er sah mich dankbar an und reichte mir die Hand. »Ich verlasse mich auf Sie, Fräulein von Berken!« sagte er ernst.
Diese kleine Scene am Tage meiner Ankunft gab mir zu denken. War des Barons Eifersucht, welche mir seine Frau schon früher angedeutet, die Triebfeder dazu? Diese Annahme war die richtige, wie ich bald genug einsah. In dem palastartigen Hause, in den weiten Räumen, die Reichtum und künstlerisches Verständnis so reich geschmückt, lauert ein Gespenst, das grünäugige Scheusal »mit den hundert Augen, die alle nicht zum Sehen taugen.« Es hockt auf den schwellenden, seidenen Divans und Sesseln, es lauscht hinter den Spitzenvorhängen und Sammetportièren, es schleicht unhörbaren Schrittes hinter der schönen, jungen Herrin des Hauses und schaut ihr mit heimtückisch spähenden Augen über die Schulter.
Ob Rose auch die unholde Gestalt sieht, ob sie Furcht vor ihr empfindet? Ich weiß es nicht, ich bin nun schon seit Wochen in ihrer Nähe und habe sie stets heiter und guter Dinge gesehen. Sie führt das müßige und doch so vielbeschäftigte Leben einer Salondame; kaum ein Tag ohne eine Gesellschaft, ein Konzert oder einen Ball. Ich hielt mich in den ersten zwei Wochen meines hiesigen Aufenthaltes von allem fern, doch da Rose entschieden erklärte, ohne mich nicht mehr auszugehen, auch ihr Gatte sehr in mich drang, gab ich nach und begleitete sie bereits hin und wieder.
* * *
Am 8. Dezember. Ich bin in einen wahren Strudel von Vergnügungen geraten. Mein Herz ist nicht dabei; aber da es nun einmal eine nicht zu umgehende Konsequenz meines Besuches bei Rose ist, kann ich mich denselben nicht entziehen. Schon auf dem ersten Balle, an welchem ich teilnahm, ließ sich mir ein Regierungsassessor von Steinthal, ein auffallend hübscher, eleganter Mann, vorstellen, welchen ich seitdem fast in jeder Gesellschaft getroffen. Er gehört zur jeunesse dorée der hiesigen Gesellschaft, ist ein guter Tänzer, geistreich und amüsant, ich unterhalte mich gern mit ihm. Rose neckt mich mit dem Anbeter, wie sie ihn nennt, besonders gern in Gegenwart ihres Gatten, obgleich derselbe eine leise Antipathie gegen Herrn von Steinthal zu haben scheint. Vor einigen Tagen – ich hatte abends vorher den Kotillon mit ihm getanzt – ließ sich letzterer in der Besuchsstunde melden. Er kam zum erstenmal ins Haus, und Rose drohte mir scherzend mit dem Finger, ehe sie ihrem Gemahl die Karte zeigte. Baron Scholten sah mich forschend an, und ich errötete unwillkürlich, obgleich der Besuch mich innerlich vollkommen kühl ließ. Peinlich war es mir nur, daß die Frau des Hauses mir so völlig den Gast überließ und sich nur soviel an der Unterhaltung beteiligte, wie es, ohne unhöflich zu sein, möglich war.
* * *
Am 10. Dezember. Der Baron ist verreist, und wir sind häuslich geworden. Rose schlägt jede Einladung aus, nur unsere tägliche Spazierfahrt hat sie von ihren sonstigen Gewohnheiten beibehalten. Auch heute bestiegen wir um die Mittagszeit den zierlichen, nur für zwei Personen bestimmten Schlitten, der Diener legte die weiche Pelzdecke um uns, gab dem bereits auf dem Bock thronenden Kutscher einen Wink, und die glänzenden Rappen flogen dahin, lustig ihre silbernen Schellen schüttelnd.
Es war eine prächtige Fahrt, der Winter hatte seinen weichen, blendend weißen Teppich über Weg und Steg gebreitet, glitzernder Sonnenschein lag auf den bereiften Bäumen der Fahrstraße und verlieh ihnen ein phantastisches, märchenhaftes Aussehen. Rose war in heiterster Laune; besonders als uns, wie gewöhnlich, Herr von Steinthal außerhalb der Stadt begegnet und eine Strecke neben uns hergeritten war, kannten ihr Übermut und ihre Necklust keine Grenzen. Dabei sah sie blendend schön aus in dem kostbaren Sammetpelz; den Schleier hatte sie zurückgeschlagen, die Aurikelaugen blitzten unter dem rötlichen, tief in die Stirn fallenden Gelock, das feine, zarte Gesicht hatte die Winterluft rosig angehaucht.
Sie scheint doch recht glücklich zu sein, dachte ich soeben, als sie plötzlich zusammenfuhr und mit fast schmerzendem Drucke meinen Arm ergriff. Ich sah erschreckt auf. Uns entgegen kam – gerade hier war der Weg etwas holprig – langsam ein Schlitten gefahren; die Insassen desselben bemerkten uns nicht, sie waren vollauf mit sich selbst beschäftigt. Der hübsche, stattliche Mann in Militärmantel und Mütze beugte sich mit glücklichem Lächeln zu seiner Nachbarin, einer jungen, blonden Frau mit herzigem Kindergesicht, herab, ihnen gegenüber saß eine ältere, behäbige Person, welche ein fröhlich jauchzendes Kind sorgsam auf dem Schoße hielt. Der Schlitten war vorüber, und »Leutnant Linke!« kam es halblaut von meinen Lippen.
»Ja, Linke!« wiederholte Rose leise, ihr Gesicht war weiß wie der Schnee, auf welchen ihre Augen starrten. »Er hat seine Frau aus hiesiger Stadt; sie sind wohl zum Besuch bei den Eltern.« Sie drehte sich um und sah dem Schlitten nach, dann preßte sie leidenschaftlich meine Hand in der ihren. »Sie sind glücklich, Hanna, und sie haben ein Kind!«
O, ein Kind, ein kleines, süßes Geschöpf, welches weiche Ärmchen um uns schlingt, welches lallt und jauchzt und dessen erstes, stammelndes Wort » Mutter« lautet!
Sie schwieg; dann, nach ein paar Minuten, fragte sie, wie aus einem Traum heraus: »Ob eine Mutter wohl schlecht sein kann, Hanna, ob sie es nicht fürchtet, das klare, unschuldige Auge ihres Kindes?«
Am Abend erschien Herr von Steinthal, zum erstenmale in des Hausherrn Abwesenheit. Rose hatte ihn sonst stets abgewiesen, heute schien sie ihn erwartet zu haben. Sie hatte ein langschleppendes Hauskleid von weißem, feinem Wollenstoff angelegt, welches in weichen Falten an ihrer wunderbar graziösen Gestalt herabfloß, ihre Augen leuchteten in verzehrender Glut, Wangen und Lippen brannten wie im Fieber. Heute sang sie auch wieder, was sie lange nicht gethan; sie wählte fast nur lustige, jodelnde Weisen, die wie Lerchenschlag das weite Zimmer erfüllten. Der Assessor begleitete ihren Gesang auf dem herrlichen Ehrhardtschen Flügel.
Während eines Nachspieles, sie hatte eben jubelnd gesungen: »Wenn Zwei sich nur gut sind, sie finden den Weg!« schlug er die dunklen Augen zu ihr auf: eine Bitte, ein leidenschaftliches Flehen lag darin, vielleicht mehr noch als in den leise geflüsterten Worten, welche mein Ohr nicht erreichten. Eine rote Blutwelle färbte ihr Gesicht, dann sagte sie leichthin, zu mir gewendet:
»Herr von Steinthal wünscht nun noch ein ernstes Lied zu hören, wollen wir ihm den Gefallen thun, Hanna? Das Heft Mendelssohn, welches ich heute erhielt, liegt noch in meinem Zimmer auf dem Schreibtisch. Möchtest Du nach Heinrich klingeln?«
Sie hatte vergessen, daß sie für heute abend den Bedienten beurlaubt, ich ging darum selbst, mußte aber trotz sorgfältigen Suchens unverrichteter Sache zurückkehren, die Noten waren nicht zu finden.
Rose, welche noch am Flügel stand und den rauschenden Melodieen lauschte, welche unter des Assessors Fingern aus den Tasten hervorquollen, schlug sich besinnend auf die Stirn, als ich mit leeren Händen ins Zimmer trat. »Wie zerstreut ich bin, ich habe das Heft selbst in den Notenständer gethan! Verzeih, liebes Herz! Aber singen möchte ich nun doch nicht mehr,« fuhr sie fort und warf sich in einen Sessel, den schönen Kopf an die rote Lehne drückend. »Ich bin müde!«
Sie blieb den Rest des Abends schweigsam und zerstreut, der Assessor gab es bald auf, sie ins Gespräch zu ziehen, und unterhielt sich in seiner lebhaften Weise fast ausschließlich mit mir. Als er gegangen, sah Rose ihm starr nach. »Der Arme,« lachte sie dann plötzlich, »welche Mühe er sich giebt! Wie ist es eigentlich, Kind, hat er Chancen bei Dir?«
* * *
Am 18. Dezember. Rose hat jetzt fast täglich Gänge, zu denen sie mich nicht auffordert. Auch den Diener nimmt sie nicht mit, obgleich sie gewöhnlich um die Dämmerstunde das Haus verläßt.
»Vor Weihnachten hat jeder Mensch seine kleinen Geheimnisse,« meint sie, »und ich liebe es so sehr, zu überraschen. Du wirst staunen, Hanna, und Scholten auch. Aber, nicht wahr, dem sagen wir nichts von meinen kleinen Kommissionen, kein Sterbenswörtchen, sonst ist die halbe Freude dahin. Eine Überraschung muß vollständig sein. Also reinen Mund, hörst Du?«
* * *
Den 22. Dezember. Heute kam Baron von Scholten zurück. Seine Geschäfte hatten ihn länger, als ihm lieb, aufgehalten, er war übellaunig und erschien mir fahler und älter als sonst. Rose war zärtlich um ihn bemüht, bedauerte ihn der erlittenen Strapazen wegen und erkundigte sich teilnehmend, ob es ihm unterwegs nicht an der gewohnten Bequemlichkeit gemangelt. Sie war ganz sorgsame Gattin und Hausfrau; aber trotzdem gelang es ihr nicht, ihren Gemahl heiterer zu stimmen. Er schaute sich überall in den Gemächern um, als ob er etwas suche, endlich fiel sein Blick auf die große Schale von Cuivrepoli, welche zur Aufnahme von Briefen und Karten diente. Ganz obenauf lag eine Visitenkarte, er hob sie an die etwas kurzsichtigen Augen und warf sie dann auf den Tisch.
»Leo von Steinthal, Regierungsassessor! War wohl täglicher Gast, teilnehmender Hausfreund während meiner Abwesenheit?«
In der Stimme des Mannes grollte es, doch seine Gattin schien es nicht zu bemerken, sie sah zu mir, die mit einer Handarbeit am Tische saß, herüber und lachte heiter auf.
»Wie rot Du wirst, Hanna! Aber ganz mit Unrecht, Herzchen! Steinthal ist ein Ziel »aufs innigste zu wünschen« für alle Jungfräulein der Stadt, und ich würde mich kindisch freuen, wenn Du ihnen allen den Rang abliefst. Du hast recht, Axel,« wandte sie sich dann zu ihrem Gemahl, »er kam hin und wieder. Zuerst wurde er nicht angenommen, dann – wer kann den stummen Bitten gewisser Augen widerstehen? Aber jetzt will ich's nur eingestehen, Hanna, zu amüsant war die Sache nicht für mich. Steinthal ist ja sonst – ich wäre die letzte, das in Abrede zu stellen – Kavalier vom Scheitel bis zur Sohle, aber in seiner Verehrung für Dich doch ein wenig rücksichtslos gegen andere Menschenkinder.
Das soll aber durchaus kein Vorwurf für ihn sein, mein Gott, in solchen Dingen bin ich gern tolerant, besonders jetzt, wo ich nicht mehr allein die Staffage bilden werde! Nicht wahr, Axel, vorläufig bleibst Du nun doch bei Deiner kleinen Frau und hängst all die dummen Geschäfte, die ich so hasse, an den Nagel?«
Sie schmiegte ihre Wange zärtlich an des Barons hageres Gesicht und flüsterte ihm lächelnd zu: »Übrigens: revanche pour Pavie, Axel; ich fand in Berkenhagen mein Glück, da ist es nur recht und billig, daß Hanna in unserem Hause zu dem ihren kommt.«
Des Angeredeten finstere Stirn hatte sich langsam erhellt, jetzt beugte er sich herab und küßte die zarte, kleine Hand, welche auf der seinen lag. Ich war an dem Abend schweigsam und nachdenklich. Ich sann darüber nach, ob Rose ein Recht hatte, so zu mir zu sprechen, und ob der Assessor wirklich das warme Interesse für mich empfindet, welches sie so oft betont. Es ist wahr, er ist sehr aufmerksam zu mir, bevorzugt mich in jeder Gesellschaft, schickt mir Blumen und Bücher; aber ich erinnere mich nicht, daß ich ihn jemals ohne die glatte Salonmaske gesehen, daß ein Herzenston durch seine leichte, gefällige Weise gedrungen wäre. Nicht, daß ich nach einem solchen auch nur im entferntesten verlange! Im Gegenteil, ich glaube, selbst wenn ich nicht so fest ein geliebtes Bild im Herzen trüge, könnte ich nie Zutrauen, geschweige denn ein wärmeres Gefühl für Steinthal fassen, ein gewisses Etwas, von dem ich mir keine Rechenschaft abzulegen weiß, warnt mich vor ihm und macht mich mißtrauisch.
* * *
Den 26. Dezember. Die Weihnachtstage sind vorüber, mir waren es keine frohen. Ich mußte soviel zurück denken an vergangene Zeiten, an die beiden, die mir die liebsten auf der Welt. Der eine schlummert unter grünem Rasen, der andere ist durch Tausende von Meilen von mir getrennt. Und wenn er einst wiederkehrt, wenn er den Wanderstab aus der Hand legt und sich ein Heim im Vaterlande gründet, zu mir kommt er darum doch nicht, mich sucht keiner seiner Gedanken. Manchmal, gewöhnlich im Festsaal, umrauscht von Musik, umflutet von fröhlichen Menschen, erfaßt mich eine wilde Angst, eine namenlose Sehnsucht. Ich möchte aufspringen, zu ihm eilen über Länder und Meere, und ihn bitten, mich noch einmal, nur einmal noch lieb anzuschauen, mich seinen Hans, seinen kleinen Kameraden zu nennen. Aber er wird es nicht thun, er hat mich ja aus seinem Herzen verstoßen, mir kein Wort des Mitleids gesagt, als mein Vater von mir gegangen. O, wie das schmerzte, wie ich es erst da so grausam deutlich erkannte, daß jedes Band zwischen uns zerrissen! Es ist ja nicht denkbar, daß er meinen Verlust nicht erfahren, sicher haben ihn die Seinen davon benachrichtigt.
* * *
Zwei Tage später. Am Sylvesterabend ist großer Ball hier im Hause, man trifft bereits großartige Vorbereitungen dazu. Ich werde zu demselben die Toilette tragen, die Rose für mich unter den Weihnachtsbaum gelegt hatte. Es war ein reiches Geschenk, ich zögerte fast, es anzunehmen. Weißer, kostbarer Spitzenstoff über schwerer rosa Seide, Kränzchen und Puffs von wunderbar feinen Schneeglöckchen. Für sich hat Rose denselben Anzug anfertigen lassen, wir werden ganz gleich gekleidet das neue Jahr begrüßen.
* * *
In der Sylvesternacht. Endlich ist die Musik verrauscht, die letzten Gäste haben das Haus verlassen und ich kann versuchen, in der Stille meines Zimmers meinen Gedanken nachzuhängen. Wie ein Flug aufgescheuchter Vögel sind sie in den letzten Stunden durcheinander geschwirrt; wird es mir gelingen, sie jetzt zur Ruhe zu zwingen? Es ist so schwer, an das Schlechte im Menschen zu glauben, zu verdammen, wo man geliebt hat!
Und ich war so blind, vertraute so kindisch, wie spöttisch mögen sie über mich gelacht haben!
Eine halbe Stunde vor der festgesetzten Zeit waren Rose und ich zum Balle geschmückt und bereit, uns dem Hausherrn zu präsentieren. Er bewegte wiederholt die bereits in hellgelben Glacés steckenden Fingerspitzen gegen einander, als wir ins Zimmer traten, und zog die Hand seiner Frau an die Lippen.
»Du siehst süperb aus, Rose, und Deine Freundin nicht minder! Man wird sich heute streiten, wer die Schönste ist: Fräulein Hanna mit ihrem Kaméengesicht und der glänzenden Flechtenkrone darüber, oder meine kleine Satanella mit dem Feuergelock?« Er fuhr schmeichelnd über Roses schimmernde, duftige Locken. »Aber tanzen wirst Du doch heute nicht, mein Liebling?«
Sie zog einen Moment die feinen, dunklen Brauen, die sich so scharf von der Alabasterstirn abheben, zusammen, aber einen Moment nur, dann sagte sie freundlich: »Du weißt, Axel, ich füge mich gern Deinen Wünschen, aber ich fürchte, eine Quadrille oder dergleichen werde ich heute nicht ausschlagen können. Zu große Konsequenz in diesem Falle stände im striktesten Widerspruche zu meinen Pflichten als Hausfrau.«
Ein Diener meldete, daß ein Wagen vorgefahren; sie ergriff den Arm des Barons, um ihre Gäste zu begrüßen.
Bald füllte sich der große, geschmackvoll dekorierte Ballsaal mit einer zahlreichen, auserlesenen Gesellschaft. Strahlend helles Licht ergoß sich von den Kristallkronen und Girandolen, brach sich in unzähligen Diamanten, blitzte auf glänzenden Uniformen und Ordenssternen, schimmerte auf Sammet und Seide, auf Flor und Blumen, ließ schöne Augen heller strahlen und weiße Arme und Nacken wie lebendiggewordener Marmor erscheinen. Dazu der feine Duft, der die Luft erfüllte, das Geschwirr fröhlicher Stimmen, Gläserklingen und Fächerrauschen. Der Baron und seine Gemahlin waren die liebenswürdigsten Gastgeber der Welt, ich hatte ersteren noch nie so verbindlich und lebhaft gesehen wie eben jetzt. Selbst Herrn von Steinthal, welcher etwas spät erschien, begrüßte er mit größter Artigkeit, was freilich nicht hinderte, daß ein scharf beobachtender Blick seine Gattin streifte, als der Assessor mit tiefer Verneigung ihre Hand an seine Lippen führte.
Ich tanzte viel und war so froh gestimmt wie lange nicht. Die herrliche Musik, das malerische, wechselvolle Bild um mich herum blieb nicht ohne Wirkung auf mich, ich vergaß für ein paar Stunden das stille Leid meines Herzens und war ein so fröhliches, junges Mädchen wie nur eins im Saale. Beim Souper saß ich neben Steinthal, uns gegenüber Rose an der Seite eines vornehmen, alten Militärs. Sie unterhielt sich lebhaft mit ihm, die Exzellenz schien ganz bezaubert von der reizenden Nachbarin zu sein, dabei behielt sie aber mich und meinen Kavalier fest im Auge. Letzterer war heute anders als sonst. Zuerst gegen seine Gewohnheit schweigsam und nachdenklich, wurde er bald fieberhaft lebhaft, verschlang mich mit seinen Blicken und schüttelte eine Flut von Komplimenten über mich aus. Ich wäre ihm bis jetzt kalt wie eine Gletscherjungfrau erschienen, flüsterte er mir zu, wie ein Marmorbild, heute aber hätte der Stein Leben erhalten und überstrahlte an sieghafter Schönheit alle.
»Alle!« wiederholte er laut und neigte sein Champagnerglas gegen das meinige. Mir wurde unbehaglich bei diesen leidenschaftlichen Flüstertönen, und ich war froh, als die Hausfrau endlich die Tafel aufhob.
Der erste Tanz nach derselben war eine Quadrille, welche Rose mit dem Assessor, mir und meinem Partner, einem jungen Offizier, gegenüber tanzte, dann folgte ein Galopp, zu welchem ich nicht versagt war. Ich liebe diesen Tanz mit seinen wilden Bewegungen nicht und zog mich darum in den Wintergarten zurück, der am Ende des Korridors liegt und durch die ganze, lange Zimmerflucht von dem Tanzsaal getrennt ist. Meine Hoffnung hatte mich nicht getäuscht, es war niemand dort, schweigsam und lauschig wie ein verborgenes Stückchen Eden lag der Raum. Ich setzte mich auf meinen Lieblingsplatz, ein Bänkchen, ganz versteckt von hohen Fächerpalmen, und lauschte den gedämpften Tönen der Musik, welche aus dem Ballsaal herüberklangen und vereint mit dem leisen Plätschern des Springbrunnens eine traumhaft zarte Weise bildeten. Wie lange ich so gesessen, weiß ich nicht; plötzlich hörte ich das Rauschen einer seidenen Schleppe, und gleich darauf klang leise, wenn auch leidenschaftdurchbebt, eine Stimme an mein Ohr.
»Gestehen Sie es! Ich will es wissen, Sie lieben das Mädchen!«
Nun wurde auch die tiefe Stimme eines Mannes hörbar.
»Aber, Rose, was soll das alles? Sie wissen, ich folgte nur Ihren Wünschen!«
Sie lachte höhnisch halblaut auf. »Ja, Sie spielen Komödie, aber zu natürlich, mein Bester, man weiß nicht mehr Kunst und Natur bei Ihnen zu unterscheiden! Man sagt ja, daß es Schauspieler giebt, die sich förmlich in eine gewisse Rolle verlieben, daß ihnen dieselbe in Fleisch und Blut übergeht, und zu denen gehören auch Sie!«
»Rose, Sie sind eifersüchtig!«
»Und wenn ich es wäre, Leo, wenn ich es nicht ertragen könnte, von Dir verraten zu werden, von Dir, dem ich alles opferte, meine Ruhe, meine –«
Zwei Lippen schienen die der Sprechenden zu schließen, eine Sekunde war alles still, dann hörte ich wieder Steinthals Stimme.
»Rose, thörichtes, schönes, berückendes Weib, warum quälst Du Dich und mich? Wer könnte Dich sehen und stumpf und blind genug sein, Dich nicht namenlos zu lieben? Sieh, hier zu Deinen Füßen –«
Ich hatte schreckgelähmt, regungslos dagesessen, es konnte ja nur ein Traum, ein wirrer, entsetzlicher Traum sein, der mich quälte; jetzt öffnete ich weit die Augen und schaute verwirrt um mich. Es war ein seidenes, rosenfarbenes Gewand, welches durch die blütenbedeckten Zweige eines prächtigen Granatbaumes unweit von mir hindurchschimmerte, zarte Schneeglöckchen, die sich anmutig mit goldenen Locken mischten; kein Zweifel, es war Rose. Aber dort im Eingang des Wintergartens, die glühenden, fast aus den Höhlen quellenden Augen starr auf sie gerichtet, war das nicht ihr Gatte, Baron von Scholten? Ich sah genauer hin, die Vision war verschwunden, aber ich flog vorwärts, drängte mich ungestüm durch eine Pflanzengruppe, die mir den Weg versperrte, und stand im nächsten Augenblicke vor Rose, die sich eben tief zu dem Knieenden herabbeugte.
»Rose, um Gottes Barmherzigkeit willen, rasch, Dein Mann! Durch diese Thür, geschwind, er kann Dein Gesicht nicht erblickt haben – unsere gleichen Kleider – eile, wenn Dir Dein Leben lieb ist!«
Sie stand wie ein Bild von Stein, dann ein Sprung, ein wildes Kleiderrauschen, die Thür schloß sich hinter ihr.
Es war die höchste Zeit, leise, hastende Schritte kamen näher, im nächsten Augenblick teilten sich laut rauschend die Zweige, rote Blüten rieselten wie Blutstropfen von ihnen herab, und das entstellte, dunkel gefärbte Gesicht des Barons starrte uns mit blutunterlaufenen Augen entgegen.
Sein Blick haftete auf mir, er fuhr zusammen, er keuchte nach Atem; etwas Blinkendes, welches seine Rechte krampfhaft umschloß, bebte leise in derselben. Den Assessor hatte mein beschwörender Blick auf seinen Platz gebannt, ich stand, einer Ohnmacht nahe, vor ihm.
Nahm Scholten das für mädchenhafte Scham, für Verlegenheit, fand er dadurch seine Besinnung wieder? Die Hand mit dem blinkenden Gegenstand fuhr auf den Rücken, die flammende Röte seines Gesichtes wich einer fahlen Blässe, die ihn plötzlich greisenhaft alt erscheinen ließ, seine Lippen verzogen sich zu einer lächelnden Grimasse.
»Pardon!« brachte er mühsam hervor, dann verschwand er.
Die ganze, furchtbare Scene hatte nur einige Minuten gedauert, mir waren sie wie eben so viele Jahre erschienen; schaudernd legte ich die Hand über die Augen. Steinthal kniete noch immer vor mir, jetzt berührten seine Lippen den Saum meines Kleides.
»Fräulein, Fräulein Hanna!« murmelte er mit erstickter Stimme. »Wie soll ich Ihnen danken? Sie haben die Ehre einer Frau gerettet und mein Leben! Ich bin nicht feige,« fuhr er lauter fort, »oft schon habe ich, ohne zu zucken, meine Brust dem Lauf einer Pistole geboten; aber hier so hinterrücks – sahen Sie die Waffe in seiner Hand?«
Ich schwieg, ich zog mein Kleid enger an mich und wandte mich zum Gehen. Er sprang auf und trat mir in den Weg.
»So verabscheuen, so verachten Sie mich? Nicht einmal danken soll ich Ihnen? Aber Sie müssen mich hören, Fräulein Hanna, oder – bei Gott! – ich gehe stehenden Fußes zu dem beleidigten Gatten und stelle mich seiner Rache!«
Sein Ton war furchtbar ernst, ich blieb stehen und neigte stumm den Kopf.
»Ich will mich nicht entschuldigen, Fräulein von Berken, nicht mein Vergehen in ein milderes Licht zu stellen suchen! Ich könnte es vielleicht, ich könnte Ihnen beweisen – aber ich will es nicht, und Sie sind auch viel zu rein, viel zu unschuldig, um mich auch nur zu verstehen, selbst wenn ich es wollte. Nur eins: schon als ich Sie zum erstenmale erblickte, dämmerte in mir die Ahnung auf, daß Sie anders seien, als die meisten Ihres Geschlechtes, daß ich vielleicht durch Sie das wiederfinden könnte, was ich längst durch eigne und fremde Schuld verloren: den Glauben an das Weib. Rose – die Baronin hatte recht; das Spiel welches sie ersonnen, wurde mir zum Ernst! Die Flamme, welche ich mutwillig mit frevler Hand entzündete, lohte auf und schlug über mir zusammen! Hanna, Sie haben in dieser Stunde mein Leben gerettet, wollen Sie es behalten und sich dienstbar machen für immer?«
Ich entzog ihm meine Hand, die er ergriffen hatte, und sah ihm zürnend in die flehend auf mich gerichteten Augen.
»Sie vergessen, mein Herr, daß erst Minuten vergingen, seit Sie ähnliche Worte zu einer andern sprachen, zu dem Weibe Ihres Gastfreundes! Kein Wort weiter,« fuhr ich gebieterisch fort, als er sprechen wollte, »ein jedes wäre eine Beleidigung für mich. Ich empfinde nichts für Sie, und selbst, wenn es anders wäre, mit glühenden Zangen würde ich ein Gefühl aus meinem Herzen reißen, welches einem Unwürdigen gilt!«
Er taumelte, als wäre er ins Gesicht geschlagen, dann lachte er heiser auf: »Sag' mir noch einer, es gäbe keine Nemesis! Aber fortan will ich sie mir nicht furienhaft, umwallt von Schlangenhaaren, denken, sondern hoch und schlank, mit einem Kindergesicht und großen, ernsten Augen.«
Er wollte hinausstürzen, ich trat auf ihn zu. »Kommen Sie, Herr von Steinthal, Sie müssen mich nun in den Ballsaal begleiten!«
Er starrte mich an. »In den Ballsaal? Mein Weg führt mich hinaus, zurück über die Schwelle, die ich nie hätte betreten sollen!«
Ich sah ihn ernst an. »Wollen Sie den Verdacht des Barons aufs neue rege machen? Denken Sie an Rose!«
Er schlug sich vor die Stirn. »Richtig, der Vorhang ist noch nicht gefallen, mein Stichwort wartet!«
Im Saal kam uns Rose, hingebend auf den Arm des Gatten gestützt, entgegen. »Da bist Du ja, Hanna! Es war eine förmliche Revolution unter Deinen Verehrern ausgebrochen, wohl ein Dutzend mal mußte ich berichten, daß Du die Galoppade nicht liebst und Dich für die Dauer des Tanzes zurückgezogen hättest. Wo warst Du denn, und hat Dir Herr von Steinthal Gesellschaft geleistet? Das war liebenswürdig, Herr Assessor; hoffentlich haben Sie meine Freundin gut unterhalten?« Wie harmlos ihr die Worte von den roten Lippen kamen.
Ein Gefühl des Widerwillens stieg in mir auf, und ich war froh, als ein Herr, welchem ich den soeben begonnenen Tanz gegeben, lebhaft auf mich zutrat und mich so einer Antwort enthob.
Auch der Assessor stürzte sich in das Gewühl der Tanzenden.
Ich sprach ihn nicht mehr im Verlauf des Festes, auch nicht Rose, die mir auswich. Erst als ich in meinem Zimmer war und soeben das Ballkleid mit einem bequemen Schlafrock vertauscht hatte, klopfte es, und sie trat herein.
»Ich mußte Dich heute noch sprechen, Hanna, es hätte mir sonst die ganze Nacht keine Ruhe gelassen! Ich muß Dir auch noch danken; so harmlos die Scene mit Steinthal im Wintergarten war, ohne Dein Zuthun hätte sie höchst tragisch werden können, – mein Mann versteht in solchen Dingen keinen Spaß.« Sie sprach hastig, leichthin, dabei brannten ihre Hände, welche die meinen gefaßt hatten, wie Feuers und ihr Blick senkte sich unsicher.
Ich machte mich frei und erhob mich. »Ich habe alles gehört, Rose, ich saß ganz in Deiner Nähe!«
Sie versuchte ein frivoles Lachen. »Mein Gott, wie ernst Du das sagst, Schatz! Glaubtest Du im Ernst, Scholten fülle mein Herz aus?«
»Nein, Rose, das nicht,« sagte ich traurig, »aber ich glaubte, Du wärest eine ehrenhafte Frau und eine treue, ehrenhafte Freundin!«
Sie schlug beide Hände vors Gesicht, und ich fuhr fort: »Du bist beides nicht; Deinen Mann, dem Du vor dem Altar Treue geschworen, der Dich mit Glanz und Reichtum umgiebt, hast Du verraten, seine Ehre in den Staub getreten, ihn fast zum Mörder gemacht – vor wenigen Stunden sah ich ihn die Waffe auf Deinen Mitschuldigen zücken, Rose; – mich, die Gefährtin Deiner Kindheit, Deiner Jugend, die Dich so innig liebte, holtest Du in Dein Haus, um sie zum Deckmantel Deiner sündigen Verirrung zu gebrauchen.«
Es übermannte mich, ich verhüllte mein Gesicht und weinte fassungslos.
»Rose, Rose, warum hast Du mir das gethan?« schluchzte ich. »Ich bin schon so arm, warum muß ich auch Dich noch verlieren?«
Sie war aufgesprungen und preßte mich wild an sich. »Nein, bei Gott, Hanna, das sollst Du nicht! Ich will Dich lehren, mich wieder zu lieben, ich will alles, alles gut machen! Nur geh' nicht fort von mir! Bleib' bei mir als mein guter Engel, auf den Knieen will ich Dir danken. Sieh, Hanna,« sprach sie wie im Fieber weiter, »ich bin ja nicht schlecht, nur mein Herz, mein junges, heißes Herz, das noch nicht gestorben, nur scheintot ist, erwacht manchmal, und dann pocht es so wild und unbändig in der Brust und schreit laut nach seinem Recht, nach Liebe! Glaubtest Du, das Gold, das viele gelbe Gold, um welches ich es verkauft, hätte es erstickt, ganz stumm gemacht? Glaubtest Du das wirklich? Aber wenn Du bei mir bleibst, dann wollen wir schon Herr darüber werden, nicht wahr, Du wirst mir helfen?«
Sie schluchzte, sie küßte mein Gesicht, meine Hände und fuhr fort, in verworrenen Worten zu sprechen. Als sie endlich gegangen, fiel ich unausgekleidet auf mein Bett, meine Glieder waren schwer wie Blei. Aber trotzdem kam kein Schlaf in meine Augen, ich sprang wieder auf, nahm mein Tagebuch hervor und schrieb bis jetzt, wo die Pendule mir gegenüber die fünfte Stunde zeigt. Vielleicht kann ich jetzt ein wenig schlummern, ich will es versuchen.
* * *
Am 2. Januar. Am nächsten Morgen, ich war soeben aus einem ängstlichen Traume aufgeschreckt, brachte mir Roses Zofe mit der Morgenchokolade einen Brief. Er war von Hause, aus Berkenhagen, und ich lehnte mich wieder in die spitzenbesetzten Kissen zurück und schloß noch einmal die Augen. Gott sei Dank, ich hatte noch ein Heim, ein Zuhause, und wenn es auch schlicht und einsam war, wenn auch von der Sonnenhöhe des Lebens, dort wo die Kunst wohnt und alles was das Leben schmückt, sich selten ein Strahl bis zu ihm verirrte, so war doch sein Thor der Sünde verschlossen, Lüge und Falschheit fanden schwer den Weg über seine Schwelle. Ich streichelte leise den Brief, der Mamas Handschrift trug, dann öffnete ich ihn. Wie wenig ahnte ich, was er enthielt, daß er mir das nehmen könnte, nach welchem ich soeben mit ganzer Seele verlangte: die Heimat.
Er lautete:
»Meine liebe Tochter!
Dein Brief mit den guten Wünschen zum neuen Jahre ist bereits in meinen Händen. Ich danke Dir dafür und wünsche auch Dir viel Glück und Segen! Daß Du Dich bei Deiner Freundin gut gefällst, freut mich, wenngleich ich es auch wiederum nicht recht begreife. Ich muß gestehen, mir schwindelte der Kopf schon beim bloßen Lesen von all den Soiréen, Bällen und Gesellschaften.
Bleibt denn Rose bei solchem Leben noch Zeit, nach ihrem Haushalt zu sehen? Ich denke, daß es schlecht damit aussieht, und sie vieles verfehlt. Nimm Du Dir nur kein Beispiel daran, liebe Hanna, und glaube Deiner Mutter: selbstgethan ist wohlgethan. Das gilt nirgends so sehr wie im Haushalt, wie ich jetzt zu meinem eigenen Schaden einsehe. Du weißt, daß ich seit dem Tode Deines Vaters zu meinen Pflichten auch noch die seinen übernahm, also meine ganze Aufmerksamkeit nicht wie sonst der inneren Wirtschaft zuwenden konnte. Mansell Minchen ist ja recht verläßlich und kennt meine Art, und doch, wenn man nicht bei allem dabei ist, – beim Jahresschluß machte ich die unangenehme Entdeckung, daß unser Haushalt 225 Mark 63 Pfennige mehr gekostet hat, als im Vorjahre. Wodurch diese Mehrausgabe entstanden, weiß ich nicht, die Mamsell gebraucht ja stets etwas Butter mehr als ich, und auch mit den Eiern versteht sie nicht sparsam umzugehen, aber daran allein kann es doch nicht liegen. Jedenfalls aber merke ich, daß Frauenkraft allein nicht ausreicht für eine so große Besitzung wie Berkenhagen, daß eins dabei unter dem andern leidet. Zu einem Oberinspektor kann ich mich so schwer entschließen, das Regiment wird einem so leicht von solchen Leuten aus den Händen genommen, und so dachte ich denn, es wäre am besten, wenn ich den Antrag meines Schwagers Lauterbach annähme. Er war Weihnachten hier und stellte mir die Sache vor. Er hat das eine Kind, das schöne Vermögen, welches ihm meine verstorbene Schwester hinterlassen, dazu sein eigenes nicht unbedeutendes, und gilt weit und breit für einen selten tüchtigen Landwirt. Er ist auch recht gutmütig, meine verstorbene Schwester hat nie über ihn geklagt. Er würde auch Dir, liebe Tochter, ein guter Vater sein, er hat einen großen Bekanntenkreis, vielleicht gelingt es ihm, Dich trotz Deines geringen Vermögens – Du weißt vielleicht nicht, daß Du nur über 20+000 Mark verfügst, Berkenhagen war tief verschuldet, als ich Deinen Vater heiratete, und nur mit meinem Vermögen konnte es ihm erhalten bleiben – anständig zu verheiraten. Wenn es auch kein Otto Hofer sein wird, – ich habe Dir damals gleich gesagt, solch eine Partie kommt nicht wieder – so vertraue nur auf uns, mich und Deinen zukünftigen Vater, wir werden uns schon Mühe geben, Dich anständig zu versorgen. Unsere Vermählung wird in nicht ferner Zeit, wahrscheinlich Anfang März stattfinden, Lauterbach wünscht bei der Frühjahrsbestellung selbst anwesend zu sein.
Es erwartet Dich zu dem Tage natürlich bestimmt
Deine stets treue Mutter
Dorothea von Berken.«
Mehrere Male hatte ich den Brief gelesen, ehe ich den Sinn zu fassen vermochte. Mama wollte, so bald schon, eine neue Ehe eingehen, mein geliebtes Berkenhagen sollte einen neuen Herrn erhalten?
Ich kannte ihn, der nun bald dort an Stelle meines Vaters schalten und walten sollte, er war öfter bei uns gewesen und auch von Mama zu meinem Vormund ernannt worden! Er ist ein starker, schwerfälliger Mann mit einem runden, dicken Kopfe auf kurzem Halse, breiten, roten Händen und einer dröhnenden Baßstimme. Er lacht viel, am meisten über seine eigenen, plumpen Witze. Und den sollte ich Vater nennen, er sollte die gütige Vorsehung für mich spielen? Nein und tausendmal nein!
Ich sprang auf, badete mein glühendes Gesicht in kaltem Wasser und kleidete mich an. »Was soll ich thun? Was soll ich thun?« flüsterte ich dabei unzählige Male vor mich hin. Hier im Hause konnte ich seit dem Erlebnis der vergangenen Nacht nicht bleiben, die Heimat, an die ich noch soeben wie an eine Oase des Friedens gedacht, war mir mit einem Schlage fremd geworden.
Verwaist und heimatlos! Ich drängte die Thränen, die mir immer wieder heiß ins Auge traten, zurück und verließ das Zimmer. Ich fand Rose und den Baron am Kaffeetisch, auch sie hatten erst soeben das Wohnzimmer betreten. Rose trug ein Morgenkleid von dunkelblauem Plüsch mit langer Schleppe, ein Häubchen auf den hochgesteckten Locken; sie erschien mir ernster und frauenhafter als sonst. Der Baron sah überwacht und zusammengefallen aus und ließ sich Roses aufmerksame, kleine Dienste gern gefallen. Sonst lehnte er sich gewöhnlich schroff gegen alles auf, was nur im entferntesten an seine Jahre erinnerte, ich hatte ihn z.+B. nie anders wie sehr sorgfältig gekleidet gesehen, heute wies er nur mit entschuldigender Geberde auf sein bequemes Morgenjackett. Es war offenbar, er hatte endlich den Kampf gegen das heranziehende Alter aufgegeben, er fühlte sich geschlagen.
Seine Frau füllte ihm erst die Tasse, versah ihn mit Zucker und Sahne, ehe sie mir die Hand reichte. »Verzeih, liebe Hanna, aber mein Mann bedarf heute ein wenig meiner Sorgfalt. Das gestrige Fest mit der anstrengenden Pflicht des Repräsentierens hat ihn etwas angegriffen, es war wohl ein wenig zu viel nach den kaum überstandenen Strapazen der Reise. Und dann der ganze Gesellschaftstrubel der letzten Monate! Ich muß gestehen, auch mich hat er ermüdet.«
Sie beugte sich mit freundlichem Lächeln ihrem Gatten näher und fuhrt fort: »Und das rechte Vergnügen haben wir dabei doch nicht, Axel. Du findest an dem unruhigen Treiben kein Gefallen, und ich –,« sie wurde dunkelrot und stockte – »bin eine verheiratete Frau, der an Tanz und dergleichen nichts mehr gelegen ist.«
Ihr Mann schaute sie ungläubig an, der goldene Kaffeelöffel in seiner Hand klirrte leise gegen die Tasse. »Du wolltest, Rose, Du, mein junges, schönes Weib wolltest –+«
Sie unterbrach ihn, aus den braunen, voll zu ihm aufgeschlagenen Augen sprach ein heiliger Ernst. »Nur für Dich fortan leben, Axel,« sprach sie leise, »Halte es meiner Jugend zu gute, wenn es bis jetzt nicht geschah, wenn ich eine egoistische, vergnügungssüchtige –«
Er zog sie an sich und küßte ihre Stirn. »Meine Rose, mein Weib!«
Er hatte meine Anwesenheit offenbar völlig vergessen; erst als ich eine leise Bewegung machte, fiel sein Blick auf mich, und eine leise Röte huschte über seine Stirn. Er reichte mir freundlich die Hand. »Der erste Tag im neuen Jahre, Fräulein Hanna; mögen Sie ihn eben so freudigen Herzens begrüßen, wie ich es thue.«
Er sah glückstrahlend auf Rose, die begonnen hatte, die Couverts der zahlreich erschienenen Briefe aufzuschneiden und ihren Inhalt vor ihm hinzulegen. Es war einer der letzten Briefe, aus welchem er eine Einlage nahm und seiner Frau reichte.
»Für Dich, Rose, aus Berlin, von Alice!«
Sie überflog es, ihre Lippe zuckte dabei. »Deine Schwester ist in Verlegenheit,« beantwortete sie den fragenden Blick des Barons. »Ihre langjährige Gesellschafterin hat sie verlassen. Sie ist entrüstet und bittet mich, ihr Ersatz zu schaffen; in den Kreisen, welchen ich früher angehörte, ließe sich wahrscheinlich leicht derartiges finden.«
Baron Scholten streichelte begütigend die Hand seiner Frau.
»Zürne ihr nicht, mein Liebling, sie ist alt und verbittert und kann es nicht verschmerzen, daß Du mein ganzes Herz einnimmst.«
Mich durchzuckte es wie eine Erleuchtung. »Was verlangt die Baronin von ihrer Gesellschafterin?« fragte ich.
Rose sah mich verwundert an. »Das übliche: vorlesen, mit ihr ausgehen, Kommissionen besorgen. Aber warum fragst Du? Weißt Du jemand für die Stelle?«
»Ich selbst wäre dazu bereit!«
Sie fuhr zusammen, auch der Baron richtete seine erstaunten Augen auf mich. »Aber das kann doch nur ein Scherz sein, Fräulein von Berken,« meinte er.
Ich zog Mamas Brief aus der Tasche und reichte ihn Rose hinüber. »Lies, Rose, und sage dann Deinem Gemahl, daß ich nicht scherze, daß ich – kein Heim mehr habe!«
Sie hatte die Zeilen schon durchflogen und zog mich stürmisch in ihre Arme. »Meine arme, liebe Freundin! Aber wie kannst Du nur so sprechen, weißt Du nicht, wie glücklich ich wäre, Dich immer bei mir zu behalten?«
Auch der Baron, den Rose in fliegenden Worten verständigt, drang in mich, doch mit demselben Erfolg. Ich hatte das richtige gefunden: meine eigene Kraft sollte mir eine Stätte gründen, auf die ich ein Recht hatte. Umsonst schilderte mir Rose, als der Baron das Zimmer verlassen, wie eigentümlich ihre Schwägerin sei, wie selbstsüchtig, wie hochmütig trotz aller zur Schau getragenen Frömmigkeit, wie monoton und einsam sie lebe: ich ließ mich nicht abschrecken. Meine Energie war erwacht, schon eine Stunde später war ein Brief unterwegs, welcher Hanna von Berken der Baronesse von Scholten als Gesellschafterin antrug.
* * *
Einen Tag später. Die Schreckensscene in der Sylvesternacht, an welche Rose und ich mit keiner Silbe rühren, hatte heute ihr Nachspiel. Herr von Steinthal hat seine Abschiedskarte gesandt, Familienverhältnisse zwängen ihn, sich versetzen zu lassen, er müsse schon heute abreisen und bedauere unendlich, sich nicht persönlich empfehlen zu können.
Baron Scholten sah mich forschend an, während er die Zeilen laut vorlas. »Sehr überraschend, in, der That, ich glaubte an einen andern Schluß unseres Verkehrs mit dem Herrn.«
Ich gab ruhig seinen Blick zurück, »Herr von Steinthal hat mir einen Antrag gemacht, ich mußte ihn zurückweisen; ich liebe ihn nicht!«
Scholten trat lebhaft auf mich zu. »Verzeihung, Fräulein Hanna, ich wollte nicht indiskret sein! Und im übrigen« – er zog meine Hand ehrerbietig an seine Lippen – »sind Sie stets meiner Verehrung und Hochachtung gewiß.«
Rose stand während dieses Gespräches an einer Etagere und ordnete die kostbaren, japanesischen Krüge und Schalen auf derselben. Sie klirrten unter ihren Händen, und ihr Gesicht war weiß bis in die Lippen, als ich zu ihr trat.
* * *
Anfang Februar. Schon seit drei Wochen bin ich in der Reichshauptstadt, und noch immer fand ich kein Stündchen der Muße für diese Blätter. Oder bin ich bereits zu müde, zu stumpf dazu? Ach, ich hatte meine Kraft überschätzt, ich hatte ja auch nicht gewußt, wie schwer, wie lähmend es ist, sein eigenes Selbst zu verleugnen, sich nicht viel besser als einen Automaten behandelt zu sehen, von welchem man stillschweigend annimmt, daß er keinen eigenen Willen, keine eigene Meinung und kein eigenes Urteil hat. Rose hat in der Schilderung ihrer Schwägerin, meiner jetzigen Herrin, nicht übertrieben. Gleich als ich ins Haus trat, als mir die große, hagere Frauengestalt in gesucht einfacher schwarzer Kleidung, auf welcher das übergroße, goldene Kreuz fast aufdringlich blitzte, entgegentrat, als sie die kalten grauen Augen so gleichgültig prüfend auf mich richtete, mir die langen, gelblich-weißen Finger zum Kusse reichte, durchschauerte es mich eisig, und ich wäre gerne geflohen, hätte ich nur gewußt wohin.
Nach Berkenhagen wäre ich gerade recht zu den Hochzeitsvorbereitungen gekommen, und Mamas Verlobter hätte vielleicht wieder die schwere Hand auf meine Schulter gelegt und schallend gelacht: »Na, bist richtig wieder da, Hanning? Hab' ich Dir nicht gesagt, wirst es bald genug satt kriegen, Gesellschaftsfräulein zu spielen, und dann noch gerne den hübschen, forschen Kerl nehmen, den Onkel Lauterbach für Dich bereits in petto hat? Was Proppres, Hanning, wirst mit mir zufrieden sein!«
So ähnlich hatte er gesprochen, als ich, bevor ich die Reise hierher antrat, ihn in Berkenhagen getroffen, und dabei hatte er mir mit den kurzen, fetten Fingern in die Wange kneifen wollen und sich vor Vergnügen klatschend aufs Bein geschlagen, als ich ihm ängstlich auswich. Und dann hatte er meiner Stiefmutter mit dem breiten, roten Gesicht gutmütig zugenickt: »Laß man, Dorchen, solch junges Volk will auch mal seinen Willen haben! Kommt uns schon wieder, die Kleine, und tanzt noch auf unserer Hochzeit, so wahr ich August Eduard Lauterbach heiße!«
Nein, nach Berkenhagen konnte ich nicht zurück, nur als Gast und der Kinder wegen würde ich es Wiedersehen. Und doch, wie schwer, wie unsagbar schwer wurde mir der Abschied von der geliebten Heimat, wieviel Leid und Weh hatte ich durchzukosten, ehe ich von ihr ging. Noch einmal, zum letztenmale, wanderte ich durch die verschneiten Wege des Gartens und des Parkes, begleitet von hundert lieben Erinnerungen. Diesen schlanken Stamm hatte Vater an meinem zehnten Geburtstag gepflanzt; dort unter der alten Linde hatte er mich so oft auf seinen Knien gehalten und mir von meiner Mutter erzählt; in dieser Laube pflegte er an Sommerabenden so gerne zu sitzen, mit mir zu plaudern, sich mit den Kleinen zu necken. Und hier auf der mächtigen, alten Kastanie, ganz versteckt in einem lauschigen Nest von grünen Zweigen, hatte ich oft mit Heinz gesessen, zwischen diesen Fliederbüschen waren wir Hand in Hand gewandert, dort auf jenem Bänkchen hatten wir im Mondschein der Nachtigall gelauscht, aber dort, wo der Rotdorn seine schneebedeckten Zweige vor den Eingang des Laubweges streckte, hatte er mich von sich gestoßen. Vorbei, vorbei!
»Ach, Thränen machen nicht maiengrün, lassen tote Liebe nicht wieder blühn!« klang es mir durch den Sinn, als ich den Park verließ und den Seitenpfad einschlug, welcher auf den kleinen Friedhof führt. Es galt ja auch dort noch Abschied zu nehmen. Ich wollte stark sein, gewappnet für mein ferneres Leben; aber dort auf dem stillen Fleck, der mein Liebstes barg, verlor ich die mühsam behauptete Fassung. Ich drückte meine heiße Wange an das Kreuz, welches meiner Mutter Namen trug, ich kniete neben dem schneebedeckten Grabe meines Vaters nieder und umschlang den Stein am Kopfende des Hügels.
»Nun muß ich fort, Vater,« schluchzte ich. »Dein Kind, Deine Hanna, geht in die fremde, kalte Welt, ist heimatlos! O, Vater, lieber Vater!«
Ich hielt den Atem an, ich blickte mit weitgeöffneten Augen um mich, er hatte seine Hanna so geliebt – o, ein Zeichen nur, daß er mich gehört! – Aber alles blieb still, lautlos fiel der Schnee herab, Bäume und Sträucher standen reglos, wie festgebannt unter seiner Wucht. Nur Hektor, der mir gefolgt war, stieß klagende Laute aus und sprang stürmisch in die Höhe, als ich mich endlich erhob.
Als ich eine Stunde später im Eisenbahncoupé saß, wurde noch im letzten Moment die Thür aufgerissen und eine Dame sprang hastig hinein. Es war Fräulein Else Meinhard, die mich lebhaft begrüßte.
»Wie schade, Fräulein Hanna, daß ich nur eine halbe Stunde mit Ihnen zusammen sein kann! Ich fahre nur bis zur nächsten Station, wo ich von Bekannten, bei denen man morgen Hochzeit feiert, erwartet werde. Es ist im Winter so sterbenslangweilig auf dem Lande, man muß alles mitnehmen, und ich begreife, daß auch Sie, kaum gekommen, eiligst wieder Reißaus nehmen. Dazu noch den dicken Lauterbach zum Papa! Entzückende Aussicht! Sagen Sie nur, Einzigste, wie konnte Ihre Mama solche Wahl treffen? Nach Herrn von Berken – wissen Sie, ich hatte immer ein faible für Ihren schönen Papa – den dicken Lauterbach! Aber chacun a son goût, nicht wahr? – Und nach Berlin reisen Sie? Ich hörte es gestern zufällig von Frau Otto Hofer, mit der ich bei den andern Hofers in Sophienruh zusammentraf. Die kleine Frau ist ja ganz untröstlich über Ihre Abreise. Was haben Sie übrigens nur gesagt, daß die gnädige Frau Mama schnell pater peccavi machte, und es sich ganz wohl sein läßt bei dem bürgerlichen Schwiegersohn? – Also wirklich nach Berlin? Wissen Sie, daß Sie beneidenswert sind und sich ganz unnötig Ihre schönen Augen rot geweint haben?«
Sie rückte mir näher und sah mir mit ihren dreisten, schwarzen Augen ins Gesicht. »Ihre schönen Augen!« wiederholte sie. »Sagen Sie mal aufrichtig, Kind, wie oft hat unser gemeinsamer Freund und Verehrer, Egon Tesmer, dieselben eigentlich besungen? Es war doch eine allerliebste Zeit damals vor zwei Jahren, ich amüsiere mich noch oft in dem Gedanken, wie brillant der Troubadour die Rolle des bekannten Esels zwischen den beiden Heubündeln spielte. Nun, zuletzt trugen Sie den Sieg davon, und in Berlin, wo er Ihrer gewiß bereits sehnsüchtig harrt, kommt die Sache zum glücklichen Ende. Eine Verlobungsanzeige bekomme ich doch auch? Aber bitte bald, sonst komme ich Ihnen zuvor; auch ich stehe nämlich am Vorabende eines großen Ereignisses.«
Sie lachte laut auf, und ich benutzte die Pause in ihrem Wortschwall, um ihr zu sagen, daß Herr Tesmer mich nie besungen und ich in keiner Verbindung mit ihm stehe.
Sie sah mich ungläubig an. »Aber Sie werden ihn doch in Berlin sehen?«
Ich zuckte die Achseln, ich hatte in letzter Zeit kaum mehr an Tesmer gedacht. Fräulein Else hatte mich aufmerksam beobachtet, dann fragte sie plötzlich: »Und wie geht es Herrn Dr. Wagner? Von ihm hören Sie natürlich!«
»Auch das muß ich verneinen, Fräulein Meinhard!«
Sie wurde dunkelrot, und dann ihre Sachen zusammenraffend – der Zug hielt bereits – sagte sie hastig: »Leben Sie wohl, Fräulein Hanna, und – verzeihen Sie mir!«
Sie hielt mir die Hand entgegen, ich legte meine Fingerspitzen hinein. Ich ahnte es längst, daß sie es gewesen, welche das Gift des Argwohns in Heinz' Herz gesenkt, aber ich zürne ihr kaum deswegen. Warum glaubte er ihr? Warum durfte ich nicht sprechen?
* * *
Am 10. Februar. Ein Tag vergeht langsam wie der andere, kaum ein Ton dringt aus dem Getriebe der Großstadt hierher in das stille Haus der vornehmen Straße, welche hinaus auf den nahen Tiergarten mündet. Fräulein von Scholten versteht es auch meisterhaft, solche Töne fernzuhalten, nicht bis zu dem stillen Frieden ihres »dem Herrn geweihten« Daseins gelangen zu lassen. Alles, was außerhalb ihrer Sphäre liegt, behandelt sie mit streng erhobenen Augenbrauen, mit wegwerfendem Zucken der schmalen Lippen, in erster Linie natürlich Theater und Konzerte, diese »Stätten sündhafter Weltluft«. Ich habe darum noch nicht den Mut gefunden, einen darauf hinzielenden Wunsch laut werden zu lassen, trotz der glühenden Sehnsucht, die ich manchmal nach irgend einem Kunstgenuß empfinde. Glühende Sehnsucht! Als ob ich wirklich noch derartiges empfände, als ob nicht die hier im Hause verlebte Zeit bereits anfängt, mich stumpf und wunschlos zu machen!
Des Morgens mit dem Glockenschlage acht – nicht eine Minute früher oder später – trete ich in das Zimmer der Baronesse, die, bereits fertig für den Tag gekleidet, im Sessel sitzt und mir nach stummem Gruße ein aufgeschlagenes, in schwarzen Sammet gebundenes Buch entgegenreicht. Es ist ein Andachtswerk, und mein Amt ist es, morgens und abends eine der fast ausnahmslos sehr langen Betrachtungen, welche es wohlgeordnet für jeden Tag der Woche enthält, daraus vorzutragen. Auch Hollmann, der langjährige Diener des Hauses, die Köchin und das Stubenmädchen sind zugegen, sie stehen in der Nähe der Thür, und oft fliegt ein scharf beobachtender Blick der Herrin zu ihnen. Vor einigen Tagen hatte sich der Bediente, ein alter, grauköpfiger Mann, bei einer besonders langen Abendandacht müde an den Thürpfosten gelehnt; ich fuhr gleich ihm erschreckt zusammen, als der Baronin harte Stimme seinen Namen rief.
Nachdem das Buch geschlossen und die Dienerschaft lautlos das Zimmer verlassen, nehme ich sofort ein anderes, dieses Mal das Haushaltungsbuch, zur Hand. Jeder verausgabte Pfennig wird nicht einmal, sondern mehrere Male gebucht, und endlose Debatten entstehen um den unaufgeklärten Verbleib eines solchen. Baronesse von Scholten ist trotz ihres Reichtums sehr geizig, die Art, wie sie mit Näherinnen, Handwerkern und dergleichen kleinen Leuten feilscht, treibt mir oft die Röte der Scham ins Gesicht. Dabei aber ist ihr Dasein, wie sie oft betont, der Barmherzigkeit geweiht, sie gehört verschiedenen wohlthätigen Vereinen an, freilich nur solchen, die unter dem Protektorat irgend einer hohen Dame stehen, und näht und strickt unermüdlich für dieselben.
Bei letzterer Beschäftigung helfe ich ihr eifrig bis zur zwölften Mittagsstunde, wo Hollmann mit der Meldung erscheint, daß die Equipage vorgefahren, und wir uns zur täglichen Ausfahrt rüsten. Die Baronin geht im Winter keinen Schritt ins Freie, sie fürchtet sich unsäglich vor jedem kalten Lüftchen, und hält selbst im festgeschlossenen Wagen ängstlich ihr weißes Tuch an den Mund gepreßt. Von einer Unterhaltung zwischen uns kann also nicht die Rede sein; ich sitze stumm neben ihr und schaue sehnsüchtig durch die Scheiben der Wagenfenster auf die bereiften Bäume des Tiergartens, die verschiedenen Gefährte und vielen Menschen, an welchen wir vorüberrollen. Oft sehe ich ganze Trupps junger Mädchen, mit rosigen Gesichtern unter den kecken Pelzmützen, die Schlittschuhe fröhlich schwenkend, dahineilen. Wie beneide ich sie, wie gern ginge ich mit ihnen. Ich, das Landkind, an Bewegung und Freiheit gewöhnt, bin wie der Vogel im Käfig. Man flattert wohl gegen die Stäbe desselben, stößt sich vielleicht sogar den Kopf blutig daran und – duckt sich schließlich doch geduldig in seinen Winkel.
Nach dem Mittagessen, welches sofort nach unserer Rückkehr serviert wird, setzt sich die Baronin in ihren Lehnstuhl, ich ergreife wieder ein Buch, dieses Mal Geschlechter- und Wappenkunde, und lese vor. Die große, schwarze Frauengestalt mir gegenüber sitzt regungslos mit geschlossenen Augen da, sowie ich aber ermüdet bin und eine längere Pause mache, richtet sie sich auf und sieht mich mit den wasserhellen Augen strafend an. Wenn sie sich, genau nach einer Stunde, erhebt, ist es auch mir gestattet, und ich darf den Kaffee bereiten. Um diese Zeit klingelt es manchmal, und der Diener meldet irgend eine hocharistokratische Dame, welche sich nach dem Befinden ihrer lieben Baronin erkundigen will. Ich werde dann flüchtig als: »Meine Gesellschafterin!« vorgestellt, und man sieht es nicht ungern, wenn ich das Zimmer verlasse. Sind wir wieder allein, wird eifrig für irgend einen Verein geschafft. Ich stricke jetzt Strümpfe für Botokudenkinder, nur schade, daß mir das noch immer kein so erhebendes Bewußtsein ist, wie es eigentlich sollte – und zwar bis zum Abendessen, nach welchem Hollmann ein für allemal das Kästchen mit dem Dominospiel auf den Tisch stellt. Es ist eine entsetzliche Beschäftigung für mich und doch: ich spiele, spiele, bis endlich der kleine Zeiger der Stutzuhr, deren Schäferpaar aus Meißner Porzellan mir schon lange mitleidige Blicke zugeworfen, die zehnte Stunde verkündet. Nun kommt noch die Abendandacht, wobei die Köchin mit den blauroten, fromm gefalteten Händen gewöhnlich schlaftrunken schwankt, und dann kann ich mich – zurückziehen! Ach nein, erst muß Baronesse Alice von Scholten schlafen können, bevor es ihrer Gesellschafterin vergönnt ist. Es ist gewöhnlich ein englischer Roman orthodoxer Richtung, der Gott Morpheus herbeiwinken soll. Aber so trocken und langatmig sein Inhalt, erst nach Stunden thut er seine Schuldigkeit. Dann darf ich mich lautlos zurückziehen und in der Stille meines Zimmers Betrachtungen über Vergangenes und Gegenwärtiges anstellen. Wie oft kommen mir dabei die Thränen in die Augen, wie oft weine ich mich in den Schlaf!
* * *
Ende Februar. Heute wurde mir in Gegenwart der Baronin eine Sendung aus der Buchhandlung gebracht. Sie sah mit strenger Richtermiene auf das kleine Paket, welches der Diener auf den Nähtisch zwischen uns gelegt hatte.
»Hoffentlich sind das keine Romane, Fräulein, leichtfertig geschriebene Machwerke, welche von vornherein jedem guten Einfluß entgegenarbeiten!«
Meine Lippen zuckten, doch bezwang ich mich und sagte ruhig: »Nein, gnädiges Fräulein, es ist die Fortsetzung eines größeren naturwissenschaftlichen Werkes, welches ich in Lieferungen erhalte.«
»Naturwissenschaftliches Werk?« Die Fragende richtete sich kerzengerade in ihrem Sessel auf und ließ entsetzt den groben Wollstrumpf, an welchem sie strickte, in den Schoß sinken. »Und das gestehen Sie mit so dreister Stirn, mein Fräulein? Wissen Sie es denn wirklich nicht, daß Sie mit Hilfe solcher Lektüre auf dem besten Wege sind, ein Freigeist, eine Atheistin zu werden? Oder vielleicht sind Sie es schon?« fuhr sie immer erregter fort, während eine stechende Röte in ihr hageres Gesicht stieg.
»Darum also Ihre ablehnende Haltung bei jedem auf das einzig wahre hinzielenden Gespräch, Ihre Gleichgiltigkeit bei meinen humanen Bestrebungen?«
Ich erhob mich stolz. »Ich bedauere unendlich, gnädiges Fräulein, Ihr Mißfallen erregt zu haben; da ich aber nicht gewohnt bin, mein Geistesleben derartig kontrolliert zu sehen, so ist es wohl am besten, wenn ich Sie um meine Entlassung –+«
Die Angeredete unterbrach mich; das hatte sie nicht erwartet, und eine so willige Gesellschafterin, welche noch dazu von vornherein auf jedes Gehalt verzichtete, fand sich wahrscheinlich auch nicht so bald.
Sie winkte abwehrend mit der Hand. »Wie Sie eine Sache auf die Spitze treiben können, Fräulein von Berken! Ich traue Ihnen ja nicht ernstlich solche Verirrung zu, nur warnen wollte ich Sie mit dem Rechte meiner Jahre und meiner Erfahrung. Die Jugend entfernt sich so leicht vom Wege des Heils und sollte darum die Hand nicht zurückstoßen, die sie wieder darauf zurückführen möchte.«
Sie klopfte mit dem hageren, langen Zeigefinger mehreremale scharf auf das Paket. »Glauben Sie mir, Fräulein, hier drinnen schlummert ein Giftstoff, der schon stärkere Seelen als die Ihre angefressen und sie unaufhaltsam ins Verderben gezogen hat. Den Gläubigen ist das Himmelreich und nicht den Grüblern und den Zweiflern.«
Mir stieg das Blut heiß ins Gesicht, und furchtlos begegnete ich dem stechenden Blick der Baronin. Es wäre feige, hier zu schweigen. Heinz' geliebte Wissenschaft, mein einziger Trost, meine einzige Zerstreuung in der Öde meines jetzigen Lebens, hatte ein Recht auf meine Verteidigung.
»Wer aber den Schöpfer liebt,« sprach ich glühend, »sollte der nicht auch sein Werk lieben? Und wo sollte man Gott mehr lieben, anbetender vor ihm knieen, als in seinem eigensten Tempel, inmitten seiner wunderbaren, herrlichen Natur? Zu Hause, gnädiges Fräulein, wenn ich in früher Morgenstunde durch den Wald ging, wenn es um mich blitzte und funkelte, rauschte und duftete, sang und jubilierte, da habe ich wohl unwillkürlich die Hände gefaltet und mit feuchten Augen gen Himmel geblickt. Glauben Sie wirklich, daß da meine Andacht nicht tiefer, wahrer und besser war als in der von Menschenhänden erbauten Kirche, wo sich so vieles unseren Sinnen aufdrängt, unsere Stimmung ablenkt, daß meine gestammelten Worte nicht ein besserer Ausdruck meines Dankes, meines heiligen Empfindens waren, als das lange, mir vorgeschriebene Gebet?«
Die Baronin hatte sich während meiner Worte unruhig auf ihrem Sitz bewegt, jetzt sagte sie schneidend: »Phrasen! Ich kenne das! Der sogenannte Naturfreund gebraucht sie im ersten Stadium seiner Entwickelung und meint es – ich will Ihnen das zugeben – gewöhnlich ehrlich damit. Aber er bleibt nicht dabei. Er geht weiter, er dringt mit frevelhaftem Mute immer tiefer in die Geheimnisse der Schöpfung, er zieht mit frecher Hand einen Schleier nach dem andern von ihrem Antlitz, und je mehr er erblickt, desto weiser dünkt er sich. Er glaubt an keine Wunder mehr, es ist ja alles so einfach, eins folgert sich aus dem andern – wozu bedarf es da eines Schöpfers? – Bis er schließlich das Werk über den Meister stellt, Gott einfach aus seiner Schöpfung wegdisputiert. Die Thörichten! Als wenn nicht geschrieben stände: Selig sind, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen!?«
Ein Besuch wurde gemeldet und enthob mich einer Antwort, auch später kam die Baronesse nicht mehr auf unser Gespräch zurück, nur die Abendandacht hielt sie heute selbst. Sie hatte eine Betrachtung gewählt, welche mit aller Schärfe gegen die Gottlosen, die Spötter und die Zweifler gerichtet war.
* * *
Am 5. März. Fräulein von Scholten ist krank, der Arzt kommt täglich ins Haus. Sie leidet an allgemeiner Schwäche, die sich oft bis zu Ohnmachtsanwandlungen steigert.
»Kein Wunder, Gnädigste,« brummte der alte Geheimrat, als er seine erste Visite machte, »kein Wunder bei Ihrer Lebensweise! Sie machen sich zu wenig Bewegung und sperren zu ängstlich die frische Luft ab. Jetzt werden wir erst durch sorgfältige Pflege die Kräfte etwas zu heben suchen und dann: täglich hinaus. Aber nicht etwa, wie bisher, im geschlossenen Wagen, sondern direkt in die freie, frische Luft, die noch keinem Menschen geschadet hat.«
»Auch Ihnen, mein liebes Fräulein,« sagte er im Vorzimmer, wohin ich ihn begleitet hatte, »wird meine Verordnung dienlich sein. Sie sehen für eine so junge Dame merkwürdig bleich aus.« Er lachte gutmütig. »Macht sich ja nicht übel im Verein mit den großen, dunklen Augen; andere Leute werden es sogar wahrscheinlich ungeheuer interessant« – er betonte die letzten beiden Worte sehr komisch – »finden; aber wir Ärzte sehen denn doch lieber Rosen, als Lilien auf so jungen Wangen.«
Er kommt seitdem täglich und hat immer ein freundliches Wort für mich und die Sorgfalt, mit welcher ich Tag und Nacht um die Patientin bin. Letztere nimmt dieselbe gleichgiltig, wie etwas Selbstverständliches hin, wenigstens hat mich noch kein warmer Blick, kein freundliches Wort vom Gegenteil überzeugt, und doch ist sie mir durch ihre Krankheit viel näher gerückt. Die starre Unnahbarkeit, welche sie von vornherein gegen jedes wärmere Gefühl abschloß, ist geschwunden, schwach und hilflos wie sie ist, empfinde ich herzliche Teilnahme für sie. Trotz ihres Reichtums ist sie so arm, kein Wesen, welches zu ihr gehört, welches für sie fühlt und sorgt. Ich weiß, wie traurig solch Bewußtsein macht, und darum streichele ich leise ihre welke Hand, wenn sie so müde auf ihrem Ruhebett liegt, und plaudere ihr vor von der Heimat, meinem Mütterchen, dem unvergeßlichen Vater und den Zwillingen.
Letztere haben bereits wieder einen Vater erhalten, vor einigen Tagen feierte man Hochzeit in Berkenhagen.
* * *
Am 15. März. Mit unserer Patientin geht es täglich besser, wir haben schon eine Ausfahrt im offenen Wagen gemacht, in nächster Woche beginnen unsere Spaziergänge. Ich freue mich dazu, der Frühling beginnt sich zu regen, und ich bin so gerne um diese Zeit im Freien. Nun hat auch unsere stille Straße ein ganz verändertes Aussehen erhalten. Die Linden zu beiden Seiten derselben stehen seit dem letzten, warmen Regen unter lichtgrünem, zartem Flor, Schneeglöckchen und Krokus schlagen in den kleinen Vorgärten die Augen auf, und hier und da wird ein Fenster geöffnet und ein blonder oder brauner Kinderkopf beugt sich hinaus und schaut dem Spiel der gelben Schmetterlinge da draußen zu.
»Nun muß sich alles, alles wenden!« singt soeben eine süße Frauenstimme im Nachbarhause, und ich drücke die Hand aufs Herz und spreche leise die Worte nach. Warum ist mir plötzlich so frei und leicht ums Herz – grünt es denn auch im Frühling, das Kräutlein Hoffnung?
* * *
Am 16. März. Die Sonne sandte heute den Menschenkindern so strahlende Grüße vom Himmel herab, daß Baronesse Alice trotz ihrer hypochondrischen Ängstlichkeit nun nicht länger zögerte und an meinem Arm, gefolgt von Hollmann, der eine warme Hülle in Bereitschaft hielt, dem nahen Tiergarten zuschritt. Dort wimmelte es von fröhlichen Kindern, Damen in hübschen Frühjahrstoiletten, alten und jungen Paaren. Ich atmete nach der langen Winterhaft auf, mir war's, als wüchsen mir hier in dem herrlichen, lenzdurchwehten Waldpark, unter den hohen, knospenden Bäumen Schwingen, die mich hinwegtrügen über den Erdboden.
Wie schön ist doch die Welt, und es sollte Sünde sein, sie zu lieben? Ich sah unwillkürlich meine Begleiterin an. Sie atmete in tiefen Zügen die weiche, würzige Luft, ihr Gesicht war milder als sonst, ihre Augen hatten einen Teil des ihnen sonst eigenen harten, kalten Ausdrucks verloren. Dankte sie nun doch dem Schöpfer hier in seinem herrlichen Tempel für ihre Genesung?
Heute war sie auch gesprächiger als sonst, machte mich auf verschiedene Plätze und die dieselben schmückenden Gruppen und Figuren aufmerksam und freute sich offenbar meines Entzückens. Wir waren eben in einen der stilleren Seitenwege getreten, als uns eine Dame am Arme eines Herrn entgegentrat. Letzterer hatte den Kopf zur Seite gewandt, seine Begleiterin, eine ältere Dame mit leicht ergrauten Lockenpuffen zu beiden Seiten des fast noch jugendlich-schönen Gesichtes sah uns voll entgegen. Ein freudiges Erkennen trat in ihre Züge, sie verneigte sich lebhaft, ließ den Arm des Herrn frei und trat auf uns zu.
»Wie angenehm, meine liebe Baronesse! Ich habe mich stets im Verein so lebhaft nach Ihnen erkundigt, mit so tiefem Bedauern von Ihrer Krankheit gehört, und freue mich nun doppelt, Sie so frisch wiederzusehen!«
Auch die Angeredete hatte sich frei gemacht und der Dame die Hand gereicht. »Herzlichen Dank, Frau Präsident,« sagte sie verbindlich, »und zugleich auch dafür, daß Sie den ganzen Winter hindurch alle Vorstandsgeschäfte, die ich mit Ihnen teilen sollte, so bereitwillig auf Ihre Schultern genommen. Gottlob, geht es mir nun aber besser, in nächster Woche hoffe ich bestimmt wieder meinen Pflichten nachkommen zu können. Vielleicht aber begleiten Sie mich noch ein wenig und orientieren mich im voraus?«
Die Dame verneigte sich zustimmend und die Baronin fuhr fort: »Sie gestatten gnädige Frau: Fräulein von Berken, meine Gesellschaftsdame – Frau Präsident Tesmer, liebes Fräulein, meine verehrte Mitvorsteherin im Verein für verwahrloste Kinder.«
Die Dame, deren Name nur undeutlich an mein Ohr geklungen war, reichte mir mit liebenswürdigem Lächeln die Hand und trat dann einen Schritt zurück, um ihrem etwas zurückgebliebenen Begleiter Platz zu machen.
»Meines Sohnes erinnern Sie sich vielleicht noch von der letzten Vereinssoirée, Baronin, wo er, die Ehre hatte, Ihnen vorgestellt zu werden. Referendar Tesmer, mein liebes Fräulein – Fräulein von Berken, lieber Egon, die Dir vielleicht erlaubt, sie zu begleiten, während ich mich Baronesse von Scholten anschließe.«
Sie reichte der zuletzt Genannten den Arm, ihr Sohn und ich folgten langsam. Egon Tesmer hatte noch kein Wort zu mir gesprochen, mich nur mit vor Erregung entfärbtem Gesicht angeschaut, jetzt sagte er leise: »Fräulein Hanna, sagen Sie mir, daß ich nicht träume, daß Sie es wirklich sind, die ich hier vor mir sehe!«
Ich entzog ihm meine Hand, die er mit fast schmerzhaftem Drucke ergriffen hatte. Mein Herz schlug stürmisch, und es klang mir selbst gezwungen, als ich fragte: »Ist Ihr Gedächtnis so treulos, Herr Tesmer, oder haben mich die letzten zwei Jahre in der That so verändert?«
Er sah mich mit Blicken an, vor welchen sich die meinen senkten.
»Verändert? Ja, die duftende Knospe hat sich zur berauschend schönen, weißen Rose erschlossen, aber erkannt hätte ich sie darum doch, unter Tausenden! Ich ein treuloses Gedächtnis? Für Sie, Fräulein Hanna, für meine Muse, an die ich so oft mit so glühender Sehnsucht gedacht? Warum antworteten Sie mit keiner Silbe auf meinen Brief?« fragte er traurig.
Ich sah ihn verwundert an. »Ihren Brief, Herr Tesmer?«
»Ja, ich schrieb Ihnen nach Ihres Vaters Tode, welchen ich durch die Zeitung erfahren, und bat –+«
Ich unterbrach ihn. »Verzeihen Sie, ich war damals so wenig für Trost zugänglich, ich vernichtete jeden Brief, welcher in der Zeit an mich gelangte, ohne ihn zu lesen.«
Er biß sich auf die Lippen. »Jeden Brief! Und wie hätte ich auch denken können, daß der meine eine Ausnahme bilden würde! Sie sind schon längere Zeit Gast im Hause der Baronin Scholten, gnädiges Fräulein?« fragte er dann im verändertem Ton.
»Zu Anfang dieses Jahres trat ich meine Stellung als Gesellschafterin dort an.«
Er fuhr zusammen, ein tiefes Erschrecken malte sich in seinen schönen, sprechenden Zügen. »Gesellschafterin? Aber wie ist das möglich, Fräulein Hanna? Was ist geschehen?«
Wie warm das klang, wie herzlich! Ich war es so entwöhnt, in dem Tone sprechen zu hören, meine Augen füllten sich mit Thränen, als ich antwortete: »Meine Stiefmutter ist eine neue Ehe eingegangen, ich habe kein Recht mehr auf die geliebte Heimat!«
Über Tesmers Stirn zog eine dunkle Röte, seine. Augen flammten.
»Und zu Fremden mußten Sie Ihre Zuflucht nehmen? Es war niemand, der das verhinderte?« –
»Niemand!« wiederholte ich leise.
Wieder ergriff er meine Hand und drückte sie heftig.
»Das aus Ihrem Munde zu hören, Ihre Augen so traurig blicken zu sehen und machtlos mit gebundenen Händen daneben zu stehen!« Er sah mir flehend mit den schönen, blauen Augen ins Gesicht. »Nein, so dürfen Sie mich nicht ansehen, Hanna, ich ertrag es nicht! Ich muß Sie lächeln sehen, und sollte ich dieses Lächeln einer Welt abtrotzen!« Er schwieg und starrte düster zu Boden.
»O,« fuhr er nach ein paar Minuten fort, »warum klingt das aus meinem Munde wie thörichte Phrase eines Schwärmers, warum mußte mir die eine bittere Stunde das Recht dazu für immer entreißen. Nein, nicht für immer,« fuhr er leidenschaftlich fort, »ich will glauben, daß diese Stunde nie gewesen, daß Ihre Hand nie mein Herz zurückgestoßen!«
Er sah, wie ich zusammenzuckte und sprach bittend weiter:
»Fräulein Hanna, ist es denn so unrecht, wenn ich vergessen will, wenn das Glück dieser Stunde mich berauscht? Wenn Sie wüßten, wie mir zu Mute ist! Als wenn mein Herz lange, lange geschlafen und nun erwacht, als wenn ein Reif, der es fest mit eisernem Druck umklammert hielt, plötzlich abgefallen ist davon.« Er nahm den weichen Filzhut vom Kopfe und atmete tief auf.
»Kennen Sie das Märchen vom treuen Heinrich und den drei eisernen Bändern, welche er sich ums Herz legen ließ, damit es ihm nicht zerspränge vor Weh und Herzeleid? Und wie dann die Not ein Ende hat und sie krachend von ihm abfallen?« Wieder that er einen tiefen Atemzug, dann beugte er sich näher und flüsterte leise, dicht an meinem Ohr: »Es war ein Band von meinem Herzen, das da lag in großen Schmerzen!«
Ich hatte unwillkürlich meine Schritte beschleunigt; erst als wir in Gehörweite der beiden Damen waren, richtete ich das Wort an meinen Begleiter.
Ich erkundigte mich nach seinem geistigen Schaffen und schilderte ihm, welchen Eindruck sein Waldmärchen, welches er mir vor Jahren gesandt, auf mich gemacht »Und doch fand kein armes Wörtchen den Weg darauf zu mir,« meinte er traurig. »Ich durfte es darum auch nicht wagen, aufs neue mit meinen schlichten Geisteskindern zu Ihnen zu dringen. Ich hätte sie Ihnen so gern gesandt; die günstige Aufnahme, welche meine Arbeiten fanden, hätte mich dann doppelt erfreut. Jetzt beschäftigt mich die erste, größere Arbeit, ein mehrbändiger Roman. Ich glaube, daß ich damit mein eigentliches Feld gefunden habe, ich schaffe mit Lust daran und hoffe – besonders jetzt, wo ich meine Muse gefunden habe,« schaltete er lächelnd ein – »gutes davon.«
Ich hatte ihm interessiert zugehört und sprach eben die Hoffnung aus, seine früheren Arbeiten noch jetzt kennen zu lernen, als der Baronesse harte Stimme mich anrief: »Bitte, Ihren Arm, Fräulein, ich bin ermüdet. Sie vergaßen, mich zu erinnern, daß die vom Arzt bewilligte Stunde seit sechs Minuten bereits abgelaufen ist.«
Sie reichte ihrer bisherigen Begleiterin die Hand. »Auf Wiedersehen, Frau Präsident! Es war mir eine angenehme Stunde; hoffentlich begegnen wir uns von nun an öfter auf unsern Promenaden!«
Über Tesmers Gesicht war bei ihren ersten Morten eine flammende Röte gehuscht, jetzt strahlte es in seinen Augen auf, und während er sich verneigte, flüsterten seine Lippen: »O Königin, das Leben ist doch schön!«
* * *
Einen Tag später. Als ich vorhin müde und abgespannt, es war bereits die zwölfte Abendstunde, auf mein Zimmer kam, fiel mein Blick auf ein kleines Packet, welches meine Adresse trug. Aus der Buchhandlung erwartete ich nichts, die schöne, fast zierliche Männerhand, welche meinen Namen geschrieben, war mir fremd. Von wem konnte die Sendung sein? Ah, richtig, Herr Tesmer wollte mir seine Dichtungen senden und hat Wort gehalten! Für heute war ich zu müde zu der Lektüre, ich blätterte darum nur flüchtig in einem der kleinen, eleganten Goldschnittbändchen, welche schon von vornherein jedes Frauenauge bestechen, als mir ein weißes Blatt daraus entgegenflatterte. Es enthielt ein Gedicht: »An Hanna!« und lautete:
»Drei Bänder hatt' ich ums Herz mir gelegt,
Drei Binder von Stahl und von Erze,
Sie sollten fesseln, was drinnen sich regt,
Sie sollten ersticken mein Herze.
Du wolltest ja sein treu Lieben nicht,
Sein Hoffen, sein Jubeln, sein Klagen –
Und warst doch seines Lebens Licht! –
Da mußt' ich in Fesseln es schlagen.
Nun sah ich Dich wieder, Du reichst mir die Hand,
Mein Glück und mein Alles, mein Leben!
Da fiel mir vom Herzen das eine Band,
Es wich wohl dem Pochen und Beben.
Du schaust mir ins Auge, mich grüßte Dein Mund
Ade nun, ihr Jahre voll Schmerzen!
Nun bin ich erwacht, nun werd' ich gesund,
Herunter du zweites vom Herzen!
Und als wir gewandert durch Flur und durch Land,
Im süßen, im seligen Plaudern,
Fiel leis' auch zur Erde das dritte Band,
Was sollt' es länger noch zaudern?
Nun klopft mir das Herz, befreit in der Brust,
Es jubelt und dehnt sich weit!
Geliebte! o laß ihm nun seine Lust!
Geliebte! o thu' ihm kein Leid!«
Ich saß lange und starrte auf das Blatt, so lange, bis meine Thränen darauf fielen. Ich grübelte dem großen, ewig ungelösten Rätsel nach: warum nimmt das Menschenherz nicht dankbar die Liebe an, welche ihm geboten wird? Warum geht es trotzig seinen eigenen Weg und klammert sich hartnäckig da an, wo es sicher ist, zurückgewiesen zu werden?
»Heinz!« murmelte ich leise. »O, nur einmal aus Deinem Munde: »Hans, mein lieber, kleiner Hans!« – Müßte das nicht alle Dichterworte der Welt überwiegen?«
* * *
Am 19. März. Die letztverflossenen Tage waren trübe und regnerisch, erst heute war für die Baronin an einen Aufenthalt im Freien zu denken. Es war wieder ein herrlicher Tag, sonnenbeleuchtet und lenzesduftend, ein Tag, ordentlich herausfordernd zum Schwärmen und Fröhlichsein. Und doch wollte mir beides nicht gelingen; schweigsam und bedrückt wanderte ich neben meiner Herrin unserem gewöhnlichen Ziele, dem Tiergarten zu.
Ich hatte Tesmer seit unserem Begegnen nicht wieder gesehen und – ich wünschte es auch nicht. Wenn ich auch nicht mehr das schwärmerische, weltfremde Kind war, welches von seiner Schönheit, vereint mit dem Dichternimbus welcher ihn umgab, geblendet, von seinem Wesen verwirrt und geängstigt wurde; wenn mich die letzten Jahre auch in mir selbst gefestigt und geklärt hatten, gefeit durch den Talisman einer starken, treuen Liebe, so hatte mich doch dieses Wiedersehen mehr erschüttert, als meiner Ruhe gut war. Egon Tesmer war zu sehr mit dem Leid meines Lebens verknüpft; immer wieder drängte sich mir, seit ich ihn so unerwartet wiedergesehen, der Gedanke auf: Wäre er nie in mein Dasein getreten, wie anders, wie glücklich hätte sich dasselbe gestaltet!
Und doch, als er mir nun so plötzlich bei einer Biegung des Weges an der Seite seiner Mutter entgegentrat, als seine schönen Augen so glücklich aufleuchtend die meinen suchten, da konnte ich nicht kalt seinen Gruß erwidern. Er liebt mich; soll ich ihm deswegen zürnen?
Während seine Mutter an Baronesse Alices Seite trat, sagte sie, mich mit freundlichem Interesse anschauend: »Wir sind hier unweit vom Luisendenkmal, Fräulein von Berken, welches Sie als Fremde vielleicht noch nicht kennen. Wenn Sie den Wunsch haben, es zu sehen und meinen Sohn als Cicerone annehmen wollen, Baronesse von Scholten ist indessen gut bei mir aufgehoben.«
Letztere wandte den Kopf rückwärts, Hollmann tauchte in geringer Entfernung zwischen den Bäumen auf, ein gleichgiltiges Kopfnicken; ich war entlassen.
»Verdient Mama nicht einen Extrahandkuß für die Klugheit, mit welcher sie meine Wünsche errät?« lachte Tesmer heiter, als wir einen Seitenpfad eingeschlagen hatten. »Aber es geschah wohl mehr aus eigener Eingebung! Sie haben es ihr nämlich vollständig angethan, Fräulein Hanna. Mama ist so sehr empfänglich für Schönheit und Grazie, und scharfsichtig genug, um nicht sofort herauszufühlen, daß Sie nicht eben goldene Tage bei Ihrer Baronin haben. Wenn Sie wüßten, wieviel Sie uns beschäftigen! Die arme Mama hat es sich in den Kopf gesetzt, Sie bald einmal ohne diese ernsten Augen, heiter und jugendfroh zu sehen, und brütet über allerhand dunklen Anschlägen, Sie Fräulein von Scholten für ein paar Stunden zu entführen. In den nächsten Tagen giebt man im Schauspielhause den Sommernachtstraum mit vorzüglicher Besetzung; würden Sie meiner Mutter die große Freude machen, sie dazu zu begleiten?«
Ich glaube, ich sah sehr glücklich aus, doch sagte ich zögernd: »Ihre Frau Mutter ist sehr, sehr gütig; doch ich weiß wirklich nicht, ob –+«
Mein Begleiter unterbrach mich lächelnd. »Das übrige überlassen Sie nur getrost Mama, sie ist die geborene Diplomatin! Aber nun müssen Sie sich umsehen, Fräulein Hanna, wir sind am Ziel, und der Platz ist des Ansehens wert.«
Ja, es war ein entzückender Anblick, der sich mir bot. Stumm stand ich da und schaute andachtsvoll empor zu dem herrlichen Marmorbilde, zu Preußens edler Königin Luise. Unweit von dem Denkmal, auf einer kleinen Bank, nahm ich auf meines Begleiters Aufforderung Platz, von hier aus konnte man den wunderbar schönen Anblick bequem genießen. Wir hatten ein paar Minuten stumm dagesessen, als Tesmer das Schweigen unterbrach.
»Wissen Sie auch, Fräulein Hanna, daß ich anfange neidisch zu werden? Dem toten Marmor gönnen Sie nun schon so lange Ihre Blicke, mich hat Ihr Auge heute kaum gestreift.« Er rückte näher und sprach halblaut weiter: »Und doch habe ich diese Stunde so herbeigesehnt, war so ungeduldig, als ein Tag nach dem andern verging, ohne daß er Sonnenschein, meinen Sonnenschein, brachte, wissen Sie denn auch, daß sechs Tage, sechs endlos lange Tage vergangen sind seit unserm Wiedersehen? Mein Gott, wie ein Schuljunge, der seiner Angebeteten Fensterparade macht, bin ich täglich an Ihrem Hause vorübergegangen. Lachen Sie mich aus, Fräulein Hanna, aber ich konnte wirklich nicht anders, schon die Hoffnung, Ihren Schatten zu erspähen, war verlockend.«
Ich lachte nicht, ich hatte ja kaum vernommen, was die weiche, klangvolle Stimme neben mir sprach; ohne es zu wollen, fast unbewußt, kam es von meinen Lippen: »Wie geht es Heinz? Was hören Sie von ihm?«
Er fuhr zusammen, die weißen Zähne gruben sich in die blaß gewordene Lippe. »Von Heinz Wagner?« fragte er unsicher. »Aber, mein Gott, gnädiges Fräulein, wissen Sie denn nicht, daß wir nicht im guten, fast als Feinde schieden? Heinz hatte sich an dem Abend vor meiner Abreise – Sie erinnern sich, daß ein Tanzfest bei Meinhardts stattfand – so eigentümlich zu mir benommen, daß es allgemein auffiel, und ich mich sehr beherrschen mußte, um es nicht dort schon zum offenen Bruch kommen zu lassen. Er hatte ein wenig viel, eigentlich gegen seine Gewohnheit, dem Gotte des Weines geopfert, und ich hatte sein Benehmen darauf zurückführen zu müssen geglaubt. Aber tags darauf merkte ich meinen Irrtum. Ich war eben von Ihnen gekommen, als ich ihm auf dem Rückweg begegnete. Ich blieb unbefangen stehen und reichte ihm die Hand. Aber er nahm sie nicht, er murmelte undeutlich: »Du kommst von –?« »Von Berkenhagen!« ergänzte ich harmlos und wollte seinen Arm ergreifen. Aber er entriß ihn mir, daß ich taumelte. Und ich? – nun ich that eben, was einem in solchem Falle zu thun übrig bleibt, ich packte noch in derselben Stunde meinen Koffer und reiste ab. Später freilich habe ich mir die Sache erst richtig erklären können. Der gute Heinz stand damals dicht vor der Ausführung seiner Wandergelüste, die schon lange in ihm gährten, er war hochgradig erregt und dadurch nicht eben – mein Gott, wie soll, ich es nennen? – rücksichtsvoller geworden. Solcher Seelenzustand nimmt ja den meisten Menschen die Maske vom Gesicht und zeigt sie in ihrer wahren Gestalt. Auch Sie hören nicht von ihm, gnädiges Fräulein?«
Ich fühlte seinen leidenschaftlich forschenden Blick und sagte errötend:
»Nur durch die Tagesblätter, die hin und wieder eine Notiz über die Expedition, welcher er angehört, bringen.«
Tesmer lachte etwas gezwungen. »Ja, er ist auf dem besten Wege, ein berühmter Mann zu werden, da darf man es ihm kaum verargen, wenn er frühere Beziehungen, Freundschaften älteren und neueren Datums zu den Toten wirft. Die Naturen sind eben verschieden, nicht allen ist es gegeben, ihren Empfindungen Treue zu halten. Und sie sind vielleicht besser daran,« sprach er halblaut wie zu sich selbst, »wie derjenige, der »Getreu bis in den Tod!« zum Wahlspruch seines Lebens erkoren hat!«
Er schwieg ein paar Augenblicke, dann fragte er plötzlich: »Fräulein Hanna, haben Sie meine Verse gelesen und zürnen Sie mir ihretwegen nicht?«
Ich sah ruhig zu ihm auf. »Nein, Herr Tesmer! Nur erscheint mir Ihr Gedicht inbezug auf mich übertrieben, durchaus nicht der Situation angemessen. Doch Sie sind eben Dichter,« fügte ich lächelnd hinzu, »man dürfte in solchen Dingen nicht mit Ihnen rechten.«
Er zuckte zusammen, ein Schatten flog über sein schönes Gesicht.
»Das war ein böses Wort, Fräulein Hanna,« sagte er, »und ich will nicht hoffen, daß es aus Ihrem Herzen kam. Ich müßte sonst annehmen, daß Sie die Dichter, die Verkünder alles Hehren und Schönen, gering achten, ihnen kein wahres Empfinden zutrauen. Muß ich meiner Muse denn wirklich erst sagen, daß solch armer Poet einen Schatz von Liebe im Herzen trägt, größer und reicher, als der kühl berechnende Alltagsmensch auch nur zu ahnen vermag, daß er –?«
Er stockte und schaute starr geradeaus; ich folgte der Richtung seines Blicks. In geringer Entfernung, auf einer Bank uns gegenüber, hatte sich soeben ein junges Mädchen niedergelassen, oder war im Begriff, es zu thun. Es mußte sie etwas erschreckt haben, ihre Hand hielt krampfhaft die Lehne der Bank umschlossen, ein paar große, dunkle Augen starrten aus einem blassen, von aschblonden, kurzen Löckchen umgebenen Gesicht zu uns herüber.
»Eine Musiklehrerin oder -Schülerin,« meinte mein Begleiter leichthin, auf die Mappe am Arme des jungen Mädchens deutend, »Berlin ist von beiden überschwemmt. Ich glaube übrigens eine Bekannte zu sehen,« fügte er hinzu, während er sich erhob.
Wir gingen einen andern Weg zurück. Bei einer Biegung desselben wandte ich noch einmal den Kopf, das Mädchen stand noch immer regungslos und starrte uns nach. Mein Begleiter war etwas zerstreut, er fand den vorhin abgerissenen Faden nicht wieder und plauderte von allerlei, von Theater und Konzerten, von seinem Frondienst, wie er seine juristische Thätigkeit bezeichnete, von seinem Roman, den er in den nächsten Tagen zu beenden gedachte.
Auf dem Heimwege, welchen ich bald darauf mit der Baronesse antrat, eröffnete mir letztere, daß sie nichts dagegen habe, wenn ich übermorgen mit der Präsidentin Tesmer das Schauspielhaus besuche. »Einmal könne man eine Ausnahme machen, Prinzeß – die Protektorin des Vereins für verwahrloste Kinder – würde auch der Vorstellung beiwohnen. Übrigens zeichne Prinzeß die Präsidentin, die nebenbei aus guter, alter Familie sei, stets aus.« – Daher also die liebenswürdige Herablassung der hochmütigen Aristokratin zu der bürgerlichen Dame, welche mir schon längst zu denken gab! – »Und,« fuhr sie fort, »die Prinzeß habe auch ihren Sohn, als er auf der letzten Vereinssoiree einen selbstverfaßten Prolog vorgetragen und mehrere Lieder gesungen, durch eine längere Unterredung geehrt.«
* * *
Zwei Tage später. Soeben komme ich aus dem Theater und bin noch so erfüllt von dem Zauber der letzten Stunden, daß ich kein Bedürfnis nach Ruhe verspüre. Die herrliche Vorstellung, die vielen festlich gekleideten Menschen, die Lichtfülle, die Musik, alles hat mich nach dem grauen Einerlei der letzten Monate förmlich berauscht, mir bewiesen, daß noch junges, heißes Blut in meinen Adern wallt. Ich zweifelte manchmal daran, ich kam mir alt und stumpf vor und sah darum mein eigenes Spiegelbild, als es mir im Foyer des Schauspielhauses entgegenlächelte, erstaunt an. War denn das fröhlich blickende, junge Mädchen im weißen Kaschmirkleide mit den roten Rosen im Haar und an der Brust – Frau Präsident Tesmer hatte sie mir überreicht, als sie mich selbst zum Theater abholte, und nicht eher geruht, als bis ich mich damit geschmückt – wirklich die ernste, blasse Gesellschafterin der Baronin Scholten? Egon Tesmer war glücklich, mich so froh zu sehen; auch seine Mutter überhäufte mich mit ihrer liebenswürdigen Güte. Sie hat gleich ihrem Sohne ein geradezu bezauberndes Wesen, unwillkürlich fragt man sich, ob es wohl Herzen giebt, die diesen beiden Menschen nicht zufliegen.
Egon Tesmer gefiel mir heute übrigens besser als sonst, er hatte eine herzliche, fast brüderliche Art, die mich wohlthuend berührte und es mir möglich machte, heiter und unbefangen mit ihm zu plaudern. Und wunderschön sah er aus in dem feinen Salonanzug mit der Blume im Knopfloch; ich glaube, er ist in den letzten zwei Jahren noch schöner, jedenfalls stattlicher geworden. Blicke aus strahlenden Frauenaugen folgten ihm auch unablässig, ich hätte eigentlich stolz auf solchen Kavalier sein können. Auch das junge Mädchen, welches mir vor einigen Tagen am Luisendenkmal aufgefallen, sah ich wieder. Ich erkannte sie sofort an dem aschblonden, gelockten Haar und den dunklen, brennenden Augen, welche oft im Laufe des Abends die meinen – oder Egon Tesmers? – suchten. Als letzterer mich später an den Wagen, der meiner zur Heimfahrt harrte, begleitete, sah ich sie noch einmal. Sie streifte fast Tesmer, der eben abschiednehmend meine Hand an seine Lippen führte, so dicht glitt sie an ihm vorüber.
* * *
Am 25. März. Welch ein Tag liegt hinter mir und wie gewaltig zittert die Erregung, welche er mir gebracht, in meinem Herzen nach. Vielleicht klingt sie eher aus, vielleicht beruhigen sich meine fiebernden Pulse früher, wenn ich versuche, das Erlebte zu schildern.
Wie immer in den letzten Wochen, hatte Baronesse Scholten den heutigen Nachmittag ihren Vereinspflichten geweiht. Sie war bereits gegangen, und ich saß, glücklich über die seltene Muße, auf dem grünumrankten Balkon, welcher an den Salon stößt, meine geliebten naturwissenschaftlichen Bücher neben mir. Ich hatte mich bereits in eine fesselnd geschriebene Abhandlung über Orchideen vertieft, als Hollmann seinen grauen Kopf durch die Thür steckte, »Herr Referendar Tesmer wünschen Fräulein von Berken zu sprechen.« Ich fuhr erschreckt auf und trat in den Salon, »haben Sie denn nicht gesagt, daß die Baronin abwesend?« – »Gewiß, Fräulein, aber der Herr –+« Er schwieg und zog sich respektvoll zurück, Egon Tesmer stand bereits vor mir. Seine Augen leuchteten, sein Gesicht war gerötet, ein stolzes, glückliches Lächeln spielte um seinen Mund.
Er warf seinen Hut auf den nächsten Stuhl und ergriff meine beiden Hände. »Fräulein Hanna, Ihnen muß ich mein Glück zuerst verkünden! Mein Roman ist von einer der größten Buchhandlungen Leipzigs unter glänzenden Bedingungen angenommen; L. – er nannte einen berühmten Schriftstellernamen – hat mein Werk geprüft und mir in ehrendster Weise darüber geschrieben! O, Hanna, die erste Staffel auf der Leiter des Ruhmes ist erklommen!«
Er sah herrlich aus, wie er mit stolz erhobenem Haupte vor mir stand; der menschgewordene Apollo, mußte ich denken.
Ich reichte ihm, hingerissen, die Hand. »Glück auf zum Flug nach oben!« sprach ich herzlich.
Er ließ meine Hand nicht los, er kniete nieder und legte seine heiße Stirn darauf. »Wie wohl mir Ihre Finger thun, wie weich sie sind und wie kühl! Nein, entziehen Sie mir Ihre Hand nicht, gönnen Sie sie mir noch ein paar Minuten, diese kleine Gunst darf mir meine Muse nun nicht mehr verweigern. Missen Sie, Fräulein Hanna, wie ich mein Buch genannt? »Getreu bis in den Tod!« und seine Heldin ist ein junges, schlankes Mädchen mit dunkler Flechtenkrone über dem wunderschönen, blassen Gesicht, mit Märchenaugen, die jeder, der nur einmal in sie hineingeschaut, nie mehr vergessen kann.«
Seine flammenden Blicke suchten die meinen, tief senkten sie sich hinein. »Nie!« flüsterte er wie traumverloren.
Ich senkte meine Lider, aber mein Ohr konnte ich nicht verschließen, es trank jeden Laut, jedes der heiß geflüsterten Worte, welche so weich und melodisch zu ihm emporklangen.
»Sieh, Hanna, ich habe Dich geliebt seit ich Dich zuerst gesehen, und habe seitdem nicht aufgehört, Dich zu lieben. Du hast mich verschmäht, mich von Dir gestoßen; aber ich komme wieder, ich neige demütig mein Haupt vor Dir, wie der Pilger vor dem wunderthätigen Gnadenbilde, und flehe: »Sei mir hold, habe Mitleid mit mir, bei Dir allein ist mein Glück!« Er ergriff meine Hand und drückte sie auf sein pochendes Herz.
»Nun klopft mir das Herz so laut in der Brust,
Es jubelt und dehnt sich weit.
Geliebte, o laß ihm nun seine Lust!
Geliebte, o thu' im kein Leid!«
Wie im Traume lauschte ich und wie im Traume zogen allerhand Bilder vor meine Seele. Ich war nicht mehr allein, ich war nicht länger ein verwehtes Blatt, jedem Sturmwind preisgegeben; ein Herz, ein großes, reiches Herz bot sich mir an, daß ich meinen Kopf daran bette, ausruhe von allem Weh meines jungen Lebens. Und wie schön er war, wie gottbegnadet!
Ich hob die gesenkten Lider, ich wollte sprechen, ihm sagen – da – tönte es nicht leise, ganz leise an mein Ohr: – oder war es in meinem Herzen? – »Hanna, mein lieber, kleiner Hans!?«
Ich sah verwirrt auf, ich entzog dem noch immer Knieenden meine Hand.
»Stehen Sie auf, Herr Tesmer, ich bitte!«
Er gehorchte, führte mich zu einem Sessel und nahm mir gegenüber Platz. Ich merkte, wie gewaltsam er sich beherrschte, wie seine Stimme bebte, als er nun sprach: »Und haben Sie keine Antwort für mich, vermag mein glühendes Empfinden keinen Widerhall in Ihrem Herzen zu wecken?« Die Leidenschaft riß ihn wieder fort, er sprang auf und beugte sich über meinen Stuhl. »Und doch bin ich Ihnen nicht gleichgiltig, Hanna, ich sah, wie Sie kämpften! Sprich, was entfernt Dich immer wieder von mir?«
Der Rausch war verflogen, ich hatte meine Besonnenheit wieder.
»Was mich von Ihnen entfernt, Herr Tesmer?« fragte ich ruhig. »Nun denn: Die Überzeugung und die Vernunft, die beide zu Rate gezogen sein wollen, wenn es sich auch um eine Sache handelt, in der das Herz allein die Entscheidung treffen sollte. Ich besitze kein nennenswertes Vermögen –+«
Er sah mich verständnislos an. »Aber, ich begreife wirklich nicht –+«
Ich lächelte unwillkürlich. »Also der richtige Poet, dem ein Herz und eine Hütte genügen!«
Er war dunkelrot geworden, ein verlegener Ausdruck trat in sein Gesicht. »Ah, so ist's gemeint!« sagte er und sicher. »Aber, Hanna, liebe, süße Hanna, hat das wirklich nicht noch Zeit, kommt das nicht erst in zweiter Linie? Wie lange soll ich denn noch schmachten, bis Ihre süßen Lippen mir mein Glück verkünden? Muß ich es mir denn wirklich erst rauben?« Er schlang seinen Arm um mich und näherte sein flammendes Gesicht dem meinen.
Ich riß mich los und richtete mich stolz auf.
»Sie vergessen sich, Herr Referendar Tesmer! Unsere Unterredung hat überdies für Ort und Verhältnisse schon zu lange gedauert; ich denke, wir beenden dieselbe.«
Er sah mir flehend ins Gesicht. »Sie sind mir nicht böse, Hanna? Geben Sie mir wenigstens den Trost mit auf den Weg!«
Ich schüttelte den Kopf und legte meine Hand in die seine, welche er mir bittend entgegen hielt.
»Und Sie vergessen nicht,« sagte er, »daß ich Sie liebe und auf ein Gnadenwort von Ihnen warte? Wann wird es mir endlich aus Ihrem Munde werden, wann darf ich Sie wieder sehen?«
»Nicht eher, Herr Tesmer, bis ich Klarheit in mein Inneres gebracht; lassen Sie mir ein paar Tage Zeit dazu!«
Er neigte sich und zog meine Finger an seine glühenden Lippen. »Stolzes, unnahbares, herrliches Mädchen, warum quälst Du Dich und mich?« murmelte er, und dann war er verschwunden.
Wie schwer wurden mir heute die gewohnten Pflichten, wie sehnte ich mich, allein zu sein! Nun habe ich mir die Erregung von der Seele geschrieben, ich bin müde und will versuchen zu ruhen.
* * *
Einen Tag später. Ein ganzer, freier Nachmittag liegt vor mir. Baronesse Scholten hat Besuch; Gräfin Hochkirch ließ sich anmelden, und ich durfte mich zurückziehen. Ich ging in mein Zimmer und nahm ein Buch zur Hand, ich wollte lesen; aber meine Gedanken ließen sich nicht fesseln, immer wieder kehrten sie von dem toten Buchstaben auf einen Punkt zurück, auf denselben, der mich die ganze, lange Nacht beschäftigte: auf Egon Tesmer und die Worte, welche er gestern zu mir gesprochen.
Er wollte eine Antwort auf seine Frage haben – warum zögerte ich, sie ihm zu geben? Die ganze Nacht hatte ich darüber gegrübelt. Ich hatte mir ausgemalt, welch herrliches Los meiner harrte, wie ich nicht nur des Dichters Weib, nein, auch die Genossin seines Strebens, seine geistige Gefährtin sein, würde, wie er die reichen Schätze seiner Seele, seines Geistes über mich ausschütten, mich mit hinauf zu seiner Höhe tragen würde. mit welcher Begeisterung, mit welcher Andacht habe ich stets von den Frauen gehört, die so begnadigt gewesen, von eines Dichters Hand geweiht und geadelt zu werden für alle Zeiten.– Und doch, warum wollte das dumpfe Weh in meinem Herzen nicht schwinden, warum wimmerte die leise Stimme tief drinnen und wollte sich nicht zufrieden geben, nicht schweigen, so oft die Vernunft sie auch zur Ruhe wies? Wie deutlich ich sie hörte!
»Thu's nicht, thu's nicht! Ruhm, Ehre, alle Geistesschätze der Welt machen nicht glücklich, wenn das Herz leer dabei ausgeht! Und das Deine wird leer ausgehen und sich zu Tode sehnen nach ihm, dem einzigen, den es liebt!« – »Und der es nicht wiederliebt,« flüsterte die andere Stimme, »der spöttisch lachen würde, könnte er einen Blick in Dein Herz thun! Vielleicht ist er schon wieder auf heimatlichem Boden, vielleicht hat er in der Fremde neue Herzensbande geknüpft und führt bald ein geliebtes Weib an den Herd, welchen er sich nun gründet. Wie werden ihn die Eltern empfangen, wie werden sie die segnen, welche ihr Sohn erwählt. Dir wird er kaum mehr nachfragen, wenn er Dich auch einst zu lieben gemeint; das ist lange vorbei, starb ja schon in der Stunde, als er von Dir ging. Wie hätte er sonst volle zwei Jahre vergehen lassen ohne das kleinste Zeichen seines Gedenkens; wie durfte er schweigen, als der Tod Dir Dein Liebstes nahm? Und nun sieh den andern! Wie herrlich er ist an Leib und Seele, wie glühend, wie tief und treu sein Empfinden, wie ideal und harmonisch sein ganzes Wesen. Sollte es Dir so schwer fallen, ihn zu lieben? Hast Du denn nicht sagen hören, daß Liebe wunderthätig, allmächtig ist, daß sie Liebe erwecken kann, und scheint Dir das so unmöglich einem Egon Tesmer gegenüber?«
Ich setzte mich an den Schreibtisch, ich wollte schreiben, ihm sagen, daß ich ihm gehören will; aber ich warf die Feder fort, sie brannte wie Feuer in meiner Hand. Zuerst ein wenig hinaus ins Freie, vielleicht kommt doch Klarheit und Frieden in mein Herz.
* * *
Drei Monate später. Heute, ungefähr acht Wochen nach unserer Hochzeit, ist es der erste Abend, den ich allein, ohne meinen Gatten, zubringe. Er folgte so ungern der dringenden Aufforderung seiner Freunde, noch in der Thür drehte er sich wieder um und rief mir zu: »Also spätestens um 11 Uhr bin ich wieder bei Dir! Wirst Du mich erwarten, Schatz?«
Ich nickte lachend. Mein gestrenger Herr und Gebieter hatte in der letzten Stunde mindestens ein Dutzend Mal die wichtige Frage an mich gerichtet: »Und was wird mein Herzensweibchen indessen thun? Auch ein wenig an mich denken?«
Ich nahm eine sehr strenge, hoheitsvolle Miene an. »Was diese Herren der Schöpfung doch für eine Meinung von sich haben! Als wenn man nichts anderes wüßte, als sich mit ihnen zu beschäftigen! Wenn Sie es denn durchaus wissen wollen, mein sehr arroganter Herr und Gemahl, dieser Abend ist ernsten Pflichten geweiht: ich werde meine Memoiren schreiben.«
»Ah, Du willst das Tagebuch Deiner Mädchenzeit vollenden? Line sehr löbliche Vornahme, Schätzchen, um so löblicher, da sie Dich zwingt, Dich auch ein wenig mir zu widmen. Oder wäre Dir ein anderer Schluß Deiner Erinnerungen lieber?« fragte er neckend.
Ich flog auf ihn zu und schlang meine Arme fest um seinen Hals. »Mein Geliebter, mein einziger Mann, wie glücklich bin ich!«
Er beugte sich zu mir herab und küßte die Thränen aus meinen Augen. »Mein Weib!« sprach er innig.
Nun ist er fort, und ich sitze in meinem behaglichen, mit den Bildern meiner Eltern und allem, was die Liebe ersinnen kann, reich geschmückten Zimmer an meinem Schreibtisch. Noch einmal taucht jetzt vor meinem Auge auf, ihr Stunden voll Not und Herzensqual, nur einmal noch, und dann flieht wie Schatten vor der Sonne; in meinem Leben hat die Erinnerung an euch keinen Raum mehr.
Ich hatte geschildert, wie ich an Tesmer schreiben wollte, aber die Feder hinwarf, um im Freien Sammlung zu gewinnen.
Ich war aufgeregt und mit meinen Gedanken beschäftigt, bemerkte aber doch, als ich nun die Treppe herabschritt, eine schlanke Mädchengestalt, welche soeben durch den Hausflur huschte, dem Ausgange zu. War das nicht dieselbe graziöse Erscheinung, welche mir schon öfter ausgefallen? Erst gestern hatte ich sie vom Balkon aus erblickt. Sie war langsam am Hause vorüber gegangen, die großen, dunklen Augen, welche einen so auffallenden Kontrast zu den hellen Haaren bilden, glitten wie suchend an den Fenstern empor. Wahrscheinlich hatte sie Bekannte hier im Hause. Als ich an der Portierloge vorüberkam, öffnete sich dieselbe und die mir wohlbekannte Frau des Pförtners trat heraus.
»Ach, gnädiges Fräulein, das trifft sich ja gut,« sagte sie, »eben wollte ich zu Ihnen.« Sie legte ein sorgfältig versiegeltes, in weißes Papier geschlagenes Päckchen in meine Hand. »Das hat man mir soeben abgegeben für Sie! Fräulein müssen die junge Dame noch gesehen haben, vor einer Minute war sie hier. Sie sah ganz verstört aus und wußte nicht einmal Ihren Namen. Ich wollte darum auch das Paket gar nicht nehmen; aber sie hatte es mir in die Hand gedrückt, einen Thaler darauf gelegt und husch, husch war sie verschwunden.«
Die Frau lief nach der Thür und bog sich weit hinaus.
»Natürlich keine Spur mehr,« rief sie, »dachte es mir wohl!«
Was war das? Es durchrieselte mich wie die Ahnung eines Unheils, das weiße Päckchen in meiner Hand brannte wie Feuer darin.
»Aber vielleicht ist es gar nicht für mich, Frau Müller? Sie sagten, die Dame kannte nicht einmal meinen Namen!«
»Aber sie beschrieb Sie mir ganz genau, gnädiges Fräulein,« sagte die Frau eifrig, »Ihr Aussehen, Ihre Kleidung; da ist jeder Irrtum ausgeschlossen.«
Ich ging, mit dem kleinen Paket in der Hand, wieder zurück, die Treppe hinauf; in meinem Zimmer öffnete ich es.
Es enthielt Briefe, viele auf einander geschichtete Briefe, welche ein rotes Seidenband zusammen hielt, obenauf lag ein loses Blatt. Ich entfaltete es, lange irrten meine Augen darauf umher, ehe zu meinem Verständnis drang, was sie erblickten. Dort stand:
»Mein Fräulein!
Ich kenne Sie nicht, nicht Ihren Namen und Stand, Ihr Herz und Ihren Charakter, ich weiß nur, Sie sind ein Weib, und darum komme ich zu Ihnen, umklammere Ihre Knie und flehe: Nehmen Sie ihn mir nicht, er ist der Inhalt meines Lebens, mein Einzigstes, das Licht meiner Augen, die Hoffnung langer Jahre. Sie wissen vielleicht nicht, was es heißt: Jahr für Jahr zu warten, geduldig, klaglos zu warten, alles aufzugeben, alles zu opfern, um dann, nahe am Ziel, erbarmungslos zurückgeschleudert zu werden. Aber wenn Sie alles wissen und ihn dann von sich weisen, wird er wieder zu mir zurückkehren, mich wieder seine Muse, sein Ideal, seinen Herzensliebling nennen, und ich werde denken, ich habe nur so schwer geträumt, und ihm alles verzeihen. Ich weiß ja, er kann nicht treu sein; er wäre auch Ihnen nicht treu geblieben, trotzdem Sie jung und schön sind, trotzdem er es Ihnen vielleicht zugeschworen, wie er es so oft zu meinen Füßen that; aber er hat recht, einen Dichter muß man nicht mit dem gewöhnlichen Maßstab messen, und wenn er erst einsieht, daß niemand auf Erden ihn mehr liebt, als seine Toni, wird er endlich immer bei ihr bleiben.
Ein anderes ist ja nicht denkbar, nicht möglich; schon den Gedanken daran kann mein armes, gemartertes Hirn nicht fassen. Es müßte ja wahnsinnig werden, wenn sein letzter Brief wahr würde, wenn er das Band, welches fünf lange Jahre geknüpft, zerreißt.
Aber nicht wahr, er wird es nicht thun, und Sie werden seine Briefe lesen und Mitleid mit mir haben und ihn mir wiedergeben?
Wie würde Sie dafür jede Stunde ihres Lebens segnen
Ihre unglückliche
Toni Langendorf.«
Endlich hatte ich gefaßt, was ich las. Aber es war ja nicht möglich, es konnte ja nicht von Egon Tesmer die Rede sein!
»Mein Gott, laß mich ihn nicht verachten müssen!« murmelte ich, als ich einen der zusammengebundenen Briefe hervorzog.
Er zeigte die auffallend zierliche Handschrift, welche ich bereits kannte, das Datum war fast um vier Jahre zurück; »Bis in den Tod getreu, Dein Egon,« stand darunter. Wie glühend er das Mädchen geliebt hatte, wie er ihr dankte, daß sie seinetwegen den jungen Arzt, der sich um sie beworben, zurückgewiesen, wie er seine blonde Muse, sein Herzenskleinod, dafür auf Händen durchs Leben tragen wolle.
Und nun der letzte, erst am verflossenen Tage geschriebene Brief.
»Liebe Toni!
Warum zwingst Du mir so hartnäckig – fast täglich bringt mir die Post ein Lamento von Dir – die Feder in die Hand? Muß ich es Dir denn wirklich noch einmal, schwarz auf weiß, wiederholen, was ich Dir längst schon klar gemacht zu haben glaubte, daß unsere Wege sich trennen müssen? Du weißt, ich habe Dich lieb, Toni, und werde nie aufhören, mit herzlichem Interesse Deiner zu denken; aber leider kann man von solchen Gefühlen allein in unserer prosaischen Welt nicht leben. Wenn mir mein Talent neben dem Lorbeer hoffentlich auch immer goldene, klingende Früchte bringen wird, so fürchte ich doch, es reicht für die verfeinerten Bedürfnisse meines nun einmal ästhetisch beanlagten Wesens nicht aus, und ich werde nie einen eigenen Herd gründen können ohne die Hilfe einer reichen Frau. Wozu ist denn auch der Reichtum, wenn er dem Genie nicht die Pfade ebnen will?
Vorläufig freilich, und das sei nicht nur zur Beruhigung Deiner erregten Nerven gesagt, liebe Toni, denke ich noch nicht daran, mir Fesseln, und seien dieselben auch noch so stark vergoldet, anlegen zu lassen – ich halte auch nichts für einen Dichter hinderlicher, wie eine frühe Ehe, der Genius sollte eigentlich immer ungebunden sein – Du brauchst also nicht so in Harnisch zu geraten, wenn Du mich zufällig neben einem schönen Mädchengesicht erblickst. Du weist ja, die Schönheit ist die Flamme, an der ich armer Schmetterling mir schon so oft die Flügel verbrannte.
Und nun Gott befohlen, liebe Toni! Glaube, daß ich nie aufhören werde, mich zu nennen
Deinen stets ergebenen Freund
Egon Tesmer.«
Ich hatte genug gelesen, ich schleuderte das rotumwundene Päckchen von mir, als ob eine Schlange daraus hervor nach meinem Herzen züngele.
Also das war Tesmers wahres Gesicht, das seine ideale Gesinnung, sein heißes, poetisches Lieben, seine felsenfeste Treue? Lüge, nichts als Lüge, elende, erbärmliche Lüge! O, der Schmach, der Schande!
Aber mitten durch den Ekel, den Widerwillen, der mich erfaßt hatte, rang es sich empor wie das Bewußtsein eines großen Glückes. So übermächtig war es, daß es mich auf die Knie zwang, mir wie einem Kinde die Hände zum Gebet faltete, und mich zusammenhanglose Worte schluchzen, stammeln ließ.
»Gerettet, gerettet! O mein Gott, ich danke Dir! Nun darf ich nicht aufhören, ihn zu lieben; ich kann mir selbst getreu bleiben!«
Und dann sprang ich auf, riß Heinz' Bild hervor, drückte es an mein Herz, meine Lippen, und lachte, weinte, sprach zu ihm, als wenn er vor mir stände. Nun mochte es kommen wie es wollte, ich hatte mich wiedergefunden! Wie köstlich ich in dieser Nacht schlief, und wie froh ich erwachte!
Im Laufe des nächsten Vormittags brachte mir die Post ein Billet von Tesmer. Er könne nicht leben in dieser peinvollen Erwartung, mit der Sehnsucht nach mir im Herzen. Für den Nachmittag wären die Vorstandsdamen des Vereins für verwahrloste Kinder zur Prinzeß befohlen, wie er von seiner Mutter wüßte, ich wäre also für ein paar Stunden frei und könne ihm das Geschick seines Lebens verkünden. Er beschwor mich, ihn zu empfangen, das Glück seines Lebens hänge von der stunde ab u.s.w.
Mit verächtlichem Lächeln hatte ich den glühenden Erguß gelesen; gut, mochte er kommen, je eher die widerwärtige Angelegenheit erledigt, desto besser. Und doch, als zur bestimmten Stunde die Glocke erklang, ein leichter, elastischer Schritt auf dem Korridor hörbar wurde, flog mein Körper wie im Fieber, und jeder Blutstropfen wich aus meinem Gesicht. Es war doch furchtbar schwer, einem Menschen die Maske vom Antlitz reißen zu müssen.
Da stand er schon vor mir, und meine Blässe, meine Bewegung zu seinen Gunsten deutend, beugte er sein Knie vor mir.
»Hier bin ich, Hanna, Geliebte meines Herzens, nun sprich es aus, sage mir endlich, daß Du mein sein willst!«
Ich konnte nichts erwidern, meine Kehle war wie zugeschnürt, und er fuhr in den innigen, weichen Tönen fort: »Muß ich es Dir noch einmal sagen, daß Du mein Alles bist, daß ich nie für ein Wesen so empfunden, so tief, so glühend, so verzehrend empfunden habe, wie für Dich?«
Endlich konnte ich sprechen, und wie Stahl so hart klang meine Stimme.
»Auch nicht für Toni Langendorf, Herr Tesmer?«
Er starrte mich an, als erblicke er plötzlich das Haupt der Medusa, dann sprang er auf und brach in ein lautes Lachen aus.
Wie häßlich war das schöne Gesicht auf einmal geworden!
»Hat sie sich wirklich an Sie gedrängt, die überspannte Närrin,« rief er, die blassen, verzerrten Lippen noch immer zum Lächeln zwingend, »und Ihnen ihren meisterhaft erfundenen Roman vorgetragen? Ein jahrelanger Herzensbund, Riesenopfer auf ihrer, Treubruch auf meiner Seite, nicht wahr, so lautet die rührende Geschichte?«
Er zwang sich zur Ruhe, zum gleichmütigen Sprechen.
»Und doch ist die nackte Thatsache so einfach, so durchaus prosaisch. Ich kam als junger Student – meine Mutter lebte damals noch am Rhein – nach Berlin und nahm durch einen Zufall, den ich seitdem oft genug beklagte, meine Wohnung bei einer Frau Dr. Langendorf, der Witwe eines Philologen. Die Tochter, Toni, welche sich damals auf der Hochschule für Musik und Gesang ausbildete, war jung wie ich von den gleichen Interessen beseelt, was Wunder, wenn wir viel beisammen waren – schon der Kultus der heiligen Cäcilia führte uns täglich zusammen – und Gefallen an einander fanden? Von meiner Seite blieb letzteres in den Grenzen der Freundschaft – einer idealen Freundschaft, wie ich sie trotz mancher entgegengesetzten Behauptung sehr wohl für möglich halte zwischen Mann und Weib; daß Toni anders fühlte, mir bald unverschleiert ihr heißes Empfinden zeigte, wer kann mich dafür verantwortlich machen? Nur der einen Schwäche habe ich mich anzuklagen: ich hätte sofort ein Band zerreißen müssen, welches zur lästigen Fessel zu werden drohte, nicht immer wieder, verleitet von Mitleid und falscher Gutmütigkeit, es zu einem Ausgleich kommen lassen sollen.
Schelten Sie mich unmännlich, Hanna, schwach und ohne Konsequenz; aber ich konnte nicht anders, Frauenthränen gegenüber bekenne ich mich als Feigling. Und dann hoffte ich auch, meine ruhige Freundschaft würde mit der Zeit ihre Wirkung nicht verfehlen; ein Feuer, welchem keine Nahrung zugeführt wird, muß ja mit der Zeit verlöschen. Aber ich hatte mich verrechnet, nicht geahnt, wessen ein leidenschaftliches Frauenherz fähig ist, dem der vornehmste Führer und Berater, der Stolz, fehlt. Wie eine Klette hat sich das Mädchen an mich gehängt, immer wieder Mittel und Wege gefunden, sich mir zu nähern, mir nachzuspüren, Sie selbst haben den Beweis davon. Wie mag sie in ihrem Ungestüm meine Muse erschreckt haben, was werde ich thun können, um das gut zu machen?«
Zu Anfang seiner Rede hatte Tesmer stockend, in abgebrochenen Sätzen gesprochen; doch je länger er sprach, desto fließender, geläufiger war sie geworden. Er bezwang sie, mußte ich denken, wie der Reiter ein störrisches Pferd, welches ihm nicht gehorchen will, aber gar bald den Herrn und Meister fühlt und sich nun willig tummeln läßt, wohin er es wünscht. Bei der letzten Frage hatte Tesmers Stimme sogar ihren alten, elegischen Klang wieder erlangt. Aber auf mich verfehlte er seine Wirkung gänzlich, im Gegenteil, er reizte mich förmlich zum Zorn.
»Genug und übergenug,« rief ich schneidend, die Hand, welche Tesmer soeben ergreifen wollte, mit stolzer Bewegung an mich ziehend. »Toni Langendorf hat sich nicht an mich gedrängt, sie that besseres, sie sandte mir Ihre Briefe!«
Tesmer taumelte, als hätte er einen Schlag erhalten, er wurde totenblaß, seine verzerrten Lippen stießen undeutliche Worte hervor; aber ich empfand kein Mitleid für ihn, ich sprach unbeirrt weiter:
»Schon als Kind vermochte mir nichts solchen Abscheu einzuflößen, mich mit solchem Widerwillen zu erfüllen, wie die Lüge, und dieses Gefühl ist mir geblieben, hat sich sogar in mir verstärkt; ich mag nicht dieselbe Luft mit einem Lügner atmen. Ich bitte, Herr Tesmer, verlassen Sie mich!«
Ich wandte mich um, das Zimmer zu verlassen, aber er stürzte mir nach und ergriff wie ein Rasender mein Kleid.
»Mach mich nicht wahnsinnig, Mädchen,« murmelte er heiser, »alles kann ich ertragen, Deine Verachtung nicht! Ja, ich habe gesündigt, ich taumelte von Blume zu Blume, unbekümmert, ob mein Hauch sie welken macht; aber Dich – beim ewigen Himmel! – Dich habe ich geliebt, Dir wäre ich treu geblieben!«
Ich wandte den Kopf, er sollte die Verachtung nicht sehen, welche meine Züge verrieten, und er fuhr fort:
»Nicht wahr, Du nimmst sie zurück, die schrecklichen Worte, und verzeihst mir?«
Ich richte mich stolz auf. »Verzeihung? Fordern Sie dieselbe von derjenigen, die Sie verraten, der Sie die Jugend gestohlen! Ich habe Ihnen nichts zu verzeihen, mein Herz konnten Sie nicht verletzen; denn Sie hatten keinen Teil daran!«
»Keinen Teil daran!« wiederholte er langsam, während der Schatten eines ungläubigen Lächelns um seine Lippen irrte.
Ich bemerkte es, wie Zündstoff fiel es in meine erregte Seele.
»Keinen, so wahr mir Gott helfe!« sprach ich feierlich. »Schon einmal vor Jahren, als Sie mein unschuldiges Kinderherz mit Ihren Liebesworten zu verwirren suchten, gab ich es Ihnen zur Antwort, und nun wiederhole ich es: Ich liebe Sie nicht, habe Sie nie geliebt! Sie konnten mich blenden, bestechen, die Natur gab Ihnen die Gaben dazu; aber über mein Herz hatten Sie keine Macht! Es war beschützt durch geheimen Talisman, gefeit durch mächtigen Zauber, durch eine große, starke Liebe, welche ihm nichts zu entreißen vermag.«
Tesmer hatte mit abgewandtem Haupte dagestanden, nun richtete er sich auf und griff nach seinem Hute. »Sie sprechen von Heinz Wagner! Da bleibt mir also nichts, als Ihnen zu kondolieren!«
Er schritt der Thür zu, blieb aber wie festgebannt vor derselben stehen. Inmitten der dunklen Sammetportiere stand eine hohe Männergestalt, zwei braune, flammende Augen schleuderten ihm Blitze entgegen.
Ein paar Minuten hindurch war Totenstille im Zimmer, dann trat die fremde Gestalt über die Schwelle und wies gebieterisch nach der Thür.
»Hinaus, Feigling, der es wagt, ein wehrloses Mädchen zu verletzen!«
»Das wirst Du mir mit Deinem Blute büßen!« knirschte es zurück.
Tesmer erhielt keine Antwort, mit geballten Fäusten, mit wilden Blicken schaute er um sich, es schien, als wolle er sich in der nächsten Minute auf jemand werfen, dann stürzte er zur Thür, die Portiere fiel lautlos hinter ihm zusammen.
Ich hatte in den letzten Minuten dagestanden wie ein Bild von Stein, ich konnte mich nicht rühren, weder vor noch rückwärts. Mir war's, als sänke ich langsam in ein tiefes Wasser, und die Wellen umrauschten mich, immer höher und höher, bis sie über mir zusammenschlugen. Aber ich hatte nicht Furcht, und es benahm mir auch nicht den Atem, ich schloß nur die Augen und lehnte mit seligem Lächeln mein Haupt an den Halt, der sich ihm bot. Wie es dort drinnen pochte, wie laut und stark, und wie süß es war, dem Ton zu lauschen! Ach, immer so träumen können, nie erwachen!
Aber klang es da nicht leise, mitten in dem Wasserrauschen, an mein Ohr: »Hanna, mein lieber, kleiner Hans!?«
Nun mußte ich doch meine Augen öffnen, und geradeswegs schauten sie hinein in zwei andere, die sich mit unbeschreiblichem Ausdruck über sie neigten. »Meine Hanna, meine einzig Geliebte, hab' ich Dich erschreckt?«
»Heinz!« schrie ich auf. »Heinz, es ist kein Traum? Du bist es, wirklich Du?« Und dann schlang ich beide Arme um seinen Hals, fest, ganz fest, und flüsterte unter Lachen und Weinen: »Bist Du nun endlich gekommen, Heinz, und willst Du nun nie wieder von mir gehen? Ach, Heinz, lieber Heinz, seit Du von mir gingst, ist auch meine Sonne versunken, kalt und finster erschien mir die Welt!« Ich schmiegte mich dicht an ihn. »Aber hier ist es warm und licht, o, so warm, und nun bleibe ich immer hier, selbst wenn Du mich gehen heißt.«
Er wollte sprechen, aber seine Lippen zuckten nur, kein Wort kam darüber.
Ich löste meine Arme von seinem Nacken und streichelte mit beiden Händen sein Gesicht. »Wie braun Du geworden bist, Heinz, und wie bärtig! Ich hätte Furcht vor Dir, wenn nicht Deine Augen wären, die alten, treuen, geliebten Augen!«
Und ich beugte mich vor und küßte die Tropfen fort, die darin schimmerten.
Er schlang seine Arme um mich und hielt mich fest an seinem Herzen.
»Und verzeihst Du mir ganz und voll, was ich an Dir gesündigt, Hanna? Wirst Du es vergessen können, daß ich von Dir ging, so von Dir ging, daß ich mein Herzblatt, mein heißgeliebtes Mädchen ohne Schutz jedem Wettersturm preisgab? Ach, Hanna, ich wußte ja nicht, was ich that; ich war ja wie wahnsinnig vor Eifersucht und wütendem Schmerz! Else Meinhard hatte an dem Abend leichtes Spiel mit mir. Was wußte ich in meiner schlichten Geradheit von Frauentrug und -List; ich glaubte ihr, und als ich dann vollends im Feuer der bengalischen Flamme Tesmer zu Deinen Füßen sah, seine Lippen auf Deinen Händen, da war es ganz um meine Besinnung geschehen. Was ich an dem Abend, in der Nacht durchgekämpft habe, weiß Gott allein; aber als der Morgen kam, war ich doch ruhiger geworden, ich beschloß, zu Dir zu gehen, Dich wählen zu lassen zwischen ihm und mir.«
»Und ich, Heinz,« schluchzte ich leise, »harrte indessen Deiner, aber nicht wie sonst, wie Dein kleiner Kamerad, der Dir jubelnd entgegenlief, sondern« – ich wurde dunkelrot und verbarg mein Gesicht einen Augenblick an seiner Schulter – »wie die Braut, welche den Geliebten erwartet! In der Stunde, als mir der Fremde seine Liebe gestand, war es wie blendendes Licht in meine Kinderseele gefallen, wußte ich, daß ich Dich liebe!«
Er beugte sich zärtlich über mich und sah mir tief in die Augen.
»Meine Hanna, mein Lieb, hätte ich alles geahnt, was wäre Dir und mir erspart worden! Als ich an jenem Tage den Waldweg hinunter nach Berkenhagen ging, schreckte mich eine helle, jodelnde Stimme aus meinem trüben Sinnen. Ich kannte das Lied, welches dort durch den stillen Wald tönte, ich hatte es oft von Tesmer gehört. Der Gesang kam immer näher, ich konnte bereits die Worte des Liedes verstehen.
»Ich weiß ein Mädchen hübsch und fein – Hüte Dich!
Es kann wohl falsch und freundlich sein – Hüte Dich!
Nimm Dich in Acht, sie narret Dich,
Vertrau' ihr nicht, sie narret Dich!«
Nun stand der Sänger vor mir, ein übermütiges Lächeln auf dem schönen Gesicht, eine frischgebrochene Rose zwischen den Lippen. Ich wollte an ihm stumm vorübergehen, Egon Tesmer war seit gestern mein Freund nicht mehr. Aber er trat mir unbefangen, als wäre nichts geschehen, in den weg.
»Nun, ausgeschlafen, Heinz? War gestern famos in Schönau, was? Die schwarzäugige, kleine Hexe versteht es, Feste zu arrangieren!«
Ich gab keine Antwort. »Du kommst von –+«
»Von Berkenhagen, wie Du siehst! Fräulein Hanna befahl mich gestern zu dieser Stunde, und ich gehorchte natürlich, trotz Mittagshitze und Müdigkeit. Du weißt: mon coeur à la dame, besonders wenn diese Dame so bezaubernd ist, wie diese kleine Berken. Sie ist wirklich reizend. Und dazu diese schwärmerische Empfänglichkeit für alles Ideale!«
Er lächelte und führte die rote Rose, mit welcher seine weißen Finger spielten, an die Lippen. Ich sah genauer hin, war das nicht eine Blüte von dem Moosrosenstrauch, den ich gepflanzt, dessen erste Rose mir mein kleines Mädchen stets höchst feierlich ins Knopfloch zu nesteln pflegte?
»Wo hast Du die Rose her?« rang es sich von meinen Lippen.
»Sonderbare Frage, Heinz! Wo anders als von Berkenhagen? Es war die einzig erschlossene am Strauch!«
Ich biß die Zähne auf einander, um ihn nicht in das schöne, lächelnde Gesicht zu schlagen; aber ich glaube, ich stieß nach ihm, dann ging ich, die Hölle im Herzen, weiter. Ich einfältiger Geselle, ich hatte noch zweifeln können an Else Meinhards Worten, an den poetischen Zusammenkünften, von welchen sie gezischelt; nun hörte ich es ja selbst aus dem Munde des glatten Burschen, dem ich trotz seiner bestechenden Außenseite nie recht hatte trauen können. Und er, er durfte die Hand ausstrecken nach dem Abgott meines Herzens, nach meinem Kleinod, meiner süßen Knospe, welche mir am Herzen erblühen sollte!«
»Wie ich Dir gegenüber stand, mein armes Lieb, wie ich von Dir ging, weißt Du! Ich hatte mein Herz verhärtet, ich hatte blind sein wollen gegen Deine Lieblichkeit, und doch konnte ich Dein Bild, wie ich es zuletzt geschaut, nicht vergessen. Auf dem Schiff, welches mich über das Weltmeer trug, in die öden Steppen, welche mein Fuß durchschritt, in den dichten Urwäldern, welche ich mühsam durchdrang, immer standest Du vor mir in Deinem hellen Gewand, die Händchen auf der Brust gefaltet, die großen Augen wie ein verwundetes Reh auf mich gerichtet. Warum hatte sie mich so angeschaut, wollte sie mich um Verzeihung bitten, daß sie mich nicht lieben kann, daß dem andern ihr Herz gehört? »Ich will aber kein Mitleid!« schrie ich dann wohl bei dem Gedanken auf. »Ich bin kein liebesüchtiges Mägdelein, ich bin ein Mann und will allein mit meinem Herzen fertig werden!«
»Und dann stürzte ich mich in die Arbeit, untersuchte, forschte, verglich und prüfte; ich fühlte, daß ich nur so, bei strenger Pflichterfüllung, am Herzen der Natur gesunden konnte. Und sie dankte mir meine treue Hingabe. Manches, was sie andern Blicken streng verhüllte, woran andere Jahre mühevollen Forschens gewandt, ohne zum erwünschten Ziele zu gelangen, entschleierte sie mir willig; ich machte mir bald einen Namen in meiner Wissenschaft. – So waren zwei Jahre in angestrengter Thätigkeit vergangen. Die Eltern, die Mutter besonders, hatten oft nach mir verlangt, in der Heimat winkte mir ein ehrenvolles Amt, ich durfte nicht länger zögern. Aber hatte sich meine Hoffnung erfüllt, kehrte ich gesundet heim? Ach, meine amerikanischen Freunde, welche mir so zahlreich das Geleit gaben, die Mitglieder unserer Expedition, welche mit mir vereint die Heimfahrt machten, sie alle hätten wohl verwundert die Achseln gezuckt, wenn sie mich stundenlang in stiller Nacht auf dem Verdeck des Schiffes hätten wandern sehen, wenn sie gehört, was so oft meine Lippen flüsterten. Willst Du wissen, meine Hanna, was es war, was der prosaische Heinz, der zähe, nüchterne Forscher so oft leise vor sich hinsprach?«
Er beugte sich herab zu mir und flüsterte dicht an meinem Ohr: »Ach, ich kann nicht vergessen! Gern stürb' ich, sie zu seh'n, sie zu seh'n noch einmal! – Weißt Du noch, Hanna?«
Ich nickte unter Thränen. Heinz hatte mir so oft aus meiner geliebten Fritjofssage vorgelesen, und gerade diese Worte hatten mich immer besonders gerührt.
»Die ungewohnte Muße auf dem Schiffe,« sprach Heinz weiter, »hatte die mühsam bezwungene Sehnsucht nach Dir zur hellen Flamme angefacht; als ich in Hamburg deutschen Boden betrat, gab es kein Halten mehr, ich mußte zu Dir. Ich dachte nicht daran, daß ich im Zorn von Dir gegangen, daß Dein Herz einem andern gehört, nur fort, immer fort! Ich reiste ohne Aufenthalt, ich ging direkt vom Schiff zur Eisenbahn, endlich war ich am Ziel, durchschritt ich das Thor von Berkenhagen. Soll ich Dir schildern, was ich empfand, als mir statt Deines Vaters, meines väterlichen, gütigen Freundes, dessen Schweigen in meinen Augen der beste Beweis für die Wahrheit des Geschehenen war, ein anderer entgegentrat, als ich hörte, daß sein Kind Zuflucht bei Fremden gefunden?«
Ich unterbrach ihn. »Du wußtest nicht, Heinz, daß mein Vater gestorben, Deine Eltern konnten Dir das vorenthalten?«
Er umschlang mich fester. »Sie hatten es mir geschrieben, Hanna, doch ist der Brief, wie mancher bei meinen Irrfahrten, verloren gegangen. Andere Nachrichten erhielt ich nicht über Dich; meine Mutter, die einzige, welche ahnte, was mich in die Fremde getrieben, erwähnte Deiner nie, sie mochte wohl nicht an der Wunde in der Brust ihres Sohnes rühren.«

Ich schmiegte meine Wange in seine Hand, wie ich schon als Kind so gern gethan, und fragte leise: »Was wird Deine Mutter nun aber zur Wendung der Dinge sagen? Wird sie mich noch ein wenig lieb haben können?«
Er drückte einen Kuß auf meine Augen, die wahrscheinlich etwas ängstlich zu ihm aufgeschlagen waren: »Thörichter kleiner Hans,« lachte er, »wie Du nur so fragen kannst? Die arme Mutter sitzt ja augenblicklich gar nicht weit von uns in ihrem Hotel und wartet sehnsüchtig, ob ihre Hoffnung sich erfüllt, und ich Dich ihr als Töchterlein zuführe. Und das soll bald geschehen. Ich gehe nämlich ohne mein Bräutchen nicht von der Stelle,« schloß er mit großer Entschiedenheit.
»Deine Mutter hier? Aber, Heinz, erkläre mir –+«
»Das ist bald geschehen, mein Liebling! In Berkenhagen hatte man mir Deine Adresse gegeben, und ich fuhr hierher, wo die Eltern mich, wie vorher bestimmt, am heutigen Tage erwarten wollten. Mutter war allein erschienen – Vater ist durch ein leichtes Unwohlsein ans Haus gefesselt – und so beichtete ich ihr sofort, fast in der ersten Wiedersehensfreude. Ich sprach ihr von meiner unbezwingbaren Sehnsucht nach Dir und der leisen Hoffnung, welche sich in meinem Herzen zu regen beginne, von der Stimme in meinem Innern, welche mir, seitdem ich wieder auf heimatlichem Boden, immer lauter zuraune, daß ich mich doch vielleicht getäuscht, daß mein Ungestüm einzig und allein all das Leid herausbeschworen. Und dann stürmte ich zu Dir. Mir brannte der Boden unter den Füßen; seit ich mich mit Dir an einem Ort wußte, überflutete mich noch einmal die ganze Sehnsucht der letzten beiden Jahre. Ich bat den Diener, mich Dir nicht zu melden, ganz unvorbereitet wollte ich zu Dir treten, mein Schicksal aus Deinen Augen lesen.
Wie mir wurde, Hanna, als ich Tesmers Stimme hörte, Dich allein mit ihm im Zimmer fand – o, eine Hölle lag in der Minute! – und wie das Licht der Wahrheit, der Erkenntnis, welches mich dann grell überflutete, mir fast den Atem benahm. O, mein herrliches, edles Lieb,« sprach Heinz und beugte sein Knie vor mir, »bin ich denn Deiner wert, wirst Du es denn wirklich vergessen können, was ich Dir Übles that, was Dir mein Starrsinn zugefügt? Zwei Jahre, zwei lange Glücksjahre habe ich uns geraubt!«
Ich hob ihn auf und schmiegte mich fest an seine Brust.
»Dafür giebst Du mir jetzt Dein ganzes Leben, nicht wahr, mein Heinz, mein Einziggeliebter?« flüsterte ich unter Thränen.
»Ja, nur Dir soll es geweiht sein! Ich will Dich glücklich machen, so wahr mir Gott helfe!« sprach er feierlich, ehe er seine Lippen im heißen Kusse auf die meinen preßte.
Ein Laut unwilligen Erstaunens ließ mich den Kopf heben, Baronesse von Scholten war ins Zimmer getreten, wie ein dunkler Schatten glitt sie in ihrer langen Hofschleppe näher.
»Ich begreife wirklich nicht, mein Fräulein!«
Ich wand mich erglühend aus Heinz' Armen, der ohne jede Spur von Verlegenheit der Nähertretenden entgegensah. Er hielt meine Hand fest und sagte, sich artig verbeugend: » Dr. Heinz Wagner, meine Gnädigste, welcher nach zweijähriger Abwesenheit heute seine Braut begrüßt.«
Sie sah ihn starr an, in ihre harten Züge kam ein höfliches Lächeln. »Herr Dr. Wagner, der berühmte Reisende, von welchem soeben bei Prinzeß soviel die Rede war?«
Heinz lächelte. »Schon möglich, gnädigste Baronesse, daß man mich gemeint, ich bin zu morgen zu einer Audienz bei Hofe befohlen. Man interessiert sich allerhöchsten Ortes sehr für meine Wissenschaft.«
Unwillkürlich sah ich die Baronin an. Ihr Lächeln war etwas säuerlich geworden. Aber meinen Heinz focht das nicht an, unbeirrt sprach er weiter: »Sie werden es begreiflich finden, meine Gnädigste, daß ich nach so langer Trennung meine Braut nicht eine Minute länger entbehren kann, meine Mutter erwartet uns bereits sehnsüchtig. Sie gestatten daher –+« die Angeredete fiel ihm ins Wort:
»Aber das ist ja selbstverständlich, Herr Doktor! Ihre Braut ist vollständig frei in ihren Entschlüssen.« Und dann, einer plötzlichen Regung folgend, trat sie auf mich zu und berührte meine Stirn mit ihren blassen Lippen. »Ich wünsche Ihnen Glück, mein liebes Kind, und glaube, daß Sie es verdienen!«
Ich küßte ihr gerührt die Hand. Dieser Augenblick versöhnte mich vollständig mit ihren Schroffheiten, unter denen ich so oft gelitten.
Meine Habseligkeiten waren unter Hollmanns geübten Händen bald gepackt, meine Adresse hinzugefügt und dann, nach reichem Geldgeschenk für die Dienerschaft, verließ ich glückstrahlend am Arme des Geliebten das Haus, welches ich vor vier Monaten mit bange klopfendem Herzen betreten. In stummer Seligkeit, unsere Blicke in einander senkend, nur hin und wieder ein leises Wort flüsternd, gingen wir die Straße hinunter und bogen in die nächste ein, wo Heinz' Mutter seiner, unserer harrte.
Vor Glück weinend sank ich ihr in die Arme, und schluchzend hielt sie mich umfangen. Wir hatten uns so viel zu erzählen, dazwischen so viel zu herzen und zu küssen, daß mein Heinz endlich erklärte, nun wäre es nachgerade genug, und er fände, daß er als Hauptperson entschieden zu kurz dabei käme.
Wie herzlich Mama Wagner da lachen konnte und wie gleich darauf wieder ihre Thränen flossen, als Heinz und ich vor ihr hinknieten und sie um ihren Segen baten.
Und wie wir dann an dem sinkenden Abend nach Potsdam fuhren, und wie Onkel Wagner die Augen aufriß, daß die Hanna nun doch noch fein »Schwiegerdöchting«, wie er immer prophezeit, würde, und wie ihm dann plötzlich etwas ins Auge gekommen war, an dem er noch immer ärgerlich rieb, als bereits Frau Trude mit ihrem ritterlichen Gemahl erschienen war und so jubelnd mit mir durchs Zimmer tanzte, daß ihr Töchterchen sie ganz verdutzt ansah.
O, ihr schönen, herrlichen Tage und Wochen, die nun folgten, die Erinnerung an euch wird stets wie Sonnenschein mein Herz erleuchten! Nur einmal fiel ein leichter Schatten hinein.
Heinz war einer wissenschaftlichen Angelegenheit wegen nach Berlin gereist und erschien mit dem Arm in der Binde wieder. Er hatte sich durch einen Zufall eine kleine Verletzung zugezogen, wie er den Seinen sagte. Aber ich wußte es besser, er hatte Tesmer mit der Waffe in der Hand gegenüber gestanden. –
Es war – wie heiß ich dem Himmel dafür dankte! – nur eine leichte Fleischwunde, sie heilte bald; Tesmer war unverletzt geblieben.
»Ich hatte eigentlich vor, sein glattes Gesicht ein wenig zu zeichnen,« gestand Heinz, »aber ich schonte ihn, ich bin zu glücklich dazu, und dann ist er bereits durch den Augenblick, in welchem ich ihm so plötzlich gegenüber stand, genügend bestraft. Vielleicht hat dieser den Buben endlich gelehrt, daß ein Frauenherz kein Spielzeug ist, mit welchem man nach Willkür verfährt!«
Ich küßte die Falte, welche sich zwischen seinen Augenbrauen gebildet hatte, er lächelte mich glücklich an.
Und dann, nach einigen Wochen, im lachendsten Sonnenschein, kam mein Hochzeitstag. Meine Stiefmutter war gekommen mit den jubelnden Zwillingen, ebenso Rose, Hilde mit ihren Gatten, einige Freunde von Heinz; es war eine kleine, aber strahlend heitere Hochzeitsgesellschaft.
Mein Heinz ließ den ganzen Tag kein Auge von mir.
»Du siehst mit Deinem verklärten Antlitz unter dem grünen Kranze und in dem weißen Kleide wie ein Engel aus!« sagte er, sich entschuldigend. »Ich muß doch aufpassen, daß Du Deine Schwingen, welche wahrscheinlich unter dem langen Schleier verborgen sind, nicht plötzlich entfaltest und mir davon fliegst in den Himmel!«
»Mein Himmel ist auf Erden, bei Dir!« flüsterte ich zurück.
Unsere Hochzeitsreise führte uns zunächst nach Berkenhagen auf die teuren Gräber dort, dann weiter an den Rhein.
Als wir nach drei Wochen, erfüllt von Glück und den herrlichen Eindrücken, die wir empfangen, heimkehrten, führte der Privatdozent Dr. Heinz Wagner, dem bereits in greifbarer Nähe die Professur winkt, sein glückliches Weib in sein Heim nach Berlin.
Anfangs war mir der Gedanke peinlich, mit Tesmer an einem Ort zu leben; doch ist die Reichshauptstadt ja so groß, daß man sich in derselben nur durch einen Zufall begegnet, und geschieht es, dann wendet Herr Egon Tesmer, der bereits viel genannte Schriftsteller, hochmütig den schönen Kopf und mustert ein gegenüberliegendes Gebäude.
Einmal in der Dämmerstunde, als ich mit meinem geliebten Manne Hand in Hand auf einer Bank des Tiergartens saß, schien es mir, als erblicke ich ihn, und an seinem Arme Toni Langendorf, welcher ich damals sofort ihre Briefe zurückgesandt. Sollte sie ihm wirklich verziehen haben, ihn lieben können, ohne ihn zu achten?
Unwillkürlich schaue ich dankend nach oben. Wie gesegnet bin ich doch, wie reich; der Mann meines Herzens ist der beste, edelste Mensch der Erde!
Horch, es klingelt! Ich werfe die Feder hin und fliege ihm entgegen. »Willkommen, willkommen, mein Heinz, mein Glück, Du meine erste, meine einzige Liebe!«
Schluß.
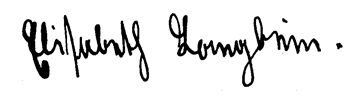
Gedruckt bei Friedrich Schirmer in Berlin S. W. 13.