
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Georg stieg langsam die Stufen der breiten Marmortreppe hinab und knöpfte bedächtig, während er ziemlich gedankenlos vor sich hinblickte, die Messingknöpfe seines großen Mantels zu. Der Portier des Klubs, der die Mütze zog und gehorsamst guten Morgen wünschte, öffnete dienstfertig die Tür. Georg trat auf die Straße, ohne den Gruß zu erwidern. Der Kutscher der Nachtdroschke, die vor dem Klub hielt, wollte vom Bock steigen, aber Georg rief ihm zu:
»Ich fahre nicht, ich gehe.«
Er schlug den Kragen seines Mantels in die Höhe; denn der Morgen war ziemlich frisch, und da oben war es sehr heiß gewesen. Gleichmäßigen Schrittes und in straffer Haltung ging er durch die menschenleere Straße in der Richtung auf den Tiergarten zu. Das scharrende, klappernde und rasselnde Geräusch, das durch das Aufschlagen der metallenen Säbelscheide auf das Pflaster verursacht wurde, und das er sonst niemals bemerkt hatte, schien ihn nervös zu machen. Er hakte den Säbel ein und ging weiter.
Es war um die dritte Morgenstunde im Frühsommer, – noch nicht Tag und nicht mehr Nacht. Ein bläulich grauer Duft lag über dem Tiergarten, in dem die vollbelaubten Bäume merkwürdig dunkelfarbig, fast schwarz erschienen. Auffallend schnell wurde es heller und lichter; die fahle, kalte, graue Beleuchtung verkündete den nahen Sonnenaufgang. Im Osten nahm der Horizont alsbald eine rosig wärmere Färbung an, und nach wenigen Augenblicken erglänzten die ersten Sonnenstrahlen an der Goldgestalt der Viktoria auf der Siegessäule.
Georg blieb unwillkürlich einen Augenblick stehen und blickte auf zu dem blendenden Gefunkel. Er atmete tief; dann setzte er in längeren Schritten seinen einsamen Weg fort. Er ging die breite Siegesallee entlang. Zwei Nachtigallen wetteiferten in klagendem und verlangendem Liebesschmettern; er achtete nicht darauf, obwohl er hart an dem Baum vorüberging, auf dem die eine der Nachtigallen saß und sehnsüchtig flötete. Er achtete auch nicht auf die Straßenreiniger, die schweigsam ihre Arbeit verrichteten, und ging durch den dichten Staub, den sie durch ihr Fegen aufwirbelten, ohne davon belästigt zu werden.
Das kalte Licht der Morgendämmerung war nun der freundlichen Helligkeit des anbrechenden Tages gewichen. Hoch an dem lichtblauen Himmel war noch die fast volle Scheibe des Mondes sichtbar, die, nun zwecklos, matt schimmerte. Am Ende der Siegesallee, auf der sich außer den Straßenfegern keine menschliche Seele hatte blicken lassen, stand eine schmutzige Nachtdroschke. Der Kutscher, dessen Gestalt unter dem dicken, klumpigen Mantel ganz verschwunden und kaum erkennbar war, war auf dem Bock eingeschlafen; das alte magere Pferd stand breitbeinig da und ließ den Kopf tief hängen. Das Petroleumlämpchen brannte noch hinter der roten Glasscheibe, die die Nummer trug. Georg blieb wiederum stehen. Einen Augenblick kämpfte er mit sich, ob er den weiten Weg bis zu seiner Wohnung in der Baruther Straße, die in der nächsten Nähe seiner Kaserne liegt, zu Fuß zurücklegen solle oder nicht. Aber plötzlich empfand er eine große Müdigkeit; er rüttelte den Kutscher aus dem Schlaf, der schwerfällig aus seiner dicken Umhüllung hervorkroch, und gab seine Adresse an.
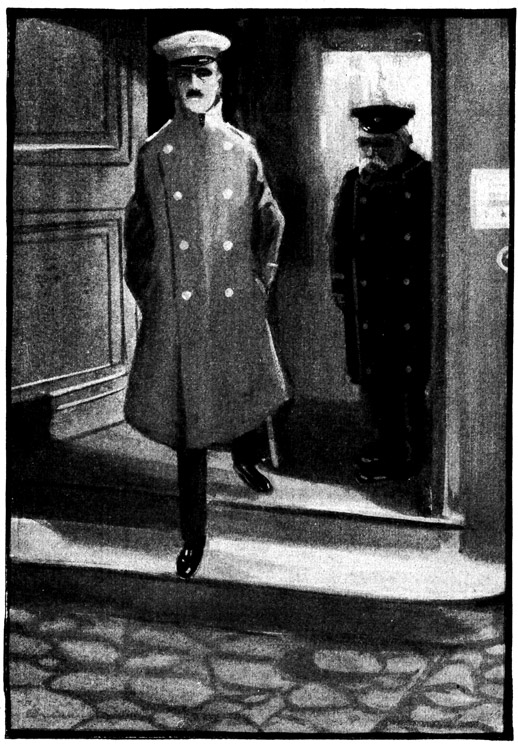
Bis jetzt war er wie betäubt gewesen. Er hatte, ohne an etwas Bestimmtes denken zu können, nur ein starkes Unbehagen empfunden. Während der langsamen Fahrt über holpriges Pflaster aber war er allmählich etwas zur Besinnung gekommen. Den Säbel hatte er zwischen die Beine gestemmt, und mit vorgebeugtem Oberkörper stützte er das Kinn auf die rechte Hand, die den Knauf des Griffes umschloß, mit der linken strich er seinen langen hellblonden Schnurrbart. Unablässig blickte er auf einen Punkt des schmutzigen, abgeschabten, tiefkirschroten Plüschkissens des Rücksitzes, atmete einige Male tief auf und sagte dann vor sich hin:
»Das wäre das – aber was nun?«
Ja, was nun?
Er legte sich die Frage vor, er wiederholte sie sich, aber er fand keine Antwort darauf, und als die Droschke vor seiner Haustür hielt, als er ausgestiegen war, das Haus aufgeschlossen hatte und die beiden ziemlich steilen Treppen, die zu seiner Wohnung führten, hinaufgestiegen war, war er gerade so klug wie zuvor. Unschlüssig blieb er einen Augenblick vor der Tür, die zu seiner Wohnung führte, stehen und betrachtete mit einer vollkommen unberechtigten Aufmerksamkeit das Messingschild, das seinen Namen trug: Georg von Lützen. Während er das Schild anhauchte und gedankenlos mit seinem waschledernen Handschuh polierte, überlegte er sich, ob es nicht das Gescheiteste sei, wenn er sogleich seinen Freund, den Justizrat Felix Quintus aufsuchte, um mit dem zu beraten, was er nun zu tun habe. Er sah nach der Uhr. Es war wenige Minuten vor Vier. Nun öffnete er mit dem Drücker die Tür zu seiner Wohnung und trat ein; denn er hatte sich gesagt, daß es eine Torheit sei, um diese Stunde den Justizrat aufzusuchen, den er entweder noch nicht zu Hause finden würde oder im festen Schlafe.
Und schließlich, welchen Rat konnte ihm der Justizrat geben? Er allein kannte ja die Wahrheit seiner Lage, und er war alt genug, um zu wissen, was er nun noch zu tun habe.
Als er in sein Zimmer trat, sprang eine große Ulmer Dogge vom Sofa herab und ihm entgegen. Der Hund fühlte sich offenbar schuldbewußt und schien auf eine gelinde Züchtigung vorbereitet zu sein. Mit eingeklemmtem Schwanze drängle er sich hart an die Beine seines Herrn und sah mit seinen schönen treuen Augen bittend und fragend zu Georg auf. Als Georg ihm freundlich über den Kopf strich und ihn klopfte, sprang das große Tier in gewaltigen Sätzen rührende Laute der Freude ausstoßend und den Schweif in mächtigen Schwingungen schlagend, um ihn herum.
»Ruhig, Pluto!« rief Georg dem Hunde zu.
In dem mittelgroßen, behaglich eingerichteten Zimmer sah es ordentlich aus. Der Bursche hatte auf die Ecke des Tisches, auf dem eine Schale für Visitenkarten und andere Kleinigkeiten standen, wie jeden Abend so auch gestern Leuchter und Zündhölzer gestellt. Daneben lag nun ein großer verschlossener Umschlag. Georg erkannte an der Aufschrift die Hand seines Oheims und Vorgesetzten, des Kommandeurs der Kavallerie-Brigade. Der Brief mußte in einer späten Abendstunde überbracht worden sein, denn erst nach neun Uhr hatte Georg seine Wohnung verlassen. Georg trat an das Fenster, öffnete den Brief und las ihn. Der Inhalt, der ihn noch vor wenigen Stunden hochbeglückt haben würde, stimmte ihn jetzt sehr wehmütig. Der General teilte seinem Neffen in herzlicher Weise mit, daß er zum großen Generalstabe versetzt sei. Seit Jahren hatte Georg nichts anderes gewünscht und sich lebhaft darum bemüht; nun war es für ihn wertlos geworden, wertlos wie alles andere. Er legte den Brief sehr behutsam auf den Tisch. Darauf knöpfte er seinen hellblauen Überrock auf, lockerte die Halsbinde, setzte sich auf den Lehnsessel und streckte die Beine von sich. Pluto lagerte sich neben ihm. Unausgesetzt blickte Georg vor sich auf einen bestimmten Punkt im Teppich, immer wieder tauchte die Frage auf: »Was nun?« Dazwischen schoben sich allerhand Erinnerungen an einige verhängnisvolle Unglücksfälle der Nacht. Dreimal hintereinander mit der Sieben und zweimal mit Schlag Acht verlieren – es war noch nicht dagewesen! Aber das half nun nichts, es war geschehen, er war vollkommen ruiniert, und was nun?
Wohl eine halbe Stunde mochte er so grübelnd dagesessen haben, als er sich plötzlich mit einem schweren Entschluß erhob und an den kleinen Schreibtisch trat, der in der Nähe des Fensters stand. Er nahm ein Blatt Papier und einen Bleistift, holte sein kleines Portefeuille aus der Hüftentasche und mit tiefernstem Gesicht schrieb er, nachdem er darin geblättert hatte, einige Zahlen auf. Es half alles nichts – er hatte eine Spielschuld von 180 000 Mark sofort zu regulieren! Gerade so viel mochte sein Vermögen noch betragen.
Schon vor zwei Jahren hatte er sehr erhebliche Verluste erlitten; damals hatte er seinem Onkel das Versprechen gegeben, nicht mehr zu spielen; er hatte sich auch über ein Jahr tapfer gehalten, aber allmählich war er wieder schwach geworden und hatte seit einigen Monaten wieder mit wechselndem Glück und in kleineren Beträgen gespielt. Diese Nacht war für ihn verhängnisvoll geworden. Er suchte sich zwar mit allerlei Kleinigkeiten einigermaßen zu entschuldigen, aber wenn er auch alle möglichen guten Gründe für sich anführte, an der Tatsache, daß in den letzten sechs Stunden eine vollständige Veränderung seiner Lage eingetreten war, vermochte er nichts zu ändern. Alle möglichen Gedanken und Kombinationen wälzten sich in seinem Kopf. Das schließliche Ergebnis blieb immer dasselbe: es ist nicht möglich, den Schaden wieder gut zu machen und das bisherige Leben weiter zu führen. Mit einem gewaltigen Entschluß mußte er mit allem brechen, was bis zu dieser Stunde die Bedingungen seines Daseins gebildet hatte. Er mußte fort von hier, von seiner Familie, von seinen Kameraden und Freunden, er mußte in einer neuen Welt ein neues Leben beginnen.
Das war ihm, während er auf dem Sessel brütend vor sich hingestarrt hatte, zur unabweislichen Gewißheit geworden, und er machte sich nun entschlossen ans Werk. Nachdem er sich durch die Aufstellung seiner Aktiva und Passiva, soweit er dazu imstande war, überzeugt hatte, daß er voraussichtlich seine Gläubiger auf Heller und Pfennig werde befriedigen können, und daß noch ein paar tausend Mark übrig bleiben würden, schrieb er mit brennender Stirn und geröteten Augen die folgenden Zeilen an den Generalmajor von Deggendorf-Lützen:
»Verehrtester Onkel!
Mit diesen Zeilen werde ich Dir schweren Kummer bereiten, und das ist es, was mich in diesem ernsten Augenblick auf das tiefste bewegt. Ich will keine Entschuldigungen suchen, ich will Dir ganz nüchtern nur das Tatsächliche mitteilen. Ich habe trotz meiner Versprechungen einen Rückfall in meinem Leichtsinn gehabt. Ich habe gespielt, habe hoch gespielt und unglücklich gespielt. Ich will keine mildernden Umstände anführen. Meine Situation ist eine so aussichtslose, daß ich den sehr schweren Entschluß habe fassen müssen, mich von allem gewaltsam loszureißen, was mich hier fesselt. Ich hoffe, daß mir die harte Schule in der neuen Welt, die ich aufsuche, gut bekommen wird, und ich verspreche Dir, daß ich unserem Namen keine Schande machen werde. Die Regulierung meiner finanziellen Angelegenheiten habe ich Herrn Justizrat Felix Quintus übertragen. Ich hinterlasse keine Schulden, und Du wirst nichts von mir hören, was Dir die Schamröte auf die Stirn treiben könnte. Ich füge diesem Briefe zwei Schreiben bei: in dem einen bitte ich Dich, mir auf längere Zeit Urlaub zu bewilligen, in dem andern bitte ich um meinen Abschied aus der Armee. Während meines Urlaubes wird die Entscheidung über meinen Abschied ohne Überhastung getroffen werden können. Ich werde Dir schreiben, sobald ich mich irgendwo niedergelassen haben werde. Denke ohne Groll an
Deinen Dich aufrichtig liebenden
und verehrenden Neffen
Georg.«
In einem zweiten Briefe an den Justizrat Quintus teilte Georg das Ergebnis seiner Vermögensfeststellung, seine Aktiva und Passiva mit. Er bat den lieben Freund, die finanzielle Regelung vorzunehmen. Es war im Grunde ein ziemlich einfaches Geschäft. Georg hatte außer der Spielschuld nur geringfügige Kleinigkeiten zu bezahlen, und sein Vermögen war leicht flüssig zu machen. Zweitausend Mark nahm er an sich; es mußte ihm noch immer eine kleine Summe bei der schließlichen Abrechnung zugute kommen. Im Notfall sollte Quintus auch sein Mobiliar und einige mehr oder minder wertvolle Kunstgegenstände, die sich bei ihm angesammelt hatten, verkaufen; wäre das aber nicht erforderlich, so sollten seine Habseligkeiten seinem Onkel in Gewahrsam gegeben werden. »Sie besitzen das vollste Verständnis für meine Lage, liebster Justizrat«, schloß Georg seinen Brief, »und ich weiß, daß ich mich auf Ihre Freundschaft verlassen kann. Ich hoffe, Ihnen dafür meinen Dank noch einmal mündlich abstatten zu können. Sagen Sie unsern gemeinsamen Freunden in meinem Namen herzlich Lebewohl und vergessen Sie nicht die niedliche Frau Kathi in der Hildebrandstraße. Ich gedenke mit wirklicher Rührung an die gemütlichen Abende, die wir dort verbracht haben, und es wird mir wirklich schwer, von hier fortzugehen, ohne der reizenden Frau noch einmal die Hand gedrückt zu haben. Ihren Brief, in dem Sie mir über die geschäftliche Abwickelung das Nähere berichten wollen, schicken Sie nach der Postoffize New York; ich werde da von Zeit zu Zeit nachfragen. Es sollte mich gar nicht wundern, wenn in diesem Briefe eine Mitteilung enthalten wäre, die Ihre Freunde, zu denen ich mich ja rechnen darf, seit einigen Wochen mit einer gewissen Spannung erwarten: daß Sie nämlich gesonnen sind, sich in den heiligen Stand der Ehe zu begeben. Meiner Glückwünsche dürften Sie im voraus versichert sein; denn die reizende kleine Frau hat mir mit jedem Tage besser gefallen. Und nun nochmals tausend Dank!
In herzlicher Zuneigung
der Ihrige
Georg.«
Nachdem Georg seine Briefe geschlossen und adressiert hatte, begann er mit der großen Arbeit des Aufräumens. Er entnahm den verschiedenen Schubläden seines Schreibtisches Stöße von Papieren, die er mit wechselnden Gefühlen durchmusterte. Er sonderte zunächst eine große Anzahl von Briefen aus, die ihm als persönliche Erinnerungen von Wert zu sein schienen. Bei der zweiten Sichtung verminderte sich die Zahl seiner Jugendreliquien immer mehr, und schließlich machte er kurzen Prozeß und warf nahezu alle Briefe, die ihn an reizende Verbindungen und unvergeßliche Stunden gemahnten, in das Kaminfeuer, das er angezündet hatte. Manchmal glitt ein wehmütiges Lächeln über sein Gesicht, und er vertiefte sich verhältnismäßig lange Zeit in die Lektüre, aber mit einem Seufzer riß er sich los, um auch dieses ihm so liebe Blatt von einst geliebter Hand schonungslos dem Flammentode zu opfern. Nur einige ältere Familienbriefe, namentlich die Briefe seiner verstorbenen Eltern, legte er sorgsam beiseite, glättete sie und schob sie in ein großes Kuvert, das er versiegelte.
Gegen sechs Uhr trat sein Diener in das Zimmer. Fritz übersah mit einem flüchtigen Blick, daß etwas Ungewöhnliches geschehen war, daß etwas Ungewöhnliches noch geschehen sollte.
»Machen Sie mir Kaffee,« sagte Georg. »Aber beeilen Sie sich, ich brauche Sie. Ich verreise auf längere Zeit. Packen Sie alles, was an brauchbaren Zivilanzügen, an Wäsche und so weiter vorhanden ist, zusammen.«

Fritz war zu wohlgeschult, um sich eine Frage zu erlauben. Er gehorchte stumm und mit ernster Miene dem Befehl seines Herrn. Gegen sieben Uhr meldete Fritz, daß die beiden großen Koffer gepackt seien, und daß er die Abfahrtszeit des Zuges nach Bremen ermittelt habe. Um acht Uhr verließ der Kurierzug Berlin.
»Dann habe ich also gerade noch Zeit, mich umzukleiden und auf den Bahnhof zu fahren,« sagte Georg.
Und nun war der entscheidende Augenblick da. Der Wagen hielt vor der Tür, die beiden Koffer waren schon von Fritz heruntergebracht. Georg hatte seinen Reisemantel umgehängt und einen kleinen runden Hut aufgesetzt, er hielt die Tasche mit den wenigen Kleinigkeiten, von denen er sich nicht trennen mochte, in der Hand und ernsten, beinahe finstern Mienen durch die kleine Wohnung.
Pluto folgte ihm in bedächtigen Schritten auf den Fersen. Es war, als ob auch das schöne Tier ahnte, daß sich etwas Außerordentliches vorbereite. Der Hund wich seinem Herrn nicht von der Seite, stieß ihn von Zeit zu Zeit mit der Schnauze an und versuchte, den großen Kopf zwischen Arm und Hüfte durchzuzwängen. Georg ließ sich noch einmal auf den Stuhl, der der Tür am nächsten stand, nieder, wie erschöpft. Pluto setzte sich ihm gerade gegenüber und sah ihn mit unendlich schwermütigen Blicken an.
»Du mußt hier bleiben, alter Kerl,« sagte Georg, indem er sich vorbeugte und mit der Handfläche die breite Stirn des Tieres klopfte. »Es hilft nichts, mein alter Pluto.«
Der Hund verstand seinen Herrn ganz gut. Er fegte mit dem gewaltigen Schweif langsam den Teppich und sah noch trauriger zu ihm auf. Er blieb auch ruhig sitzen, als Georg sich schnell erhob und das Zimmer verließ. Pluto wandte den Kopf und blickte unverwandt nach der Tür, die eben ins Schloß gefallen war. Und in dieser resigniert wartenden Haltung verharrte er.
Fritz wollte auf den Bock steigen, aber Georg nötigte ihn, sich ihm gegenüber in den Wagen zu setzen.
»Ich habe mit Ihnen zu sprechen.«
Während die Droschke dem Bahnhof zufuhr, teilte Georg seinem erstaunten Diener mit, daß er sich von ihm trennen müsse. Er habe ihm ein gutes Zeugnis, das er im Kasten seines Schreibtisches finden werde, ausgestellt. Der Justizrat Quintus sei beauftragt, ihm für die nächsten drei Monate das Gehalt auszuzahlen; bis dahin werde er ohne Zweifel eine andere Stelle gefunden haben. Der ehrliche Pommer wurde durch diese unerwartete Mitteilung sichtlich gerührt; aber er wagte keine Frage und sagte kein Wort weiter als: »Zu Befehl, Herr Leutnant«; und er wiederholte diese Worte jedesmal, wenn Georg eine Pause machte.
»Den Pluto bringen Sie mit meiner Karte,« sagte Georg langsam, während er seinem Portefeuille eine Karte entnahm und in die rechte Ecke p. p. c. schrieb, »zu Frau Kathi Bewer in der Hildebrandstraße. Sie kennt das gute Tier und hatte mich gebeten, ihr gelegentlich einen ähnlichen Hund zu besorgen. Da wird er's gut haben. – Vielleicht finden Sie da auch ein Unterkommen.«
»Zu Befehl, Herr Leutnant.«
»Und schließlich besorgen Sie noch im Laufe des Vormittags die beiden Briefe an meinen Onkel und an den Justizrat Quintus, beide sind eilig.«
»Zu Befehl, Herr Leutnant.«
Der Fahrschein war gelöst, das Gepäck war besorgt, und nachdem sich Georg in einer Ecke des Waggons seinen Platz zurecht gemacht hatte, wurde die Tür vom Schaffner geschlossen. Georg kreuzte die Arme in der schmalen Fensteröffnung und nickte seinem Diener mit ungewohnter Gemütlichkeit zu.
»Also Sie besorgen alles?«
»Zu Befehl, Herr Leutnant.«
»Und vergessen Sie mich nicht!«
Fritz stand in strammer militärischer Haltung da und rührte kein Glied, aber seine Augen wurden feucht, und er wiederholte:
»Zu Befehl, Herr Leutnant.«
Der Zug setzte sich in Bewegung. Fritz machte rechtsum und blickte demselben lange Zeit nach. Dann kehrte er langsam nach der Baruther Straße zurück.
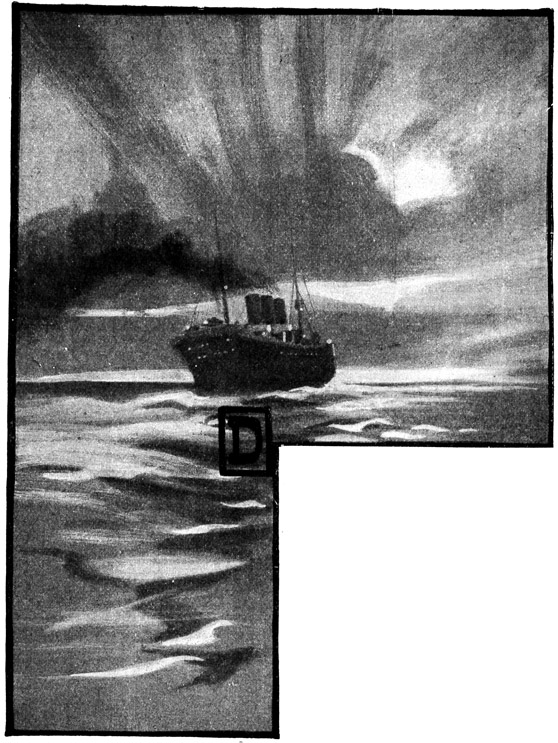
Der bequem und schön eingerichtete Dampfer des Norddeutschen Lloyd war seit achtundvierzig Stunden auf hoher See. Das Wetter war herrlich, die See spiegelglatt und das Deck überfüllt. Die Passagiere der ersten Kajüte kannten sich untereinander schon oberflächlich, es hatten sich auch schon kleinere vertrautere Gesellschaften gebildet, und zwischen allen herrschte die größte Zuvorkommenheit, jenes liebenswürdige Bestreben, sich gegenseitig gefällig zu sein, das die Seereise so überaus angenehm macht.
Der breitschultrige Kapitän mit dem blonden Vollbart und den hellblauen Augen besaß in hohem Maße die weltmännische Kunst, der ihm anvertrauten Gesellschaft das Leben angenehm zu machen. Er vermittelte in ungezwungener Weise Bekanntschaften, ließ die aus den Stewards der zweiten Kajüte gebildete Schiffskapelle im hellen Sonnenschein lustige Tänze aufspielen, und es wurde zuerst zaghaft, aber bald recht flott auf dem Deck getanzt.
Der Kapitän schien den hochgewachsenen, jungen, blonden Leutnant besonders in sein Herz geschlossen zu haben; er hatte ihm bei Tische den Ehrenplatz neben sich anweisen lassen und unterhielt sich mit ihm eingehender als mit allen anderen. Durch den Kapitän wurde Georg auch seinen Tischnachbarn vorgestellt, einer amerikanischen Familie aus dem Westen: Mr. Augustus W. Jefferson, dessen Frau und Tochter.
Augustus W. Jefferson hatte in den Minen von Kolorado viel Geld verdient. Er war einer der sogenannten »prominenten« Männer von Denver. Er war kaum mittelgroß, ziemlich hager, mit einem klugen tatkräftigen, aber ziemlich langweiligen Gesicht. Er trug den vollen Backen- und Kinnbart, die Oberlippe war rasiert. Er sah aus wie ein Mann, der schnell gealtert ist, sehr viel gearbeitet und sich verhältnismäßig wenig amüsiert hat, nicht böse, aber hart. Gegen seine Frau war er von rührender Aufmerksamkeit.
Mrs. Jefferson war eine stattliche Dame, etwas größer als ihr Mann, rundlich, mit einer leichten Hinneigung zur Korpulenz, mit weichen Zügen, gutmütigen, ein bißchen schläfrigen Augen, wundervollen Zähnen und reizenden, vollen wohlgepflegten Händen. Ein beständiges, wohlmeinendes Lächeln umspielte den hübschen halbgeöffneten Mund. Sie sprach fast gar nicht, beeilte sich nie, aß mit ausgezeichnetem Appetit und tat den lieben langen Tag nichts. Wenn sie langsam Toilette gemacht hatte, ließ sie sich von ihrem Manne auf Deck führen, streckte sich auf dem langen Schiffsstuhl aus, ließ sich mit verschiedenen Plaids warm einmummeln, las einen Roman, aus dem sie von Zeit zu Zeit halb schläfrig lächelnd aufblickte, schlummerte darüber endlich ein, ließ sich zu den Mahlzeiten in die Kajüte und nach den Mahlzeiten wieder auf Deck führen, streckte sich dann wieder aus, lächelte, schlummerte, war wohlwollend und überflüssig vom frühen Morgen bis zum späten Abend; und so einen Tag wie den andern; das Fleisch und Blut gewordene Phlegma, die berufsmäßige Trägheit, der vollständigste, ebenso unnütze wie unschädliche Egoismus. Man sah es Mrs. Jefferson an, daß sie vor zwanzig Jahren bildschön gewesen sein mußte, wahrscheinlich noch schöner als ihre reizende Tochter Noëmi, die zwei Jahre lang in Dresden in einer guten Pension gewesen war, und die nun die Eltern abgeholt hatten, um sie in die Heimat zurückzubringen.
Noëmi war zwar keine Schönheit, aber ein wunderhübsches Mädchen in der vollsten Frische der Jugend, mit großen blauen, vertrauenden Augen, und offenbar darauf angelegt, das Leben von der heitersten Seite zu nehmen und recht viel zu lachen. Es machte aber nicht den Eindruck, als ob ihr dazu im elterlichen Hause viel Gelegenheit geboten werden würde. Sie hatte in Dresden natürlich feurige Freundschaften mit anderen jungen Mädchen fürs Leben geschlossen, aber sie war doch glücklich, aus dem Pensionszwang befreit, nun nach dem herrlichen Amerika, das sie über alles liebte, zurückkehren zu dürfen.
Es war kein Wunder, daß ihr Georg von allen Passagieren bei weitem am besten gefiel. Er hatte unstreitig das gefälligste Äußere, er war der beste Tänzer und ein vollkommener Kavalier. Schon beim ersten Lunch hatte er angefangen, ihr ein klein wenig den Hof zu machen, und da Noëmi ganz damit einverstanden war und die Eltern das kindliche Vergnügen nicht weiter störten, fuhr er fort, Noëmi unausgesetzt merken zu lassen, daß er in ihrer Gesellschaft sich besonders wohl fühle. Es war ihm auch ganz recht, sich jetzt mit dem liebenswürdigen und schönen jungen Mädchen, das ihm bisher eine völlig Fremde gewesen war, viel zu beschäftigen. Er wurde dadurch abgelenkt von manchen unerfreulichen Betrachtungen und Grübeleien, denen er freilich doch nicht ganz entgehen konnte. Abends wenn er in die enge Kajüte stieg und in das schmale Bett sich einpferchte, – dann dachte er doch an mancherlei, was ihn nicht gerade heiter stimmte. Dann machte er sich doch ungefähr klar, wie viel er jetzt hatte aufgeben müssen und wie wenig er von der Zukunft zu erwarten hatte. Aber er war so jung, daß der Ernst und die Traurigkeit seines Schicksals doch nur vorübergehend seine Stimmung beherrschten und das Unerfreuliche immer bald wieder verscheucht wurde durch ein freudiges Gedenken an die angenehmen Stunden, die er im Laufe des Tages in der Gesellschaft des anmutigen, lebensfrohen, jungen Mädchens verbracht hatte. Und wenn er vor seines Geistes Auge das strenge und betrübte Antlitz seines Oheims auftauchen sah, so erschien auch zugleich im Hintergrunde eine jugendfrische Blondine mit rosigem Kinn und reizenden Grübchen, und er freute sich auf den anderen Morgen, der ihm wiederum das Vergnügen bereiten würde, mit Noëmi zusammenzusein.
Und die Reise selbst war ja ganz dazu angetan, einen dicken Strich unter das soeben abgeschlossene Kapitel seines jungen Lebens zu ziehen. Der Zusammenhang mit allem, was bisher zu ihm gehört hatte, war auf einmal gewaltsam gelöst. Es war ihm jede Möglichkeit genommen, denen, die sich für ihn interessierten, und an denen er irgend ein Interesse hatte, Nachrichten von sich zu geben oder von diesen Nachrichten zu erhalten. Er wußte, daß er keinen Brief, keine Einladung, nicht nur während der zehntägigen Überfahrt, sondern auf Monate hinaus empfangen würde. Und in der Regelmäßigkeit, der Einförmigkeit und den gänzlich neuen Bedingungen des Lebens an Bord schien es ihm, als ob der letzte Klubabend, der für ihn verhängnisvoll hatte werden sollen, schon in ferner Vergangenheit hinter ihm liege.
Aber unerreichbar weit lag auch die Zukunft vor ihm. Vergeblich bemühte er sich in den Stunden des Alleinseins seinen Blick darauf zu richten. Eine verschwommene Wirrnis starrte ihm entgegen. Er war vollkommen ratlos.
Inzwischen schwamm das Schiff seinem Ziele näher und näher. Am siebenten Tage der Reise war leichter Sturm; das Schiff machte ungeheure Schwankungen, viele Passagiere wurden seekrank. Mrs. und Miß Jefferson blieben in der Kajüte, und nur wenige der seetüchtigen Männer hatten sich auf Deck gewagt und erfreuten sich des großartigen Naturschauspiels. Der Kapitän und die Offiziere hatten vollauf zu tun. In den Nachmittagsstunden wurde die See so grob, daß beständig große Spritzwellen über Bord bis zur Höhe der Schornsteine aufschlugen und der Aufenthalt auf Deck für die Passagiere nicht mehr ratsam war. Selbst der Rauchsalon, der sonst immer dicht besetzt war, war heute fast verödet.
An dem kleinen runden Tisch nahe dem Eingang saßen Augustus W. Jefferson und Georg von Lützen. Sie hatten schon lange geplaudert, von allen möglichen mehr oder minder gleichgültigen Dingen. Plötzlich nahm das Gesicht Georgs, das bisher immer nur lebensfrisch und frohsinnig gewesen war, einen merkwürdig ernsten, fast düstern Ausdruck an, und ohne nach einem Übergang zu suchen, sagte er mit veränderter Stimme:
»Mein lieber Mr. Jefferson, Sie sind ein erfahrener Mann, Sie kennen die amerikanischen Verhältnisse genau, vielleicht können Sie mir einen Rat geben.«
Jefferson sah ihn mit seinen müden, großen Augen ruhig an und schwieg.
»Ich bin bis jetzt Offizier gewesen,« fuhr Georg fort. »Ich habe gespielt, verloren, habe mein Zelt abgebrochen und gehe nun nach der Neuen Welt, um mir ein neues Leben zu begründen. Ich habe wenig Geld aber viel Mut.«
»Haben Sie? – Gut! Wenn Sie arbeiten wollen und arbeiten können, dann werden Sie es bei uns zu etwas bringen.«
»Das hoffe ich. Ich möchte nur wissen, wo ich ansetzen soll.«
»Überall, wo sich die Gelegenheit bietet. Das kann ich Ihnen hier natürlich nicht sagen, das müssen Sie selbst drüben sehen. Sie sind gewiß wie alle Leute Ihres Landes und Ihres Standes ein wenig verwöhnt. Wenn Sie ein bequemes Leben unter den Bedingungen der Zivilisation weiterführen wollen, so werden Sie wohl im Osten bleiben müssen; da finden Sie in New York oder sonst einer großen Stadt sicherlich bald eine Stellung, die ihren Mann ernährt, zum Beispiel als Kellner ...«

Georg sah ihn groß an. Aber Mr. Jefferson schien es kaum zu bemerken und fuhr fort:
»Oder als Kondukteur bei der Pferdebahn und dergleichen, bescheidene, aber sichere Stellungen. Vielleicht können Sie auch in ein kaufmännisches Bureau eintreten, und wenn Sie Talent zum Handel haben, werden Sie es da weit bringen können; aber Sie sehen mir nicht danach aus. Und es wäre auch schade, wenn ein Mann von Ihrem Schlage im Bureau verkümmerte. Sie sind sehr gut gebaut. Sie scheinen stark zu sein. Sind Sie ein guter Reiter?«
»O ja; ich war Kavallerieoffizier.«
»Sie schießen wohl auch gut?«
»O ja.«
»Nun dann rate ich Ihnen: versuchen Sie es erst gar nicht mit dem Schlaraffenleben im Osten, gehen Sie gleich nach dem Westen weiter! Da finden Sie sicher bald, was Sie brauchen. Sie scheuen doch die Arbeit mit der Hand nicht? – Sie halten es doch nicht für unter Ihrer Würde, als Eisenbahnarbeiter Sand zu karren oder Steine zu klopfen? Das wird bei uns noch gut bezahlt, und Sie haben nur wenig Ausgaben. Sie können ja auch in die Minen gehen, und wenn Sie sich erst ein bißchen eingearbeitet haben, werden Sie vielleicht Talente in sich entdecken, von denen Sie noch gar keine Vorstellung haben. Vielleicht sind Sie ein geschickter Prospektor. Man braucht nicht Mineralogie studiert zu haben, um Gold zu finden. Und wenn Sie gut schießen und reiten können, können Sie sich ja auch als Jäger oder als Hirt eine Stellung machen. Sie brauchen eben nur zu wollen, dann wird's schon gehen. Sie sind in den besten Jahren ... Wie alt sind Sie denn?«
»Siebenundzwanzig Jahre.«
»Sie sind gesund, wenn Sie die Anstrengungen nicht scheuen, wird es Ihnen schon gut gehen. Bei uns in Kolorado, in Neu-Mexiko und Arizona und da oben in Oregon, Montana und Dakota ist noch für Tausende und aber Tausende Platz, und Tausende und aber Tausende können da noch zu reichen Männern werden. Aber die Hauptsache ist: strenge, unverdrossene Arbeit, Verzicht auf alle Bequemlichkeiten und Freuden Ihres bisherigen Daseins, Selbstvertrauen und Selbsttätigkeit. Helfen kann Ihnen kein anderer, helfen können Sie sich nur allein. Und wenn Sie Ihr Weg einmal nach Denver führt, so kommen Sie zu mir und erzählen Sie mir, wie es Ihnen gegangen ist, und wenn Sie sich als tüchtiger Mann bewährt haben, dann können wir vielleicht auch einmal zusammen arbeiten – wer weiß! –«
Augustus W. Jefferson schwieg. Georg nickte langsam mit dem Kopf und sagte nach einer ziemlich langen Pause:
»So ungefähr hatte ich es mir auch gedacht.«
Er war gerade so klug, wie er gewesen war. Nichts von alledem, was Jefferson ihm gesagt hatte, war ihm besonders verlockend erschienen. Nur eines hatte Eindruck auf ihn gemacht: der Rat, nach dem Westen zu gehen; denn bisher hatte er immer nur an die Möglichkeit, sich in New York eine Stellung zu begründen, gedacht. Aber dem Sohne des Landwirtes, der seine Jugend selbst auf dem Lande zugebracht und ein angeborenes Verständnis für die Natur hatte, erschien es jedenfalls reizvoller, unter freiem Himmel als Jäger oder Hirt seine Zukunft zu suchen als in dem dunkeln Bureau der großen Handelsstadt. Die ernste gedrückte Stimmung wollte ihn im Laufe des Tages nicht mehr verlassen, und er war sehr niedergeschlagen, als er am Abend seine Kajüte aufsuchte. Er blieb lange wach in seinem schmalen Bett, und während der Wind durch das Takelwerk pfiff und die Wellen dröhnend an die Lukenfenster klatschten, dachte er mit schwerem Herzen an alle die Daheimgebliebenen und mit besonderer Rührung an seinen Oheim, an Pluto und den biedern Pommer. Und diesmal wurde das trübe und graue Bild seiner Phantasie nicht durch die lichte Gestalt der freundlichen Noëmi aufgehellt. Sein Schlaf war schwer und traumlos.
Dem Sturme war ein herrlicher Sonnentag gefolgt. Das helle Licht lockte die Passagiere, die zum großen Teil seit mehr als vierundzwanzig Stunden ihre dumpfe Kajüte nicht hatten verlassen können, auf das freundliche Deck, auf dem alles wie im Festschmuck blitzte und glänzte. Man sah ganz neue Erscheinungen wieder auftauchen, die seit dem ersten Tage wie verschwunden gewesen waren. Vom Zwischendeck her hörte man lautes übermütiges Lachen, das Kratzen der Fiedel und die schnarrenden Töne der Ziehharmonika. Die Auswanderer sangen Volkslieder und tanzten. Alles machte den Eindruck des Heitern und Frohen. Und doch schienen einige von einer gewissen weichen Regung beherrscht zu sein. Es hatten sich während der Überfahrt verschiedene Gruppen gebildet und zwischen einzelnen derselben recht angenehme Beziehungen geknüpft; und nun sollte die Fahrt bald ihr Ende erreichen, und diejenigen, die sich sympathisch einander genähert hatten, sollten nun wieder auseinandergesprengt und in alle Winde zerstreut werden.
Das Deck der ersten Kajüte war übervoll. Dutzende von linnenbespannten Streckstühlen standen da herum, und die »Deckläufer«, eine ganz besondere Art von Reisenden, die es für ihre Pflicht halten, täglich ein paar Stunden wie von Furien gehetzt auf dem Deck schnellen Schrittes hin- und herzurennen, hatten Mühe, sich durch die schmale Gasse, die durch die Bequemeren und weniger Bewegungsbedürftigen noch mehr verrammelt wurde, Bahn zu brechen.

Mrs. Jefferson lag wie gewöhnlich auf dem Stuhle, sie hatte ein Buch in der Hand, in dem sie sehr wenig las, und lächelte milde. Augustus W. Jefferson unterhielt sich mit einem Minenbesitzer über Silberwährung, und Georg hatte sich neben Noëmi gestellt. Sie stützten sich auf das Geländer des Seitenbordes, blickten auf den schaumigen Gischt, der an den Planken aufgetrieben wurde, und auf die ungeheure ruhige, in den herrlichsten Farben glänzende Wasserfläche und erzählten sich allerlei.
»Ja,« sagte Georg lächelnd. »Es ist wirklich merkwürdig, wie sich auf dieser großen weiten Welt alles zusammenschiebt. Natürlich kenne ich Frau Kathi Bewer und sogar sehr gut. Aber wie kommen Sie, Fräulein Noëmi, dazu, Interesse an der jungen Frau zu nehmen?«
»Das ist sehr einfach,« entgegnete Noëmi. »Die Familie White in San Franzisko ist seit langen Jahren mit der unsrigen innig befreundet. Die älteste Tochter Ellen hat Herrn Wilhelm Bewer in San Franzisko geheiratet, und mit der jüngeren, Bella, die etwa ein Jahr älter ist als ich, bin ich in Dresden in derselben Pension gewesen. Wir haben uns regelmäßig geschrieben, und sie hat mir in ihren Briefen viel von Herrn Klaus Bewer vorgeschwärmt und hat mir gesagt, daß die Ehe keine glückliche gewesen, und daß Herr Klaus Bewer wieder zu seinen Wilden nach Sumatra zurückgekehrt sei. Jedes Wort in Bellas Brief verriet deutlich eine ganz ungewöhnliche warme Teilnahme für Herrn Klaus Bewer, und deshalb können Sie sich doch denken, daß es mich interessiert, etwas näheres über die Frau zu erfahren, die den von Bella so aufrichtig verehrten Mann unglücklich gemacht hat. Sie ist wohl eine böse Frau?«
»Ganz und gar nicht. Im Gegenteil, eine herzensgute, liebenswürdige, muntre, reizende Frau. Ich kenne Herrn Klaus Bewer nicht, aber er muß es jedenfalls merkwürdig ungeschickt angefangen haben, wenn er mit dieser allerliebsten Dame nicht hat glücklich werden können. Sie ist bildhübsch, immer lustig, vollkommen anspruchslos, und ich kann sagen, daß die Stunden, die ich in dem gemütlichen Salon in der Hildebrandstraße bei Frau Kathi Bewer verbracht habe, mit zu den angenehmsten meines Berliner Aufenthalts gehören. Sie ist eine Fremde in Berlin und hat auch wenig Anschluß an die dortige Gesellschaft gefunden, aber sie erfreut sich des allerbesten Rufes, und das ist für eine junge alleinstehende Frau, der natürlich jedermann den Hof macht, nicht ganz leicht.«
»Haben Sie ihr auch den Hof gemacht?« fragte Noëmi, ohne Georg anzusehen.
»Eigentlich nicht. Der zufällige Umstand, daß derjenige, der mich Frau Bewer vorgestellt, selbst eine tiefere Neigung für die junge und anmutige Frau zu empfinden scheint, hat mich davon abgehalten. Es ist mein Freund Felix Quintus, wohlbestallter Justizrat in Berlin, der die Scheidungsangelegenheit geleitet und bei den Auseinandersetzungen Frau Bewer näher kennen und schätzen zu lernen Gelegenheit gehabt hat. In den letzten Wochen war gerade in unseren Kreisen das Gerücht verbreitet, daß Justizrat Quintus sich demnächst mit Frau Bewer verloben werde.«
»So?« entgegnete Noëmi, »alles das werde ich in meinem nächsten Briefe Bella mitteilen; es wird sie sicherlich in hohem Maße interessieren. Und wenn Sie Ihr Weg nach San Franzisko führt, so sollten Sie es nicht versäumen, Miß Bella White aufzusuchen ...«
»Wenn Sie mich durch eine Zeile von Ihrer Hand, durch einen freundlichen Gruß, den ich überbringen könnte, dazu in den Stand setzen wollten, so würde ich's mit großem Vergnügen tun. Es ist sogar sehr wahrscheinlich, daß es bald wird geschehen können; denn ich habe die Absicht, gleich nach dem Westen aufzubrechen. Ihr Herr Vater hat mir Lust dazu gemacht.«
»Nun, es braucht ja nicht gleich der fernste Westen zu sein. Bei uns in Kolorado ist es ja auch sehr hübsch.«
»Ich glaube es Ihnen gern, liebes Fräulein. Ich lasse den Zufall entscheiden, wohin er mich verschlagen mag. Einstweilen will ich mich in Ihrem Lande, dessen Schönheit mir von allen Kundigen so hoch gerühmt wird, ein wenig umtun und sehen, ob ich mich irgendwo und irgendwie nützlich machen kann. Führt mich mein Weg in Ihre Nähe, so seien Sie versichert, daß ich es nicht versäumen werde, Sie aufzusuchen.«
»Ich werde mich sehr freuen,« sagte Noëmi langsam, indem sie unausgesetzt auf die gletschergrünen Schaummassen, die unter der leichtbewegten Wasserfläche neben dem Schiffe dahinzogen, hinabblickte.
Die beiden schwiegen eine Weile. Dann sagte Georg, zunächst nur um die Pause nicht allzusehr zu verlängern:
»Ja, so geht's! Man findet sich, man verliert sich aus den Augen; man glaubt ein paar Tage, sich ganz nahe gerückt zu sein, und nach kurzer Frist merkt man, wie unendlich fern man sich geblieben ist.«
»Wenn man sich ernsthaft sucht, sollte man sich schon wiederfinden können, meine ich. Die Welt ist ja nicht so groß ... Ich will ein paar Worte für Bella White aufsetzen,« sagte sie mit veränderter Stimme, »und sie Ihnen für alle Fälle mitgeben.« Und mit einer leichten Kopfbewegung wandte sie sich ab und stieg die Treppe, die zu den Kajüten führt, hinunter.
Georg blieb noch lange ziemlich gedankenlos am Schiffsrande stehen und blickte auf die gewaltige beruhigende Einförmigkeit des Meeres.
Beim Diner reichte Noëmi Georg ein kleines Briefchen mit der Aufschrift »Miß Bella White, Kaliforniastreet, San Franzisko.«
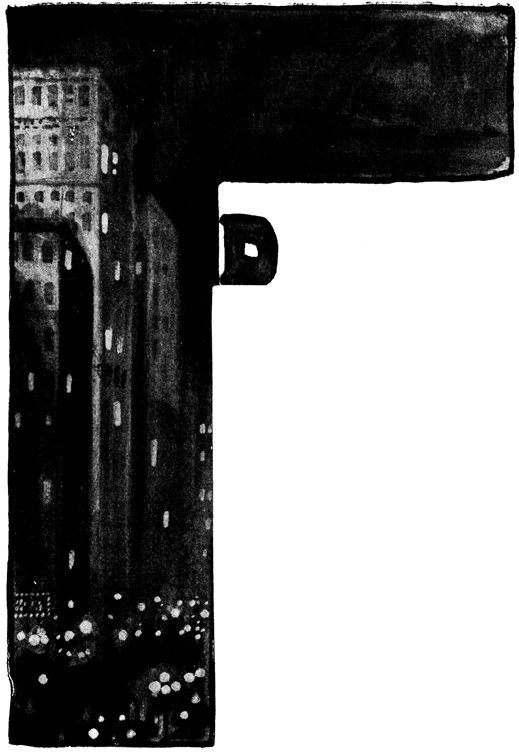
Der Abschied von der Familie Jefferson war kurz und herzlich gewesen. Jeffersons hatten sich nur wenige Tage in New York aufgehalten und waren nach Saint Louis gefahren, wo sie einige Wochen verweilen wollten, um sich von dort nach Denver zu begeben. Georg war mit ihnen in demselben Hotel abgestiegen, hatte ihre Vergnügungen geteilt, die für seine Verhältnisse nun kostspielige geworden waren, und war im Innern eigentlich ganz froh, als er nun sich selbst überlassen, die Bedingungen seines Daseins ohne Rücksicht auf andere feststellen und seine Ausgaben allein bestimmen konnte. Gleichzeitig mit der Familie Jefferson verließ er das elegante Hotel Brunswick und suchte in einer weniger vornehmen Gegend der ungeheuren Stadt ein Unterkommen. Als Soldat wußte er sehr gut, daß man sich unter Umständen mit wenigem behelfen kann; er hatte sich daher nur mit dem Notwendigsten ausgerüstet und alle übrigen Sachen im Hotel in Gewahrsam zurückgelassen.
Der Zufall führte ihn in ein Wirtshaus, das in der Nähe des Hafens lag und von einer sehr bunten und abenteuerlichen Gesellschaft besucht war. In der verqualmten Wirtsstube des Erdgeschosses erregte das Erscheinen Georgs einiges Aufsehen. Die Eleganz seiner Kleidung, seine ganze Haltung und namentlich die wohlgepflegten Hände ließen in ihm sofort den Neuling erkennen, der erst im Begriff stand, in die Kreise, die hier heimisch waren, herabzusteigen. Der deutsche Wirt behandelte ihn denn auch mit einer gewissen Auszeichnung. Er setzte sich zu ihm und ließ sich mit ihm in ein längeres Gespräch ein. Nachdem er von Georg gehört, daß dieser die Absicht habe, nach dem Westen zu gehen, riet er ihm dringend, den nördlichen Westen zu wählen; da werde jetzt die neue Bahn gebaut, da sei Arbeit die Hülle und Fülle, da könne man es leicht zu etwas bringen. Mehrere der Gäste, die er da am runden Tisch versammelt sehe, seien für den Bau in Dakota und Montana angeworben worden, und er könne gar nichts Gescheiteres tun, als sich diesen ehrenwerten Männern anzuschließen.
Georg sagte nicht ja und nicht nein. Der Vorschlag erschien ihm gerade so annehmbar wie alles andere. Ein paar Wochen konnte er es allerdings noch aushalten, aber bis dahin mußte er auf alle Fälle irgend eine lohnende Beschäftigung gefunden haben. Er setzte sich also zu den Arbeitern am runden Tisch, und eine Stunde darauf war er fest entschlossen, mit diesen gemeinsam Bildung und Gesittung in die noch unkultivierten Gegenden der nordwestlichen Wildnis zu tragen. Georg hatte es auch nicht zu bereuen. Seine fünf Genossen, drei Deutsche und zwei Schweden, waren freilich ein bißchen rohe, aber gutmütige Menschen, die instinktiv die Überlegenheit Georgs herausfühlten, sich in der Gesellschaft des kräftigen blonden, vornehmen jungen Mannes geschmeichelt fühlten und ihm auf dem langen Wege allerlei kleine Gefälligkeiten gern erwiesen.
Sie hatten sich kurze Zeit in Chicago aufgehalten, waren dann nach Saint Paul in Minnesota hinaufgegangen, und dort war ihnen vom Bureau der Nördlichen Pazifikbahn die Arbeit angewiesen worden. Georg wurde auf seinen Wunsch nach dem westlich am weitesten vorgeschobenen Posten, in die Rocky Mountains geschickt.
Das Leben, das sich ihm da eröffnete, war hart und freudlos. Er mußte sich gehörig schinden und placken und verdiente damit gerade so viel, wie er brauchte, um sein Dasein zu fristen. Seine Kameraden waren meistens wüste, rohe Gesellen, mit denen er kaum mehr verkehrte, als nötig war, um nicht das Sprechen zu verlernen.
Der elegante Kavallerie-Leutnant hatte sich in den wenigen Monaten völlig verändert. Äußerlich vermochte ihn selbst ein geübtes Auge kaum noch von seiner Umgebung zu unterscheiden. Der breitkrämpige Strohhut hatte sein Gesicht doch nicht genügend beschattet; seine Hautfarbe war gerade so sonnengebräunt wie die aller anderen, seine Hände waren gerade so hartgearbeitet und seine Kleider gerade so abgerissen wie die seiner Kumpane. Er hatte den Vollbart wachsen lassen, er hielt sich nicht mehr so stramm, er hatte etwas vorzeitig Ermattetes. Er war nicht eigentlich unzufrieden mit seinem Lose, aber es war, als ob die rechte Lebensfrohheit in ihm wie erloschen sei; er blickte merkwürdig ernst mit seinen jungen Augen in die langweilige Welt. Aufstehen, sich schinden, um gerade genug zu verdienen, damit man sich weiter schinden könne, keine Freude, keine einzige! – es war nicht heiter; und so sollte es weiter gehen, einen Tag wie alle Tage. Es war, wenn man sich's recht überlegte, zum Verzweifeln. Und wie gut hatte er's gehabt, wie gut könnte er's jetzt noch haben, wie gut hätte er es haben können für alle Zeiten, wenn er nicht so dumm, so entsetzlich dumm gewesen wäre! Georg mußte über sich selbst lächeln. Zwei Worte ohne Überlegung, in einer Art dämonischen Leichtsinns hervorgestoßen, unwiderruflich, die beiden entscheidenden Worte » Va banque!« die gleichzeitig mit den Rauchwolken der Zigarette von seinen Lippen gekommen waren, – sie hatten genügt, sie waren daran schuld, daß er hier in gottvergessener Wildnis die Felsstücke absprengte und Sand karrte. Und seine jetzigen Gefährten, waren sie um einen Deut gescheiter, machten sie es nicht gerade so, wie er's gemacht hatte? Arbeiteten sie nicht mit verdoppelter Kraft, um nur ja recht früh in die Spielhölle zu kommen und da im Handumdrehen zu verlieren, was sie im Schweiße ihres Angesichts erworben hatten und den Lohn für künftige Tage und Wochen zu verschwelgen? Konnte er es ihnen verdenken, wenn sie verdrossen bei der Arbeit und grob und roh in den Feierstunden waren? Und so sollte es weitergehen, immer weiter! – Das war das Einzige, was Georg wirklich erschreckte.
Zwei Monate hatte er nun hier gearbeitet. Er hatte sich so eingerichtet wie nur möglich; er war der seltenste Gast in den Spiel- und Schnapsspelunken, den einzigen Stätten der Kultur an der neuen Bahn. Er spielte nie und trank wenig, und er hatte es doch nicht weiter bringen können als ein paar Dollars beiseite zu legen, und auch diese mußten bald für neue Anschaffungen daraufgehen. Da mußte er sich denn sagen, daß er auf diese Weise, wenn er immer Arbeit haben werde, nach zehn Jahren noch genau auf dem alten Fleck sein werde.
Eines Morgens schnürte er sein Bündel, packte sein Handwerkszeug auf die Schulter und zog eine Tagereise weiter westwärts nach der Stadt Helena, von deren lustigem Treiben er im Lager schon viel gehört hatte. Er wollte versuchen, sich als Minenarbeiter zu verdingen; vielleicht, daß es ihm da besser gehen würde. Seine Erwartungen wurden aber vollkommen getäuscht.
Vergeblich meldete er sich in den verschiedenen Bureaus, die die Arbeiten in den Minen nachzuweisen hatten; man vertröstete ihn auf einige Wochen, vorderhand konnte man ihn nicht gebrauchen.
In einem elenden Wirtshause hatte er für verhältnismäßig geringen Entgelt Unterschlupf und Kost gefunden. Der Wirt, wiederum ein biederer Deutscher, ein Recke aus Westfalen, unterhielt in den unteren Räumen seiner Bretterbude unter dem pompösen Titel »Opernhaus« einen erbärmlichen Tingeltangel, der zugleich mit einer Spielhölle kombiniert war. Seine geringen Ersparnisse vom Bahnbau her hatte Georg längst verausgabt. Er hatte auch das stark zusammengeschmolzene Kapital, das er sich als Zehrpfennig für die bitterste Not unversehrt hatte erhalten wollen, wiederum angreifen müssen. Er machte sich ernsthafte Vorwürfe, daß er so wählerisch gewesen war und die lohnende Beschäftigung an der Bahn übermütig aufgegeben hatte. Bei größter Sparsamkeit konnte er es allerdings noch drei bis vier Wochen aushalten, aber was dann? Wenn er bis dahin keine Beschäftigung gefunden hatte – was dann?
Als die Not am höchsten war, sollte ihm doch eine unerwartete Hilfe gewährt werden. In der Schenke, die in den späten Stunden von den Minenarbeitern und sonstigen Pionieren der Kultur gewöhnlich überfüllt war, war eines Abends wüster Streit ausgebrochen. Ein Spieler hatte den Bankhalter des Betruges bezichtigt, und von den Verbalinjurien war man sofort zur tatsächlichen Auseinandersetzung übergegangen. Der Gentleman, der sich in seinen Interessen geschädigt glaubte, hatte aus der Hüftentasche den Revolver gezogen und auf den Bankhalter gefeuert. Dieser war beiseite gesprungen, und die Kugel war in den Rücken des unglücklichen Klavierspielers gedrungen, der sich durch den Lärm nicht hatte abhalten lassen, den Walzer aus der »Fledermaus« vor dem kunstsinnigen Auditorium vorzutragen. Schwer verwundet sank der Beklagenswerte von seinem Stuhl. Der wütende Revolver-Gentleman wurde überwältigt, geknebelt und in Sicherheit gebracht, der Klavierspieler in Pflege gegeben.
Alle Welt war sehr aufgeregt, besonders aber der westfälische Wirt, der in großer Verlegenheit war, einen Ersatz für seinen Klavierspieler zu finden. Denn wenn er nicht sofort einen Mann auftreiben konnte, der imstande war, den musikalischen Bedürfnissen der kunstliebenden Gesellschaft von Helena zu genügen, die Lieder der heiseren französischen Chansonettensängerin zu begleiten und dem Nigger zum Tanz aufzuspielen, so war es um seine Reputation geschehen, und er vermochte der schon ohnehin bedenklichen Konkurrenz der benachbarten Konzerthalle nicht mehr die Stirn zu bieten.
Georg war ein mäßig begabter musikalischer Dilettant. Er hatte früher öfter, wenn gerade kein Besserer zur Stelle war, zum Tanz aufgespielt, aber nie daran gedacht, daß er mit diesem bescheidenen Talente einst sein Brot werde verdienen können. Er fragte den Westfalen, ob er mit ihm sein Heil versuchen wolle, und der Wirt war froh, einen Ersatzmann für den Schwerverwundeten zu finden.
Die Stellung war nicht gerade bedeutend, aber sie war eben besser als nichts. Er hatte freien Verzehr und einen Dollar täglich. Mit dem freien Verzehr war es aber eine eigene Sache. Die Stammgäste tranken ihm beständig zu, und wenn sich Georg beim Morgengrauen auf die harte Matratze warf, war ihm der Kopf wüst und schwer, und er sagte sich jedesmal, daß er viel mehr getrunken hatte, als ihm dienlich war. Aber er paukte unverdrossen auf die Tasten, der Nigger tanzte, und die geschminkte vierzigjährige Französin sang ihre schlüpfrigen und sentimentalen Lieder dazu, und alle Welt war zufrieden, besonders der Wirt aus Westfalen, der Georg völlig in sein Herz geschlossen hatte.
Eines Abends kam eine sehr auffällige Erscheinung in dies eigentümliche Opernhaus, ein übermäßig langer, unheimlich hagerer, knochiger Mensch mit großer Adlernase, eingefallenen Wangen, struppigem, braunen Bart, eine Art Don Quixote, mit hohem, breitkrämpigem Hute, einer Lederjoppe, hohen Ledergamaschen, um den Leib einen Gurt mit Patronen und die Doppelflinte auf dem Rücken. Er wurde von den meisten Gästen sehr freundlich begrüßt, und alle Welt schien ihn zu kennen. Er schüttelte allen die Hand, setzte sich an einen kleinen Tisch in der Nähe des Klaviers und bestellte einen Cocktail von Whisky. Der Wirt setzte sich zu ihm und redete ihn in deutscher Sprache an. Der Hagere, der kein Lot Fleisch mehr, als nötig war, um die Knochen zu bedecken, auf dem Leibe hatte, sprach ein wunderbares Kauderwelsch.
»Du hast dich ja lange nicht bei uns blicken lassen. Kommst du aus den Bergen?«
»Ja,« erwiderte der Lange. »Ich habe eine ganz gute Jagd gemacht und bin mit dem Erlöse zufrieden.«
»Wirst du ein paar Wochen bei uns bleiben?«
»Nein. Ich bin bloß in dies Nest gekommen, um mir Munition zu holen. Ich ziehe heute abend wieder ab.«
»Wohin?«
»Südlich, in der Richtung auf Virginia-City. Vielleicht kann man einen guten Fang tun. Hast du einen resoluten Burschen zur Hand?«
»Entschlossene Leute gibt's hier genug,« versetzte der Wirt. »Was führst du denn im Schilde?«
»Ich will versuchen, ob ich die Kerle abfassen kann, die die stage angefallen haben.«
Der Wirt sah den Langen verwundert an.
»Weißt du denn von nichts?« fuhr dieser fort. »Ihr sauft und spielt hier den ganzen Tag und bekümmert euch nicht um Gott und die Welt. Hinter Fort Ellis ist die Post von drei geschwärzten Kerlen überfallen worden, Kutscher und Führer getötet, die Kasse gestohlen, drei Pferde ausgespannt. Auf denen sind die Kerle entwischt. Die beiden Passagiere sind wie durch ein Wunder entkommen. Auf die Ergreifung der Kerle ist eine Prämie von fünfhundert Dollars gesetzt, ich denke, die kann man sich verdienen, aber es wäre gut, wenn ich noch Einen zur Hand hätte; finde ich keinen, so versuche ich mein Heil auf eigne Faust.«
Georg hatte gerade eine Pause gemacht und das Gespräch am nahen Tische gehört. Der hagere Mensch, der ohne irgend welche Prahlerei dem Wirte mitteilte, daß er in die Berge ziehen wolle, um allein drei Raubmörder abzufangen, imponierte ihm. Er erhob sich von seinem Stuhl am Klavier, trat an den kleinen Tisch und sagte:
»Ich hätte nicht übel Lust, mitzumachen.«
Der Lange maß ihn vom Scheitel bis zur Sohle. Er schien mit der Musterung zufrieden zu sein. Georg war in der Tat ungewöhnlich stark und machte den Eindruck eines starken Menschen. Der Lange verzog keine Miene weiter und sagte:
»Wenn du nichts Besseres vorhast, komm! Ein Pferd kann ich dir geben.«
Die beiden machten schnell Bekanntschaft. Der Lange war Dutch Bill, von dem Georg schon oft hatte sprechen hören, einer der verwegensten Abenteurer der ganzen Gegend. Er lebte seit mehr denn zwanzig Jahren hier im Westen, immer in der Wildnis, er schimpfte über die Eisenbahnen, die ihm die ganze Freude an der Natur zu verderben drohten. Helena war ihm schon viel zu kultiviert. Als ganz junger Mensch war er aus Deutschland oder Holland – darüber waren die Meinungen geteilt – weggegangen, niemand wußte, weshalb. Zehn Jahre lang hatte er sich mit den Indianern in Dakota herumgetrieben, jetzt hauste er immer am nördlichen Rande des Yellowstone-Parkes, schoß Elche, Büffel, Bergschafe, lebte monatelang in seinem Blockhause, niemand wußte, wie, tauchte ab und zu in einem der größeren Flecken des Westens auf, um sich neu auszustaffieren, Munition und Konserven einzukaufen, und verschwand dann wieder. Er wurde von den Strolchen gefürchtet, denn er hatte der öffentlichen Sicherheit schon manche Dienste geleistet und mehreren gefährlichen Halunken für immer das Handwerk gelegt. Den bei weitem größten Teil des Jahres verbrachte Dutch Bill in der Einsamkeit. Er hatte seine Muttersprache beinahe verlernt und sprach einen nicht leicht verständlichen Mischmasch. Nach einer Viertelstunde erhob er sich.
»Also, es bleibt dabei,« sagte er zu Georg, dem er die Hand reichte. »In einer Stunde bin ich wieder hier. Ich hole den Gaul für dich, den ich bei Everet eingestellt habe, und du sorge für gute Waffen; für das andere sorge ich schon.«
Der Wirt lamentierte freilich, sprach von Treubruch und Undankbarkeit, aber Georg blieb hartherzig. Er verzichtete auf den Dollar, das Honorar für den letzten Tag seiner musikalischen Leistungen, und an demselben Abend sah man in der Dämmerung zwei Reiter mit vorgebeugtem Leibe aus Helena in der Richtung auf die Berge traben: den hageren Abenteurer und Georg Lützen.

Sie waren gute Freunde geworden, Dutch Bill und der blonde »German George«, wie die Leute von Helena den früheren Leutnant getauft hatten, seitdem sich die beiden gefunden und zu abenteuerlicher Brüderschaft verbunden hatten. Seit Monaten hausten sie nun zusammen, und es war ihnen gut gegangen. Die Sozietät war gleich unter glücklichen Bedingungen in Tätigkeit getreten.
Schon in der Nacht, welche ihrer ersten Begegnung in der Schenke zu Helena folgte, hatten sie die Spuren der Wegelagerer, die die Postkutsche ausgeraubt, entdeckt, im Frühlicht des nächsten Morgens zwei derselben im Schlafe überrumpelt, auf den gestohlenen Pferden geknebelt, in die Stadt getrieben und den Behörden ausgeliefert. Der Dritte war ihnen entwischt. Die ausgesetzte Prämie hatten sie brüderlich geteilt, und das war die Grundlage ihres Wohlstandes geworden.
Georg hatte sich neu equipiert, er hatte sich einen bessern Revolver, eine gute Doppelflinte, reichliche Munition, warme Kleidung und wollene Decken für den Winter, der, wie man ihm gesagt hatte, ein bißchen streng sein sollte, angeschafft und seinem Freunde Dutch Bill auf den Mustang, den dieser ihm überlassen hatte, eine Abschlagszahlung geleistet. Dann hatten die beiden glücklich gejagt, hatten noch eine der selten gewordenen Büffelherden angetroffen und nahezu vernichtet, viel prächtiges Hochwild erlegt und die reichliche Jagdbeute gut verwertet. Nun war der Mustang längst bezahlt, in Bills Blockhaus lag in gutem Versteck reichlicher Vorrat an Konserven, und in der rechten Hüftentasche seiner Lederhose, unter dem Revolver, hatte Georg jetzt eine größere Barschaft geborgen, als er bei seiner Landung auf amerikanischem Boden besessen hatte. Es waren auch noch beträchtliche Nebenverdienste hinzugekommen. Die beiden hatten bei einer geologischen Expedition der Geysererforschungen Dienste geleistet und waren mit den Wissenschaftlern als Führer in den Yellowstonepark vorgedrungen.
In allen größeren und kleineren Niederlassungen von Montana, in dem benachbarten Idaho und Wyoming sprach man mit Achtung von German George, dem Genossen des allbekannten Dutch Bill.
Aber die Erfolge, deren Georg sich erfreute, waren nicht wohlfeil gewesen. Vom Yellowstonepark waren die beiden südlich nach Wyoming vorgegangen. Sie hatten die Absicht, in der Nähe der großen Verkehrsstraße der Pazifikbahn die kältesten Wochen zu verbringen; aber der Winter überfiel sie plötzlich, und wahrhaft erschreckliche Schneestürme hemmten ihren Weg. Und was für ein Winter! Georg hatte sich bisher in seiner kühnsten Phantasie keine Vorstellung machen können, was in Wahrheit rauhe Witterung ist; jetzt sollte er es erfahren. Hunger und Durst, Nässe und Frost hatte er ertragen, und mehr als einmal war sein Leben im Schneesturm in Gefahr gewesen.
Was hatte er erdulden müssen! Über zwei Tage war er auf den verwehten Pfaden herumgeirrt, bei eisiger Kälte, ohne einen Bissen zu sich zu nehmen und ohne die Höhle wiederfinden zu können, in der sie die Pferde in Sicherheit gebracht und ein Lager hergerichtet hatten. Vergeblich hatte Bill nach ihm gesucht; er hatte den Freund schon verloren geglaubt, bis diesen die Rauchsäule des Feuers, das Bill entzündet hatte, endlich nach vierundfünfzig Stunden wieder auf die gute Fährte brachte. Die Kälte, der Hunger, die Ermattung hatten Georg wie blödsinnig gemacht. Er konnte sich nicht einmal mehr freuen. Als er den hageren Bill erblickte, brach er wie leblos zusammen, und dieser mußte ihn mit seinen knochigen Armen auf die Schulter packen und ihn in die Hütte tragen, wo sich die erstarrten Glieder endlich lösten. Bill pflegte den Freund, der vierzehn Tage auf dem Tode lag, mit rührender Treue, und er kurierte ihn gründlich ohne Anwendung einer andern Medizin als der wollenen Decken und des durchaus nicht in homöopathischen Dosen verabreichten Brandys. Georg erholte sich dann mit wunderbarer Elastizität, und als der Gesundete seinem Arzte dankbar die Hand drückte, sah ihn dieser verwundert an und begriff gar nicht, was er damit sagen wollte. Die beiden sprachen überhaupt sehr wenig miteinander. Dutch Bills entsetzlicher sprachlicher Mischmasch war zu einer eleganten Unterhaltung über Fragen subtilerer Natur in der Tat nicht recht angetan, und sobald Georg irgend etwas sagte, was über das Allereinfachste, Allerfaßlichste hinausging, sah ihn Dutch Bill verwundert an und verstand ihn nicht. Er hatte eben nur noch Fühlung mit den Grundbegriffen.

So kam es, daß die beiden tagelang im besten Einvernehmen nebeneinander einhergingen, ihre Mahlzeiten zusammen nahmen, zusammen jagten, zusammen hausten, ohne daß sie eine Silbe wechselten. Es fiel ihnen nicht auf. Dutch Bill dachte nicht einmal darüber nach. Er lebte eigentlich nur mit den Augen. Beobachtend und findig schweifte sein Blick überall umher, nichts entging ihm. Wenn zwei Steine in der verwichenen Nacht eine andere Lage zueinander angenommen hatten, so merkte er es und machte mit einem Rippenstoß Georg darauf aufmerksam; aber er empfand nicht das geringste Bedürfnis, irgend eine seiner Beobachtungen und Wahrnehmungen in Worten auszudrücken, sie genügten ihm eben als Hinweise und Belehrungen. Über sich selbst nachzudenken, über seine Vergangenheit, seine Gegenwart und Zukunft zu grübeln, hatte er längst verlernt. Überhaupt war seine menschliche Empfindungsfähigkeit eine sehr verminderte geworden. Georg war ihm ein angenehmer Kumpan, aber eine tiefere Neigung vermochte er nicht für ihn zu empfinden. Er hatte ihn ohne besondere Freude zu sich gesellt und würde ihn ohne besonderen Schmerz von sich haben ziehen sehen.
Diesem Stammgast der Wildnis gegenüber war Georg noch ein schüchterner Novize. Georg beschäftigte sich noch viel mit sich, und wenn er auch in den letzten Monaten eine sehr starke Wandlung durchgemacht hatte, so legte er sich wenigstens doch Rechenschaft davon ab. Er erstaunte darüber, wie wenig Sentimentalität er jetzt besaß. Er war früher ziemlich weich und allen Eindrücken leicht zugänglich gewesen. Mit inniger Liebe hatte er an den Seinigen gehangen, gute treue Kameraden, denen er herzlich ergeben war, gehabt, und flüchtige Liebschaften hatten ihn viel mehr beschäftigt, als es richtig war. Und nun, noch nicht ein Jahr von der Heimat entfernt, mußte er sich gestehen, daß er ohne Wehmut an seine Blutsverwandten denken konnte. Er mußte wahrhafte Anstrengungen machen, um sich den Kreis, in dem er bisher verkehrt hatte, wieder zu vergegenwärtigen. Alle die lebensvollen Gestalten, die sich bis vor dem entscheidenden Tage an ihn gedrängt hatten, und deren warmen Hauch er in jedem Augenblicke seines Daseins verspürt hatte, waren wesenlos zerstoben und flatterten schattenhaft vor seiner Erinnerung – er konnte sie nicht mehr greifen. Er schüttelte den Kopf bei dem Gedanken, wie ein Wort, das dieser oder jener damals gesprochen hatte, oder gesprochen haben sollte, ihn erregt habe; war jenes Wort wirklich gesagt – was schadete es, was nützte es? Es war ja ganz gleichgültig! Er erinnerte sich, welche Geringfügigkeiten sein Blut in Wallung gebracht, er fragte sich, ob es denn wirklich wahr sei, daß er sich schwer geärgert hatte, als eines Tages in irgend einer Zeitung eine boshafte Notiz über eine kleine Tänzerin, der er den Hof machte, gestanden hatte; ob es denn denkbar sei, daß er sich damals wirklich mit der Absicht habe tragen können, den Redakteur aufzusuchen und zur Verantwortung zu ziehen. Er hatte eine unruhige Nacht verbracht und war tagelang verstimmt gewesen; und jetzt – es waren noch nicht zwei Jahre darüber vergangen – jetzt wußte er nicht einmal mehr, was in der Zeitung gestanden, was ihn damals so schwer verdrossen, ja gekränkt hatte! Er dachte daran, wie er seinem Schneider den letzten Überrock vor die Füße geworfen, weil nach dreimaligem Anproben die Falte am Einsatz des Ärmels nicht beseitigt worden war. Nun betrachtete er seine Joppe aus geripptem Halbsammet. Er wußte nicht zu sagen, ob sie gut saß oder nicht, sie behagte ihm, ein Weiteres verlangte er nicht. Es fiel ihm nun auch ein, daß er sich seit einem halben Jahre ohne Spiegel beholfen hatte, und er freute sich, daß er auch ohne Spiegel ganz gut fertig geworden war. Er betrachtete die wundervollen Höhenzüge des Felsengebirges, und all' der menschliche Kleinkram der Kultur erschien ihm unglaublich geringwertig.
Wenn er mit diesen Wahrnehmungen aber auch zufrieden war, so flößten sie ihm doch auch ernsthafte Besorgnis ein. In dem Gefährten, mit dem er nun seit Monaten zusammen war, hatte er ein warnendes Beispiel der menschlichen Verwilderung vor Augen. Er gestand sich, daß er auf dem besten Wege war, wie dieser sich völlig loszulösen von der Gemeinsamkeit mit der Kultur und in Gesellschaftslosigkeit zu verkümmern. Wie eine ernste Mahnung klang das alte Bibelwort ihm in die Ohren: »Es ist nicht gut, daß der Mensch allein sei.«
Die Tage waren milder geworden, und mit der lauen Witterung war auch eine gewisse Weichheit in Georgs Seele eingezogen. Die beiden hofften, in wenigen Tagen Cheyenne zu erreichen, um dort ihre reiche Winterbeute, Felle und Geweihe zu verkaufen und die nötigen Einkäufe für die nächste Zeit zu machen. Dann wollten sie wieder nördlich ziehen, denn Dutch Bill hatte einen unüberwindlichen Abscheu vor den südlicheren Regionen.
»Der Süden bekommt mir nicht«, pflegte er zu sagen.
Georg dagegen hatte an den Winter in den Felsengebirgen eine keineswegs angenehme Erinnerung bewahrt, und seine Sinne waren für die leuchtende Färbung und die erwärmende Kraft des riesigen Feuerballes, der gewaltig und großartig von dem hohen blauen Himmel herabstrahlte, besonders empfänglich. Er vermochte sich mit dem Gedanken, mit Dutch Bill wieder gen Norden zu ziehen, gar nicht recht vertraut zu machen.
Nachdem sie in Cheyenne ihre Geschäfte erledigt hatten, saßen sie eines Abends wortkarg wie immer, in einer Schenke einander gegenüber, während wieder eine alte abgesungene aufgeschwemmte Französin in abgetragener Sammetrobe, mit strohgelber Perücke und fürchterlich geschminkt, ihre Lieder vortrug.
»Von Cheyenne nach Denver kann's nicht weit sein?« fragte Georg, während er Bill die brennende Zigarre aus den Fingern nahm und seine daran anzündete.
Bill schüttelte den Kopf.
»Gibt's von hier nach Denver Bahnverbindung?« fragte Georg weiter.
Bill steckte die Zigarre, die ihm Georg zurückgegeben hatte, in den Mund und nickte bejahend.
»Dann geh' ich nach Denver.«
»Wann?«
»Wann kommst du wieder?«
»Das weiß ich noch nicht.«
»Was willst du dort tun?«
»Ich erwarte Briefe.«
»So!« schloß Bill die Unterhaltung.
Georg hatte in der Tat schon vor Monaten, in den trübsten Tagen, von Helena aus die Post-Office in New York aufgefordert, alle unter seinem Namen eintreffenden Sendungen, und an das Hotel Brunswick geschrieben, seine beiden Koffer nach Denver an die Adresse von Augustus W. Jefferson zu schicken.
Die beiden blieben bis spät in der Nacht wach. Sie sprachen noch von diesem und jenem, aber von der bevorstehenden Trennung war nicht mehr die Rede. Nur nebenbei fragte Georg seinen Freund, ob er ihm das Pferd wieder abkaufen wolle, und Bill nickte wiederum. Über den Preis einigten sie sich leicht, und Bill zahlte die Summe bar aus.
Am andern Morgen brachte Bill seinen Freund auf die Bahn, auf die »gottverdammte Bahn«, wie er nie zu sagen versäumte, wenn sich ihm die Gelegenheit darbot, von den neuen Schienenwegen zu sprechen.
Sie sprachen wenig vor dem Abschiede.
»Wir sind gute Freunde gewesen,« sagte Georg.
»Das sind wir,« versetzte Bill.
»Und wir wollen es bleiben.«
»Und wir werden uns wiedersehen?«
»Ich hoffe so.«
»Du solltest mitkommen nach Denver.«
Bill schüttelte den Kopf.
»Der Süden bekommt mir nicht. – Du findest mich immer da oben, in der Gegend von Helena, Virginia City und Bozeman.«
Bill hielt Georgs Hände fest. Der Zug setzte sich in Bewegung. Bill schüttelte noch immer die Hand des Gefährten. Mit einem starken Druck befreite sich endlich Georg, lief dem Zuge nach und sprang auf das Trittbrett der Plattform. Von da grüßte er noch einmal den Freund, der gleichfalls zum Gruße die Rechte erhob und sich dann langsam abwandte.
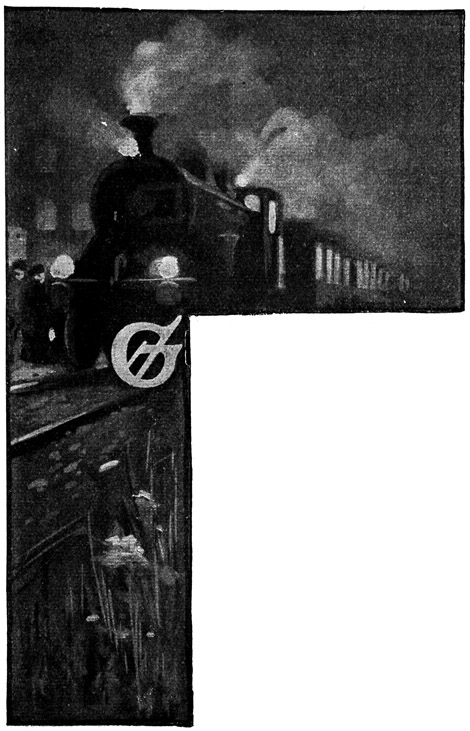
Georg, der zu vorgerückter Abendstunde in Denver eingetroffen und im ersten Hotel abgestiegen war, hatte eine schlechte Nacht verbracht. Das Bett war ihm zu gut gewesen, und tausend wirre Gedanken waren auf ihn eingestürmt und hatten ihn nicht recht zur Ruhe kommen lassen. Mit schwerem Kopf war er zur frühen Stunde aus unerquicklichem Halbschlafe erwacht, hatte sein Bad genommen und sich langsam angekleidet.
Heute zum erstenmal wieder nach langen Monaten musterte er seine Kleider, die er bisher nur auf die Dauerhaftigkeit geprüft hatte, auf ihre gefällige Wirkung hin. Er kam sich nun auf einmal wie ein Strauchdieb vor. Er sagte sich, daß er in diesem Aufzuge, mit seiner grauen Joppe aus Corduroy, mit dem dunkelblauen Wollenhemd, den hohen Stiefeln und dem breitkrempigen Schlapphut unmöglich vor Mr. Jefferson und dessen Damen erscheinen könne. Der Gedanke, daß er zum erstenmal wieder mit Leuten, die ihn nur als verwöhnten Kulturmenschen, der sein Äußeres mit großer Sorgfalt gepflegt hatte, kennen gelernt, zusammentreffen würde, machte ihn ganz befangen. Er betrachtete sich lange und sehr aufmerksam im Spiegel, und er war beinahe erschrocken über die Veränderung, die mit ihm vorgegangen war. Er war in dem einen Jahre um zehn Jahre älter geworden. Seine verwitterte Haut und der Vollbart hatten ihn gänzlich verändert. Er legte die beiden Hände auf den Tisch, spreizte die Finger und sah sie mit ungewohnter Aufmerksamkeit an wie etwas Fremdes, und während er unausgesetzt den Blick auf die breit und rauh gewordenen Handrücken heftete, atmete er schwer und beklommen und dachte an alle die Erregungen, die der bevorstehende Tag noch bringen sollte: die ersten Nachrichten aus der Heimat, seit einem langen, an Ereignissen überreichen Jahre die ersten!
Noch nie war der Gedanke an die Heimat mit einer solchen Macht über ihn gekommen, nie das sehnsüchtige Verlangen, die Daheimgebliebenen einmal wiederzusehen, stärker in ihm gewesen. Einen Augenblick fuhr es ihm durch den Kopf, ob er nicht am gescheitesten täte, wenn er als reuiger Sünder zu den Seinen zurückkehrte und sich drüben recht und schlecht wie jeder andre sein Brot zu verdienen suchte. Von dem, was man Standesvorurteile zu nennen pflegt, war nicht die Spur mehr in ihm zurückgeblieben. In der Beziehung hatte die amerikanische Luft, der Sommer in Montana und der Winter in den Rocky Mountains Wunder gewirkt. Es kam ihm gar nicht bei, daß ihm drüben im Vaterlande eine Arbeit irgendwelcher Art verdacht werden könnte. Er wußte nur nicht, was er beginnen sollte; er wollte nur nicht wiederum aufs Ungewisse um ein Drittel des Erdballs gehen.
Aber hier, was hatte er hier erreicht? Er war äußerlich und innerlich gealtert, seine Empfänglichkeit für alles, was das Leben verschönt, hatte sich in bedauerlicher Weise abgestumpft, er legte sich vollkommen Rechenschaft davon ab. Es war eben nur der Kampf um das Dasein, um das elende schale Dasein, den er aufzunehmen hatte, – nichts anderes! Und das Schlimmste war, daß er nicht einmal klagen durfte. Er hatte es ja tatsächlich weiter gebracht, wenn der erworbene Besitz als Maßstab angesehen werden durfte. Er besaß ja heute tatsächlich ein paar hundert Dollar mehr, als er am Tage seiner Abreise von Berlin in der Tasche hatte. Tausend andere durften ihn beneiden! Von den armen Teufeln, mit denen er an der Bahn gearbeitet, und unter denen sich doch auch so mancher befunden hatte, der an ein anderes Leben gewöhnt gewesen war, von den meisten, mit denen er in Helena und sonstwo zusammengetroffen war, hatte gewiß kaum einer so glänzende Erfolge erzielt. Gerade das war es, was ihn am meisten verstimmte. Er mußte mit diesem jämmerlichen Leben obenein noch zufrieden sein.
Noch immer starrte Georg auf die ausgespreizten Finger. Plötzlich glitt sein Blick auf eine dreieckige lederne Tasche, die neben seinem eleganten Wiener Portefeuille, dem einzigen Gegenstand, der aus der früheren Herrlichkeit stammte, vor ihm auf dem Tisch lag. Er beugte sich langsam nach vorn und griff danach, und er entnahm der Tasche seinen Revolver, den er lange und aufmerksam betrachtete. Er überzeugte sich, daß er scharf geladen war, hauchte den vernickelten Lauf an und putzte ihn mit dem Ärmel seiner Joppe spiegelblank, dann ließ er die Trommel spielen und stellte die Feder ein.
Er legte den Zeigefinger an den Hahn.
Ein Ruck, und alles wäre aus gewesen: alle trüben Gedanken, alle Beschwerden und alle Langweiligkeit dieses Daseins. Und wenn man ihn hier fände, kein Mensch würde seinetwegen trauern, kein Mensch würde auch nur wissen, wer der Selbstmörder ist. Den Seinigen daheim hatte er schon den tiefsten Kummer bereitet; für diese würde er einfach verschollen bleiben, wie er seit einem Jahre für sie verschollen gewesen war.
Niemals waren solche Gedanken in Georgs Hirn aufgestiegen, aber gerade ihre Neuheit reizte ihn, und es bereitete ihm ein wollüstiges Behagen, diese Bilder seiner Phantasie mit einer eigentümlichen Sauberkeit des Details auszumalen. Auf einmal sagte er halblaut vor sich hin:
»Dummes Zeug! – dazu hat man noch immer Zeit.«
Er schaltete wieder aus und schob den Revolver in die Ledertasche zurück.
Wenige Minuten darauf verließ er langsamen Schrittes das Zimmer, stieg in die Offize hinab und trat an die Bar. Er betrachtete den »Barkeeper«, der mit großer Geschicklichkeit den bestellten Mischtrank bereitete. Kein Zweifel: das war ein Landsmann! Die hohe viereckige Stirn, das schlichte blonde Haar und vor allem die sehr scharfe Brille für Kurzsichtige ließen sogleich auf einen Deutschen raten. Als ihm der Kellner das Glas vorsetzte, redete ihn Georg in deutscher Sprache an:
»Woher kommen Sie denn?«
»Aus der Stadt der reinen Vernunft,« versetzte der Kellner, »aus Königsberg.«
»Und wie sind Sie denn hierher, nach Kolorado verschlagen?«
»Du mein Gott«, antwortete der Kellner, » usus sum juventate mea, atque abusus! Ich habe als Student zu viel gebummelt. Ich bin schon drei Jahre in Amerika, habe es mit allem möglichen versucht, war Professor an einer Privatschule in Oregon, habe Kühe gemolken in Kalifornien, Kohlen geschippt in Kansas und bin nun seit über einem Jahre hier Barkeeper. Denver ist eine lustige Stadt, und es wird Ihnen hier gut gefallen, wenn Sie hier bleiben wollen.«
Der philologische Kellner konnte Georg auf alle Fragen Bescheid geben, denn er kannte Denver sehr genau. Er bezeichnete ihm den Laden, wo er am besten und billigsten einen neuen Menschen anziehen könne; er kannte sehr wohl den Namen des Mr. Jefferson und bezeichnete ihm die Lage des Hauses.
Georg traf nun sogleich umfassende Vorkehrungen zu seinem Besuch. Er ließ sich den Bart scheren, das Haar kürzen, er kleidete sich vollständig ein, und als er in der Mittagstunde mit diesen Vorbereitungen fertig war, kam er sich auf einmal wieder ganz menschlich vor. Ohne besondere Erwartungen, aber doch mit einer gewissen Spannung schlug er die bezeichnete Richtung ein und fand bald in einer der neuen Straßen das schöne, elegante, von einem parkartigen Garten umgebene Holzhaus des reichen und in Denver vielgenannten Mr. Jefferson.
Von dem Schwarzen wurde er durch ein geräumiges Gemach, das mit frostig steifer Eleganz sehr kostbar und geschmacklos möbliert war, auf die Veranda, die in den Garten hinabführte, geleitet.
Da ruhte auf einem Schaukelstuhl Mrs. Jefferson. Mit ihrer Rechten hielt sie einen zusammengeklappten Roman, in den sie den Zeigefinger gelegt hatte, um die Seite, auf der sie ihre Lektüre unterbrochen hatte, zu markieren. Sie lächelte milde und freundlich, und ihre gemütlichen, schläfrigen Augen blickten auf einen Moment hell auf.
»Aoh!« sagte sie verbindlich – »Mr. Lutzen!«
Sie legte den Roman bedächtig beiseite, erhob sich ohne Überstürzung von ihrem Schaukelstuhl, während Georg sich tief verneigte, und streckte ihm ihre rundliche, weiche, hübsche kleine Hand entgegen.
»Wir haben Sie schon lange erwartet,« fuhr sie fort, indem sie mit einer Handbewegung Georg einlud, neben ihr Platz zu nehmen, und sich wieder auf den Schaukelstuhl niederließ.
»Wie ist es Ihnen denn in der Zeit ergangen?«
Georg gab mit einigen nichtssagenden Worten Bescheid, erkundigte sich seinerseits nach dem Befinden der Familie und erfuhr, daß Mr. Jefferson unten in der Stadt in der Offize sei, aber jedenfalls zum Frühstück kommen werde, daß verschiedene Briefe für ihn angekommen seien, und daß Noëmi über die Einförmigkeit des Lebens in Denver Klage führe. Im übrigen sei alles in bestem Zustande.
Sie hatten kaum zehn Minuten miteinander gesprochen, als ein leichter Wagen vor der Gartentür hielt und Mr. Jefferson sich zu den beiden gesellte. Er war ebenfalls freundlich, aber auch nichts weiter. Er zeigte nicht die geringste Überraschung, Georg bei sich zu sehen, und wunderte sich auch nicht darüber, daß er nicht früher gekommen war und nichts hatte von sich hören lassen. Georg hatte nicht die geringste Berechtigung, etwas anderes als diese Aufnahme zu erwarten, aber sie erschien ihm doch in ihrer Stimmungslosigkeit merkwürdig öde, und er war auch vollkommen enttäuscht über die Art und Weise, wie Noëmi, die nun auch herbeigerufen war, ihn bewillkommnete. Sie sagte genau dasselbe, was ihre Mutter gesagt hatte:
»Aoh! Mr. Lutzen – freue mich sehr.«
Sie reichte ihm ebenfalls die Hand und tat ebenfalls nichts, was auf eine besonders freudige Überraschung hingewiesen hätte. Das Frühstück war recht langweilig. Georg bemerkte, daß ihm die Gabe, die er früher in hohem Maße besessen hatte: von allen möglichen gleichgültigen Dingen mit Wärme oder erheucheltem Interesse zu sprechen, vollständig abhanden gekommen war. Er wußte nicht recht, was er sagen sollte. Er erzählte auf Befragen von seinem Leben in den Rocky Mountains. Jefferson kannte das längst und fand das alles vollkommen in der Ordnung. Mrs. Jefferson aß sehr viel und lächelte, und Noëmi war sichtlich befangen. Georg verheimlichte sich nicht, daß sie die starke Wandlung, die er durchgemacht, sehr wohl wahrgenommen, und daß sie davon einen nicht angenehmen Eindruck empfangen hatte. Nach dem Frühstück sagte Jefferson zu Georg:
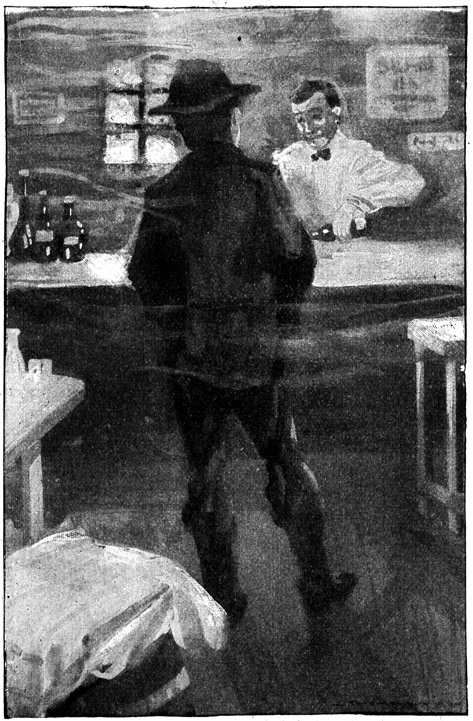
»Sie begleiten mich wohl nach meiner Offize? Es liegen für Sie verschiedene Briefe da, und ich habe auch Geschäftliches mit Ihnen zu besprechen. Wie lange wollen Sie überhaupt in Denver bleiben?«
»Nur ganz kurze Zeit,« entgegnete Georg.
»Nun, dann werden wir vielleicht ein Geschäft zusammen machen können. Also, wenn es Ihnen recht ist, dann kommen Sie!«
Schon auf dem Wege durch die sandigen Straßen von Denver, vom Wohnhause bis in die mittlere Geschäftsstadt, wo das Bureau des Mr. Jefferson lag, teilte ihm dieser in wenigen Zügen seine Absichten mit. Aber Georg hörte kaum darauf. Er war verstimmt, er fühlte etwas Unbehagliches, Kaltes in sich. Er kam sich lächerlich vor, daß er sich selbst gegenüber vorher soviel Wesens von dem Wiedersehen gemacht hatte, das nun so unendlich nüchtern verlaufen war. Und dann erfaßte ihn eine jähe Ungeduld, die Briefe, die seit Wochen und Monaten für ihn in Denver lagen, endlich in Empfang zu nehmen. Er entschuldigte sich mit einigen Worten, daß er jetzt nicht die nötige Aufmerksamkeit besitze, um sich auf geschäftliche Unterredungen einzulassen, und bat um die Erlaubnis, mit Herrn Jefferson im Laufe des Nachmittags das Geschäftliche eingehender zu besprechen. Jefferson fand das ganz natürlich, wie er überhaupt alles natürlich fand. Er führte ihn in das kleine Privatkabinett, in dem er allein zu arbeiten pflegte, öffnete den Geldschrank, entnahm diesem einen Stoß Briefe, die er schweigsam vor Georg hinlegte, schloß den Geldschrank wieder zu und ließ Georg allein.
Mit wahrer Rührung durchmusterte Georg die Aufschriften der verschiedenen Briefe. Sein Herz klopfte stark, und er zitterte vor innerer Erregung. Es traten ihm die Tränen in die Augen, als er das große Kuvert mit dem großen Siegel und der mit militärischer Deutlichkeit geschriebenen Adresse öffnete: den Brief seines Oheims. Kein Wort des Vorwurfes war in dem herzlichen Briefe enthalten, nur tiefes wahres Bedauern um das Geschehene, nur der Ausdruck der Hoffnung, daß alles wieder gut werden würde. Der General hatte alles geregelt. Georg hatte den ehrenvollen Abschied aus der Armee erhalten.
Georg las den Brief langsam, beinahe andächtig, und seine Augen feuchteten sich. Er stemmte die Ellenbogen auf den Tisch, er drückte die Stirn mit beiden Händen und blickte unverwandt auf die großen Schriftzüge des edlen Mannes, dem er so tiefen Schmerz bereitet hatte. Und die Schrift verschwamm vor seinen Augen, und der große starke Mensch zuckte konvulsivisch, weinte und schluchzte bitterlich. Seit Jahren hatte er nicht geweint, es war ihm wie eine Erlösung. Mit tiefen Atemzügen faltete er das Schreiben zusammen und steckte es zu sich.
In drei großen Umschlägen, die eine Bureauhand mit der New Yorker Adresse versehen hatte, befanden sich allerlei Briefe, die nach seiner Abreise angekommen und seiner Weisung gemäß an den Justizrat Quintus eingehändigt und von diesem weiter befördert waren, lauter antiquierte Dinge, Einladungen, Vorwürfe über zu langes Schweigen, Bitten um kleine Gefälligkeiten und dergleichen. Georg hatte das schnell erledigt. Mit einer gewissen Zaghaftigkeit öffnete er aber den letzten großen Brief, der »Eingeschrieben« war und den Stempel des Justizrats Felix Quintus trug. Der Inhalt des Briefes befriedigte ihn jedoch vollkommen. Der Justizrat hatte alles mit freundschaftlicher Genauigkeit erledigt, alles war geordnet, Georgs Mobiliar und sonstiges Besitztum war dem General übergeben worden, und die Liquidation hatte einen Überschuß von viertausend und einigen hundert Mark ergeben. Der Justizrat fügte seinem Schreiben einen Wechsel auf ein New Yorker Haus im Betrage von viertausend Mark bei und stellte Georg den geringfügigen Rest zur Verfügung.
»Somit wäre das Geschäftliche zu aller Zufriedenheit geordnet,« schloß der Justizrat seinen Brief. »Und nun lassen Sie mich noch hinzufügen, lieber Lützen, wie aufrichtig und allgemein das Bedauern über Ihr Verschwinden aus unserem Kreise ist. Sie sind ein merkwürdiger Mensch und imponieren mir wirklich. Daß Sie nicht auf den Gedanken gekommen sind, es noch ein letztes Mal am grünen Tisch zu versuchen, ist geradezu stupend, aber Sie werden wohl recht gehabt haben. Sie zählen hier viele Freunde, und Sie haben keinen Einzigen verloren, während wir alle um den einen zu trauern haben. Hoffentlich ist es Ihnen gut ergangen, und hoffentlich geht es Ihnen auch in Zukunft gut. Kommen Sie nur bald wieder! Was wollen Sie da drüben? Da vegetiert man, hier lebt man. Die kleinen Geschichten, die ich Ihnen etwa erzählen könnte, werden für Sie kaum noch ein Interesse haben; nur Eines wird Ihnen Spaß machen: Ihr Fuchs Cassagnac, den Sie an den Prinzen Strusa verkauft hatten, hat sich glänzend bewährt, hier und in Baden ist er zweimal als Erster angekommen.
»Und beinahe hätte ich's vergessen! Wie kommen Sie denn auf den sonderbaren Gedanken, mich mit Frau Kathi Bewer zu verloben? Ich weiß, daß dies törichte Gerücht einige Zeit hier verbreitet worden ist, aber es ist kein wahres Wort an der Sache. Ich bin einstweilen noch immer der alte eingefleischte Junggeselle von früher und werde es wohl bleiben. Aber man soll nichts verschwören. Auf eins aber kann ich doch einen Eid ablegen: daß, wenn ich mich jemals verheiraten sollte, die nette kleine Frau Kathi gewiß nicht die Auserwählte sein würde. Ich komme jetzt selten in ihren Salon. Es hat sich da eine Gesellschaft von kleinen Komödianten zusammengefunden, die mir als gewöhnlicher Umgang doch nicht recht behagt. Da ist namentlich ein Heldenspieler aus dem Belle-Alliance-Theater, ein gewisser Specht, der da das große Wort führt und mit einer Autorität auftritt, die mich einigermaßen besorgt machen würde, wenn ich tiefere Gefühle für die kleine Bewer empfände. Das verhindert übrigens nicht, daß ich die kleine Frau immer noch sehr gern habe und mich immer freue, wenn ich ihr im Tiergarten begegne, in dem sie in Begleitung Ihres großen Pluto, der wie ein Toller um sie herumspringt, immer einiges Aufsehen erregt.
Und nun Gott befohlen, lieber Lützen! Geben Sie uns recht bald Nachricht, Sie werden uns alle herzlich dadurch erfreuen, besonders aber
Ihren treu ergebenen
Felix Quintus.«
Die ungewohnte Rührung, die Georg befallen hatte, als er die Briefe aus der Heimat zur Hand nahm, war zwar längst gewichen, aber er war doch noch immer tief bewegt und fühlte sich völlig außerstande, sich jetzt mit dem langweiligen Jefferson hinzusetzen und » business« zu sprechen. Er hörte, während er las, die Stimme der Schreiber, und es war ihm ein so ganz anderer Klang, als er ihn vernommen hatte, seit er auf amerikanischem Boden war. Es war so eine ganz andere Sprache! Er fühlte sich nie deutscher als in diesem Augenblick. Er hatte auf einmal die vollste Empfänglichkeit für tausend Kleinigkeiten, die ihm in seinem früheren Leben als selbstverständliche niemals aufgefallen waren. Er fühlte eine Wärme und Zärtlichkeit für seine Verwandten und Freunde in Deutschland, wie er sie bisher nie empfunden zu haben glaubte. Es kam ihm hier alles so nüchtern, so kalt, so spröde und brüchig vor. Er taugte gewiß nicht hierher!
Nur noch eine kurze Prüfungszeit, vielleicht auf ein Jahr oder zwei! Vielleicht lächelte ihm das Glück. Ein kleines Kapital, das ihm jetzt groß genug erschien, hatte er ja aus dem Schiffbruch gerettet, ein weniges hatte er hinzuerworben. Sein Ehrgeiz war ja nicht, als »gemachter Mann« die Rückreise anzutreten! Wenn er nur hier genug verdient haben würde, um es bei schmalem Leben in Deutschland ein paar Jahre mitansehen zu können, um die Möglichkeit der Begründung einer neuen Existenz zu gewinnen, dann – ja an demselben Tage zurück in die Heimat!
Das war sein Programm, und er fühlte sich nun auf einmal merkwürdig ermutigt und gefestigt. Er sagte Mr. Jefferson, daß er sehr wichtige Briefe empfangen habe, die er sogleich zu erledigen wünsche, und daß er deshalb erst morgen mit ihm in Verhandlung über das angedeutete Geschäft treten werde. Auch damit war Mr. Jefferson einverstanden. Eine Einladung zum Diner lehnte Georg dankend ab, da er wahrscheinlich bis zum späten Abend zu schreiben haben werde. Mr. Jefferson fand das ganz natürlich und bat ihn, am folgenden Morgen auf das Kontor zu kommen. Georg schrieb stundenlang. Er erstattete seinem Oheim genauen Bericht über alles, was ihm begegnet. Er schilderte alles im rosigsten Lichte und schloß damit, daß er auf dem besten Wege sei, sich ein kleines Vermögen zu erwerben, und daß er dann heimkehren werde, um als biederer Landwirt in der Heimat sein Dasein zu beschließen. Ebenso vergnügt und noch vergnügter schrieb er an Quintus, und er fühlte sich trotz der sehr anstrengenden und ihm ganz ungewohnten Arbeit des stundenlangen Schreibens frischer und heiterer denn je, als er gegen acht Uhr abends mit dem philologischen Kellner zu Nacht speiste und dann mit diesem den bewegten Tag in der üblichen Singspielhalle beschloß.
Über den Ozean waren die Stimmen der Seinigen zu ihm gedrungen, und den Hauch der heimatlichen Kultur hatte er wieder verspürt.

Jefferson und Georg saßen seit einer Stunde in dem kleinen Kabinett, das neben dem Kontor lag, und in dem Georg gestern seine Briefe gelesen hatte. Über den Tisch war eine Spezialkarte des südlicheren Gebietes der Nordstaaten gebreitet, auf der ein mit Blaustift gezogener Strich von der Westgrenze Neu-Mexikos, etwa von Koolidge nach Kalifornien reichte, und verschiedene Namen von Städten blau unterstrichen waren. Daneben lagen allerlei Geschäftspapiere. Die Verhandlungen schienen sehr ernsthafte gewesen zu sein. Der kleine Mr. Jefferson schob seiner Gewohnheit gemäß den Unterkiefer vor, klemmte die glattrasierte Oberlippe ein und streichelte das bärtige Kinn. Georg blickte fast düster vor sich hin.
»Also fassen wir die Sache zusammen,« sagte Jefferson nach einer kleinen Pause, »und kommen wir dann zum Schluß. Daß Sie von dem Geschäfte noch nicht viel verstehen, hat nichts auf sich. Ein jeder muß anfangen, und es handelt sich nur um einen ehrlichen, schneidigen und gewandten Mann. Sie konnten nicht zu besserer Stunde hier eintreffen, Sie kommen wie gerufen. Die ganze Herde ist jetzt bei Koolidge zusammengetrieben, Rinder und Pferde. Das Vieh ist gestempelt, es können also Schwierigkeiten wegen der Eigentumsansprüche nicht entstehen. Die Tiere sind in gutem Zustande. Die Treiber, die ich dabei habe, sind zuverlässige, eingearbeitete Leute, die ihre Schuldigkeit tun, wenn Sie sich bei ihnen in Respekt zu setzen wissen. Besonders empfehle ich Ihnen einen prächtigen Burschen, einen Jungen von sechzehn bis siebzehn Jahren, indianisches Halbblut, Little Dog nennen ihn die Leute, der von klein auf bei meinem Vieh ist, – ein geriebener Bursche, der ganz genau Bescheid weiß, und den Sie mit einem freundlichen Worte und einem Glas Brandy dahin bringen können, daß er für Sie durchs Wasser und Feuer geht. Er gehorcht Ihnen wie ein Hund, wenn er weiß, daß ich Sie geschickt habe. Von meinem Agenten habe ich sichere Nachricht, daß Hul Witling, der unerschrockenste Kerl in ganz Neu-Mexiko, der seit fünf Jahren als berittener Hirt in meinen Diensten steht, und es durch seine Brauchbarkeit weit bei mir gebracht hatte, ein gottverlassener Schurke ist und mein Vertrauen schnöde mißbraucht hat. Seine Behauptungen, daß ihm die Indianer so und so viel Stücke gestohlen hätten, daß andere versprengt und gefallen seien, – alles Lug und Trug! Um einen Schleuderpreis hat der Halunke das schöne Vieh verkauft und den Ertrag in den Spielhöllen versoffen, verspielt, verpraßt. Ich wollte dieser Tage selbst nach Koolidge hinuntergehen und den pflichtvergessenen Lump zum Teufel jagen. Nun sollen Sie also mein Vertreter sein! Das Geschäft ist so gut wie abgeschlossen. Sie werden in Koolidge selbst und in den benachbarten Städten, Winslow und Preskott, die ganze Rinderherde losschlagen können. Der Schlingel, der Hul Witling hätte da noch mühelos ein hübsches Stück Geld verdienen können. Aber ich traue ihm nicht mehr. Sie sollen die Sache abschließen! Für die Pferde sind die Konjunkturen in Arizona und Kalifornien jetzt besonders günstige. Da ist jetzt Zuzug von Ansiedlern, da ist Bedarf! Hier,« schloß Jefferson, indem er mit der Handfläche auf die vor ihm ausgebreiteten Geschäftspapiere schlug, »sind die genauen Aufstellungen: so und so viel Stücke Rinder, Jungvieh und Pferde im Werte von so und so viel! Und das sind sie unter Brüdern wert. Gehen Sie nun nach Koolidge! Ich erteile Ihnen die Vollmacht, Hul Witling beim Kragen zu fassen und zum Henker zu schicken, und stelle Sie mit unbeschränkten Befugnissen an die Spitze des Geschäfts. Wenn Sie Glück haben, können Sie noch höhere Preise herausschlagen, als sie bis jetzt von den Händlern mir geboten sind. Das Nähere läßt sich von hier aus nicht übersehen. An Ort und Stelle müssen Sie entscheiden, was zu tun ist. Sie wissen, was ich haben will und haben muß; wenn von jedem Stück nur eine Kleinigkeit mehr auf Sie kommt, – die Masse bringt's! Und Sie haben ja selbst noch etwas Geld?«
»Wenig,« antwortete Georg, »alles in allem etwa fünfzehnhundert bis achtzehnhundert Dollars.«
»Es ist immerhin etwas. Nun mache ich Ihnen noch den Vorschlag, schießen Sie Ihr kleines Kapital in das Geschäft ein; ich beteilige Sie dann nach Maßgabe Ihres Einschusses an dem Nettogewinst. Sie dürfen mir vertrauen! Ich habe eine glückliche Hand, und es müßte sonderbar zugehen, wenn Sie nicht Ihre dreißig bis vierzig Prozent dabei verdienen sollten. Das macht freilich nur ein paar hundert Dollars, aber die haben auch ihre Bedeutung; wenn Sie aber einigermaßen Glück mit dem Verkauf des Viehes haben, können Sie eine ganz ansehnliche Summe verdienen.«
Er machte wiederum eine kleine Pause.
»Die Sache scheint Ihnen nicht völlig einzuleuchten,« sagte er dann.
»Doch,« versetzte Georg. »Sie eröffnen mir sogar allzu glänzende Aussichten, und ich frage mich: womit habe ich das Vertrauen, das Sie mir entgegenbringen, verdient?«
»Das brauchen Sie sich nicht zu fragen. Lassen Sie das meine Sorge sein. Ich habe schon mit Hunderten und Tausenden von Menschen zu tun gehabt, und nur einer hat mich hintergangen: Hul Witling. In Ihnen täusche ich mich nicht.«
Georg reichte Mr. Jefferson die Hand.
»Dann wäre also die Sache abgemacht!« sagte dieser.
»Abgemacht,« versetzte Georg, indem er die kleine fleischlose Hand seines neuen Geschäftsfreundes drückte.
»Und nun wollen wir frühstücken,« sagte Jefferson, indem er sich erhob, »und auf gutes Gelingen anstoßen.«
Die beiden bestiegen den kleinen Buggy, der vor dem Hause hielt. Jefferson nahm die Zügel, und zehn Minuten darauf hielt der Wagen vor der Gartentür. Mrs. Jefferson lag wieder im Schaukelstuhl, Noëmi saß neben ihr. Die beiden Damen lasen. Beide begrüßten ihren Gast wie gestern mit derselben gelangweilten Freundlichkeit und artigen Nüchternheit, und Georg empfing von dem Jeffersonschen Hause wiederum den Eindruck jenes öden Komforts und genußlosen Reichtums, der ihn gestern so verstimmt hatte. Der Königsberger Philologe hatte ihm mitgeteilt, daß Augustus W. Jefferson auf fünf bis sechs Millionen Dollars geschätzt werde. Was hatte der stille, in sich gekehrte, arbeitsame kleine Mann mit den klugen kalten Augen von seinem Gelde? – Ziffern und Zahlen und eine ruhige reizlose Häuslichkeit! Und diese anmutige Frau, die ihr Dasein in einem Halbschlummer bei einem mittelmäßigen Roman auf dem Schaukelstuhl, mit einem Plaid bedeckt, verduselte! Die sich und andern so viel Freude hätte bereiten können! Und dies arme hübsche, blühende junge Mädchen mit den großen blauen, dunkeln Augen, das in der erstickenden Luft dieser freudeleeren Umgebung in seiner Lebensblüte verkümmerte und darauf wartete, bis die Langweile in der Ehe die Langweile des Mädchentums abgelöst haben würde! Was hatten sie alle von den sogenannten Glücksgütern? Georg empfand wahres Mitgefühl mit der armen Noëmi, und mit einem wunderbaren Gedankensprunge sagte er sich plötzlich:
»Da lobe ich mir doch Dutch Bill.«
Nach dem Frühstück gingen Georg und Noëmi im Parke spazieren. Vom Geschäft war bei Tisch natürlich nicht die Rede gewesen; aber Jefferson hatte mit seinem jüngsten Beamten und Partner angestoßen und ihn gefragt:
»Wann gedenken Sie aufzubrechen?«
»Morgen früh,« hatte Georg geantwortet, und darauf hatte Jefferson versetzt:
»Das ist vernünftig; nur keine Zeit versäumen.«
Noëmi hatte bei diesem kurzen Zwiegespräch zwar keine Miene verzogen, aber sie hatte sehr wohl verstanden, um was es sich handelte; und nun, da sie ziemlich wortkarg durch den wohlgepflegten Park schlenderten, sagte sie auf einmal:
»Also morgen wollen Sie uns schon wieder verlassen?«
»Leider,« entgegnete Georg. »Dringende Geschäfte zwingen mich dazu.«
»So hatte ich es mir auch gedacht,« sagte Noëmi. »Bei uns bleibt niemand länger, als er gerade bleiben muß.«
Diese einfachen Worte hatten im Munde des jungen Mädchens einen merkwürdig traurigen Klang.
»Sie sagen das so eigentümlich,« entgegnete Georg, während er Noëmi freundlich anblickte. »Ich finde Sie überhaupt etwas verändert, mein Fräulein. Sie sind viel ernster und ruhiger geworden. Bei unsrer früheren Begegnung waren Sie so frisch, so vertrauend, so lebensfroh! Entschuldigen Sie, wenn ich Ihnen das sage – ich irre mich ja vielleicht, und auch wenn ich mich nicht täusche, habe ich jedenfalls nicht das Recht, Sie nach dem Grunde Ihrer Verstimmung zu fragen.«
Noëmi seufzte tief auf und sagte:
»Ich langweile mich, Herr von Lützen! Ich bin enttäuscht, bitter enttäuscht. Mama und Papa sind herzensgut und tun alles, was sie mir an den Augen absehen können; aber was können sie mir hier bieten? Als Kind war ich froh, wenn ich hier im Parke spielen, wenn ich spazierenfahren und reiten konnte. Wie habe ich mich in Dresden nach der Heimat gesehnt! Ich meinte, es gäbe kein schöneres Land auf der Welt! Und nun finde ich alles so ganz anders, als ich es mir gedacht hatte! Sie werden das nicht recht verstehen können; aber wenn Sie einige Wochen und Monate hierblieben, so würden Sie es wohl besser begreifen. Es ist wirklich recht schade, daß Sie uns morgen schon wieder verlassen.«
Georg hatte sehr wohl verstanden; er hatte die Wahrheit schon durchschaut, bevor das junge Mädchen den Mund aufgetan hatte. Er fühlte, daß er Noëmi nicht raten, nicht helfen konnte und machte einige banal ausweichende Redensarten.
Noëmi lächelte trübe und sagte:
»Sie bemerken an mir eine starke Veränderung. Nehmen Sie mir's nicht übel, wenn ich Ihnen sage: Auch Sie finde ich ganz anders wieder, als ich Sie verlassen hatte. Auf den ersten Blick habe ich es Ihnen angesehen. Ich wäre Ihnen wirklich so dankbar gewesen, wenn Sie wie früher von allem möglichen Überflüssigen hätten plaudern können. Seit Jahr und Tag höre ich eben nur das Notwendige, und das Entbehrliche ist doch eigentlich am reizendsten.«
Georg nickte bestätigend.
»Sie mögen wohl recht haben. Es weht hier ein scharfer Wind, der alles, was lose und leicht ist, unbarmherzig abreißt, dörrt und verderben läßt. Wenn hier aber etwas reift und gedeiht, dann muß es auch die rechte Lebenskraft besitzen; und das ist doch auch etwas wert, mein Fräulein. Ich gebe zu, daß ich das Plaudern verlernt habe. Ich sage es Ihnen sogar ehrlich heraus, daß ich jetzt eine gewisse Befangenheit verspüre, wenn ich mit einem jungen Mädchen, wie Sie, allein bin. Ich weiß nicht mehr recht, was ich Ihnen sagen soll. Früher wäre es mir nicht schwer geworden, da hätte ich Ihnen den Hof gemacht ...«

»Ach!« rief Noëmi mit einem verzweifelten Seufzer, »wenn mir doch irgend jemand nur den Hof machen möchte!«
Die Tragik dieses Ausrufs wirkte unwillkürlich komisch auf Georg.
»Nun, es müßte doch sonderbar zugehen, wenn sich nicht jemand finden sollte, der ...«
»Aber ich bitte Sie!« unterbrach ihn Noëmi heftig. »Sie sehen es ja an sich selbst: es geht hier nicht. Weswegen tun Sie es denn nicht?«
Georg antwortete lächelnd:
»Diesmal habe ich beim besten Willen keine Zeit, aber ...«
»Keine Zeit!« unterbrach ihn wiederum Noëmi. »Da haben Sie es! Kein Mann hat Zeit! Zeit haben nur wir, ach, und mehr als wir brauchen!«
»Nun, ich verspreche Ihnen feierlich, Fräulein Noëmi, wenn ich wieder nach Denver komme, dann soll es meine hauptsächliche, ja, meine einzige Aufgabe sein, in Ihrer reizenden Gesellschaft wieder zu erlernen, wie man mit anmutigen jungen Damen umgeht.«
»Wenn Sie wiederkommen?« wiederholte Noëmi. »Werden Sie denn überhaupt wiederkommen?«
»Ich denke doch! Ich kann leider nur nicht bestimmen, wann? Ich gehe von hier nach dem Westen, nach Arizona und Kalifornien ...«
»Auch nach San Franzisko?«
»Jawohl.«
»Dann wird es lange währen, bis Sie wiederkommen. Am stillen Ozean ist es lustiger als hier!«
»Es ist gewiß nicht das letztemal, daß wir uns sehen, Fräulein Noëmi,« sagte Georg, während er ihr die Hand entgegenstreckte, in die Noëmi einschlug. Sie sah dabei ungläubig und recht niedergeschlagen aus.
Sie hatten sich der Veranda wieder genähert. Jefferson wartete dort schon seit einigen Augenblicken auf seinen Partner, mit dem er in die Stadt zurückfahren wollte. Georg verabschiedete sich von den beiden Damen. Er verbrachte einige Stunden des Nachmittags im Kontor des Herrn Jefferson und besprach mit ihm noch das Geschäft in allen Einzelheiten.
Georg ließ sich die nötigen Papiere und Vollmachten aushändigen, dann erhob er sich zum Abschiede.
»Wenn alles so geht, wie es gehen soll,« schloß Jefferson, »so treffen wir uns also in San Franzisko, wo ich wie jedes Jahr auch heuer Ende August und Anfang September sein werde. Ich wohne im Palacehotel.«
»Werden Ihre Damen Sie begleiten?« warf Georg ein.
»Nein,« entgegnete Jefferson. »Die Damen haben es gut! Die lasse ich unterwegs in Las Vegas. Da verbringen sie in dem schönen Hotel Montezuma die heißesten Wochen und erholen sich vom Nichtstun.«
Es lag eine gewisse Bitterkeit in diesen letzten Worten Jeffersons; dann aber verfiel er sogleich wieder in den ruhigen Geschäftston wie vorher und sagte:
»Also wir treffen uns im Palacehotel in San Franzisko, und da rechnen wir ab.«
»Sehr wohl,« entgegnete Georg. »Dann möchte ich Sie auch bitten, meine Koffer dorthin zu senden; denn wahrscheinlich werde ich auch einige Zeit in San Franzisko bleiben.«
»Ich bringe sie Ihnen mit,« entgegnete Jefferson.
Die beiden drückten sich die Hand; und am anderen Morgen fuhr Georg nach Koolidge. Auf der Fahrt dachte er viel an Noëmi, mit mitleidiger Zärtlichkeit, mit wehmütigem Bedauern über das Schicksal eines reichen Mädchens.
In dem wüsten Koolidge hatte Georg keinen leichten Stand. Hul Witling ließ sich nicht ohne weiteres depossedieren. In der Schenke, in der Georg seinen Vorgänger im Zustande völliger Trunkenheit antraf, kam es sogar zu einem sehr ärgerlichen Auftritt. Hul Witling schrie wie ein Besessener, als Georg ihm mitteilte, daß er seiner Wege gehen könne; er griff sogar nach dem Revolver, um seine Hoheitsrechte zu behaupten. Aber Little Dog, der sich in der Tat vorzüglich bewährte, hatte das Terrain genügend vorbereitet; und da Georg der lärmenden Gesellschaft der Cowboys Die »Cowboys«, die berittenen Hirten, sind durch ihre Verwegenheit, Körperkraft und Leistungsfähigkeit ausgezeichnete, bisweilen aber auch wegen ihrer Gewalttätigkeit und Roheit gefürchtete typische Gestalten des amerikanischen Westens. durch seine Unerschrockenheit und Kraft Respekt einflößte, da es allgemeine Freude bereitete, wie der blonde starke Mann mit eisernem Griff Huls rechtes Handgelenk umspannte und ihm den Revolver entwand, so fand Georg alsbald in der übrigen Gesellschaft die nötige Unterstützung, um Hul Witling auf schnellstem Wege an die frische Luft zu befördern. Als Hul seinen Rausch ausgeschlafen hatte, sah er ein, daß nichts zu machen war, schickte sich in das Unvermeidliche und suchte sich einen andern Herrn.
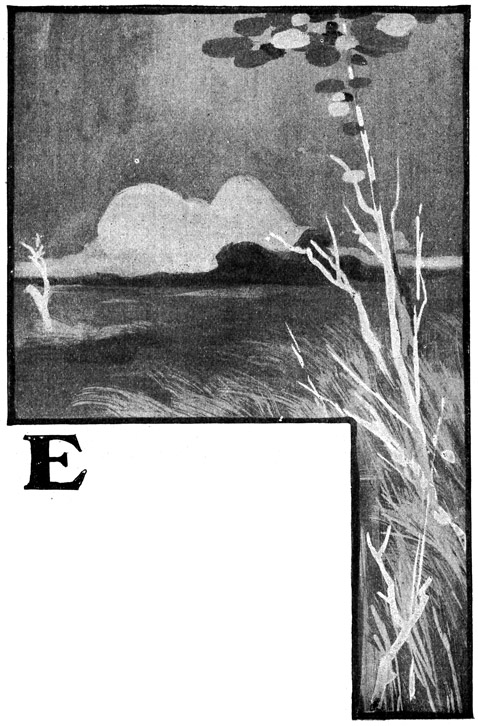
Es war alles über Erwarten gut gegangen. Georg hatte in Neu-Mexiko nahezu seine ganze Herde losgeschlagen. Jefferson hatte ihm nicht zuviel gesagt: er hatte in den wenigen Wochen tatsächlich eine recht ansehnliche Summe verdient. Nur von den Pferden hatte er wenige verkaufen können. Der Markt war überfüllt. Aber in Arizona und Südkalifornien sollte gerade jetzt ein gutes Geschäft damit zu machen sein, da dort wegen der Befürchtungen vor den Indianern, die sich wieder geregt hatten, die Zufuhr sehr erschwert und der Bedarf ein großer sei. Georg vertraute nun die auf ein paar Dutzend Stück zusammengeschmolzene Rinderherde Little Dog an, der in jeder Weise sich hervorgetan hatte, kaufte für seine eigene Rechnung von dem Gewinn, den er erzielt hatte, noch Pferde ein, traf mit den Treibern die nötigen Verabredungen und zog frohen Mutes mit seinen Tieren durch die großartige Wildnis, in die sich vor ihm und seinen staubigen, unermüdlichen, bis an die Zähne bewaffneten Genossen nur wenige kühne Abenteurer gewagt hatten.
Einen langen, entsetzlich beschwerlichen Weg durch Wüstensand und Sonnenglut, durch Öde und Dürre, durch Felsen und Geröll hatte Georg mit seiner Herde zurückgelegt; er hatte Mühsale erduldet, im Vergleich zu denen die Schrecknisse in den Rocky Mountains ihm nun noch ganz erträglich und milde erschienen waren. Aber das Gefühl der Verantwortlichkeit hatte ihm eine merkwürdige Spannkraft und Widerstandsfähigkeit gegeben. Er war von einem ähnlichen Gefühl beherrscht, wie es der Heerführer empfinden mag, der eine große ihm anvertraute Masse durch fremdes Land zu dirigieren hat. Unablässig war er besorgt, die günstigsten Bedingungen zur Weiterbeförderung und zum Unterhalte ausfindig zu machen, und in dem beständigen Alleinsein schärften sich seine Sinne für die Beobachtung der natürlichen Wahrzeichen in einer Weise, die selbst sein freudigstes Erstaunen hervorrief. Dutch Bill hatte ihm die ersten Unterweisungen in der Beobachtung der dem gewöhnlichen Auge verborgenen Weiser gegeben, die die Natur für den Kundigen, der sich liebevoll in sie vertieft, deutlich aufstellt, und in dieser Kunst hatte sich Georg in verhältnismäßig kurzer Zeit zu einem wahren Virtuosen herausgebildet. Er beobachtete alles, und jede Beobachtung war ihm eine Lehre, die ihm praktischen Gewinn gewährte. Und unverzagt, wenn auch von schweren Sorgen bedrückt, trieb er die Herde weiter, und sein Herz jubelte auf, wenn er erkannte, daß dem verschmachtenden Vieh bald Wasser und Weide geboten werden sollte. Und er täuschte sich nie.
Er war auf seinem Zuge zu verschiedenen Malen größeren und kleineren Banden von Indianern begegnet; diese zeigten sich indes keineswegs feindselig und leisteten ihm bisweilen sogar als gelegentliche Führer gute Dienste. Er wußte sich genügend mit ihnen zu verständigen; der große Lehrmeister, die Not, hatte ihn ausreichend unterwiesen.
Der Transport ging sehr langsam von statten und unter Schwierigkeiten, die er nicht geahnt hatte. Lange Stunden, ja Tage gingen verloren, bis seine Leute die versprengten Tiere eingeholt und wieder zusammengetrieben hatten. Er wechselte mit den berittenen Treibern kein überflüssiges Wort, und seine stille und bestimmte Art imponierte den rohen, aber bewundernswerten Männern. Sie folgten blindlings seinen Anordnungen, die sich immer als die richtigen erwiesen, und er war stolz auf seine Untergebenen, die viel verlästerten »Cowboys«, deren unermüdliche Pflichttreue, deren staunenswerte Leistungsfähigkeit und großartige Männlichkeit ihm Respekt einflößten. Sie waren auf verhältnismäßig weite Strecken verteilt, ein jeder von ihnen wußte, was seines Amtes war, und tagelang war Georg allein mit seinen fünf großen, zottigen Hunden bei seiner Abteilung und sprach kein Wort. Oft bedrückten ihn schwere Sorgen, und er klagte Jefferson und sich selbst an, daß er an eine Aufgabe, deren Lösung seine Kräfte überstieg, mit leichtsinnigem Übermute herangetreten war. Aber er wollte den Mut nicht sinken lassen.
So war er nach wechselvollen Tagen ruhiger Verzweiflung und freudiger Hoffnung mit seiner Herde, die nur wenig Schaden erlitten hatte, den Treibern und den Hunden, deren stärkstem und anhänglichstem er den Namen Pluto gegeben hatte, seinem Zelte und seinem sonstigen ganzen Besitztum im heißen Juli an dem Koloradoflusse, an der Grenze von Arizona, angelangt. Es trennte ihn nur noch die große Mohavewüste von dem Ziele seiner Wanderung.
Die Pferde, die sich mit der Zeit ein, durch die Peitsche der Treiber und die vorzüglichen Hunde geschärftes Gefühl ihrer Zusammengehörigkeit angeeignet hatten, hatten sich auf den sandigen, mit spärlichem Gras bewachsenen Höhen in der Nähe des Flusses gelagert. Georg hatte die Treiber zurückgelassen und war allein auf seinem schnellen, unglaublich leistungsfähigen Pony an den Ufern des seichten, durch die Hitze an einigen Stellen beinahe ganz ausgetrockneten Koloradostromes entlang geritten, um die geeignetste Stelle zum Übersetzen zu erforschen.
Es war in der heißesten Sonnenglut des Vormittags. In unendlicher Höhe wölbte sich über das gewaltige Land der wolkenlose Himmel im tiefsten Blau. In unmittelbarer Nähe ragten ganz eigentümlich gebildete scharfzähnige Felsenriffe in wunderbar tiefroter Färbung aus dem gelben Boden auf, und ein Höhenzug in sanften Wellenlinien, der in dem heißen Lichte des Tages duftig und mild schimmerte, schloß den Horizont ab.
Georg hatte sein Pferd, mit dem er zuerst im Galopp lustig davongesprengt war, allmählich in ein langsameres Tempo gebracht und dem Tiere, das nun in bedächtigem Schritte daherging, die Zügel über den Hals geworfen. Den Oberkörper vorbeugend, stemmte er die beiden Hände auf die Schenkel und sah bewundernd um sich auf die herrliche Landschaft. Er blickte staunend auf zu der unermeßlichen Höhe des blauen Äthers. Sein Blick schweifte über die felsigen Nadeln und über die bläulich rosigen Wellen der Höhen und senkte sich auf das träge dahinfließende lehmige Wasser des Flusses und auf den gelben sandigen Boden, dem Opuntien und mit stahlharten lanzettartigen Stacheln bewehrte Wüstenpflanzen aller Art entwuchsen.
Er empfand ein ganz seltsames Wohlgefühl. Die Luft war so rein und das Licht so goldig. Die Brust war ihm weit, das Herz war ihm frei; er fühlte sich so leicht, so ausgeglichen wie seit langen Wochen nicht. Er schöpfte tief Atem, als wolle er die herrliche Friedlichkeit und Ruhe der großartigen Natur in seine Lungen einziehen und sein ganzes Wesen damit durchtränken.
Auf einmal machte er eine schnelle Bewegung, ergriff die Zügel und brachte das Pferd zum Stehen. Er bog sich etwas seitwärts nach rechts und betrachtete sehr aufmerksam den Boden. Er sah da Eindrücke, deren Schärfe der Wind freilich verweht hatte, die aber immerhin deutlich genug die Spuren eines lebenden Wesens zeigten. Nach einer Weile ritt er langsam weiter. Die Eindrücke kehrten von Zeit zu Zeit wieder, und an einem erkannte er deutlich die Spur eines kleinen menschlichen Fußes. Nachdem er das festgestellt hatte, interessierte ihn das Weitere nicht mehr, und er setzte seinen langsamen behaglichen Ritt ruhig fort.
Er hatte den eigentlichen Zweck seiner Forschungen zwar schon erreicht und die Stelle schon gefunden, die er gesucht hatte, aber der Tag war so schön, er fühlte sich so merkwürdig glücklich in dieser herrlichen Einsamkeit, daß er das Pferd ruhig seines Wegs gehen ließ, wohin es eben gehen wollte.
Da erregte eine neue Erscheinung seine Aufmerksamkeit. Auf einem der gelben Sandhügel in der Ferne, der fast ganz kahl war, erblickte er einen brennend roten Punkt. Was mochte das sein? – Es bewegte sich nicht. Es war keine Täuschung. Es war wirklich etwas Rotes, Unerklärliches. Er ließ den roten Punkt nicht aus den Augen, schnalzte seinem Pony zu und trabte nun in schnellerem Tempo darauf los. Es wurde größer, es blieb unbeweglich. Er kam näher und näher, und nun erkannte er es. Es war ein roter Fetzen, wahrscheinlich die Umhüllung eines Indianers oder einer Indianerin. Und jetzt stellte er fest, daß er sich nicht getäuscht hatte. Über dem Feuerrot sah er tiefes Schwarz: die Mähne der Rothaut.
Er hatte Indianer zu Hunderten und Tausenden erblickt, und an einem andern Tage, in einer andern Stimmung würde er den Kopf nicht gewandt haben, um noch einen mehr zu sehen. Aber er war eben besonders gut aufgelegt und machte seit einem Jahre zum erstenmal im wahren Sinne des Wortes einen Spazierritt. Ohne sich etwas Besonderes dabei zu denken, lenkte er wohlgemut das Pferd auf den Hügel und ließ das ans Klettern gewöhnte Tier die leichte Höhe nehmen.
Er war bis hart an die rotvermummte Gestalt herangeritten. Diese hatte sich nicht gerührt. Nun hielt er das Pferd an und stieg ab. Er machte wenige Schritte und blieb vor ihr stehen.
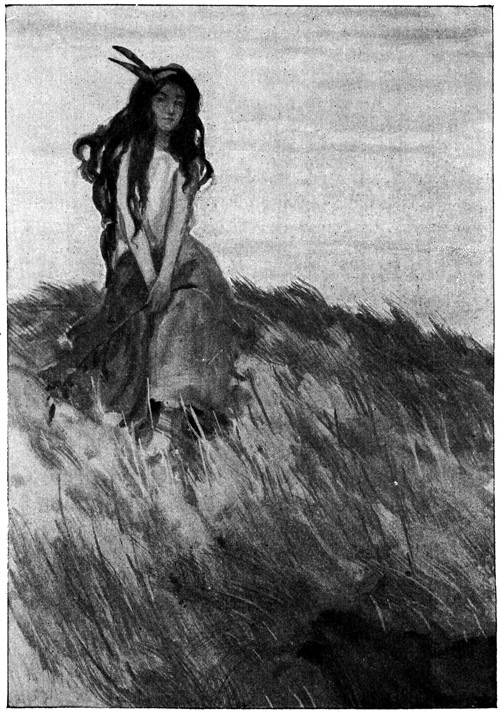
Es war ein wunderschönes Mädchen, die schönste Indianerin, die sein Auge je erblickt hatte. Sie saß oder hockte vielmehr auf dem heißen Sande. Auf die Kniee, die sie der Brust genähert hatte, stützte sie die beiden Ellenbogen und den Kopf auf die Hände. Sie mochte etwa sechzehn Jahre alt sein. Das starke, dichte, schwarze Haar, das gleichmäßig geschnitten war, fiel langsträhnig auf die runden Schultern und bedeckte die Stirn bis zu den Augenbrauen. Verwundert und scheu blickten auf ihn die großen braunschwarzen Augen von wunderbarer, eher tierisch als menschlich zu nennender Schönheit, die von ganz ungewöhnlich langen und starken, leuchtenden schwarzen Wimpern umsäumt waren. Zwischen den halbgeöffneten Lippen wurden zwei Reihen herrlichster, glänzendweißer Zähne sichtbar. Die ganze Gestalt war von zauberhaft harmonischem Ebenmaße, Hände und Füße klein und die Knöchel von seltener Zartheit; ihre Haut hatte eine ganz eigentümliche Bronzefärbung mit goldigen Reflexen. Das Mädchen war zum Glück durch die Geschmacklosigkeiten der Wilden fast gar nicht entstellt. Nur ein ganz schmaler hellblau tätowierter Strich, der senkrecht über Stirn, Nasenrücken und Kinn das Gesicht durchschnitt und sich am Halse verlor, kündete die barbarische Unsitte ihrer Abstammung. Um die Hüften trug sie einen Schurz aus bunten geflochtenen Lederstreifen. Sonst hatte sie als Bekleidung nur noch ein großes Stück leuchtenden feuerroten Kattuns mit weißem Muster, in das sie sich wie in einen Mantel gehüllt, und das sie am Halse verschlungen hatte. Der Oberkörper und die Beine waren nackt.
Einen Augenblick sah Georg dies wunderschöne Kind voll Erstaunen und Bewunderung an. Sie blickte noch immer scheu und unsicher zu ihm auf.
Mit dem Indianergruße »Ha–o!« hieß Georg das Mädchen willkommen und streckte ihr die Hand entgegen. Zögernd und bedächtig schlug sie ein. Lange Zeit hielt er die kleine dunkle, schöngeformte Hand in der seinigen und blickte freundlich zu dem Mädchen nieder. Sie fühlte auch sehr wohl, daß ihr der starke weiße Mann nicht übelwollte, und der Ausdruck des Zaghaften und Ängstlichen wich dem der lächelnden Verwunderung. Beide schienen der Begegnung froh zu sein. Mit einem warmen Drucke ließ Georg endlich ihre Hand los und setzte sich neben sie in den Sand. Sie wandten den Kopf zueinander und betrachteten sich gegenseitig mit offenbarem Behagen.
Das Weibliche, das im Dasein Georgs früher eine große Rolle gespielt hatte, war ihm seit seinem Verweilen auf dem amerikanischen Festlande nahezu gänzlich entrückt. Auch Noëmi Jefferson hatte ihn wohl nicht gerade in ihrer Eigenschaft als junges Mädchen gereizt; er hatte für das unglückliche Kind eines reichen Mannes doch wohl hauptsächlich warmes Mitgefühl empfunden. Die schöne junge Wilde aber mit ihren sonderbar tiefen Augen und den glänzenden Zähnen, dieses Wesen von unbeschreiblich bestrickender Anmut und Eigentümlichkeit sprach zum erstenmal wieder zu seinen Sinnen. Er fühlte, wie eine innere Glut ihm in die Wangen stieg, und seine Lippen öffneten sich. Er streckte ihr die Hand wiederum entgegen; sie lächelte und schlug ein. Er hielt die kleine Hand fest. Einen Augenblick empfand er wie ein flüchtiges Bedauern, daß er sich mit ihr nicht in Worten verständigen könne; aber gleich darauf schwand dies Gefühl, und er sagte sich, daß er seiner Nachbarin, die ihn noch immer verwundert und mit ehrlichem Wohlbehagen betrachtete, eigentlich gar nichts Gescheites anzuvertrauen habe. Ja, die Schwierigkeit, die Unmöglichkeit der vollen Verständigung durch Worte erhöhte in seinen Augen womöglich noch den Reiz dieser unerwarteten Begegnung.
Nach einer Weile entzog sie ihm ihre Hand ohne irgend eine Spur von Unwillen; es schien ihr eben nur unbequem zu sein. In Georg regte sich zunächst der Wunsch, dem Mädchen etwas zu schenken. Es tat ihm wirklich leid, daß er nichts hatte, womit er ihr irgend eine Freude bereiten könne; er betastete seine Brust, seine Taschen – nichts. Zu seiner Entschuldigung sagte er sich, daß er auch nicht darauf vorbereitet gewesen war, hier irgend einer Schönen eine Aufmerksamkeit zu erweisen. Plötzlich leuchtete sein Auge auf. Aus einer verborgenen Tasche zog er seine Uhr hervor, an der ein goldener Georgstaler befestigt war. Er war ihm vor mehreren Jahren von lieber Hand geschenkt worden; er sollte ihm Glück beim Spiel bringen. Leider hatte sich sein Schutzheiliger, der heilige Georg, als Glückbringer gar nicht bewährt, und sein Spieleraberglaube war längst überwunden. Für ihn war die Münze wertlos geworden. Der Kleinen aber machte das blinkende goldige Ding vielleicht Spaß. Mit einiger Mühe hakte er den Taler von der Uhr los. Sie bog sich vor und sah mit großer Aufmerksamkeit zu, wie seine breiten ziemlich ungeschickten Finger die beschwerliche Arbeit verrichteten. Als er endlich damit fertig war, steckte er die Uhr wieder in die Tasche und reichte dem Mädchen das goldige Stück. Sie sah ihn groß an, nahm langsam das Dargereichte und erkundigte sich durch einen sehr beredten Blick, was sie damit anfangen solle? Er machte ihr klar, durch Bewegungen, die ebenfalls gar nicht mißzuverstehen waren, daß er es ihr schenke, daß sie es tragen solle. Sie wiederholte die Bewegungen, um sich noch einmal das Unglaubhafte von ihm bestätigen zu lassen, und als er zustimmend nickte, sprang sie mit einem Satze auf und klatschte in die Hände wie ein kleines Kind.
Es berührte Georg ganz eigentümlich, als er dies große schlanke Mädchen in der vollen körperlichen Reife der Jungfrau sich wie ein Baby gebärden sah. Ihr roter Mantel umfloß wie eine lodernde Glut die dunkle jugendliche Gestalt. Mit tiefem Ernst betrachtete sie die Prägung der Münze. Was das im bewegten Wasser schwankende Schiff zu bedeuten hatte, verstand sie offenbar nicht. Um so glücklicher war sie, als sie die Gestalt des Reiters auf der Rückseite erkannte. Sie lächelte mit großer Befriedigung, hockte sich neben Georg nieder, betippte mit ihrem schmalen Finger das geprägte Roß und deutete dann auf Georgs Pferd, einen merkwürdig freudigen, gurgelnden Ton hervorbringend. Darauf löste sie den Knoten, durch den sie die Zipfel des Tuches am Halse verschlungen hatte, und die rote Hülle glitt langsam von ihren Schultern. Nun erst sah Georg, daß sie um den Hals eine Reihe von Glasperlenschnüren trug. Den Kopf nach vorn beugend, knüpfte sie mit den beiden Händen den Halsschmuck am Nacken auf und befestigte dann in der Mitte der Perlenschnüre mit großer Gewandtheit den goldenen Taler. Sie faßte nun den Schmuck an den beiden Enden, streckte ihn von sich, ließ ihn in der Sonne spielen und freute sich kindisch des Gefunkels.
Darauf versuchte sie, die Schnüre wieder um den Hals zu befestigen; aber es wollte ihr nicht gleich gelingen, und Georg war ihr dabei behilflich. Als er bei dieser Hilfeleistung die bloße farbige Haut des Mädchens berührte, durchrieselte es ihn, und auch sie empfand etwas wie einen Schauer. Sie duckte den Kopf noch tiefer und sah mit ihren sonderbaren tiefen Augen lauernd von der Seite zu ihm auf. Da nahm mit einer plötzlichen Bewegung Georg den schwarzummähnten Kopf der reizenden Wilden in seine beiden Hände und drückte auf die schwellenden Lippen, die sich wie die eines Kindes halb öffneten, einen heißen, innigen Kuß.
Sie zitterte, sie wußte nicht, wie ihr geschehen war. In einer seltsamen Bestürzung blickte sie zunächst vor sich hin in den Sand. Endlich wandte sie langsam den Kopf zu dem glühenden Antlitz Georgs, dessen warmen Hauch sie an der Wange spürte, und lächelte befremdlich. Georg führte ihren Kopf zärtlich an seine Schulter, sie ließ es ruhig geschehen, und mit dem Gefühl, als ob er etwas gutzumachen habe, streichelte er ihr beinahe väterlich das volle starke schwarze Haar. Beiden schien wohl zu sein, denn sie beharrten geraume Zeit in dieser zärtlichen Stellung, lächelten und sprachen kein Wort.
Und kein Laut ließ sich ringsum vernehmen. Die Sonne stand hoch an dem herrlichen blauen Himmelsgewölbe, und in der reinen Sonnenglut schien die ganze Natur zu schlummern. Großartig und feierlich ragten vor ihnen die roten Nadeln der Felsen auf, versöhnend und ruhig schlossen die blauen Höhenzüge im Hintergrunde das Bild ab, und lautlos floß zu ihren Füßen das gelbe Wasser des Kolorado.
Geraume Zeit hatten sie so dagesessen, bis endlich Georgs Pferd, das bisher philosophisch genickt hatte, laut zu wiehern anfing, als wolle es den Säumigen an seine Pflicht gemahnen. Nun erhoben sich die beiden; Georg sah fragend das schlanke dunkle Mädchen an und wies mit der Hand über den Kolorado, als wolle er sich erkundigen, wo sie ihr Zelt aufgeschlagen habe? Das Mädchen verstand ihn auch sehr gut, verneinte mit einer Kopfbewegung die Frage und wies nach der nördlichen Richtung hin, über die nächste Erhöhung. Beide hatten innige Freude daran, daß sie sich verständigt hatten.
Mit scherzhafter Galanterie reichte ihr Georg den Arm und führte sie zu seinem Pferde. Sie nickte wie ein Kind, dem man den Willen tut, ließ schnell den Arm Georgs los, faßte das Pferd an der Mähne, stellte den linken Fuß in den mexikanischen Bügel und schwang das rechte Bein über den Rücken des Pferdes. Mit einem übermütig neckenden Jauchzer schlug sie dem Tiere die Hacken in die Weichen und ritt in gestrecktem Galopp, den Oberkörper jach zurückwerfend, so daß ihre langen Haarsträhnen die starke Kruppe des Pferdes streiften, die Höhe hinunter. Dann warf sie das Pferd schnell herum, brachte es zum Stehen, erhob sich in den Bügeln, winkte lebhaft mit der Hand und lachte laut.
Im ersten Augenblicke hatte Georg den etwas ernüchternden Gedanken gehabt: Das Mädchen wird doch wohl nicht mit meinem Pferde davonreiten? – und er wußte nicht, ob sie Ernst machte oder Spaß. Nun, da er ihr volles Lachen vernahm, schämte er sich seines Verdachtes und beeilte sich, ihrem freudigen Winke zu folgen.
Nun hatte er sie erreicht, und nun wies sie wieder nach derselben Richtung, auf die sie vorhin gezeigt hatte, und ließ das Pferd langsam darauf zugehen. Georg schritt neben ihr her. Er blickte auf zu der eigentümlichen Reiterin und vergaß dabei die Beschwerden des Weges, den Sand, in den sich seine Füße tief eingruben, und die glühende Hitze des Tages. Aber die Reiterin sah, wie sich ihr Begleiter quälte, und sie hatte Mitleid mit ihm. Sie zog die Zügel an, und der Braune stand. Sie bog sich zu Georg hinab, strich mit der Hand über seine feuchte Stirn und brachte einen merkwürdig teilnahmvollen Laut hervor. Gleich darauf war sie auch schon abgesprungen und forderte Georg mit kindischer Dringlichkeit auf, sich auf den Sattel zu schwingen. Georg weigerte sich, und in einer eigentümlichen Anwandlung von Ironie machte er dabei die besten Salongebärden, als stünde er irgend einer Gnädigen in einem der vornehmsten Salons der Großstadt gegenüber. Aber die Bronzefarbige bestand auf ihrem Willen. Sie stampfte trotzig mit dem kleinen Fuß auf und gab zu verstehen, daß sie weglaufen würde, wenn er sich nicht aufs Pferd setzte. Nach langem Widerstreben gab Georg endlich nach.
Kaum saß er im Sattel, so hatte auch das schlanke Mädchen schon hinter ihm auf dem Rücken des Pferdes Platz genommen. Sie legte ihre Hände um seine Brust, faltete sie, und mit dem leichten Druck ihrer Schenkel und leichtem Schnalzen trieb sie das Tier an. Der sonderbare Ritt ergötzte Georg aufs höchste. Immer senkte sich sein Blick auf die beiden schönen, zarten, braunen Hände, die vor ihm auf seiner Brust gefaltet waren, und immer wieder klopfte er sie zärtlich. Und wenn er den Kopf wandte, sah er dann die schönsten, weißesten Zähne glänzen, die sein Auge je erblickt hatte, und die unergründlichen schwarzbraunen Augen. Er war von dem Zauber des Fremdartigen ganz berückt, wie willenlos, und er überließ auch dem Mädchen die Führung des Pferdes.
Bald nahm Georg die deutlichen Anzeichen wahr, daß man sich den Wohnstätten der Menschen nähere. Er sah im Sande verschiedene geleerte Konservenbüchsen und zerbrochene Flaschen herumliegen.
Sie waren etwa zehn Minuten geritten, als Georg, durch einen leichten Aufschrei seiner Begleiterin aufmerksam gemacht, den Kopf ihr zuwandte. Sie zeigte nun nach rechts, und da erkannte Georg das ihm wohlbekannte Bild eines Arbeiterlagers: einige Zelte und drei oder vier Bretterbauten. Er sah da in der Ferne auch Menschen und erkannte an einigen grellfarbigen Kleidungen Indianer. Sie waren nun in der Ebene, und in schnellem Ritt erreichten sie in wenigen Minuten die provisorische Niederlassung.
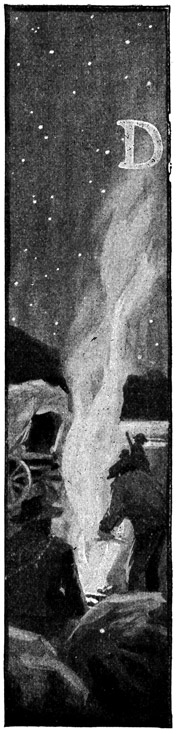
Die Ankunft der beiden erregte im Lager einiges Aufsehen. Die amerikanischen und chinesischen Arbeiter blickten lachend von ihrem Spaten zu den beiden auf. Die Indianer musterten den weißen Mann mit ernster Neugier; sie umdrängten das Mädchen, als diese abgestiegen war, und schienen allerhand Fragen an sie zu richten. Sie gab lebhaft Antwort, und einer nach dem andern betrachtete mit Verwunderung und Neid den glänzenden Georgstaler an ihrem Halse. Georgs Genossin mußte günstige Auskunft gegeben haben, denn alle Indianer – es waren ihrer vielleicht fünfzig bis sechzig – zeigten in ihrem Wesen eine große Zuvorkommenheit, und einige pudelnackte braune Kinder wurden von ihren Eltern zu dem weißen Manne abgeschickt, um ihn anzubetteln. Georg legte auch in jede der kleinen dunklen Patschen, die sich ihm entgegenstreckten, ein kleines Silberstück.
Nur einer schien eine Ausnahme zu machen, ein schlanker hübscher Bursche, der etwa 20 bis 25 Jahre alt sein mochte. Er hatte in sein schwarzes Haar ein safrangelbes Tuch geschlungen, das ihn leicht kenntlich machte, und eine hellrote Schlangenlinie lief ihm quer übers Gesicht von einem Ohrzipfel zum andern. Er stand etwas abgesondert von den übrigen und sah Georg mit keineswegs freundlichen Blicken an. Er war es, der zuletzt an Georgs Gefährtin herantrat und mit ihr in eifrigem Gespräch abseits ging.
Die ganze Gesellschaft war so wenig wie möglich bekleidet. Die Männer trugen nur ein Tuch, das sie sich um die Hüfte geschlungen hatten, die Weiber entweder lange Schürzen aus buntem Kattun, die bis zu den Knöcheln hinabreichten, oder einen Schurz aus Lederstreifen geflochten, der bis zum Knie reichte, so wie ihn Georg bei seiner Begleiterin wahrgenommen hatte. Wenige hatten den Luxus eines Mantels. Die braunroten Kinder waren ganz nackt.
Vor einer der Bretterbuden, die den stolzen Namen »Hotel« trug, war eine aus rohem Holz gezimmerte Bank aufgeschlagen, und da saß ein Mann, der eine Bierflasche zwischen die Kniee geklemmt hatte und ein halbgefülltes Glas in der Hand hielt. Georg begrüßte den Mann. Er holte sich gleichfalls eine Flasche Bier und setzte sich neben ihn. Es war eine merkwürdige Erscheinung. Wäre der Fremde nicht auf entsetzliche Weise verstümmelt worden, so wäre er wahrscheinlich ein schöner Mann gewesen; aber das rechte Auge war ihm ausgestoßen, und die fleischige Augenhöhle machte einen schauerlichen Eindruck. Er hatte einen falschen künstlerischen Anstrich: er trug einen kurzen braunen Sammetrock, einen hellgrauen spitzen Hut mit breiter Krempe; um den Kragen des blauen Wollenhemdes hatte er ein buntes Tuch in mächtiger Schleife geschlungen. Sein Haar war kraus und ziemlich lang; Schnurr- und Kinnbart hatte er zu Spitzen gedreht. Er hatte ein edles Profil und eine entfernte Ähnlichkeit mit dem Kopfe van Dyks. Er war wohl kaum vierzig Jahre alt, aber er sah älter aus. Sein Gesicht war durchfurcht und verwittert.
Georg begrüßte ihn in englischer Sprache, und der Fremde antwortete ebenfalls englisch. Er knüpfte an die Begrüßung einige nichtssagende Sätze, und in diesen waren soviel sprachliche Ungeheuerlichkeiten enthalten, daß Georg sich nach der Landsmannschaft des Sprechers erkundigte. Da vernahm er denn, oder erriet vielmehr aus einem Kauderwelsch, das noch viel entsetzlicher war als der Mischmasch von Dutch Bill, daß der Fremde in Pennsylvanien von Eltern deutscher Abstammung geboren war. Er führte auch den gut deutschen Namen Kaspar. Aber er war schon als kleiner Knabe aus der Heimat fortgezogen und hatte sich seit fünfundzwanzig Jahren bis zu diesem Augenblicke in Mexiko, Texas, Neu-Mexiko, Arizona und Kalifornien herumgetrieben. Lange Jahre hindurch war er in der Wildnis bei den Indianern gewesen; er verstand Spanisch, Deutsch, Englisch und einige Indianeridiome des südlichen Gebietes und hatte sich aus alledem eine ungeheuerliche Mischsprache gebildet, die mit großer Mühe jedermann ungefähr und keiner recht verstehen konnte. Er war, nachdem er alles mögliche betrieben hatte, schließlich Photograph geworden, und in diesem Augenblicke durchzog er Kalifornien und Arizona, um Indianerbilder für einen großen Photographen in San Franzisko aufzunehmen. Seit einer Woche war er hier in der kleinen Gesellschaft der Mohave-Indianer, die er als gutmütige, ehrliche und freundliche Leute rühmte. Vor allem aber schätzte er an ihnen eine Eigenschaft, die er bei den andern Stämmen immer schmerzlich vermißt hatte: die kleine Gesellschaft, die immer an den Ufern des Kolorado hauste, war im Gegensatze zu den andern sehr reinlich. Sie plätscherten fast den ganzen Tag im Wasser herum. Das war auch Georg schon beim ersten Blick aufgefallen.
Von diesem einäugigen Photographen hörte nun Georg, daß er sich an der Endstation der Southern Pazifik- und an der Anfangsstation der Atlantik Pazifikbahn befand, und daß diese nach den eigentümlichen Felsennadeln den Namen » The Needles« führte. Noch mehr aber interessierte Georg, was ihm der Einäugige über das schlanke Mädchen erzählte. Sie war die größte Schönheit und der Stolz ihres Stammes, die Tochter des früheren Häuptlings. Sie führte bei den Ihrigen wegen ihrer Schnellfüßigkeit und Anmut in den Bewegungen den indianischen Namen der Antilope: man rief sie Mayo.
»Mayo?« sagte Georg und wiederholte das Wort mit innigem Behagen »Mayo!«
Es klang ihm freundlich in die Ohren; es paßte ganz zur Erscheinung des schlanken Mädchens: »Mayo!«
Er sah sich nach ihr um, sie war verschwunden; vergeblich spähte sein Auge unter den bunten Lappen nach dem roten Mantel.
»Ein hübsches Mädchen,« sagte Georg. »Ich möchte sie wohl mit mir nehmen.«
»Wohin ziehen Sie?«
»Sechs bis sieben englische Meilen südlich von hier lagern meine Pferde. Ich will sie durch die Mohavewüste in der Richtung auf Los Angeles treiben.«
»Und Sie wollen Mayo mitnehmen? Was wollen Sie mit ihr anfangen?«
»Nun,« entgegnete Georg, »sie soll mich eben begleiten. Ich bin lange genug allein gewesen und sehne mich nach Gesellschaft.«
»Sie würden ihrer bald überdrüssig werden, und sie würde auch schwerlich kommen.«
»Das wäre abzuwarten,« entgegnete Georg mit dem Ausdruck eines gewissen Selbstvertrauens. »Und wenn ich mich ihr verständlich machen könnte ...«
»Ich will's ihr schon sagen, aber ich glaube nicht, daß sie kommen wird.«
»Versuchen Sie's nur!«
In der Unterhaltung zwischen den beiden war aber auch noch von anderen und ernsthafteren Dingen die Rede als von Liebeständeleien, und Georg erfuhr vom Photographen Kaspar eine Nachricht, die für ihn geschäftlich von großer Bedeutung werden konnte. Er hörte, daß in dem benachbarten westlichen Flecken sich seit einiger Zeit verschiedene Agenten herumtrieben, die für irgendwelche geheimnisvolle Spekulation bedeutende Ankäufe von Pferden gemacht und mit diesen Ankäufen noch keineswegs abgeschlossen hatten. Kaspar riet ihm daher auch, sich in der Nähe der großen Verkehrsstraße zu halten, da werde er mit den Leuten, die noch vor wenigen Tagen in dem Flecken Bagdad sich aufgehalten hatten, wohl zusammentreffen.
Die Indianer drängten sich wieder an die beiden, Georg hatte seine Geberlaune, und in einer anderen Bretterbude, die die Aufschrift »Store« führte, kaufte er für ein paar Dollars verschiedene Gegenstände: etwas Mehl, Wassermelonen, Biskuits und einige Ellen bunten Kattuns, die er unter die jungen Schönen der Gesellschaft galant verteilte. Immer wieder sah er sich spähend nach Mayo um; sie war wie in den Erdboden versunken.
Der Safrangelbe mit der roten Schlangenlinie stand abseits, verfolgte höhnisch Georgs spähende Blicke und lachte.
Der Photograph, den Georg fragte, wo die Kleine geblieben sein möchte, konnte ihm keine Auskunft geben.
»Das Volk verkriecht sich, man weiß nicht, wo es bleibt. Es ist, als ob die Erde sie verschlingt. Aber sie wird schon wiederkommen. Verlieren Sie nur nicht die Geduld.«
»Die Geduld verliere ich nicht,« erwiderte Georg. »Aber ich habe keine Zeit zu verlieren. Ich muß zu meinen Leuten und meiner Herde zurück. Wir wollen die Herde noch vor Sonnenuntergang auf das jenseitige Ufer bringen. Das ist eine langwierige Arbeit, und es ist für mich die höchste Zeit, an den Aufbruch zu denken. Wenn Sie Mayo sehen, so sagen Sie ihr, daß ich sie erwarte; und wenn sie nicht kommt, komme ich auf dem Rückwege zu ihr. Und wenn ich sie wieder halte, soll sie mir so leicht nicht wieder entwischen. Das schlanke Mädchen hat es mir angetan!«
Georg drückte dem Einäugigen die Hand, stieg auf sein Pferd und trabte davon, während die Indianer und Bahnarbeiter dem Reiter nachschauten.
Auf seinem Ritte konnte Georg an nichts anderes als an das Mädchen denken. Zum erstenmal ging er mit einem gewissen Unwillen an seine harte Arbeit. Aber das Übersetzen der Pferde machte ihm doch so viel zu schaffen, daß die Idylle vor den rauhen Forderungen der Pflicht einstweilen in den Hintergrund rücken mußte. Am Abend aber, nach getaner Arbeit, als er sich müde auf der über den warmen Sand gelegten Decke ausstreckte und in die unendliche Höhe hinaufstarrte, da traten die Erlebnisse des Tages mit wunderbarer Schärfe wieder vor seine Seele, und er freute sich von ganzem Herzen. Pluto hatte sich zu seinen Füßen gelagert.
Georg war todmüde, aber er vermochte nicht die Augen zu schließen. Immer blickte er hinauf zu dem dunkeln Himmel, an dem die Sterne mit einem Glanze und einer Pracht funkelten, wie er sie nie gesehen hatte. Da glitzerte tief am Horizonte das Prachtgestirn des großen Bären, der ihm plötzlich vertraulich wie ein Bekannter aus der Heimat, nur in verschönter Gestalt entgegenleuchtete; und es war ihm, als ob der herrliche Stern einen Gruß vom deutschen Boden aufgelesen hätte und ihn hier auf die Wüste von Arizona herabsandte.
Und er gedachte in der feierlichen Stille der Nacht aller, die er verlassen hatte. Er gedachte auch der traurigen Noëmi. Sie tat ihm herzlich leid.
Es war wunderbar geheimnisvoll ruhig, und sein Ohr trank die feierliche Stille. Endlich fielen dem Müden und Glücklichen die Augen zu, und er schlummerte sanft ein.
Er konnte noch nicht lange geschlafen haben, als er geweckt wurde. Die Hunde schlugen an, Pluto zuerst, der schnell aufgesprungen war und seinem Herrn mit dem Schweif ins Gesicht wedelte. Georg hatte sich nun jählings erhoben und blickte in das Dunkel, das nur durch die flimmernden Sterne einigermaßen erhellt war. Er sah nichts, aber die Hunde wollten sich nicht beruhigen. Er nahm seinen Revolver zur Hand, machte ihn schußgerecht und schickte Pluto voran.
Auf einmal hörte er einen hohen merkwürdigen Ruf aus der Ferne. Sein Herz klopfte mächtig. Ein ahnungsvolles Hoffen durchzog sein Gemüt. Er antwortete mit einem hohen Schrei. Da vernahm er den Ruf zum zweiten Male. Er lockte den Hund an sich und gebot ihm Ruhe. Bald darauf ertönte ein drittesmal der Ruf und diesmal aus geringerer Entfernung. Wiederum gab Georg freudigen Bescheid. Und nun sah er nicht weit von sich in schnellem Lauf eine Gestalt mit langem wehenden Mantel auf sich zulaufen; und einen Augenblick darauf lag Mayo atemlos, keuchend und sonderbare zärtliche Laute ausstoßend in seinen Armen.
»Woher kommst du, Mayo?« fragte er. »Hat dir der Einäugige meinen Auftrag ausgerichtet?«
Die Worte waren ihm unwillkürlich von den Lippen gefallen. Er lächelte darüber. Er wußte, daß sie ihn nicht verstehen konnte; aber es genügte ihm, daß er sie gesprochen hatte.
Mayo hatte sich losgerissen und war ihm zu Füßen gesunken. Sie umklammerte seine Kniee und lallte in eigenartig melodisch gurgelnden Lauten Unverständliches. Gewaltsam richtete er sie auf, schlang den Arm um ihre Hüfte und führte sie nach der Stelle, wo sein Lager bereitet war. Er sagte ihr tausend Zärtlichkeiten, und sie antwortete darauf, als ob sie ihn verstanden hätte. Es war ein ganz merkwürdiges Duett.
Sie erzählten sich noch mancherlei; sie lachten sich gegenseitig aus, daß sie sich nicht verstehen konnten, und freuten sich zugleich, daß sie sich doch wohlverstanden. Georg saß neben Mayo, er hielt fest ihre kleine Hand in der seinen. Endlich verstummte das kosende unnütze Geschwätz. Mayo entzog dem weißen Freunde langsam ihre Hand, lehnte sich zurück und ließ das müde Haupt auf die Fläche der rechten Hand sinken, während sie den linken Arm lang neben sich ausstreckte. Bald verkündeten die ruhigen, gleichmäßigen Atemzüge, daß sie eingeschlafen war.
Auch Georg suchte nun den Schlaf. Auch er hatte sich niedergelegt. Aber er fand ihn nicht sogleich. Sein Blick flog wieder auf zu dem mondlosen, unvergleichlich herrlichen, von Millionen diamantenglitzernder Welten bestirnten Nachthimmel, und seine Gedanken schwebten in launischem Zickzack in die Weite und flatterten wieder in seine nächste Nähe, um abermals in die Ferne zu schweifen. Er gedachte der Heimat, er mußte wieder mit einer mitleidigen Rührung an Noëmi denken, und an den braven Dutch Bill, – und zwischen all' die Gestalten, die zerrannen, wieder auftauchten, ineinanderflossen und sich verzerrten, drängte sich ein bronzefarbenes Mädchen mit schlanken zarten Gliedern von unsagbarer Anmut, mit braunen langbewimperten Augen von einem Ausdruck, der sein Tiefstes erschütterte, und mit den schönsten Zähnen, die je in einem menschlichen Munde geglänzt hatten. Eine ganz merkwürdige gurgelnde Altstimme, die Unverständliches lallte, klang ihm dabei in den Ohren, ein tiefes jauchzendes Lachen. Und seine Vorstellungen verwirrten sich. Er sah einen feuerroten Mantel durchsichtig in der Sonne flattern, und daraus sprengte sein Schutzheiliger hervor, der heilige Georg, der seine eigenen Züge trug. Er saß auf hohem Schlachtroß in goldener Rüstung, mit goldenem Helm, er hatte die Lanze eingelegt, um den Drachen, der sich zu seinen Füßen wand, zu durchbohren. Und das geschah in dem heißen Garten zu Denver, hart an der Veranda. Und was dann noch durch sein Hirn jagte, vermochte er nicht mehr festzuhalten.
Pluto hatte sich zu Füßen der beiden Schlummernden auf den Sand gestreckt.

Schon beim Erwachen hatte Georg eine besondere Freude bei der Erwägung empfunden, daß er nun nicht mehr allein war, daß er ein menschliches Wesen an seiner Seite hatte, – freilich, ein unvollkommenes menschliches Wesen, das zum Austausch menschlicher Empfindungen nicht angetan, und mit dem die Verständigung eine höchst schwierige und mangelhafte war; aber es war doch menschlich schön und konnte sich menschlich freuen, und das genügte ihm. Er hatte aus der Herde ein gutes leichtfüßiges Pferd ausgesucht und aus seinem Gepäck das Notzaumzeug hervorgeholt; und als Mayo die Augen aufschlug, stand das Tier aufgezäumt vor ihr.
Mayo wurde durch diese Aufmerksamkeit in helles Entzücken versetzt, und sie jubelte wieder in ihrer kindisch rührenden Weise auf. Sie hatte sich schnell erhoben, hatte den Kopf des Fuchses liebkosend an ihre schwarze Mähne gedrückt und mit der Handfläche zärtlich den Hals des Pferdes geklatscht. Sie hatte das Tier mit den Augen eines Kenners aufmerksam gemustert, die Zügel ergriffen und sich dann im Bügel aufgeschwungen; und im sausenden Galopp war sie davongejagt. Georg blieb wie gebannt stehen. Es war ein wundervoll malerischer Anblick. Auf dem guten Pferde das dunkelfarbige Mädchen mit den flatternden schwarzen Haaren, hinter der wie ein Feuerschein der rote Mantel herzog, dessen durchsichtiges Gewebe das Sonnenlicht durchdrang, und unter dem der Rücken von Roß und Reiterin tiefrot erglänzten. So hatte sich Georg Penthesilea gedacht, die Heldin seines Lieblingsdichters Kleist:
»... wie sie mit den Schenkeln
Des Rosses Leib inbrünstig umarmt!
Wie sie, bis auf die Mähn' herabgebeugt,
Hinweg die Luft trinkt lechzend, die sie hemmt.
Sie fliegt, wie von der Sonne abgeschossen.«
Mit Meisterschaft tummelte Mayo das gehorsame Tier, das der Herrschaft des Reiters lange Zeit entwöhnt, sich wieder mit Ehrgeiz der Führung gehorsam zeigte. Stolz und froh sprengte es, von Mayo sicher gelenkt, daher und hielt mit schnaubenden Nüstern und steifen Ohren, den Sand unruhig scharrend, vor Georg. Mayo klopfte ihm wiederum wie zur Belohnung den glatten Hals und sah mit einem sehr komischen Ausdruck höhnischer Herausforderung, muntern Spottes und übermütiger Verachtung auf Georg und dessen Braunen, den es mit gar nicht zu verkennender Geringschätzung, die Achsel zuckend, belächelte.
Georg verstand das auch sehr gut und gab ihrem heitern und stummen Hohne die Worte zurück:
»Oho! meinst du, daß du mehr kannst als wir?«
Er setzte sich in den Sattel. Mayo wußte sogleich, daß es sich um ein Wettrennen handelte, und mit fröhlichster Gebärde nahm sie den Kampf auf. Sie brachten ihre Pferde in gleiche Richtung und sahen sich wartend an. Auf einmal stieß Mayo einen hohen Schrei aus, und beide sausten davon. Es war Georg um den schließlichen Ausgang zwar nicht bange, – denn er kannte sehr gut die Leistungsfähigkeit seines Pferdes, und er kannte Mayos Fuchs, – aber er mußte doch viel mehr Anstrengungen machen, als er glaubte, um sich nicht beschämen zu lassen. Schließlich aber gönnte er doch Mayo die Freude des Sieges. Mayo war überglücklich. Sie liebkoste das Tier mit einer Vertraulichkeit wie ihresgleichen, drückte ihre Brust auf die Mähne und umschlang seinen Hals; und der Fuchs nickte verständnisinnig.
Mayo hätte das Spiel am liebsten gleich von neuem beginnen mögen; aber Georg machte ihr klar, daß er doch noch andere Geschäfte zu erledigen habe, und sie schien das auch ganz einleuchtend zu finden.
In seiner fröhlichen Stimmung wurde er doch eine unangenehme Anwandlung bei der Frage, die er sich beständig vorlegen mußte, nicht los: wie lange wird der Spaß dauern? Werden Mayos Zugehörige dem Mädchen so ohne weiteres Urlaub auf unbestimmte Zeit erteilen? Wird man sie nicht wieder abholen? Wird sie selbst nicht morgen schon, vielleicht heute noch davonziehen und zu den Ihrigen zurückkehren? Es wäre schade! Denn der Umgang mit diesem Mädchen, das nichts mit ihm gemein hatte, übte doch einen ganz besonderen Zauber auf ihn. Und noch ein anderes warf einen gewissen Schatten auf die lichte Freude des Augenblicks. Es war ihm, als ob er sich wegen der Vertraulichkeit mit dieser schlanken Wilden vor anderen rechtfertigen müsse – vor Noëmi zum Beispiel. Aber er schüttelte alle diese Gedanken wieder ab: Noëmi war fern, und vorläufig war Mayo da und schien noch keine Anstalten zu machen, die Gemeinschaft wieder aufzugeben.
Sie waren weiter gezogen und auf eine andere Abteilung des Lagers gestoßen. Dort bereitete Georg die erste gemeinsame Mahlzeit. Mayo sah den Vorbereitungen mit großer Aufmerksamkeit zu und war auf das Resultat sichtlich gespannt. Als sie Georg mit bestem Appetit essen sah, griff auch sie zu, und zwar ohne der umständlichen Vermittlung durch Messer und Gabel zu bedürfen, mit ihren kleinen braunen Händen. Georg schüttelte zwar den Kopf mit der Miene einer Gouvernante, als ob er sagen wollte: »Mademoiselle, das schickt sich nicht« – aber Mayo kümmerte sich nicht weiter darum. Sie verzog indessen den Mund, als sie das Fleisch zu sich genommen hatte, machte eine Gebärde des Widerwillens und warf das, was sie noch in der Hand hatte, vor sich in den Sand. Georg nötigte sie und redete ihr gut zu; sie wollte indessen nichts davon wissen.
Zum Glück war in dem Lager wieder ein »Store«, und Georg fand da, was seiner Gefährtin mundete: Mesquite-Bohnen, Wassermelonen, trockne Biskuits und dergleichen; und er kaufte davon einen genügenden Vorrat, um auf einige Tage Mayo unter den ihr genehmen Bedingungen ernähren zu können. Außerdem erstand er auch von dem Krämer einige Ellen grellfarbigen Kattuns, von dem er wußte, daß er nach dem Geschmack seiner Gefährtin sein werde.
Die Art und Weise, wie Mayo die große Wassermelone zerriß und den Saft, der ihr an den Mundwinkeln herunterlief, einsog, war ihm nicht gerade angenehm. Ein bißchen weniger wild wäre ihm lieber gewesen. Sie zeigte beim Essen in ihren Bewegungen, in ihrem Kauen auf einmal etwas völlig Unzivilisiertes, das in einem schneidenden Widerspruch zu der natürlichen Anmut ihres sonstigen Wesens stand, und das den verwöhnten Kulturmenschen abstieß.
Er saß ihr gegenüber und sah ihr zu, als sie mit dem Rande der Hand das schon ausgesogene, aber immer noch saftige Fleisch der Frucht abschabte und in der Handfläche zusammenpappte, um es an den Mund zu führen. Er klopfte ihr leicht auf die Finger, und sie sah ihn erstaunt an. Er zeigte ihr nun, wie man manierlicher essen könne, und sie hatte auch zunächst offenbar das Bestreben, sich gelehrig zu zeigen. Sie machte einige mißglückte Versuche und lächelte dabei über ihre Ungeschicklichkeit. Dann aber wurde sie ungeduldig, und mit einem Laute, der in allen Sprachen der Welt dasselbe bedeutet: »Ach was, laß mich zufrieden!« kehrte sie zu dem einfacheren Modus, bei dem sie aufgewachsen und gesund geblieben war, zurück und lachte ihren pedantischen Lehrmeister aus.
Alles das machte auf Georg doch vorwiegend den Eindruck des Komischen und Spaßhaften, und die Komik milderte wesentlich den Eindruck des peinlich Befremdenden, den solche Wahrnehmungen unwillkürlich zunächst in ihm hervorriefen. Er zürnte dem Mädchen nicht, er war nicht einmal ungehalten; er empfand gutmütiges Mitleid mit ihr; er ließ sie ruhig gewähren, sah sie mit den Händen herummanschen und vergnügt kauen und fühlte sich veranlaßt, ihr eine längere Rede zu halten:
»Iß nur ruhig weiter, mein Kind, wie du es gewohnt bist! Du verstehst es ja nicht besser und brauchst es auch nicht besser zu verstehen! Du bist ja nicht darauf eingerichtet, an der Seite eines mit Europens übertünchter Höflichkeit behafteten Leutnants a. D. zu tafeln. Bitte, unterbrich mich nicht! Du fütterst dich auf deine Weise, Kind – es ist zwar nicht die meine, aber wer weiß, wer recht hat? Du hast die Zeit, die wir Kulturmenschen dazu gebrauchen, um uns anständig benehmen zu lernen, darauf verwandt, deine Sinne zu schärfen und mit dem Pferde zu verwachsen; du hast in dunkler Nacht die Spuren gefunden, die dich zu mir geführt haben; du siehst gewiß mit deinen wunderschönen Augen tausend Dinge, die mir verborgen bleiben, und dein scharfes Ohr hört deutlich, was mir unvernehmlich bleibt. Iß also nur ruhig weiter, mein Kind! Vielleicht hast du sogar das bessere Teil erwählt und findest mich ebenso dumm wie ich dich. Denn darüber darfst du dir keine Illusionen machen: nach unsern Begriffen bist du furchtbar dumm und ganz ungebildet! Du siehst mich jetzt so freundlich an – hast du das verstanden? Gott bewahre! Kein Wort! Aber das schadet auch gar nichts. Ich sage es ja gar nicht deinetwegen.«
Mayo hatte die Melonenschalen weggeworfen und sich mit der Handfläche den Mund gewischt, sie legte nun die Hände in den Schoß und hörte mit einer Aufmerksamkeit zu, als ob sie jedes Wort verstände. Der Klang von Georgs Stimme und der Klang unsrer Sprache schienen ihr wohlzugefallen. Sie nickte auch ermunternd mit dem Kopfe und gurgelte irgend etwas Bittendes vor sich hin, als wolle sie den weißen Freund auffordern, mit seinem wohllautenden Vortrage fortzufahren.
»Nein, mein Kind,« sagte Georg mit heiterer Wichtigkeit, »Genügsamkeit ist eine Tugend; und schon einer unserer Klassiker sagt: Entbehren sollst du, sollst entbehren! – Meine Gedanken sind zwar nicht viel wert, aber dazu sind sie denn doch zu kostbar, daß sie bloß um des Klanges der Worte willen das Ohr einer kleinen unbekleideten Wilden erfreuen sollten. Das geht wirklich nicht! Wenn du mich aber denn durchaus hören willst, so will ich dir eine Geschichte erzählen, die deinem Verständnis näher liegt, so ein Märchen, wie es uns die Amme in der Kinderstube erzählt hat. Also paß gut auf.
Es ist ein Beweis meiner besonderen Hochschätzung. Hörst du, Mayo?«
Als sie ihren Namen hörte, richtete sie den Kopf freudig auf und grinste seelenvergnügt. Georg, den das törichte Spiel des Predigers in der Wüste belustigte, fuhr in seinem Monologe fort:
»Es war einmal ein großer Hund – wauwau – und eine große Kuh – muh ...«
Mayo war ganz außer sich vor Freude. Unbändig lachend sprang sie auf und umkreiste ihn in großen Sätzen; und wie Georg das Mädchen so um sich herumspringen sah, dachte er unwillkürlich an seinen alten Pluto, und ohne, daß er sich dabei etwas dachte, schnalzte er mit der Zunge und schnippte mit dem Daumen und dem dritten Finger, als ob er seinen Hund heranrufen wolle. Mayo folgte auch wie ein kluges Tier und lagerte sich neben ihn, ihr schwarzbemähntes Haupt vertraulich an seine Brust legend.
Und als er sie so in einer herrlich ungezwungenen Bewegung von unaussprechlicher natürlicher Grazie neben sich hingestreckt liegen sah, rührend in ihren unbewußten Reizen, da verstummte er.
Nun war er nicht mehr zum Spaßen aufgelegt, und der Zauber dieser echten, von keinem Zwange der Kultur beeinträchtigten, freien, wilden und schönen Weiblichkeit hatte ihn wieder ganz gepackt.
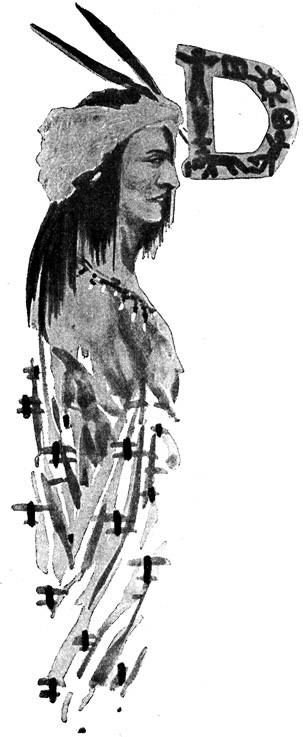
Der Verkehr zwischen den beiden veränderte sieh sehr wenig während der nächsten Zeit. Die Seltsamkeit des Abenteuers und das Ungewisse, mit dem es umgeben war, gewährten Georg eine unausgesetzte Anregung. Es war gekommen, er wußte nicht, wie, und es sollte enden, er wußte nicht, wann.
Immer wieder drängte sich ihm der Gedanke auf: wie lange kann es dauern? Und er kam nicht darüber hinweg, so sehr er sich bemühte, philosophisch des Augenblicks, der so schön war, zu genießen. Es war ihm bei dem Gedanken an eine Trennung zunächst recht unbehaglich zumute. Er erschrak, wenn er sich vergegenwärtigte, daß er bald wieder allein sein, und wie er dann Mayo vermissen werde. Freilich war es ja nur eine flüchtige Laune, nur ein neckisches Spiel seiner Sinne; aber er war davon doch tiefer erfaßt, als er sich selber gestehen mochte. Mit wahrer Liebe hatten sicherlich die Gefühle, die er für Mayo empfand, nichts gemein. Die schlanke, dunkle Kleine reizte ihn durch ihre befremdliche körperliche Schönheit, durch die wunderbare Harmonie und den eigenartigen Rhythmus ihrer Bewegungen. Sie rührte ihn zugleich durch ihre seelische und intellektuelle Unbeholfenheit. Er empfand Mitleid mit ihr, wie ein Vater mit einem Kinde, das an einem unheilbaren Gebrechen leidet.
War sie zu beklagen, war sie glücklich zu preisen?
Er wußte es selbst nicht. Sie war gewiß ihres Lebens in Staub und Sonnenstrahl von Herzen froh. Sie wußte nichts von den kleinen Bekümmernissen der überempfindlichen Kultur, nichts von den schweren Sorgen der Gesittung. Sie lebte wie der Vogel unter dem Himmel, sie säete nicht, sie erntete nicht, sie sammelte nicht in die Scheunen, und der himmlische Vater nährte sie doch; sie wuchs wie die Lilie auf dem Felde, sie arbeitete nicht, sie spann nicht, und war doch schöner als Salomo in aller seiner Herrlichkeit. Sie war in ihrer ungeheuern Einfalt sicherlich tausendmal glücklicher als so manche ihrer weißen Schwestern, die der Überfluß verweichlicht und die Bildung nur leidensfähiger gemacht hatte. Sie war reicher in ihrer unbändigen Bettelarmut als so manche, die ihr Dasein im frostigen Luxus vertrauerte. Er hatte ja selbst einen flüchtigen Einblick in die kranke Seele so eines armen reichen Mädchens werfen dürfen, Und er sah Noëmi im heißen Garten zu Denver vor sich; anders als früher. Ihr Auge hatte jetzt einen merkwürdig strengen, fast strafenden Ausdruck. Wie konnte er auch jene zarte mädchenhafte Blüte mit diesen! wild aufgewachsenen Geschöpfe vergleichen! Er schämte sich. Mochte auch die Tochter des reichen Kaufherrn zu Denver bittere Kränkungen und Enttäuschungen erdulden – sie lebte doch ein menschliches Empfindungsleben. Diese ahnungslose Wilde aber vegetierte nur.
Und es war ein so schönes menschliches Wesen, diese Mayo, und dabei so völlig unnütz, so unbildsam, so unfähig, an ihrem Seelenleben einen andern teilnehmen zu lassen und in das eines andern einzudringen. Sie tat ihm herzlich leid, wenn er sie ansah. Er konnte nicht anders mit ihr verkehren wie mit einem ganz kleinen Kinde oder mit einem klugen Tiere. Er vertrieb sich mit ihr die Zeit, wie er mit seinem Hunde gespaßt hatte, und rief sie oft unabsichtlich: »Pluto!« Wenn er ihr aber eine besondere Achtung erweisen wollte, so spielte er mit ihr wie mit einer lebendigen Puppe und putzte sie in närrischer Weise aus mit den bunten Lappen, die er im Store des Lagers gekauft hatte. Da zeigte sich bei Mayo eine weibliche Eigenschaft, die zwischen ihr und der Kultur eine Brücke zu schlagen schien: die Eitelkeit. Mayo nahm einen ganz andern Ausdruck an, wenn sie die lange safrangelbe Schleppe, die Georg übermütig an dem roten Mantel befestigt hatte, im Sande hinter sich herschleifte. Dann erhob sie den Kopf höher und ging mit wahrhaft königlichem Anstande daher.
Die Verständigung zwischen den beiden war nicht vollkommener geworden und reichte auch nicht weiter, als die mit einem klugen Haustiere. Georg hatte sich öfter bemüht, Mayo Unterricht zu erteilen; er hatte es sich in den Kopf gesetzt, ihr einige englische Wörter beizubringen; aber dazu verspürte Mayo nicht die geringste Lust und zeigte auch nicht das mindeste Geschick. Sie sträubte sich sogar mit auffälligem Eigensinn, die ihr vorgesprochenen Worte nachzusprechen, und hielt ihm eines Tages mit einer gewissen Erregung eine lange und offenbar sehr beredte Rede, in der sie ihm vermutlich mit schlagenden Argumenten auseinandersetzte, daß sie zu Georg nicht in die Lehre gegangen sei und auch gar nicht die Absicht habe, von ihm belehrt zu werden.
Ebenso sträubte sie sich, Georg mit den Geheimnissen ihrer Muttersprache vertrauter zu machen. Ihr genügte ja der Verkehr, wie er war, vollkommen, und sie war mit ihrem Lose zufrieden. Sie war bei ihm, sie hatte ihr schnelles Pferd, sie hatte ihre warme Decke, ihr Zelt, sie hatte genug, um Hunger und Durst zu stillen, sie war ganz zufrieden! Und wenn sich Georg mit ihr beschäftigte, wenn er mit ihr spielte, mit ihr lachte, mit ihr um die Wette lief und ritt, sie ausputzte und ihr bunte Lappen schenkte, dann war sie das glücklichste Geschöpf unter Gottes Sonne.
So waren Tage vergangen, die Georg merkwürdig lang und voll erschienen waren, und eigentlich waren sie doch völlig ereignislos und erstaunlich einförmig.
Nur ein geheimnisvoller Zwischenfall hatte sich zugetragen.
Georg hatte einst nach Sonnenuntergang, als die Herde lagerte, die Lust verspürt, sich ein wenig allein umzutun. Er hatte Mayo bedeutet, bei den Tieren 511 bleiben, war auf seinen Braunen gestiegen, hatte die Flinte übergehängt und war davongeritten. Als er nach etwa zwei Stunden zurückkehrte, war Mayo verschwunden. Ihr Fuchs stand ruhig neben dem Zelte und nickte bedächtig, die Hunde waren aber etwas unruhig. Georg machte sich auf die Suche und rief ihren Namen. Er durchritt die ganze Gegend, es war keine Spur von ihr zu entdecken. Er war nicht weiter beunruhigt, er nahm an, daß er es wieder einmal mit einer der ihm nicht begreiflichen Launen der kleinen Wilden zu tun habe, richtete sein Nachtlager her und schlief bald ein. Nach einigen Stunden, in der Mitte der Nacht schlugen die Hunde leise an, nur um zu melden, daß etwas komme, aber um gleichzeitig anzudeuten, daß es nichts Feindliches und Fremdes sei. Georg sprang mit einem Satze vom Lager auf und wußte sogleich, um was es sich handelte.
»Mayo!« rief er laut und vernahm gleich darauf als Antwort den ihm bekannten hohen Schrei des Mädchens.
Atemlos, keuchend, mit Schweiß bedeckt kam sie daher; wie in furchtbarer Erregung warf sich das Mädchen an seine Brust und winselte und schrie. Vergeblich versuchte Georgs sie zu beruhigen und den Grund ihrer erschrecklichen Aufregung zu erforschen. Sie konnte gar nicht zu sich kommen. Es verging geraume Zeit, bis sie sich endlich zu sammeln vermochte. Die Nacht war zwar hell, und Georg sah sehr wohl, daß ihm Mayo in dringlicher Gebärdensprache irgend etwas mitzuteilen habe, aber er war nicht imstande, den Sinn ihrer gewaltsamen Bewegungen und Verrenkungen zu erfassen. Sie deutete auf dieselbe Schleppe an ihrem roten Mantel, deutete auf ihr schwarzes Haar, machte wilde Gesten, die wie auf einen Kampf hinwiesen, und war ganz verzweifelt darüber, daß Georg sie nicht verstand. Sie schrie vor Wut, und ihre sonst so wohlklingende tiefe Stimme war heiser und rauh.
Es währte lange, bis es Georg gelang, sie endlich zu beruhigen.
Am andern Morgen versuchte sie es noch einmal, Georg von dem Geschehenen in Kenntnis zu setzen. Sie war über Georgs Schwerfälligkeit geradezu entrüstet und sah ihn verächtlich an, daß er sie nicht verstand, die sich doch so klar und vernehmlich ausdrückte! Dann aber schien sie ihn um Verzeihung zu bitten wegen ihrer ungerechten Aufwallung. Sie schmiegte sich fest an ihn und wollte gar nicht von ihm lassen, als habe sie Furcht, ihm entrissen zu werden. Georg erkundigte sich im Laufe des Tages bei den Treibern, zu denen er herangeritten war, ob sie irgend etwas Besonderes bemerkt hätten. Diese wußten aber von nichts.
Die Episode schien keine andere Nachwirkung zu haben, als daß Mayo von nun an mit einer gewissen Unruhe und Scheu alles, was ihr ungewöhnlich erschien, wahrnahm. Bisweilen hielt sie mitten im Ritte inne, legte den Kopf nach der Seite, hob den Zeigefinger auf und lauschte mit gespanntester Aufmerksamkeit. Mitunter, wenn ihr das Geräusch verdächtig erschien, sprang sie von ihrem Fuchs ab, setzte sich hinter Georg auf den Braunen und umklammerte zitternd seine Brust.
Es vergingen mehrere Tage, bis die völlige Ruhe wieder in sie einkehrte. Bis auf diese geheimnisvolle Begebenheit waren die Stunden im ruhigen Einerlei dahingeflossen. Georg hatte eigentlich allen Grund heiter und guter Dinge zu sein, denn in Bristol hatte er in der Tat einen der Agenten, von denen Kaspar gesprochen hatte, aufgefunden und mit diesem ein glänzendes Geschäft abgeschlossen. Den größten Teil seiner Pferde verkaufte er bar für einen guten Preis und ließ sie an Ort und Stelle, und auch wegen des andern war der Handel abgeschlossen; er mußte sie nur einige Tagereisen weiter westwärts treiben, wo er sie gegen den bedungenen Preis abzuliefern hatte. Es war also alles weit über Erwarten gut verlaufen, und wenn Georg in Denver in seinem Briefe an den Oheim, der Zukunft vorgreifend, bloß zur Beruhigung seiner Angehörigen gesagt hatte, daß er auf dem besten Wege sei, es zu etwas zu bringen, so hatten jetzt die Tatsachen aus einer gutmütigen Prahlerei eine Wahrheit gemacht.
Er hätte sich also von ganzem Herzen freuen sollen; aber er konnte sich wirklich nicht freuen. Es lastete etwas auf ihm wie ein schwerer Druck. Er wußte zunächst selbst nicht recht, was es war, er wollte es sich wenigstens nicht gestehen. Aber es half nichts, er mußte mit sich darüber ins Klare kommen: das Mädchen war es, Mayo!
Sie schien sich an die Geselligkeit mit ihm völlig gewöhnt zu haben. Sie tat auch nichts, was irgendwie auf eine Trennung hingedeutet hätte. Aber er war nun bald am Ziele seiner Wanderung; er näherte sich jetzt den großen Städten. Und da drängte sich ihm die Frage auf, die der Einäugige schon auf der Holzbank an den »Needles« an ihn gerichtet hatte: was sollte er mit dem Mädchen anfangen?
Sie war nun einmal bei ihm. Sie hatte sich seinem Schutze anvertraut. Er konnte sie doch nicht einfach im Stiche lassen. Freilich mußte er sich sagen, daß die Verantwortlichkeit, die er zu tragen hatte, verhältnismäßig nicht sehr drückend sei. Er hatte keine teuflischen Verführungskünste angewandt, um das Mädchen an sich zu fesseln; die Unbändige hatte sich ihm angeschlossen, weil es ihr so gefiel. Er hatte ihr keine Versprechungen gemacht und keine Verbindlichkeit irgendwelcher Art übernommen; aber immerhin – sie war da!
Es schnitt ihm in die Seele, wenn sie ihn mit ihren ahnungslosen Augen freundlich ansah. Er konnte ihr nicht einmal sagen, daß das Ende nahe. Er mußte sich beherrschen und darüber wachen, daß sein Mitleid nicht seine Zärtlichkeit verdopple.
Er beobachtete sie aufmerksam. Sie war sorglos und arglos wie immer, ungelehrig und zufrieden, anhänglich und wild wie ein Tier.
Daß ihn eine Kluft, die gar nicht überbrückt werden konnte, von dem schönen Geschöpf trennte, war ihm schon in den ersten Tagen klar geworden und wurde ihm mit jedem Tage klarer. Es gab keinen Weg, der Kultur und Wildheit zusammenführte. Er empfand mit der Zeit einen gewissen Verdruß darüber, daß alle Versuche, das Mädchen zu sich emporzuheben, an ihrem völligen Unverständnis scheiterten, daß nichts in diesem undankbaren Boden Wurzel schlug. Der Reiz der Neuheit war vorüber, und das, was ihn zuerst befremdlich angestachelt hatte, war ihm vertraut geworden. Er wurde stiller und schwerfälliger.
Er langweilte sich.
Und eine ähnliche Wandlung schien sich auch in Mayo zu vollziehen. Sie war weniger beweglich und leichtfüßig wie früher, sie sprang nicht mehr um ihn herum, sie ergötzte sich nicht mehr in wilden Ritten; gedankenlos trabte sie neben der Herde und ließ die Blicke zwischen den Ohren des Fuchses vor sich in die unbestimmte Ferne schweifen. Ob auch sie ein Sehnen nach den Ihrigen empfand?
Georgs grüblerische Verstimmung verstärkte sich immer mehr, und an gewissen Einzelheiten mußte er immer wieder deutlich und empfindlich wahrnehmen, wie eine unendliche Entfernung ihn von dem bronzefarbigen Mädchen trennte, mit dem er nun seit Wochen in inniger Gemeinschaft lebte.
Bei einer der gemeinsamen Mahlzeiten waren sie eines Tages wieder in heiterer Stimmung. Mayo neckte den weißen Freund mit allerhand Späßen, die er freundlich aufnahm. Aber an einer dieser Neckereien vermochte Georg durchaus keinen Gefallen zu empfinden. Mayo hatte wieder eine Wassermelone ausgesogen und warf ihm dabei übermütig lachend die nassen Kerne ins Gesicht. Sie fand das reizend und lachte sich halbtot darüber.
Georg gab sich zwar die größte Mühe, gute Miene zum bösen Spiel zu machen, aber es war ihm doch etwas zu stark, und er vermochte es nicht, seine Verdrossenheit über den ihn ungehörig dünkenden Scherz zu verbergen. Als Mayo das bemerkte, war sie ganz bestürzt und sah ihn so wehmutsvoll und so beängstigt an, daß er wieder von einer mitleidigen Regung befallen wurde und einsah, wie er ihr nicht grollen dürfe. Sie hatte ja nicht gewußt, was sie tat.
Ebenso störend wie manche ihrer Neckereien waren ihm auch mitunter die Ausbrüche ihres Unwillens. So hatte sie einmal von Georg verlangt, er solle sie wieder ausputzen, und alle bunten Lappen herbeigeschleppt. Georg hatte keine Lust dazu verspürt und sie ziemlich unwillig abgewiesen. Wie ein gepeitschter Hund war sie davongeschlichen und hatte sich versteckt. Als er sie nach langem Suchen nicht hatte auffinden können, war er ziemlich unruhig geworden, hatte sich auf seinen Braunen gesetzt und wollte sie suchen. Auf einmal wurde das Pferd durch einen Steinwurf erschreckt und machte einen so jähen und wilden Satz, daß Georg sich nur mit großer Mühe im Sattel zu halten vermocht hatte. Entrüstet über den boshaften Streich, bei dem er das Genick hätte brechen können, blickte er um sich. Da sah er zwanzig Schritte von sich, wie aus dem Boden aufgeschossen Mayo in herausfordernder Stellung vor sich. Sie hatte die Hand in die Hüfte gestemmt, warf den Kopf trotzig in den Nacken, und aus ihren Mienen war deutlich zu lesen: Jawohl, ich habe den Stein geworfen, mach' nun mit mir, was du willst! Sie rührte sich auch nicht von der Stelle, als Georg heransprengte. Sie biß die Lippen fest zusammen, als er ihr zu verstehen gab, daß er solche Späße noch weniger zu dulden gesonnen sei als ihre übermütige Neckerei. Sie schien sogar auf eine Züchtigung gefaßt zu sein. Sie ballte die beiden Fäuste, hob den rechten Fuß des nach hinten gestreckten Beines auf, wie zum Sprunge, als wolle sie sich bei einem etwaigen Angriffe wie eine Katze auf ihren Gegner stürzen. Sie schmollte und trotzte den ganzen Tag hindurch, und auch am folgenden Morgen sprengte sie der Herde weit voraus und mied jede Begegnung mit Georg.
Georg war darüber gar nicht ungehalten. Als er seinen Gedanken allein überlassen war, gestand er sich ehrlich, daß Mayo ihm in der letzten Zeit lästig geworden war. Er übte jetzt eine schärfere Kritik an seinem Verkehr mit ihr, und er kam sich selbst unglaublich kindisch vor, daß er mit diesem ausgewachsenen, reifen Menschenkinde nur in törichten Spielereien die Stunden verbringen könne.
Schon seit einiger Zeit war ihm das aufgedämmert, und seitdem er die Erkenntnis erlangt hatte, konnte er nicht mehr unbefangen wie früher mit ihr spielen und kam sich selbst lächerlich vor. Er selbst fand kein Vergnügen mehr daran, und was ihn am meisten entmutigte, war die Wahrnehmung, daß auch Mayo der Sache überdrüssig zu werden schien, daß auch sie sich zu langweilen angefangen hatte. Nur aus dieser Stimmung heraus hatte er sich die zornige Aufwallung, die ihm Kopf und Kragen hätte kosten können, zu erklären vermocht.
Ja, wenn er sich die Veränderung, die in Mayos Wesen sich vollzogen hatte, vergegenwärtigte, so konnte er nicht mehr daran zweifeln, daß sie von einem starken Unbehagen beherrscht war. Sie war langsamer und verdrossener in ihrem ganzen Wesen, und wenn sie abends Rast machten, so drängte sie sich nicht mehr wie früher an seine Seite, war ihm nicht mehr wie früher behilflich das Lager zu bereiten, sie ging abseits, hockte sich auf den Sand, stemmte die Ellbogen auf die Knie und den Kopf in die Hände und blickte unausgesetzt mit unendlich schwermütigen verlangenden Blicken nach Osten, von wo sie gekommen war.
Kein Zweifel, die Sehnsucht nach den Ihrigen bewegte das Herz des armen Mädchens.
Sie fuhr auch nicht mehr schreckhaft zusammen und suchte auch nicht mehr Schutz bei Georg, wenn sie irgend ein Geräusch vernahm; sie horchte sogar mit freudiger Erwartung auf und war enttäuscht und verstimmt, wenn sie die Ursache erforscht hatte, die ihren Erwartungen eben nicht entsprach.
An alles das dachte Georg, als er nun allein war, und er dachte daran mit wechselnden Gefühlen einer zärtlichen Rührung für das schöne schlanke braune Mädchen, eines unwilligen Mitleids über ihre Ungelehrigkeit, über alles Scheitern seiner Versuche, sie sich zu nähern, eines gewissen unklaren Gefühls von Scham vor anderen Leuten, vor Jeffersons zum Beispiel, und peinigender Besorgnis über das, was nun werden solle.
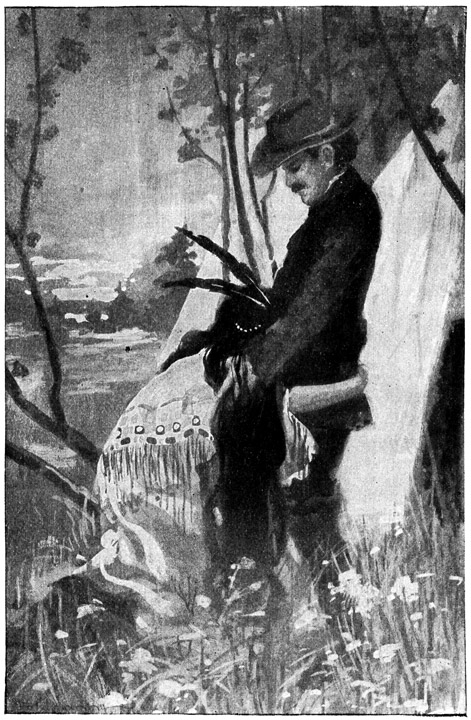
Nur noch zwei Tagereisen trennten ihn von dem vorläufigen Ziele seiner Wanderung, dann kamen die größeren Städte. Was sollte er da mit Mayo anfangen? und schließlich kam die ganz große Stadt San Franzisko, wo er geschäftlich mit Augustus W. Jefferson abzurechnen hatte, wo er Noëmis Freundin, Bella White, begrüßen sollte. Was sollte er da mit Mayo anfangen?
Immer wieder tauchte diese Frage in ihm auf, und in launischem und unerklärlichem Spiel führte ihm seine Phantasie jene beiden Mädchen zusammen, das bleiche Kulturkind aus Denver und die bronzefarbige Wilde der Mohave-Wüste.
Sein Plan war fertig: sobald der Pferdehandel abgeschlossen war und er frei über sich verfügen konnte, wollte er mit Mayo nach den »Needles« zurückkehren und sie wieder zu den Ihrigen bringen. Von da wollte er dann auf schnellstem Wege allein nach San Franzisko gehen.
Georg war am Ufer eines kleinen Binnensees angelangt, wo er den letzten Rasttag machen wollte. Seit Stunden hatte sich Mayo nicht blicken lassen. Die Sonne stand tief, und der ungeheure tiefrote Feuerball beleuchtete ganz herrlich die gelbe, mäßig bewachsene Ebene, den glatten Spiegel des Wassers und die fernen Höhenzüge. Pluto schlug leise an, und dadurch aufmerksam gemacht, blickte Georg um sich.
In mäßiger Entfernung sah er Mayo heransprengen. Etwa zwanzig Schritte von ihm hielt sie und stieg ab; nicht wie sonst sprang sie in großen behenden Sätzen jauchzend ihm entgegen, sie duckte sich und schlich ganz unheimlich an ihn heran.
Als sie in seine nächste Nähe gelangt war, kroch sie auf dem Boden bis zu seinen Füßen, umklammerte seine Kniee und stieß dabei ein ergreifendes Winseln mit hohen, heulenden, von Schluchzen unterbrochenen Klagetönen aus. Georg wurde davon ganz erschüttert. Er wollte sie aufrichten und an sich ziehen, Mayo sträubte sich und hielt Georgs Kniee fest umklammert. Unaufhaltsam stürzten aus ihren Augen die Tränen, und sie jammerte und weinte zum Herzerweichen. Georg streichelte ihre schwarzen Haare und klopfte ihr beschwichtigend freundlich und versöhnend die Schulter. Mayo konnte gar nicht wieder zu sich kommen. Es dauerte lange, lange Zeit, bis sie sich endlich beruhigte. Dann ließ sie sich neben Georg nieder, in der hockenden Stellung, die ihr eigentümlich war, die Füße gegen die Brust gezogen, die Ellbogen auf die Kniee und den Kopf auf die Hände stützend, und blickte mit ihren tiefen, traurigen rührenden Augen unverwandt auf die sinkende Sonne, von deren rotem Lichte übergossen sie in ihrer Trauer ihm schöner als je erschien. Manchmal wandte sie langsam den Kopf nach Georg und sah ihn schmerzlich an. Sie reichte ihm ihre Hand und drückte die seinige auf einen Augenblick. Dann zog sie sie wieder zurück und stützte das der sinkenden Sonne wieder zugewandte, von tiefem Weh durchzuckte Antlitz darauf. Endlich schlich sie von ihm, legte sich etwa dreißig Schritte von ihm entfernt auf den Sand nieder und schlief ein.
Auch Georg war todmüde und verfiel bald in festen Schlaf. Es war ihm so, als ob mitten in der Nacht der Hund angeschlagen hätte, aber er legte sich nicht recht Rechenschaft davon ab, und da Pluto sich nicht mehr regte, war sein tiefer Schlaf dadurch nur auf einen Augenblick gestört worden.
Georg schlief länger als gewöhnlich. Mayo, die er sonst bei seinem Erwachen immer begrüßt hatte, war nicht da. Da er aber ihren Fuchs vor sich neben seinem Braunen sah, nahm er an, daß sie nicht weit sein könne. Nachdem er die Vorbereitungen zum Aufbruch getroffen hatte, suchte er Mayo – und heute mit einem gewissen Gefühl von Beängstigung, das ihm bisher fremd gewesen war. Er ritt die ganze Strecke ab, stundenlang, bis er alle Treiber gesprochen hatte, er rief, er pfiff, es half alles nichts. Er gab sogar zwei Schüsse ab – keine Antwort.
Plötzlich befiel ihn der Gedanke, daß Mayo davongelaufen sei, und zugleich bemächtigte sich seiner das bestimmte Gefühl, daß sie nicht wieder komme.
Mayos Zerknirschung und tiefe Trauer am vergangenen Abend – war das der Abschiedsgruß gewesen?
Georg wußte nicht, wie er alles das deuten sollte. Einstweilen hatte er für nichts anderes Sinn, als sich Gewißheit über das Verbleiben von Mayo zu. verschaffen.
Wenn sie nicht wiederkam?
Er mußte sich ehrlich gestehen, daß seine Wünsche, die er sich selbst kaum eingestehen mochte, dann eigentlich erfüllt wären. Er konnte ja mit dem Mädchen nicht sein Leben verbringen! Alles das war wahr und richtig; aber dennoch empfand er eine gewisse Niedergeschlagenheit bei dem Gedanken, daß das Mädchen auf immer von ihm geschieden sei.
Er hatte geraume Zeit an demselben Flecke verweilt, er war noch immer am Ufer des kleinen Binnensees, und am Nachmittage war der größere Teil der Herde mit den Treibern zu ihm gestoßen. Auf sein wiederholtes Befragen vermochten ihm diese keine Auskunft zu geben. Er mußte vorwärts, es half nichts, er konnte nicht umkehren und den Spuren des Mädchens weiter nachforschen. Als aber wiederum die Sonne dem Untergang zueilte, und Mayo sich noch immer nicht hatte blicken lassen, gab er alle Hoffnung auf. Er wußte, daß sie ihn verlassen hatte – und auf Nimmerwiedersehen!
So war es gewiß am besten. – Er fühlte sich auch wie von einem schweren Druck erleichtert. Aber alle Erwägungen seiner Vernunft vermochten nicht, die wehmütig milde Trauer, die ihn ganz erfüllte, zu verscheuchen. Gefaßt und in sich gekehrt erfüllte er seine Pflichten, und nun, da er wieder allein war, empfand er erst, was ihm die braune Genossin gewesen war. Einmal über das andere sagte er still vor sich hin: »Arme Mayo!« Aber sie war und blieb verschwunden.

In dem Flecken Mohave, von wo aus die südliche Pazifikbahn direkt nach San Franzisko führt, brachte Georg mit dem Agenten, den er in Bristol getroffen hatte, das Pferdegeschäft zum Abschluß. Er lohnte die Treiber ab und hatte allen Grund, mit dem Handel vollauf zufrieden zu sein. Mit dem nächsten Zuge in der Frühe wollte er zur Hauptstadt Kaliforniens hinauffahren.
Am Abend saß er mit jenem Agenten, einem verschmitzten Mexikaner, namens Pedro Falquez, in der Wirtsstube und schwatzte von diesem und jenem. Ganz nebenbei bemerkte Falquez:
»Sie sind wohl froh, daß Sie die kleine Indianerin, die Sie vor ein paar Tagen in Bristol bei sich hatten, wieder los geworden sind?«
Georg sah ihn groß an.
»Woher wissen Sie ...?« fragte er.
»Woher ich es weiß? – Weil ich mit ihr zusammengetroffen bin. Ich habe sie auf den ersten Blick wiedererkannt an ihrem roten Mantel und der Goldmünze. Sie tränkte ihr Pferd an demselben Brunnen wie wir die unsrigen, nicht weit von Waterman. Sind Sie nicht auch durch das Nest gekommen? Vom scharfen Ritt schienen sie ziemlich ermüdet zu sein.«
»Waren es denn mehrere?« fragte Georg, der seine innere Bewegung möglichst zu verbergen suchte.
»Aber wissen Sie denn nicht?« gab Falquez zurück. »Das Mädchen hatte einen Begleiter, einen hübschen Burschen, hochgewachsen, braun wie eine Kaffeebohne, mit safrangelbem Tuch in den Haaren und einer geschlängelten roten Linie quer übers Gesicht. Auf demselben Pferde waren sie dahergesprengt und auf demselben Pferde sprengten sie wieder davon, in der Richtung auf den Kolorado.«
»Und sie folgte gutwillig?« fragte Georgs der am liebsten eine verneinende Antwort gehört hätte.
»Versteht sich!« antwortete der Agent einfach.
Es fiel Georg wie Schuppen von den Augen. Er erinnerte sich nun sehr wohl des hochgewachsenen Burschen mit dem gelben Tuch und der roten Schlangenlinie und des eigentümlichen Ausdrucks, mit dem dieser ihn betrachtet hatte, als er zuerst in das Lager an den »Needles« gekommen war. Er verstand nun auf einmal die ihm unverständlich gebliebene Szene, die dem ersten Verschwinden Mayos gefolgt war, ihr pantomimisches Spiel, ihr Hinweisen auf die gelbe Schleppe und die schwarzen Haare, ihre lebhaften Gebärden. Der Gelbe hatte sie entführen wollen, und sie war ihm damals entkommen. Der Gelbe war ihnen gefolgt, und endlich, da Mayo die Erkenntnis aufgegangen war, daß doch geschieden sein müsse, hatte sie ihn gesucht, gefunden und sich über die heimliche Flucht in der Nacht mit ihm verständigt.
Das war ihm nun alles sonnenklar! Er wußte nicht, ob er sich darüber freuen oder grämen solle. Er empfand gleichzeitig ein Gefühl ernsthafter Befriedigung und tiefer Wehmut. Er sagte sich zwar, daß es so am besten sei; aber es tat ihm doch recht wehe.

Am Vormittag des folgenden Tages traf Georg bei leuchtendem Sonnenschein in San Franzisko ein. Die schöne Beherrscherin des Stillen Ozeans machte auf ihn, der aus dem Sande von Arizona und der Dürre der Mohavewüste kam, einen tiefen Eindruck. Was war das für ein Leben. Mit heitern Blicken musterte er das bunte Treiben auf den imposanten Straßen, die schönen Wagen und herrlichen Pferde, die auffallenden und prächtigen Toiletten der Damen. Der sonderbare Zauber der Großstadt erfüllte ihn ganz. Die große Gemeinsamkeit der Menschen, die zwar die Qualen, aber auch die Lebensfreudigkeit des Einzelnen erhöht, wirkte eindringlich und tief auf ihn. Er fühlte sich erfrischt, erfreut, erstarkt. Die Sage des Altertums von dem Riesen Antäus, der durch Berührung der Mutter Erde jedesmal neue Kraft gewinnt, erschien ihm nun als ein getreuer symbolischer Ausdruck dessen, was er jetzt empfand.
An der Office des Palacehotels hörte Georg, daß Mr. Jefferson aus Denver bereits seit zehn Tagen im Hotel seine Wohnung genommen hatte; und als er seinen Namen angab, wurden ihm zahlreiche Briefe aus Europa eingehändigt, und er erhielt gleichzeitig die Mitteilung, daß seine Koffer im Depot des Hotels für ihn bereitstünden. Er beorderte dieselben gleich auf das ihm angewiesene Zimmer und hinterließ eine Zeile für Mr. Jefferson, in der er seine Ankunft anzeigte.
Draußen war es drückend heiß geworden. Georg hatte sein behagliches Zimmer ganz verdunkelt und verschlang mit wahrem Heißhunger die Berichte aus der Heimat. Sie brachten ihm nur Erfreuliches, und er war in der allerheitersten und leichtesten Stimmung.
Es war ihm ganz sonderbar zumute, als er den großen Koffer, den er zum letztenmal im Zollhause bei seiner Ankunft in New York geöffnet hatte, auspackte. Es war ihm, als ob er mit einem Male wieder in Beziehungen zu den Seinigen träte. Die Wahrnehmung, mit welcher Umsicht und Genauigkeit der gute Fritz alles erledigt hatte, rührte ihn. Eine jede Geringfügigkeit führte ihm mit einer gewissen Schärfe irgend eine längst vergessene Situation ins Gedächtnis zurück; aber es war nicht die trübe Wehmut, die ihn bei seinem Eintreffen in Denver überfallen hatte; er war freudig und frisch, leicht und froh, und ihm war, als ob er mit seinen Berliner Kleidern wieder den alten Kulturmenschen angezogen habe. Die Erlebnisse der letzten Wochen, die eigentümlichen Tage in der Mohavewüste schienen weit hinter ihm zu liegen – weiter, viel weiter als die Berliner Tage, mit denen er nun auf einmal wieder innige Fühlung gewonnen hatte.
Gegen drei Uhr nachmittags – Georg schrieb gerade einige sehr vergnügte Briefe nach Hause – überbrachte ihm ein Schwarzer eine Visitenkarte mit der Aufschrift: »Augustus W. Jefferson wäre sehr erfreut, Mr. Georg Lutzen zu sprechen. Zimmer 252.«
Georg folgte der, Aufforderung auf der Stelle. Mit ganz ungewohnter und unerwarteter Herzlichkeit wurde er von Mr. Jefferson bewillkommnet. Der kleine Mann erschien ihm heute viel lebensfrischer und sympathischer als bei seinen früheren Begegnungen, namentlich der letzten in Denver. Er beglückwünschte Georg wegen des errungenen großen Erfolges mit einer Wärme, die Georg in den Tagen seiner Mißerfolge schmerzlich vermißt hatte. Mit festem Händedruck sagte ihm Mr. Jefferson, er habe sich des Vertrauens, das Jefferson in ihn gesetzt, in jeder Weise würdig gezeigt und seine Aufgabe mit Männlichkeit und Umsicht vortrefflich gelöst. Georg wandte ein, daß man seine Verdienste überschätze, die Sache sei viel einfacher verlaufen, als er selbst erwartet habe. Aber Jefferson ließ sich dadurch nicht irre machen.
»Sie haben freilich Glück gehabt,« sagte er; »aber man verliert auch mit guten Karten.«
Das Beispiel leuchtete Georg allerdings ein, und lächelnd sagte er:
»Man verliert sogar hauptsächlich mit guten Karten.«
»Und es ist Ihnen gut bekommen!« rief Jefferson vergnügt aus. »Der Winter im Felsengebirge hatte Sie gealtert, der Sommer in Arizona und Kalifornien hat Sie wieder verjüngt. Sie sehen vorzüglich aus!«
Georg dankte für das Kompliment etwas zerstreut; denn sein Blick hatte einen Gegenstand erspäht, der seine Aufmerksamkeit in hohem Grade in Anspruch nahm: Auf dem runden Tische vor dem Sofa lag ein eleganter Sonnenschirm mit gebeizter Elfenbeinkugel als Griff, offenbar ein Damenschirm. Wem mochte der Schirm gehören? Hatte Mr. Jefferson sein Programm verändert? Hatten ihn die Damen, anstatt in Las Vegas zu bleiben, hierher begleitet?
»Ich habe mich noch nicht einmal nach Ihren Damen erkundigt,« sagte Georg, der darauf brannte, sich Gewißheit zu verschaffen.
»Ich danke,« erwiderte Mr. Jefferson. »Es geht alles gut. Ich habe heute früh einen Brief von meiner Frau aus Las Vegas bekommen.«
»Und Fräulein Noëmi?« wollte Georg dazwischenwerfen.
Aber Jefferson ließ ihm keine Zeit dazu. Er trat sofort in die geschäftliche Unterredung ein, und Georg mußte ihm auf das Gebiet wohl oder übel folgen. Er war und blieb indessen zerstreut und zerbrach sich den Kopf über die Besitzerin des Sonnenschirms. Während ihm Mr. Jefferson vorrechnete, daß er so und so viel verdient habe, und daß das Geld heute nachmittag für ihn in der Kaliforniabank niedergelegt werden würde, blickte Georg unausgesetzt auf den Schirm und fragte sich immer wieder, wem er wohl gehören könne?
Jefferson, durch Georgs Erfolg ermutigt, hatte neue und große Ideen mit seinem jugendlichen Partner vor. Er entwickelte ihm auch schon in breiten Zügen einen Plan, der darauf hinauslief, Georg womöglich dauernd an sich zu fesseln. Jefferson sagte, daß er sich müde, abgespannt und alt fühle, und daß es ihm schmerzlich sei, wenn die Unternehmungen, die eingeleitet und in gedeihlichem Fortgange begriffen seien, nicht zu gutem Ende geführt werden sollten. Er brauche einen tüchtigen, tatkräftigen, jungen Mann; er habe leider keinen Sohn, und er glaube, daß er in Georg eine Persönlichkeit, wie er sie suche, finden werde.
Alles das sagte Mr. Jefferson mit einer Einfachheit und Wärme des Tones, die Georg aufs neue freudig überraschten, und er wäre vielleicht für dies väterlich freundschaftliche Entgegenkommen noch dankbarer gewesen, wenn er nicht nebenbei immer an die Besitzerin des Schirmes, mit dessen glatter Kugel er spielte, hätte denken müssen.
Da ging die Tür auf; und die Hoffnung, die er im stillen gehegt hatte, erfüllte sich: Noëmi trat ein.
Eine flammende Röte flog über ihre Stirn, als sie Georg erblickte und ihm die Hand entgegenstreckte. Georg war aufgesprungen und begrüßte Noëmi in der herzlichsten Weise. Etwas über ein Vierteljahr hatte die Trennung gewährt, nicht länger! – und doch erschien ihm Noëmi merkwürdig verändert. Sie sah nicht so verstimmt, so gelangweilt, so enttäuscht aus, wie er sie in Denver gefunden hatte. Sie machte den Eindruck größeren Ernstes; sie erschien ihm gereift; und nun, da das Rot, das das Wiedersehen auf ihre Wangen getrieben hatte, wieder gewichen, bemerkte Georg, daß sie sehr blaß geworden war. Sie war etwas älter und viel schöner geworden. Es war ihm ganz klar, daß sie unter dem Reflexe der schläfrigen Mutter und der öden Häuslichkeit in dem heißen sandigen Denver gelitten hatte.
Sie machte übrigens gleich nach der Begrüßung dieselbe Wahrnehmung, der Mr. Jefferson schon Ausdruck gegeben hatte: auch sie fand, daß Georg sich äußerlich sehr zu seinem Vorteil wieder verändert habe.
Die Drei setzten sich und unterhielten sich in der gemütlichsten, zwanglosesten Weise wohl eine Stunde lang von diesem und jenem. Mit wahrem Entzücken hörte Georg dem jungen Mädchen zu, und jede ihrer einfachen Redewendungen machte jetzt auf ihn einen besonderen Eindruck. Er fühlte überall Gleichgestimmtes, Gleichartiges; der Hauch der Bildung umwehte ihn und tat ihm wohl. Ohne daß er sich Rechenschaft darüber ablegte, stellte er wiederum unwillkürliche Vergleiche zwischen dem bleichen, klugen, wohlerzogenen Mädchen und der schlanken braunen Wilden aus der Mohavewüste an. Die Feinfühligkeit, mit der Noëmi jede seiner Andeutungen verstand, die Art und Weise, wie sie sich in der gefälligen Verschleierung der Kultur über einzelnes äußerte, gewährten ihm eine wahre Herzensfreude; und er mußte nun daran denken, wie er sich mit Mayo nur durch grobsinnliche Gebärden hatte verständigen können, wie jene ihn erst begriffen hatte, als er bellte und blökte.
Noëmi erinnerte daran, daß inzwischen die Zeit der Mahlzeit gekommen war, und forderte Georg auf, mit ihrem Vater und ihr im Speisezimmer des Hotels das Diner einzunehmen.
Immer aufs neue war Georg entzückt, als er an dem kleinen runden Tische Noëmi gegenübersaß und beobachtete, mit welchem ungezwungenen gesellschaftlichen Geschick sie aß und trank. Er hatte das früher natürlich nicht bemerkt; er hatte damals für das, was ihm selbstverständlich erschienen war, keinen Sinn gehabt. Jetzt aber beobachtete er es, und mit wohlgefälligem Lächeln betrachtete er ihre geschickten Handbewegungen und freute sich aufrichtig, wie sie mit reizender Grazie das Fleisch vom Flügel des Präriehuhns löste, zum Munde führte und verzehrte.
»Sie essen ja nicht?« sagte Noëmi. »Haben Sie keinen Appetit?«
»Doch,« versetzte Georg; »aber es macht mir so viel Vergnügen, Ihnen zuzusehen.«
Nach Schluß der Mahlzeit wurde von dem schwarzen Diener eine in kunstvolle Zacken zerschnittene Wassermelone aufgetragen. Als Noëmi ihm davon ein Stück anbot, lehnte Georg mit einer unwillkürlichen Bewegung naiven Entsetzens ab. Der Anblick der roten saftigen Scheibe, der eigenartige Duft versetzten ihn auf einmal ganz wo anders hin. Unabsichtlich führte er die Serviette ans Gesicht, als wolle er sich die Wangen trocknen. Er hatte die Empfindung, als ob ihm nasse Kerne ins Gesicht schlügen.
Beim Kaffee forderte Mr. Jefferson Georg auf, mit ihm und seiner Tochter in der Familie seines Freundes White, mit dem sie sich für den Abend verabredet hatten, den Tag zu beschließen. Georg nahm das Anerbieten mit Dank an, und sich an Noëmi wendend, sagte er:
»Dann werde ich gleich Gelegenheit haben, Fräulein Bella White Ihren Brief zu übergeben.«
Jefferson horchte auf.
»Also Noëmi hat Ihnen von unseren Freunden schon erzählt? Nun, Sie werden ein sehr schönes Mädchen kennen lernen; und Sie würden ein gutes Werk tun, wenn Sie sie vom Flecke weg heirateten.«
»Aber Papa!« rief Noëmi strafend. »Wie kannst Du nur so sprechen!«
Jefferson paffte mit großer Gelassenheit seine Zigarre weiter und sagte gleichgültig:
»Ich sage meine Meinung, nichts weiter. Ich ärgere mich darüber, daß das schöne kluge Mädchen, das es so gut haben könnte, einer eigensinnig phantastischen Laune halber sich das Leben verdirbt. Eine überspannte Närrin, die in ihrem Liebesgrame schwelgt! Sie redet sich ein, daß sie in den Bruder ihres Schwagers, in Herrn Klaus Bewer, sterblich verliebt sei. Und sie hat sich so darauf versessen, daß sie von keinem Menschen etwas hören oder sehen mag.«
»Aber wenn sie's sich nun nicht einredet,« warf Noemi ein. »Wenn sie ihn nun wahr und wahrhaftig liebt?«
»Dummes Zeug!« antwortete Jefferson. »Was hat denn Herr Klaus so Großes getan, um ihre Liebe zu erwerben?«
»Aber darauf kommt doch gar nichts an, Papa! Ich besitze zwar nur geringe Lebenserfahrung, aber so viel weiß ich doch, daß die Wahrheit viel weniger motiviert als die Dichtung. In den Romanen rettet der Held dem Mädchen, das er heiraten wird, gewöhnlich das Leben. Keiner meiner Freundinnen ist jemals das Leben gerettet worden, und manche haben sich doch recht ernsthaft verliebt. Ich denke, die Liebe ist ein Etwas, das man mit sich ganz allein abzumachen hat. Da braucht ein Zweiter gar nicht mitzuwirken, er braucht nicht einmal etwas darum zu wissen. Und wie willst du denn das nennen, was Bella für Herrn Klaus Bewer empfindet? Alles bringt sie unbewußt in Zusammenhang mit ihm; der Gedanke an ihn erfüllt sie ganz und gar; sie hat wirklich keine Freude mehr, weil ihr der Eine fehlte nach dem sie sich sehnt. Wenn er sie riefe, würde sie alles verlassen, ihren Vater, ihre Schwester, ihr Heim! Wie nennst du das?«
Verrückt,« antwortete Mr. Jefferson. »Habe ich nicht recht, Mr. Lutzen?«
»Nein,« antwortete Georg. »Ich kenne ja die Verhältnisse nicht, aber was Fräulein Noëmi sagt, erscheint mir doch ganz einleuchtend.«
»Es ist dummes Zeug,« fuhr Jefferson in demselben ruhigen Tone fort. »Und wenn's gar so arg ist, weshalb macht sie sich nicht auf? – Es gibt Leute, die schon weiter gereist sind, als von San Franzisko nach Sumatra. Warum sagt sie nicht: Da bin ich, mach' mit mir nun, was du willst; und wenn ich nun einmal dazu bestimmt bin, unglücklich zu werden, so will ich es lieber an deiner Seite sein als ohne dich! – Das ist doch die einzige praktische Beantwortung der Frage.«
Georg lächelte.
»Und glauben Sie auch, daß Mr. White damit einverstanden sein würde?«
»Aber mein lieber Mr. Lutzen, welcher Vater hat jemals seine Tochter daran verhindern können, ihren Willen durchzusetzen? Wir können unsere väterliche Autorität darauf verwenden, unsere Kinder so zu erziehen, daß wir ihnen durch Mahnungen und Warnungen und Beispiele gesunde Grundsätze und sittliche Anschauungen einflößen; wir haben Zwangsmittel, um sie von Unwürdigem abzuhalten; aber die Macht, ihre Neigungen zu brechen, – aus keinem anderen Grunde, als weil wir diese Neigungen nicht teilen, – die besitzen wir nicht. Und tun wir's gewaltsam, so müssen wir immer früher oder später dafür büßen. Wir sind in unserem Lande stolz auf unsere Freiheit, und wir setzen auch unsern Stolz darein, aus unsern Kindern freie Menschen zu bilden, nicht Sklaven, deren Seelen wie verschachern dürfen! Gestern abend noch habe ich meinem Freunde White gesagt: ›Kümmre dich nicht um die gemeinen Vorurteile; und wenn's auch ungewohnt ist, spiele den Brautwerber! Schreibe dem Herrn Bewer, daß dein Kind sich abhärmt, er solle kommen und es gesund machen! Er braucht sie ja nur zu sehen und kennen zu lernen, das andere findet sich von selbst. Alles ist besser als dieses verzehrende Bangen, an dem das arme Mädchen körperlich und seelisch zugrunde geht.‹«
»Ja, Papa,« sagte Noëmi mit tiefer Innigkeit und so ausdrucksvoll, daß Georg sie ganz erstaunt anblickte, »du hast recht!«
»Ich habe immer recht,« schloß Jefferson die Unterhaltung.
Das Wetter hatte sich gegen Abend erheblich abgekühlt, und sie legten den ziemlich weiten Weg bis zur Höhe der Kaliforniastreet zu Fuß zurück, Noëmi und Georg unterhielten sich sehr lebhaft und mit fast zärtlicher Freundlichkeit. Sie sprachen weiter über das unerschöpfliche Thema, das Mr. Jefferson angeregt hatte, und von den allgemeinen Sätzen, die sie mit Vorliebe aufstellten, machten sie, ohne daß sie sich klar davon Rechenschaft abgelegt hätten, beständige Nutzanwendungen für sich selbst. Als sie in der Nähe des Hauses angelangt waren, sagte Noëmi plötzlich und etwas leiser:
»In allen Punkten brauchen Sie übrigens Papas Rat nicht zu befolgen. Es ist gar nicht nötig, daß Sie sich in Bella verlieben.«
»Das ist auch kaum zu befürchten,« entgegnete Georg lächelnd.
»Wer weiß?« versetzte Noëmi. »Sie müssen auf Ihrer Hut sein. Sie werden ein sehr schönes Mädchen kennen lernen. Und sie ist ebenso gut und klug wie schön.«
»Das mag schon sein; aber ich bin ja genügend vorbereitet! Und ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, daß mir ein Mädchen, von dem ich weiß, daß es in einen andern sterblich verliebt ist, jemals gefährlich werden könne.«
»Das wäre mir lieb!« flüsterte Noëmi.
Hatte sich Georg getäuscht? – Hatte er wirklich ein leises Zittern ihres Armes auf dem seinigen gespürt? – Er sah sie flüchtig von der Seite an; sie schlug die Augen zu Boden.

In dem mittelgroßen, ungemein behaglichen, geschmackvoll eingerichteten Salon des Whiteschen Hauses in der Kaliforniastreet saßen sie beisammen und plauderten: Mr. Artur G. White, ein Mann in der Mitte der Fünfziger mit breitem, rotem Gesicht, ganz kurzgeschnittenen, schneeweißen, stoppligen Haaren und ebenfalls kurz geschnittenem Backenbart, mit kleinen, blauen, unglaublich vergnügten Augen; sein Schwiegersohn, der breitschultrige vollbärtige Wilhelm Bewer, dessen rundliche, hübsche, frische Frau, Ellen, Whites älteste Tochter, die jüngere Miß Bella White, Mr. Jefferson, Noëmi und Georg. Der dicke Teppich, der den Boden bedeckte, die schweren Vorhänge und Portieren, die dunkelbunten Überzüge der Polster gaben den: wohnlichen Raum eine große Wärme und Gemütlichkeit; die blendende Helligkeit der Lampen war durch Schleier gemildert.
Zwischen den Mitgliedern des Whiteschen Hauses herrschte ein Ton einfacher Herzlichkeit, der auch für den Fremden den Verkehr mit diesen liebenswürdigen Menschen sogleich gemütlich machte. Bella wurde augenscheinlich von allen verzogen. Man schonte sie wie eine Rekonvaleszentin. Das ganze Haus strömte den Duft glücklichen Familienlebens aus.
Man hatte Georg nicht zuviel von Bellas Schönheit gesagt. Sie war sogar von ungewöhnlicher Schönheit: hoch und schlank gewachsen, mit vornehmen, etwas strengen Gesichtszügen und Farben von wundervoller Zartheit. Besonders eigentümlich berührte der Gegensatz zwischen ihren aschblonden, leicht gewellten Haaren und den tiefbraunen großen Augen. Bella war gegen den Gast, den der beste Freund des Hauses, Mr. Jefferson, eingeführt hatte, von großer Zuvorkommenheit und Liebenswürdigkeit; aber es gehörte kein besonderer Kennerblick dazu, um zu bemerken, daß sie zerstreut war, daß sie gewisse Anstrengungen wachen mußte, um ihre Pflichten als Tochter des Hauses zu erfüllen.
Georg mußte viel erzählen von seinem Leben in den Rocky Mountains, von feinem Auge durch Arizona und Kalifornien. Aber er schwieg von Mayo; er empfand sogar eine starke Befangenheit, als sich ihm die Erinnerung aufdrängte; ein gewisses Gefühl des Respektes vor Noëmi veranlaßte ihn über diese Episode schweigend hinwegzugleiten. Er hatte ein dankbares, verständnisvolles Publikum. Der alte Jefferson war ganz stolz auf seinen Gast; er kam sich beinahe vor wie ein Impresario, der mit einem Virtuosen reist. Er verschaffte Georg soviel wie möglich Gelegenheit, sein Licht leuchten zu lassen, und freute sich über dessen Leistungen und Erfolge.
Aber auf keinen machte Georgs ungezwungene Erzählung einen tieferen Eindruck als auf Noëmi. Sie saß dicht neben Bella, hatte ihren Arm um Bellas Hüfte gelegt, den Kopf an deren Schulter gelehnt, und langsam und tief atmend schien sie ein jedes seiner Worte zu verschlingen. Jedesmal, wenn sein Blick auf sie fiel, waren die ausdrucksvollen Augen der bleichen Noëmi auf ihn gerichtet; und wenn er ihr dann zulächelte, lächelte auch sie mit lieblicher Dankbarkeit, und ihre Wangen röteten sich. Gewiß war Bella schöner, aber sie war ihm fern; und Noëmi fühlte er sich nahe.
Während er wie Othello vor Desdemona von seines Lebens wundervoller Fahrt berichtete, ging ihm beständig das Gespräch, das sie bei Tisch und unterwegs geführt hatten, durch den Kopf. Es kam ihm wie ein Traum vor, wenn er sich klar machte, daß keine achtundvierzig Stunden vergangen waren, als er im dunklen Wollenhemd, mit Lederhosen, in die sich der Wüstenstaub des Mohavelandes eingefressen, den Revolver in der Hüftentasche, in einer elenden Bretterbude mit einem spitzbübisch aussehenden Agenten aus Mexiko von einem entlaufenen Indianermädchen sich unterhalten hatte! Wie weit lag das alles hinter ihm! Die Ausströmungen der Kultur schienen das alles weggeschwemmt zu haben. Er war ein neuer Mensch geworden – wieder der alte.
Das wetteifernde Bestreben, sich gegenseitig angenehm zu sein, wie es ihm hier überall entgegentrat, erfüllte ihn mit einer seltenen Zufriedenheit; er klagte sich zugleich der Ungerechtigkeit an. Wie lieblos hatte er über Land und Leute geurteilt! Hier war doch noch etwas anderes als die bloße Freude am schnöden Gewinn, als die Rücksichtslosigkeit des Erfolges: Hier herrschte doch im wahrsten Sinne des Wortes tiefes Behagen; hier tobte nicht bloß der Kampf ums Dasein, hier waltete vor allem die Freude am Dasein. Es waren gute tüchtige Männer, eine kluge, herzliche Frau, reizende junge Mädchen, einheitlich verbunden durch gute Formen, guten Ton und einheitlich in dem Bestreben, sich und andern Freude zu bereiten.
Als der Tee aufgetragen war, hatte sich Bella erhoben und war an den Flügel getreten. Noëmi näherte sich ihr schnell.
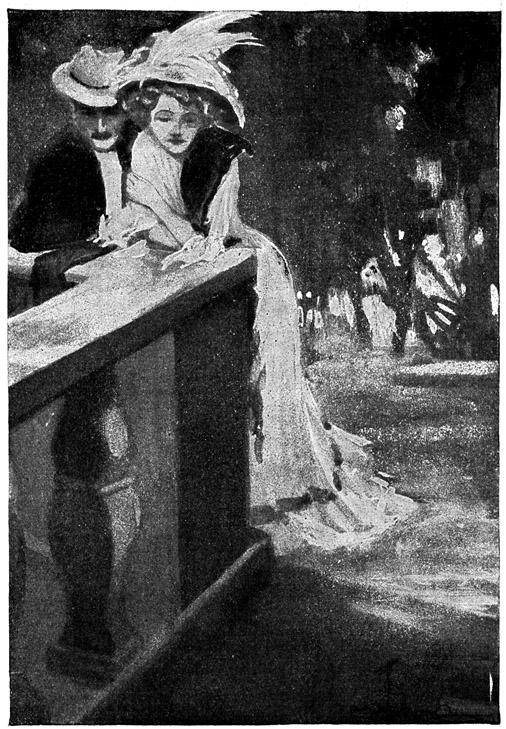
»Bitte, Bella,« sagte sie leise, »spiele nicht.«
»Weshalb nicht?« fragte Bella erstaunt.
Noëmi machte eine kleine Pause und versetzte darauf kleinlaut:
»Ich spiele so schlecht.«
Bella hatte sogleich verstanden. Sie lächelte, blickte zu Georg hinüber und drückte Noëmi die Hand.
»Wie wär's,« sagte Wilhelm plötzlich, »wenn wir unserem Gaste gleich heute eine unsrer Sehenswürdigkeiten zeigten, auf die wir besonders stolz sind? Das Wetter ist herrlich, wir haben hellen Mondschein, der Wagen ist in zehn Minuten angespannt, – wie wär's, wenn wir nach dein Cliff-House führen?«
Die Jungen waren mit dem Vorschlage sofort einverstanden, und die beiden Alten hatten unter der Voraussetzung, daß sie nicht dabei zu sein brauchten, nichts dagegen einzuwenden. Für diese wurde der Spieltisch hergerichtet, beide setzten sich sofort an die Arbeit, und ein jeder gab Georg die feierliche Versicherung, daß er vom andern regelmäßig betrogen werde.
Bald darauf meldete der Diener, daß der Wagen vor der Tür stehe. Wilhelm kletterte auf den Bock, Ellen und Noëmi nahmen auf dem Rücksitz Platz und ihnen gegenüber Bella und Georg. Durch die hügligen Straßen der Stadt, auf den wohlgepflegten Wegen des Parkes und durch den Dünensand rollten sie schnell dahin und stiegen am Cliff-House ab, das auf der Düne, hart an der Bai liegt, und von dessen Veranda aus der Blick die ganze malerische Umgebung der Stadt beherrscht.
Es war eine wundervolle, helle, frische Mondnacht. Das dunkle Wasser der Bai war von den silbernen glitzernden Streifen, die der Widerschein des hochstehenden Mondes bildete, durchzogen. Die schönen Berge jenseits erschienen wie phantastisch verschleiert, und nach dem goldenen Tor zu verschwamm der Hintergrund in bläulich-mattem grauschimmerndem Schein. Aber sehr deutlich und scharf tauchten die kleinen Felszacken nahe dem Ufer, auf denen die Robben und Seeenten hausen, aus dem glitzernden Wasserspiegel auf; und mit dem Opernglase konnte man sogar deutlich die Tiere im Mondschein erkennen, deren krächzendes stoßartiges Brüllen nun, da sich sonst kein Laut regte, zugleich schauerlich und komisch klang.
Die beiden Mädchen hatten sich von den drei Herren etwas entfernt und flüsterten leise.
»Weshalb willst du mit mir Versteck spielen?« sagte Bella herzlich! »Mir ist ja, als ob ich mich im Spiegel sähe! Alles das kenne ich ja. Ich habe es verbergen wollen und habe es so gut verborgen, daß der andere es gar nicht gemerkt hat. Nun sieh mich an! Bezahle ich es nicht teuer genug? Du sollst nicht unglücklich werden, und es ist keine Sünde, wenn du es nicht vor ihm verbirgst, daß du unglücklich werden würdest. Er ahnt ja schon die Wahrheit, er wagt sie sich nur nicht zu gestehen. Noëmi, geht nicht auseinander, ohne daß ihr von dem gesprochen, was euch beiden auf der Lippe brennt!«
Bella schwieg. Einen Augenblick schwankte Noëmi; dann warf sie sich schluchzend an Bellas Brust und sagte kein Wort; aber sie drückte der Freundin mit einem Ausdruck von Entschlossenheit die Hand, als sei sie jetzt mit sich einig.
»Was sich junge Mädchen alles zu erzählen haben!« sagte Wilhelm zu Georg. »Mir ist's ein Rätsel!« Und indem er die Stimme erhob, rief er: »Wo steckt ihr denn?«
»Wir kommen schon,« rief Bella zurück, und die beiden Mädchen vereinigten sich nun mit den übrigen. Sie stützten sich auf das Geländer der Veranda und blickten unverwandt auf das leichtgekräuselte, wie mit silbernen Flittern besäete Meer. Noëmi stand dicht neben Georg. Beide hatten die Hände auf das Geländer gelegt. Wilhelm, der auf der anderen Seite an Noëmi herangetreten war, veranlaßte diese, sich noch ein wenig mehr Georg zu nähern, und dabei streifte unwillkürlich ihre Hand die Georgs. Es war ihm eine angenehme Empfindung, so angenehm, daß er nicht daran dachte, seine Hand der zufälligen Berührung zu entziehen. Wenn es ihr unangenehm ist, dachte er, wird sie selbst schon die schmale Hand wegziehen. Aber die kleine Hand blieb ruhig an der seinen liegen. Vielleicht bemerkte sie es nicht. Er machte eine ganz leichte Bewegung mit seiner Hand, aber Noëmi rührte sich nichts obwohl sie es nun doch wohl gemerkt haben mußte. Oder wäre doch noch ein Irrtum möglich? Er wollte sich Gewißheit darüber verschaffen. Wie spielend hob er langsam die Finger, senkte sie wieder, bedächtig taktschlagend, und jedesmal, wenn er die Finger niederließ, berührte sein kleiner Finger den Noëmis. Sie ließ ihre Hand ruhig liegen. Nun wurde er dreister. Sein kleiner Finger spielte ein wenig mehr nach links hinüber und berührte etwas verwegener Noëmis Hand. Diese verharrte noch immer in ihrer früheren Lage. Währenddessen blickten die beiden unausgesetzt auf die Wasserfläche, und man konnte glauben, daß sie von der Schönheit des nächtlichen mondbeschienenen Meeres tief ergriffen seien. Aber Georg dachte gewiß an etwas ganz anderes. Und Noëmi auch. Ohne die Augen vom Meere abzuwenden, setzten sie das kindische Spiel fort. Sie sprachen kein Wort. Die Robben brüllten, und die kurzatmig abgerissenen, hervorgestoßenen Töne klangen seltsam durch den stillen Abend. Georg streichelte zärtlich die kleine Hand, die auf dem Geländer unbeweglich neben der seinigen lag.
»Es ist freilich hier sehr schön,« sagte Wilhelm; »aber allmählich wird's doch Zeit, an den Aufbruch zu denken.«
Da bewegte sich endlich Noëmis Hand. Sie umschloß die Finger, die mit ihr gespielt hatten, und drückte sie; aber es war keine Strafe für Ungezogenheit, es war ein verständnisvolles, herzliches Erwidern einer zärtlichen Gesinnung.
Nun wandten sich die beiden zueinander und sahen sich lächelnd an.
Auf dem Heimweg wurde wenig gesprochen. Ellen war müde, Bella sprach seit ihrer Rückkehr in die Heimat überhaupt nicht viel, und Georg und Noëmi verstanden sich ohnehin.
Jefferson und White hatten sich wie gewöhnlich beim Kartenspielen gezankt.
Als Georg im Hotel Jefferson und Noëmi gute Nacht wünschte, reichte er Noëmi die Hand und drückte sie innig, bedeutungsvoll und lange. Noëmi sah ihn wie fragend an, dann senkte sie langsam die Lider und schlug sie langsam wieder auf. Es leuchtete in ihren Augen.
»Gute Nacht!«
Er blieb wohl noch eine Minute vor der Tür stehen, die sich hinter den beiden geschlossen hatte, und schüttelte den Kopf. Bedächtig ging er die unendlichen Korridore entlang, und nachdenklich stieg er die hohen Treppen hinauf.
Nachdem er die Tür hinter sich geschlossen und in einem Zimmer eine Flamme angesteckt hatte, begann er in wunderlichem Zickzack um die Möbel und Koffer, die mitten in der Stube standen, mit großen Schritten einen andauernden Rundgang anzutreten.
 Die Sache ist ganz klar,« sagte er vor sich her, während er beständig auf- und abmarschierte.
Die Sache ist ganz klar,« sagte er vor sich her, während er beständig auf- und abmarschierte.
Aber die beruhigende Versicherung, die er sich gegeben hatte, daß die Sache ganz klar sei, stimmte doch nicht recht für seinen Gemütszustand. Es sah in ihm sogar recht wirr und wüst aus; aber es war ein leuchtendes Chaos, an dem er seine Freude hatte. Seine Augen blickten so heiter wie je, seine Bewegungen waren elastisch und zuversichtlich.
Es war ihm nicht hell genug im Zimmer, obwohl die eine Gasflamme vollkommen ausreichte, um den Raum von bescheidenem Umfange zu erhellen. Er zündete noch eine zweite, eine dritte, eine vierte an. Er war in einer Stimmung, als ob er sich selbst eine Gesellschaft geben wollte.
Endlich setzte er sich auf den Lehnstuhl, der neben dein Sofa mit Tisch stand, und blickte unverwandt auf einen bestimmten Punkt im Teppich. Sein Gesicht wurde ernsthafter. Er dachte nach.
Genau dieselbe Situation hatte er doch schon einmal erlebt!
Plötzlich heiterten sich seine Mienen wieder mit dem Ausdruck völligster Zufriedenheit auf: er hatte gefunden, was er gesucht hatte. Auch an jenem unglücklichen Morgen, der über sein neues Dasein hatte entscheiden sollen, hatte er sich auf den Sessel am Tisch geworfen und das Teppichmuster angestarrt. Aber wie anders damals und heute! Damals hatte er beim Spiel nahezu alles verloren, heute hatte er, wenn ihn nicht alles täuschte, gewonnenes Spiel; und was er heute gewonnen oder doch zu gewinnen die feste Zuversicht hatte, war mehr wert als Geld und Gut: Noëmi!
Wie kam es nur, daß er plötzlich Eigenschaften an ihr würdigte, die er bei früheren Begegnungen nicht an ihr wahrgenommen hatte. Weshalb entzückte ihn die Anmut ihrer langsamen Bewegungen, das stille vornehme Wesen, die leise, wohlklingende Stimme, die gebildete Gewandtheit ihrer Ausdrucksweise? Weshalb erschien sie ihm auf einmal als der Inbegriff alles dessen, was ihm behagte, was ihm Wohltat? Er war mit Blindheit geschlagen gewesen, und er hatte eine unwillige Anwandlung über die strafbare Unaufmerksamkeit, die er sich ihr gegenüber früher hatte zuschulden kommen lassen. Er hätte doch nur die Augen zu öffnen brauchen, um zu sehen, daß sie ganz anders war als ...
Er schlug den Blick auf. Er bemerkte plötzlich, daß es im Zimmer sehr heiß geworden war. Er trat an das Fenster und öffnete es. Von dem hochgelegenen Zimmer aus blickte er auf die merkwürdig geformten Dächer, die verzierten Zinnen und Kuppeln und Türmchen der Häusermasse, die sich um ihn ausdehnte, und aus der die Fahnenstangen eigentümlich aufragten. Das Mondlicht hatte alles das in einen glänzend-bläulichen Lichtschleier gehüllt.
Mayo!
Sie war es, die ihm die keusch verborgenen Reize Noëmis gewiesen! Sie hatte sein Auge geschärft, und die Vergleichung war seine Lehrmeisterin gewesen. Das arme und ungelehrige wilde Kind hatte sicherlich keine Ahnung davon gehabt, daß sie ihm die Leuchte vorantragen und ihn aus dem Dunkel seiner Empfindungen zur Erkenntnis führen sollte. Er hatte es ja selbst nicht geahnt. Die Tage in der Mohavewüste an Mayos Seite waren ja für ihn nichts anderes gewesen als eine poetische Episode, deren Eigentümlichkeit und Fremdartigkeit ihn bestrickt hatte. Er hatte eine Wirklichkeit durchlebt, die etwas anderes war, als er je hatte träumen können. Er hatte von dieser Glückseligkeit in Staub und Sonnenschein, von dieser Einsamkeit mit einem menschlichen Wesen an seiner Seite nie eine Vorstellung gehabt. Dieser phantastische Traum, der eine Wahrheit gewesen, war vorüber. Er wußte, daß er zu jenen gehörte, die man nur einmal träumt, und die nicht wiederkommen. Er lächelte seltsam, als dieses Bild vor seiner Seele vorüberzog; aber eine unwillige Falte zuckte über seinem Auge, als er sich die Möglichkeit einer Wiederholung vergegenwärtigte. Es war ein Zwischenfall ohne allen Zusammenhang mit seinen: sonstigen Sein und Wesen; so sollte er es bleiben, so war er voller Reiz, so konnte er mit Freude daran denken.
Und auch mit Dankbarkeit. Denn er machte sich klar, daß dieser Zwischenfall die entscheidende Wendung in seinem Dasein herbeigeführt hatte, daß er so wichtig und tief einschneidend für ihn gewesen war, daß er, wenn er für sein Schicksal in der Neuen Welt eine Verkörperung hätte suchen wollen, diese nur in Mayo gefunden haben würde.
Sie hatte an seinem Lebenspfade den wahren Wegweiser aufgerichtet, sie hatte mehr auf ihn eingewirkt, als der Unglücksfall, der ihn von Hause vertrieben, als die Genossenschaft mit dem verwilderten Abenteurer und Freunde im Winter des Felsengebirges, als das Alleinsein. Jetzt hatte er erkannt, was er bisher nur unbewußt gefühlt hatte: wie er mit allen Fasern seines Seins mit der Kultur des Ostens zusammenhing. Deswegen war ihn: Noëmi, in der die Bedingungen seines Daseins gewissermaßen Fleisch und Blut geworden waren, nun so nahe gerückt!
Wenn er's sich recht überlegte, hatte sie ihm ja gleich als er sie zum erstenmal in der Kajüte des Dampfers neben sich sah, ungemein gefallen, so sehr, daß er darüber die schmerzliche Ursache seiner Auswanderung, wenn auch nicht vergessen, doch weniger schmerzlich hatte empfinden können. Sie allein hatte ihm die langen Stunden der Überfahrt zu heiteren und frohen gemacht. Aber damals war er nicht in der Stimmung, daß er darüber hätte nachdenken können. Damals hatte er sich nicht die Vorstellung machen dürfen, – und er hatte sie sich auch tatsächlich nicht gemacht, – daß es ihm je gelingen könne, das Schicksal eines jungen Mädchens an die abenteuernde Rastlosigkeit, die ihm bevorstand, zu fesseln. Und nicht besser hatte es uni ihn gestanden, als er in Denver wieder mit ihr zusammengetroffen war. Da war ihm die Trostlosigkeit und Jämmerlichkeit seines Lebens zu vollem Bewußtsein gekommen; da hatte er diese Sprache, das schüchterne Lallen eines übervollen jungfräulichen Herzens, nicht verstanden. Jetzt klangen ihm alle die Worte wieder in den Ohren, die sie im Garten ihres Vaters ihm gesagt hatte, und nun erst verstand er deren verborgenen Sinn. Sie aber wußte schon damals, was ihm erst heute bewußt geworden war! Sie hatte in der Einöde des elterlichen Hauses nur an ihn gedacht. Und nun vergegenwärtigte er sich, wie auch in seinen einsamen Stunden immer wieder und wieder Noëmi vor seines Geistes Auge aufgetaucht, wie vertraut sie seinem Herzen gewesen war, ohne daß er es sich hatte gestehen wollen.
Sein Herz pochte mächtig, er fühlte es weit in seiner Brust. Er legte die Linke darauf und umspannte zitternd mit der Rechten den metallenen Riegel des Fensterflügels. Und lächelnd, mit dem Ausdruck unsagbarer Zärtlichkeit, flüsterte er ganz leise, während sein Blick über den Silberglanz der verschwommenen Massen um ihn schweifte:
 Georg hatte zwar sehr unruhig und nicht viel geschlafen aber er hatte sich doch am andern Morgen frischer und aufgeräumter denn je gefühlt und Jefferson und Noëmi beim Frühstück mit beinahe übermütiger Freudigkeit begrüßt. Als Jefferson Miene gemacht hatte, von Geschäften zu sprechen, hatten die beiden jungen Leute so heiter protestiert, daß dem ernsten Geschäftsmann selbst die Lust vergangen war. Er hatte es ganz in der Ordnung gefunden, daß Georg es vorzog, seine Tochter, die in der Stadt noch allerhand Besorgungen zu machen hatte, zu begleiten, als mit ihm in einem unfreundlichen Kontor in mehr oder minder nüchterne Verhandlungen einzutreten. Es eilte ja auch nicht.
Georg hatte zwar sehr unruhig und nicht viel geschlafen aber er hatte sich doch am andern Morgen frischer und aufgeräumter denn je gefühlt und Jefferson und Noëmi beim Frühstück mit beinahe übermütiger Freudigkeit begrüßt. Als Jefferson Miene gemacht hatte, von Geschäften zu sprechen, hatten die beiden jungen Leute so heiter protestiert, daß dem ernsten Geschäftsmann selbst die Lust vergangen war. Er hatte es ganz in der Ordnung gefunden, daß Georg es vorzog, seine Tochter, die in der Stadt noch allerhand Besorgungen zu machen hatte, zu begleiten, als mit ihm in einem unfreundlichen Kontor in mehr oder minder nüchterne Verhandlungen einzutreten. Es eilte ja auch nicht.
Die beiden jungen Leute waren in rosigster Laune durch die schönen und interessanten Hauptstraßen der Stadt, durch die Marketstreet und die Montgommerystreet geschlendert, waren vor den schönen Schauläden stehen geblieben, hatten dies und das eingekauft und fühlten sich in vertraulicher Annäherung seelenfroh. Von dem Vorfall des vergangenen Abends, von der stummen Auseinandersetzung auf der Veranda des Cliff-House, war zwar mit keiner Silbe die Rede gewesen aber gleichwohl schien dieser doch unwillkürlich den Rhythmus und die Tonart ihrer Unterhaltung, ja ihres Verkehrs überhaupt zu bestimmen. Die beiden sprachen miteinander wie Leute, die wissen, was sie voneinander zu halten haben. Eine zwanglose Innigkeit herrschte zwischen ihnen, die ihnen nun ganz natürlich erschien. Sie wählten wiederum mit Vorliebe allgemeine Wendungen, über deren besondere Bedeutung für sie ein unausgesprochenes Einvernehmen unter ihnen bestand. Ohne nach einem Übergang zu suchen, sagte Georg auf einmal:
»Ich habe gestern noch viel an Sie gedacht, Fräulein Noëmi. Es ist mir alles mögliche durch den Kopf gegangen, besonders auch Ihre Äußerung bei Tisch: man brauche kein Romanheld zu sein, man brauche nicht das Leben der Angebeteten zu retten, um geliebt zu werden. Ich muß Ihnen gestehen, daß mir das eine große Beruhigung gewesen ist. Denn bis zur Stunde habe ich mich eigentlich immer recht wenig Held gefühlt und auch wenig Gelegenheit gehabt, Heldentaten zu vollbringen. Es gehen so selten Pferde durch, wenn ich dabei bin; es werden so selten in meiner Gegenwart räuberische Anfälle auf junge Mädchen gemacht, die ich verteidigen könnte! Und doch habe ich immer das bestimmte Gefühl: ein bißchen Heldentum gehört nun einmal zum Manne, wenn ein Mädchen ihm vertrauen soll. Da habe ich mir denn durch alle möglichen Trugschlüsse auch zu meinen Gunsten so eine Art von Heldentum künstlich zurechtgemacht. Ich habe mir gesagt: wenn man die Ketten löst, die ein Mädchen an den Felsen der Nüchternheit und der Alltäglichkeit fesseln, das ist doch auch etwas! Viel mehr hat Perseus der gefesselten Andromeda gegenüber auch nicht getan, und Perseus gilt doch als starker Held. Ich denke mir: die Heirat, der Beschluß, das Geschick eines mehr oder minder hilflosen Wesens mit dem seinigen zu verbinden und die Verantwortlichkeit für dessen Glück zu übernehmen – das ist doch auch schon ein Heroismus! Ich kenne viele Leute, die es nicht fertig gebracht haben. Nun, das würde ich mir allenfalls zutrauen!«
Noëmi sah ihn lächelnd an und sagte:
»Ich glaube. Sie sprechen sehr vernünftig; mir leuchtet es wenigstens ein.«
»Um so besser,« versetzte Georg. »Ich würde mich auch nicht einen Augenblick besinnen, gleich einen entscheidenden Schritt zu tun, wenn mich nicht mein Gewissen zu einer gewissen Vorsicht nötigte. Ich kann mir ganz gut vorstellen, wie sich im Herzen eines jungen Mädchens eine starke Zuneigung für einen mehr oder minder Unbekannten ausbildet. Sie hat ihn gesehen, er hat ihr nicht mißfallen, er hat nur Gelegenheit gehabt, sich ihr von der gefälligsten Seite, als artiger und zuvorkommender Mann zu zeigen, und so scheidet sie von ihm und nimmt den günstigsten Eindruck mit. In ihrem Alleinsein vertieft sich der Eindruck immer mehr und mehr; ihre jungfräuliche Phantasie malt das Bild, das sie empfangen, in immer gefälligeren Farben aus, und sieht er sie wieder, so ist sie ihm schon von Herzen zugetan. Aber sie kennt ihn eigentlich doch nur sehr wenig; und vielleicht besitzt er Eigentümlichkeiten, die bisher nicht zum Vorschein gekommen sind, und die ihr später, wenn sie deren gewahr wird, höchlich mißfallen. Sie mag da ganz in der Stimmung sein, sich den Kopf verdrehen zu lassen; ich würde es indessen für verwerflich, für unverantwortlich halten, wenn er das holde Vertrauen, das ihm entgegengebracht wird, mißbrauchte, wenn er, der ja der Verständigere sein soll, ihr nicht sagte: Bedenken Sie es wohl, der Mann, der jetzt mit Ihnen spricht, ist nicht die Idealgestalt Ihrer mädchenhaften Träume, er ist ein Mann wie andere mehr, der Sie vielleicht enttäuschen wird.«

»Gott behüte das arme Mädchen davor!« sagte Noëmi ernst. »Aber ich sollte, doch meinen, es gäbe eine sichere Gewähr. Wenn er sie liebt und aufrichtig ist, dann ist gewiß nichts zu befürchten. Liebt er sie aber nicht, ist es nur eine flüchtige Laune, die ihm für den Augenblick ein eitles Behagen gewährt, dann hat er als Mann von Ehre nichts weiter zu tun, als das Spiel nicht weiter zu treiben. Dann kann er das kranke Herz nicht heilen, und dann ist es besser, daß er es bricht, als daß er es langsam zu Tode martert. Liebt er sie aber, dann hat er sich um nichts weiter zu bekümmern, dann ist alles andere selbstverständlich, dann braucht er auch keine Heldentaten zu begehen, dann findet sich alles!«
Die beiden hatten unabsichtlich ihren Schritt verlangsamt und blieben nun vor einen: Schaufenster stehen. Sie sahen sich ernst, ehrlich und freundlich in die Augen; sie schwiegen beide. Nun, da sie sich verstanden hatten, brauchten sie auch kein Wort mehr zu sagen. Nach einer Weile wandten sie ihre Aufmerksamkeit den in: Fenster geschmackvoll ausgestellten Gegenständen zu.
Georg machte eine plötzliche Bewegung. Sein Blick hatte etwas ganz Unerwartetes erspäht, das ihn aufs äußerste überraschte: im Fenster befand sich eine Sammlung von neu aufgenommenen Indianerphotographien, und auf den ersten Blick erkannte er das Werk des einäugigen Kaspar. Es waren Gruppen von Mohave-Indianern an den Needles. Er erkannte den schlanken Burschen mit safrangelbem Kopftuch und der Schlangenlinie quer über das Gesicht. Und da war ihr Bild, Mayos! Sie war in derselben Stellung aufgenommen, in der er sie zum erstenmal gesehen hatte, die Kniee gegen die Brust gezogen, die Ellenbogen auf die Kniee gestützt und die Wangen auf die Hände. Ihr rotes Tuch war ihr von der Schulter geglitten. Die Photographien waren älter als Georgs Bekanntschaft mit Mayo – der Georgstaler an ihrem Halsschmuck fehlte.
Noëmi beugte sich vor und sagte:
»Ich finde nichts Besonderes da zu sehen. Es ist eben eine Indianerin. Ein schönes Mädchen! Vielleicht schöner als viele andere ihres Stammes, aber eine Indianerin. Interessieren Sie sich dafür?«
»Für diese, ja,« antwortete Georg. »Ich bin mit dem Photographen, der diese Bilder ausgenommen hat, an den Needles zusammengetroffen; ich habe auch das Mädchen kennen gelernt, ein eigentümliches Geschöpf von unglaublicher Anmut. Sie hat mir sogar Gesellschaft geleistet, und ich habe, wenn auch ohne ihren Willen, durch sie mancherlei gelernt, was ich sonst wohl nicht erkannt hätte. Mayo heißt sie.«
»Das ist ja ein ganz reizender Zufall,« sagte Noëmi; »so kaufen Sie sich doch das Bild zur Erinnerung an das Original.«
»Wollen Sie mich necken?« fragte Georg.
»Ganz und gar nicht«, sagte Noëmi ruhig. »Wenn Sie das Mädchen kennen gelernt haben, wenn Sie es schön finden, scheint es mir ganz natürlich, daß Sie sich das Bild verschaffen.«
»Und würden Sie mir auch dazu raten, wenn es eine Weiße wäre?«
»Das weiß ich nicht«, antwortete Noëmi wirklich verlegen. Und leiser setzte sie hinzu: »Da könnte man ja vielleicht eifersüchtig werden.«
»Und können Sie sich gar nicht vorstellen, daß ein Kind unserer Kultur jemals auf eine Indianerin eifersüchtig werden könnte?«
Noëmi strahlte ihn mit ihren dunklen Augen an und lächelte herzlich.
»Sie scherzen doch wohl? Wie es die andern machen, weiß ich nicht; aber von mir kann ich Ihnen sagen, daß ich mir meine Eifersucht, wenn ich sie jemals empfinden sollte, doch nur für meinesgleichen bewahren würde. Ich weiß wohl, es gibt Leute, die eifersüchtig auf ein Kunstwerk sind, auf ein Haustier, auf Verstorbene oder Wilde, aber das scheint mir recht wenig natürlich. So etwas liebt man doch anders, als man andere liebt.«
Und während sie sich vorbeugte und das Bild mit großer Aufmerksamkeit und vollkommener, ungewollter Objektivität betrachtete, wiederholte sie: »Kaufen Sie nur das Bild!«
Die Zeit zur gemeinsamen Mahlzeit war herangekommen. Sie waren in das Hotel zurückgekehrt und erwarteten in dem geräumigen Gesellschaftssalon die Rückkehr des Mr. Jefferson. Sie saßen in reizender Vertraulichkeit nebeneinander auf dem Runddiwan und plauderten und lachten und schwatzten. Die Gäste waren schon bei Tisch, die beiden waren zufällig allein. Georg hatte einen flüchtigen Blick auf die große Stutzuhr geworfen, und Noëmi war dem Blicke gefolgt.
»Papa muß gleich kommen«, sagte sie.
»Schade!« platzte Georg heraus, mit dem Ausdruck so komischen Bedauerns, daß Noëmi laut auflachte.
»Entschuldigen Sie«, sagte Georg. »Ich schätze Ihren Herrn Vater ungemein; er ist mir auf das freundlichste entgegengekommen, er hat mir nur Gutes erwiesen, ich bin ihm nur zu Dank verpflichtet, aber gerade in diesem Augenblicke sehne ich mich doch nicht nach ihm. Ich bin viel lieber mit Ihnen allein. Die Gegenwart eines Dritten – und wäre es auch die Ihres Herrn Vaters – erlegt mir doch einen gewissen Zwang auf, den ich jetzt ungern ertrage.«
»Sie kennen Papa nicht; er ist herzensgut.«
»Fräulein Noëmi,« sagte Georg ganz plötzlich, mit völlig veränderter Stimme und mit lustiger Bestimmtheit. »Ihr Vater kommt gleich, nicht wahr? Soll ich ihn gerade heraus fragen, ob er mir gestaltet, öfter mit Ihnen allein zu sein? Wozu sollen wir uns noch länger quälen? Weshalb soll ich noch länger zaudern, das auszusprechen, was doch einmal gesagt werden muß? Ich habe das Gefühl, daß Sie mir gut sind. Glauben Sie mir,« fuhr er mit Wärme fort, »ich bin Ihnen auch von ganzem Herzen gut. Es ist keine flüchtige Laune, es ist eine ernsthafte tiefe Zuneigung. Ich bin so ungeschickt wie möglich, um Liebeserklärungen zu machen; aber Sie verstehen mich ja schon so wie so; ich sehe es Ihnen an. Ich täusche mich nicht. Darf ich Ihren Vater fragen?«
»Fragen Sie ihn«, sagte Noëmi ganz leise, und langsam reichte sie ihm ihre zitternde Hand, die er an seine Lippen führte.
In demselben Augenblick trat Jefferson in den Salon. Georg erhob sich schnell, trat auf ihn zu und sagte, indem er sich ehrerbietig verneigte:
»Mr. Jefferson, wollen Sie mir Ihre Tochter zur Frau geben?«
Die unerwartete Anrede versetzte den kleinen Mann in nicht geringes Erstaunen. Er klemmte die Oberlippe scharf ein, schob die Unterlippe noch weiter vor als gewöhnlich, streichelte seinen Kinnbart und sagte ruhig:
»Das muß man sich doch noch etwas überlegen.«
Als sein Blick aber auf Noëmi fiel die mit vorgebeugtem Oberkörper, langsam und tief atmend, auf dem Diwan sitzen geblieben war und ihre merkwürdig schönen Augen mit einem Ausdruck von Glückseligkeit, den ihr Vater nie an ihr gesehen hatte, auf ihn richtete, setzte er gemütlich hinzu:
»Einstweilen wollen wir zusammen speisen.«
Das genügte Georg. Er ergriff Mr. Jeffersons Hand, drückte sie herzlich und schloß Noëmi, die mit glühenden Wangen an die beiden herangetreten war, zärtlich in seine Arme.
 Auf der neueröffneten Bahnstrecke der »Atlantik« fuhren Mr. Jefferson, Noëmi und Georg dem Osten zu. Ihr Ziel war zunächst das anmutig gelegene Modebad Las Vegas in Neu-Mexiko. Da sollten sie sich mit Mrs. Jefferson vereinigen, die schon seit langen Wochen in dem bequemen Hotel Montezuma in anmutigstem Lächeln ihre einförmigen Tage verbrachte und auf ihrem Schaukelstuhl in der offenen Halle sich gerade so wenig aufregte, wie wo anders. Mrs. Jefferson wartete schon lange auf ihren Mann und das junge Paar mit der ihr eigentümlichen freundlichen Gelassenheit. Sie freute sich, als sie das Telegramm empfing, das ihr die Ankunft der Ihrigen für einen bestimmten Tag meldete; aber sie hätte ohne Verdruß noch viel länger gewartet.
Auf der neueröffneten Bahnstrecke der »Atlantik« fuhren Mr. Jefferson, Noëmi und Georg dem Osten zu. Ihr Ziel war zunächst das anmutig gelegene Modebad Las Vegas in Neu-Mexiko. Da sollten sie sich mit Mrs. Jefferson vereinigen, die schon seit langen Wochen in dem bequemen Hotel Montezuma in anmutigstem Lächeln ihre einförmigen Tage verbrachte und auf ihrem Schaukelstuhl in der offenen Halle sich gerade so wenig aufregte, wie wo anders. Mrs. Jefferson wartete schon lange auf ihren Mann und das junge Paar mit der ihr eigentümlichen freundlichen Gelassenheit. Sie freute sich, als sie das Telegramm empfing, das ihr die Ankunft der Ihrigen für einen bestimmten Tag meldete; aber sie hätte ohne Verdruß noch viel länger gewartet.
Es war Georg ganz sonderbar zumute, als er diese Strecke, die er vor nicht langer Zeit unter ganz andern Bedingungen kennen gelernt hatte, nun im bequemen Pullman-Wagen und an der Seite seiner reizenden Braut durchfuhr. Noëmi strahlte in den blühenden Farben der entzückenden Jugendfrische. Aus ihren tiefblauen Augen leuchtete das reinste Glück. Sie freute sich darüber, wie genau Georg Bescheid wußte, wie er sie schon im voraus auf gewisse Besonderheiten in der Landschaft aufmerksam machte; sie ließ sich ganz genau den Weg, den Georg früher genommen hatte, beschreiben und folgte mit dem ernsthaftesten Bestreben, so teilnahmvoll wie nur möglich zu sein, den Erklärungen Georgs, die dieser ihr mit Benutzung einer Spezialkarte zu geben suchte. Mr. Jefferson hatte es sich in dem Strecksessel bequem gemacht und war darüber eingeschlafen.
Georg und Noëmi waren, um mehr von der Gegend zu sehen und ungestörter plaudern zu können, auf die vordere Plattform des Wagens getreten.
»Da sind sie ja!« rief Georg plötzlich in einer gewissen Erregung, mit dem Zeigefinger nach Osten weisend. »Da! Die roten Zacken! die Needles!« Und mit aufrichtiger Bewunderung fuhr er fort: »Habe ich dir zuviel gesagt? Sind sie nicht herrlich? Sieh nur, wie wunderbar sich die scharfen grellfarbigen Felsnadeln, die jetzt in der vollen Mittagssonne erglühen, von den: lichtblauen sanften Höhenzuge im Hintergründe abheben. Ist es nicht wunderschön?«
Noëmi sah mit ihren großen Augen in die Ferne. Es gefiel ihr auch sehr gut; aber sie war doch noch zu jung, um das volle Entzücken Georgs teilen zu können.
»Ja,« sagte sie, um Georg einen Gefallen zu tun, »es ist wirklich sehr schön.« Aber ihre Aufrichtigkeit zwang sie hinzuzusetzen: »Und dir erscheint es am Ende sogar noch schöner, als es ist. Du hast mir ja erzählt, daß sich für dich ganz besondere poetische Erinnerungen an die Needles knüpfen. Ich sehe in den Needles nur rot und gelb beleuchtete Felszähne; für dich sind sie gleichsam ein von der Natur errichtetes Denkmal an eine entscheidende Wendung in deinem Leben. Aber du hast recht; es ist wirklich hübsch.«
Der Zug dampfte näher. Die Sonne sandte aus der Mittagshöhe sengende Strahlen auf das dürre Land herab. Noëmi war es auf der Plattform zu drückend heiß und zu staubig geworden, und sie trat in den Wagen zurück; Georg aber, der gegen derlei kleine Behelligungen gefeit war, hielt stand und konnte keinen Blick wenden von dem herrlichen Naturschauspiele, das ihn dereinst schon so rief ergriffen hatte.
Der Zug hielt.
Georg war abgestiegen und schlenderte sinnend, den Sand mit den Fußspitzen aufstöbernd, vor dem Wagen auf und ab.
Wie überall auf dem Wege, so hatten sich auch hier in der Nähe des Stationsgebäudes kleine Gruppen von lungernden Indianern eingefunden, die die Reisenden mit neugierigen Augen anglotzten.
Auf einmal entstand unter diesen eine gewisse Bewegung. Sie sahen alle nach einer Richtung hin. Und von da kam leichtfüßig in großen Sätzen ein bronzefarbiges Mädchen herangesprungen, an deren Halse eine goldene Münze in der Sonne glänzte. Georg war von dem Anblick tief ergriffen. Mayo jauchzte kreischend auf, und seltsame Laute lallend, schluchzend und lachend sank sie vor Georg in den Staub und umklammerte seine Kniee. Sie war außer sich vor Erregung. Freundlich abwehrend versuchte Georg sie aufzurichten. Sie verharrte gewaltsam in ihrer geduckten Lage und schüttelte die starken schwarzen Haare.
Erstaunt sah Noëmi vom offenen Wagenfenster auf das befremdliche Schauspiels das sie tief bewegte. Alles Blut wich ihr aus den Wangen.
Endlich hatte Georg das Mädchen vermocht, sich vom Boden zu erheben. Aus ihren tiefen braunen Augen schossen mit wilder Zärtlichkeit ihre Blicke auf ihn. Als sie aber Georgs betroffenen, fast entsetzten Ausdruck gewahrte, zuckte sie zusammen und blickte angstvoll um sich.
Da sah sie am Fenster des Wagens den Kopf eines bleichen Mädchens mit dunkelblauen Augen.
Sie wich scheu einen Schritt zurück, und mit einer unbeabsichtigten plötzlichen Bewegung streckte sie die beiden Flächen der kleinen braunen Hände, als wolle sie etwas Unheimliches beschwören, gegen die weiße Noëmi aus, die nun teilnahmvoll auf sie herabsah. Dann aber verzerrten sich ihre Züge. Sie stieß ein unheimlich ergreifendes Winseln mit hohen heulenden, von Schluchzen unterbrochenen Klagetönen aus.
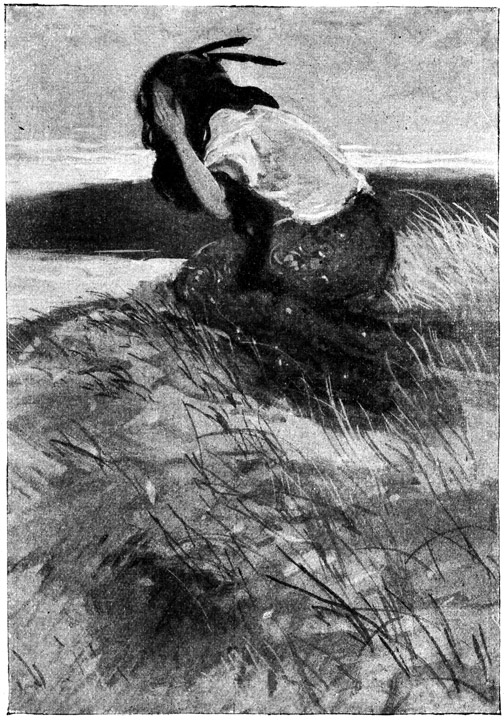
Auf einmal halte sie alles verstanden. Es wurde ihr dunkel vor den Augen.
Sie zürnte nichts aber sie war tief unglücklich. Sie wußte, er war für sie verloren, und sie ahnte, daß sie ein Etwas von dem Geliebten trennte, das nicht zu überbrücken war; und alles, was in diesem Augenblick durch ihre Seele zog, erschütterte sie so, daß sie am ganzen Körper bebte.
Sie sah sich um. Da waren Menschen! Die verhaßten Weißen, die sie anstarrten! Da waren auch Genossen ihres Stammes, die sich neugierig herangedrängt halten! Ein plötzlicher Wutanfall überfiel sie. Sie fletschte die Zähne und stieß einen hohen Schrei aus.
Sie sprang seitwärts, machte mit den Armen Schwimmbewegungen, als wolle sie sich Platz machen, und in wildem Lauf, den Boden kaum berührend, stürmte sie dahin über den gelben Sand, rotbeflügelt in ihrem flatternden Mantel, leicht und schnell, wie die tieffliegende Möwe über den glatten Wasserspiegel.
Auf dem nahen Sandhügel, hart am Ufer des Kolorado hockte sie nieder. Da war sie allein; da hatte sie ihn zuerst gesehen. Und wie damals zog sie die Kniee gegen die Brust, stützte die Ellenbogen auf die Kniee und den schönen schwarzumwallten Kopf auf die Hände und sah mit unsagbarer Schwermut auf den herrlichen Feuerball am unermeßlich blauflutenden Himmel. Der Sonne Glanz blendete sie nicht. Das so schöne, von den langen leuchtenden Wimpern umfaßte wehmutsvolle Auge blieb unverwandt mit dem Ausdruck inbrünstigen Flehens auf das heißglühende und strahlende Gestirn gerichtet, und ihre Lider schlossen sich nicht. Dann aber wurde ihr Auge feucht, und dicke Tropfen rollten über ihre dunklen Wangen. Aus dem halboffenen Munde atmete sie laut und schwer wie eine Tiefleidende.
Und so saß sie noch da, wie weltentrückt zur ewigen Sonne aufstarrend, als das eiserne Dampfroß der Kultur grausam an dem gelben Hügel der Wildnis vorübersauste.
»Das war Mayo«, sagte Georg ernst.
Noëmi nickte schweigsam und lehnte den Kopf an Georgs Schulter. Er neigte sich dankbar zu ihr, streichelte sanft die mit rosigem Hauch übergossenen Wangen und küßte ihre weiße Stirn.
»Wo sind wir denn eigentlich?« fragte Mr. Jefferson, der eben aufgewacht war und sich die Augen rieb.
»An den Needles, Papa«, antwortete Noëmi, ohne ihren Kopf von Georgs Schulter zu entfernen. Sie schmiegte sich noch fester an, und als Jefferson nach der falschen Richtung hinblickte, fügte sie, wie im Frohgefühle des Sieges nach ernsthaftem Kampfe, mit einem eigentümlichen Lächeln auf die Felszacken weisend, hinzu: »Da liegen die Needles! ... hinter uns.«