
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
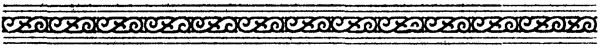
Einige Tage, nachdem der Prinz Berlin verlassen, hatte man im Wegmannschen Hause die Taufe des ersten Enkels feierlich begangen.
Die Gäste hatten sich entfernt, die letzten Spuren des Festmahles waren fortgeräumt, und eine sanfte Stille herrschte in dem Putzzimmer, an dessen Fenster die beiden alten Leute saßen. Tannengewinde schmückten die Türen, durch welche man den Täufling getragen; weißer, feiner Sand und Tannenknospen waren auf Fluren und Treppen gestreut, und bewegten sich knisternd und duftend unter den Fußtritten der Dienstboten, welche noch geschäftig umhergingen, während die Hausfrau sich nach der freudigen Mühe des Tages auszuruhen vergönnte.
Der Mond schien durch leichtes Gewölk freundlich vom Frühlingshimmel in das Gemach, er berührte die Primeln und Schneeglöckchen mit hellem Streiflicht, welche in altertümlichen Blumenvasen auf den mit Damast überdeckten Tischen standen. Im grünen Schlafrock, die Füße mit den warmen Morgenschuhen bekleidet, saß der Alte in seinem Lehnstuhl und wirbelte blaue Wolken aus der Meerschaumpfeife in die Luft, ein Bild behaglicher Ruhe, zu der eben so friedlichen Hausfrau hinüberblickend.
Die junge Mutter hatte sich zu ihrem Kinde begeben, und liebevoll gedachten die Alten der schönen Schwiegertochter und des blühenden Enkels, als ihr Sohn zu ihnen in das Zimmer trat.
Nun mein Junge! rief der Vater dem Eintretenden entgegen, schläft Wegmann junior schon nach seinen ersten Heldentaten? Ich wär auch mit einem Mädchen zufrieden gewesen, aber der Knabe ist mir doch lieber. Das ist ein Nachfolger im Geschäft, und den hab ich mir und Dir gewünscht. Jetzt fehlt uns nichts mehr zum Glück, als –
Mein Bruder! fiel ihm der Sohn ins Wort, welcher neben den Eltern Platz genommen hatte. Ich kam herunter, lieber Vater, um für Fritz bei Ihnen zu bitten. Ich, Sie, wir alle sind so glücklich gewesen; Fritz allein hat uns gefehlt!
Der Alte nahm die Pfeife aus dem Munde. Wer trägt die Schuld? fragte er trocken. Du hast jetzt selbst ein Kind; glaubst Du, daß ein Vaterherz, daß eine Mutter sich leicht von ihrem Kinde trennen? Meinst Du, daß er mir heute nicht gefehlt hat im Kreise der Unsern? daß ich die Tränen der armen Mutter nicht verstanden habe?
Er erhob sich und ging im Zimmer umher, der Sohn stand gleichfalls auf, nur die Mutter blieb am Fenster sitzen, still die überfließenden Augen trocknend.
So rufen Sie ihn zurück! er ist in unserer Nähe, lieber Vater!
In Berlin? hier in Berlin? und was treibt er in Berlin?
Er ist Soldat!
Auch das noch! auch diese letzte Schmach! rief der Alte in heftigem Zorn. Nicht genug, daß er sich in Leipzig mit dem Frauenzimmer eingelassen hat, daß Leipziger Kaufleute mich davor warnen mußten, daß ich auf der Messe nicht rechts noch links zu sehen wagte, aus Furcht, wegen der schändlichen Geschichte einmal zur Rede gestellt zu werden – nun noch Soldat! Mitten unter alle dem Gesindel! Der Sohn von Wegmann und Compagnie Soldat! Es wird mir Ehre machen, wenn ich mit meinen Geschäftsfreunden von der Börse komme, und man mir sagen wird: da, dort in Reihe und Glied, Herr Wegmann, da steht Ihr Sohn!
Des Königs Rock –
Den soll mein Sohn tragen! rief der Alte, so heftig mit der Hand auf den Tisch schlagend, daß die Blumenvasen erzitterten und das Wasser zur Erde floß.
Und doch, Vater, trug ihn der Prinz, als er uns hier besuchte! –
Der Prinz ist nicht des alten Wegmann Sohn! Der Prinz mag Soldat sein, Frauenzimmern nachlaufen, so viel er will, mein Sohn solls nicht! Er soll es nicht.
Es entstand eine Pause. Endlich sagte Karl: So kaufen Sie ihn los. Ich hätte es getan, aber es bedarf Ihres Zeugnisses, weil Fritz noch minderjährig ist.
Der Alte antwortete nicht. Er soll mir schwören, dem Mädchen zu entsagen! rief er nach langem Schweigen plötzlich, und ich will alles vergeben und vergessen.
Sie wissen, bester Vater, daß er gerade dies eine verweigert, sagte Karl mit dem begütigenden Ton kindlicher Unterordnung. Seien Sie gerecht, Vater, lassen Sie uns eingestehen, daß Ihre Strenge ihn zu dem verzweifelten Schritt bewog, der ihn ins Militär getrieben hat. Sträubt sich Ihr Gefühl dagegen, ihn hier mit seiner Frau leben zu lassen, so machen Sie ihn frei. Machen Sie, daß er fortgehen und sich in Frankreich oder Amerika eine Heimat suchen kann.
Weder in Frankreich, noch in Amerika soll mein Sohn eine Dirne heiraten, und auf keinem Punkt der Erde soll ein Judenmädchen meinen ehrlichen Namen tragen. Ich habe den Namen unbescholten ererbt von meinen Eltern, unbescholten will ich ihn Dir und Deinen Kindern hinterlassen. Entweder er schwört, das Mädchen aufzugeben, oder, so wahr Gott lebt, ich will nie mehr seinen Namen vor mir hören!
Ohne eine Antwort abzuwarten, ging der Alte hastig aus dem Zimmer.
Laut schluchzend fiel die Mutter dem Sohne um den Hals. Habe ich ihn dazu mit so unsäglichen Schmerzen geboren, daß er Schimpf und Schande, Gram und Streit bringe über mein Alter? weinte sie.
Der Sohn streichelte freundlich ihr greises Haar, küßte ihre Hände und bot alles auf, sie zu besänftigen, sie zur nochmaligen Fürbitte bei dem Vater zu überreden. Er schilderte ihr sein Empfinden, wie er neulich, als sie im bequemen Wagen vorübergefahren, den Bruder plötzlich Holz spaltend vor der Kaserne erblickt habe. Er malte ihr das Wiedersehen am darauffolgenden Tage. Er schwor ihr, daß jenes Mädchen nur unglücklich und nicht unwürdig sei, daß sie Friedrich eine treue Gattin sein würde. Er bat sie, den Sohn kommen, ihn selbst zum Mutterherzen sprechen zu lassen – es blieb umsonst.
Und wenn mein Herz bricht, ich kanns nicht zugeben; ich darf ihn nicht sehen, ich kann nicht für ihn bitten. Wie soll ich vor Gottes Tisch, wie soll ich vor den Pastor treten, wenn mein eigen Fleisch und Blut sich mit Juden verheiratet? Ich könnts nicht vor Gott verantworten auf dem Totenbett!
Wie an dem harten bürgerlichen Vorurteil des Vaters, scheiterten an der Mutter religiöser Starrheit alle Versöhnungsversuche Karls; und selbst sein junges Weib, auf deren Vermittlung er gerechnet, hatte ihm diese verweigert, weil sie vom Standpunkte der Sittlichkeit aus sich nicht überwinden konnte, ihren Schwager und seine unglückliche Geliebte zu entschuldigen.
In traurigen Gedanken ruhte Karl, das Haupt in die Hand gestützt, an derselben Stelle, an der sein Vater gesessen hatte, überlegend, wie er dem Bruder helfen möge, sich ein glücklicheres Los zu bereiten, ohne den Konsens des Vaters zur Loskaufung und zur Ehe erhalten zu haben. Nur Seitenwege, nur Bestechung, welche damals in Preußen fast alles möglich machte, konnten zum Ziele führen; widerwillig entschloß er sich dazu.
Aber während er aufstand, um in seine Wohnung zurückzukehren, sagte er sich selbst: Und er sollte sein Leben opfern für ein Land, in dem jedes blinde Vorurteil durch Gesetze, durch Institutionen geheiligt und unvergänglich gemacht wird? Wäre er in Frankreich, so wäre der Kriegsrock, der ihn hier in den Augen des eigenen Vaters entehrt, sein stolzester Schmuck, und kein Vorurteil trennte ihn von dem Weibe, das er liebt. Er soll fort von hier und bald!
Es gibt Stunden, in denen die Notwendigkeit einer Aenderung unseres Schicksals so dringend vor unsere Seele tritt, daß wir glauben, die Möglichkeit dieser Aenderung müsse nahe liegen, müsse uns leicht werden, sobald wir nur wollen. Aber die Fesseln unserer Vergangenheit halten uns niederziehend an das Bestehende gebannt, und nur selten wird es einem Glücklichen zuteil, eine unheilvolle Vergangenheit von sich schleudern und ein neues Leben beginnen zu können.
Ich habe mich betrogen, sagte der Prinz zu sich selbst, als er, vom Pferde gestiegen, in Charlottenburg die Gemächer betrat, welche er dort zu bewohnen pflegte. Ich weiß jetzt, daß ein Weib immer nur ein Weib ist. Dies war meine letzte schmerzliche Enttäuschung. Wahres Glück zu suchen in der Liebe, war ein kindischer Traum. Mein Liebesleben ist zu Ende. Jetzt, heute, in diesem Augenblicke, beginne ich ein neues Dasein.
Anknüpfend an jene Unterredung auf dem Maskenballe wollte er der Königin sich und sein Leben darbringen, jeder Selbstbestimmung entsagend. Sie sollte entscheiden, was er beginnen, was er tun sollte. Er zweifelte nicht, daß sie ihn verstehen, daß sie Teil an ihm nehmen müsse, und bei der Lebhaftigkeit seiner Einbildungskraft hatte er sich auf dem einsamen Ritte die ganze Audienz, die ganze Begegnung mit der Königin bis in die kleinsten Züge deutlich ausgemalt.
Er ließ sich melden, ward angenommen, aber die Königin war nicht allein. Ihre Oberhofmeisterin und noch eine Dame befanden sich in dem Gemache. Der Prinz kannte sie, es war Frau von Stael, die Tochter des französischen Ministers Necker, eine der ausgezeichnetsten Frauen ihrer Zeit.
Noch nicht vierzig Jahre alt, groß und stark gebaut, konnte sie, trotz der Unregelmäßigkeit ihrer Züge, welche besonders in den zu vollen Lippen hervortrat, auch äußerlich für eine anziehende Erscheinung gelten. Prächtiges schwarzes Haar, in griechischen Flechten lose um das Haupt gewunden, große, flammende Augen, schöne Schultern und Arme gaben ihr einen Reiz, der durch ihre seltene Beredsamkeit noch erhöht ward.
Mehr eine Feindin Bonapartes und seiner Alleinherrschaft als eine Anhängerin der vertriebenen Königsfamilie war sie aus Frankreich verbannt und schon darum am Hofe zu Berlin von allen denen mit Wohlwollen empfangen worden, welche gleiche Abneigung gegen Bonaparte hegten als sie. Auch der Prinz nahm Teil an ihrem Schicksal, liebte ihre Gesellschaft, sah sie fast täglich und würde in jeder anderen Stunde ebenso erfreut von dieser Begegnung gewesen sein, als sie ihm jetzt unwillkommen erschien. Eine gleichgültige Unterhaltung mit Fremden führen zu müssen in einem Augenblicke, in dem man an einem Wendepunkte seines Lebens zu stehen glaubt, ist schwer. Es schien ihm eine üble Vorbedeutung darin zu liegen, daß schon bei dem ersten Schritte auf dem neuen Wege ihm ein Hindernis entgegentrat. Mißtrauisch geworden gegen sich selbst, gegen seine Willenskraft, wollte er das entscheidende Wort gesprochen haben, durch Fesseln gebunden zu sein, um einen Beistand gegen die eigene Schwäche zu finden, die er selbst in diesem Augenblicke eine unmännliche nannte.
Jeden Augenblick hoffend, daß die Königin Frau von Stael entlassen, daß er eine Privataudienz erhalten werde, konnte er sich nicht zum Fortgehen entschließen, obwohl die Unterhaltung ihm ebensosehr zur Qual gereichte, als die Königin sie mit Teilnahme verfolgte.
Man sprach von den Zuständen Frankreichs, von den französischen Prinzen, von den Aussichten, welche sich für den Sturz Bonapartes, für die einstige Rückkehr der Bourbons auf den Thron von Frankreich bieten konnten.
Es scheint mir unmöglich, es ist fast gegen die menschliche Natur, daß ein Zustand, wie der in Frankreich, lange dauern könnte, sagte die Königin. Die Stürme der Revolution grollen fort und fort in dem unglücklichen Lande, alle Leidenschaften sind aufgeregt, jeder glaubt sich zum Herrschen berechtigt, da die rechtmäßigen Herrscher fehlen. Wie ist es anzunehmen, daß man Bonaparte lange eine Macht in Händen lassen werde, auf die Tausende gleiche Ansprüche geltend machen. Wie sie untereinander auch verfeindet sind, wird der Neid die verschiedenen Parteien verbinden, den einen zu stürzen, der sie jetzt alle noch in Fesseln schlägt.
Er wird mit seiner Tyrannei alle Parteien besiegen, Majestät! Er wird unantastbar bleiben, solange er sich selbst besiegt und nicht Hand anlegt an die Republik, welche seine Mutter, das feste Fundament seiner Größe ist, behauptete Frau von Stael.
Und das sagen Sie, die ihn einen Robespierre zu Pferde nannten? fragte der Prinz, Sie, seine entschiedene Gegnerin, die er aus Frankreich verwies?
Ich habe das Recht gewonnen, ihn zu hassen und gering zu schätzen, weil ich ihn einst so warm und wahr bewunderte. Was man einst geliebt, haßt man am stärksten, wenn es uns betrog.
Ein Stich zuckte durch das Herz des Prinzen, das Paulinens Namen nannte. Im Tone der Selbstanklage sagte er leise: auf tausend Wegen immer zu dem einen Ziel! Dann atmete er tief auf, fuhr mit der Hand über die Stirn, als wolle er einen bösen Gedanken verscheuchen, und wendete sich gegen die Königin, welche nähere Erklärung über die erste Behauptung der Frau von Stael gefordert hatte.
Es gab eine Zeit, Majestät! antwortete diese, in der ich noch an Wunder glaubte, welche die Willenskraft des einzelnen vollbringt. Solch ein Wunder erwartete ich von Bonaparte, als ich ihn den Drachen der Anarchie unter seine Ferse treten sah, stolz und sicher über ihn fortschreitend, allmächtig durch das Vertrauen in sich, in die Götterkraft seines Willens. Weil er so fest an sich selbst glaubte, habe ich ihm geglaubt. Sein fanatisches Selbstgefühl schien mir eine göttliche Mission zu künden, und wenn der Tod ihn verschonte, wenn er rings um ihn her alles darniederwarf, traute ich mit Bonaparte auf seinen Stern. Es ist so erhebend, Großes zu erleben, an Großes zu glauben! Jetzt aber, seit ich auch ihn nur als einen der Tausende erfunden habe, seitdem hasse ich ihn und werde ihn verachten, wenn er es wagt, die Krone eines gemordeten Königs auf sein Haupt zu setzen, der seines Volkes Wohl treuer und wärmer im Herzen trug als Bonaparte und es glücklich gemacht hätte, würde er die Einsicht dieses Usurpators besessen haben.
Frau von Staels Augen sprühten Flammen eines heiligen Zornes; die Königin, der Prinz sahen sie staunend an, sie schien ihre Umgebung vergessen zu haben, ihr Blick haftete an keiner der anwesenden Personen. Wie eine Sibylle hatte sie, gezwungen durch ihr Gefühl, ihr ganzes Denken enthüllt, nun schien sie Vergangenheit und Gegenwart im Geiste zu durchforschen, um die ferne Zukunft danach zu ergründen.
Ich habe nie gewußt, daß die Republik eine so leidenschaftliche Bekennerin an Ihnen hat, meine gnädige Frau! sagte endlich der Prinz.
Frau von Stael blickte ihn einen Augenblick in halber Zerstreuung an. Die Republik? wiederholte sie, wer kann an die Möglichkeit einer Republik glauben, wenn selbst ein Bonaparte nicht die Kraft hat, ein wahrer Republikaner zu sein. Ich habe die Republik geliebt, weil ich den Menschen achtete, die Tugend liebte, an seine Selbstverleugnung glaubte. Das Leben hat mich eines anderen belehrt. Ich bin klüger geworden, doch nicht besser.
Sie schmeicheln uns nicht, bemerkte die Königin, wenn Sie die Herrscher auf diese Weise als notwendige Uebel betrachten!
Ich erachte die Macht der Krone und ihre Träger nach den Erfahrungen, welche ich gewonnen, für die segensvolle Schranke, für die notwendigen Wächter, welche die Leidenschaft des einzelnen von dem Streben nach der höchsten Macht zurückhalten, die, solange die Selbstsucht noch die Besten verblendet, unerreichbar sein muß, um nicht von jedem begehrt, um nicht Veranlassung zu unausgesetztem Kampfe zu werden. Aber das hindert nicht, daß alles, außer der höchsten Macht, teilbar und gleich geteilt sei unter denen, die dazu auf irgendeine Weise berechtigt sind. Ich denke an England und seine Verfassung, indem ich dieses sage, Majestät!
Stets bereit, die Wahrheit zu hören und sich zu unterrichten, hatte die Königin die vollste Duldung für jede Meinung und eine hohe Achtung vor selbständiger Gesinnung, auch wo diese von ihren Ansichten verschieden war. So konnte Frau von Stael es wagen, sich offen gegen sie auszusprechen, gewiß, Verständnis und Würdigung ihrer Freimütigkeit zu finden, wie sie sie auch von dem Prinzen gewöhnt war.
Der Eintritt des Königs beendete diese Unterhaltung. Frau von Stael wurde entlassen, die Kammerherren und Hofdamen erschienen, und man begab sich zur Tafel.
Als darauf am Nachmittage der Prinz in seine Gemächer trat, schien es ihm, als habe er seit diesem Morgen viele Monate verlebt. Die Entschlüsse, mit denen er nach Charlottenburg gekommen war, lagen ihm traumartig fern; nur ein Gedanke stand lebhaft vor seiner Seele, die Sehnsucht nach Pauline, der Schmerz um sie. Nicht daß er litt, beklagte er, sondern daß sie ihm ein Leid getan.
So lange schien ihm die Zeit, seit er sie nicht gesehen, daß er noch in dieser Stunde zu ihr eilen wollte. Aber was sollte, was konnte er Paulinen sagen, die sich, glaubenlos gegen ihn, vertrauend an Wiesel angeschlossen hatte.
Sie fürchtete, ihr Weiberherz werde zittern bei dem Dolchstoß, und sie bat Wiesel, ihre Hand zu führen, um sicher und tödlich zu treffen! rief er aus, als er sich den Entschluß abgetrotzt hatte, sie nicht wieder zu sehen.
Tage voll tiefer Schwermut waren diesem ersten gefolgt. Endlich ertrug es der Prinz nicht länger.
Sage mir, daß Dein Herz nach mir verlangt, und ich liege anbetend, liebend und vertrauend zu Deinen Füßen, schrieb er ihr.
Aber, von Wiesel bestimmt, hatte Pauline sich taub gemacht gegen ihr eigenes Gefühl und sich in der ersten Heftigkeit ihres Zornes so festgebannt in die Beteuerungen, den Prinzen nie wieder sehen zu wollen, daß sie sich vor Wiesel ihrer Liebe und ihrer Sehnsucht wie einer Schwäche schämte.
Wirklich starke Charaktere haben den Mut und die Freimütigkeit, ein Unrecht als Unrecht zu bekennen, weil sie immer den Willen und fast immer die Macht haben, es zu sühnen. Schwache Naturen gestehen das Unrecht ein, um hinter diesem Eingeständnis Schutz vor sich selbst und vor dem Tadel anderer zu suchen. Sie verlangen, von fremder Kraft gestützt und auf den rechten Weg geführt zu werden, um nicht durch freiwilliges Aufgeben des bisher verfolgten Pfades einzuräumen, daß sie selbst ihn als einen falschen anerkennen mußten.
So war es mit Paulinen. Täglich ging sie zu Rahel, machte Bekenntnisse, verlangte Aufschlüsse, Trost und Rat; sie beschwor heut ihre Liebe und ihr Vertrauen, morgen ihre Zweifel und ihren Haß, ohne ein Ende zu finden, einen Entschluß fassen zu können, weil sie sich den Anschein zu geben wünschte, als habe nicht die eigene Sehnsucht, sondern die dringende Ueberredung anderer sie zur Versöhnung bestimmt.
Unablässig bemüht, Pauline von ihrem Unrecht zu überzeugen, litt Rahel fortwährend durch sie. Einer Frau die Leidenschaft des Mannes zu schildern, den man selbst ohne Hoffnung liebt, dazu gehört die ganze Kraft einer starken, weiblichen Seele.
Wir leben in Zuständen, schrieb Rahel einmal an Gentz, die ganz dazu gemacht sind, uns den Rest des Verstandes zu nehmen, den die Zeitverhältnisse und ihre Trostlosigkeit uns übriggelassen haben. Pauline martert mich bis zur Nervenabspannung mit Fragen, welche sie sich alle selbst beantworten könnte. Ich aber verabscheue solche Fragen, die mir auch der Prinz und Henriette vorlegen. Einer ist unglücklicher als der andere, und ich habe das Ehrendiplom, es am meisten zu sein.
Henriette macht sich verdiente Vorwürfe über ihr Verhältnis zu Dussek und macht sie deshalb dem Prinzen und Dussek doppelt und dreifach. Der Prinz möchte Dussek fortschicken, behält ihn aber, um in seiner Abneigung gegen ihn den Vorwand zum Vermeiden Henriettens zu haben, und tadelt sich doch, weil er diesen Nebenbuhler duldet.
Pauline läßt sich von Wiesel einbilden, eine erhabene Stärke zu beweisen, indem sie ein liebendes, vertrauendes Herz durch Eigensinn quält, und ich muß es sehen, mit weinender, knirschender, ohnmächtiger Wut, daß der Prinz mitten in dieser Schlechtigkeit, Halbheit, Kleinheit, die uns alle schon elend gemacht hat, sie noch immer liebt und glaubt und hofft.
Wiesel allein ist glücklich und froh. Er lacht über Henriette und Dussek, über den Prinzen und Pauline, aber am meisten über mich; und wie ich das Diplom habe, die Unglücklichste zu sein, habe ich auch das Privilegium, ihm am lächerlichsten zu erscheinen.
Nicht wahr, Gentz! nicht wahr? auch Sie lachen, daß ich, die kluge Rahel Levin, so dumm und blind sein konnte, von Pauline, von Wiesels Schülerin, Wunder idealischer Liebe zu erwarten, Liebeswunder von einer Berlinerin im neunzehnten Jahrhundert! Aber Gentz, nicht dumm war ich, sondern schwach! Schwach wie ein Mutterherz, das dem kranken Kinde, wenn es phantasierend Engel zu Spielgefährten verlangt, ein Engelsbild ins Krankenzimmer bringt und mit der Inbrunst der Mutterliebe auf den Knien zu Gott schreit: Gott im Himmel, tue ein Wunder! belebe das Bild, denn der Abgott meines Herzens kann nur genesen, wenn Du ihm einen Engel sendest. – Und er soll, er muß genesen, meine Liebe will es!
Lachen Sie jetzt auch noch, Gentz? Ich weiß, Sie werden schaudern und sich wundern, daß nicht die Nacht des Wahnsinns sich um die Sinne der unglücklichen Mutter legt, wenn sie inne wird, daß Gott keine Wunder mehr tut in unserer Zeit, und sie dem hinsterbenden, engelverlangenden Liebling nichts zu bieten hat – als ein totes, kaltes Bild, welches die Wüstheit seiner Phantasien steigert.
Sie sagen, Deutschland wird untergehen, – was kümmert mich das, in diesem Augenblicke! In mir ist auch eine Welt untergegangen, und es wird eine untergehen in dem Prinzen, die mehr wert war als alle Königreiche der Erde.
Von seiner Unruhe fast alltäglich nach Berlin getrieben, befand der Prinz sich eines Mittags in Rahels Wohnung, als plötzlich Graf Tilly in das Zimmer trat. Rahel und der Prinz erschraken bei seinem Anblicke. Sein Haar war vom eiligen Gehen in Unordnung geraten, des Puders zum Teil entblößt, seine Kleidung weniger sorgfältig als sonst, seine Züge drückten Schmerz und tiefes Entsetzen aus.
Was bringen Sie, Tilly? Was ist geschehen? fragten Rahel und der Prinz zugleich.
Ein Treubruch, ein Verbrechen ohne Beispiel, der furchtbarste Verrat an Völkerrecht und Menschenrecht. Bonaparte hat den Herzog von Enghien, den Sohn Bourbon Condé's, erschießen lassen.
Das ist nicht möglich! rief der Prinz, das hat er nicht gewagt!
Was wäre in dem unglückseligen Lande, was wäre dem frechen Korsen unmöglich, seit das heilige Haupt des Königs unter dem Beile der Guillotine gefallen ist?
Aber wie, unter welchem Vorwande ist das geschehen? Der Prinz befand sich ja außer den Grenzen Frankreichs, auf deutschem Boden, unter dem Schutze eines deutschen Fürsten, wendete der Prinz ein.
Kümmert das Bonaparte? fragte Tilly. Der Herzog, bei dem Ausbruche der Revolution entflohen, befand sich in Ettlingen, wo er ruhig lebte. Plötzlich wird er von einem Detachement französischer Truppen überfallen. Man sagt ihm, daß er ein Gefangener sei. Unter dem Vorgeben, er habe teilgehabt an Georg Cadoudals Verschwörung gegen Bonaparte, führt man den Prinzen nach Frankreich in die Gefängnisse von Vincennes. Ein Kriegsgericht erklärt ihn des Verrates am Vaterlande schuldig, und noch in derselben Nacht vollstreckt man das fluchwürdige Todesurteil, indem man dem Prinzen eine Laterne vor die Brust bindet, um den republikanischen Schützen ihr Ziel zu zeigen.
Das Gesicht mit den Händen verhüllend, überließ Graf Tilly sich seinem tiefen Schmerze, während der Prinz bitter hohnlachend ausrief: Wie werden sie jammern und klagen, daß die Schlange sticht, die sie zu zertreten nicht Mut besaßen, als sie die Kraft dazu noch hatten!
Nach kurzer Unterredung verließen der Prinz und Tilly Rahel, um nach Charlottenburg zu eilen, mit dem Versprechen, ihr so bald wie möglich Nachricht zu senden, wie man die Untat dort aufgenommen habe.
In Charlottenburg angelangt fanden sie alles in der größten Bestürzung. Die Minister, die auswärtigen Gesandten waren versammelt. Botschaften gingen zwischen Charlottenburg und Berlin hin und her, Kuriere mit Depeschen und Noten wurden nach allen Weltgegenden abgefertigt. Fast alle Mitglieder des königlichen Hauses fanden sich im Laufe des Tages ein, man kam und ging in den Zimmern der Königin, während Graf Haugwitz und die Minister den ganzen Morgen im Kabinett des Königs arbeiteten.
Das königliche Paar bewohnte in Charlottenburg die Gemächer, welche, zu ebener Erde gelegen, sich mit Flügeltüren auf die Orangerie-Terrasse öffnen. Möbel von schlichtem Holz, mit Ueberzügen von Kattunen, die man aus der Wegmannschen Fabrik neuerdings angekauft hatte, um den Gebrauch inländischer Erzeugnisse einzuführen, englische Kupferstiche und Bilder in schwarzer Kunst, größtenteils Szenen des Familienlebens darstellend, bildeten den ganzen Schmuck derselben. Nirgend sah man Pracht, nirgend Ueberfluß, aber auch nirgend eine Spur jener künstlerischen Bildung, welche den Genuß edler Kunstwerke als eine Grundbedingung des Daseins empfindet.
In dem kleinen, von dunkeln Kastanienbäumen beschatteten Teile des Gartens, zunächst dem Schlosse, den der Hof sich zu seinem ausschließlichen Gebrauche vorbehalten hatte, gingen die Prinzessin Marianne, die Gemahlin des Prinzen Wilhelm, und die Prinzessin Radziwill Arm in Arm umher, die Zeit zu verkürzen, bis sie die Königin sehen konnten. Prinz Louis, der sich zu ihnen gesellte, hatte dieselbe eben verlassen.
Wie haben Sie die Königin gefunden? rief ihm die Prinzessin Marianne entgegen.
Aeußerlich gefaßt, aber bleich und still. Ihre Augen füllten sich mit Tränen, als sie, jenes Mordes gedenkend, die Kinder ansah, die man auf ihren Befehl zu ihr gebracht hatte.
Und der König? was sagt er zu dem Ereignis?
Er schweigt aus Resignation und resigniert sich aus Pflichtgefühl, antwortete der Prinz in einem Tone, welcher seine Unzufriedenheit mit dieser Handlungsweise durchblicken ließ.
Ja, die Last ist groß, welche der Zorn des Herrn in dieser Zeit auf die Schultern der Könige wälzt, seufzte die fromme, junge Fürstin.
Um so schneller müßte der Entschluß der Könige sein, diese Last abzuschütteln und sich und ihre Völker von der Tyrannei Bonapartes zu befreien, entgegnete der Prinz.
Die Prinzessin blickte ihn mit ihren großen Augen wehmütig an. Spotten Sie meiner Verzagtheit, Vetter, sagte sie, aber spotten Sie nicht über die Wege und Mittel, welche Gott wählt, unsere Herzen zu lenken. Wir büßen vielleicht alle die Schuld unserer Voreltern, ihre Verschwendung, ihre Zügellosigkeit. Wer weiß es, ob wir besser wären als sie, hätte nicht die Revolution an unser Gewissen geklopft und stände nicht der Entsetzliche ewig mit dem gezogenen Flammenschwert vor unsern Augen. Der König handelt und duldet, wie ein christlicher Fürst es soll, er wird auch siegen und nicht untergehen, das hoffe ich zur Gerechtigkeit Gottes, der ihn erleuchten wird.
Ich hoffe und glaube alles, was Sie wollen, solange Ihre Augen überzeugend auf mich wirken, antwortete der Prinz. Fern von Ihren Augen baue ich jedoch weit weniger auf die Erleuchtung des Herrn, als ich die Verblendung fürchte, deren Schöpfer Haugwitz ist.
Aber was wird man tun, Louis? fragte die lebhaftere Fürstin Radziwill ihren Bruder; was denkt, was meint Haugwitz?
Haugwitz denkt, da die Reben nicht erfroren sind und wir um jeden Preis, selbst um den unserer Ehre, Frieden behalten müssen, werde er im Oktober wieder ein Winzerfest in seinem Garten feiern und bei dem Weinkeltern das Blut des französischen Prinzen vergessen können.
Scherze nicht! ich beschwöre Dich, Bruder, sage, was wird man tun? wiederholte sie dringender.
Tun? hier in Preußen? – Nichts Louise! Bonaparte allein tut etwas, und zwar alles, was er will, wir anderen sehen zu und staunen, antwortete der Prinz, als ein Kammerherr die Prinzessin Marianne auffordern kam, sich zur Königin zu begeben. Die beiden Geschwister blieben zurück. Die Prinzessin nahm den Arm ihres Bruders und ging mit schnelleren Schritten den entlegeneren Teilen des Parkes zu.
Eine Strecke vom Schlosse blieb sie stehen, sah sich um, als fürchte sie das Ohr eines Lauschers. Endlich, als sie sich überzeugt hatte, daß sie allein seien, sagte sie: Ich habe Dich gefragt, was wird man tun, und Du hast mir mit gerechtem Spotte die Tatenlosigkeit unseres Hauses vor die Seele gerufen. Jetzt frage ich Dich, Louis, Prinz von Preußen, Enkel der Hohenzollern, was wirst Du tun?
Luise!
Nein! rief sie, unterbrich mich nicht. Ich weiß, was Du sagen kannst, weiß alles, was mir die Mutter von Jugend auf gepredigt hat von der schweigenden Unterwerfung unter den Willen unseres Oberhauptes, des Königs, der uns ein Gesetz ist. Ich weiß das alles – aber ich glaube es nicht mehr, denn Bonaparte und wir kämpfen mit ungleichen Waffen. Er hatte nichts zu verlieren, als er seinen Weg begann, das war sein Glück, denn dadurch war er frei und konnte die Höhe erreichen, von der herunter er uns bedroht.
Mußt Du meine tiefen Wunden aufreißen, Schwester? fragte der Prinz, krampfhaft ihre Hand in der seinen pressend.
Und blutet mein Herz denn nicht? rief sie. Glaubst Du, daß ich vor meinem Manne nicht erröte, vor dem Polenfürsten, der knirschend das Joch der Knechtschaft auf dem Nacken seines Volkes sieht, unablässig auf Rettung, auf Erlösung seines Vaterlandes denkend? Glaubst Du, ich bebe nicht, wenn das mächtige Königshaus, dem ich, sein Weib, entsprossen bin, die Hände dem Usurpator, kriechend vor ihm, entgegenstreckt, damit er, der Niedriggeborene, die Königskinder in Ketten schlage?
Tränen des Zornes glänzten in ihren Augen, der Prinz war bleich geworden vor innerer Bewegung.
Wecke die Dämonen nicht, sagte er mit gepreßter Stimme, die mich seit Jahren verfolgen, die ich niederhalten muß mit aller Kraft meiner Seele, mich festklammernd an Satzung und Ehre, welche mich, den Untertan, den Soldaten, den Prinzen, mit dreifachen Ketten an den König binden.
Vor der Notwehr endet die Pflicht! Notwehr zerbricht die Ketten! entgegnete die Prinzessin. Toren die Ihr seid! Ihr bindet Euch an Gesetze, an Verträge, an Völkerrecht einem Feinde gegenüber, der so riesig wird, weil er weder Gesetze, noch Verträge, noch Völkerrecht achtet. Er hat sich außerhalb der staatlichen Gesellschaft hingestellt. Darum ist er allmächtig geworden. Darum hat er die Möglichkeit gehabt, sich über uns zu erheben als unser böser Dämon oder als eine Geißel des Zornes, wie die Cousine es nannte.
Soll ich ehrlos handeln wie er?
Willst Du stehenbleiben vor der angewiesenen gesetzlichen Schranke im Zweikampf auf Leben und Tod, wenn Du siehst, daß Dein Gegner die Schranke niedertritt, um Dir die Pistole auf die Brust zu setzen?
Es entstand eine Pause, sie gingen wortlos nebeneinander her, stumm vor innerer Erregung. Plötzlich fuhr der Prinz empor, und seine Schwester fragte: Was war das? Es knisterte in den Zweigen der Gebüsche, und ein Mann bog seitwärts ab in die Nebenallee, welcher ganz in der Nähe der fürstlichen Geschwister gewesen sein mußte.
Der Prinz schlug vor, einen Umweg zu machen, um ihm zu begegnen, aber sie konnten die Gestalt nicht wiederfinden.
Statt des früher gesehenen Mannes trat ihnen der Kapellmeister Reichard, ein ausgezeichneter Musiker, in den Weg, der von Halle nach Berlin gekommen war und einen Spaziergang durch den Schloßgarten gemacht hatte.
Reichard war dem Prinzen und seiner Schwester bekannt, und diese wandte sich nach den ersten Worten der Begrüßung mit der Frage an ihn: was man in Berlin an den öffentlichen Orten zu der neuesten Gewalttat Bonapartes sage?
Es ist nur ein Schrei der Empörung überall, Hoheit! sagte der Kapellmeister. Man blickt mit Spannung nach Charlottenburg, einen entscheidenden Schritt des Königs erwartend, und ich möchte, wenn es nicht zu dreist wäre, fragen, ob Hoheit glauben, daß man einen solchen beabsichtige?
Denken Sie, daß wir die Pläne des Grafen Haugwitz kennen? rief der Prinz. Was man tun wird, weiß nur er allein. Aber das ist gewiß, wenn dieser Bonaparte einmal Lust bekommt, ein Gericht Prinzen-Ohren zu essen, so sind diese hier – er faßte mit der Hand nach seinem Haupte – nicht sicherer als das Leben Enghiens!
Acht Stunden nach dieser Unterredung der beiden Geschwister kehrte Graf Haugwitz, von der langen Konferenz des Tages ermüdet, in sein Hotel nach Berlin zurück. In einen seidenen Schlafrock von persischen Stoffen gewickelt, das Halstuch losgeknüpft, das Jabot geöffnet und die Füße in wärmende Schuhe gehüllt, lag er, ein Portrait betrachtend, das er in Händen hielt, auf einer Bergère, die man an den Arbeitstisch gerollt hatte, während ein Rat seines Ministeriums, der vielgewandte Lombard, Briefe öffnete und Vorträge hielt.
Der Graf schien ihnen geringe Aufmerksamkeit zu schenken, und Lombard sah öfters von seinen Papieren beobachtend nach seinem Chef hinüber, der das Bild in seinen Händen mit dem lächelnden Ausdrucke höchster Zufriedenheit anblickte und es bald nach der einen, bald nach der anderen Seite wendete, um die richtige Lichtwirkung herauszufinden. Noch hatte er auf keinen der Vorträge anders als mit einem Kopfnicken oder einer Handbewegung geantwortet, welche der Rat jedoch durch lange Gewohnheit zu deuten wissen mußte.
Ein Brief von Hofrat von Gentz, fuhr er fort, nicht offizielle Depesche, sondern Privatkorrespondenz. Er meldet, daß die Wahl Bonapartes zum Kaiser unzweifelhaft sei, daß man sie an jedem Tage erwarten könne, obschon Bonaparte noch den Widerstrebenden spiele.
Shakespeares edler Cäsar – unterbrach ihn Haugwitz, und dreimal überreicht, wies er die Krone dreimal fort – wir kennen diese Komödien! – aber weiter! was meldet Gentz?
Daß man in Wien Bonapartes Erhebung zum Throne als eine Kriegserklärung gegen alle legitimen Fürstenhäuser betrachte, daß man sie nicht anerkennen wolle und sie –
Sehr ungern sehe! nicht wahr, Lombard? Und doch ist sie das einzige Mittel, uns Ruhe und Frieden zu verschaffen. Sie haben alle keine Menschenkenntnis, keinen psychologischen Blick. Bonaparte hat ein Ziel im Auge, das er erreichen will und wird, dies Ziel ist die Kaiserkrone. Hat er sie erreicht, so wird das Streben aufhören, die Befriedigung, die Lust zu genießen, treten an ihre Stelle, und der Sieger gesteht zu, was man von dem Besiegten nie erlangt haben würde. Daß man in Wien es ungern sieht, das glaube ich, auch hier wird man sich dagegen sträuben. Aber das Auge des Staatsmannes, des Menschenkenners, erblickt eine heilsame Notwendigkeit und folgt ihr, wo Kurzsichtige ein Unglück, ein Verbrechen zu sehen glauben.
Er zog aus der Tasche seines Schlafrockes eine kostbare Tabaksdose, schnupfte stark, schüttete dabei einen Teil des Tabaks über das Miniaturbild, das er in Händen hielt, und sagte, es abstäubend und es freundlich anblickend: oh pardon! chère! als ob er ein lebendes Wesen vor sich hätte.
Dann stand er auf, band den Schlafrock fest um seine Taille, setzte das Bild auf den Tisch, die Wachskerzen davor und fragte, sich zu Lombard wendend: Vortrefflich! nicht wahr?
Meisterhaft, Exzellenz! obschon nach einem der Kunst so unerreichbaren Originale! antwortete dieser.
Währenddessen hatte der Graf angefangen, im Zimmer auf und nieder zu gehen. Plötzlich blieb er stehen: Was haben denn seine Hoheit Prinz Louis und die Fürstin Radziwill heute den ganzen Morgen in Charlottenburg getrieben, Lombard? fragte er. So oft ich das Zimmer der Königin betrat, fand ich einen von ihnen in dem Gemache.
Prinz Louis, Exzellenz, scheint sehr ergriffen zu sein von dem Vorgange in Vincennes; es hat lebhafte Erörterungen zwischen ihm und der Frau Fürstin Hoheit gegeben.
Welcher Art?
Man hörte, daß die Frau Prinzessin ihn zu Taten aufforderte, des Namens Hohenzoller würdig, daß sie ihn beschwor, den Mord des Prinzen von Enghien, die Ehre der legitimen Fürsten zu rächen, welche von Bonaparte in den Staub getreten werde. Sie versicherte, daß man bei einer Schilderhebung auf den Beistand ihres Mannes, auf den Beistand aller Polen rechnen könne.
Und der Prinz? –
Exzellenz kennen ihn und haben ihn immer richtig beurteilt, entgegnete Lombard, der Prinz ersehnt den Krieg!
Exzellenz, mein Sekretär, der mich nach Charlottenburg begleitete und den Exzellenz schon sonst als verläßlich erfunden, ist zufällig Zeuge jener Unterredung geworden.
Der Graf schwieg eine Weile. Fertigen Sie den Bescheid nach Wien aus, sagen Sie, wir würden die gefürchteten Entschlüsse abwarten, unsere Nachrichten lauteten anders, befahl er darauf statt aller Antwort. Und während Lombard sich zur Vollziehung dieses Auftrages anschickte, setzte Graf Haugwitz, mit sich selbst sprechend, wie es seine Gewohnheit war, das Umherwandern fort. Lombard folgte ihm mit Auge und Ohr, trotz seiner Beschäftigung, vermochte aber nur einzelne Worte dieses Selbstgespräches zu erhaschen, das ihm bedeutend zu sein schien.
Er muß fort, dieser Abgott der Weiber! murmelte der Minister. Krieg! um ihn mit Lorbeeren zu krönen! um sie alle vollends zu bezaubern! Krieg! um die Nichtkrieger zu verspotten, um Sieger zu sein im Kabinett wie im Boudoir! Auch die Prinzessin, die Königin fordern Krieg! Das ist Zunder, Stahl und Stein. Man muß sie trennen, daß es nicht zum Brande aufschlägt! –
Lombard schrieb, und der Graf wanderte umher. Endlich blieb er stehen und sagte, die kleinen, schwarzen Augen fest und stechend auf Lombard gerichtet: Wie stehen denn die Herzensangelegenheiten dieser Hoheit? Ist er mit Madame Wiesel wieder ausgesöhnt? ist man wieder beisammen?
Nicht daß ich wüßte, Exzellenz! der Prinz soll diesen Bruch sehr schwer empfinden.
Die Unterhaltung war hiermit zu Ende. Der Graf öffnete ein Portefeuille, das man ihm brachte, las den Inhalt der Depesche, unterschrieb die Aktenstücke und Verordnungen, welche Lombard ihm vorlegte, und stand bereits in der Türe, um das Arbeitskabinett zu verlassen, nachdem er den Rat verabschiedet hatte, als er denselben nochmals zurückrief.
Sie haben mir von einem Darlehen gesprochen, Lombard, das Herr Wiesel für die Fabrikanten Wegmann forderte. Ist es ihm bewilligt?
Nein, Exzellenz, man wartet auf Ihre Resolution.
Wie hoch belief sich die Summe? ich erinnere mich nicht mehr.
Vierzigtausend Taler auf fünf Jahre.
Legen Sie mir die Sache vor, und Herr Wiesel solle sich morgen in der Frühe bei mir einfinden.
Mit diesen Worten verließ er das Gemach; auch Lombard entfernte sich, jedoch erst, nachdem er vorsichtig die angelangten Briefpakete und einige Billete an den Grafen durchgemustert und gelesen hatte.
Die Ermordung des Prinzen von Enghien, welche in Europa so heftige Aufregung zuwege brachte, hatte in Frankreich nur dazu gedient, einen neuen Beweis für die Gewalt Bonapartes zu liefern und die royalistische Partei zum Schweigen zu bringen, deren Tätigkeit und Kräfte in jenem Zeitpunkte ohnehin fast erschöpft waren. Anders verhielt es sich mit der großen Anzahl wirklicher Republikaner, welche grollend und drohend die Alleinherrschaft des Kaisers betrachteten. Ihre Aufmerksamkeit von seinen Handlungen abzulenken bedurfte Bonaparte des Krieges als des friedlichsten Mittels zur Ausweisung der Tatendurstigen, zur Dezimierung der unruhigen Jugend.
Ueberall erwartete man einen neuen Feldzug, niemand wagte die Heimat zu verlassen, und auch Rahel begnügte sich um so bereitwilliger, für den Sommer ihren Aufenthalt in Charlottenburg zu nehmen.
In der Mitte des April bezog sie eine Wohnung am obern Ende der Schloßstraße. Hier besuchte der Prinz sie häufig, um Trost und Erhebung bei Rahel zu suchen, die es um seinetwillen ganz zu vergessen schien, wie hoffnungslos ihr eigenes Leben sei.
Pauline und Wiesel hatten Berlin verlassen, ohne den Prinzen davon vorher zu benachrichtigen, und diese ganz unerwartete Vereinigung der Gatten mußte ihn um so tiefer verletzen, da er seit Monaten auf Paulinens Scheidung von Wiesel gedrungen, welche sie selbst als eine Notwendigkeit anerkannt hatte.
Weder Wiesel noch Pauline schrieben ihren Freunden in Berlin, niemand kannte ihren Aufenthalt, niemand den Zweck ihrer Reise. Diejenigen, welche besser von Wiesel dachten, und ihm einen Rest von Liebe für Pauline zutrauten, nahmen an, daß er sie entfernt habe, um sie nicht dem Prinzen zu überlassen. Andere, die ihn und seine Ansichten kannten, lachten über jene Voraussetzung. Vergebens hatte der Prinz in Vetter gedrungen, ihm Auskunft über Pauline zu geben; auch Vetter wußte nichts, als daß Wiesel, wenig Tage, nachdem die Ermordung des Prinzen von Enghien bekannt geworden war, den beiden Wegmanns mitgeteilt hätte, er würde mit seiner Frau den Sommer außerhalb Berlins zubringen, und könne dies um so leichter, da das Staatsdarlehn für die Fabrik bereits bewilligt, die königliche Kasse zur Auszahlung an die Wegmannsche Ordre angewiesen sei. Wegmann behauptete, daß man von einem Aufenthalte in Schlesien gesprochen habe, ohne doch näheres zu wissen.
Vetter, dessen Teilnahme an Pauline nie erloschen war, hatte darauf bei allen Bekannten Wiesels in Schlesien Anfragen gemacht, um zu ermitteln, bei wem sie sich befände, aber es stellte sich bald heraus, daß Wiesel gar nicht nach Schlesien gegangen, und auf der Polizei in Berlin überhaupt kein Paß für ihn ausgefertigt worden sei.
In der quälendsten Sorge um Pauline, in der Ungewißheit über die nächste Wendung der politischen Verhältnisse, vergingen dem Prinzen die Tage des April, und die verschiedenen Hofstaaten, welche bis dahin noch in Berlin geblieben waren, schickten sich an, die Hauptstadt mit den Lustschlössern zu vertauschen, als die Prinzessin Radziwill noch einmal einen kleinen Abendzirkel in ihrem Palaste versammelte.
Außer dem Prinzen Wilhelm mit seiner Gemahlin, den Prinzen Louis und August, und den Brüdern des Fürsten Radziwill, nebst den vertrautesten Personen dieser fürstlichen Herrschaften, zum Teil dem Regiments Garde du Corps angehörend, waren nur Graf Tilly und Frau von Stael geladen. Man hatte Musik gemacht, eine neue Komposition des Fürsten Anton Radziwill ausgeführt, und dann Frau von Stael vermocht, einzelne Stellen aus Voltaire und Racine vorzutragen, denen ihr prächtiges Organ und der Schwung ihrer dichterischen Seele neues, bezauberndes Leben verlieh. Sie hatte eben geendet, als Prinz Louis den Saal betrat. Er beklagte, daß er den Genuß, sie zu hören, versäumt habe.
Sie werden bald Ersatz finden, Hoheit, entgegnete sie, denn man bereitet sich zur Aufführung von Sprüchworten, von Fabeln, und Graf Tilly hat versprochen, die Fabeln zu deklamieren, welche man erraten haben wird.
Es währte auch nicht lange, bis die erste Darstellung begann. Scenen mit und ohne Rede wurden rasch vorgeführt, und leicht erraten. Graf Tilly trug ein paar Lafontainesche Fabeln vor, und man war in der heitersten Laune, als die geschlossenen Türen des Nebenzimmers, in dem man gespielt hatte, sich abermals öffneten. Auf einem hohen Throne erblickte man einen der größten Männer der Gesellschaft. Er trug eine Teufelsmaske, eine Krone auf dem Haupte, und einen Purpurmantel auf den Schultern, der bis zur Erde herniederfloß. Plötzlich trat eine kleine Zwerggestalt, ein Napoleon Bonaparte neben ihm hervor, von Pappe und Seidenstoffen ausstaffiert, dem nichts fehlte, was ihn kenntlich machen konnte, weder der dreieckige Hut, noch die Reiterstiefel oder die grüne Uniform. Langsam und pathetisch schritt er bis an die Stufen des Thrones, schüttelte das Haupt, trampelte vor Zorn, bewegte verzweiflungsvoll die Arme, und versuchte dabei den Kopf in die Höhe zu heben, um zu dem Könige emporzureichen; aber umsonst, der Kleine war gar zu klein. Indes, er ließ sich nicht abschrecken, schien Mut gefaßt zu haben, reckte sich, und fing zu wachsen an. Immer emporblickend, und wenn er ein Stück größer geworden war, an den König hinauflangend, der dann jedesmal spöttisch das Haupt schüttelte, wuchs und wuchs er mit sichtlicher Anstrengung weit und weiter fort. Der Kopf, der Leib, die Beine entfalteten sich; immer angstvoller und eifriger blickte er nach oben, immer höhnischer schüttelte der König das Haupt. Endlich, als der werdende Riese fast die Größe seines Gegenübers erreicht hatte, machte er eine letzte Anstrengung, schoß noch ein paar Zoll in die Höhe, und streckte mit heftiger Gier die Arme nach des Königs Krone aus; aber in dem Augenblick erscholl ein Knall, die Gestalt Bonapartes platzte in der Mitte auseinander, und eine ganze Schaar kleiner, bunt gemalter Teufel, die Habsucht, den Ehrgeiz, den Mord und alle Laster darstellend, wurden aus der großen Umhüllung an Stricken in die Luft gezogen, während der Offizier, der in der Bonaparte-Maske gespielt hatte, unter dem hellen Lachen und Beifallklatschen aller Zuschauer aus dem Gerüste trat, und der Teufel, der ihn versucht hatte, vom Throne herabstieg.
La grenouille qui veut se faire grand comme le boeuf! erscholl es von allen Seiten und zugleich die Bitte, Graf Tilly, der ein Meister in dieser Art der Deklamation war, möge auch noch die Lafontainische Fabel vortragen, welche jene Ueberschrift führte. Er tat es mit all der anmutigen Laune, mit der geistreichen Mimik, welche er dabei zu entwickeln wußte, und die Heiterkeit der Gesellschaft stieg von Minute zu Minute. Unzählige Anekdoten auf Kosten Bonapartes wurden mitgeteilt, man überbot sich in Spott und Witzen gegen den hochmütigen, tolldreisten Emporkömmling. Nur Frau von Stael saß etwas abgesondert von den Uebrigen in einer Unterhaltung mit der Prinzessin Marianne, welche, ihrer ernsteren Natur nach, an dieser spottenden Fröhlichkeit nicht Anteil zu nehmen vermochte.
Plötzlich sagte diese: Und das ist Wahrheit, Frau von Stael? keine Dichtung? es wäre ein so wunderbares Zusammentreffen!
Man hatte den Ausruf gehört, fragte, wovon die Rede sei, und bat Frau von Stael um eine Wiederholung ihrer Erzählung.
Es ist keine Erzählung, antwortete sie, nur eine ganz einfache Tatsache. Als Bonaparte, zum Tode erschöpft, eines Tages in der Wüste unter dem Schatten einer Pyramide rastete und in Schlummer versank, weckte ihn, den kaum Entschlafenen, ein Schlag, der seine Hand berührte. Er schreckt empor, eine antike Münze, welche nur von der Höhe der Pyramide herabgefallen sein konnte, liegt in seiner Rechten, und hell und deutlich strahlen ihm die Worte Cäsar Augustus entgegen.
Die Prinzessin Marianne erbleichte, ein leichter Schauder flog durch ihre Glieder, man sah es, daß sie tief ergriffen war, während Graf Tilly es ein Taschenspielerstückchen, eine Erfindung Bonapartes nannte, und Fürst Radziwill behauptete, wenn Bonaparte es erfunden habe, verrate er dichterischen Takt und Kenntnis dessen, was auf die Massen wirke.
Getrennt von den Sprechenden, stand während dessen in einer Fensternische Graf von Brankow, ein Offizier des Regiments Garde du Corps, in eifrigem Gespräche mit dem Prinzen Louis.
Vergeben Sie mir, gnädigster Herr, sagte er, wenn ich behaupte, es gäbe keinen andern Weg der Rettung.
Als Rebellion? nimmermehr Graf Brankow!
Hier ist von keinem Eidbruche, von keiner Untreue die Rede, königliche Hoheit! Weil wir den König lieben, weil die Ehre des Vaterlandes uns heilig, sein Waffenruhm unser höchster Stolz ist, beschwören wir Sie, Sich uns nicht zu entziehen. Ohne Sie ist jener Schritt unmöglich, mit Ihnen wird er leicht. Sind wir Verräter, weil wir einen Elenden aus der Nähe des Königs entfernen wollen, der die Ehre des Vaterlandes verkauft und verschachert? Sind wir Meuterer, wenn wir uns in den Rat des Königs drängen, um uns, dem Könige seine Ehre zu erhalten?
Und was gedenken Sie zu tun, was fordern Sie von mir?
Der Graf hielt inne. Nach einer Weile sagte er: Das Regiment möchte, wenn Sie gnädigster Herr! sich an die Spitze zu stellen geruhten, zum Könige gehen, im Namen aller treuen Söhne Preußens die Entlassung des Grafen Haugwitz und eine Kriegserklärung gegen Bonaparte zu erbitten.
Sie sagen: erbitten, Graf Brankow! Und wenn man diese Deputation nicht vorzulassen, wenn man der Bitte kein Gehör zu geben dächte? Was dann Graf Brankow?
Da der Graf schwieg, fuhr der Prinz fort: Mit Gewalt fordern, Graf Brankow! ist fluchenswerte Tat. Bitten, wo wir des abschlägigen Bescheides sicher, uns eine neue Demütigung, Haugwitz einen neuen Triumph bereiten würden, wäre törichtes Beginnen. Ich, ein Prinz von Preußen, bescheide mich, das Glück des Friedens zu dulden, das dieser Haugwitz auf uns ladet, denn der König will den Frieden; und das Brandmal der Rebellion ist keine Ehrenrettung für das Heer des großen Friedrich. Sagen Sie das den Kameraden, welche Sie an mich gesandt haben. Meine Ueberzeugung, daß sie abstehen müssen von jenem Unterfangen, wenn sie Preußen, wenn sie Kavaliere sind, bürgt Ihnen für mein Schweigen.
Die Nacht verging dem Prinzen schlaflos in heftigster Erregung, in wachen, wilden Träumen. Die Unterredungen mit der Fürstin, mit dem Grafen, wirkten in ihm nach. Er sah sich an der Spitze eines Heeres, die besten Männer des Vaterlandes strömten ihm zu, er zog Bonaparte entgegen, der Geist des großen Friedrich schwebte über seinen Fahnen. Sieg reihte sich an Sieg; Lorbeeren gekrönt kehrte er in die Heimat zurück, als Untertan, als Herrscher. Seine Gedanken schlangen sich wild und wilder durcheinander. Warum sollte ihm, dem Fürstensohne unerreichbar sein, was der Sohn des Advokaten errungen hatte, das Scepter höchster, irdischer Gewalt? Er wollte das Glück, die Ehre seines Vaterlandes! Seine Hand schien sicherer, sein Herz kühner als das seines Königs, war es nicht Pflicht, Ehre und Volk und Land zu retten? Die Königin selbst –
Die brausende Flut seiner Gedanken stand plötzlich stille.
Er hat sein Leben der Königin gelobt, er hatte ihr bei seiner Fürstenehre geschworen, dem Könige nie zu fehlen in der Stunde der Gefahr. Und seine Phantasien beschäftigten sich mit Hochverrat.
Er kämpfte einen ernsten Kampf. Als der Morgen kam, war derselbe beendet, der Prinz war Herr geworden über sich selbst. Mit völliger Ruhe ging er an sein Bureau, und mit sicherer Hand schrieb er die folgenden Worte: Eure Majestät! Der lebhafte Wunsch, die Zustände der deutschen Völkerschaften und ihre Heeresverfassungen kennen zu lernen, welche Kenntnisse vielleicht in kurzer Zeit Ihren Generalen nötig sein dürften, veranlaßt mich zu der Bitte, mir einen Urlaub von vier Monaten für eine Belehrungsreise zu bewilligen. Ich werde diesen Urlaub als erloschen betrachten, sollte das Vaterland früher meiner bedürfen, und meinen höchsten Ruhm darin suchen, diesem Vaterlande und Eurer Majestät zu dienen, mit allen Kräften, welche ich besitze.
Gegen die Gewohnheit seiner mitteilsamen Natur, hatte der Prinz von diesen Vorgängen mit niemand gesprochen, und Rahel war höchlich überrascht, als er an einem der folgenden Abende ihr seinen Reiseplan enthüllte, zu dem der König in einem freundlichen Handschreiben augenblicklich die Bewilligung gegeben hatte.
Der Prinz war sehr ernst. Er setzte Rahel auseinander, wie es ihm notwendig scheine, sich einmal für längere Zeit zu entfernen, um sich zu einem ruhigen Ueberschauen der Verhältnisse zu sammeln, und einen gewaltsamen Bruch zwischen seiner Vergangenheit und seiner Zukunft zu tun. Es sei ihm unmöglich, den Handlungen der Regierung ohne Tadel zuzusehen, ebenso unmöglich eine Aenderung in denselben zu bewirken, und er halte es für seine Pflicht, sich nicht in dieser ohnmächtigen Erbitterung aufzureiben. Der Augenblick der Tat könne nicht mehr fern sein, weil Bonaparte selbst der Friedfertigkeit des Königs ein längeres Ertragen unmöglich machen werde; und sobald dieser Zeitpunkt komme, hoffe er, es dem Könige zu beweisen, wie er es immer verdient habe, als treue Stütze des königlichen Hauses betrachtet zu werden. Ueberdem, fügte er hinzu, glaube er auch für sein Verhältnis zu Henriette diese Entfernung nützlich, ja unerläßlich notwendig.
Henriette und ich können die Liebe nicht wieder beleben, sagte er, die in uns beiden längst erlosch, aber wir sind es unsern Kindern schuldig, in ruhigem Verständnis aneinander zu halten. Dies zwischen uns allmählich festzustellen, wird die Trennung uns erleichtern. Dussek hat sich bereit erklärt, eine neue Kunstreise zu beginnen. Wir alle haben Ruhe nötig, sollen wir nicht untergehen, und einer besseren Zukunft fähig bleiben, auf die ich zuversichtlich hoffe.
Rahel, so schwer die Furcht vor der nahen Trennung sie beängstigte, stimmte dem Prinzen aus voller Ueberzeugung bei. Man sprach von dem Wege, welchen der Prinz einschlagen, von den Orten, welche er besuchen solle, von den Verbindungen, die er anzuknüpfen habe, um persönlichen Genuß und Belehrungen mit Vorteilen für die Partei in Preußen zu verbinden, die eine Erhebung gegen Bonaparte im Schilde führte.
Nur Eines, sagte der Prinz, macht mir dies Scheiden schwer – die Ungewißheit über Paulinens Schicksal. Sie hat mir weher getan, als je ein Weib. Ich fühle, daß ich mich in ihr betrogen habe, und doch Rahel, liebe ich sie, nicht nur trotz ihrer Mängel, nein! selbst um dieser Mängel willen. Können Sie das begreifen, liebe Rahel?
Glauben Sie, daß ich nicht Gerechtigkeit von Liebe zu unterscheiden wisse? Die Eigenschaften eines Feindes schätzen, seine Mängel mild beurteilen, das ist Gerechtigkeit. Aber Liebe, was hat die mit Prüfung, mit Gerechtigkeit gemein? Liebe umschließt das Wesen eines Menschen, wie es vor uns hintritt, mit Mängeln und Eigenschaften, mit Tugenden und Lastern, mit Schönheiten und Gebrechen, denn sie ist eben die Liebe, das heißt ein göttliches Erfassen, ein göttliches Ergänzen, und darum sicher höher, als jeder Maßstab des prüfenden Verstandes. O! ich begreife gewiß, wie man die Fehler eines Menschen liebend in sein Herz schließt! antwortete sie schmerzlich lächelnd.
Nun, so versprechen Sie mir, daß Sie, wenn Pauline zurückkehrt, ihr sagen wollen – Gott des Himmels! rief er, plötzlich aufstehend, verwirren sich meine Sinne, das ist Paulinens Stimme! –
Er und Rahel eilten der Türe zu, aber noch ehe sie dieselbe erreicht hatten, ward sie geöffnet, und bleich, atemlos vor heftiger Erregung, sank Pauline mit dem Ausdruck: Endlich! Endlich! fast ohnmächtig in seine Arme.
Des Prinzen Erschütterung, seine Freude kannten keine Grenze. Er bedeckte ihr bleiches Gesicht, ihre Hände und Füße mit seinen Küssen, er schalt sie, daß sie ihm Schmerz bereitet, und beteuerte ihr, daß sie das höchste, das einzige Glück seines Lebens sei. Bald verlangte er Erklärung über ihr rätselhaftes Verschwinden, über ihre plötzliche Rückkehr, bald bat er sie, vor ihr kniend, nicht zu sprechen, sondern zu ruhen, er wolle nichts wissen, er bedürfe keiner Erklärung, denn sie sei ja bei ihm.
Ich sehe Dich wieder! rief er immer und immer, das ist genug! O! Du weißt nicht, Du kannst es nicht wissen, was es heißt, wieder sehen, die himmlischen Züge des Wesens endlich wieder zu sehen, das man liebt. Denn man muß gerade Dich lieben, um es zu begreifen.
Schweigend den Kopf des vor ihr knienden Prinzen in ihren Händen haltend, und mit tiefer Zärtlichkeit ihn betrachtend, saß Pauline da. Es schien, als müsse sie sich erst der Gegenwart bewußt werden, als vermöge sie noch nicht ihr Glück zu fassen. Rahel hatte sich mit tränenschwerem Blick entfernt.
Endlich, als der erste leidenschaftliche Rausch des Entzückens sich besänftigt hatte, vermochte Pauline über ihre plötzliche Entfernung, über ihre unverhoffte Rückkehr die Aufschlüsse zu geben, die der Prinz ersehnte.
Ach! sagte sie, ich weiß erst jetzt, wie man mich von Dir entfernt hat, ich weiß es kaum, wie ich zu Dir gekommen bin. Sie hatten mir die Sinne verwirrt mit jenem Brief der Toten, Eifersucht zerriß mir das Herz. Man ist so mißtrauisch, wenn man sich selbst nicht mehr vertraut. Ich glaubte an Verrat, hatte ich ihn doch an mancher Liebe selbst begangen, und ich wollte lieber leiden, als verraten von Dir sein. Da kam Wiesel, der mein Elend sah, und sprach: Laß uns fortgehen von hier. Der Prinz soll durch mich erfahren, wohin wir reisen, und liebt er Dich, so wird er Dir folgen. Dir Gewißheit über seine Liebe zu schaffen, ist alles, was ich für Dich tun kann.
Aber ich habe keine Nachricht erhalten, unterbrach sie der Prinz, ich –
Das, das war ja eben der höllische Betrug. Weder die Nachricht, noch einen der Briefe hat er Dir gesendet, die ich Dir in der Verzweiflung meines Herzens geschrieben. Wir lebten in Franken bei einer Verwandten Wiesels auf dem Lande. Da kommt vor vier Tagen in Wiesels Abwesenheit ein Bote, er bringt einen Brief, ich sehe das Postzeichen Berlin, erbreche das Kuvert, und lese die Worte, von fremder Hand geschrieben: Werter Herr! Der Augenblick ist gekommen, in dem man es für wünschenswert erachtet, dem Prinzen Mitteilungen über Ihren Aufenthalt zukommen zu lassen, haben Sie die Güte ihn jetzt augenblicklich von demselben zu benachrichtigen, und zwar in einer Weise, die ihn auffordert, Ihnen zu folgen, wenn Sie den verabredeten Reiseplan bereits festgesetzt haben werden. Der Brief hatte keine Unterschrift, das Petschaft keine Chiffre. Ich verstand den Zusammenhang nicht gleich, aber ich sah, daß wir betrogen waren. Ich hatte keine Wahl. Der alte Gutspächter, der oft von mir zur nächsten Stadt geschickt worden war, um nach Briefen von Dir zu fragen, gab mir Geld, weil er meine Verzweiflung sah. Er selbst begleitete mich zur Stadt, schaffte mir einen Wagen, und ich bin bei Dir! rief sie, ihn mit ihren Armen umschlingend.
Alle Fragen des Prinzen, der den leitenden Faden dieses Lügengewebes zu finden wünschte, blieben unbeantwortet, denn Paulinens leichtlebige Natur machte sie blind für alles, was um sie her geschah, wenn sie nicht ein vorherrschendes Interesse zum Beobachten trieb. Endlich besann sie sich, das Geld, welches sie geborgt, in jenen Brief gewickelt zu haben, welcher ihre Reise veranlaßt hatte. Der Prinz nahm das Blatt, es trug die Handschrift des Grafen Haugwitz selbst, und somit blieb ihm kein Zweifel, daß man Pauline fortgelockt habe, um die Sehnsucht des Prinzen zu steigern, und ihn dann um so sicherer von Berlin zu entfernen. Jenes Darlehen für die Fabrik, in der Wiesel beteiligt war, hatte den Kaufpreis des Dienstes gemacht, dessen Haugwitz bedurfte.
Des Prinzen Empörung, sein gerechter Zorn flammten auf, um unterzugehen in der Freude, Pauline wieder zu sehen, und sie schuldlos zu wissen. Stunden flogen den Liebenden wie Minuten dahin, Vergangenheit und Zukunft entschwanden ihrem Auge in dem Glück der Gegenwart, als Rahels Frage, welchen Tag der Prinz zu seiner Abreise bestimmt habe, sie aus ihrer Freude aufschreckte.
Wie ein drohendes Gespenst tauchte jetzt plötzlich die Vorstellung dieser Reise vor dem Prinzen, vor Pauline empor. Sie zu verlassen, sie aufs Neue den Schlingen ihres Mannes, den Einflüsterungen seines Uebelwollens auszusetzen, schien ihm eben so unmöglich, als es unstatthaft war, sie mit sich zu nehmen. Er wollte bleiben aus Liebe für Pauline; er mußte bleiben, sagte er sich, um Haugwitz nicht durch seine Entfernung gewonnenes Spiel zu geben. Jene Reise, die er aus der Notwendigkeit erwählt, sich den, von allen Seiten auf ihn eindringenden Versuchungen zu entziehen, und den unzufriedenen Regimentern den Mittelpunkt zu rauben, welchen sie sich zur Vereinigung ersehen hatten, jene Reise schien ihm jetzt eine schimpfliche Flucht, seit er wußte, daß Graf Haugwitz sie wünsche. Aber durfte er bleiben? durfte er gewiß sein, daß nie ein Aufruf zur Empörung gegen die Absichten des Königs einen zustimmenden Widerhall in seinem Herzen finden würde? Und was sollte er dem Könige sagen? wie diese plötzliche Sinnesänderung erklären?
Bald zu dem einen, bald zu dem andern Schritte entschlossen, von Rahel, welche die eigentlichen Gründe der Reise nicht kannte, um seines Schwankens willen ernst getadelt, litt der Prinz noch zehnfach durch Paulinens Klagen und Tränen. Sich wolle er retten vor Versuchung, weil er seiner Willensstärke nicht vertraue, und Pauline, das leichtbewegliche, auf des Geliebten Beistand angewiesene Weib, solle allein zurückbleiben in den schwierigsten Verhältnissen, dem schlausten, eigennützigsten Manne gegenüber!
O! rief er, es ist mein altes Schicksal! Alles verschwört sich gegen mich, jeder Schritt zur Befreiung wird mir unmöglich, und das ersehnteste Glück wird mir zu neuer schwerer Qual! Rahel, geben Sie mir noch einmal die stützende Freundeshand, und helfen Sie mir aus diesem Labyrinthe, denn Sie allein vermögen es!
Was soll ich tun? was verlangen Sie?
Ich werde reisen, weil ich reisen muß. Aber soll ich nicht Folterqualen der Sorge erdulden in der Ferne, so versprechen Sie mir, über Pauline zu wachen, bat er dringend. Ich vertraue sie Ihnen, denn – Sie verstehen es, daß man die Fehler der Geliebten liebt.
Sich gleich nach diesem Wiedersehen der Geliebten von Pauline zu trennen, schien dem Prinzen unmöglich, und er hatte bald Scheingründe aufgefunden, seine Abreise für einige Zeit hinauszuschieben. Da sowohl der Prinz als Pauline entschieden gegen ihre Rückkehr in das Haus der Mutter eingenommen, und in Charlottenburg keine Wohnungen frei waren, hatte man für Pauline ein Häuschen in dem nahegelegenen Moabit gemietet, dessen Garten die Spree bespülte, und das traulich und freundlich aus dem Grün alter Kastanienbäume hervorsah.
Unbekümmert um irgend einen Lebensbedarf, hatte Pauline weder bei ihrer Flucht von Wiesel, noch bei ihrer Uebersiedelung nach Moabit, die geringste Sorge für die notwendigsten Dinge getragen. Daß man Kleider, daß man Möbel haben müsse, schien sie vergessen zu haben. So lange sie bei Rahel wohnte, nahm sie von deren Sachen, was ihr brauchbar däuchte, und nahm sie ohne Frage, ohne Dank, weil aller Besitz ihr selbst ganz wertlos war. Als sie Charlottenburg verließ, mußte Rahel den Prinzen aufmerksam darauf machen, daß Pauline einer vollständigen Ausstattung bedürfe, da sie es nicht wagte, die Herausgabe ihrer Sachen, welche sich teils in Wiesels, teils in Frau von Cäsars Händen befanden, zu fordern, aus Furcht vor Mißhelligkeiten, welche sie in ihrem Glücke stören könnten.
Den Prinzen entzückte diese Sorglosigkeit. Es machte ihn glücklich, Pauline ganz von sich abhängig zu wissen, und mit der verschwenderischen Großmut der Liebe ward ein Hausstand für Pauline hergerichtet, der ihrer Schönheit und ihrer Lust am Schönen gleich entsprechend, unter dem bescheidenen Dache eines Bauernhäuschens ein kleines Feenschloß hervorzauberte.
In dem Genusse dieses Landlebens wurden den Liebenden glückliche Tage zuteil. Jeden Augenblick, welchen der Prinz seinen Verhältnissen zum Hofe abmüßigen konnte, verlebte er mit Pauline, und hielten ihn Pflichten der Etikette in Charlottenburg zurück, so wußte sie ihm, bald als Landmädchen, bald als Knabe verkleidet, in den Gängen und Boskets des Schloßgartens zu begegnen und ihm die Freude des unerwarteten Wiedersehens zu bereiten.
Aber dieses Idyll sollte nur von kurzer Dauer sein. Wiesel war zurückgekehrt, und sowohl Henriette, als Graf Haugwitz von Paulinens Anwesenheit benachrichtigt.
Ruhig, als könne es nicht anders sein, trat eines Tages Henriette mit den Kindern in die Wohnung Paulinens, als der Prinz in ihrer Gesellschaft das Mittagsmahl verzehrte. Der Knabe sprang jubelnd an ihm empor, das kleine Mädchen breitete ihm seine Händchen entgegen, und Henriette sagte: die Kinder verlangten so lebhaft nach Dir, da zog ich es vor, Dich lieber hier, als garnicht zu sehen, und ich soll es ja auch lernen, Deine Freundin zu werden.
Hätte sie die härtesten Vorwürfe, die bittersten Klagen gegen ihn ausgesprochen, sie würden den Prinzen nicht so hart getroffen haben, als diese Entsagung, deren schwere Kämpfe sich in Henriettens verfallenen Zügen verrieten.
Der Prinz umarmte sie, umarmte seine Kinder, aber er sowohl als Pauline waren fassungslos. Es wollte sich kein Weg der Vermittlung, keine Anknüpfung des gleichgültigsten Gesprächs finden. Selbst die Kinder schienen, von der drückenden Schwüle erfaßt, ihr harmloses Plaudern vergessen zu haben. Endlich fragte Pauline, ob Dussek schon abgereist sei?
Er sollte den Prinzen in Dresden erwarten, antwortete Henriette sehr einfach, aber da er mir nicht schreibt, weiß ich nicht, ob er Gegenbefehl erhalten hat.
Der Prinz blickte Pauline zornig an, und doch war diese Frage nur Folge ihres Leichtsinns, ihrer peinlichen Verwirrung, nicht böser Wille gewesen. Aber er liebte Henriette in diesem Augenblicke mehr als seit Jahren, da sie ihm zum ersten Male wieder in der Schönheit wahrer Weiblichkeit erschien. Mißgestimmt gegen Pauline, wendete er sich mit achtender Zärtlichkeit Henrietten, mit Liebe den Kindern zu, und litt dennoch nicht allein für sich, sondern auch für Pauline. Ein solches Beisammensein konnte nicht dauern.
In Begleitung Henriettens und der Kinder verließ der Prinz das Landhaus, Pauline blieb in Tränen zurück. Aber trotz seines achtenden Gefühls für Henriette kam, sobald er sich ihr allein gegenüber befand, eine Erbitterung gegen sie, ein Mitleid gegen Pauline in dem Herzen des Prinzen auf. Niemals hatte er mehr das Unaushaltbare dieser geteilten Existenz empfunden, als in diesem Augenblicke, niemals weniger die Möglichkeit begriffen, Henriette, die er nicht mehr liebte, zu verstoßen, oder Pauline aufzugeben.
Vollkommen zerstört in seinem Innern kehrte er in seine Gemächer zurück. Ein Brief lag auf seinem Schreibtische. Von der Handschrift des Königs und mit dem Privatsiegel desselben geschlossen, lautete er:
Ew. Hoheit haben von Mir den Urlaub zu einer Reise verlangt, den Ich augenblicklich bewilligte, ohne daß Sie bis jetzt von jener Erlaubnis scheinen Gebrauch machen zu wollen. Es sind Mir in der Frühe Nachrichten zugegangen, die, von den schlechten Gesinnungen einzelner Regimenter sprechend, den Namen Ew. Hoheit in jene Gerüchte zu mischen wagen. Ich verachte Denunziationen, und lege auch auf diese Mir gemachte Mitteilung kein Gewicht. Dennoch rate Ich, daß Ew. Hoheit den Reiseurlaub benutzen, um die Ehre eines Hohenzollern auch vor dem Verdachte eines strafbaren Unternehmens zu bewahren, wünsche aber, daß Sie noch einige Tage am Hofe verweilen, damit jene Personen, von welchen die Warnung ausging, nicht der Meinung werden, ihre Angeberei habe bei Mir Glauben gefunden und Ew. Hoheit Entfernung veranlaßt.
Das kommt von Haugwitz! rief der Prinz in heftigstem Zorne, während er sich niedersetzte, um dem König für seine edle Handlungsweise zu danken, die den Prinzen wie ein Dolchstoß in das Herz traf, und von ihm ein Vertrauen zu begehren, das nicht mehr in dem Könige sein konnte, obschon der Prinz es zu verdienen wußte. Zugleich zeigte er dem Könige an, daß er den fünfundzwanzigsten Mai für seine Abreise bestimmt habe.
Die fünf Tage bis zu diesem festgesetzten Termine vergingen in den peinlichsten Berührungen. Die Stellung Louis Ferdinands am Hofe, an dem er nach des Königs Willen alltäglich zu erscheinen hatte, war sehr drückend, die Begegnungen mit Henriette voll schmerzlicher Wehmut, das frohe beglückende Verhältnis zu Pauline getrübt. Und um die Last dieser Zustände noch drückender zu machen, war die Großherzogin von Schwerin in Charlottenburg angekommen, der zu Ehren man Bälle und Feste im Freien veranstaltete, bei denen der Prinz nicht fehlen durfte.
So war der vierundzwanzigste Mai herangekommen. Der Prinz hatte am Morgen Henrietten Lebewohl gesagt, und sie waren voneinander mit gramzerrissenen Herzen und doch voll Liebe und Vergebung geschieden, wie Menschen, die nicht miteinander leben und nicht voneinander lassen können. Erschöpft und der inneren Sammlung bedürftig, hatte er gehofft, am Abende Pauline noch in Ruhe zu sehen, und die letzten Stunden vor dem Scheiden mit ihr verleben zu können, als man ein neues Fest in Vorschlag brachte, bei dem man Bauernquadrillen und kleine Aufzüge beabsichtigte, und den Beistand des Prinzen in Anspruch nahm.
Aber mitten in den Zurüstungen für diese Spiele langte eine Nachricht in Charlottenburg an, welche, obschon seit Wochen gefürchtet, einen tiefen nachhaltigen Eindruck auf die königlichen Wirte und ihre fürstlichen Gäste machen mußte.
Bonaparte war am achtzehnten Mai zum Kaiser erwählt und am zwanzigsten unter dem Namen Napoleon der Erste als solcher ausgerufen worden. Le petit caporal, auf den man von den Thronen mit so legitimem Stolze herabgesehen, der freche Korse, den man in den Sälen der Prinzessin noch vor wenig Tagen als einen Gegenstand des Spottes dargestellt hatte, saß in dieser Stunde als Kaiser auf einem Throne, den ihm das ruhmreichste Volk Europas selbst bereitet hatte, und verkündigte den Sieg des eingeborenen Genius über die angeerbte Macht.
Während man im Schlosse diese Botschaft erhielt und dieselbe klopfenden Herzens in den Schäferanzügen besprach, hingen bereits tausende von bunten Lampen in dem jungen Grün der Bäume, widerstrahlend aus den Teichen und Bassins des Gartens. Zwischen den eleganten Männern und Frauen des Hofes schlüpfte das Dienstpersonal noch eilig umher, hier eine verlöschende Lampe frisch anzuzünden, dort eine Guirlande zu ordnen, welche in der Eile nicht fest genug an die Baumstämme geknüpft worden war.
In dem ganzen Teile des Gartens, der sich vom Schlosse abwärts bis zu den großen Wiesenplätzen jenseits der Brücken erstreckt, herrschte reges Leben und Tageshelle strahlte aus den unteren Sälen des Palastes, deren Fenstertüren nach der Terrasse geöffnet standen, wogegen die nicht erleuchteten Partien des Gartens um so lauschiger erschienen. Im Schutze dieses Halblichtes landete um die neunte Stunde vorsichtig ein Kahn an einer jener Steintreppen, die von der rechten Seite des Gartens zur Spree hinabführen. Nur flimmernd machte sich hier das Licht der Lampen durch die Zweige sichtbar; verscheucht von dem Lärm des Festes sangen die Nachtigallen hier ihre süßen Lieder, und das Mondlicht strahlte sanft auf den Weg hernieder, den Pauline zu ihrem Stelldichein verfolgte.
An der äußersten Grenze des Gartens liegt auf einer in die Wiesengräben hineinragenden Spitze ein Pavillon. Rohrgeflecht überzieht von außen die Wände und Fenster, eine kleine brückenartige Galerie schließt ihn ein. Dort sollte Pauline den Prinzen erwarten.
Unbemerkt schlüpfte sie hinein, und kaum war es geschehen, als der Prinz ihr bereits folgte.
Louis! rief sie ihm entgegen, ich habe eine Bitte an Dich, Du mußt mich mit hinaufnehmen nach dem Schlosse, ich muß das Fest ansehen.
Der Prinz, abgestumpft gegen alle solche Eindrücke, vermochte nicht, Paulinens Ergötzen daran zu verstehen, und fühlte sich unangenehm davon berührt, daß sie in einer Trennungsstunde nach dem Genuß einer leeren Zerstreuung verlangte. Er war nicht fähig, ihr dieses zu verbergen.
Aber sich an ihn schmiegend, wie ein Kind, das schmeichelnd Verzeihung und Gewährung erfleht, sagte sie: Kann ich denn dafür, Louis, daß ich von bürgerlichen Eltern geboren bin? daß mich der Glanz des Hofes und all die Pracht entzücken, die Dir gleichgültig sind, weil Du sie besessen hast von Jugend an? Menschen wie ich, werden das nie gewohnt, nie überdrüssig!
Josephine Beauharnais wird es wohl gewohnt und überdrüssig werden als Kaiserin von Frankreich, meinte der Prinz.
Pauline horchte auf und fragte; sie erfuhr, was vorgegangen war.
O! rief sie, die Glückselige! Wie göttlich muß es sein, aus der Hand des Geliebten eine Kaiserkrone zu empfangen.
Da faßte der Prinz krampfhaft Paulinens Rechte über dem Handgelenk, und sie so fest drückend, daß sie davon erbebte, sprach er: Mußt Du mir sagen, was seit einer Stunde in meinem Herzen wütet, als ein brennender, zerstörender Schmerz?
Pauline blickte ihn erschrocken an. Sie fragte, was er meine, und kniete vor ihm nieder, den Blick seines Auges aufzufangen, da er sich auf eine der Bänke gesetzt, und das abgewendete Antlitz schwermütig sinnend auf die Hand gestützt hatte.
Als sie nun vor ihm lag und die Mondesstrahlen ihr helles Haar umglänzten, nahm er sanft ihr Haupt in seine Hände. Ja! sagte er: dies Haar verlangt eine Krone, und ich habe sie diesem schönen, stolzen Haupte nicht zu bieten! Sieh Pauline! seit Tagen habe ich mir gesagt, Bonaparte wird Kaiser werden und das Diadem drücken auf Josephinens Stirne. Daß er dies vermag, daß er sein Weib hinstellen kann und sagen: weil ich sie liebe, sollt ihr sie alle lieben; die Fürsten der Erde sollen sich vor ihr neigen und ihr sollt niederknien vor ihr, als vor eurer Kaiserin; daß er alle Ehren und Schätze der Welt häufen kann auf ihr geliebtes Haupt, das ist es, was ich ihm neide.
Pauline versuchte ihn zu beruhigen. Sie beteuerte ihm, wie glücklich sie sei, sie überhäufte ihn mit Zärtlichkeit; aber, mitten in den Liebesworten und Versicherungen, welche sie aus vollem Herzen gegen ihn aussprach, zogen vor Paulinens Seele alle Möglichkeiten des Glückes vorüber, die sich der neuen Kaiserin eröffneten, und plötzlich rief sie: Wie stolz muß sie auf Bonaparte sein!
Der Prinz fuhr vor diesen Worten zusammen, und sagte dann: Sei unbesorgt Pauline! Du sollst nicht erröten dürfen über Deine Wahl. Eine Krone habe ich Dir nicht zu geben, aber ein Lorbeerkranz soll Dir einst zu Füßen gelegt werden, und wäre er auch blutgetränkt. Das verspreche ich Dir. Vielleicht steht dann der Tote höher in Deiner Liebe, als der Lebende in dieser Trennungsstunde.
Etwa anderthalb Jahre nach diesen zuletzt erwähnten Ereignissen, durchwandelte eine Frau raschen Schrittes die Alleen des Tiergartens, wie jemand, der achtlos für die Außenwelt mit den eigenen Gedanken beschäftigt ist. Sie trug einen Ueberrock, einen sogenannten Schanzenläufer, von hellgelbem Kaschmir mit doppelten Pellerinen, da der feuchtkalte Oktobertag schon wärmere Bekleidung forderte, einen Hut von weißem Atlas, aus dem ihre dunklen Augen unter schwarzem Haargelock lebhaft hervorblitzten, und Vetter, der in Begleitung eines andern Mannes herankam, erkannte schon von fern Rahel Levin an Kleidung und Gang.
Sie schritt den Männern schnell entgegen und fragte, Vetter mit einem Gruße die Hand gebend und dann sich zu dem andern wendend: Nun, Herr Geheimrat! wie stehen die Sachen? welche Nachrichten haben Sie?
Der Angeredete war Johannes Müller, der Verfasser der Schweizergeschichte, ein kleiner Mann, von beweglichen Gesichtszügen und großer Lebhaftigkeit der Gebärden. Er zuckte bedenklich mit den Schultern. Die Sachen stehen so, Mademoiselle! antwortete er, daß ich wollte, Sie verlangten keine Nachricht!
Aber was ist denn eigentlich geschehen?
Nun, Bernadotte, der noch immer mit seinen Truppen in Anspach und Bayreuth verweilt, hat, als Hardenberg dagegen, wie gegen einen Friedensbruch, protestierte, ausdrückliche Befehle Napoleons vorgelegt. Die Franzosen hausen dort wie in Feindesland, und als man hier dem Gesandten Laforest Vorstellungen machte und Aufklärungen verlangte, leugnete er entschieden die Tatsachen, die Brutalitäten ab, welche dort verübt worden sind, und sprach abbrechend ganz ruhig von Pariser und Berliner Tagesneuigkeiten.
Das ist unerhört! das ist beispiellos! rief Rahel im Tone der Entrüstung.
Unerhört? beispiellos? wiederholte Vetter, liebe Rahel, das sind die Worte, die man in Preußen aus dem Lexikon streichen sollte. Bei uns ist leider seit Jahren keine politische Schande mehr unerhört. Ist es denn nicht schmachvoll, daß Preußen, welches vor vierzig Jahren dem vereinten Oesterreich und Frankreich glorreich die Spitze zu bieten vermochte, welches seitdem Deutschland vorangeleuchtet als eine große, starke Macht, jetzt zu der Rolle einer Exekutiv-Behörde Bonapartes herabgesunken ist?
Ja! fiel ihm Müller in die Rede, ja Herr Assessor! Exekutivgewalt Bonapartes, voilà le mot! Nous ne sommes que cela! Und wie Polizeispione, wie Häscherknechte werden wir im ganzen übrigen Deutschland verachtet und gehaßt.
Es ist, als ob ein Wahnwitz die Regierung erfaßt hätte, meinte Rahel. Können Sie denken, daß ich gestern verschiedene Personen aus den Ministerien gesprochen habe, die mir triumphierend die unglückselige Neuigkeit von der Vernichtung des österreichischen Heeres bei Ulm erzählten? Triumphierend bei einem Ereignis, das Napoleon in kürzester Zeit zum Beherrscher Deutschlands machen muß.
Cela vous étonne! sagte Müller, der von seinem langen Aufenthalte in der französischen Schweiz, die Gewohnheit angenommen hatte, das Deutsche mit französischen Redensarten zu untermischen. Cela vous étonne! Was werden Sie aber sagen, Mademoiselle Levin, wenn ich Sie versichere, daß alle jene Schritte, die man zu einer Annäherung an Rußland und die österreichisch-englisch-russische Triplealliance getan hat, nur scheinbar sind!
Ich sollte es Ihnen glauben, Herr Geheimrat! aber ich vermag es nicht. Denn wozu in diesem Falle das Ausrücken unserer Truppen nach Franken, Hessen, Westfalen? Wozu die Spiegelfechterei der russischen Freundschaft, und die bevorstehende Ankunft des Kaisers Alexander?
Zur Spiegelfechterei, meine Verehrte! zur Spiegelfechterei! Meinen Sie, eine Sumpfpflanze könne Rosen tragen? ein Mensch könne in seinem politischen Leben seinen Privatcharakter verleugnen? Dem widerspricht die Erfahrung der Geschichte. Stellen Sie den geraden, durchweg deutschen Hardenberg an das Ruder der Geschäfte, und Sie werden Handlungen erleben, die in vernünftiger, notwendiger Folge auseinander hervorgehend, das Vernünftige, das Ehrenwerte erstreben und erreichen. Ein Minister, der in seinem Privatleben ein uneigennütziger Ehrenmann ist, wird auch dem Staate eine würdige, eine auf Achtung gegründete Stellung zu verschaffen wissen. Wer aber wie Haugwitz sich von einer Misere in die andere stürzt, von jämmerlichen affaires de coeur in jämmerliche intrigues d'antichambre, und noch jämmerlichere liaisons mit Illuminaten und Mystikern; wer heute sündigt und morgen bereut, um übermorgen wieder zu sündigen, der wird und muß gleiche Unordnung, gleiche Jämmerlichkeit über das Land bringen, dessen Angelegenheiten er leitet. Haugwitz ist es, und sein serviler Intriguengeist, qui flétrit à tout jamais la gloire de la Prusse, und der das Preußen Friedrichs des Großen zu Grabe trägt.
Eine Weile gingen sie schweigend neben einander. Dann sagte Vetter: Haugwitz soll in diesen Tagen der Geldnot fast alle seine Gläubiger, und zwar mit französischem Gelde, bezahlt haben. Indes würde die Tatsache an sich nichts beweisen, denn wir haben seit Jahren so viel französische Truppen in Deutschland, daß französische Münzen ebenso häufig bei uns sind, als die deutschen.
Sie sagen Deutschland! mais c'est une chose qui n'existe plus! mein werter Herr! bemerkte der Geheimrat Müller. Nennen Sie Deutschland jene verschiedenen Länder, deren Fürsten, Oesterreich ausgenommen, nur darin einig sind, daß jeder den eigenen Vorteil sucht, wozu denn freilich das unglückselige Preußen das erste und fortdauernde Beispiel gegeben hat? Das deutsche Oesterreich triumphierte, als es vor wenig Tagen die deutschen Bayern an der Iller geschlagen. Preußen besetzt Hannover, ein deutsches Land, für Frankreich und triumphiert über Oesterreichs Niederlage bei Ulm, wie Mademoiselle sehr richtig bemerkte. Wo sehen Sie da ein Deutschland? Bonaparte kannte die Unfehlbarkeit des Grundsatzes divide et impera! Ein starkes, einiges Deutschland war eine Macht, die ihm trotzen konnte. Fünfzig Fürsten, die einander aufreiben in kleinem Eigennutz, zerstören diese Macht und lassen dem Feinde nur die angenehme Mühe, die Brocken der einstigen deutschen Größe in seine Tasche zu stecken, in der sich das Getrennte dann wieder zu einem Ganzen zusammenfindet.
Bei diesen Worten hatte man das Chausseehaus des Charlottenburger Weges erreicht, und Rahel fragte, als der Geheimrat weiter gehen zu wollen schien, ob er es nicht vorziehe, umzuwenden, da die Sonne schon tief gesunken war und der Abend kühl wurde. Aber Müller lehnte es ab.
Ich bin mit so freudigem Stolze in die Dienste Preußens getreten, sagte er, daß ich den Untergang dieses Reiches nicht ohne den bittersten Kummer anzusehen vermag. Denken Sie, daß ich, berufen hier die Geschichte des großen Friedrich, die Geschichte Preußens zu schreiben, jetzt als Historiograph des Könighauses die schmachvollen Ereignisse der Gegenwart aufzuzeichnen habe. Ich will nach Charlottenburg hinausgehen, den Herzog Karl von Strelitz aufzusuchen, um durch diesen Bruder, den die Königin liebt, immer und immer wieder den Notruf an ihr Ohr dringen zu lassen.
Das heißt das Faß der Danaiden füllen, Herr Geheimrat, meinte Vetter, so lange Haugwitz allein das Ohr und das Vertrauen des Königs besitzt.
Wohl möglich! aber wie die Danaiden, folge ich einem eisernen Müssen, einer inneren Notwendigkeit. Lassen Sie mir den Trost, d'avoir fait mon devoir, d'avoir fait tout ce que je pouvais, um nicht den Untergang der Monarchie des großen Königs schreiben zu müssen.
Mit diesen Worten verließ Johannes Müller die beiden andern, welche den Rückweg antraten. Rahel ging nun an Vetters Arm zurück, und die Unterhaltung wendete sich bald auf den Prinzen Louis Ferdinand. Vetter fragte, ob Rahel nicht wisse, wie man das Gesuch des Prinzen aufgenommen habe, ihm eine der ausrückenden Heeresabteilungen anzuvertrauen?
Man hat es mit dem Vorgeben abgelehnt, daß der Herzog von Braunschweig, der Fürst Hohenlohe und der Kurfürst von Hessen als ältere Generale bereits dazu ernannt worden seien.
Und wie nahm es der Prinz?
Lieber Freund! wie nimmt man Tantalusqualen? – nichts! aber nichts kann er erlangen, nicht Wirksamkeit, nicht Ruhe, ja nicht einmal eine schöne hohe Liebe, die doch bei seiner Natur so leicht erreichbar scheinen müßte.
Aber Pauline?
Liebt er leidenschaftlich, und dennoch ohne eigentliches Glück. Es ist wunderbar: während Wiesel, der ihr nichts als Leid bereitet, sie heute noch so vollkommen beherrscht, daß der Prinz ihre Scheidung von ihm nicht durchzusetzen vermag, welche er schon seit seiner Reise forderte, ist der Prinz noch nicht dahin gelangt, wirkliche Herrschaft über Pauline zu gewinnen.
Früher, sagte sie dann nach einer Pause, habe ich mich oft gefragt, worin es liegt, daß manchem Menschen, daß zum Beispiel dem Prinzen, daß mir aber auch gar nichts gelingt; habe nachhelfen, das Schicksal spielen, ordnen und zurecht legen wollen. Jetzt ergebe ich mich in das Leidenmüssen, denn ich weiß, woher es kommt und daß es nicht anders sein kann.
Und worin besteht diese Einsicht, Rahel?
In der einfachen Erkenntnis, daß der Boden gesund sein muß, auf dem Glück aufgehen soll. Wer aber keinen ausfüllenden, ihm natürlichen Beruf im Leben findet, dem fehlt der gesunde Boden. Und weil ein solcher mir, weil er dem Prinzen fehlt, sind wir Narren des Glückes geblieben, während Henriette, die ihn hat, sich in der Erfüllung ihrer Mutterpflichten zurechtgefunden, und durch diese ihre naturgemäße Entwicklung, auch die warme Neigung des Vaters ihrer Kinder wieder gewonnen hat. Ich bin neulich ganz erstaunt darüber, wie gefaßt und wie ruhig sie geworden ist. Und sie wird durch diese Ruhe besser und anmutiger, als sie jemals war.
Wiesel behauptete dieser Tage, meinte Vetter, der Prinz werde sich der Kinder wegen mit Henriette trauen lassen.
Nicht mit Henriette, und auch mit Pauline nicht! entgegnete Rahel. Denn weil er beide liebt, weil er keine von beiden leiden sehen kann, leidet er für alle und wird von den Furien der widersprechendsten Gefühle so lange umhergetrieben werden, als noch ein Funken Lebenskraft in ihm sein wird. Er fühlt und weiß das selber, dieser Ueberzeugung muß er leben, ein Prinz sein, witzig sein und lächeln, und außerdem zusehen, daß Preußen untergeht.
Nehmen Sie Platz! und vielen Dank! mein werter Herr! sagte einige Tage später der erste Kanzleirat des Haugwitzschen Ministeriums, als der junge Wegmann abends in die Geheimkanzlei getreten war, deren Türe der Sekretär sorgfältig hinter dem Ankommenden verschloß.
Sie haben also meine Sendung erhalten, Herr Kanzleirat!
Zuverlässig! werter Herr Wegmann! und auch die schöne Zugabe für meine Frau, die auf das Angenehmste von Ihrer Galanterie überrascht worden ist.
Ich habe den Shawl von Paris mitgebracht, bemerkte Karl, wo ich leider durch das Ausbleiben der Zahlung jener zweiten Hälfte der vierzigtausend Taler so ungemein lange aufgehalten wurde. Erst heute bin ich hier eingetroffen, und mein erster Gang ist zu Ihnen, um Sie an Ihr anderweitiges Versprechen zu erinnern. Haben Sie die Ursachen endlich ermitteln können, um derentwillen man so hartnäckig die Entlassung meines Bruders verweigert, die mir so sehr am Herzen liegt?
Diese Entlassung wird schwer zu erlangen sein, verehrter Freund! bedeutete der Kanzleirat, so lange Ihr geschätzter Herr Vater dieselbe nicht in Person begehrt. Denn da Ihr Bruder nur körperlich angegriffen, nicht organisch krank ist, liegt gar kein Grund für seine Freigebung vor.
Gesetzlich nicht, das weiß ich! aber man ist sonst ja in gleichem Falle nicht eben streng gewesen, warum will man hier sich denn so eisern an den Buchstaben des Gesetzes binden?
Der nahe Ausbruch des Krieges! meinte achselzuckend der Beamte, und manche andere Rücksicht –
Herr Kanzleirat! sprechen Sie es aus, was Sie mir verschweigen. Der Ausbruch des Krieges ist es nicht allein, wie Sie selbst mir andeuten. Welche Rücksichten hindern es, daß man für meinen Bruder einen Ersatzmann annimmt, den ich so groß und so kräftig stellen will, daß Friedrich Wilhelm der Erste ihn in seine Garde aufnehmen könnte. Sie wissen, Herr Wiesel und selbst seine Hoheit Prinz Louis haben sich bei dem Regimentskommandeur dafür verwendet, als meine Geschäfte mich zu schleuniger Abreise zwangen.
Sehen Sie, Wertester! sagte der Kanzleirat, sich nahe zu Wegmann hinneigend und die Hand auf seinen Arm legend, während er leiser sprach, sehen Sie, Wertester, das war eben das Unglück. Hätten Sie die Sache abgemacht, wie Sie selbst sie angefangen, so wäre das mit dem Unteroffizier, dem Feldscher und dem Regimentskommandeur ein Leichtes gewesen. Nun aber reisten Sie ab, Herr Wiesel ging in Ihrem Auftrage zu dem Obersten, bezog sich auf den Beistand des Grafen Haugwitz, des Prinzen Louis Ferdinand. Der Obrist, um dem Grafen Haugwitz seine Bereitwilligkeit zu zeigen, fragte bei seiner Exzellenz persönlich an, und damit war eben die Sache verloren.
Aber erklären Sie mir nur, was kann Graf Haugwitz daran liegen, ob mein Bruder frei wird oder nicht, da er in der Tat von dem ihm ungewohnten Leben so leidend ist, daß er unmöglich einen Marsch, einen Feldzug in dieser Jahreszeit ertragen könnte. Ich würde im Augenblicke des Krieges nicht alles daran setzen, ihn dem Dienste zu entziehen, wäre es nicht eine Notwendigkeit für seine Erhaltung.
Der Kanzleirat rückte noch näher. Wissen Sie, wie Herr Wiesel jene Bewilligung der vierzigtausend Taler erlangte? Graf Haugwitz steht sich schlecht mit dem Prinzen Louis, und wünschte ihn von Berlin zu entfernen. Herr Wiesel versprach die Entfernung zu bewirken, und hielt nicht Wort. Darum zögerte man, Ihnen den Rest des Geldes auszuzahlen; darum, weil man dem Prinzen und Herrn Wiesel nicht gefällig sein wollte, hat man die Freilassung Ihres Herrn Bruders hintertrieben. Ich habe zufällig erfahren, daß man diese Einmischung des Prinzen in die Angelegenheiten fremder Regimenter übel gedeutet, und höchsten Ortes an Vorgänge erinnert hat, bei denen er einmal durch ähnliche Einmischungen in schlimme Verwickelungen mit einem Offizier geraten ist. Ich weiß auch, daß man ihn höchsten Ortes zur Vorsicht ermahnt und ihm nochmals streng alle Uebergriffe in Angelegenheiten verboten hat, die nicht in sein Ressort gehören.
Und zu welchen Schritten würden Sie mir bei dieser Lage der Sache jetzt noch raten können, um an mein Ziel zu gelangen?
Es käme auf einen Versuch an, meinte nach einigem Besinnen der Beamte, ob sich nicht durch die kleine Nina vom Ballette etwas erreichen ließe. Es ist ein hübsches, artiges Kind, wohlgelitten bei hochstehenden Personen, hat schon hie und da eine carte blanche zu erschmeicheln gewußt, die man nachher nicht zurückzunehmen vermochte. Sie hat das Ameublement, zu dem Sie uns den Stoff gesendet, und fand es sehr hübsch. Vielleicht könnte sie etwas tun. Dabei, mein werter Freund, fällt mir ein, zu fragen, ob man dieses Zeug wohl auch in anderen Farben hat? Sie wünschen bei mir zu Hause ein zweites Zimmer einzurichten und baten mich, gelegentlich nachzufragen, ob der Stoff vielleicht aus Ihrer Fabrik genommen sei, und ob man auch im Handel davon erhalten könnte?
Ich werde für das Nötige sorgen, antwortete Wegmann kurz, und stand auf, sich zu empfehlen. Als er schon an der Tür war, rief ihn der Kanzleirat zurück. Sprechen Sie vor allen Dingen doch noch einmal mit dem Kriegsrat Mommsen. Er pflegt abends im Theater zu sein, und wird heute gewiß nicht fehlen, da man den Tell von Schiller aufführt, dem die höchsten Herrschaften beiwohnen sollten. Schlüge aber alles fehl, so bleibt noch der Versuch übrig, sagte er, daß Ihr Bruder bei dem Ausrücken des Regiments, das in den nächsten Tagen erfolgen muß, sich aus dem Staube zu machen sucht. Sie müßten dann die Etappen wissen und dort vorsorgen. Was ich Ihnen dabei helfen kann, soll gern geschehen.
Die Hand im Unmute zusammenballend, stieg Wegmann die Treppe des Ministeriums hinab, um sich nach dem Schauspielhause zu verfügen.
Die Straßen waren strahlend erleuchtet, die Ankunft des Kaisers von Rußland zu feiern, aber in den Gemütern der Einsichtigen sah es nicht so heiter und strahlend aus.
Die französische Besetzung von Anspach und Bayreuth hatte auch den Gleichgültigeren die Augen geöffnet. Man begriff die drohende Gefahr, und das Erscheinen des Kaisers, dessen liebenswürdige, ritterliche Persönlichkeit Männer und Frauen begeisterte, ward deshalb als ein Rettungsmittel begrüßt, das die Hoffnung politischer Aenderungen in Aussicht stellte. Wo sich der Kaiser in Begleitung des Königs zeigte, scholl ihrer Vereinigung von allen Vaterlandsfreunden ein Vivat entgegen, von allen Gebildeten erklang der Ruf zu den Waffen, zum Kampfe, nur am Hofe sprach man noch von Ausgleichungen und wollte den Frieden.
In den Theatern ward jede Anspielung auf die Erhebung eines Volkes, auf die Freiheit der Nation mit Beifallssturm empfangen, und die Aufführung des Wilhelm Tell von Schiller, der zum erstenmal in Berlin gegeben werden sollte, wurde förmlich als ein politisches Zugeständnis an den Willen der Kriegspartei betrachtet.
Der ganze Hof sollte der Darstellung beiwohnen. Der Prinz hatte Wegmann aufgefordert, ihm die Auskunft über den Erfolg seiner Unterhandlung mit dem Kanzleirat in das Theater zu bringen. Wegmann sollte am Ende des dritten Aktes den Adjutanten des Prinzen im Buffetzimmer treffen. Da es aber durch die große Galaerleuchtung sehr warm in den Logen geworden, war der Prinz selbst mit seinem Adjutanten hinabgegangen, noch ehe der Akt zu Ende war. Hinter einem Wandschirm, den man in dem Buffetzimmer zum Schutze gegen die Zugluft aufgestellt hatte, nahm der Prinz, in seinen Mantel gehüllt, einen Platz, von dem aus er die Anwesenden sehen konnte, ohne gesehen zu werden.
Das Zimmer war noch fast leer, als Wegmann eintrat, nur in einer Ecke, zunächst dem Platze des Prinzen, saßen jenseits des schützenden Schirmes drei Männer in eifrigem Gespräche bei ihren Punschgläsern. Ein vierter ging, eine Melodie vor sich hinsummend, auf und ab. Die Trinkenden hatten sich hier fest niedergelassen und schienen die Aufführung des Tell nicht weiter ansehen zu wollen.
Der eine war ein königlicher Stallmeister, der andere eben jener Kriegsrat, an den Wegmann gewiesen worden war. Diese beiden machten die Erzähler, und besonders der Kriegsrat, ein noch junger Mann, legte in jede seiner Aeußerungen das ganze Gewicht der hohen Bedeutung, die er sich selbst zuschreiben mochte. Der dritte, ein wohlhabender Materialhändler, hörte ruhig zu, seinen Punsch trinkend und nur hie und da eine Frage dazwischen werfend.
Nachdem Wegmann dem Prinzen die Erfolglosigkeit seiner bisherigen Bemühungen mitgeteilt hatte, riet dieser ihm, sich gleich hier an den Kriegsrat zu machen, dem Wegmann schon bekannt war. Ich höre ihn ohnehin schon eine ganze Weile und mehr als nötig über Krieg und Frieden unterhandeln, sagte der Prinz. Vielleicht erfahren Sie irgend etwas, das Ihnen nützlich ist, ohne daß Sie darum zu fragen brauchen.
Wegmann trat hinzu, der Kriegsrat lud ihn ein, Platz zu nehmen, und der Kaufmann sagte, in der Unterhaltung fortfahrend: ich kanns mir nur nicht denken, daß wir nun, so mir nichts, dir nichts in den Krieg ziehen werden. Wir sind nicht vorbereitet, und Rußland und Oesterreich, die fix und fertig dastehen, die werden nicht erst auf uns warten.
Nicht fertig? meinte der Kriegsrat. Wer sagt Ihnen das? Es ist alles in Ordnung, alles fertig, bis in die kleinsten Details der Pläne, nach denen die Truppen zusammengezogen werden sollen.
Ja, es ist ohne Frage, bekräftigte der Stallmeister, denn sehen Sie, ich darf es unter Freunden sagen, wir haben geheime Ordre, die Kriegspferde zuzureiten, und auch die Equipagen werden schon besorgt.
Wie oft sind schon Pläne entworfen und Ordres gegeben, meine Herren! wendete Wegmann ein, die widerrufen worden sind! Ich werde erst dann an den Krieg glauben, wenn die erste Schlacht geschlagen sein wird.
Nun, rief der Kriegsrat, der sich durch den Zweifel in seine Aussagen beeinträchtigt zu fühlen schien, wenn Ihnen denn mein Wort nicht genügt, so glauben Sie vielleicht meinen Papieren. Ueberzeugt Sie das? – damit zog er seine Brieftasche hervor und legte zwei Papiere auf den Tisch: den Plan der Truppenaufstellung und die Liste der Lieferungen, welche man ausgeschrieben hatte.
Während Wegmann und der Stallmeister sich die Zusammenziehung der Truppen auseinandersetzen ließen, nahm der Kaufmann die Lieferungsliste zur Hand, und sagte: Sagen Sie mir, mein verehrter Herr Kriegsrat! könnte man nicht auch etwas von diesen Lieferungen erhalten? Die Zeiten sind schwer, und – fügte er hinzu, sich flüsternd zu dem Kriegsrat hinüber neigend – und man würde nicht undankbar sein.
Mein lieber Mann! entgegnete der Kriegsrat, sich mit einer Protektormiene in den Sessel zurücklehnend, das sagt ein jeder; aber die Begriffe über Dankbarkeit sind verschieden. Zudem haben der Herr Minister und der Herr Geheimrat selbst diejenigen bestimmt, welche die Lieferungen übernehmen sollen. Sehen Sie, diese Herren haben Verpflichtungen gegen Personen, die ihnen dienstlich behilflich waren, gegen die man sich abfinden will. Da wird denn die Gelegenheit benutzt, und uns bleibt nur die Verfügung über kleine Posten zu Gunsten irgend eines Freundes.
So ablehnend diese Antwort schien, ließ sichs der Kaufmann nicht anfechten. Wenn es mit den Lieferungen eben nichts wäre, meinte er, so könnte man doch vielleicht an den Ruheplätzen noch einen kleinen Gewinn erzielen, wenn man diejenigen Bedürfnisse, Tabak und desgleichen, hinschickte, welche an kleinen Orten nicht in nötiger Menge vorrätig zu sein pflegen. Für die bloße Mitteilung der Marschroute, der Rasttage würde ich dem verehrten Herrn Kriegsrate schon äußerst dankbar sein.
Nun, das ließe sich machen, Bester! lächelte der Kriegsrat, so etwas ließe sich machen. Besuchen Sie mich gelegentlich, und hier können Sie ja vorläufig sich den Plan einmal ansehen.
Darauf fing er an, dem Kaufmanne, der sich auf der Karte nicht zurecht zu finden wußte, die beabsichtigten Operationen mit allen Details auseinanderzusetzen, wobei der umhergehende Fremde, der den Kriegsrat immerfort im Auge behalten hatte, näher zum Tische herantrat und aufmerksam seinen Worten folgte.
Ungeduldig sprang der Prinz empor. Es ist um rasend zu werden: sagte er zu seinem Adjutanten. Das sind nun die königlichen Diener, das ist ihre Pflichttreue, ihre Amtsverschwiegenheit! Der elendste Lakai in der Livree des erbärmlichsten Herrn dient treuer, als diese vornehm tuenden, aufgeblasenen Verräter. Wer nur der herumschleichende Fremde sein mag? Fragen Sie doch nach?
Der Adjutant wendete sich an den Besitzer des Buffets, und kam mit der Nachricht zurück, es sei ein Franzose, der deutsch spreche und das Theater oft besuche. Befehlen Hoheit, den Kriegsrat vielleicht zu warnen?
Kann denn auch nur einer dieser Pläne ausgeführt werden, die nur auf dem Papiere möglich sind? und ist der Kriegsrat der einzige, der sie verrät? entgegnete bitter der Prinz. Sie hören ja von Wegmann, und wir wissen aus eigener Erfahrung, wie elend die Mehrzahl dieser Klasse ist, wie ihre schlechte Besoldung und ihre Habsucht sie alle käuflich gemacht haben. Wie sie jetzt kleine Dienste für kleinen Gewinn verkaufen, werden sie das Land verkaufen, sobald der rechte Preis geboten wird. Oben im Saale klatscht dieses vornehme Gesindel dem Patriotismus eines Tell, eines Stauffacher Beifall, weint Tränen der Rührung und verschachert in der nächsten Minute sein Vaterland! Es widert mich an, ich mag nicht mehr hineingehen. Lassen Sie den Wagen kommen!
Die Lage des Prinzen, welche dem Hofe gegenüber schon seit Jahren eine peinliche gewesen war, hatte sich, seit Parteiungen in der öffentlichen Meinung eingetreten waren, noch verschlimmert, und steigerte sich während der Anwesenheit des Kaisers Alexander fast bis zum Unaushaltbaren. Dem Kaiser stand die ganze Natur des Prinzen in ihrer lebhaften Jugendkraft und Tatenlust viel näher als das zögernde, verschlossene Wesen des Königs. Dazu kam, daß der Prinz sich von jeher für den Krieg und für eine Verbindung mit Rußland erklärt hatte, von der man noch immer nicht mit Gewißheit voraussehen konnte, ob der König sie jetzt schon, und inwieweit er sie eingehen werde.
Vom Könige mit Mißtrauen betrachtet, von des Grafen Haugwitz Spionen unablässig bewacht, hatte der Prinz dennoch nicht die Freiheit, sich von Berlin zu entfernen, und war gezwungen, allen jenen Festen beizuwohnen, welche die Anwesenheit des Kaisers und seiner militärischen Begleitung, sowohl am Hofe, als in den Zirkeln der Aristokratie veranlaßte.
Die Feste dieser letzten Kreise übertrafen an Ausdehnung alles, was man jetzt der Art als üblich annimmt. Graf Stadion, der österreichische Gesandte, hatte die Sitte eingeführt, daß man sich abends acht Uhr zum Spiele versammelte, dem gegen Mitternacht das Souper folgte. Nach diesem begann der Tanz, der bis zum Morgen währte, worauf die ganze Gesellschaft, solange die Jahreszeit es irgend zuließ, sich in bereitgehaltenen Wagen zu einem Frühstück auf das Land verfügte, und oft erst am Nachmittage in die Stadt zurückkehrte.
Ein solches Fest war von dem Grafen Haugwitz in der letzten Woche des Oktober den russischen Offizieren zu Ehren veranstaltet worden, und die Prinzessin Ferdinand hatte ihren Sohn selbst aufgefordert, sich nicht davon auszuschließen. Es war gegen elf Uhr mittags, als die Gesellschaft von dem Landgute des Grafen heimkehrte, und der Prinz, seinen Wagen am Tore verlassend, den Weg nach seiner Wohnung zu Fuß zu machen beschloß.
An den beiden vorhergehenden Tagen war die Wachtparade nicht abgehalten worden, weil man einigen ausrückenden Bataillonen das Geleit gegeben hatte. Jetzt war die Stunde derselben bereits vorüber, dennoch sah der Prinz schon von fern, daß sie noch nicht aufgelöst sei. Einige der Gardeoffiziere, welche an dem Haugwitzschen Feste teilgenommen hatten und des Dienstes wegen früher heimgekehrt waren, standen mit bleichen, übernächtigten Gesichtern noch beisammen auf dem Platze. Sie besprachen mit der müden Gleichgültigkeit der Uebersättigung die Anordnung des Festes und die Schönheit der Frauen, als der Prinz mit der Frage an sie herantrat, weshalb man noch nicht auseinander gegangen sei.
Ein Füsilier läuft Spießruten, Hoheit! berichtete der Gefragte mit vollkommener Teilnahmlosigkeit.
Es war ein schlanker, schöner Jüngling, an dem die Exekution vollzogen wurde. Hundert Mann von der Wachtparade hatte man in zwei Reihen aufmarschieren lassen und jeden derselben mit einer starken Weidenrute bewaffnet. Zwischen diesen ging mit entblößtem Oberkörper der Sträfling; vor ihm ein Unteroffizier mit umgekehrtem Kreuzgewehr, die Spitze gegen ihn gewendet, ein anderer Unteroffizier ihm nach; und hinter den beiden Reihen zum Schlagen kommandierter Soldaten befanden sich zwei Regimentsadjutanten, um jeden sogleich zu strafen, der nicht tüchtig auf den Delinquenten loshieb.
Kein Laut regte sich, nur die Weidenruten pfiffen durch die Luft. Um bei solchen Exekutionen das Schreien der Gepeitschten unhörbar zu machen, steckte man ihnen eine große Bleikugel in den Mund, welche zugleich verhinderte, daß sie sich, im Schmerz die Zähne zusammenbeißend, nicht die Zunge beschädigten und für den weitern Dienst unbrauchbar wurden.
Das Blut rieselte bereits über den Rücken des Jünglings hernieder, dessen Gesicht die furchtbarsten Schmerzen verriet. Als der Prinz hinblickte, war der empörende Akt vorüber, man nahm dem Gestraften die Bleikugel aus dem Munde, mit einem Schmerzenslaut brach er ohnmächtig zusammen, und ein paar Kameraden sprangen hinzu, ihm mitleidend Hilfe angedeihen zu lassen, als Buße für die Grausamkeit, zu der man sie gezwungen hatte.
Unter dem schmerzlichen Eindrucke dieser letzten Szene langte der Prinz ermüdet in seiner Wohnung an. Auf dem Vorflur fand er den alten Wegmann, der sich totenbleich und entstellt zu seinen Füßen warf. Retten Sie, retten Sie! allergnädigster Prinz! Das waren die einzigen Worte, welche er hervorzubringen imstande war.
Eine schwere Ahnung zuckte durch des Prinzen Herz. Er hob den Alten auf, führte ihn in das nächste Zimmer und fragte, was geschehen sei.
Mein Sohn! mein Fritz! – Er wird mir fluchen, er wird der Mutter fluchen! – Wir, unser Hochmut, unsere Verblendung tragen die Schuld! Retten Sie um Gottes willen.
Aber was ist geschehen? fragte der Prinz nochmals dringender; ich muß wissen, was geschehen ist, um helfen zu können!
Das Mädchen kam nach Berlin, hub der Alte an, voraussetzend, ein jeder müsse diese Verhältnisse kennen. Das Mädchen kam nach Berlin, weil sie einen alten Mann nicht mehr nehmen wollte. Sie sahen sich, so oft er Urlaub hatte, der Karl wußte darum, er war der einzige Gerechte unter uns. Jetzt soll sie Mutter werden; Fritz wollte fort mit ihr, er war selbst krank und konnte es nicht ertragen, sie in dem Zustande allein zu wissen. Karl hatte des Bruders Freiheit noch nicht erlangt, aber er hoffte sie zu erlangen und gab dem armen Weibe Geld zu leben bis dahin. Das Geld haben die Unglückseligen zur Flucht benutzt. Er ist eingeholt und soll – Tränen stürzten aus des Greises Augen, seine Zunge versagte den Dienst, das Furchtbare auszusprechen, bis er endlich, händeringend dem Prinzen sich nochmals zu Füßen werfend, mit erstickter Stimme die Worte hervorstieß: Mein Sohn, mein leiblicher Sohn! Er muß Spießruten laufen, wenn Sie nicht Hilfe schaffen.
Der Ruf: es ist zu spät! schwebte auf den Lippen des Prinzen, aber er wollte dem Vater die schmerzliche Botschaft vorenthalten, bis er wenigstens die Kunde hinzufügen konnte, daß der Sohn noch lebe.
Wo ist Ihr älterer Sohn? fragte er.
Er ist zu Mademoiselle Levin gefahren, um vielleicht Hoheit dort zu treffen. Auch das Mädchen war bei ihr, ihre Bekannten hatten sie dorthin gewiesen, um Fürbitte und Protektion zu erflehen.
Und ist Ihre Frau zu Hause? forschte der Prinz weiter, um den Greis in die Nähe befreundeter Personen zu bringen.
Sie wollte mit der Schwiegertochter in ihrer Todesangst zum Obristen, um dort für ihn zu bitten.
So erwarten Sie mich hier, ich werde selbst nachsehen und Ihnen Kunde bringen.
Der Prinz befahl anzuspannen und wollte, da es geschehen war, den Wagen besteigen, als Karl Wegmann mit jener Ruhe in das Zimmer trat, welche die Gewißheit eines unabänderlichen Unglücks über starke Charaktere bringt.
Nun? Nun? rief der Alte. Kommt er frei? erläßt man ihm die Strafe?
Sie ist vollzogen, Vater! antwortete Karl tonlos.
Gott des Himmels! Du strafst mich hart! – und wo ist er? lebt er? hat ers überstanden? fragte der Vater nach einer Pause.
Da fiel der Sohn dem Vater um den Hals, und mit einem Strome heißer Tränen, in denen seine Mannesstärke unterging, sagte er: Fritz hat's überstanden, er hat ausgelitten.
Der Prinz schlug schmerzhaft beide Hände vor das Gesicht und verließ das Gemach.
Der Tag entschwand ihm in dem furchtbaren Nachklang dieser Erlebnisse. Gegen den Abend hin ging er zu Rahel. Sie wußte bereits um alles.
Wie starb er denn? fragte der Prinz.
Er muß sich, sobald er verbunden worden war, von seinem Lager erhoben haben, einen Dolch hervorzuziehen, den er seit Wochen in seinem Strohsack verbarg; mit diesem hat er sich das Herz durchbohrt.
Der Prinz schauderte, und Rahel fuhr fort: Ich bin jetzt ganz ruhig, weil ich all meine Schmerzenskraft erschöpft habe in dem Leiden mit dem unglückseligen Mädchen, das den ganzen Morgen bei mir zugebracht hat. Sehen Sie, Prinz, da bluten tausend Wunden auf einmal hervor. Wissen Sie, warum die Arme das Vaterhaus floh? Weil man sie nach Rußland einem alten, fremden Manne verkuppeln wollte. Und wissen Sie, was die Juden zwingt, ihre so heißgeliebten Kinder weit von sich in der Fremde an Fremde zu verheiraten? Die wahnsinnigen Gesetze Ihres Landes, welche, uns auszutilgen von der Erde wie giftiges Gewürm, es nur zwei Kindern jeder jüdischen Familie gestatten, sich in der Vaterstadt zu verheiraten und anzusiedeln. Ich selber, Prinz! Ihre Freundin, Rahel Levin, ich bin auch heimatlos in der Heimat. Ich habe mein Heiratsprivilegium dem Bruder abgetreten – und es ist gut, daß es so ist, daß ich einsam, kinderlos sterben werde. Ich hätte nicht den Mut, den Fluch, den Ihr auf uns geworfen habt, fortzupflanzen auf ein Kind, das ich unter meinem Herzen getragen, an meiner Brust genährt hätte. Oh! die Unmenschlichkeit unserer Zustände ist himmelschreiend, und ich glaube nicht mehr an Gott, wenn er sie noch lange duldet.
Den Tagen der Hoffnung, welche die Ankunft des Kaisers erzeugt, schien auch eine Erfüllung folgen zu sollen. Preußen schloß sich so weit an Rußland und Oesterreich an, daß es Napoleon Vorschläge zur Ordnung der europäischen Verhältnisse vorlegte, welche Graf Haugwitz mit der Erklärung nach Paris zu überbringen gesendet ward, daß Preußen in der Mitte des Dezember den Krieg beginnen werde, wenn Napoleon jene Vorschläge nicht annehmen sollte.
Die Vorbereitungen zum Kriege wurden dabei in Berlin immer ernstlicher betrieben, und die Truppen, besonders die Garderegimenter, fanden ihrer Freude kein Ziel, daß sie endlich in die Lage gesetzt werden würden, die Lorbeeren zu pflücken, welche das lange Zögern der Regierung ihnen bisher vorenthalten hatte. Indes ihre Zurüstungen für den Kampf waren nicht so kriegerisch als ihre Worte. Man ließ bequeme Zelteinrichtungen, Feldbetten, Feldequipagen machen, und jene Franzosen von Roßbach, welche mit ihren Schmink- und Pomadebüchsen noch immer der Gegenstand des preußischen Spottes waren, konnten schwerlich üppiger und verweichlichter gewesen sein, als man die preußischen Offiziere nach ihren Bequemlichkeitsvorrichtungen glauben durfte.
Endlich zu Anfang des Dezembermonats rückten einige Regimenter von Berlin aus nach Sachsen und Thüringen vor, unter denen sich auch das Regiment des Prinzen befand. Aber schon wenige Tage darauf verbreitete sich in Berlin die Nachricht von der am Krönungstage Napoleons bei Austerlitz erfolgten furchtbaren Niederlage der Oesterreicher und Russen, und gleich darauf kehrte Graf Haugwitz mit neuen Friedensvorschlägen aus Paris zurück, welche man, da Oesterreich und Rußland sich von dem Kampfplatze zurückzuziehen gezwungen waren, notwendig annehmen mußte.
Von seiner Siegeshoffnung, von der Kampfeslust sank das preußische Militär zur tiefsten Mutlosigkeit herab, denn jeder gestand sich, daß der Augenblick des Einschreitens vorüber sei und daß man jetzt alles zu dulden genötigt sein werde, weil man die Zeit zum Handeln versäumt habe. Die Aristokratie, welche ihre dem Soldatenstand angehörigen Söhne überall, wo sich die tatenlos Heimkehrenden zeigten, verspottet sah, war nun plötzlich gegen den Frieden und gegen den König empört. Die Bürger, mit Recht die Summen in Betracht ziehend, welche das Militärwesen seit den Zeiten des großen Königs verschlungen hatte, warfen dem König und dem Heere vor, wie unnütz das letztere sei, wenn es nicht einmal die Abtretung der treu preußisch gesinnten Lande Anspach und Bayreuth zu verhindern vermocht habe. Kurz, die Unentschlossenheit, das Zaudern und die Halbheit, mit welcher der König den Interessen jeder Partei seines Landes und den eigenen Neigungen zu genügen gemeint hatte, um allgeliebt zu werden, hatten es dahin gebracht, ihm den Tadel aller Parteien und seiner Regierung das Mißtrauen des ganzen Landes zuzuziehen.
Aber der Volksunwille, so mächtig er war, stand trotzdem noch immer unter dem Banne der fesselnden Gewohnheit. So lebhaft war die Begeisterung für den großen Friedrich gewesen, so tief gewurzelt die Anhänglichkeit für seine Dynastie, daß man den König weniger hart anklagte als seinen Minister, den Grafen Haugwitz, in welchem das Volk den Anstifter der schmachvollen Abtretung preußischer Erblande an Frankreich, den Urheber seiner demütigenden Stellung überhaupt verdammte.
Unter diesen Umständen kehrte auch Prinz Louis mit seinen Truppen nach wenigen Wochen ohne Schwertschlag heim. Es war in den letzten Tagen des Jahres, als er frühmorgens in seiner Wohnung anlangte. Erst spät am Abend entschloß er sich auszufahren, um sich in das Palais seiner Eltern zu verfügen. Eine unruhige Volksbewegung machte sich in den Straßen bemerkbar. Einzelne Gruppen von Männern standen beisammen, lebhaft sprechend und gestikulierend. Je näher man dem Palaste des Grafen Haugwitz kam, um so unruhiger wurde es auf dem Wege, bis endlich vor demselben der Wagen des Prinzen in ein so dichtes Gedränge geriet, daß man kaum noch im Schritte zu fahren vermochte.
Wohlgekleidete Männer der höheren Stände, Offiziere aller Regimenter, darunter eine große Anzahl Garde du Corps, hatten sich, in Mäntel gehüllt, hier versammelt, umringt von jener Volksmasse, welche sich in großen Städten bei jedem auffallenden Ereignisse lawinenartig zusammenballt. Jeder, auch der Kenntnisloseste, begriff, um was es sich hier handelte: um den Verrat an der Volksehre, um den Verrat einer Nation durch die Regierung.
Wie lange wird das Geld reichen, rief ein großer, starker Mann, das der Herr Graf für den Verkauf von Anspach und Bayreuth erhalten hat? Was kostet solch liederliche Wirtschaft! Ists zu Ende, so wird wieder geschachert werden, und der Graf verkauft uns so sicher, als er die treuen Anspacher verkauft hat.
Verkaufen? uns? das soll er probieren! dawider haben wir Fäuste! schrie ein anderer. Schlagt den Hund tot, ehe er wieder Preußen verschachern kann.
Was kriegt er für die Seele? scholl es von einer dritten Seite, und zugleich flogen mit dem Rufe: man muß anklopfen, damit man Antwort bekommt, zahllose Steine in die Fensterscheiben.
Pereat dem Seelenverkäufer! Nieder mit dem Schacherer! dem Verräter! donnerte es von allen Ecken, und Kot- und Steinwürfe regneten gegen das Haus.
Vergebens versuchten Polizeibeamte und Gendarmen Ordnung zu schaffen. Zum ersten Male seit vielen Monaten wurde das Militär von den Zivilpersonen gut angesehen; Offiziere und Bürger machten zum ersten Male wieder gemeinschaftliche Sache, aber nicht für, sondern gegen die Regierung. Dahin hatte man es in dem monarchisch gesinnten Lande durch Mißkennen der Zeit und der Umstände gebracht.
Plötzlich wendete sich die Aufmerksamkeit eines Mannes der zum Stillstehen gezwungenen Equipage zu. Man erkannte die königliche Livree, ein Offizier der Garde du Corps erkannte den Prinzen. Im gleichen Augenblicke war er an der Türe des Wagens. Der Ruf: Prinz Louis! Vivat Prinz Louis! erscholl. Man drängte sich heran: Lassen Sie es nicht geschehen! Fordern Sie Rettung unserer Ehre! Gnädigster Herr! verlassen Sie das Land nicht! Halten Sie zu uns, Prinz! riefen verschiedene Stimmen durcheinander.
Mit Mühe gelang es dem Prinzen, dem Andrange zu wehren. Er erinnerte, den Wagen verlassend, die nächststehenden Offiziere an ihren Eid, ermahnte sie, sich nicht vom Augenblicke hinreißen zu lassen, und suchte so schnell als möglich dieser Szene zu entfliehen. Zu Fuß langte er in dem Palaste seiner Eltern an, entschlossen, seiner Mutter, welche leidend war, die Vorgänge auf der Straße womöglich zu verschweigen.
Prinz Ferdinand hatte sich wie immer früh zur Ruhe begeben; die Prinzessin wartete ihres Sohnes. Auf einem Armstuhl ruhend, der neben dem Kamin stand, hatte sie das Haupt in die Kissen zurückgelehnt und betrachtete in träumerischem Sinnen die aufspringenden und wieder erlöschenden Funkengarben des Feuers. Sie hatte sichtlich gealtert in den letzten Monaten; ihre stolze Haltung schien gebrochen, körperliches oder geistiges Leid war über ihre Züge Herr geworden. Sie sehen angegriffen aus, meine Mutter! sagte der Prinz, ich erfuhr am Morgen, daß Sie leidend wären. Wie fühlen Sie sich jetzt?
Du wußtest mich krank und warst tagsüber in Berlin, ohne mich zu besuchen! entgegnete sie vorwurfsvoll. Willst Du mich im voraus daran gewöhnen, die Achtung zu entbehren, welche man mir schuldet?
Mutter! wenn Sie von solchen Ahnungen erfüllt sind wie ich – wenn Sie denken, empfinden wie ich, rief der Prinz, all' seine Vorsätze, die Mutter zu schonen, vergessend, dann werden Sie es begreifen, daß ich an dem Tage nicht durch die Straßen gehen mochte, an dem ich ruhmlos, ohne Schwertschlag, als ein Besiegter heimkehrte. Sie müssen fühlen, was es heißt, als Mann vor Männern, als Fürst vor seinem Volke zu erröten.
Die Prinzessin neigte schmerzlich beistimmend das Haupt. Und der Augenblick war so glückversprechend, die Stimmung des Volkes noch so günstig vor wenigen Wochen! klagte sie.
Nein, Mutter! nein! das war sie nicht! Die Tage, in denen ich auf Glück, auf die Treue des Volkes zu zählen und durch sie den Sieg zu erkämpfen hoffte, sind bei mir vorüber.
Die Prinzessin schwieg eine Weile, dann sagte sie: Sonderbar! wir stehen uns in Lebensfülle gegenüber, und doch klingt es wie der Abschiedston von Sterbenden zwischen uns. In schwüler Luft erlöscht der Klang der Glocken. Es ist der Druck der Tyrannei, der unsern Atem einengt, unser Auge trübt. Ich fühle ihn wie Du.
Der Prinz neigte sich, die Hand seiner Mutter zu küssen. Es zerriß ihm das Herz, die stolze Frau so tief gebeugt zu sehen. Noch war der Palast von den Scharen dienstbeflissener Höflinge erfüllt, noch prangte alles in der hergebrachten Ordnung, und doch lagen schon unheilverkündende düstere Schatten für das Auge der Besitzer über dies alles hingebreitet. Das Gefühl der festbegründeten, der durch den Volksglauben gesicherten Existenz hatte sie verlassen.
Du wirst Berlin verändert finden, hub die Prinzessin wieder an; ich kenne es selbst kaum wieder. Wo ist die Freude hin, die uns sonst willkommen hieß, wenn wir erschienen? wo der sympathische Jubelruf, der den König und die Königin im Theater begrüßte? Ueberall Schweigen und Kälte, überall eine Entfremdung zwischen dem Volke und uns, und – – sie hielt inne, als wolle sie dem Gedanken nicht Worte geben.
Der Prinz tat es statt ihrer. Und die Schuld ist unser! ergänzte er. Ja Mutter! das Bewußtsein ist es, das auf uns lastet. Was mir ein Bürger Berlins einst sagte, was ich damals stolz zurückwies, ich habe es einsehen gelernt zu einer Verzweiflung: wir haben nicht auf das Volk zu rechnen, denn wir haben kein freies Volk, das sich frei mit seinem Herrscher verbündet zu gegenseitigem Schutz und Trutz; wir haben Untertanen, treue Untertanen, ich will es zugeben. Aber wir haben die Gebildeten des Volkes verlassen, die ihre Nationalehre zu verfechten begehrten, wir haben den Geist der Zeit verhöhnt, uns festbannend an veraltete Gesetze; dafür wird die Zeit uns stürzen in ihrem stürmischen Fluge, uns begraben unter dem Schutte unserer verjährten Institutionen, unserer barbarischen, unmenschlichen Vorurteile.
Und nur ein Weib sein! zusehen, schweigen, überleben müssen! sagte die Fürstin leise in achtlosem Selbstgespräche.
Der Prinz aber hatte es dennoch gehört und, ihrer Gedankenreihe folgend, entgegnete er: Als wir, dem Kaiser Alexander das Geleit gebend, in Potsdam bei der Abendtafel saßen, und man siegesfreudig in die Zukunft blickte, verlangte er plötzlich, die Vergangenheit heraufzubeschwören und die Gruft des größten Herrschers zu besuchen. Seine Wagen standen gepackt, Mitternacht war nahe, als wir ihn vom Schlosse zu der Kirche geleiteten. Die Nacht war sternenlos, die Kirche frostig kalt. Als wir eintraten, schlug es zwölf Uhr. Das Glockenspiel klingelte seine schwermütige Melodie durch die Stille.
Zu Dreien stiegen sie hinab, der Kaiser, der König und die Königin, einen Bundeseid zu schwören über des großen Friedrichs heiliger Asche. Mir schauerte banges Todesahnen durch Mark und Bein, als ich die Lichtgestalt der Königin, vom Fackelschein der Vorleuchtenden hell bestrahlt, in jener Totengruft verschwinden sah. Es war mir, als versänke mit ihr der Genius Preußens in Nacht, als müsse ich nachstürzen, sie zurückzuhalten, mich selbst darbringen als ein Sühneopfer. Aber klarer als jemals fühlte ich in dem Augenblicke, was ich Ihnen einst gesagt, als das Unglück, das uns jetzt bedroht, sich fern an unserem Horizonte zeigte: den Untergang Preußens würde ich nicht überleben.
Die Prinzessin erschrak, sie bereute das Wort, welches sie gesprochen. Kleinmut? Verzagen in dem Enkel jenes Helden? fragte sie einlenkend. Wo wäre Preußens Größe, hätte er sich gebeugt unter der Last des Mißgeschickes? hätte er aufgehört zu kämpfen und zu hoffen?
Dem Mißgeschicke trotzen, ausharren im Vertrauen auf eigene Kraft, das ist Tugend! ich weiß es, teure Mutter. Schmach dulden, welche fremder Wille auf uns wälzt, ein entehrtes Dasein tragen, wäre Feigheit, entgegnete er, als laute Volksbewegungen auf der Straße Mutter und Sohn emporschreckten und an das Fenster riefen.
Dieselben Männer, welche vorhin den Palast des Grafen Haugwitz bedroht hatten, zogen zu der Wohnung des Grafen Hardenberg, ihm ein Vivat zu bringen, da er, der Verwaltung der Markgrafentümer durch die Besitznahme der Franzosen enthoben, nach Berlin zurückgekehrt war.
Und kein Lebe-hoch dem Könige! Sind wir denn nicht mehr in Preußen, in Berlin! sagte die Fürstin, indem sie bleich und kummervoll das Fenster am Arme ihres Sohnes wieder verließ.
Die Demonstrationen für den Grafen Hardenberg und gegen Haugwitz, deren zufälliger Zeuge der Prinz geworden, waren von den ihm feindlich Gesinnten benutzt worden, neue Verdächtigungen gegen ihn heraufzubeschwören, indem man ihn als Teilnehmer, ja, als Anstifter derselben nannte. Unter solchen Verhältnissen mußte in dem Prinzen der Wunsch, Berlin aufs neue verlassen zu können, natürlich entstehen. Er wünschte sich wieder einmal nach Schricke zurückzuziehen, um dort bis zu einer möglichen Aenderung der Dinge zu verweilen, aber man weigerte ihm die Erlaubnis dazu, ohne die Gründe dieser Weigerung anzugeben.
So begann das Jahr achtzehnhundertsechs noch trüber, als das vorherige geendet hatte. Jeder Lebensmut, jede Hoffnung einer besseren Zukunft schien die Umgangsfreunde des Prinzen verlassen zu haben, weil die Wetterwolken der nächsten Gegenwart den Blick in die Ferne verdüsterten. Daß Preußen trotz seiner Nachgiebigkeit zum Kampfe gezwungen werden würde, nahm man im Volke ebenso zuverlässig an, als man hier und da besorgte, daß dieser Kampf unglücklich enden müsse, weil Preußen jetzt fast allein sich der Macht Napoleons entgegenzustellen hatte, der die großen, vereinten Kräfte von Oesterreich und Rußland nicht zu trotzen vermocht.
Henriette, ganz gebrochen durch die Furcht vor diesem Kriege, durch den Gedanken an die Gefahren, denen der Prinz entgegenging, hatte nur stille Tränen und Klagen, so oft sie ihn sah. Rahels feste, männliche Ergebung in das Unvermeidliche, so erhebend sie war, wirkte dennoch niederbeugend auf den Prinzen, weil sie den Glauben an ein glückliches Ende entschieden auszuschließen schien. Pauline allein war schöner und heiterer als je, voll Lebensmut und Hoffnung.
Unbekümmert durch die schweren Schicksale des Vaterlandes, achtlos gegen die Gestaltung der Zustände um sie her, schien sie einer Welt anzugehören, die mit dem Erdentreiben nichts gemeinsam hatte. Ihr Frohsinn, ihre Liebesfreudigkeit legten sich wie ein goldener Vorhang zwischen den Schmerz und ihr Auge. Von der Zukunft, von dem bevorstehenden Kriege sah sie nichts als den heimkehrenden, sieggekrönten Geliebten, der von dem Danke seines Volkes hoch gepriesen ihr seine Lorbeeren zu Füßen legte, um in ihrer Freude, ihrer Liebe seinen höchsten Lohn zu finden.
Wenn Rahel diese Sinnesart unfaßbar für sich fand, Henriette sie Herzenskälte nannte und der Prinz sich selbst gestehen mußte, daß Pauline jeder ernsten Lebensauffassung vollkommen unfähig sei, so war und blieb sie ihm trotzdem ein Ausnahmswesen, der Gegenstand seiner nie verminderten Liebe und gerade jetzt seine Zuflucht und sein Trost.
Daß Pauline sich schmücken, ihm und anderen gefallen wollte, daß sie Vergnügungen suchte und zu genießen fähig war in einem Augenblicke allgemeiner Entmutigung, erfreute den Prinzen. Mochten die Wetterwolken sich immer drohender über dem Lande zusammenziehen, in Paulinens lachendem Antlitz fand er den Sonnenschein des Glückes, mochte die tiefste Niedergeschlagenheit sich der Gemüter bemächtigen, Pauline blieb heiter wie zuvor, und nur der Wunsch, das trübselige Berlin und die trübseligen Unglückspropheten zu verlassen, regte sich in ihr.
Laß uns nach Schricke gehen, bat sie den Prinzen oft, wo niemand uns von den Dingen erzählt, die Dich verstimmen. Dort bin ich Deine Welt, dort hast Du keinen Herrscher als mich, und kein Laut soll an Dein Ohr dringen, als die Worte meiner Liebe und die Erzählung meines Glückes. Wozu sich plagen, wo man nichts zu ändern vermag? Wozu leiden, wenn man die höchste Seligkeit genießen kann? Es ist Undank, schnöder Undank gegen die wunderschöne Welt, die sich für uns, für unser Glück bald aufs neue in die Pracht des Frühlings kleiden wird.
Endlich beim Beginn des Sommers ward es dem Prinzen möglich, Berlin zu verlassen und mit Pauline nach Schricke zu gehen. Es waren Jahre vergangen, seit er dies Gut zuletzt besuchte. Er malte es sich aus, wie die Arbeiten, welche er dort einst für die Verschönerung seines Besitzes hatte beginnen lassen, nun ausgeführt und vollendet sein würden. Er gedachte mit Lust manch friedlicher, in sich begnügter Tage, die er in jenem Schaffen für die Zukunft dort verlebt; er erwartete Freude und Beruhigung dort zu finden, weil er sich ihrer mehr als je bedürftig fühlte.
Aber kaum in Schricke angelangt, fand er statt der ersehnten Freude, nur Sorge und Not. Von all den Anordnungen, welche er einst im Glauben an eine ruhige Zukunft gemacht, war wenig vollzogen worden, von den Saaten, die er gestreut, kein Segen erwachsen. Die Durchmärsche der Heeresabteilungen hatten die Fortsetzung des Begonnenen, die Ausführung des Beabsichtigten gehindert. Die Felder waren nachlässig bestellt, die Herden nicht mehr vollzählig. Man scheute sich, Ersatz für dasjenige zu schaffen, was den Truppen geopfert worden, aus Furcht, es bald aufs neue hergeben zu müssen. Die Gebäude waren beschädigt, die Glashütte und die Ziegelei in Verfall, die dabei angestellt gewesenen Arbeiter ohne Erwerb. Die bloßen Vorboten des Krieges hatten hingereicht, die heitere Schönheit dieses Besitzes zu zerstören.
Der Amtsrat und seine Frau empfingen den Prinzen, der statt ihrer Nichte, Pauline mit sich brachte, ohne Freude mit kalter Unterwürfigkeit. Schon in den ersten Tagen wurden ihm große Rechnungen für Reparaturen und Neubauten vorgelegt, welche durch die Verwüstungen der Soldaten unerläßlich geworden waren. Von Schricke aus hatte Louis Ferdinand gehofft, seine Vermögensverhältnisse zu ordnen, seinen Kindern eine Zukunft in diesem Besitze zu gründen, und jetzt fand er ihn in einem Zustande, der nur neue Verlegenheit, aber keine Hilfe herbeiführen konnte.
Daß solche Dinge den Prinzen zu verstimmen, ihm Sorge zu machen im Stande waren, schien Pauline unbegreiflich.
Was ist denn an solch totem Hab und Gut gelegen, rief sie, wenn man mit dem liebsten Wesen zusammen sein kann! Hast Du kein Geld, so muß der König Dir welches geben, denn Du bist ein Prinz, und mußt leben können wie ein Prinz, und mich behältst Du immer. Wozu also die Sorgen.
Sie freute sich des Sommers, der Gärten, der Möglichkeit in einem Schlosse zu befehlen, der Selbständigkeit, mit welcher sie dem Prinzen trotz Wiesels Einwendungen gefolgt war, und vor allem des Alleinseins mit dem Geliebten. Stark und ausdauernd begleitete sie ihn von früh bis spät, bald gehend, bald reitend, auf seinen Wanderungen durch Flur und Wald, überall Schönheit und Anlaß zur Freude entdeckend.
So hatten sie einst einen weiten Weg durch die Felder gemacht, als es gegen den Abend hin dem Prinzen einfiel, den alten Klaus zu besuchen. Der Tag war regnerisch gewesen, noch hingen graue, schwere Wolken am Himmel, und die Wiesen dampften in der dämmrigen Schwüle ihre feuchten Nebel empor.
Das Häuschen des Alten hatte viel von seinem schmucken Ansehen verloren, die Tünche der Wände war abgefallen, die Fensterscheiben trübe und sonnenverbrannt, das Strohdach neuer Belegung bedürftig. Vor der Türe saß auf hölzernem Lehnstuhl der Alte, nur noch ein Schatten des einst so rüstigen Greises. Er war hinfällig und blind geworden.
Wer kommt da? fragte er bei dem Nahen der Schritte.
Ich bin es, Klaus! Prinz Louis! ich komme sehen, wie es steht und wo man helfen muß.
Ach Sie! gnädiger Herr! und Mamsell Jettchen auch?
Nein Klaus! Henriette ist mit den Kindern in Berlin, dies hier ist eine Dame aus der Nachbarschaft, antwortete der Prinz, mit einer Art von scheuer Befangenheit sich des Augenblickes erinnernd, in welchem dieser alte Schäfer den Bund seiner Liebe mit Henriette als einen heiligen gesegnet hatte.
Dem Alten schien eine Reihe von Gedanken plötzlich durch den Kopf zu gehen, und, wie sich besinnend, fragte er: Gnädiger Herr! wo ist denn die Amtmännin von Bernau geblieben, die damals fortgebracht worden ist?
Sie ist tot, sagte der Prinz tonlos.
Tot? wiederholte der Alte, solch' junge, starke Frau? –
Ihn abzubringen von Erörterungen, welche schon wegen Paulinens Gegenwart dem Prinzen drückend waren, erkundigte sich dieser, ob es dem Schäfer an nichts gebreche?
Gnädiger Herr! entgegnete der, am Augenlicht gebrichts mir und am Jungsein; da kann denn alles andere doch nicht helfen. Meinen Wasser, der alt und schwach geworden war, wie ich, hat ein Husarenpferd totgetreten; den Dompfaff hat ein Weibsbild, eine Marketenderin mitgenommen, und alles, was sie sonst brauchen konnte, auch. Nur mich haben sie sitzen gelassen, denn mich konnten sie nicht brauchen.
So hat Er Not gelitten seitdem, Klaus?
Das just nicht. Sie lassen es mir an nichts fehlen, schicken mir vom Schlosse Essen und Trinken um die rechte Zeit. Aber es ist doch alles nicht mein eigen, und ich kann mir nicht mehr selbst helfen, wie ein Mensch, sondern muß mich versorgen lassen, wie das liebe Vieh.
Er soll alles wiederhaben, Klaus! rief der Prinz, ich will Ihm ersetzen, was man Ihm genommen hat.
Auch den Wasser? auch den Dompfaff? und Augen und Kräfte? entgegnete der Alte kopfschüttelnd. Gnädiger Herr! lassen Sie es nur bewenden! Es muß eben sein! Wenn das Korn zum Schneiden reif ist, kann kein Mensch es mehr zum Grünen bringen. Es ist nur schlimm, wenns zu lange stehen bleibt, so daß es verkommt. Ich klage nicht mehr um meine Jungen, die jung gestorben sind. Es ist ein schlimm Ding ums Verkommen, und ist kein Rat dagegen, bis der da oben ruft.
Die Ruhe des Alten erschütterte die beiden Hörer und der Prinz fragte nochmals, ob er denn garnichts tun könne, was ihm erfreulich oder nützlich wäre.
Nein! garnichts! gnädiger Herr. Ich wünsche mir nichts, habe keinem ein Leid getan mit Wissen, und bin keinem Menschen etwas schuldig auf der Welt. Nun warte ich ab, was Gott schickt. Aber können Sie machen, daß der Bonaparte nicht ins Land kommt, daß der Feind uns nicht Haus und Hof verwüstet und unsere Saaten nicht zertritt, so tun Sie es, denn der Feind im Lande ist eine große Plage.
Jedes dieser Worte traf den Prinzen schwer. Als er fortgehen wollte, reichte er dem Greise die Hand, der sie herzhaft schüttelte.
Das ist Abschied! sagte der Alte. Ich bin alt, und Sie werden in den Krieg gehen. Der Krieg ist aber ein heißer Sommer! da reifen die Aehren, die am höchsten aufgeschossen sind am ehesten und fallen ab im Sonnenbrand. Es ist aber doch besser, als so langsam verwelken.
Nun, Klaus, verzage Er nicht! wir kommen noch zusammen, tröstete der Prinz.
Hier oder dort, gnädiger Herr! ergänzte Klaus, und fügte dann, als der Prinz sich schon zum Fortgehen abgewendet hatte, die Bitte hinzu, ihm den Johann, den Reitknecht, zu schicken, damit er ihm von Mamsell Jettchen und den Kindern erzählen könne.
Ernst und schweigend legte der Prinz den Heimweg zurück, selbst Pauline fand ihre gewohnte Leichtigkeit nicht wieder. Im Gartensaal des Schlosses angelangt, lehnte sie sich schweigend an seine Brust, das Haupt an ihn geschmiegt, in ernsten Gedanken. Der Prinz hielt sie still umfangen. Nach einer Weile hob sie das schöne Haupt empor, blickte ihn zärtlich an und fragte: Nicht wahr Louis! Du wirst glücklich sein?
Niemals Pauline!
Aber wenn wir siegen, wenn Du den Sieg erkämpfst?
So möchte ich einen Augenblick die volle Siegesfreude genießen und dann sterben.
Und das sagst Du mir? rief Pauline im Tone des tiefsten, schmerzlichsten Vorwurfs, mir? und jetzt? Wie klagen diese Worte mich an! Wäre ich das Weib gewesen, das Dein Herz ersehnte, ich hätte Dir das Leben wert gemacht, Du hättest es wieder lieben gelernt durch mich. Aber Du bedurftest eines Engels, und fandest in mir ein gesunkenes Weib.
Der Prinz betrachtete sie mit schmerzvoller Zärtlichkeit. Und wärst Du ein Engel gewesen, wärst Du das Ideal gewesen, das ich in Dir geliebt, sagte er, es war zu spät!
Er versank einen Augenblick in tiefes Hinbrüten. Dann sich langsam emporrichtend, fuhr er fort: Pauline! höre mich an, aber antworte mir nicht. So wie ich hier vor Dir stehe, in Kraft und Fülle der Jugend, bin ich doch nur einer glänzenden Frucht zu vergleichen, in deren Innern der Wurm der Zerstörung nistet. Kannst Du mir eine verschwendete Jugend wiedergeben? verschwendet in wilder Wüstheit, halb aus Lust, halb aus Verzweiflung? Kannst Du Henriettens Leiden aus meinem Leben tilgen, und Mathildens unglücklichen Schatten verscheuchen? Kannst Du mir den Glauben wiedergeben, den ich verloren an allem, was mir groß erschien? Den Glauben an mich selbst? Den Glauben an irgend etwas auf Erden? Denn auch Dich, fuhr er mit leidenschaftlicher, bewegter Stimme fort, auch Dich liebe ich, aber ich glaube nicht an Dich!
Louis! wehklagte Pauline.
Und was sagte der alte blinde Schäfer heute, der Greis am Rande des Grabes: ich habe das Meine getan auf der Welt, und bin niemandem etwas schuldig. – Und ich – ich? – Ich habe nichts getan von allem, was ich hätte tun, nichts von dem vollbracht, was ich vielleicht unter günstigeren Sternen hätte vollbringen können! Nichts! auch nicht die kleinste Tat. Und falle ich in dem bevorstehenden Kampfe, so wird mein Name von meinen Gläubigern verwünscht werden, deren Forderungen zu befriedigen eine Million nicht hinreicht.
Eine lange Pause entstand, aber es schien, als habe dies Aussprechen seiner Gedanken dem Prinzen die Seele befreit. Die nächsten Tage war er heiterer. Er freute sich des ungestörten Beisammenseins mit der Geliebten, traf mancherlei Anordnungen zum Besten seiner Gutsinsassen, und musizierte viel.
Jeder Fremde, der ihn in diesen Zuständen zum erstenmale gesehen hätte, würde ihn für zufrieden und in sich beruhigt angesprochen haben; Pauline aber und alle Personen seiner Umgebung fühlten sich beängstigt durch Züge nachgiebiger Weichheit und Stille, welche außer seinem Wesen lagen.
Ich wage nicht mehr, Dich zu umarmen wie sonst, sagte eines Tages Pauline, Du bist so ruhig geworden, so sanft, daß ich den Frieden in Dir durch meine Liebe zu stören fürchte.
Weißt Du nicht, daß nach den Regeln der Kunst, die grellsten Dissonanzen leise verklingen müssen vor dem Schlußakkord? antwortete er, indem er sie herzlich in seine Arme zog. Deine Schönheit, meine Pauline! soll die Göttin sein, welche mich die auflösenden Harmonien mild und richtig wählen lehrt.
Einige Wochen stillen Rastens waren dem Prinzen in Schricke gegönnt. Sie hatten ihn wesentlich erfrischt, als er nach Berlin zurückkehrte. Man fand ihn gesammelter, ernster als früher, und erwartete das Beste von seinem Mute, der sich jetzt mit ruhiger Besonnenheit zu paaren schien.
Die preußischen Heere standen schlagfertig, die Bildung einer Landwehr ward besprochen, aber es fehlte Geld zur Ausrüstung derselben, und man sah sich, trotz der vorhergehenden Friedensjahre, genötigt, zehn Millionen Schatzscheine auszugeben, was große Besorgnis erregen mußte, wenn man an die Möglichkeit eines längern Krieges dachte.
Indes noch immer pflog man Unterhandlungen, obschon Napoleon gar keine Rücksicht mehr darauf nahm, und Länder, welche er Preußen zuerkannt hatte, an England abzutreten gedachte. Es war im August, als man diese Treulosigkeit erfuhr, und einen neuen Gesandten nach Paris schickte, während fast zu derselben Zeit das ganze preußische Heer an sechs verschiedenen Stellen über die Elbe ging, als wolle man den Krieg beginnen, ohne ihn erklärt zu haben.
Dies Verfahren fand selbst in Deutschland allgemeinen Tadel, und bei dem Mißtrauen, welches die andern Staaten gegen Preußen hegten, benutzten es Hessen und Sachsen, sich von dem bisherigen Bunde mit Preußen loszusagen.
So rückten denn die letzteren ganz allein in das Feld. Was noch von Truppen in Berlin war, sollte in der Mitte des September dem Heere folgen. Die Stadt war totenstill, von Soldaten entblößt, durch eilig gebildete Bürgermilizen bewacht. Die unwahrscheinlichsten Gerüchte von dem Herannahen, von einem Ueberfalle der Franzosen, liefen umher und wurden geglaubt. Obschon das ganze preußische Heer noch in voller Stattlichkeit dastand, trugen Berlin und die Physiognomie des Volkes das Gepräge einer erlittenen Niederlage; ein schlimmes Zeichen! Denn ohne verständiges Selbstvertrauen wird die größte Kraft ein toter Besitz, mit dem nichts auszurichten möglich ist.
An einem frischen, sonnigen Septembermorgen folgte Prinz Louis seiner Heerabteilung. Er war bestimmt, die Vorhut des linken Flügels zu führen. Mit schwerem Herzen hatte er sich von Eltern und Geschwistern, von Henriette und von seinen Kindern getrennt. Noch spät in der Nacht war er zu Rahel gefahren. Er fand sie allein, seiner wartend, da er ihr sein Kommen gemeldet hatte.
Sie haben mich erschöpft mit ihren Tränen, sagte er, da wollte ich zu Ihnen kommen, Rahel, um mein Herz wieder fest zu machen. Das Leben tut recht weh!
Sehr weh! antwortete sie still.
Meine Kinder sind so schön und noch so jung! Es schmerzt mich zu denken, daß sie kein eignes Bild von mir behalten werden. Euch allen war ich etwas; viel oder wenig, doch stets so viel, als ich vermochte. Diesen Kindern, die ich so sehr geliebt habe, werde ich ein bleicher Schatten sein, und man wird ihnen mein Bild entstellen!
Er blickte sinnend vor sich nieder, dann nahm er Rahels Hand: Höre, Rahel! sagte er, Du sollst mir etwas schwören. Sie werden, wenn ich fallen sollte, viel von meinen Fehlern sprechen, meinen Lebenslauf tadeln, mein Andenken durch manchen Flecken zu entstellen wissen, denn ich habe Feinde, und sie brauchen nicht zu lügen, um mich anzuklagen. Versprich Du mir, Rahel! daß Du leben willst, mich zu vertreten, zu sagen: Ich habe Louis geliebt, denn obschon er fehlte und irrte, war sein Herz rein, sein Wille gut, und er strebte nach dem Besten. Willst Du mir das tun, Rahel? Willst Du meinen Kindern das Andenken ihres Vaters rein erhalten?
So wahr ich Sie liebe! sagte Rahel, und hob die dunkeln Augen mit ernstem Aufschlage zum Himmel empor.
Das ist ein großer Schwur, denn Du hast mich sehr geliebt, und ich danke Dir dafür. Deine Liebe war oft mein guter Genius im Leben; sie wird auch mein Vertreter nach dem Tode sein.
Sie lohnen mir wie ein Königssohn; ich will's verdienen! sagte Rahel fest.
Der Prinz erhob sich, umarmte sie, und sie schieden.
Nur die Trennung von Pauline stand ihm noch bevor, und mit Angst gedachte er an diese.
Am lichten Morgen, funkelnd im Waffenschmuck, ritt er vor ihr Haus. Er hatte sich auf jene Ausbrüche eines leidenschaftlichen Schmerzes gefaßt gemacht, welche Pauline eigen waren, und all seine Kraft in sich beschworen, diesen zu begegnen. Statt dessen fand er sie heiter, strahlend im vollen Glanze ihrer Schönheit, zur Reise gekleidet, und einen Reisewagen vor ihrer Türe.
Kommst Du mich holen? fragte sie, denn Du hast doch nicht geglaubt, daß ich Dich jetzt verlassen würde?
Beglückt durch ihren Anblick, wie durch ihren unerwarteten Entschluß, mußte der Prinz ihr dennoch weigern, sie mit sich zu nehmen, um dem Heere nicht ein solches Beispiel zu geben.
Aber Pauline wollte davon nichts wissen. Sie erbot sich in Männerkleidern zu folgen, beteuerte, allen Anstrengungen gewachsen zu sein, und sagte: Du nennst mich Dein Glück, Deinen guten Stern! Du sagst, ich sei Dir das Bild des Lebens! willst Du Glück und Leben von Dir stoßen, die sich Dir darbieten in vollster Freudigkeit? Soll Dein guter Stern nicht bei Dir sein, wenn das Gestirn des Sieges nun endlich an Deinem Himmel aufgehen wird? Muß ich es denn nicht sein, die Dich zuerst erblickt, wenn Du heimkehrst als Sieger aus der gewonnenen Schlacht?
Einen Augenblick schwankte der Prinz, aber das Gefühl seiner Pflicht trug den Sieg davon. Mit stürmischem Schmerze trennte er sich von Pauline, die er fast sinnlos zurückließ, und nur durch Versprechen zu besänftigen vermochte, daß sie ihm folgen solle, daß er sie selbst rufen werde, und seinem Herzen zu genügen, rufen müsse, sobald sich Aussicht zu längerem Verweilen an irgend einem Ruhepunkte bieten sollte.
So waren für den Augenblick alle Bande gelöst, und der Prinz fühlte sich freier als seit Jahren, da er jetzt bestimmte Pflichten und ein festes Ziel vor Augen hatte.
Wenige Tage nachdem er Berlin verlassen hatte, gingen auch die verschiedenen Hofstaaten fort, und das Königspaar begab sich nach Naumburg, wohin man das Hauptquartier verlegte. Diese Abreise ward das Zeichen zu einem allgemeinen Aufbruche. Man glaubte sich nicht mehr sicher in der Mark, und viele wohlhabende Familien flüchteten nach Dresden, Prag oder Wien.
Rahel hatte anfangs beschlossen in Berlin zu verweilen, aber die Stimmung der Hauptstadt war so niederdrückend, daß sie, selbst der Erhebung bedürftig, es wie eine Notwendigkeit empfand, sich diesen Eindrücken zu entziehen. Seit Jahren hatte Gentz oftmals den Wunsch ausgesprochen, Rahel wiederzusehen, immer hatten dazwischentretende Ereignisse es gehindert. In diesem Augenblicke war er von Wien aus mit geheimen Aufträgen nach Dresden gesendet, und da er ihre Absicht erfuhr, Berlin zu verlassen, erlangte er es leicht, daß sie Dresden zu ihrem Aufenthalte wählte. Dort fanden sie sich nach einer fünfjährigen Trennung endlich wieder.
Rahel und Gentz hatten sich beide, wie es bei so stark ausgeprägten Naturen zu erwarten gewesen war, nicht wesentlich verändert. Nur schärfer, nur entschiedener noch als früher machten sich ihre Eigentümlichkeiten geltend. Nach jenen ersten, stummen, erschütternden Augenblicken des Wiedersehens, deren die Seele immer bedarf, um in sich gewiß zu werden, daß die Trennung vorüber, und der Entfernte aus dem Schattenreiche der Erinnerung in die Wirklichkeit getreten sei, schien es beiden, als hätten sie immer neben einander gelebt, und doch war eine so reich bewegte Zeit an ihnen vorübergegangen, daß es des Mitteilens und Erzählens kein Ende werden konnte.
Gentz fragte nach Frau von Grotthuß, nach der Unzelmann, die beide noch in den früheren Verhältnissen und in gewohnter Weise lebten. Er war vor wenig Wochen dem Grafen Tilly auf einer Reise begegnet, denn Tilly hatte Berlin vor einem Jahre in Folge eines Liebesabenteuers verlassen, welches mit dem Selbstmorde der von ihm verführten Frau geendet hatte. Er erzählte, daß Schlegel und Dorothea am Rheine lebten, und forderte von Rahel Auskunft über Wiesel, über Vetter.
Wiesel ist schlecht geworden, sagte sie, um auch an sich selbst seine Theorie durch die Praxis zu beweisen; aber es ging langsam damit, denn er hat wie viele Menschen, mehr Konsequenz im Denken, als im Handeln. Sein früherer Freund Vetter ist des Lasters überdrüssig, das er haßt, ohne deshalb die Tugend zu lieben. So langweilt er sich, wie Herkules auf seinem Scheidewege, und wird ewig auf dem Scheidewege stehen bleiben.
Und Pauline? Wie ist Pauline?
Pauline ist das Ideal des Weibes, das Ihr Männer erstrebt und verdient. Nichts durch sich selbst als schön und heiter, alles andere von dem Manne empfangend, der sie liebt, angebetet wie sein Spiegelbild, sein anderes Ich. Ihr letzter Liebhaber wird über sie entscheiden. Was dieser sein wird, wird sie bleiben!
Engel! himmlischer Dämon! rief Gentz, Rahels Hände ergreifend und mit ausgelassener Zärtlichkeit küssend. Wer urteilt denn so göttlich boshaft und so kindlich wahr über die Menschen, als Sie! Haben Sie einen Zauberspiegel? – dann sagen Sie mir, wie und was bin ich geworden?
Was Sie versprachen und wollten! sagte sie mit Nachdruck.
Ja, Rahel! so ists! rief Gentz. Ich habe mir Wort gehalten und revoltiert auf meine Weise. Ich bin geadelt, bin Hofrat, habe Geld, lebe ungeheuer gut, besitze ein Landhaus, die schönsten Möbel, halte zwei Kammerdiener, einen Koch, und habe Einfluß – Einfluß nach allen vier Himmelsgegenden der Welt.
Rahel lachte, weil Gentz mit wahrhaft kindlicher Lust sich dieser äußern Erwerbnisse seines so bedeutenden Lebens zu erfreuen vermochte. Er berichtete ihr von seinen Verbindungen, stellte ihr seine Ansicht über die jetzigen Zustände dar, und wußte, während er sie durch die Klarheit seines Geistes entzückte, sie doch in jedem Augenblicke fühlen zu lassen, wie ihm dies alles nur Mittel zum Zwecke wären.
Ich halte darauf, daß die große politische Maschine, in der die Welt verarbeitet wird, möglichst gut im Stande bleibe, sagte er; denn fängt sie zu rosten an, oder gerät sie ins Stocken, so kann der einzelne vor dem infamen Spektakel nicht mehr ein Auge ruhig zu machen. Ich arbeite für alle, um meines Komforts willen.
Plötzlich unterbrach er sich. Wir sprechen von der Welt, von mir, von unseren Freunden, und Sie sagen mir nichts von sich, Rahel! Wie geht es Ihnen? Haben Sie sich innerlich beruhigt? Lernen Sie allmählich die Welt genießen, nur das Mögliche verlangen? Haben Sie Lust bekommen, auch einmal glücklich zu werden?
Sehe ich denn aus wie jemand, der dazu Talent hat? entgegnete Rahel. Nein Gentz! ich werde nie glücklich sein, aber ich werde ein Schicksal haben, und das ist eine Auszeichnung; denn die meisten Menschen haben nur Erlebnisse. Ich werde für andere leben, wie die andern für sich selbst.
Es entstand eine Pause, dann bemerkte Gentz, gleichsam als Schluß einer Gedankenreihe: Prinz Louis ist nun beim Heere. Diese Ereignisse könnten ihn retten, wenn –
Ein Diener in der Livree von Gentz, mit einem Schreiben eintretend, unterbrach seine Worte. Er meldete, die Depesche sei von einem Kurier überbracht, der die Antwort zurücknehmen solle. Gentz öffnete das Blatt und war sichtlich auf angenehme Weise davon überrascht.
Sieh' da! rief er, gegen Rahel gewendet, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden! Es gab eine Zeit, in welcher Seine Excellenz der Graf von Haugwitz, sehr vornehm vorübergingen durch die Antichambre, wenn der Kriegsrat Gentz die ihm zustehende Beförderung demütig forderte!
Und jetzt? was geht jetzt vor sich, Gentz?
Lesen Sie! antwortete er, indem er ihr mit zufriedenem Lächeln das Schreiben hinhielt.
Es war aus dem Hauptquartiere von der eigenen Hand des Grafen Haugwitz geschrieben. In den verbindlichsten Ausdrücken forderte er Gentz auf, sich dorthin zu verfügen, um seinem Vaterlande einen wesentlichen Dienst zu leisten. Man wolle die Kriegserklärung durch ein Manifest begründen, und wünsche sowohl für dieses, als über die österreichischen Zustände und die Möglichkeit einer Vereinigung mit dieser Macht, die Ansicht des Hofrat von Gentz zu vernehmen.
Rahel blickte ihn lange an. Da sie schwieg, fragte er sie, weshalb sie ihn betrachte.
Ich will mir das Bild eines Menschen einprägen, dem es gelingt, sein Ziel zu erreichen, sagte sie. Solche Menschen sind selten auf dieser Erde. Ihr Märchen von den Thronen, die Sie stützen, ist schnell zur Wahrheit geworden!
Gentz gab ihr die Hand; er war ernst geworden. Denken Sie der Stunde und des Märchens noch? Ich habe jenen Tag nicht vergessen, Rahel! Das Märchen zur Wahrheit machen, war meine Aufgabe – ich habe sie vollführt. Aber die Wünsche, welche ich damals hegte, die Bitte, welche ich Ihnen damals aussprach, zu erfüllen, das lag in Ihrer Hand. Wollen Sie mir am Ziele gewähren, was Sie mir beim Beginn meines Weges verweigerten?
Ich kann es nicht, Gentz! obschon ich wollte, daß ichs könnte.
So muß das wahrgewordene Märchen mich denn trösten! sagte Gentz, und stand von seinem Platze auf, sich gewaltsam fassend. Ich gehe noch diese Nacht nach Naumburg; denn ich habe die wunderliche Phantasie, dies Preußen, das mich schlecht behandelte, zu lieben, weil es mich doch werden sah. Ich reise gleich! Was soll ich dem Prinzen sagen, wenn ich ihm begegne?
Lehren Sie ihn leben, denn Sie allein verstehen es von uns allen, dieser Welt froh zu werden.
Während Rahel und Gentz in Dresden dieses flüchtigen Beisammenseins genossen, und der letztere seine Reise nach Naumburg antrat, befand sich Prinz Louis Ferdinand in Jena, dem Standquartiere des Fürsten Hohenlohe, welcher zu einem Kriegsrat in das Hauptquartier berufen worden war. Der Prinz, als ältester General dieser Abteilung, hatte den Fürsten zu vertreten.
Der Marsch und das bewegte Leben waren ihm zusagend gewesen. Ich fühle mich frei und leicht, hatte er zu seinem Adjutanten gesagt, da ich endlich einmal nur unter Männern lebe. Die Weiber haben mich zu lange beherrscht und gequält.
Mit großer Leichtigkeit ertrug er die Beschwerde des Dienstes, ohne eine Bequemlichkeit für sich zu beanspruchen, welche den andern versagt war. Außer seinem Kammerdiener und Reitknechte begleitete ihn nur Dussek. An jedem Orte, an welchem man längere Zeit verweilte, ward ein Instrument herbeigeschafft, und der Prinz sprach oftmals aus, wie die Musik das einzige, das ihm beständigste Gut des Lebens gewesen sei.
So war man nach Leipzig gelangt, und Prinz Louis Ferdinand war dort mit dem Generale Blücher zusammengetroffen, der bedeutend älter als jener, und schon mit kriegerischen Ehren geschmückt, dennoch grade in seinem eigenen leidenschaftlichen und rücksichtslosen Charakter den Maßstab zur Würdigung des Prinzen besaß.
Kühnem Wagen geneigt in der Stunde der Gefahr, der eigenen Kraft vertrauend und dem eigenen Scharfblicke, mußte ihm wie dem Prinzen, das lange Zögern und Beraten, das Ueberlegen und Verwerfen besonders widerwärtig werden, welches im Hauptquartiere herrschte.
Der Angriffsplan der nächsten Tage bot den Gegenstand des Gespräches, als die beiden Männer zusammen saßen: der eine in aller Schöne der Jugend, der andere in der reifen Kraft nerviger Männlichkeit. Weinflaschen standen zwischen ihnen auf dem Tische, auf welchem der Prinz die Terrain-Karten entfaltete, und den Angriffsplan des Fürsten Hohenlohe zu erklären versuchte.
General Blücher hörte aufmerksam zu. Er hatte den Kopf auf den linken Arm gestützt, die blitzend grauen Augen unter buschigen Brauen, sahen klug über der starken Habichtsnase hervor. Während er den langen Schnurrbart langsam durch die Finger der rechten Hand zog und bald den Kopf verneinend schüttelte, bald zustimmend neigte, lächelte er plötzlich, als der Prinz einen andern Plan Hohenlohes entwickelnd, mit den Worten begann: wenn Napoleon den Weg einschlägt, welchen der Fürst erwartet –
So ist er ein Esel! rief Blücher dazwischen. Haltens zu Gnaden, Hoheit! es ist lauter dummes Zeug mit den Wenns! Diese Feldherren von Wenn und Aber, wie der Hohenlohe und der Braunschweig, die meinen, sie hätten Ihresgleichen vor sich an dem Bonaparte. Aber der Bonaparte denkt den Teufel an Vauban und die andern alten Scharteken, aus denen jene ihre Weisheit holten, denn er fabriziert sich seine Schlachten selbst. Und da denke ich, der beste Plan wäre –
Welcher, lieber Blücher! Welcher? fragte der Prinz.
Ich denke, kommt der Bonaparte bei Weimar zum Vorschein, so müssen wir ihn bei Weimar schlagen, und kommt er nach Naumburg, so schlagen wir ihn bei Naumburg. Denn daß wir ihn schlagen, das ist die Hauptsache; das Wie und Wo, das wird er uns schon bestellen.
Und werden wir es können, General?
Können? Wir müssens können, Prinz! Sie haben uns verdammt tief hineingeritten mit ihren Kongressen und Schreibereien; aber wir wollen uns schon heraushauen mit unsern Säbeln, denn Preußen soll und muß wieder glorreich dastehen, oder ich will nicht leben.
Die Hand darauf! rief der Prinz, wir fallen mit dem Vaterlande!
Hand und Wort darauf! wiederholte Blücher mit feierlichem Ernste.
Beide schwiegen dann, bis nach einer Weile Blücher bemerkte: Wollen doch aber erst recht ernstlich zusehen, ob nicht zu helfen ist, denn zum Untergehen kommt man immer zu früh, so lang es noch Weiber, Wein und Karten gibt.
Er lachte bei diesen Worten mit schallender Stimme, trank schnell sein Glas aus, und fing gleich wieder an, die Vorgänge zu besprechen, welche allen in diesem Augenblicke am meisten am Herzen lagen.
Die Frische, die Derbheit Blüchers hatten den Prinzen belebt, und heiterer als seit langer Zeit, ja selbst mit dem Glauben an die Möglichkeit einer glücklicheren Zukunft, war Louis Ferdinand nach Jena gegangen, die Wiederkehr des Fürsten Hohenlohe abzuwarten, um nach derselben sich zu seiner Heeresabteilung zu begeben, welche das Saaletal besetzt hielt.
In Naumburg aber, wohin Gentz beschieden worden, herrschte die bunteste Verwirrung. Der König und die Königin, sämtliche Heerführer und Minister, mehrere Prinzen und Diplomaten befanden sich dort, und waren in dem kleinen Orte, so gut es tunlich gewesen, untergebracht worden.
Kaum war Graf Haugwitz benachrichtigt, daß Gentz angelangt sei, so ließ er ihn gleich ersuchen, zu ihm zu kommen.
Die Gewalt der Zeitumstände hatte das Aeußere des Ministers gealtert, aber seine Neigung, sich würdig und in einem bestimmten Charakter darzustellen, nicht gemindert. Wie er einst als Freund ländlicher Freuden, im Kreise der Seinen mit Bewußtsein die Rolle des Cincinnatus durchgeführt, um seiner inneren Vorstellung ein äußeres Genüge zu tun, so war er heute ganz und gar ein Regulus, ein edler verkannter Staatsmann, ein antiker Bürger.
Mit Würde und Herzlichkeit trat er dem Ankommenden entgegen. Seit wir uns in Wien zuletzt gesehen haben, hat sich manches ereignet, sagte er. Ich weiß, daß man, daß Sie nicht ganz zufrieden mit mir gewesen sind; das wird sich ändern, sobald Sie die Sachlage kennen. Keines Falles sollen Sie Ursache haben zu bedauern, in dieser interessanten Krisis hergekommen zu sein. Der Federkrieg hat bereits begonnen – es wird nicht lange währen, so donnern die Kanonen, denn eben ist die Nachricht eingetroffen, daß Napoleon in Würzburg angekommen sei.
Aber ehe es noch zu den weiteren Aufklärungen kommen konnte, welche der Minister zu geben versprochen hatte, ward er in das Konseil zum Könige berufen. Dadurch gewann Gentz Zeit, seine übrigen Bekannten aufzusuchen und sich zu überzeugen, wie wenig Zuversicht die Verständigen und Wohlunterrichteten zu dem glücklichen Ausgang dieses Unternehmens hegten.
Die Unfähigkeit der Feldmarschälle, des Herzogs von Braunschweig und des Fürsten von Hohenlohe, war für alle Generale ein Gegenstand ängstlicher Besorgnis, welche durch die Tüchtigkeit der Unterbefehlshaber wie Blücher, Kalkreuth, Rüchel nicht aufgehoben werden konnte; denn diese letzteren waren abhängig von den Anordnungen ihrer Chefs und hatten höchstens die Freiheit, begangene Fehler möglichst zu verbessern.
In den Ministerien sah es nicht günstiger aus. Die Minister schützten überall ausdrückliche höchste Befehle, die Untergebenen Anordnungen der Minister vor, welche man zu tadeln nicht versäumte.
Gentz hatte von seinen früheren Verhältnissen in Berlin her zahlreiche Bekannte unter den Offizieren; er wurde mit Freuden begrüßt, wo er sich blicken ließ. Seine ruhige Klarheit, seine Bestimmtheit in Geschäftsangelegenheiten mußten allen willkommen sein, die, auf dem Punkte, ihr Leben für eine heilige Sache zu wagen, immerfort durch Gerüchte und Halbheiten über den Stand derselben getäuscht wurden.
Selbst die Königin schien von dem beängstigenden Gefühle, welches diese Ungewißheit verbreitete, berührt zu sein, und verlangte Gentz zu sprechen, der ihr vorgestellt werden sollte, als das Andringen Napoleons eine Verlegung des Hauptquartiers nach Erfurt nötig machte, wohin man Gentz zu folgen einlud.
Der Weg nach Erfurt wurde über Auerstädt eingeschlagen; der Zug dahin bot eines der feierlichsten Schauspiele dar. Umgeben von seinen Truppen, von Kanonen und Geschützwagen umringt, fuhr das königliche Paar in einem geschlossenen Wagen über die Höhen von Kösen einer Schlacht entgegen, von deren Entscheidung seine Zukunft und die Zukunft eines Volkes abhing.
Es war in den Frühstunden des vierten Oktobers, als Gentz auf der Brücke bei Kösen stand, und die Regimenter defilieren, das Königspaar vorüberfahren sah. Seine ganze Vergangenheit, sein inneres Leben entfalteten sich vor seinem Auge, und mit dem freudigen Bewußtsein, welches durch festes Wollen immer erzeugt wird, durfte er sich sagen, daß er erreicht habe, was er erstrebte, den Gebrauch seiner geistigen Kräfte auf eine ihm zusagende Weise. Seine Stellung war so einzig, wie seine Begabung; sein Einfluß so bedeutend, daß seine, des Privatmannes Meinung, den Ausschlag gebend, in die Schale gelegt wurde, welche über das Schicksal ganzer Nationen entschied. Aber in dies Gefühl des Triumphes, das jeder am errungenen Ziele empfindet, mischten sich ein Gefühl der Verantwortlichkeit und eine Besorgnis für die nächste Zukunft, welche um so schwerer wurden, je klarer er alle Zustände zu übersehen vermochte.
In Erfurt begannen die Arbeiten und Konferenzen gleich wieder, welche man in Naumburg unterbrochen hatte. Hier sprach Gentz die Königin, hierher brachte ein Adjutant des Herzogs von Weimar die ersten zuverlässigen Nachrichten über die Bewegungen der Franzosen, welche ihre frühere Stellung in der Umgegend von Würzburg verlassen hatten, um ihre gesamten Kräfte bei Bamberg zusammenzuziehen.
Gleich nach dem Empfang dieser Nachricht erhielten alle bei Gotha und Eisenach stehenden preußischen Truppen den Befehl, sich nach der Saale zu begeben, da man in dieser Gegend den Angriff erwarten mußte.
Fern vom Hauptquartier verzehrte Prinz Louis Ferdinand sich indessen vor brennender Ungeduld, während er dem Augenblick der Entscheidung entgegenharrte.
Jenas Mauern erschienen ihm wie ein Kerker, dessen Enge ihn erdrückte. Vergebens nahm er zu seinen Feldzugsplänen und Terrainkarten, zu Büchern und zum Flügel seine Zuflucht. Es vermochte nichts, ihn dauernd zu fesseln. Tagsüber sah man ihn auf den Straßen die Truppen mustern, die einzelnen Feldstücke untersuchen, und mit Offizieren verkehren. Es war ihm, als müsse er den andern seinen Mut, seine Lebensverachtung und seine Todesfreudigkeit in die Seele hauchen, um sie würdig vorzubereiten für den großen Tag des Kampfes.
In lebhafter Unruhe ging er abends mit seinem Adjutanten und einigen Offizieren auf dem Markte umher, die Ankunft eines Kuriers erwartend. Je länger dieser ausblieb, mit um so schnelleren Schritten fing der Prinz an, den Marktraum zu durchmessen, bis endlich sein Adjutant, Graf Nostitz, ein Liebling des Prinzen, leise gegen einen Kameraden bemerkte, solche Unruhe bringe den Kurier nicht um eine Minute früher nach Jena und der Prinz reibe seine Kräfte durch die Ungeduld nur nutzlos auf.
Aber so wenig diese Worte für das Ohr Louis Ferdinands berechnet waren, hatten sie es doch erreicht. Sie haben geliebt, fragte er plötzlich, und haben gespielt, nicht wahr, Nostiz?
Wer hätte das nicht getan, Hoheit?
Sie haben geliebt und gespielt, wiederholte der Prinz, und wundern sich über die fieberheiße Glut der Erwartung, über die bebende Spannung vor dem Augenblick der Entscheidung? Ich habe diesen Kampf ersehnt, wie die Umarmung des geliebtesten Weibes; das Schicksal wirft seine Würfel über unsere Zukunft, und Sie wundern sich, daß die Sekunden sich mir in Jahre verkehren?
Ein Posthorn erschallte, alles fuhr empor, aber es war nicht der ersehnte Kurier, sondern der französische Gesandte Laforest, welcher nach Erfurt ging. Zwei Wagen voll Franzosen begleiteten ihn, und blieben zurück, während er nur die Pferde wechselte, um sein Ziel zu erreichen.
Diese Spannung verwirrt meine Gedanken! rief der Prinz. Ich begreife es, wie man wahnsinnig wird, wenn die Seelenkräfte sich zu gewaltsam auf einen Punkt richten. Sprechen Sie von etwas anderm, geben Sie mir einen andern Gedanken, als den an diese alten Zöpfe, die im Hauptquartier sitzen, und weil ihre Zeit vorüber ist, die Zeit verpassen. Lassen Sie uns etwas vornehmen, irgend etwas!
Aber es braucht nur einer so gewaltsamen Aufforderung zu einer Zerstreuung, um jede Möglichkeit derselben zu vernichten, um alle Anwesenden zu lähmen. Niemand wußte etwas anderes, als die gleichgültigsten Dinge vorzuschlagen, keine Unterhaltung wollte Wurzel fassen und gedeihen.
Da fiel des Prinzen Auge auf das Schild eines Weinhauses. Die starke Bewegung hatte ihn durstig gemacht, und plötzlich rief er: Lassen Sie uns hineingehen, lassen Sie uns trinken. Vielleicht verkürzt das die Stunden; und holen Sie Dussek herüber.
Es mochten gegen zwanzig Offiziere in dem Lokale anwesend sein. Sie hatten sich den großen Saal öffnen lassen, und saßen hier beim vollsten Zechen, als der Prinz mit seinen Begleitern eintrat.
Man wollte aufstehen, ihm den Saal überlassen, er litt es nicht.
Wir sind nicht auf der Parade, meine Herren! wer zuerst kommt, hat das Terrain. Bleiben Sie; aber rücken Sie zusammen, daß wir unterkommen können, sagte er.
Es geschah, man ließ sich nieder, die Champagnerflaschen wurden gebracht, die Korke knallten, und von den Lippen der jungen Krieger ertönten abwechselnd zärtliche und kriegerische Toaste. Ein altes Klavier, das sich im Saale befand, wurde bald geöffnet, Dussek machte es möglich, selbst den halbverstimmten Saiten noch Wohllaut zu entlocken.
Wunderbar, sagte der Prinz, daß ich trotz dieses Lachens und Lärmens die Sekundenschläge der Uhr höre, daß ich nichts empfinde, als die Dauer der Zeit. – Dussek! spiele uns keine sanften Lieder, spiele uns Schlachtendonner, präludiere uns die Musik der nächsten Tage.
Dussek tat es. Er spielte die beliebtesten Kriegslieder, er variierte sie, und alle Anwesenden stimmten bald ein. Inzwischen schlug die Uhr die achte Abendstunde.
Um drei Uhr konnte der Kurier hier sein! rief der Prinz, von Wein und Ungeduld mehr und mehr erhitzt. Aber sie werden zu keinem Entschlusse gelangen, sie werden am Spiegel stehen, sich die Perrücken kleistern und die Gamaschen knöpfen lassen, bis Bonaparte sie an den Zöpfen haben und zausen wird, daß ihnen das Paradereglement vergeht. Ich verfluche die alte Zeit, das ganze alte verzopfte Wesen, das uns zu Grunde richtet. Pereant die Zöpfe! alle Zöpfe!
Die Offiziere stimmten jubelnd mit ein.
Herunter mit ihnen, wer es ehrlich meint! rief der Prinz.
Vor diesem Vorschlage, der dem Prinzen Ernst zu sein schien, erschraken die Offiziere wie vor einem Verbrechen. Man tat, als ob es ein Scherz gewesen sei; das entflammte den Prinzen noch mehr.
Komm Du her, Dussek! rief er, der Du der einzige Freie bist unter uns, und sieh nun selbst, wie sie uns an dem chinesischen Schwanze halten, der uns verdiente Nackenschläge gibt. Komme Du her, und wie Du brav auf Deine Tasten loszuhauen pflegtest, so haue mir mit einem ehrlichen Hiebe den Zopf herunter. Du hast doch kein Bedenken?
Nicht das geringste! lachte Dussek, auf Erden wächst er wieder, wenns sein muß; zu einem Liebespfande bleibt genug Haar auf dem Kopfe, und jenseits läßt St. Peter die Frommen wohl auch ohne Zopf herein.
Nun denn frisch! sagte der Prinz, zog den Degen, kniete vor einem Seitentische nieder, legte den wohlgebundenen Zopf darauf und Dussek, sich von seinem Sitze erhebend und die Manschetten von den fetten weißen Händen zurückschlagend, hieb mit einem Schlage den Zopf des Prinzen herunter.
Ein allgemeines Lachen erscholl. Aber als der Prinz ausrief: Pereat! den alten Zöpfen und der ganzen miserablen Vergangenheit, Vivat eine glorreiche Zukunft! Da stürzte Alt und Jung in der Versammlung herbei, und in wenig Minuten lagen alle Zöpfe wie Leichen starr und steif nebeneinander.
Ein unermeßlicher Jubel, eine ausgelassene Lustigkeit begannen. Plötzlich jedoch verstummte der Prinz. Seine Blicke hefteten sich starr auf eine Glastüre, welche in ein Nebenzimmer führte, seine Wangen erbleichten, und in bebendem Zorn schienen sich seine Lippen zusammen zu pressen.
Was haben Sie, Hoheit! fragte Dussek erschrocken.
Der Prinz fuhr mit der Hand über die Augen, blickte nochmals hin, es war niemand zu sehen. Wunderbar! sprach er, ich hätte gewettet, daß Er es wäre!
Wer denn?
O! laßt es nur, es war ein Bild meiner überreizten Phantasie!
Aber die Stimmung des Prinzen hatte ihren Schwung verloren; er brach bald auf, und noch im Fortgehen beauftragte er seinen Adjutanten, zu fragen, wer in dem Nebenzimmer gewesen sei.
Man erfuhr, daß es die Franzosen waren, welche Laforest hier zurückgelassen hatte.
In seiner Wohnung angelangt, überreichte François dem Prinzen einen Brief Paulinens. Ihr ganzes Wesen war darin ausgesprochen, der Prinz las ihn wieder und wieder, und setzte sich sogleich hin, ihr zu antworten.
Als er dann spät sein Lager suchte, kam François wie immer, ihn zu entkleiden. Es sind Franzosen angekommen, Hoheit! sagte er, die hier ausruhen; gegen Morgen wollen sie ihre Route kontinuieren.
Ich weiß es.
C'est étrange, fuhr der Alte fort, wie in diesem siècle die Schicksale der Leute wechseln. Ce Monsieur de Heldrich, der vor Jahren im Palais mit Oehrdorf connaissance gemacht hatte und dort umherspionierte, ist mit dabei. Er trägt die Offiziersuniform der Chevaux légers, aber er hat sich einen anderen Namen gegeben. Sie nennen ihn, Monsieur … Monsieur … der Alte suchte vergebens den Namen, der seinem Gedächtnisse entschwunden war.
Was tut der Name! sagen Sie mir, wo ich den Leutnant finde, rief der Prinz mit Lebhaftigkeit, den Alten unterbrechend. Ich muß ihn sprechen, und sogleich!
François warf dem Prinzen die Kleider wieder über und schickte sich an, den Verlangten aufzusuchen, als plötzlich sich ein Posthorn hören ließ. Ein Wagen hielt vor dem Hause. Der Prinz wähnte, es sei der Kurier, aber statt des erwarteten Kuriers trat der Fürst von Hohenlohe selbst ein, dem Prinzen die Mitteilungen zu machen, deren er bedurfte.
Ihre Unterredung währte zwei volle Stunden. Als der Fürst den Prinzen verließ, gab dieser Befehl zum Aufbruch; indes die Hoffnung, welche seit dem Zusammentreffen mit Blücher über ihn gekommen war, hatte einer tiefen Niedergeschlagenheit Platz gemacht.
Während man packte und die Pferde sattelte, verlangte Louis Ferdinand nochmals, man solle Heldrich suchen, und sendete François zu diesem Zwecke ab, der bald darauf mit dem Bescheid zurückkehrte, der General, in dessen Begleitung sich Herr von Heldrich befunden, habe während der Unterredung des Prinzen mit dem Fürsten Jena verlassen und der Leutnant ihm folgen müssen. Ein Billet des letzteren ward dem Prinzen gebracht.
Mein neues Vaterland hat mir mit seinem Degen die Ehre wiedergegeben, welche Ew. Hoheit einst zu zerstören so eifrig waren; dafür gehört ihm mein Leben. Ich darf mir nicht erlauben, es im persönlichen Streite am Vorabend einer Schlacht für eine persönliche Sache einzusetzen. Vielleicht treffen wir uns auf dem Schlachtfelde – wo nicht, stehe ich Ew. Hoheit nach dem Kampfe zu Befehl.
Es war die Nacht vor dem achten Oktober, als der Prinz mit seinem Stabe Jena verließ, um nach Rudolstadt zu gehen. Seine Vorschrift lautete, sich womöglich in kein Gefecht einzulassen, wenn der Feind anrücke, sondern sich auf die Division des Generals von Grawert zurückzuziehen, welche vor Orlamünde stand.
Bei seinen Truppen eingetroffen, mußte der Prinz jedoch abermals sechsunddreißig Stunden in tatenlosem Harren verweilen, obschon sich bereits feindliche Pikets an verschiedenen Punkten gezeigt hatten. Endlich am Abend des neunten Oktober langte die Botschaft an, daß die Franzosen mit ganzer Macht heranzurücken schienen.
Seit Jahren hatte der Prinz die Stunde dieses Kampfes wie eine Befreiung, seit Monaten wie eine Erlösung betrachtet. Sich jetzt noch vor dem Feinde zurückzuziehen, kam ihm so unmöglich als unwürdig vor. Die Pläne, welche Fürst Hohenlohe ihm vorgelegt hatte, versprachen geringen Erfolg und waren weder klar noch bestimmt. Bei dem fortdauernden Unterhandeln und Parlamentieren, bei der geringen Zuversicht, welche man im Hauptquartier für den glücklichen Ausgang des Krieges hegte, fürchtete er, dieser werde auch jetzt nicht begonnen werden, man werde sich zu neuen Zugeständnissen an Frankreich hergeben, neue Demütigungen auf Preußen laden, wenn er selbst nicht einen unwiederbringlich entscheidenden Schritt tue.
Er wußte, daß auch die Königin den Krieg für unerläßlich halte, er gedachte des Versprechens, das er ihr einst gegeben hatte, und glaubte sich, als ein Prinz von Preußen, um so mehr berechtigt und berufen, endlich selbsthandelnd die Sache des Vaterlandes zu vertreten, je weniger die eigentlichen Feldherrn dazu befähigt schienen.
In diesem Sinne schrieb er dem Prinzen von Hohenlohe, wie er es dringend notwendig halte, zu einer kraftvollen Offensive überzugehen. Nur diese allein sei dem Geiste der Zeit, der Armee und dem Drange der Umstände angemessen, während längeres Zaudern die eigenen Mittel lähme, die Streitkräfte des Feindes vermehre und der preußischen Sache ebenso die öffentliche Meinung als bereitwillige Verbündete entziehe. Man dürfe, wenn man das Vaterland nicht mehr zu retten vermöchte, es doch nicht ohne Kampf untergehen lassen, und müsse wenigstens beweisen, daß man sein Leben dafür zu opfern entschlossen sei.
In dieser Gesinnung bereitete der Prinz nach Absendung des Briefes alles für die bevorstehende Schlacht und rüstete sich zum Vorschreiten über die Saale, wo die Preußen angreifen sollten, sobald die Heere einander gegenüberstehen würden.
Der Prinz durchwachte fast die ganze Nacht. Aus seiner hochgelegenen Wohnung konnte er die hellen Wachtfeuer der Franzosen erblicken, welche sich in weitem Kreise längs des ganzen Horizontes hinzogen. Die häufig fallenden Schüsse ließen über die ernstlichen Absichten des Feindes für den kommenden Tag keinen Zweifel mehr übrig. Mit hoher, freier Seelenruhe blickte Louis Ferdinand diesem Tage entgegen. Nach Mitternacht setzte er sich zum Flügel und spielte mehrere Stunden. Der treue François wachte im Nebenzimmer; er war ebenso bewegt als sein Herr ruhig.
Gegen Tagesanbruch, als der Prinz sich eben auf sein Feldbett geworfen hatte, ward gemeldet, daß die französischen Vortruppen unter dem Marschall Lefèbre über Gräfenthal heranrückten, und die preußischen Truppen, welche jenseits Saalfeld ständen, sich infolgedessen auf Saalfeld zurückzögen.
Sogleich entsandte der Prinz einige Ordonnanzoffiziere mit kurzen, schriftlichen Befehlen an die Kommandanten der verschiedenen Truppenabteilungen, dann schellte er nach François, um sich ankleiden zu lassen.
Nun, sagte der Prinz, da er bemerkte, daß des Alten bebende Hände ihm den Dienst versagten, will's heute nicht recht fort? Und Du hast es doch all die Jahre gut verstanden!
Veuille Dieu! daß ich es noch viele Jahre zu tun behielte!
So mache es schneller als jetzt! entgegnete der Prinz, und reiche mir die Orden und den Paradehut.
Gnädigster Herr! nur nicht die Orden! nur den Federhut nicht! Der weiße Federhut ist ein Signal!
Das soll er werden, François, für alle braven Preußen! Gib ihn her! Soll ich denn ungeschmückt zu einem Festtage gehen, auf den ich mich seit Jahren freute?
Hoheit! sagte der Alte, während er den Hut hinlegte und die Orden auf der Brust des Prinzen befestigte. Hoheit! je comprends ce noble sentiment, denn ich bin ein Franzose; aber – rief er in Tränen ausbrechend – schonen Sie Ihr Leben, gnädiger Herr! Wir haben nur einen Prinzen Louis!
Der Prinz antwortete nicht. Er war beschäftigt, die Briefe Paulinens und ein Medaillon mit dem Haare seiner Kinder in eine Brieftasche zu schließen, die er in der Uniform auf seiner Brust verbarg.
Als er den Hut aufsetzte und der Tür zuschritt, hielt François ihn zurück. Hoheit! fing er wieder an, ma vie Vous appartient, aber freilich, die Jugend kann das Alter entbehren; wir Alten können nur die Jugend nicht entbehren. Denken Sie, gnädigster Herr, an die Frau Prinzessin Mutter! et ne Vous exposez pas trop! rief er, in Tränen des Prinzen Hände küssend. Dann, als halte er diese Ermahnung für unangemessen, fügte er scherzend die Worte hinzu: Mon Dieu! wie werden die Frauen Hoheit vergöttern, wenn Sie aus dem Felde zurückkehren! – Mais pour retourner il faut vivre avant tout!
Ich danke Dir, François! von Herzen danke ich Dir! war alles, was der Prinz der Rede des Alten entgegnete, während er ihm die Hände schüttelte und das Gemach verließ.
Im Vorsaale empfingen ihn seine Adjutanten. Als er sein Pferd bestiegen hatte, gab er nochmals dem alten Johann, der nicht mehr in die Schlacht zu folgen fähig war, und François die Hände.
Beide blickten ihm nach, so lange sie ihn sehen konnten.
Der ist von des alten Fritzen Schlag! meinte Johann, und François sagte, sich die Augen trocknend, während er in das Haus zurückkehrte: Dieu le protège! c'est un vaillant enfant! Er hätte verdient, ein Franzose zu sein!
Es war um die Mittagsstunde des zehnten Oktober. Der Kampf hatte bereits zwei Stunden gedauert, als Prinz Louis Ferdinand einzusehen begann, daß er sich einem dreifach überlegenen Feinde gegenüber in einer Stellung befinde, welche von Stunde zu Stunde unhaltbarer und gefährlicher wurde.
Ein Hauptangriff gegen die auf der Höhe nach Blankenburg vorrückenden feindlichen Kolonnen, welche dem Prinzen den Rückzug von Saalfeld nach Rudolstadt abzuschneiden drohten, schien unerläßlich. Dieser Angriff mißlang, und nur die persönliche Unerschrockenheit des Prinzen, der sich überall der größten Gefahr aussetzte, vermochte die zurückgeworfenen Truppen vor wilder Auflösung zu schützen. Von jetzt an war der Rückzug unvermeidlich, und mit schwerem Herzen entschloß sich der Prinz, den Befehl zu demselben zu erteilen. Als dies geschehen war, sprengte er selbst, nur von einem Adjutanten begleitet, nach der Stadt zurück, um hier die nötigen Maßregeln zur Deckung des Rückzuges zu treffen.
Aber schon am Tore begegneten ihm fliehende Haufen seines Fußvolkes, welche von dem mit Macht herangedrungenen Feinde zurückgetrieben worden waren. Nur einige Trupps Jäger und Füsiliere hielten sich vor der Stadt, deren Tore man bereits in der Geschwindigkeit barrikadierte. Der Prinz sprengte den Fliehenden entgegen. Vor seinem Anblick verstummte das wilde Geschrei der Flüchtigen.
Seid ihr Preußen? rief er ihnen mit starker Stimme zu, wann haben jemals preußische Soldaten ihren General, einen preußischen Prinzen verlassen?
Ein lauter Vivatruf war die Antwort. Der Prinz stellte sogleich die Ordnung wieder her und wies ihnen den Punkt am Ausgange der Vorstadt an, bei dem sie Posto fassen sollten. Sein ruhiges, würdevolles Benehmen wirkte auf die Truppen wie ein Zauber. Obgleich er in diesem Augenblicke die dringende Gefahr seiner Lage völlig übersah, nahm man doch auf seinem Gesicht ebensowenig als in seinen Aeußerungen und Bewegungen irgend etwas wahr, was die auf ihn blickenden schwächeren Gemüter hätte beunruhigen können. Absichtlich ritt er mit langsamem Schritte vom Tore der Stadt bis zum Ausgange der Vorstadt zurück, wo er mit bewunderungswürdiger Gelassenheit den Knäuel auseinander wickelte, den ein hier am unrechten Ort haltender Kavallerietrupp veranlaßt hatte.
Aber diese Anordnung verschlang kostbare Zeit. Der Rückzug auf Wöhlsdorf, den die Kavallerie bereits angetreten hatte, ward immer gefahrvoller durch das Vordringen des Feindes, der, mit aller Macht anrückend und die gegen ihn aufgestellten Regimenter langsam zurückwerfend, jetzt die ganze Masse seiner bisher versteckt gehaltenen überlegenen Kavallerie zu entfalten suchte, um durch einen großen Reiterangriff die Niederlage der zurückweichenden preußischen Corps zu vervollständigen.
Der Prinz begriff die Wichtigkeit des Augenblickes. Es galt, die Aufstellung der feindlichen Kavalleriemassen zu hindern. Dies konnte nur durch Geschütz geschehen. In seiner Nähe, auf einer kleinen Anhöhe, hielten als Reserveartillerie zwei berittene Kanonen. Der Prinz befahl, sie herbeizuholen, um die sich in Kartätschenschußweite entwickelnden französischen Husarenregimenter mit Kartätschen zu beschießen. Als er eine Zögerung in der Ausführung seines Befehles bemerkte, sprengte er selbst dorthin.
Der Adjutant, blaß und bebend vor Zorn, hielt vor dem Unteroffizier, der die Geschütze befehligte.
Hoheit! rief er dem Prinzen zu, der Hund von Unteroffizier weigert sich, dem Befehl zu folgen, und die Stückknechte, die nur seinen Winken gehorchen, versagen gleichfalls den Gehorsam.
Vorwärts! vorwärts! wenn Dir Dein Leben lieb ist! herrschte der Prinz. In demselben Augenblicke, wo er dem Manne ins Gesicht schaute, erschien er ihm bekannt. Es waren die wilden, frechen Züge des Rekruten, den er vor Jahren bei dem Transporte vor dem Oranienburger Tor in Berlin gesehen hatte, wo der Werbeoffizier seinen Hund auf ihn hetzte, um den Zurückbleibenden herbeizutreiben.
Der Unteroffizier blieb unbeweglich. Hierher bin ich postiert vom General Bevilaqua. Der hat mir gesagt: ich solle auf keine Ordre den Platz verlassen, und so tue ich, mag kommen, wer da will.
Der Mensch ist wahnsinnig! rief der Prinz. Er stürzt uns ins Verderben.
Was geht das mich an! trotzte mit frecher Stimme der Unteroffizier. Ich bin ja nicht freiwillig hier. Der Prinz hier hat selbst gesehen, daß ich mit Hunden in den preußischen Soldatenrock gehetzt bin.
Der Prinz verlor die Fassung. In der Verzweiflung über diesen Trotz führte er einen Hieb mit der flachen Klinge auf den Menschen, indem er ausrief: Ich steche Dich nieder, Elender! wenn Du nicht augenblicklich folgst.
Hoho! davor ist Rat! schrie der andere, und seinem Gaule die Sporen gebend, jagte er, gefolgt von einem Teile seiner Stückknechte, der Stadt zu.
Hat sich denn alles wider uns verschworen! rief der Prinz aus, als in diesem Augenblicke der Erdboden erdröhnte von dem Hufschlag der feindlichen Reiterei, welche sich unterdessen ungehindert entfaltet hatte, und mehrere tausend Mann stark auf den Rest der Infanterie des Prinzen losstürmte. Doch dieser ließ sie fast auf Pistolenschußweite herankommen und empfing sie dann mit einem so mörderischen Feuer, daß sie in Unordnung sich zur Flucht zurückwandte.
Dieser Augenblick muß unser Schicksal entscheiden! sagte der Prinz und sprengte, von seinen Adjutanten, Leutnant Nostiz und Hauptmann Valentini, begleitet, auf das nahe Wöhlsdorf zu, wo fünf Eskadrons sächsischer Husaren aufgestellt waren.
Mit den Worten: Mir nach, Kameraden! setzte er sich an ihre Spitze und stürzte sich im wildesten Jagen auf die feindlichen Kavalleriemassen.
Allein dieser Angriff, ohne Einheit, ohne Ordnung unternommen, scheiterte an der überwiegenden Stärke des Feindes, der durch eine geschickte Bewegung sich den ansprengenden Schwadronen in beide Flanken warf.
Die Unordnung der fliehenden Haufen, von der ganzen Masse des Feindes verfolgt, teilte sich den noch Standhaltenden mit, und preußische, sächsische und französische Husaren stürzten in tollem Jagen in das von Hohlwegen durchschnittene Terrain, dessen Beschaffenheit die Verwirrung noch vermehrte.
Alle Bemühungen des Prinzen, der mitten im Handgemenge oft wie ein gemeiner Reiter focht, waren unvermögend, den Strom der Flüchtigen aufzuhalten.
Um Gottes willen, retten Sie sich, Hoheit! rief ihm einer der Offiziere zu, welche sich in dem Handgemenge zu ihm gesellt hatten, um das kostbare Leben ihres fürstlichen Generals zu verteidigen.
Die Schlacht ist verloren! was liegt an meinem Leben! rief er verzweiflungsvoll aus.
Alles Hoheit! Ein gefangener Prinz von Preußen ist verhängnisvoller als eine verlorene Schlacht. Bedenken Sie, daß Sie Ihr Leben dem Vaterlande schulden.
In diesem Augenblicke zeigte sich am Eingang des Hohlweges, in dem sie kämpften, ein Trupp französischer Husaren, von einem Offizier der Chevaux légers geführt, welche mit wildem Geschrei auf den Prinzen und seine Begleiter einsprengten.
Noch immer schien der erstere unentschlossen; da ergriff Leutnant Nostiz das Pferd am Zügel und wandte es zur Flucht. In diesem Moment mochte dem Prinzen zum ersten Male die Möglichkeit lebhaft vor Augen treten, statt eines heldenmütigen Todes das schreckliche Geschick der Gefangenschaft zu erleiden; denn er bedeckte mit dem Hute den Stern auf seiner linken Brust, und der Schnelligkeit seines vortrefflichen Pferdes vertrauend, versuchte er über Gräben und Hecken aus dem Bereich der Verfolgenden zu entkommen.
Plötzlich aber sperrte ihm die Umzäunung einer Wiese den Weg der Flucht. Der Prinz war der geschickteste Reiter des preußischen Heeres. Er spornte seinen Schweißfuchs, mit welchem er oft viel gewagtere Reiterkünste geübt, zum Sprunge über den scharfkantigen Zaun. Das treue Tier streckte sich mit der letzten Kraft zu dem gefährlichen Satze, aber die Anstrengung des Tages, dessen Verwirrung den Prinzen in den letzten Stunden verhinderte, ein frisches Pferd zu nehmen, hatte die Kräfte des edlen Rosses erschöpft. Der Sprung gelang nur halb, das Pferd blieb mit einem Hinterfuße in der Umzäunung hängen und stürzte nieder.
Während der Prinz noch beschäftigt war, sich von dem Sturze aufzuraffen, hatten ihn aber die verfolgenden Husaren bereits erreicht, und ehe er noch die Klinge zur Abwehr entgegenstrecken konnte, empfing er einen Hieb auf den entblößten Kopf, der ihn taumeln machte. Zu gleicher Zeit drang der Offizier in Chevaux-légers-Uniform mit dem Rufe auf ihn ein: Sie sind mein Gefangener! Ihren Degen, Prinz!
Da hast Du ihn! entgegnete Louis Ferdinand, mit der letzten Kraft einen Stoß auf seinen Gegner führend, der demselben den linken Arm durchbohrte.
Nun, so fahre hin! schrie der andere wütend, und begrub seinen langen Stoßdegen in der Brust des Prinzen.
Ist's möglich! rief der Prinz besinnungslos zusammenbrechend.
Mit stummem Entsetzen erblickten der Hauptmann Valentini und der Leutnant Nostiz, welche in diesem Augenblick mit einigen Reitern herbeisprengten, den gefallenen Fürsten. Ihre Bemühungen, den Sterbenden dem Feinde zu entreißen, waren vergebens. Die Uebermacht neu herandringender Franzosen zwang sie, den teuren Leichnam zu verlassen, an welchem die Wut der feindlichen Husaren noch mit Hieb- und Stichwunden ihren Grimm ausließ.
Zerfetzt und nackt ausgeplündert ward Prinz Louis Ferdinand am Abend, nur in ein Laken gehüllt, unter dem Schalle der Musik durch die Straßen von Saalfeld getragen und dort in der Fürstengruft beigesetzt.
So endete Prinz Louis Ferdinand. Er hatte das vierunddreißigste Jahr noch nicht zurückgelegt.
Das Schicksal, welches ihm versagte, die Erhebung des Jahres achtzehnhundertdreizehn zu erleben, hatte ihm wenigstens den Todesschmerz erspart über den, wie es damals schien, hoffnungslosen Fall des Vaterlandes.
Der heldenhafte Ausgang seines Lebens versöhnte selbst die strengsten Richter desselben mit den Irrtümern und Ausschweifungen, in welchen sich eine Jugend verloren hatte, deren Unglück es war, ein Prinz zu sein. In dem Gedächtnis aller, welche ihn gekannt, lebte er fort als eine schöne seltene Erscheinung. Das Volk aber trug Leid um seinen Liebling noch jahrelang, und aus den Tagen unserer Kindheit klingt das vielgesungene Lied:
Klaget Preußen! ach, er ist gefallen!
mit den rührenden Tönen seiner Melodie in unserer Erinnerung nach.
Buchdruckerei Gustav Schenck Nachfl. P. M. Weber G.m.b.H.
Berlin SW. 68, Hollmannstr. 9/10.