
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
»Des Aberglaubens alte Rechte
Erstrecken sich auf jedes Haupt:
Noch ist im menschlichen Geschlechte
Ihr Einfluß größer, als man glaubt.«
Buch vom Aberglauben 1791
»Viele suchen nicht bloß bei den Heiligen« – sagt Peter Gelcicky, der Gründer der Brüdersekte, im Sittenspiegel seiner Zeit, im Kapitel über den Aberglauben –, »sondern in ihrem Wahne auch bei den Zauberern und Wahrsagern Hilfe, indem sie zu ihnen dasselbe Vertrauen haben wie zu den Heiligen. Bald wenden sie sich nach Kyjow an die Mutter Gottes, bald nach Temelin an einen Hexenmeister, bald nach Thein und an den heiligen Prokop bei Zajimac, es gilt ihnen gleich, wer helfe, ob Gott oder der Teufel.«
Es konnten in der Vorzeit kein öffentlicher Aufzug, kein Schauspiel zur Zufriedenheit der Zuschauer, ja nicht eine lebhafte christliche Kirchendarstellung gegeben werden, in der nicht der Teufel eine Hauptrolle spielte. Beim Kirchenfeste am Himmelfahrtstage zogen mehrere vermummte Teufel in die Kirche ein und bildeten eine ganze Hölle, aus welcher sie um sich warfen, um sich gegen das von Geistlichen getragene Kreuz zu wehren. Deshalb mußte auch der Nürnberger Schönbart seine Hölle und seine Teufel haben. In ihren wunderbaren Aufzügen und sonderbaren Gestalten mit Schwänzen, Hörnern, Krallen, Pferdefüßen usw. versehen, belustigten sie die Zuschauer. In Frankreich mußten solche christliche Schauspiele, sogenannte Mysterien, mindestens vier Teufel haben, wenn sie eine große Teufelei sein sollten.
In Schernberks Mysterie: das Spiel von Frau Jutten im Jahre 1480 erschienen nicht nur acht Teufel, von denen ihrer zwei Spiegelglanz und Federwisch hießen, sondern auch des Teufels Großmutter, Frau Lillis. Sie sangen in einem Rundgesang:
»Luziver, in deinem Throne,
Rimo, Rimo, Rimo,
Warest du ein Engel schone,
Rimo, Rimo, Rimo,
Und bist nun ein Teufel greulich,
Rimo, Rimo, Rimo pp.«.
Zuweilen haben die Verfasser im Personen-Verzeichnis bei der Angabe von vier, sechs, acht Teufeln hinzugesetzt: »Allhie mag man auch wohl mehr Teufel verordnen.« Die Teufel hatten ihre besonderen Stimmtöne, rasselten mit Ketten, klingelten mit Schellen und schrien mit fürchterlichem Zischen, Brummen, Brüllen, Heulen: Hoho, hoho! Huhahu, burrurrr, brurrur, rur! russihususch, briiix, braaax!« usw.
Geistliche und Mönche wurden dabei gar oft als Tiere vorgestellt. So sah man den Fuchs, Meister Reineke, erst als einen gemeinen Pfaffen, wie er eine Epistel sang, nachher als Bischof, dann als Erzbischof, dann als Papst. Dabei verspeist er unausgesetzt alte und junge Hühner und anderes. Kam der Teufel zu einer solchen Szene, so gab es Spaß für die Zuschauer.
Solcher deutscher Volkshumor mag der Geistlichkeit bisweilen unbequem gewesen sein und Papst Innozenz VIII. wenig behagt haben. Nach Einführung des » Hexenhammers« wurde aus dem Scherz fürchterlicher Ernst und er mit Feuer und Schwert bekämpft.
Die Schauspieldichter jener Tage taten das ihre in Erschaffung der verschiedenartigsten Teufel für ihre Stücke, und die Theologen erkannten entweder die waltende Hand eines Teufels bei jedem Laster oder sie machten das Laster selbst zu einem Teufel. Da erschienen dann Bücher, deren Titel Teufelsnamen zierten, wie Tanzteufel, Fluchteufel, Saufteufel, Jagdteufel, Eheteufel, Hoffartteufel, Spielteufel, Hofteufel, Eidteufel, Hosenteufel usw., die alle gefielen, so daß schließlich der Buchhändler Siegmund Feyerabend zu Frankfurt im Jahre 1575 davon eine Sammlung veranstaltete und unter dem Titel » Theatrum Diabolorum« herausgab.
Nun wurde der Teufel das Modethema der Schriftsteller. Alle seine Ränke wurden geschildert und die Hölle aufs eingehendste beschrieben Die Hölle sollte sogar ihre Küche haben; Oberkoch ist Belzebub; er röstet die Verdammten gleich Schweinen am Bratspieß und begießt dann den leckeren Braten mit Essig und Galle; dem höchsten Teufel soll aber das Gericht nicht gemundet haben.. Besonders machte sich damals durch diese infernalische Topographie der Jesuit Hieronymus Drexel bekannt, der auch von den Höllenstrafen zu sprechen wußte in seinem Buche: » Infernus Damnatorum carcer et rogus aeternitatis« ( Col. 1631). Nach ihm hat die Hölle sieben Gemächer und drei Pforten. In jeder Wohnung sind sieben Flüsse von Hagel. In jeder Wohnung befinden sich 7000 Löcher, in jedem Loche 7000 Risse, in jedem Risse 7000 Skorpionen, deren jeder sieben Gelenke hat und in jedem Gelenke seien 1000 Tonnen Gift. –
Man hatte auch Rezepte gegen die Hölle, so das nachstehende aus dem Jahre 1718: Erstlich nimm 5 Lot Traurigkeit, 10 Lot Geduld, 15 Lot Mäßigkeit, 20 Lot Keuschheit, 125 Lot Demut und 30 Lot Freigebigkeit. Diese Ingredienzien stoße wohl durcheinander in dem Mörser des Glaubens mittels des Stempels der Stärke. Alsdann gieße darauf ein Vierteil Hoffnung, siede es in der Pfanne der Gerechtigkeit bei dem Feuer der christlichen Liebe, rühre es oft um mit einem andächtigen Gebet, und bewahre es dann in dem Geschirre der Beständigkeit, auf daß der Schimmel der Eitelkeit nicht dazukomme. Mit dieser Salbe salbe dich dann täglich, morgens und abends. Es hilft wider die Hölle.
Vom Teufel kam's nun auf die Erzählungen von seinen Teufelsstreichen. Ein Hamburger Pfarrer, Peter Goldschmid mit Namen, gab im Jahre 1704 eine Sammlung dieser Art heraus unter dem Titel: » Höllischer Morpheus«, und Erasmus Francisi zu Nürnberg im Jahre 1708 seinen » Höllischen Proteus«. Man hatte sonach eine vollständige Teufelsliteratur. Alle diese Erzählungen zu entkräften, schrieb im Jahre 1751 ein Ungenannter ein Buch: » Über die Werke des Teufels auf dem Erdboden.«
Bald kam indes der Teufel in die Hexengeschichten, und die Sache wurde bitterernst, und als über die Teufeleien gestritten und philosophiert wurde, mochte man nichts mehr davon wissen, und der Spaß ging durch den Ernst verloren Von einer Erlösung aus der Hölle berichtet eine schlesische Chronik: Der König Georg von Böhmen hatte sich wegen seiner hussitischen Ketzereien bei den Katholiken sehr verhaßt gemacht. Der damalige Abt auf dem Sande zu Breslau ließ diesen König in einer neuen Kapelle seiner Kirche darstellen, wie er beim Jüngsten Gerichte von zwei Teufeln auf einer Düngertrage in die Hölle geschafft wurde. Der Sohn König Georgs, Herzog Heinrich von Glatz, nahm dies gewaltig übel und drohte dem Abt sowie allen Breslauern, daß er alle Klöster und Dörfer Schlesiens abbrenne, wenn jenes Bild nicht entfernt würde. – Der Abt fand sich endlich gezwungen, das Gemälde (1472) übertünchen und dadurch den König aus der Hölle erlösen zu lassen, wenn er nicht Gefahr laufen wollte, sich in die unangenehmsten Händel zu verwickeln. – Da das Gemälde nur mit gewöhnlicher Leimfarbe übermalt worden war, so kam es bei Gelegenheit einer Renovation der Kapelle wieder zum Vorschein und wurde für eine Sammlung kopiert..
Selbstredend lebt der Teufel noch heute in unzähligen Sprichwörtern, so wie: »Der Teufel trägt allerlei Larven«, »Der Teufel guckt ihm aus den Augen«, »Der Teufel hat mehr als zwölf Apostel«, »Der Teufel ist nie so schwarz, als man ihn malt«, »Der Teufel ist nie mehr zu fürchten, als wenn er predigt«, »Wem der Teufel einheizt, den friert's nicht«, »Der Teufel hofiert nimmer auf den größten Haufen«, »Er nimmt's überhaupt, wie der Teufel die Bauern«, »Was hilft's, wenn ihn der Teufel holt und ich die Fracht bezahlen muß?«, »Er sieht aus, als hätte der Teufel Erbsen auf ihm gedroschen«, »Der Teufel ist schon alles gewesen, nur kein Schulmeister und kein Lehrbube«, »Wo der Teufel nicht selbst hin will, schickt er einen Pfaffen oder ein altes Weib«, »Dem Teufel beichten«, »Wer den Teufel zum Freund hat, hat's gut in der Hölle«, »Man braucht dem Teufel keinen Boten zu schicken«, »Ich habe den Teufel geladen, nun muß ich ihm auch Arbeit geben«, »Man muß den Teufel mit Beelzebub austreiben«, »Wenn man den Teufel an die Wand malt, so kommt er« usw.
Ein gewisser Kaspar Neithart, von Geburt ein Gersbrucker, damals Nachrichter zu Passau, verkaufte im Jahre 1611 an die verzagten Soldaten mit Zauberzeichen beschriebene Stückchen Papier, einen Taler groß, die mit einem messingenen Stempel gedruckt und mit nichts bedeutenden, unbekannten Wörtern bezeichnet waren, welche diese verschluckten oder anhängten und dadurch unverwundbar gemacht zu sein glaubten. Er verdiente viel Geld, und das Festmachen erhielt den Namen Passauer Kunst, seine Papiere aber wurden Passauer Zettel genannt. Eine alte Handschrift gibt über den Ursprung der Passauer Kunst und der Passauer Zettel folgende Auskunft:
»Ein Student, Christian Elsenreiter genannt, versuchte zu Anfang des 17. Jahrhunderts in der Stadt Passau in einem Gäßchen rückwärts des Rathauses, wo er sich aufhielt, durch Verfertigung von Zauberzetteln, die gegen alle Verwundungen schützen sollten, Ansehen und Reichtümer zu erlangen. Es waren auf diesen Zetteln folgende Worte zu lesen: ›Teufel, hilf mir, Leib und Seele geb' ich dir!‹ Wer sich vor jeder Schuß- und Hiebwaffe sicherstellen wollte, verschluckte einen solchen Zettel, und seine Existenz war auf Lebenszeit gesichert. Starb er aber innerhalb der ersten vierundzwanzig Stunden nach der Verschluckung, so gehörte seine Seele dem bösen Feinde.«
Die Sage vom Festmachen ist unfehlbar daher entstanden, daß mancher General, wenn er seine Soldaten vor den Feind führte, für ratsam fand, ihnen Mut zu machen und vorzugeben, er könne mit seinem Kommandostab alle Kugeln abweisen. Er selbst hatte vielleicht ein Panzerhemd unter seinem Wams und bewies, indem er etwa aus einem schwachgeladenen Gewehr nach sich schießen ließ, den Glauben, daß seine Kunst probat sei; er ließ auch wohl heimlich die Kugel aus dem geladenen Gewehr ziehen und zeigte sie dann vor, als hätte er sie aufgefangen. Natürlich glaubten die Leute, ihm könne keine Kugel schaden. – Übrigens sollte auch der 91. Psalm, vor einer Schlacht gesprochen, die Kugeln entfernen und die Hiebe entkräften, das tägliche Hersagen des 109. Psalms aber einen Feind töten.
Einem Major v. E. brach der Ort, wo er sich die Hostie hatte einheilen lassen, gegen das Ende seines Lebens wieder auf und war nicht wieder zu heilen. Er stand dabei außerordentliche Schmerzen aus, weil ein großer Teil des Fleisches abfaulte und Maden in die Wunde kamen. Vor seinem Tode bereute er seine abergläubische Torheit.
Später glaubten viele Söldner, die Mansfelder St.-Georgs-Taler, besonders die in den Jahren 1611 und 1613 geprägten, schützten gegen Stich und Schuß, und wurde das Stück oft mit 10 Talern bezahlt.
Ein Graf von Mansfeld hatte auf die Taler St. Georgs Kampf mit dem Lindwurm prägen lassen und benutzte diese Taler zur Besoldung seiner Kriegsleute. Seine Nachkommen behielten manches Jahrzehnt dieses Privilegium, allein solche Stücke prägen zu lassen. Die Stadt Kremnitz in Ungarn dagegen durfte sie nur während eines Jahres aus dem bei ihr gegrabenen edlen Metalle herstellen lassen, weshalb denn auch die Kremnitzer Georgstaler die seltensten sind.
Die ältesten Mansfelder Georgstaler zeigen auf der einen Seite den Ritter, auf der anderen das Mansfelder Wappen, und die Umschrift lautet verdeutscht: »Bei Gott ist Rat und Tat«. Später geschlagene Georgstaler führen statt des Wappens zuweilen ein Schiff und verschiedene Umschriften. Ein altes numismatisches Werk: »Thaler-Cabinet des Herrn David Samuel von Madai« (Königsberg 1765) sagt hierüber:
»Der berufene mansfeldische oder St.-Jörgen-Taler, auf dessen einer Seite sich wie gewöhnlich der Ritter St. Georg mit erhobenem Schwert im Galopp gegen die rechte Seite zeiget, während unter ihm der Drache, dem ein Stück von der abgebrochenen Lanze im Rachen steckt, auf dem Rücken liegt, trägt die Umschrift: DAVID. CO. E. DO. IMANSF. NOB. D. I. HEL. ET SCHRAPL (Comes et dominus in Mansfeld, nobilis dominus in Heldrungen et Schraplau). Auf dem Revers ist (wie schon erwähnt) das alte mansfeldische Wappen ohne Helm mit der Jahreszahl auf den Seiten und den Buchstaben G M. Über dem Wappen steht in drei Reihen der Spruch Jeremias 32, 19: Bei Gott ist Rath vnd That, welche Worte des Grafen David Wahlspruch gewesen, wie aus einem alten Stammbuch erhellt.
Von diesem Taler machen abergläubische Menschen viel Werks, indem sie dafür halten, daß, wer denselben bei sich trage, niemals mit einem Pferde stürzen könne, ja hieb-, stich- und schußfest sei. Wie denn ehemals in einem Feldzuge wider die Türken nicht leicht ein vornehmer Offizier soll gewesen sein, der nicht einen solchen Taler bei sich getragen, wodurch er dermaßen im Preise gestiegen, daß bei fünfzehn und mehr Taler dafür bezahlt worden.
Zu dieser Torheit soll ein sächsischer Obrister, des Geschlechts von Liebenau, wiewohl wider seine Absicht, Gelegenheit gegeben haben. Denn derselbe soll in Aktionen zweimal geschossen, aber allemal auf solch mansfeldisch Geld, welches er zum Notpfennig bei sich getragen, getroffen worden sein, also daß die Kugel nicht durchgeschlagen, noch ihn verwundet; dieses hat er anderen erzählt, welche darauf dem Taler eine solche beschützende Kraft zugeschrieben.
In den zu Halle Anno 1705 gedruckten auserlesenen Anmerkungen ( Part. II. p. 120 § 49) wird vorgegeben: der im Dreißigjährigen Kriege so sehr renommierte Mansfelder habe dergleichen Taler zur Bezahlung seiner Soldaten schlagen lassen. Den Ritter St. Georg, so darauf gepräget ist, habe er zu seinem Patron und Vorbilde erwählet, weil er die Absicht hatte, Deutschland, wie jener die in Todesgefahr schwebende Jungfrau, von der zu sehr anwachsenden Macht des Papstes zu befreien. Andere mutmaßen, daß, wie St. George allemal ein Patron der englischen Nation gewesen, auch von demselben der Ritterorden den Namen führet, so habe der Mansfelder dadurch andeuten wollen, daß er das englische Interesse embrassieret, und die mit ihrem Gemahl, dem unglücklichen Könige in Böhmen und Pfalzgrafen Friedrich, vertriebene englische Prinzessin Elisabeth, eine Tochter Jakobs I., Königs in England, zu retablieren suchen wollte, wie denn zu gleicher Anzeigung Herzog Christian von Braunschweig dieser unglücklichen Prinzessin Handschuhe auf dem Helme getragen und nicht eher zu ruhen sich vermessen, als bis sie wieder zu voriger Würde gelangt wäre. Die gemeine Einbildung hält auch nur diejenigen Taler für kräftig, welche Anno 1609 bis 1611 gepräget worden.« –
Fest zu sein, soll selbst König Karl XII. von Schweden geglaubt haben. – Soldaten, die bei einem am 22. Mai 1640 vom Rittmeister Strauß geleiteten Überfall der Schweden in Sorau, ob sie gleich schwer verwundet waren, vor Sonnenuntergang nicht sterben konnten, hatte man angeblich mit Äxten zu töten versucht. Sie waren aber mit Hilfe des Teufels stahl- und eisenfest gemacht. Die rebellierenden Russen unter Peter I. glaubten auch fest zu sein, bis ihrer 12 000 tot auf dem Platze liegenblieben, und man hat noch im Siebenjährigen Kriege Soldaten gesehen, die Passauer Zettel bei sich trugen. Auch glaubte man: »Wer St.-Johannis-Blüte gedörrt bei sich führt, kann nicht verwundet werden, wenn er sie unter dem Arme trägt«, weshalb beinahe einer im Jahre 1601 zu Erfurt nicht eher enthauptet werden konnte, als bis er sie wegtat. »Aber es ist ein wunderlich Ding und kann – wie es auch gesucht werde – nur gefunden werden mittags zwischen 11 und 12 Uhr.« Auch suchte man Kräuter und allerhand Dinge auf, daraus eine Waffensalbe zu verfertigen, wie Bärenschmalz, Regenwürmer, Blutstein, Sandelholz, Moos von der Hirnschale eines Gerichteten, Natterwurz, Wallwurz u. a. m., die zubereitet, wenn die Sonne in der Waage stand, gegen Hieb und Stich schützen sollte. Erfahrene Chirurgen und Ärzte nannten das eine Waffensalbe und stellten dieselbe her; dieselbe galt als Universalmittel zur Heilung aller Art von Wunden.
Eine hübsche Probe eines solchen Mittels wider »Schuß und Stich« stellte Herzog Albrecht zu Sachsen an, von dem wir in einer Predigt des Bernhard Waldschmidt aus dem Jahre 1660 folgendes wörtlich gedruckt finden:
»Als auff ein Zeit ein Jud kam zu Hertzog Albrecht zu Sachsen, vnd jhm einen Knopff gab, mit seltzamen Charactern vnd Zeichen, der solle dienen für kalt Eisen, stechen vnd schießen, sagte er: Da will ich's mit Dir Juden erst probiren; führet den Juden für's Thor, ins Feld hinauß, hing jhm den Knopff an Hals, zog sein Schwerdt aus undt durchstach ihn. Da hat jhm nichts geholfen, sein Schemhampheres, Tetta grammaton, vnd andere seine Gauckeley.«
Sonst trug auch wohl der Pöbel die Länge Jesu, um gegen den Schuß sicher zu sein. Das war ein elendes Gebet, in Tuch von fünferlei Farben eingewickelt, von welchem man glaubte, daß es, wenn es auf dem bloßen Leib getragen würde, dem Träger nicht nur Festigkeit und Unverletzlichkeit, sondern ihm auch, mochte er sterben, wie er wollte, die ewige Seligkeit geben sollte. Es bestand aus einem Streifen Papier, eine Hand breit und fünf Fuß lang, weil Jesus so lang gewesen wäre, wie auf dem Riemen zu lesen war. Man wollte diese Länge Jesu im Jahre 1655 zu Jerusalem beim Heiligen Grabe gefunden haben, und Papst Klemens VIII. sollte nicht nur diese Nachricht, sondern auch die Gebete, welche auf diesem Papier gedruckt standen und die für deren Anbetung verliehenen Gnaden gutgeheißen und bestätigt haben. Am 3. Juni 1790, am Fronleichnamsfeste, wurde ein bischöflich straßburgischer Untertan, der auf Wildschießen ausgegangen war, von einem markgräflich badischen Freijäger (Forstpolizisten) erschossen. Man fand bei ihm ein Exemplar der »Länge Jesu«. Dasselbe war außer vielem anderen mit den Worten bedruckt: »gelobet sei der allerheiligste Nahme Jesus, und seine heilige Läng' in alle Ebwigkeit Amen.« – Wer diesen Papierstreifen bei sich trug oder im Hause hatte, der sollte vor allen sichtbaren oder unsichtbaren Feinden, Straßenräubern, vor Zauberei und Schaden der Verleumdung sicher sein. Schwangere Weiber sollten dadurch vor großen Schmerzen beim Gebären geschützt werden. In einem Hause, in welchem sich ein solcher Papierstreifen befand, sollte nichts Böses bleiben, ihm sollten weder »Donner noch Wetter, weder Wasser noch Feuer schaden«. Wer ihn aber besaß, mußte alle Sonntage für die ganze Woche fünf Vaterunser, fünf Ave Maria und einen Glauben zu Ehren der heiligen fünf Wunden Jesu Christi beten. Dreimal des Jahres sollte er die heilige Länge lesen oder sich lesen lassen. Tat er das, so war er allezeit »gesegnet zu Wasser und zu Lande, bei Tag und Nacht, an Leib und Seel' in alle Ewigkeit, Amen«!
Wer die lateinischen Worte
| s | a | t | o | r |
| – | / | \ | Ι | = |
| a | r | e | p | o |
| – | / | \ | Ι | = |
| t | e | n | e | t |
| – | / | \ | Ι | = |
| o | p | e | r | a |
| – | / | \ | Ι | = |
| r | o | t | a | s |
| – | / | \ | Ι | = |
auf einen Zettel geschrieben, bei sich trug, glaubte man, dem könne auch der Stärkste nichts anhaben, der sei vor allem Übel gesichert, vor dem fürchte sich jeder. Die einzelnen Worte übersetzt »der Säer, ergreift, hält, die Werke, die Räder« – würden etwa folgenden Sinn geben: »der Sämann ergreift den Pflug, arbeitet und erntet dann.« Das Wort arepo ist wahrscheinlich aus arripo hergestellt.
Man besprach auch Gewehre, daß sie nicht losgehen sollten. Das geschah, wenn jemand im Walde oder auf dem Felde einen Schuß hörte und dann unter Benennung gewisser Worte einen Strauch in einen Knoten band, so sollte der Schütze seine Flinte nicht eher wieder abschießen können, als bis entweder der Knoten von selbst aufgegangen oder von einem andern aufgelöst worden.
»Hier und da sind noch Arbeiten vorhanden, die man für Werke des Teufels hielt, wie die Teufelsmauer im Harze. In Wismar sollte ein künstlich gearbeitetes Gitterwerk, welches dem Taufstein zur Einfassung dient, vom Teufel angefertigt sein. Auch im Dom zu Magdeburg zeigt man angebliche Arbeiten von ihm. In Sennewitz bei Halle liegt ein Stein, den der Teufel vom Petersberge, also eine gute Meile weit, dahin geworfen haben soll, um die neugebaute Kirche zu zertrümmern, welche in jener Gegend die erste lutherische gewesen, und in Wien zeigt man sogar noch den Ort, wo der Teufel einen lutherischen Schlosserjungen zur Hölle hinabgeführt haben soll, weil er über eine katholische Religionsangelegenheit gespottet.
Geschickte und gelehrte Männer, z. B. der Erfinder der Buchdruckerkunst, wurden ehemals vom Neide oder der Dummheit beschuldigt, mit dem Teufel in Verbindung zu stehen.
Bei einem verstorbenen Gelehrten fand man ein Glas, in welchem sich ein vierfüßiges, haariges Tier befand. Das mußte der Teufel sein. Man verwehrte seinem Leichnam die Erde zum Begräbnis, bis man überzeugt wurde, daß es eine Spinne sei. Von denen, die sich dem Teufel ergeben, sagte man, daß sie sich mit einem Pergament, welches dieser ihnen gebe, in den Finger schneiden müßten, um sich dann mit ihrem Blute folgendermaßen zu unterschreiben:
»Dieweil du, Luzifer und Beelzebub, Oberster der Teufel, versprochen hast, alle meine Begehren zu erfüllen, so verspreche ich N. N. dir nach den abgelaufenen … Jahren für deine Dienste hinwiederum meinen Leib und Seele, daß du damit umgehest nach deinem Gefallen.«
Der Kobold war nach der Meinung der Leute eine Art von Teufel, den ein Mensch, nachdem er mit dem Hauptteufel in Verbindung getreten, oft aber ganz wider Willen in dieser oder jener Gestalt in sein Haus bekommen und seiner dann nie wieder loswerden könne. In Leipzig auf Auerbachs Hofe konnte man den Kobold in Gestalt einer Schmeißfliege, die in einer Schachtel war, für einen Dukaten kaufen.
Viele Abergläubische hörten den Kobold pfeifen und lachen und sahen Steine sich um den Kopf fliegen, und wenn sie fragten: »Hänschen, wo bist du?« so antwortete er: »Hier!« – »Hänschen, wie heißt du?« – »Hans!«
Am Ende entdeckte man meist, daß die verbuhlte Magd, um ungestörter zu sein oder sicherer zu stehlen, die Ursache davon war. Andere entdeckte Betrüger gestanden, daß sie bei dem Koboldsspiel bloß die Absicht gehabt, das Haus in Furcht zu setzen oder durch Bann und Vertreiben des Kobolds etwas zu verdienen.
Und sind die » Kobolde« in unseren Tagen etwa verschwunden? Mitnichten! Wir erinnern nur an den Geisterspuk von Resow in der Nähe von Berlin und an den Bauernjungen, der ihn veranstaltet und vom Gericht im Jahre 1890 bestraft wurde. Man hat nur den Namen verändert und nennt ihn in unseren Tagen » Medium« und die gegenwärtigen Zauberer und deren Anhänger » Spiritisten«. Selbst an einen Zauberbanner in Gestalt eines Geistlichen fehlte es in jenem Prozesse nicht. Wir sehen, »der Aberglaube pflanzt sich wie eine ewige Krankheit fort«.
Unter Nickert stellte man sich eine kleine menschenähnliche Gestalt vor, die beinahe so dick als lang ist, mit einem ungeheuer dicken Kopf, roten Haaren, roten Augen und mit einer Kröte unter der Zunge. Die Nixen dagegen sollten vernünftige Geschöpfe sein, die ihr Geschlecht fortpflanzen und in Haushaltungen und Familien im Wasser ihren Aufenthalt hatten. Sie sollen den Menschen in das Wasser zu ziehen suchen und namentlich die Kinder gern mit den ihrigen vertauschen.
Der wilde Jäger wurde da, wo er sich am meisten aufhalten soll, und wo man ihn besonders gesehen und gehört haben will, Hackelberg genannt, nach einem vornehmen Geschlecht, das im Braunschweigischen gelebt haben soll.
Er, seine Bedienten, Hunde und Pferde sind ohne Kopf. Sie schrecken auf ihren nächtlichen Jagden den Menschen durch ihr Geschrei und werfen den Leuten Pferdekeulen auf den Herd.
Der dreibeinige Hase galt unter all den Gespenstern als das unschädlichste. Er tat niemandem etwas, außer wenn man ihn beleidigte; man zerbrach dann leicht ein Bein. Die Hexen sollten sich gern in Hasen verwandeln und dann auf drei Beinen laufen.
Der Bieresel sollte sich in einigen Wirtshäusern aufhalten, und wenn ihm nicht alle Nächte ein Krug Bier an einen bestimmten Ort gesetzt wird, soll er alles zerwerfen. Das Bergmännchen oder der Berggeist erscheint angeblich den Bergleuten in den Schächten so klein wie ein Kind, aber dick.
Der fliegende Drache Von den Drachen finden wir in einem uns vorliegenden Buche, welches im Jahre 1660 in Frankfurt a. M. unter dem Titel erschien: »Achtundzwanzig Hexen- und Gespensterpredigten«, eine eingehende Schilderung. Der Verfasser dieses etwa 700 Seiten in Quart umfassenden Werkes ist der evangelische Prediger Bernhard Waldschmidt, ein völlig vom Hexenwahn befangener Mann. Welch großes Unheil mag er wohl mit seinem Werke und seinen Predigten angerichtet haben! Dabei scheint dieser Prediger ein sehr eitler Theologe gewesen zu sein; denn er hat seinem Buche sein Bildnis beigefügt, und man sollte kaum glauben, daß in dem nicht unschönen Kopfe, dessen Antlitz mit keckem Schnauz- und Knebelbart geziert ist, so großer Wahnwitz Platz gehabt hätte. Unter einem Wust gelehrter und lateinischer Phrasen schlug er in seinen Predigten das reinste Blech. oder Teufel in sichtbarer Gestalt wurde häufig erblickt. War man auf der Reise, und gewahrte man ihn am Himmel, so mußte man eilends ein Wagenrad abziehen und es verkehrt anstecken. Nach noch vorhandenen Abbildungen hatte er einen gewaltigen feurigen Rachen, große Zunge und Augen, spitze große Zähne, Schweinsohren und Borsten, dabei die Gestalt eines Fisches. Denjenigen, die mit ihm gut standen, brachte er Würste und Eier durch den Schornstein. Wo er hinflog, war es nicht richtig, da wohnten Hexen und mußten verbrannt werden. Die feurigen Kugeln bedeuteten Pest und Krieg, die Sternschnuppen hatten den Jüngsten Tag gesehen, nahmen die Ruhe der Nacht und bedeuteten den Tod eines Kindes.
Die Feuermännchen oder Irrlichter lockten vom rechten Wege ab, führten in Gruben und Sümpfe, aufs Hochgericht, den Schindanger oder den Gottesacker.
Aus den Farben des Nordlichts machte man Meere von Blut, zerstampfte Getreidefelder, ganze Kriegsheere usw.
Vom Regenbogen wurde gesagt, daß auf ihm die Engel tanzen, und der Regen, der fiel, solange er sichtbar war, half gegen alle Krankheiten. Auch erzeugte er die goldenen Regenbogenschüsseln oder Sternschosse, die wie vertiefte Pfennige aussahen, und auf denen man Sterne, Strahlen, Vögel, Schlangen usw. erblickte. Wo ein solches Stück im Hause war, gab es Glück.
Der Hof des Mondes oder der Sonne setzte in Angst und Schrecken, ebenso wie Nebensonnen, Nebenmonde und Kometen. Bei Gewittern glaubte man, das Einschlagen des Blitzes geschehe vermittels eines Donnerkeils, von dem man mehrere gefunden haben wollte und sogar in Naturaliensammlungen aufbewahrte. Es waren jedoch uralte Streitkolben. Ein Donnerkeil im Hause sollte dasselbe gegen den Blitz schützen, und wenn man den Kühen das Euter damit bestreiche, bekämen sie durch Zauberei verlorene Milch wieder. Sie schwitzten angeblich bei Veränderungen des Wetters, und wenn es donnerte, bewegten sie sich. Sie sollten auch einen dicht um sie gewickelten Faden vor dem Verbrennen bewahren und nach Schwefel riechen, wenn man sie an anderen Steinen reibe.
Das Holz eines vom Blitz getroffenen Baumes sollte Zahnschmerzen heilen und Backofen zerspringen machen.
Beim Gewitter hielt man sich vorm Einschlagen sicher, sobald Feuer im Ofen oder Licht auf dem Tische brannte.
Ein durch den Blitz in Flammen geratenes Haus konnte nur mit Milch gelöscht werden.
Man glaubte allen Ernstes die Fabel, daß einst ein Gewitter sieben Tage am Himmel gestanden, bis eine Stimme vom Himmel gerufen habe: Zündet Kardobenedikten an, daß ich mich verziehen kann. Als man die ersten Blitzableiter anbrachte, hieß es allgemein, es sei frevelhaft, sich dem Strafgerichte Gottes zu widersetzen.
Zum Bier legte man während des Gewitters Nesseln, um das Sauerwerden zu verhüten.
In der Gegend, wo ein Selbstmörder begraben lag, tat angeblich das Gewitter Schaden.
Sonnen- und Mondfinsternisse erregten selbstverständlich Bestürzung, da man noch weit davon entfernt war, ihre Ursachen zu kennen. Als im Jahre 1654, den 2. August, eine Sonnenfinsternis entstand, wurden die Leute in große Angst versetzt. Die Nürnberger hielten sie für eine Anzeige und Folge der Blindheit des menschlichen Herzens und des kommenden göttlichen Zorns, für ein Vorbild des Todes und für den schrecklichen Verkündiger des einbrechenden letzten Gerichts. Man verkaufte nichts auf dem Markte, kein Vieh wurde auf die Weide getrieben, alle Brunnen wurden zugedeckt, weil man glaubte, es falle Gift aus der Luft, und aus Furcht vor dem Tode nahmen 2285 Personen in den Kirchen das heilige Abendmahl. Die dunkeln Flecken, welche im Monde wahrgenommen werden, hielt man für einen Mann, der, weil er ein Holzbund gestohlen, zur Strafe mit demselben im Monde stehen müsse.
Abergläubische Leute, welche die Ursache der abwechselnden Lichtgestalten des Mondes nicht kennen, haben darin etwas Geheimnisvolles gesehen und dem Mond Wirkungen angedichtet, die er nie haben kann. So glaubte man, daß der Vollmond Krebse, Austern, Muscheln und Schnecken voller mache als der abnehmende – daß die zur Zeit des Vollmondes versetzten Blumen voller werden – daß das Holz bei zunehmendem Monde mehr Feuchtigkeit besitze als beim abnehmenden – daß die im vollen Mond geschlachteten Tiere fetteres und schmackhafteres Fleisch haben als die im abnehmenden geschlachtet werden – daß die im vollen Mond abgewöhnten Kälber bessere Kühe werden und größere und von Milch strotzendere Euter bekommen als solche, die man zu einer anderen Zeit gewöhnt – daß der Mohrrübensamen im abnehmenden Mond müsse gesäet werden, weil die Rüben sonst zu sehr ins Kraut wachsen – daß aus den Eiern, mit welchen eine Gans zur Zeit des neuen Mondes gesetzt wird, Gänse ausgebrütet werden, die blind sind – daß, wer kein Geld hat, sich hüten müsse, damit nicht der Neumond ihm in den Beutel scheine, weil sonst, solange dieser Monat währt, Geldmangel bei ihm sei. Zur Zeit des Neumonds soll es auch schädlich sein, Samen auszustreuen. Manche Leute glauben auch, daß der Weizen nicht brandig werde, wenn man ihn auf den Tag, an welchem der Michaelsmond voll ist, säet. Laut einer im Löwenberger Ratsarchiv befindlichen Originaleingabe vom Jahre 1489 bat das Bäckermittel in Löwenberg in Schlesien beim E. E. Rate: Er möchte doch vernünftige Mathematiker, erfahrene Astrologen und verständige Astronomen anstellen und zur Stadt berufen, damit diese, wenn Gott unser aller Schöpfer und die heilige Dreifaltigkeit in ihrem unerforschlichen Rate beschlossen hätten, die Stadt mit Teuerung heimzusuchen, die klugen Männer es vorher prophezeien und ansagen könnten; sie würden dann beizeiten Getreide in Vorrat anschaffen, damit, wenn die Not käme, niemand hungern dürfe.
Zuweilen sollte es auch Schwefel regnen; denn man sieht nach dem Regen auf dem Wasser bisweilen gelbliche Stäubchen, die das Ansehen des Schwefels haben. Der Abergläubische fürchtete dann Krieg, weil zum Pulver Schwefel gehört, Pest, weil seiner Meinung nach die Luft schon halb vergiftet ist, Erdbeben, weil die in der Erde befindlichen großen Schwefelmassen bald losbrennen werden.
Zur Zeit eines Donnerwetters sollte es bisweilen Feuer regnen, so daß unter dem Regen feurige Tropfen bemerkt würden. Auch Steine, Frösche, Fische, Korn, Wolle usw. soll es geregnet haben.
Außerdem bildete man sich ein, daß sich zuweilen das Wasser in Blut verwandle, und hielt es für die Anzeige eines sehr blutigen Krieges. Schon manchmal ist hierdurch eine ganze Gegend in Angst versetzt worden, bis man endlich fand, daß rote Tierchen, sogenannte Wasserflöhe, sich so vermehrt und in so ungeheurer Anzahl auf der betreffenden Wasserfläche verbreitet hatten, daß das Wasser wie Blut aussah.
Neu entstehende Quellen sollten gegen alle Krankheiten helfen.
In teueren Zeiten glaubten die Leute, Gott tue dadurch ein Wunder, daß er auf außerordentliche Weise Brot gebe. Man fand Mondmilch, eine feine weiße Kalkerde, hielt sie für auf außergewöhnliche Weise gesandtes, für » Berg- und Himmelsmehl«, und verwandte es zum Kochen und Backen. Bei der großen Unkenntnis in der Naturwissenschaft fabelte man eine Menge Albernheiten über alle Tiere, deren Lebensweise weniger bekannt war. So über Regen- und Ohrwürmer, Blutegel und Blattläuse, die man Meltau nannte, über Heuschrecken, Grillen, Ameisen, Heimchen, Blattwespen, Spinnen, Krebse, Schlangen, Eidechsen usw., denen man die lächerlichsten Eigenschaften zuschrieb. Beispielsweise glaubte man, die Hähne legten alle sieben Jahre ein Ei, aus welchem, wenn es von einer Kröte ausgebrütet wurde, Basilisken zum Vorschein kämen. Die Schlangenbeschwörer sollten durch Zauberformeln die Schlangen an gewisse Orte bannen können. Der Vogel Greif gab zu einer Unzahl von Fabeln die Veranlassung. Der Neuntöter sollte täglich neun Tiere umbringen, und am Dasein des Phönix, des Lindwurms und des Drachens zweifelte niemand. Schwalben und Störche waren glückbringende Vögel; nur die Nachtschwalbe nicht. Sie nannte man Hexe oder Ziegenmelker, weil sie nachts den Ziegen die Milch aussauge. – Der Rattenkönig mit zehn Köpfen ist vielfach gesehen worden, und man glaubte, wo ein Stück Rattenkönig im Hause sei, bleibe keine Ratte.
Vom Renntiere glaubte man, man brauche ihm nur ins Ohr zu sagen, wohin die Reise gehen solle, Zügel brauche man nicht.
Vom Stachelschweine erzählte man, daß es seine Stacheln wie Pfeile auf seine Verfolger abschießen könne, und vom Igel, daß er Birnen und Äpfel abschüttele und den Kühen und Ziegen die Milch aussauge.
Auch die Edelsteine spielten im Aberglauben eine Rolle. Emil Romminger schrieb im »Thüringer Hausfreund« darüber: »Die Edelsteine, diese glänzenden, harten, einer hohen Politur fähigen, schönen Schmucksteine, von nur geringem praktischen Wert, aber einer außerordentlichen, durch ihre Seltenheit hauptsächlich bedingten Kostbarkeit, sind im Altertum sowie im Mittelalter, ja bis in die Neuzeit hinein vielfach mit abergläubischen Ansichten in Zusammenhang gebracht worden, indem man ihnen gar außergewöhnliche Kräfte und wundersame Wirkungen zuschrieb. Daher auch ist es zu leiten, daß die Materie, mittels welcher sich unedles Metall in Gold verwandeln, jede Krankheit sich heben und das menschliche Leben sich beliebig verlängern ließ, der › Stein der Weisen‹ genannt wurde, deshalb ist es ein Stein, welcher in der bekannten, einer alten orientalischen Sammlung entlehnten Fabel des Boccaccio demjenigen, der ihn besitzet, die Herrschaft über seine Brüder sichert, und derselbe Stein, in einen Ring gefaßt, ist es, dem in Lessings ›Nathan der Weise‹ die sittliche Eigenschaft anhaftet, ›bei Menschen beliebt zu machen‹.«
Das wundersüchtige Mittelalter begnügte sich nicht damit, wirklich vorhandenen Edelsteinen absonderliche Wirkungen beizulegen, es erdichtete vielmehr noch Steine, samt deren Namen und Eigenschaften.
So sprach man damals von dem Stein Quirim, der sehr schwer, und zwar nur im Neste der Wiedehopfe zu finden war. Legte man ihn einem schlafenden Menschen unter den Kopf, so mußte derselbe alles ausplaudern, was er in wachem Zustande entweder sorgfältig als Geheimnis bewahrte oder doch nur seinem vertrautesten Freund unter dem Siegel der Verschwiegenheit mitteilte.
Da fabelte man ferner von dem Stein der Unsichtbaren, der nur in einem Zeisigneste und selbst da nur von einem Vogel zu entdecken war. Wollte man seiner habhaft werden, so mußte man aus einem Rabenneste einen Raben nehmen, ihn erwürgen und neben dem Neste an einem recht starken Stricke aufhängen. Die alten Raben vermochten diesen herzzerreißenden Anblick nicht zu ertragen und bemühten sich, den Strick zu durchbeißen, was ihnen natürlich nicht gelang. Der alte Rabe wußte aber Rat, er flog von dannen und kehrte nicht früher wieder heim, als bis er den Stein der Unsichtbaren in einem Zeisigneste erspäht hatte und ihn mitbringen konnte, um ihn dem toten, hängenden Nachkömmling in den Schnabel zu stecken, wodurch er sofort durch des Kleinods Kraft unsichtbar wurde, also den Blicken der alten Raben entschwunden war. Jetzt konnte der begehrliche Mensch den kostbaren Stein sich aneignen, denn nur der Vogel, nicht auch der Strick war unsichtbar geworden. Selbstverständlich konnte sich mit Hilfe dieses gar erwünschten Steines auch der Mensch zusamt der Kleidung, so er auf dem Leibe trug, unsichtbar machen. So auch erzählte man von einem Steine »Juperius«, dem alles Wild zuliefe, weshalb ihn sich die Jäger sehnlichst wünschten.
Einige Beispiele werden dartun, welche Vorstellung man sich von der geheimnisvollen, mächtigen Wirkung verschiedener wirklich existierender Edelsteine ehedem gemacht hat.
Berücksichtigen wir zunächst das Altertum.
Der Achat war bei den Alten ein sehr geschätzter Stein, mehrfach besungen von Orpheus, welcher rühmend hervorhebt, daß der Achat den Mann bei Frauen angenehm mache, gegen den Stich des Skorpions helfe und gepulvert mit gutem Weine gesund und angenehm zu trinken sei.
Adamas, der Unbezwingliche (griechisch), der Diamant, sollte sich gleichwohl, in das Blut eines Ziegenbocks gelegt, darin auflösen, dieses Blut aber, als Medizin getrunken, jede Krankheit heilen. Ferner sollte schon die Nähe dieses Steines dem Magnet seine Kraft nehmen, die er auch nach der Entfernung des Steines nicht mehr wiedererlangte.
Der Stein, den wir Rubin nennen, wurde von den Alten seines Glanzes wegen maßlos gepriesen. Ein Römer Vartomanus berichtet, daß ein solcher, den der König von Pegu besessen, so sehr geleuchtet habe, daß man bei seinem Schein in finsterer Nacht ebensogut habe sehen können, als ob die Sonne schiene, und Bischof Epiphanius berichtet von ihm, er scheine durch die Kleider, welche ihn bedeckten, wie eine Flamme hindurch. Daher hieß er bei den Griechen Anthrax (glühende Kohle), bei den Römern Carbunculus, woraus das deutsche »Karfunkel« entstanden ist.
Den Spinell schätzten die Alten unter dem Namen Balassus oder Pilatius als die Mutter, Wohnung oder Palast, in welchem der Karfunkel erzeugt wird und sitzet.
Der Saphir war nach Dioscorides dem Apollo geheiligt, und wer ihn trug, erwarb die Gunst der Fürsten, war sicher vor Zauberei, Bande und Gefängnis.
Der Smaragd war dem Merkur zugeeignet, und nach Plinius wuchs der schönste szythische Smaragd in Goldgruben, worin die Greife nisten und ihn bewachen.
Der Topas (so nannten die Alten den heutigen Chrysolith) war, pulverisiert und mit Wein getrunken, ein sicheres Mittel wider Fieber und Melancholie.
Der Türkis hatte die gar vortreffliche Eigenschaft, alle Feindschaft aufzuheben und namentlich bei Zwistigkeiten Mann und Frau zu versöhnen.
Übrigens waren die Alten der Ansicht, daß die Edelsteine aus den Ausdampfungen der Erde entständen, und da dieselben in den heißen Ländern durch die wärmere Sonne begünstigt würden, sahen sie darin den natürlichen Grund, daß in besagten Gegenden mehr edle Steine gefunden würden als in kälteren.
Im Mittelalter verlieh:
Der Achat die Kraft, alle Gefahren abzuwenden, alles Irdische zu besiegen und die Kräfte des Herzens zu heben, so daß sein Eigentümer mächtig, wohlgefällig und fröhlich wurde.
Der Adlerstein (eine Art Toneisenstein), am linken Arme getragen, erweckte Liebe zwischen Mann und Weib.
Ein gar köstlich tugendreicher Stein war der Beryll, wie folgende Verse beweisen:
»Mehr lob ich Edelgestein,
Der Barillus ist ein,
Gut Tugend er hat
Als von ihm geschrieben stat;
Er macht, daß Mannes Leib
Lieb hat sein ehlich Weib,
Er ist dem Auge gut,
Welches thränen thut,
Wer trinkt davon zur Stund,
Dem wird das Milz gesund.
Trägt ihn bei ihm ein Mann,
Deß Red wird lobesan
Und wo der Stein ist
Da mag zu keiner Frist
Der arge Teufel syn,
Der Stein vertreibet ihn.«
Der Besitz eines großen Diamanten schützte einerseits gegen Hexerei und Zauberei und gab andrerseits dem Eigentümer Gewalt über die unterirdischen Mächte, so daß kein stärkeres Beschwörungsmittel existierte, als eine gewisse Formel, auf einen flachen Diamant gegraben. Hexen vermochten sich durch ein Amulett aus Diamant gegen die Qualen der schmerzhaftesten Folter unempfindlich und fest zu machen, und Fürsten sich gegen Vergiftung zu schützen, indem sie nur einen Diamanten in den Becher werfen durften, aus dem sie ihren Wein tranken. Bei Frauen beseitigte der Diamant alle Schwermut, und diese liebenswürdige Wirkung soll sich durch ihn bei geschickter Anwendung noch bis auf den heutigen Tag in der Regel erzielen lassen.
Wollte man unsichtbar werden, so mußte man einen Opal, in ein Lorbeerblatt gewickelt, bei sich tragen, der dann von solcher Tugend war, daß er die Umstehenden blind machte, weshalb er auch der »Patron der Diebe« war.
Der Smaragd schärfte den Verstand, vermehrte den Reichtum und gab, sofern man ihn unter die Zunge legte, die Fähigkeit, Künftiges vorherzusagen.
Solcher Beispiele ließen sich wohl noch mehrere auffinden, indessen genügen ja die hier angeführten schon, um darzutun, auf welche Irrwege die Menschen geraten konnten, solange ihnen das Licht der Wissenschaft noch nicht hell genug leuchtete.
Was man unter Hexen und Hexenmeistern verstand, wissen wir. Daß sie aber mit Aufhören der Hexenprozesse noch fortlebten, wenigstens in der Phantasie der Abergläubischen, könnte uns fast zum Einstimmen in Schillers Seufzer veranlassen: »Weh denen, die den Ewigblinden – des Lichtes Himmelsfackel leihn! – Sie strahlt ihm nicht, sie kann nur zünden und äschert Städt' und Länder ein.«
Wohnte da noch im Jahre 1786 ein Zauberer in der damaligen Grafschaft Lippe-Detmold, auf der sogenannten Knetterheide, unweit Schöttmar, der, weil er Kuren unternahm, gestohlene Sachen nachwies pp. in jener Gegend gute Geschäfte machte. Vor ihm fürchteten sich die Diebe mehr als vor der Obrigkeit. Einst wurde in jener Gegend einem Manne sein ganzes Fleisch gestohlen. Wütend darüber erklärte der Bestohlene öffentlich, er wolle nach der Knetterheide gehen und dem Diebe ein Auge ausschlagen lassen. Er tat das auch, fand aber den Hexenmeister nicht zu Hause. Während dieser Abwesenheit wurde das Fleisch jedoch in die Behausung des Abwesenden zurückgebracht. Hätte er den Hexenmann daheim angetroffen, so hätte ihn derselbe vermutlich mit dem Bescheide nach Hause geschickt, daß er, wenn sein Fleisch in drei- oder viermal 24 Stunden nicht wiedergebracht würde, wiederkommen möchte, und daß der Dieb dann ein Auge verlieren solle. – Einst starb ein Bauer, der durch das Einstoßen eines Zweiges in das Auge dasselbe verloren hatte. Dieser Verlust fiel gerade in die Zeit, in welcher ein Bestohlener dem Diebe durch den Hexenmeister – wenigstens wie er glaubte – ein Auge hatte einschlagen lassen. Was war natürlicher, als daß der Einäugige unter dem Verdacht des Diebstahls starb! Durch solche Zufälligkeiten steigen die sogenannten Hexenmeister im Ansehen. Man hielt jeden für einen Hexenmeister, dessen Tun man nicht begreifen konnte. Auch der große Erfinder der Luftpumpe, Otto von Guericke, hatte das Schicksal, für einen Zauberer gehalten zu werden.
Noch zu Ende des 18. Jahrhunderts kurierte ein Herr auf folgende Weise von Hexenwahn. Derselbe befand sich auf einem Dorfe, als gerade eine Anzahl Personen einen Schäfer geknebelt anbrachten. Der Herr fragte, was der Mann Böses getan habe, und erhielt zur Antwort, es sei ein Hexenmeister, den man der Gerechtigkeit überliefern wolle. Der Herr ersuchte, ihm den Menschen zunächst zu überlassen, was auch geschah. Als er mit ihm allein war, sagte er zu ihm: »Freund, du mußt mir die Wahrheit sagen. Hast du wirklich ein Bündnis mit dem Teufel?« – »Ja, mein Herr!« erwiderte der Schäfer. »Ich gestehe, daß ich alle Tage in die Versammlung der Hexen komme. Einer von meinen Freunden hat mir einen Saft gegeben, welchen man einnehmen muß; ich bin seit drei Jahren unter den Zauberern!« Überhaupt redete der Schäfer von den Teufeln so, als wenn er wirklich täglich in ihrer Gesellschaft gewesen wäre. Da forderte ihn der Herr auf, ihm die Arznei zu zeigen unter dem Vorgeben, ihn nachts in die Hexenversammlung begleiten zu wollen. »Das können Sie«, antwortete der Schäfer, »sobald es Mitternacht sein wird!« Als die Mitternachtsstunde kam, sagte der Herr: »Nun, die Zeit unserer Abreise ist da!« Da nahm der Schäfer eine Büchse aus seiner Tasche, in welcher er Opium hatte; er nahm für sich in der Größe einer Nuß und gab dem Herrn ebensoviel und sagte: »Das müssen Sie einnehmen und hernach sich unter den Schornstein legen. Dann wird der Teufel in Gestalt einer großen Katze kommen und Sie in die Versammlung führen.« Der Herr nahm die Salbe und stellte sich, als könne er sie nicht einnehmen, wenn er sie zuvor nicht in etwas Wohlschmeckendes gewickelt hatte, ging in die Kammer, nahm Backwerk, legte Oblaten darauf und sagte, als er wieder zum Schäfer kam: »Ich bin bereit!« – »Wir wollen uns beide auf den Boden legen und so einnehmen!« antwortete der Schäfer. Beide streckten sich nun am Schornstein hin. Der Herr aß sein Backwerk, der Schäfer sein Opium. Kaum waren einige Minuten vergangen, so schien dieser außer sich, schlief ein und redete im Traume tausenderlei Narrheiten. Nachdem er über vier Stunden so geschlafen hatte, erwachte er und sagte zu dem Herrn: »Nun, Sie müssen mit der Art, wie Sie der Bock aufgenommen hat, zufrieden sein. Es ist eine große Ehre, daß er Sie gleich den ersten Tag Ihrer Aufnahme zum Afterkuß zugelassen hat.« Der Herr aber löste dem Schäfer das Rätsel, indem er in seiner Gegenwart einem Hunde von dem Opium eingab, welcher sofort einschlief, Zuckungen hatte, winselte und bellte.
Die Hexen sollten außerordentliche Dinge tun können; daher sind die Mittel, mit denen man sich gegen sie zu verwahren suchte, oft sehr seltsam. Wer Geld liegen hat, sagte man, der lege Kreide dazu, damit Hexen keinen Teil daran haben oder etwas davon nehmen können, denn sie sollen die Kunst wissen, es unter den Schlössern hervor heimlich zu entwenden.
Wider das Behexen sollte es gut sein, etwas von der Kleidung eines armen Sünders bei sich zu führen. Auch sollte ein solcher Lappen dienen, die Pferde fett zu machen, die man damit putzt – und gut füttert.
Wenn der Drache oder die Hexen nichts vom Gelde holen sollten, so sollte man es mit reinem Wasser abwaschen und ein wenig Brot und Salz dazulegen.
Wenn eine Hexe fragte, sollte man nicht mit Ja antworten, sonst konnte sie durch Zauberei etwas nehmen. Auch sollte man sich von ihnen, am wenigsten Freitags, nicht mit der Hand über den Rücken fahren lassen und drei Schritte weit von ihnen abtreten, weil man sich sonst vor ihrer Zauberei nicht hüten könne. Wenn die Hexen einen verzauberten, so sagten sie, nach dem Glauben der Leute, folgendes zum Teufel: »Tue hin und fahre hin in N., und martere und plage und beiße den in aller und meines Teufels Namen.« Wer sich dann aber nackend auf den Mist setzte und, indem er seine Notdurft verrichtete, Käse und Brot aß, der wurde das Übel wieder los. Ehe man sich schlafen legte, verwahrte man noch die Tür mit seinem Überwurf (Kittel), um Hexen und Gespenster dadurch abzuhalten. »Wenn Hexen einen hanfenen Strick an die Torsäule hängen«, sagten die Abergläubischen, »daran melken und sagen: ›Du, Teufel, (Strutzfeder, Wittfedder oder wie man ihn sonst hieß), bringe mir Milch‹, so können sie alle Morgen und Abend so viel bekommen, als sie wollen; denn der Teufel melkt die Kühe eines reichen Nachbarn so lange, als die Hexe am Stricke zieht, und bringt ihr dann die Milch. Von dieser Milch läßt sich aber nicht gut Butter machen.« Wenn Hexen sagen: »Strutzfeder pp., bringe mir Eier«, so bringet er sie. Wenn eine Frau buttern will, so soll sie ein dreikreuziges Messer an das Butterfaß stecken, oder drei Kreuze an dasselbe schreiben, um den Hexen die Macht zu nehmen, dabei zu schaden. Hexenbutter glaubte man daran zu erkennen, wenn sie im Wasser untersinke.
Die Katzen hielt man für diejenigen Tiere, in welche die Hexen sich am leichtesten verwandeln könnten. Wenn in und an einem Hause die Katzen sich häufig bissen, sollte es nicht ganz richtig sein; denn in dieser Gestalt, glaubte man, machten die Hexen einander Besuche. –
Das Nestelknüpfen Über die zahllosen Störungen der ehelichen Freude durch Nestelknüpfen klagt schon der Franzose Bodin, der versichert, es gebe mehr als 50 Arten des Nestelknüpfens. war die Knüpfung eines Knotens, wobei eine unbekannte Kraft vermittels Segensprechens wirken sollte. Man sagte, es könne einem die Mannheit benommen werden, während der Zeit, da verlobte Personen vor dem Altar stehen, um sich durch priesterliche Einsegnung zu verbinden, mit besonderen Zeremonien (Feierlichkeiten) und Worten in das Hosenband einen Knoten bände, welches dann Kraft habe, wenn die Verlobten nicht nahe genug aneinanderständen. Man brauchte gegen das Nestelknüpfen lächerliche Mittel. Man sollte einen Ring am Finger tragen, in welchem das rechte Auge eines Wiesels eingefaßt sei, Hauswurzel essen, durch den Trauring sein Wasser laufen lassen, sich mit dem Zahn eines toten Menschen räuchern, von einem Grünspecht essen, über eine Türschwelle gehen, unter welcher Quecksilber in einem mit Wachs zugestopften Federkiel gelegt ist. Eine Pomeranze ganz verschluckt, und nachdem sie so wieder weggegangen, gerieben – sollte verliebt machen, wenn man sie jemand irgendwo eingebe. Man glaubte auch, wenn man einen Frosch in einer durchlöcherten Schachtel in einen Ameisenhaufen setze, so finde man an dem zurückgebliebenen Gerippe eine Spitze, welche die Eigenschaft habe, denjenigen verliebt zu machen, der damit gestochen oder nur berührt werde. Viele standen in dem Wahne, daß, wenn ihre Fußstapfen aufgenommen und in den Rauch gehangen würden, sie ganz verkommen müßten. Andere, daß dies durch das Anschreiben gewisser Zeichen und durch das Anschmieren gewisser Salben an die Haustür oder durch Vergrabung einer Kröte oder Eidechse unter die Türschwelle geschehen könne. – Die Kinder sollten dem Behexen und Beschrienwerden besonders ausgesetzt sein. Wenn man wissen wollte, ob ein Kind behext sei, sollte man es an der Stirn lecken. Schmecke es hier salzig, so sei es wirklich an dem. Nun gebrauchte man Kehricht aus vier Winkeln, Abgeschabtes von vier Tischecken, räucherte das Kind mit neunerlei Holz usw. Starb es demungeachtet, so hieß es, es sei »auf den Tod behext« gewesen. – Die beste Probe, um zu sehen, ob ein Kranker beschrien sei oder nicht, sollte die sein: »Man soll Frauenflachs oder Rufkraut kochen, damit den Kranken baden und das Bad hinter das Bett setzen. Läuft es zusammen, so ist er beschrien, läuft es nicht zusammen, so ist er es nicht. Das Wasser muß stillschweigend und zu einer gewissen Zeit geholt und nicht dem Strom entgegen geschöpft werden.« – Wenn man ein Kind mit dem Besen schlägt, so verdorrt es. Wenn es aus Hunger, Durst oder weil ihm etwas schmerzt, schreit, so hat es den Pfizwurm, der es im Leibe kneipt. Man band ihm dagegen einen lebendigen Schmerlfisch auf den Nabel. Wenn nun dieser auf der Seite, auf welcher er auf dem Bauch des Kindes lag, von der Wärme abfaulte, so glaubte man, der Wurm habe ihn abgefressen. Nun räucherte der Abergläubische mit Berufskraut, oder er legte venedische Seife und Spießglas in einer Nußschale auf den Nabel des Kindes. Dies half, jedoch nicht eher, als bis das Kind satt zu essen bekam oder ihm nichts mehr wehtat.
Wenn ein Kind nicht recht gedieh, riet man, so wende einen Taler daran und lasse es von einem Pater überlesen. – Wer Brot und Salz bei sich trägt, soll vor Zauberei sicher sein. Man sollte die Kinder mit Kot an der Stirn bestreichen, um sie vorm Behextwerden zu bewahren. –
Das Bannen galt für eine geheime Kunst. Man glaubte durch Zeichen, die man in die Luft hinmachte und durch Aussprechung gewisser Worte einen Menschen dergestalt festmachen zu können, daß er von einem Orte nicht wegkommen können, sondern unbeweglich bleiben müsse. Auf diese Weise wollte man Diebe festmachen, daß sie nicht von der Stelle, Vögel, daß sie nicht wegfliegen, wilde Tiere, daß sie nicht davonlaufen konnten. –
Man glaubte auch, man könne Gewehre besprechen, daß sie nicht losgehen konnten, sowie an Freikugeln und dergleichen.
Auch an Verwandlungen, wonach gewisse Menschen nach Gefallen eine andere Gestalt annehmen und dann wieder in der menschlichen erscheinen konnten, glaubte man. Sie hatten angeblich vom Satan die Gabe erhalten, sich in Hasen, Katzen, Hunde und dergleichen zu verwandeln. Besonders hat man geglaubt, daß die Menschen sich in Werwölfe verwandeln, d. h. die Gestalt eines Wolfes annehmen könnten. Von ihnen sagte man, sie bewirkten durch Anlegung eines Riemens um den Leib die Verwandlung in einen Wolf, als welcher sie durch Wälder und Felder streiften und alles zerrissen und fraßen, was ihnen vorkäme.
Auch an das Sichunsichtbarmachen einzelner Menschen und das Versetzen an einen anderen Ort glaubte man und nannte dies »bei lebendigem Leibe spuken«. –
Sympathie und Antipathie (Geheimkraft und natürlicher Widerwille) wurde auf jede mögliche Art angewandt. Diejenigen, welche sich schämten, gewisse Dinge und Krankheiten mit allen alten Mütterchen für Hexereien und Wirkungen des Teufels zu halten, nahmen zur Sympathie und Antipathie ihre Zuflucht und suchten die Möglichkeit und die Ursache davon durch feine Ausflüsse zu erklären, die aus dem menschlichen Körper oder in denselben übergingen und darin etwas bewirkten. Hast du einen Kropf, sagt der, der hieran glaubt, so stelle dich mit dem Gesicht gegen den Mond, nimm einen Stein, der vor dir liegt, bestreiche damit den Kropf dreimal und wirf ihn hinter dich; tue dies bei drei zunehmenden Monden nacheinander. – Wenn dein Hals angeschwollen ist, so winde einen gelben Wachsstock da herum, oder wenn du die »gelbe Sucht« hast, so stehle den Schmierkübel von einem Fuhrmannswagen und sieh hinein. – Hast du einen Schaden am Leibe, so nimm ein Ei und trink es aus, laß deinen Urin in die Schale, verwahre es in einem Säcklein und hänge es in den Rauch. – Schneidest oder stichst du dich, so schmiere die Nadel oder das Messer mit Fett, verbinde es mit einem Läppchen und lege es an einen temperierten Ort, die Wunde verbinde mit einem trockenen Lappen, so heilt sie zu Abscheuliche Rezepte enthält das »Medikamentenbuch des Johann Keller in Pottenstein«, das vermutlich aus dem Anfange unseres Jahrhunderts stammt. Unter anderem wird gegen ein sogenanntes Überbein folgendes Verfahren empfohlen: »Schmiere das Überbein mit Skorpionöl, lege täglich ein frisches Blatt von der Hauswurzen über oder einen lebendigen Laubfrosch und lasse selben darauf sterben. Oder lege eine Bleikugel auf, mit der ein Wild geschossen ist, dann hilft es desto geschwinder.« Gegen den Krebs wird angeraten: »Nimm eine Kroth (Kröte), spieße sie auf und dörre sie an der Sonne; hernach schlage eine Schlange tot, brenne beide in einem Haufen zu Pulver und streue es auf die kranke Stelle; dieses tötet gewiß den Krebs. Oder lege Schafgall, Geißkot mit Honig über.« Wer an Epilepsie litt, dem wurde verordnet, er nehme »im Märzen einen jungen Raben, so noch im Nest sitzt, verbrenne ihn mit aller Substanz und nehme öfter davon ein«.. Wenn du Warzen hast, nimm einen Faden, umwickele sie damit und wirf ihn dann unter eine Dachrinne; wenn darauf der Faden verfault, geht auch die Warze weg. Oder gehe des Morgens früh, wenn es geregnet hat, stillschweigend auf den Kirchhof, wasche dich mit dem Wasser, das auf einem Leichenstein stehengeblieben ist; gehe stillschweigend wieder zurück, dann vergeht sie. Oder nimm ein Hölzchen und schneide soviel Kerben hinein, als du Warzen hast, wirf es heimlich dem Klingelmann in den Korb. – Wenn dich ein Hund gebissen hat, so sieh, daß du Haare von ihm bekommst, lege sie darauf, dann wird die Wunde heilen. – Wenn dir die Nase blutet, so laß das Blut in eine auf Kohlen gesetzte Eierschale oder auf ein aus Strohhalmen gelegtes Kreuz laufen, dann hört es auf. Wenn dir jemand ein Messer schenken will und du nimmst es von ihm, so wird er dir gram. – Wenn du das Brot ißt, von dem ein anderer schon gegessen hat, so bekommst du seinen Geiz. Schlage die Kuh, wenn sie nicht still steht und die Milch lassen will, mit dem Stabe eines Bettlers, dann wird sie ruhig stehen usw. usw.
Von Dieben, Gehängten pp. sind von alters her mancherlei Erzählungen im Umlauf, die darauf hinauslaufen, daß, nachdem ein Unschuldiger vom Leben zum Tode gebracht worden, ein außerordentlicher Sturm, Hagel, Regen, Gewitter, wohl gar ein Erdbeben entstanden sei, um den für einen Missetäter Gehaltenen zu rechtfertigen. Wenn aber so etwas Außerordentliches geschehen sollte, dann soll auch das Schwert des Scharfrichters in eine außerordentliche Bewegung geraten. An dem Galgen hängt ein Dieb schon längere Zeit. Ein Fuhrknecht zwickt ihm die Teile des Fingers ab, woran die Nägel sitzen und womit der Diebsgriff geschehen ist und läßt sie in den Handgriff seiner Peitsche einflechten, woraus, wie er glaubt, die Wirkung entsteht, daß, wenn die Pferde mit dieser Peitsche getroffen werden, sie den Wagen auch in dem tiefsten Morast nicht stecken lassen. Der Weinschenk sucht einen Daumen zu bekommen. Gewinnsüchtige Spieler tragen einen solchen in der Absicht herum, und Wirte glauben, daß dadurch viel Gäste herbeigezogen werden. Der Strick des Gehängten ist schon lange um nicht geringen Preis an abergläubische Weibsleute verkauft, welche ihn ihrem Vieh, wenn es die Würmer pp. hat oder gar behext ist, mit Vorteil umhängen. Wer den Nagel bekommen kann, der beim Hängen gebraucht wurde, der hält sich gesichert gegen alle Hexereien pp. –
Eine Mutter muß den Kindern zum ersten Male die Nägel abbeißen, damit sie nicht stehlen lernen.
Wenn Diebe von einem neugeborenen Kinde einen Finger anzünden, so kann keiner im Hause aufwachen. –
Wenn jemand geköpft wurde, so kam es vor, daß epileptische Personen das Blut tranken, um von ihrer Fallsucht befreit zu werden. Andere haben mit der kalten Hand des Toten sich den Kropf und andere Auswüchse bestrichen, um sie wegzubringen.
Mit Schatzgraben wurde der größte Betrug getrieben. Zu dem Gelderheben gebrauchte man zuweilen die Wünschelrute. Eine solche Rute ist ein von einer Haselnußstaude in der St.-Johannis-Nacht zwischen 11 und 12 Uhr abgeschnittener Zweig, der die Gestalt einer Gabel hat und gegen den Aufgang der Sonne gewachsen sein muß. Der, welcher sie über dem Punkte, wo die Nebenzweige herausgewachsen sind, abschneidet, muß in dem Zeichen der Waage geboren sein und dabei folgende Worte auch gegen den Aufgang der Sonne sprechen: »Gott grüße dich, du edles Reis, mit Gott, dem Vater, such' ich dich, mit Gott, dem Sohne, find' ich dich, mit Gott des Heiligen Geistes Macht und Kraft brech' ich dich. Ich beschwöre dich, Rute und Sommerlatte, bei der Kraft des Allerhöchsten, daß du mir wolltest zeigen, was ich dir gebiete, und solches, so gewiß und wahr, so rein und klar, als Maria die Mutter Gottes eine reine Jungfrau war, die unseren Herrn Jesum gebar. Im Namen Gottes des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen!« Sonst wird dabei auch wohl das erste Kapitel Johannis: Im Anfang war das Wort usw. oder die Worte des 23. Psalm gesagt: Dein Stecken und Stab tröstet mich. Es mögen Buchen, Birken, Tannen, Eschen, Erlen, Eichen, Äpfel-, Birnen-, Lorbeer- oder Mandelbäume sein, die Rute kann aus allen gemacht werden. Jedoch soll man eine gewisse Art Holz zu jedem Metall wegen Gleichförmigkeit ihrer Teile wählen, als Haseln zum Silber, Eichen zum Kupfer, Tannen zum Blei, Zinn, Eisen, Stahl, Gold. Die von Weiden und Haselnuß aber sollen die besten sein und auf alle Metalle schlagen. Die Wünschelrute wurde auch aus Draht, Papier und Fischbein verfertigt, und es hat Leute gegeben, welche die geheime Wissenschaft zu besitzen vorgegeben und sie für schweres Geld verkauft haben. Solche künstlich gemachte Rute besteht aus zwei Stücken eisernem Draht, welche dergestalt zusammengefügt sind, daß sie sich biegen lassen. Sie sind über und über mit Leder überzogen und mit Zwirnfaden bewunden. Durch das Schlagen dieser Rute sollen alle verborgenen Dinge, vorzüglich die vergrabenen Schätze, auch Erzgänge, Wasserquellen, Marksteine, dann verirrtes Vieh, Mörder, Diebe, unbekannte Wege und Stege entdeckt und sogar auf vorgelegte Fragen richtige Antworten gegeben werden. –
Der Sattler Striedicke hatte schon einmal einen mansfeldischen Prediger zu überreden gewußt, ihm zur Hebung eines Schatzes behilflich zu sein, und der würdige Geistliche hatte seinen Aberglauben durch einen Verlust von 180 Talern und mit einem Verweise, den er für seine Dummheit vom Konsistorium erhielt, büßen müssen. Dennoch hörte Striedicke nicht auf, zu behaupten, daß ihm ein Schatz bestimmt sei, und kurz vor Weihnachten des Jahres 1785 verbreitete sich plötzlich das Gerücht, daß er ihn nun gefunden habe, was vernünftige Leute allerdings nicht glaubten. Da Striedicke jedoch mancherlei Ausgaben machte, die mit seinem Verdienst in keinem Verhältnis standen, wurde die Obrigkeit aufmerksam auf ihn und stellte geheime Nachforschungen an. Diese ergaben, daß das Gerücht, Striedicke habe aus der Ferne eine reiche Erbschaft gemacht, auf Unwahrheit beruhte. Bald darauf wurde das Rätsel durch eine Witwe gelöst, welche Striedicke, weil sie die Miete nicht bezahlen konnte, aus dem Hause warf. Die Frau sagte aus: In der früher von ihr bewohnten Stube sei, wenn man ein Brett des Fußbodens aufhebe, eine Öffnung, durch die man den darunter liegenden Keller des Striedicke übersehen könne. Gegen Weihnachten habe sie einmal viele Personen darin beobachtet, unter denen sie indes nur Striedicke, seine Frau und einen Windmüller aus der Neustadt erkannt habe; die anderen Personen waren verkleidet gewesen, einer als Teufel, der andere als Mönch, der dritte als Geist usw. Man habe einen Kreis geschlossen, und nach vielen Zeremonien habe man mit Schaufeln die Erde aufgeworfen und sei auf einen Kasten gestoßen, den man mit vieler Mühe heraufgebracht. Beim Heben habe der als Teufel Verkleidete so heftig gebrüllt, daß ihr angst und bange geworden sei. Man habe den Kasten einen Augenblick geöffnet, und alles habe daraus wie Gold und Silber gefunkelt, ihn aber sogleich wieder verschlossen, mit mehreren Petschaften versiegelt und zum Windmüller in die Neustadt geschafft. Von jenem Tage datiere das Wohlleben im Striedickeschen Hause. Striedicke und Frau wurden in Untersuchungshaft genommen, und die Untersuchung ergab: Striedicke hatte erfahren, daß der Windmüller einiges Gold liegen habe. Alsbald ging Striedicke wie tiefsinnig in der Nähe der Windmühle auf und nieder. Vom Müller gefragt, was ihm sei, schreckt er auf, starrt den Müller eine Weile mit vielversprechendem Schweigen an und ruft dann entzückt: »Gott! Nun habe ich gefunden, was ich schon lange gesucht habe! Freund! Er ist der glückliche Mann, der mich auf einmal in die blühendsten Umstände versetzen kann. Mit ihm nur kann der Schatz gehoben werden, der mir zugedacht ist.« Damit hatte der Schwindler den Müller schnell gewonnen, und bald gelang es Striedicke, den Toren zu überreden, ihm 200 Taler vorzuschießen, wofür er von dem Schatze 2000 Taler erhalten und zu seiner Sicherheit bis zu der Zeit, da man ihn angreifen dürfe, den Kasten in seine Verwahrung nehmen solle. Das war der Kasten, von dem der Teufel durch sein verzweiflungsvolles Brüllen Abschied nahm. Die Rolle des Teufels hatte der abgedankte Postillon Scharf gespielt und die des Geistes Burkhardt, ein liederlicher Bergmann. Der unterpfändliche Schatz wurde in die Richterstube gebracht, und der Geist und der Teufel mußten den einige Zentner schweren Kasten auf den Tisch heben. Die Siegel waren noch unverletzt. Man fand: Zuoberst einige achtzig kleine, mit Flitter vergoldete Münzen, dann schwere Steine und dazwischen Kiessand, und bei der Haussuchung Werkzeuge und Bücher mit allerlei Formeln und Fratzen, sowie Schmelztiegel, Stempel und ähnliches. Striedicke war sonach ein Schwindler, der seine Strafe erhielt, während der Prediger und der Müller sich in dem Prozesse als habsüchtige Einfaltspinsel gezeigt hatten. –
Eine wohlhabende Bauerswitwe, die Ruschkin in Quappendorf bei Fürstenwalde, wurde vor etwas über hundert Jahren ebenfalls von angeblichen Schatzgräbern betrogen. Zunächst mußte sie eine vorgeblich mit Türkenblut bestrichene Wünschelrute mit 10 Talern bezahlen. Es kamen Boten zu ihr, die von naheliegenden Schätzen redeten und den eigentlichen Schatzgräber, der noch kommen sollte, ankündigten. Er habe überstudiert, sagten sie, und sei Priester gewesen. Die Frau gab Geschenke und was man sonst von ihr forderte, u. a. ein Stück Speck, um es auf dem Kreuzwege einzugraben, und ein Stück Leinwand zur Befriedigung des Geistes. Endlich kam der überstudierte Mann, ein lahmer Husar, und man ging ans Werk. Er führte die Bäuerin um Mitternacht aufs Feld, ließ hier in einem von ihr bezeichneten Kreise ihren Knecht und ihre Magd graben und murmelte unverständliche Worte, um den Geist, der den Schatz bewache, zu zitieren. Darauf erschien eine weiße Gestalt und sprach: »Ich war ein alter General, ich habe meinen Schatz vor dem Feinde vergraben und hatte auf Erden niemand, dem ich dies offenbaren konnte usw.« Dann beschrieb er den eisernen Kasten, gab die Kostbarkeiten und das bare Geld in demselben an, letzteres zu 72 000 Taler. Um dies zu heben, sollten nun 100 Taler, Damast usw. an eine katholische Kirche in der Lausitz gegeben werden, anderenfalls würde allen dreien der Hals gebrochen. Der Schatz sei mit einem Hahn versetzt. Der Hahn wurde gebracht, vom Schatzgräber dem Geist gegeben, worauf letzterer verschwand. Man grub weiter und fand den Kasten. Die Witwe half ihn in ihr Haus tragen, gab dem Geisterbeschwörer mehr, als er für Lesung der Gebete am katholischen Altar gefordert, und ließ ihn ziehen, nachdem er versprochen, in einer bestimmten Zeit wiederzukommen, da nur in seinem Beisein der Kasten geöffnet werden dürfte. Natürlich kam er nicht wieder, und als man schließlich den Kasten öffnete, fand man Steine und Sand darin. Übrigens wurde der Geist entdeckt und bestraft. –
Gegenüber dem Unterberge bei Brotterode liegt ein Berg, Ave Maria, nach anderen auch Ave Markus geheißen. Hier stand vor alten Zeiten eine Kapelle. Trotzdem ist es bis heute daselbst nicht geheuer gewesen. Denn es läßt sich daselbst zuweilen ein gespenstischer Schulmeister sehen, hat ein Gesicht wie Spinnweben und predigt zum Schrecken der Leute von einer auf dem Ave Maria befindlichen Felskanzel. Zuweilen steigt er auch auf einen alten Holzapfelbaum am Laudenbache und hockt sich dann Vorübergehenden auf, die ihn nun ein gut Stück Weg mitschleppen müssen. So kamen einmal Leichenträger von Seligenthal her, und einer von ihnen war der alte Johannes Eck. Kleinschmalkalden lag bereits hinter ihnen; hell schien der Mond, und der gefrorene Schnee glitzerte rings an den Bergwänden. Als sie sich nun umsehen, fehlt einer. Nun rufen sie. Umsonst! Sie bleiben stehen, horchen, rufen wieder – nichts läßt sich hören. Da machen sie sich entschlossen auf und gehen den Weg zurück. Endlich kommt ihnen der alte Eck entgegen, keuchend, von Schweiß durchnäßt, und mit zitternder Stimme erzählt er seinen Kameraden, daß es sich plötzlich auf ihn gelegt hätte, schwer wie ein Schaf, und erst, als sie ihm nahe gekommen seien, sei es wieder von ihm rücklings abgeglitten.
Am Ausgang von Brotterode erhebt sich der Burg-Berg, auf dem man früher noch verfallene Mauerüberreste der einst hier gestandenen Brunosburg gewahren konnte. Auch hier war es nie geheuer. Denn ein Schatz lag hier vergraben, und alle sieben Jahre tauchte zwischen dem Burggetrümmer eine Jungfrau auf, die Hüterin des Schatzes. Sie trug ein langes weißes Gewand mit rotem Bande und war von einem Hündchen begleitet, das am Halsband eine Schelle hatte. Von dem Burgberge stieg sie zum Orte nieder bis da, wo die Gärten beginnen. Sonntagskinder, die ihr begegneten, vernahmen, wie sie leise vor sich hin die Worte sprach:
»Ein Knäblein von sieben Jahren
Mit weißen Haaren
Kann mich erretten!«
Seitdem das letzte Trümmerwerk der alten Brunosburg verschwunden ist, hat man auch die Jungfrau nicht mehr gesehen; ob der Schatz gehoben, ob sie erlöst worden ist? Wer will es wissen?
Nicht nur in der Umgebung Brotterodes aber webt die Sage ihre Schleier, auch drinnen im Orte selbst haben Aberglaube und Volksphantasie so manchen Schatz an Mären und seltsamen Überlieferungen bewahrt. So soll sich früher im alten Gemeindewirtshause zu Brotterode gar oft den Wirtsleuten im Keller ein Geist in Gestalt einer Flitterbraut – so geheißen, weil die Brotteroder Bräute eine aus lauter Goldflitter bestehende Haube am Hochzeitstage zu tragen pflegen – gezeigt haben, während zu gleicher Zeit sich in der Küche eine Züchterin (Brautjungfer) sehen ließ. Letztere griff immer in die Luft, bis endlich ein Mann aufmerksam ward, daß an der Stelle, wo sie hintastete, einige Fädchen auf einem Balken hervorsahen. Nun zupfte er, neugierig geworden, an denselben, bis aus dem morschen Holz ein uraltes Leinwandbeutelchen herausfiel, das einige verschimmelte Silbergroschen enthielt. Von Stund' an war die Züchterin für immer verschwunden. Wohl aber erschien die Flitterbraut alle Tage und Nächte und erschreckte die Wirtsleute durch ihr geheimnisvolles, stummes Wesen. Niemand wagte sie anzureden, und so blieb der Spuk bestehen. Die Wirtsleute verarmten und starben endlich. Neue Bewohner sah das Haus. Unter diesen auch das Töchterlein, schmuck und reinen Herzens. Als dasselbe eines Tages in den Keller hinabstieg, einen frischen Trunk heraufzuholen, sah es die Flitterbraut stehen. Die aber hatte ganz die Züge einer Freundin der Wirtstochter angenommen. Verwundert, da diese Freundin gerade an demselben Tage Hochzeit gehalten hatte, frug das junge Mädchen: »Was machst du da?« Da antwortete die Flitterbraut: »Wisse, daß ich ein seit vielen hundert Jahren an diesen Ort gebannter Geist bin und einen großen Schatz bewache, den du heben sollst und geschwind von seiner Stelle rücken mußt, denn wenn die Glocke die Mitternachtstunde anschlägt und es ist nicht getan, so bleibe ich ewig unerlöst. Darum habe ich die Züge deiner Freundin angenommen, damit du mich fragen solltest, denn ungefragt war mir nicht vergönnt, zu dir zu reden. Eile und hebe den Schatz, der dort an jener Stelle ruht!« Fast zu Tode erschreckt, stieg die Wirtstochter aus dem Keller empor und erzählte ihren Eltern, was sie gesehen und gehört. Da nahm der Vater beherzt Schaufel und Hacke, stieg mit der Tochter wieder hinab und ließ sich die geheimnisvolle Stelle zeigen. Und in der Tat, bald, nachdem er daselbst eingeschlagen, kam ein mächtiger, mit Goldstücken gefüllter Kessel zum Vorschein. So war der Wirt ein reicher Mann über Nacht geworden, und auch Segen war bei dem Golde, denn der erlöste Geist erwies sich dankbar. Noch die Nachkommen jenes Wirtes sind heute reiche Leute. Das Wirtstöchterlein aber verfiel bald in Zittern und Siechtum und starb nicht lange darauf. Denn von denen, welche bei Hebung eines Schatzes zugegen sind, muß immer einer das Glück der anderen mit seinem Leben bezahlen.
Auch sonstige Hausgeister trieben früher ihr Wesen in Brotterode und sollen sich zuweilen noch heute hier und da bemerkbar machen. So auch in einer Bergmühle, die dort stand, wo man die Stätte jetzt die Schleifkothen nennt. Da wohnten ehemals zwei Brüder, Messerschmiede natürlich. Denen waren die Hausgeister gewogen und verhalfen ihnen zu vielem Reichtum. Diese Hausgeister aber trugen sich immer sehr gering und dürftig, so daß die Brüder in ihrer Erkenntlichkeit eines Tages dahin übereinkamen, ihnen neue schmucke Gewänder anfertigen zu lassen. Gesagt, getan. Als der Gevatter Zwirn die roten Jäckchen und blauen Höschen abgeliefert hatte, legten die Brüder dieselben neben die Klingen, welche die fleißigen Geister die kommende Nacht wieder schleifen sollten. Doch kaum sahen dieselben neue Kleidung, da sprachen sie gar traurig:
»Da liegt nun unser Lohn.
Jetzt müssen wir auf und davon!«
Sie nahmen die Kleider und zogen fort, und niemals sind sie wiedergekommen. –
Ein Student zu
Jena, namens
Weber, hatte sich mit zwei Bauern, Gesner und Zenner, vereinigt, einen Schatz zu heben. Die drei begaben sich in den in der Nähe der Stadt befindlichen Weinberg eines Schneiders, dort den Geist zu zitieren, der den Schatz bewachte. Nach der Meinung des Studenten hieß der Geist
Och, und der sollte seinen Diener
Nathanael schicken. Weber schrieb etliche unverständliche, nichts bedeutende Worte an die Tür. Dann setzten sich alle drei nieder und legten
Fausts
Der Doktor
Faust, der vermutlich als historische Person mehr Abenteurer und Scharlatan als Gelehrter war, gehört in die Geschichte der Hexenprozesse nur insofern, als der Pfaffengeist und der von ihm beherrschte Pöbelglaube durch das Märchen von Faust zu beweisen suchen, daß der Teufel auch in den vornehmeren Zauberern seine Untergebenen erkennt. In Wahrheit war nach einer alten Pergamenthandschrift Dr. Johannes Faust eines Bauern Sohn aus Roda im Altenburgischen, obwohl er selber oftmals sagte, er stamme aus Knüdlingen in Schwaben, weil er alldort einen reichen Ohm hatte, den er auch nach dessen Abscheiden beerbte.
»Er war geboren im Jahre 1512 studierte in Wittenberg 1530 und weiter in der Zeit, ergab sich neben der Theologie auch der Weltweisheit. Als er nun im Jahre 1532 in Wittenberg mit sechzehn Doktoren disputierte um des Amtes willen, ward ihm die Theologie zuleide. Hatte er auch gar wohl bestanden, wurde er doch nicht einig mit den Herren. Denn als er zum Exempel gefragt wurde, was er von dem Ablaß halte, sagte er: ›Taugt nichts, sonst konntet ihr ohne Ablaß in die Hölle fahren, jetzt müßt ihr mit Ablaß dreinfahren, hättet also wenigstens eure Gaben sparen können!‹ Und da er vieles bestritt in den alten Büchern und die Herren deshalben in Zorn gerieten, fuhr er heraus mit den Worten: ›Viel, alles ist Gewohnheit und Torheit, aber nicht Wahrheit; doch braucht darüber kein Zagens unter euch zu sein, denn wohl ist die Dummheit, nicht aber die Vernunft ansteckend. Immer ist's aber gewiß, daß die Guten und Besseren, die die alten Schriften auf uns übertrugen und sie für uns auslegten, ehrlich das Ihre getan; das Beste taten aber doch stets die, welche das Gute und Rechte, wie es der Zeit erforderlich, aus sich selber herzustellen wußten.‹
Und als man ihm nun im Grimm erwiderte, das würde der Kirche Regiment zerstören und Lärmen in die Welt bringen, antwortete er: ›Der faulen Kirche Szepter ist aus dem Feigenbaum gemacht, den der Herr zur Unfruchtbarkeit verfluchte, und wenn's am Himmel finstert und auf Erden schwül wird, bedarf's des Blitzes und Donners zur Klärung.‹
Ob solcher Reden wurde insgeheim beschlossen, dem Johannes Faust kein Amt zu geben, obwohl man ihn hinhielt, und so sprach er eines Tages zu den Herren: ›Eure Sach' ist nichts als Ja und Nein, Ja im Versprechen und Nein im Halten!‹, und zog gen Ingolstadt, dort den Wissenschaften zu leben. Als er jedoch leichtlich merkte, daß er auch hier mit der Wahrheit nicht durchkomme, und überall alte Mißbräuch' für ewige Ordnung wollte genommen haben, ergab er sich ganz der Weltweisheit und wurde Mediziner. Aber hierbei erging's ihm gleichfalls übel, und man stellte ihn zurück, weil er mehr wußte, als derzeit in Deutschland zu wissen erlaubt und rätlich war, wollte man von der Gelehrten und Laien Narrheit sein Brot essen. Da sprach eines Tages Johannes Faust zu sich selber: ›Nun, so will ich doch statt der Weltweisheit fortan Weltnarrheit studieren und zusehen, ob ich da weiterkomme, und will's wieder anfangen in Wittenberg.‹
Alsbald begab er sich dorthin und vertiefte sich ganz in die Torheit der Gelehrten, damit er den Torheiten aller gefällig werden könne. Er beobachtete die Leidenschaften und Geschicke der Menschen, studierte die Schriften des Nostradamus, Paracelsus und Agrippa, lernte das Horoskopstellen und Wetterverkünden, trieb die Künste der Kristallseher und machte Bekanntschaft mit Haillinger in Wittenberg, der ein Teufelaustreiber und Teufelsbeschwörer zu sein vorgab, wegen seines Betruges aber nachmals von einigen Bergknappen erstochen wurde.
So in anderer Weise ausgerüstet, durchzog Johannes Faust die Länder, und die Menschen liefen ihm zu, schrien Wunder! und brachten ihm Geld und Gaben, wonach er dann oft bitter lachte, das Gewonnene aber so leichtfertig ausgab, wie er's erworben, das Leben genoß und seiner dennoch nicht froh wurde. Unwirsch in sich und bös auf die Welt, zog er sich abermals nach Wittenberg zurück, nahm sich einen Famulus, namens Wagner, und war fast erdrückt von denen, die von ihm Hilfe und Lehre begehrten, blieb auch meist einsam daheim, bis ihn dazwischen das wilde Sausen und Brausen auf kurze Frist wieder hinriß.
Da begab es sich eines Ostermorgens, daß er seine Düsterheit loswerden wollte in einem Spaziergange, und er gewahrte eine Jungfrau, die eben aus der Kirche trat, und die nahm ihm Herz und Gedanken so ganz hin, daß er ferner nicht glaubte leben zu können ohne sie. Sie war eines reichen Bräuers wunderliebliche Tochter, hieß Martha und sollte einem reichen Bräuer wider ihren Willen verlobt werden. Das erkundete Johannes Faust, wußte auch durch Marthas Amme an sie zu kommen und gewann der Jungfrau Neigung, daß sie ihm versprach, zu folgen, wohin er sie führe. Von da nun sammelte er sein Hab und Gut und erwarb, was zu erwerben war. Er hatte, weil er eben auch seines Oheims in Knüdlingen Verlassenschaft empfing, so viel beisammen, um mit der Zufriedenheit haushalten zu können, verschrieb nun sein Haus in Wittenberg dem Famulus
Wagner und lud seine Freunde ein, mit ihm in dem Dorfe Rünlich bei jener Stadt zu Abend zu essen, weil er, wie er ihnen sagte, zu einer Reise verschwinden wolle. Er machte sie aber alle trunken und verschwand vor ihren Augen nach Mitternacht, um mit Martha, die seiner harrete, von dannen zu ziehen. Sie begaben sich erst nach den Rheinlanden, dann gen Hispanien, wo Johannes Faust sich Juan Pugnero (vom lateinischen
Pugnus = Faust) nannte und als Arzt großen Ruhmes gewürdigt wurde. Da er aus Deutschland vernahm, daß durch sein Verschwinden zu Rünlich die Sage ginge, ihn habe der Teufel geholt, sagte er lachend: ›Ist mir mehrmals geschehen! Es wird noch manchen der Teufel holen, weil er's nicht verbergen konnte oder möchte, daß er etliches mehr weiß als die anderen.‹
Er aber, gar glücklich und froh im Besitz seines guten Weibes und wohlgeratener Kinder, erlebte der Jahre noch viele und erforschte bis in sein späteres Alter Wahrheit und Natur. War dann einmal von seinen sonstigen Irrfahrten die Rede, setzte er die Lehre hinzu in dem Spruch: ›Halt an dir selber und beschwöre die Natur, daß sie dir vertraut, treu und gewärtig werde, dann hast du Gott gefunden und den Teufel nicht zu fürchten!‹«
Höllenzwang nebst gewissen Charakteren und vier Beuteln zu den vermeintlichen Hecketalern vor sich auf den Tisch. So saßen die Narren bis zehn Uhr. Da beschrieb der eine Bauer mit Webers Degen einen Kreis an der Decke, welches er alle
Viertelstunden dreimal wiederholte, und Weber las die Beschwörungsformel aus dem Buche »Fausts Höllenzwang«. Der Geist blieb indessen aus. Da es nun sehr kalt war, so hatten die Schatzgräber in dem verschlossenen, ofenlosen
Häuschen ein Feuer von Steinkohlen angemacht, woran sie erstickten. Als der Schneider am anderen Tage von ohngefähr in sein Weinberghäuschen kam, fand er darin zu seinem Schrecken die drei Männer, die beiden Bauern tot und Weber halbtot und sprachlos, eine Verletzung am Arm und rote Flecke, Geschwulst und Blasen auf der Brust. Man wollte dahinter kommen, ob der Teufel das Unglück angerichtet habe, und stellte die Wächter Baier, Krempe und Schuhmann in das Gartenhäuschen. Als diese froren, machten sie in dem verschlossenen Häuschen ebenfalls ein Feuer an, und es ging ihnen daher ganz ebenso wie den Geisterbeschwörern. Man fand sie am anderen Morgen halbtot. Sie erholten sich aber wieder bis auf Baier, welcher starb. Schuhmann sagte, nachdem er sich erholt, aus: Es sei ihm gewesen, als ob er auf der Bank eine Strecke fortgeschoben worden; er habe aber nichts gesehen, nichts gehört, während Krempe sich wichtig machte, er habe den Teufel gesehen und ein Kratzen an der Tür gehört. Auf die Frage, wie der Teufel ausgesehen, beschrieb er ihn: »Der Teufel sah aus, als hätte er keine Gewalt über mich.« Darüber wurde er ausgelacht, und als er später Nachtwächter geworden, riefen ihm die Spaßvögel beim Stundenabrufen zu: »Heda! Krempe? Wie sieht der Teufel aus?« –
Ehedem standen katholische Priester im Rufe, nicht nur Gespensterbannen und Geister zitieren, sondern auch, daß sie Geld geschickt zu heben wüßten. Einst ging ein solcher, der sich den heiligen Christoph zum Schutzpatron ersehen hatte, mit seiner betrogenen Gesellschaft um Mitternacht in ein altes Gewölbe, von dem noch die Wände standen, das oben mit Brettern leicht zugedeckt war. Dort machte Pater Franziskus einen Kreis um sich herum, sprengte Weihwasser an die Wände, sprach das Ave Maria und betete:
»Heiliger und ehrwürdiger Märtyrer Christoph, himmlischer Fürst! Wir rufen Dich an, als denjenigen, der Du den großen König gesucht hast, und zuerst einen heidnischen König, hernach den Teufel, endlich aber den Herrn Jesum gefunden hast, weil Du die Leute durch den Jordan trugest. Und da Du in Deiner Einsiedlerhütte schliefest, rufte Jesus als ein Knab': Offery, Offery! Da Du das erstemal und andere Mal aufstundest, war niemand da. Das drittemal rufte und sagte der Knabe: Offery, Offery, nehme Deine Stange und trage mich durch den Jordan. Du nahmst ihn auf Deine Schultern und gingest durch das Wasser. Der Knabe aber war so schwer, daß Du in Lebensgefahr kamest und zu dem Knaben sagtest: Du bist so schwer, daß ich meine, ich trage Himmel und Erde. Der Knab' antwortete: Du trägst wahrlich Den, der Himmel und Erde geschaffen hat. Da tauchte Dich der Knabe ins Wasser und taufte Dich im Namen des Vaters † des Sohnes † und des Heiligen Geistes † und veränderte Deinen Namen mit dem Beisatz: ›Du sollst nicht mehr Offey, sondern Christoph heißen. Ich erschaffe Dich zu meinem Schatzmeister und gebe Dir Gewalt über alle in der Erde verborgenen Schätze, daß Du sie unter diejenigen, welche Dich in meinem Namen anrufen, austeilst. Ich gebe Dir auch Gewalt über alle bösen Geister.‹ Nun rufen wir Dich, o heiligster und verehrungswürdigster Herr Märtyrer und Fürsprecher Christoph an, daß Du Dich unserer erbarmest und uns neben Gott und der Jungfrau Maria erhörest und uns zum Behuf unserer Arbeit diese Nacht hunderttausend Gulden guten Geldes bescherst, wir rufen Dich das erste, andere und dritte Mal an und beschwören Dich in dem Namen des Vaters † des Sohnes † und des Heiligen Geistes † und der heiligen Maria, mache durch meine Fürbitte, daß wir reich werden und aller Glückseligkeit genießen. So wahrhaftig Du Gott gedienet hast, und von ihm getauft bist, und Du den heidnischen König und unzählige andere zu dem christlichen Glauben gebracht hast, und Dir Gott Seele und Leib gegeben hat; hilf uns und bringe uns gutes lauteres Gold, gutes Geld durch Gott Vater † Sohn † und Heiligen Geist † Amen!«
Nach Beendigung dieses Gebetes sprengte der sündige Pfaffe noch einmal Weihwasser gegen die vier Wände, ließ vier Personen mit mit Kreuzen bezeichneten Hämmern dreimal gegen die vier Wände schlagen und dies zum zweiten und dritten Male wiederholen. Plötzlich aber stürzt eine Wand ein, und – erschrocken laufen alle zum Gewölbe hinaus. Allein die Habsucht ließ sie, nachdem sie sich erholt, umkehren und suchen; natürlich fanden sie nichts. –
Ein sterbender Vater sprach zu seinem Sohne: »Sohn, grabe den Acker und den Weinberg fleißig um, und du wirst einen Schatz finden!« Kaum war der Alte beerdigt, als H. auch schon alles umzuwühlen begann; allein er fand nichts. Nach Jahren fingen Acker und Weinberg an, reicher als je zuvor zu tragen. H. hätte nun merken können, was der Vater unter dem Schatz, den er finden sollte, gemeint habe; er sprach aber oft in der Schenke seinen Unwillen darüber aus, daß er den Schatz – den er meinte – noch nicht gefunden habe. Da bemerkte ihm ein Bergmann, ein listiger Bursche, er wisse einen Schatz. H. bezahlte die Zeche für ihn und sagte: »Bruder, wenn du ihn weißt, warum hast du ihn nicht schon gehoben?« – »Ja, meinte der Betrüger, das geht so nicht; ich bin arm. Wenn ich 33 Taler 3 Groschen und 3 Pfennige in Gold, Silber und Kupfergeld hätte, womit ich den Schatz herauflocken könnte, so wollte ich ihn gleich heben.« Sofort erhielt er von H. den Betrag, und schon nachts um 12 Uhr ging der Schwindel vor sich. H. mußte sich in gewisser Entfernung unter eine Eiche stellen, und sollte, bei Lebensgefahr!, sich weder rühren noch sprechen! Er hatte schon drei Stunden unter großer Angst dagestanden. Endlich wurde ihm die Zeit lang; er wagte es, sich umzusehen, zu rufen und dann an den Ort hinzugehen, wo der Schatz sollte gehoben werden; aber der Bergmann war über alle Berge. –
Ein französischer Bauer, der mit seiner Wünschelrute so viel Aufsehen erregte, daß selbst die Richter mit ihm umherliefen, um vermöge derselben Mörder zu entdecken, wurde als Betrüger entlarvt und mußte das Land verlassen. Ein abergläubischer Gerichtsschöppe glaubte den Dieb entdeckt zu haben. Dieser wurde aber unschuldig befunden und der Schöppe in Strafe genommen, außerdem mit sechs Tagen Gefängnis gebüßt. Ein listiger Bergmann versicherte einem reichen Bauernburschen, daß er durch seine Wünschelrute schon verschiedene Schätze entdeckt hätte. Sie gingen an den bezeichneten Ort. Dort ließ erst der Bergmann, dann S. die Rute schlagen, und schon in der nächsten Nacht um 12 Uhr sollte der Schatz gehoben werden. – »Wenn wir nur das Geld anschaffen können«, sagte der Bergmann, »welches zur Hebung des Schatzes notwendig ist. Ich bin arm, und meine Armut ist eben die Ursache, warum ich durch meine Wünschelrute noch nicht reich geworden bin. Die unterirdischen Geister werden den Schatz, ohne Schwierigkeiten zu machen, heben lassen, sobald sie erkennen, daß ich 50 Taler in der Tasche habe. Merken sie aber, daß ich weniger oder wohl gar nichts bei mir führe, so werden sie ihn stets fortrücken, wenn man gleich glaubt, ihn schon in den Händen zu haben.« Nun empfing er das verlangte Geld. Sie gingen an den bestimmten Ort und fingen genau um 12 Uhr an zu graben. Der Erdboden war gefroren. Als sie etwas hineingearbeitet hatten, fragte der Bergmann seine Rute, die ihm, wie er vorgab, sagte, daß der Schatz nur noch einen Fuß tief stehe, und gab S. zu erkennen, daß kein Ungeweihter zugegen sein dürfe, wenn der Schatz gehoben würde, worauf sich derselbe zitternd entfernte. – Die Geschichte endete, wie man leicht erraten kann; der Bergmann hatte sich mit den 50 Talern davongeschlichen, und S. verfiel in ein hitziges Fieber, an welchem er, der einzige Sohn seiner Eltern, starb. –
Einen Fall von Schatzgräberei aus neuerer Zeit erzählte C. Kahle in der »Weidaer Zeitung« nach Akten des Weidaer Gerichts, der in Gera und in Dürrenebersdorf vor nicht allzulanger Zeit spielte. Da die betreffenden Opfer der Schwindler noch leben, so hat Kahle die Namen derselben nur mit den Anfangsbuchstaben bezeichnet.
»Nicht weit von Dürrenebersdorf wohnte der Bauerngutsbesitzer J.G. Pr. Dieser bemerkte eines Tages, daß seine Kühe verhext seien, d. h. nicht mehr genügende Milch gaben, und wandte sich an Johann Georg S. in Weida, der als Zauberkünstler großen Ruhm genoß. S. zog mit und fragte seine Wünschelrute, die er um den Stall trug, ob das Vieh verhext sei. Die Wünschelrute bejahte die Frage dreimal und zeigte auf eine Stelle im Miste, wo der Hexenschuß vergraben sein sollte. Pr. machte, nachdem er auf Geheiß des S. den Mist weggehackt hatte, ein Loch in den gepflasterten Boden der Düngestätte, in welches Simon eine Kanne voll mit Salz und Asche vermengtes Wasser goß. Nach einer Viertelstunde war das Wasser versickert, und es fand sich auf dem Boden der Grube ein verschimmeltes Päckchen, welches nach Angabe des S. der Hexenschuß war. In dem Päckchen waren eine Bleikugel, einige alte Nägel, Kuhhaare und Eierschalen.
Alles dies ließ S. überm Feuer verkohlen, räucherte das Vieh damit und befahl Pr. den Topf um Mitternacht ins Wasser zu werfen. S. ging hierauf mit Pr. in das Nebenhaus, woselbst er einen magischen Kreis legte und die Hexe beschwor. Sofort tat es einen fürchterlichen Schlag, die Hexe kratzte an der Tür und klirrte mit der Kette. Da ging S. hinaus und prügelte die Hexe.
Als sie abends in der Stube saßen, erzählte Pr. dem S., unter seiner Treppe läge ein Schatz von 400 Talern. Eine Zigeunerin habe ihm gesagt, er könne ihn heben, müße aber vier Jahre darauf sterben.
Sogleich nahm S. seine Wünschelrute und ging auf die Treppe, wo die Rute sofort aufschlug und meldete, der Schatz betrage 700 Taler in Gold und 1000 Taler in Silber.
Nun war Pr.s Gier geweckt; er bat S., ja den Schatz zu heben.
Der sagte, man müsse ein Werk haben, worin zu lesen wäre, wie der gute Geist zitiert werden könne; er wüßte, wo es zu haben sei.
Nach vier Wochen teilt S. dem Pr. mit, das Buch sei gefunden, er solle nach Gera kommen und 60 bis 100 Taler mitbringen.
Bei Pr.s Ankunft in Gera erzählte ihm S., er habe das Buch schon gekauft, man wolle heute in Weida die Probe damit machen.
Elf Uhr nachts gingen beide mit einer brennenden Laterne auf S.s Boden. Dort zog S. einen magischen Kreis, schnallte Salomonis Gürtel um, befahl Pr. niederzuknien und sprach dann die Beschwörungsformel, die er aus dem gekauften Buche ablas.
Sofort ertönte ein schwacher Knall, und aus der Tür kam eine weiße Gestalt, die auf Befragen des Beschwörers angab:
›Ich heiße Tischma. In dem Hause des Herrn Pr. liegt ein Schatz, der nur mit dem Siegel aus dem Kloster N. gehoben werden könnte. Dasselbe kostet fünfzig harte Taler.‹
Darauf befahl ihnen der Geist, die Worte nachzusprechen:
Ich schwöre im Namen der heiligen Dreifaltigkeit, Gottes, des Schöpfers Himmels und der Erden, Jesu Christi und des Heiligen Geistes, daß ich standhaft sein und von dem, was hier vorgegangen ist, niemand etwas sagen will. Auch der Geist schwur etwas, aber in der unverständlichen Geistersprache, schnaubte heftig und verschwand.
Beide Beschwörer gingen in die Wohnstube zurück, Pr. bekannte, daß er die fünzig Taler nicht habe, daß er aber seinen Schwager in Münchenbernsdorf überreden wolle, dem Schatzheben mit beizutreten. Beide Schwager schafften das Geld, und S. brachte darauf das Erdzwangssiegel mit seiner Frau zu Pr. Der Schwager Pr.s aber war argwöhnisch und verlangte, erst solle S. noch einmal die Hexe beschwören, die das Vieh bezauberte.
S. war gleich bereit, goß Branntwein auf einen zinnernen Teller, stellte auf seinen Teller Räucherkerzchen, warf Weihrauch in den Branntwein und zündete ihn an. Darauf zog er einen Kreis mit Kreide, schrieb magische Zeichen an die Tür und entfernte sich einige Zeit, um auch draußen magische Zeichen anzuschreiben.
Jetzt begann die Beschwörung. Ein heftiger Schlag erfolgte, S. ging hinaus und prügelte die Hexe, die jammernd mit hoher Frauenstimme um Schonung bat.
Hierauf glaubte auch Pr.s Schwager. Das Erdzwangssiegel wurde auf die Treppe gelegt und siehe – nach einer Viertelstunde lag ein altes Goldstück und ein halber Gulden unter ihm.
Noch offenbarte die Wünschelrute, die Beschwörung des Schatzes dürfe nicht im Hause des Pr. geschehen, da könnte ein Unglück geschehen, man sollte sie, über Weißig gehend, auf einer Holzebene nahe bei Dürrenebersdorf vornehmen.
S. führte Pr. und dessen Schwager dahin, zog einen magischen Kreis, umgürtete sich mit Salomos Gürtel, hing ein Kruzifix an die Rute, stellte drei brennende Räucherkerzchen in den Kreis und beschwor den Geist mit folgenden Worten: ›Ich beschwöre dich im Namen des allerhöchsten starken Gottes, erscheine mir, guter Geist, in dieser glückseligen Stunde. Tut euch auf, ihr Felsen und Gebirge, und machet Raum den dienstbaren Geistern. Hephata, Nemphmalabus, Spirituana!‹
Kleine Feuerschlangen hüpften auf dem Boden umher, und eine weiße Gestalt nahte sich dem Kreise und sprach mit hohler Stimme:
›Euch fehlt das Ewige Licht aus dem Kloster zu Banz, schafft es für dreieinhalb Säckel und hebt den Schatz.‹
S. erklärte nach dem Verschwinden des Geistes, ein Säckel sei 100 Taler. Die Schwager versprachen auch, das Geld zu schaffen, kamen aber mit S. ohne Geld in Gera zusammen. Gleichwohl zitierte S. aufs neue den Geist. Diesmal war er aber grob und schwur, Pr. und seinen Schwager durch die Lüfte zu entführen.
Da sank den Armen das Herz in die Hosen, und sie baten S., er möge doch das Geld borgen, sie wollten den Schatz dann teilen.
Acht Tage darauf erhielten sie einen Brief von S., des Inhalts, er habe 350 Taler Mündelgelder geliehen, die er in acht Tagen zurückzahlen müsse.
Da erschienen nach ungefähr vierzehn Tagen Pr. und sein Schwager in Gera und zahlten dem dorthin berufenen S. 200 Taler. S. war auch bereit, 150 Taler daraufzulegen und begab sich mit beiden nach dem Hölzchen.
Dort erschien der Geist; sanft und gütig erklärte er, das Geld sei zu spät gebracht, das Ewige Licht habe in der jetzigen Zeit keine Kraft mehr. Der Schatz könne nach neunundvierzig Monaten gehoben werden, wenn sie den Altar des Klosters Banz mit dreißig Ellen grünem Tuche bekleideten. Am 15. September nach neunundvierzig Monaten werde ein Kartäusermönch in der Mittagsstunde am Kreuz von Miesitz sitzen, an welchen man das Geld für das Tuch bezahlen könne. Der Mönch trage ein grün Reislein zur Erkennung. Doch sollten die drei nicht vergessen, jährlich dreimal zu beten.
Als S. aber die erste Betstunde mit den Verblendeten abhalten wollte, wurde er verhaftet.«
Verborgene Schätze. Leonhard Turneisser, der über den Sälen der Berliner Schloßapotheke als Hofalchimist und Leibarzt des Kurfürsten Johann Georg seine geheimnisvolle Kunst trieb, später aber in nächtlicher Stille die Mauern des grauen Klosters verließ, welches ihm sein hoher Gönner nach dem Tode des letzten Franziskanermönchs eingeräumt, hatte ein Verzeichnis von verborgenen Schätzen angefertigt, in welchem er unter anderem berichtet von einer lebensgroßen goldenen Statue, dem Abbild einer heidnischen Göttin, welches vorzeiten in einem alten Tempel am Venusberge zu Merseburg gestanden und dort zur Zeit Karls des Großen vergraben sein soll.
Ferner sollen sich in dem Dorfe Berga unfern des Städtchens Roßla am Harz in einem Gewölbe unter der auf einem Berge stehenden Kirche ein Schatz im Werte von mehreren Tonnen Goldes befinden, welche zu Karls V. Zeiten dort vergraben worden. Wie die Sage berichtet, führt zu dem Schatzgewölbe ein zugemauerter Gang; allein man hat denselben bis jetzt nicht aufgefunden.
Auch hinter der Kirche zu Spremberg sollen auf dem Georgenberge unter einer Linde über 20 000 Taler, in den Gewölben der Kirche selbst 50 000 Taler, unweit des Altars eine gleiche Summe und an verschiedenen anderen Stellen daselbst über 20 000 Taler vergraben sein. Wie sehr man solchen Gerüchten Glauben schenkte, beweist die Tatsache, daß der Herzog Christian von Sachsen-Merseburg nach diesen Schätzen – allerdings vergeblich – suchen ließ. – Auch unter der Marienkirche auf dem Marien- oder Hartunger Berge bei Brandenburg sollte ein Schatz versteckt liegen, der seiner Hebung harrte: Die Kirche, von welcher sich im neuen Berliner Museum eine Abbildung befindet, wurde um das Jahr 928 gegründet, als Heinrich der Städtebauer die märkischen Wenden siegreich im eigenen Lande angriff und ihre feste Hauptstadt Brennabor (Brandenburg) eroberte. Auf den Trümmern des heidnischen Tempels entstanden, ist sie verschwunden, wie die jahrhundertlang in ihr aufbewahrte Bildsäule des Heidengottes Triglav, welchen Kurfürst Joachim I. im Jahre 1586 seinem damals in Berlin anwesenden Verwandten, dem dänischen Könige Christian II. verehrte. An die älteste Gestalt des Aachener Domes und an das von Karl dem Großen in Zürich erbaute Münster erinnernd, fiel die Marienkirche 1722 als das Opfer eines schätzesuchenden Generals. Auf die Vorstellung desselben gab König Friedrich Wilhelm I. den Befehl zum Abbruch der starken Mauern, in denen man unermeßliche Schätze vermutete. Vergebens legte der Magistrat der Stadt Verwahrung dagegen ein und erbot sich zum Bau der Stadtmauer von Potsdam, wozu die Steine jener Kirche demnächst verwendet werden sollten, neue Steine zu liefern, wenn das für die vaterländische Geschichte so unschätzbare Baudenkmal erhalten bliebe; alles war umsonst: die Kirche wurde mit großen Kosten abgebrochen, Schätze aber nicht vorgefunden.
Als die Dynastie der Bourbonen in Spanien gestürzt worden, brachte der damalige Vizekönig von Mexiko, Don Jose Isturrigaray, und sein Anhang schnell die ungeheure Summe von vier Millionen Pesos zusammen, um damit Ferdinand VII. und das alte Königshaus zu unterstützen. Das Geld wurde mit anderen Kostbarkeiten und wertvollen Heiligenbildern nach Verakruz geschafft, um nach Spanien eingeschifft zu werden. Die Kunde von diesem Transport ging wie ein Lauffeuer durch das Land und erregte jene beutelustigen Männer, an denen es in Mexiko nicht mangelt. Eine Bande der verwegensten derselben, unter denen sich auch ein Priester befand, hatte sich zusammengerottet und überfiel den Zug in einem wüsten Engpasse, metzelte die Bedeckung nieder und brachte den Schatz in Sicherheit. Die schwerbeladenen Maultiere wurden gruppenweise auf verschiedenen Wagen nach einem bestimmten Punkte im Gebirge getrieben, wo die Bande sich wieder vereinigte. In einer Höhle, die sich an einer über tausend Fuß hohen Felsenwand befand, versteckte man den großen Schatz; dann wurden alle Spuren unkenntlich gemacht, ja sogar ein Flüßchen nach der Felswand geleitet, so daß er gerade darüber hinabstürzte und die nur auf Strickleitern zu erreichende, mit Steinen verschlossene Höhle bedeckte und verbarg. – Nach Jahresfrist sollte die Teilung des Schatzes in aller Ruhe vorgenommen werden. Ein jeder der Abenteurer kehrte in seine Behausung und zu seinen gewöhnlichen Geschäften zurück, und man verbreitete geflissentlich das Gerücht, daß die ganze Geschichte des Raubes nur eine leere Erfindung des Vizekönigs sei.
Aber der Teufel der Habsucht kam über die einzelnen Räuber; ein jeder von ihnen wollte womöglich den ganzen Schatz für sich allein erlangen. Es bildeten sich einzelne kleine Banden, es entstanden Verschwörungen, deren Folge ein gegenseitiges Morden war, welches die Zahl der Verbündeten dermaßen lichtete, daß nur wenige übrigblieben, und diese wagten es wieder nicht, den Schatz für sich allein zu heben, wollten andererseits aber auch keine fremden Personen aus Furcht vor Verrat in das Geheimnis ziehen. Nur einer, ein Priester, ließ auf seinem Sterbebette einen Deutschen zu sich rufen und vertraute ihm, als einem Landsmanne Alexander von Humboldts, der sich um Neuspanien große Verdienste erworben hatte, das wichtige Geheimnis an. J.W. von Müller hat in seinem Werke »Reisen in den Vereinigten Staaten, Kanada und Mexiko« die Geschichte, welche ihm von dem erwähnten Deutschen erzählt worden war, mitgeteilt. Er schickt derselben die Bemerkung vorauf: »Obgleich die Mitteilung in allen Stücken der Wahrheit gemäß ist und aus authentischer Quelle stammt, so zwingen mich doch die Verhältnisse, die Namen der handelnden Personen, wie auch des speziellen Schauplatzes zu verschweigen.«
Der Geistliche war in ein Kloster gegangen. Er lag auf dem Sterbebette. Unter einem Maisbündel, auf welchem sein Haupt ruhte, befand sich ein Papier, welches eine genaue Beschreibung des Ortes enthielt, wo der Schatz sich befinden soll. – Der Deutsche nahm das Papier an sich und teilte einem Freunde seine Erlebnisse mit. Beide studierten nun die Angaben des Papiers, auf welchem genau die ganze Örtlichkeit bezeichnet war, um von einem Punkte am Rio de la Soledat aus die betreffende Felswand zu finden. Die Sache wurde von ihnen weiter verfolgt; eine Expedition nach der bezeichneten Gegend ließ trotz der üppigen Vegetation, die alles überwuchert und unkenntlich gemacht hatte, zwar nicht den Schatz, wohl aber den Wasserfall und die Felswand nebst allen anderen Anzeichen wahrnehmen.
Dennoch waren beide außerstande, den Schatz zu heben, teils weil die mexikanische Regierung Kenntnis von der Sache hätte erhalten und sie um die Früchte ihrer Arbeit hätte bringen können, teils auch aus Furcht vor Banditen und Mördern. Demnach liegt vermutlich auch dieser unermeßliche Schatz noch in der tausend Fuß hohen, von einem Wasserfall überstürzten Felsenwand. –
Juden, Zigeuner, Köhler und Aschenbrenner gaben vor, das Feuer besprechen zu können. Die Juden hatten zweierlei Arten, es zu tun. Der Feuerbesprecher wählte einen erhabenen Ort, von dem er alles, was brannte, übersehen konnte, ließ sich eine Pfanne mit glühenden Kohlen nebst einer Gießkanne voll Wasser geben, sah unverwandt das Feuer an, murmelte die hebräischen Worte aus dem 4. Buche Mose, Kap. 11, 2: Da schrie das Volk zu Mose, und Moses bat den Herrn, da verschwand das Feuer – silbenweis her, und beim Aussprechen goß er ein wenig Wasser über die glühenden Kohlen in dem guten Glauben, das Feuer müsse verschwinden oder es werde nun mit leichter Mühe gelöscht. Andere feuerbesprechende Juden suchten bei einer Feuersbrunst ein Haus, das noch nicht angegangen, dadurch zu retten und dem weiteren Vordringen des Feuers zu wehren, daß sie mit Kreide entweder die vorgedachten Worte oder den Schild Davids mit dem Wort Agla oder den göttlichen Namen Adonai anschrieben. Unter dem Schild Davids dachten sich die törichten Feuerbesprecher die bildliche bedeutende (hieroglyphische) Figur, welche David, ihrem Vorgeben nach, auf seinem Schilde gehabt haben soll. Sie besteht aus zwei unter- und etwas ineinanderstehenden Triangeln, in deren sechs Winkeln, wie auch in der Mitte, das Wort Agla mit hebräischen Buchstaben geschrieben steht. Dieses Wort bedeutet an sich nichts, sondern es zeigt nur die Anfangsbuchstaben von den vier hebräischen Worten an: Atta Gibbohr Leolam Adonai – Du bist stark in Ewigkeit, Herr! – Siebenmal steht das Wort Agla in der Figur, denn die Zahl sieben ist unter den Juden so heilig wie unter den Christen die drei. War das Haus schon angegangen, so schrieben sie jene Worte aus dem 4. Buche Moses auf eine Brotrinde, auf Papier oder einen Teller, gingen, wenn sie konnten, dreimal um das Feuer herum und warfen den so beschriebenen Gegenstand hinein. Dies sollte gleichfalls das Feuer verschwinden machen.
Die Zigeuner und die Geister dagegen pflegten einen Feuersegen herzusagen:
»Feuer, steh still, um Gottes Will,
Um des Herrn Jesu Christi Willen!
Feuer, steh still in deiner Glut,
Wie Christus der Herr ist gestanden
In seinem rosinfarbigen Blut.
Feuer und Glut, ich gebeut dir bei Gottes Namen,
Daß du nicht weiter kommst von dannen,
Sondern behaltest alle deine Funken und Flammen.
Amen! Amen! Amen!«
Oder der Feuerbesprecher sagte: »Feuer, heiße Glut und Flamm', dir gebeut Jesus Christus der große Mann. Du sollst still stehn und nicht weitergehn, im Namen Gottes des Vaters, des Sohnes und des heiligen Geistes, Amen.« – Er sollte dabei dreimal um das Feuer reiten, jedesmal eine Strophe langsam sagen und dann in einen Teich hineinjagen, weil nun das Feuer aus allen Winkeln hervorkomme und ihn verfolge, und wenn es ihn erreichen könne, ihn töte und verzehre. Das Feuer besprechen sollte nur bei vollem Mond, des Freitags nachts zwischen elf und zwölf Uhr, indem drei Lichter auf dem Tische brannten, so gelernt werden können, daß der Lehrende wie der Lernende vor- und nachher jedesmal drei Kreuze sich vor die Brust machen und beim Lernen des Segens die linke Hand aufs Herz legten.
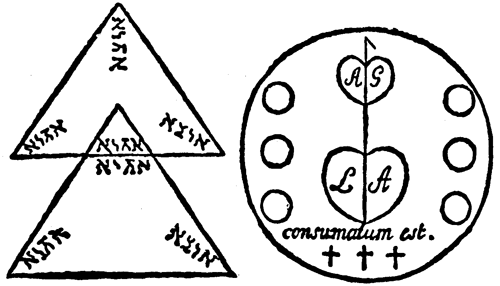
Man bediente sich, das Feuer zu besprechen, auch wohl eines hölzernen Tellers, auf welchem nicht weit vom Rande drei Zirkel nahe untereinander und gegenüber noch drei gezeichnet sind. Innen unterwärts steht ein Herz und darüber ein kleineres. Mitten durch diese beiden Herzen ist eine gerade Linie gezogen mit einem daran befindlichen Widerhaken. In dem oberen Herzen stehen die Buchstaben A G, in dem unteren L A, so daß die Zusammenfügung das Wort Agla ergibt. Ganz unten stehen die Worte consumatum est (es ist vollbracht), welche der Erlöser am Kreuze gesprochen, und darunter findet man drei Kreuze. Mit dieser Figur und diesen Buchstaben sollte der Teller des Freitags bei abnehmendem Mond zwischen elf und zwölf Uhr mit frischer Tinte und mit einer neuen Feder beschrieben, bei einer entstandenen Feuersbrunst im Namen Gottes ins Feuer geworfen und, wenn das Feuer nicht verlösche, noch zweimal wiederholt werden.
Den Marktschreiern und Wunderdoktoren strömte sonst die Menge zu und kaufte von ihnen.
Mit Mondschein und Gebet heilte ein solcher Doktor in Berlin in den Jahren 1780 und 1781 angeblich viele Kranke, vorzüglich äußere Schäden. Er heilte sie mit Mondschein, obgleich der Mond oft gar nicht zu sehen war und seine Frau ihrerseits Heilungen zu derselben Zeit in einem anderen Zimmer vornahm, das eine ganz entgegengesetzte Lage hatte. Er heilte unentgeltlich, um desto mehr Zulauf zu haben, aber die Billetts beim Eintritt in das Haus mußten bezahlt werden.
Ein Knabe in Oberschlesien, Thomas Gablunec, hatte die Krätze. Ein Quacksalber riet, ihn in den Backofen zu stecken, nachdem das Brot drei Stunden darin gebacken hätte. Es geschah. In kurzer Zeit war der Junge über und über verbrannt; er kam zwar wieder zu sich, starb aber nach zwei Tagen.
Einige Jahre nach dem Mondscheindoktor trat in Berlin ein anderer Wundermann auf, welcher vorgab, geheime Naturkräfte bei Heilung der Kranken anzuwenden. Er bestimmte die Krankheit um zwölf Uhr; vor dieser Zeit durften seine Kranken nicht reden. Er schnitt ihnen die Haare ab, legte sie kreuzweis übereinander, verbrannte sie dann und gab ihnen die Asche ein. Dabei murmelte er Gebetsformeln, sprach seinen Patienten viel von Bezauberung, vom Teufel besessen sein und dergleichen. Der Schwindler endete im Zuchthause.
Und sind in unseren Tagen etwa die Wunderdoktoren ausgestorben? Mitnichten! Und noch heute wäre für sie die Strafe ganz am Platze, die man ehedem in Montpellier für derart Leute hatte. Wenn man dort nämlich einen Marktschreier entdeckte, so war man berechtigt, ihn auf einen mageren Esel zu setzen, das Gesicht nach hinten gekehrt, und ihn so durch die Stadt zu führen, mit Kot zu bewerfen pp., ihn überhaupt der Schande preiszugeben.
Nicht leicht hat ein Scharlatan größeres Aufsehen gemacht als Cagliostro, der sich einen Grafen nannte und bald vorgab, er stamme aus fürstlichem Geblüt, bald von einem Malteser-Ordensgroßmeister, bald von einem arabischen Prinzen und bald in Asien, bald in Europa geboren sein wollte. Seinem Vorgeben nach unterrichteten ihn morgenländische Weise. Reisen nach Ägypten und Einweihungen in die unterirdischen Geheimnisse der Pyramiden verschafften ihm geheime Kenntnisse. Ende des Jahres 1780 wurde er in Rom auf der Engelsburg gefangengesetzt. Als Cagliostro einst nach den Grundlagen seiner Kunst gefragt wurde, antwortete er, ihre Kraft beruhe in verbis, in herbis, in lapidibus (in Worten, Pflanzen und Steinen). Diese Dreiheit findet sich auch schon in König Jakobs I. von England Dämonologie, wo sie allerdings nur als das Abc der Zauberei bezeichnet wird. –
Überbleibsel des Aberglaubens. Gar mancher Aberglaube hat sich im gemeinen Leben bis auf unsere Tage erhalten. So glaubten zum Anfang des 19. Jahrhunderts noch viele folgendes: Garn, von noch nicht siebenjährigen Mädchen gesponnen, sei gut gegen Gicht – bewahre von Hexerei und mache den, der sie am Leibe trage, schuß- und stichfrei. Wer sie in ein Gewehr lade, schieße nicht fehl. Wenn eine Maus am Kleide nagt, bedeutet das Unglück. Wenn ein Fremder in die Stube kommt, muß er sich setzen, sonst nimmt er den Kindern die Ruhe mit. Wenn eine Henne kräht, so bedeutet das Unglück. Wer früh nieset, kriegt selbigen Tages Neues zu erfahren oder etwas geschenkt. Wenn in eine Stube, in welcher eine Wöchnerin liegt, jemand mit einem Tragkorb kommt, so muß man einen Spahn vom Korbe abbrechen und in die Wiege stecken, sonst nimmt er der Mutter oder dem Kinde die Ruhe mit. Wenn Weiber Garn sieden, so müssen sie recht dabei lügen, sonst wird es nicht weiß. Es ist nicht gut, wenn man über den Kehricht geht. Es ist nicht gut, den Krug, woraus man trinkt, mit der Hand über den Deckel anzufassen, daß er hierdurch überspannt werde, denn das schadet dem andern, der daraus trinkt; denn wer zuerst daraus trinkt, sagt man, bekommt den Herzspann. Die Eltern sollen den Kindern nicht selbst Klappern kaufen, sondern sie ihnen von andern schenken lassen, sonst lernen sie langsam und schwer reden. Wenn die Kinder schwer reden lernen, soll man ihnen Bettelbrot zu essen geben. Wenn man ausgeht und verreist, soll man nicht wieder umkehren, wenn man etwas vergessen hat, sondern soll es lieber durch einen andern nachbringen lassen, denn wer das tut, dem sollen seine Verrichtungen nicht wohl vonstatten gehen. Wenn die Weiber Federn in die Betten füllen, sollen die Männer nicht zu Hause bleiben. Die Federn stechen sonst durch das Inlett. Es ist nicht gut, wenn man eine leere Wiege wiegt. Mit einem kleinen Kinde soll man unter einem Jahre nicht in den Keller gehen, es wird sonst furchtsam. Die Mutter soll den ersten Zahn, der dem Kinde ausfällt, verschlucken, alsdann bekommt es schöne Zähne. Wenn man die Kinder unter einem Jahre in den Spiegel sehen läßt, so werden sie stolz. Wenn ein Hund in den Backofen sieht, so bäckt das Brot ab. Man macht drei Kreuze über den Teig, damit er desto gesegneter sein soll, und drei Kreuze an das Brot, ehe man es anschneidet. Wenn Teig im Backtrog steht, soll man die Stube nicht auskehren, man kehrt sonst das Brot hinaus. Den Essigkrug soll man nicht auf den Tisch setzen, der Essig verdirbt davon. Wenn man den kleinen Kindern den ersten Brei nicht bläst, so verbrennen sie sich hernach an heißen Suppen den Mund nicht. Wer reich werden will, der schneide das Brot fein gleich. Wenn zu Grabe geläutet wird, soll man nicht essen, sonst tun einem die Zähne weh. Wenn einem Kinde unter einem Jahre rote Schuhe angezogen werden, so kann es hernach, wenn es erwachsen ist, kein Blut sehen. Wenn man über ein Kind hinschreitet, so wächst es nicht. Wer mit Holz, Stroh und anderen brennbaren Stoffen in Feuer oder Licht gaukelt, der harnt hernach ins Bett. Wer bei dem Spiel Geld wegleiht, der verliert. Wer zu Markte zieht und die erste Lösung verborgt, der verborgt sein Glück. Wenn ein Weib zu Markte gehen will, so muß es den rechten Schuh zuerst anziehen, dann wird es seine Ware teurer los. Wer des Morgens rückwärts aus dem Bette steigt, dem geht selbigen Tages alles verkehrt. Von Kindern, die trotz starken Essens nicht gedeihen, sagt man, daß sie das Älterlein haben. Man weiß aber ebensowenig, was das Älterlein, wie was das Jüdel ist. Wenn das Kind das Älterlein hat, soll man es lassen in den Backofen schieben. Vorzeiten hat man denn auch bedauernswürdige Kinder wirklich auf Schieber gebunden und verschiedene Male in den Backofen geschoben, statt die Ursache der Krankheit zu heben. An der Wiege muß ein Drottenfuß gemalt sein, sonst kommt der Schlenz und drückt und saugt das Kind aus, ob es gleich kleinen Schlenz gibt. Im langen Korn, glaubt man, halten sich gewisse Geister auf, die man Kornengel nennt. Sie sollen besonders den Mägden sehr gefährlich sein. Wenn eine Kuh gekalbet hat, so läßt man sie den Sonntag zum erstenmal wieder aus dem Stall, dann, glaubt man, kalbt sie künftig allemal Motschenkälber. Wer einer Katze Schaden tut oder sie totschlägt, dem steht ein Unglück bevor. Wem ein Floh auf die Hand hüpft, der erfährt Neues. Beim Schlafengehen soll man nichts auf dem Tisch liegenlassen, es kann sonst das Älteste oder das Jüngste im Hause nicht schlafen. Es ist nicht gut, daß man sich Feuer oder Licht durch einen Fremden aus dem Hause tragen läßt. Wenn eine Magd zu einem neuen Herrn zieht, so soll sie bei ihrem Anzuge sogleich ins Ofenloch hineinsehen, damit sie es bald gewohnt wird. Die Mägde ziehen an Fleischtagen an, damit ihnen das Jahr nicht lang deuchten soll. Viele lassen sich an Fleischtagen kopulieren. Wer in ein neues Haus zieht, soll einen neuen Besen, ein Brot und Salz vorher in dasselbe schicken. Wenn die Weiber waschen wollen, so muß im Hause alles freundlich aufstehen, alsdann bekommt man ein schönes Wetter. Wer ein vierblätteriges Kleeblatt findet, der soll es aufheben und bei sich tragen, denn so lange er es hat, ist er glücklich. Wenn die Mägde Zunder brennen, so müssen sie von Mannshemden Stücken dazu nehmen, von Weihnachtshemden fängt der Zunder nicht. Wer eine Katze oder einen Hund behalten will, daß sie nicht entlaufen, der soll sie dreimal um den Herd treiben und sie mit den Hintern an der Feuermauer reiben, dann bleiben sie. Wenn ein Fuhrmann eine Otter- oder Schlangenzunge in seine Peitsche flicht, so werden seine Pferde die größten Lasten aus einem Graben ziehen und sich auch nicht übersaufen. Wer gestohlenen Käse oder Brot ißt, der bekommt den Schlucken davon. Wer einen Menschen, der sich selbst gehenkt hat, vom Strick losmacht, der wird unehrlich.
Zahlenaberglaube. Die Drei, die Sieben und die Dreizehn sind es hauptsächlich, welche im Volksglauben eine Rolle spielen. Die Drei ist die eigentliche heilige Zahl. In den wichtigsten Religionen kommen drei Hauptgottheiten, zum Teil Dreieinigkeiten vor. In der ältesten indischen Religionsform sind es Agini, Indra und Varuna (Feuer, Luft und Himmel), im Brahminismus: Brahma, Wischnu und Siwa. Bei den Griechen waren es Zeus, Poseidon und Hades (Himmel, Meer und Unterwelt), bei den alten Skandinaviern Odin, Thor und Freia. Das Christentum hat neben der Zweiheit (Vater und Sohn) die Dreieinigkeit (Vater, Sohn und Heiligen Geist). Man findet ferner drei Zyklopen, drei Zentimanen, drei Urriesen, drei Götterbrüder, drei Schicksalsgöttinnen (Mören oder Parzen, Nornen), drei Rachegöttinnen (Erinnyen oder Furien), drei Grazien, drei Weise (Könige), drei Hauptengel (Michael, Gabriel und Raphael) usw. Drei Jungfrauen oder Burgfräuleins kommen häufig in unseren Volkssagen vor. Manus, der Sohn des erdgeborenen Tuiskio, hat drei Söhne: Ingo, Isko und Hermio, von denen die drei germanischen Hauptstämme, die Ingäwonen, Istäwonen und Hermionen, abstammen sollten. Die Oberpriesterin Pythia sitzt auf einem Dreifuß; Melkstühle sind dreibeinig. In der Sage von der wilden Jagd und vielen anderen ist vielfach von dreibeinigen (gespenstischen) Tieren die Rede, die germanische Todesgöttin reitet auf einem dreibeinigen Pferde. Drei Kreuzchen (ursprünglich Odins Kammer) wurden und werden heute noch zu gewissen Zeiten, wie in der Walpurgisnacht, als Schutzzeichen gegen Hexen und Geisterspuk an Fenstern und Türen angebracht. Drei Kreuze gelten auch für des Schreibens Unkundige als Unterschrift. Zu Dreien zu Tische sitzen, gilt hier und da als bedenklich.
Sieben gilt als Zauberzahl. Der Ursprung dieser Bedeutung ist astronomisch und stammt aus Ägypten. Veranlassung waren die damals bekannten sieben Planeten. Die Erschaffung der Welt dauerte, den Ruhetag eingeschlossen, sieben Tage. In der Bibel kehrt überhaupt die Sieben besonders oft wieder. Noah nahm sieben Paar Vieh und sieben Paar Vögel mit in die Arche, worauf nach sieben Tagen die Sintflut hereinbrach. Siebenfältige Rache, die sieben fetten und die sieben mageren Kühe usw. Jedes siebente Jahr war ein Sabbatjahr, in welchem die Felder nicht bestellt wurden und Sklaven frei waren, alle sieben mal sieben Jahre trat das Jubeljahr ein, welches außerdem die Tilgung aller Schulden brachte; verschiedene Feste dauerten sieben Tage usw. Ferner kommen vor: sieben Siegel (Siebenschläfer), sieben Todsünden, sieben Sakramente. Später sieben Kurfürsten, sieben Freikugeln (Freischütz); sieben Schöffen gehörten zu einem gültigen Spruch, sieben Zeugen zu einem vollgültigen Beweis. Verborgene Schätze steigen alle sieben Jahre an die Oberfläche, und mit dem siebenten Jahre hört die Kindheit auf. Bei Krankheiten wird der siebente Tag als Krisistag angesehen, weshalb dieser Tag auch bei den sympathischen Kuren eine wichtige Rolle spielt. Um das Fieber zu vertreiben, muß der Abergläubische z. B. um 7 Uhr morgens und 7 Uhr abends sieben aufeinanderfolgende Tage Weihwasser aus sieben verschiedenen Kirchen trinken. Die Monatsdaten, welche eine sieben enthalten (7, 17, 27), gelten als unglückbringend. Ein böses Weib heißt im Volksmunde eine böse Sieben. Schwarze Katzen, welche das Alter von sieben Jahren erreichen, werden zu Hexen. Wenn Schwalben sieben Jahre in einem Neste gebrütet haben, lassen sie nach dem Volksglauben darin den Schwalbenstein zurück, der sehr heilkräftig ist, insbesondere bei Augenkrankheiten. Mit siebenerlei Holz werden in Süddeutschland Reinigungsfeuer für krankes Vieh angezündet.
Was endlich die Zahl Dreizehn betrifft, so ist ihre Bedeutung als Unglückszahl allbekannt. Von einer Tischgesellschaft von dreizehn Personen muß nach der abergläubischen Anschauung in demselben Jahre noch eine sterben, und zwar diejenige, die beim zufälligen Erwähnen der Zahl dreizehn erschrickt, oder die unter dem Spiegel oder in der Ecke sitzt, oder auch diejenige, die zuletzt aufsteht. Sind die dreizehn Personen aber jede fünfunddreißig Jahre alt, so sei die Wahrscheinlichkeit des Sterbens für eine Person erst in acht bis neun Jahren vorhanden. Man hat den Grund jenes Aberglaubens mit den dreizehn Personen des heiligen Abendmahls (Christus und die zwölf Apostel) in Verbindung gebracht, von denen Judas sich in demselben Jahre erhenkte. Möglicherweise hat er auch Zusammenhang mit dem mythologischen Umstande, daß von den dreizehn Göttern in Walhalla einer (Baldr) dem gewaltsamen Tode verfällt. Die Zahl ist übrigens auch bei sympathischen Kuren wichtig, kommt aber auch als Glückszahl vor, indem zur Erzielung einer glücklichen Brut dreizehn Eier vonnöten sind usw.
Die Tagwählerei
Auf der Kirchstraße in M. hielt ein Zweispänner; »Wohin geht die Reise;« fragte der alte Klaus, der, aus seinem Pfeifchen schmauchend, zum Fenster hinaussah, den Kutscher.
»Der Herr Sekretär fährt mit seiner Familie nach K. Es ist heute so schönes
Wetter.«
In diesem Augenblicke blies ein »Haderlump« (Lumpensammler) auf seiner Holzpfeife seine einzige Melodie. Da meinte Klaus: »Ach, wenn der Lumpenmann kommt, da regnet's an dem Tage noch. Bleibt nur lieber daheim, übrigens ist morgen auch Himmelfahrtstag, da regnet's
immer.«
»So?« – lächelte überlegen der Kutscher. »Bei uns in B. und L. und ›dort herum‹ regnet's jedesmal, wenn ein Kienrußmann kommt. Aber vom Haderlump – das ist dummes Zeug!« ist ein alter Aberglaube. Schon in den ältesten Zeiten kannte und übte man die Tagwählerei aus. Die Heiden wählten die Lage, um etwas zu unternehmen, und die Christen ahmen ihnen darin nach. Wenn ein Fremder des Montags zur Stubentür hineinsieht und nicht ganz hineingeht, der macht (angeblich), daß der Mann die Frau schlägt. Wer am Gründonnerstag oder drei Feiertage hintereinander fastet, der ist selbiges Jahr vom Fieber frei, wer es aber schon hat, dem vergeht es davon. Die Kinder soll man Freitags nicht baden, weil sie angeblich aus ihrer Ruhe kommen. Wenn des Sonnabends der Wocken nicht abgesponnen wird, so wird aus dem übrigen Flachs und Werg kein gutes Garn und bleicht sich nicht weiß. Am Gründonnerstag soll man vor Sonnenaufgang dreierlei Frucht säen, und sobald der Samen aufgegangen ist, daß er in die Halme schießen kann, alles vom Boden wegschneiden und eine Salbe daraus machen, die das einzige und beste Mittel für alle Brandschäden sein soll. Andere glauben, so viel Lasten Dünger in der Karwoche aus dem Dorf oder Hof gefahren würden, so viel Leichen würde man aus
solchem Ort zu Grabe tragen, und so viel Bett- und Tischtücher man in dieser Woche auswaschen lasse, so viel Menschen würden in dem Jahre sterben. Wer am Karfreitag Laugenprezeln ißt, bleibt das ganze Jahr vom Fieber frei. Wenn man am Silvestertage die Maulwurfshügel abträgt, so wirft der Maulwurf selbiges Jahr nicht mehr, denkt mancher. Schreibt man am Tage Nikasii (fällt nach dem dritten Advent) frühmorgens stillschweigend an alle Türen des Hauses: Heute ist Nikasiitag, so werden dadurch die Mäuse vertrieben. Wenn die Obstbäume auf Fastnacht beschnitten werden, so bekommen sie selbiges Jahr keine Raupen und die Früchte keine Würmer. An Fastnachten soll man keine Suppe essen, weil sonst die Nase stets triefe. Wenn du Lein säest, so nimm einen langen Sack dazu, laß den Samen recht lange in den Sack hineinlaufen, ziehe ihn wieder recht lang heraus, so wird der Flachs auch lang. – Wie vielerlei sonderbare Meinungen hat man von der Johannisnacht! Den Tag vor Johannis hängt man in Sachsen eine aus Klapprosen, Kornblumen, Rittersporn usw. gemachte Krone in die freie Luft, davon die Blumen, wenn die Krone neun Tage gehangen hat, gutes Ratten- und Mäusepulver sein sollen. Diese Eigenschaften sollen auch die Ähren aus den Erntekränzen äußern, nachdem sie ein Jahr gehangen haben. Manche Leute glauben, daß wenn sie am genannten Tage zwischen elf und zwölf Uhr an der Wurzel einer kleinen Pflanze, welche sie Johanniskraut nennen, schneiden, das Blut des Täufers Johannis in kleinen Körnern sich zeige, und daß solches gleich nach 12 Uhr wieder unsichtbar werde. Am Johannistage holen viele stillschweigend fließendes Wasser, bewahren es sorgfältig auf und glauben, es halte sich das ganze Jahr frisch. Wenn der schwarze Johannisbeerstrauch unter gewissen Zeremonien ausgegraben wird, so glaubt dieser und jener, daß die Beeren dieser Staude Kraft bekämen, die Gicht zu vertreiben, sobald die kranke Person davon esse. Zu dem Ende holt am Abend vor dem Johannistag eine Frauensperson von dem Gärtner einen solchen Strauch. In der darauffolgenden Nacht zieht sie sich ganz nackend aus, nimmt den Strauch und geht damit in den Garten. Hier gräbt sie ein Loch und setzt, indem sie gewisse Worte spricht, den Strauch
hinein, und dadurch sollen die Beeren dieser Staude Kraft bekommen, denen, die sie essen, die Gicht zu vertreiben. Einige halten den Mittwoch, andere den Donnerstag, andere den Freitag zu Unternehmungen für unglücklich. Die Ferkel pflegt man an Fleischtagen abzusetzen. Am Mittwoch geborene Kälber sollen von der besten Art sein, man soll sie im Stall behalten, aber die am Valentinstag geworfenen sollen nicht zur Zucht dienen. An diesem Tage soll man auch keine Henne zum Brüten aufsetzen. Am Mittwoch soll man kein Kalb abbinden, nicht ein- und ausziehen, soll keine Magd in und außer Dienst gehen. Am Freitag soll man kein Kind baden, allen Wein und Essig füllen. Hier und da hält man den Tag der unschuldigen Kinder für unglücklich, widmet man die Tage der heiligen Agnes, des Valentin und Markus den Liebessachen und glaubt, das, was man in dieser Rücksicht an genannten Tagen vornehme, sei von besonders glücklichem Erfolg. Was doch die Menschen von jeher für sonderbare Einfälle hatten! Am Himmelfahrtstage wollen die Weiber nicht nähen, weil sie glauben, wer das Genähte trage, sei bei einem Gewitter in besonderer Gefahr. Viele essen am Gründonnerstag Brezeln, um in dem Jahre vor dem kalten Fieber sicher zu sein. Am Fronleichnamstag eine blaue Kornblume mit der Wurzel ausgerauft, soll das Bluten der Nase stillen, wenn man sie in der hohlen Hand so lange an dieselbe hält, bis sie erwärmt ist. Wenn am Lichtmeß- oder Maria-Reinigungs-Tage die Sonne scheint, so sagen die Schäfer, sie wollen lieber den Wolf in ihren Höfen sehen als die Sonne. Die Weiber verlangen Sonnenschein, weil, wie sie glauben, der Flachs gerate, wenn sie an diesem Tage tanzen. Wer Lein säet, soll dem Säemann ein Trinkgeld geben, weil sonst der Flachs verdirbt, wenn es an Medardi oder am Johannistage oder am Tage Mariä Heimsuchung regnet, soll es vierzig Tage, und wenn's am Siebenschläfer (den 27. Juni) regnet, sieben Wochen hintereinander regnen. Die Förster glauben, bei der Holzsaat müsse man auf das Kalenderzeichen sehen. Zum Baumsamensäen wird eine glückliche Hand erfordert. Das Holz, welches in den Hundstagen gefällt wird, brennt nicht. Das Eschenholz kuriert angeblich alle offenen und sonstigen Schäden, wenn es am Johannistage oder Karfreitag
morgens vor Aufgang der Sonne stillschweigend geschnitten wird. Eichmistel heilt die fallende Krankheit und ist bei Menschen und Vieh sehr heilsam.
Alter Volksglaube. Wenn man früh nüchtern nieset, bedeutet das: Montags: beschenkt, – Dienstags: gekränkt, – Mittwochs: geht's trübe, – Donnerstags: neue Liebe, – Freitags: viel Glück, – Sonnabends: alle Anschläge gehn zurück! –
Aberglaube vor und nach der Geburt eines Menschen. Wenn eine Sechswöchnerin über ein Feld- oder Gartenbeet geht, so wächst in etlichen Jahren nichts darauf, und was gewachsen ist, verdirbt. Wenn eine schwangere Frau vor dem Brotschrank essend stehenbleibt, so bekommt das künftige Kind Mitesser. Wenn eine Wöchnerin einen schwarzen Latz vorlegt, so wird das Kind furchtsam. Wenn eine Wöchnerin zur Kirche geht, kann sie merken, ob sie inskünftige einen Sohn, eine Tochter oder gar kein Kind bekommen werde; denn wenn der Kirchengängerin eine Mannsperson zuerst begegnet, soll sie einen Sohn, wenn eine Weibsperson – eine Tochter bekommen. Begegnet ihr aber niemand, so soll sie auch kein Kind mehr bekommen. Wenn ihr zwei Personen zugleich begegnen, soll sie Zwillinge kriegen. Ein schwangeres Weib, das Gevatter wird, soll ja nicht das Kind selbst aus der Taufe heben, denn sonst würde entweder das Kind, das getauft ist, oder ihr eigenes bald sterben. Wenn zwei kinderstillende Weiber zugleich miteinander trinken, so trinkt eine der anderen die Milch ab. Diese Meinung stimmt mit der überein, daß man glaubt, daß zwei Personen, wenn sie zu gleicher Zeit miteinander anfingen und aufhörten zu trinken, einer der andern die Farbe abtrinke. Über die Wiege des Kindes, wenn es darin liegt, darf man nichts herüberholen, es kriegt sonst den Herzspann. Bringt man ein Kind zum erstenmal zu dir, so schenke ihm eins, drei, sechs oder neun Schnattereier. Diese stoß dem Kinde dreimal in den Mund und singe: Wenn das Buttla anfängt zu gatzen, so fange du an zu schwatzen, da lernt das Kind bald sprechen. Schneide den Kindern vor dem siebenten Jahre die Haare nicht ab, du schneidest sonst den Verstand hinweg, der in den Haaren steckt. In den Sechswochen soll man ein Kind nicht in den Mantel fassen, sonst wird es melancholisch, und hat stets zu trauern, wenn es immer neues Unglück erlebt. Ein neugeborenes Kind soll man nicht auf die linke Seite zuerst legen, es wird und bleibt sonst sein Lebtag links, wenn man ihm das Linkssein sich angewöhnen läßt. Ein Knabe, der geboren wird, wenn Venus Morgenstern ist, bekommt ein viel jüngeres Weib, als er ist; ist aber Venus Abendstern, bekommt er eine ältere Frau, als er ist. Bei einem Mädchen ist es ganz das Gegenteil. Wenn der Mond bei dem Jupiter oder der Venus gesehen wird, so zeigt es bei der Geburt eines Kindes Glück, wenn aber Saturn oder Mars mit dem Mond in Verbindung stehen, Unglück. Der siebente Sohn ist glücklich, etwas zu heilen oder zu pflanzen. Kinder, am Sonntag geboren, können Gespenster sehen und sind glücklich. Wenn ein Kind, nachdem man es schon zu entwöhnen angefangen hat, wieder an die Brust gelegt wird, so kann es beschreien. Das am Himmel regierende Zeichen des Krebses, Löwen usw. hat auf die Denkungsart und die Schicksale der Kinder Einfluß. Wenn das Kind so zur Welt kommt, daß es das Gesicht oben hat, dann kommt es an den Galgen, wenn es ihn verdient hat. –
Aberglaube beim Gevatterstehen und Taufen. Wenn ein Junggesell und eine Jungfrau miteinander ein Kind aus der Taufe heben, soll der Prediger sich zwischen sie stellen, sonst würde, wenn sie sich heiraten, stets Uneinigkeit sein. Es soll keiner seine Gevatterin heiraten. Wer Gevatter steht und muß dazu borgen, dann wird dem Patchen nichts versagt werden und es überall Kredit finden. Wenn ein Kind hundert Jahre alt werden soll, muß man aus drei Kirchspielen die Gevattern dazu bitten. Wenn die ersten Kinder der Eltern Namen bekommen, so sterben sie noch eher als die Eltern. Die Paten sollen dem Kinde Löffelchen kaufen, sonst lernt es geifern. Wer Gevatter stehen soll und sich schon angezogen hat, darf nichts Abseitiges verrichten, sonst tut's das Patchen im Bette nach. Wem es in der linken Hand juckt, wird bald Gevatter stehen. Wenn die Paten in des Kindes Haus kommen, so müssen sie, ehe sie zur Taufe gehen, ihre Handschuhe auf die Wiege legen, wenn es ein Mädchen ist, ist es aber ein Knabe, den Hut, dann steht dem Kinde der Staat gut. In dieser Absicht putzt man das Kind auch wohl drei Sonntage hintereinander sauber an. Auch müssen die Paten vorher etwas Kuchen essen, damit das Kind Kuchen essen lerne. Wenn während der Taufe die Uhr schlägt, so stirbt das Kind. Einem Kinde, das in der Taufe Johannes genannt wird, widerfährt kein Unglück. Wer keine zaghaften Kinder haben will, da soll der Vater gleich nach der Taufe dem Kinde ein Schwert in die Hand geben, dann sind sie immer beherzt und kühn. Sobald das Söhnchen oder Töchterchen getauft ist, soll man es mit den Füßen an des Vaters oder der Mutter Brust stoßen und ihm Gutes wünschen.
Aberglauben Friedenbringender Aberglauben. Als im 11. Jahrhundert die Polen unter Wladislaus I. die Pommern bekriegten und trotz ihrer Überlegenheit mehrere Niederlagen erlitten, ging man ernstlich über die Ursachen des Mißgeschicks zu Rate. Man kam endlich überein, es sei eine Strafe Gottes, weil die polnische Armee in den Fasten Milchspeisen genossen habe, und kehrte traurig um, weil man überzeugt war, aus dieser Ursache nicht siegen zu können. beim Sterben und Begrabenwerden. Wer viel bauet, stirbt bald. Wer ein Erdhuhn oder eine Hausotter beschädigt oder nur sieht, der muß selbiges Jahr sterben. Wenn ein Weib in den Sechswochen stirbt, so muß man ein Mandelholz oder ein Buch ins Wochenbett legen, auch alle Tage das Bett neu machen, sonst kann sie nicht in der Erde ruhen. Wenn der Hausherr stirbt, muß man die Bienenstöcke, die Wein- und Bierfässer im Keller fortrücken, sonst bleiben sie stehen. Wenn das Feuer platzt und prasselt, die Kinder oder Hunde vor einem Hause scharren und heulen, Raben krächzen, Eulen und Elster auf dem Hause schreien, die Katzen sich beißen, so stirbt jemand. Wenn einem die Haut schauert, so läuft ihm der Tod über das Grab. Wenn man Tränen auf den Kranken fallen läßt oder über ihn wegragt, so stirbt er schwerer, und wenn er nachmittags um vier Uhr noch nicht tot ist, so quält er sich noch sechs Wochen. Wenn die Leiche im Sarge auf die rechte Seite sich legt, so stirbt jemand männlichen Geschlechts, wenn sie sich aber auf die linke Seite legt, so stirbt jemand weiblichen Geschlechts aus der Familie. Sobald der Mensch tot ist, muß man die Fenster aufmachen, damit die Seele hinaus kann. Daß der Tote nicht wieder komme, muß man, sobald die Leiche fortgetragen wird, einen Eimer Wasser hinterher gießen und die Haustür zumachen oder den Toten bei der großen Zehe anfassen. Wenn man vor alle Türen drei Kreuze malt, so kann der Tote nicht herein. Wenn das Gesicht eines verstorbenen Ehegatten oder Freundes im Tode weich bleibt, so holt er einen aus dem Hause nach. Wer den ersten Spaten voll Erde in die Grube werfen kann, an dem hat der Tote keinen Teil. Wenn das Grabloch nachfällt, so stirbt einer aus der Freundschaft.
Vom Wahrsagen aus der Kaffeetasse. Die Wahrsagerin schüttet in die Obertasse etwas dicken Kaffeesatz, schwingt denselben dreimal, haucht dreimal hinein, setzt sie dann so lange, daß das Gebet des Herrn dreimal gebetet werden kann, auf die Untertasse umgekehrt hin, so daß die dünne Feuchtigkeit abläuft, setzt die Obertasse an einen andern Ort, nimmt sie, nachdem sie drei Kreuze darüber geschlagen, auf, sieht hinein, um aus den darin zurückgebliebenen Kaffeeteilchen das Unbekannte bekannt zu machen. Gewöhnlich fallen die Wahrsagereien zweideutig aus oder die Wahrsagerin setzt sie nach dem von der fragenden Partei Gehörten zusammen. –
Das Klingen in den Ohren hält der Abergläubische für eine Wirkung, die dadurch verursacht wird, wenn Abwesende von ihm reden. Klingt es im rechten Ohr, so redet man Gutes, klingt es im linken, Böses. –
Wahrsagen aus den Sternen. Unter der Astrologie, welche ehedem so in Ansehen stand und eifrig erlernt und getrieben wurde, versteht man die Kunst, aus verschiedenen Stellungen der Gestirne (Konstellationen) und ihrem Lauf zukünftige Begebenheiten, wie die Veränderungen des Wetters, die Fruchtbarkeit der Erde, die Schicksale ganzer Reiche und einzelner Menschen und den Ausgang ihrer Unternehmungen vorher zu sagen. Der Ursprung derselben ist in dem Heidentum zu suchen, da man glaubte, der Himmel besitze selbst Leben und beseele die Gestirne, welche daher sehr vollkommene Wesen wären, durch welche dann auch die Schicksale der Menschen und die Begebenheiten auf dieser Unterwelt regiert würden, welche man daher durch fleißige Beobachtung derselben voraussehen könnte. Man glaubte, Gott habe jedem Planeten einen Erzengel zugeordnet, der Legionen Engel unter sich habe. Sobald nun ein Kind geboren würde, sende der Erzengel einen seiner Untergebenen, der zeitlebens bei dem Kinde bleibe, welches dann auch solche Eigenschaften bekomme, als der Planet habe, unter welchem es geboren ist. Selbst Philipp Melanchthon war von dieser Art des Aberglaubens angesteckt und suchte durch Astrologie sein Lebensende zu erfahren. Als er daher um die Zeit, auf welche er seinen Tod prophezeit hatte, zu der Versammlung der Theologen reiste, die im Jahre 1540 zu Hagenau gehalten wurde, setzte er vorher zu Wittenberg ein Testament auf, verfiel aber unterwegs zu Weimar schon in eine tödliche Krankheit, die ihre Ursache lediglich in seiner Einbildung hatte. Der Kurfürst von Sachsen schickte Luthern von Wittenberg dahin, dem kranken Melanchthon mit Trost beizustehen. Als dieser ankam, fand er ihn in den letzten Zügen, die Augen waren schon gebrochen, die Sprache und das Gehör ihm vergangen; er kannte niemand mehr. Luther erschrak darüber sehr, nahm den schon halbtoten Melanchthon bei der Hand und redete ihn mit den Worten an: »Sei getrost, Philippe, du wirst nicht sterben. Ob Gott schon Ursache hätte, dich zu töten, so will er doch nicht den Tod des Sünders, sondern daß er sich bekehre und lebe usw.«; Melanchthon erholte sich und wurde gesund. Er gesteht in einem Brief, den er nachmals geschrieben hat, daß diese erschreckliche Krankheit bloß von einem Gemütskummer hergerührt habe, den ihm eine fremde Sache verursacht habe, und er würde an derselben gestorben sein, wenn er nicht durch Luthers Ankunft dem Tode gleichsam aus dem Rachen gerissen wäre. –
Eine Sibylle. Am 25. Juni des Jahres 1843 schloß die ihrer Zeit vielgenannte Wahrsagerin Lenormand ihre Augen für immer. Seit fünfzig Jahren hatte sie das Haus Nr. 5 in der Rue de Tournon zu Paris bewohnt. Eine Tafel im Hofe, über dem Eingang zum Erdgeschoß, trug die Worte: »Mlle. Lenormand, Buchhändlerin.« Sie verkaufte nämlich ihre eigenen Werke und nannte sich, da das Gesetz schon damals der Wahrsagerei nicht hold war, Buchhändlerin. Man konnte jederzeit bei ihr eintreten; durch eine Dienerin angemeldet, wurde man sogleich vorgelassen. Das Empfangszimmer war einfach und freundlich möbliert, Mlle. Lenormand saß auf einer Ottomane, eine prachtvolle Perücke und einen wunderbaren persischen Turban auf dem Haupte, sonst aber gut bürgerlich gekleidet. Keine Totenköpfe, keine Schlangen, keine Skelette und keine Krokodile, es ging alles ganz einfach her. Ihre erste Frage war: »Was für ein Spiel wünschen Sie? Zu sechs, zu acht, zu zehn, zu zwanzig bis zu vierhundert Franken?« Sobald der Besucher gewählt hatte, besah sie seine linke Hand, fragte ihn nach seinem Alter, seiner Lieblingsblume, dem Tiere, das er am meisten verabscheue, und nach ähnlichen Dingen, dann nahm sie ihre Karten, ließ, wieder mit der linken Hand, abheben und breitete sie nun vor sich auf der grünen Tischdecke aus. Unmittelbar darauf begann sie, die Augen fest auf die Karten gerichtet, ihre Prophezeiung in vielen volltönenden, sprudelnden Worten, hin und wieder den Zuhörer auch durch einen Geistesblitz überraschend. Jedermann verließ befriedigt die Wahrsagerin, und die meisten versicherten späterhin, daß ihre Prophezeiungen eingetroffen wären.
In Alençon am 27. Mai 1772 geboren, wurde sie in dem dortigen Benediktinerinnenstifte erzogen und soll, kaum sieben Jahre alt, die Absetzung der Äbtissin prophezeit haben. Einen Monat später war ihre Vorhersagung eingetroffen. Sie bestimmte auch der Äbtissin Nachfolgerin voraus, und dieser Orakelspruch ging drei Monate später in Erfüllung. So trat sie, im Gefühle ihrer übernatürlichen Mission, zu einer Zeit in die Welt, als die französische Revolution bereits am Horizonte aufdämmerte. Trübe, traurige Weissagungen flossen aus ihrem Munde, worüber die frivole Pariser Welt lachte. Da kamen eines Tages drei junge Männer zu ihr. Sie betrachtete dieselben aufmerksam, dann sagte sie ernst: »Ihr werdet alle drei eines gewaltsamen Todes sterben. Sie«, fügte sie bei dem einen hinzu, »von den Segnungen des Volkes begleitet und zum Gott gemacht, ihr anderen mit seinen Verwünschungen beladen.« Die Herren lachten und gingen. Es waren Marat, Robespierre und St. Just. Als Marat durch den Dolch der Charlotte Corday gefallen war, als das Volk wehklagend seine Leiche ins Pantheon getragen hatte, als die Lenormand in ihren düsteren Prophezeiungen fortfuhr, wurde Robespierre unruhig und ließ eines Morgens die Prophetin verhaften und in die Gefängnisse der Conciergerie schleppen, die man damals nur verließ, um das Schafott zu besteigen. Der 9. Thermidor rettete ihr das Leben und gab ihr die Freiheit wieder, und die Verfolgung Robespierres umkleidete sie mit neuem Nimbus. Unzählige strömten zu ihr, um sich von ihr die Zukunft enthüllen zu lassen. Unter ihnen erschien auch eine junge Frau in tiefer Trauer. Sie hatte ihren Gatten unter dem Beil der Guillotine verloren. »Trösten Sie sich, Madame«, sagte die Lenormand, »eine Krone wartet Ihrer!«
Diese Dame war Josephine Beauharnais. Kurze Zeit darauf heiratete die Witwe einen unbekannten, damals noch einflußlosen General ohne Vermögen und dachte seufzend: Ich verzichte auf die mir geweissagte Krone! Allein die Neugier stachelte sie doch, und einige Wochen nach der Hochzeit veranlaßte sie Bonaparte, der bekanntlich ebenfalls nicht frei von Aberglauben war, mit ihr zur Lenormand zu gehen. Wie groß aber war ihr Erstaunen, als die Prophetin zu ihr sagte: »An Ihrem Lose, Madame, hat sich nichts geändert!« Als nun Bonaparte lächelnd ihr seine Hand hinhielt, rief die Lenormand: »hundert siegreiche Schlachten, Retter der Republik, Gründer einer Dynastie, Besieger Europas!« – Bonaparte wurde ernst und sagte: »Ich werde Ihrem Orakel Ehre zu machen suchen, Madame!« Als die Lenormand viele Jahre später ihre bevorstehende Ehescheidung prophezeite, ließ Napoleon sie verhaften. Sie wurde zu Fouché geführt, der sich ihrer erinnerte; sie hatte ihm nämlich, als er noch Konventsdeputierter war, gesagt: »Sie sind schon gestiegen, Sie werden aber noch höher steigen!« – »Ihre Prophezeiung ist eingetroffen«, sagte er zu der Gefangenen; »ich bin höher gestiegen, als ich es mir damals träumen ließ. Aber haben Sie auch vorausgewußt, daß Sie ins Gefängnis wandern und dort wahrscheinlich sehr lange bleiben werden;« – »O ja«, entgegnete die Lenormand, »ich habe es in meinen Karten gelesen, aber auch, daß mich Ihr Nachfolger, der Herzog von Rovigo, bald befreien wird.« Und es geschah wirklich, wie sie vorausgesagt: Fouché fiel in Ungnade, wurde abgesetzt und die Prophetin bald darauf wieder frei. Die Restauration begünstigte sie, hatte sie doch in ihrer Schrift: » Souvenirs prophétiques d'une Sibylle« Napoleons Sturz prophezeit. Alles strömte ihr zu, und bis zu ihrem Tode lebte sie ungestört als ausschließlich privilegierte Prophetin. Die Staël, die Tallien, die Recamier, Benjamin, Constant, der Kaiser Alexander von Rußland und viele andere Berühmtheiten jener Tage hatten sie besucht. Sie schrieb nach und nach mehrere Werke; so außer dem schon genannten: » Memoires historiques et secrètes de l'Impératrice Josephine« u. a. Als sie starb, hinterließ sie ihren Erben 500 000 Franken, ihre Papiere und zahllose Briefe merkwürdiger Personen, die an sie gerichtet worden waren. –
Vom Wahrsagen aus den Händen. Eine alte Zigeunerin wird dem Abergläubigen ehrwürdig, wenn sie den prophetischen Mund öffnet, und ein Verliebter wird bewundert, wenn er wahrsagt. Kaum läßt sich ein schwarzbraunes Zigeuner-Gesicht sehen, so läßt jeder seine Geschäfte und läuft demselben nach, um etwas Glückliches zu hören. Die Zigeuner sind dreist genug, mit ihren Wahrsagereien sich jedem aufzudringen, und unverschämt zu sagen, daß man es bedauern werde, wenn man sie nicht hören würde. Ungeheißen stehen sie still, rufen: »Gott grüße dich, mein Herr! Ach, was hast du für ein gutes Herz, und hast doch so viele Feinde und Neider, die immer mit dir umgehen und dir so freundlich begegnen. Du wirst sehr alt werden, grau wirst du werden, und du wirst auch selig werden.« Vergebens bietet man ihnen Almosen an, um weiterzugehen, oder legt ihnen Stillschweigen auf. »Wir sind auch Christenleute, antworten sie, und glauben an den Herrn Jesum; aber höre uns an, wir haben bei Generals und Obersten Gehör gefunden. Es steht dir ein großes Unglück bevor, hüte dich vor zwei paar Schuhen! du kannst es aber vermeiden. Hör, mein Herr! es ist nicht gut, daß die Leute alles wissen, ich kann dir hier auf der Straße nichts sagen, komm mit mir, so will ich dir die beschreiben, denen du so viel trauest, und die doch hinter dir her sind. – Ach, du hast heimliche Feinde, und dein edles Herz macht, daß sie dich hassen. Hör mich an, mein Herr, ich will dir alles sagen, was sie vorhaben.« –
Vom Kartenschlagen. Es geschieht dies auf verschiedene Art. Die bekannteste ist folgende: Die Wahrsagerin mischt die Karten, läßt sie den, der sich wahrsagen lassen will, abheben und ein Blatt wählen, wonach sie sich richten will. Dann legt sie die Blätter, je acht nach der Reihe, auf, betrachtet die Lage des von jenem erwählten Blattes und die Lage der anderen gegen dasselbe und fängt nun an, Vergangenes und Zukünftiges zu sagen. Jedes Blatt in der Karte und jede Farbe hat ihre Bedeutung.
Im Dorfe Wuthenow, eine Meile von Soldin in der Neumark, wurden dem Krüger fünfzig Taler, lauter harte Taler und Achtgroschenstücke, gestohlen. Der Krüger ließ sich die Karte legen, und das Weib, welches dies tat, sagte: Der erste Jude, der in einem braunen Rocke zu ihm käme, habe sein Geld gestohlen. Kurz darauf kehrte ein alter Jude aus Lipehne, der in Soldin zu Markte gewesen, bei dem Krüger ein, um einmal zu trinken. Der Bestohlene sah kaum, daß der Jude mit einem braunen Rocke bekleidet war, als er ihn auch schon für den Dieb seines Geldes hielt. »Habt Ihr kein hart Geld?« fragte er ihn. »Laßt mir doch einige Taler ab!« Der Jude sagte, er habe hart Geld in Soldin eingewechselt, um es auf der Frankfurter Messe zu gebrauchen, aber er wolle ihm doch sechs Stück ablassen. Bei dieser Gelegenheit bemerkte der Krüger, daß der Jude an achtzehn Stück hatte und beredete sich mit seiner Frau, seinem Knecht und seiner Magd, ihn zu knebeln. Dies geschah; der Jude wurde mit einem Strick über den Leib, den man hinten mit einem Prügel zusammendrehte, so gepreßt, daß ihm das Blut aus Mund und Nase quoll, und als er dennoch mit großem Geschrei seine Unschuld versicherte, legte man ihm zwischen jeden Finger und Zehe kleine Hölzer und drückte sie zusammen. Dabei prügelte man den Armen unmenschlich, daß er gestehen sollte. Der Lärm und das Geschrei rief die Nachbarn herbei, die, weil sie das Haus verriegelt fanden, die Tür einschlugen und den schon halbtoten Juden von weiteren Grausamkeiten des Krügers retteten. Die Sache wurde untersucht und der Jude völlig schuldlos befunden; denn er hatte, wie glaubwürdig nachgewiesen wurde, das harte Geld bei einem Kaufmann in Soldin eingewechselt. Diese Geschichte hat sich im Juni des Jahres 1784 zugetragen. –
Das Punktieren oder die Geomantie ist die eitle Kunst, durch Punkte, die man in den Staub, Sand oder auf Papier macht, etwas Unbekanntes erfahren zu wollen. Die Punkte, die aber, indem man sie zeichnet, nicht gezählt werden dürfen, werden, wenn sie gemacht sind, zusammengezählt und von der Zahl, die da herauskommt, auf mannigfaltige weise Gebrauch gemacht. Es werden auch wohl die Taufnamen der nach Rat fragenden Personen aufgeschrieben und die einzelnen Buchstaben mit der Summe der gezählten Punkte verglichen. Jeder Buchstabe bedeutet eine Zahl. Das Verfahren ist ganz willkürlich. –
Vom Teufel Besessene, auch Angefaßte genannt. Das viele Schreiben und predigen über die Gewalt des Teufels, über die neuen Moden, welche Gottes Strafen, Pest, Krieg, Brand, Mißgeburten, Hungersnot nach sich ziehen sollten, wodurch Schuldige und Unschuldige in gleiches Elend gestürzt würden; die angeblichen Vorboten des jüngsten Gerichts: die Kometen, Feuer- und Luftzeichen, Blutregen usw. verwirrten in der letzten Hälfte des 16. Jahrhunderts einer großen Menge von Menschen den Verstand und machten bei hypochondrischen Körpern und schwachen, abergläubischen Seelen einen besonderen Eindruck und brachten schlimme Wirkungen hervor. Viele Leute glaubten selbst sich vom Teufel besessen und sagten die wunderlichsten Dinge aus. Zu Friedeberg in der Neumark glaubten sich im Jahre 1593 sechzig und nach und nach hundertundfünfzig Menschen vom Teufel besessen, welche in der Kirche großen Unfug verübten, so daß der Prediger M. Heinrich Lemrich, der sich vorher viel mit diesen Leuten abgegeben und sie unterrichtet hatte, sich einstmals selbst auf der Kanzel, als er davon predigte, wie ein Besessener gebärdete und auch dafür gehalten wurde, wodurch die Macht des Teufels noch mehr im Ansehen stieg. Deswegen wurde damals von dem betreffenden Konsistorium anbefohlen, in allen Kirchen in der Mark öffentliche Gebete zur Befreiung der Menschen von der Gewalt des Teufels anzustellen, das übel wurde aber dadurch nicht gehoben. Es nahm vielmehr den weg einer ansteckenden Krankheit, wenn an einem Orte ein Besessener war, so fanden sich gleich mehr, die sich ebenfalls für besessen hielten und aus Einbildung mit fortgerissen wurden. Wüßte man nicht die Geschichte der Nonnen zu Loudon und der zwanzig Besessenen zu Annaberg und so viele Begebenheiten dieser Art bis in die neueste Zeit – wir erinnern nur an die zahlreichen vom Antichrist Angefaßten in einem Waisenhause des Wuppertales zu Ende der fünfziger Jahre unseres Jahrhunderts –, so würde man solche Erscheinungen für unglaublich halten. – In Spandau bekam ein Hutmachergesell im Jahre 1594 einen ähnlichen Paroxysmus, wie jene Friedeberger, und in kurzer Zeit wurden etliche dreißig bis vierzig Menschen davon befallen, die allerlei Gaukeleien und Kontorsionen machten, unter welchen einige wie Mondsüchtige auf den Schornsteinen, Dächern und Bäumen mit Lebensgefahr herumkrochen. Der Rat ließ eiserne Ringe in den Mauern befestigen, um die Besessenen dieser Art mit Ketten daran festzuschließen, wodurch das Übel etwas gemildert wurde. Leider bestärkten einzelne Geistliche diese armen Leute in ihrer verrückten Einbildung und mißbrauchten sie, ihre Lehrsätze von der Gewalt des Teufels zu bestätigen. Lökel hat die Geschichte der hier angeführten Besessenen und eine noch größere Anzahl von solchen Verrückten angezeigt und bei einigen die Worte und Reden angeführt, deren sie sich bedienten, um im Namen des Teufels die Menschen über die Modesucht zu bestrafen und Moral zu predigen, die vollkommen in dem damaligen Kanzelstil abgefaßt sind. Angesehene und rechtschaffene Männer, welche die Bosheit und verworrene Einbildungskraft dieser Elenden erkannten und sie verachteten, wurden dafür von ihnen mit üblen Nachreden und Lästerungen heimgesucht. War ein geistlicher Amtsbruder gelinder in seinen Predigten, lärmte und polterte er nicht dem Teufel und seiner Gewalt das Wort, so wurde er vom Teufel durch die Besessenen selbst ermahnt, seine Gemeinde mit mehr Eifer selbst zu bestrafen und mit Ernst anzugreifen, wie solches dem Superintendenten zu Spandau, M. Albrecht Colerus, begegnete, welchen der erwähnte Hutmachergeselle deshalb zu vermahnen von einem Engel wollte Befehl erhalten haben. Lökel sagt ganz vernünftig, daß dieser Mensch wahnsinnig gewesen und von dem Henker ein Brandmark verdient hätte. Das Unwesen zu Spandau machte indessen so viel Aufsehen, daß Kurfürst Johann Georg die vornehmsten Theologen von Berlin und Frankfurt dahin schickte, um die Sache zu untersuchen, deren ausführliches Bedenken, welches nach damaliger Einsicht abgefaßt ist, Engel in seinen Annalen abdrucken ließ. In Frankfurt a. d. O. trieb der Teufel auch sein Spiel. Eine Fischerstochter aus Leubus wollte im Jahre 1536 mit einem Soldaten zu tun gehabt haben und ihm zu willen gewesen sein. Sie gebärdete sich alsbald als Besessene und wurde nach Frankfurt gebracht. Das Auffallende war – wenigstens nach Berichten aus jener Zeit –, wenn diese Frauensperson an die Wand strich, so erhielt sie die Hand voll Geld. Die Geschichte dieser Besessenen hat zu jener Zeit viel Redens von sich gemacht und die Federn der Gelehrten beschäftigt; kein einziger hat sich getraut, die natürlichen Ursachen zu erforschen. Engel erzählt sie in den märkischen Annalen, und Leuthinger in seinen Kommentarien. Dr. Stymmel, ein Professor der Arzneigelahrtheit zu Frankfurt, der gelehrte Jodokus Willich und der berühmte Sabinus haben sie weitläufig beschrieben, und alle Hexenbücher damaliger Zeit erzählen sie, jedoch mit allerlei Bemerkungen aus den gewöhnlichen Hexengeschichten verbrämt, und doch war der Zusammenhang leicht zu erklären. Zuletzt, als die Person auf Luthers Anraten in allen Predigten zur Kirche geführt und zu Hause auf Befehl des Rates angeschlossen wurde, wurde sie der Possen selbst überdrüssig, und der Zauber hörte auf. –
Natürlich war die Geisterbeschwörungsgaukelei, die ja in unseren Tagen selbst unter den aufgeklärten Deutschen noch nicht ganz verschwunden ist, im vorigen und den vorhergehenden Jahrhunderten in vollem Schwunge. So produzierte, als Kaiser Karl V. sein Hoflager in Innsbruck hielt, sich der berühmte Schwarzkünstler Dr. Johann Faust vor ihm, und richtig! – er ließ auf Verlangen des Kaisers Alexander den Großen »ein wohlgesetztes dickes Männchen, mit rotem dichtem Bart, glühenden Wangen, blitzenden Augen und strengen Angesicht in schönem Harnisch einherschreiten«. Bald erschien auch seine Gemahlin im blauen Samtrock mit goldener Stickerei und Perlen geziert, und daß sie es wirklich war, das erkannte Kaiser Karl an der großen Warze, die sie im Nacken hatte. Man nahm die Sache bei dieser Vorstellung glücklicherweise von der heiteren Seite.
Ein altes rheinländisches Liedchen schildert in naiver Weise die abergläubischen Vorurteile der pfälzischen Landbewohner. Dasselbe ist betitelt »Reeshinnernisse« und lautet:
»Ich kann halt gar nit weiter kumme,
Es is a wahri Noth,
Uf heut hatt ich mer's vorgenumme,
Da war die Sunn so roth;
Un geschtert, wie ich's überleech,
Lauft so a Sapperlot,
A dummer Haas mer übern Weech,
Do reesa – b'hüt mich Gott!
Am
Mondtach fangt man nie was an,
Am
Suntach wollt' ich gehn,
Da muß, als war's mer angethan,
A
Schwein am Stadtthor stehn;
Uf morche, da werd's juscht a Jahr,
Daß mer der Wooche brecht;
Der Tach kann freilich nix davor;
Doch weeß mar's als nit recht,
Drum weeß ich nit, was anzufange,
For daßmal geht's mer bös;
Denn deß wird doch kein Mensch verlange,
Daß ich am Freitach rees'!«
Indessen wird jeder mit dem Leben und den Gewohnheiten des Volks, mit seinem Denken und Tun nur einigermaßen Vertraute aus eigener Erfahrung wissen, daß man ähnliche Vorurteile und mit geringen Abweichungen und Nuancen denselben Aberglauben, wie er sich in diesem Liede ausspricht, überall in Deutschland antrifft. Noch immer werden hier und da einzelne Frauen mit sogenanntem bösen Blicke ängstlich gemieden und manches bejahrte rotäugige Weib als Hexe gefürchtet und ihren Verwünschungen dies und jenes Unheil, Krankheiten, ja der Tod von Kindern zugeschrieben. Jedoch ist das Volk darauf bedacht gewesen, dem unheilbringenden Einflusse der bösen Mächte vorzubeugen und zu entgehen. So wird der böse Zauber eines quer über den Weg laufenden Hasen dadurch vernichtet, daß man nicht mehr und nicht weniger als neun Schritte zurückgeht, und wer nur nicht nüchtern des Montags und Freitags früh ausgeht, hat diese dies fatales keineswegs zu fürchten; jedenfalls aber bleibt es eine schlimme Vorbedeutung, wenn jemand auf seinem Geschäftswege zuerst ein weibliches Individuum entgegenkommt, sie müßte denn einen Korb voll Klee tragen, dagegen ist glückverheißend die Begegnung von Männern und Wagen; und wer bei gerichtlichen Verhandlungen, Verabredungen, Verträgen, Bittgesuchen und ähnlichen Verhältnissen auf guten Erfolg rechnen oder doch vor Nachteil gesichert sein will, der versäumt es gewiß nicht, neun oder sieben kleine Brotwürfelchen zu sich zu stecken und bei dem Eintritt in das Verhandlungszimmer den Namen der heiligen Dreieinigkeit still vor sich hin auszusprechen. Sehr gewöhnlich endlich ist der Gebrauch eines Erbschlüssels, den man in ein ebenfalls altes, in derselben Familie von den Voreltern fortgeerbtes Buch steckt, dasselbe mit einem Faden umbindet und den Schlüsselkopf zwischen zwei Fingern hält, um den Ort oder mutmaßlichen Inhaber eines verlorenen Gegenstandes oder sonst eine ungewisse Sache zu erraten. Dreht sich das Buch sogleich nach der an dasselbe gerichteten Frage, so ist man auf rechter Spur und der Wahrheit nahe; rührt aber das Buch sich nicht, so hat man einen durchaus falschen Verdacht gehegt.
Was aber allerorten am Weihnachts- und am Silvesterabend das junge ledige Volk zur Kurzweil vorzunehmen pflegte, um aus der Gestaltung gegossenen Bleies, aus der geraden oder ungeraden Anzahl Holzstücken, die aus der Remise hinter den Ofen getragen werden, oder aus dem Schütteln eines Erbzauns um Mitternacht und dem danach unterbleibenden oder sich erhebenden Hundegebell abzunehmen, ob und wer, wann und von welcher Gegend her der zukünftige Ehegemahl zu erwarten sei, daran zu zweifeln hat noch niemand ernstlich gedacht. Wird ferner um dieselbe Stunde ein Sarg in der Esse hangend erblickt, da stirbt im selbigen Hause eins im Laufe des Jahres, und wer hineinrufend in die Ofenblase einen Widerhall hört, der muß selber sterben; in den zwölf heiligen Nächten aber hat jedermann acht auf die gehabten Traumerscheinungen, durch welche die Erlebnisse in den jenen Nächten entsprechenden zwölf Monaten des laufenden Jahres angedeutet sind. Ganz besonders wichtig allen Unverheirateten ist der St.-Andreas-Tag. Der gute Heilige läßt da jeden, der sich in umgekehrter Richtung auf sein Nachtlager gelegt, sein künftiges Los im Traume schaun; vor dem Einschlafen ruft man den Heiligen also an:
O heiliger Andreas mein,
Den Herzallerliebsten laß heut mir erschein'!
Soll ich mit ihm leben in Kummer und Not:
Laß ihn mir erscheinen bei Wasser und Brot!
Doch soll ich mich guter Tage erfreun:
Laß ihn mir erscheinen bei Kuchen und Wein!
Soll ich mit ihm leben in Zufriedenheit:
Laß ihn mir erscheinen voll Heiterkeit.
Auch pflegt St. Andreas im Traume zu antworten auf folgende an ihn gerichtete Fragen:
Andreas, heiliger Schutzpatron,
wende von mir Schmach und Hohn!
Schaue doch mein Alter an,
Schaffe bald mir einen Mann!
Krieg' ich einen oder keinen?
Antwort: Einen, einen.
Ei, das wäre ja gar schön!
Wird er viel nach andern sehn;
Treulos, unbeständig sein,
Oder einzig und allein
Mir nur leben zu Gefallen?
Antwort: Allen, allen.
Ei, das klänge nicht gar fein,
Würde lieber gestorben sein!
Hat er denn ein eigen Haus,
Und wie sieht es drinnen aus,
Ist es denn von rechter Länge?
Antwort: Enge, enge.
Nun, das gehet auch noch an,
Leb' ich nur glücklich mit meinem Mann;
Hat er, was mir Freude schafft,
Sind die Betten auch von Taft,
Da ich drinnen ruhen werde?
Ach, wie klingt es schauerlich,
Heil'ger Andreas, behüte mich;
Soll denn der Tod mein Ehegemahl sein:
Muß ich mich ergeben drein.
Erden – Hoffnung – falscher Schimmer!
Antwort: Immer, immer!
Brautpaare begeben sich erst nach völligem Ausläuten der Glocken auf den Kirchweg, gehen häufig hintereinander; so ein Teil sich umsieht, deutet es Trennung der Ehe an durch Tod oder Scheidung, das Regnen im Brautkranz aber Glück; über die Schwelle der Kirchtür wird mit dem rechten Fuß zuerst getreten, mit zum Himmel erhobenem Blick, »so Gott will« gebetet und an den Stufen des Altars, eng nebeneinander kniend, wird kein Zwischenraum gelassen, damit künftig niemand zwischen die Ehe trete, endlich bei auswärtiger Trauung eilt man, noch vor der zwölften Mittagsstunde heimzukehren.
Wie werdende Mütter sich hüten müssen, vor jedem Schreck und Haschen und Greifen nach Insekten und andern Tieren, um ihren Kindern kein Muttermal beizubringen, ist allbekannt; so wagt auch keine, in solchen Umständen nicht eine Stecknadel fremden Gutes sich anzueignen, aus Besorgnis, dem Kinde einen Diebessinn zu geben; noch sich die Nase zuzuhalten, bei dem Vorübergehen an übelriechenden Gegenständen aus Furcht, es möchte das Kind einen ungesunden Atem erhalten; noch Gevatter zu stehen, weil einer der Täuflinge sterben muß; doch wird durch das Antun zweier Schürzen der böse Zauber wiederum zunichte. Schaut endlich ein neugeborenes Kind sich innerhalb des ersten Jahres in den Spiegel, so stirbt es binnen Jahresfrist.
Sehr häufig sind die Heilungen durch Sympathie; Leichdornen, Warzen werden gewöhnlich im letzten Viertel des abnehmenden Mondes kreuzweise mit einem Strohhalm bestrichen, im Namen der heiligen Dreieinigkeit und unter eine Dachtraufe vergraben; nicht selten auch im zunehmenden Monde, wobei man sich des Sprüchleins bedient: »Was ich sehe, vermehre sich«, indem man nämlich das Angesicht dem Monde zuwendet, »Was ich streiche, verzehre sich.« Mit der Verwesung jenes Halmes schwindet auch das Übel. Durch Osterwasser, am ersten Osterfeiertage früh vor Sonnenaufgang aus einer Quelle geschöpft, pflegen viele den Magenkrampf zu heilen, indem sie abwechselnd in ungerader Anzahl bald einen Löffel solchen Wassers, bald einen Löffel voll Bierhefe trinken. Wer sein Zahnweh loswerden will, der schneidet sich am Karfreitag vor Sonnenaufgang die Nägel erst an der linken Hand, dann am rechten Fuße und an der rechten Hand und am linken Fuße ab, begibt sich mit den Abschnittlingen auf den Steg eines Wassers und wirft dieselben hinter sich dem Wasserlaufe nach im Namen der heiligen Dreieinigkeit.
Die Schwindsucht endlich sucht man durchgängig durch Messen zu büßen, und zwar in folgenden Weisen: Der Schwindsüchtige legt sich schweigend auf den Boden nieder, und nun nimmt ein anderer einen von einem Kinde gesponnenen wergenen Faden Garn und mißt vom Wirbel des Hauptes bis an die Sohle des linken, dann des rechten Fußes und zuletzt von der Spitze des Mittelfingers der linken Hand bis zur rechten hin, still die Worte sprechend: »Schwindsucht, ich will dich büßen an Händen und an Füßen im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.«
Danach aber wird der Faden verbrannt.
Reichte die Länge des Fadens vom Hauptwirbel bis zur Fußsohle bis wenigstens in die Mitte der rechten Hand, so ist die Gefahr noch unbedeutend, wird aber um so größer, je weiter die Fadenlänge nach und über die Handwurzel zurückreicht. Mit dem Tage der Messung tritt ein Stillstand der Schwindsucht ein. Die völlige Heilung wird dadurch herbeigeführt, daß der Kranke für eine ungerade Summe Geldes sich ein Quart Wein holen läßt und in jedem letzten Mondesviertel dreimal Freitags und Montags, einmal nach Sonnenuntergang und zweimal vor Sonnenaufgang in drei Schlucken das mit obigem Wein gefüllte Glas austrinkt und dazu spricht:
Ich, N. N., das tu' ich zur Zeit,
Das trink' ich für meines Leibes Macht;
Das trink' ich für meines Herzens Kraft;
Das trink' ich für mein Lung- und Leberblut;
Das hab' ich getrunken für die Schwindsucht gut.
Im Namen des Vaters, des Sohnes und des heiligen Geistes.
Ist noch ein Tropfen Wein im Glase, so gießt man ihn auf den Wirbel des Kopfes, beobachtet bis zum Aufgang der Sonne das tiefste Stillschweigen und wiederholt den Akt jeden Monat, bis die abermalige Messung dartut, daß die Länge des Körpers von der linken zur rechten Hand der vom Hauptwirbel bis zur Fußsohle gleichgekommen ist.
Eine Teufelsbeschwörung im 16. Jahrhundert schildert Bartholomäus Sastrow, Bürgermeister von Stralsund, in seiner umfangreichen Selbstbiographie mit folgenden Worten:
»Im Jahre 1529 ging meine Mutter schweren Fußes und wollte vor der Entbindung noch scheuern und waschen lassen, wie es die Frauen in Brauch haben. Nun hatten meine Eltern diesmal eine Magd, die vom bösen Geist besessen war. Sie hatte sich bis dahin nicht hervorgetan, aber jetzt, als sie das große Wandgerät zu scheuern hatte, Kessel und Tiegel herunterzunehmen, warf sie diese herab auf den Boden, sehr graulich, und rief mit lauter Stimme: ›Ich will hinaus!‹ Als man den Grund merkte, nahm ihre Mutter die Magd zu sich, und sie wurde etliche Male in die Kirche zu St. Nikolaus in einem rigaischen Schlitten geführt. Wenn die Predigt geendigt war, wurde der Geist beschworen, und ergab sich aus seinem Bekenntnis, daß ihre Mutter einen frischen sauren Käse gekauft und in den Schrank eingesetzt hatte, die Magd war in Abwesenheit ihrer Mutter an den Schrank gekommen und hatte den Käse gegessen. Als nun die Mutter gesehen, daß jemand bei dem Käse gewesen war, hatte sie dem den bösen Geist in den Leib geflucht; seitdem hatte er in der Magd hausgehalten. Als er darauf gefragt wurde, wie er denn bei und in der Magd hätte bleiben können, da sie in der Zeit zum Sakrament gegangen war, gab er die Antwort: ›Es liegt wohl ein Schelm unter der Brücke und läßt einen frommen Mann über sich hingehen‹, er hätte mittlerweile ihr unter der Zunge gesessen. Er wurde aber nicht allein gebannt und beschworen, sondern es ward auch von männiglich, so in der Kirche dabei- und umherstand, auf den Knien fleißig und andächtig gebetet. Mit dem Exorzismo trieb er sein lautes Gespött; denn als der Prediger ihn beschwor, daß er ausfahren sollte, sagte er: Ja, er wollte weichen, er müßte ja wohl das Feld räumen, aber er forderte allerlei, was man ihm mitzunehmen erlauben sollte; wenn ihm das eine Geforderte abgeschlagen würde, so stände ihm das Bleiben frei. Es stand einer unter den Anwesenden, welcher den Hut aufbehielt, als diese beteten, da begehrte er von den Predigern, ihm zu erlauben, daß er dem den Hut vom Kopf nehmen dürfte, den Hut wolle er mit sich nehmen und weichen. Ich trage Sorge, wäre es ihm vor Gott gestattet worden, Haut und Haar hätten mit dem Hut gehen müssen. – Zuletzt, als er wußte, daß seine Zeit die Magd zu plagen verflossen war, und vermerkte, daß unser Herrgott das gläubige Gebet der gegenwärtigen Leute gnädiglich erhörte, forderte er gar spöttisch eine Tafel Glas aus dem Fenster über der Turmuhr, und als ihm eine Raute aus demselben erlaubt wurde, hat sich dieselbe zusehends mit einem Klange abgelöst und ist davongeflogen. Nach der Zeit hat man nichts Böses bei der Magd vermerkt. Sie hat auf dem Dorfe einen Mann bekommen und von ihm Kinder erhalten.«
Katharina von Medici und der Geisterbeschwörer. Ein altes Buch »Europäische Staatswahrsager« schildert uns (buchstäblich) folgenden Vorgang:
»Caput IV. Propheceyungen, das Königreich Franckreich betreffend.
Das Königreich Franckreich ist vor andern reich an Propheten, welche zukünftige Dinge geweissaget haben. Hier sind auch sonderlich berühmet die Propheceyungen des Nostradami, welcher als Franckreichs Prophet seine Weissagungen im Jahre 1555 geschrieben, auch daselbst bei dem Könige Heinrich II. als dessen Leib Medicus und der Chatharina de Medices in vieler Hochachtung gewest; weilen er auf alle ihre Fragen zukünftiger Dinge, eine Antwort gewust. Er soll dem Mönch, welcher mit seinem Messer den König Heinrich den III. Anno 1598 erwürget, wie auch den Scharf-Richter, welcher unter Ludwig dem XIII. den Hertzog von Montmorancy Anno l632 enthauptet, vorher mit Nahmen genannt haben.
Bekandt gnug ist es auch, welcher gestalt Franckreich seine vermeinte Last vor sehr viel tausend neuen, an Languedoc und dem Delphinat gräntzenden begeisterten Propheten, denen so genannten Cevennes und Camisards gehabt, welche gar nicht zum Wohlgefallen des Königs, sondern wider die Päbstliche Clerisey und derselben anhangende Potentaten, deutlich genug geweissaget; wesfalls man sie durch grimmige Execution tilgen, und da ihrer immer mehr geworden, am liebsten mit guten Worten aus dem Lande locken wollen. In der Schweiz und in Engelland fand ein gut Theil derselben seinen Unterhalt, und ihre gewaltsame Entzuckungen, ungemeine Propheceyungen und seltsame Thaten wurden mit Erstaunen gesehen und gehöret, auch darüber allerley raisonnirt, biß diß Neue, alt, und kaum mehr darauf reflectiret ward. Ihre fürnehmste Propheten Marion, Fage, Cavalier, Misson u. s. f. waren sonst keine unebene Männer, deroselben meistes Weissagen aber, gieng auf bessere und güldene Zeiten für die Protestantische Kirche und Policey, und daß auch der König in Franckreich auf gute Gedanken würde kommen.
Ganz besonders aber ist diejenige Anzeige, welche König Heinrich des II. Gemahlin Catharina de Medices, von der zukünftigen Nachfolge der Könige in Frankreich gehabt, wie sie einer nach dem andern den Königlichen Thron besteigen werden.
In einem alten Buche, Memoires de Monsieur Haillon genannt, findet sich diese gar sonderbare Historie.
Heinrich der II. König in Frankreich, hatte die Florentinische Prinzessin Catharinam de Medicis unglücklicher Weise zur Gemahlin, indem sie tausenderley lose Händel stifftete, und eine grosse Liebhaberin von der Zauberei war. Einsmahls trieb sie der Vorwitz an, zu erfahren, was ihr Gemahl und die künftigen Könige in Franckreich, vor ein Schicksal zu gewarten, hätten.
Zu solchem Ende ruhete sie nicht eher, biß sie mit großer Mühe und Kosten, einen berühmten Schwartz-Künstler von Florenz herbey lockete. Ob es der zur selbigen Zeit sehr beruffene Nativität-Steller Lucca Gaurico gewesen, kann ich eigentlich nicht sagen, jedoch ist es zu vermuten. Zum wenigsten war er sehr entrant bei den Lucifer, und correspondirte fleißig mit den vornehmsten bösen Geistern der Hölle. Als sich nun derselbe einstellete, und das Verlangen der Königin gehöret hatte, sagte er zu ihr: Daß er zwar dieses alles bewerkstelligen könnte, jedoch müsse er gantz allein mit ihr in einem Zimmer seyn, darinnen sie solche entsetzliche Dinge zu sehen bekommen würde, daß sie, wie er gewiß glaubete, nicht standhaft genug wäre, solches ohne tödtlichen Schrecken anzuschauen, da sie doch in der größten Gefahr des Lebens seyn würde, wenn sie einiges Wort redete, oder einen lauten Ton von sich hören ließ: Ja; wenn sie alsdenn aus Furcht davon lauffen wollte, so würde sie von den grimmigen Geistern in Stücken zerrissen werden.
Alle diese Vorstellungen waren nicht fähig, die Königin abzuschrecken. Sie war sehr verwegen, und ihr Vorwitz überwog die Furcht, welche dem weiblichen Geschlechte insgemein pfleget angebohren zu seyn. Sie sagte demnach zu dem Herrn Teufels-Banner, sie wolte ihre Person rechtschaffen spielen, er solte nur auch das seinige redlich thun, und zwar, sobald als möglich, weil ihr die Neugierigkeit, keine längere Ruhe verstattete. Er war streng hierzu willig, indem er zu seiner Kunst, keine große Zubereitung nöthig hatte.
Die Comödie solte auf dem grossen Saal im Louvre, praesentiret werden, und zwar in der Nacht: Denn diese gehöret zu den Wercken der Finsterniß. Die Königin vertraute sich Niemand als ihrem Hofmeister und einer alten Cammer-Frau, welche sie biß in ein an den großen Saal stoßendes Zimmer mit sich nahm, allwo diese beide blieben und hernach von demjenigen, was in dem Saal vorging, nicht das geringeste höreten, ob sie schon so nahe dabei waren.
Als die Königin mit ihrem Negromanten in den Saal eingetreten war, und er die Thür hinter sich zugeschlossen hatte, ermahnete er sie nochmahls sich wohl zu prüfen, und lieber ihre Curiosité zu verleugnen, als sich in Gefahr zu stürtzen, wofern sie nicht Muthes genug hätte. Sie blieb aber bei ihrer einmahl gefaßten Resolution, und befahl ihm, seine Künste ohne ferneren Verzug sehen zu lassen. Solchem nach machte er mitten im Saal einen Cräys (Kreis) um sich herum, und fieng seine Beschwörungen mit unbekannten barbarischen Worten an, worauf ein grausames Gepolter entstand und ein Königlicher Thron erblicket wurde. Sodann erschiene ihr Gemahl, König Heinrich der II. setzte sich auf den Thron, und fiel nicht lange hernach von demselben plötzlich auf die Erde.
Ich habe vergessen zu sagen, was massen der Negromante die Königin verständiget, daß diejenigen Könige, welche herunter gehen, und verschwinden würden, eines natürlichen Todes sterben solten, diejenigen aber, welche herunter fielen und verschwänden, würden gewaltsamer Weise sterben.
Nun ist bekannt, daß Heinrich der II. an einer Wunde im Haupte starb, welche er von dem Grafen Montgommeri im Thurier empfing. Ferner hatte der Negromante die Königin benachrichtiget, daß je länger ein König auf dem Throne bliebe, je länger würde er regieren. Nach diesem stieg einer auf den Thron, welcher, wie der Ausgang gelehrt hat, Franciscus II. der mit der Zauberey beschäftigten Königin Catharina ältester Sohn war. Er blieb aber nicht lange darauf sitzen, sondern begab sich bald wieder herunter und verschwand; wie denn auch dieser König nicht lange regieret hat. Bald nachher setzte sich Carl der IX. hinauf, welcher weit länger sitzen blieb, bis er auch herunterging und sich unsichtbar machte. Sodann bekleidete Heinrich der III. den Thron, und fiel endlich mit großem Tumult herunter. Dieses hat eingetroffen, indem er von einem Mönch, Jacob Clement genannt, mörderischer Weise erstochen worden. Anjetzo hatte die vorwitzige Königin gesehen, wie es nebst ihrem Gemahl denen anderen Königen ergehen würde, aber, daß sie an ferneren Erscheinungen einen Abscheu hätte haben sollen, so wurde sie immer begieriger, und fragte den Schwartz-Künstler, ob er nicht noch mehr Könige zeigen könnte? Als es nun derselbe bejahete und seine Beschwörungen ferner machete, stieg eine kleine Person auf den Thron hinauf, worüber die Königin voller Zorn und Verwunderung ausrief:
Helas! Voicy le petit Bearnois! Ach, das ist der kleine Bearner. Es bekam ihr aber dieses Geschrey sehr übel, indem die bösen Geister mit heftigem Ungestüm auf sie loß stürmten, und ihr sonder Zweifel Schaden gethan haben würden, woferne sie der Schwartz-Künstler nicht mit Gewalt zurückgetrieben hätte, wie wohl es bei ihr nicht ohne Zittern und Beben abging.
Die Ursache ihres Geschreyes war daher entstanden, weil sie diesem Printzen, welchen sie aus Verachtung jederzeit le petit Bearnois nannte, von gantzem Hertzen feind war. –
Als nun derselbe eine Zeitlang auf den Throne gesessen hatte, und nachmals herunterfiel, worauf er unsichtbar wurde, wollte der Florentinische Schwartz-Künstler in seinem Handwerk nicht ferner fortfahren, sondern sagete: Weil er wohl sehe, daß die Königin sich des Redens und Schreiens nicht enthalten könte, so seye es besser, allhier abzubrechen, damit sie nicht noch in größere Gefahr gerathen möchte, zumal da sie doch nunmehro schon Begebenheiten genug gesehen hätte. Sie wurde aber durch diese Ermahnung noch immer begieriger, und ersuchete ihn fleißig, in seiner Teufels-Arbeit nicht müde zu werden; indem sie sich schon hüten würde, ihre Stimme nicht wieder hören zu lassen, bis die ganze Erscheinung völlig zu Ende wäre. –
Derowegen ließ der Schwartz-Künstler wieder einen König auf den Thron steigen, welcher eine lange Zeit, der nachfolgende aber noch länger sitzen blieb; alle beide aber gingen hin, nehmlich einer nach dem andern in ihrer Ordnung wieder herunter, und verschwanden. Diese waren, wie es die nachfolgenden Zeiten klar gemacht haben, Ludwig der XIII. und Ludwig XIV.
Hierauf fing der Schwartz-Künstler an, die Königin von neuem auf das inständigste zu bitten, es möchte dieselbe nichts weiter von ihm begehren, woferne ihr das Leben lieb wäre: Denn sonsten würden solche Dinge erscheinen, worüber sie nothwendig vor Furcht überlaut schreien und hernach von den Geistern in tausend Stücke zerrissen würde. Man hatte gedenken sollen, der tapferste Held würde über diese Vorstellungen furchtsam geworden sein: Allein dieser Königin Hertz war härter als ein Felß, und sie wollte kurtzum noch mehr sehen, als sie bereits gesehen. Demnach fuhr der Schwartz-Künstler in seinem Teufels-Dienste fort. Es entstand ein gewaltiger Sturm-Wind; die Fenster zitterten; der Saal schiene sich zu bewegen; es erregte sich ein stinkender Dampf, als ob Pech und Schwefel brennete; aber die Königin hielte noch beständig aus. Es ging ihr wie den Soldaten, welche in der ersten Schlacht verzagt seynd, hernach aber des Feuers gewohnt werden.
Sie hatte gleichsam schon unterschiedliche Bataillen mit dem Teufel gehalten. Endlich kamen unterschiedliche Ungeheuer hervor, welche sich in ihrer Gegenwart auf das allergrausamste zerzauseten und herum bissen. Ihre Gestalt war so entsetzlich, daß es keine Zunge aussprechen kan. Löwen, Bären, Tyger-Thiere, Drachen, Schlangen, Ottern, Hyderen und dergleichen Thiere und Ungeziefer, wären allesammt gegen diesen abscheulichen Ungeheuern vor die lieblichste und angenehmste Creaturen zu halten gewesen. Die Königin biß die Zähne zusammen, damit sie nicht schreien möchte, jedoch hatte die Courage auch nunmehr ein Ende, indem sie in Ohnmacht zur Erden niedersanck, da inmittelst die grausamen Ungeheuer wiederum verschwanden.« pp.
Man sieht aus der vorstehenden Schilderung, wie tief Jahrhunderte hindurch der Teufelswahn und der Aberglaube bei Hohen und Niederen eingefressen war, und wie Gaukler und Geisterbeschwörer vor den Mächtigsten ihr Wesen trieben. –
Der Aberglaube und sein Zwillingsbruder, der Wahn, sind allerdings auf Erden noch nicht ausgestorben, und selbst in unserem an der Spitze der Zivilisation marschierenden Vaterlande sind bis auf die jüngste Zeit hier und da noch vereinzelte Erscheinungen zutage getreten; allein das Zwillingspaar – Aberglaube und Wahn – ist nicht mehr das finster drohende, Schauder erregende Ungeheuer, wie ehedem; es äußert sich vielmehr, wie wir gesehen haben, in milderer Form, und die Hexen, Unholde, Zauberer und Teufel sind dahin gekommen, wohin sie gehören, in das Gebiet der Sage.
Noch glaubt man beispielsweise hier und da, z. B. in den beiden Provinzen Preußen, an den sogenannten » Liebeszwang«. Will man sich beispielsweise die Gegenliebe eines geliebten Wesens verschaffen, so muß man ihm heimlich in Speisen oder Getränke einen Tropfen des eigenen Blutes beibringen. Läßt man einen Apfel oder eine Semmel, welche man in den Kleidern bei sich trägt, vom Schweiße des Körpers befeuchtet werden und bietet die Frucht oder das Gebäck dem Begehrten des anderen Geschlechts an, so bindet man diesen an sich, wenn er den Apfel oder die Semmel verzehrt.
Wünscht ein Mädchen einen jungen Mann an sich zu fesseln, so muß sie, trifft sie ihn einmal die Hände waschend an, ihm ihre Schürze zum Abtrocknen geben. Benutzt er das Dargereichte, so kann er sie nimmer lassen.
Zu gleichem Ziele gelangt sie angeblich, wenn sie ein seidenes Halstuch einschwitzt, es darauf zu Zunder verbrennt und ihm davon in Speisen und Getränken zu genießen gibt. Kann man vom Kopfe des Mädchens, das man sich wünscht, drei Haare bekommen, so klemme man diese in eine Baumspalte, so daß sie mit dem Baume verwachsen müssen, und – das Mädchen vermag dagegen eine Mannsperson sehr leicht an sich zu fesseln, wenn sie ihm in die Stiefel p … t.
Wenn man – glaubt man im Samlande – da, wo es Niemand hören kann, dreimal den Namen der geliebten Person ruft, so zwingt man sie dadurch, an den Rufenden zu denken.
Am Johannisabend streut man in der Gegend von Angerburg Samen in die Erde und spricht dabei:
Ich streu' meinen Samen
In Abrahams Namen,
Diese Nacht mein Feinslieb
Im Schlaf zu erwarten,
Wie er geht und steht,
Wie er auf der Gasse geht!
Oder man streut Leinsamen ins Bett und spricht:
Ich säe Leinensamen
In Gottes Jesu Namen,
In Abrahams Garten
Will ich mein Feinslieb erwarten!
Beide Formeln sollen bewirken, daß der Bräutigam im Traume erscheint.
Der Aberglaube, der in der Johannisnacht üppige Blüten treibt, hat im Jahre 1891 leider ein Menschenleben gefordert. Die beim Rentier Sch. in Rummelsburg bedienstete 18jährige Auguste Zadewack, die Tochter eines in einem Dorfe bei Fürstenwalde wohnenden Tagelöhners, hatte, einem alten Brauche in der Mark folgend, sich heimlich in der Johannisnacht nach dem Garten begeben, um dort von 12 verschiedenen Pflanzen Blätter zu sammeln, die dann unter das Kopfkissen gelegt, der Schlafenden im Traum das Bild des Zukünftigen zeigen sollten. So war die Abergläubische bis an einen Kreuzpfad des Gartens gekommen, als ihr plötzlich eine weiße Gestalt entgegentrat, bei deren Anblick die Z. so erschrack, daß sie lautlos, ohnmächtig zu Boden stürzte, während das Gespenst spurlos verschwand. Wie sich später herausstellte, war der Spuk ein gleichfalls in diesem Hause dienendes Mädchen gewesen, das ebenso wie die Z. den Zauber der Johannisnacht hatte probieren wollen. Leider hatte sie die Z. nicht bemerkt und war wieder nach Hause zurückgekehrt, ohne die am Boden Liegende zu sehen und ihr Hilfe leisten zu können. Erst zwei Stunden darauf, gegen zwei Uhr, fand ein anderer Hausbewohner die vom Gehirnschlage Betroffene, welche ein Opfer des Aberglaubens in der Johannisnacht geworden ist. –
Am Andreasabend streut man eine Handvoll Hafer und Leinsaat unter sein Kopfkissen und spricht dazu:
Hafer und Lein, ich säe dich,
Heil'ger Andreas, ich flehe dich:
Laß mir im Traum erschein'n
Heute den Liebsten mein,
Wie er geht, wie er steht,
Was er im Herzen trägt!
Man stößt auch wohl dreimal an das untere Ende des Bettes mit den Füßen und spricht:
Bettlad', ich trete dich,
Heil'ger Andreas, ich bitte dich
Laß mir im Traum erschein'n
Heute den Liebsten mein.
Im Samlande brauchen die Mädchen auch folgende Formel:
Heil'ger Andreas, ich bet' dich an,
Du brauchst eine Frau und ich ein'n Mann;
Laß du mir im Schlaf erschein'n,
Wer mein Geliebter soll sein!
Der
Silvesterabend
»Sie läuten schon zur
Christnacht!« meldete der Dorfbote, der, mit Weihnachtspaketen beladen, vom Postamte in Kupferberg in Schl. kam.
»So trage geschwind diese Salzschnitte der Liese, Nelke und der Roten in den Stall, auf daß sie gedeihen im künftigen Jahre!« befahl hastig die Müllerin der Kuhmagd. Die Magd eilte hinaus und die Herrin begab sich schnellen Schritts in den Obstgarten und band die Bäume mit Strohseilen, während die Glocken von der erleuchteten Kirche feierlich herüberklangen. So glaubte die gute Frau auch eine reiche Obsternte für den nächsten Sommer gesichert.
Die Tochter der Müllerin aber, die auch den Friedensruf der Weihnachtsglocken vernommen, zog, als sie sich allein sah, einen
ganz roten Apfel aus der Tasche, schnitt ihn mittendurch und trug geschwind die eine Hälfte in ihr Schlafkämmerchen, um sie dort unter dem Kopfkissen zu verbergen. Eine alte mütterliche Freundin hätte ihr ja gesagt: was Johanna dann träume, werde wahr. Die andere Hälfte des Apfels verzehrte sie an der Tür, vor der die Kirchgänger vorüber mußten, und ein gütiges Geschick fügte es, daß ein Jüngling gerade vorüberging, nach dem sie schon längst mit stillem, uneingestandenem Wunsche schaute. Wie aber, wenn ein anderer, ein Häßlicher gekommen wäre? – –
Denn wer von den ledigen Männern just zuerst vorübergeht, während diese Apfelhälfte verspeist wird, der ist der Esserin zum Manne ausersehn. soll vorzugsweise zur Entscheidung der Frage geeignet erscheinen, ob man im Laufe des neuen Jahres heiraten werde, und zur Ermittelung des künftigen Bräutigams.
Ob sie im kommenden Jahre überhaupt heiraten werde, kann – nach Meinung der Samländer – ein Mädchen sehr leicht erfahren. Es gehe nur um Mitternacht in den Schafstall und greife, natürlich im Finstern, ein Schaf. Ist dies ein Mutterschaf, so wird aus der Heirat nichts, ergreift sie jedoch einen Hammel oder gar einen Bock, so kommt die Heirat zustande, und was der Mittel mehr sind.
Aus welcher Gegend der Bräutigam kommen wird, läßt sich ermitteln, wenn das Mädchen in der Mitternacht in Begleitung eines Hundes an einen Zaun geht, diesen schüttelt und dabei spricht: »Tunke, öck schedder di!« Der Hund fängt an zu bellen und nach welcher Gegend er dabei sieht, aus der kommt der Bräutigam. Oder sie schlägt mit einem Waschholz an den Zaun und merkt auf, aus welcher Gegend zuerst Hundegebell ertönt. Wer der Bräutigam sein wird, kann das Mädchen in der Silvesternacht ebenfalls leicht ermitteln, wenn es sich um die Mitternachtsstunde nackt auf den Herd stellt und durch die Luken in den Schornstein oder ins Ofenloch sieht. Dort erblickt es den ihm bestimmten Bräutigam. Geht die Maid um Mitternacht auf einen Kreuzweg, so wird sie dort dem ihr bestimmten Bräutigam begegnen.
Stellt sich das Mädchen mittags ans Fenster und ißt Äpfel, so ist der, welcher zuerst vorbeikommt, der ihr bestimmte Bräutigam. Man schreibt drei Namen auf verschiedene Zettel, steckt sie in einen Strumpf und legt diesen unter das Kopfkissen. In der Nacht greift man in den Strumpf, zieht einen Zettel heraus und erfährt durch ihn den Namen des Zukünftigen. Will man im Samlande erfahren, welcher Gestalt der Geliebte sein wird, so geht man um Mitternacht ohne Licht in den Holzstall und zieht eine Klobe Holz aus dem Holzstoße. Nach der Gestalt der herausgenommenen Klobe richtet sich auch die Gestalt des künftigen Liebsten. Ist sie krumm, so wird er verwachsen sein.
Ebenso wichtig ist der Silvesterabend zur Entscheidung der Frage, ob ein Liebespaar im Laufe des kommenden Jahres Hochzeit machen werde. In eine Schale Wasser träufelt man zwei Tropfen Lichttalg oder Wachs. Einer dieser Tropfen stellt den Bräutigam, der andere die Braut dar. Kommen sie schwimmend zusammen, so gibts im neuen Jahre Hochzeit. Man pflegt auch kurze Wachskerzchen in ausgeleerte halbe Walnußschalen zu setzen. Kommen diese Schiffchen noch während die Lichtlein brennen zusammen, so heiratet das Brautpaar. Eine weitere Art besteht im Samlande darin: Das Mädchen reitet auf einem Besen bis an die Tür des Pferdestalles und horcht. Wiehert ein Pferd, so kommt sie mit ihrem Schatz im neuen Jahre in die Ehe; hört sie dagegen die laute Blähung eines Pferdes, so muß sie im kommenden Jahre Kindtaufe geben, ohne einen Mann zu haben.
Im Samlande hat man auch noch folgende abergläubischen Gebräuche: Die Braut legt beim Zubettgehen ein Gesangbuch unter das Kopfkissen. In der Nacht kneift sie ein Ohr in ein Blatt und sieht am Morgen nach, wo das Zeichen steht. Hat es ein Hochzeitslied getroffen, so gibt es unfehlbar Hochzeit im Laufe des Jahres; traurig soll es dagegen sein, wenn sie ein Todeslied bezeichnet – dann würde sie im Laufe des neuen Jahres sterben.
Man geht unter das Fenster einer Stube, in welcher man sich laut unterhält und fragt: »Werde ich heiraten?« Erfolgt auf diese Frage zufällig ein »Ja!« als Antwort, so ist die Heirat sicher; hört man dagegen ein »Nein!« so wird nichts aus derselben.
Auch das in der Silvesternacht gegossene Zinn kann der Aussicht auf die Verheiratung sichere Bestätigung geben, wenn der Guß die Form eines Kranzes gewann; gestaltet er sich jedoch zu einem sargähnlichen Gebilde, so stirbt man.
Geht man in der Mitternachtsstunde dreimal rückwärts ums Haus und sieht nach beendetem Gange aufs Dach, so wird man im Laufe des neuen Jahres heiraten, wenn man einen Kranz erblickt. Gewahrt man dagegen einen Sarg, so stirbt man – einen Storch, so gibts Kindtaufe – einen Hahn, so brennt das Haus ab. –
Im XIII. Jahrgange (1886/87) der illustrierten Berliner Wochenschrift »Der Bär« veröffentlichte der Prediger E. Handtmann in Seedorf » Aberglaubensüberbleibsel«, die er in der Mark Brandenburg, insbesondere in den Landstrichen Neumark, Sternberg, Teltow, Zauche, Berlin und in der Priegnitz gesammelt und die der emsige Forscher bei Männern und Frauen aller Stände und Bildungsgrade fand. Er teilte seine Blütenlese ein in medizinischen Aberglauben, Gottesurteil über Hausdiebe, Aberglauben gelegentlich religiöser Feiern, religionsgefärbte Sprüche und Formeln.
1. Gegen entzündete Augen, Geschwüre, Fieber ist das Besprechen gut, wenn zugleich mit einem Steine, welcher von dem Hexenmeister immer an einem kühlen Orte aufbewahrt wird, über die leidende Stelle gestrichen wird. Der Besprecher muß aber älter und kräftiger sein als der Leidende. Ganz besondere Kraft wohnt Frauen bei, welche über 46 Jahre alt sind. Auch kahlköpfige Männer mit Fistelstimme sind gut; Männer mit Baßstimmen taugen nichts. Der Besprecher muß forsch und dreist auftreten, das Besprechen leise erfolgen und im übrigen helltönend geredet werden. Ein Hexenmeister vererbt seine geheime Weisheit auf den anderen. Auf die Zeremonien kommt es gar nicht an. Man sagt am besten: »In Gottes Namen, hilft es nicht, so schadet es nichts.« Die Hauptsache ist, recht viel vor sich hermurmeln, jubmisch wasche, wischi, waschi und den stylum curiae innehalten, d. i. recht viele Kreuze und Striche vor dem Gesichte des Kranken und über die leidende Stelle machen. Dabei bedeutet: 1. Senkrechter Strich = Gott den Vater, 2. Kreuz = Gott den Sohn; hierbei sind die Knie zu beugen und der Oberkörper vornüber zu wippen. 3. Waagerechter Strich = Gott den Heiligen Geist, hierbei Hände ausbreiten wie schlagende Flügel. Zuletzt muß der Besprecher, ohne daß es der Kranke merkt, seitwärts hinter dem ausgetriebenen Krankheitsgeist ausspucken.
2. Gliederreißen wird dadurch gestillt, daß man zur Mitternachtsstunde und zur Mittagszeit drei Tage zu einem Holunder, den man sich in jungen Jahren als kleinen Strauch vom Pastor oder vom Küster hat schenken lassen oder auch selbst vom Kirchhof an der Kirchenwand »geholt« (gestohlen!) hat, hingeht und den Stamm dreimal umspannend entlang streicht mit den leise gemurmelten Worten: » Fieken, fieken, menne huc, aber, Vater Abraham« (= Fuge, fuge, mane huic arbori: Abrakadabra).
3. Epilepsie, Krämpfe, einseitiger Kopfschmerz. Man schleicht sich während des Mittagsschlagens, ohne daß der Küster etwas merkt, in die Kirche, rennt um den Altar und macht, als wäre es beim Abendmahl, zu beiden Seiten eine Verbeugung, legt auf die Kelchseite etwas, was man sonst immer bei sich trägt, etwa ein Taschenmesser, Taschentuch, Halskette, hinter den Altar in ein Versteck und ist am nächsten Sonntag eilig dabei, der erste in der Kirche zu sein und sein Liegengelassenes herauszuholen. Solange man solches dann zu eigen besitzt, ist man vor der Wiederkehr des Übels sicher.
4. Universalmittel gegen alle Krankheiten hat man, wenn es gelingt, von der inneren Vergoldung des Abendmahlskelches oder von dem am Kelche haftenden Grünspan etwas abzuschaben und das Geschabte, auf frische Leinwand gestrichen, aufzulegen. Ebenso heilsam ist das Tuch, mit dem man beim Krankenabendmahl dem Küster den Kelch auswischt. In schweren Fällen legt man das dem Kranken auf die Herzgrube oder wickelt es um den großen Zeh. Gewiß; das stillt! Man warte es nur ab!
5. Entzündung der Brust wird durch Auflegen von Wachs der Altarkerzenreste geheilt. Besonders heilkräftig in ganz schlimmen Fällen sind die Altarlichts-Abtropfungen.
6. Krämpfe sind Teufelsbesessenheiten. Wo sie eintreten, ist irgend etwas in der Taufe versehen, und es hilft nur nochmalige Taufe. Dasselbe ist bei »Lattensteigern« (Mondsüchtigen) zu beobachten.
Die Priester wollen freilich hiervon nichts wissen. Da hilft man sich: wenn so ein Kranker einmal vor einem über ein schmales Brett recht kaltes Wasser überschreitet, stößt man ihn unverhofft im Namen des Vaters, Sohnes, Heiligen Geistes hinein.
7. Fieber und Sommersprossen werden dadurch vertrieben, daß man sich mit Taufwasser eines Kindes anderen Geschlechts wäscht oder einen Schluck davon trinkt. Um das zu bekommen, kann eine Witwe den Küster bitten, das wegzugießende Wasser da- oder dorthin zu schütten. Dieselbe hat an solchem Ort zuvor einen Scherben oder eine kleine Kruke versteckt, und was da hineinschlägt von dem ausgegossenen Taufwasser, trägt sie heimlich dem Kranken zu.
8. Wer ein Feuermal im Gesicht hat, kann davon befreit werden, indem er mit der Hand eines totgeborenen Mädchens über dasselbe streicht.
9. Wer sich die Finger verbrennt, fahre schnell mit denselben ans Ohr und kneife sich ins Ohrläppchen, indem er schreit: »Au Jee, Petrus!« Dann gibt es keine Brandblasen.
10. Ein Gerstkorn wird durch dreimaliges Aufdrücken des Traurings geheilt.
11. Wenn es nicht gelingt, Warzen, trockne oder nasse Flechten durch Auflegen von frischem Rindfleisch, welches nachher unter die Dachtraufe vergraben wird, oder dadurch zu heilen, daß man eine Speckschwarte darüberstreicht, welche man darauf in einen Schweinestall an der Schuppstelle des Schweines annagelt und wartet, bis das Schwein dieselbe zerschuppt hat, so gibt es dafür noch zwei ganz sichere Mittel. 1. Eine Salbe aus der Apotheke, welche der »Kohlenprovisor« d. i. der Stoßer oder Hausknecht, heimlich besorgt auf das Rezept »Zug, Druck, Stich, Drachenblut und Rekuzius – auch Ochsenkruzius«. 2. Man esse tüchtig »Drachenblut« allein, d. i. eine wilde Birne, Knödel. Nüchtern täglich drei Tage lang eine Metze; das gibt »schnelle, mach hurtig« und futsch ist einem beinahe die Seele aus dem Leibe – zehn Schritte gegen den Wind, zugleich aber auch alles Elend des alten Adam in diesem Leibe (?).
12. Gegen Warzen allein muß man aufpassen, ob einem einmal zwei Reiter auf einem Pferde zu Gesichte kommen, und dann, solange man noch zwischen denselben durchsehen kann, brüllen:
»Da sitten twee up eenem Perd,
De Hingerscht is min Wratten werth.
Lazarus, armer Lazarus!«
Oder auch: Während des Mittagläutens führt einer eine, resp. eine einen, an das frischaufgeworfene Grab einer Person anderen Geschlechts und streut von der Erde dem Kranken dreimal kreuzweis über die Warzen. Es vergehen keine vierzehn Tage, so sind sie weg.
13. Fieber läßt sich a) in Weidenbäume mit Nadeln einstechen, b) in Birkenzweige einknoten, c) von böhmischen Leuten, namentlich Scherenschleifern – auf Butterbrot verschreiben, welches aufgegessen werden muß, ehe man dreimal mit den Augen geblinkt hat, d) dadurch stillen, daß man – wie sonst bei Nasenbluten – unvermutet den Kirchenschlüssel ins Genick gesteckt bekommt oder einem plötzlich das Mittelglied des kleinen Fingers linker Hand im Namen Gottes usw. kräftig eingeschnürt wird. e) Ganz sicher gegen Fieber ist folgendes Verfahren: An einem Freitag, abends 6 Uhr, geht man bei Regenwetter schweigend von Hause fort zu einem großen fließenden Wasser. Unterwegs streut man dreimal drei Kreuze aus feinem weißen Mehl beim Hingange, hüte sich aber wohl, bei der Rückkehr auf diese Stellen zu treten, sonst haftet das Fieber wieder an. Tritt ein anderer in solche Streustellen, so nimmt er das Fieber an sich. Sonst geht es mit dem abströmenden und ablaufenden Regenwasser unschädlich in die Tiefe.
14. Schwindsucht zu heilen muß man nur für den Leidenden dreizehn Wochen lang täglich frisches Taufwasser besorgen, wovon derselbe täglich nüchtern drei tüchtige Schlucke im Namen pp. trinkt.
15. Ein Sargnagel, welcher beim Aufwerfen eines neuen Grabes ans Tageslicht tritt, vertreibt a) Zahnschmerz, sobald man ihn spitz in den leidenden Zahn stößt; b) Nasenbluten, sobald man den Nagelkopf fest auf den Halswirbelknochen drückt.
16. Schreit ein Kind so toll, das es blüschen (= ersticken) will, so weiß man nicht, womit es behaftet ist. Alsdann muß die Mutter stillen (=beruhigen), indem sie zunächst innerhalb fünf Minuten neunerlei tut, sodann das Kind dreimal schweigend in einen offenen Schrank schiebt und es dann still in die Wiege legt.
17. Gegen »Schluckauf« (Kehlkopfkrampf) hilft sicher: drei Schluck frisches Wasser und bei jedem Schluck kreuzweis unter die Kelle sehen, während man drei zählt.
18. Bruchleiden zu heilen a) im ersten Lebensjahr: man schiebt Freitags vor Ostern und am Ostermorgen das Kind vor Sonnenaufgang rückwärts und vorwärts durch die Sprossen der Stalleiter. b) In späteren Jahren, doch vor dem zwölften: man spalte eine junge Eiche an der Grenze, schiebt das leidende Kind durch den Spalt, verbindet den gespaltenen Baum und wartet, ob der Spalt vernarbt. Damit, daß solch gespaltener Baum sich wieder schließt und weitergedeiht, verwächst auch der Bruch.
19. Schichtzähne muß ein Kind ins Mauseloch werfen mit dem Wunsch:
»Mäuslein, Mäuslein, hast du meinen Zahn,
Gib mir deinen Zahn!«
Das wehrt vor Schmerzen und frühem Verlieren. Ausgezogene Zähne muß man, den Blick zur Erde gesenkt, über die Schulter in fließendes Wasser werfen. Dann heilt nicht bloß die Zahnwunde schnell, dann ist man auch ein ganzes Jahr vor Zahnschmerzen gesichert.
Geschieht irgendwo ein Hausdiebstahl und das »Siebhalten« führt zu keiner Entdeckung, so hilft sicherlich das » Erbbuchlaufen«.
Man nimmt ein recht altes ererbtes Buch, welches etwas von Gottes Wort enthält, am besten Großvaters Gesangbuch. Hat dasselbe vier Heftklammern, um so besser. In deren Ermangelung wird es mit Großmutters Strumpfband fest zugebunden. Nun wird ein großer Truhenschlüssel in das Buch geklemmt, doch muß es ein Erbschlüssel sein. Dann sammelt sich die ganze Hausgenossenschaft. Die beiden Ältesten im Hause halten jeder den rechten Zeigefinger festgestemmt unter den breiten Rand, welcher sich unterhalb des Schlüsselgriffs befindet, und halten so Schlüssel und Buch in der Schwebe. Nunmehr fragt der Hausvater das Buch nach dem Diebe, indem er ganz leise die Namen aller Hausgenossen herzählt. Sobald der richtige Name erschallt, fängt er an zwischen den Fingern der beiden Haltenden zu wackeln, und in demselben Augenblick »verfiehrt«, d. i. entsetzt und entfärbt sich der Dieb: er ist erkannt!
I. Der Weihnachtspfennig. Einem jungen Birnbaum kann man zu besonderer Fruchtbarkeit verhelfen, indem man am Heiligen Weihnachtsabend während des Glockenläutens einen blanken, im selben Jahre geprägten Pfennig mit dem Holzpantoffel unter die Rinde schlägt. Das darf weder weitergesagt noch darf es wiederholt werden.
1. Patenstehen das erstemal muß man je bei einem Kinde andren Geschlechts. Sonst verdirbt man sich das Heiraten.
2. Kinder, am Sonntag oder Donnerstag geboren, dürfen nicht am Sonntag oder Donnerstag getauft werden, sonst gibts Hellseher und Nachtwandler.
3. Wer sich zum Patengehen angekleidet und das Patengeld eingesteckt hat, darf nicht mehr hinters Haus gehen, sonst würde das Kind von schlimmen Übeln heimgesucht.
4. Vater und Mutter sollen nicht bei der Taufe sein. Sie haben die Sorge für den Glauben dem Priester und den Paten zu überlassen. Sie müssen an das irdische Leben des Kindes denken, indem die Mutter zwischeninne, daß die Paten die Hände auf das Kind legen, neunerlei vollbringt, worin das Kind einmal besonders geschickt werden soll. Der Vater muß inzwischen schweigend Obacht geben, daß Türen und Fenster geschlossen bleiben und niemand die in ihren neun Stücken hastende Mutter stört.
5. Eigentlich muß jedes Kind, um den Segen rein und frisch zu haben, neues Taufwasser bekommen: Jedenfalls darf nie ein Mädchen aus dem Taufwasser eines Knaben getauft werden, sonst bekommt es einen Bart.
6. Vor der Taufe darf das Kind nicht mit dem ihm bestimmten Namen gerufen werden. Das hört der Böse, merkt's sich an und hat Übergewalt später über solch ein armes Ding. Man sage »das Kleine!«
7. Bis zur Taufe soll man einem Kinde den Kopf oben nicht waschen, es wird sonst altklug und naseweis. Doch nach der Taufe muß alles gleich herunter und mit ihm Unducht (Untugend) und Gottlosigkeit (Unart).
8. Sofort nach der Taufe muß das Kind in einem Zuge von Arm zu Arm wandern, ehe das Wasser fortgetan ist. Jeder, der es vorher hochnimmt, hebt es zehn Jahre weiter ins Leben.
9. Man schüttle beim Patestehen das Kind ja nicht, sonst vernichtet es später viele Kleider und gerät in ein Leben voller Aufregungen.
Kirchliche Gebräuche.
1. Ein Brautpaar muß innerhalb der Haustür warten, bis der letzte Glockenschlag des Vorläutens verklungen ist. Begönne es vorher den Gang zur Kirche, so würde das Geläut dem, der den Vortritt gehabt, zum Grabgeläut innerhalb Jahresfrist. Beim Gang zur Kirche darf keiner der Brautleute sich umsehen, sonst gibt es eine seufzervolle Ehe. Am wenigsten dürfen sich verwitwete, wieder getraut werden sollende umsehen.
Alle Torwege müssen längs des Weges eines Brautzuges geschlossen sein. Wer seinen aufließe, bewirkte, daß böse Zwischenträger aus seinem Hause den Neuvermählten etwas Störendes in den Lebensweg brächten, das Glück zu verderben. Ist unterwegs, namentlich an Kreuzwegen, geschnürt, so hüte sich die Braut auf die Strippe zu treten. Das würde später immer je ein Kindesleben kosten! Was es für Kinder geben wird, ist leicht bei der Erscheinung zu ersehen: was für ein Kind das beim Schnüren von dem Bräutigam gestreute Geldstück aufhebt, ob Knabe oder Mädchen, dessen Geschlecht gibt's das je erste, zweite, dritte usw. Mal.
Auch gibt es hierfür noch ein anderes Merkzeichen. Es müssen nämlich, wenn beide, Bräutigam und Braut, Geld streuen, die auflesenden Kinder rechts und links schleunigst nach dem Hochzeitshause laufen, sich Kuchen und Wein zu holen. Kommt nun dort das Kind rechts zuerst an, so bedeutet das: Knabe, links aber Mädchen.
2. Um Trauopfergeld muß die Braut den Bräutigam im letzten Augenblick bitten, als habe der Vater es ihr zu geben vergessen. Er wird das in solcher Lage nicht verweigern. Sie aber hat alsdann immer die Hauskasse in ihrer Gewalt. Beim Opfergeld muß auch ein Pfennig der Gottespfennig sein. Den wird der Priester sehr gerührt ansehen. Und diesen muß man ihm nachher abluchsen (= ablocken), indem man ihn z. B. bittet, am Schluß der Tafel Geld zu wechseln. Wer solch einen Gottespfennig unter seinem Gelde hat, gewinnt sicher.
3. Die Braut nehme zwei Körner Dill und Kümmel oder auch Fenchel in den Brautstrumpf und spreche, während ihr Schatz das »Ja« sagt:
»Ick steh up Kümel un up Dill,
Min Mann muß dhun so as ick will.«
Damit hat sie ihn besser unter, als wenn sie ihm beim Jasagen auf den großen Zehen tritt oder beim Ringwechseln und Segenempfangen die Hand obenauf hält.
4. Ein bißchen Opfergeld muß die Braut in der Tasche behalten und während des Trausegens ein bißchen mit dem rechten Bein schütteln, daß es in der Tasche klirrt. Dann geht das Geld in der Wirtschaft nie aus.
5. Fest aneinandergeschlossen muß das Paar vor dem Altar stehen, daß niemand zwischen sehen kann, sonst wird's durch Klatscherei und Zwischenträgerei auseinander gebracht.
6. Während der Trauung in der Kirche (und beim Haustrauen) darf im Hochzeitshause keine Uhr schlagen. Sollte es das Brautpaar versehen und das Schlaggewicht nicht aushängen, so muß solches ein alter Vetter oder auch der Ortsküster besorgen, welch letzterer eigens, um hierauf Obacht zu geben, ganz besonders zum Frühstück im Hochzeitshause einzuladen ist.
Tod und Begräbnis.
1. Wenn es zum Sterben geht, ist es gut, in einem weißblaugestreiften Bettüberzug zu liegen, am besten in einem mit dem alten Färbermuster »Josua und Caleb«. Weiß nämlich bedeutet (und wirkt) Gerechtigkeit der Heiligen (Off. Johannis 19, 8). Blau ist die Himmelsfarbe, die Farbe des Mantels Mariä, der Mutter Gottes, der großen Fürbitterin. Wo man keinen solchen Bettüberzug besitzt, muß man dem Sterbenden wenigstens ein anderes blauweißes Leinentuch, Taschentuch oder Halstuch nahe bringen.
2. Einem Sterbenden muß man alles zu Willen reden und nur immer dazu leise sprechen »so Gott will«. Sonst läßt einem der Verstorbene ein ganzes Jahr lang keine Ruhe.
3. Wer sich vor einem Toten erschreckt, muß sich sofort von einer klugen Frau » streichen, kneten, messen und recken« lassen. Sonst tut es ihm der Tote an; er bekommt Schwellen in den Gliedern und bleibt steif sein Leben lang.
4. Vom Kirchhofe in die Kirche hinein zur Leichenpredigt müssen alle aus dem Trauergefolge möglichst eilen und ihr Opfergeld früher auf den Altar niederlegen, bevor der Totengräber sein Gerät völlig fortgestellt hat und der Küster anfängt zu singen. Sonst kommt der Tote noch mit in die Kirche, um selbst den Trauergesang mit zu singen, erschreckt die Leute die Woche durch und kommt erst am nächstfolgenden Sonntag mit seiner Abkanzlung zur Ruhe.
5. Beim Begräbnisgeläut muß ja aufgepaßt werden, daß nicht der Glockenklöppel zum Schluß auf einer Seite »nachbimmelt«. Sonst stirbt binnen Jahresfrist schon wieder einer aus dem Trauerhause.
6. Bei jedem Begräbnis ist zu ersehen, welchen Geschlechtes der nächstfolgende Tote sein wird. Sobald nämlich der Grabhügel festgeklopft ist, legen die Grabhelfer ihre Geräte querüber. Wird nun zuletzt ein »Gräber« (scharfer Eichenspaten) hingelegt, so holt der Tod zunächst einen Mann, wird zuletzt eine »Schippe« oder eine hohle Holzschaufel beigelegt, so ist der nächstfolgende Tote weiblichen Geschlechts.
Hier schickt der Aufzeichner des »Aberglaubens in der Mark« folgende Vorbemerkung voraus: Eine reiche Literatur ist, betreffend die berühmte » Sator Arepo-Formel«, in der Anthropologischen Zeitschrift der letzten drei Jahre zutage getreten. Ich wiederhole aus derselben hier nur das von mir als persönliches Erlebnis Mitgeteilte, daß ich – im Sommer 1853 oder 1854 – gelegentlich des Umherschweifens toller Hunde von einem »Wissenden« Stücke Butterbrots heimlich übermittelt erhielt als Präservativmittel (für uns selbst und unsre beiden Hunde), welche mittels Grashalms in der Weise beschrieben waren:
Sa–tor–a–re–po
O–pe–ra–ro–tas
Also: zehn Silben auf zehn Brotstückchen. Oben aber waren in die Butter die Zeichen »Auge, Kreuz, Pfeil« gezeichnet, als weihende Dreieinigkeitszeichen.
Ich erhielt in treuherzig guter Absicht solches Präservativ geschenkt und erschreckte den Geber samt der Überbringerin nicht wenig, als ich es lächelnd achtlos dem einen Hunde zuwarf. Es sollte für zehn Fälle dienen und kostete eigentlich zehn mal zehn Silbergroschen!!
1. Fieberspruch, auf einen Zettel geschrieben mit Tinte, welche aus reinstem Wasser und Holzkohle hergestellt ist, mittels einer im Kirchturm gesuchten Eulenfeder und zwischen zwei Butterbrote gepackt, verzehren. Gültig für Erwachsene im Frühjahr.
»Im Namen usw.
Die (resp. der) Alte hat das Kalte.
Behält die (der) Alte das Kalte,
So holt der Kuckuck die Alte.
Kuckuck zum Kuckuck Gott walte.«
2.
Fieberformel
 Sana, Sava, Savita: Sieben Silben innerhalb des Triangels (Dreieinigkeitszeichen) auf Butterbrot geschrieben, welches zerschnitten in sieben Stücken (täglich nüchtern je ein Stück) verzehrt wird. Nach sieben Wochen ist die ersehnte Heilung da! (Andere Fassung: am nächsten Sonntag hilft's!)
Sana, Sava, Savita: Sieben Silben innerhalb des Triangels (Dreieinigkeitszeichen) auf Butterbrot geschrieben, welches zerschnitten in sieben Stücken (täglich nüchtern je ein Stück) verzehrt wird. Nach sieben Wochen ist die ersehnte Heilung da! (Andere Fassung: am nächsten Sonntag hilft's!)
3. Flechten-Bannspruch. Man streicht an einem Weidenbau Sonnabends nach dem Ausläuten dreimal längs und quer, dreht mit Daumen und Zeigefinger ein Stückchen Weidenborke um, zieht ein Stück flechtenbedeckte Haut ab, steckt diese dort mit einer Nadel fest und spricht:
»Im Namen usw.
Wedenbom, ick kloag di an,
Ick kloag di mine Flechte an;
Min Flechte wann (= wandte sich)
Min Flechte schwann (= verschwand).«
Danach drei Kreuze schlagen und zu Hause drei Vaterunser.
Besonders heilkräftig sind die Knackweiden an den Rändern von Priestergärten. Für diese gibt es auch den andern Spruch:
»De Wid un de Flecht,
De jingen beed' to Recht (zu Gericht).«
Über Aberglauben in der Mark, in welcher verhältnismäßig wenig Überbleibsel sich erhalten haben, weiß auch Hans Sundelin zu berichten. Man sagt: »Wenn jemand ißt, während es zum Begräbnis läutet, bekommt er Zahnschmerzen.« – »Wenn Eeender jeschtorrewen (gestorben) is un där Düscher (Tischler) sal in Sarrek maken, so rädert et (redet es) däen Ovend vörho int Handwerriktstüeck« (den Abend vorher im Handwerkszeug). (In der Gegend von Treuenbritzen.) – Sagt jemand, was sich reimt, so erhält er an demselben Tage noch einen Brief. – Wenn man sich verkleidet und eine häßliche Larve vors Gesicht nimmt, dann »kommt es« (Geister = der Teufel) und nimmt einen mit. – Das Trinken von Backwasser (Wasser, mit welchem man den Teig bestreicht, bevor er in den Ofen geschoben wird) schützt vor Zahnweh. – Wer über den Kehricht geht, hat kein Glück. – Wer Tabak raucht, läuft die Stiefel nicht schief. – Wenn man eine junge Katze zum Geschenk erhält, muß man einen Sechser dafür geben, sonst maust sie nicht. – Das erste Veilchen muß man essen, dann friert einen nicht so sehr. – Will man sehen, ob das Korn teuer wird, muß man, wenn das erste gedroschen und noch nicht gereinigt ist, drei Tassenköpfe voll Kornähren dazwischen tun und jeden Tassenkopf voll auf den Hof schütten und wieder mittun. Ist es dann mehr, so wird das Korn billig, ist es weniger, aber teuer. – Ob es nach Weihnachten teurer wird, ist zu erkennen, wie der Wind am Michaelistage weht: geht er vormittags heftiger als nachmittags, wird das Korn billig und umgekehrt. – Wenn's bei der Trauung der Braut in den Kranz regnet, bedeutet das Tränen, und sie muß viel weinen. In Locto bei Niemegk heißt es: dann wird die Braut reich; schneit es ihr aber in den Kranz, arm. – Läßt sich ein Paar bei abnehmendem Monde oder im Zeichen des Krebses trauen, geht alles rückwärts; am Freitag bleibt es nicht lange zusammen, weil es Gerichtstag ist; ebenso, wenn einer Braut das Kleid bei der Trauung zerreißt. – Sticht sich der Verfertiger des Brautkleides mit der Nadel in den Finger, so bekommt die junge Frau von ihrem Manne recht viel Küsse. – Die Irrlichter werden »Lichtermander« (Lichtermänner) genannt, und wenn man sie sieht, muß man nicht beten, sonst kommen immer mehr; flucht man dagegen, verschwinden sie alle plötzlich. In Locto heißt es umgekehrt: Lichtermander sind Kinder, welche den Segen Gottes nicht erhalten haben und die sofort verschwinden, sobald sie diesen empfangen. In der Plaue-Niederung gibt es viele Irrlichter, und man erzählt dort: Einmal kam ein Bauer mit einer Fuhre Heu durch eine sumpfige Gegend. Als er noch im Trocknen war, erschien ihm ein Lichtermann, und der Bauer sprach zu ihm: »Wenn du mir einmal leuchten willst, so leuchte mir durch den Sumpf.« Der Lichtermann tat es wirklich; als sie glücklich hindurch waren, sprach der Bauer: »Gott segne dich!«, und der Lichtermann war verschwunden.
In einem zwei Meilen von Berlin entfernten Dorfe bat Sundelin einmal eine besorgte Mutter für ihren zum Militärdienst einberufenen Sohn folgenden » Schutzbrief« abzuschreiben. »Im Namen des Vaters usw. Amen L. J. F. K. G. B. K. N. K. Die Buchstaben bei der Gnade. Im Namen Gottes usw. So wie Christus im Ölgarten stillstand, so soll alles Geschütz stillstehen. Wer diesen Brief bei sich trägt, den wird nicht treffen des Feindes Geschütz und wird vor Dieben und Mördern gesichert sein. Er darf sich nicht fürchten vor Degen, Gewehren und Pistolen, denn so wie man es anschlägt, so müssen durch den Tod und Befehl Jesu Christi alle Geschütze stillstehen, ob sichtbar oder unsichtbar, alles durch den Befehl des Engels Michael im Namen Gottes des Vaters usw. Gott sei mit dir: Wer diesen Segen gegen die Feinde bei sich trägt, der wird vor Gefahr geschützt bleiben. Wer dieses nicht glauben will, der schreibe es ab, hänge es einem Hund um den Hals und schieße auf ihn, so wird er sehen, daß der Hund nicht getroffen und daß es wahr ist; auch wird derjenige, der daran glaubt, nicht von den Feinden genommen werden. So wahr es ist, daß Jesus Christus auf Erden gewandelt hat und gen Himmel gefahren ist, so wahr ist es, daß jeder, der an diesen Brief glaubt, vor allen Gewehren und Waffen im Namen des lebendigen Gottes des Vaters usw. unbeschädigt bleiben soll. Ich bitte im Namen unseres Herrn Jesu Christi Blut, daß mich keine Kugel treffen möge, sie sei von Gold, Silber und Blei. Gott im Himmel halte mich von allem frei, im Namen usw. Dieser Brief ist vom Himmel gesandt und in Holstein gefunden worden im Jahre 1724 und schwebte über der Taufe Magdalena. Wie man aber angreifen wollte, wich er zurück, bis sich im Jahre 1791 jemand mit dem Gedanken näherte, ihn abzuschreiben.« – Einen ähnlichen Schutzbrief teilt Strackerjahn in seinem Buche »Aberglauben und Sagen aus dem Herzogtum Oldenburg« mit.
Über Aberglauben in Sachsen veröffentlichte noch im Mai 189l ein Chemnitzer »F. G.« folgendes: In den Häusern (in Chemnitz) werden gedruckte Schriften vertrieben, über deren abergläubischen Inhalt mir die Worte fehlen. Ich erstand von einem Austräger 1. Traum der heiligen Jungfrau, 2. Mittel für jedermann in landwirtschaftlichen und häuslichen Verhältnissen, 3. (Auf rotem Papier gedruckt!) Moses letzter Brief durch Gott und seinen heiligen Sohn, welchen an goldenen Ketten ein Engel der heiligen Dreieinigkeit in Galiläa bis zum Jüngsten Gericht aufbewahrt und großes Aufsehen erregt durch seine Wunder.
Ich gebe zunächst aus der an zweiter Stelle genannten Schrift eine kleine Blumenlese.
Vor die Schwinden.
Altes Schmeer und Branntwein, drei Krebsaugen zu Pulver gestoßen, vier Knoblauchherzen; ein Käsenäppchen voll Wachholderbeeren, dieses alles zusammengestoßen und damit geschmiert.
Vor die Rose.
Rose Marie und Christi Blut ist vor die Rose gut! † † † w Oder: (sit), (set), (hoet) auf die Rose geschrieben.
Oder: die Rose gebeut Gott zu deiner Buße: du sollst nicht hitzen, du sollst nicht schwitzen, du sollst nicht gären, du sollst nicht schwären, du sollst nicht wüten, du sollst nicht töten, das zähl' ich dir N. N. zugut. † † †
Vor die Hitze in den Augen und anderen Wunden.
Jesus Christus ging übers Land und hatte einen Brand in seiner Hand; Brand, brenn aus und nicht ein, tief ist die Wund', glückselig ist die Stund', da meine hitzigen, schmerzenbrennenden (was nun sei) heilen mag! Gott der Herr heilete fünf Wunden in einer Stunde, meine hitzige, schmerzbrennende – soll die sechste sein. –
Warzen zu vertreiben.
Man sehe, daß man an dem letzten Freitag soviel Speck oder fettes Fleisch als eines Hellers groß kann stehlen, damit schmiere man die Warze und trage solches unter die Dachtraufe zu Mitag in der zwölften Stunde, daß niemand etwas weiß, so vergehen sie in kurzer Zeit.
Vor das Zahnweh.
St. Petrus stand unter einem Eichenbusch, da sprach unser lieber Herr Jesu Christ zu Petro: Warum bist du so traurig? Petrus sprach: warum soll ich nicht traurig sein, die Zähne im Munde wollen mir verfallen! Da sprach unser lieber Herr Jesu Christ zu Petro: Petrus, gehe in den Grund, nimm Wasser in den Mund und spei es wieder in den Grund. † † †
Wie man Maulwürfe fangen kann.
Wenn man Maulwürfe fangen will, lege man vor das Loch eine Knoblauchhaut oder Zwiebel, so werden sie ihre Löcher verlassen und können mit den Händen gefangen werden.
Wenn eine Jungfrau ihre Zeit nicht haben kann.
Man nehme ein Stück von einem Manneshemde, brenn' es zu Pulver, das Kraut Tormentill gepülvert und Saft von der Hauswurzel mit weißem Lilienöl zu Pillen gemacht und eingenommen.
Oder zu Tee nimm die Kräuter: Johanniskraut, Wermut, Dillwurzel, Frauenhaarkraut, Dorant, gedörrte Kirschenstiele, Fenchel, Anis und Aloe, jedes für drei Pfennig, täglich etliche Tassen getrunken.
Vor Bezauberung des Viehes.
Hole drei weiße Kieselsteine aus einer Leichenpforte, mache sie heiß, tue sie in ein Gefäß und gieße Milch darauf, für ein Pfennig Schwefel, ein Pfennig schwarzen Kümmel, drei Pfennig Teufelsdreck und Eberwurzel, laß dieses drei Tage stehen in dem Stalle, darnach tue sie wieder in der Stunde dahin, wo du sie geholt hast.
Wenn einer Kuh die Milch genommen ist.
Nimm Milch, Urin und Kot von der Kuh, tue solches in einen neuen Topf, derselbe muß in einer ungeraden Stunde gekauft sein und bezahlt, wie er geboten worden ist, mit einer neuen Stürze, die darauf passend ist und fest verklebt, daß kein Dampf daraus kann und setze solches zum Feuer, lasse sieden und das Feuer nicht abgehen vierundzwanzig Stunden lang, so werden selbige kommen in dein Haus.
Auf der zuletzt genannten Schrift stehen die klugen Worte: »Wer diese Schrift in den Händen hat und heilig aufbewahrt in seiner Wohnung wie im Tempel der heiligen Dreieinigkeit, dem werde ich meine Gnade und Segen zukommen lassen bis aufs letzte Glied seines Stammes.«
Aus dieser Schrift führe ich die folgenden Stellen an:
† Sympathie der Natur. †
1. Wer auf rechtlichen Nahrungswegen geht und trägt diesen Brief oder die vorstehenden drei Verse bei sich, den werde ich mit meinem Segen selbst begleiten und Glück und Segen schenken.
2. Wenn eine schwangere Frau bei ihrer Entbindung diesen Brief auf ihrem Herzen trägt, die wird einer leichten, sowie schnellen Entbindung ohne alle Nachfolgen entgegensehen. Trägt dieselbe den Brief in den sechs Wochen, wird keine Antipathie haften.
3. Wer stets mit Unglück belastet worden, der bete vorstehende drei Verse neun Sonntage lang früh und abends, so wird meine Gnade euch Schutz und Segen spenden. † † †
4. Wenn die Regel bei einem Frauenzimmer nicht eintritt und damit viel Beschwerden hat, die nehme die Kräuter: 1. Johanneskraut, 2. Wermut, 3. Dillwurzel, 4. Frauenkraut, 5. Dorant, 6. Fenchel, 7. Anis, 8. Aloe, jedes für drei Pfennig, und täglich zwei Tassen getrunken, wird sofort das Blut regelrecht erscheinen. Außerdem sind die vorstehenden drei Verse früh und abends zu beten.
5. Sollte ein Kind oder erwachsene Person beschrien worden sein, wodurch das Blut am Herzschlag gehindert, so bete man vorstehende drei Verse, mache bei jedem Gebet die drei † † † an das Herz mit dem Zeigefinger der rechten Hand und spreche nach dem diese Worte:
»Es waren zwei böse Augen, die dich übersahen, drei waren, die dir das Gute widersprachen, sie haben dir genommen deinen Schweiß vom Blut, du sollst wiederbekommen Schweiß, Schlaf und Ruh', daß du wieder nehmest zu. † † †
Im Namen Gottes des Vaters † des Sohnes † und des Heiligen Geistes.« †
6. Wer an Gicht, Reißen, Krämpfen, Magenbeschwerden, Lungen- und Leberleiden, Unterleibskrankheiten, Wasserbeschwerden, Mattigkeit, Schlaflosigkeit, Zittern der Glieder, ängstlichen Blutanfällen, Schwermütigkeit, Fallsucht, Hautausschlag, Schwerhörigkeit u. dgl. m. leidet, der koche ein Ei in seinem vom Körper gelassenen Wasser, schreibe dann seinen ganzen Vor- und Zunamen auf ein Blatt Papier, nehme dann einen feuerroten Faden, wickele das Ei in das Blatt, binde dann den Faden um das Ei, im Namen Gottes des Vaters, des Sohnes und des heiligen Geistes, tue dann das Ei wieder in das Töpfchen, binde dasselbe zu und vergrabe das Töpfchen nach Sonnenuntergang unter einer Birke. Außerdem trinke die Woche zweimal eine Tasse Wegebreit, darunter einen Eßlöffel Lebertran, und sofort wird die Krankheit beseitigt werden. † † †
7. Wer Hausfeinde hat, welche eine Wirtschaft bereden, stets gedenken Schaden zu tun, schlechte Reden gegen Mann, Weib und Kind führen, der schreibe vorstehende drei Verse ab und hänge dieselben an einem feuerroten Faden über die Türe, so werden die Zungen von selbst schweigen, und die Ruhe ist hergestellt.
9. Wer glaubt, daß etwas an dem Viehstande durch antipathische Personen getan worden ist, so auch bei verschiedenen andern Krankheiten des Viehstandes, der schreibe vorstehende drei Verse ab und hänge dieselben dem Tier zwei bis drei Stunden an den Hals, nehme sie dann wieder ab und vergrabe dieselben, ohne etwas anderes zu tun, sofort unter einem jungen Baum, und die Besserung wird eintreten.
9. Wer glaubt, daß etwas an dem Viehstande nicht richtig sei, was teilweise durch Erkältung des Euters und der Milchadern herkommt, der füttere beim warmen Saufen folgendes:
Es wird ein Wassereimer voll Holunder mit ganz kochendem Wasser aufgebrüht und unter das warme Saufen geschüttet, so werden sich durch den Schweiß die Adern und das Euter wieder erwärmen, und die Milch sowie die Butter wird ausgezeichnet sein, und der Nutzen wird sich sofort herausstellen.
Glaubet fest an das Wort Gottes und an seinen heiligen Sohn, so wird euch geholfen! † † †
Im Jahre 1848 kam in Berlin eine Frauensperson zu der Frau eines Vorkosthändlers, welche seit längerer Zeit leidend war. Die Unbekannte gab vor, Mehl und Kuchen kaufen zu wollen; da sie aber von der Krankheit der Frau hörte, nahm sie sich ihrer anscheinend teilnehmend an und suchte ihr Vertrauen zu gewinnen, was ihr um so eher gelang, als sie jene durch Anwendung ihrer Sympathie bald von ihrem Leiden zu befreien versprach. Die Kranke schenkte der Unbekannten vollen Glauben, und so geschah es denn, daß drei Talerstücke, ein goldener Schlangenring und zwei goldene Trauringe in einen Teller unter Mehl zugedeckt, gebracht, mit einem von der Patientin getragenen Hemde unter Hersagung allerlei frommer und zauberischer Sprüche bestrichen und dann, nachdem eine Serviette darüber geknüpft war, das Ganze in ihr Bett gestellt, von der Unbekannten aber ausdrücklich angeordnet wurde, die Serviette unter keinen Umständen eher zu öffnen, als nach vollen vierundzwanzig Stunden, wo sie wiederkommen und die Zeremonie beenden werde. Wie indes wohl zu erwarten stand, ist die Unbekannte nicht wieder erschienen, und man hat bei Öffnung der Serviette wohl das Mehl, nicht aber die darunter verborgen gewesenen drei goldenen Ringe und drei Taler vorgefunden. Auch ist keineswegs eine Abnahme der Krankheit bei der Frau eingetreten. –
Aberglaube aus unseren Tagen. Gottfried Hammer besaß außer einem elenden Häuschen in einem Gebirgsdorfe rein nichts; selbst mit seinen Verstandeskräften war es schlecht bestellt. Jedermann im Dorfe kannte die plumpe, gedrückte, krummbeinige Gestalt mit dem aufgedunsenen, stupiden Gesichte und der grunzenden Stimme. Er tat niemandem etwas zuleide, und doch fürchtete ihn jedermann. Er galt für den Alp der ganzen Ortschaft, und einzelne Leute erzählten, wenn sie nachts an dem Zustande gelitten hätten, den die Ärzte Ephialtes, Incubus nennen, der verdammte Hammer habe auf ihnen gelegen. Die Dorfjugend glaubte die Albernheit auch, und wo sich der Ärmste blicken ließ, warfen die Buben mit Steinen nach ihm, schlugen ihn wohl auch. Erst im Grabe fand der Beklagenswerte Ruhe vor der Verfolgung seiner beschränkten Nächsten. –
In einem kleinen Geestdorfe starb in den siebziger Jahren einem Einwohner eine Kuh. Da sich nun beim Öffnen des Kadavers kein Fehler zeigte, an dem das Tier verendet sein konnte, ward von allen Seiten angenommen, daß es von Hexen getötet sei. Als derselbe Hauswirt bald darauf ein Pferd gekauft hatte, wurde Rat gehalten, auf welche Weise das Tier vor den bösen Hexen bewahrt werden könnte. Nach langer Beratung wurde schließlich bestimmt, das gekaufte Tier rückwärts ins Haus und in den Stall zu ziehen. Dem Braunen mußte diese Gangart doch wohl etwas ungewohnt sein, denn die ganze Familie war gezwungen, sich an den Schwanz des Pferdes zu hängen und aus Leibeskräften zu ziehen; so gelang denn auch schließlich die Prozedur. – In einem anderen Orte machte ein Landmann, dem das Rauhfutter mangelte, und der das Korn lieber im Sacke behielt, die Wahrnehmung, daß sein Vieh nicht allein aufstehen konnte. Ein Nachbar erklärte ihm sehr wohlweise: »Dein Vieh ist behext, dagegen gibt es aber ein sicheres Mittel. Du mußt jeden Tag dreimal vor dem Vieh vorüberkriechen und jedem Stück Vieh ein fingerdickes, rund ums Laib geschnittenes Stück Brot ins Maul stecken und dabei jedem Tiere dreimal in die Nase spucken, aber kein Wort dabei sprechen.« Der gute Mann folgte dem Rat und siehe – es half. In seiner Freude erzählt er das Geschehene und nennt auch den Hexenmeister. Letzterer leugnet keinen Augenblick, sagt aber, es ginge auch ohne Kriechen und Spucken, und das Brot wirke noch besser, wenn es zweier Finger Dicke habe. –
Im Jahre 1884 bildeten sich Leute in Schleusenau bei Bromberg ein, von einer Frau behext worden zu sein. –
In Wien herrscht noch heute der Lottoaberglaube. Wie bei allen hervorragenden Ereignissen, welche dort den Gegenstand der lebhaftesten Erörterung bilden, hatte auch eine Bluttat in Mariahilf, welcher das Ehepaar Emeder zum Opfer gefallen, bei den Lotterieschwestern die Kombination der auf das blutige Ereignis »Bezug habenden« Zahlen angeregt. Insbesondere waren es die Nummern 11 (Wohnungsnummer der Ermordeten in der Sandwirtgasse), 62 (Mord), 90 (Angst), 50 (Tod), 47 (Leben und Tod); ferner die Nummern 49 und 54 (Alter der Julie und des Rudolf Emeder), welche stark besetzt wurden. –
Im Sommer 1891 wurde ein Arzt aus Lissa auf ein benachbartes Dorf geholt, wo ein Landmann mit seinem Sohne schwer krank darniederlagen. Dem Vater war leider nicht mehr zu helfen; er starb. Der Grund zu der Erkrankung der beiden sollte folgender sein: Dem Bauern war eine Kuh erkrankt, und er wandte sich an einen Schäfer, der im Rufe eines »klugen Mannes« steht, damit dieser die Kuh heilen sollte. Der kluge Mann ließ sich für seinen zu erteilenden Rat zunächst zehn Mark zahlen; dann meinte er, die Kuh sei behext. Um das Verhexen zu heben, sollten die männlichen Mitglieder der Familie um die Mitternachtszeit sich mit entblößtem Körper auf einen Ameisenhaufen setzen. Der Bauer und sein erwachsener Sohn waren auch abergläubisch genug, diesen Unsinn zu glauben, und begaben sich nach dem eine halbe Meile von ihrem Dorfe entfernten Walde, wo sie um zwölf Uhr nachts sich nach Vorschrift des klugen Mannes auf einen Ameisenhaufen setzten. Während sie so dasaßen, raschelte es neben ihnen, wahrscheinlich hatten sie irgendein Tier aus dem Schlafe geweckt; beide erschraken heftig und meinten, es sei der Böse aus der Kuh, der sie necke. In unbeschreiblicher Hast liefen sie, ohne erst die Kleider in Ordnung gebracht zu haben, atemlos nach Hause, wo sie beide infolge der ausgestandenen Angst und Erkältung so schwer erkrankten, daß den Vater der Tod ereilte. Der zu Bett liegende Sohn erzählte dem Arzt, daß die Ameisen ihn ganz gewaltig gebissen hätten. –
In Uschütz bei Rosenberg in Oberschlesien ließ sich im Juni 1891 ein junger Mann, der sich verhoben hatte, von »klugen Frauen« in eine Krauttonne stecken, mit heißem Wasser von »neunerlei Kräutern« begießen; zum Überfluß gab man ihm noch drei heiße Steine mit ins Faß und schloß dieses mit wollenen Decken. Der Kranke verließ indes das Faß nicht mehr lebend. Die gerichtliche Untersuchung gegen die heilkundigen Weiber wurde eingeleitet. –
Welcher Aberglaube noch im Volke herrscht, davon gibt folgender Brief eine Probe, der im Juni 1891 von einem in einer böhmischen Stadt lebenden deutschen Handwerker an die Leipziger Stadtbibliothek gerichtet worden ist und der nach dem »Leipziger Tageblatt« folgendermaßen lautet:
an Wohl Löbligen bücher Biblodek
Ersuch sie mir geföllichts mid zu Theilen, ob mann in ihren werthen lager von Büchern auch zauber Bücher für Magischer kunst haben kan dieses Buch miste aber so Sein das man Endwentten gehenstände die gestohlen Sein dur das zwancks Cittiren wieder haben kan. Das der betreffenter dieb zurickistellen mus und wo auch dieb segen und Sonst andere Sachen darinnen Enthalden Sind
wen ich ein Soliches Buch haben kände Bitte sie mir den Breis an zeugen zu wollen
Bitte Umgehente andwort. –
Am 10. Juni 1891 meldeten Berliner Zeitungen: » Es spukt wieder! Dr. Egbert Müller hat ein neues Medium à la Wolter entdeckt, und zwar in einer sechzehnjährigen Kleinmagd im Kirchdorf Storbeck bei Neu-Ruppin. Die sogenannten Spukvorgänge bestehen in Werfen mit Holz, Hinstreuen von Holzstücken in der Küche, mehrmaliges Ausheben der Flügel eines Fensters, die sich alsdann auf oder unter dem Dunghaufen wiederfinden, Beschmutzen von hängenden Kleidungsstücken durch Anspritzen mit Wasser und Dung, Hineinstopfen eines Kleides in das Butterfaß und dergleichen mehr neckischer Dinge. Dr. Egbert Müller ist so naiv, zu verlangen, daß die Erscheinungen von Staats wegen auf Staatskosten untersucht werden. Wir unterstützen dieses Gesuch mit dem Hinzufügen, daß die Untersuchung in Dalldorf (dem Irrenhause) unternommen werde.« –
Im April 1891 wurde in B. bei Gräfinau einem Bauern eine Kuh krank und fraß nicht mehr. Zufällig kam ein Witzvogel, welcher riet, die Kuh, welche verhext sei, sofort zu schlachten und zu verschenken und die Rippen und einige Fleischteile abends nach Sonnenuntergang im Backofen zu verbrennen, sonst könnte sich die Hexerei auch auf das andere Vieh übertragen! Der Bauer glaubte das alberne Geschwätz, ließ die Kuh töten und schenkte das Fleisch und die Haut zwei Männern, welche fünfundsiebzig Mark dafür vereinnahmten. Obendrein wurden die bestimmten Fleischteile und Knochen, in welchen die Hexe stecken mußte, unter zeremoniellen Umständen im Backofen verbrannt. –
Im April 1891 meldete die »Amb. Volkszeitung« allen Ernstes: »Eine grausige Mißgeburt! Am heutigen Tage sind wir in der Lage, folgende wahrhafte (!!) Mitteilung zur Kenntnis der Leser zu bringen. In Plato, einem Dorfe von Mc. Leod Co., Minnesota (Nordamerika), lebt ein junges Ehepaar namens Miller. Der Mann ist ein Schuhmacher und betreibt als solcher ein blühendes Geschäft. Vor nicht gar zu langer Zeit kam ein jüdischer Hausierer nach Plato und wollte u. a. auch der Frau Miller eines seiner Oeldruckbilder, die ›Kreuzigung Christi‹ darstellend, verkaufen. Des weigerte sich die Frau, und als der Hausierer mit jüdischer Zudringlichkeit nicht ablassen wollte, geriet sie in heftigen Zorn und verstieg sich zu der greulichen Lästerung, lieber wollte sie den Teufel im Hause sehen als das Bild eines gekreuzigten Heilandes. Bald darauf ging ihr Wunsch in Erfüllung, denn 3 Wochen, nachdem sie das schreckliche Wort gesprochen, gab sie einem Wesen das Leben, von dem man nicht sagen kann, ob es Mensch, Tier oder Teufel ist. Welch ein Schrecken erfaßte die Mutter, den Vater und die anderen anwesenden Personen, als sie ein mit fast zwei Zoll langen groben Haaren über und über bedecktes, zottiges Wesen mit kleinen funkelnden Augen, einem voll entwickelten Gebisse von scharfen spitzigen Zähnen, krallenartigen Händen (!), hufbesetzten Bocksfüßen (!), einem 18 Zoll langen Schwanze und zwei kurzen scharfen Hörnern auf dem Kopfe (!) sahen, das, affenartig aus dem Bett schlüpfend, sofort auf allen vieren herumkroch, um die Abfälle in Küche und Haus zu suchen und zu fressen. Dieses grausige Wesen ist nun schon fünf Wochen alt, schneidet eine unbeschreiblich boshafte Fratze, entwickelt die schlimmsten Instinkte eines wilden Tieres und schnappt grimmig nach jedem, der es anzurühren oder zu bändigen wagt. Aus seinen funkelnden Augen unter den buschigen Brauen scheint der leibhaftige Teufel hervorzublicken, und als neulich die Wärterin ihm die Treppe hinunter nachlief, um es in das Zimmer zurückzubringen, dem es entschlüpft war, griff es dieselbe so bösartig an, daß sie genötigt war, es zu ihrer Selbstverteidigung mit dem Kruge, den sie eben in der Hand hatte, niederzuschlagen. Die unglücklichen Eltern scheinen der Verzweiflung nahe zu sein. Von nah und fern strömen die Ärzte und von allen Seiten neugierige Menschen jeden Standes und Alters herbei, um dieses schreckliche Wunder zu betrachten. Obwohl man von seiten der Behörden den Versuch gemacht hat, die grausige Nachricht zu unterdrücken, so breitete sie sich doch immer weiter aus. Die Bevölkerung hält fest daran, daß in dieser Mißgeburt ein Gottesgericht zur Bestrafung einer greulichen Lästerung zur Offenbarung gekommen sei.«
Von einem Hexenbanner im Jahre 1891 berichteten die Blätter aus Ulm: Auf der Anklagebank der Strafkammer saß ein » Hexenbanner« aus dem Dorfe Hohenstaufen bei Göppingen; er hieß Luther, war seines Zeichens Maurer und genoß in der Gegend einen namhaften Ruf als Beschwörer von Hexen und Spukgeistern und Bezwinger aller finsteren Mächte. Als es nun Ende vorigen Jahres in dem Hause des Bäckers und Wirts Scheer zu Göppingen greulich spukte, indem nächtlicherweile den Kindern die Litzen von den Kleidern getrennt, der Stiefelzieher hinter den Spiegel gesteckt und andere schreckliche Sachen verübt wurden, hatte der biedere Bäcker nichts Eiligeres zu tun, als den großen Hexenbanner von Hohenstaufen kommen zu lassen. Der machte sich's denn auch mehrere Tage bequem im Scheerschen Hause, aß und trank, was ihm schmeckte, und trieb seinen Hokuspokus mit Beschwören, Räuchern und Verstecken hieroglyphischer Zettel in allen Ritzen und Löchern. Schließlich verlangte und erhielt er für diese »Versicherung« des Hauses auch noch fünfundzwanzig Mark bar. Aber die Sache wurde ruchbar und der Hexenbanner selbst von der Justiz in den Untersuchungsarrest gebannt. Die Verhandlung bot ein trauriges Bild des borniertesten Aberglaubens, und der Staatsanwalt gab seiner Verwunderung unverhohlen Ausdruck, daß so etwas bei uns noch möglich sei. Luther wurde wegen Betrugs zu drei Wochen Gefängnis verurteilt. –
Der bornierte Hexenwahn und Teufelsglaube steht noch überall unter dem unwissenden Volke, besonders aber in Serbien in üppigster Blüte. »Hexen« nennt man in Serbien solche Weiber, die in sich einen »Teufelsgeist« bergen. Während ein solches Weib schläft, verläßt es, dem Volksglauben zufolge, der Teufelsgeist, verwandelt sich in einen Schmetterling, in ein Huhn oder Truthuhn, fliegt in die Häuser und frißt Menschen, besonders kleine Kinder. Sobald die Hexe einen Menschen im Schlafe antrifft, gibt sie ihm einen Hieb mit ihrem Hexenstabe über die linke Milchdrüse; durch diesen Schlag öffnet sich die Brust, und die Hexe reißt das Herz heraus und zehrt es auf, worauf die Brust wieder zuwächst. Die Hexen essen keinen Knoblauch, deshalb reiben sich viele Leute zu bestimmten Zeiten damit ein und besonders in den Faschingstagen, da dann die Hexen am eifrigsten auf die Menschenvertilgung ausgehen. – Bei den Südslawen in Dalmatien, der Herzegowina und Montenegro wird ein seltsames, übrigens schon im Mittelalter hier und da gebrauchtes Mittel angewandt, um festzustellen, wieviel Hexen es im Lande gebe. Alle streitfähigen Männer im Dorfe, welche ein Gewehr tragen können, versammeln sich, und der Dorfvorstand spricht sie an: »Seht ihr, Leute, daß uns die Hexen stark beunruhigen? Gott möge sie dafür strafen! Morgen früh führe ein jeder sein Weib und seine Mutter zum Flusse, ich bringe auch die meinigen, dann werden wir sie in den Fluß tauchen und dabei erkennen, welche die schuldigen Hexen sind, die wir dann steinigen, oder sie müssen uns schwören, daß sie uns nichts Böses antun.« – Den folgenden Tag bringt ein jeder sein Weib mit, auch die Mütter werden herbeigeführt, man bindet jede mit einem Stricke unter der Achsel, damit man sie zurückziehen könne, und wirft eine nach der anderen mit den Kleidern in den Fluß. Diejenige, welche untertaucht, ist von jedem Verdacht gereinigt und wird schnell herausgezogen, die aber längere Zeit an der Oberfläche des Wassers sich hält, wird kurzweg als »Hexe« angesehen. Solche Tollhausblasen treibt am Ende des 19. Jahrhunderts der Wahn- und Aberglaube noch! Und diejenigen, die gegen diesen Wahn- und Aberglauben in allen seinen Gestaltungen kämpfen, werden von gewissen Leuten als Sünder wider die »guten Sitten« hingestellt! –
Wie Wallenstein glaubte Napoleon I. an eine Sternenschrift und suchte sie zu erforschen. Als vor dem Ausbruche des Krieges mit Rußland sein Oheim, der Kardinal Fesch, bei stiller nächtlicher Unteredung ihn warnte und bat, davon abzustehen, trat er mit ihm ans geöffnete Fenster und sprach: »Schau auf und lies! Da am gestirnten Himmel steht mein Schicksal geschrieben, und was da geschrieben steht, wird unabänderlich in Erfüllung gehen!«
Wie aufgeklärt war dagegen der Philosoph auf dem Throne, Friedrich II. von Preußen! Als Voltaire ihm im Jahre 1765 vorschlug, eine kleine Kolonie von französischen Philosophen in Cleve zu gründen, die dort, ohne Furcht vor den Ministern, den Priestern und den Gerichtshöfen, frei die Wahrheit sagen könnten, erwiderte er: »Ich bin gewiß, daß, wenn eine solche Gemeinde gegründet wäre, sie bald einen neuen Aberglauben in die Welt setzen würde.«
Der alte Fürst von *** glaubte nicht an Gott; wenn er aber auf die Jagd ging und drei alten Weibern begegnete, kehrte er um – das war ihm eine schlechte Vorbedeutung! Am Montag unternahm er nichts, weil dieser Tag ihm unheilbringend schien. Wenn man ihn aber nach dem Grunde fragte, konnte er denselben nicht angeben. Und so gibt es viele Menschen, die am Tage ungläubig sind und nachts aus Furcht vor Gespenstern nie allein schlafen. – –
In die Geschichtsbücher der europäischen und auch einiger amerikanischer Nationen sind die Hexenprozesse mit Blut eingetragen. Die Folterwerkzeuge sind wie die Hexenverfolgungen – ebenfalls der Vernunft und Menschlichkeit sei es gedankt – teils verschwunden, teils in die Rumpelkammer geraten; aber sie starren dem Beschauer in unseren Tagen als bluttriefende Zeugen des Menschenwahns und Aberwitzes entgegen:
Der Teufels-, Zauberei-, Hexen- und Spukglauben war eben leider fast unausrottbar im Volke eingewurzelt. » Des Aberglaubens Weihaltar« hat leider auch in unserer Nation Jahrhunderte hindurch unzählige Opfer gefordert. Zunehmende Volksbildung und Aufklärung allein vermögen ihn wirksam zu bekämpfen und allmählich zu bannen. Es sollte daher jeder einzelne den Aberglauben ernstlich bekriegen; allein noch heute ist es eine unanfechtbare Wahrheit, was Lessing sagt: » Der Aberglauben schlimmster ist, den seinen für den erträglichsten zu halten.«