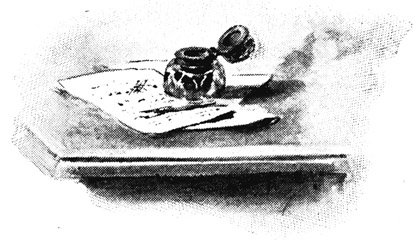|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Ich hatte mich zu später Nachmittagsstunde auf der Promenadenseite des Wiener Kärnthnerringes mit Willy zusammenbestellt, um einen Spaziergang in den Prater zu unternehmen.
Gern wanderte ich mit ihm auf stillen Wegen. Willy hatte die halbe Welt gesehen, kannte Menschen und Völker, hatte viel erfahren, viel erlebt und – es ist nicht nur meiner Vorliebe für alliterierende Redewendungen anzurechnen, wenn ich beifüge: auch viel geliebt. Von all dem wußte er spannend, anschaulich und lebendig zu erzählen; er war gleichsam ein wandelndes Stoffkompendium für einen Novellisten, denn wenn er seine gute Stunde hatte, übersprudelten seine Lippen von Geschichten und Geschichtchen, so daß ich von jedem unserer gemeinsamen Spaziergänge ein farbiges Stück seines bewegten Lebens mit nach Hause trug.
Neapel und London, Petersburg und Paris hatte ich aus seinen klaren, scharfzeichnenden Schilderungen kennen gelernt. Und wenn er mir von den Menschen, die da lebten, von ihren Sitten und Unsitten erzählte, mußte ich gegenüber dieser seltenen Beobachtungsgabe und dieser bis ins Kleinste zurückgreifenden Erinnerung gar oftmals staunend in des Erzählers kluge, hellblitzende Augen schauen. Wenn er das gewahrte, lächelte er wohl über mich ungereisten Menschen und drehte dabei mit beiden Händen die braunen Spitzen seines starken Schnurrbartes gegen die unruhigen Nasenflügel. Diese Zierde der Oberlippen verlieh seinem Gesichte trotz der mannigfachen Fältchen, welche die Augenlider umringten, und trotz der zwei scharfen Furchen, die unter den Mundwinkeln hervorlugten, ein keckmännliches Aussehen – und hätte nicht das schon etwas gelichtete, über den Schläfen bereits leicht ergraute Haupthaar den Verräter gespielt, man würde kaum geglaubt haben, wie mein Freund dem Vierziger schon so nahe stand. –
Pünktlich zur festgesetzten Stunde war ich zum Stelldichein eingetroffen und war bereits ein paarmal unter vergeblichem Umherspähen das menschenbelebte Trottoir auf und nieder gewandert, als ich Willy vor dem Schaufenster einer Kunsthandlung in Betrachtung der ausgestellten Bildwerke versunken fand.
»Was bewunderst du da?« fragte ich, während ich meine Hand auf seine Schulter legte.
Mit einem leichthin genickten Gruße wandte er sich zu mir. »Bewundern? Ich wundere mich nur, wie wenig da ist, was halbwegs zu bewundern wäre.«
»Bitte, nicht weiter in diesem Thema,« lachte ich, nahm Willys Arm und zog ihn nach der Mitte der Promenade, »sonst beginnt unser Spaziergang mit dem alten, unaustragbaren Streit. Ich weiß, du hast in den hundert Galerien, die du bestauntest, den Pessimismus gegen unsere moderne Kunst großgezogen in dir. Ich aber will mir von deiner blinden Parteiwut für Tintoretto und Genossen den Geschmack und die Freude an der lieben Kunst von heute nun einmal nicht verderben lassen …«
»Die dir eben gerade den Geschmack und die richtige, einzig berechtigte Herzensfreude an den Werken einer wahren, gottseligen Kunst lange schon verdorben hat.«
»Ja ja, es ist gut, ich weiß …«
»Nein, du weißt es nicht, wie unendlich viel du verlierst bei deiner halben Schätzung der Alten.«
»Oh! Oh! Dein Fanatismus für die Herrlichkeit des Cinquecento läßt dich nun gar ungerecht werden gegen mich und mein gutes Kunstverständnis. Ich weiß die Alten sehr wohl zu schätzen und zu würdigen. Bei mir aber hat auch der Lebende sein Recht.«
Hier half jedoch kein Protest mehr; die Verhimmelung jener schönen Zeit, da der Fuß eines Raphael noch die Erde getreten hatte, war meines Freundes Lieblingsthema, und so mußte ich wohl oder übel das oftgehörte Loblied wieder einmal über mich ergehen lassen.
Da ich aus alter Erfahrung wußte, daß jeder Widerspruch die Strophen dieses Liedes verlängerte und vermehrtes so lauschte ich schweigend und vor mich hin zur Erde blickend seinen begeisterten Auseinandersetzungen, bis der Klang seltsamer Worte mich plötzlich aufschauen machte.
»Mamma! Mamma! Ecco lo zio Guglielmo!« hörte ich eine helle Kinderstimme rufen, und als ich überrascht die Augen hob, gewahrte ich wenige Schritte vor uns an der Hand einer auffallend schönen Dame ein etwa achtjähriges, zierlich gekleidetes Mädchen, und es schien mir, als wollte das reizende Kind unter allen Zeichen freudiger Erregung uns entgegeneilen.
Kaum hatte jedoch die Dame, die man schon beim ersten Blick als die Tochter eines südlichen Himmels erkennen mußte, dem deutenden Arme des Kindes ihre Augen folgen lassen, da stockte plötzlich ihr Fuß, und jähes Erschrecken flog über das schöne Gesicht; dann riß sie mit einem ungestümen Ruck das Kind an ihre Seite, ihre Lippen kniffen sich ein, geradaus starrten die Augen, und hastigen Schrittes ging sie an uns vorüber, während das Mädchen mit verschüchterten Blicken zu seiner Geleiterin emporsah und, einmal noch nach unserer Seite blinzelnd, das Köpfchen zwischen die Schultern duckte.
Dumpf und tonlos hatte ich diesen Namen von den Lippen meines Freundes klingen hören; auf meinem Arm fühlte ich den seinen erzittern, und als ich in Willys Antlitz sah, erschrack ich vor der tiefen Blässe, die es bedeckte.
Seine Augen waren geschlossen, und wie in einer Anwandlung von Ohnmacht stützte er sich schwer an meine Schulter.
Auch einigen Vorüberwandelnden fiel das auf, denn ich sah, wie sie die Gesichter mit neugierigen Blicken uns zukehrten.
Mit tiefem Seufzer hob Willy den Kopf.
»Komm, komm!« stieß er in rauhem Ton hervor und zog mich am Arm quer über den sandigen Reitpfad nach dem Fahrweg. Dort rief er einen Fiaker an und stieg mir voraus in den Wagen.
»Gnä' Herr befehl'n?« fragte der Kutscher, während er das runde Hütchen bis zu den Knieen zog.
»In den Prater.«
»Schön!« Und mit lautem Zungenschlag ermunterte der edle Rosselenker seine flinken Thiere zu raschem Ausgreifen.
Es war ein herrlicher Abend. Der letzte rote Schein der sinkenden Sonne spielte über die Dächer der Häuser, und uns zu Häupten lag tiefblau und wolkenrein der Himmel. Lau und doch erfrischend wehte bei der raschen Fahrt die Juniluft um unsere Wangen.

Willy hatte eine Cigarette in Brand gesteckt und lehnte wortlos in der Wagenecke, mit kurzen Stößen die blauen Wölkchen vor sich hinpaffend. Wohl war jene Blässe längst wieder von seinem Antlitz geschwunden, aber an dem Zucken, das ab und zu über seine Augenlider flog, und an seinen schweren Atemzügen konnte ich merken, wie es in seinem Innern noch immer kämpfte und tobte.
Von hundert Fragen lag es auf meiner Zunge, und dennoch schwieg ich.
Bald aber wurde mir diese Stille lästig und unbehaglich. Ich begann von Dutzend Dingen zu reden, machte meinen Freund bald auf einen anfahrenden Wagen und seine geputzten Insassen, bald auf einen seltsamen Lichteffekt in der landschaftlichen Umgebung, bald auf eine auffallend kostümierte Spaziergängerin, bald auf dies und jenes aufmerksam – immer aber war ein stummes Kopfnicken die ganze Antwort.
Seine Augen schienen so müde, so gleichgültig für die ganze Außenwelt – so ins Innere blickend, wie Byron von Manfreds Augen sagt.
Erst an dem Straßenkreuz vor der Rotunde, als der Kutscher den Wagen anhielt und sich fragend umschaute, ob er weiterfahren oder wenden solle, sprach Willy wieder ein erstes Wort.
»Komm, laß uns aussteigen!«
Wir verließen den Wagen und lohnten den Kutscher ab, der uns etwas nachbrummte von einer »halbeten Fuhr«.
Arm in Arm wanderten wir gemächlich dahin. Die Dämmerung wob sich bereits zwischen die stillgrünen Bäume; da und dort flammten frühzeitige Gaslichter auf; alle Spazierwege waren belebt von fröhlich plaudernden Menschen; von nahen und fernen Straßen hörte man das Rollen der Wagenräder; die Musiken der Kaffeehäuser und Wirtsgärten verschwammen zu einem unentwirrbaren Tonchaos, und zwischenein klang wohl auch ab und zu vom Wurstelprater herüber ein helles Gejohle, das Schmettern einer einzelnen Trompete, oder das dumpfe Brummen eines Muschelrufes.
Wir lenkten in den weniger belebten Weg ein, der die Rückseite von Ronachers Kaffeehaus umzieht, und da wir uns der Csarda näherten, und die Kapelle nebenan gerade den jüngsten Straußischen Walzer beendete, klang uns eine fröhliche, raschbewegte Zigeunerweise entgegen. Willy blieb stehen, und mit gehobenem Kopfe lauschte er diesen springenden, durcheinanderhuschenden Geigentönen.
»Ich liebe die Musik meiner Heimat,« sagte er. »Wenn ich solch einen echten, rechten Csardas höre, wacht meine ganze schöne Kindheit wieder auf in mir. Da seh ich das hölzerne Haus meiner seligen Eltern, mit seinem bemoosten Strohdach, auf dem die Störche klappern; vor meinen Augen dehnt sich die Pußta mit ihrem wogenden Ried, mit ihren weithornigen Rindern und flinkfüßigen Pferden; ich höre das Flüstern und Raunen in den abendgrauen Schilffeldern und das eintönige Schlummerlied der Unken … nur eines kann ich nicht mehr nachfühlen: das helle Glück meiner fröhlichen Knabenzeit. Ich habe mich emporgebracht im Leben, vom barfüßigen Pferdejungen zum hochdotierten Kassier eines weltbekannten Bankhauses. Ich sollte also wohl sagen müssen, daß ich zufrieden sein kann und daß es mir gut geht. Aber glaube mir, trotz alledem verwünsch ich manchmal die Neugierde und Weltsehnsucht, die mich fortgetrieben aus meinem stillen Dorf. Wer weiß, ob ich mich, angethan mit Gatija und Zischme nicht wohler gefühlt hätte, als tut Moderock und in Lackstiefeln, und ob ich als Csikos nicht meines Lebens froher geworden wäre, wie durch all die dreißig bunten Jahre. Sicher wär es mir in keiner Sekunde so armselig, einsam und liebverlassen zu Mut gewesen, als gerade jetzt in dieser Stunde. Komm … laß uns da hinaufgehen und ein Glas Wein trinken! Ich will dich dabei mit einer Geschichte langweilen, die du wohl nie gehört hättest, würde dich der Zufall nicht zum Zeugen dieser Begegnung gemacht haben, welche mir bis ins Innerste jeden Nerv erschüttert hat, da sie so ungedacht, so unerwartet kam, wie der Tod dem blühenden Sünder.«
Wir stiegen die paar Stufen hinauf, die zum Garten der ungarischen Weinschenke emporführen. Es waren wenig Gäste da, und auch noch von diesen wenigen gesondert setzten wir uns an einen einsamen Tisch der äußersten Gartenecke.
Noch saßen wir keine Minute, noch stand der bestellte Wein nicht auf dem Tische, da beehrte uns bereits der lächelnde Sammelbruder der Musikbande mit seinem tellerklappernden Besuch. Willy reichte ihm eine Banknote.
»Da! Spielt mir das Huzad czak, huzad czak keservesen.«
Nach einer in Dankbarkeit ersterbenden Verbeugung verließ uns der Beschenkte, und gleich darauf erklang die leidenschaftlich bewegte Weise dieses schönen ungarischen Volksliedes. Einer der Geiger hatte sich erhoben und spielte, gegen uns gewendet, die führende Melodie.

»Sieh nur an, wie der Bursche den Bogen führt,« sagte Willy. »Ein Joachim und Sarasate könnte von dieser Grazie und Leichtigkeit noch lernen. Und diese dicken, schwebenden Töne, die er an den Haaren aus seinem schäbigen Instrumente zieht … und doch möchte ich wetten, daß er all seiner Lebtage noch keine Silbe gehört hat vom Unterschied einer diatonischen und chromatischen Scala. Es liegt diesen Leuten im Blut, in der Hand, im Herzen …« Er unterbrach sich und starrte, an der Unterlippe nagend, vor sich nieder auf das rot und weiß karrierte Tischtuch. »Wenn ich nur wüßte, was sie hieher nach Wien geführt hat … sie und ihr Kind!«
Der Kellner brachte die bestellte Flasche. Ich schänkte die Gläser voll.
»Hast du sie angesehen? Nicht wahr, sie ist schön!« Willy stieß sein Glas an das meine, stellte es jedoch, ohne zu trinken, wieder auf den Tisch. »Und da hast du nur ihre schlanke, zierliche Gestalt gesehen, die schwarzen, blau schillernden Haare und die großen, leuchtenden Augen in dem feinen Gesichtchen, dem dieses angehauchte Olivbraun zum verführerischen Schmucke gereicht, wie dem weißen Apfel das duftige Rot der Reife. Das alles ist nur ihre halbe Schönheit. Du hättest sie sehen sollen zwischen ihren vier Wänden, wie sie da ging, stand und saß, wie sie das Köpfchen hob und neigte, wie sie die runden, vollen Arme regte, wenn sie nach einem Buche, nach einem Fächer griff … in allem die verkörperte Grazie. Und erst ihre Stimme, ihr Lachen und Plaudern! Wie soll ich dir das schildern … es ist nicht zu schildern … der Dichter ist noch nicht geboren, der für solchen Liebreiz ein vollbezeichnendes Bild zu finden wüßte. Dabei war sie das echte, unverfälschte Weib, das Weib im alleinigen Schmuck seiner Weiblichkeit. Lesen und Schreiben war ihr ganzes Wissen … mit dem letzteren stand es zudem noch recht bedenklich … ich sehe sie noch vor mir, diese kritzeligen, eckigen, verschrobenen Buchstäbchen, von denen sie mühsam eins ans andere malte, gleich einem Kinde der zweiten Schulklasse. Die Novellen des Boccaz, Goldoni, ein Dutzend von Petrarkas Sonetten, Manzonis promessi sposi und die italienischen Übertragungen von einem Hundert französischer Romane … darauf beschränkte sich ihre ganze Litteraturkunde, und das war die Quelle ihres ganzen übrigen Wissens. Aber was sie nicht wußte, das vermißte man nicht an ihr; gerade diese Unwissenheit war die Quelle einer unbeschreiblich entzückenden Urwüchsigkeit. Ich hasse die überbildeten Weiber von heutzutage, die dir so genau definieren können, daß das Menschenherz nur ein Muskel ist mit unwillkürlicher, stoßartiger Bewegung, die alles verstehen, nur nicht den Mann und die Liebe. O Rachele, du unwissend thörichtes Weib, wie viel klüger warst du als sie alle! So manche hab ich geliebt, geliebt in dem Sinne, in dem dies schöne Wort millionenmal im Tage mißbraucht wird von Abertausenden … diese Einzige hab ich lieb gehabt für mein Leben.«
Er schwieg, griff mit zitternder Hand nach dem Glas und leerte es in raschem Zuge.
»Du warst noch nicht in Konstantinopel? Was soll ich dir da ein Langes und Breites schildern … ein andermal vielleicht … mit meiner Geschichte hat das wenig zu thun. Denke dir eine selbst für die ausschweifendste Phantasie ganz unerfindbare Mischung von Schmutz und Romantik, von blinkenden Minarets und stinkenden Holzhütten, von ekelhaften Straßenpfützen und einem entzückenden Meer, von einer durch ihre Schönheit blendenden Natur und dumpfigen, wanzenbelebten Häusergruften … kurz, denke dir allen Abscheu und alle Poesie der Welt und des Lebens in engster Berührung und Vermischung, dann hast du so ziemlich den Grundton für ein Bild jener Stadt am goldenen Horne.
In wenigen Wochen werden es fünf Jahre, daß mein Bankhaus mich auf Grund meiner Sprachkenntnisse nach Konstantinopel schickte, um über ein paar Geschäftshäuser, die mit unserem Hause in Geldverkehr treten wollten, an Ort und Stelle genauere Erkundigungen einzuziehen. Ich nahm, nach einer recht unerquicklichen Seefahrt an meinem Bestimmungsorte angelangt, im Hotel Missiri Quartier, und nachdem ich mich unserem Gesandten vorgestellt, nützte ich die ersten Tage, um die Stadt, das Meer und Skutari zu besichtigen. Da sich mein Aufenthalt unter Umständen auf Monate ausdehnen konnte, dachte ich auch daran, mich nach einer behaglichen Privatwohnung umzusehen. Ich erkundete verschiedene Adressen und machte mich dann auf die Suche, freilich mit geringem Erfolg.
So war ich wieder einmal vergebliche Stunden in den besseren Straßen Peras umhergewandert und war dabei in jenes Viertel geraten, das noch den türkischen Namen Teke führt, obwohl es zum größten Theil nur noch von Italienern und Griechen bewohnt wird. Ich begegnete wenig Menschen, denn mit einer versengenden Hitze brannte die Sonne senkrecht aus ihrer Höhe nieder, und schwarz und scharf umrissen warf sie die spärlichen Schatten der Dachvorsprünge auf die weißen, kalkstaubigen Straßen. Die Luft war so von Glut durchschwängert, daß mein Sonnenschirm mir blutwenig zu nützen vermochte.
Eben wollte ich aus einer schmalen, steilansteigenden Seitengasse in die Dschambassokak (Theaterstraße) einlenken, als ich Zeuge eines die öffentliche Sicherheit von Konstantinopel recht deutlich illustrierenden Vorfalles wurde.
Ich war an der Mündung der Gasse stehen geblieben, denn an mir vorüber schritt eine Dame von seltener Schönheit … du würdest sie erkennen, wenn ich sie schildern wollte. Sie trug ein enganliegendes graues Seidenkleid und einen gleichfarbigen Hut und hatte als einzigen Schmuck um den Hals eine dicke goldene Kette liegen, von welcher ein kleines Kreuz auf die volle Büste niederhing. Einen Augenblick streifte im Vorüberschreiten ihr großes, flammendes Auge mein Gesicht … aber dieser eine Augenblick machte mir das Blut sieden, und mit bewundernden Blicken schaute ich dieser schlanken, reizvollen Erscheinung nach.
Da seh ich plötzlich, wie aus einer schattendunklen Thürnische solch ein Halunke von einem Griechen auf die Dame losstürzt und ihr mit einem Ruck die goldene Kette vom Halse reißt. Ich springe hinzu, und da der Spitzbube mit seinem Raub davonjagen und in die Gasse verschwinden will, aus der ich getreten, saust ihm auch schon mein aufgespannter Sonnenschirm über den Schädel, daß die Eisenstangen knicken und der ganze Stoff in Fetzen geht. Der unerwartete Schlag schien ihm für einen Moment die Besinnung geraubt zu haben, und diesen Augenblick nützte ich, um nach dem Kleinod zu haschen, das seine Hand umklammert hielt.
Nun eilten auch ein paar Leute die Straße einher, und als der Bursche das sah, ließ er seinen Raub fahren, riß ein Messer aus seinem Gürtel, führte damit nach meinem Arm einen Schlag, den ich nur halbwegs zu parieren vermochte, und sprang unter Flüchen davon, um die Mauerecke der Gasse verschwindend.

Ich ging, von den herbeigeeilten Leuten umringt – um den Flüchtigen scherte sich kein Mensch – auf die Dame zu, die halb ohnmächtig vor Schreck an der Wand des Hauses lehnte, aus dessen Thürnische der Halunke hervorgesprungen war, und reichte ihr den Schmuck, wobei ich sie in französischer Sprache anredete. Sie aber stammelte im reinsten Florentinisch ein Dutzend abgerissener Worte des Dankes und der Besorgnis … und als ich mich zu Boden bückte, um ein paar abgesprengte Glieder der Goldkette aufzulesen, stieß sie einen leisen Schrei aus. Ein dicker Blutstropfen war von meiner Hand in den Staub gefallen.
»Heilige Maria! Gott! O Gott! Er hat nach Ihnen gestochen!« jammerte sie händeringend. »Oh, hätten Sie ihm doch das verwünschte Ding gelassen.«
»Beruhigen Sie sich, Signora,« lächelte ich, »es wird nicht so schlimm sein.« In der That empfand ich auch nicht den mindesten Schmerz und fühlte nur, wie mir das Blut warm und feucht am Arme niederrieselte gegen die Hand; nahe bei der Schulter zeigte der Rockärmel einen fingerlangen Querschnitt. »Und das Bewußtsein, Ihnen einen kleinen Dienst geleistet zu haben,« hatte ich beigefügt, »ist mir, bei Gott, mehr noch wert als diese zwei Blutstropfen.«
Ein seltsamer Blick traf mein Auge. »Aber mir ist dieser Dienst Ihr rotes Blut nicht wert!« stieß sie kurz und heftig hervor, während sie nach meiner Hand faßte. »Kommen Sie! Kommen Sie! Ich selbst will Ihnen, so weit ich es vermag, die erste Hilfe bieten.« Und mit hastigem Fuß der Straße folgend, zog sie mich am Arme mit sich fort.
Nach ein paar hundert Schritten hielt sie vor einem schmucken Haus und rührte ungestüm den Thürklopfer. Eine junge Dienerin öffnete. Da wir aus dem blendenden Sonnenlicht in den dunklen Flur traten, schien mir alles schwarz vor den Augen. Aber ich brauchte ja nur dieser weichen, führenden Hand zu folgen. Es ging über eine Treppe empor und durch ein helles Vorzimmer in ein luxuriös ausgestattetes, halb europäisch, halb türkisch eingerichtetes Wohngemach, dessen Licht durch die niedergelassenen Jalousien wohlthuend gedämpft war.
»Rasch, Catina,« hatte meine Geleiterin bereits im Vorzimmer dem Mädchen zugerufen, »bringe mir frisches Wasser, und aus meinem Schlafzimmer Schwamm und Tuch!«
Nun riß sie mit zitternden Händen den Hut herunter und schleuderte ihn auf den niederen Divan.
»Legen Sie den Rock ab,« sagte sie und nahm mir dabei meinen übelzugerichteten Schattenspender weg, den ich unter den Arm geklemmt hatte, um die eine Hand freizubekommen und mit dem vorgehaltenen Taschentuch das Niedertropfen des Blutes verhindern zu können.
Zögernd und verlegen lächelnd sah ich auf das schöne Weib. »Signora … wie kann ich …«
»Legen Sie den Rock ab!« wiederholte sie, und zwischen ihren schwarzen, feingeschwungenen Brauen schürzte sich eine Falte des Unwillens.
Ich versuchte, ihren Willen zu thun, konnte aber damit nicht recht zu stande kommen. Da trat sie auf mich zu und half mir den Rock ausziehen. Ein leichter Schauer rüttelte ihre Schultern, als der mit Blut getränkte Hemdärmel zum Vorschein kam. Einen Moment schloß sie die Lider – sie war so schön in diesem Augenblick – dann warf sie das Köpfchen auf, griff nach meinem verwundeten Arme, riß die Manschette auseinander, und da die Wunde zu hoch lag, um durch ein Aufstülpen des Ärmels bloßgelegt werden zu können, schnitt sie diesen mit einer rasch herbeigeholten Schere dicht von der Schulter und warf das blutige Stück Linnen in die Kaminhöhlung.
Nun trat auch Catina wieder in das Zimmer, ein Handtuch über dem Arm und in den Händen ein silbernes Waschbecken, darin ein feiner, citronengelber Schwamm auf dem krystallklaren Wasser schaukelte.
Meine Samariterin schickte das Mädchen aufs neue um frisches Wasser fort, hieß mich an den Tisch treten, die Hand in das Becken tauchen, und so wusch sie mir das Blut vom Arm und von der Wunde. Schweigend ließ ich all das geschehen, mit heißen Augen nur immer jede ihrer Bewegungen verschlingend – und ich fand auch kein Wort der Erwiderung, als sie einmal sagte:
»Es ist wirklich nicht so schlimm, wie ich fürchtete.«
Catina brachte ein zweites Gefäß mit Wasser und reinigte in demselben auf Geheiß ihrer Herrin den Schwamm, während diese nach einer Kommode schritt und derselben zwei weiße Taschentücher entnahm. Als ihr das Mädchen nun den Schwamm wieder reichte, preßte sie selbst mit beiden Händen daraus den letzten Rest des Wassers und schnitt eine dünne Scheibe aus seiner Mitte.
Da hörte man ein dumpfes Pochen – an der Hausthüre mußte der Klopfer gerührt worden sein – und Catina verließ das Gemach.
Ihre Herrin legte mir das Stückchen Schwamm auf die kaum mehr blutende Wunde, umwickelte den Arm mit einem gefalteten Taschentuch und band das andere mit einem festen Knoten darüber. Seltsam erschien mir die Hast, mit der sie all das vollführte – und ich fühlte auch, wie ihre Finger zitterten, da sie meinen nackten Arm berührten. Stumm wie ein Klotz war ich die ganze Zeit über dagestanden, Herz und Sinne befangen von der Seltsamkeit meines Abenteuers und von dem Zauber dieses entzückenden Weibes. Ein Wort freilich, wie es meiner inneren Bewegung entsprach, wagte sich nicht auf meine Zunge, aber ich sah nun doch die Notwendigkeit ein, meinem holdseligen Arzte wenigstens ein Wort des Dankes sagen zu müssen, und ein Wort des Bedauerns wegen all der Mühe, die ich ihr in das Haus getragen.
Lächelnd hörte sie mich an, dann neigte sie das Gesicht über meinen Arm – und flüchtig streiften ihre Lippen den Verband der Wunde.
Jäh schoß mir das Blut in die Wangen. »Signora!« stammelte ich und haschte nach ihren Händen. Sie aber entwand sich mir, bis in den Hals errötend, und ging mit hastigen Schritten auf den Divan zu, wie es schien, um meinen Rock zu bringen.
Da scholl vom Vorzimmer her eine helle Männerstimme, und gleich darauf wurde die Thür sperrangelweit aufgerissen.
»Rachele!« rief ein Mann, der mit seiner Größe und seinem Umfang die ganze Thüröffnung versperrte. »Was soll das?« Dabei trat er mit schwerem Fuß in das Gemach. Ihm folgte ein zweiter – und die beiden sahen einander so ähnlich, daß man, wenigstens nach der Gestalt und nach den knochigen, tiefbraunen Gesichtern, den einen für den andern halten konnte. Nur in der Kleidung unterschieden sie sich. Der erstere trug einen lichtgelben Anzug aus feinem Stoff; über seine Weste spannte sich eine schwere, goldene Uhrkette, an welcher eine kinderfaustgroße Amethystberloque baumelte; seine Finger waren überladen mit Brillantringen, und an seiner langen, brennroten Kravatte trug er drei Nadeln über einander. Der zweite hingegen war schmucklos und einfach gekleidet – und man mußte schon ein sehr wohlwollender Beurtheiler sein, wenn man an dieser Kleidung wenigstens den einen Vorzug der Sauberkeit rühmen wollte. Erst späterhin hab ich auch in den Gesichtern einen Unterschied gefunden – wieder zum Nachteil dieses zweiten.

Hinter den beiden Männern hatte sich ein reizendes, etwa dreijähriges Mädchen in das Gemach gedrängt, war mit dem Jubelrufe: »Mamma, Mamma!« auf Rachele zugestürmt und hatte sich ihr in die Arme geworfen. »Babbo ist zu Onkel Leone gekommen, und da haben sie mich miteinander heimgebracht. Ich war so froh, daß ich mich nicht von der alten, häßlichen Paraskeva nach Hause führen lassen mußte. Die Leute auf der Straße bleiben immer stehen und lachen …« da erst gewahrte mich das Kind, schwieg erschrocken und drückte sich in die Rockfalten seiner Mutter.
»Catina!« rief Rachele.
Das Mädchen erschien.
»Führe das Kind in seine Stube und kleid es um.« Sie drückte einen Kuß auf die Stirne der Kleinen. »Geh, Susetta, geh … ich komme gleich zu dir.«
Die beiden verließen das Gemach und Rachele wandte sich an den zuerst Eingetretenen.
»Guten Tag, Ottavio! Du kommst heute außergewöhnlich frühe nach Hause.«
»Vielleicht früher als dir lieb ist?« stieß der Angesprochene ungestüm und beleidigend hervor, während der andere mit einem bösartigen Lächeln auf das nächste Fenster zuging und die Jalousien öffnete. »Was ist hier vorgegangen? Wer ist der Herr?«
»Ottavio Scarpa, mein Mann … Signor Leone Scarpa, mein Schwager,« stellte mir Rachele die beiden vor; und während sie auf mich zutrat und mir mit erhobenen Händen meinen Rock entgegenhielt, so daß ich nur in die Ärmel zu schlüpfen brauchte, wandte sie sich wieder an Signor Ottavio. »Wer dieser Herr ist, weiß ich bis zur Stunde selbst noch nicht. Wir wurden unter Umständen bekannt, die uns nicht gestatteten, Komplimente zu machen. Aber Sie hören ja, Signore,« sprach sie nun mich wieder an, »mein Mann wünscht zu wissen, wer Sie sind. Und auch ich wäre neugierig, wie ich meinen Retter zu nennen habe.«
Ich nannte meinen Namen – und jetzt erzählte Rachele mit raschen Worten die Geschichte des Raubanfalles. Und seltsam – ich weiß nicht, geschah es aus Absicht oder Zufall – die Sache mit dem Messerstich stellte sie in einer Weise dar, daß ein Unbetheiligter schließen mußte, der Stich hätte ihr gegolten und wäre nur durch mein Dazwischenspringen auf meinen Arm abgelenkt worden.
Während Racheles Erzählung musterte Signor Ottavio mit forschenden Blicken bald das Gesicht seines Weibes, bald das meine. Aber er hatte ja meinen nackten, verbundenen Arm noch gesehen; der blutige Leinwandfetzen im Kamin, der zerschnittene Schwamm und das rotgefärbte Wasser in den beiden Becken schien ihn vollends von der Glaubwürdigkeit des Berichteten zu überzeugen, und so trat er, als Rachele ihre Erzählung geschlossen, mit freundlichen Blicken auf mich zu und faßte mit dankenden Worten meine Hand.
Mir selbst war bei diesem ganzen Auftritt recht betrüblich zu Mut – nicht, als ob mich die Situation an und für sich bedrückt hätte – o nein! Aber … ihr Kind, ihr Mann … das waren zwei böse Worte für mich gewesen. Hatte ich doch in meinem Herzen eine Hoffnung aufsteigen fühlen, leuchtend und rosig wie der Morgen eines schönen Frühlingstages.
Auch ich mußte noch einmal den ganzen Vorfall auf der Straße erzählen, wobei ich ebenfalls, um Racheles Aussage nicht zu irritieren, der Wahrhaftigkeit einen gelinden Fußtritt versetzte. Signor Ottavio, der inzwischen nach einem Mietwagen fortgeschickt hatte, schien sich ganz besonders für die Umstände zu interessieren, die mich so als deus ex machina zu der Katastrophe geführt hatten.
Ich erzählte ihm also, daß ich mich erst seit einigen Tagen in Konstantinopel befände und mich nach einer Privatwohnung habe umsehen wollen – und so hätte mich ein glücklicher Zufall bei der Besichtigung einiger notierter Adressen gerade im Augenblick des Attentates in die Dschambassokak geführt.
»Hab ich recht verstanden? Sie suchten eine Wohnung?« sprach mich Signor Leone an, aus seiner reservierten Stellung am Fenster hervortretend. »Und haben Sie schon etwas Passendes gefunden?«
»Bis zur Stunde noch nicht.«
»Bei allen Heiligen, das trifft sich gut. Gerade seit ein paar Tagen hab ich zwei prächtige Zimmer leerstehen. Ein Graf hat darin gewohnt, ein feiner Herr aus Paris; er hat mir doppeltes Geld für die Zimmer bezahlt, damit ich ihn nur ja nicht ausmieten möchte. Und die hellen Thränen hat er geweint, da ich ihn am Ende doch fortschicken mußte … es war meiner zwei hübschen Töchter wegen … er hatte sich in die Mädels verguckt … gleich in alle beide. Freilich … da möchte jedem die Wahl sauer werden.« Ein wieherndes Lachen begleitete diese Worte.
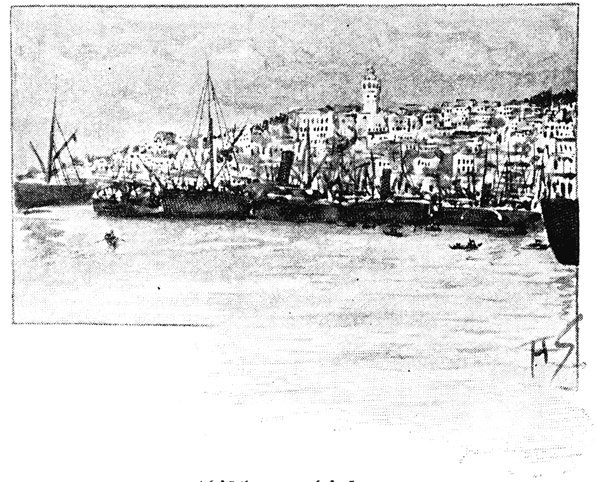
Er kam mir nicht besonders sympathisch vor, dieser Signor Leone, aber doch – vielleicht verhehlte ich mir selbst den wahren Grund, wenigstens redete ich mir in diesem Augenblick ein, es geschehe nur, um mir die Mühe eines weiteren Suchens nach einer Wohnung zu ersparen – doch schlug ich in seine Hand ein, die er mir mit den Worten reichte: »Nun, Sie scheinen ein braver, honetter Herr zu sein, Sie sollen die Zimmer haben. Schicken Sie nur, sobald es angeht, ihre Sachen … wegen des Preises werden wir uns nicht raufen.«
Catina trat ein, um die Ankunft des Wagens zu melden.
»Kommen Sie, mein verwundeter Held, ich will Sie führen,« lächelte Signor Ottavio, während er meinen gesunden Arm in den seinen schlang. »Und bis in einer Stunde schick ich Ihnen unseren Arzt in das Hotel.«
Rachele trat auf uns zu und reichte mir die Hand. »Auf Wiedersehen … denn ich hoffe, daß Sie uns in wenigen Tagen selbst die Nachricht von Ihrem vollständigen Wohlbefinden bringen können.«
Ich fühlte einen leisen Druck ihrer schlanken Finger; als ich ihr aber in die Augen blicken wollte, senkte sie die Lider.
Ihr Mann und Signor Leone führten mich bis zum Wagen. Der eine wünschte mir gute Genesung, der andere versicherte, daß seine »alte, dicke Giuditta« und seine beiden »feueraugigen Schwarzköpfe«, wenn er ihnen Kunde von ihrem neuen »feinen« Hausgenossen bringen würde, mein Eintreffen wohl kaum mehr erwarten könnten. Und diese Worte waren wieder von jenem hölzernen, unangenehm berührenden Lachen begleitet.
Als ich im Hotel angelangt war, schritt ich mit heißem Kopf in meinem Zimmer auf und nieder, bis der angemeldete Arzt, ein junger Deutscher, bei mir eintrat: eine schlankaufgeschossene Gestalt mit einem schmalen, blassen Gesicht und großen, geistvollen Augen.
Er untersuchte die Wunde und legte einen neuen Verband an. Die Sache wäre nicht im geringsten gefährlich, meinte er, doch sollte ich mich zur Vorsicht ein paar Tage aufs Ohr legen, da bei geringer Bewegung des Körpers die Wunde sich um so rascher schließen würde.
Ich befolgte denn auch seinen Rat – und daß ich in den hundert schlaflosen Stunden der folgenden Tage an nichts anderes dachte, als an Rachele und wieder an Rachele, das magst du dir denken können, ohne daß ich es sage.
Ob ich vom ersten Blick an ihr eigen war, oder ob erst das Grübeln, Sehnen und Träumen dieser Stunden irgend ein winziges Fünklein in meinem Herzen zur lohenden Flamme entfachte – mag das gekommen sein wie immer – am Ende fühlte ich nur die Gewißheit, daß ich dieses Weib liebte, wie ich noch nie geliebt in meinem Leben, daß ich ihr angehörte mit meiner ganzen Seele, und daß es für alle Zeit zu Ende wäre mit meinem Glück und meiner Ruhe, wenn ich sie nicht gewinnen konnte oder durfte.
Eines aber schwur ich mir. Ich wollte mich bezwingen und mein Gefühl in mich zurückdrängen, wollte ihr mit keinem Blick mein Empfinden verraten, mit keinem Wort von meiner Liebe sprechen. Sollte aber auch in ihrem Herzen ein Gefühl für mich erkeimen, und sollte sie dies mit einem Wort, mit einem Blick nur mich gewahren lassen, dann – auch das hab ich mir damals geschworen – dann war ich entschlossen, mir den Besitz des geliebten Weibes um jeden Preis zu erkämpfen. –
Tagtäglich kam der Arzt, und mit jedem Besuche konstatierte er einen erfreulichen Fortschritt der Heilung. Auch Signor Leone suchte mich ein paarmal auf – und wenn er dann wieder ging, roch es in meinem Zimmer immer noch stundenlang nach dem abscheulichen Tabak, den er mit seinen gelben Fingern zu dicken Cigaretten verarbeitete. Unangenehm im höchsten Grade war mir dabei die Art und Weise, wie er von der gesteigerten Neugier und Erwartung seiner beiden »Käfer«, und wie er von seinem Bruder sprach. Dieser »Kerl«, dieser »Mensch«, dieser »Bursche«, dieser »alberne Nichtswisser« brauche mit seinen »Wurstfingern« nur den Straßenkot zu berühren, damit er ihm unter der Hand zu Gold würde, während Er, der doch in einer Haarspitze mehr Verstand hätte, als jener andere in seinem ganzen »Büffelkopfe«, sich Tag für Tag schinden und placken müsse wie ein Maulesel, um nur sein und der Seinigen Leben kärglich zu fristen. Ich war immer herzlich froh, wenn dieser Signor Leone sich mit der Versicherung erhob, wie leid es ihm wäre, daß seine dringenden Geschäfte ihm nicht erlaubten, mir noch länger Gesellschaft zu leisten.
Zweimal im Tage kam auch Catina, um sich im Auftrage ihrer Herrin nach meinem Befinden zu erkundigen – und es that mir immer unendlich wohl, wenn sie mir in wortreicher Gutmütigkeit vorplauderte, wie sich ihre »süße Signora« so sehr um meine Genesung kümmere und sorge.
Einmal trug ich ihr auf, mit meinen Grüßen an Signora Scarpa die Bitte um einige Bücher für meine einsamen Stunden zu überbringen. Am anderen Tage brachte sie ein großes Paket. Es enthielt mehrere Bände der Florentinischen Ausgabe Goldonis, eine italienische Übersetzung von Sues »Geheimnisse von Paris« – und ein schwarzsamtenes Schmucketui. Als ich den Deckel aufspringen ließ, fiel mir eine Visitkarte entgegen. »Ich hoffe, Sie werden mir nicht zürnen,« las ich auf der Rückseite, »wenn ich Ihren übel zugerichteten Sonnenschirm, den Sie in der Eile des Abschiedes bei mir stehen ließen, als ein sprechendes Andenken an die Stunde zurückbehalte, die uns unter so seltsamen Umständen zusammenführte. Das Beiliegende bitte ich zum Tausche mit freundlicher Gesinnung entgegenzunehmen. Rachele S.«
Und dieses »Beiliegende« war die goldene Halskette, die ich jenem Halunken wieder abgejagt hatte. Sie war zu einer Uhrkette umgewandelt und trug statt des kleinen Kreuzes ein Medaillon mit Racheles wohlgetroffenem Bilde.
Da ließ ich nun freilich die Bücher ungelesen liegen und plauderte im überquellenden Empfinden meines Herzens mit diesem Bilde, wie ein Kind mit seiner stummen Puppe. An der Kette ließ ich späterhin das Schloß wieder ändern, um sie am Halse tragen zu können – und so trag ich sie heute noch.

Ein paar Tage darauf – ich war schon außer Bett und hatte gerade einen Brief an mein Haus begonnen, um mich zu entschuldigen, daß ich wegen eines mehrtägigen Unwohlseins meinen Pflichten bislang noch wenig, oder besser gesagt, gar nicht hätte genügen können – trat Signor Ottavio in mein Zimmer.
»Der Doktor hat uns verraten,« plauderte er in seiner kurzatmigen Sprechweise, nachdem die ersten Grüße und Erkundigungen um mein Befinden erledigt waren, »der Doktor hat uns verraten, daß es Ihnen gut thun könnte, wenn Sie wieder einmal eine Stunde in frische Luft kämen. Und so haben wir uns zusammen in einen Wagen gesetzt, um Sie zu einer kleinen Spazierfahrt abzuholen. Eigentlich war das ein Gedanke meiner Frau … sie hat immer so gute Gedanken. Aber machen Sie sich fertig, wir dürfen sie nicht lange warten lassen, sie sitzt mit Susetta drunten im Wagen.«
Als wir wenige Minuten später aus dem Hotelportal auf die Straße traten, grüßte mir Rachele lächelnd mit der Hand entgegen. Auch gewahrte ich, daß sie einen raschen Blick nach meiner Weste warf.
Ich küßte ihr die Fingerspitzen, und nachdem ich ihre Frage nach meinem Befinden beantwortet hatte, dankte ich ihr mit kurzen Worten für das »freundlich Übersandte«.
Signor Ottavio hob, als ich das sagte, den Kopf und warf einen neugierigen Blick auf Rachele, welche diese stumme Frage mit den Worten erwiderte:
»Ich habe Signor Pilliccio« – Pilliccio, so hatte sich Rachele meinen gut ungarischen Familiennamen für ihre florentinische Zunge zurecht gelegt – »ich habe Signor Pilliccio auf sein Ersuchen einige Bücher geschickt, damit ihm das Krankenzimmer nicht gar zu langweilig würde.«
Signor Ottavio wußte also nichts von der »Erinnerung«? Ich suchte Racheles Augen – und da vor meinem Blick ein flüchtiges Rot ihre Wangen überzog, mußte ich denken, daß sie die Frage nachfühlte, die ich mir im stillen vorgelegt hatte.
Ich stieg in den Wagen und wollte auf dem Rücksitze Platz nehmen. Signor Ottavio nötigte mich aber an Racheles Seite, nahm selbst den Rücksitz ein und hob das Kind auf seinen Schoß.
Die Kutsche war schmal gebaut, so daß sich die Falten von Racheles seidenem Gewand über meine Kniee bauschten, und daß bei jedem stärkeren Ruck, bei jeder Wendung des Wagens ihre Schulter meinen Arm berührte. Ein warmer Schauer überlief mich bei jeder Berührung – und diese stete Erregung meines ohnedies schon überreizten Empfindens machte mich unfähig für jedes Gespräch von längerer Dauer.

Auch Rachele verhielt sich schweigsam; doch mußte sie sich wohl in Gedanken mit mir beschäftigen, denn die ruhelosen Manöver ihres Sonnenschirms schienen von der Absicht geleitet, mich ausgiebig an seinem wohlthuenden Schatten teilnehmen zu lassen.
So trug nun zumeist Signor Ottavio die Kosten der Unterhaltung. Er nannte mir die Namen der Straßen, die wir passierten, bezeichnete mir bemerkenswerte Gebäude und Plätze, machte mich aufmerksam auf irgend eine Fernsicht, die flüchtig zwischen den Häuserlücken hindurchblitzte oder über den tieferliegenden Stadttheilen sich erhob, und späterhin, als die Mauern schon hinter uns lagen, erzählte er mir politische und unpolitische Geschichten und Geschichtchen von den Besitzern der üppig grünenden Gärten, die sich zu beiden Seiten der staubigen Straße bergauf und nieder dehnten.
Er benahm sich so liebenswürdig, so freundlich gesprächselig, wie ich es hinter dem rauh erscheinenden, großmächtigen Menschen in dem schreiend geschmacklosen Aufzuge gar nicht gesucht hätte. Und trotzdem vermochte ich ihm gegenüber kein warmes Wort, keinen herzlichen Ton zu finden – sah ich in ihm doch stets nur den vom Schicksal mir gesetzten Feind meines Glückes und meiner Liebeshoffnung.
Wenn ich überhaupt sprach, wandte ich mich fast immer nur an die kleine Susetta. Ich hatte dieses lebendige Miniaturbild der Mutter vom ersten Blick an in mein Herz geschlossen, und da es Kinder gar bald heraus haben, wer ihnen gut ist – meine schmeichelnden Worte, die in meinem Innern freilich zur Hälfte an eine andere Adresse gerichtet waren, thaten auch das ihrige – so wurden wir beide noch während dieser Fahrt die traulichsten Freunde. Signor Ottavio zeigte späterhin oft Anwandlungen väterlicher Eifersucht gegenüber der Zärtlichkeit, mit welcher Susetta an ihrem zio Guglielmo – so hatte sie mich getauft – an ihrem Onkel Wilhelm hing.
Als der Wagen nach zweistündiger Fahrt wieder vor dem Hotel Missiri hielt, hatte ich kaum zwanzig Worte mit Rachele gesprochen. Es berührte mich seltsam, daß sie mir zum Abschied nicht mehr die Hand reichte; sie nickte mir nur mit einem halben Lächeln zu, während sie Susetta auf den freigewordenen Platz an ihrer Seite hob.
Signor Ottavio wünschte mir einen erquickenden Schlaf – vielleicht, weil er selbst gegen Ende der Fahrt ein wenig schläfrig geworden war – und Susetta warf mir unter fröhlichen Abschiedsgrüßen schallende Kußhändchen nach.
Unter dem Thor blieb ich noch stehen und lauschte dem Rollen des Wagens, bis es in der Ferne verklang.
Droben in meinem Zimmer warf ich mich auf den Divan und grub, Racheles Bildnis an die Lippen pressend, mein heißes Gesicht in die Polster.
Anderen Tags vollführte ich den Umzug nach meinem neuen Quartier. Ich hatte mir keine besondere Vorstellung von Signor Leones »prächtigen« Zimmern gemacht, konnte mich also auch nicht enttäuscht fühlen – es waren zwei Stuben, in denen sich's zur Not wohnen ließ.
Ich will dir, um mich späterhin nicht wieder unterbrechen zu müssen, gleich das ganze Haus und seine Insassen schildern, wie ich das alles im Laufe der folgenden Tage kennen lernte.
Wie die meisten Häuser in Pera, das auf Art italienischer Kleinstädte zugeschnitten ist, war auch Signor Leones Haus schmal und hoch gebaut. Jedes Stockwerk umfaßte außer dem Treppenabsatz und einem kleinen dunklen Vorraum nur zwei Zimmer. Im Parterre lag die Küche und die Magdstube. Eine steile, in ihrer Breite gerade noch für eine stark beleibte Person genügende Wendeltreppe führte von hier bis zum flachen Dach empor. Im ersten Stockwerke befanden sich meine beiden Zimmer. Im Salon – Signor Leone hatte wirklich den Mut dieser Bezeichnung – lag an der thürlosen Längenwand eine Matratze auf der Erde, die ein darüber gebreiteter persischer Teppich und ein roter, quastenbesetzter Rundpolster zum Divan erhoben. Am Pfeiler zwischen den beiden Fenstern stand ein altertümlicher Tisch mit zwei wackeligen Stühlen. An der zweiten Längenwand, deren Mitte von der Schlafzimmerthüre durchbrochen war, stand auf der einen Seite eine großmächtige Kommode mit plumpen Broncehenkeln an den Schubfächern, auf der anderen Seite ein leeres Bücherregal, dessen oberstes Brett ein paar geschmacklose Nippes trug. Das war die ganze Einrichtung dieses »Salons« – ja, daß ich nicht vergesse, vor dem Divan stand noch eines jener kleinen, mit Perlmutterrauten ausgelegten, türkischen Rauchtischchen. Ebenso primitiv war der Schmuck der Wände: zwei abscheuliche Farbendrucke nach Rafaelschen Madonnen.
In dem einfenstrigen Schlafzimmer standen ein Kleiderschrank, ein hölzernes Gestell für das Waschbecken und ein eisernes, mit Wolldecken überbreitetes Bett. Über diesem Bette hing an der getünchten, von Mörtelsprüngen durchzogenen Wand ein aus Holz geschnitztes Hochrelief, das eine Kreuzigung Christi darstellte. Nach dem eingetrockneten Staube in seinen tieferen Fugen und nach den zahllosen Wurmstichen zu schließen, mußte das Ding uralt sein, doch war es ohne irgend welchen künstlerischen Wert. Die Figuren waren von einer grauenhaften Proportionswidrigkeit, und ihre Mienen zeigten einen so entsetzlich leidenden Ausdruck, daß man unter der Reflexwirkung dieses Anblickes unwillkürlich das Gesicht verzerren mußte. Dazu war das Bild von früheren Heiligenfesten her mit vertrockneten Blumen aller Art geschmückt, die den Figuren zwischen den Beinen, in den Armen und hinter den Köpfen steckten. Wenn ich mich des Nachts auf meinem Bette rührte, so zitterten diese Zweige und streuten von ihren welken Blättern und Stacheln über mein Lager – in der Folge mußt ich mir dann auch noch gefallen lassen, daß vor dem Bilde an gewissen Kirchenfesten durch Tag und Nacht ein ranziges, übelriechendes Öl gebrannt wurde.
Köstlich aber war die Aussicht, welche mit ihrer blühenden Schönheit durch die Fenster hereinlachte. Gleich über die Straße hinüber sah ich in einen herrlichen Garten, aus dessen üppigem, von bunten Blumen untermischtem Gesträuch die blaugrünen Cypressen schlank emporstachen. In der Tiefe des Gartens stand ein freundliches Haus, das wohl ehemals von Türken bewohnt war – wenigstens schloß ich dies aus den dichten Holzgittern, die jeden Einblick in die Fenster verwehrten, und aus den halbzerfallenen Grabsteinen, die unter Blumenbüschen und Cypressen hervorlugten. Über das Dach dieses Hauses hinweg schweifte das Auge in die flimmernde Pracht des goldenen Hornes, über das leuchtende, von aberhundert Segelschwänen durchzogene Meer und vorüber am Leanderthurme nach dem weißglänzenden Skutari.
Diese Aussicht mußte ich freilich theuer genug bezahlen, denn Signor Leone stellte, »mir zuliebe«, wie er sich ausdrückte, einen so unverschämten Mietpreis, daß ich mir dafür im Hotel Missiri zwei Prunkzimmer des ersten Stockes hätte halten können. Ich war aber nun einmal da – und so blieb ich. Dabei dacht' ich wohl auch an Rachele.
Im zweiten Stockwerk des Hauses lag das Speisezimmer der Familie, sowie die Schlafstube der beiden Mädchen; und im obersten Stocke hauste Signor Leone mit seiner »alten dicken Giuditta«, der ich noch in der ersten Stunde meines Einzuges vorgestellt wurde. Während ich mit ihr plauderte, besann ich mich immer, an wen mich diese umfangreiche, supernaive und borniert kokette Dame doch so lebhaft erinnern mochte – und ich kam dieser Ähnlichkeit auch richtig auf die Spur. Wie ein Original seinem wohlgetroffenen Porträt, so glich Madame Scarpa jener Signora Latizia in Heinrich Heines »Bäder von Lucca«, jener »fünfzigjährigen jungen Rose« mit dem »roten Meere« zwischen den fleischigen Armen. Freilich fand ich Signora Giuditta etwas mehr bekleidet, als uns von der Geliebten Christoforo di Gumpelinos berichtet wird – aber der graulich weiße Schlafrock, den sie trug, war immerhin bis zu unappetitlicher Tiefe ausgeschnitten. Auch schien sie unter diesem Schlafrock keinen weiteren Faden mehr am Leibe zu tragen, denn als sie einmal, um mir ein Album mit den Photographien ihrer beiden Töchter herbeizuholen, am hellen Fenster vorüberschritt, zeigte sich an der unteren Hälfte des dünnen Gewandes eine recht verfängliche Silhouette.
Die beiden Mädchen, die ich zuerst durch Vermittlung der lobpreisenden Mutter aus ihren Photographien kennen lernte, waren zur Stunde meines Einzuges außer Hause. Aber am Abend noch, als sie zurückkehrten, wurde ich mit einer mich etwas frappierenden Eilfertigkeit in das Speisezimmer gerufen, um ihre persönliche Bekanntschaft zu machen. Es waren zwei bildhübsche, schwarzhaarige und schwarzäugige Dinger von achtzehn und sechzehn Jahren, gleich Puppen ausstaffiert mit bunten Bändern und behängt mit allerlei Tand und falschem Schmucke. Viola hieß die ältere, die jüngere Michelina.

Ich hatte mich von Mutter und Töchtern überreden lassen, an diesem ersten Abend das Souper mit ihnen einzunehmen – und als ich dann zwischen den beiden Mädchen hinter dem niederen Tische auf dem Divan saß, that es eine der andern an ermunternder Liebenswürdigkeit zuvor. Während aber Viola mehr die Schmachtende und Sensible spielte, fuhr Michelina mit schäkernder Ausgelassenheit auf ihrem Sitze hin und her, und sie sprach zu mir nicht nur mit den lüstern aufgeworfenen Lippen, sondern auch mit Ellbogen, Knieen und Füßen.
In der Folge wurden mir die beiden Mädchen bis zur Widerlichkeit lästig – konnt' ich doch keine Stunde zu Hause über meinen Schreibereien sitzen, ohne daß eines von ihnen unter dem nichtigsten Vorwand in mein Zimmer trat. Einmal sogar in der Nacht – wenn ich nicht irre, war es die Nacht vor dem Fronleichnamsfeste – öffnete sich leise die Thüre meines Schlafzimmers, und Michelina trat ein, in einem recht familiären Aufzuge – um nachzusehen, ob das Öllämpchen vor dem Christusbilde, das am Abend zu Ehren des heiligen Festes entzündet worden war, nicht etwa erlöscht wäre. Ich glaube, ich bin damals etwas grob gegen den Fratzen geworden.
Nun darf ich aber einer letzten Mitbewohnerin des Hauses nicht vergessen, die sich unter all meinen neuen Dachgenossen allein meiner Sympathie zu erfreuen hatte. Es war das Signor Leones alte Magd, eine Griechin Namens Paraskeva. Ihr äußerer Anblick war freilich nicht besonders vertrauenerweckend, denn man durfte sie, ohne ungerecht zu werden, als einen Ausbund von Häßlichkeit bezeichnen. Und doch war ihr Äußeres weniger abschreckend als komisch. Mit diesem runzelndurchfurchten, schlitzäugigen und ebermäuligen Gesichte kontrastierte gar seltsam ihr mädchenhafter, halb koketter Aufzug, hauptsächlich das buntschillernde Seidentuch, das sie, nach Art der griechischen Mägde in Konstantinopel, mit den grauen Zöpfen verflochten um den Kopf gewunden trug, und dessen silbergestickte Enden ihr über das linke Ohr auf die Schulter baumelten.
Ich hatte anfangs schwere Mühe, mich Paraskeva verständlich zu machen oder sie selbst zu verstehen, denn ihre Sprache war ein kunterbuntes Mischmasch von Neugriechisch, Türkisch und Italienisch. Dabei trug sie, mochte sie mir nun die Familienchronik ihrer Herrschaft ausplaudern oder die alltäglichsten Dinge mit unermüdlicher Redseligkeit vorschwatzen, alles, was sie sagte, mit einer eigentümlich geheimnisvollen Wichtigkeit vor, wobei sie nach jedem zehnten Wort ihr stereotypes Kyrie! Kyrie! (Herr! Herr!) dazwischen warf.
Paraskeva war mir am Morgen des zweiten Tages, den ich unter Signor Leones Dach verlebte, behilflich gewesen, meine Koffer zu entleeren. Da kam denn neben all dem Nötigen manch Unnötiges zum Vorschein: Medaillons, gestickte Täschchen, monogrammierte Etuis und andere zärtliche Angedenken, die eine momentane Laune oder eine nur halb überwundene Pietät mich mit auf die Reise hatte nehmen lassen. Nun aber war durch die Gedanken an Rachele meine Gefühlswärme für all diese Dinge tief unter Null gesetzt worden, und da ich sie nicht geradewegs zum Fenster hinauswerfen wollte, packte ich den ganzen Kram zusammen und beglückte damit die alte Paraskeva. Nur mit einem kleinen, zierlich eingelegten Revolver, der ebenfalls unter diese »süßen« Geschenke zählte, machte ich eine Ausnahme. Das Abenteuer in der Dschambassokak hatte mich überzeugt, wie in Konstantinopel unter Umständen eine kleine, handliche Waffe gar nützlich und ersprießlich sein könnte – ich behielt also das Ding; Paraskeva zerfloß ohnedies schon in Dank und Entzücken.
Von dieser Stunde an waren mir ihr Wohlwollen und ihre anhängliche Treue zugeschworen; sie wäre für mich durch Wasser und Feuer gegangen. Wenn ich so etwas nun auch nicht von ihr verlangte, so suchte ich doch ihr Vertrauen so weit zu nützen, um über die Familienverhältnisse der beiden Scarpa, besser gesagt über Rachele zu erfahren, was hierüber von Paraskeva eben zu erfahren war. Freilich mußte ich bei all dem, was ich wissen wollte, auch all das in Kauf nehmen, was sie mir sagen wollte; denn immer und immer wieder kam sie von den Geschicken der beiden Brüder auf die Chronik ihres eigenen Hauses zu reden – und wenn sie mir davon erzählte, tauchte das ganze ewige Lied des blinden Homers vor meinen Augen auf. Achilles, Agamemnon, Hektor, Ajax, Menelaus, Nestor – das waren so die Namen, welche Paraskevas Brüder, Oheime und Vettern zu führen beliebten, wenngleich ihr Stiefbruder Ajax, der eine Hausknechtstelle im Hotel Missiri bekleidete, noch derjenige war, der unter ihnen allen die höchste gesellschaftliche Rangstufe einnahm.
Was ich nun von Paraskeva über die Brüder Scarpa erfuhr, durch Fragen und Fragen in Tagen und Wochen, will ich dir, bevor ich in meiner eigentlichen Geschichte weiterfahre, in kurzem Zusammenhange berichten, da ja so manches in dem Schicksal dieser beiden für das Verständnis alles Folgenden notwendig sein dürfte.
Ottavio und Leone waren Zwillingsbrüder, die Söhne eines wenig bemittelten Korallenhändlers in Maltas Hauptstadt La Valetta. Nach dem Tode des Vaters – die Mutter war wenige Wochen nach der Geburt der Zwillinge gestorben – führten die herangewachsenen Brüder einige Jahre das ererbte Geschäft gemeinsam weiter, bis Leones Verheiratung die Ursache immerwährender Zwistigkeiten wurde. Ottavio, der nie ruhenden Reibereien müde, überließ endlich seinem eigennützigen Bruder Haus und Geschäft und ging nach Konstantinopel, um dort für sich allein das Glück zu versuchen. Und das Glück war ihm günstig. Er hatte auf der Basis seiner mäßigen Mittel einen Handel mit Schmucksachen begonnen, dessen Gewinn ihm freilich zu anfangs nur knapp das Leben fristete. Da wurden ihm eines Tages von einem Unbekannten Juwelen zum Kaufe angeboten, deren Wert sein ganzes Vermögen wohl um das Hundertfache überstieg. Ottavio schöpfte wegen der Provenienz dieser Edelsteine Verdacht, und dieser Verdacht führte zur Entdeckung eines im Hause eines türkischen Großen verübten Juwelendiebstahls. So war er plötzlich populär geworden, die Glorie der Ehrlichkeit, mit der ihn dieser Vorfall umwoben, hatte ihm Kredit und Protektion verschafft, und diese zwei schönen Dinge wußte Ottavio in so kluger Weise für sich zu nützen, daß er in kurzer Zeit nicht nur viele vornehme und reiche Privatleute zu seinen Kunden zählte, sondern auch mit einträglichen Juwelenlieferungen für das Serail betraut wurde. Nun aber ließ er es bei der Einseitigkeit des zuerst begonnenen Geschäftes nicht bewenden. Er hatte einmal das Glück an seiner Seite, und was er auch beginnen mochte, geriet ihm mehr als nach Wunsch. Er warf sich in ausgedehntem Sinne auf das »Liefern« – lieferte neben seinen Juwelen auch Stoffe, Teppiche, Möbel, schließlich Nahrungsmittel und hundert andere Dinge, er wurde Regierungs- und Armeelieferant – und dabei ein reicher Mann.
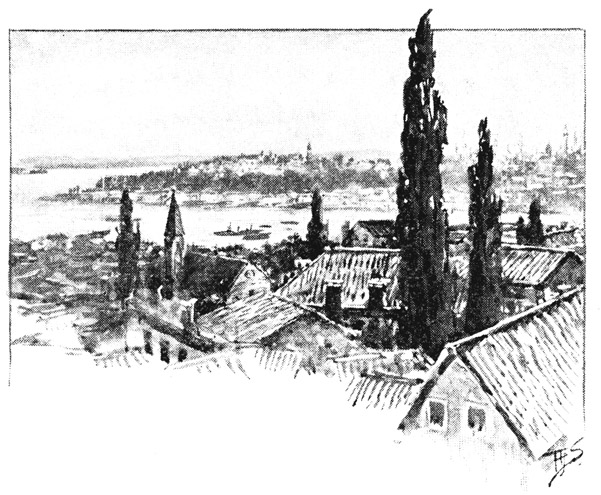
Du lächelst ein wenig ungläubig? Ja, ja – Signor Ottavio Scarpa war einer von den wenigen Sterblichen, die bei Geschäften mit der türkischen Regierung ein Erkleckliches profitierten. Ob er deshalb klüger war als die anderen, das will ich nicht behaupten – er war eben glücklicher. Freilich, Glück haben, das ist ja am Ende die Potenz der Klugheit.
Diese Wendung zum Guten, welche Ottavios Verhältnisse in Konstantinopel genommen hatten, blieb natürlich seinem Bruder Leone kein Geheimnis. Da kam nun alle paar Wochen aus La Valetta ein jammervoller Bettelbrief – da drüben in Malta schien die Handelslage plötzlich eine ganz entsetzliche geworden zu sein, denn mit jedem Vierteljahre stand die Firma Leone Scarpa aufs neue vor dem Ruin, wobei natürlich immer der liebe Bruder Ottavio den rettenden Engel abgeben mußte. Und dieser Bruder war gutmütig genug, zu geben und immer wieder zu geben – er hatte ja hundertmal mehr, als er für sich allein bedurfte. Schließlich aber fand sich auch für Ottavio ein Grund, der es ihm wünschenswert erscheinen ließ, einen brüderlichen Blutegel von sich abzustreifen. So sandte er denn eines Tages eine größere Summe Geldes an Leone mit dem Bemerken, daß es nun ein für allemal zu Ende wäre mit der so oft in Anspruch genommenen Hilfe. Solang er noch für sich allein in der Welt gestanden, hätte er von seinem Überflusse gerne dem Bruder ein anständiges Theil zukommen lassen, nun aber müsse er mit etwas mehr Bedacht sein Erworbenes zusammenhalten, da der größte Reichtum noch zu armselig wäre, um der jungen Frau, die er in wenigen Wochen heimzuführen gedenke, das Leben so schön und angenehm zu machen, als sie es verdiente.
Zwei Monate später kehrte Ottavio mit Rachele von seiner Hochzeitsreise aus Italien zurück – und da war er nicht wenig überrascht, in seinem Hause einen fünfköpfigen Besuch vorzufinden: Leone, Giuditta, Viola, Michelina und Paraskeva.
Lachend berichtete Leone seinem Bruder, daß er, wollte er nicht ganz an den Bettelstab kommen, wohl oder übel sein Geschäft hätte verkaufen müssen, und so wolle auch er nun sein Glück in Konstantinopel versuchen, wobei es ihm sicher nicht fehlen könne, wenn ihm nur Ottavio für den Anfang mit Geld und gutem Rat ein wenig an die Hand ginge. Ein paar tausend Piaster, das wäre ja für den Millionenbruder eine Kleinigkeit, und verhungern könne er schließlich seine nächsten Verwandten doch auch nicht lassen.
Das fand nun aber selbst der gutmütige Ottavio ein wenig zu stark, und es setzte zwischen den beiden Brüdern einen heftigen Auftritt, an dem sich die edle Signora Giuditta und ihre holdseligen Töchter mit Jammer und Wehgeschrei betheiligten. Wenn Ottavio dennoch zu diesem bösen Spiel eine gute Miene machte, so war nur die liebenswürdige Intervention Racheles die Ursache, da sich's die junge Frau wohl nicht ins Gesicht sagen lassen wollte, daß ihr Eintritt in die Familie das Herz des Bruders für die Not seiner Anverwandten verschlossen hätte – wenngleich ich beifügen muß, daß es mit dieser »Not« nicht so weit her sein konnte, denn aus Äußerungen der alten Paraskeva mußte ich entnehmen, daß Signor Leone gar nicht so mittellos nach Konstantinopel gekommen war, sich vielmehr aus den Hilfsgeldern des guten Ottavio ein hübsches Sümmchen zusammengescharrt hatte, das aber freilich bei der Lebsucht dieser Leute nicht lange anhalten mochte.
Kurz und gut, Ottavio schenkte seinem Bruder jenes Haus, das ich dir oben beschrieben, und verschaffte ihm bei der Hafenbehörde eine Aufseherstelle, die sich allerdings weniger durch das bescheidene Gehalt einträglich für Leone erwies, als durch die Art und Weise, wie er seine Stellung zu seinem und auswärtiger Kaufleute Nutzen für die Vermittlung erlaubter und unerlaubter Zollermäßigungen gebrauchte, oder richtiger: mißbrauchte.
Aber wenn auch für Leone die Erwerbsquellen so reichlich geflossen wären, wie die biblischen Milchströme Kanaans, er hätte es dennoch nie zu geordneten Vermögensverhältnissen gebracht. Bei jedem Vergnügen, bei jeder Festlichkeit mußte er mit seinen beiden »Käfern« vornedran sein, und wenn die »alte, dicke Giuditta« bei solchen Gelegenheiten durch ihre schwerfälligen Proportionen an die Stube gefesselt blieb, so entschädigte sie sich dafür mit der Befriedigung einer durch ihre Ausdauer geradezu bestaunenswerten Gefräßigkeit. Vom Morgen bis in die Nacht stand ein Korb mit Backwerk und Leckereien auf Madamas Tisch, und ihre Mittagstafel drückten die ausgesuchtesten Speisen und die feinsten Weine. Da bei einer solchen Lebensweise der Familie überdies noch Signor Leone nur jenen Verdienst liebte, der ihm Geld ohne Mühe einbrachte, so mochte die Geldklemme, in der er sich immer und ewig befand, ganz natürlich erscheinen.
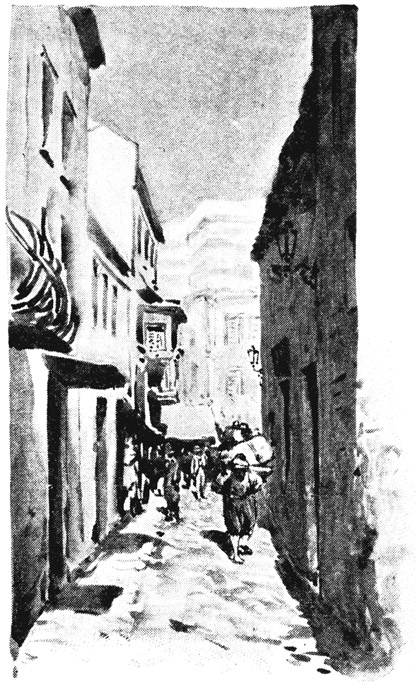
Wenn nun auch in solchen Fällen Ottavios Reichtum immer noch die Hilfsquelle blieb, so war Leone doch klug genug, sich selten mehr direkt an seinen Bruder zu wenden, sondern immer durch eines seiner Mädchen Rachele um ihre Fürbitte ansprechen zu lassen, was denn auch zumeist vom besten Erfolge war.
So lagen in der Familie Scarpa die Verhältnisse zu jener Zeit, da ich als Mietsmann unter Signor Leones Dach einzog. Daß auch meine Gutmütigkeit, nachdem ich mich nur erst ein bißchen eingewohnt hatte, von diesem immer geldbedürftigen Herrn auf manche harte Probe gestellt wurde, magst du dir denken. Anfangs ließ ich mir das, soweit es meine Verhältnisse gestatteten, auch gefallen. Als aber diese Pumpversuche immer häufiger wurden und immer gefährlichere Dimensionen annahmen, wurde ich doch etwas zurückhaltender, umsomehr, als ich durch Paraskeva erfahren hatte, daß mein Vorgänger in der Miete, jener »feine Herr Graf«, den mir Signor Leone vor jeder neuen Anleihe als das Muster eines gefälligen Gentlemans zu rühmen pflegte, nach einer unvorsichtigen Liebesaffaire mit der älteren Tochter von dem nachsichtigen Vater in des Wortes verwegenster Bedeutung zum Hause hinaus gepumpt worden war. Ich suchte also zwischen Geben und Versagen in einer Weise die Mitte zu halten, die mir meinen sauberen Hausherrn nicht direkt zum Widersacher machen konnte – und wenn auch hiebei noch mein Etat erheblich belastet wurde – du mein Gott – was hätt ich am Ende für die Gunst, in Racheles Nähe atmen zu dürfen, nicht alles hingenommen oder hingegeben.
Freilich hatte ich in der ersten Zeit wenig Gelegenheit, Rachele zu sehen; späterhin aber verging kein Tag, ohne daß ich lange Stunden an ihrer Seite verbrachte. Und Signor Ottavio war es selbst, der diesen häufigen Verkehr vermittelte. Ich habe gewiß niemals das Geringste gethan, um diesen Mann mir freundlich zu stimmen, da ich ihn ja um meiner Liebe willen hassen mußte, und dennoch faßte er für mich eine Art von Freundschaft, die man eigentlich eine innige Zuneigung nennen durfte. Auf der Börse, am Hafen, oder wo uns sonst der Zufall in den ersten Tagen zusammenführte, rief er mir stets mit seiner mächtigen Stimme über alle Leute hinweg einen fröhlichen Gruß zu, schlang dann meinen Arm in den seinen und gab mir lachend und plaudernd das Geleit auf meinen Spaziergängen und Pflichtwegen. Ich glaube kaum, daß ich meine damalige geschäftliche Mission so prompt und erfolgreich hätte ausführen können, wenn Signor Ottavio mir hiebei nicht mit Rat und That so liebenswürdig an die Hand gegangen wäre. Der ganze Dank, den er dafür von mir begehrte, war, daß ich ab und zu eine Partie Billard oder Bezique mit ihm spielen mußte.
So führte er mich wieder einmal nach Schluß der Mittagbörse in das Kaffeehaus, das wir die Zeit über fast täglich besucht hatten. Ottavio mußte auf der Börse oder sonst in seinen Geschäften Ärger gehabt haben, denn er war in einer recht unrosigen Stimmung, welche er nun den Kellner, der uns bediente, bitter fühlen ließ. Was man ihm brachte, fand er schlecht und ungenießbar; und als wir am Billard standen, spielte er ungeschickt, schalt mit lauter Stimme auf das staubige Tuch wie auf die miserablen Queues – und da ihn am Ende nach verlorener Partie der Kellner noch mit unvorsichtiger Unverschämtheit in der Rechnung übernahm, stieg ihm der Zorn dunkelrot ins Gesicht, weiß quollen seine Augen aus den Höhlen, und mit einem greulichen Fluche warf er dem Burschen eine Handvoll Geld an den Kopf. Ich fürchtete noch weitere Thätlichkeiten und sprang zwischen die beiden – da aber stützte sich Ottavio mit zitternden Armen auf die Brüstung des Billards, und mit erblaßten Lippen und heiserer Stimme rief er nach Wasser. Ich selbst holte ihm das Verlangte herbei, und als er das Glas mit langen gierigen Zügen geleert hatte, zog ich ihn am Arme mit mir fort, da auch schon die Gäste des Lokales anfingen, mit lauten Worten gegen ihn Partei zu nehmen.
Auf der Straße angelangt, lehnte sich Ottavio gegen die Mauer, und schweratmend trocknete er sich mit dem Taschentuche das Gesicht.
»Ich soll mich nicht ärgern! Ich soll mich nicht aufregen!« stieß er zwischen den schmalen Lippen hervor. »Der Doktor sagt's immer … und meine Natur erleidet's auch nicht. Da mein' ich immer, das Blut sprengt mir den Schädel, und im Halse würgt's und drückt's mich … aber nun hab ich es satt!« Er setzte den Hut zurecht und schlug, in meinen Arm sich hängend, die Richtung nach seinem Hause ein. »Ich bin ein Dummkopf, daß ich mich immerzu noch schinde und plage. Als ob ich nicht längst genug hätte, um ohne Ärger und Sorgen ein behagliches Leben zu führen. Jetzt aber sei's geschworen … prügeln will ich mich lassen, wenn ich zeitlebens noch um einen halben Piaster Geschäfte mache. Wo ich noch beteiligt bin, da wird abgewickelt … und dann fertig!«
Er erzählte mir nun auch von der ersten Veranlassung seines heutigen Ärgers. Bei einem großen Lieferungsgeschäfte hatte ihn ein Zwischenhändler im Stich gelassen, und nun konnte er den festgesetzten Termin nicht einhalten und verlor durch die Konventionalstrafe den ganzen Nutzen seiner Mühe.
»Und wenn ich mich über solch eine Geschichte ärgere,« sagte er, »so weiß ich anfangs meinen Unmut wohl so halb und halb niederzuzwingen. In mir drinnen wurmt es aber fort, bis es schließlich bei der unschuldigsten Gelegenheit und am unpassendsten Orte herauskommt. Ich hab mir aber immer schon gedacht, weshalb wir denn eigentlich ins Kaffeehaus laufen müssen, um unsere Partie zu spielen. Wir können das bei mir zu Hause viel behaglicher und gemütlicher haben, wenn wir uns auf die Karten beschränken wollen … und wenn nicht, so laß ich mir eben ein Billard ins Haus stellen. Platz dafür hab ich. Rachele wird sich freuen, wenn sie nicht immer alleine sitzen muß. Und daß wir gleich den Anfang machen … kommen Sie mit herauf zu Tisch und stärken Sie sich auf den Schreck hin, den Sie da mit mir gehabt haben.«
Von diesem Tag an war ich allabendlicher Gast in Ottavio Scarpas Haus. Er hatte in der That eines seiner Gemächer zu einem Billardzimmer umgewandelt – und wenn ich zur festgesetzten Stunde die Dschambassokak einhergewandert kam, lag er immer schon breit im Fenster und schalt dann, bis mir unten die Thüre geöffnet wurde, mit lachenden Worten über mein langes Ausbleiben zu mir hernieder. Droben erwartete er mich im Vorzimmer und zog mich plaudernd zum Billard, kaum daß er mir Zeit ließ, Rachele zu begrüßen und mit einem Worte nach ihrem Befinden zu fragen. Da spielten wir nun eine Partie um die andere, bis Rachele, welche während des Spieles das Zimmer niemals betrat, die Thüre öffnete und uns zum Abendimbiß rief. Mit Ausnahme weniger Abende, an denen die Witterung es verbot, war der Tisch auf der steinernen Veranda gedeckt, die sich an der Rückseite des Hauses vom ersten Stockwerk in den herrlichen, leicht bergabwärts fallenden Garten hinausbaute. Es war das ein Plätzchen zum Entzücken! Von der Wand aus und vorne von schlanken Holzsäulen getragen, waren zum Schutze gegen die Sonne buntfarbige Teppiche gespannt. Das ganze Geländer der Veranda war durchflochten und überwuchert von blühenden Rosengewinden, die sich an den Teppichpfeilern emporrankten, ohne deshalb die unbeschreibliche, goldflimmernde Fernsicht zu schädigen. Wenn die Sonne sank und vom blauschillernden Meer einher der laue Abendwind gezogen kam, erfüllt mit süßen, betäubenden Düften, dann rauschten die dunklen Bäume ein so seltsames Lied, und gleich farbigen Wolken wogten die Teppiche zu unseren Häupten.
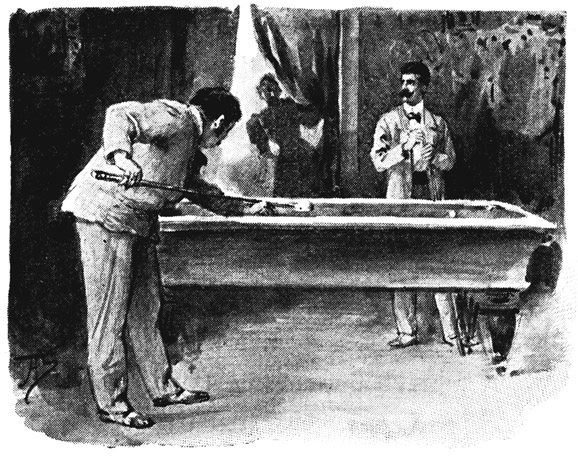
Da saßen wir nun immer – Ottavio, Rachele, die kleine Susetta und ich armer, liebeskranker Bursche – bis spät in die Nacht hinein; und daß der Zauber einer Natur, wie sie uns hier umgab, auf mein Herz, meine Sinne und mein Empfinden nicht besänftigend und beruhigend wirkte, das magst du dir denken. Mitten im gleichgültigsten Geplauder war mir oft zu Mut, als müsse ich jählings aufspringen und unbekümmert um alle Folgen das schöne, geliebte Weib in meine Arme reißen. Aber zwischen all dies Sehnen und Begehren mischten sich wieder die quälendsten Selbstvorwürfe – und ich gab mir die schlimmsten Namen, daß ich es über mich vermochte, einem Manne, der mir nur Freundschaft und Wohlwollen erwies, an der Seite zu sitzen, im Herzen das brennende und sündhafte Verlangen nach seinem Weibe. Wenn solche Gedanken mich überkamen, litt es mich nicht mehr im Kreise dieser Menschen, und da nahm ich oft so raschen Abschied, daß Ottavio mich verwundert und kopfschüttelnd anblickte. Lange Stunden durchwanderte ich dann noch in der lauen Sommernacht die Straßen Peras und versuchte meinem Herzen Entsagung und Ruhe einzupredigen. Ich weiß nicht, ob ich mir damals schon eingestanden habe, inwieweit zu solchen Ernüchterungsversuchen auch der Umstand Veranlassung gab, daß ich nach Racheles Benehmen meine Liebe als eine völlig hoffnungslose betrachten mußte.
Sie war in ihrer Art und Weise stets dieselbe, die immer gleich fröhliche und freundliche Wirtin. Mich schien sie zu schätzen und zu achten, wie eine Frau eben den Freund ihres Mannes schätzt, und wenn sich ihr Empfinden für mich vielleicht noch um ein Weniges darüber erhob, so hielt ich dieses Mehr nur für jenes unbestimmte Gefühl, das wir gewöhnlich einem uns sonst fernestehenden Menschen zu widmen pflegen, dem ein zufälliger Dienst uns verbindlich machte. Ich weiß mich auch nicht zu erinnern, daß Rachele, wenn ich mich in später Stunde verabschiedete, nur ein einzigesmal mit einem einzigen Worte an das Wiederkommen gemahnt hätte, während mir's Ottavio jedesmal mit hundert Worten auf die Seele band, anderen Tages eher früher als später zu erscheinen.
Manchmal nur, wenn wir so zusammensaßen und ich bei Ottavios Geplauder achtlos seiner Worte und ganz beschäftigt mit meinem Herzen vor mich niederstarrte, um dann jählings aus meinen Träumen aufzufahren, sah ich Racheles dunkle Augen mit einem seltsam forschenden Ausdruck auf mich gerichtet – und wenn sich da unsere Blicke trafen, umspielte ein feines Lächeln ihre Lippen, während sie mich nach irgend etwas fragte, das gerade im Bereich des Gespräches lag. Stets aber trieb mir dieses Lächeln das Blut in die Wangen. Man hört oft sagen, daß Frauen mit scharfem und hellsehendem Blick in ein Herz zu schauen vermögen, das ihnen zugehört – und das mußte ich immer denken, wenn ich auf Racheles Lippen dieses Lächeln sah, aus dem ich zu gleichen Theilen Mitleid und Spott zu lesen vermeinte. Diese Vermutung machte mich unsicher und befangen, und um in solcher Stimmung Racheles forschendem Blick zu entgehen, schlug ich Ottavio eine Partie Bezique vor, oder ich sprang mit der kleinen Susetta, die Abend für Abend an meiner Seite und oft lange Stunden auf meinen Knieen saß, in den Garten hinunter, wo ich mich dann mit dem Kinde wie ein Knabe zwischen den Büschen und Bäumen umhertollte. Dabei geschah es wohl auch, daß Susetta, wenn sie mich nicht haschen konnte, ihre »süße Mamma« zu Hilfe rief – und Rachele, den Ruf der Kleinen mit einem Schmeichelwort erwidernd, eilte über die Stufen der Veranda nieder und verfolgte mich auf den weißbesandeten Wegen des Gartens, während das Kind jubelnd und jauchzend vor Freude in die Hände klatschte. Droben aber lehnte sich Ottavio über das Geländer, bald Rachele mit fröhlichen Worten zu raschem Laufe anfeuernd, bald mir wieder zurufend, ich solle mich nicht allzuleicht fangen lassen. Da wurde, was erst dem Kinde zulieb begonnen war, uns selbst zum ergötzlichen Spiel – und ich nahm nun wirklich all meine Gewandtheit zusammen, um den hurtigen Füßchen Racheles zu entrinnen, die mit klingendem Lachen und flatterndem Gewand über den weichen Pfad dahinflog, oft mitten durch die Blumen ihren Weg kürzend, bis es ihr endlich gelang, mit leichtem Schlag meine Schulter zu erreichen. Wenn wir dann mit geröteten Wangen und pochendem Herzen, das Kind in unserer Mitte führend, zur Veranda emporgestiegen kamen, rückte uns Ottavio die Stühle zurecht oder holte jedem von uns einen Fächer herbei, während Susetta mir in kindlichem Stolze vorhielt, um wie viel besser ihre süße Mamma laufen könne als ihr ungeschickter zio Guglielmo.
Aber seltsam – gerade nach solch fröhlichen Stunden konnte ich manchmal gewahren, daß Rachele mitten im muntersten Geplauder verstummte, ernst wurde und sinnend in sich versank. Wenn ich in solchen Augenblicken irgend eine Frage an sie richtete, ob sie sich ermüdet fühle, oder ob ihr die allzurasche Bewegung nachträgliches Unbehagen verursache – was konnte und durfte ich anderes fragen? – so schüttelte sie unwillig den Kopf und starrte mit umflorten Augen in die abenddunkle Ferne.
Du magst es immerhin Eitelkeit heißen, ich aber nenn' es Sehnsucht und Liebeshoffnung, was solch einem Gebahren gegenüber in mir die Vermutung wachrief, ob nicht am Ende dennoch meine Person die Ursache dieses jähen Wechsels in Racheles Stimmung wäre. Und wie mein Herz nun erst an diesem Gedanken hing, da kam ihm auch immer meine Erinnerung mit alledem zu Hilfe, was mein heißes Wünschen und Begehren zu Gunsten meiner Liebe deuten mochte. Ich dachte wieder jenes flüchtigen Kusses, den Rachele auf meinen verwundeten Arm gedrückt; ich sann dem Umstande nach, daß sie nie mehr mit einem Worte jenes Abenteuers Erwähnung that, das uns zusammengeführt hatte; ich griff an meine Brust, wo ich verborgen jene Kette trug, die sie mir ohne Wissen ihres Mannes gesandt, und die ich nur in einsamer Nacht vom Halse löste, um das Bild des geliebten Weibes zu küssen – – und wenn dann Racheles gute, fröhliche Laune ebenso plötzlich, wie sie geschwunden, wiederkehrte, wenn sie mir in munterer scherzbelebter Rede von ihrer Vaterstadt Florenz und ihrem ganzen schönen Heimatlande plauderte, dann hing ich mit so heißen Blicken an ihrem schönen Gesicht und sog ihr die Worte vom Munde, das Glück ihrer Nähe mit vollem Herzen genießend, bis ich in später Stunde heimwärts wanderte, verliebter denn je – um mich anderen Tages durch Racheles Ruhe und Sicherheit wieder enttäuscht und ernüchtert zu fühlen. Da kamen dann wieder die Stunden jener Zweifel und Selbstvorwürfe; da wollte ich wieder kämpfen und mich bezwingen; da setzte ich wieder meine Hoffnung auf die alles mildernde, alles heilende Zeit – und einmal sogar nahm ich mir auf dem Heimwege das heiligste Versprechen ab, Ottavios Haus nicht wieder zu betreten. Als ich aber andern Tags, eingedenk dieses Versprechens, in meiner Stube saß, kaum eine Stunde nach der Zeit, zu der ich allabendlich dem liebgewordenen Hause entgegenzuwandern pflegte, trat Ottavio bei mir ein. Seine Frage, ob ich denn krank wäre, konnte ich doch wohl nicht mit einem Ja beantworten, und so schob ich die Schuld des Versäumnisses auf dringende Korrespondenzen, deren Erledigung mich solange aufgehalten hätten. Lachend stülpte mir Ottavio den Hut aufs Haupt, und während er mich zur Thüre hinausschob, plauderte er mir vor, wie er, da ich doch sonst so pünktlich wäre und als höflicher junger Mann eine Abhaltung sicherlich mit ein paar Zeilen gemeldet haben würde, bei all dem vergeblichen Passen am Fenster schon das Schlimmste für mich gefürchtet hätte.

Aber ich merke, daß ich die eigentliche Geschichte, oder besser gesagt, den Bericht ihres korrekten Verlaufes recht sehr vernachlässige und allzuviel von Dingen, Umständen und Empfindungen rede, von denen ich nicht weiß, inwieweit sie dein Interesse erwecken. Doch mußt du mir das zugute halten – mein Herz ist zu bewegt, und die Erinnerung, nun einmal lebendig geworden, stürmt so mächtig auf mich ein, daß ich diese ganze vergangene Wahrheit noch einmal zu durchleben meine. Und wer noch allzu subjektiv in einer Geschichte steckt, wird immer ein schlechter Erzähler sein – das mußt du ja selbst am besten wissen.
Wo knüpf' ich nur wieder an? Ja – es war ungefähr in der dritten Woche nach jenem Vorfall im Kaffeehaus, als Signor Leone zu ungewöhnlich früher Morgenstunde in mein Schlafzimmer trat. Ich stand gerade vor dem Waschtisch und hatte im ersten Augenblicke nichts Eiligeres zu thun, als mit dem Handtuch meinen Hals zu decken, um Racheles Kette den Blicken Leones zu entziehen. Er mußte sie aber doch wohl gewahrt haben, denn ein breites Lächeln überzog seine dicken Lippen; vielleicht schien ihm nur diese Beobachtung dem gegenüber, was er auf dem Herzen hatte, allzu unwichtig, da er kein einziges Wort hierüber verlor.
»Na, also, haben Sie schon gehört, was mein schöner Herr Bruder für Geschichten macht!« stieß er mit grobem Unmut hervor. »Ich hab es ja immer gesagt, daß bei ihm unter den Haaren etwas nicht in Richtigkeit ist! Da haben wir jetzt den Beweis! Der Mensch ist reif für Kuratel und Irrenhaus.«
Mir waren an Signor Leone derartige Auslassungen brüderlicher Gesinnung nichts Neues, denn ich bekam sie meistens zu hören, wenn ihm ein Pumpversuch bei Ottavio nicht völlig nach Wunsch geraten war.
»Ich bin zwar ungemein neugierig, wodurch sich Ihr Bruder schon wieder in so vernunftwidriger Weise versündigt hat,« erwiderte ich, während ich Leone durch die Thür in das Wohnzimmer hinausdrängte, aber so neugierig bin ich trotz alledem nicht, daß ich mich auf die Kenntnis dieser neuen Sünde nicht wenigstens gedulden könnte, bis ich völlig angekleidet bin.«
»Ich glaube gar, es geniert Sie, daß ich Sie in solcher Verfassung getroffen habe? Hören Sie, ich werde Sie nächstens engagieren, meinen beiden Mädels Unterricht in der Schamhaftigkeit zu ertheilen.«
»Wenigstens könnten ihn alle beide recht gut brauchen,« brummte ich vor mich hin, während Signor Leone mit seinem wiehernden Lachen draußen auf und nieder schritt.
Eine Minute später trat ich unter die Thüre.
»Nun?«
»Nun … ja, nun! Nun hat es dieser Mensch mit seiner Verrücktheit so weit gebracht, daß die ganze Familie darunter zu leiden haben wird!« schrie mich Leone an. »Unglaublich! Denken Sie sich nur … die letzten Tage her hab ich da und dort erfahren, daß Ottavio all seine Geschäfte abwickle, sich aus all seinen Betheiligungen loslöse … kurz, daß es den Anschein habe, als ob er sich auf die faule Haut legen wolle. Was sagen Sie dazu? Aber ich weiß, ein arbeitsscheuer Faulpelz ist er von jeher gewesen, und wenn sich ihm das Glück in einer unbegreiflichen Laune nicht auf den Kopf gesetzt und ihm das Gold mit allen zwei Händen in die offenen Taschen gestopft hätte … der Mensch wäre verlungert und verhungert. Er aus sich selbst heraus hätt es seiner Lebtage zu nichts gebracht! O, nur ein paar Jahre wenn ich bei meinem Verstande dieses schuftige Glück gehabt hätte, dann könnt ich jetzt fragen: Was kostet die Welt? Ich kaufe sie! Daß aber ein Mensch, der schon einmal im Glück sitzt, die Dummheit so weit treiben kann, vor dem Goldregen die Taschen zu vernähen, das ist denn doch ein wenig zu stark, und es wird, um von mir gar nicht zu reden, schon ein ganz gewöhnlicher Menschenverstand so etwas nicht für glaubhaft halten wollen.«
»Ich weiß zwar nicht, ob Sie meinen Verstand über oder unter der menschengewöhnlichen Größe einschätzen,« erwiderte ich, »aber ich könnte … abgesehen von meiner Ansicht, daß Sie die Charakteristik Ihres Bruders recht unbrüderlich schwarz malen … wohl noch begreifen, daß sich ein Geschäftsmann nach einer an Ärger und Aufregung reichen Reihe von Jahren der Ruhe und dem sorgenfreien Genüsse seines Erworbenen entgegensehnt.«
Ein höhnisches Lachen schütterte von Leones Lippen. »Sie wollen mich doch wohl nicht meinen Bruder kennen lehren! Hahaha! Sehnsucht nach Ruhe? Der? Sehnsucht nach der Faullenzerei, sagen Sie! Dann treffen Sie halbwegs das Richtige! Und wenn Sie noch einen Hauptgrund dazu wissen wollen …« dabei schlug mein edler Hausherr mit einem greulichen Fluche die Faust auf den Tisch, »er hat seine Geschäfte aufgegeben, um mir sagen zu können, daß er nichts mehr verdiene, um einen Vorwand zu haben, seinen nächsten Verwandten vorzuenthalten, was er ihnen von rechtswegen schuldet … in dreifacher Verpflichtung: als Bruder, Schwager und Onkel!«

Ich hatte nur ein stummes Lächeln für die seltsame Logik dieses Egoisten.
»Wie! Sie glauben mir nicht, daß er so ist, mein Herr Bruder?« schrie Leone, der mein Lächeln wohl als ein Zeichen der Ungläubigkeit für seine Anschuldigungen aufgefaßt haben mußte. »Seien Sie versichert, ich bin kein grünes Bürschlein, das so in den Tag hineinredet, ohne zu wissen, was! Ich kann Belege bringen, Belege! Ich habe mich überzeugt, Signore, überzeugt! Oh, ich bin nicht der Mensch, der irgendjemanden auf das bloße Gerede der Leute hin einen Schuft nennt, und wenn das auch nur mein Bruder wäre! Wie man mir da und dort so gesagt hat: du, der Ottavio wickelt seine Geschäfte ab, er zieht sich von allem zurück, er nimmt keine Aufträge mehr an … da hab ich mir gedacht: Laß die Leute reden, geh hin und überzeuge dich selbst! Ich hab ihn ohnedies letzter Tage aufsuchen wollen, um ein gemeinschaftliches Unternehmen mit ihm zu verabreden. Und nun denken Sie sich: Ich komme hin – Guten Tag, Ottavio! sag ich – Guten Tag, Leone! sagt er, – du, Ottavio, sag ich, ich habe da Wind von einem Geschäfte bekommen, bei dem mit fünfhundert Piaster soviel Tausende zu verdienen sind; was meinst du, wenn wir die Sache miteinander in die Hand nehmen möchten?«
»Und Ihr Bruder hat abgelehnt?« fragte ich, in meinen Worten nur mit Mühe den Spott unterdrückend, denn ich kannte die Sorte von »Geschäften«, die Signor Leone auch mir zeitweise vorzuschlagen pflegte.
»Abgelehnt? Wenn es nur das allein wäre!« polterte Leone. »Weißt du – so sagt er mir ganz ruhig ins Gesicht – ich hab es jetzt satt mit den Geschäften, ich mache nichts mehr, ich halt es für meine Pflicht gegen Weib und Kind, meine Gesundheit, die ohnedies nicht die beste ist, zu erhalten und zu kräftigen, indem ich mein schweres Blut vor jeder Aufregung schütze. Gut – sag ich – wenn du nicht mehr arbeiten willst, das ist deine Sache, obschon ich es ein wenig leichtsinnig finde, daß du einen so sicheren und mühelosen Gewinn, wie ich ihn dir vorschlagen möchte, so kurzweg auf die Straße wirfst. Das thu ich auch nicht – sagte er – ich gönne eben dir allein den ganzen Nutzen.«
»Nun, ich finde das nur sehr brüderlich und uneigennützig gehandelt.«
»Warten Sie nur, warten Sie nur! Sie als Kaufmann wissen ja selbst auch, daß oft der bestsituierte Geschäftsmann das bare Geld nicht immer in der Schublade liegen hat. Und ich gerade bin ganz besonders darauf aus, daß ich keinen Piaster unverzinst und nutzlos schimmeln lasse … da und dort, in hundert Geschäften und Geschäftchen habe ich mein Geld stecken – – Sie lachen? Würden Sie nur Ihre übrigen Summen nach meinen Ideen plazieren, dann sollten Sie einmal sehen, wie Ihnen der Gewinn zufliegt! Aber natürlich, wenn man so wie ich bei allem und jedem betheiligt ist, kann es leicht vorkommen, daß man eine Gelegenheit zum schönsten und sichersten Verdienst verpassen muß, weil man gerade kein Bares in der Hand hat. Und der Teufel auch, so geht‹s mir gerade jetzt bei der Geschichte, die ich dem Ottavio in Vorschlag hab bringen wollen.«
»Schade!«
»Nicht wahr? Jammerschade! Ich allein soll den ganzen Gewinn einstreichen, sagt er! Ja – wo aber soll ich im Augenblick die fünfhundert Piaster hernehmen? Du – so sag ich also zu ihm – so und so steht‹s momentan mit meiner Kasse, sei darum so gut und hilf mir mit dem Bettel aus, natürlich nur für ein paar Tage. Und was, glauben Sie, hat dieser Mensch die Keckheit, mir zu antworten?«
»Ich habe da gar keine Meinung.«
»Er bedaure … er mache keine Geschäfte mehr, müsse also das Seinige zusammenhalten … er könne mir nichts mehr geben … ich müsse mich eben einschränken … oder arbeiten – – Hören Sie! – ich – arbeiten – sagt mir dieser Mensch, der vor Faulheit – –« Leone brach in ein Gelächter aus, das weniger dem Lachen eines Menschen als dem zornigen Brüllen eines Stieres vergleichbar war. Und als er nach Husten und Prusten seiner Stimme wieder mächtig wurde, flutete es in kreischenden Worten von seinem geifernden Munde: »Ja, so handelt er an mir, dieser Knicker, dieser Schubiak! Ist das brüderlich, ist das gerecht? Wer hat mich in La Valetta sitzen lassen, allein in diesem strapaziösen, aufregenden Geschäft? Dieser Taugenichts! dieser Streuner! Wer hat mich mit Weib und Kind hiehergelockt in dieses Hundenest, wo ein ehrlicher, rechtschaffener Mensch Brot fressen muß und Wasser saufen? Dieser Schwindler! Dieser Galgenvogel!«
»Nun wird es mir aber zu bunt!« schrie ich den Krakehler an.
»Mir auch! Mir wird es auch zu bunt! Schon lang ist mir‹s zu bunt geworden!« überbrüllte mich Leone. »Not, Jammer, Sorgen, Elend. Kummer, alles Schlechte in der Welt hat dieser Halunke mir an den Hals gehetzt! Aber ich weiß schon, wer die saubere Ursache ist! Diese hergelaufene Person! Diese Landstreicherin, die er in Saloniki von der Straße aufgegabelt hat, und die mir und meinen armen Würmern wegstiehlt, was uns von rechtswegen hätte zukommen sollen!«
»Kein Wort mehr!« schrie ich in ausbrechendem Zorn.
Verdutzt und eingeschüchtert durch diese unerwartete Unterbrechung schaute mir Leone ins Gesicht, aus dem, wie ich fühlte, alles Blut gewichen sein mußte.
Mit Gewalt zwang ich mich zur Mäßigung und zu ruhigem Ton. »Signor Leone! Abgesehen davon, daß ich nicht begreife, wie ich zu der zweifelhaften Ehre komme, Ihren Vertrauten wider Willen spielen zu müssen, möcht ich Ihnen nur eines bemerken. Ich verkehre fast täglich im Hause Ihres Bruders … Ihr Bruder hat sich mir gegenüber immer nur liebenswürdig und zuvorkommend erwiesen, was Ihnen durchaus kein Geheimnis geblieben ist … und so finde ich es gelinde gesagt seltsam, fast eine Geringschätzung meiner Person beweisend, daß Sie es über sich vermögen, zu mir in einer solchen Art von Ihrem Bruder zu sprechen.«
»Hab ich etwa nicht alle Ursache dazu?« fuhr Leone mir ins Wort, mit Ton und Miene den Gekränkten spielend.
»Ich habe weder Lust noch Veranlassung, mich mit Ihnen über die Berechtigung solcher Vorwürfe in einen Streit einzulassen – obschon ich glaube, daß er zu Ihren Ungunsten entschieden werden müßte. Ich rate Ihnen nur ein für allemal, eine derartige Sprache über Signor Ottavio in meiner Gegenwart zu unterlassen!«
Leone verzog die Mundwinkel und zuckte, mit langen Schritten im Zimmer auf und niederschreitend, die Achseln.
»Gut! Ah, gut! Wenn Ihnen ein so besonderer Gefallen damit geschieht, kann ich ja in Zukunft meine Meinung für mich behalten. Übrigens …« dabei blieb er vor mir stehen und kramte in seinen Rocktaschen, »übrigens bin ich auch gar nicht hergekommen, um Ihnen meine Ansichten über Ottavio zum besten zu geben … es ist mir eben nur so die Galle übergelaufen … ich wollte Ihnen nur den Brief da bringen.« Er reichte mir ein Couvert, das nach seinem Zustande den Verdacht in mir aufsteigen ließ, als ob es schon einmal geöffnet und wieder verschlossen worden wäre. »Das Ding ist gestern am Abend gekommen und durch die Unachtsamkeit meiner Leute droben liegen geblieben. Entschuldigen Sie!«
»Bitte!«
Leone nickte einen stummen Gruß und ging zur Thüre. Die Klinke in der Hand, blieb er stehen und schaute ein paar Sekunden, wie sich besinnend, zu Boden. Dann hob er den Kopf, lächelte und rief mir in gemütlichem Plaudertone zu:
»Was meinen Sie, wenn wir beide zusammen das Geschäft machen möchten, das ich dem Ottavio in Vorschlag hab bringen wollen?«
»Ich bedaure, von meinen eigenen Angelegenheiten allzusehr in Anspruch genommen zu sein, um noch für Nebengeschäfte Kopf und Sinn zu haben.«
»Schade … schade!« knurrte Signor Leone, drückte die Thüre wieder ins Schloß und kam, die Hände in den Hosentaschen, mit breiten Schritten auf mich zugewandert. »Aber ich hoffe, daß Sie dann doch in anderer Weise Einsicht haben! Gönnen Sie wenigstens mir diesen Verdienst! Borgen Sie mir die lumpigen fünfhundert Piaster! Sie wissen, ich bin Ihr Freund …«
»Ihre Freundschaft in Ehren … leider bin ich aber nicht in der Lage, über eine solche Summe verfügen, oder besser gesagt, sie entbehren zu können. Jedoch …« ich wußte aus Erfahrung, daß ich ungerupft den sauberen Herrn nicht los wurde, ergab mich also freiwillig in eine halbwegs erträgliche Notwendigkeit, »wenn Ihnen mit zwanzig Piaster gedient ist, stell ich dieselben gerne zu Ihrer Verfügung.«
Ich kannte meinen Mann, zog also bei dieser Frage bereits die Börse aus der Tasche.
»Na, sagen wir wenigstens fünfzig.«
»Bedaure!«
»Meinetwegen also … geben Sie her, Sie armer Schlucker!« Lachend hielt er mir die offene Hand entgegen. »Ich muß eben zusehen, daß ich mich mit einer kleineren Summe bei der Geschichte betheiligen kann.« Er warf die beiden Goldstücke, die ich ihm gereicht, ein paarmal spielend in die Luft und schob sie dann in die Westentasche. »Apropos … wissen Sie übrigens, daß ich Ihnen in meiner Eigenschaft als Vater zweier hübscher Mädels bitterböse sein sollte?«
»Ich wüßte aus meinem Verhalten nicht den geringsten Grund hiefür zu finden.«
»So! Keinen Grund! Sie Herzensräuber! Allen beiden haben Sie den Kopf verdreht, daß die sonst so lustigen Dinger nun den ganzen Tag im Hause umherschleichen mit einem ewigen Geseufze und mit verweinten Augen!«
»Sie scheinen zu übertreiben, verehrter Signor Leone!«
»Ich? Und übertreiben? Die pure Wahrheit sag ich! Sie Eisenherz! Aber alles, was menschlich ist – – mit einer hätten Sie doch Erbarmen haben sollen, um wenigstens die andere zu kurieren. Und weiß Gott … ich glaub, ich hätte ein Auge zugedrückt … hab ich doch selbst einen Narren an Ihnen gefressen, Sie Tausendsasa!« Bei diesen letzten Worten kniff er mich, bevor ich es hindern konnte, mit seinen dicken Fingern in die Wange und verließ mit einem wiehernden Gelächter die Stube, von der Thür aus noch einmal mit zwinkernden Augen mir zuwinkend.
Da stieg mir der Ekel vor diesem Menschen in die Kehle, und der Gedanke, mit ihm unter einem Dache wohnen zu müssen, fing an, mir unbehaglich zu werden. Fast unglaublich wollte es mir scheinen, daß in einer Natur eine solche Fülle von Charakterlosigkeit vereinigt liegen könnte, wie mir der Verlauf dieser Scene das bewiesen hatte. Das war ja ein Mensch, der gegebenen Falles einer jeden Erbärmlichkeit und jeglicher Schandthat fähig sein mochte!
Ich öffnete nun den Brief, den Signor Leone mir gebracht, und aus dessen Adresse ich beim Empfange schon die Handschrift meines Chefs erkannt hatte. Das Schreiben gedachte in anerkennenden Worten der umfassenden Auskünfte, die ich meinem Hause gesandt, und schließlich enthielt es noch die Mittheilung, daß man bis in etwa vier Wochen meiner Rückkehr entgegensehe, da meiner bereits eine neuerliche Geschäftsreise nach Paris und London warte.
Wie ein kalter Hauch durchzog es mein Herz, als ich diese Worte las. Wenn meine Liebe auch reich war an Kämpfen und Zweifeln, wie arm an Hoffnung und Trost, so war mir in meinem Sehnen und Begehren doch niemals der Gedanke aufgestiegen – wie nah er auch lag – als könnt ich einmal von Rachele Abschied nehmen müssen, um sie nie, niemals wieder zu sehen. Und wenn ich nun gehen mußte – sollte ich vor der letzten Stunde mit kühnem Wort eine Entscheidung herbeiführen, oder sollte ich die Liebe meiner Ehrenhaftigkeit gegen Ottavio hintansetzen und die Ungewißheit mit mir fort in die Welt tragen, ob ich der geliebten Frau gleichgültig geblieben, oder ob ich nicht doch das Glück meines Lebens aus ihren Händen hätte erbitten können?

Von solch widersprechenden Gedanken gefoltert, wanderte ich lange, qualvolle Stunden in meinem Zimmer auf und nieder. Böse und beseligende Bilder schossen im Geiste vor meinen Augen empor. Bald sah ich Rachele mit bleichem zürnendem Antlitz, wie sie mit stummer Gebärde mich von hinnen wies – bald fühlte ich ihre warmen, runden Arme an meinem Hals und den Schlag ihres Herzens an meiner wogenden Brust – bald sah ich mich heimwärts ziehen, einsam und liebverlassen – bald sah ich mich an Bord des rauschenden Schiffes stehen, mir zur Seite das schöne Weib, dem ich die goldene, lockende Ferne zeigte und mit seligen Worten das Glück und die Wonne pries, denen wir entgegeneilten. Dann wieder sah ich mich in Ottavios Haus und Rachele zur Flucht bereit – ich höre Susetta in einem fernen Zimmer nach ihrer süßen Mamma rufen, ich sehe die Kleine unter die offene Thüre treten, sehe ihre seltsam staunenden Augen – nun eilt sie auf Rachele zu und klammert sich mit jammerndem Geschrei an ihre Mutter – da steht Ottavio, herbeigerufen durch die Klagelaute seines Kindes, und starrt mich an mit erblaßtem Gesicht und mit einem Blick, der das Unglaubliche nicht fassen will – ich sehe – – Was soll ich dir noch schildern und sagen? Es war ein schlimmer, martervoller Tag, den ich da verlebte. Und als dann der Abend kam, als ich das liebe Haus betrat, als ich Rachele und ihrem Gatten meine Hand zum Gruße reichte, muß die Marter dieses Tages wohl in meinen Zügen gelegen haben, denn Ottavio strich mir die Haare aus der Stirne und fragte mit besorgter Stimme nach meinem Befinden.
Während wir den Thee nahmen, trieb uns ein plötzlich ausbrechendes Gewitter von der Veranda in das Speisezimmer. Doch wurde mir zwischen den vier Wänden bald zu schwül. Ich öffnete die Glasthüren – und während an unserem Tische immer und immer wieder die Rede stockte, klang von draußen her das dumpfe Rauschen des Regens und das eintönige Plätschern des vom Dache auf die Steinplatten fließenden Wassers.
Es war ein stiller, schwermütiger Abend, der uns da in langen Stunden verfloß. Wohl hatte Rachele versucht, mit ihrem Geplauder den gewohnten, fröhlichen Unterhaltungston zu erwecken, doch ohne Erfolg. Schon Ottavio war nicht in der richtigen Stimmung dazu. Er hatte die Tage her viel über Beklemmungen und Atembeschwerden geklagt, die sich ihm gerade an diesem Abende wieder recht fühlbar machten. Auch die kleine Susetta, sonst ein überaus belebendes Mitglied unserer Gesellschaft, war frühzeitig schläfrig geworden und mußte bald zu Bette gebracht werden. Und ich – wie hätte ich eines harmlosen Gespräches fähig sein sollen! In meiner Phantasie gaukelten immer noch jene Bilder auf und nieder, die mich den ganzen Tag verfolgt hatten, und dazu beunruhigten mich noch allerlei andere Sorgen und Gedanken. So sann ich im stillen darüber nach, was wohl geschehen würde, wenn Signor Leone einträte, wenn er im Laufe des Gespräches in der Art der plumpen Scherze, die man an ihm gewohnt war, von der seltsamen Entdeckung reden würde, die er des Morgens gemacht, und dabei mit den unzweideutigsten Anspielungen von der Ähnlichkeit meiner Kette mit einem ihm gar wohlbekannten Schmucke Racheles spräche? Was würde diese selbst, was würde Ottavio zu der Sache sagen? Wenn ich bei solchen Gedanken Signor Leones Stimme im Geiste reden hörte, klangen mir aber gleichzeitig im Ohr jene bösen Worte nach, mit welchen mein Hauswirt bei seinen Schmähreden über Ottavio auch Rachele verunglimpft hatte. Da ließ sich dann oft lange Minuten meine Blicke auf dem Antlitz der schönen Frau ruhen – und dachte dabei mit schwerem Herzen meiner nahen Abreise.
Gegen zehn Uhr verzog sich das Gewitter – und als ich eine halbe Stunde später auf die Veranda hinaustrat, um wegen des Heimwegs nach dem Regen zu sehen, entlockte mir das Bild, das ich zu meinen Füßen liegen sah, einen lauten Ausruf des Entzückens, der auch Rachele und Ottavio unter die Thüre rief.
Fern am östlichen, wolkenfreien Horizonte stand, kaum emporgetaucht über das Gelände, die vollleuchtende Scheibe des Mondes, scharf abgehoben vom nachtschwarzen Himmel. Die höher liegenden Wolken des eben erst vertobten Gewitters, die sich drängend und schiebend und von Sekunde zu Sekunde ihre vielgestaltigen Formen wechselnd, vor einem leichten Winde durcheinander wogten, waren übergossen von einem blendend weißen Schimmer, den nur seltene, rasch wieder schwindende und anderwärts auftauchende Schatten unterbrachen. Klar und durchsichtig war die Luft, so daß wir im fernen Skutari die Konturen der mondbeglänzten Häuser zu unterscheiden vermochten. Das Meer, das von den Küsten sich hindehnte in unermessene Weiten, warf gewiß noch mächtige Wellen, die aber durch die Entfernung für unser Auge zu kleinen Sicheln wurden – und wo solch eine Sichel emporsprang, blitzte sie uns einen flüchtigen Reflex der schimmernden Wolken entgegen, so daß dieses Bild sich ausnahm, als läge das Meer ruhig, als hüpften über seinem Spiegel Millionen und aber Millionen von Lichtern und Flämmchen in leichtem Tanze auf und nieder. Je weiter das Meer gegen Südwest sich hinausdehnte, um so enger rückten diese Reflexe aneinander, bis sie endlich in eine einzige blinkende Fläche zusammenschmolzen, die in der fernsten Ferne mit den weißen Wolken des Himmels zu einem für das Auge untrennbaren Glanze verschwamm.
Einen wenn auch verschiedenen, so doch gleich bezaubernden Anblick gewährte der Garten zu unseren Füßen. Helle Lichter und tiefschwarze Schatten flochten sich da zu einer phantastischen Mosaik ineinander. Wohin immer die Strahlen des Mondes einen Weg fanden, da ging von den tausend Regentropfen, die an den Blättern, Blumen und Gräsern hingen, ein sanftes Leuchten aus, während unter Bäumen und Büschen zahllose Glühwürmer ihren stillen Reigen durch das schattige Dunkel schlangen. Huschte von Zeit zu Zeit ein sanfter Windstoß durch die Laubkronen, so stäubte ein leichter Regen von glitzernden Perlen über die weißen Wege und hurtiger schwirrten die Leuchtkäfer durcheinander.
»Wie schön! Wie schön!« rief Rachele. »Schade nur, daß uns die Bäume die Aussicht auf die Stadt selbst verdecken. Wir könnten übrigens bis zur unteren Gartenmauer hinab gehen. Ich glaube nicht, daß die Wege allzufeucht sind.« Und schon war sie bei diesen Worten in das Zimmer zurückgeeilt, um nach wenigen Sekunden wieder zu erscheinen, Haupt und Schultern in ein dichtes Spitzentuch gehüllt.
Ich stand bereits auf der untersten Stufe der Veranda und schritt ein Stückchen in den Weg hinaus.
»Nun?« fragte Rachele.
»Der Weg ist wohl feucht, aber nicht naß. In dem feinen Kiese hält sich eben das Wasser nicht lange, es sickert rasch in den tieferen Grund.«
Leicht schürzte Rachele das Kleid und stieg über die Steintreppe zu mir nieder.
»Nimm dich nur in acht,« rief ihr Ottavio nach, »daß du mit den Armen nicht an die triefenden Äste streifst.«
»Du gehst nicht mit?« fragte Rachele hastig.
»Nein! Geht nur allein! Wegen Mondschein und schillernden Regentropfen hol' ich mir keine nassen Füße.« Lachend verschwand er in der hellerleuchteten Thür, und ich hörte das Rücken des Stuhles, auf den er sich niederließ.
Einen Augenblick schien es, als ob Rachele unschlüssig stünde, dann warf sie das Köpfchen auf, und schnellen Fußes schritt sie mir voraus den mondhellen Weg hinunter.
Die äußerste Gartenecke, die sich mit einer gemauerten Ballustrade hoch hinausbaute über den weiter bergabziehenden Grund, trug eine kleine, hölzerne Rotunde, welche, ringsum offen, einen wunderbar freien Ausblick gewährte. Hier ließ sich Rachele auf eine Bank nieder, während ich an einen der Pfosten gelehnt stand, die das flache Dach trugen. Stumm blickten wir eine Zeitlang hinunter auf die im Mondschein flimmernde Stadt und auf das glitzernde Meer, dessen Rauschen leicht vernehmlich zu uns emportönte.
»Ich weiß nicht, wie es kommt …« unterbrach ich endlich das Schweigen, »aber die Natur in ihrer höchsten Schönheit, in jener Schönheit, die sie dem Menschenauge so selten und stets nur für kurze Stunden zeigt, bringt mich nach flüchtigem Entzücken immer in eine Stimmung, die sich von Schwermut wenig unterscheidet. Und das Peinlichste an diesem Gefühl ist für mich der Umstand, daß ich mir von seiner Ursache keine Rechenschaft ablegen kann. Weshalb ergeht es mir nicht wie hundert anderen Menschen, die solch einem Bilde gegenüber nur reine, ungetrübte Freude empfinden, Freude darüber, daß unsere Erde, wenn auch nur für Stunden, so himmelschön sein kann?«

»Weil Sie es eben nicht diesen hundert anderen Leuten, unter die ich auch mich einrechne, gleichthun, die solch einem Bilde gegenüber nur an ihre Freude und ihr Gefallen denken und nicht auch daran, wie diese Schönheit so selten und vergänglich ist. Solch überkluge Nebengedanken müßten uns am Ende jeden Genuß und jedes Glück verbittern und vergällen.«
»Doch wohl nicht! Wer das wahre Glück wohlgeborgen in seinem Herzen trägt, dem vermag kein Gedanke den reinen Genuß desselben zu stören und zu trüben. Sein ganzes Denken zieht vielmehr alles Gute und Herrliche, was ihn umgiebt, in den Bereich seiner ureigenen Freudigkeit. Wer aber in seinem Innern keinen anderen Besitz empfindet, als nur die Sehnsucht nach einem solchen Glücke, wer das Glück und die Schönheit immer nur in jener Ferne schauen darf, welche weit außer dem Bereich seiner Arme liegt, muß wohl oder übel, wenn er die glückliche Schönheit an sich vorüberwandeln sieht, von dem Gedanken sich verstimmen und quälen lassen, daß er sie nur durch kurze, flüchtige Stunden mit seinen Augen verfolgen kann, mit Augen, die ja zur Qual seines Herzens bei jedem Blick ihn belehren, wie Glück und Schönheit ihm nicht entgegen, nur an ihm vorüber ziehen.«
Lauschend hatte, während ich sprach, Rachele das Haupt erhoben. Als ich schwieg, vernahm ich von ihren Lippen einen leisen Laut, als ob sie reden wollte, aber im ersten Worte sich schon wieder unterbrochen hätte. Langsam wandte sie das Gesicht dem Meere zu.
»Es müßte schön sein,« sagte sie nach kurzem Schweigen, »zu solcher Stunde in einem flinken Nachen über die leuchtenden Wogen dahinzugleiten.«
»Vielleicht beschert mir der Zufall, wenn ich zu Schiffe bin, solch eine zweite zauberhafte Nacht.«
»Zu Schiffe? Wieso?«
Ich hatte von meiner nahen Abreise sprechen wollen, und dennoch brachte ich nun das für mich so bittere Wort nicht über die Lippen. »Meine Berufsgeschäfte führen mich für einige Tage nach Saloniki,« erwiderte ich, die Wendung des Gespräches für einen Gedanken nützend, der mir seit Signor Leones Schmähreden drückend auf der Seele lag.
»Nach Saloniki? Ah … da will ich Ihnen ein paar Zeilen an meine Schwester mit auf die Reise geben. Sie werden dann für die Zeit Ihres Aufenthaltes in Saloniki bei meinem Schwager so gut versorgt sein, wie Sie es nur immer wünschen mögen.«
»Sie haben eine Schwester? In Saloniki?«
»Ja, die Frau des italienischen Konsuls.«
»Und Sie selbst sind in Saloniki bekannt?«
»Das kann ich nicht sagen … ich war nur ein einziges mal vor vier Jahren bei meiner Schwester durch drei Wochen zu Besuch. In ihrem Hause hab' ich damals auch meinen Mann kennen gelernt. Mein Schwager war geschäftlich mit ihm in Berührung gekommen, hatte ihn zu Tisch gebeten … und zwei Tage später waren wir Braut und Bräutigam.«
»Das ist eine kurze Zeit, um sich zu verlieben!« warf ich ein, wobei ich den nutzlosen Versuch machte, meine Worte in einen scherzhaften Ton zu zwingen.
»Verlieben?« Rachele erhob sich von der Bank und trat in das volle Licht des Mondes. »Ich war damals der Ansicht, daß die stille, ungetrübte Ruhe des Herzens eine weit bessere Vorbedingung für eine glückliche Ehe wäre, als diese vielgenannte Liebe … und auch heute noch bin ich dieser Meinung. Ottavio Scarpa und ich, wir lieben uns nicht – es müßte denn gegenseitige Achtung in der Ehe schon Liebe sein – und dennoch leben wir glücklich zusammen. Ich bin vollauf zufrieden mit diesem Glück und glaube mir dasselbe auch erhalten zu können, da ich mir die Kraft zutraue, die Ruhe meines Herzens zu bewahren.«
Mir schien es, als hätte ich aus der Stimme, mit welcher Rachele diese Worte gesprochen, einen seltsam herben Klang herausgehört. Oder hatte ich mich getäuscht? Hatten diese Worte eben nur für meine zweifelnde Liebeshoffnung so herb und bitter geklungen? Denn als Rachele die Brüstung der Mauer verließ, und mit langsamen Schritten den Rückweg antrat, sprach sie im harmlosesten Plaudertone weiter:
»Daß wir beide uns damals so rasch zusammengefunden haben, lag übrigens auch an Verhältnissen und Umständen. Als ich im achtzehnten Jahre stand, hatte mein Papa die Laune, mir eine um kaum drei Jahre ältere Stiefmutter zu geben, deren Liebenswürdigkeiten mir in kurzer Frist den Aufenthalt in meiner schönen Heimatstadt Florenz unleidlich machten. Eines Tages ging ich zu Hause durch und flüchtete mich zu meiner Schwester nach Saloniki. Dort führte der Zufall Ottavio Scarpa an den Tisch meines Schwagers, und wieder ein Zufall wollte, daß ich bei einem Gespräche über Männer, Frauen, Liebe und Ehe in scherzhaftem Sinne die Äußerung that: ›Alles um mich her heiratet, nur ich komme nicht unter die Haube. Ich möchte wirklich, daß bald einer käme, mich heimzuholen. Wenn er nur brav und rechtschaffen wäre und mir ein sorgenfreies Leben bieten könnte … mehr würde ich nicht verlangen. Das ist doch bescheiden?‹ Ich lachte dazu. Ottavio Scarpa, der zuvor laut und viel geredet hatte, war plötzlich still und nachdenklich geworden. Als er dann ging, verabschiedete er sich zuerst von Schwager und Schwester, dann trat er lächelnd auf mich zu und sagte: ›Signorina! Ich meine, brav und rechtschaffen zu sein, und könnte Ihnen nicht nur ein sorgenfreies Leben, sondern ein Leben in Überfluß bieten. Wollen Sie mich nehmen?‹ Ich hielt diese Worte für eine spaßhafte Fortsetzung meines eigenen Scherzes, legte deshalb lachend meine Finger in die dargereichte Hand … und dachte eine Stunde später nicht mehr an diesen lustigen Zwischenfall. Da war ich dann freilich überrascht, als mein Schwager am nächsten Morgen mit der Nachricht kam, Ottavio Scarpa hätte bei ihm allen Ernstes um mich angehalten. Ich brauchte jedoch nicht lange zu überlegen. Sollte ich in das zankerfüllte Haus meiner Stiefmutter zurückkehren? Sollte ich meiner Schwester auf unbestimmte, vielleicht lange Zeit zur Last fallen? Keins von beiden war nach meinem Geschmack. So sagte ich Ja … am Abend wurde die Verlobung in aller Form gefeiert, und als Ottavio nach Stambul zurückkehrte, hieß ich Rachele Scarpa und zog mit ihm als seine Frau in dieses Haus.«
Rachele legte aufatmend die Hand an das Geländer der Verandatreppe, die wir inzwischen erreicht hatten, und blickte zu der offenen, hell erleuchteten Thür empor. »Vier Jahre sind es her, daß ich zum erstenmale da oben stand und hinausblickte über das Meer und die Schönheit dieser Stadt … doch hab ich bis heute noch keinen Augenblick meinen raschen Entschluß von damals zu bereuen gehabt. Ottavio ist ein herzensbraver Mensch, und mein Wohlbefinden ist seine ganze Sorge.«
Rachele hatte diese letzten Worte mit halblauter Stimme vor sich hingesprochen. Nun stieg sie langsam und wie ermüdet die steinernen Stufen empor. Rasch trat ich an ihre Seite und bot ihr meinen Arm.
»Ich danke!« sagte sie kurz und legte den Rest der Treppe eiligeren Schrittes zurück; doch blieb sie oben auf der Veranda wieder stehen, um das Spitzentuch von den Haaren zu lösen.

So ging ich an ihr vorüber und betrat das Gemach. Hier fand ich Ottavio in seinem Stuhl eingeschlafen; die langgestreckten gekreuzten Beine waren auf den Rand des Divans gestützt, und die Hände, von denen die eine noch das Zeitungsblatt, die andere den erloschenen Cigarrenstummel hielt, hingen an schlaffen Armen fast bis zum Boden nieder, während der Kopf mit dem offenen, laut atmenden Munde weit über die Kante der Stuhllehne zurückgeneigt war. Bei dieser unbequemen Lage mußte ihm das Blut zu Kopf gestiegen sein, denn eine dunkle Röte bedeckte das ganze Gesicht.
Als wenige Sekunden später auch Rachele in das Zimmer trat und das Gleiche sah, ging sie auf Ottavio zu, hob ihm mit beiden Händen sacht das Haupt und rief ihm halblaut seinen Namen in das Ohr.
»Was giebt's?« fuhr der Erweckte auf, mit schlaftrunkenen Augen im Gemach umherblickend. »Ach ja … so? Ihr seid schon zurück? Das ist aber schnell gegangen!«
»Wie kannst du das beurtheilen, da du geschlafen hast?« sagte Rachele, während sie sich müd lächelnd in die Ecke des Divans fallen ließ. »Wenn ich dir erzählen möchte, welch einen herrlichen Blick wir von der Rotunde aus genossen haben, wäre es dir gewiß leid, daß du nicht mitgegangen bist.«
Ottavio gähnte und brummte ein paar unverständliche Worte.
Von Racheles Lippen klang ein spitzes Kichern. »Und du hättest nur hören sollen, zu welch klugen Reden uns die Schönheit der Natur anregte! Was wir da alles gesprochen haben … ich glaube fast, das war philosophiert … ja! Und inzwischen liegst du hier … und schläfst!«
»Es ist schmachvoll, gewiß! Aber ich kann mir nicht helfen. Ich weiß nicht, was das ist. Ich bin doch sonst kein Siebenschläfer, heut aber liegt's mir wie Blei auf den Lidern.«
»Nun, für diese Plage giebt es ein sehr einfaches Remedium,« entgegnete ich mit erzwungenem Lachen. »Legen Sie sich schlafen! Ich wollte mich ohnedies gerade verabschieden, es ist spät.«
»Sie wissen, wie gern ich Sie bei mir habe,« sagte Ottavio, »heut aber red ich Ihnen wirklich nicht zu, länger zu bleiben. Und morgen sehen wir uns ja wieder.«
»Wer weiß!« Diese beiden Worte lagen mir auf den Lippen; aber ich sprach sie nicht. Schweigend griff ich nach meinem Hut und näherte mich Rachele. Als sie mir die Hand zum Abschied reichte, fühlte ich ihre Finger kalt und regungslos zwischen den meinen liegen. Mit einem langen Blick – denn ich hatte in meinem Innern beschlossen, daß dieser Abschied ein Abschied für immer sein sollte – mit einem langen Blicke hing ich an dem schönen Gesicht des geliebten Weibes, bis Rachele mit ungeduldigem Ruck ihre Hand aus der meinen löste, während eine finstere Falte sich zwischen ihre Brauen senkte.
»Sie sind wohl auch der Meinung, daß ich Sie schon zu lange belästigt habe?« sagte ich. »Aber ich gehe ja nun!« Rasch wandte ich mich der Thüre zu, und als ich an Ottavio vorüberschritt, der bereits wieder mit geschlossenen Augen zurückgelehnt im Stuhle saß, streifte ich zu einem kurzen »Addio!« mit der Hand seine Schulter.
Draußen im Vorzimmer saß Catina in dem Rohrsessel, in welchem sie allabendlich mein Gehen erwartete, um mir in den Flur hinabzuleuchten. Sie rührte sich nicht, als ich aus der Thüre trat – sie schnarchte nur. Ich ließ ein Goldstück in die abstehende Tasche ihrer Schürze gleiten und schritt über die dicken Teppiche lautlos der finsteren Treppe zu – kannte ich dieses Haus doch so gut, um dieses letztemal auch ungeführt die Straße finden zu können.
Als ich drunten das Thor leise hinter mir ins Schloß zog, hauchte die Nachtluft kühl und erquickend über mein Antlitz. Lange Sekunden blieb ich im Schatten der Thornische stehen – mir war, als wollte mein Fuß mich nicht hinwegtragen von diesem Hause, an dem mein Herz mit tausend Banden hing. Und dennoch hatt ich es nun verlassen auf Nimmerwiederkehr! Freilich – was blieb mir noch zu wünschen und zu suchen in seinen Mauern, nun, da Rachele mit so klaren, unumwundenen Worten meiner Liebeshoffnung das Urteil gesprochen hatte: ›Ich bin zufrieden mit meinem Glücke – – vier Jahre sind es her und ich habe noch keine Sekunde bereut –‹ das klang und tönte mir immer und immer wieder im Ohr. Waren diese Worte im Zufall des Gespräches von Racheles Lippen geflossen? Hatte sie mit Willen und Absicht so gesprochen, um mir den Weg zu zeigen, den ich zu gehen hatte? Ob es nun so oder so sein mochte – für mich blieb die Wirkung immer die gleiche.
Endlich schritt ich doch in die Straße hinaus, deren kalkige Steine im steigenden Mondlicht weiß erschimmerten, und blickte am Haus empor nach den dunklen Fenstern. Da ward es licht hinter einer der Scheiben – ich unterschied es genau, es war in Ottavios Schlafzimmer – und rasch trat ich, um nicht gesehen zu werden, wieder in den Schatten der Mauer.
Mit lautem Klirren wurde über mir das Fenster geöffnet, und ich vernahm Ottavios scheltende Stimme:
»– eine Hitze hier zum ersticken! Wie oft schon hab ich Ihnen gesagt, Catina, daß ich mein Fenster mindestens eine Stunde, bevor ich schlafen gehe, geöffnet wünsche … und siebenmal in der Woche vergessen Sie das! Noch einmal, und wir sind geschiedene Leute! Nun gehen Sie! Gute Nacht! Und lassen Sie mich morgen nicht verschlafen!«
Eine Thüre wurde geschlossen – dann hörte ich Ottavios schwere Schritte in dem Zimmer auf und nieder wandern.
Mich stets im Schatten der Häuser haltend tappte ich die nachtstille, menschenleere Straße hinunter, immer wieder über die schlafenden Hunde stolpernd, die in Gruppen auf dem löcherigen Pflaster umherlagen. Als ich bei der Stelle anlangte, an welcher ich Rachele zum erstenmal gesehen hatte, lehnte ich mich an die Mauerecke und sann der Tücke des Zufalls nach, der mich gerade zu jener Stunde hieherführen mußte.
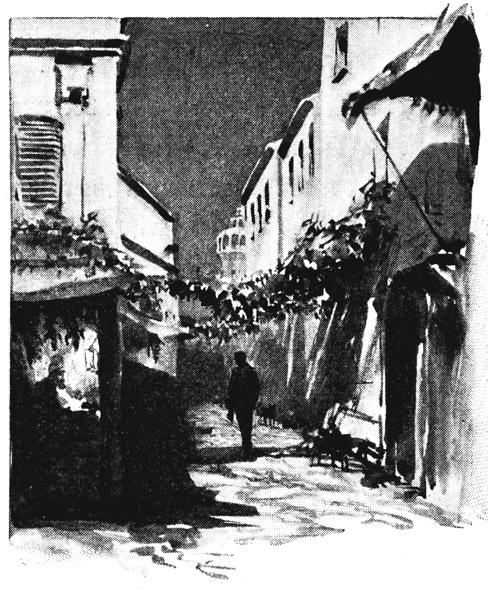
Ein lärmender Trupp junger Leute, die wohl von einem fröhlichen Gelage kamen, riß mich schließlich aus meinem Sinnen und Brüten. Um nicht etwa mit der Weinlaune dieser Überlustigen in Kollision zu geraten, stieg ich durch eine Seitengasse hinab. So wanderte ich Stunde um Stunde plan- und ziellos in den Straßen Peras umher.
Es mochte lange nach Mitternacht sein, als ich, um eine Tasse Mokka zu nehmen, in ein kleines Kaffeehaus trat, das zu meiner Verwunderung noch offen stand. Ich fand in dem rauchigen Lokal nur wenig Gäste; um einen Tisch zur Seite des Buffets saßen vier oder fünf Männer, welche schweigend in ein Hasardspiel versunken waren; in einer anderen Ecke saß ein russischer Offizier zwischen zwei gähnenden Dirnen.
Ein kleiner, kaum vierzehnjähriger Bursche, aus dessen abgelebtem Gesicht zwei kleine Augen mehr frech als pfiffig mich anschauten, brachte mir den Kaffee. Als er mir für meine Cigarette einen brennenden Spahn reichte, öffnete sich im Fond des Lokals eine Tapetenthür, und ein junger hübscher Mensch ging mit müde scheinenden Schritten quer durch das Gemach auf die zur Straße führende Thüre zu. Eine leichte Blässe lag über seinem Gesicht, aus dem die weit offenen Augen gleich zwei glühenden Kohlen hervorleuchteten.
»Der hat sich's wohl sein lassen!« flüsterte der Bursch an meiner Seite.
»Wieso?«
Der kleine Kerl blinzelte mir geheimnisvoll zu, schnalzte mit den Lippen, kniff die Augen ein und sog mit einem schnullenden Zug die Luft zwischen seine Zähne; dabei griff er in die Westentasche und zeigte mir zwischen den Fingerspitzen ein winziges, schwarzbraunes Kügelchen. »Eine Pfeife, so fein und süß, wie wir sie haben, finden Sie nirgends wieder! Nun? Was meinen Sie?«
Opium! Wie viel des Seltsamen und Verlockenden hatte ich schon von den Wirkungen dieses »süßen Giftes« gehört und gelesen! Und was konnte mir in meiner jetzigen Stimmung willkommener sein, als durch einen Nervenrausch mein Herz um seinen Kummer zu betrügen.
Ohne zu antworten, erhob ich mich und ging der Tapetenthüre zu; als ich sie öffnete und die Schwelle überschritt, fand ich mich in einem dunklen Raume, fühlte mich aber bereits an der Hand gefaßt und wurde eine Strecke weit fortgezogen.
»Bitte, hier!« hörte ich die Stimme des kleinen Kellners sagen, während vor mir eine Thüre geöffnet wurde, durch die mir aus einem mattrot erleuchteten Gemach ein schwerer, betäubender Dunst entgegenschlug.
Das Zimmer, welches ich betrat, hatte kaum drei Meter im Geviert. Von der Decke hing eine Ampel nieder, deren Licht durch rote Seidenhüllen gedämpft war; Boden und Wände waren bedeckt und behängt mit bunten Teppichen; an der rechts gelegenen Wand sah ich ein aus Ebenholz und Perlmutter gefertigtes Gestell, das ungefähr ein Dutzend größerer und kleinerer Tschibucks trug. An der linken Wand und an jener, welche der Thüre gegenüberlag, zog sich ungefähr in Tischhöhe ein tiefer, schwellender Divan durch das halbe Gemach. In der einen Ecke saß ein fein gekleideter älterer Herr mit einem gestutzten weißen Barte und sog in langen, hörbaren Zügen an seiner Pfeife, während er die Augen regungslos in den Schoß der gekreuzten Beine gesenkt hielt. In der zweiten Ecke lag ein blutjunger Mensch in tiefem Schlafe.

Während ich das Zimmer musterte, war mein junger Führer mit katzenartiger Behendigkeit über einen zweistufigen Schemel nach der freien Mittelecke des Divans emporgeklettert und hatte dort verschiedene Kissen und Rundpolster zu bequemem Gebrauche zurechtgerückt. Nun hüpfte er wieder auf den Teppich nieder, lud mich mit einer theatralischen Gebärde ein, meinen Platz zu besteigen, und huschte zur Thüre hinaus, um nach wenigen Sekunden mit einem Becher Scherbet zurückzukehren, den er auf ein kleines, neben meinem Sitze in die Wand eingelassenes Tischchen stellte. Darauf wählte er eine Pfeife, schraubte in das Rohr derselben eine frische Bernsteinspitze, füllte die enge Bohrung des Kopfes mit einem faserigen Tabake, entzündete an einer in der Zimmerecke farblos brennenden Spiritusflamme einen dünnen weißen Span und kam mit beiden Dingen auf mich zu; als ich durch ein paar Züge die Pfeife in Brand gebracht hatte, nahm er aus seiner Westentasche eines jener Kügelchen, ließ es achtsam in die Glut fallen, und mir einmal noch blinzelnd zunickend, verschwand er lautlos aus dem Gemach.
Etwas beunruhigt durch die Seltsamkeit meiner Umgebung und meines Vorhabens, saß ich nun da und wartete der Dinge, die ich vom Hörensagen als Wirkungen des Opiums kannte: das Erlöschen der Erinnerung, das Schwinden alles seelischen Schmerzes, das wonnesame Träumen von paradiesischen Gefilden, in denen alles wächst und wandelt, was ein Glück und Genuß ersehnender Mensch seinen fünf Sinnen gönnen und wünschen mag.
Es will mir aber fast scheinen, als ob alles, was ich über diesen Punkt in Romanen oder sonstigen Schriften gelesen, mehr Erfindung als Erfahrung gewesen wäre – denn was ich schließlich unter der Wirkung meiner Pfeife empfand und fühlte, war etwas ganz anderes, als ich erwartet hatte.
Während aus dem Kopf des Tschibuks ein dünner Faden brenzligen Qualmes emporstieg, hatte ich vom ersten Zug einen unangenehmen, bitteren Geschmack, unter welchem mir die Gaumendrüsen anschwollen und rauh wurden wie beim Genusse eines recht herben Weines. Bei den zwei oder drei nächsten Zügen verspürte ich zuerst ein Unbehagen, wie man es wohl nach übermäßigem Genuß von Süßigkeiten empfinden mag, dann ein Drücken über den Augen, wie von nervösem Kopfschmerz; zugleich fing's in meinen Ohren leise zu sausen an, und die Schlagader auf meinem Scheitel begann heftig zu hämmern, was sich in wenigen Sekunden zu einem Toben und Brausen verstärkte. Noch ein paar lange, krampfhafte Züge aus der Pfeife – und jene Symptome verschwommen und verschwanden mir in Empfindungslosigkeit und Apathie, wobei es mich gar seltsam dünkte, daß ich mir dieses Zustandes doch wieder völlig bewußt war. Vor meinen Augen erweiterte sich der Raum in eine unbegrenzte nebeldämmerige Ferne; meine Glieder, wie der ganze Körper, schienen auseinander zu streben und alles Gewicht zu verlieren, was ein Behagen in mir wachrief, unter dessen wohligem Bann ich immer nur den einzigen Gedanken zu denken wußte, wie dieses Behagen so behaglich wäre. Dabei war es mir, als geriete mein Leib in wiegende oder schaukelnde Bewegung, als läge ich auf einer lauen, sanft auf- und niedersteigenden Woge gebettet, in die sich meine Glieder einschmiegten wie in weiche, schwellende Kissen, – nein, dieser Vergleich paßt nicht, denn selbst das lindeste Kissen läßt immer noch eine gewisse Schwere, einen Druck des Liegens verspüren – mir aber war so leicht, ich fühlte mich so körperlos, wie von Lüften, wie nur von einem Hauche getragen und gehoben. Dieses Schweben, dieses Steigen und Sinken verstärkte und verschnellerte sich mehr und mehr, bald glich es einem Fliegen in unermeßliche Höhe, dem ein Fallen in bodenlose Tiefe folgte – und was mir anfangs ein Gefühl von unbeschreiblichem Wohlbefinden eingeflößt hatte, verursachte mir nun Angst und Beklemmung, bis ich schließlich unter Schwindel und Grauen die Besinnung verlor, oder richtiger gesagt, bis ein Augenblick kam, über welchen hinaus ich nach dem Erwachen keine Erinnerung mehr für meinen Zustand hatte.
Ich glaube von keiner falschen Voraussetzung auszugehen, wenn ich annehme, auch du wärest schon des öfteren in der unangenehmen Lage gewesen, daß dir nach einer durchschwärmten, weinseligen Nacht die mit dem Morgen beginnende Pflicht nur einen Schlaf von kurzen Stunden erlaubte. Wenn du dich da von deinem Lager erhobst, war dir das Haupt so dumpf und schwer, das Auge so heiß und müde und die Zunge so bitter vom Bodensatz des Kelches, dessen Inhalt dir doch so köstlich gemundet.
So ähnlich fühlte ich mich, nur unter noch verschärften Symptomen, als ich mich aus meiner Betäubung ermunterte. In meiner Umgebung hatte sich inzwischen nicht das Geringste verändert. Noch immer goß die Lampe ihren roten Dämmerschein durch das dunstige Gemach; in der einen Divanecke saß jener weißbärtige Herr, mit halbgeschlossenen Augen an seiner Pfeife saugend, und in der andern Ecke lag immer noch jener junge Mensch – um einen alten Fremdwörterwitz in passenden Gebrauch zu nehmen – in Morphiums Armen.
Als ich aber einige Minuten später das Kaffeelokal betrat, sah ich durch die schmutzigen Fensterscheiben bereits den hellen Tag hereinblicken.
Vor meiner Wohnung angelangt, brauchte ich den Klopfer der Thüre nicht mehr zu rühren, denn sie stand schon geöffnet. Im Flur trat mir Paraskeva entgegen.
»Guten Morgen, Kyrie!« sagte sie mit einem schelmisch sein sollenden Blinzeln und Grinsen.

»Lustig gewesen, Kyrie? Lustig? Lustig?« Nun trat sie auf mich zu und wurde geheimnisvoll. »Die droben brauchen es nicht zu wissen! Ich habe deshalb den Zimmerschlüssel abgezogen … für den Fall, daß es noch später geworden wäre. Und wenn mich die da droben gefragt hätten …« dabei zuckte sie die Schultern und nahm eine Miene an, als hätte ich diese Frage gestellt, die sie nun beantworten müßte: »Was weiß ich! Signor Guglielmo wird seine Geschäfte haben, und dann bleibt er nicht in den Federn liegen, wie gewisse andere Leute. Heut war er wieder auf den Beinen, kaum daß es Tag wurde.« Paraskeva schmunzelte und drückte mir den Rücken meiner Hand tätschelnd, den Schlüssel zwischen die Finger. »Und nun geschlafen, Kyrie! Nur fest geschlafen! Das macht die Augen wieder frisch!« Noch einmal blinzelte sie mir wohlwollend zu, dann schob sie mich mit beiden Händen gegen die Treppe.
Kaum wollte ich die schmalen, steilen Stufen emporkommen, so bleischwer lag's mir in den Knieen. Oben in meinem Zimmer nahm ich mir nur die Zeit, den Hut abzulegen – wie ich ging und stand, warf ich mich auf das Bett.
Verworren gaukelten die Erlebnisse des vergangenen Tages vor meinen müden Augen auf und nieder, aber alle Bilder, die ich sah, schwammen mir immer und immer wieder in das schöne Antlitz Racheles zusammen. Ich dachte der Worte, die sie gesprochen, ich dachte des Abschiedes, den ich genommen, und des Entschlusses, den ich in meinem Innern beschworen hatte – d. h. wenn ich sage: ich dachte, so ist das nicht der richtige Ausdruck – es war mehr ein unklares Empfinden, bei dem ich mein Denken und Sinnen nur teilweise in willkürlicher Gewalt hatte – ich befand mich wie in einem Halbtraum.
Wie lang ich so gelegen, das weiß ich nicht mehr. Ich erinnere mich nur noch, daß ich mich plötzlich aus tiefem Schlaf erwachen fühlte, als meine Uhr die vierte Stunde nach Mittag zeigte.
Ich kleidete mich um; und da ich, meine Kravatte in Ordnung zu bringen, vor den Spiegel trat, erschrak ich vor dem fahlgesichtigen und hohläugigen Bild, das mir aus dem Glas entgegenblickte.
Ohne dem lautredenden Appetit, der sich in mir regte, Gehör zu geben, setzte ich mich an den Tisch und begann einen Brief an meinen Chef: Ich hätte seine geehrte Zuschrift vom so und sovielten erhalten, würde demgemäß drei Tage post datum meines Briefes von Konstantinopel abreisen und auf einem Umweg über Venedig nach Wien zurückkehren, in der Hoffnung, daß mein Chef den im Interesse meiner angegriffenen Gesundheit mir selbst gewährten Urlaub von vierzehn Tagen nachträglich sanktionieren würde.
Ich dachte diese vierzehn Tage zu nützen, um in einem Strudel von Genuß den Versuch zu machen, ob es wirklich so schwer wäre, eines Weibes zu vergessen, das man aus ganzem Herzen und mit voller Seele liebte.
Noch war ich mit diesem Brief nicht zu Ende geraten, als ich von einer Stimme, die mich bis ins Mark durchschauerte, aus meiner Beschäftigung aufgestört wurde.
»Sind die Mädchen zu Hause?« klang diese Stimme, durch die geschlossene Thüre gedämpft, aus dem Flur zu mir herauf.
»Ei wohl, Signora!« hörte ich Paraskeva erwidern. »Oben im Speisezimmer sind sie, auch Signor Leone.«
Draußen auf der Treppe huschten leichte Schritte über die Stufen, dann vernahm ich aus dem mittleren Stockwerke Stimmengeräusch und fröhliches Lachen, eine Thüre wurde zugeschlagen – und nun hörte ich Leones schallende Stimme über die Treppe rufen:
»Signor Guglielmo! He!«
Ich trat unter die Thüre des Vorzimmers.
»Sie wünschen?«
»Ah, gut, daß Sie zu Hause sind. Kommen Sie herauf! Rachele ist da, sie hat Ihnen etwas zu sagen.«
Mit ein paar Sprüngen war ich auf der obersten Stufe. Leone, den Hut auf dem Kopf und die Hände in den Hosentaschen, stand unter der offenen Thüre des Speisezimmers.
»Hui!« sagte er lachend, während er beiseite rückte, um mich einzulassen. »Das heiß' ich ja mit Eilpost angefahren!«
Als ich das Zimmer betrat und hart an der Thüre stehen blieb, nickte mir Rachele einen stummen Gruß zu. Da sie mit dem Rücken gegen das Fenster gelehnt stand, lag ihr Gesicht in tiefem Schatten. Sie war in jenes graue Seidengewand gekleidet, das sie in der Stunde unserer ersten Begegnung getragen, das ich aber seither nie wieder an ihr gesehen hatte. Nur die goldene Kette fehlte.
»Signora wünschen?«
»Ottavio hat draußen auf dem Lande eine Abrechnung wegen alter Geschäfte; er ist früh schon hinausgefahren. Nun will ich ihn mit den beiden Mädchen abholen … und Ihnen soll ich sagen, daß Ottavio sich freuen würde, wenn Sie mit von der Partie wären.«
Während Rachele sprach, war ich langsam auf sie zugegangen. Nun that sie einen raschen Schritt mir entgegen, streifte den Schleier über die Augen empor und sah mir mit forschendem Blick ins Gesicht.
»Sind Sie krank?«
»Ich? Nein.«
»Wahrhaftig!« polterte Leone, der mir zum Fenster gefolgt war. »Sie sehen schlecht aus! Ein Gesicht haben Sie, mein Lieber, wie ein Gestorbener! Aber ich weiß schon, was ihm fehlt!« wandte er sich nun lachend an Rachele. »An dem guten Burschen zehrt der geheime Liebesgram! Ich hab ihn ertappt … gestern am Morgen … er trägt seinen Kummer an einer goldenen Kette um den Hals. Es wird ihm wohl irgend ein blondhaariges Kätzchen in seiner Heimat das sanfte Herzchen gestohlen haben, weil er sich hier zu Lande gar so brav und tugendhaft hält. Ja, ja … und da wird dann in stiller Nacht, wenn vernünftige Leute schlafen, unter Seufzern das Medaillon geöffnet und das Bild des Schätzchens abgeschmatzt bis zum Morgen … und dabei wundert man sich über blasse Wangen und blaugeränderte Augen. O du heilige Einfalt! Aber da steh ich und verschnacke meine Zeit mit dem Liebeskummer anderer Leute. Ich habe zu thun, ich kann da nicht lange herwarten, bis meine beiden Faulpelze mit ihren fünfundvierzig Schleifen und Schleifchen zustandekommen. Euch beide kann ich auch unbesorgt allein lassen … somit Gott befohlen! Und gute Unterhaltung!« Grüßend rückte er den Hut und stapfte mit schweren Tritten zur Thüre hinaus.
Rachele that einen Schritt – fast schien es, als wollte sie Leone zurückhalten – nun aber hob sie das stolze Haupt, wandte sich kurz gegen das Fenster und blickte durch die Scheiben.
Schweigend stand ich, mit pochendem Herzen und bebenden Lippen, und mit scheuen Blicken glitten meine Augen über die feine Silhouette, welche Racheles Büste in das helle Fenster zeichnete. Leicht hoben und senkten sich ihre Schultern unter langen, doch unhörbaren Atemzügen. War sie durch die Entdeckung, welche sie aus Leones Worten schöpfen mußte, überrascht, erregt worden? Ich konnte das nicht glauben. Denn was anderes hätte sie daraus erfahren können, als was sie längst schon aus meinem Gebahren, aus meinen Augen hatte lesen müssen? Oder war dies dennoch nicht der Fall? Hatte dieses Weib so sehr Gewalt über sich, oder war ihr Herz so kalt und gefühllos, daß sie die Kunde, von einem Menschen heiß und glühend geliebt zu sein, hinnehmen konnte ohne ein Wimperzucken, ohne die Miene wenigstens einer leisen Verwunderung?
So stand ich in Sinnen und Brüten, während still und bang die Sekunden verrannen.
»Signore!« brach endlich Rachele, ohne ihre Stellung zu verändern, das peinliche Schweigen. »Ich vermisse noch immer Ihre Antwort auf Ottavios Frage.«

»Ach ja … ob ich mit von der Partie sein werde? Nein. Ich bedaure, Signora, ablehnen zu müssen, und bitte Sie, mich bei Ottavio zu entschuldigen. Auch wäre ich Ihnen dankbar, wenn Sie ihm meine sonstigen Grüße überbringen möchten, für den Fall, daß ich ihn vor meiner Abreise nicht wieder sehen sollte.«
»Nein, nein! Diesen Auftrag übernehm ich nicht,« erwiderte Rachele mit raschen Worten, wobei sie mir voll das Gesicht zuwandte. »Für eine Minute, denk ich, können Sie bei uns wohl noch vorsprechen, ehe Sie reisen. Ich muß Ihnen ja doch den besprochenen Brief an meine Schwester übergeben … und auch Ottavio wird Ihnen gerne die eine und andere Empfehlung für Saloniki …«
»Saloniki? Ich reise nicht nach Saloniki.«
»Nicht? Ich meine doch, Sie sprachen gestern von Ihrer Reise dahin?«
»Ach ja … gestern! Ich weiß, ich weiß! Aber ich habe meinen Plan heute geändert … eigentlich gestern schon. Ich reise nicht nach Saloniki … ich reise fort von hier … nach meiner Heimat … für immer.«
»Für immer?«
Betroffen von dem seltsamen Ton dieser beiden Worte, suchte ich Racheles Augen – sie aber senkte die ihren und sah eine Zeitlang schweigend vor sich nieder, während sie mit der Spitze ihres Sonnenschirmes die Zeichnung des Teppichs verfolgte.
»Für immer!« wiederholte sie langsam, und mit leiser Stimme. »Das sind zwei recht unfreundliche Worte … und wenn ich sie zusammen mit Ihrem Abschiedsgruß meinem Manne sagen soll, so wird ihm das bitter leid sein. Ottavio ist Ihnen zugethan … er wird Sie lange, lange vermissen.«
»Ottavio, Ottavio, und immer Ottavio,« stieß ich, von meiner Erregung bewältigt, im Tone überquellender Bitterkeit hervor. »Immer und immer Ottavio! Weshalb denn niemals Rachele? Und wenn schon früher nicht … weshalb nicht jetzt wenigstens, da ich gehe … für immer gehe … und da doch der Grund meines Gehens Rachele heißt? Wie wär es doch für Ihre Lippen so leicht und billig, mir zu sagen: ›Wie schade, daß Sie gehen … sie waren so hübsch, diese Abende unter uns dreien … es plaudert sich ja zu dreien gemütlicher als zu zweien … und so ist es mir herzlich leid, daß Sie gehen, so unerwartet schnell gehen … aber leben Sie wohl, kommen Sie gut nach Hause u. s. w. …‹ was man eben zu scheidenden Menschen sagt, gegen die man höflich sein will. Und sehen Sie, Rachele, ich armer Bursche hätte dann mit etwas gutem Willen diese billige Höflichkeit für teuren Ernst nehmen können und durch all die schlimme Zeit, die nun für mich kommen wird, einen schwachen Trost in dem Bewußtsein finden mögen, daß auch Sie mich vermissen! Auch Sie, Rachele! Nicht nur Ottavio!«
Geneigten Hauptes hatte ich all diese Worte vor mich hingehastet. Nun machte mich ein Laut, der wie unterdrücktes Stöhnen klang, jählings aufblicken. Mit dem Rücken gegen die Mauerecke des Fensters gelehnt und mit dem Arm sich auf die Brüstung stützend, so stand Rachele, die Augen geschlossen und das Antlitz weiß wie ein Linnen. Ich erschrack, als ich das gewahrte, und es überkam mich wie Reue, daß ich einen Augenblick die Gewalt über mich verlieren, mich so sehr vergessen konnte.
»Rachele!« rief ich leis und flehend, während ich mich zögernd näherte.
Da drückte sie unter leichtem Schauer den Kopf in den Nacken; dann hoben sich langsam ihre Lider, mit einem flüchtigen Blicke kreuzte ihr Auge das meine, ein herber, trotziger Zug legte sich um ihre Lippen, und zwischen ihren Brauen schürzte sich eine finstere Falte.
»Sie sind krank, Signore, ernstlich krank,« sagte sie, »denn gerade von Ihnen will ich nicht glauben, daß Sie vor dem Weib eines Mannes, der Ihnen so von Herzen gut ist, bei gesunden Sinnen eine solche Sprache reden könnten.«
»Vorwurf hab ich verdient, Rachele, doch keinen Spott.«
»Sie verkennen meine Worte. Ich meine allen Ernstes, daß Sie sich pflegen sollten … um so mehr, da Sie in wenigen Tagen eine so weite Reise vor sich haben. Aber ich werde mich verspäten …« dabei zog sie eine kleine goldene Uhr aus dem Gürtel und warf einen Blick auf das Zifferblatt. »Es scheint, die beiden Mädchen vergessen, daß unten der Wagen wartet.«
Sie nickte einen kurzen Gruß und wandte sich zur Thüre – ich aber vertrat ihr mit raschem Schritte den Weg.
»Bleiben Sie, Rachele! Gehen Sie nicht so von mir! Sie haben doch wohl gehört … Leone hat es ja gesagt: uns beide kann man unbesorgt allein lassen. Oder fürchten Sie meine Krankheit? Ohne Sorge, Rachele … sie ist nicht ansteckend, diese Krankheit … und gewiß nicht für Sie! Wer einem genügenden Glück zulieb seine Seelenruhe, sein ganzes Fühlen und Denken so wohlbewahrt in seiner Gewalt hat … oh, ich habe diese Worte, mit denen Sie gestern all die geheime Hoffnung meines Herzens so gründlich zu vernichten wußten, nur allzugut im Gedächtnis behalten … wer, wie Sie, Rachele, sich so sicher weiß vor jeder seelischen Ruhestörung, kann sorglos zusehen, wenn einem anderen, ruhelosen Menschenkind in einem Augenblick der Erregung das ganze langverschwiegene Leid mit heißen Worten über die Lippen springt. Aber ich gebe ja zu, daß Sie Grund haben, mir um dieser Worte willen zu zürnen … und damit hab' ich auch schon gesagt, daß ich meine Sünde bereue … obwohl das eine Sünde ist, die ich wider Wunsch und Willen begangen habe. Hätte nicht Leone in dieser Stunde aus unseligem Zufall von jener Entdeckung gesprochen, die Ihnen das Geheimnis meiner Liebe verraten mußte, nie und nimmer hätten Sie eine andere Kunde hievon erfahren, als jene vielleicht, die Sie in der Zeit unseres Zusammenseins aus meinem heißen Auge lesen mußten. Ohne meiner Liebeshoffnung den Trost eines offenen und alles erklärenden Abschiedes zu gönnen, hätt ich mich losgerissen aus Ihrer süßen Nähe und wäre fortgezogen mit all der unausgesprochenen Qual auf meinem Herzen, um durch Jahre und Jahre in Liebe Ihrer zu gedenken. Nun aber ist es anders gekommen … ich habe gesprochen, was ich nicht hätte sprechen sollen … doch bei allem, was ich gekämpft und gelitten! Spott hab ich nicht verdient! Hätten Sie mit einem einzigen Blick mir ins Herz schauen und gewahren können, wie alles, was an wahrhaftigem Empfinden hier innen lebt und wohnt, nur den einen geliebten Namen Rachele trägt, Sie würden mir in dieser bitteren Stunde, wenn auch kein trostreicheres, so doch ein minder verletzendes Wort …«
Da mußte ich bestürzt inmitten der Rede verstummen. Rachele, die bei meinen Worten regungslos gestanden, den finsteren Blick zur Thüre gerichtet, hatte jählings unter lautem Aufschluchzen die beiden Hände vor das Gesicht geschlagen, und krampfhaftes Weinen erschütterte ihre Schultern und das gebeugte Haupt.
»Rachele! Rachele!« rief ich und eilte, den letzten Rest meiner schwerbewahrten Ruhe verlierend, auf die Weinende zu. Mit beiden Armen sie stützend, führte ich sie zu einem Lehnstuhl, und als Rachele sich niederließ, sank ich vor ihr in die Kniee, während mir die heißen Worte fassungsloser Erregung von den Lippen sprudelten: »Was hab ich gethan, Rachele! Vergebung! Vergebung! Ich werde mich hassen von dieser Stunde an … nur weinen Sie nicht! Weinen Sie nicht, Rachele … diese Thränen verbrennen mir das Herz! Ich möchte sterben bei dem Gedanken, daß ich es bin, der Ihre schönen Augen zu Thränen betrübte. Und dennoch … und müßt ich auch Kränkung zu Kränkung fügen … diese Thränen, Rachele, das sind nicht Thränen des Grolles! Mich überkommt es wie die berauschende Ahnung einer Glückseligkeit, die ich für meine Sehnsucht unerreichbar und meinem Herzen schon verloren wähnte. Bei dem wahren und wahrhaftigen Glück, das aller Menschen Erdenziel und Höchstes ist … sprechen Sie, Rachele … was sollen mir diese Thränen sagen? Ein Wort, ein einziges Wort nur, wie es mein Herz ersehnt, und es soll den Mut meiner Liebe bis in den Himmel heben! O Rachele, Rachele … wie lieb ich dich!«
Mit zitternden Händen hatte ich ihre Arme zu mir niedergezogen, und unter sinnlosem Gestammel bedeckte ich ihre Hände mit Küssen und Küssen. Und als ich aufblickte, zitterte ein Schauer seliger Wonne durch mein Herz, denn mit heißem Blick der Liebe tauchte Rachele ihr Auge in das meine – doch nur für die Dauer einer flüchtigen Sekunde. Dann rang sie ihre Hände aus den meinen – und während sie mit schwerer Mühe sich aufrichtete, zitternd am ganzen Leibe, preßte sie mir die beiden Fäuste vor die Stirne und stieß mich von ihrer Seite.

Ich taumelte fast zu Boden – solche Kraft hatte dieser Stoß – und als ich mich erhob, klang plötzlich der Hall hastig über die Treppe emporeilender Schritte in das Zimmer. An der Thüre ließ sich ein kurzes Pochen hören, und Catina trat ein, im Hauskleid und mit geröteten Wangen.
»Catina?« rief Rachele wie in zielloser Sorge.
»Gut, gut, daß ich die Signora noch treffe!« sprudelte es von den Lippen des Mädchens. »Ich habe mir's zwar gedacht, als ich unten vor der Thür den Wagen stehen sah.« Sie gewahrte den auf dem Teppich liegenden Sonnenschirm, hob ihn auf und reichte ihn Rachele. »Der Herr schickt mich … er ist ganz unerwartet nach Hause gekommen, da er sich nicht wohl fühlte.«
»Nicht wohl?« fragte Rachele bestürzt. »Aber doch nichts Schlimmes?«
»Ach Gott, nein! Ich war selbst im ersten Augenblick ein wenig erschrocken und wollte den Arzt holen … das gab aber der Herr nicht zu. Ich mußte ihm nur ein Glas frisches Wasser bringen, und dann schickte er mich hieher, um für den Fall, daß ich die Damen noch fände, auszurichten, er wäre bereits zurückgekehrt. Doch sollte sich Signora deshalb durchaus nicht von der Spazierfahrt abhalten lassen.«
Mit zitternden Händen zog Rachele den Schleier vom Hutrand über die Augen. »Komm, Catina!« sagte sie dann. »Komm, nach Hause!« Und ohne mir einen Blick, einen Gruß zu gönnen, schritt sie dem Mädchen voraus durch die Thüre.
Draußen im Vorzimmer hörte ich sie noch ein paar Worte mit Leones Töchtern sprechen, die sich über den Entgang des erhofften Vergnügens recht ungebärdig äußerten – dann klang ihr leichter Fuß auf der Treppe, und gleich darauf vernahm ich das dumpfe Geräusch des abrollenden Wagens.
Ich war wie betäubt. Lange Minuten noch stand ich regungslos auf der gleichen Stelle. Im anstoßenden Zimmer hörte ich die beiden Mädchen rumoren.
»Dieser wehleidige Tölpel hätte mit seiner dummen Krankheit auch bis morgen warten können!« klang Michelinas Stimme durch die offenen Thüren zu mir herüber. »Aber nein, gerade heute muß er uns die Freude verderben. Dieser Mensch ist wahrhaftig nur auf der Welt, um andere Leute zu ärgern. Es wäre wirklich nicht schade, wenn …« da wurde drüben die Thüre zugeschlagen.
Ein kalter Schauer rüttelte meinen Leib, als ich unwillkürlich den Gedanken ausdenken mußte, der sich mir aus Michelinas unterbrochenen Worten aufgedrängt hatte. Ich meinte mich selbst verabscheuen zu müssen, daß ich, wenn es auch wider Willen geschah, solch einem Gedanken in meinem Kopfe Raum geben konnte.
In solcher Stimmung stieg ich die Treppe zu meiner Wohnung hinunter. Da lag auf dem Tische noch jener unvollendete Brief – ich zerriß ihn und streute die Fetzen aus dem Fenster; vom Winde gefaßt, flatterten sie nach hundert Richtungen auseinander.
Dann warf ich mich auf den Divan – fand aber keine Ruhe – erhob mich wieder und wanderte mit rastlosen Schritten im Zimmer auf und nieder, bis ich endlich meinen Hut ergriff und auf die Straße hinunter ging.

Es trieb mich in Raeheles Nähe. Ich glaubte, ruhiger zu werden, wenn ich nur aus der Ferne nach einem ihrer Fenster spähen könnte.
So lenkte ich nach kurzem Gange in die Dschambassokak ein. Kaum aber war ich hier ein paar Dutzend Schritte die Häuserzeile entlang gewandert, als mit rasselnder Eile ein Wagen die Straße einher geflogen kam – es war Ottavios Kutsche, und darin saß Catina mit zerrauften Haaren und leichenblassem, verstörtem Gesicht.
»Catina! Catina!« rief ich.
Halb im Wagensitz sich erhebend, blickte das Mädchen nach allen Seiten umher, bis es mich gewahrte – rief dem Kutscher ein rasches Wort zu und winkte mir mit beiden Armen.
Ich eilte über die Straße hinüber und sprang in den Wagen, ehe noch die Pferde still hielten – und wieder rasselte die Kutsche weiter.
»Gott! O Gott! Dieses Unglück!« jammerte Catina unter hervorbrechenden Thränen.
»Ums Himmels willen, was ist denn geschehen?«
»Sie wissen ja, Signore … Sie waren ja dabei, als ich die Signora suchen kam und ihr sagte, der Herr wäre zurückgekommen, er fühle sich nicht wohl. Da fuhren wir dann zusammen nach Hause … im Vorzimmer nehm' ich ihr noch, wie gewöhnlich, wenn sie von einem Spaziergang oder einer Ausfahrt zurückkehrt, Hut und Schirm ab und denke weiter nichts Schlimmes, da ich sie allein nach dem Speisezimmer gehen lasse … will eben durch die Küche zur Garderobe, um die beiden Sachen zu verwahren … da hör ich einen furchtbaren Schrei, so daß ich alles, was ich in den Händen habe, fallen lasse und in das Zimmer laufe … Gott! O Gott! Wie entsetzlich! Denken Sie … ich komme durch das Wohnzimmer zu der offenen Speisezimmerthür, und meine, mir gerinnt vor Schreck alles Blut im Leib, denn auf der Schwelle liegt die Signora, ohnmächtig … nur so in sich zusammengefallen. Drinnen aber … auf dem Boden, da seh ich den Herrn liegen, das Gesicht aufgeschwollen und blau … in der Hand hat er noch das Trinkglas gehalten … und der ganze Teppich war naß vom verschütteten Wasser. Erst bin ich dagestanden wie versteinert und wußte nicht, was anfangen. Dann aber fuhr mir's in die Glieder, und so hab ich die Teresina, unser Küchenmädchen, herbeigerufen, bin um Essig und Riechfläschchen gerannt … dann haben wir die Signora zum Divan getragen, haben ihr alles aufgerissen und hundert und eins versucht, bis endlich wieder ein bißchen Leben in sie kam. Während die Teresina bei der Signora blieb, habe ich nach dem Herrn gesehen … aber da war alles umsonst. Gott, o Gott! Wie schrecklich! Ich glaube, da hat's ein Ende … ich kenne das! Da wird der Doktor auch die Hände in die Tasche stecken müssen. Wenn wir ihn jetzt nur zu Hause finden! Gott, o Gott! Wie schrecklich! Die arme, arme junge Frau … und das liebe, liebe Kind!«
Wie mir bei all diesen Worten zu Mute war, das vermag ich dir nicht …« – – –
Willy hatte sich in seiner Erzählung unterbrochen. Die unliebsame Ursache dieser Unterbrechung waren ein Herr und zwei Damen, welche, nachdem sich seit unserer Ankunft der ganze Gartenraum der Csarda allmählich mit Gästen gefüllt hatte, die letzten freien Plätze an unserem Tisch in Beschlag nahmen.
Wenige Minuten harrten wir in dieser unwillkommenen Gesellschaft aus, dann beglichen wir unsere Zeche und gingen.
Als wir über die schmalen Holzstufen zur Straße hinunterstiegen, sagte ich:
»Diese drei Leute haben nun gewiß nicht die mindeste Ahnung, wie bitterbös ich ihnen bin … oder richtiger gesagt, dem Zufall, der sie so unerwartet zwischen mich und deine Geschichte hineinsetzte. Es ist doch etwas Seltsames um den Zufall! Das kam ja diesmal just wie gemacht, wie der richtige Diabolus ex machina in der Komödie, mitten hinein in die Kulmination der Handlung.«
»Daraus magst du wieder einen Beweis schöpfen,« erwiderte Willy, sich gewaltsam zur Ruhe zwingend, »einen Beweis für meine alte, stets von dir bekämpfte Behauptung, daß eure ästhetischen Gesetzgeber sehr unrecht thun, wenn sie aus dem Stoffgebiet der erzählenden und dramatischen Kunst das Wirken und Walten des Zufalls verbannt wissen wollen. Welch ein anderes Endziel haben diese beiden Künste, als dem Lebenden, dessen Blick sich in dem dichten Getriebe des Tages verengt und verkürzt, zum Zwecke seiner Selbsterkenntnis ein volles, allumfassendes, somit notwendigerweise auch getreues Bild des Lebens in Ernst und Frohsinn wiederzuspiegeln? Welche Macht aber unter den Mächten, die unsere Lebenswege gestalten, ist so unermüdlich wirkend, so allgegenwärtig, so Unheil bringend und Segen spendend, kurz so mächtig, wie die dunkle Macht des Zufalls. Sieh dir nur einmal die Geschichte an, die ich dir da eben erzähle, so wahr und wahrhaftig erzähle, wie ich sie erlebte … ist sie etwas anderes, als eine Kette von Zufällen und Zufällen?«
»Was dieses naheliegende Exempel betrifft, so kann ich deine Behauptung allerdings nicht widerlegen,« entgegnete ich lächelnd. »Im übrigen aber will ich nicht mit dir streiten, doch nur aus dem Grunde, weil ich augenblicklich Besseres zu hören als zu sagen habe.«
»Wenn du so denkst, mag dir allerdings diese Unterbrechung recht unlieb gekommen sein; mir selbst aber war sie fast erwünscht, da sie mir nun ein paar Minuten recht nötiger Ruhe gönnte. All diese Ereignisse haben zu tief in mein Leben eingegriffen, sie sind durch die heutige Begegnung wieder so wach und lebendig in mir geworden, daß mich ihr Bericht kaum weniger ergreift, als die Wirklichkeit, das Erleben selbst es that. Komm … laß uns von der Straße in diesen einsameren, vom Lärme abseits gelegenen Seitenweg einlenken! Und während wir durch die stille, schöne Nacht der Stadt zuwandern, sollst du das Ende meiner Geschichte hören.«
Willy legte seinen Arm in den meinen, schweigend schritten wir eine Weile dahin – dann begann er aufs neue zu erzählen:
»Ich kann es dir nicht schildern, Freund, ich weiß es nicht in Worte zu fassen, unter welchen Empfindungen ich aus Catinas wortreichem Munde jene erschütternde Nachricht hörte. Wenn ich sage, ich saß wie betäubt, wie vom Schwindel ergriffen und keiner Bewegung fähig neben dem weinenden Mädchen im Wagen, so sind das kaum halbwegs bezeichnende Worte. Alles um mich her und alles in mir drehte sich und wirbelte durcheinander. Was ich dachte, waren keine Gedanken, nur Gedankenbruchstücke, Gedankenanläufe, von denen einer den andern jagte und überstürzte, welche jedoch schließlich, nachdem ich den ersten jähen Schrecken zu überwinden begann, allesamt in die eine Frage zusammenliefen: »Was kann ich da nützen, wie kann ich hier helfend eingreifen?«
Das Quälendste war für mich, Rachele fast allein zu wissen in dieser entsetzlichen Lage, nur unter dem Beistand einer vielleicht kopflosen und ungeschickten Dienerin. So schickte ich Catina nach Hause, während ich selbst mit dem Wagen der Wohnung des Doktors zujagte. Er war nicht zu Hause, und ich mußte ihn im Kaffeehaus suchen. Dort saß er in Gesellschaft eines älteren Herrn und spielte Domino.
»Doktor! Gut, daß ich Sie finde! Kommen Sie! Kommen Sie rasch mit mir, ich bitte! Jede Sekunde ist kostbar! Vor der Thüre steht der Wagen. Ottavio Scarpa …«
»Ist einem Herzschlag erlegen?« fiel mir der Doktor ins Wort, während er aufsprang.
»Sie wissen?«
»Ihr Gesicht, Ihre Eile und die Art, in der Sie Ottavios Namen nannten, läßt mich fürchten, daß die Katastrophe eingetroffen ist, die ich seit Wochen und Monaten kommen sah.«
Bei diesen Worten hatte er Hut und Stock ergriffen und ein Geldstück auf den Tisch geworfen; er nickte seinem Partner einen Gruß zu, und wenige Augenblicke später saßen wir im davoneilenden Wagen.
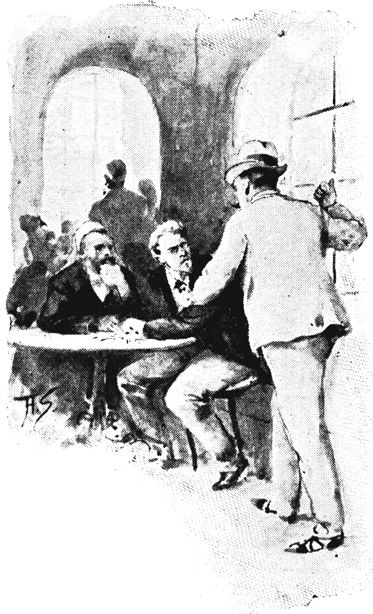
Nun hielten wir vor Scarpas Haus. Während der Doktor in den Flur vorauseilte, schärfte ich dem Kutscher ein, für alle Fälle mit seinem Wagen vor der Thüre zu warten; doch solle er den ersten Lastträger, der vorüberkäme, nach dem Hafen senden, um Ottavios Bruder herbeizurufen.
Droben im Vorzimmer holte ich den Doktor ein und folgte ihm. Es war ein trauriges Bild, das sich unseren Augen bot, als wir ins Speisezimmer traten. Mit aufgelösten Haaren und halboffenem Kleid, das schöne Antlitz verzerrt von Schreck und Jammer, kniete Rachele auf dem Teppich und hielt Ottavios lebloses Haupt im Schoße. Rings um sie her lagen Tücher und Fläschchen.
»Doktor!« schluchzte sie. Und weiter fand sie kein Wort – eine Hand nur löste sie und deutete mit stummberedter Gebärde auf den Hingestreckten.

Der Arzt trat näher. »Lassen Sie das!« flüsterte er Catina zu, welche gleichfalls auf dem Teppich kauerte und mit einem essiggetränkten Tuch Ottavios nackte Füße rieb. Dann ließ er sich auf die Kniee nieder und nahm das Haupt des Leblosen aus Racheles Schoß.
Als Rachele sich erhob, sah sie mich unter der Thüre stehen. Mit zornfunkelnden Augen trat sie mir entgegen.
»Sie hier? Wer hat sie gerufen?«
»Der Wunsch, nach meiner Kraft zu nützen und zu helfen,« gab ich ernst zur Antwort.
Mit unsicherem, fast mißtrauischem Blick sah Rachele mir ins Gesicht; dann aber schmolz der finstere Ausdruck ihrer Züge, ihre Augen füllten sich mit Thränen, und während sie das Gesicht in die erhobenen Arme preßte, jammerte sie schluchzend: »Wer hätte das gedacht! Wer hätte das gedacht!«
Catina, mit welcher der Doktor inzwischen einige Worte flüsternd gesprochen hatte, trat an Rachele heran und führte die Weinende unter gutherzig zuredenden Worten aus dem Zimmer.
»Kommen Sie,« sagte, als sich hinter den beiden die Thüre geschlossen hatte, der Arzt zu mir, »wir müssen versuchen, ob wir ihn nicht in sein Schlafzimmer hinüber zu tragen vermögen.«
Ich kann mir nur denken, daß Notwendigkeit und Aufregung unsere Kräfte verdoppelten, sonst wär' es uns wohl kaum gelungen, diesen mächtigen, bleischweren Körper durch zwei Zimmer zu tragen und auf das Bett zu heben.
Während nun der Arzt durch bange, stille Minuten das ernste Werk seines Berufes übte, stand ich zu Füßen des Lagers, im Innersten ergriffen und bis ins Mark erschüttert von solch einem jähen Machtspruche des Schicksals.
»Morgen sehen wir uns ja wieder!« hatte mir Ottavio gestern zum Abschiede gesagt. »Wer weiß!« hatte ich darauf antworten wollen – und diese zweifelnden Worte, die ich in einem so ganz anderen Sinne dachte, wie ungeahnt, wie schrecklich waren sie nun Ernst und Wahrheit geworden.
»Es ist so, wie ich dachte: ein Herzschlag,« sagte der Doktor. »Der Tod muß plötzlich eingetreten sein, vor mindestens zwei Stunden schon.«
Ich stand erschüttert und wie gelähmt, während er die rote Decke um Ottavios Brust und Füße breitete und über ihr die wachsbleichen Hände des Entseelten kreuzte; dann drückte er ihm die halb noch offenen Lider zu, und während er ihm die nassen Haare glättend aus der Stirne strich, sagte er:
»Gehen Sie zu Rachele! Suchen Sie das Unvermeidliche für sie in ein tröstendes Wort zu fassen.«
Zögernd ging ich zur Thüre. Ach, hätt' ich nur jenen Auftritt im Haus Leones ungeschehen machen können, wie wäre mir dieser Gang um so vieles leichter geworden!
Ich sann und grübelte, wie ich es ihr sagen sollte – als ich es zu wissen glaubte, öffnete ich die Thüre. Als ich aber Rachele vor mir stehen sah, als sie mir unter angstvollen Blicken mit thränenerstickter Stimme entgegenrief: »Er ist zu sich gekommen, nicht wahr? Es ist besser mit ihm? Alles, alles wird wieder gut werden?« – da war meine ganze, so wohl ersonnene Trostrede vergessen, und ich brachte kein Wort über die Lippen. Schweigend nur hob ich die Arme und ließ sie schweigend wieder sinken.
»Tot!« schrie Rachele erschauernd auf, und wankend tastete sie mit beiden Händen nach einem Halt. Ich eilte hinzu, um sie zu stützen. Sie aber raffte sich auf. »Lassen Sie mich,« stöhnte sie, »lassen Sie mich! Ich will zu ihm … zu ihm …«
Noch hatte sie die Thüre nicht erreicht, als sie lauschend das starre Antlitz hob – vom Vorzimmer herein klang die helle Stimme der kleinen Susetta, die von ihrem abendlichen Spaziergang nach Hause kehrte.
Nun trat die Kleine ins Zimmer, und während die Bonne von Catina fortgezogen wurde, wankte Rachele unter dem jammernden Rufe »Mein Kind! Mein Kind!« mit ausgebreiteten Armen auf Susetta zu, welche scheu und verwundert zu der Mutter aufsah. Schluchzend hob Rachele das Kind an ihre Brust und verschwand mit ihm in der Thüre des Speisezimmers.
Da hörte ich leise Schritte neben mir; es war der Doktor.
»Ich glaube kaum,« sagte er flüsternd, »daß Signora Scarpa in der Verfassung sein wird, alles anzuordnen, was in solch einem traurigen Falle unumgänglich ist. Wir wollen uns also in diese Mühe teilen. Steht der Wagen noch unten?«
»Ich glaube.«
»So haben Sie die Güte, nach der englischen Gesandtschaft zu fahren, der Ottavio als geborener Malteser unterstand. Sie brauchen nur mit einem Wort das erfolgte Ableben zu melden. Alle sonst nötigen schriftlichen Anzeigen und Meldungen werde ich inzwischen von hier aus versenden. Doch gedulden Sie sich noch einen Augenblick, bis ich wieder hereinkomme. Ich will nur eines der Mädchen nach einem Wärter senden.«
Mit lautlosen Tritten verließ er das Zimmer. Da ich in all meinen Gliedern eine bleierne Müdigkeit verspürte, wollte ich mich auf den Divan niederlassen. Aber da klang durch die halboffene Thüre leises Weinen an mein Ohr. Das schnitt mir ins Herz – und ich rührte mich nicht mehr.

»Mamma? Mamma? … Weshalb weinst du?« hörte ich die kleine Susetta mit schüchternem Stimmchen fragen.
»O, mein Kind! Ich weine … ich weine, weil uns der gute Babbo verlassen hat. Er ist fortgereist, Susetta, fort von uns, weit, weit fort.«
»Nein, nein, Mamma, das glaub ich nicht. Noch jedesmal, wenn Babbo fortgereist ist, hab ich ihn so um den Hals nehmen müssen …, ja, Mamma, und dann hat er mir einen Kuß gegeben und dann hat er mir Addio! Addio! Addio! gesagt. Oh ich weiß, das hält er heute gewiß auch gethan. Babbo geht nicht fort von seiner Settiza ohne Addio! Ich glaub es nicht, Mamma, ich glaub es nicht!«
»Glaub es nur, mein süßer Schatz, glaub es nur, dem guten Babbo that es gewiß recht sehr im Herzen weh, daß er seine kleine Settiza nicht mehr sehen und küssen konnte … denn er wird lange, lange nicht wieder heimkommen.«
»Mamma! Das glaubst du? Nein, du bist aber dumm! Wirst sehen, morgen kommt er schon wieder, oder übermorgen, oder morgen übermorgen ganz gewiß. Er kann ja gar nicht lange fortbleiben, weil er dich und mich so lieb hat, Mamma, so lieb, so lieb.«
»Mußt du mir das sagen, das, mein Kind, gerade das!«
»Du drückst mich, Mamma, du thust mir weh.«
»Oh, mein süßer, süßer Schatz, das that ich gewiß nicht gerne.«
»Das weiß ich schon, Mamma. Ich bin dir auch gar nicht böse. Nun darfst du aber nicht mehr weinen! Nicht, Mamma, nicht! Was hast du nur! Nicht weinen, … nicht weinen, Mammiza … Mammiza …«
Die Worte des Kindes erstickten in lautem Schluchzen.
»Sei gut, mein Kind, sei gut! Sieh, ich weine ja nicht mehr. Und nun komm, Settiza, komm, ich will dich schlafen bringen.«
»Ich soll schlafen gehen? Jetzt schon? Es ist ja noch gar nicht Nacht.«
»Morgen in aller Frühe darfst du mit deiner Signorina im Wagen spazieren fahren … hinaus aufs Land … weißt du, wo die schönen Blumen sind, und die jungen Pferdchen. Und deshalb mußt du heute früher schlafen gehen, damit du morgen zeitig munter bist. Ja? Willst du?«
»Aber ich habe Hunger, Mamma!«
»Ja, mein Herzchen, ja, komm nur! Du sollst etwas Gutes haben. Und wenn du in deinem Bettchen liegst, dann setz ich mich zu dir, dann wollen wir zusammen für den guten Babbo beten … und so lange bleib ich bei dir sitzen, bis du schläfst.«
»Ja, ja, ja, Mamma! Aber siehst du, du böse Mammiza, jetzt weinst du schon wieder.«
Ich hörte das Öffnen und Schließen einer Thüre, dann war es still da drinnen – mir aber rannen die heißen, schweren Thränen über die Wangen.
»Glückliches Kind! Wie gleitet die Hand des Schicksals, die uns große Menschen niederdrückt, so leicht hinweg über dein junges unschuldsvolles Haupt!«
Der Doktor kam. »Es ist unglaublich,« sagte er, »was das eine Mühe kostet, bis man solch einer Person etwas begreiflich macht. Sie haben auch alle, wie sie draußen sind, den Kopf verloren.« Er setzte sich an den Schreibtisch. »Wenn es Ihnen also jetzt beliebt, Signore … ich werde einstweilen das Meinige besorgen.«
Ich nickte einen stummen Gruß und ging. Draußen im Vorzimmer fragte ich Catina, die mir weinend meinen Hut reichte, ob Madama Giuditta von dem traurigen Vorfall bereits benachrichtigt wäre. Sie verneinte das – und so fuhr ich zuerst nach Leones Wohnung. Hier teilte ich der alten Paraskeva, die aus dem Hausthor herbeigehumpelt kam, in raschen Worten das Nötigste mit. Der guten Person schossen die hellen Thränen in die Augen, und jammernd rang sie die Hände. Ich trug ihr auf, Madama Giuditta auch noch zu sagen, daß bereits jemand an den Hafen geschickt worden wäre, um Signor Leone zu suchen. Dann fuhr ich weiter.
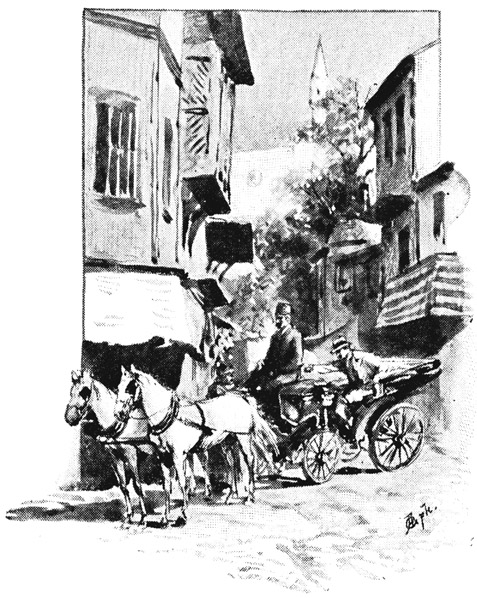
Als ich nach etwa einer Stunde von dieser Fahrt zurückkehrte, senkte sich schon die erste Dämmerung über Dächer und Straßen.
»Signore! Signore!« klang mir, als ich vor Ottavios Haus aus dem Wagen sprang, Leones Stimme ins Ohr.
Ich trat unter die Thür und wartete, bis er kam.
»Wer hat denn eigentlich da nach mir geschickt?« schnauzte er mich in seiner ungezogenen Weise an.
»Ich.«
»So? Und Sie glauben wohl, ich habe meine Zeit gestohlen? Was, bei allen Teufeln, hat's denn gegeben, daß ich von der dringendsten Arbeit weggerufen werde?«
»Ihr Bruder ist gestorben.«
Es war weder Schreck noch Trauer, was aus Leones Mienen sprach – nur Verblüffung. Eine Weile starrte er mich offenen Mundes an, dann stieg ihm das Blut dunkelrot ins Gesicht, und ein Funkeln erwachte in seinen Augen.
»Gestorben?« fragte er, während die Hand, mit der er meinen Arm umklammerte, heftig zu zittern begann. »Nicht wahr, mein Lieber, Sie wollen mich nur ein klein wenig zum besten halten?«
Aus dem unwilligen Blick, mit dem ich seine Augen streifte, mußte er sich wohl eine Antwort gelesen haben.
»Und es ist wahrhaftig aus mit ihm … aus und fertig? Gestorben? Wie gestorben? An was gestorben?«
»Am Herzschlag.«
»Ich sag's ja, ich sag's ja! Das hat er nun davon.« Leone schob mich beiseite und trat in den dunklen Flur. »Teufel, Teufel, das kam ein wenig plötzlich! Nun heißt's, den Kopf obenbehalten.«
Daß er diese letzten Worte zu mir gesprochen, glaub ich kaum. Ich hatte sie eben noch verstanden, als er mir voraus in langen Sätzen die Treppe emporgesprungen war.
Im Vorzimmer brannte bereits Licht; auch im Wohnzimmer, das ich wenige Sekunden nach Leone betrat, fand ich die Lampe schon entzündet. Vor dem Doktor, der an den Schreibtisch gelehnt stand, saßen die beiden Töchter meines Hausherrn, Viola und Michelina; sie hielten weiße Taschentücher in der Hand, welche sie bei meinem Eintritt seufzend vor die Augen drückten.
»Wo liegt er?« hörte ich Leone fragen.
Schweigend deutete der Doktor mit der Hand nach Ottavios Schlafzimmer.
»Ist Rachele bei ihm?« wandte sich Leone flüsternd an Michelina.
»Nein, aber sie war hier, als wir kamen. Die Sache scheint ihr recht nahe zu gehen.«
»Scheint?«
Das Mädchen zuckte die Schultern. »Nun, ich denke mir eben, daß es der übergroße Schmerz war, der sie bei unseren Trostworten so stumm dastehen ließ. Ohne ein Wort ist sie dann zur Thüre hinaus. Ich glaube sogar, daß sie geweint hat.«
»So?« meinte Leone kurz und trocken, schritt auf das Schlafzimmer zu und stieß die Thüre auf.
Da wurde eine Zahl brennender Kerzen und der dunkle Umriß eines bei dem Totenbette beschäftigten Mannes sichtbar.
»Wer ist dieser Mensch?« fragte Leone, sich zu uns zurückwendend.
»Der Leichenwärter,« antwortete der Doktor.
Ein paar Augenblicke stand Leone wie unschlüssig, dann trat er in das Zimmer und drückte hinter sich die Thüre ins Schloß.
Meine Blicke kreuzten sich mit denen des Doktors, der mir zublinzelte und mit den Augen gegen die geschlossene Thüre winkte.
»Sie waren so freundlich, uns zu benachrichtigen,« sprach Michelina nach einer schweigsamen Weile mich an und reichte mir die Hand. »Mamma läßt Ihnen recht sehr für diese Mühe danken.«
»Bitte!«
»Nein, wie traurig das ist!« seufzte Viola.
»Ach ja!« gähnte die Schwester. »Da sieht man wieder, wie es gehen kann. Man sollte wahrhaftig Angst vor jedem neuen Tag bekommen.«
»Sieh da,« sagte der Doktor mit einem leichten Sarkasmus im Ton, »ich hätte mir nie gedacht, daß hinter dem Fräulein ein so niedlicher Philosoph zu stecken beliebt.«
»Nicht wahr? Oh ..schäckerte das Mädchen, das diese Worte allem Anschein nach für ein ernstgemeintes Kompliment nahm, »hinter mir steckt gar manches, was man auf den ersten oberflächlichen Blick bei mir nicht vermutet.«
»Da mögen Sie recht haben,« fiel ich unwillig ein, »denn trotz der mannigfachen Entdeckungen, die ich bei Ihnen zu machen schon Gelegenheit hatte, würd ich nie und nimmer gedacht haben, daß Sie eines so scherzhaften Tones fähig wären, wenn fünf Schritte von Ihnen der Bruder Ihres Vaters, kaum erkaltet, auf dem Totenbette liegt.«
Wie beistimmend nickte Viola vor sich hin und hob das Taschentuch wieder an die Augen, während Michelina sich mit trotzig aufgeworfenen Lippen erhob.
»Sie sind ein Brummbär, ein Pedant, das weiß ich schon längst. Zu jedem Braten machen Sie Ihre langweilige Sauce. Komm, Viola, laß uns nach Hause gehen. Ich bin nicht hieher geschickt, um mich zu ärgern.«
Nach einem verachtungsvollen Blicke für mich und einem lächelnden, koketten Gruß für den Doktor schritt sie der Thüre zu.
»Aber Michelina!« zürnte die seufzende Schwester. »Wie du nur wieder bist! Bedenke doch, wo wir sind! Wenn Mamma das wüßte!«
»Nun? Was dann?«
Dieses mir so unerquickliche Gespräch wurde durch Leones Eintritt unterbrochen. Er schien in sichtlicher Erregung; seine Augenlider zuckten, und unruhig bewegten sich die Nasenflügel.
»Wo willst du hin?« fuhr er Michelina an, als er sie unter der Thüre stehen sah.
»Nach Hause.«
»Nichts da! Du bleibst hier. Ihr beide geht heute Nacht überhaupt nicht nach Hause. Viola wird drinnen im Speisezimmer schlafen, und du hier auf dem Divan.«
Michelina lachte. »Das wäre noch das Letzte, was mir einfiele.«
»Du …« schrie Leone zornig auf; dann aber, nach einem flüchtigen Blick gegen mich und den Doktor, schritt er auf das Mädchen zu und wisperte ihm einige Worte ins Ohr.

Michelina schüttelte den Kopf. »Nein, nein, ich thu es nicht, nicht um alles in der Welt.«
»Du wirst! Verstehst du mich! Ich will es haben! Ich!«
»Nein, nein! Hier schlafen, wo nebenan ein Toter liegt? Ich müßte sterben vor Angst und Ekel.«
»Du wirst also nicht thun, was ich sage?« knirschte Leone und rüttelte das Mädchen am Arme.
»Nein! Laß mich! Ich will nach Hause!«
»Da hast du was auf den Weg!« schrie Leone, und mit klatschendem Schlag fiel seine Hand auf Michelinas Wange. »Du Kreatur!«
»So eine Flegelei!« schluchzte das Mädchen. »Aber warte nur, komm du nur heim zu Mamma …« Und weinend eilte sie aus dem Zimmer, laut hinter sich die Thüre zuschlagend.
»Gott! Gott! Welch ein Skandal!« seufzte Viola und folgte, auf einem Umweg am Vater vorüberhuschend, der Schwester.
»Viola! Viola!« rief Leone und eilte dem Mädchen nach.
Als er aber die Thüre aufriß, prallte er zurück. Vor der Schwelle standen zwei Männer, die einen Sarg trugen.
»Soll er heute noch fortkommen?« wandte sich Leone kleinlaut zu uns. »Wer hat das angeordnet?«
»Ich!« sagte der Doktor. »Aus sanitären Gründen, da die Zersetzung zu dieser Jahreszeit eine sehr rapide sein wird.«
Schweigend drückte sich Leone und ließ die Sargträger eintreten, welche mit schweren Tritten durch das Zimmer tappten. Der Doktor ging ihnen voraus und öffnete die Schlafzimmerthüre, die er, nachdem er mit den beiden eingetreten war, hinter sich wieder schloß.
Ich hatte mich auf einen Stuhl niedergelassen und verfolgte mit meinen Blicken Leone, welcher, die Hände auf dem Rücken, mit erregten Schritten im Zimmer auf und nieder ging.
Einmal blieb er stehen, blickte eine Weile vor sich zu Boden, dann warf er, mit den Lippen schnalzend, den Kopf auf und rief mit scharfer Stimme in das Vorzimmer hinaus: »Catina! Catina!«
Das Mädchen kam gesprungen.
»Signore Leone?«
»Wo ist meine Schwägerin?«
»Drüben im Kinderzimmer. Sie sitzt bei der Kleinen am Bett.«
»Weiß sie, daß ich hier bin?«
»Ich glaube wohl; denn als ich vor wenigen Minuten der Signora ein Glas Wasser brachte, haben wir den Signore bis hinüber sprechen hören.«
»So! Wenn also meine Frau Schwägerin keine Ursache hat, mich zu sprechen, so habe doch ich meine Gründe, mit ihr zu reden. Gehen Sie hinüber, Catina, und sagen Sie der Signora, daß ich ihre Anwesenheit wünsche.
Catina ging – und Leone, welchem, wie ich aus einem Blick und einer Miene schließen mußte, meine stumme Gesellschaft nicht sonderlich genehm schien, schritt an mir vorüber in das Speisezimmer.
Diese Beobachtung drängte mir die Frage auf, mit welchem Recht und aus welcher Veranlassung ich mich eigentlich noch hier befand. Und da ich mir auf diese Frage keine Antwort zu geben vermochte, hielt ich den Augenblick für den günstigsten, mich ohne Störung und Aufsehen zu entfernen.
Ich erhob mich also, um mich von dem Doktor zu verabschieden und um Ottavio noch ein letztesmal zu sehen.
Doch hatte ich die Thüre des Schlafzimmers noch nicht erreicht, als sie von innen geöffnet wurde. Die beiden Sargträger kamen heraus, während ich den Doktor zu ihnen sagen hörte:
»Warten Sie im Vorzimmer so lange, bis ich Sie wieder rufe.«
Der Leichenwärter, welcher hinter den beiden anderen aus der Thüre trat, sah erst mit suchenden Blicken im Wohnzimmer umher, dann wandte er sich zum Doktor zurück:
»Ist der große, starke Herr nicht hier, der vor ein paar Minuten bei mir war?«
»Was wünschen Sie von ihm?«
»Ich will ihm nur diesen Schlüsselbund bringen; er hat vorhin in den Kleidern, die wir dem Toten ausgezogen haben, darnach gesucht und war recht ärgerlich, daß er ihn nicht finden konnte. Da hab ich die Schlüssel eben jetzt vom Teppich aufgehoben … ich denke mir, daß sie aus einer der Taschen fielen, als wir die Leiche entkleideten.«
»Geben Sie mir diese Schlüssel,« sagte der Doktor, und als er sie empfangen hatte, verbarg er sie in seiner Brusttasche. Dann fragte er den Wärter leise: »Und was ist mit der Brieftasche, mit der Börse, mit den Brillantringen und mit der goldenen Uhr geschehen, die ich dort auf die Fensterbrüstung legte?«
»Jener Herr hat alle die Sachen zu sich gesteckt.«
»Gut, Sie können gehen … und warten Sie draußen mit den beiden andern, bis ich Sie rufe.«
Lautlos verließ der Mann das Zimmer.

»Nun? Aus Ihrer Miene muß ich beinahe schließen,« wandte sich der Doktor flüsternd zu mir, »daß Sie über das eben Gehörte sich noch zu wundern vermögen. Kennen Sie unsern Signor Leone nicht besser? So sehen Sie ihm doch in die Augen … das sind die richtigen Hyänenaugen. Er fängt hier genau so an, wie ich es nach seinem Charakter erwartete. Aber lassen wir ihn jetzt! Der Sarg soll geschlossen werden … und wir müssen Signora Scarpa benachrichtigen, wenn sie ihren Gatten noch einmal zu sehen wünscht …«
»Sie kann jede Sekunde hier eintreten, Leone hat bereits nach ihr gesandt. Ich selbst wollte Sie eben aufsuchen, um mich zu verabschieden, von Ihnen … und von ihm. Ich war schon zu lange hier, und mein von niemanden begehrtes Mitgefühl allein giebt mir das Recht nicht, noch länger zu bleiben. Ich möchte nicht, daß mich Signora Scarpa noch findet, wenn sie kommt.«
Bei diesem Worte reichte ich dem Doktor meine Hand hin, die er hastig ergriff.
»Nein, nein! Was fragen Sie da lange nach Grund und Recht? Sie dürfen nicht gehen! Bleiben Sie bei mir … zu meiner Hilfe. Unsere Freundschaft für den Toten macht es uns beiden zur heiligen Pflicht, sein Weib und Kind vor diesem – – horch!«
Mit verschlungenen Händen standen wir schweigend und lauschten.
Eine Thüre war gegangen.
»Kommst du endlich?« hörten wir aus dem Speisezimmer die Stimme Leones. »Eine Stunde bin ich schon hier, ohne daß du es der Mühe wert fandest, mir ein Wort zu sagen. Aber ich will jetzt nicht den Empfindlichen spielen. Da hast du meine Hand! Wir sind ja alle beide schmerzlich betroffen. Ich habe den einzigen geliebten Bruder verloren, den unsere selige Mutter als ein Fleisch und Blut mit mir zugleich unter dem Herzen trug, und der sein ganzes Leben lang nicht vergessen hat, daß mir das Glück weniger hold war als ihm. Du hast den Gatten und den Vater deines Kindes verloren, wobei du freilich vor mir den Trost voraus hast, daß dich Ottavio in Verhältnissen zurückließ, um derentwillen du sein Ableben verschmerzen kannst.«
»Leone! Leone!« klang Racheles bebende Stimme. »Wie magst du in solcher Stunde mit solchen Worten zu mir reden!«
»Was weinst du jetzt? Mit Weinen allein ist hier nichts gethan. Das Unglück ist einmal geschehen, und da sind vernünftige Worte besser am Platz als zwecklose Thränen. Und wenn dir die Art und Weise, wie ich rede, gar so unzart erscheint, so mußt du nur bedenken, was Ottavios Tod für mich bedeutet hätte, wenn nicht du mit deinem Kinde zwischen ihm und mir gestanden wärst. So aber hinterläßt er mir nur die Pflicht, neben meinen eigenen häuslichen Sorgen mich auch noch um dein und deines Kindes Wohl zu kümmern.«
»Oh, ich werde dir gewiß niemals zur Last fallen.«
»Das glaub ich gerne, daß du so denkst. Leider aber verbietet mir mein Pflichtgefühl, von dieser Liebenswürdigkeit Gebrauch zu machen. Ich als der natürliche und gesetzliche Vormund deines Kindes kann das große Vermögen desselben nicht so kurzweg in der Hand einer unerfahrenen Frau lassen … und vielleicht sagen: »Mach' damit, was du willst! … wenn ich auch glaube, daß dir das unter Umständen recht lieb wäre.«
»Diesem Gespräch will ich ein Ende machen!« fuhr der Doktor auf und ging zur Thüre des Speisezimmers.
»Was wünschen Sie?« hörte ich Leone unwilligen Tones fragen.
»Ich wünsche der Signora zu sagen, daß der Sarg geschlossen werden soll.«
Tiefe Stille folgte diesen Worten des Doktors. Nun wurde die Thüre weit geöffnet, und Rachele trat ein. Ihr Gesicht war starr und blaß. Sie schien mich nicht zu gewahren; die Augen zu Boden gesenkt, ging sie wankenden Schrittes an mir vorüber. An der Thüre des Schlafzimmers angelangt, griff sie mit beiden Händen, wie um sich zu stützen, in den niederhängenden Teppich, verharrte so eine Weile und schritt dann in das matterleuchtete Zimmer. Lautlos brach sie vor dem Sarg in die Kniee und grub das Antlitz in die verschlungenen Arme. Lange, stille Minuten verrannen. Endlich erhob Rachele wieder das Gesicht – und ich gewahrte, wie sie ein kleines Etwas, wohl eine Weihmünze oder eine Reliquienkapsel, die sie an einer dünnen Schnur um den Hals getragen, von ihrer Brust löste und in die Hände des Toten legte. Mühsam richtete sie sich auf und trat unter die Thüre, das Antlitz mit ihrem Tuch verhüllend.
»Signora, nehmen Sie meinen Arm!« sagte der Doktor, der an Rachele herangetreten war, und an mir vorüber führte er sie zurück in das Speisezimmer.
Unter der Thüre winkte er mir zu, den Leichenwärter und die beiden Sargträger herbeizurufen. Ich ging, um das zu befolgen. Als ich hinter den dreien, die sich emsig an die Vollendung ihres traurigen Werkes machten, wieder eintrat, hörte ich aus dem Speisezimmer Leones laute Stimme:
»Sie nehmen sich sehr viel heraus, Signore! Ich hätte gewünscht, daß Rachele hier bleibt, da ich als Vormund ihres Kindes mit ihr zu sprechen habe.«
»Und ich in meiner Eigenschaft als Arzt mußte wünschen, daß der Signora, wenigstens für heute, jede weitere Aufregung erspart bleibt. Sie ist ohnedies von all dem Traurigen so angegriffen, daß ich eine Störung ihrer Gesundheit befürchten muß.«
»Pah! Rachele ist keines von den schwachnervigen Weibern, die über jeden Hundspfiff Krämpfe kriegen. Ich kann mir übrigens schon denken, weshalb sie Ihre hochweisliche Anordnung, sich nur ja recht schnell aufs Ohr zu legen, so gern und schleunig befolgt hat. Aber was liegt daran? Morgen ist auch ein Tag.«
Bei diesen Worten trat er unter die Thüre und traf hier mit dem Leichenträger zusammen, der die Meldung brachte, daß der Sarg geschlossen und zum Transport bereit wäre.
»Signore,« wandte sich der Doktor an Leone, »Sie werden, wie ich denke, den Sarg nach dem Leichenhause geleiten? Wenigstens ist es so Sitte, daß der nächste Anverwandte eines Toten ihm diesen Dienst erweist.«
»Was kümmert mich die Sitte!« knurrte Leone. »Ich bleibe hier. Der Sarg wird nicht gestohlen … aber hier kann alles drunter und drüber gehen, wenn nicht ein Mann nach dem Rechten sieht.«
»Gut! Nach Ihrem Belieben! Ich dachte eben, Sie würden diesen Gang, abgesehen von Ihrer verwandtschaftlichen Verpflichtung, auch wegen des Totenscheines machen, den Sie zur Erlangung der Vormundsbestätigung nötig haben. Aber damit wird's ja ein paar Tage Zeit haben. Ich werde also selbst den Sarg begleiten, und Sie können das Papier übermorgen bei mir abholen.«
»Nein, nein!« fuhr Leone mit hastigen Worten auf. »Ich werde morgen in aller Frühe zu Ihnen schicken.«
»Ich werde kaum zu treffen sein, da ich draußen in einem Landhause einen Krankenbesuch zu machen habe. Übrigens würd' ich den Schein auch keiner Mittelsperson übergeben, da ein Verlust desselben doppelte Laufereien verursachen würde.«
»Aber ich brauche das Ding morgen um neun Uhr.«
Der Doktor zuckte die Achseln und wandte sich zu den Sargträgern; als diese mit ihrer Last das Wohnzimmer durchschritten hatten, öffnete ihnen der Doktor die Thüre und machte Miene, den Trägern in den Flur zu folgen.
»Doktor! He!« rief Leone plötzlich. »Ich habe mir's anders überlegt. Ich werde doch selbst mitgehen. Ich, als Ottavios Bruder, darf diesen Dienst keinem andern überlassen.«
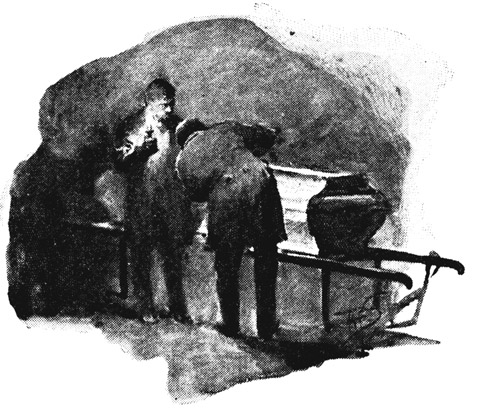
»Ganz wie Sie wünschen,« erwiderte der Doktor leichthin.
»Ich werde nach der Geschichte wieder hieher zurückkommen. Und nicht wahr, Sie erweisen mir den Gefallen, so lange noch zu warten. Man kann die Frauenzimmer nicht allein im Hause lassen.«
Der Doktor zog seine Uhr hervor, und der lange, prüfende Blick, den er auf das Zifferblatt heftete, schien zu sagen, daß ihm diese Bitte recht ungelegen käme.
»Ich habe meine Zeit zwar auch nicht gefunden,« sagte er endlich mit gedehnter Stimme. »Aber wenn Sie meinen, es muß sein, in Gottesnamen, so will ich bleiben.«
»Danke, Signore!« erwiderte Leone, nickte uns beiden einen stummen Gruß zu und verließ das Gemach. »Signor Guglielmo!« hörten wir ihn draußen rufen.
Fragend sah ich den Doktor an.
»Gehen Sie auf keinen Fall mit ihm!« flüsterte dieser. »Und wenn er Sie nicht hier läßt, so verlassen Sie ihn unten auf der Straße und kehren Sie wieder zurück, wenn er außer Sehweite ist.«
Nun ging ich in den Flur hinaus.
Leone zog mich in eine Ecke. »Thun Sie mir den Gefallen,« sagte er, »und bleiben Sie bei dem Doktor da, bis ich komme. Ich will ja nicht mißtrauisch gegen ihn sein, aber … nun ja, ich gehe eben beruhigter, wenn ich ihn nicht allein weiß. Ein andermal steh ich Ihnen zu Dienst … mit allem, was Sie von mir haben wollen.«
Überfreundlich drückte er mir die Hand und stürmte, ohne eine Antwort abzuwarten, die Treppe hinunter.
»Nun?« fragte der Doktor, als ich in das Zimmer zurückkehrte.
Ich machte ihm kein Hehl aus Leones Worten, worauf er lächelnd nach der Thüre blickte. »Ein Spitzbube wittert in jedem Menschenkind seinesgleichen. Aber sein Mißtrauen mag uns nur ein Beweis sein, daß er sich selbst klar darüber ist, was Signora Scarpa und ihr Kind von seiner Vormundschaft zu gewärtigen haben. Das ist ein schlauer Bursche! Und doch ist er mir in die Falle gegangen! Seine Habgier ist eben noch größer als seine Schlauheit. Ich möchte nur sein Gesicht sehen können, wenn er draußen dem Märchen vom Totenschein, das mir so gelegen eingefallen ist, auf die Wahrheit kommt. Dann wird es aber wohl für ihn zu spät sein. Vor Ablauf von zwei Stunden kann er unmöglich zurück sein … und diese zwei Stunden sind für uns Zeit genug.«
»Was gedenken Sie zu thun?«
»Ich denke, daß wir beide Signora Scarpa veranlassen und ihr behilflich sein werden, das Eigentum ihres Kindes vor dem Wölflein Leone in Sicherheit zu bringen.«
»Was ich fragen wollte … ich hörte Sie vorhin Leone gegenüber Bedenken über den Zustand von Racheles Gesundheit äußern. »Steht es wirklich …«
»Signora Scarpa ist gewiß auf das Tiefste erschüttert,« unterbrach mich der Doktor, »aber so schlimm, als ich es für Leone machte, ist es, Gott sei Dank, doch nicht. Ich schickte die Signora eigentlich nur aus dem einen Grund zur Ruhe, um sie vor weiteren Auseinandersetzungen mit ihrem Schwager zu schützen, der es hiebei an verletzenden Worten nicht hätte fehlen lassen. Solche Worte werden ihr zwar morgen auch nicht erspart bleiben, aber heute hätten sie doppelt geschmerzt. Kommen Sie, wir wollen uns ein wenig ausruhen. Setzen Sie sich dort in den Lehnstuhl; ich will mir's da auf dem Sopha bequem machen.«
»Ich bin nicht allzumüde,« entgegnete ich. »Dann mein' ich auch, wir sollten keine Zeit mehr verlieren.«
»Eine Weile müssen wir uns noch gedulden. Ich fürchte Leones Mißtrauen.«
Kaum hatten wir unsere Plätze eingenommen, als der Doktor lauschend den Kopf hob.
»Hören Sie ihn über die Treppe heraufschleichen?« flüsterte er. »Hören Sie nur! Er will uns überraschen. Nun steht er draußen und horcht.«
Da wurde die Thüre aufgerissen, und Leone trat in das Gemach, uns beide mit lauernden Blicken musternd.
»Signore? Was soll's?« fragte ihn der Doktor mit gut gespielter Überraschung. »Es wird doch wohl mit dem Sarge nichts passiert sein.«
»Das nicht,« erwiderte Leone, während er zu uns an den Tisch trat. »Aber unten auf der Straße ist mir eingefallen, daß ich zufälliger Weise keinen Heller bei mir habe. Und da ich draußen im Leichenhause wohl sogenannte Taxen und weiß der Teufel was sonst zu bezahlen habe, so – – Signor Guglielmo! Sie haben schon die Güte, nicht wahr?«
Ich reichte ihm ein Goldstück.
»Wird das genug sein?« fragte er, während er die Münze auf der flachen Hand wog.
»Übergenug!« fiel der Doktor ein. »Was Sie draußen zu bezahlen haben, ist eine Kleinigkeit; der Wärter und die Träger werden ohnedies ihre Rechnung schicken. Gehen Sie nur! Gehen Sie nur! Und sehen Sie zu, daß Sie bald wieder zurückkommen! Ich möchte nach Hause.«
Ohne ein weiteres Wort verließ Leone das Gemach.
»Sehen Sie,« lächelte der Doktor, »das war der ganze, richtige Leone! Er macht sich mit seiner Spionage noch einen Nebenverdienst; er kommt Geld borgen, während er doch vor einer halben Stunde Ottavios Börse zu sich steckte, die er gewiß nicht leer gefunden.« Er erhob sich und blieb inmitten des Zimmers horchend stehen, bis ein dumpfes Geräusch das Zufallen der Hausthür anzeigte. »So, nun haben wir noch immer die zwei vollen Stunden vor uns.« Damit ging er auf die Thüre zu, trat halb auf den Flur hinaus und rief Catina herbei. »Gehen Sie hinunter und sperren Sie die Hausthüre zu. Falls Signor Leone später zurückkommen und Sie deshalb befragen sollte, so sagen Sie ihm, Sie hätten die Thüre aus eigenem Antrieb versperrt, aus Furcht, es könne sich jemand ins Haus schleichen. Wenn Sie dann wieder nach oben kommen, so gehen Sie der Signora sagen, daß ich sie dringend noch zu sprechen wünsche.«
Wenige Minuten später kehrte Catina zurück mit der Nachricht, daß die Signora erscheinen würde.
Als Rachele kam, blieb sie unter der Thüre stehen und richtete ihre großen, vom Weinen geröteten Augen in stummer Frage auf das Gesicht des Doktors.
Dieser schritt ihr entgegen und führte sie zum Divan. Während er Rachele gegenüber auf einen Stuhl sich niederließ, winkte er mir zu, an seiner Seite Platz zu nehmen.
»Signora!« begann er zu sprechen. »Gestatten Sie zuvörderst, daß ich Ihnen diese Schlüssel übergebe.« Er nahm dieselben aus seiner Tasche und legte sie vor Rachele auf den Tisch. »Nur ein Zufall ist die Ursache, daß diese Schlüssel jetzt nicht dort sind, wo sich die Brieftasche, die Börse und der Schmuck Ihres Gatten befinden, nämlich in der Tasche Ihres charaktervollen Schwagers. Und nun zu dem, was ich Ihnen raten will … Ihnen raten als der jahrelange Freund und ärztliche Berater Ihres Mannes, von dem ich weiß, daß er mich zu Ihrem Schutze bestellt haben würde, wenn ihm nicht der Tod so jählings die Lippen geschlossen hätte. So trag ich mich mit der Überzeugung, daß ich mit dem, was ich beginne, einen nur unausgesprochenen Willen des Toten erfülle. Und Signor Guglielmo, von dessen aufrichtiger und wahrhaft freundschaftlicher Gesinnung für Ihr Haus ich Ihnen wohl nicht zu sprechen brauche …« es war wie ein Schatten von Schwermut, was bei diesen Worten Racheles Antlitz überflog, »Signor Guglielmo hab ich gebeten, mich mit Rat und That zu unterstützen. Es wird Ihnen bekannt sein, Signora … Leone selbst hat es Ihnen ja bereits in recht unverblümten Worten ausgesprochen … daß nach englischem Gesetz, dem Sie als Gattin eines geborenen Maltesers unterstehen, bei Ableben eines Vaters der nächste Blutsverwandte desselben, hier also Ihr Schwager Leone, zum Vormund des halbverwaisten Kindes bestellt wird. Und wenn nun Leone von morgen an das Recht erhält, mit der Hinterlassenschaft seines Bruders nach seinem, keiner Kontrolle unterstehenden Gutdünken zu schalten und zu walten … ich brauche Ihnen, Signora, den Charakter und die Lebensweise Ihres Schwagers wohl nicht näher zu schildern, damit Sie einzusehen vermögen, was in einem solchen Falle für das Hab und Gut Ihres Kindes wie für Ihr eigenes Wohlbefinden zu gewärtigen steht?«
Zur stummen Antwort neigte Rachele das Haupt.
»Aber ich denke,« fuhr der Doktor weiter, »daß sich Mittel und Wege finden lassen werden, wenn auch nicht allen Schaden zu verhindern, so doch denselben auf ein geringes Maß zu beschränken. Und eben über die Art dieser Mittel und Wege wollte ich Ihnen, falls Sie ihre Notwendigkeit einsehen, meine Meinung aussprechen. Glauben Sie …«

»Mein lieber Doktor!« unterbrach ihn Rachele, während ihr die Thränen in die Augen traten. »Wie soll ich heute fähig sein für ein Gespräch solcher Art. Ich kann heute über solche Dinge nicht sprechen … ich kann nicht … ich kann nicht!«
»Sie müssen können, Signora, und müssen es heute können! Morgen ist Leone der Vormund Ihres Kindes, und es ist zu spät …«
»Mag es denn zu spät sein! Wenn schon all das Traurige mich betroffen hat, so mag nachkommen, was will! Schlimmeres kann ich nicht mehr erfahren!«
»Es ist unrecht von Ihnen, so zu denken,« erwiderte der Doktor ernst, während er sich zu Rachele neigte und ihre beiden Hände faßte. »Die erste Pflicht, welcher Sie gerecht werden müssen, ist Ihre Pflicht als Mutter. Sie müssen Ihres Kindes denken und seiner Zukunft zuliebe vor Ihrem Schmerze der Einsicht und der Vernunft das Wort geben.«
Rachele zog ihre Hände aus denen des Doktors und ließ sich in den Divan zurücksinken. »Sprechen Sie!«
»Vorerst darf ich Sie wohl bitten, mir einige Fragen zu beantworten,« sagte der Doktor. »Haben Sie irgend welche Kenntnis von der Existenz eines Testamentes?«
»Ich weiß bestimmt, daß ein solches nicht vorhanden ist. Ottavio äußerte wohl manchmal, daß er bei Zeiten daran denken müsse, die für den Fall seines Ablebens nötigen Verfügungen zu treffen. Da ich aber wahrnahm, wie solche Bedenken immer nur seiner Fürsorge und Güte gegen mich entsprangen, so hab ich selbst immer abgeredet, indem ich meinte, daß es für solche Dinge einmal nach Jahren und Jahren an der Zeit wäre. Wer hätte auch denken mögen, daß der Tod so unerwartet an unsere Thüre pocht. Aber seltsam … gerade in den letzten Wochen sprach Ottavio häufiger als sonst von seinem Entschluß, eine letzte Verfügung zu treffen.«
»Vielleicht mag ich die Ursache gewesen sein, da ich ihm offen meine Bedenken über den Zustand seiner Gesundheit äußerte.«
»Nie hat Ottavio zu mir mit einem Wort davon gesprochen. Oh, ich weiß, er wollte mich nicht beunruhigen, mich nicht betrüben. Er war ein guter, guter Mann!«
Weinend barg Rachele ihr Gesicht in beide Hände.
»Signora! Fassen Sie sich!« mahnte der Doktor mit eindringlicher Stimme, nachdem er einen unruhigen Blick auf seine Uhr geworfen. »Denken Sie, daß diese Stunde dem Wohl Ihres Kindes gilt!«
Mit zitternder Hand drückte Rachele ihr Tuch über die Augen. »Nehmen Sie keine Rücksicht auf mich,« sagte sie. Sprechen Sie nur! Fragen Sie nach allem, was Ihnen zu wissen nötig scheint!«
»Da also ein Testament wohl nicht vorhanden ist, so enthält vielleicht der Ehekontrakt irgendwelche Bestimmungen, welche nun zur Geltung kommen?«
»Im Ehekontrakt ist, wenn ich nicht irre, von einem Witwengut die Rede, das mir bei kinderloser Ehe nach dem Tod meines Mannes zugefallen wäre.«
»Aber Sie haben ja nun eine Tochter. Ist für diesen Fall im Ehekontrakt eine Verfügung getroffen?«
»O ja! Es heißt, wenn Ottavio mir Kinder hinterließe, so sollte ich bis zu deren Großjährigkeit oder Verheiratung für meinen und ihren Unterhalt den Zinsenertrag der vier Häuser, welche er in Pera besitzt, zu freier Verfügung haben. Und erst, wenn diese Häuser Eigentum meiner Kinder würden, sollte ich in Besitz des bezeichneten Witwengutes gelangen.«
»Das ist ja vortrefflich!« rief der Doktor. »Erstens einmal sichert Ihnen diese Verfügung eine sorgenfreie Existenz an der Seite Ihres Kindes, und zweitens sichert sie die Unverkäuflichkeit jener vier Häuser für den Fall, daß Signor Leone die Absicht hätte, sich durch einen solchen Handel ein Stück Geld zu machen. Über diesen Theil des Vermögens können wir ihm also getrost die Vormundschaft überlassen. Enthält der Ehekontrakt noch anderweitige Vermögensbestimmungen?«
»Nein,« erwiderte Rachele. »Aber ich besitze eine Schenkungsurkunde über dieses unser Wohnhaus und seine Einrichtung. Als ich mit meinem Gatten hier einzog, konnte ich nicht genug Worte finden, wie sehr mir mein neues Heim gefiele … und drei Tage später überraschte er mich mit jener Schenkung. Doch leiste ich auf diesen Besitz zu Gunsten meines Kindes Verzicht … wie ich überhaupt auf alles verzichte … auf alles! Was Ottavio hinterlassen hat, soll Eigentum meiner Tochter sein. Ich verlange mir nur so viel, um mit und bei meinem Kinde leben zu können!«
Diese Worte waren von Rachele mit so seltsamer Hast und Heftigkeit gesprochen worden, daß wir beide verwundert aufblicken mußten.
»Die Absicht, welche Sie hier geäußert, Signora,« sagte der Doktor mit leisem Lächeln, »ehrt gewiß Ihre uneigennützige Gesinnung und ist ein Beweis, wie Susetta von ihrer Mutter geliebt wird. Eine Verwirklichung dieser Absicht hätte aber jetzt weder Sinn noch Nutzen, im Gegentheil. Sie würden dadurch nur in Leones Gewalt und Hände geben, was dank der Bestimmungen des Ehekontraktes und dieser Schenkungsurkunde seiner vormundschaftlichen Machtsphäre entrückt wird. Wenn Sie Ihr Kind solcherweise bedenken wollen, so warten Sie, bis Susetta den Verstand hat, die Größe dieses Geschenkes zu begreifen. Gehen wir also weiter! Besaß Ottavio außer diesen fünf Häusern noch andere Liegenschaften?«
»Nein.«
»Haben Sie Kenntnis von dem Stande seiner Geschäfte?«
»Ottavio hat im Laufe der jüngsten Wochen alle seine Geschäfte gelöst. Er sagte mir gestern noch, daß er morgen – also heute – gehen würde, um seinen letzten ausstehenden Posten einzukassieren. Oh, er freute sich so sehr auf das ruhige, behagliche Leben, das er von nun an führen wollte!«
»Welche Summe Ottavio von diesem heutigen Gange in seiner Brieftasche mit nach Hause gebracht, darüber werde ich Signor Leone befragen, wenn er zurückkommt. Auch wegen des Schmuckes …«
»Nein, nein!« unterbrach Rachele den Doktor. »Thun Sie das nicht! Er mag behalten, was er sich genommen.«
»Sie vergessen vielleicht in diesem Augenblick, Signora, daß Ottavio an Fingern und Brust ein kleines Vermögen zu tragen pflegte?«
»Gleichviel! Leone mag es behalten! Reden wir nicht mehr hierüber!«
»Ihr Wunsch ist in dieser Angelegenheit natürlich der einzig maßgebende. Und nun meine letzte Frage. Wie steht es mit dem Vermögen, das Ottavio sonst noch besaß, etwa in Papieren oder anderweitigen Wertsachen?«
»Davon weiß ich Ihnen wenig zu sagen, da ich nie Veranlassung hatte, über solche Dinge von meinem Manne Aufklärung zu verlangen, oder eine solche nur zu wünschen. Bekannt ist mir jedoch, daß er noch von früheren Zeiten her große Summen in wertvollen Schmuckgegenständen und ungefaßten Steinen liegen hat. Alles übrige freie Geld besteht in türkischen Papieren. Doch äußerte er vor wenigen Tagen erst die Absicht, diese Papiere gegen ausländische zu vertauschen.«
»Ließe sich nicht aus irgend welchen Aufschreibungen oder aus Ottavios Büchern der Wert dieser Steine und die Höhe dieser Summen ersehen?«
»Mein Mann hat weder über seine Geschäfte noch über den Stand seines Vermögens jemals Buch geführt. Sein gutes Gedächtnis war sein Buch. Wenn Sie es doch für notwendig erachten, die angedeuteten Aufschlüsse zu erhalten, so gibt es hiefür einen sehr einfachen Weg. Hier liegen noch die Schlüssel. In dem eisernen Schranke, der in meines Mannes Schlafzimmer steht, werden Sie all die Dinge finden, von denen ich Ihnen eben gesprochen.«
Der Doktor erhob sich und griff nach den Schlüsseln. »Ich bitte, Signora … wir haben Eile …«
Rachele erschrak, daß sie ganz weiße Lippen bekam. »Nein! Nein! Das kann ich nicht! Ich bitte! Lassen Sie mich hier! Ich bitte, bitte!« Es war ein rührend ängstlicher Blick, mit welchem Rachele bei diesen Worten ihre Augen über unsere Gesichter irren ließ.
»Signora …«
»Lassen Sie mich, ich bitte, lassen Sie mich hier!« Unter Thränen faltete Rachele die Hände. »Ich kann Ottavios Gemach heute nicht betreten … nicht zu solchem Zweck betreten … ich kann nicht! Gehen Sie allein, ich bitte! Sie kränken mich, wenn Sie von mir eine Beaufsichtigung dessen verlangen, was Sie aus freundschaftlicher Sorge für mich und mein Kind unternehmen. Muß ich es denn mit Worten sagen, daß ich zu Ihnen und zu Ihrem Freunde …« es war das erstemal, daß Rachele mit einem Worte meiner Anwesenheit gedachte, »daß ich zu Ihnen und zu Ihrem Freunde so volles und festes Vertrauen habe, wie zu niemanden auf der Welt. Glauben Sie, daß ich es sonst mit diesem Gespräche so weit hätte kommen lassen? Von jedem Rate, den Sie mir erteilen, weiß ich, daß er nur mein und meines Kindes Wohl im Auge hat … und ich werde ihn befolgen, ohne nur eine Sekunde zu überlegen. Gehen Sie also, ich bitte, gehen Sie!«
Der Doktor bot Rachele seine Hand, und als sie ihm die ihrige reichte, erwachte ein seltsamer Glanz in seinen Augen. Ich schalt mich im stillen – aber ich konnt' es nicht hindern, daß ich ein Gefühl des Neides und der Eifersucht empfand.
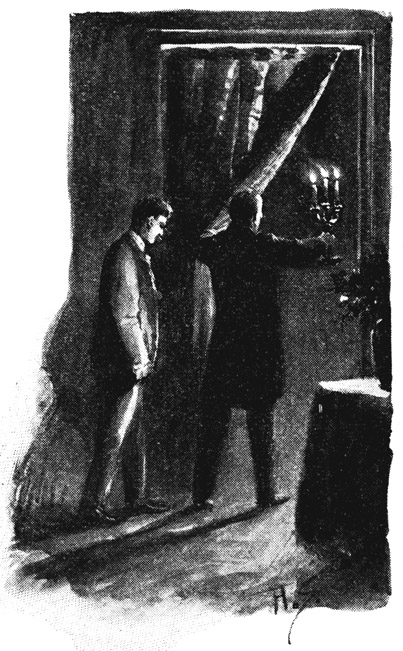
An mir vorüber ging der Doktor zu einem Pfeilertisch und entzündete einen dreiarmigen Leuchter.
Noch einmal zog es meinen Blick zu Rachele – sie saß gebeugt, die Hände im Schoß verschlungen – dann folgte ich dem Doktor in das Wohnzimmer. Er schritt, den Leuchter in der einen, die Schlüssel in der anderen Hand, bereits der Thüre von Ottavios Schlafstube zu, als ich ihn einholte. »Doktor? Ich meine, es wäre für alle Fälle besser, das Licht hier zu lassen, da das Fenster von da innen nach der Straße geht.«
»Sie haben recht. Aber wir werden uns in dem Halbdunkel schwer zurecht finden.«
»Geben Sie nur mir die Schlüssel. Ich glaube, daß ich nach all der Übung in meinem Berufe mit solchen Dingen umzugehen weiß.«
Aus dem Bunde, den mir der Doktor reichte, sonderte ich jenen Schlüssel aus, den ich seiner komplizierten Gestalt nach für den richtigen hielt, und betrat das kleine Gemach. Man roch die Farbe des Sarges noch und den schweren Dunst der Wachskerzen. Da überkam mich's wie eine Anwandlung von Ohnmacht, ein Schauer überflog meinen Leib, und geraume Weile stand ich vor dem Schranke, die beiden Hände eingekrampft in die Schnörkel seines Gesimses.
»Ist Ihnen nicht wohl?« fragte der Doktor, der an meine Seite getreten war.
»Es wird vorübergehen,« sagte ich, mit Gewalt meine Schwäche überwindend.
Als ich den Schrank geöffnet hatte, trugen wir die sechs Schubfächer, die er enthielt, auf den Tisch des Speisezimmers.
Es war ein großes Vermögen zu nennen, was hier in Papieren, in Ringen, Nadeln, anderweitigen Schmuckgegenständen und ungefaßten Steinen vor uns lag.
Zwei der Schubfächer waren mit Briefschaften und Verträgen angefüllt.
Der Doktor holte Schreibzeug herbei, und während er die Zahl und Gattung der Schmucksachen und Steine notierte, verzeichnete ich die Nummern und den Betrag der Papiere. Kein Wort wurde gesprochen – und Rachele saß regungslos die ganze Zeit, mit nassen Augen niederstarrend auf ihre verschlungenen Hände.
Ich war mit meiner Arbeit früher zu Ende, als der Doktor mit der seinen, und benützte die Zeit, um von unseren Aufzeichnungen eine Abschrift zu machen, sowie die kunterbunt durcheinander liegenden Briefschaften und Schriftstücke mit laufenden Nummern zu versehen.
»Und nun,« sagte der Doktor, nachdem alles geschehen war, »nun wollen wir beraten, wie wir all das, was hier vor uns liegt, vor den Händen Leones in Sicherheit bringen. Ich habe mir zwar hierüber schon manches gedacht,« wandte er sich zu mir, »da Sie jedoch in Geldangelegenheiten und was damit zusammenhängt sicher besser beraten sein werden, so darf ich Sie wohl bitten, vorerst Ihre Meinung zu äußern.«
»Die erste Notwendigkeit,« erwiderte ich, »die wir im Auge behalten müssen, ist die, daß jeder Schritt, den wir unternehmen, sich innerhalb der rechtlichen Grenzen hält, damit keine unserer Maßregeln den Verdacht erwecken kann, als hätte sich Signora Scarpa durch die Bergung dieser Werte irgendwelches Verfügungsrecht über dieselben sichern wollen. Dazu haben wir den Beistand eines Anwaltes nötig, der in den hier giltigen Gesetzen über Mündelpflege eingehend Bescheid weiß. Ich möchte zu diesem Zweck der Signora den hiesigen Anwalt unseres Hauses, den Dr. Grenelli, empfehlen.«
»Ich kenne ihn persönlich,« fiel der Doktor ein. »Es ist das ein durch und durch verläßlicher Mann.«
»Ich kann dafür bürgen,« wandte ich mich an Rachele, »daß Ihnen Grenelli nach bestem Wissen raten wird. Bis er aber Gelegenheit finden dürfte, mit Ihnen hierüber zu sprechen, oder etwa nötige Schriftstücke durch Sie zeichnen zu lassen, können immerhin Tage vergehen – denn ich bin überzeugt, daß Leone von dem Augenblick an, in welchem er wieder dieses Haus betritt, keinen Ihrer Schritte unbewacht lassen wird. Unsere jetzige Ungestörtheit haben wir ohnedies nur der Unfolgsamkeit seiner Töchter zu verdanken, von denen er verlangte, daß sie die Nacht hier zubringen sollten. Es ist also inzwischen ein Schritt der Notwehr nicht zu umgehen. Vor allem müssen diese Wertsachen außer Haus sein, bevor Leone zurückkehrt. Freilich ist es auch, um allen Verdacht von seiner Seite zu vermeiden, wieder notwendig, daß er bei seiner Zurückkunft uns beide hier vorfindet.«
»Da weiß ich einen Ausweg,« unterbrach mich der Doktor, einen raschen Blick auf seine Uhr werfend. »Ja, es geht. Wir haben fast eine ganze Stunde noch vor uns … und ich brauche nur zwanzig Minuten. Aber sprechen Sie weiter!«
»Da eine längere Verwahrung so großer Werte in einem Privathause eine riskierte Sache wäre,« fuhr ich fort, »so dürfte es das Beste sein, dieselben im Laufe des morgigen Vormittags, entweder unter meinem oder des Doktors Namen als Geheimdepot der Ottoman-Bank zu übergeben, wo sie so lange verbleiben könnten, bis Grenelli sie in einer Weise zu sichern weiß, welche die vormundschaftlichen Befugnisse Leones entkräftet. Bevor jedoch die Deponierung vollzogen wird, wäre es notwendig, die türkischen Papiere gegen sicher fundierte ausländische Werte umzutauschen. Alles das könnte bis zwölf Uhr Mittags geschehen sein. Hierauf könnten wir Grenelli aufsuchen, ihm die Sache auseinandersetzen und das hier liegende Verzeichnis, die vorgefundenen Schriften, sowie den Depotschein in seine Verwahrung geben; die Bestätigung hierüber würde dann in Ihrem Besitze sein, noch ehe Leone seine Bevollmächtigung als Vormund in Händen haben wird.«
»Signora,« wandte sich, nachdem ich geschlossen hatte, der Doktor an Rachele, »ich weiß den Vorschlägen Signor Guglielmos keine besseren entgegenzuhalten. Sollten jedoch dieselben Ihren Beifall nicht haben …«
»Sie quälen mich, Doktor!« unterbrach ihn Rachele. »Ich fühle, daß Sie beide mir's zum besten meinen … das genügt mir, und darin liegt auch schon meine ganze Zustimmung zu allem, was Sie thun … zu allem!«
»Gut! So will ich mich gleich an meine Aufgabe machen. Kaum fünfhundert Schritte von hier wohnt ein mir befreundeter Kollege, auf dessen Charakter und Verschwiegenheit ich bauen kann. Ihm will ich, was Sie uns hier anvertrauen, für eine Stunde in Verwahrung geben. Doch halt, ich habe noch ein Bedenken. Wenn Leone morgen, mit seiner Vollmacht in der Hand, den Schrank öffnen wird, um ihn völlig leer zu finden, so ist es vorauszusehen, daß er zu den äußersten Mitteln greifen wird, um das, was wir vor ihm zu retten suchen, wieder in seine Gewalt zu bekommen. Denn wenn ihm Ottavio über den Stand seines Vermögens auch niemals Aufklärung gab, so hatte Leone doch sicher so viel Einblick in die Verhältnisse, um sich sagen zu können, daß sich in Susettas Erbe neben den Liegenschaften auch bares Geld finden müsse. Wird er aber einige tausend Piaster vorfinden, so wird ihm fürs erste, wie ich ihn kenne, der Sperling in der Hand lieber sein, als die Taube auf dem Dach. Daß man sich vor seiner Vormundschaft gewahrt und geschützt hat, wird er zwar noch immer vermuten, da ja Mißtrauen und schlechte Absicht immer gleichen Schritt halten, aber er wird sich, um mit dem Vorgefundenen einstweilen ungestört wirtschaften zu können, statt auf Skandal und Gerichtshilfe, auf das Heucheln und Spionieren verlegen. Es frägt sich nur, Signora, welche Summe Sie für diese Schutzmaßregel opfern wollen?«
Aufs geradewohl griff Rachele mit beiden Händen in die auf dem Tische liegenden Papiere und reichte, was sie so zusammengerafft, dem Doktor.
Dieser zögerte. »Signora,« sagte er mahnend, »was Sie da in Händen halten, ist eine große Summe!«

»Nehmen Sie! Nehmen Sie nur! Ich bedenke, daß Ottavio, wenn es ihm vergönnt gewesen wäre, eine letzte Verfügung zu treffen, seinen Bruder gewiß nicht hätte leer ausgehen lassen. So mag sich Leone von diesem Gelde nehmen, was ihm beliebt … mag er alles behalten … ich werde mit keiner Silbe darum fragen.«
»Mir scheint zwar eine Großmut in solchem Maße hier nicht am Platz,« erwiderte der Doktor, »denn Sie werden wenig Dank davon ernten … aber es ist Ihr Wille!«
Wir vertheilten die Papiere, welche Rachele dem Doktor gereicht, je nach der Höhe ihres Betrages in die einzelnen Schubfächer und notierten auf der von ihm gefertigten Nummernliste die Größe der zurückbleibenden Summe. Es waren sechzigtausend Piaster. Dann trugen wir die Fächer in den Schrank zurück. Als ich denselben versperrte, gewahrte ich, wie der Doktor suchend umherblickte.
»Vermissen Sie etwas?«
»Das nicht! Aber ich habe hier in einer Ecke ein kleines Handkoffer stehen sehen, das mir gute Dienste leisten würde. Ah, da ist es.«
Wir kehrten in das Speisezimmer zurück und packten die sämtlichen Schriftstücke, Papierwerte, Schmucksachen und Steine in das Köfferchen.
»Sie, Signore,« wandte sich der Doktor zu mir, werden den Schlüssel des Koffers und die beiden Originalverzeichnisse in Verwahrung nehmen.« Dann reichte er Rachele den Schlüsselbund und die Abschrift der Verzeichnisse. »Signora werden gut thun,« sagte er, »diese beiden Papiere in den nächsten Tagen immer bei sich zu tragen, da Leone aller Wahrscheinlichkeit nach auch Einsicht in Ihre Schränke und Schatullen verlangen wird. Und nun Gott befohlen einstweilen! In weniger als zwanzig Minuten bin ich wieder zurück.«
Schweigend, doch mit einem dankbaren Blick zu ihm aufschauend, reichte ihm Rachele die Hand.
Nun ging er – und ich war allein mit ihr.
Keine Hand wagte ich zu rühren, kein Auge zu heben. So verrann eine geraume Weile. Da plötzlich rauschte ihr Gewand – und als ich aufsah, stand Rachele vor mir.
»Ich hoffe, Signore,« sagte sie flüsternd, mit gesenkten Wimpern, »ich hoffe, daß es Sie nicht kränken wird, wenn ich mich zurückziehe.«
»Nein, nein, Signora!« stammelte ich. »Achten Sie meiner nicht! Sie bedürfen der Ruhe, der Erholung! Gehen Sie! Gehen Sie!«
Mit zitternder Hand ergriff Rachele die Schlüssel und die beiden Blätter, welche vor ihr auf dem Tische lagen, neigte wortlos das Haupt ein wenig und ging mit müden Schritten der Thüre zu.
Da krampfte sich mir die Brust zusammen, und alles, was mir das Herz bedrückte, stieg mir auf die Zunge. Eh ich noch wußte, daß ich es that, hatte ich Rachele schon eingeholt.

»Signora … ein Wort … ein Wort nur … es läßt mir keine Ruhe …«
Als aber Rachele mit ihren großen, traurigen Augen zu mir aufsah, war mir die Zunge wie gelähmt. Mühsam rang ich nach Atem und Fassung, bis es sich in stockenden Lauten von meinen Lippen löste:
»Ich möchte Ihnen danken, Signora … für das rücksichtsvolle Wort, welches Sie zu mir gesprochen … und danken für das Vertrauen, das Sie mir in dieser Stunde erwiesen! Denn ich nehme dieses Vertrauen als einen Beweis, daß Sie mich für die Unbesonnenheit nicht verdammen, mit der mein Herz an Ihnen gesündigt hat. Aber ich kann nicht zufrieden sein damit … Sie müssen es sagen, daß Sie mir vergeben … mit Worten sagen, wenn ich nicht vergehen soll unter der Last meiner Selbstvorwürfe. O könnten Sie wissen, was ich in diesen für Sie so traurigen Stunden empfunden und gelitten habe … gelitten unter dem quälenden Bewußtsein, daß ich es war, der Ihnen die Bitternis dieser Stunden noch mehr verbitterte! Glauben Sie mir, Signora, daß ich weniger Verdammung, als Bedauern und Mitleid verdiene. Denn auch mir ist mit diesem Tag ein herzliebes Etwas gestorben, das nun für mich unwiederbringlich ist: die Hoffnung auf ein Glück im Leben. Nicht aus Güte … denn die hab ich nicht verdient … sagen Sie es aus Mitleid, daß Sie mir vergeben!«
Mit bangen Augen hing ich an dem blassen Antlitz Racheles, welche regungslos meinen Worten gelauscht hatte.
Nun hob sich unter tiefem Atemzug ihre Brust, und während sich ihre Augen mit Thränen füllten, reichte sie mir die Hand. Als ich mich aber neigte, um diese heißen, zitternden Finger mit einem schüchternen Kusse zu streifen, wandte sich Rachele von mir, und leise schluchzend verließ sie das Gemach.
Als ich allein war, öffnete ich die Balkonthüre, trat hinaus in die laue, sternenlichte Nacht, umklammerte mit beiden Armen einen der laubumrankten Pfeiler und weinte bittere Thränen. Nun erst, da alles für mich verloren war, fühlte ich so recht im tiefsten Innern, wie mein ganzes Herz an diesem Weibe hing.
Aber Tragik und Komik liegen im Leben eng bei einander. Ich mache diese gerade nicht mehr neue philosophische Anmerkung, um mir von dir, mein lieber Freund, wenn ich als Erzähler treu bei der Wahrheit bleibe, ein spottendes Lächeln zu ersparen.
Als meine Thränen versiegten, als ich ruhiger wurde, empfand ich einen nagenden Hunger. Ich hatte seit mehr als vierundzwanzig Stunden keinen Bissen mehr genossen. Nun ging es nah auf Mitternacht, eine Zeit, zu der ich auf dem Heimweg alle Speiselokale schon geschlossen finden mußte. Aber mich tröstete der Gedanke an die gute, alte Paraskeva – wenngleich ich von ihr nicht viel mehr zu erwarten hatte, als eine Tasse Thee und harten Zwieback.
Wenige Minuten später kam der Doktor zurück. Als ich ihn das Wohnzimmer betreten hörte, verließ ich den Balkon und schloß die Thüre wieder ab.
»Sie sind allein?« fragte er verwundert noch auf der Schwelle.
»Signora Scarpa hat sich zurückgezogen, gleich nachdem Sie gegangen waren,« gab ich ihm zur Antwort, wobei ich in seinem Gesicht eine Miene der Enttäuschung zu gewahren vermeinte.
»So wollen wir unsere Plätze wieder einnehmen, wie wir sie inne hatten, als Leone ging. Er kann nicht lange mehr ausbleiben. Aber halt …« Er ging zur Thüre und rief das Mädchen. »Nicht wahr,« sagte er, als Catina vor ihm stand, »Sie sind der Signora von Herzen zugethan?«
»Ach ja! Ach ja! Das weiß der Himmel! Ich gäbe für sie meinen letzten Blutstropfen … und am liebsten wär ich selbst gestorben, wenn ich ihr den ganzen Jammer von heute damit hätte ersparen können!«
»Gut, Catina, gut! Weinen Sie nur nicht! Sie sind eine brave, treue Person. Aber wenn Sie die Signora vor neuem Kummer behüten wollen, so äußern Sie zu keinem Menschen eine Silbe davon, daß wir beide in Signor Leones Abwesenheit die Signora gesprochen und daß ich auf eine Viertelstunde das Haus verlassen habe. Und nun gehen Sie! Im Speisezimmer drehen Sie noch die Lampen ab, und wenn Sie die Thüre von innen versperrt haben, legen Sie sich schlafen. Signor Leone wird jetzt auch ohne Ihre Hilfe ins Haus kommen, da ich unten den Riegel offen ließ. Und wenn er Sie morgens ausfragen sollte … Sie haben nichts gehört und nichts gesehen, und nachdem Sie nicht gewußt, daß er wiederkäme, vielmehr geglaubt hätten, daß wir beide bis zum Morgen hier blieben, hätten Sie sich um elf Uhr schlafen gelegt, da Sie so todmüde waren. Frauenzimmer fürchten sich auch gerne vor Gespenstern und Dieben … deshalb dürfen Sie draußen alle Thüren, durch die man zu den Zimmern der Signora gelangen könnte, ebenfalls versperren … ich meine für den Fall, daß es Leone in den Sinn kommen sollte, die Signora in ihrer so nötigen Nachtruhe zu stören. Haben Sie mich verstanden? Ja? Also gute Nacht, liebe Catina, gute Nacht! Ich werde morgen der Signora sagen, welch ein gutes und braves Mädchen Sie sind! Gute Nacht!«
Catina ging – und schweigend saßen wir uns gegenüber.
Doch nahezu eine halbe Stunde verging, bis wir von der Treppe Leones schwere Tritte vernahmen. Er trat ein, ohne Gruß, den Hut auf dem Kopf und die Hände in den Taschen. Eine Weile betrachtete er uns schweigend, den plumpen Kopf zwischen den Schultern wiegend, dann lachte er kurz und gezwungen auf, näherte sich dem Tisch und schnauzte den Doktor an:
»Wollen Sie mir jetzt wohl gefälligst sagen, was das eigentlich für ein Schwindel ist, den Sie mir da aufgebunden … mit diesem Teufelsschein!«
Der Doktor erhob sich seufzend vom Divan, und während er gähnend die Arme reckte, sagte er:
»Erstens einmal schreien Sie nicht so! Und zweitens müssen Sie Ihre ungezogenen Worte mit näheren Erläuterungen versehen, wenn ich sie verstehen soll.«
»Sie verstehen mich nicht? Sie als Doktor müssen doch wohl am besten wissen, daß man einen solchen Totenschein gar nicht bekommt. Der Mensch da draußen lachte mir ins Gesicht, als ich den Fetzen verlangte.«
Der Doktor zuckte die Achseln. »Du mein Gott! In solchen Dingen wechseln hier die Vorschriften alle paar Monate. Glücklicher Weise hab ich seit Jahresfrist in meiner Praxis keinen Todesfall zu verzeichnen … es ist also immerhin möglich, daß inzwischen eine Änderung der früheren Bestimmungen getroffen wurde, von der ich noch keine Kenntnis besitze.«
Leone warf seinen Hut in eine Ecke. »Sie können mir da leicht vorreden, was Ihnen gerade Spaß macht. Ausreden werden Sie mir aber damit nicht, daß Sie Ihren guten Grund hatten, mich zum Hause hinaus zu bugsieren.«
»Einen Grund?« erwiderte der Doktor lachend. »Höchstens den einen, daß ich hier auf einem für meine Länge zu kurzen Divan durch nahezu drei Stunden Ihrer ungemütlichen Rückkehr entgegensehen konnte, während zu Hause ein bequemes Bett meiner wartet. Ja, und wenn ich schon bleiben mußte, könnt ich auch einen zweiten Grund gehabt haben: mir durch die Entfernung Ihrer Person Ihre flegelhaften Redensarten zu ersparen.« –
Einige Minuten später standen wir auf der Straße, und zornig stieß Leone hinter uns den Riegel vor.
Mit raschen Schritten wanderten wir dem Hause zu, in welches das inhaltsschwere Köfferchen zu vorläufiger Verwahrung gegeben war, und brachten dasselbe, um die Dschambassokak nicht mehr passieren zu müssen, auf einem Umweg nach der Wohnung des Doktors.
Während wir durch die nachtstillen und menschenleeren Straßen dahingingen, besprachen wir die Stunde, zu der wir uns am andern Tage treffen wollten, um den gemeinschaftlich übernommenen Verpflichtungen gerecht zu werden.
»Ich werde auch,« sagte ich unter anderem, da wir uns schon dem Hause des Doktors näherten, »ich werde auch morgen, so früh ich mir einen Boten beschaffen kann, ein paar Zeilen an Grenelli schicken, damit wir ihn um die Mittagsstunde sicher in seinem Bureau treffen.«
»Hören Sie, einen besseren Dienst als die Empfehlung dieses Grenelli hätten Sie unseren beiden Schutzbefohlenen nicht erweisen können. Es überraschte mich wirklich, wie schnell und sicher Sie die Sachlage erkannten und den besten Rat zu finden wußten.«

»Was wäre dabei so Überraschendes? Während Sie an die Signora all jene nötigen Fragen richteten, hatt' ich ja vollauf Zeit, meine fünf Sinne zusammenzunehmen. Über Sie jedoch, lieber Doktor, hab' ich gestaunt. Ihnen ging ja alles von der Hand, als ob Sie die Folgen dieser Katastrophe und die Art und Weise, wie Sie zu Gunsten von Mutter und Kind hier eingreifen müßten, schon Wochen und Monate lang überlegt und bis ins Kleinste bedacht hätten.«
»So ist es auch!« nickte der Doktor mit halblauter Stimme vor sich hin. »Und Sie wundern sich darüber? Allerdings … ein wenig wunderlich mag es erscheinen, doch nur so lange, als Sie den wahren Grund meiner Fürsorge nicht kennen. Er ist mit einem Worte gesagt – – ich liebe Rachele! Was stehen Sie nun da und starren mich an! Einmal mußte mir das über die Lippen … und da sag' ich es immer noch besser einem Manne, bei dem ich so viel Freundschaft für mich voraussetze, daß er dieses Wort in seinem Innern bewahren wird, als daß ich es der geliebten Frau gestanden hätte, von der ich weiß, daß ich der allerletzte bin, an den ihr Herz in Liebe denken möchte.«
Wir hielten vor der Thüre des Doktors. Tief seufzend hob er die Hand – und mit dumpfem Halle schlug der schwere Klopfer an die dunklen Bohlen. Bald wurde ein schlurfender Tritt im Innern des Hauses hörbar; nun klirrte der Riegel, und die Thüre wurde geöffnet.
»Gute Nacht, Signore! Und morgen auf Wiedersehen!«
»Gute Nacht!«
Da stand ich nun und starrte die geschlossene Thüre an. Wie ein Schlag vor die Stirne war mir das gewesen. Auch er liebte sie – auch er war der siegenden Gewalt dieser Schönheit erlegen. Und mir, gerade mir mußte er das gestehen! Um mich zu quälen, um mich zu beschämen! Um mich zu zwingen, daß ich mir sagen mußte, wie er in seiner Liebe um so vieles besser wäre! Er hatte alle Wünsche seines Herzens verschlossen gehalten in tiefster Brust, und die einzige Bethätigung, die er seiner Liebe gewährt hatte, war Sorge gewesen für das Wohl derer, die er liebte, Sorge und Mühe, daß ihr ferneres Geschick nach dem herben Schlag, den er voraussah und nicht verhindern konnte, nicht abhängig wäre von der Willkür eines Schurken. Und ich – was hatte ich gethan! Kränkung und Schmerz, das waren die Gaben, die aus meiner Liebe für Rachele erwachsen. Aber ich war ja gestraft! Der Witwenschleier, den dieser grauenvolle Tag über Racheles Haupt gebreitet, mehr aber noch die Hand, welche sie mir als ein Zeichen der Vergebung gereicht, hatte mir die Lippen geschlossen für jedes fernere Wort der Hoffnung und Liebe. Nun zählte mein Bleiben nur mehr nach Tagen – was hätt' ich auch anderes an diesem Orte noch suchen und finden können, als Mehrung meiner Qual und Verlängerung meiner Marter. Fort, fort – je schneller, um so besser! Ein anderes gab es nicht mehr für mich! Er indessen, er konnte bleiben, durfte in ihrer Nähe weilen, mit ihr die gleiche Luft atmen, durfte sie bewachen und beschützen und konnte in geduldiger Ruhe die Zeit erwarten, die den Wünschen seines Herzens günstig wäre.
Unter solchen Gedanken, die an meinem Herzen nagten, erreichte ich meine Wohnung.
Als ich hinter Paraskeva, die mich erwartet hatte, die schmale Treppe zu meinen Zimmern hinaufstieg, klang mir aus dem zweiten Stock ein dreistimmiges Geschrei entgegen, das wohl Gesang sein sollte. Die Mitglieder dieses nächtlichen Terzettes waren Madama Giuditta und ihre würdigen Töchter.
»Oh! Oh! Kyrie, Kyrie!« jammerte Paraskeva, als sie in meinem Zimmer den Leuchter auf den Tisch stellte. »Das sind böse, böse Leute! Hören Sie nur, hören Sie nur! Oh, Kyrie! Denken Sie, Kyrie, vor einer halben Stunde war ich oben … da haben sie sich auf dem Boden gewälzt! Besoffen sind sie, Kyrie, besoffen wie die Schweine! An einem solchen Tage! Kaum daß er noch recht tot ist, der liebe, gute Signor Ottavio! O, diese arme, arme, liebe, gute schöne Frau! Dieser Signor Leone … Kyrie, er bezahlt mich, ich bin seine Magd, ich will nichts weiter sagen … aber, Kyrie … vor zwei, drei Stunden war er hier, da haben sie oben gejubelt und geschrieen, und wie er wieder weg war, da hat mich Madama gerufen und da hat sie mir Geld gegeben … ein grausames Geld, Kyrie, ein grausames Geld … und da mußte ich Zuckerwerk holen und Obst und Fleisch und Backwerk und Kapaunen und Cyperwein … und nun haben sie gefressen und sind besoffen, Kyrie, besoffen wie die Schweine!«

So machte Paraskeva noch eine geraume Weile ihrer Entrüstung Luft, eh' ich ein ruhiges Gehör fand für jenes nagende Anliegen, bei dem ich so sicher auf ihre Hilfe gebaut hatte – und Paraskeva täuschte auch meine Hoffnung nicht. Freilich, als ich sie nach kurzer Abwesenheit mein Gemach mit schmunzelnder Geheimthuerei wieder betreten und den Tisch mit Fleisch und Wein bestellen sah, hütete ich mich, auch nur mit einer Silbe der Herkunft dieser mir so willkommenen Dinge nachzufragen, um mich durch eine wahre Antwort nicht in die Lage versetzt zu sehen, auch noch die Nacht hindurch hungern zu müssen.
Nachdem Paraskeva mein Zimmer verlassen hatte, aß ich mit Heißhunger, in den sich Ekel mischte, und schlief dann bis zum Morgen einen schweren, traumlosen Schlaf, um beim Erwachen meine Müdigkeit und Abspannung wenig gelindert zu finden.
Mein erster Weg war es, Grenelli aufzusuchen und ihm die besprochenen Zeilen zu übergeben; dann holte ich den Doktor ab.
Die Ordnung der Angelegenheiten, die wir übernommen, ging rascher von statten, als ich gedacht, so daß wir bereits gegen ein Uhr Mittags bei Rachele vorsprechen konnten, um ihr die schriftlichen Belege der von uns unternommenen Schritte zu überreichen und ihr mitzutheilen, was nach Grenellis Meinung weiter in dieser Sache geschehen müsse. Da auf den nächsten Tag, es war ein Samstag, ein hoher Feiertag fiel, und da an diesem wie am darauffolgenden Sonntage jeder Geschäftsverkehr stockte, und nachdem auch vorauszusehen war, daß Rachele an diesen beiden Tagen wohl kaum eine unbewachte Stunde finden würde, hatten wir verabredet, daß Grenelli erst im Laufe des Montags Signora Scarpa aufsuchen sollte, um die für seine Schritte nötigen Beglaubigungen und Vollmachten von ihr unterzeichnen zu lassen.
Bevor wir die Dschambassokak erreichten, blieb der Doktor zurück, um nicht gleichzeitig mit mir in Racheles Wohnung einzutreffen. Auch steckte er alle Papiere zu sich, da er als Arzt am besten Gelegenheit finden würde, mit Rachele allein zu sein.
Als ich einige Minuten später in dem lieben Hause die Treppe hinaufstieg, die ich so oft mit Hoffen und Bangen betreten hatte – weiß Gott, da war es mir recht bang ums Herz.
Im Vorzimmer traf ich Catina. Ich fragte, wie Rachele die Nacht und den Morgen verbracht hätte.
»Die Signora hat des Nachts wohl ein paar Stunden geschlafen, aber gar nicht gut, gar nicht gut!« gab mir Catina flüsternd zur Antwort. »Und am Morgen hat ihr Signor Leone keine Ruhe mehr gelassen. Umgewirtschaftet hat er im Hause wie ein Wilder. Um neun Uhr sind dann die beiden Mädchen gekommen, und er ist gegangen. Vor einer Stunde nun hat sich die Signora wieder ein wenig niedergelegt …«
»Ich hoffe doch, daß das Befinden der Signora nicht Anlaß zu Besorgnis giebt?« fragte ich beklommen.
»Die Signora ist wohl recht gebrochen … du mein Gott, dieser gestrige Tag und das viele Weinen … aber wenn sie sich jetzt zurückgezogen hat, that sie es eigentlich nur, um sich von den beiden Mädchen loszumachen, die sich recht seltsam aufführen. Michelina liegt im Wohnzimmer auf dem Divan und schnarcht wie ein Kutscher; und draußen auf dem Balkon sitzt Signorina Viola und hält mit beiden Händen den Kopf. Zehnmal gewiß hab' ich ihr schon Limonade bringen müssen. Gott, o Gott! Wie wird es jetzt in diesem Hause zugehen!« Seufzend fuhr sich Catina über die Augen. »Soll ich der Signora sagen, daß Sie da sind?«
Weshalb sollte ich Rachele in ihrer Ruhe stören? Was ich ihr zu sagen hatte, konnte sie vom Doktor besser und ungestörter erfahren. Und mir selbst ersparte ich einen Schmerz – ihr Anblick hätte mir nur wieder gezeigt, was ich verlieren und verlassen mußte.
So reichte ich dem Mädchen meine Karte und ging.
Unten im Flur traf ich mit dem Doktor zusammen; ich theilte ihm mit, was ich von Catina erfahren; mit einem stummen Händedruck trennten wir uns.
Den Rest des Tages nützte ich, um alle jene Gänge und Besorgungen abzumachen, die vor meiner Heimreise noch nötig waren. Da mir in meiner gedrückten Stimmung das laute, buntwechselnde Leben einer Seereise gewiß zuträglicher sein mußte, als die monotone, quälende Langeweile einer mehrtägigen Eisenbahnfahrt, so sicherte ich mir einen Platz auf einem Schiffe, das am Montag um zehn Uhr morgens nach Triest in See gehen sollte.
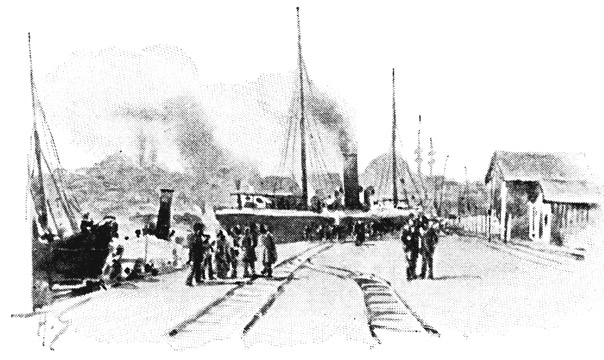
Als ich gegen Abend meiner Wohnung zuwanderte, trat ich noch in einen Kaufladen und nahm einen bunten Kleiderstoff und etliche Seidentücher mit nach Hause. Ich wollte mir einen guten Platz in Paraskevas Andenken sichern.
Die gute Alte geriet außer Rand und Band, als ich ihr den Kram auf die Arme legte – aber die Freude schlug in sprachlosen Jammer um, als ich ihr die Bedeutung des Geschenkes klar machte. Sie weinte helle Thränen, während sie nur ein einziges Wort für ihren Kummer fand:
»Kyrie … Kyrie … Kyrie …«
Ich versuchte die gute, treue Person zu trösten; aber die Bächlein, welche über ihre runzligen Wangen flossen, wollten lange nicht versiegen. Nachdem sie mir geholfen hatte, meine Koffer vom Vorplatze in das Zimmer zu tragen, ging's wieder aufs neue los, und wer weiß, wie lange dieses zweite Jammerkapitel gedauert hätte, wäre Paraskeva nicht von Madama Giuditta in das obere Stockwerk gerufen worden.
Ich ordnete meine Papiere und fing an, das Entbehrlichste in die Koffer zu legen. Gegen zehn Uhr vernahm ich auf der Treppe draußen Leones schwere Tritte. Er mußte wohl eben erst nach Hause gekommen sein; und seine Laune schien nicht die beste, denn ich hörte, wie er die arme Paraskeva mit einer Flut von Schimpfworten überschüttete, weil er das Hausthor unverriegelt gefunden hatte. Thüren wurden oben zugeschlagen, und über mir schwankte die Decke unter Leones dumpftönenden Schritten. Hatte ihm vielleicht das Ergebnis seiner ersten vormundschaftlichen That die Laune verdorben?
Ich wandte mich wieder meiner Beschäftigung zu, und es mochte dabei eine geraume Weile vergangen sein, als ein kurzes, heftiges Pochen an meiner Thür ertönte, die sich auch schon öffnete.
Signor Leone trat ein, und während er langsam näher kam, hefteten sich seine eingekniffenen Augen mit stechendem Ausdruck an mein Gesicht.
»Zum Teufel, Signore, was hab ich hören müssen?« knurrte er zwischen den geschlossenen Zähnen hervor. »Sie wollen verreisen? Das ist aber schnell gekommen! Weshalb denn?«
»Der Brief, welchen Sie mir vorgestern zu überbringen die Güte hatten, ruft mich nach Hanse,« erwiderte ich, ohne mich im Packen durch Leones Anwesenheit stören zu lassen. »Ich wäre morgen schon gereist, wenn nicht das beklagenswerte Ereignis des gestrigen Tages meine Absicht geändert hätte. Ich wünsche dem Begräbnis Ihres Bruders beizuwohnen und habe deshalb meine Abreise auf Montag verschoben.«
»So, so! Ja … ich glaub es gerne, daß Sie Ursache haben, ihm diese letzte Ehre zu erweisen. Er hat ja an Ihnen gehangen, wie der Hund am Herrn, der ihn kurbatscht. Ein Glück, daß ich kein allzu empfindsames Gemüt habe, sonst hätt' ich als sein leiblicher Bruder ausgiebigen Grund zur Eifersucht finden müssen.« Ein hölzernes Gelächter schloß diese Worte.
Ich gab ihm keine Antwort, sondern trat in mein Schlafzimmer, um den Schrank zu leeren. Als ich wieder zurückkehrte, einen Pack Kleider auf dem Arme, saß Leone mit baumelnden Füßen auf dem Tisch und wickelte sich eine Cigarette.
»Was ich sagen will! Wissen Sie …« sich unterbrechend, führte er die Cigarette an den Mund, um das Papier zu netzen, »wissen Sie, daß ich meinen Bruder für reicher gehalten habe, als es sich heute herausgestellt hat? Ich dachte mir, wenn ich als Susettas Vormund meines Bruders Kästen und Schränke öffne, würde ich das Geld in dicken Säcken und die Banknoten in hohen Stößen vorfinden. Und was hab ich gefunden? Ein paar lumpige Hunderter, die kaum ausreichen werden, die Begräbniskosten und die jedenfalls noch ausständigen Rechnungen zu bezahlen.«
Der Halunke! Sechzig tausend Piaster nannte er »ein paar lumpige Hunderter«! Oder – er hatte so auffällig harmlos gesprochen – sollte diese Rede nur eine Falle sein? Hatte er einen Verdacht, und hoffte er ein unvorsichtiges Wort von mir zu hören? Dieser Gedanke huschte durch meinen Kopf, bevor ich antwortete:
»Was Sie da sagen, überrascht mich einigermaßen. Allerdings, für so übermäßig reich, wie Sie Ihren Bruder hielten, hab ich ihn nie genommen. Aus dem anständigen Haushalte, den er führte, schloß ich wohl, daß Ottavio sehr vermögend sein müsse; aber einen Aufwand, oder sonst einen Umstand, der solch einen unermeßlichen Reichtum hätte voraussetzen lassen, hab ich in der Zeit meines Verkehres mit ihm nie beobachten können. Daß es aber mit der Hinterlassenschaft gar so kärglich bestellt wäre, hätt' ich mir auch nicht gedacht. Und da bedaure ich die Signora … unter solchen Umständen wird sie das Haus, welches ihr so lieb zu sein scheint, wohl verlassen müssen, um leben zu können.«
Leone lachte laut auf. »Was Sie doch ein guter Mensch sind! Aber Ihr Mitleid ist hier ganz am unrechten Orte. Meine holde Frau Schwägerin ist recht schön aus der Patsche … die kann sich ins Fäustchen lachen. Das Haus mit allem, was es enthält vom Keller bis unters Dach, ist ihr als Eigentum zugeschrieben, und daneben hat sie mit ihrem Kind die Nutznießung der vier andern Häuser.«
»Ottavio besaß außer seinem Wohnhaus noch andere Häuser?« fragte ich mit allen Zeichen der Verwunderung. »Und gleich ihrer vier?«
»Das wußten Sie nicht?«
»Das erste Wort, das ich höre. Aber nun ist mir alles begreiflich. Wie können Sie da von einer armseligen Hinterlassenschaft reden? Da haben Sie das große Vermögen! Vier Häuser … sie brauchen nicht einmal Paläste zu sein … repräsentieren einen Besitz, von dessen Erträgnis eine Familie besser leben kann als nur gut und anständig.«
»Ah ja, ah ja! Wenn Ottavio diese Häuser vorige Woche gekauft hätte, wäre gegen solch eine harmlose Ansicht kein Tipfelchen einzuwenden. Aber sie waren ja sein Eigentum schon lange vor dieser gottverdammten Heirat! Und nun frag ich: wo ist das Geld, das er in den letzten vier Jahren verdient hat, von dem nicht zu reden, was er vor dieser Zeit noch an Barem besessen haben muß? He? Wo ist dieses Geld? Es müssen Heidensummen gewesen sein!«
Ich zuckte die Achseln. »Hierüber hab ich kein Urteil und keine Meinung, nicht einmal eine ganz harmlose.«

»Aber ich … ich hab eine Meinung!« schrie Leone, rutschte vom Tisch, wobei er die brennende Cigarette in einen Winkel schleuderte, und trat mit raschen Schritten dicht an meine Seite. Sein Gesicht war weiß, die Nasenflügel zitterten, und unheimlich funkelten seine Augen. »Ich, ja, ich meine, daß man sich vorgesehen hat, da drüben … daß man das Geld beiseite geräumt hat … so … so …« Dabei streifte er mit den gespreizten Fingern der verkehrten Hand durch die Luft, machte im Handumdrehen eine Faust und steckte sie in die Tasche. »Und ich hab auch so meine Ansicht, wann das geschehen ist, wann … verstehen Sie mich … wann! Solang Ottavio im Hause lag, ist es nicht geschehen! Und nach der Zeit, zu der ich das Haus wieder betrat, ist es auch nicht geschehen. Was also folgt daraus? He? Was folgt daraus?«
Lächelnd sah ich ihm ins Gesicht. »Signor Leone! Nehmen Sie es mir nicht übel, wenn ich lache … aber was Sie da vorbringen, geht mir ein wenig gegen den Verstand. Zugegeben, es wären solche Summen, wie Sie vermuten, vorhanden gewesen … zugegeben, es hätte jemand Kenntnis davon und zugleich die Absicht gehabt, dieses Geld an sich zu bringen und hätte diesem Wunsch entsprechend gehandelt … wie kann Ihnen ein vernünftiger Gedanke sagen, daß dieser Handstreich gerade in der angedeuteten Zeit ausgeführt wurde? Nicht wahr, Sie meinten doch die paar Stunden, während welcher der Doktor und ich Ihre Rückkunft erwarteten? Signor Leone, bedenken Sie doch … wir beide saßen ja die ganze Zeit über im Wohnzimmer … der Geldschrank, wenn ich mich recht erinnere, steht in Ottavios Schlafzimmer, das keinen andern Zugang hat als durch das Wohnzimmer … die Thüre stand offen, so daß wir auch das leiseste Geräusch hätten vernehmen müssen, wenn es der Dieb versucht hätte, durch das Fenster einzudringen.«
Verdutzt blickte mir Leone in die Augen. »Dieb? Dieb?« knurrte er zwischen den Zähnen hervor. »Wer hat denn von Stehlen und Rauben gesprochen? Nein, nein, so schlimm ist es nicht … das heißt, wie man es eben nehmen will … unter Umständen noch schlimmer. Kurz und gut, ich glaube, daß meine Schwägerin den größten Theil des vorhandenen Geldes während meiner Abwesenheit beiseite geschafft hat, um … um mir meine Arbeit als Vormund zu erleichtern, oder mit anderen Worten, um sich selbst in den Besitz dieser Summen zu setzen. Und des weiteren glaub ich, daß man ihr dabei geholfen hat … verstehen Sie mich … geholfen!«
Nachdenklich blickte ich eine Weile vor mich hin, als ob ich mir Mühe gäbe, den Sinn dieser Worte zu erfassen, dann schüttelte ich den Kopf und sagte mit allem Ernst, den ich in meine Stimme zu legen vermochte: »Ich habe von Signora Scarpa eine zu gute Meinung, ich halte sie für zu edeldenkend und rechtschaffen, als daß sie das Erbe ihres Kindes nur um einen Heller schmälern möchte. Welchen Grund sollte sie also zu der von Ihnen bezeichneten Handlungsweise gehabt haben, da es doch für sie, als eine in Geldsachen unerfahrene Frau, nur angenehm sein muß, das Vermögen ihres Kindes in so gewiegten und verläßlichen Händen zu wissen, wie die ihres Schwagers.«
Leone drückte das eine Auge zu und visierte mit dem andern schief über die Nase nach meinem Gesicht.
»Und … wie sagten Sie noch? Geholfen soll man ihr haben? Ach ja …« nun lachte ich möglichst herzlich, »jetzt erst begreif ich die Bitte, die Sie gestern vor Ihrem Fortgehen an mich stellten. Was Sie jetzt als geschehen bezeichnen, hielten Sie schon damals für möglich. Sie sahen in dem guten Doktor diesen sogenannten Helfer, und deshalb ließen Sie mich wohl so gleichsam zu seiner Überwachung zurück?«
»Ja … so gleichsam! Nun aber scheint es mir,« platzte Leone heraus, »daß ich mir den Wolf unter die Schafe gepfercht habe.«
»Signor Leone!« fuhr ich auf.
»Nun, nun, nun … was nehmen Sie das jetzt gar so tragisch!« begütigte Leone, wobei ich es ihm wohl ansah, daß er seine unvorsichtigen Worte gern wieder zurückgenommen hätte. »Ich habe ja nichts Schlimmes damit sagen wollen. Ich meinte eben … ich dachte …«
»Was Sie dachten oder meinten, ist mir völlig gleichgiltig. Ich bemerke Ihnen nur, daß Sie ein Wort gesprochen haben, welches mich eine möglichst rasche Beendigung dieses Gespräches wünschen läßt.« Damit ging ich in mein Schlafzimmer und schlug hinter mir die Thüre zu.
Es währte jedoch keine Minute, so stand Leone wieder vor mir.
»Signore, lassen Sie die Geschichte gut sein!« sagte er. »Bedenken Sie die paar Tage, die wir noch beisammen sind! All die Zeit über waren wir die besten Freunde, und so wollen wir auch ohne Streit auseinander gehen. Kommen Sie mit nach oben! Speisen Sie mit uns zu Abend!«
»Ich danke!«
Eine Weile blieb er noch auf der Schwelle stehen, dann zuckte er die Achseln und ging.
Dieser Auftritt hatte mich sehr verdrießlich gestimmt – und am meisten war ich über mich selbst ungehalten. Ich hatte da eigentlich eine recht unwürdige Rolle gespielt. Zwar durfte ich mir zu meiner Entschuldigung sagen, daß es einer guten Sache zulieb geschehen war – aber diese Entschuldigung wollte mich wenig trösten, da bedenkliche Zweifel in mir wach wurden, ob ich dieser guten Sache auch wirklich einen guten Dienst geleistet. Ich fürchtete, die Harmlosigkeit etwas gar zu weit getrieben und so den Verdacht Leones nur bestärkt zu haben, statt ihn zu entkräften. Es war ersichtlich – er wollte keinen Streit, er wollte es mit mir nicht verderben, sah vielmehr in mir die richtige Quelle für das, was er zu erfahren wünschte, und hoffte aus dieser Quelle auch noch zu schöpfen.
Diese Bedenken verließen mich nicht wieder, und als ich mich in später Nachtstunde aufs Lager streckte, hielten sie gar lange noch den Schlaf von meinen Augen fern. Die Sorgen meines Herzens sprachen auch mit lauten Worten auf mich ein – es war eine schlimme, schlimme Nacht.
Mit dem Morgen verließ ich frühzeitig das Haus. Auf neun Uhr war Ottavios Begräbnis angesetzt. Als ich vor dem Friedhof anlangte, war es höchste Zeit, denn bereits ordnete sich der kleine Trauerzug. Ich trat an die Seite des Doktors, der mich stumm begrüßte, und fragte ihn leise nach Racheles Befinden.
»Sie ist leidend, sehr leidend,« erwiderte er flüsternd. »Allen Ernstes hab ich ihr verbieten müssen, dem Begräbnis beizuwohnen. Vor Unruh und Aufregung zu Hause konnte ich sie freilich nicht schützen – Leone hat seine ›liebe, gute‹ Michelina zu ihrer ›Stütze‹ zurückgelassen. Haben Sie sich übrigens diesen Signor Leone und seine beiden Damen schon angesehen?«
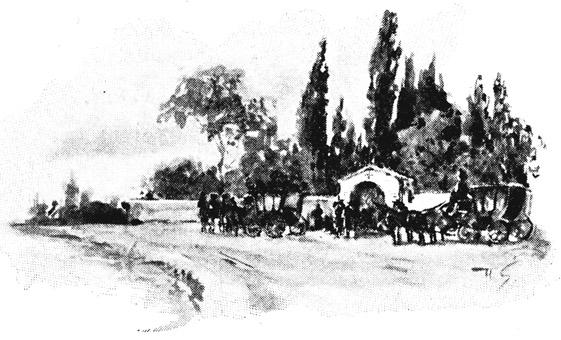
Ein Blick nach den Genannten belehrte mich, was der Doktor mit dieser Frage gemeint hatte. Was Leone am Leibe trug, von den Stiefeln bis zum Hut, war funkelnagelneu – und der Trauergewänder, mit denen ich Madama Giuditta und Signorina Viola bekleidet sah, hätte sich eine Fürstin nicht zu schämen brauchen.
Als man den Sarg in das Grab senkte, brachen die drei Leute in überlautes Schluchzen aus. Diese komödiantenhafte Heuchelei empörte mich, und es war mir bitter leid um den stillen Mann da unten, der um seines guten Herzens willen wohl bessere und aufrichtigere Thränen verdient hätte.
Nach Beendigung der Ceremonie wollte ich mich in Begleitung des Doktors entfernen. Signor Leone jedoch faßte mich, da ich an ihm vorüberschritt, beim Ärmel.
»Warten Sie ein paar Augenblicke,« sagte er, »bis ich meine Weiber eingepackt habe. Ich fahre mit Ihnen.«
Da ich einem Alleinsein mit Leone ausweichen wollte, erwiderte ich, daß ich bereits dem Doktor den freien Platz in meinem Wagen für die Rückfahrt angeboten hatte. Doch kümmerte sich Leone wenig um diesen Einwurf, und da ich auf dem Friedhof keinen Streit hervorrufen wollte, mußt' ich es mir gefallen lassen, daß Leone mich in den Wagen schob und an meiner Seite Platz nahm.
Wir fuhren noch keine Minute, als Leone bereits begann, das am verwichenen Abend besprochene Thema zu variieren. Ich schlug diesmal einen anderen Weg ein, ließ ihn reden und beantwortete jede seiner Fragen mit Schweigen.
Mein Mittel schien zu fruchten, denn nach einer Weile verstummte Leone, drückte sich in die Wagenecke und begann an seinen Nägeln zu kauen. Plötzlich aber richtete er sich mit einem Ruck wieder auf und faßte mit beiden Händen meinen Arm.
»Signor Guglielmo!«
»Signor Leone?«
»Wir wollen zu Ende kommen.«
»Diesen Wunsch hab ich seit Ihrem ersten Worte.«
»Ich … ich habe das anders gemeint! Sehen Sie, mein Bester … ob Sie mir so sagen oder so … ob Sie mir ellenlange Meinungen vorplaudern oder ob Sie gar nichts reden … ich lasse mich nun einmal auf den Glauben hin hängen, daß Sie und der Doktor meiner Schwägerin behilflich waren, von Ottavios Hinterlassenschaft etliche hunderttausend Piaster zu ihrer freien Verfügung auf die Seite zu legen. Was fahren Sie nun schon wieder auf? Lassen Sie mich doch ausreden! Ich mache mir ja deshalb über Sie nicht den geringsten schlimmen Gedanken. Ich kann es mir vorstellen, wie's gegangen ist. Man wird Ihnen vorgeplauscht haben, daß ich für solche Summen nicht der Mann des Vertrauens wäre, und Sie … nun ja – –« Mit einer Miene des Bedauerns schlug Leone die Hände auf seine Schenkel. »Oh, ich kenn' ihn, diesen Doktor! Ich bin nicht so blind, wie mein guter dummer Ottavio! Wär es mir nachgegangen, so wäre dieser Bursche schon längst kopfüber zum Hause hinausgeflogen. Aber natürlich, mein harmloser Ottavio schwor alle Himmel auf die Tugend seiner Frau. Und ich weiß es, sie hat's mit dem Doktor gehalten, seit Jahren schon.«
»Pfui, Signore!« fuhr ich auf, bebend vor Entrüstung. »Wie mögen Sie in solchen Worten über eine Frau sprechen, die … ich will nicht davon reden, wie nah sie Ihnen steht … die nun verlassen und einsam, mit heißen Thränen ihren Gatten betrauert, an dessen Grab Sie vor zehn Minuten die Güte hatten, einige Zähren mühsam zu vergießen. Pfui, Signore! Pfui!«
»Was haben Sie denn? Herr du mein Gott … fressen Sie mich nur nicht! Was hab ich nur so Schreckliches gethan? Eine ganz unschuldige Meinung hab ich geäußert … und hab mir gedacht, daß das unter Männern wohl noch erlaubt ist. Und weil ich einmal diese Meinung habe, so darf es mir, als Susettas Vormund, nicht gleichgültig sein, wenn sich die beiden aus Ottavios Hinterlassenschaft für alle Fälle ein angenehmes Reisegeld reservieren. Viel, sehr viel, alles liegt mir daran, zu erfahren, was man beiseite gebracht und wohin man es gebracht hat.«
Er schien auf irgend ein Wort von meiner Seite zu warten. Ich aber achtete seiner mit keinem Blick, mit keiner Miene; der Platz neben mir war Luft für mich.
»Signore,« hub er nach einer Weile wieder an, »Sie sind ein verständiger, praktischer junger Mann, ein Mann, der weiß, was Geschäft heißt. Ich will Ihnen etwas sagen – – zehn Prozent sollen Sie verdienen!«
Ich erhob mich. »Kutscher! Halten Sie den Wagen an!«
»Wohin denn?« fragte Leone verdutzt.
»Überall hin, wo ich Ihre Gesellschaft los bin.«
»Machen Sie keine Witze!« brummte Leone, während er mich bei den Rockschößen faßte und in die Polster niederzog. »Fahr weiter, Halunke!« schrie er dem Kutscher zu und nannte ihm, als die Pferde sich in Trab setzten, Racheles Wohnung. »Ich hoffe, Sie haben nichts dagegen, wenn ich mich von Ihnen vor dem Hause meiner Schwägerin abladen lasse. Also … wie steht's mit unserem Geschäft? Oder trauen Sie mir etwa nicht? Gut! Sie sollen mich kennen! Heute noch, ehe Sie mir nur das geringste Wort gesagt haben, sollen Sie zehn Tausend bar haben … den Rest, wenn alles glatt abgelaufen ist. Sie sehen, ich mein' es ehrlich und reell. Nun? So reden Sie doch wenigstens ein Wort! Sagen Sie, was Sie wollen!«
»Meine Ruhe will ich haben! Und wenn Sie diesen Wunsch nicht beachten sollten, werde ich Sie in unliebsamer Weise daran erinnern müssen, daß Sie in meinem Wagen sitzen, in dem ich mir eine Gesellschaft und eine Unterredung nicht gefallen zu lassen brauche, die mich beleidigt!«
»Gut, gut! Es muß ja nicht sein! Ich werde wohl auch auf andere Weise hinter die Geschichte kommen. Nur dürfen Sie dann nicht mir die Schuld geben, wenn Sie in Folge meiner weiteren Schritte Veranlassung bekommen sollten, Ihre Abreise auf unbestimmte Zeit zu verschieben.«

Ein Achselzucken war meine ganze Antwort auf diese Drohung, und so fuhren wir den Rest des Weges schweigend dahin.
Als wir Racheles Haus zu Gesicht bekamen, gewahrte ich an einem der Fenster Michelinas Kopf, der jedoch hastig verschwand, nachdem das Mädchen unser Kommen bemerkt zu haben schien.
Der Wagen hielt; und bevor ihn Leone noch verlassen hatte, stand Michelina bereits unter der Hausthür, in Hut und Schleier, ein kleines Paket auf den Armen haltend.
»Weshalb hast du nicht gewartet, bis ich nach oben kam?« wurde sie von Leone angeschnauzt.
»Weil ich um jede Minute froh bin, die ich eher hier fortkomme,« erwiderte das Mädchen, vollends auf die Straße tretend. »Mit Rachele ist kein Wort zu reden, sie zerfließt nur immer in Thränen. Hätt' ich es noch eine Stunde aushalten müssen, so wär' ich gestorben vor Langweile.«
»Was hast du da?« fragte Leone, während er mit beiden Händen das Paket auf Michelinas Armen betastete.
»Ein paar von Racheles Büchern. Ich habe sie mir zum Lesen mitgenommen.«
Leone wandte sich zu mir. »Signore! Würden Sie wohl die Kleine da in Ihrem Wagen mit nach Hause nehmen?«
Die Erfüllung dieses Wunsches war jedoch nicht nach meinem Geschmack. »Ich bedaure, daß mein Weg mich nach der entgegengesetzten Richtung führt,« sagte ich, den Wagen verlassend. »Doch werde ich diesen Weg eben so gern zu Fuß zurücklegen. Es steht also mein Wagen der Signorina zur Verfügung.«
Ich bezahlte den Kutscher und ging meiner Wege.
Ein paar Stunden wanderte ich planlos in den Straßen umher, dann suchte ich meine Wohnung auf, um mich umzukleiden und eine neue Jammerscene der guten Paraskeva über mich ergehen zu lassen. Während des übrigen Tages machte ich den vergeblichen Versuch, die Unruhe meines Innern zu betäuben. Ich unternahm eine Segelfahrt nach Skutari; ich zog, als der Abend eingebrochen war, von einem lautbelebten Vergnügungsplatze zum andern – um mich unter tausend fröhlichen Menschen traurig und einsam zu fühlen. Spät in der Nacht kehrte ich nach Hause; da starrten mich die Wände meiner ungastlichen Stuben im fahlen Kerzenschimmer so kahl und trostlos an, daß ich mich heiß nach der Stunde sehnte, in der ich diese Stadt verlassen konnte, um bald im Kreise meiner heimischen Freunde und in neuer Arbeit, wenn auch nicht Genesung und Vergessen, so doch Linderung für mein krankes Herz zu finden.

Am andern Morgen packte ich den Rest meiner Sachen in die Koffer. Den Bedarf für die Reise gab ich in eine größere Handtasche, so daß in der Kommode nur mehr zurückblieb, was ich für den nächsten Tag an Wäsche bedurfte. War es Laune von mir, war es Zufall – ich weiß es nicht – bei diesen paar Sachen ließ ich auch jenen kleinen Revolver liegen, von dem ich dir, wenn ich nicht irre, gesprochen habe. Ich wollte das Ding während der Reise zu mir stecken.
Kurz nach elf Uhr verließ ich meine Wohnung, um den Doktor und Rachele ein letztesmal zu besuchen. Den ersteren traf ich nicht zu Hause; so hinterließ ich meine Karte, auf die ich mit einigen Worten schrieb, wie sehr ich es bedauern würde, wenn ich gehen müßte, ohne persönlichen Abschied von ihm genommen zu haben. Dann wanderte ich meinem zweiten Ziele zu. Je näher ich demselben kam, desto langsamer wurden meine Schritte, desto ungestümer pochte mein Herz. Nun sollte ja das letzte Wort gesprochen werden, das Lebewohl für immer und ewig.
Eine kurze Strecke noch trennte mich von dem Hause, da sah ich Signor Leone aus der Thüre stürmen. Sein Gesicht glühte wie von heller Freude. Nun ward er meiner gewahr, blieb stehen, und laut lachend schlug er mir seine Hand auf die Schulter.
»Sie gehen zu Rachele? Gehen Sie nur! Gehen Sie nur! Sie wird eine rechte Freude haben! Ja, ja, glauben Sie es nur, wir haben viel von Ihnen gesprochen, gerade jetzt.«
Und lachend schritt er seines Weges dahin, ein um das anderemal noch das Gesicht wendend, wobei es mich bedünkte, als spräche Spott und Hohn aus seinen Augen.
Was war da geschehen?
Ein seltsames Gefühl der Bangigkeit erfaßte mich. Hastigen Schrittes ging ich der Thüre zu, trat in den Flur und eilte die Treppe hinauf.
Da stand Catina.
»Ist die Signora zu sprechen?«
»Ich glaube wohl. Soeben war sie noch mit Signor Leone im Speisezimmer.«
Ich reichte dem Mädchen meinen Hut und betrat das Wohnzimmer. Die Thüre zum anstoßenden Raume stand offen. Ich überschritt die Schwelle. Die weichen Teppiche hatten den Hall meiner Tritte gedämpft, und so mußte Rachele mein Kommen wohl überhört haben.
Mit dem Rücken gegen die Thüre saß sie auf einem Stuhl, das Antlitz niedergeneigt in die beiden Arme, welche gekreuzt auf dem Tische lagen.
»Signora!«
Ein dumpfer Schrei, und hochaufgerichtet stand Rachele vor mir. Wachsbleich hob sich ihr Gesicht aus dem schwarzen Gewand, ihre Lippen zuckten, Thränen standen auf ihren Wangen, in die der Gram sein erschreckendes Siegel gedrückt, und aus verweinten Lidern sahen zwei fieberglühende Augen auf mich wie in Abscheu und Entsetzen.
»Was suchen Sie hier, Signore?« klang es mit schrillender Stimme von ihren Lippen.
Dieser Anblick, diese Worte und der Klang dieser Stimme lähmten mir die Zunge. Ich brachte kein Wort hervor, stand nur und starrte mit ratlosen Blicken in diese Augen, deren Ausdruck und Sprache mir unfaßbar waren.
Mit vorgestrecktem Halse näherte sich Rachele. »Hören Sie nicht, Signore … ich frage, was Sie bei mir noch suchen? Wahrlich, alles begreif' ich, nur das eine nicht, wie Sie den Mut finden, hier zu stehen … hier vor mir! Oh, es gelüstet Sie wohl, mit eigenen Augen zu sehen, was Sie mir angethan, als Sie mein Kind um sein Erbe und mich um den guten Glauben betrogen, mit dem mein Herz an Ihnen hing.«
»Signora,« stammelte ich, »sagen Sie, ich hätte gemordet … das will ich leichter fassen als den Sinn all dieser anderen Worte!«
»Gut so! Gut so! Gesellen Sie zu Ihrer That noch die Feigheit der Lüge. Seh ich ja doch, daß sie Ihnen so leicht von der Zunge geht, wie all die biederen Ratschläge, die Sie in jener entsetzlichen Nacht einem weinenden Weibe ertheilten. Ich dachte nicht an Geld und Gut … ungerufen kamen Sie, und aus meinen Thränen mich aufrüttelnd, sagten Sie mir: Denken Sie an Ihr Kind! Schützen Sie sein Erbe vor schurkischen Händen! Weshalb thaten Sie das, da Sie mich verraten wollten? Um mich und mein Kind nur um so wehrloser jenen Händen preiszugeben?«
»Signora, Signora! Wie können Sie glauben …«
»Glauben? Glauben?« unterbrach mich Rachele mit einer Stimme, die in Zorn und Thränen halb erstickte. »Glauben? Was bewiesen ist, das glaubt man nicht … das weiß man! Gehen Sie! Ihr Anblick ist mir Pein und Ekel! Gehen Sie! Und mag Ihnen mein Haß und meine Verachtung den Genuß des Judaslohnes verbittern, dem zuliebe Sie ein Schurke wurden!«
Zitternd stand ich vor Rachele und bohrte mir die Nägel in das Fleisch meiner Hände. »Ich gehe, ja, ich gehe! Doch wenn ich in meinem Herzen eine tödliche Kränkung mit mir forttrage aus diesen Mauern, muß ich mich fragen, ob Sie das Recht haben, mich solcher Erbärmlichkeit fähig zu halten, nur weil ich … andere Ursache weiß ich nicht … in einer unseligen Stunde meine Vernunft von meiner Sehnsucht besiegen und meine Lippen zu dem Weibe eines andern in Liebe sprechen ließ.«
»Schamloser!« schrie mir Rachele ins Gesicht, während sie die Fäuste wie zum Schlage gegen mich erhob. »Liebe? Wag' es nicht wieder, dieses heilige Wort auf deine Zunge zu nehmen! Es würde dich ersticken! Oh …« In sich zusammenbrechend, preßte sie schluchzend die Hände vor das Gesicht. »Ottavio! Ottavio! Diesen Menschen hast du geliebt! Um dieses Menschen willen hab' ich dich in meinem Herzen betrogen!«
»Rachele!«

Ein Schauer rüttelte ihren Leib, als dieser Name von meinen Lippen klang. Dann richtete sie sich auf und ließ die Arme fallen, die wie tot an ihr hinunter hingen. »Ja … ja … magst du es wissen! Was deine That über mich und mein Kind gebracht, ist eine Unbill, die ich verschmerzen könnte. Daß aber du es warst, der dies gethan … du … gerade du … das ist für mich der Wahnsinn! Denn dich hab' ich geliebt von der Stunde an, in der ich dein rotes Blut um meinetwillen in den Staub rinnen sah. Was half es mir, daß ich nicht lieben wollte … mein Herz war stärker als mein Wille. Was half es mir, daß ich zum Schutze vor mir selbst mich an den Arm dessen klammerte, dem ich meine Ehre zugeschworen, der mir alles gab, was Güte geben kann! Was konnten Ehre und Güte meinem Herzen sein, da es die Liebe wollte! Nichts! Nichts! Was ich am Tage dachte, war Sünde, und Verbrechen der Traum meiner Nacht … und nur die Liebe zu meinem Kinde hat mich bewahrt, daß mein Denken und Träumen nicht sündige Wahrheit wurde. Als ich aber in jener Stunde, die du so unselig nennst, mich an deinen Worten berauschte … hörst du … da fing ich auch an, meines Kindes zu vergessen. Doch es war zu viel … zu viel! Du bist blind gewesen … aber Gott hat mir in die verworfene Seele geschaut, und um mich zu strafen, hat er mir in eben dieser Stunde den Vater meines Kindes getötet! Oh, nun mag er schlafen, draußen in der stillen Erde … ruhig schlafen! Du selbst hast ihn an mir gerächt, als du mich jenen verachten lehrtest, den ich wider Willen und Ehre bis zum Wahnsinn liebte. Weißt du nun, was du thatest? Bist du nun mit dir zufrieden? So geh … und auf jedem Wege soll mein Haß an deiner Seite gehen wie dein Schatten. Geh! Geh! Oder ich könnte vergessen, daß ich ein Weib bin!«
Ich wollte ihre Hände fassen, wollte sprechen, aber –
»Catina! Catina!« klang es mit gellendem Schrei von Racheles Lippen.
Draußen ging die Thüre, und mit erschreckten Mienen erschien das Mädchen auf der Schwelle – ich aber taumelte hinaus, dem Irrsinn näher als dem Bewußtsein all dessen, was ich in dieser Stunde erlebt hatte.
Als ich auf der Straße stand, mußte ich mich an die Mauer stützen, so zitterten mir die Kniee. Ich griff an meine Stirne, die sich anfühlte wie die Stirn eines Fieberkranken – ich fragte mich, ob ich denn wirklich wache, oder ob es nicht doch ein Traum wäre, was so mein Herz zerriß und meine Seele marterte.
Dann wieder begriff ich nicht, wie ich all diese Worte über mich hatte ergehen lassen können, ohne zu einer Abwehr die Kraft zu finden. Aber das hatte mich überfallen, wie die brausende Flut den harmlos am Strande Wandelnden.
So also war die Stunde beschaffen, in der ich erfahren sollte, daß ich geliebt war – und wie geliebt! Und nun erst mußt' ich es erfahren, nun, da diese Liebe sich in Haß verwandelt hatte! Doch wenn es so war – wer trug die Schuld daran? Wer?
Leone! Leone! In diesem Namen lief alles zusammen, was ich an Kränkung, Schmerz und Empörung in mir wühlen fühlte. Dieses Wort gab mir die Besinnung wieder und sagte mir, was ich zu thun hatte.
Mit taumelnden Schritten eilte ich meinem Hause zu. Hier erfuhr ich von Paraskeva, daß Leone bei Tisch wäre. Was kümmerte mich das! Ich sprang die beiden Treppen hinauf und trat in das Speisezimmer. Da saß die ganze Sippe um eine reich gedeckte Tafel.
»Schon zurück? Ja?« fragte Leone, ohne den Knochen, den er just benagte, vom Munde zu nehmen.
»Ich habe mit Ihnen zu reden!« stieß ich in bebendem Zorn hervor.
»Was Sie sagen? Aber gut, in einer halben Stunde steh' ich zu Diensten.«
»Wenn ich hätte warten wollen, so wär' ich nicht jetzt gekommen!«
»Aber, mein Bester, Sie werden doch nicht verlangen, daß ich den Braten kalt verzehren soll.« Bei diesen Worten stach er sich ein neues Stück aus der gehäuften Schüssel. »Wenn Sie übrigens eine gar so wichtige Neuigkeit bringen … reden Sie nur … die gönn' ich meinen Frauenzimmern auch.«
Die beiden Mädchen steckten kichernd die Köpfe zusammen, während Madama Giuditta mich mit koketter Handbewegung an den Tisch lud. »Wollen Sie nicht ein wenig mithalten, Signore? Sie sehen, wir haben im Überfluß.«
»Also? Was giebt's?« fragte Leone mit vollem Munde.
»Sie fragen, was es giebt? Ich komme von Rachele!«
»Von Rachele? Ei, sieh mal! Aber eigentlich hab' ich mir das gedacht. Und … ja … nun kann ich mir auch denken, was Sie zu mir führt. Nicht wahr … Sie bringen mir den Depotschein der Ottoman-Bank?«
»Dieses Wort beweist mir, daß Sie nun wissen, was Sie gestern von mir erkaufen wollten …«
Lachend unterbrach mich Leone. »Ja, gestern hätt' ich noch ein Heidengeld für diese Wissenschaft bezahlt, die ich heute so billig haben konnte.«
»Ich will nicht fragen, woher Ihnen diese Wissenschaft kam. Doch eines frag' ich: Wie Sie es wagen durften, mich als jenen zu bezeichnen, von dem Sie alles erfuhren … für Geld erfuhren? Ja! Ja! Das haben Sie Rachele gesagt, das müssen Sie ihr gesagt haben … oder sie hätte nicht so zu mir sprechen können … nicht so …« die Stimme versagte mir.
»Ach, Sie Armer! Sie scheinen da in eine recht unbehagliche Zwickmühle gekommen zu sein!« lachte Leone. »Aber Gott soll mich strafen, wenn ich zu Rachele nur ein einziges Wort in solchem Sinne gesagt habe! Es ist mir also ganz unbegreiflich, wie sie zu Ihnen – – Gott! Nun merk' ich erst, wie Sie aussehen! Geht Ihnen die Geschichte denn gar so nahe? Sie zittern ja an Händen und Füßen! Kommen Sie … kommen Sie …« Er beugte sich vom Tisch und zog einen Stuhl an seine Seite. »Ruhen Sie sich ein wenig aus! Sie wollen nicht? Gut, nach Belieben! Also … was ich sagen will, ja … nicht im Traum ist mir's eingefallen, zu Rachele ein Wort von Ihnen zu sagen. Ich bin heute vormittags zu ihr gegangen, hab' ihr gesagt: Du, Rachele, das und das weiß ich, so viel ist bei Seite geschafft worden, man hat es der Ottoman-Bank in Depot gegeben, ich will keinen Skandal machen, aber ich hoffe, daß ich bis morgen mittag den Depotschein in Händen habe, oder … ja, oder, hab' ich gesagt … sonst keine Silbe mehr. Darauf ist sie eine Weile dagesessen und hat kein Wort geredet … mit einmal aber schreit sie mich an: »Weshalb verschweigst du mir's! Sag' nur, daß du es von ihm weißt!« Ich schau sie an. Von ihm? frag' ich. Wer ist dieser »ihm«? Statt daß ich aber eine Antwort erhalte, fängt diese Person an, über Sie, Signore, in einer Weise loszuziehen, jammert dazu und weint, so daß ich mir schließlich keinen besseren Rat wußte, als meinen Hut zu nehmen und zu gehen. Na ja, und unten auf der Straße bin ich Ihnen doch begegnet.«
Während Leone sprach, quälte ich meinen Verstand, um in all diesen Worten die Lüge von der Wahrheit zu trennen. Daß er mich nicht direkt als den Angeber genannt, meinte ich glauben zu dürfen. Sicher aber hatte er irgend eine Frage, irgend einen Verdacht Racheles benützt, um sie in jenem für mich so kränkenden Glauben zu bestärken.
»Worüber studieren Sie jetzt?« fragte Leone, als ich noch immer schwieg.
»Ich frage mich, ob nicht ein Gefühl der Billigkeit Sie hätte veranlassen müssen, Rachele mit einem offenen Wort zu sagen, wie sehr sie mir unrecht that mit jenem Verdacht?«
Leone zuckte die Achseln. »Sehen Sie, mein Bester … wenn ich das gethan hätte, würde Rachele doch gefragt haben: ›Also wer hat mich verraten? Wenn nicht er … wer dann?‹ Und ihr das zu sagen, lag durchaus nicht in meinem Interesse, also auch nicht in meiner Absicht. Um Ihnen aber zu beweisen, daß ich gar keine Ursache habe, mich auch vor Ihnen hinter die Thür zu stellen, und damit Sie sehen, wie unter Umständen alles mit natürlichen Dingen zugehen kann …« sich vom Stuhl erhebend, wischte er die Hände an eine Serviette, griff in die Brusttasche seines Rockes und reichte mir ein zusammengefaltetes Papier. »Hier, lesen Sie!«
Zögernd griff ich nach dem Blatt. Diese krausen, kritzeligen Buchstäbchen glaubte ich zu kennen – das war Racheles Handschrift – und was ich da in meinen vor Erregung zitternden Fingern hielt, war ein Brief, den Rachele an ihre Schwester geschrieben.
Ich las – und da las ich den Tod Ottavios, Angst, Jammer und Thränen, die Furcht vor Leone, der mit bezeichnenden, aber wenig schmeichelhaften Worten geschildert war, und alles las ich, was Leone gestern so sehnlichst von mir zu wissen wünschte: die Höhe der geretteten Summe und den Ort ihrer Verwahrung.
Leone, der wohl gelauert haben mußte, bis ich mit der Lektüre zu Ende war, zog mir, als ich das Gesicht hob, mit raschem Griff das verräterische Blatt aus den Fingern.
»Nun? Was sagen Sie jetzt?«
»Signor Leone? Wie kommt dieser Brief in ihre Hände?«
»Tja!« Er lachte. »Das möchten Sie wohl gerne wissen?« Und Madama Giuditta, die sich eben erhob, um mit einem riesigen, blankgeschliffenen Messer die Torte anzuschneiden, fügte, den Blick zur Decke erhebend, mit schwärmerischen Worten bei: »Ein Engel vom Himmel hat ihn uns gebracht.«
Da lachte Michelina laut auf und klatschte in die Hände, wie man ein geistreiches Wortspiel beklatscht.
»Sie sehen, Signore, wir sind dem Sonntag angemessen gelaunt,« sagte Leone. »Da könnten Sie sich mit uns einen vergnügten Tag machen! Wir haben für Nachmittag und Abend so eine Geschichte verabredet, Landpartie, Wasserfahrt … sogar meine gute, dicke Giuditta ist mit dabei. Wenn Sie also Lust haben … Sie sind mein Gast!«
»Ich danke! Sie wissen, daß ich morgen reise …«
»Gott! Wie schade!« seufzte Madama.
»Und Sie werden es begreiflich finden, daß ich noch so manches zu ordnen und zu besorgen habe. Und da auch Sie, Signore, die Aufklärung, um derentwillen ich gekommen, mir nicht vorenthalten haben, so will ich nicht weiter stören. Ich wünsche den Damen einen fröhlichen Tag.«

Mit diesen Worten verließ ich das Zimmer. Als ich hinter mir die Thüre schloß, vernahm ich noch ein lautes, lustiges Gelächter. Auf der Treppe überlegte ich, was ich nun thun sollte. Wohl sagte ich mir, daß ich nach all den Worten, die Rachele mir ins Antlitz geschleudert, keine Veranlassung mehr hatte, irgendwie für ihre Sache und ihr Wohl zu handeln. Aber mich selbst wollte ich beruhigen, wenngleich ich zu diesem Zwecke nichts anderes zu thun wußte, als Grenelli von der Lage der Dinge in Kenntnis zu setzen.
Ohne mein Zimmer zu betreten, eilte ich hinunter auf die Straße. Als ich aus der Thüre trat, hörte ich über mir meinen Namen rufen und gewahrte vor einem der Fenster des zweiten Stockes den Kopf Leones.
»Übereilen Sie sich nur nicht, Signore,« rief er, »es hat keinen Zweck. Aber den lieben Doktor können Sie von mir grüßen!« Lachend zog er sich zurück, und ich hörte die Scheibe klirren.
Er mußte sich also wohl gedacht haben, welchen Weg ich machen wollte – und dieser Weg erschien ihm ungefährlich, sonst hätte er sich gewiß nicht so verhalten, wie eben jetzt.
Zu meiner Bestürzung traf ich Grenelli nicht zu Hause. Erst gegen drei Uhr nachmittags fand ich ihn – und als ich ihm erzählte, was ich von Signor Leone erfahren, war ein Achselzucken und eine bedauerliche Miene seine ganze Antwort. Jeden weiteren Schritt bezeichnete er als zwecklos, solange Leone im Besitz eines so unwiderleglichen Zeugen wäre, wie dieser Brief Racheles. Ob er nun auf rechtliche oder unrechtliche Weise in Besitz dieses Briefes gelangt wäre, das sei für die Sache ohne Belang.
Ratlos stand ich auf der Straße. Einmal kam mir der Gedanke, Rachele aufzusuchen, um ihr den wahren Sachverhalt mitzuteilen. Doch verwarf ich diesen Gedanken wieder, eh' ich ihn noch ausgedacht hatte. Ich fühlte mich von Rachele zu tief beleidigt – nie wieder wollte ich sie sehen!
So wanderte ich schließlich meinem Hause zu, wobei ich immer sann und sann, auf welche Weise Leone wohl in den Besitz jenes Briefes gelangt wäre, der natürlich nie an seine Adresse gekommen, die Stadt überhaupt nicht verlassen hatte.
Daheim fand ich meinen Hausherrn und seine Damen wirklich ausgeflogen – und während diese vier Leute ihrem Vergnügen nachrannten, um den Tod Ottavios würdig zu feiern, mußte die arme, geplagte Paraskeva den Sonntag am Waschtroge zubringen.
In meinem Zimmer angelangt, nahm ich die Schreibmappe wieder aus der Handtasche. Sehen wollte ich Rachele nicht wieder – aber ich meinte es meiner Ehre schuldig zu sein, wenigstens auf schriftlichem Wege jenen verletzenden Verdacht von mir abzuweisen.
Brief um Brief begann ich – Brief um Brief zerriß ich, bis ich endlich in heller Ungeduld die Feder auf den Tisch warf und aufsprang. Dabei blieb ich mit dem Sacco am Schlüssel der Tischlade hängen und riß mir die ganze Tasche aus der Naht. Da ich meinen Koffer nicht wieder öffnen wollte, um das beschädigte Kleidungsstück gegen ein anderes zu vertauschen, und als praktischer Junggeselle mit der Kur solcher Wunden ziemlich vertraut war, trat ich in den Vorplatz hinaus und rief über die Treppe hinunter:
»Paraskeva!«
»Kyrie?« klang ihre Stimme von unten.
»Könnt' ich wohl Nadel und Faden haben?«
»Oh, oh, Kyrie, ich kann gerade unmöglich abkommen. Aber wenn Sie hinaufgehen wollten … vor Madamas Zimmer steht ein Kasten, unter diesem liegt der Zimmerschlüssel … und drinnen im Zimmer, gleich in dem Schrank beim Fenster, in der obersten Lade, da werden Sie alles finden, was Sie nötig haben.«
Ich stieg die beiden Treppen hinauf – und was soll ich lange Worte machen: ich komme in das Zimmer, öffne die Lade, und vor mir liegt, in einem Nähkörbchen obenauf, Racheles Brief. Mit beiden Händen griff ich nach ihm – um sie eben so rasch wieder zurückzuziehen und pochenden Herzens das lockende Blatt zu betrachten. Übergehen will ich, was ich in einer bangen Minute alles dachte und mir vorredete. Das Ende war – daß ich den Brief nahm.
An das, was ich hier oben gesucht hatte, dachte ich nun freilich nicht mehr. Mit zitternden Händen stieß ich die Lade zu, verschloß das Zimmer wieder und legte den Schlüssel an seinen Platz. Drunten in meiner Stube – nun mußte ich doch den Koffer wieder öffnen – wechselte ich in Eile den Rock, griff nach meinem Hut und stürmte aus dem Hause.
Der Schweiß stand mir auf der Stirne, als ich eine halbe Stunde später an Grenellis Wohnung die Glocke zog, um einen recht unliebsamen Bescheid zu erhalten. Er war mit seiner Familie irgendwo für den Abend zu Gast gebeten – wo, konnte man mir nicht sagen – und würde wohl erst spät in der Nacht zurückkehren.

Aber ich mußte den Brief los werden – mir war's, als trüge ich Feuer in meiner Tasche. Was blieb mir übrig? Ich mußte warten, bis Grenelli kam. In einer Weinschänke, seinem Hause gegenüber, legte ich mich auf die Lauer. Es war das eine starke Geduldsprobe. Als er endlich kam, spät in der Nacht, gab ich ihm nur, ohne ein Wort der Aufklärung beizufügen, den Brief in Verwahrung und sagte, daß ich am anderen Morgen frühzeitig bei ihm vorsprechen würde.
Leichteren Herzens konnte ich nun meiner Behausung zuwandern. Als mir Paraskeva das Thor öffnete, erkundigte ich mich bei ihr, ab Leone bereits zurückgekommen wäre und ob er nach mir gefragt hätte.
»Du mein Gott, Kyrie,« raunte mir die Alte zu, »die sind in einem Zustand heimgekommen, daß ihnen das Fragen schwer geworden wäre. Wie Klötze sind sie in die Federn gefallen, eins ums andere.«
Ich ersuchte Paraskeva, mich zwischen sechs und sieben Uhr zu wecken, dann stieg ich, jedes Geräusch vermeidend, die Treppe hinauf, ging in meine Schlafstube und schob den Riegel vor.
Die Aufregungen dieses Tages und die vielen Wege lagen mir schwer in allen Gliedern, so daß mir der Schlaf wie Blei auf die Augen fiel.
Als ich am Morgen erwachte, hörte ich ein schwaches Pochen an der Thür und Paraskevas leise Stimme:
»Kyrie! Kyrie!«
»Ich höre schon, Paraskeva. Wie spät?«
»Sieben Uhr schon lange vorüber! Oh, Kyrie, nur nicht böse sein! Ich war oben, und da ließen sie mich nicht weg … Gott, wie's da zugeht! Sie suchen etwas … einen Brief. Mich haben sie gefragt … aber ich hätte mich schlagen lassen, eh ich gesagt hätte, daß außer mir noch jemand oben war. Das sind böse Leute, Kyrie … weiß Gott, was sie gedacht hätten!«
»Gut, gut, Paraskeva! Ich danke Ihnen!« gab ich mit gedämpfter Stimme zur Antwort. »Aber haben Sie jetzt eine Minute Zeit für mich?«
»Ei wohl, Kyrie … wird sich schon machen!«
»So laufen Sie auf die Straße hinunter und sehen Sie, ob Sie mir vier Lastträger besorgen können. Aber flink, Paraskeva! Nur flink!«
Ich hörte, wie die Alte mit schlorpenden Tritten davonrannte. Mich in meinem Bette aufsetzend, rieb ich mir vollends den Schlaf aus den Augen und griff nach meinen Kleidern.
Da klang auf der Treppe draußen ein lautes Poltern und Rumpeln – nun kam's in meine Stube – und ich hörte Leones brüllende Stimme:
»Wo ist er? Wo ist er?«
An der Thüre meines Schlafzimmers rasselte die Klinke, und von schweren Faustschlägen hallten die Bretter.
»Öffnen Sie, Signore! Öffnen Sie! Öffnen Sie!«
»Vor allem verbitte ich mir einen solchen Skandal!« rief ich im ersten Zorn. »Was wünschen Sie von mir?«
»Öffnen Sie! Öffnen Sie! Oder ich zerbreche die Thüre!«
Ich wollte aus dem Bette springen. Schon aber hob sich ächzend die Thüre – ein Krach – klirrend flog der Riegelhaken zu Boden, und auf der gewaltsam eröffneten Schwelle stand Leone mit wutverzerrtem Gesicht, in der einen Hand jenes lange Messer, mit welchem ich Madama Giuditta Tags zuvor die Torte hatte zertheilen sehen. Und nun stand Madama hinter Leone, in einem Aufzug, der sich durch Worte nicht wiedergeben läßt. Ihr zu beiden Seiten drängten sich die zwei Mädchen unter die Thüre und reckten die Hälse über die Schulter ihres Vaters.
Dem Gesicht und den aufgequollenen Augen Leones sah ich es an, daß dieser Mensch in diesem Augenblick der übelsten Dinge fähig war. Nur kaltes Blut und Besonnenheit konnten mich jetzt vor Mißhandlung und vielleicht vor Schlimmerem bewahren.
»Sind Sie wahnsinnig geworden, Signore?« schrie ich ihn an, während ich bis zum Hals die Decke über mich zog. »Sind Sie wahnsinnig, daß Sie mich in einer solchen Weise überfallen! Und weshalb? Was suchen Sie hier?«
»Den Brief!« keuchte er mit schäumendem Munde. »Den Brief!«
»Welchen Brief?«
»Den Brief! Den Brief! Geben Sie mir den Brief, oder bestellen Sie Ihren Sarg!« Er war bei diesen Worten vor mein Lager getreten und faßte mit der einen Hand die Decke, während er mit der anderen das blitzende Messer über mir schwang.
Kopfschüttelnd blickte ich ihm in die drohenden Augen. »Noch begreif' ich zwar Ihr Verlangen und die seltsamen Gesten nicht, mit denen Sie Ihren sonderbaren Wunsch begleiten, aber ich bemerke für alle Fälle, daß ich Ihnen mit keiner Silbe weiter Rede stehen werde, solange Sie Ihren Damen den Anblick meiner Nachtwäsche zu gönnen belieben.«
Die Ruhe meiner Worte schien einigermaßen ernüchternd auf ihn zu wirken. Mit einem groben Worte schickte er Madama Giuditta und die beiden Mädchen aus der Stube. »Und nun den Brief, Signore,« schrie er mich wieder an, »geben Sie mir den Brief zurück, oder es wird Sie gereuen.«
»Vorerst werden Sie wohl noch die Güte haben, ein wenig beiseite zu treten, bis ich mich halbwegs angekleidet habe. Es paßt mir nicht, hier in den Federn mit Ihnen über Dinge zu verhandeln, welche Ihnen das Messer gegen mich in die Faust drücken.«
Bei diesen Worten sprang ich aus dem Bett, und während Leone, um einige Schritte zurücktretend, mit funkelnden Augen jede meiner Bewegungen verfolgte, legte ich meine Kleider an.
»So, nun steh' ich Ihnen mit Vergnügen zu Diensten,« sagte ich, als ich an meiner Weste den letzten Knopf geschlossen hatte. »Darf ich bitten?« Und ich deutete mit einer einladenden Handbewegung gegen die Thür meiner Wohnstube.
»Gehen Sie voran!« herrschte mir Leone zu.
»Welche Umstände Sie machen!« erwiderte ich, meine Worte mit einem höflichen Kompliment begleitend. »Aber Sie gehen wohl von der Meinung aus, daß Sie hier mehr zu Hause sind, als ich es bin!« Lächelnd schritt ich an ihm vorüber in das Zimmer, ging auf den Divan zu und setzte mich nieder.
»Es scheint, Signore, Sie wollen auch heute den Harmlosen spielen!« zischte Leone, dicht an mich herantretend. »Das wird Ihnen aber blutwenig nützen, denn heute bin ich meiner Sache gewiß! Außer Ihnen wußte keine Seele von diesem Brief, außer Ihnen ist kein Mensch in mein Haus gekommen! Und wenn dieser Brief nun verschwunden ist …« er beugte sich nieder und faßte mich am Arme, »bei wem soll ich ihn suchen müssen, wenn nicht bei Ihnen, Signore? Bei Ihnen!«
»Nun glaub' ich zu verstehen, daß Sie von jenem Briefe sprechen, den Sie mir gestern zu lesen gaben.«
»Ja! Von jenem Brief! Wo ist er? Geben Sie mir ihn zurück! Gutwillig!«
Ich erhob mich und wand meinen Arm aus Leones Fingern. »Wenn Sie sich einen Augenblick gedulden wollen,« sagte ich – und ehe Leone sich besinnen oder Zeit finden konnte, mir zu folgen, war ich auf die Kommode zugetreten, hatte die Lade geöffnet, den Revolver ergriffen, und blitzschnell mich umwendend, hob ich die Waffe.
Leone erblaßte. »Was machen Sie denn da?« fragte er stotternd. »Ist das Ding geladen?«
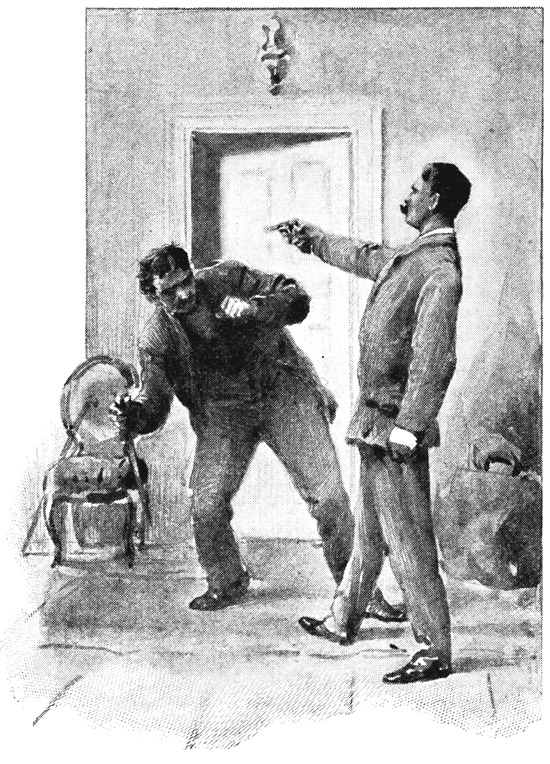
»Wenn Sie den Versuch machen wollen, mich noch mit einem Finger zu berühren, werden Sie das schnell und genau erfahren.«
»Und was soll dieser Knallapparat in Ihrer Hand bedeuten?«
»Dasselbe, was in der Ihrigen jenes Messer bedeutet, das ich Ihnen abzulegen rate, für den Fall, daß Sie weiter mit mir zu sprechen wünschen.«
Noch blickte mir Leone unschlüssig mit blinzelnden Augen ins Gesicht, als sich an der Thür ein ungeduldiges Pochen hören ließ.
»Bitte einzutreten!« rief ich hastig und mit lauter Stimme. Die Thüre ging auf, und der Doktor trat mit fröhlichem Gruß in das Zimmer.
»Guten Tag! Guten Tag! Ich fürchtete schon, Sie nicht mehr zu treffen …« Er unterbrach sich, und forschend glitten seine Blicke zwischen mir und Leone hin und wider.
»Guten Morgen, lieber Doktor! Was sehen Sie uns so verwundert an?« sagte ich lachend, während ich ihm die Hand entgegenstreckte. »Am Ende halten Sie uns gar des Zweikampfes verdächtig … trotz der etwas ungleichen Waffen. Aber beruhigen Sie sich … wir beide sind nicht so blutdürstig. Das Messer in Signor Leones Händen deutet nur an, daß ich ihn vom Kuchen-besetzten Frühstückstische hieher rief, um ihm diese niedliche Waffe zu zeigen, bevor ich sie verpackte. Es ist ein reizendes Ding!« Ich reichte ihm die Waffe zur Besichtigung. »Nehmen Sie nur … ganz unbesorgt … was nicht geladen ist, kann nicht losgehen.« Mit einem lustigen Blick streifte ich bei diesen Worten Leones Gesicht. »Aber was führt Sie zu mir, lieber Doktor?«
»Der Inhalt jener Karte, die Sie gestern bei mir zurückließen. Es wäre mir in der That bitter leid gewesen …«
Er wurde unterbrochen; Paraskeva kam mit der Nachricht, daß die Lastträger draußen stünden.
»Sie sollen nur eintreten!«
Vier stämmige Bursche stapften über die Schwelle. Ich hieß sie ein paar Minuten warten, dann wandte ich mich zum Doktor und zu Leone: »Nicht wahr, ich darf mich für einige Augenblicke entschuldigt halten?«
Kaum befand ich mich aber eine Weile in meiner Schlafstube, mit der Vollendung meiner Toilette beschäftigt, als Leone zu mir hereintrat und die wackelige, halb aus ihren Fugen gebrochene Thüre hinter sich zulehnte.
»Signore!« sprach er mich mit flüsternder Stimme an. »Ich war ein Narr! Aber wir wollen nun ein ruhiges, vernünftiges Wort mit einander reden. Geben Sie mir den Brief zurück!«
»Ich habe den Brief nicht.«
»Beschwören will ich's, daß Sie ihn haben. Unsere alte Hexe hat mir zwar bei allen Heiligen betheuert, daß außer ihr niemand das Zimmer betreten hätte … aber sie ist dabei blaß geworden bis in den Hals. Ich kenne das … sie wird immer blaß, wenn sie lügt. Signore! Sie haben den Brief! Geben Sie ihn mir zurück!«
»Lassen Sie mich in Ruhe!«
»Ich verlange keine Gefälligkeit, Signore … ich kaufe den Brief … für jede Summe.«
»Nehmen wir an, ich hätte den Brief … gerade dieser höchst ehrenvolle Antrag würde mich veranlassen, den Brief vor Ihren Händen doppelt in Sicherheit zu bringen!«
Da hörten wir Paraskeva draußen in der Wohnstube nach Leone fragen, und nun trat sie unter die Thüre.
»Kyrie, Sie möchten nach oben kommen … zwei Signori sind da.«
»Sie sollen warten!« schnauzte Leone die Alte an.
»Sie wollen aber nicht warten; sie sagten, daß sie herunter kommen würden, wenn sie länger als eine Minute warten müßten.«
Leone stutzte. »Gut! Sag' ihnen, daß ich den Augenblick oben sein werde.« Und wieder wandte er sich, als Paraskeva verschwunden war, mit leiser Stimme zu mir. »Signore! Ein letztes Wort! Ich komme in wenigen Minuten zurück. Sollten Sie dann immer noch nicht geneigt sein, mir den Brief auszuliefern, oder sollten Sie sich inzwischen von hier entfernt haben … ich schwör' es Ihnen … dann werde ich auf der Polizei sein, noch ehe Sie am Hafen sind … und dann werden Sie heute nicht reisen!«
Er maß mich mit funkelndem Blick und verließ die Stube.
Eine Viertelstunde später war ich reisefertig, und mein Gepäck stand zum Fortschaffen bereit.
»Wenn ich nicht denken müßte,« wandte ich mich an den Doktor, »daß Ihre nächsten Stunden von Ihrem Beruf in Anspruch genommen sind, hätte ich eine große Bitte an Sie zu richten.«
»Aber, lieber Freund, sprechen Sie doch!«
»Ich habe noch einen wichtigen Gang abzumachen, und es wäre möglich, daß mir nicht mehr die genügende Zeit zur Besorgung meines Gepäckes verbliebe. Würden Sie mir die Gefälligkeit erweisen, die Einschiffung meiner Koffer zu überwachen?«
»Mit Vergnügen! Geben Sie mir nur Ihre Schiffskarte, und Sie werden alles in bester Ordnung finden, bis Sie an den Hafen kommen.«
Er nahm die Karte, und nachdem er meine Hände fest und lange gedrückt, folgte er den Lastträgern, die mit den Koffern das Zimmer schon verlassen hatten.
Als ihre Tritte auf der Treppe verhallten, war mir, als ob ich leises Weinen vernähme. Ich trat unter die Thür und sah Paraskeva, das Gesicht von der Schürze bedeckt, in einer Ecke stehen. Rasch ging ich auf die Weinende zu und zog sie am Arm in das Zimmer.
»Paraskeva? Was ist Ihnen denn?«
»Oh, Kyrie, Kyrie …« Was sie weiter noch sagen wollte, erstarb in Stammeln und Schluchzen.
Ich mußte wohl denken, daß diese Thränen meiner Abreise galten, und hielt es für meine Pflicht, sie mit freundlichem Troste zu stillen.
»O Kyrie,« jammerte die gute Person, »was ist das eine schöne Zeit gewesen, solange Sie im Hause waren! Nun gehen Sie wieder fort … nun hab' ich niemand mehr … niemand, der … der mich auch … wie einen Menschen behandelt! Ooooh … ich möchte lieber sterben, Kyrie … lieber sterben, als hier … hier …« Wieder erstickte lautes Schluchzen ihre Worte.
Ich meinte zu wissen, was sie hatte sagen und klagen wollen.
»Paraskeva! Glauben Sie nicht, daß es besser für Sie wäre, wenn Sie von hier fortgingen, um einen leichteren Dienst zu suchen, bei Leuten, die Ihnen gut sind?«
»O du lieber Himmel! Wer wird mich noch nehmen wollen … mich alte Fledermaus! Ich muß ja zufrieden sein, daß sie mich hier nicht schon lange auf die Straße geschmissen haben!«
»Wenn aber dennoch ein solcher Platz sich fände? Würden Sie gehen?«
»Gehen, Kyrie, nur gehen? Rennen würd' ich … rennen wie ein Windhund mit vierzehn Beinen!«
»Gut, Paraskeva, gut! Dieser Platz wird sich finden! Das verspreche ich Ihnen! So! Und weg mit der Schürze! Und nun gehen Sie hinauf zu Signor Leone und sagen Sie ihm, daß ich nicht länger auf ihn warten kann!«
»Oh, Kyrie, er ist lange nicht mehr zu Hause … es waren zwei Signori da … und mit denen ist er fortgegangen.«
»So gehen Sie, liebe Paraskeva, und holen Sie mir einen Wagen!«
Während die Alte in geschäftiger Eile davontrippelte, stieg ich die Treppe hinauf, um Madama Giuditta – zwar nicht Lebewohl zu sagen – aber doch zu sagen, daß ich ginge. Aus einem der Zimmer hörte ich Michelinas laute Stimme. Ich pochte und öffnete die Thüre. Verdutzt blieb ich auf der Schwelle stehen. Auf dem Divan saß Viola mit ihrer Mutter, und die beiden hielten sich weinend umschlungen, während Michelina, durch mein Eintreten in einer Zimmerpromenade unterbrochen, mit gekreuzten Armen vor mir stehen blieb: »Wer hat Sie gerufen, Signore?«

»Ich komme, um mich von Madama zu verabschieden.«
»Ist gar nicht nötig!«
»Ja wohl … ist gar nicht nötig,« schluchzte Madama.
Ich zuckte die Achseln und ging. Allem Anschein nach war hier etwas Unerwartetes und Unwillkommenes vorgefallen.
Vor dem Thore fand ich Paraskeva mit dem Wagen. Ich nannte dem Kutscher Grenellis Adresse – aber Paraskeva machte mir das Einsteigen schwer. Als der Wagen davon fuhr, wankte sie unter das Thor und drückte laut jammernd ihr Gesicht an die Bretter.
Eine Viertelstunde später saß Grenelli bei mir im Wagen, und wir fuhren dem Hause Racheles zu. In meinen Händen hielt ich den Brief, den er mir zurückgestellt hatte.
»Wissen Sie, was dieses Blatt enthält?« fragte ich ihn.
»Ja. Es war nicht verschlossen. Wie kamen Sie in den Besitz dieses Briefes?«
»Durch Zufall. Und … da Signor Leone diesen unwiderleglichen Zeugen, wie Sie selbst das Blatt da nannten, nicht mehr für sich sprechen lassen kann … wie steht unsere Sache jetzt?«
»Genau so, als hätte Signor Leone den Brief niemals besessen.«
Der Wagen hielt. Als wir die Treppe hinaufgestiegen waren, erfuhr ich von Catina, daß Rachele soeben mit Susetta das Frühstück einnehme.
Ich führte Grenelli in die Wohnstube, ersuchte ihn, sich hier eine Weile zu gedulden, und trat in das anstoßende Zimmer.
Stumm, mit weit offenen Augen, erhob sich Rachele – und ich erschrak vor der Blässe dieses hohlwangigen Gesichtes. Susetta war mit ausgebreiteten Armen auf mich zugesprungen. Ich hob das Kind zu mir empor und küßte seinen kleinen, blühenden Mund. Als hätte Rachele das verhindern wollen, mit so hastigen Schritten war sie an meine Seite getreten – und als ich das Kind zu Boden stellte, faßte sie das Kind am Arm und führte es aus dem Zimmer.
Nun stand sie vor mir – allein.
»Ich bitte um Vergebung, daß ich der Signora noch einmal die Qual und den Ekel meines Anblicks bereite,« sprach ich sie an, und mit Gewalt zwang ich meine Stimme zur Ruhe, »aber ich hielt es für nötig, das Gewissen der Signora zu beruhigen, indem ich selbst den Beweis erbringe, daß ich … ein Schurke bin. Zwar nicht jener Schurke, den Signora in mir zu sehen beliebten, aber doch ein Schurke, ein Dieb, der gestohlen hat. Und jede andere Meinung über mich … wär' es auch die schlimmste … wird ja durch diese Thatsache gerechtfertigt erscheinen. Doch bitte ich, mir zuvor eine Frage zu gestatten. Sie schrieben an Ihre Schwester einen Brief … nicht wahr, Signora? Einen Brief, der von dem Tod Ihres Gatten sprach und von andern Dingen?«
»Ja …« gab Rachele zögernd zur Antwort, mich mit scheuen Blicken betrachtend.
»Und Signora sind überzeugt, daß dieser Brief an seine Adresse gelangte?«
Jähes Entsetzen malte sich auf Racheles Antlitz. Mit wankenden Schritten stürzte sie auf einen Schrank zu, riß ihn mit zitternden Händen auf und warf die Bücher, die er barg, in fiebernder Hast durcheinander. »Wo ist das Buch?« stammelte sie. »Das Buch? Ich habe den Brief in das Buch gelegt … Michelina kam in das Zimmer … da konnt' ich ihn nicht fortsenden … ich habe den Brief in das Buch gelegt … und habe vergessen … das Buch … das Buch … ich find' es nicht wieder … es ist nicht hier …«
Das also war die Lösung des Rätsels, wie Leone in den Besitz dieses Briefes gekommen!
»Signora vermissen ein Buch? Vielleicht befand es sich unter jenen Büchern, welche Michelina vorgestern von hier mit nach Hause nahm. Ich habe die Bücher auf ihrem Arme gesehen, als ich Leone hieher geleitete.«
Rachele starrte mir in das Gesicht. Dann schlug sie stöhnend die Hände vor die Augen –
»Was hab' ich gethan … Signore, was hab' ich gethan! O, ich weiß … Sie werden es nie vergessen … nie!«
»Ja, Signora! Beleidigungen, die das Herz zerreißen, vergißt man nicht so leicht, wie eine witzlose Anekdote. Zwischen mir und dem Vergessen liegen Haß, Verachtung, Qual, Pein und Ekel … liegen alle die Worte, die ich aus Ihrem Munde vernahm. Was jedoch alles Übrige betrifft, mögen Signora beruhigt sein. Hier ist jener Brief …« Ich nahm das Blatt aus der Tasche und legte es vor Rachele auf den Tisch. »Ein Zufall führte mich vor die Lade, in der ihn Leone verwahrt hatte … und diesen Zufall glaubte ich benützen zu müssen, meiner kleinen Susetta zuliebe. Man thut ja viel für Menschen, die man liebt! Man kann für sie auch zum Dieb werden … ohne sonderliche Gewissensbisse. Nur eines bedaure ich dabei … was ich da verschuldet habe, wird die arme Paraskeva büßen müssen. Ich habe ihr wohl geraten, einen anderen Dienst zu suchen. Wer wird sie aber nehmen wollen … sie ist ja alt und schwach … um ihrer Treue willen wird sie keinen Herrn finden. Auch mir war sie treu und anhänglich … sie weinte wie ein Kind, als ich vor einer Stunde von ihr Abschied nahm.«
»Signore?« glitt es tonlos von Racheles Lippen, »Sie verreisen … und heute?«
»Ja, Signora. Um zehn Uhr. Der Weg bis zum Hafen ist weit … ich habe nur eine Minute noch zu meiner Verfügung. Gestatten Sie, Signora, daß ich diese Minute benütze, um Sie mit dem Manne bekannt zu machen, den ich Ihnen als gewissenhaften Berater empfohlen habe.« Ich öffnete die Thür und winkte Grenelli herbei. »Signor Grenelli … Signora Rachele Scarpa. Die Minute ist vorüber, Signora … gestatten Sie, daß ich mich zurückziehe.«
Ich verneigte mich gegen Rachele und verließ das Zimmer. Als ich im Flur stand, glaubte ich einen Schrei und einen dumpfen Fall zu hören. Da mußt' ich mir all jene häßlichen Worte, die Rachele am verwichenen Tag zu mir gesprochen, ins Gedächtnis zurückrufen, um mich zu zwingen, den Fuß auf die Treppe zu setzen.

Endlos schien mir die Fahrt zum Hafen. Als ich dort anlangte, fand ich just noch Zeit, um zu bezahlen, was zu bezahlen war, da das Boot bereits seit Minuten meiner wartete. Ich umarmte den Doktor. Dann stieg ich über die steinerne Treppe zum Wasser nieder.
Nun glitt das Boot vor kräftigen Ruderschlägen dem Schiffe zu. Tief über das Geländer gegen die klare Flut mich beugend, suchte ich mein Gesicht vor den Blicken der Matrosen zu bergen – die braunen Bursche würden gelacht haben, hätten sie einen Mann weinen sehen.« – – –
Willy schwieg. Ein tiefer und schwerer Seufzer schloß sich an seine letzten Worte.
Wir hatten, während er erzählte, schon längst die Stadt und meine Wohnung erreicht und waren wohl schon ein dutzendmal die nachtstille Straße auf- und abgewandert.
»Da sind wir ja bald wieder vor deiner Thüre,« sagte er, als wir uns meinem Hause wieder näherten. »Wie ich dich kenne, wirst du jetzt von mir gehen und dich durch schlaflose Stunden damit abmühen, um aus dieser Geschichte deine sogenannte Logik des Geschickes und jenes Gleichgewicht von Schuld und Sühne herauszukonstruieren, die du ja überall vorhanden wähnst, wo das Leben ein Menschenherz mit Leid und Weh belastet. Möglich, daß deine gute Phantasie auch finden wird, was du nötig hast, um deine Überzeugung nicht erschüttert zu sehen. Möglich, daß du den ethischen Gründen auf die Spur kommst, die es – wie du in solchen Fällen zu sagen pflegst – mit unerbittlicher Notwendigkeit verlangten, daß zwei Menschen, die sich um ihrer Liebe willen hätten angehören sollen für ein glückseliges Leben, sich scheiden mußten, um ferne von einander den Verlust ihres Glückes zu beklagen. Denn wie es mir nicht gelungen ist, zu vergessen und zu verwinden, so ist es auch ihr nicht gelungen … das hab' ich aus dem Erblassen ihrer Wangen, das hab' ich aus dem starren Blick ihrer Augen lesen können, als mich ein Zufall heute ihren Weg kreuzen ließ. Ja, Zufall! Zufall ist alles, alles! Zufall und Ungefähr sind es, die den Menschen seinem Glück oder seinem Leid entgegenführen, ohne zu fragen, ob er das erstere verdient, das letztere verschuldet hat. Ein Zufall war es, der mich an Racheles Seite stellte … und wieder nur einen Zufall nenn' ich es, daß ich in jener Stunde, die uns schied, den versöhnlichen, alles entschuldigenden Gedanken nicht fassen konnte, den ich mir doch all die Jahre her zu hundertmalen schon vorgeredet habe. Wenn bei einem schüchternen, sanftmütigen Weibe die Liebe sich durch Hingebung, Zärtlichkeit und schrankenloses Vertrauen äußert, weshalb sollte sie sich bei einer heißblütigen, leidenschaftlichen Frauennatur nicht auch durch Mißtrauen äußern dürfen, durch blinden Zorn und falsches Urteil über jenen, der ihrem Herzen doch so lieb und teuer ist? Thor, der ich war! Die Liebe nur hätt' ich hören sollen, nicht die Worte, die sie sprach! Hätt' ich so gethan, ich wäre jetzt ein glücklicher Mann, der an seinem Leben Zweck und Wert zu finden weiß, während ich nun – –«
Unwillig schüttelte er den Kopf, als wollte er mit Gewalt die trüben Gedanken abwehren, die ihn bestürmen mochten. Dann legte er die Hand auf meine Schulter und sagte:
»Es ist Zeit, daß ich gehe. Denn wollt' ich dir alles sagen, was sich auf meine Zunge drängt, wir stünden morgen am hellen Tag noch hier beisammen. So wünsch' ich dir eine gute Nacht, Lieber! Still, still! Wünsche mir nicht das Gleiche … es klänge mir heute wie Spott und Hohn! Gute Nacht!«
Er wandte sich von mir und schritt die Straße hinunter. Nun verschwand er um eine dunkle Häuserecke – eine Weile noch, dann war auch der Klang und das Echo seiner Tritte verhallt. – – –
Es war am folgenden Tage, gegen Abend. Das Licht, welches durch die offenen Fenster auf meinen Schreibtisch fiel, begann schon müd und grau zu werden. Doch immer noch konnt' ich mich nicht entschließen, die Feder niederzulegen. Saß ich doch vor einer neuen, mir gar lieben Arbeit!
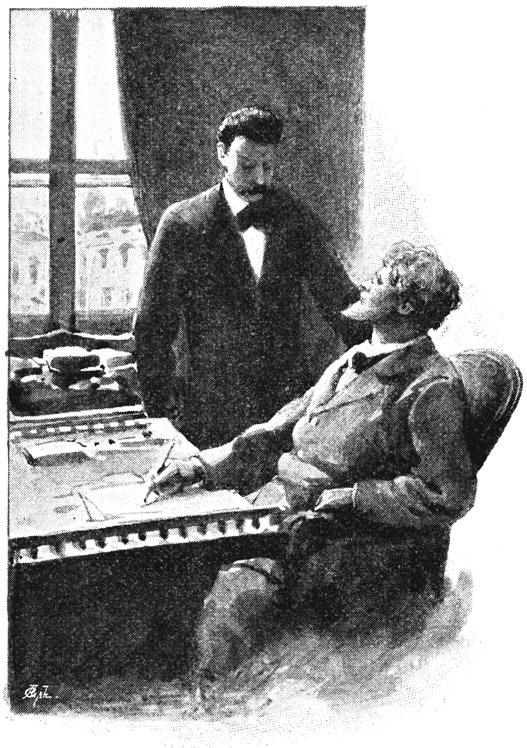
Und der Eifer, mit dem ich in diese Arbeit vertieft war, ließ mich überhören, daß die Thüre gegangen war. Ich fühlte plötzlich, wie sich eine Hand auf meinen Arm legte. Als ich verwundert aufblickte, stand Willy vor mir. Sein Gesicht schien um Jahre verjüngt, und ein klares Leuchten ging von seinen Augen aus.
»Was führt dich zu mir?« fragte ich ein wenig verlegen, während ich, freilich zu spät, den Versuch machte, die engbeschriebenen Blätter zu bedecken, auf denen zwischen stenographischen Zeichen die Namen Rachele und Leone mit ihrer lateinischen Schrift gar deutlich hervorstachen.
»Was mich zu dir führt?« erwiderte Willy lächelnd. »Ein Freundesdienst. Ich komme, um deiner ohnedies so viel beschäftigten Phantasie die Mühe zu ersparen, für diese Geschichte da einen sogenannten befriedigenden Schluß zu ersinnen. Ich komme, um dich einzuladen, heute abends meine Verlobung mitzufeiern.«
»Deine Verlobung? Doch nicht …«
»Ja, doch! Meine Verlobung mit Signora Rachele Scarpa. Komm, komm … du brauchst mir das Glück nicht mehr zu wünschen … nun ist es ja schon mein eigen.«
»Ich wüßte auch vor freudigem Erstaunen kaum, wie ich einen solchen Glückwunsch in Worte kleiden sollte,« rief ich, die Hand meines Freundes fest und herzlich drückend. »Aber sprich, wie kam das?«
»Du sollst alles erfahren! Komm nur, komm! Nimm deinen Hut! Wir dürfen Rachele nicht warten lassen. Eine Stunde nur hat sie mir Zeit gegeben, um dich zu holen.«
Wenige Minuten später traten wir auf die Straße, in der soeben die Gasflammen entzündet wurden.
Mit einem langen, zitternden Atemzuge sog Willy die laue Abendluft in seine schwellende Brust. »Sieh dir diesen Himmel an, aus dessen dämmerigem Blau schon die ersten Sterne mit mattem Schimmer herniederblicken … er ist in Wahrheit gewiß nicht schöner, als es der gestrige war, und dennoch scheint er mir um tausendfältige Schönheit reicher, um ein tausendfaches herrlicher und entzückender. Wie das Glück den Menschen verwandelt! Es ist wie die Sonne, die aus der Nacht den lachenden Morgen weckt!«
Nun schlang er seinen Arm in den meinen und zog mich dahin durch die laute, menschenbelebte Straße.
»Wie bin ich gestern von dir gegangen!« begann er nach einer stummen Weile wieder zu sprechen. »Alles, was ich dir erzählt, was ich zu dir gesprochen, widerhallte noch in meinem Innern. In meinen trüben Gedanken sah ich nichts anderes vor mir, als den freudlosen Rest eines verfehlten Lebens. Und als ich nach Hause kam – – Jetzt noch weiß ich es kaum zu fassen, wie alles so geschah, so geschehen konnte! Mir ist das Glück noch so jung, so neu, daß ich fast seine Wahrheit nicht zu glauben wage.
Als ich gestern in später Nacht nach Hause kam – lange Stunden war ich noch einsam in den öden Straßen umhergewandert – fand ich auf meinem Tisch unter anderen Briefen ein unbeschriebenes Couvert. Es schien eine Karte zu enthalten. Ich vermutete, daß einer meiner Bekannten in meiner Abwesenheit bei mir vorgesprochen und mir irgend eine Mitteilung hinterlassen hätte. Wie aber soll ich dir sagen, was ich empfand, als ich auf der Karte, die mir aus dem Umschlag in die Hände fiel, Racheles Namen las. Lange Minuten starrte ich nur immer diese Zeichen an, eh' es mir in den Sinn kam, das Blatt zu wenden. Und als ich es that, fand ich die Rückseite eng beschrieben mit jenen krausen und kritzeligen Buchstäbchen, die mir so unvergeßlich geblieben sind, seit ich sie zum erstenmale sah, damals im Hotel Missiri! Und die Worte, die da standen, hab' ich in dieser Nacht zu hundertmalen gelesen und weiß sie dir genau zu wiederholen: »Signore! Mißdeuten Sie diese Zeilen nicht, die ich aus Liebe zu meinem Kinde an Sie richte. Susetta läßt mir keine Ruhe, sie quält mich, sie will ihren zio Guglielmo sehen, will ihn sprechen. Sie will wissen, ob sie recht that, ihn nicht zu vergessen. Sollte die Mutter Ihnen Ursache sein, den Wunsch des Kindes nicht zu erfüllen, so genügt ein Wort, und Sie werden Susetta zu einer bezeichneten Stunde allein finden. Rachele.«
Wo? Wo werde ich sie finden? Das war die erste, ungeduldige Frage, die mir beifiel, als ich diese Zeilen gelesen hatte. Weder die Karte noch der Umschlag gab mir einen Aufschluß. Ich weckte meinen Diener und fragte ihn, wer die Karte gebracht. Ein Ausgeher von Sachers Hotel, war die Antwort … der Mann wäre später noch zweimal dagewesen, um eine Antwort zu holen.
Ich will dich mit einer Schilderung der peinlichen Ungeduld verschonen, mit der ich den Rest der Nacht durchwachte. Die frühe Morgensonne schien mir bereits in die Fenster, als ich für eine Stunde noch Schlaf zu finden vermochte.
Wieder erwacht, schrieb ich an Rachele, ein paar Worte nur: »Signora! Ich werde mir erlauben, um drei Uhr vorzusprechen. So sehr ich mich freue, Susetta wieder zu sehen, so sehr würde ich es bedauern, wenn mein Kommen sie nur für eine Minute von ihrer geliebten Mutter trennen sollte.«
Den Brief sandte ich durch meinen Diener an seine Adresse. Ich selbst ging meinem Dienste nach, der mir nie noch in meinem Leben so unleidlich erschienen ist. O dieser entsetzliche Vormittag! Die Buchstaben und Zahlen schwammen und flimmerten mir vor den Augen, und in fieberhafter Erregung zitterten mir die Hände, so daß ich nicht im stande war, eine glatte Zeile zu schreiben.
Nun war die Stunde da, in der ich Rachele sehen sollte! Nun pochte ich an ihre Thüre, nun hörte ich ihre Stimme, nun stand ich vor ihr … und ich weiß nicht, wie ich diesen Augenblick fassungsloser Unbeholfenheit überwunden hätte, wäre mir Susetta nicht mit jubelndem Gruß an den Hals geflogen. In stummer Bewegung hielt ich das Kind an mich gedrückt und versenkte mich in den Anblick seines rosigen Gesichtchens, in dem ich so ganz die Züge der Mutter wiederfand. Was war doch mein kleiner Liebling in diesen fünf Jahren ein schönes und zierliches Mädchen geworden!
Als ich mich von Susetta zum Divan ziehen ließ, sah ich Racheles Augen mit finsterem Blick auf uns gerichtet.
»Das war ja eine warme, liebevolle Begrüßung!« sagte sie mit herber, bebender Stimme. »Und dennoch scheint es mir, als wäre Ihre Sehnsucht, Susetta wiederzusehen, keine so übermäßig heiße gewesen. Wie hätten Sie sonst das Kind so lange warten lassen!«
»Hätte ich meiner Sehnsucht folgen dürfen, Signora,« gab ich stockend zur Antwort, »ich würde gewiß nicht bis zu dieser Stunde gewartet haben, welche die erste ist, in der mir die Pflicht meines Berufes das Kommen erlaubte.«
Weiter konnten wir nicht sprechen, denn mit hundert kindlichen Fragen nahm mich Susetta in Beschlag. Alle Mühe gab ich mir, mit scheinbarer Ruhe auf das liebliche, harmlose Geplauder des Kindes einzugehen. So oft sich dabei eine Gelegenheit ergab, suchte ich Rachele in das Gespräch zu ziehen, die an Susettas Seite Platz genommen hatte und sich aus eigenem Antrieb nie mit einer Silbe in unsere Unterhaltung mischte. Peinlich aber vermied ich es, mit einem Wort oder mit einer Frage die Vergangenheit zu berühren.
Susetta freilich konnte weder das Verständnis noch eine Ursache haben, die gleiche Vorsicht zu üben. Fröhlich plauderte sie mir vor, wie es ihr in Saloniki, wohin sie vor vier Jahren gezogen, um so vieles besser gefallen hätte als in Pera. Und doch wäre es auch in Pera so schön gewesen, aber nur zu jener Zeit, da ihr lieber, böser zio Guglielmo Abend für Abend sie besucht hätte.
»Und weißt du noch, zio, wie wir oft im Garten umhergesprungen sind, über die Wege und durch die Blumen, und wie ich dich nicht haschen konnte, und wie ich immer meine süße Mamma zu Hilfe rief, und wie wir dann zusammen hinaufgingen und wie …« Da plötzlich schwand die lachende Fröhlichkeit aus den Zügen des Kindes. Von ihrem Sitze gleitend, trat Susetta auf mich zu, faßte meine Hände und schaute mir mit großen ernsten Augen ins Gesicht. » Zio! Weißt du auch, daß mein guter Babbo gestorben ist? Lange, lange dacht' ich immer, er wäre nur verreist … und ich wartete und wartete. Aber er kam nicht wieder. Nun weiß ich es … er ist gestorben, zio, gestorben!« Die beiden Arme schlang das Kind um meinen Hals. »Ich habe meine Mamma so lieb … aber keinen Babbo mehr zu haben … ja, du, glaub mir nur, das ist traurig! Oh, zio … ich wollte, du wärest mein lieber guter Babbo!« Und schluchzend barg Susetta ihr Gesichtchen an meiner Brust.
Ich vermeinte, das Herz müsse mir stocken. Meine Blicke flogen zu Rachele. Da saß sie, bis in den Hals erblaßt, die Hände eingekrampft in die Lehne des Divans.
Ich fühlte: das war der Augenblick, welcher meinem ferneren Leben das Glück oder die Vereinsamung bringen mußte – und ich selbst wollte mit raschem Wort die Entscheidung herbeiführen.
Mit beiden Händen hob ich den Kopf des Kindes und küßte ihm die Thränen aus den Augen. »Weine nicht, Susetta, weine nicht! Und glaube mir, daß es für mich auf Erden keine seligere Freude gäbe, als wenn dein Wunsch zur Wahrheit würde. Geh, Susetta, sage das deiner Mamma, sag' ihr, daß ich niemanden auf dieser Gotteswelt so tief im Herzen trage, als dich und sie! Sag' ihr, daß ich in all den bangen Jahren, seit ich von euch geschieden, alles vergessen konnte, alles, nur meine Liebe nicht! Geh, Susetta, frage doch deine Mamma, ob etwa ihrer Liebe das Vergessen leichter wurde?«
»Dann wär' es nicht Liebe gewesen!« klang es in leidenschaftlicher Hast von Racheles Lippen, und mit rascher Hand zog sie das Kind an ihre Seite, das mit scheuen und verwunderten Augen bald auf mich und bald auf die Mutter blickte. »Komm, Susetta, komm zu mir … auch ich weiß dir eine Botschaft! Sage deinem zio, daß Liebe nie vergißt … sag' ihm, das hätt' ich in diesen Jahren Tag für Tag empfunden, das hätt' ich empfunden, als mich auf dem Wege nach dieser Stadt eine zitternde Hoffnung begleitete … sag' ihm, das hätt' ich empfunden, als ich deinem Wunsche nachgegeben, welcher doppelt und zehnfach doch mein eigener war … und wenn ich das verschwieg, geschah es nur aus Furcht, ich möchte wieder an jene schlimme Stunde erinnert werden, die ich doch so sehr, so sehr bereut und gebüßt habe! Und am tiefsten, sag' es ihm nur, am tiefsten hätt' ich das empfunden, als ich dich, mein Kind, um den herzinnigen liebevollen Gruß beneiden mußte, der dir zu theil geworden …«
»Und der in seiner Liebe doch zur Hälfte nur dem Kinde galt!« stammelte ich mit bebenden Worten. »Rachele! Da wir doch beide solch einen Gruß so heiß für uns ersehnten, was soll uns hindern, ihn nachzuholen?«
»Ja, was soll uns hindern?« flüsterte Rachele, während tiefes Rot ihr geneigtes Antlitz übergoß.
Da stand ich schon vor ihr – da hielten wir uns schon umschlungen mit engen Armen, und in einem langen, beseligenden Kusse versank uns all das Leid, das wir um unserer Liebe willen erlitten und getragen.
Wie soll ich dir den süßen Reiz der Stunden schildern, die wir nun Seite an Seite saßen, eines dem andern nachfragend, wie ihm die Zeit vergangen wäre seit dem Tage, der uns getrennt! Und dabei saß Susetta, wie einst vor Jahren, wieder auf meinem Schoß, und unseren Worten lauschend, hielt sie das Köpfchen an meine Brust gelehnt.
Ich selbst hatte freilich wenig zu erzählen – desto mehr Rachele. Und da dürfte manches für dich von Interesse sein.
Einen merkwürdig raschen, freilich recht unerwarteten Abschluß hat Signor Leones Vormundschaft gefunden – eigentlich noch an jenem Tag, an dem ich sein Haus verließ. Jene beiden »Signori« – du wirst dich ihrer erinnern – deren Besuch Leone aus meinem Zimmer gerufen hatte, waren zwei Polizeibeamte gewesen; ihr Eintreffen hatte für meinen edlen Hauswirt eine mehrjährige Trennung von seiner »dicken Giuditta« und seinen beiden »Käfern« bedeutet. Man war einer Reihe der unverschämtesten Zolldefraudationen auf die Spur gekommen, welche Signor Leone unter Mißbrauch seiner Stellung als Hafenbeamter begünstigt hatte.
Wie sehr jedoch Rachele in ihrem Rechte war, das Vermögen ihres Kindes der Vormundschaft Leones zu entziehen, hat der Umstand erwiesen, daß von den sechzigtausend Piastern, die man seinen Händen überließ, in kaum vier Tagen nahezu ein Drittel mit Bezahlung von Schulden, sowie mit Toiletten- und Schmuck-Ankäufen für Madama und ihre Töchter verbraucht war.
Rachele ergänzte aus eigenen Mitteln diese Summe wieder, und um der Familie ein sorgenloses Auskommen zu sichern, ließ sie einen Theil dieses Kapitals in eine auf Madama Giudittas Namen lautende Rente verwandeln, den Rest für die Aussteuer der beiden Mädchen sicher stellen.
Die Vormundschaft ging nominell an den Konsul über, während in Wahrheit Grenelli der Verwalter von Susettas Vermögen blieb.
Auch von Paraskeva weiß ich gute Kunde. Rachele hat die Mahnung, die ich ihr damals in der letzten Stunde ans Herz legte, gar wohl verstanden. Die alte, gute Person verzieht und verhätschelt nun in Saloniki die Kinder des Konsuls. Wenn sie wüßte, was heute geschehen! Mir ist, als seh' ich sie die Hände vor Freude über dem Kopf zusammenschlagen, als höre ich ihr jubelndes: Kyrie! Kyrie!
Eines nur hab' ich erfahren, was für mich einen Schatten in das sonnige Glück dieses Tages warf – das Schicksal des Doktors. Beim Ausbruche des russischen Krieges bot er der türkischen Regierung als Arzt seine Dienste an. Er ist mit den Truppen ausgezogen – doch nicht mehr wiedergekehrt! – – Ich weiß, was ihn aus Peras Mauern trieb! Ja, siehst du, mein lieber Freund, dieser Mann ist auch einer von denen, die nicht wissen, was sie »verschuldet« haben. Er hätte ein besseres Los verdient. Aber so ist das Leben! Um der gleichen Regung willen wird der eine von ihm beglückt und in den Himmel gehoben, der andere zertreten und getötet. Aber ich will das Leben nicht schelten … mich hat es ja beglückt und begünstigt wie keinen zweiten!«
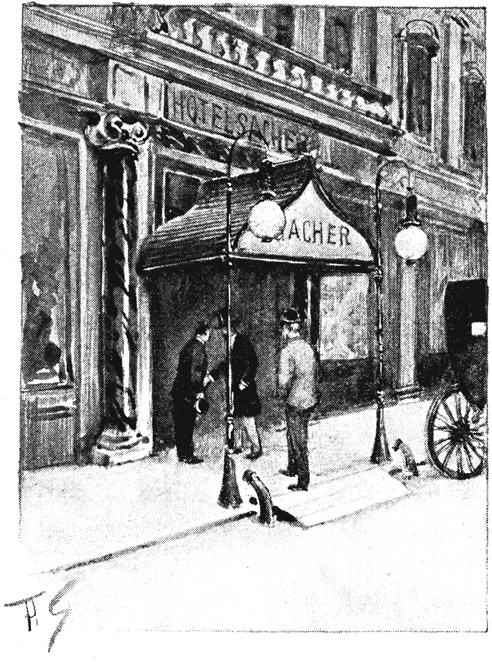
Wir standen vor Sachers Thor. Komplimentierend empfing uns der Portier, und Willy reichte ihm mit freundlichem Gruß die Hand.
»Ich bin diesem Burschen zu großem Dank verpflichtet,« sagte er, als wir schon die Treppe hinaufstiegen. »Wäre er nicht so neugierig gewesen, sich bei Gelegenheit der Frühstücke, die ich hier genommen, nach meinen Personalien zu erkundigen, dann hätte Rachele wohl kaum so rasche Auskunft über mich erhalten. Und wer weiß … am Ende stünde heute noch alles so, wie es gestern war.«
Wir traten in ein hellerleuchtetes, elegantes Gemach. Das mußte Rachele sein – diese schlanke, formenschöne Frauengestalt, die nun schimmernden Auges und lächelnden Mundes meinem Freunde die beiden Hände entgegenbot. Er aber, mit diesem Willkomm nicht zufrieden, zog sie an seine Brust und küßte der sanft Widerstrebenden die Lippen. Dann nannte er meinen Namen. »Und nicht wahr, du bist nicht böse,« fügte er, zu mir sich wendend, bei, während Rachele mir errötend die Hand reichte, »du bist nicht böse, daß ich deiner einen Augenblick vergessen habe. Aber wir haben vieles nachzuholen … wir beide!« Und mit Blicken, aus denen Glück und Liebe in stummer Beredsamkeit sprachen, hing er an Racheles schönem Gesichte.
Wir nahmen Platz – und in dem folgenden Gespräch erfuhr ich auch den gewiß nur äußerlichen Umstand, welcher Rachele nach Wien geführt hatte. Ihr Schwager, der Konsul, wollte die Sommermonate in Marienbad verbringen, und Rachele, die ihn begleitete, hatte ihn veranlaßt, für einige Tage in der schönen Kaiserstadt Halt zu machen.
Als eine Viertelstunde später der Konsul mit Susetta in das Zimmer trat, sah ich auch genügend ein, daß dieser Mann Ursache hatte, nach Marienbad zu gehen. Sein Ansehen und seine Würde füllten die Thüre.
Willy stellte mir Susetta vor und mahnte sie dabei scherzend, nur ja recht artig gegen mich zu sein, denn da er selbst nun ihr Babbo werde, müsse sie in meiner Person einen neuen zio, einen zio Luigi zu gewinnen suchen. Verschämt blickte die Kleine zur Erde, wurde aber bald vertraut, und als man zu Tische ging, da hing sie schon lustig plaudernd an meinem Arm.
Nicht allzuviele Abende in meinem Leben hab' ich so wahrhaft fröhlich verlebt wie diesen.