
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Er war ein müder Kämpfer. Das Leben hatte ihm nur wenig Sonnenblicke gegönnt, das Schicksal ihm hart mitgespielt, frühzeitig tiefe Runen auf seinem Antlitz eingegraben, ihm Haar und Bart mit Silberfäden durchsponnen. Aber das war das Schlimmste nicht. Tausendmal schlimmer war die tiefe Verbitterung, die über den vereinsamten Mann gekommen war. Er haßte die Menschen und verachtete die Welt. Er hatte wenig Liebe kennen gelernt, aber dafür vielfach Verkennung, Enttäuschungen und Verketzerungen erfahren. Der brutale Egoismus der modernen Zeit hatte die schönsten Blüten seines ursprünglich zarten und sinnigen Gemütes zerstört und seine Seele vergiftet. Das hastige Jagen und Drängen nach Ehre und Geld, die Erfolge rücksichtsloser Streber und Schmeichler ekelten ihn im tiefsten Herzen an, und die Ideale seiner Jugend waren darüber verkümmert, der reiche Quell seines Empfindens versiegt. Mehr und mehr hatte er sich von der Außenwelt abgeschlossen, deren Berührung er schließlich mit fast krankhafter Scheu mied, sich in seinem stillen Gelehrtenstübchen vergraben, hier nur noch seinen Büchern und Arbeiten gelebt, ohne doch Erfolg und Anerkennung zu erringen, und sich so in eine selbstgeschaffene Traumwelt hineingesponnen. Er verstand seine Zeit nicht mehr, und sie verstand ihn ebensowenig, und auch die Traumwelt, in der er lebte, war keine schöne und sonnige. Stundenlang konnte er unfruchtbaren Grübeleien nachhängen, und selbstquälerische Betrachtungen waren die einzigen Gefährten seines verfehlten Lebens. Er war blind geworden für die Schönheiten dieser Welt und sah in ihr nur das irdische Jammertal, in dem weiter zu leben es sich kaum noch verlohnte. Seine Widerstandsfähigkeit war gebrochen, seine Kampfesfreudigkeit geschwunden, seine Schaffenslust dahin. Erholung und Zerstreuung kannte er nicht. Ihm duftete keine Blume, ihm sang kein Vogel, ihn ließ das Erwachen der Natur im Frühling so gleichgültig wie die politischen und gesellschaftlichen Ereignisse, die seine Mitbürger in Aufregung versetzten und mit Lebenslust erfüllten. Und mit der Spannkraft des Geistes schwand ihm auch die Gesundheit des Körpers. Der Arzt riet dringend zur Enthaltung von aller geistigen Arbeit und verordnete eine größere Fußtour. Widerwillig genug trat er sie an.
Einige Stunden war er nun schon durch fruchtbares Hügelgelände gepilgert, aber die grünenden Saaten und die blühenden Obstbäume würdigte er kaum eines verdrossenen Blickes, die freundlichen Grüße der ihm begegnenden Landleute hatte er so mürrisch erwidert, daß man ihm erstaunt nachsah, das reine Blau des Himmels tat seinen überangestrengten Augen weh, die lachende Frühlingssonne empfand er nur als lästige Hitze, und die ungewohnte Anstrengung des langen Fußmarsches ermüdete ihn bis zur Erschöpfung. Ein Waldsaum tauchte hinter der nächsten Hügelreihe aus. Etwas rüstiger schritt er darauf zu, um im kühlenden Schatten ein wohlverdientes, erquickendes Ruhestündchen abzuhalten, ehe er das nächste Dorf aufsuchte, in dem er zu nächtigen gedachte. Mit einem Seufzer der Erleichterung, mit einem befriedigten Aufatmen warf er sich neben einer leise murmelnden Quelle ins üppige Gras, schwellende Moospolster und nickende Farnkräuter neben, das grüne Dach einer alten Haselnußstaude über sich.
Lange saß er so fast regungslos und starrte vor sich hin. Das unendlich süße Gefühl des Dolce far niente löste ihm allmählich die ermüdeten Glieder. Und still war es hier, totenstill, so recht nach seinem Geschmack, so still, daß man fast die Harztropfen von den alten Bäumen fallen und den grüngolden-glänzenden Laufkäfer im dürren Laube am Erdboden rascheln hören konnte. Ein kräftiger Erdgeruch, vermischt mit den balsamischen Düften all der bunten Waldblümchen, all der sprossenden Bäume und Sträucher erfüllte die weiche, linde Luft, die seine kranke Brust gierig einsog wie prickelnden Champagnerschaum, die ihn die Arme mit einem lange nicht mehr gekannten wohligen Behagen dehnen ließ und ihm neue Lebenslust in die Adern goß. Ein dürres Zweiglein taumelte hernieder und streifte ihm die gefurchte Stirn. Aber er merkte es nicht mehr, denn schon war er mit einem leisen Lächeln auf den Lippen sanft eingeschlafen. Wie lange er so im grünenden, heiligen Waldesdom geschlummert haben mochte, er wußte es nicht, als er plötzlich aus dem Schlafe neugestärkt emporfuhr. Erstaunt sah er sich um. Wo war er denn? Richtig, ja, das war noch derselbe Fleck. Träge murmelte noch das winzige Quellchen zwischen den breiten Huflattichblättern, und die blauen Glockenblümchen nickten noch immer so schläfrig der dicken Hummel zu, die zu ihnen auf Besuch gekommen war und so grob brummte, wie ein alter Onkel vom Lande, der sich zwischen die geschniegelten Neffen in der Großstadt verirrt hat. Das war alles noch ebenso, und doch kam dem Manne alles wie verwandelt vor, so viel heiterer und freundlicher. Hatte er denn geträumt? Richtig, er hatte sich als frischen, unbändigen Knaben wiedergesehen, der sich mit so übermütiger Lust in dem geheimnisvollen alten Walde um das väterliche Forsthaus getummelt, dem jeder Tag so viel Neues, Niegeschautes beschert hatte, der jede Blume kannte und jeden Bock und jeden Fuchsbau und jedes Krähennest, dem die Vögel so liebe Vertraute waren, deren Sprache er fast verstand, deren Liedern er so gern lauschte, deren niedliche, mit den bunten Eierchen gefüllte Nester er so gut zu finden wußte und vor jeder Gefahr behütete, die er im Herbste mit so tiefer Wehmut scheiden sah, und deren Rückkehr ihn im Frühling mit so wonnigem Entzücken erfüllte, da ihm dann sein lieber Wald erst ganz wieder Wald schien, wenn der Vögel jauchzende Melodien wieder in seinen heiligen Hallen ertönten. Die Vögel! Merkwürdig, daß sich hier gar keine hören ließen, daß es so unheimlich still war, so traurig und totenstill wie auf einem Kirchhof. Er hätte doch gerne einmal probiert, ob er die alten Freunde aus der glücklichen Jugendzeit wiedererkannt, ob er ihre Laute noch verstanden hätte, diese unendlich mannigfaltigen Töne, die so überzeugend zu reden und zu klingen wußten von jauchzendem Glück und namenloser Sehnsucht, von Liebe und Freude, von Trauer und Leid, die so beredt stammeln konnten von Sorge, Furcht und Schreck, so eindringlich warnen vor Feind und Gefahr. Da kommt's angezogen wogenden, bogigen Fluges, zwischen den Baumstämmen geschickt sich hindurchschwenkend. Ein großer, schwarzer Vogel mit roter Kappe: wahrhaftig ein Schwarzspecht, der sagenumwobene gefiederte Zimmermann des deutschen Waldes. Jetzt sitzt er drüben an dem alten, moosbewachsenen Buchenstamm, die Krallen fest in die Rinde eingeschlagen, und gleich darauf unterbrechen auch schon seine wuchtig geführten Schnabelhiebe hämmernd die heilige Waldesstille. Die Späne fliegen nur so nach rechts und links; unverdrossen arbeitet der fleißige Zimmermann weiter, von Zeit zu Zeit ein gickerndes Gelächter ausstoßend, als freue er sich so recht von Herzensgrunde seines fortschreitenden Werkes. Mit einem halb wehmütigen Lächeln schaut ihm der verbitterte Gelehrte zu. Freilich, der schwarze Vogel hat's gut. Zimmert er doch das Brautbett für seine Auserkorene, das bald zur Kinderwiege werden wird. Durch nichts läßt er sich beirren; es ist das zielbewußte Walten der Natur selbst, das da in dem kleinen Vogelherzen mächtig und unwiderstehlich wirkt und schafft. Und doch! Der Mann ist ja Vogelkenner und weiß, daß die moderne Forstkultur gerade den Höhlenbrütern recht übel mitgespielt hat, daß sie ihnen den Kampf ums Dasein unendlich erschwert, ihnen einen Brutplatz nach dem andern entzieht. Fast schien es, als ob der stattliche Schwarzspecht dieser Veränderung der Verhältnisse zum Opfer fallen, als ob er in absehbarer Zeit ganz aus dem deutschen Walde verschwinden müsse. Aber als kluger Vogel wußte er sich wider Erwarten mit der einmal nicht zu ändernden Sachlage abzufinden, sich in die neue Zeit und die moderne Forstwirtschaft zu schicken, sich ihr anzupassen und anzuschmiegen und so geschickt sein Plätzchen zu behaupten. Der einsame Wanderer, der da auf dem grünen Rasen ruht, fängt an, nachdenklich zu werden. War der Vogel nicht klüger als er? Hätte er selbst nicht ebenfalls mit der neuen Zeit gehen können, statt sich ihr feindselig zu verschließen, sich durch die ersten trüben Erfahrungen und Mißerfolge gleich verbittern zu lassen? Was fing er jetzt an mit seinem verkümmerten, lieb- und freudlosen Dasein? Wenn's noch Zeit wäre, das nachzuholen, den begangenen Fehler wieder gutzumachen? Er mußte an die alte Sage denken, die den Specht als Besitzer der geheimnisvollen Springwurzel hinstellt, mit der er verschlossene Türen aufspringen lassen kann. Lag nicht doch ein tiefer Sinn in dem kindlichen Märchen? Hatte nicht der geheimnisvolle Vogel, diese Verkörperung deutschen Waldzaubers, eben auch die verrostete Tür seines verschlossenen Herzens weit aufspringen lassen, daß das Licht hineinfluten konnte, daß sie offen stand für den Geist der neuen Zeit, für die herrlichen Wunder unserer heimischen Natur? Aber freilich, die Menschen, sie würden ihn wieder zurückstoßen, ihn nicht verstehen. Und das hoffnungsvolle Lächeln, das seine Lippen bereits umspielt hatte, wurde traurig und bitter und erstarb. Geheimnisvoll rauscht und raunt es in den alten Baumkronen, flüsternd und kosend bewegen sich die Blätter des nahen Holunderstrauches, neigen sich vor dem Hauche eines vorüberziehenden Windes wie grüne Meereswogen, und geheimnisvoll wie aus dem Schoße des grünen Meeres ertönen aus ihnen weiche, unendlich süße Laute. Die Nachtigall singt. Leise, ganz leise hebt sie an, tiefer und voller schwillt ihre Melodie, bis schließlich ein Schmettern ertönt, das die kleine Vogelkehle sprengen zu wollen scheint. Die Nachtigall singt! Jetzt klingt es aus dem dichten Busche traurig und wehmütig, tief schluchzend und innig flötend, jeder einzelne Laut eine ganze Klage, eine bange, lange Klage voll der rührendsten und innigsten Sehnsucht, als beklage der Vogel ein verfehltes Leben. Dem sturmerprobten, frühgereiften Mann dort unter der wehenden Haselnußstaude greift der wundervolle Gesang des schlichten, grauen Vögelchens mächtig ins gepanzerte, verbitterte Herz. Es wird ihm weich und wehmütig zumute. Wie lange ist es doch her, daß er nicht auf Nachtigallengesang gehört hat? Viele, viele Jahre! Ja damals, als er auf der moosbewachsenen Steinbank unter der alten Linde saß, in jener unvergeßlich schönen Sommernacht, als der Vollmond mit seinem bleichen Licht alles in Silber getaucht hatte, als er wonnetrunken mit seinen Armen das schöne Mädchen umschlossen hielt, als Lippe auf Lippe brannte in heißem, stammelndem Treuschwur, ja – damals hatte sie auch so sehnsüchtig geschluchzt und geflötet, gejauchzt und geschmettert, die gefiederte Sängerkönigin. Das Schicksal hatte ihm die Geliebte grausam entrissen, er war einsam geblieben. Aber war er nicht auch selbst schuld? Waren die Menschen nicht doch vielleicht besser, das Leben schöner und lebenswerter, als er es all die langen Jahre hindurch geglaubt? Dieses tönende, schluchzende, sehnsüchtige, klagende Vogellied saugte sich ihm förmlich ein in Herz und Seele und weckte längst totgeglaubte Gefühle und Hoffnungen. Ach, zur Natur zurückzukehren, dazu wenigstens würde es noch nicht zu spät sein, das würde ihm Herz und Leib gesunden und ihn im Mitmenschen den Bruder und die Krone der Schöpfung wiederfinden lassen. Ein schlichtes Häuschen am Waldessaum und ein Gärtchen für die Arbeit der eigenen Hände an der Scholle, das war's, was er brauchte! Und in seinen Mußestunden würde er dann wieder hinausziehen in den herrlichen deutschen Wald, seinen erquickenden Duft atmen, ihm seine Geheimnisse abringen, seine gefiederten Bewohner in ihrem wunderbaren Tun und Treiben belauschen! Das sollte ein Leben werden! Mit brennenden, durstigen Augen sieht der bleiche Mann auf den kleinen Vogel, dessen süße Lieder ihm von einem andern, hoffnungsfrohen und lebenswerten Leben erzählen. Jetzt schweigt endlich die Nachtigall und verschwindet im grünen Blättermeer, um mit dem Weibchen am Neste trauliche Zwiesprache zu halten. Auch der Mann erhebt sich, greift zum Wanderstabe und setzt mit strahlenden Blicken seinen Weg fort durch den grünen Waldesdom; geht er doch neuen und schöneren, zufriedeneren Tagen entgegen!
In der Tat gibt es keinen Naturlaut, der so gewaltig und innig auf das Gemüt des Menschen zu wirken vermag, wie das seelenvolle Lied des Vogels. Deshalb ist uns auch keine Klasse der Tiere so sehr ans Herz gewachsen wie die der Gefiederten. Sie sind uns ein Gedicht der schaffenden Natur, die sie verschönern und beleben wie keine anderen Geschöpfe. Ihr ganzes Tun und Treiben ist für unsere Sinne mit einem geheimnisvollen Zauber umwoben, und gerade das macht ihre Beobachtung so anziehend und unendlich reizvoll. Was wäre unser deutscher Wald ohne seine beschwingten Sänger? Er würde uns traurig und öde vorkommen, und all seine sonstigen Reize würden uns kalt lassen, uns nicht befriedigen, uns nicht ans Herz greifen. Wer das heilige Walten der Natur versteht, wer in der Anbetung und Erkenntnis der Natur den höchsten und heiligsten Gottesdienst sieht, wer ihn liebt, unsern unvergleichlich schönen und herrlichen deutschen Wald, der wird auch unsere Vögel lieben, sie gerne belauschen und unwillkürlich ihre Sprache verstehen. Er wird mit ganz anderem Genuß durch Flur und Au schreiten, denn jeder Schritt enthüllt ihm neue, wundervolle Bilder aus dem Leben seiner gefiederten Lieblinge. Jetzt wird er erst wirklich sehend. Während der Herausgabe meines »Deutschen Vogelbuchs« ist so manche herzerquickende Zuschrift auf meinen Arbeitstisch geflattert, in der die Schreiber begeisterten Ausdruck verliehen der frohen Selbstzufriedenheit, die eine geglückte Beobachtung aus dem geheimnisvollen Vogelleben zu gewähren vermag, umsponnen vom Waldeszauber, angehaucht vom Waldesduft, durchtränkt von der wahren Poesie der Natur. Ich kann mir nicht versagen, die Zuschrift des bekannten Münchener Schriftstellers Georg Muschner hier anzuführen: »Hätte ich ein zweites Leben zur Verfügung, ich wendete es auf das Studium der seltsamsten Tiere, der Vögel. Ein ganzes Leben gehörte dazu, dieses Kapitel der Naturgeschichte einigermaßen zu erschöpfen. Ehe man die vorhandenen wissenschaftlichen Vorkenntnisse errafft, ehe man sie nachgeprüft hat! Wer etwas gründlich behandeln will, muß auf jeden Baustein, der vorgebaut ist, prüfend seine Hand legen; nur so findet er weiter. Welche Perspektiven eröffnet allein Brehm; zahllose angeschlagene Fragen und unerforschte Probleme, oft nur zwischen den Zeilen angedeutet, mußte er liegen lassen; Fragen, die gerade in unserer Zeit, da man die Psychologie und Sinnesphysiologie der Tiere neu entdeckt hat, des Aufhebens und Nachgehens wert wären. Wer findet neue Möglichkeiten, die noch so geheimnisvolle Welt dieser bewegten Tiere genauer zu beobachten und zu ergründen? Die vorhandenen Mittel und Methoden genügen nicht. Und dann, nach Jahrzehnten des Forschens und Beobachtens, Jahre des Sichtens und Denkens, bis die großen, neuen Gesichtspunkte der Beschreibung gefunden sind. Aber welches Leben in der Natur bietet dieses Studium, welche Fülle entzückender Erlebnisse, feinster und schönster Naturbeobachtungen! Liebenswert und anmutig, wie die meisten Vögel sind, wäre die Beschäftigung mit ihnen. Dazu Reisen in alle Länder, in Berge und Ebenen, Wälder und Prärien, an Flüsse, Seen, Meere; Forschen bei Tag und Nacht, bei Sonnenschein und Regen, zu jeder Tages-, Wetter- und Jahreszeit; ein Nachgehen in und auf der Erde, in Strauch, Busch, Baum, Wasser und Luft, in Felsen und Türmen. Stunden im Abenddämmern des Waldes beim Drosselschlag; Stunden im Morgengrauen auf Wiesen beim frühen Lerchensang. Welche Überfülle von Nebengenüssen, von feinen und besonderen Beobachtungen der Formen, Farben und Laute der Natur! Es gälte, nicht nur Forscher zu sein mit Flinte, Netz, Kodak, nicht nur Jäger und Weltreisender, sondern es hieße auch, Zeichner und Maler zu sein; man würde Künstler und Dichter werden müssen. Wahrlich, hätte ich mein Leben nicht auf andere Dinge eingestellt, ich wendete es auf die Ergründung dieser wunderlichsten aller Tiere und ihrer flüchtigen Welt innerhalb der Welt des Ganzen.«
Schöner, vollendeter, überzeugungsvoller kann man – meine ich – wohl schwerlich ausdrücken, welch intimer Reiz in der Beobachtung des Vogellebens liegt, das uns zur Scholle zurückführt und auch den der Natur entfremdeten Großstädter seiner Allmutter wiedergibt, ihn das Verständnis für unseren vogelbelebten deutschen Wald wiederfinden läßt, und er ist ja doch das Herrlichste, was die Natur geschaffen, wie gerade ich immer wieder betone, der ich so manche fremde Länder durchwandert und ihre bunten Reize voll zu würdigen gelernt habe, um darüber die heiße Liebe zum deutschen Walde nur tiefer, größer und inniger zu empfinden. Ja, schön ist es immer im deutschen Walde, sei es im Frühjahr, wenn das zarte, lichte Knospengrün ihn wieder schmückt, Rotkehlchens leises feierliches Lied mit dem lauten Jauchzen der Drossel und dem schmetternden Schlag des Buchfinken sich vereint, wenn des Kuckucks voller Ruf und des Pirols prachtvoll verschlungener Flötenpfiff an unser Ohr tönt; sei es im Sommer, wenn bunte Blumen den Moosteppich durchsticken und das Blattgrün die saftigsten und vollsten Farbentöne aufweist, die frischen Frühlingslieder zwar schon verstummt sind, aber dafür die ängstlich-wispernden Laute der Jungvögel und die so mannigfach betonten Schreck- und Warnrufe der Alten aus dem Gebüsch erschallen; sei es im Herbste, wenn das Laub in die wunderlichsten gelben und roten Farben getaucht erscheint, von der scheidenden Sonne umgoldet, wenn rote, blaue und weiße Beeren uns anlachen und die hallenden Rufe und spöttischen Pfiffe der scheidenden Wandervögel über den ächzenden, sturmgerüttelten Wipfeln erschallen; sei es im Winter, wenn nur das dunkle Grün der Nadelbäume einen frischeren Ton in die tote, weiße Schneelandschaft bringt, wenn der ganze Wald wie überzuckert und überstaubt dasteht in keuscher, weißflimmernder Pracht und nur das kräftige Gelock der roten Kreuzschnäbel, die leisen Rufe der Meisen und die wehmütigen Flötentöne der farbenschönen Gimpel die heilige Stille unterbrechen – o schön und voll süßer Wunder und reizvoll und groß und herrlich bist du immer, mein lieber deutscher Wald, du und deine liebe, flatternde, spielende, singende und klingende Vogelwelt!
Vielfach findet man die ganz irrige Meinung verbreitet, daß die Beobachtung der einheimischen Vogelwelt dem forschenden Menschengeiste doch unmöglich mehr viel bieten könne, da die paar hundert Arten ja hinlänglich bekannt seien und man über sie kaum noch Neues und Wissenswertes in Erfahrung bringen könne. Das ist grundfalsch! Man versuche nur einmal, sich in irgendein Problem der Vogelbiologie näher zu vertiefen, und man wird bald genug zu der Einsicht kommen, daß sich die Schwierigkeiten fortwährend häufen, daß jeder Schritt nach vorwärts neue, ungeahnte, kaum zu lüftende Geheimnisse und Rätsel vor uns auftürmt. In Wirklichkeit wissen wir selbst von den allerhäufigsten Vogelarten verblüffend wenig, und gerade die gewöhnlichsten Erscheinungen und Vorgänge im Vogelleben harren noch immer genauer Untersuchung und Aufklärung. Ich erinnere nur an die vielen Rätsel des Vogelzuges, an die Verfärbung des Gefieders, an die Geheimnisse des Vogelliedes, des Vogelnestes und der Vogeleier, an die wirtschaftliche Bedeutung gewisser Vogelarten, an das Flugproblem, den Orts- und Richtungssinn und so vieles andere. Zu erklären ist diese auffällige und eigentlich recht beschämende Erscheinung zum Teile wenigstens dadurch, daß die zoologischen Fachgelehrten, für die vielfach die Wissenschaft erst bei 300facher Vergrößerung anfängt, die Ornithologie seit einem halben Jahrhundert überaus stiefmütterlich behandelt und aufs gröbste vernachlässigt oder in überaus einseitiger Weise (man denke nur an die sogenannten Balgornithologen!) erforscht haben. Und es gibt eben viele Fragen in der Ornithologie, deren Lösung nur ein gründlich und umfassend naturwissenschaftlich gebildeter Geist nähertreten kann, der nicht nur die Vogelkunde vollständig beherrscht, sondern auch in Botanik, Insektenkunde, Chemie, Physiologie, Meteorologie und zahllosen anderen Fächern weitreichende Kenntnisse besitzt. Andererseits aber ist es wenigstens in meinen Augen ein großer Vorzug unserer scientia amabilis, daß an ihr in vieler Beziehung auch der Laie erfolgreich mitzuarbeiten vermag, wenn er nur mit offenen Augen und Ohren die Vorgänge in der freien Natur zu verfolgen imstande ist. Die wenigsten freilich wissen das, und die liebliche Vogelkunde ist deshalb bei uns noch lange nicht so volkstümlich, wie sie es sein könnte und zu sein wahrlich verdiente. Ich glaube nicht, daß irgendein Laie, der ihr näherzutreten sich entschließt, dies jemals zu bereuen in die Lage käme, denn die Beschäftigung mit ihr wird seine Sinne schärfen, seinen Körper stählen, seine Beobachtungsgabe entwickeln, seine Liebe zur Heimat stärken, sein Herz mit inniger Befriedigung erfüllen und ihm Gelegenheit geben, auch der strengen Wissenschaft erhebliche Dienste zu leisten. Mögen deshalb recht viele Leser dieser Zeilen eingedenk bleiben, wie viele Fragen es in der heimischen Vogelwelt noch zu lösen gibt, und wie die unscheinbarste Beobachtung zu solchen Lösungen beitragen kann.
Erschwert, aber gerade dadurch auch wieder um so reizvoller und für den echten Forscher anziehender gemacht wird die Beobachtung der Vögel durch die große Flüchtigkeit ihres Wesens, durch die Rastlosigkeit, die den leichtbeschwingten Kindern der Lüfte eigen ist. Als in ihrer Art hochentwickelte Geschöpfe sind die Vögel in jeder Beziehung recht komplizierter Natur, voll von Wundern, aber auch von scheinbaren Widersprüchen. Ich halte sie für das Endglied einer bereits ziemlich abgeschlossenen Entwicklungsreihe, die, wie wir heute wissen, aus den Reptilien hervorgegangen ist, um das Luftreich zu erobern. Sie stellen einen fast vollständig ausgebildeten Seitenast am großen Stammbaume der Schöpfung dar, dessen Hauptstamm im Menschen gipfelt. In ihrer Art sind sie deshalb sehr vervollkommnete Wesen und in manchen Punkten weiter vorgeschritten als die Glieder des Hauptstammes, die von jeher an die feste Scholle gebunden blieben, und deren höchste Vollendung, der Mensch, sich jetzt erst mit vorläufig noch ziemlich geringem Erfolge anschickt, auch in das Luftreich einzudringen, freilich mit den Hilfsmitteln seines hochentwickelten Geistes und nicht mit denen seines nur dem Erdenleben angepaßten, nur einseitig vorgeschrittenen und in mancher Beziehung sogar recht rückständig gebliebenen Körpers. Bis heute noch sind die Vögel die weitaus besten Flieger geblieben, welche die Natur je hervorgebracht hat, und auch ihre Stimmorgane haben sich zur höchsten Vollkommenheit entwickelt, freilich nicht in der Richtung einer artikulierten Sprache, wohl aber nach der des Wohlklangs und Stimmenschmelzes, worin sie von keinem anderen Geschöpfe übertroffen werden, auch vom Menschen nicht. Wir sehen also in den Vögeln einen hoch entwickelten, aber isolierten Tierstamm vor uns. Ob er weiterer Entwicklung fähig sein wird, insbesondere in seinen beiden Haupteigentümlichkeiten, Flug und Gesang? Wer vermöchte das zu bejahen oder zu verneinen? Fast aber will es mir scheinen, als ob ihre Entwicklung im großen und ganzen so ziemlich abgeschlossen wäre, nicht zum wenigsten in den beiden erwähnten Punkten. In den Tropen und Polarländern ist der Gesang ja nie zu solcher Vollendung gediehen, wie in den gemäßigten Breiten, und in diesen führen unsere Vogelliebhaber seit Jahren die beweglichsten Klagen über die zunehmende Verschlechterung des Gesanges. Der Flug wiederum hat im Wanderflug seine höchste Ausbildung erreicht, aber es kann kaum noch einem Zweifel unterliegen, daß die Wanderungen der Vögel vor unseren Augen zusammenzuschrumpfen beginnen und unter dem Einflusse des im allgemeinen wieder milder werdenden Klimas ihre Notwendigkeit allmählich immer mehr verlieren werden, bis schließlich das ganze rätselvolle Problem des Vogelzuges vorübergerauscht sein wird wie so manche andere Epoche der Tierentwicklung. Und was wird das schließliche Schicksal des Vogelstammes sein, dieses lieblichsten und blütenreichsten Zweiges am großen Baume der organischen Schöpfung? Auch darüber können wir uns natürlich nur in Vermutungen ergehen. Nachdem in grauer Vorzeit die Reptilien die Erde beherrscht haben, um zum Schlusse den weit vollkommener organisierten Säugetieren weichen zu müssen, liegt der Gedanke nahe, daß nach Millionen und aber Millionen von Jahren auch die Vögel einmal zur Herrschaft gelangen werden, und in der Tat hat es nicht an Forschern gefehlt, welche die Vögel oder doch vogelähnliche Geschöpfe als die künftigen Beherrscher der Erde hinstellen, und selbst heute noch hört man hier und da diese Ansicht. Sie dürfte aber wohl niemals sich bewahrheiten, denn heute hat der Mensch doch vor all seinen Mitgeschöpfen einen so unendlich weiten Vorsprung errungen, daß ihm das Zepter kaum jemals wieder wird entrissen werden können. Und gerade die Vögel haben ja unter der rastlos fortschreitenden menschlichen Kultur mehr zu leiden als die anderen Tierstämme, so daß in den hyperzivilisierten Ländern ihre Scharen leider hinwegschmelzen wie der Schnee an der Frühlingssonne, was auch die besten Vogelschutzgesetze und Schutzmaßregeln auf die Dauer vielleicht nicht werden verhindern können. Schon gibt es eine lange Reihe von Vogelarten, die in historischer Zeit ausgestorben sind, und eine noch längere, deren Ausrottung wenigstens in kultivierten Ländern wahrscheinlich nur noch eine Frage der Zeit ist. Es steht daher eher zu erwarten, daß die Forscher recht behalten werden, welche glauben, daß die Tage des Vogelstammes gezählt sind, daß er den Zenit seiner Entwicklung bereits überschritten habe und nun dem Absterben und dem Untergange entgegengehe, um jüngeren Entwicklungsreihen und neuen Tierstämmen Platz zu machen. Freuen wir uns, daß dieses Ereignis erst nach vielen Jahrtausenden eintreten kann, daß vorläufig unser deutscher Wald noch widerhallt vom jubelnden Liede der gefiederten Sängerscharen, daß wir uns ergötzen können an ihren anmutsvollen Bewegungen und Flugspielen, daß wir uns versenken können in die reizvollen Probleme des Vogellebens!

Oben: Singdrossel ( Turdus musicus L.) Unten: Misteldrossel ( Turdus viscivorus L.)
Ehe wir weitergehen, dürfte es angebracht erscheinen, einen kurzen Blick zu werfen auf die hauptsächlichsten Vertreter des Vogellebens im deutschen Walde, wobei ich von allen Seltenheiten und vorübergehenden Erscheinungen absehe und nur die Arten herausgreife, welche für unseren Wald wirklich charakteristisch oder in irgendeiner Beziehung für ihn von mehr oder minder großer Bedeutung sind, ohne die wir uns unsere Forste nicht gut vorzustellen vermöchten. Die herrlichen Lieder der schwarzen Amseln und der auf der Oberseite olivenbraunen, auf der Unterseite gefleckten Singdrosseln vermissen wir wohl in keinem unserer Wälder, und im Nadelwalde des Mittelgebirges leiten die vom höchsten Baumwipfel herab weithin erschallenden Strophen der größeren Misteldrossel, die vom Volke ihres schnarrenden Locktones wegen gewöhnlich als »Schnärre« bezeichnet wird, das große Frühlingskonzert ein. Im Herbste kommt aus dem Norden auch die kleinere, rötlich überflogene Weindrossel in großen Schwärmen zu uns, um leider zu Tausenden den mit den verlockend-leuchtenden Ebereschenbeeren geköderten Schlingen des Dohnenstieges zum Opfer zu fallen. In der Hauptsache freilich gelten diese mörderischen Fangvorrichtungen dem echten »Krammetsvogel«, der stattlichen, durch den aschgrauen Nacken und Bürzel ausgezeichneten Wacholderdrossel, die, ursprünglich ebenfalls in nördlicheren Landen heimisch, jetzt auch vielfach bei uns brütet, teilweise noch in mehr oder minder umfangreichen Kolonien, wie es in der Tundra die Regel ist. An der Waldgrenze im Hochgebirge ist die durch einen auffallenden weißen Halbmond auf der Oberbrust geschmückte Ringamsel heimisch. Wo ein murmelnder Bach sich Bahn bricht, sehen wir auf einem Stein einen stargroßen, braunen Vogel mit weißem Brustlatz, die muntere Wasseramsel, die von unseren Fischzüchtern sehr mit Unrecht in Acht und Bann getan worden und dem Naturfreunde deshalb besonders ans Herz gewachsen ist, weil sie ihr fröhliches Lied auch mitten im Winter ertönen läßt. Ihr Nachbar ist der griesgrämige, aber farbenschöne, smaragdgrüne Eisvogel, der »fliegende Edelstein« unserer Gewässer. Als dritte im Bunde findet sich an den gleichen Örtlichkeiten auch die liebreizende, schwefelgelbe Bergstelze mit dem schwarzen Kehlfleck, die zierlich wie ein hochgeschürztes Wäschermädchen im Ufersande herumtrippelt, dabei den langen Schwanz wie eine Balancierstange handhabend. Sie ist wie die Wasseramsel mehr in gebirgigen Gegenden zu Hause, während die gewöhnliche schwarzweiße Bachstelze allenthalben vorkommt. Schon an den ersten lauen Märztagen sehen wir das hübsche Schwarzkehlchen (Kopf und Kehle schwarz, Unterseite braunrot, weißer Flügelschild) auf den Spitzen der jungen Fichtenbäumchen in den an Äcker und Wiesen angrenzenden Schonungen sitzen; im östlichen Deutschland ist es nur ausnahmsweise anzutreffen, aber dort ist sein Vetter, das Braunkehlchen, das allerdings mehr Wiesenvogel ist, wenn es sich auch gerne an den Waldrändern herumtreibt, um so häufiger. Unsere Sängerkönigin, die allbeliebte Nachtigall, fehlt im düsteren Hoch- und reinen Nadelwalde, ist aber dafür Charaktervogel lichter, buschiger und etwas feuchter Vorwaldungen und Feldhölzer. Der ihr sehr ähnliche, sich hauptsächlich durch den noch stärkeren und kräftigeren Schlag auszeichnende Sprosser bevorzugt sumpfige Auwaldungen längs den Stromufern und siedelt sich namentlich auch in Weidenpflanzungen sehr gerne an. Unser allbekanntes Rotkehlchen, dessen feierlich-melancholischer Gesang an schönen Frühlingsabenden so anmutend wirkt, und das am Boden im Moos oder zwischen Wurzeln nistet, will vor allem dichtes Unterholz haben, findet sich aber sonst in Waldungen aller Art. Viel seltener und schwieriger zu beobachten ist das reizende Blaukehlchen, das ähnliche Örtlichkeiten bewohnt wie der Sprosser, sich aber mehr im dichten Pflanzenwust unmittelbar über dem sumpfigen Erdboden herumtreibt. Das Gartenrotschwänzchen (Stirn weiß, Oberseite grau, Gesicht und Kehle schwarz, Unterseite rötlich) ist einer unserer ersten und lieblichsten Frühlingsboten und findet sich im allgemeinen zwar mehr in offener, parkartiger Landschaft, fehlt aber auch im Innern der großen Waldungen keineswegs; durch seine schüttelnden, sehr charakteristischen Schwanzbewegungen ist es auch für den Laien sofort leicht kenntlich. Im jungen Unterholz schlüpft die Heckenbraunelle, durch ihre schieferblaue Brustfärbung ausgezeichnet, mit erstaunlicher Gewandtheit hin und her. Ihr Nachbar ist der ebenso kecke wie winzige Zaunkönig, der mit gnomenhafter Behendigkeit und senkrecht emporgestelztem Schwänzchen durchs dichteste Dornengewirr huscht, dessen schnarrenden Lockton und überraschend lautes, kanarienvogelartig trillerndes Lied wir zu unserer Freude auch mitten im Winter zu hören bekommen. Echte Waldvögel und Buschbewohner sind alle unsre Grasmücken. Den herrlich-jubelnden Überschlag des Schwarzplättchens (mausgrau mit schwarzer Kopfplatte) vernehmen wir am häufigsten in etwas feuchten Laubwäldern mit recht dichtem Unterholz, Örtlichkeiten, die auch der selteneren, gelbäugigen, auf der Unterseite mit feinen Wellenstreifen gezeichneten Sperbergrasmücke besonders zusagen. Buschreiche Feldhölzer beherbergen die schlichte, olivbraun gefärbte, aber durch ihren melodienreichen Orgelgesang sich auszeichnende Gartengrasmücke, die wir in geschlossenen Hoch- und Nadelwäldern vergeblich suchen würden. Die kleinere, mehr graue Dorngrasmücke ist der ausgesprochenste Waldbewohner aus dieser artenreichen Familie, der die Nähe des Menschen sichtlich meidet, während seine Verwandten sie eher aufsuchen. Dies gut insbesondere von der niedlichen Zaungrasmücke, die ihren gebräuchlicheren Trivialnamen »Müllerchen« sowohl von der eigentümlich klappernden Schlußstrophe ihres anspruchslosen Gesanges, wie von der weißen Kehlfärbung und dem wie mit Mehlstaub bepuderten Aussehen ihres Unterkörpers erhalten haben mag. Der melodienreiche, auf der Unterseite gelblich gefärbte Gartenspötter, der mit den Scheitelfedern ein so nettes Häubchen zu stellen vermag, stellt sich gewöhnlich erst in den ersten Tagen des Mai wieder an seinen in kleineren, lichten Laubwäldern mit viel Unterholz gelegenen Brutplätzen ein. Der hochelegante, oben zart-zeisiggrün, unten gelblichweiß gefärbte, durch einen schönen, gelben Augenbrauenstreif geschmückte Waldlaubsänger ist ein Charaktervogel hochstämmiger Buchenwaldungen, aus deren dichten Wipfeln sein schwirrendes Liedchen zu uns herabklingt. Ganz denselben Geschmack in der Wahl des Aufenthaltsortes zeigt auch der seltene Zwergfliegenfänger, der durch den roten Brustlatz der alten Männchen lebhaft an ein Rotkehlchen erinnert, aber wesentlich kleiner ist als dieses. Der oben grünlichgraue, unten gelblichweiße Fitis bevorzugt gemischte Waldungen mit üppigem Buschwerk und hat eine besondere Vorliebe für Birken. Äußerlich schwer von ihm zu unterscheiden ist der wetterfestere Weidenlaubsänger. Aber der Gesang beider Arten ist grundverschieden. Während dieser Vogel über sein einförmig taktierendes »Zilp zalp zilp zalp zilp zalp« nicht hinauskommt, verfügt der Fitis über einen süßen Zwitschergesang in den weichsten Molltönen. Von den Rohrsängern, diesen unruhigen und lärmenden Bewohnern der Schilf- und Rohrdickichte unserer Teiche, darf vielleicht der mehr im östlichen Teile unseres Vaterlandes vorkommende und auch hier nur stellenweise häufige Flußrohrsänger oder Schlagschwirl noch am ehesten als Waldvogel bezeichnet werden, da er sumpfige, dicht verwachsene Erlendickichte jedem anderen Aufenthalte vorzieht; sein Gesang ist ein ganz eigentümliches, heuschreckenartiges Schwirren. Wo ein rohrbewachsener Teich sich im Walde vorfindet oder an ihn angrenzt, da dürfen wir auch darauf rechnen, an lauen Sommerabenden den wirren Gesang des Teichrohrsängers zu vernehmen. Im eigentlichen Walde freilich läßt er sich nicht blicken, und auch sein hübsch aus Halmen, Rispen, Schilf und Würzelchen geflochtenes Nestchen steht gewöhnlich im Röhricht über dem seichten Wasser, indem einige Rohrhalme geschickt in seine Seitenwände hineingebaut sind und so dem schwanken Gebilde den nötigen Halt verleihen. Als eifrige Vertilger schädlicher Insekten sind die verschiedenen Meisenarten für unsere Wälder von großer Bedeutung. Dem Nadelwalde gehören die behende, oberseits aschgraue, am Kopf glänzendschwarze Tannenmeise mit weißem Nackenfleck und weißen Wangen, sowie die überaus niedliche Haubenmeise an, die in Hessen ihres spitzen Federschopfes wegen vom Volke »Gensdarmle« genannt wird. Unsere gewöhnlichste Meise ist die größere Kohlmeise, deren gelbe Unterseite durch einen schwarzen Bruststreifen geziert ist und deren silberhelles Stimmchen so wohltönend den Frühling einläutet. Noch hübscher ist die bunte und in keinem Walde fehlende Blaumeise mit blauem Scheitel, blauen Schwung- und Steuerfedern. Dem Laubwalde gehören die rastlose Sumpfmeise (grau mit schwarzer Kopfplatte) und die allerliebste, winzige Schwanzmeise an, deren weißes Puppenköpfchen und langer Pfannenstielschwanz eine so urkomische und rührend hilflose Zusammenstellung abgeben. Alle Meisen harren auch den Winter über bei uns aus und ziehen während der rauhen Jahreszeit als gefiederte Waldpolizei truppweise auf der Suche nach Eiern, Larven und Puppen meist schädlicher Insekten hin und her, oft mehrere Arten vergesellschaftet und nicht selten auch mit verwandten Vögeln vermischt. So trifft man in diesen bunten Flügen häufig den munteren Kleiber (Oberseite blaugrau, Unterseite rostfarbig), der als einziger von unseren Vögeln das Kunststück zuwege bringt, kopfabwärts an Baumstämmen zu klettern, und der das Eingangsloch seiner Bruthöhle durch eine kunstvoll aufgeführte Lehmmauer zu passender Enge verkleinert; ferner das kleine Baumläuferchen ( Certhia familiaris L., S. 23, Abb. 1 auf unserem Gruppenbilde), das seines rindenfarbigen Gefieders halber so schwer zu sehen ist, wenn es still-geschäftig in Spiralen an alten Baumstämmen emporrutscht und mit dem in eine feine Spitze ausgezogenen Krummschnäbelchen so eifrig die Spalten und Risse der Baumrinde nach den winzigsten Kerfen durchstöbert. Gern schließen sich auch die Zwerge unserer Vogelwelt, die im dichten Nadelwald heimischen Goldhähnchen, die ihr feuerfarbstrahlendes Kopfdiadem so wunderniedlich erscheinen läßt und deren zarte Stimmchen erklingen wie gesponnenes Glas, diesen gemischten Meisentrupps an. Diese Gnomen sind bei uns in zwei Arten vertreten. Das Safranköpfchen bleibt auch den Winter bei uns, und seine gelbe Scheitelfärbung ist von zwei schwarzen Streifen begrenzt, die auf der Stirn nicht verbunden sind; beim Feuerköpfchen dagegen, das im Winter fortzieht, ist die Scheitelfärbung mehr rot, und die einfassenden samtschwarzen Streifen laufen auf der Stirn zusammen; auch zieht sich ein schwarzer Strich durch das Auge. Führer eines solchen buntscheckigen Meisenschwarmes ist oft ein Rotspecht, ( Dendrocopus maior [L.], Abb. 5 unserer Zeichnung), dessen Männchen eine lebhaft rote Binde auf dem Hinterkopf aufweist, und bei dem auch die Aftergegend bei beiden Geschlechtern ebenso gefärbt ist. Er gehört zur Gruppe der die deutschen Reichsfarben tragenden Buntspechte, u. zwar haben wir als regelmäßige Bewohner unserer Wälder außer ihm noch den zumeist auf Laubholz beschränkten, etwas kleineren Mittelspecht, bei dem der Scheitel auch beim Weibchen rot, die Aftergegend aber und ein großer Teil des Unterleibes zart rosenrot ist, und endlich noch den Zwerg der Familie, den reizenden, in buschreichen und feuchten Laubwaldungen am ehesten anzutreffenden Zwergspecht ( Dendrocopus minor [L.], Abb. 2). Während dieses nützliche Vögelchen sich sehr gern auch in Obstpflanzungen, Parkanlagen und großen, verwilderten Gärten ansiedelt, bewohnt der menschenscheue, stattliche Schwarzspecht (schwarz mit roter Kopfplatte und gelben Augen, Dryocopus martius [L.], Abb. 4) das Innere ausgedehnter Waldungen, besonders auch der großen Nadelforste. Der grasgrüne, ebenfalls mit einer roten Kopfplatte und einem ebensolchen Bartstreifen geschmückte Grünspecht ( Picus viridis [L.] Abb. 3) ist dagegen hauptsächlich in lichten, hochstämmigen Laubwaldungen zu Hause; während bei ihm die Augengegend schwarz ist, ist sie bei dem ähnlichen, etwas kleineren Grauspecht grau. Diese beiden Arten halten sich mehr als andere Spechte auf der Erde auf, da Ameisen und deren leckere Puppen ihre Lieblingsnahrung bilden. Da die Spechte ihrer ganzen Leibesorganisation nach auf das Leben an alten Baumstämmen angewiesen sind, die sie ruckweise, sich auf den elastisch-federnden Schwanz stützend, erklettern, zählen sie zu den hervorragendsten Charaktervögeln des deutschen Waldes, für dessen Gedeihen sie insofern von besonderer Wichtigkeit sind, als sie unter der Baumrinde die schädlichen, holzzerstörenden Larven gewisser Käferarten hervorsuchen. Sie zimmern sich ihre Bruthöhlen mit kräftigen Schnabelhieben selbst und verschaffen dadurch auch anderen Höhlenbrütern erwünschte Nistgelegenheit. Mögen sie dabei auch manchen gesunden Baum anschlagen, so sind sie doch im allgemeinen nützlich, und ihre gellenden, jauchzenden, lachenden, wiehernden, überraschend kräftigen Rufe sowie ihre eigentümlichen Trommelkonzerte wird kein wahrer Naturfreund im deutschen Walde missen wollen. Dieses absonderliche »Trommeln« kommt dadurch zustande, daß der Specht, um seiner Liebessehnsucht oder überhaupt nur seinem Wohlbefinden kräftigen Ausdruck zu geben, einen dürren Ast durch blitzschnelles Schnabelgehämmer in vibrierende Schwingungen versetzt.

Eisvogel ( Alcedo ispida L.)
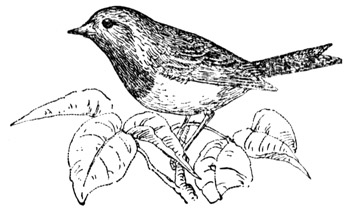
Rotkehlchen ( Erithacus rubeculus [L.])
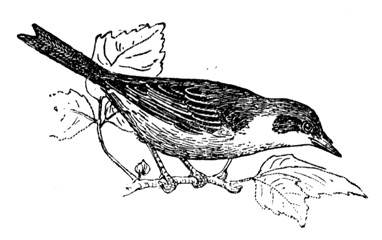
Dorngrasmücke ( Sylvia sylvia [L.]>

Teichrohrsänger ( Acrocephalus streperus [Vieill.]) brütend.

Kohlmeise ( Parus maior L.)

Spechtarten
In vernachlässigten, blößenreichen Waldungen steigt der Baumpieper, ein schlicht lerchenartig gefärbtes Vögelchen und hurtiger Läufer, von einer Baumspitze spitze aus in weitem Bogen in die Lüfte, kanarienartig dazu trillernd und schließlich mit langsam ersterbendem »Zia zia zia« wieder zu seinem Ausgangspunkte zurückkehrend. Von den liederreichen Lerchen kann nur die liebliche Heidelerche als Waldvogel gelten, da sie gewöhnlich auf heidebewachsenen Waldblößen brütet, besonders auf dürrem Boden im undichten Nadelwalde des Mittelgebirgs. Ihre süßen Strophen, die wie kleine Silberglöckchen ans Ohr tönen, sind eine wahre Erquickung für den einsamen Wanderer in solchen öden Gegenden. Die Ammern sind mehr Feld- als Waldvögel. Nur der in der Hauptsache gelb gefärbte Goldammer, dessen schlichte Strophe das Volk so sinnig mit »Wie wie wie hab ich dich – lieb« übersetzt hat, ist vornehmlich in Feldhölzern und Vorwaldungen mit viel Unterholz zu Hause. Ganz auf den Nadelwald und auf dessen Sämereien als Nahrung angewiesen ist dagegen der durch seine kreuzweise übereinandergelegten Schnabelkiefer vor allen anderen Vögeln ausgezeichnete Kreuzschnabel. Gar prachtvoll heben sich die alten, schön johannisbeerrot gefärbten Männchen im Winter von den vom Schnee überzuckerten Fichten ab, mit deren großen Zapfen im Schnabel sie eifrig hin und her fliegen, oft ihr kräftiges Locken erschallen lassend. Merkwürdig ist es, daß diese wetterharten Vögel auch mitten im Winter zur Fortpflanzung schreiten und ihr warmes, dickwandiges Nest errichten zu einer Zeit, wo Schnee, Eis und Kälte alles Tierleben in starre Fesseln schlagen. Ebenfalls als Brutvogel im Nadelwalde heimisch ist unser allbekannter Erlenzeisig mit dem gelbgrünen Gefieder und der schwarzen Kopfplatte. Im Winter kommen auch starke Schwärme des nordischen Birkenzeisigs (grau mit rotem Scheitel, das ausgefärbte Männchen auch mit roter Brust) zu uns, die namentlich solche Wälder aufsuchen, wo es Erlen und Birken gibt. In noch größeren Massen pflegen in manchen Wintern die Bergfinken (Brust rostrot, Bauch und Bürzel weiß, Oberseite grauschwarz) zu erscheinen, die dann zu Tausenden und aber Tausenden in den Buchenwäldern einfallen, deren Samenertrag empfindlich schmälern und ihre Stille mit häßlich quäkenden Locktönen nicht eben angenehm unterbrechen. Da ist unser allbekannter Buchfink doch ein viel netterer Bursche, dessen taktmäßig schmetternde, klangvolle Weise wohl kaum in einem deutschen Walde völlig fehlen wird, sei es Lauboder- oder Nadelholz, in der Ebene oder im Gebirge, auf trockenem oder feuchtem Boden. Recht stille, einsame Waldpartien sucht sich der farbenschöne Gimpel oder Dompfaff zum Standquartier aus. Im Winter kommt er auch in die Gärten, wo wir dann seinen schwermütigen Flötenpfiff hören und das schmucke Gewand der Männchen bewundern können, die brennendrote Weste, den zartblaugrauen Oberrock und das tiefschwarze Samtbarett. Der in seinem Benehmen sehr an den Kanarienvogel erinnernde, in der Hauptsache hellgelb gefärbte Girlitz, der freilich im Gegensatz zu seinem begabten Vetter von den »Inseln der Glückseligen« nur einen unbehilflich stammelnden und zirpenden, mit wirrem Zithergeklimper vergleichbaren Schwirrgesang hören läßt, war ursprünglich in den Mittelmeerländern heimisch und ist von dort aus erst im vorigen Jahrhundert auf zwei großen Einbruchsstraßen von Südwesten und Südosten aus in Deutschland eingewandert, in dessen südlichen und mittleren Teilen er heute bereits zu den häufigen Vögeln zählt, während er im Norden unseres Vaterlandes vorläufig noch ziemlich vereinzelt auftritt. Auf die Gebirgswälder des südwestlichen Deutschland beschränkt ist der schön gelbgrüne Zitronenzeisig, der nur bei rauhem Wetter in die geschützteren Täler verstreicht und deshalb im Schwarzwald als sicherer Vorbote von Schneegestöber unter dem Namen »Schneevögeli« bekannt ist. In ganz Deutschland gemein ist dagegen der mehr an Waldrändern sich aufhaltende und viel auf den Feldern sich herumtreibende Hänfling, ein vortrefflicher Sänger von braungrauer Farbe, dessen alte Männchen auf Stirn und Brust mit lebhaftem Karminrot geschmückt sind; sein melodienreiches, wechselvolles, mit einigen hart gackernden Tönen durchsetztes Lied ist durch eine auffällige, laut krähende Strophe besonders gekennzeichnet. Der bunte Stieglitz mit dem schwarz-weiß-roten Kopf und den beiden gelben Binden im schwarzen Flügel liebt parkartige Landschaften, ist daher in allen durchbrochenen und lichten Laubhölzern anzutreffen, nicht aber im geschlossenen Nadelforst und im düsteren Hochwald. Einer unserer häufigsten Vögel ist der etwas plump gebaute Grünfink (Hauptfarbe gelbgrün) oder Zwunsch, der besonders an den Waldrändern und in den Auen sich vorfindet. Das Spatzengeschlecht wird im Walde durch den in Baumhöhlungen aller Art nistenden Feldsperling vertreten, der sich vom gewöhnlichen Haussperling durch den rotbraunen Oberkopf, den weißen Halsring und eine zweite Flügelbinde unterscheidet. Ein recht dickköpfiger und vierschrötiger Bursche ist der durch seinen gewaltigen Schnabel auffallende, überwiegend gelbbraun gefärbte und im Oberflügel ein weißes Schild tragende Kirschkernbeißer; er lebt nur in Laub- und gemischten Waldungen und knackt mit seinem Riesenschnabel die härtesten Kirschkerne so wuchtig auf, daß man das dadurch verursachte Geräusch dreißig Schritte weit hören kann. Meister Star nistet, soweit er sich nicht enger an den Menschen angeschlossen und die von diesem ausgehängten Nistkästen bezogen hat, in den Baumhöhlungen unserer Laubwälder und zeigt sich an solchen Plätzen nach meinen Erfahrungen oft auffallend scheu. Der goldgelbe, schwarzflügelige Pirol, dessen köstlich verschlungener Flötenpfiff von den ersten Tagen des Mai ab wieder unser Ohr erfreut, hängt sein kunstvoll gefertigtes Beutelnest am liebsten an schwanken Birkenzweigen in gemischten, etwas feuchten Laubwaldungen auf. Während der schwarzweiß getropfte Nußhäher nur in den Arvenbeständen des Hochgebirges brütet, ist der kokette Strauchritter und schmucke Hochstapler Eichelhäher mit der hübschen Federhaube und dem schönen, blauen Flügelspiegel sowohl im Nadel- wie im Laubwalde heimisch, wo er mit mißtönig rätschendem Geschrei herumstrolcht und jedes ihm vorkommende Vogelnest erbarmungslos ausplündert. Ein arger Nesträuber ist auch die schwarzweiß gefärbte, metallisch glänzende, langschwänzige Elster, die sich aber mehr an den Waldrändern und in kleinen Feldgehölzen als im Innern großer Forste aufhält und namentlich recht sparrige Bäume und Dorngestrüpp liebt, die ihr das Material zu ihren überhaubten Nestern liefern müssen. Die uns von unseren Kirchtürmen und von alten Ruinen her wohlbekannte Dohle finden wir auch in kleinen und lichten Wäldern wieder, wo sie zu den Höhlenbrütern zählt und gleichfalls ihrem ausgesprochenen Geselligkeitstriebe huldigt. Noch größere Brutkolonien aber bildet die in ein stahlblau schimmerndes Gefieder gehüllte Saatkrähe, die im Alter eine nackte, grindige Stelle um den Schnabel herum bekommt. Ihre sparrigen Reisighorste stehen zumeist in hochstämmigen, kleinen Feldgehölzen, oft ein Dutzend und mehr auf einem Baume. Dagegen brüten die am Körper hellgraue Nebelkrähe und die sie westlich der Elbe vertretende ganz schwarze Rabenkrähe stets einzeln, beide eine arge Geißel der Niederjagd und schlimme Feinde der Kleinvogelwelt, wodurch der Nutzen, den sie durch Vertilgung von Mäusen und schädlichen Insekten unleugbar auch stiften, mehr als aufgehoben wird. Der mächtige Kolkrabe, Wodans geheiligter Vogel, ein reckenhafter Typus des alten germanischen Urwaldes, ist bei uns schon im Aussterben begriffen, was man trotz seiner großen Schädlichkeit vom Standpunkte des Naturganzen und des Naturschönen aus nur lebhaft bedauern kann. Dem rotrückigen Würger oder Neuntöter, einem unserer begabtesten Spötter, den man seiner Nesträubereien halber im Garten nicht gut dulden kann, mag man im Walde immerhin sein Plätzchen gönnen. Noch harmloser sind der auf der atlasweißen Unterseite so duftig-rosenrot überhauchte Grauwürger und der wesentlich seltenere Rotkopfwürger. Als ein arger Räuber, der selbst erwachsenen Singvögeln mit Erfolg nachstellt, muß dagegen der große Raubwürger, auch Krickelster genannt, gelten, der im Gegensatze zu seinen sehr wärmebedürftigen Verwandten auch den Winter über bei uns bleibt, dann zwar manches Mäuschen wegfängt, aber auch die Vogelscharen an den Futterplätzen grimmig zehntet. Alle Würger beanspruchen in erster Linie Dorngesträuch, auf dessen Spitzen sie auf Beute lauern und an dem sie zu Zeiten des Überflusses die gefangenen Opfertiere aufspießen. Ein sich fast jeden Winter einstellender und sich dann ausschließlich von den verschiedensten Beeren ernährender Gast ist der farbenduftige, vertrauensselige, dummgefräßige Seidenschwanz mit der hübschen Tolle, der gelben Schwanzbinde und den roten Federplättchen. Die Fliegenschnäpper sind in allen vier Arten Bewohner nicht zu düsterer Laubwaldungen. Der graue und der schwarzrückige Trauerfliegenfänger sind am häufigsten. Die in den wundervollsten Farbenabstufungen alter Baumrinde angepaßte Nachtschwalbe, der blöder Aberglaube so viel Schändlichkeiten angedichtet hat (siehe die Trivialnamen Ziegenmelker, Hexe usw.), halte ich für den forstnützlichsten aller unsrer Vögel. Den Tag verträumt dieser Sonderling, indem er sich der Länge nach an einen wenig geneigten Baumstamm andrückt, so daß man ihn nur sehr schwer zu Gesicht bekommt. Mit Einbruch der Dämmerung aber wird er munter, streicht mit geisterhaftleisem Flug die Waldränder und Waldwege entlang und fängt hier gierig die so forstschädlichen Nachtschmetterlinge mit seinem ungeheuerlichen Rachen weg. Seine Stimme ist ein absonderliches Schnurren. Auch der Kuckuck, dessen lenzkündender Ruf jedes Gemüt mit Freude erfüllt, ist, wenn er auch durch seinen Brutparasitismus zahlreiche Vogelbruten vernichtet, entschieden ein forstnützlicher Vogel, da er als der einzige von allen unseren Vögeln behaarte Raupen in so großer Menge verzehrt, daß sein Magen von den eingebetteten Haaren dieser argen Waldschädlinge oft wie ausgepolstert aussieht. Ob diese Raupen dabei teilweise mit Parasiten behaftet waren oder nicht, ist für die Praxis ganz gleichgültig. Das nähere Studium des Brutgeschäftes des Kuckucks gewährt eine Reihe hochinteressanter Einblicke in das geheimnisvolle Walten der Natur und ihre wunderbar harmonische Werkstätte. Als »Kuckucksküster« oder »Kuckucksknecht«, weil er wenige Tage vor dem Gauch bei uns einzutreffen pflegt, bezeichnet der Volksmund den possierlichen Wiedehopf, der seinen schönen Federfächer auf dem Kopf so kokett auf- und zuzuklappen versteht. Sein fröhliches »Hupp hupp hupp« ist auch einer der angenehmsten Naturlaute in dem großen Frühlingskonzert. Er siedelt sich am liebsten an den Rändern alter, vom Unterholz freier Laubwälder an, da, wo diese an Hutungen, Wiesen und Äcker stoßen. Am Neste ist das sonst so hübsche Kerlchen freilich ein arger Schmutzian und steht in dieser Beziehung in recht üblem Gerüche – in des Wortes wörtlichster Bedeutung. Einer unserer schönsten Vögel ist die blaugrüne, auf dem Rücken zimtfarbene, mehr in Ostdeutschland anzutreffende Blauracke oder Mandelkrähe, deren häßliches und mißtöniges Geschrei freilich ihrem prachtvollen Federkleide recht wenig entspricht. Sie bewohnt lichtere Wälder in ebenen Gegenden mit dürrem Boden, wo sie zumeist in Baumhöhlungen brütet, erfreulicherweise aber auch entsprechend große Nistkästen annimmt. Ein eintöniges, etwas stumpfsinnig, aber doch gemütlich klingendes Freudengeschrei macht uns Ende April auf die Ankunft des Wendehalses aufmerksam, dessen Gefiederfärbung wie beim Baumläuferchen und der Nachtschwalbe der Baumrinde nachgebildet ist. Mit seiner erstaunlich langen, klebrigen, ungemein beweglichen Zunge stöbert dieser eigentümliche und durch seine große Ängstlichkeit ausgezeichnete Vogel in den Ameisenhaufen herum und zieht dann die hängengebliebenen Kerfe rasch in den Schnabel.

Baumpieper ( Anthus trivialis [L.])

Fichtenkreuzschnabel ( Loxia curvirostra L.)

Gimpel ( Pyrrhula pyrrhula [L.])

Grünfink ( Chloris chloris [L.])
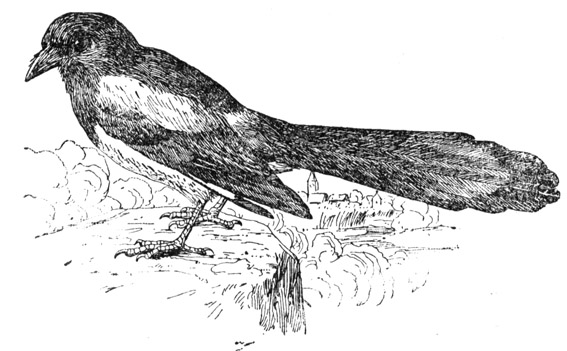
Elster ( Pica pica [L.])
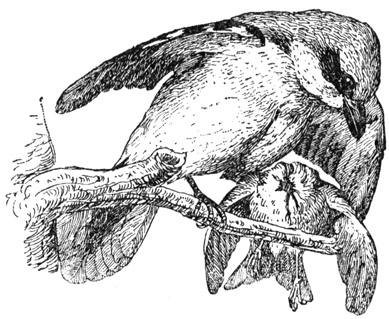
Raubwürger ( Lanius excubitor L.)
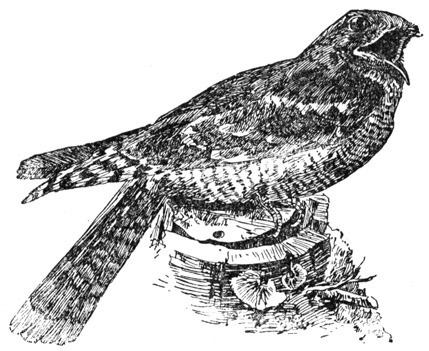
Nachtschwalbe ( Caprimulgus europæus L.)
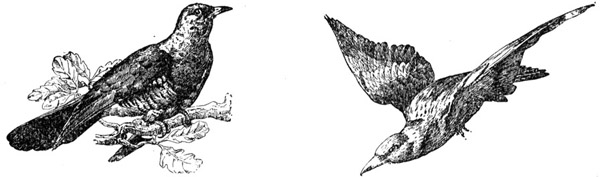
Links: Kuckuck ( Cuculus canorus L.) rechts: Blauracke ( Coracias garrula L.)
Als »fliegende Katzen« könnte man unsere Nachtraubvögel, die durch ihre glühenden Augen, ihren lautlosen Flug, ihre unheimlichen Rufe und ihr scharfes Gehör ausgezeichneten Eulen, bezeichnen, denn sie sind die besten Mäusevertilger unserer Vogelwelt. Im Walde selbst wohnt namentlich der stattliche braunäugige Waldkauz, der in einer rotbraunen und einer grauen Spielart bei uns vorkommt, in Baumhöhlungen brütet und während der Paarungszeit ein lautes »Hu hu hu huhuhuhuhu« ausstößt, das dem wilden Jauchzen eines Betrunkenen gleicht und sicherlich bei der Sagenbildung vom »Wilden Jäger« eine nicht unwichtige Rolle gespielt hat. Auch das kleine, hübsche und lebhafte Steinkäuzchen, dessen helles »Kuwitt kuwitt«-Geschrei Anlaß zu dem albernen und dem vielverfolgten Eulengeschlechte so verhängnisvoll gewordenen Aberglauben vom »Totenvogel« und »Leichenhuhn« gegeben hat, ist im Walde anzutreffen, wenn auch selten im Innern großer Forste, sondern mehr an den Waldrändern und in den Vorhölzern. Die durch sichtbare Federohren und gelbe Augen ausgezeichnete, überaus nützliche Waldohreule brütet nicht in Baumhöhlen, sondern in verlassenen Krähen-, Tauben-, Raubvogel- und Eichhörnchennestern. Unsere Rieseneule, der König der Nacht, der gewaltige Uhu, ist leider infolge unausgesetzter Verfolgungen schon so selten geworden, daß es heutzutage nur noch wenigen Beobachtern vergönnt ist, ihn in freier Natur zu Gesicht zu bekommen, und in noch höherem Grade gilt dies von dem majestätischen Steinadler, dem Vorbilde tyrannischer Herrschsucht, dem eigentlichen Vogelkönig. Eher horstet noch hier und da in den großen Waldungen Norddeutschlands der zwar größere, aber unedlere und wohl auch schwächere Seeadler. Die stolze Burg des weißbauchigen und blaufüßigen Fischadlers ist schon von weitem sichtbar, da sie in den äußersten Wipfeln der höchsten Bäume errichtet wird, aber trotzdem der erstaunlichen Höhe der Horstwände wegen schwer zu ersteigen, so daß das wunderhübsch gezeichnete Gelege von den Eiersammlern sehr begehrt ist. Er verzehrt nur Fische, die er stoßend aus dem Wasser hervorholt. Unser häufigster Adler ist der namentlich in den großen Forsten Ostdeutschlands gar nicht seltene Schreiadler mit einfarbig-kaffeebraunem Gefieder, gelben Fängen und Augen und gelber Wachshaut. Er ist ein trotz seiner stattlichen Größe verhältnismäßig harmloser Vogel, der nach meinen Beobachtungen mehr Frösche und dergleichen, als Warmblütler frißt. Der die Einsamkeit liebende, schwerfällige Schlangenadler mit blauen Fängen, blauer Wachshaut und großen gelben Glotzaugen ist durch die Fortschritte der Kultur schon so ziemlich aus unsern Forsten verdrängt worden. Leider scheint auch dem prachtvollen, pfeilgeschwinden, durch seinen schwarzen Backenstreifen ausgezeichneten Wanderfalken ein ähnliches Schicksal bevorzustehen; er ist allerdings ein arger Räuber, der namentlich unter den Tauben und Rebhühnern gehörig aufräumt, während er sitzendes und laufendes Wild nicht zu ergreifen vermag, da er sich dabei durch die Wucht seiner blitzschnell geführten und ungeheuer heftigen Stöße selbst zerschmettern würde. Wo er im Walde brütet, steht sein Horst auf den höchsten Bäumen. Sein Ebenbild im kleinen ist der reizende Lerchenfalke, der ihn an Fluggeschwindigkeit und -gewandtheit womöglich noch übertrifft und namentlich den Lerchen und selbst den schnellen Schwalben gefährlich wird. Er gehört zu den weichlichsten Zugvögeln und brütet deshalb erheblich später als andere Raubvögel, nämlich gewöhnlich erst im Juni. Auch der als regelmäßiger Wintergast bei uns erscheinende Merlin ist im Verhältnis zu seiner geringen Größe ein tüchtiger, geradezu verwegener Räuber, der insbesondere die Goldammern, Spatzen, Finken und Meisen auf den Futterplätzen wegkapert. Alle Falken sind schon von weitem an ihren auffallend spitzen Schwingen im Fluge leicht zu erkennen. Neben dem Bussard der gemeinste unserer Raubvögel ist der zierliche Turmfalke mit gelben Fängen und auffallend langem Schwanze, bei dem die Geschlechter sehr verschieden gefärbt sind. Er ernährt sich ganz überwiegend von Mäusen und größeren Insekten und ist deshalb ein durchaus nützlicher Vogel. Sehr gern siedelt er sich in kleinen Feldgehölzen an, aber ebenso häufig auch in großen Kieferwaldungen. Eigentümlich ist ihm das »Rütteln« über einer erspähten Beute, wobei er unter heftigen Flügelschlägen mit lang herabhängendem Schwanze wie angenagelt in der Luft hängt. Er brütet in Baumhöhlungen oder Felsspalten, aber auch frei in selbsterrichteten, mit Mäusefellchen gepolsterten und mit grünem Birkenreisig ausgelegten Horsten oder in verlassenen Krähen- und Elsternnestern. Fast ebenso nützlich, obgleich er sich seiner erheblicheren Stärke und Größe wegen schon eher gelegentliche Übergriffe erlaubt, ist der plumpe Mäusebussard, denn die schädlichen Nager bilden immer und überall seine Hauptnahrung, und er verbraucht ihrer ganz unglaubliche Mengen. Im Winter hilft ihm bei der Mäusevertilgung noch sein nordischer Vetter, der an dem dunklen Brustschild und den befiederten Fängen leicht kenntliche Rauhfußbussard. Die meisten Horste unseres Mausers findet man aus Kiefern. Seine katzenartig miauende Stimme und seine prachtvollen Flugspiele machen ihn auch dem oberflächlichen Beobachter bald genug auffällig. Der durch seine zum Schutze gegen die Wespenstiche schuppenartig gebildete Zügelbefiederung ausgezeichnete Wespenbussard liebt besonders Eichen- und Buchenwälder, wo er die Brut von Wespen und Hummeln mit den Fängen wie ein Huhn aus der Erde herausscharrt. Merkwürdig berührt auch seine Vorliebe für Obst. Sein Horst ist stets mit frischen Reisern ausgeschmückt. Einen schlechten Geschmack in dieser Beziehung bekundet dagegen der schwarzbraune Milan, der sich am liebsten in an fischreiche Gewässer stoßenden Waldungen aufhält, weil Fische seine Lieblingsnahrung ausmachen; er trägt nämlich mit Vorliebe alte Fetzen und Lumpen sowie schmutziges Papier in seine Kinderstube ein. Hierin ähnelt ihm der rotbraune Milan oder die Gabelweihe mit dem tief ausgeschnittenen Gabelschwanz, die durch ihren herrlichen Schwebeflug das Auge des Naturfreundes entzückt, aber sich durch ihre Diebereien aus dem Hühnerhofe beim Landmanne verhaßt macht. Ungleich schädlicher jedoch sind der raubgierige Hühnerhabicht und sein getreues Abbild im kleinen, der mordlustige Sperber. Die Natur hat beide ganz hervorragend zum Räuberhandwerk ausgerüstet, denn sie vermögen sowohl fliegende wie sitzende und laufende Beutetiere zu schlagen und mit ihren langen, gelben Fängen sogar die ins schützende Dorndickicht flüchtenden hervorzuziehen. Sind schon bei allen Raubvögeln die Weibchen erheblich größer und stärker als die Männchen, so tritt dies doch bei Habicht und Sperber, die in allen deutschen Wäldern noch verhältnismäßig häufig sind, besonders auffallend hervor. Beide haben im Alterskleide auf der lichten Unterseite eine querlaufende Wellenzeichnung, in der Jugend dagegen Längsflecken.

Waldohreule (Asio otus [L.])

Lerchenfalke ( Falco subbuteo L.)
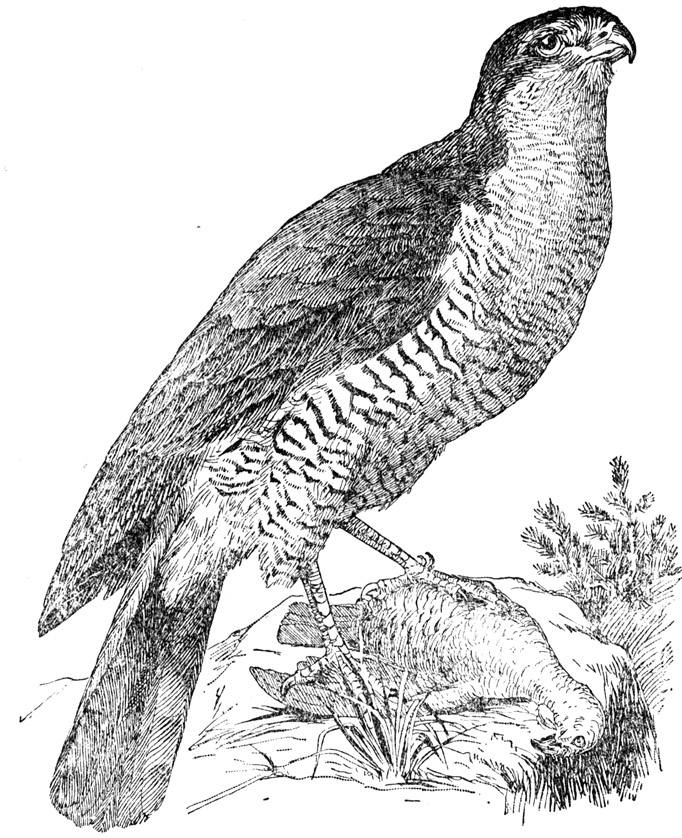
Habicht ( Astur palumbarius [L.])

Ringeltaube ( Columba palumbus L.)
Unsere drei Taubenarten sind sämtlich echte Waldvögel. Die niedliche, kleine Turteltaube lebt besonders gerne in feuchten, gemischten Waldungen mit jungen Dickungen und hohem Stangenholz, die stattliche Ringeltaube mit dem weißen Halsring und dem weißen Flügelbug bevorzugt den alten Nadelwald, nistet aber auch in kleinen Feldgehölzen, und die leider immer seltener werdende Hohltaube mit dem schönen grünen Metallschimmer am Halse ist an das Vorhandensein von alten, hohen und hohlen Bäumen gebunden, da sie Höhlenbrüterin ist im Gegensätze zu den beiden anderen Arten, die offene, flache, recht liederliche Reisignester erbauen. Das melodische Rucksen, Gurren und Heulen und das erregte Flügelklatschen der verliebten Tauber an einem schönen Frühlingsmorgen gehört auch zu den schönsten und unentbehrlichsten Naturlauten im deutschen Walde. Dasselbe gilt von dem wilden naturwüchsigen Balzgesang des mächtigen Ur- oder Auerhahns den weidgerecht anzuspringen und mit sicherem Schusse im Morgendämmern von seinem Balzbaum herabzuholen zu den schönsten Freuden und Genüssen gehört, mit denen die spröde Diana ihre getreuen Jünger zu beglücken vermag. Der liebste Standort des Auerwildes ist der düstere Gebirgswald mit recht viel Unterholz und beerentragenden Sträuchern. Das Birkhuhn bevorzugt Heidewaldungen mit viel Gestrüpp, namentlich wenn sie Birken und Pappeln aufzuweisen haben. Die schönen Hähne balzen gesellig auf dem Erdboden, und ihre lyraförmig-gebogenen, prachtvollen Schwanzfedern mit dem gleißenden Metallschimmer bilden eine begehrte Zierde für den Jägerhut. Das hübsche Haselhuhn, das wie alle Waldhühner zu unseren Standvögeln zählt, fühlt sich in gebirgigen, recht vernachlässigten, wüsten und bunt zusammengesetzten Bauernwaldungen am wohlsten. Freund Adebar wird im Walde durch den etwas kleineren Schwarz- oder Waldstorch vertreten; bei ihm sind nur Brust, Bauch und Schenkel weiß, alles übrige braunschwarz mit Metallglanz. Er kommt nur in großen, geschlossenen, menschenleeren Wäldern, auf deren höchsten und dicksten Bäumen er seinen Horst errichtet, vor, und auch da keineswegs häufig. Seine Hauptnahrung bilden Fische. Der Fischreiher brütet bei uns gewöhnlich kolonienweise (»Reiherstand«) auf den ältesten Bäumen solcher Forste, in deren Nähe sich fischreiche Gewässer befinden. Eine solche Reiherkolonie, in die sich nicht selten auch andere Vögel eindrängen, bietet dem Naturfreunde immer einen hochinteressanten und buntbelebten Anblick, wenn auch in ihr »der Schmutzerei und des Gestankes viel« herrscht, während der Fischzüchter sie natürlich nicht gerne sieht und nach Möglichkeit auf ihre Vertreibung oder Ausrottung bedacht ist, so daß die Zahl der Reiherstände in Deutschland schon sehr abgenommen hat. An einsamen Waldlachen von einiger Ausdehnung fliegt bisweilen ein oberseits schwarzbrauner, weißgetüpfelter Schnepfenvogel mit hohem, silberhellem Pfeifen vor uns auf; dabei leuchtet sein weißschimmernder Bürzel förmlich auf. Es ist dies der zierliche Waldwasserläufer, der dadurch merkwürdig ist, daß er sich oft auf Bäume (besonders auf die Spitztriebe junger Fichten) setzt, einen ausgesprochenen Bisamgeruch namentlich zur Paarungszeit) und seine Eier häufig in alten Drosselnestern ablegt. Der dem Waldleben besonders angepaßte Schnepfenvogel ist aber die wegen ihres schmackhaften Wildbrets so hochgeschätzte Waldschnepfe. Schade nur, daß unsere Jäger so viele dieser hochinteressanten Langschnäbler in törichter oder selbstsüchtiger Verblendung aus dem Frühjahrsstriche wegschießen, denn sonst hätten wir sicherlich weit mehr Brutschnepfen in den deutschen Revieren. Sie bewohnen Wälder aller Art, wenn sich nur genügend feuchte und weiche Stellen vorfinden, an denen sie nächtlicherweile mit ihrem sehr feinfühligen Schnabel nach Regenwürmern bohren (»wurmen«) oder wo sie das vermoderte, alte Laub klumpenweise umwenden und nach allerlei Insektenlarven durchstochern können. Erwähnen will ich schließlich noch den Kormoran, weil er seine Brutkolonien bei uns nach Reiherart gewöhnlich auch auf Waldbäumen anlegt, die er durch seinen scharfen Kot bald zum Absterben bringt. Viele Kormorankolonien wird man in deutschen Gauen freilich nicht mehr finden, da diese gewaltigen Fischfresser ihrer großen Schädlichkeit wegen nirgends lange geduldet werden. Es sind fast gänsegroße, grünschwarze Vögel mit weißem Wangenfleck, Schwimmfüßen und Hakenschnabel, unersättliche Fresser, gewandte Schwimmer und vorzügliche Taucher.
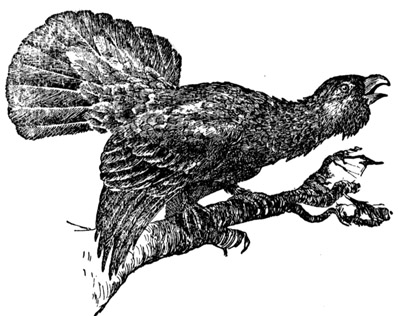
Auerhahn ( Tetrao urogallus L.)

Haselhuhn ( Tetrao bonasia L.)

Waldstorch ( Ciconia nigra [L.])
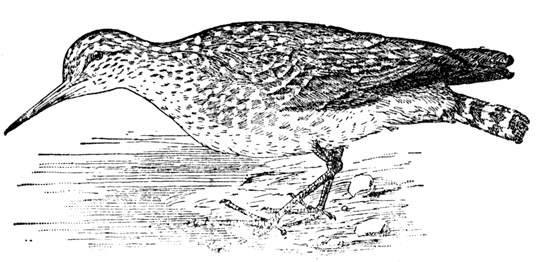
Waldwasserläufer ( Totanus ochropus [L.])
Damit wären wir mit unserem flüchtigen Überblick über die typischsten Vertreter der Vogelwelt im deutschen Walde zu Ende. Nun darf man sich freilich nicht einbilden, daß es möglich wäre, in ein und demselben Walde all diese in ihren Ansprüchen und Lebensgewohnheiten so unendlich verschiedenartigen Vogelarten vereint anzutreffen, denn ein so gedrängtes Zusammenleben erlaubt schon der harte »Kampf ums Dasein« nicht, und im allgemeinen muß eine Gegend schon als ornithologisch reich bevölkert gelten, wenn es uns gelingt, auf einem mehrstündigen Ausfluge 30-40 Vogelarten zu Gesichte zu bekommen oder sonstwie festzustellen. Bereits bei der obigen Aufzählung wird der geneigte Leser bemerkt haben, daß die meisten Vögel zwischen der Art des Waldes einen Unterschied machen und sich nur in Waldbeständen von ganz bestimmter Beschaffenheit aufhalten, wenigstens zur Brutzeit, während die Strich- und Wanderzeit sie oft auch vorübergehend an Örtlichkeiten führt, die ihrem Geschmack sonst durchaus nicht zusagen. Vor allem machen Nadel- und Laubwald einen tiefgreifenden Unterschied, und es sind nicht allzuviele Vogelarten (ich nenne als Beispiele Rotspecht, Eichelhäher, Buchfink, Kohlmeise), die sich in beiden gleich heimisch fühlen. Sehr gern sind dagegen viele Vogelarten in gemischten Waldungen, z. B. Gimpel, Wacholderdrossel, Fitis, Kuckuck. Ausgesprochene Nadelholzbewohner sind Hauben- und Tannenmeise, Heidelerche, Kreuzschnabel, Goldhähnchen, Misteldrossel usw., Laubholzbewohner dagegen Sumpf- und Schwanzmeise, Nachtigall, Dorngrasmücke u. a. Manche Vogelarten sind durch die Anpassung an das Nadelholz einerseits und an das Laubholz andererseits im Laufe der Jahrhunderte bereits in zwei deutlich unterscheidbare Formen zerfallen, z. B. der Baumläufer, und ähnliches bereitet sich bei anderen Arten (Pirol, Schwarzplättchen) ersichtlich vor. Ferner finden wir, daß die einzelnen Vogelarten innerhalb Laub- und Nadelholz wieder ihre ganz besonderen Lieblingsbäume haben, so daß ihr Vorkommen oft genug geradezu an das Vorhandensein dieser gebunden ist, indem sie hinsichtlich Ernährung, Nestbau oder anderer Lebensgewohnheiten direkt auf solche Bäume angewiesen sind. So übt die Eiche eine große Anziehungskraft auf Stare, Dohlen und Eichelhäher, die Buche auf Zwergfliegenfänger, Bergfink und Waldlaubsänger, die Weide auf Gartenrotschwanz, Sprosser und Sumpfmeise, die Erle auf Erlenzeisig, Karmingimpel und Flußrohrsänger, die Birke auf Birkenzeisig und Pirol, der Kirschbaum auf den Kirschkernbeißer, die Eberesche auf Gimpel und Seidenschwanz, die Arve auf den Tannenhäher, die Zwergkiefer auf den Wasserpieper aus, und den Würgern und Grasmücken ist dicht verwachsenes Dorngestrüpp unentbehrlich. Auch hier hat weitgehende Anpassung an einzelne Baumarten und ihre Früchte oder tierischen Bewohner schon zur Differenzierung ursprünglich einheitlicher Formen geführt. So ist im wesentlichen der Fichtenkreuzschnabel auf Tanne und Fichte, der Kiefernkreuzschnabel auf die Kiefer und der Bindenkreuzschnabel auf die Lärche angewiesen. Manche Vögel bewohnen das Innere großer Waldungen (Schwarzspecht, Auerhuhn), andere nur die Waldränder (Hänfling, Grünfink), andere parkartiges, wechselvolles Gelände (Stieglitz, Girlitz), andere die Waldblößen und -lichtungen (Baumpieper, Heidelerche) und wieder andere die Vor- und Feldhölzer (Goldammer, Gelbspötter). Manche bevorzugen den düsteren, geschlossenen Hochwald (Kolkrabe, Schwarzstorch), manche lichte Waldungen ohne Unterholz (Pirol, Grünspecht), manche buschreiche Wälder mit viel Gestrüpp und Gesträuch (Schwarzplättchen, Nachtigall, Rotkehlchen), manche Schonungen und Stangenholz (Turteltaube, Misteldrossel), manche die Nähe von Gewässern (Fischreiher, Fischadler) oder Wiesen und Feldern (Mäusebussard, Turmfalke). Die einen ziehen die Gebirgsforste vor (Auerhuhn, Ringdrossel), die anderen die Wälder der Ebene (Blauracke, Blaumeise) oder des Hügelgeländes und Vorgebirges (Gimpel, Braunelle). Auch die Höhenunterschiede vermögen Abweichungen innerhalb der Art hervorzurufen, ein Prozeß, der z. B. bei der Sumpfmeise schon vollendet, beim Hausrotschwanz erst im Entstehen begriffen ist. Viel kommt ferner auf die Bodenbeschaffenheit an, denn viele Vögel (z. B. die Heidelerche) lieben trockene, viele aber (z. B. Blaukehlchen und Nachtigall) feuchte Lagen. Aber auch die geologische Beschaffenheit des Erdbodens ist von hoher, bisher leider keineswegs gebührend gewürdigter Bedeutung. Wir dürfen uns ja den Vogel nicht als schrankenlosen Beherrscher der Lüfte, als ein gewissermaßen ätherisches Wesen vorstellen, denn auch die besten Flieger sind an die graue Scholle gebunden, und die Lerche, die jauchzend den Himmel zu stürmen scheint, muß doch wieder zur Erde zurückkehren, denn nur auf ihr findet sie Nahrung, nur auf ihr kann sie brüten, nur auf ihr können Individuum und Art sich erhalten. Jede Bodenformation hat deshalb auch ihre besonderen gefiederten Bewohner, und diese sind andere aus Kalk- wie auf Ur- oder Eruptivgestein, andere in der Sandsteinformation als im Löß oder im Alluvium. Am schönsten konnte ich die ungeheuer scharfe Grenze, die der Wechsel der geologischen Beschaffenheit eines Gebietes auch in der Vogelwelt zieht, in Montenegro beobachten, wo die Karstformation nach der albanischen Grenze zu plötzlich mit Schieferformation wechselt und dadurch ein geradezu haarscharfer Strich in der Verbreitung fast sämtlicher Vogelarten gezogen wird, denn nur ganz wenige sind in beiden Gebieten gleichmäßig vertreten. Das ornithologische Bild ändert sich vielmehr wie mit einem Zauberschlage urplötzlich wie die Dekoration in einem Theaterstücke, und beim Überschreiten dieser Grenzzone stößt man auf Schritt und Tritt auf vorher nicht gesehene und gehörte Vogelarten, während die, welche man bis dahin täglich vor Augen hatte, sich jetzt nicht mehr sehen lassen. In weniger auffallendem Maße konnte ich auch in Deutschland oft genug entsprechende Verhältnisse feststellen und die Wahrnehmung machen, daß gewisse Vogelarten fast nur auf gewissen Böden vorkommen. So sind Grau- und Gartenammer beide Kinder der Ebene und beide Feldvögel, aber erstere bevorzugt entschieden fetten Lehm-, letztere dürren Sandboden, eine Erscheinung, die auch die zerrissene, ich möchte sagen, inselartige Verbreitung so vieler Vögel erklärt. Tragen wir ihre Brutbezirke auf einer geologischen Karte ein, so fällt es uns wie Schuppen von den Augen, und so manches Rätsel in der Verbreitung der Vögel findet seine sofortige Lösung. So habe ich z. B. die allerliebste Brachschwalbe nirgends und niemals anderswo angetroffen als auf natronhaltigem Boden. Und weil der geologische Ausbau des zentralen Deutschland zwischen den mächtigen diluvialen und alluvialen Bildungen der norddeutschen Tiefebene auf der einen und den Alpen und Karpathen, diesen gewaltigen, durch von Süden her wirkende Druckkräfte gefalteten Kettengebirgen tertiären Alters, auf der anderen Seite so überaus kompliziert ist, ist es auch die Verbreitung vieler Vogelarten. In den ornithologischen Lehrbüchern wird oft die Elbe als Verbreitungsgrenze nahe verwandter Vogelformen (Nebelkrähe östlich, Rabenkrähe westlich, Schwarzkehlchen westlich, Braunkehlchen mehr östlich der Elbe) angegeben, aber nicht der herrliche Strom bildet für den Vogelflügel ein Hindernis, sondern die geologische Vergangenheit, und die heutige geologische Beschaffenheit der Gebiete östlich und westlich der Elbe sind die ausschlaggebenden Faktoren, denn im Osten haben wir im wesentlichen nur noch Diluvium und Alluvium, im Westen dagegen all die mannigfachen Gesteine des einstigen, im Laufe der Jahrtausende von den Atmosphärilien größtenteils zernagten und abgetragenen »variszischen Hochgebirges«. Kurz, die innigen und unleugbaren Beziehungen zwischen Geologie und Ornithologie sind hochinteressant und stellen ein fast noch jungfräuliches Gebiet dar, dessen planmäßige und verständnisvolle Bearbeitung dem Forschergeiste ungeahnte Früchte in den Schoß zu werfen mir sehr geeignet scheint.

Waldlaubsänger ( Phylloscopus sibilator [Bchst.])

Erlenzeisig ( Chrysomitris spinus[L.])
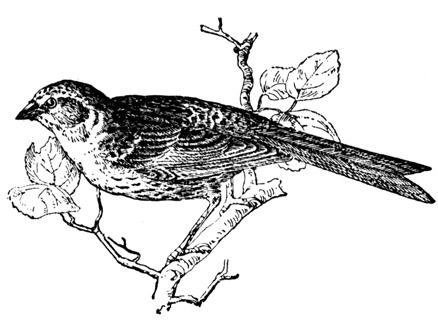
Goldammer ( Emberiza citrinella L.)
Ebenso möchte ich bei dieser Gelegenheit die Aufmerksamkeit auf die von der Forschung bisher ebenfalls arg vernachlässigte Abhängigkeit der Vogelwelt vom Klima lenken. Freilich weiß jedes Kind, daß es in den heißen Tropen andere Vögel gibt als in den schnee- und eisstarrenden Regionen der Pole, und jeder gebildete Laie, daß wir für unsere Tierwelt ein ober- und ein niederdeutsches Gebiet, aber auch einen östlichen und westlichen Gau unterscheiden müssen. Aber nicht hiervon will ich reden, sondern hinweisen auf die viel feineren und noch gar nicht näher erforschten und aufgeklärten Differenzierungen in der Verbreitung der Vogelwelt, die das Klima auch innerhalb der eben angedeuteten Grenzen zeitigt. Flensburg hat im Januar einen mittleren Luftdruck von 761, München dagegen einen solchen von 766 mm, Kiel im Oktober 760, Regensburg 763 mm, Lübeck im Juli 761, Köln 763 mm. Die Jahresschwankung der Temperatur nimmt von West nach Ost und von Nord nach Süd hin auffallend zu, denn sie beträgt z. B. für Helgoland 15,1°, für Tilsit dagegen 21,4° C, sowie für Emden 16,1° und für Basel 20,6°. Der Osten zeigt ein viel kontinentaleres Klima als der Westen: hier starke Gegensätze, dort sehr gemilderte Extreme. Königsberg hat 46 und Emden nur 20 Eistage, an denen das Thermometer tagsüber unter 0° verbleibt, dagegen Sylt nur 4, Breslau aber 34 und Geisenheim gar 52 Sommertage, an denen das Thermometer 25° C erreicht; Königsberg 53, Berlin 33 und Helgoland nur 24 Tage mit Schneefall. Thorn hat unter 500, Zittau über 1000 mm Jahresniederschlag. Das sind doch immerhin ganz bedeutende klimatische Unterschiede, die sich auf verhältnismäßig engem Raum zusammendrängen, und es wäre geradezu befremdend, wenn sie nicht auch auf die innerhalb dieser Zone wohnenden Geschöpfe ihren Einfluß ausüben würden. Nicht einmal der Mensch, der sich doch durch seine Kultur von Wind und Wetter ziemlich unabhängig zu machen verstanden hat, konnte sich diesem Einflusse entziehen, denn der Ostfriese ist ein anderer als der Pfälzer, der Ostpreuße ein anderer als der Schwabe; und auf den Vogel, das ausgesprochene Lufttier, sollte all dies ohne Einfluß geblieben sein? Das ist kaum denkbar, und in der Tat ist nicht nur die Verbreitung und Formengliederung der einzelnen Arten in hohem Maße von den klimatischen Faktoren abhängig, sondern auch ihre gesamte Lebensführung, ich möchte beinahe sagen, ihr Charakter. Selbst der oberflächliche Beobachter wird bald dahinterkommen, daß z. B. nordische Vögel, die uns im Winter besuchen, einen unter sich übereinstimmenden, aber von dem unserer Brutvögel, selbst wo es sich um die gleichen Spezies handelt, abweichenden Charakter haben, als dessen Grundzüge man Gutmütigkeit, Sorglosigkeit, Geselligkeit und Gefräßigkeit wird bezeichnen dürfen. In feineren Nuancierungen kehren diese hier nur in rohen Umrissen angedeuteten Verhältnisse auch innerhalb der deutschen Gaue wieder; so fand ich die Amseln in Thüringen und Hessen viel leidenschaftlicher, heißblütiger und zänkischer als in Ostpreußen. Man wird das vielleicht für rein persönliche Anschauung und individuelle Auffassung halten, aber man prüfe diese allerdings sehr komplizierten Verhältnisse einmal aufmerksam und vorurteilsfrei nach, und man wird ungeahnte Einblicke in die Geheimnisse des Vogellebens tun und meine Auffassung zum mindesten begreiflich finden, wenn man sie auch nicht zu teilen vermag. Der in den Fachzeitungen oft mit so viel unnötiger Erbitterung geführte Streit über den Nutzen und Schaden dieses oder jenes Vogels, wobei sich gewöhnlich herausstellt, daß ein und dieselbe Vogelart in der einen Gegend ein arger Räuber, in einer anderen aber ein ganz harmloser Bursche ist, würde vielleicht ein ganz anderes Gesicht annehmen, wenn wir die klimatischen Verhältnisse und ihren Einfluß auf Körperentwicklung, Temperament, Charakter und Verbreitung der Vögel mit in Rechnung stellen wollten. Ebensowenig wie ich mir einen Hottentotten-Shakespeare, einen Neger-Goethe, einen Feuerländer-Darwin und einen Eskimo-Nietzsche vorstellen kann, ebensowenig auch scheue Hakengimpel, vertrauensselige Brachvögel, harmlose Raben und unverträgliche Seidenschwänze. Die Niederschlagsmenge der einzelnen Gegenden ist sicherlich auf die Verbreitung der Vögel von nicht zu unterschätzendem Einfluß, denn der Vogelorganismus ist von einer außerordentlichen Feinfühligkeit gegen den Feuchtigkeitsgehalt der Luft. Die Niederschlagskarte Deutschlands steht deshalb in einem interessanten Wechselverhältnis zu den Brutbezirken nicht weniger Vögel. So ist z. B. das reizende Schwarzkehlchen hauptsächlich in dem regenreichen Mittelgebirge Westdeutschlands heimisch, östlich der Elbe dagegen nur in der Lausitz, und diese – hat die größte Regenmenge von ganz Ostdeutschland. Natürlich muß man sich hüten, solche Erfahrungen zu sehr zu verallgemeinern, denn, wie wir ja bereits gesehen haben, spielen bei der Verbreitung der Vögel noch eine ganze Reihe anderer Faktoren wesentlich mit. Eines aber steht für mich vollkommen fest: daß die Vögel in ihrer Verbreitung ganz wesentlich von den Luftverhältnissen abhängig und gegen deren Veränderungen ungemein empfindlich sind; die auffallende Vogelarmut in der Nähe von Großstädten und Industriezentren dürfte zum Teil vielleicht auch mit durch die von diesen bewirkte Luftverschlechterung zu erklären sein. Nirgends konnte ich diese eigenartigen und hochinteressanten Verhältnisse besser und eingehender studieren, als aus den Kanarischen Inseln mit ihrer so fein differenzierten Vogelwelt potenzierter Mediterranformen. Jede der sieben Inseln wird durch eigene Vogelformen besonders gekennzeichnet. Wenn namentlich die Vogelwelt der beiden östlichen Inseln sehr stark von der der übrigen abweicht, so ist dies nicht weiter zu verwundern, da die lokalen Verhältnisse zu verschiedenartig sind, und das baumarme Fuerteventura mit seinem heißen und trockenen Wüstenklima natürlich eine ganz andere Ornis erzeugen mußte wie etwa das atlantische, feuchte und waldige Teneriffa. Viel schwieriger ist es, die tiefgreifenden Unterschiede zu erklären, die unleugbar auch zwischen den fünf westlichen, nach Klima und Landschaft fast gleichartigen Inseln vorhanden sind, und die sich nicht einmal auf die speziell atlantischen Formen beschränken, sondern selbst bei weit verbreiteten Arten scharf hervortreten. So ist z. B. die Alpenkrähe auf Palma gemein und fehlt doch auf allen übrigen Inseln, während umgekehrt der auf Teneriffa so häufige Gabelweih auf Palma niemals vorkommt, ebenso das Felsenhuhn. Wie man sieht, handelt es sich sogar um gute Flieger, für die die schmalen Meeresarme zwischen den einzelnen Inseln unmöglich ein ernstliches Hindernis bedeuten können. Bodenbeschaffenheit, Vegetation und Klima sind auf diesen Inseln nicht wesentlich verschieden, und doch sind sogar Einbürgerungsversuche von Felsenhühnern auf Palma und von Alpenkrähen auf Teneriffa vollständig gescheitert. Es bleibt kaum etwas anderes übrig, als anzunehmen, daß zwischen der Atmosphäre der einzelnen Inseln doch Unterschiede bestehen, die wir mit unseren groben Sinnen gar nicht, mit unseren unvollkommenen Instrumenten kaum wahrzunehmen vermögen, für die der so luftempfindlich geartete Vogel aber doch empfänglich ist. Das über diese hochinteressanten Fragen vorläufig noch gebreitete rätselhafte Dunkel zu lüften, wird eine der vornehmsten Aufgaben für die künftige ornithologische Forschung sein.
Nichts in der Natur steht still, vielmehr ist alles in beständiger Bewegung, Entwicklung und Verschiebung begriffen; so auch die Verbreitungsbezirke der Vögel. Schon in den zirka hundert Jahren, seit denen der Mensch genauer auf die Verbreitung seiner gefiederten Lieblinge zu achten angefangen hat, sind eine ganze Reihe von Veränderungen der Verbreitungsgrenzen unserer Vögel mit Sicherheit festgestellt worden. Der großstädtische »Zug nach dem Westen«, den wir aus den sozialen Verhältnissen der Großstadt Berlin kennen, macht sich auch in der Vogelwelt geltend, indem östliche Formen bestrebt sind, ihre Verbreitungsgrenzen gen Westen vorzuschieben. So wandert die Nebelkrähe immer mehr jenseits der Elbe in die Brutbezirke der Rabenkrähe ein, die sie im Laufe der Jahrhunderte vielleicht ebenso verdrängen wird, wie die östliche Wanderratte die westliche Hausratte bei uns verdrängt hat. Hierher gehören auch die großen Vorstöße des mittelasiatischen Steppenhuhns bis ins Herz Europas, die in Jäger- und Ornithologenkreisen 1863 und 1888 so viel Staub aufgewirbelt, freilich noch nicht zu einer ständigen Niederlassung dieser interessanten Vögel geführt haben. Der Norden hat uns als neuen Brutvogel die lärmende Wacholderdrossel beschert. In Schlesien z. B. kannte Endler 1816 diese auffallende Drossel nur vom Durchzuge her, und Nest und Eier waren ihm und den anderen Ornithologen der Provinz völlig unbekannt, bis Gloger solche zuerst 1818 bei Breslau auffand. Noch 1823 und 1827 wird sie für die Lausitz von Krezschmar und Brahts ausschließlich als bloßer Durchzügler ausgeführt, 1832 aber von Tobias als Brutvogel nachgewiesen und ist 1836 nach Baron Loebenstein als solcher schon zahlreich. 1865 tritt sie als Brutvogel nach A. v. Homeyer zuerst bei Glogau, 1865 auch im Riesengebirge auf und ist 1869 dort schon häufig. 1872 siedelt sie sich auch in Oberschlesien an, und heute ist sie in der ganzen Provinz heimisch. Wir können hier also recht gut ihr allmähliches Vordringen verfolgen, und gegenwärtig hat sie ihren Eroberungszug bereits bis Südböhmen und in den Wienerwald ausgedehnt, von wo ich Nestjunge erhielt. Um auch das Beispiel einer Einwanderung von Süden her zu erwähnen, will ich auf den niedlichen Girlitz, ursprünglich einen Bewohner der Mittelmeerländer, verweisen. Bis 1828 wird er für Schlesien gar nicht erwähnt, dagegen von 1837 an für Oberschlesien, von 1842 an für die Lausitz, 1857 für das Riesengebirge, 1858 für das Isergebirge, 1863 für Glogau, 1864 für Saabor, 1865 für die Grafschaft Glatz und das Eulengebirge, 1866 für Breslau und die Bartschniederung, 1877 für Neiße. Heute ist er nordwärts schon bis Ostpreußen vorgedrungen. Westdeutschland besiedelte er gleichzeitig durch eine zweite Einfallspforte (Rhone-Rheintal), von wo W. Schuster eine Menge beweisender Daten gesammelt hat. Noch früher sind Haubenlerche und Grauammer von Südosten her in die ebenen Teile Deutschlands eingewandert, und weitere hundert Jahre früher bewerkstelligte der heute allbekannte Hausrotschwanz seinen Einzug, der noch gegenwärtig für unsere entlegenste Provinz Ostpreußen eine Seltenheit ist. Eine Gebietserweiterung anderer Art hat einer unserer schönsten Gebirgsvögel, die zierliche, gelbbäuchige und schwarzkehlige Bergstelze, durchgemacht. Sie war früher als Brutvogel nur aus gebirgigen Gegenden bekannt, hat sich aber seit ungefähr zehn Jahren in vielen Landstrichen Mittel- und Westdeutschlands auch an Mühlenwehren in der Ebene angesiedelt, so bei Hannover, in der Lüneburger Heide, im westfälischen Münsterlande, in der rheinischen Tiefebene, in Franken, bei Nürnberg, bei Leipzig und selbst in Mecklenburg. Die Amsel, früher ein scheuer Bewohner einsamer Waldpartien, ist in die Gärten der Städte, selbst der Großstädte eingewandert, und Singdrossel und Ringeltaube scheinen auf dem besten Wege zu sein, ihr zu folgen. Ihren Charakter hat die Amsel dabei freilich nicht zu ihrem Vorteil verändert, woran der Mensch durch übermäßige Verhätschelung auf den Futterplätzen (im Grazer Stadtpark z. B. werden die Amseln sogar den ganzen Sommer über gefüttert!) und insbesondere durch widernatürliche Fleischfütterung selbst schuld trägt, denn eine Amsel, die sich an Fleischbrocken gewöhnt hat, wird ein nacktes Nestjunges bald ebenfalls für einen solchen ansehen und es sich daher seelenvergnügt zu Gemüte führen. Nur auf diese Weise erkläre ich mir die leider nicht mehr wegzuleugnenden Nesterplünderungen der Amsel in unseren Gärten, von denen man doch draußen im freien Walde noch niemals etwas bemerkt hat. Wollte man den törichten Rat Thienemanns, die Meisen im Winter mit ausgehängten Kadavern zu füttern, allgemein befolgen, so würde man mit diesen ebenso lieblichen wie nützlichen Vögeln gewiß bald dieselbe traurige Erfahrung machen, zumal die kräftige Kohlmeise ohnehin schon öfters Fleischgelüste zeigt.
In der Einleitung habe ich den schwachen Versuch gemacht, zu zeigen, welch tiefgehenden Einfluß der wonnige Gesang und das ganze liebreizende Gebaren unserer Vögel auf ein empfindsames und unverdorbenes Menschengemüt auszuüben imstande ist. Mag meine Schilderung noch so unvollkommen sein, – gerade der Mann aus dem Volke wird mich verstehen. Denn dem deutschen Volke war die Vogelwelt von jeher so recht ans Herz gewachsen, ihm immer als der poetischste und sinnigste Teil des heimischen Naturlebens erschienen, innig verwoben mit dem unsagbaren Zauber des deutschen Waldes. Mit keiner Tierklasse hat sich unser Volk mehr beschäftigt als mit der der Vögel, und in unzählige Mythen, Sagen, Dichtungen und Schwänke hat es die trauten Gestalten seiner gefiederten Lieblinge hineinverwoben. Welch gewaltiges Interesse es an der Vogelwelt nimmt, das beweist schon die ungeheure Menge der vielen Trivialnamen für die einzelnen Vogelarten, deren z. B. mein »Deutsches Vogelbuch« mehrere tausend enthält, ohne doch den geringsten Anspruch auf Vollständigkeit erheben zu können. Und welch scharfe Naturbeobachtung, welch liebevolle Vertiefung in das Wesen der Vögel, welch inniges Verständnis für die Eigenart ihrer Erscheinung und ihres Gebarens, welch treffende Vergleichung mit anderen Tieren und mit menschlichen Zuständen steckt oft in diesen Trivialnamen, die bald onomatopoetische Bildungen sind, bald die Form oder Farbe, bald die Ernährungs- oder Nistweise des Vogels zum Gegenstande haben, bisweilen auch derb-drastischer oder unwiderstehlich-komischer Art sind. Und unsere Vögel verdienen wahrlich das hohe Maß der Zuneigung und Beachtung, das sich auf diese Weise kundgibt. Schade, jammerschade im Interesse unseres Volkes selbst, daß die Kenntnis der Vogelwelt und die liebevolle Beschäftigung mit ihr in den letzten Jahrzehnten stark nachgelassen hat, woran der moderne Zug nach der landfremden Großstadt und die Verkümmerung unserer Sinne in der dumpfen Schulstube, in der für die heimische Natur- und Tierkunde leider so wenig Zeit mehr geblieben ist, einerseits und die einseitige und total verfehlte Betonung des für den Laien höchst langweiligen Bälgestudiums durch die modernen Fachornithologen andererseits schuld trägt. Es ist traurig für unser Volk und schmerzlich für den wahren Freund unserer schönen heimischen Natur, wenn wir heute so oft Abiturienten finden, die keinen Sperling von einer Nachtigall, Förster, die keinen Habicht vom Bussard, Fachzoologen, die keine Grasmücke vom Rohrsänger in freier Natur zu unterscheiden vermögen. Deshalb können auch gar nicht genug volkstümliche Vogelbücher geschrieben werden, mag man noch so sehr über die Vielschreiberei spotten und höhnen, denn wir wollen unser deutsches Edelvolk nicht entfremden lassen der Natur, dem deutschen Walde, seiner liebreizenden Vogelwelt. Ein Volk, das innig verwachsen ist mit dem Naturleben seiner Heimat, ist gegen jede Schicksalsfügung gewappnet, jedem Unglück gewachsen, wird in Not und Gefahr immer neue Kraft saugen aus der heimischen Erde. Deshalb sind die Völker mit lebhaftem Naturempfinden auch so stark (Germanen, Japaner, teilweise auch die Slawen), während Völker, die den Zusammenhang mit der heimischen Natur verloren haben, alle Widerstandsfähigkeit einbüßen (Spanier). Unsere volkstümlichsten Dichter haben dies von jeher richtig erkannt, haben volles Verständnis gehabt für die Schönheit und die Bedeutung des Vogelfluges und des Vogelliedes, und deshalb spielt auch der Vogel in der Dichtung keine geringe Rolle. Der echte Dichter, der auf unser Gemüt und unsere Phantasie einwirken will, wird z. B. bei der Schilderung eines Waldes gewiß auch der Vogelwelt gedenken, weil er eben weiß, daß sie unbedingt hineingehört, daß ohne sie der schönste Wald tot, öde und traurig, sozusagen überhaupt kein Wald wäre. Es liegt in der Natur der Sache, daß die Vogelwelt namentlich in der lyrischen und auch in der didaktischen Dichtungsform eine Rolle spielen wird, weniger in der epischen und dramatischen. Walter von der Vogelweide, Kürenberger (Falkenlied), Wolfram von Eschenbach (Parzival), Shakespeare (Balkonszene zwischen Romeo und Julia, 1. Aufzug des Macbeth), Gellert (Nachtigall und Kuckuck), Goethe (Adler und Taube, Lied vom Meislein im Götz), Schiller (Tell, Kraniche des Ibykus, Thekla, Triumph der Liebe, Flüchtling, Mädchen aus der Fremde), Uhland (Lerchenkrieg), Chamisso (Auf der Wanderschaft), Grillparzer (Lied der Nachtigall), Heine (Nachtigall), Mosen (Der Kreuzschnabel), Lenau (Lied vom armen Finken), Shelley (An eine Lerche), Béranger (Die Schwalbe), Baumbach (Vogelweisheit), Hebbel (Heideknabe), Ibsen (Wildente, Vogel und Vogelfänger, Eidervogel, Sturmschwalbe, Schwan), Wildenbruch (Nachtigall), Hango (Nachtschwalbe), Puschkin (Die beiden Raben), Lermontow (Die beiden Falken), Vrchlicky (Schwanenmärchen, Lerchenlied), Gyulai (Drossellied) – sie alle, die sangesfreudigen Dichter, haben die hohe Bedeutung des Vogels für Natur und Volksgemüt erkannt und zu würdigen gewußt und in dem freien Sänger der Lüfte gewissermaßen ein Vorbild, einen lieben Freund, gesehen. Und nicht anders ist das Verhältnis zwischen Vogel und Musik. Ist es ein bloßer Zufall, daß die Melodie so vieler tiefempfundener Volkslieder deutlich an gewisse und besonders markante Strophen aus dem Liede der begabtesten gefiederten Sänger anklingt, worauf unlängst Muschner in den »Mitteilungen über die Vogelwelt« aufmerksam gemacht hat? Ich glaube nicht. Sollte nicht vielmehr das Volk bewußt oder unbewußt aus dem süßen Sange seiner gefiederten Lieblinge gelernt haben, ihre lieblichsten und innigsten Weisen nachzubilden bestrebt gewesen sein? Ich glaube wohl. Denn auch die größten Heroen der Musikgeschichte haben es nicht verschmäht, sich hier und da den Vogel zum Vorbild zu wählen. Ich erinnere nur an die Waldvögelmotive im »Waldweben« im 2. Akte vom »Siegfried« Wagners, dessen geniale Befähigung, die Natur zu belauschen und ihre Sprache in herrlichen Tönen wiedererklingen zu lassen, ja selbst von seinen Gegnern rückhaltlos zugegeben wird. Seine Vorbilder waren für das 1. Waldvogelmotiv zweifellos das einfach-sinnige Liedchen der Goldammer, für das 2. der verschlungene, kraftvolle Flötenpfiff des Pirols, für das 3. das Trillern des Baumpiepers, für das 4. die langgezogenen, schluchzenden und schmelzenden Flötentöne der Nachtigall, für das 5. und 6. ebendiese und der Choralgesang der Amsel. Der große Balladenmeister Loewe war ein großer Freund der Tiere und ein geradezu leidenschaftlicher Bewunderer der Vogelwelt, die ihn schon in frühester Jugend mit innigstem Entzücken erfüllte; er hat auch eine leider unvollendet gebliebene und erst nach seinem Tode von Runze veröffentlichte Abhandlung über die Vogelstimmen geschrieben, die eine Fülle feinsinniger Betrachtungen und geistvoller Bemerkungen enthält, auch dem Papagei 1847 eine eigene Komposition (op. 111) gewidmet, die dem kunstverständigen Könige Friedrich Wilhelm IV. von Preußen als »ein drolliges Gewächs« besonders gefiel. In anderen Balladen Loewes finden wir ein Falken-, ein Reiher-, ein Storchenmotiv usw.

Pirol ( Oriolus oriolus [L.])
Sieht man von den berufsmäßigen Illustratoren der ornithologischen Fachblätter und Fachwerke ab, so wird man in bedauerlichem Gegensatze zu Dichtern und Musikern nicht gerade behaupten können, daß sich auch die moderne Malerei mit der Vogelwelt sonderlich viel befaßt hätte, wobei allerdings die als Wildbret geltenden Vögel auf den Jagdbildern und Stilleben (Auer-, Birk-, Hasel- und Rebhuhn, Fasan, Wildente, Schnepfe usw.) auszunehmen sind. Wo sich sonst Vögel in die Bilder verirren, werden sie vom Fachmann meist als verfehlt bezeichnet werden, was kaum zu verwundern ist, da sich nur die wenigsten Maler die Mühe geben, den Vogel und sein Leben selbst kennen zu lernen, sondern sich in der Regel damit begnügen, eine ausgestopfte, steife und verbleichte Karikatur getreulich abzukonterfeien, wenn sie den Vogel als Staffage nun einmal nötig haben. Man kann in dieser Beziehung selbst hervorragenden Meistern die greulichsten Schnitzer und die drolligsten Anachronismen nachweisen. So erinnere ich mich z. B. einer sonst prachtvollen »Kleopatra«, die – einen südamerikanischen Arara liebkoste. Und es ist wirklich jammerschade um diese Vernachlässigung der Vogelwelt durch die Maler, denn ich glaube nicht, daß sich irgendwo in der Natur noch so unendlich feine Farbenübergänge, -nuancen und -wirkungen finden lassen, wie gerade in der Vogelfeder. Aber vielleicht liegt gerade hierin die Schwierigkeit der Darstellung, vielleicht wirkt gerade dies abschreckend auf den Künstler, der in unserer Zeit auf frappantere Wirkungen bedacht sein muß. Denn grelle, leuchtende Kontrastfarben, die wir in den Tropen so häufig finden, sind innerhalb der mitteleuropäischen Vogelwelt selten und, wo sie auftreten, oft an verdeckten Stellen des Gefieders verborgen, um nur beim Balzspiel zur Geltung zu kommen. Unsere meisten Vögel sehen auf den ersten Blick in der Hauptsache schlicht braun oder grau aus; schaut man aber näher hin, so bemerkt man, daß diese fein abgetönte Hauptfarbe zusammenfließt aus einer Menge der zartesten und weichsten Tinten, die durch die mannigfachsten Übergänge und Schattierungen miteinander verbunden, oft auch von irisierender oder opalisierender Wirkung sind. Ich kenne in der ganzen Natur weiter keine so duftigen Farbenspiele, wie beim Vogelgefieder, auch in der bunten Insektenwelt nicht, und selbst der zarte Schmelz des Schmetterlingsflügels muß zurückstehen hinter dem der Vogelfeder. Seine volle Schönheit (man sehe sich z. B. einmal aufmerksam das aus unzähligen Farbenmischungen zusammengesetzte, als Ganzes aber zu einer unerreicht wundervollen Imitation alter Baumrinde zusammenfließende Gefieder einer Nachtschwalbe eingehender an!) aber entfaltet das Gefieder nur am lebenden Vogel. Schon im Augenblicke des Todes oder des Loslösens vom Vogelkörper ändern sich viele Federn in ihrer zarten Farbenwirkung, verlieren sie viel von dem zarten, duftigen Schmelz, fast ganz das irisierende Aufleuchten. Aber nicht nur die Wärme des lebenden, richtig genährten Vogelkörpers, sondern auch die unverdorbene, frische, ozonreiche Luft der freien Natur scheint nötig zu sein, um der Vogelfeder ihre volle, ursprüngliche Schönheit zu sichern; denn wir wissen, daß gekäfigte Stubenvögel fast niemals den zarten Farbenduft erreichen wie ihre in freier Natur lebenden Artgenossen, und daß einige der feinsten Farbentöne bei jahrelanger Gefangenschaft ganz verschwinden und auch durch noch so sorgfältige und sachgemäße Pflege nicht wieder in ihrer ursprünglichen Frische und Reinheit herzustellen sind, so z. B. das schöne Rot der Birkenzeisige, Berghänflinge, Karmingimpel, Dompfaffen, Kreuzschnäbel und Hänflinge. Organische Chemie und Färbung des Vogelgefieders! Das ist auch eines der geheimnisvollsten und schwierigsten Kapitel aus der Naturgeschichte, ein fast noch völlig brachliegendes Arbeitsfeld, auf dem der fleißige Forscher ungeahnte Entdeckungen machen könnte. Wie wenig an diesem hochinteressanten und reizvollen Thema bisher gearbeitet worden ist, geht wohl am besten daraus hervor, daß wir heute noch nicht einmal genau wissen, ob die ausgebildete Vogelfeder ein physiologisch totes Gebilde oder aber noch weiterer Veränderungen, insbesondere Verfärbungen von innen heraus durch die Körpersäfte fähig, d. h. ob eine Umfärbung ohne Mauser, wie sie von manchen Ornithologen lebhaft behauptet und von anderen erbittert bestritten wird, möglich ist oder nicht. Eine Verfärbung ohne Mauser gibt es allerdings sicherlich in anderem Sinne, nämlich aus mechanischen Gründen. Wie wir wissen, schmücken sich viele Vogelarten, insbesondere deren Männchen, im Frühjahr zur Paarungszeit mit dem sogenannten Hochzeitskleide, das besonders lebhafte Schmuckfarben und zierliche Zeichnungen aufweist. Dieses Hochzeitskleid nun ist häufig schon im Herbste nach der Mauser vorgebildet, aber durch unscheinbare braune oder graue Federränder, die dem schlichten Winter- und Reisekleide seinen Charakter verleihen, zunächst noch völlig verdeckt. Während des Winters reiben sich nun diese Federränder unter dem Einflusse von Wind und Wetter, beim Schlüpfen und Kriechen durch das Gebüsch und Gestrüpp nach und nach ab, und wenn der Frühling kommt und die Gefühle der Liebe in den kleinen Sängerherzen weckt, können sich die Vogelmännchen dem auserkorenen Weibchen schon in der vollen Schönheit des nunmehr gänzlich von dem deckenden Braun oder Grau befreiten Hochzeitsgefieders zeigen, und sie bemühen sich auch redlich, bei den Paarungsspielen alle Vorzüge des neuen Gewandes ins rechte Licht zu setzen, wozu sie oft die sonderbarsten Stellungen annehmen, die eigenartigsten Verrenkungen vollführen. Einige besonders zarte Farbentöne, die bestimmten Stellen des Vogelgefieders gewissermaßen nur angehaucht sind, so das sanfte Rosenrot auf der atlasweißen Brust der Würger und Möwen und der satt orangegelbe Ton im Brustgefieder des männlichen Gänsesägers, scheinen auf ganz eigenartige Weise zu entstehen. Wie wir wissen, ist der federnbedeckte Vogelkörper außerordentlich arm an Hautdrüsen, von denen eigentlich nur die große Bürzeldrüse an der oberen Schwanzwurzel erwähnenswert ist. Sie sondert eine ölige Flüssigkeit ab, mit welcher die Vögel unter Zuhilfenahme des Schnabels ihr Gefieder zum Schutze gegen die Nässe einreiben. Während der Paarungszeit nun scheidet diese Bürzeldrüse aber auch noch gewisse ätherische Öle aus, die oft von eigenartigem Geruch sind und denen auch färbende Eigenschaften innezuwohnen scheinen. Die mit diesen Stoffen eingeriebenen weißen Federn erhalten dadurch jenen zarten und duftigen Rosa-Anflug. Dieser wird also gewissermaßen angeschmiert, ähnlich wie die Harzstoffe der Bäume, die eine bräunliche Gefiederfärbung bewirken, dem Unterleib der ewig an alten Bäumen herumkletternden Spechte oder wie die minimalen Eisenpartikelchen mineralhaltiger Hochgebirgsquellen, die das Gefieder der in ihnen badenden Vögel stellenweise rostrot färben, wie dies besonders vom Bartgeier bekannt geworden ist. Einmal schoß ich eine Ente, die deutliche Spuren von Anilinfärbung aufwies, zu der sie wohl beim Schwimmen in irgendeinem Fabrikabflusse gelangt sein mochte. Jedenfalls sehen wir auch hier wieder, wie zweckmäßig die Natur waltet: im Herbst das schlichte Reisekleid, darunter schon das prangende Hochzeitsgewand für den kommenden Frühling. Ersteres wird einfach abgeworfen, nachdem es seinen Zweck erfüllt hat, den Vogel auf der großen Wanderreise zu decken und zu schützen. Und das bringt uns gleich noch auf etwas anderes, nämlich auf die Schutzfarben.
Gewöhnlich verbindet man mit dem Begriffe des Vogels den eines schwachen, wehrlosen Geschöpfes; das ist er aber doch keineswegs in dem Maße, als der Laie anzunehmen pflegt, wobei man noch gar nicht einmal an die wehrhaften und kräftigen Raubvögel zu denken braucht. Vielmehr hat die gütige Natur auch den leichtbeschwingten Kindern der Lüfte mancherlei Mittel zu Schutz und Trutz verliehen, und vielleicht interessiert es unsere Leser, wenn wir diese einmal hier im Geiste kurz Revue passieren lassen. Teils dienen diese Mittel zum wirklichen Kampf gegen Nebenbuhler der eigenen Art, gegen Bedränger der Brut, teils zur Überwältigung widerstandsfähiger Beutetiere, teils zum Schutze gegen übermächtige Feinde. Es wird vielleicht auf den ersten Blick befremden, wenn ich dabei auch den Gesang mit aufzähle. Und doch ist dieser in Wahrheit ein Kampfmittel zur Zeit der Werbungen um das Weibchen und bei der Begründung des eigenen Herds, oder doch zum mindesten eine Herausforderung zum Kampf. Man denke nur an das selbstbewußt-trotzige Krähen der Hähne! Je höher ein Vogel in gesanglicher Hinsicht steht, um so mehr pflegt er sich auch seiner Kunst in Streit und Kampf zu bedienen. Mit schmetterndem Schlage rücken sich die eifersüchtigen Männchen der Buchfinken näher und näher, und mit einem letzten, wildwirbelnden Triller fahren sie sich schließlich gegenseitig in die Haare – Pardon! in die Federn. Ganz ähnlich benehmen sich die Feldlerchen und Gartenspötter, die eifrig singend einander packen und zerzausen. Nachtigall und Sprosser suchen den Nebenbuhler durch immer lauteren und anhaltenderen Schlag zu überbieten, bis er schließlich nicht mehr mithalten kann, erschöpft verstummt und beschämt den Sängerkrieg aufgibt. Jeder Vogelliebhaber weiß ja, daß er nicht zwei oder mehrere Nachtigallen in einer Stube halten kann, weil der stärkste und feurigste Schläger die anderen in kürzester Frist unterdrückt und zum Schweigen bringt.
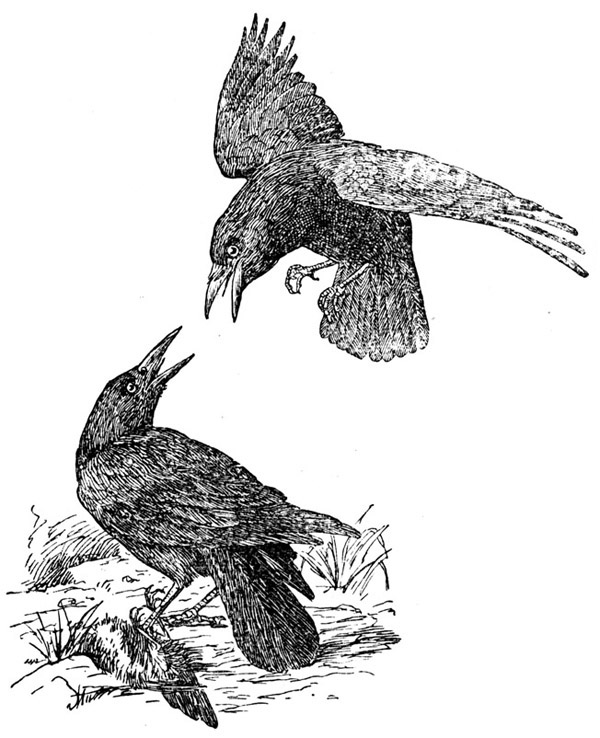
Kämpfende Rabenkrähen ( Corvus corone L.)
Eine in ihrer Bedeutung oft nicht hinlänglich gewürdigte Waffe ist der Vogelflügel, der bei großen Arten geradezu zur Hauptwaffe, ja zur einzigen Waffe werden kann. In den Kämpfen der eifersüchtigen Männchen untereinander spielt er eine große, oft entscheidende Rolle; heftige, in rascher Aufeinanderfolge geführte Flügelschläge dienen insbesondere dazu, den Gegner zu betäuben, zu verwirren und zu blenden. Manche Vogelarten tragen ja am Flügelbug auch einen mehr oder minder spitzen Dorn oder Höcker (wie z. B. der Sporenkiebitz), der doch nur dazu dienen kann, die Wirkung des Flügelschlages zu steigern, um ihn für den Gegner schmerzhafter und empfindlicher zu machen. Der riesige Bartgeier kann mit seinem plumpen Schnabel und seinen stumpfen Klauen verhältnismäßig wenig ausrichten. Wenn ihn aber der Hunger drängt, sich an einem lebenden Tiere zu vergreifen, nimmt er seine Zuflucht ausschließlich zu der Stärke seiner gewaltigen Schwingen. Ein kräftiger Schlag mit diesen genügt, um das auf steilem Grate am Rande eines tiefen Abgrundes weidende Gemskitz in die Tiefe zu stürzen, wo sich dann der gewaltige Räuber frohlockend auf seinem an den Felsen zerschmetterten Opfer niederläßt. Die ritterlichen Falken und Adler gebrauchen bei ihren häufigen Fehden untereinander viel mehr die starken Fittiche als die Klauen oder gar den Schnabel. Es liegt eine ganz bedeutende Kraft und eine ungeahnte Wucht in einem solchen Flügelschlage eines großen Vogels, und selbst ein erwachsener Mensch kann einen derartigen Hieb recht nachdrücklich empfinden. So versetzte mir einmal ein zahmer Schwan, als ich ihn ahnungslos fütterte, tückischerweise einen Flügelschlag gegen das Knie, daß ich volle vierzehn Tage lahm ging. Auch ist mir ein Fall bekannt, wo ein gezähmter Singschwan aus irgendwelchem Grunde plötzlich über das Söhnchen des Grafen R. herfiel, das Kind mit einem einzigen Flügelschlage zu Boden warf, es mit einem zweiten betäubte und durch fortgesetzte Schwingenhiebe und Schnabelbisse wahrscheinlich getötet haben würde, wenn nicht rechtzeitig jemand zur Hilfe herbeigeeilt wäre.

Kernbeißer ( Coccothraustes coccothraustes [L.])
Bekannter ist die Rolle, welche der Vogelschnabel als Angriffs- und Verteidigungsmittel spielt. Aber gerade die Vögel, denen nach Auffassung des Laien die fürchterlichsten Schnäbel zukommen, nämlich die krummschnäbeligen Adler, bedienen sich ihrer im Kampfe gegen einen überlegenen oder gleich starken Gegner nur wenig oder gar nicht. Sie betäuben wohl ihre Opfertiere durch ein paar kräftige Schnabelhiebe gegen die Schädeldecke, aber dem Menschen gegenüber verläßt sich der angeschossene Adler viel lieber auf seine scharfgenadelten, starken Fänge. Deshalb wirft er sich, wenn der glückliche Schütze an seine Beute herantritt, auf den Rücken und streckt die grimmig aufgesperrten Fänge zur Abwehr weit nach oben. Der Adlerschnabel dagegen ist ein ziemlich harmloses Ding, das man ruhig anfassen kann, ohne daß einem der erboste Vogel damit viel Leids zu tun vermag. Der Falkenschnabel ist wegen seines »Zahnes« In Wirklichkeit nur eine zahnartige Auskerbung des Oberschnabels, der eine Einkerbung im Unterschnabel entspricht. viel gefährlicher, und selbst der plumpe Geierschnabel verursacht recht böse, rissige, schwer heilende Wunden. Unter den Körnerfressern haben einige überraschend kräftige Schnäbel, mit denen sie sogar dem Menschen zu imponieren vermögen. Wer z. B. einmal einen Kirschkernbeißer in der Hand gehalten hat und von diesem dabei in die Spannhaut zwischen zwei Fingern gezwickt wurde, der wird meiner Meinung unbedingt beipflichten. Auf ähnliche Weise vermögen sich auch die Würger gehörig in Respekt zu setzen. Dagegen sind die echten Insektenfresser mit ihren schwachen, schmalen Schnäbelchen übel dran und in dieser Beziehung von allen Vögeln wohl am wehrlosesten. Noch weniger kann natürlich der winzige Schnabel der Schwalben, Segler und Ziegenmelker als eine Waffe gelten, während die Rabenvögel in ihrem kräftigen Keilschnabel eine solche sehr wohl besitzen. Die kräftigsten Schnäbel aber haben wohl die großen Papageien, und wie wissen sie diese furchtbare Waffe zu verwenden! Schon die kleinen Sittiche und Inseparables! Da hat irgendein Gefiederter in der Vogelstube sich das Mißfallen der träge dahockenden Sperlingspapageien zugezogen. Unvorsichtig wagt sich der Gehaßte in ihre Nähe; da: ein einziger, kurzer Biß, und – sein Beinknochen ist zersplittert wie Glas! Dem betrübten Vogelpfleger bleibt nichts anderes übrig, als den so grausam Verstümmelten zu töten oder ihm doch das nur noch lose am Körper baumelnde Bein vollends zu amputieren. Und nun gar die großen Araras! Auch der Beherzteste wird sich hüten, sie unvorsichtig anzufassen, denn ihr gewaltiger Schnabel zerbeißt einen zwischen seine fürchterlichen Kiefer geratenen Menschenfinger wie sprödes Glas. Schon die Amazonen und Jakos beißen bis aufs Blut. Der Jäger im Urwalde, der da weiß, eine wie kräftige Suppe die Papageien abgeben, und der ihnen deshalb fleißig nachstellt, wird sich schwer hüten, einen geflügelten Papagei so ohne weiteres mit der Hand aufzunehmen, denn die Wunden, welche der Papageienschnabel veranlaßt, sind äußerst schmerzhafter und schwer heilender Natur. Bei einer anderen Vogelgruppe dient der Schnabel nicht zum Beißen, sondern zum Stoßen; es sind dies die reiherartigen Vögel, und ihre Schnabelstöße sind für den Gegner um so gefährlicher, als sie sich regelmäßig nach seinem Gesicht und insbesondere nach seinen Augen richten. Dabei kommt ihnen auch ihr langer, muskulöser Hals sehr zustatten, vermöge dessen sie den vorher weit zurückgezogenen Schnabel plötzlich und unvermutet mit unfehlbarer Sicherheit wie eine natürliche Lanze nach ihrem Bedränger schleudern. Schon so mancher gute Jagdhund, der einen angeschossenen Reiher oder Rohrdommel apportieren wollte, fuhr mit lautem Schmerzgeheul zurück, wenn ihn so der wuchtige Schnabelstoß des ergrimmten Vogels auf die empfindliche Schnauze oder gar ins Auge traf. Auch Freund Adebar weiß seinen langen Klapperschnabel in ähnlicher Weise vortrefflich zu benützen. So konnte ich in Marokko einen Storch in einem großen Käfig wochenlang mit einem Dutzend Wild- und Ginsterkatzen und Ichneumonen zusammenhalten, ohne daß dieses vierbeinige Raubgesindel dem wehrhaften Langbein etwas zuleide zu tun versuchte, nachdem es der Storch gleich am ersten Tage durch reichlich ausgeteilte Schnabelhiebe gründlichst darüber belehrt hatte, wer hier der stärkere sei.
Die Rolle endlich, welche die Vogelklaue als Waffe spielt, ist wohl zu bekannt, als daß ich hier näher darauf einzugehen brauchte. So ein Adlerfang mit seiner kraftstrotzenden Muskulatur und seinen langen, krummen, nadelscharfen Krallen ist in der Tat eine mörderische Waffe, am furchtbarsten vielleicht bei der südamerikanischen Harpye ausgebildet. Man braucht ein solch raffiniertes Mordinstrument nur anzusehen, und man sieht schon im Geiste die armen Affen und Faultiere darin bluten. Die allerschärfsten Krallen aber haben wohl die Eulen; die von ihnen erfaßten Mäuse werden buchstäblich durch einen einzigen Zehendruck von mehreren haarscharfen Dolchen durchbohrt. Eine ganz ungeahnte Kraft entwickeln die Segler in ihren winzigen Füßchen, mit denen sie sich so hartnäckig in ihren Feind verkrallen, daß sie nur mit größter Mühe wieder losgemacht werden können. Die polygamen Hühner haben stumpfklauige Scharrfüße, aber dafür sind die Hähne am Fuße mit einem ritterlichen Sporn geziert, den sie im Kampfe gegen ihre Nebenbuhler so nachdrücklich zu gebrauchen wissen, daß künstlich in Szene gesetzte Hahnenkämpfe bekanntlich ein beliebtes, freilich sehr rohes Belustigungsmittel für die breiten Volksschichten mancher Länder bilden. Der flugunfähige Strauß verwendet seine Beine so wie Schwan und Adler ihre Flügel, d. h. er teilt damit fürchterliche Hiebe aus und zwar vermöge seiner besonders stark entwickelten Schenkelmuskulatur in so kräftiger Weise, daß er sich damit die meisten Raubtiere vom Leibe zu halten und selbst dem Menschen ein Glied zu brechen vermag. Die Schilder, mit denen der Vogelfuß in der Regel bekleidet ist, sind ihrerseits auch ein vortreffliches Schutzmittel. Dies gilt besonders für solche Arten, die auch den Kampf mit giftigen Schlangen nicht scheuen, wie z. B. unser leider schon so selten gewordener Schlangenadler. Seinem Kollegen, dem afrikanischen Kranichgeier oder Sekretär, kommt es dabei noch besonders zustatten, daß seine Füße ganz gegen Raubvogelart reiherartig verlängert sind, so daß die wütenden Bisse der von den Klauen festgehaltenen und durch Flügelschläge verwirrten Reptile immer nur auf die starrenden Fußschilder treffen und den Körper nicht erreichen. Giftfest aber ist kein Vogel, und der mutige Schlangenadler muß es mit dem Leben bezahlen, wenn er im Kampfe mit der tückischen Viper sich unvorsichtig eine Blöße gab und ihr Giftzahn ihm ins Fleisch drang.
Die Besorgnis um Nest und Brut veranlaßt die opfermutigen Vogeleltern zu wahrhaft heldenmütigen Kämpfen mit weit überlegenen Gegnern. So sah ich einmal einen Wiedehopf in wütendem »Handgemenge« mit einem Eichelhäher, obwohl doch sein langer, dünner und schwächlicher Schnabel dem bunten Strauchritter gegenüber als eine völlig unzulängliche Waffe erscheinen mußte. Wacholderdrosseln greifen mit rücksichtsloser Tollkühnheit jeden vorüberfliegenden Raubvogel an, namentlich da, wo sie noch in Kolonien brüten. Überhaupt wissen auch die Vögel sehr wohl, daß Einigkeit stark macht, wie man das am besten bei einer Möwenkolonie beobachten kann, wo jeder sich nähernde vierbeinige oder gefiederte Räuber sofort unter gellendem Geschrei mit vereinten Kräften angegriffen und in der Regel auch bald in die Flucht
geschlagen wird. Geradezu bewundernswerten Mut legen die Eulen am Neste zutage, ja sie scheuen dann sogar vor offenen Angriffen auf den Herrn der Schöpfung nicht zurück, wenn sie glauben, daß er sich ihrem Heim mit bösen Absichten nähern will. Mir persönlich sind mehrere solcher Fälle bekannt geworden, namentlich von der Waldohreule. Dagegen sind die großen Tagraubvögel am Horste dem Menschen gegenüber erbärmlich feige, und all die schönen Schauergeschichten von Angriffen brütender Adler und Geier auf den Menschen müssen unnachsichtlich in das Gebiet der Fabeln verwiesen werden. Übermächtigen Feinden gegenüber bleibt den meisten Vögeln oft nichts anderes übrig, als ihre Zuflucht zu List und Verstellung zu nehmen, und auch darin leisten sie Außerordentliches. Eine im Vogelreiche sehr verbreitete List ist es z. B., daß die Vogeleltern bei Annäherung einer Gefahr so tun, als seien sie selbst krank oder verletzt, sich flugunfähig stellen, fortwährend vor dem Feinde herumflattern, sich beinahe mit der Hand greifen lassen und auf diese Weise den Menschen immer weiter von ihren Jungen weglocken, die sich inzwischen gut versteckt haben und sich mäuschenstill verhalten, bis das ganze hübsche Gaukelspiel seinen Zweck erreicht hat und die schlauen Altvögel nun plötzlich auf- und davonfliegen, um in weitem Bogen zu den sie ängstlich erwartenden Jungen zurückzukehren. Solche Vögel, deren Gefiederfärbung gut mit der Umgebung übereinstimmt, pflegen sich mit Vorliebe zu drücken, weil sie wohl wissen, daß sie dann leicht übersehen werden, wenn sie sich ruhig verhalten, während ihr Hervorfliegen erst recht Aufmerksamkeit erregen würde. Dieses Sichdrücken ist namentlich bei den noch flugunfähigen Jungen ganz allgemein verbreitet und erreicht auch in der Regel vollkommen seinen Zweck. Man vergegenwärtige sich z. B., wie schwer es für den Menschen ist, eine sich drückende Kette Rebhühner zu sehen, und wie er diese nur mit Hilfe des eigens darauf dressierten Vorstehhundes zum Aufstiegen bringen kann, der aber dabei auch nicht von seinem Auge, sondern lediglich von seiner wunderbar feinen Nase geleitet wird. Manche Vögel nehmen beim Drücken ganz besondere Stellungen an, um so irgendeinen fremdartigen Gegenstand vorzutäuschen. So stellt sich der Reiher stocksteif ins Schilf und richtet den dünnen, schmalen Körper, den langen Hals, Kopf und Schnabel unbeweglich nach oben, so daß er in einiger Entfernung selbst für das schärfste Auge kaum von einem verwitterten alten Pfahl oder dergleichen zu unterscheiden ist. Der Wiedehopf wirft sich beim Nahen eines Raubvogels mit ausgebreiteten Flügeln und gefächertem Schwanz platt auf die Erde und sieht dann einem alten bunten Lappen in der Tat so ähnlich, daß er meist übersehen wird. Dieser Vogel verfügt aber auch noch über ein anderes in der ganzen Vogelwelt wohl einzig dastehendes Verteidigungsmittel. Seine Bürzeldrüse sondert nämlich bei den alten Vögeln während der Brutzeit und bei den Jungen nach dem Flüggewerden ein äußerst stinkendes Sekret ab, welchem Umstande auch wohl teilweise der üble Geruch zuzuschreiben ist, in welchem der Wiedehopf in des Wortes wörtlichster Bedeutung von jeher steht. Durch Beobachtungen Wiggers ist nun unlängst festgestellt worden, daß der Vogel diese dunkle und übelriechende Flüssigkeit zu seiner Verteidigung willkürlich von sich zu spritzen vermag und dadurch wohl manchen Nesträuber abschreckt: also das richtige »gefiederte Stinktier!« Der Wendehals verdreht seinen langen, beweglichen Hals zu schlangenartigen Windungen und läßt dabei seine natternartige Zunge spielen, und im Halbdunkel der Bruthöhle mag es ihm durch dieses absonderliche Gaukelspiel wohl oft gelingen, einen unliebsamen Eindringling erschrocken zurückfahren zu machen. Das Teichhühnchen verschwindet tauchend unter der Wasseroberfläche und kommt anscheinend gar nicht wieder zum Vorschein. In Wirklichkeit streckt es nach einigen Augenblicken eine Strecke weiter Kopf und Schnabel zum Atemholen heraus unter dem Schutze eines Nymphäenblattes, das es dabei kaum merklich in die Höhe hebt. In dieser pfiffigen Stellung verharrt es unbeweglich und fast unsichtbar so lange, bis sich der Beobachter wieder entfernt hat. Diese Beispiele wird jeder, der mit offenen Sinnen im großen Buche der Natur zu lesen versteht, beliebig zu vermehren vermögen.
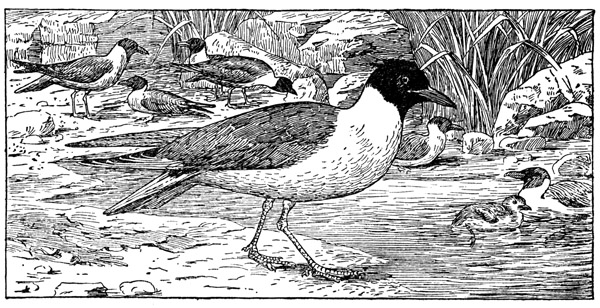
Lachmöwe ( Larus ridibundus L.)

Grauer Reiher ( Ardea cinerea L.)
Eine große Rolle spielt im Tierreiche bekanntlich allenthalben die Schutzfärbung, d. h. die Anpassung der Körperfarben an die gewöhnliche Umgebung, um so das Tier für seine Feinde weniger leicht sichtbar zu machen. In ihrer größten Vollendung führt die Schutzfärbung zur Mimikry oder Nachäffung, die wir am schönsten bei den Insekten, besonders bei den Heuschrecken, entwickelt finden. Aber auch bei den Vögeln finden wir schöne Beispiele von Schutzfärbung, worauf namentlich Darwin selbst mit Nachdruck aufmerksam gemacht hat. Solche Vögel z. B., die sich tagsüber an knorrige Bäume andrücken und hier die Lichtstunden verschlummern, um erst in der Abenddämmerung zu regerem Leben zu erwachen, zeigen in ihrem Gefieder eine so auffällige und bis in die kleinsten Einzelheiten reichende Übereinstimmung mit der Färbung und Zeichnung alter Baumrinde, daß sie sich von dieser gar nicht abheben und deshalb für einen Aststumpf oder dergleichen gehalten werden. Man sehe sich nur einmal die Oberseite des Ziegenmelkers oder der Zwergohreule an, und man wird sofort wissen, warum es so selten gelingt, dieser Vögel am Tage ansichtig zu werden. Vögel, die viel an Stämmen herumklettern, sind oft ebenfalls so gefärbt, wie z. B. unser niedlicher Baumläufer. Die Buntspechte freilich und der Kleiber stehen mit ihren lebhaften Kontrastfarben dazu in scharfem Gegensatz, aber ihnen kommt eine andere Erscheinung zugute, die v. Lucanus als Somalyse bezeichnet hat und die darin besteht, daß sich infolge der absonderlichen Art und Weise der Zeichnung die Körperformen für das Auge in einiger Entfernung verwischen und auflösen und dadurch den Vogel in seiner Umgebung verschwinden lassen. Diese Somalyse finden wir sehr schön auch bei den meist prächtig gefärbten Männchen der Entenarten, während die zugehörigen Weibchen schlichte Schutzfärbung aufweisen, die ihnen namentlich während des Brutgeschäftes zustatten kommt. Für solche Vögel, die sich viel im Laube der Baumwipfel tummeln, muß ein mit Braun, Grau oder Gelb abgetöntes Grün die naturgemäße Schutzfarbe sein, wie wir es bei den Laubsängern, Goldhähnchen, Zeisigen u. a. finden. Satter und intensiver, den leuchtenderen Farben des Südens angepaßt, erscheint das herrliche Grün der Amazonenpapageien. Die Reisenden versichern uns übereinstimmend, daß man ihre kreischenden Stimmen im Urwalde überall höre, die Vögel selbst aber nur sehr schwer erblicken könne. Unter einem der Riesenbäume stehend, bemerkt man wohl die Fruchtschalen, welche die fressenden Vögel herabfallen lassen, und hört ihr zufriedenes Knurren und Schnabelmurksen; aber der Papageien selbst im dichten Blätterwerk ansichtig zu werden, ist fast unmöglich, obgleich ihrer vielleicht mehr als hundert schmausend auf dem einen Baume sitzen. Wenn wir in einer Sammlung ausgestopfter Vögel all diese buntschillernden und in die grellsten Kontrastfarben gekleideten Exoten betrachten, so sollte man meinen, daß sie in freier Natur ungeheuer auffallend sein müßten. Dem ist aber keineswegs so. Denn der Urwald des Südens hat selbst so grelle Farbenkontraste, so ungemein bunte und leuchtende Schlingpflanzenblüten im Laubwerk, daß Buntheit hier fast weniger auffällt, wie Schlichtheit, und deshalb scharfe Gegensätze in der Färbung hier nicht verräterisch, sondern geradezu schützend und verdeckend wirken. In unserer heimischen Vogelwelt sind lebhaft schmückende Kontrastfarben ungleich seltener, wenn schon auch genügend vertreten. Dann finden sie sich aber gewöhnlich auf der Unterseite (ich erinnere nur an Blau- und Rotkehlchen, Kuh- und Bergstelze, Gimpel, Kohlmeise, Regenpfeifer, Strandläufer usw.), die den Blicken etwaiger Feinde ja viel weniger ausgesetzt ist, während die Oberseite mehr oder weniger ausgesprochene Schutzfärbung zeigt, wovon höchstens der Kopf und der leicht zu verdeckende Bürzel eine Ausnahme machen. Besonders deutlich ausgesprochen tritt eine solche Schutzfärbung bei den sich viel auf dem Erdboden aufhaltenden Vögeln zutage, so bei Lerchen, Piepern, Hühnern, Wachteln, Schnepfen, Regenpfeifern usw. Hier folgt die Gefiederfärbung häufig den feinsten Nuancen der Erdfärbung. Sehr lehrreich sind in dieser Beziehung die Haubenlerchen, bei denen alle Farbenabstufungen je nach der Bodenbeschaffenheit ihres Aufenthaltsortes vorkommen bis zur rötlichgelben Sandfärbung der Sahara und zur erdgrauen der Steppe, so daß der geschulte Blick des Ornithologen sofort erkennen kann, aus welcher Gegend eine ihm vorgelegte Lerche stammt. Der ganze Subspezieskram der modernen Ornithologie beruht ja auf ähnlichen Wahrnehmungen.
Den meisten Steppen- und Wüstenvögeln sieht es selbst der Laie ohne weiteres an, daß sie Kinder dürrer Sandgegenden sind. Flughühner und Wüstenläufer z. B. tragen doch ganz unverkennbar in ihrem Gefieder die Merkmale ihrer öden Heimat an sich. Die Halsbandregenpfeifer weisen eine überraschende Ähnlichkeit auf mit der Färbung der Kiesbank, auf der sie sich gewöhnlich herumtummeln. Unheimlich behende schnurren sie durch ihr kleines Reich, nur mit größter Anstrengung vermag das Auge des Beobachters den hurtigen Gnomen zu folgen, und wie mit einem Zauberschlage sind sie plötzlich ganz für uns entschwunden, weil sie plötzlich Halt machten und sich niederduckten. Noch auffälliger ist diese Wirkung bei ihren Dunenjungen. Ein solches kann kläglich piepend unmittelbar vor unseren Füßen auf seiner Kiesbank sitzen oder laufen, und doch sind wir oft nicht imstande, es zu sehen. Auch das Blaugrau der Gebirgsfelsen wird vielfach im Vogelgefieder nachgeahmt; ich erinnere nur an Felsentauben, Felsenkleiber, Alpenmauerläufer u. a. Die Oberseite der Möwen weist zarte Farbennuancen auf, die den Vogel rasch für das Auge verschwinden lassen, wenn er über die Wogen des Meeres dahinstreicht. Bei hochnordischen Vögeln finden wir vielfach das Weiß des Schnees im Gefieder wiedergegeben ( Schneeeule, Schneeammer). Am wunderbarsten aber tritt diese Erscheinung bei den Schneehühnern zutage, die im Winter in blendendes Weiß gehüllt sind und deshalb auf großen Schneeflächen dem Auge vollkommen unsichtbar bleiben, während sie im Sommer ein bodenfarbiges Gewand tragen. Auch die wetterharte Mohrenlerche legt Trauerkleidung an, wenn der unter den Strahlen der Frühlingssonne schmelzende Schnee das lebensschwangere Erdreich tränkt. Am wenigsten bedürfen große, wehrhafte und gesellige Vögel der Schutzfärbung, und bei Pelikanen, Schwänen, Flamingos, Silberreihern u. a. kann denn auch von einer solchen keine Rede sein.

Buchfink ( Fringilla coelebs L.) am Nest.
Dagegen wird für das Vogelnest, sofern es sich nicht um die allerstärksten Räuber handelt, eine weitgehende Schutzfärbung zur gebieterischen Notwendigkeit. Wer jemals selbst Vogelnester gesucht hat, weiß auch, daß hier eine Anpassung an die Umgebung in hohem Grade vorhanden ist. Es ist in der Tat oft ungemein schwer, ein bestimmtes Vogelnest zu finden, nicht nur, weil es so versteckt wie möglich angebracht ist, sondern auch, weil es bezüglich der zu seinem Bau verwendeten Materialien bis in die feinsten Nuancen hinein ganz und gar mit seiner Umgebung übereinstimmt. Sehr hübsch tritt dies z. B. bei den kunstreichen Nestern des Buchfinken zutage. Zu ihrer Außenbekleidung werden nur solche Moose und Flechten verwendet, wie der Baum selbst sie trägt, auf dem das Nest steht, das demzufolge vollkommen in den Rahmen seiner Umgebung sich einfügt. Dabei ist der Vogel aber doch klug genug, diese Baumaterialien nicht von demselben Baume zu nehmen, weil sonst die Stelle, von der sie weggenommen wurden, kahl und auffallend werden würde, sondern er macht sich lieber die Mühe, sie von weither zu holen. Das beweist zugleich mit Sicherheit, daß er sich der deckenden Wirkung der Schutzfärbung sehr wohl bewußt ist und sie nicht durch den blinden Zufall erzielt, so daß wir hier unmöglich von bloßem Instinkt reden können, sondern dem kleinen Baukünstler sorgsame Überlegung nicht abzusprechen vermögen. Moosbauten werden gewöhnlich auch so angebracht, daß sie im Grün ihrer Umgebung völlig verschwinden. Daher ist z. B. das wunderniedliche, kugelförmige Nestchen unseres Goldhähnchens so überaus schwer zu finden. Es hängt in oft sehr beträchtlicher Höhe zwischen den dichtesten Nadelbüscheln hoher Fichten oder Kiefern in deren äußersten Zweigen, die geschickt in seine dicken Wände hineinverflochten sind, so daß es gewissermaßen frei in der Luft zu schweben scheint. Das Schlupfloch ist merkwürdigerweise immer gerade nach oben gerichtet, die tiefe Mulde mit Federn, Haaren und Pflanzenwolle sehr warm und mollig ausgepolstert. Die zierliche Schwanzmeise baut gewöhnlich nahe am Stamm in eine Astgabel. Ihr Nest, dessen durch einige lose Federchen verdeckter Eingang schräg nach oben weist, ist auch für das schärfste Auge kaum von einem bemoosten Aststumpf zu unterscheiden, da die Außenwände ebenfalls aus Laubmoosen bestehen, die mit Birkenschale, Insektengespinsten und Spinnweben überaus künstlich und haltbar miteinander verfilzt sind. Es ist eines unserer schönsten Vogelnester. Auch der gnomenhafte Zaunkönig errichtet sich einen verhältnismäßig sehr umfangreichen Moospalast, der inwendig mit einer Unmenge von Federn austapeziert wird. Aber er sucht seine Burg nicht im Nadelgrün hoher Bäume zu verstecken, sondern bleibt bescheiden an der Nähe des Erdbodens, wo er sein Nest mit Vorliebe im Wurzelwerk alter Waldriesen, aber auch in Reisighaufen, Hecken, Gestrüpp und Erdlöchern anlegt, und auch hier kommt die deckende Schutzfärbung des Mooses recht gut zur Geltung, während die Form sich ganz der jeweiligen Örtlichkeit anschmiegt. Häufig und gewöhnlich zum Vorteil des Vogels ist das Moos der Außenwände mit dürren Pflanzenstengeln, Halmen und namentlich Laub durchmengt, so daß das ganze Gebilde altem Pflanzenwust täuschend ähnlich sieht. Dies gilt aber nur für die eigentlichen Brutnester, denn die Spiel- und Schlafnester, welche sich das Männchen nebenbei noch zu seinem Vergnügen errichtet, bestehen stets ausschließlich aus Moos. Ein recht eigentümliches Baumaterial verwendet die Singdrossel. Sie schmiert nämlich ihre dünnen Nestwände aus der Innenseite mit vermodertem Holzmulm aus, den sie mit ihrem gummiartigen Speichel und oft auch unter Zuhilfenahme von Kuhdünger zu einer dünnen und leichten, aber sehr festen und fast wasserdichten papiermachéartigen Masse zusammenknetet. Es mag wohl vorkommen, daß dieser faulende Holzmulm im Dunkeln ein wenig phosphoresziert, und hierauf dürfte die alte Sage von den »leuchtenden Vogelnestern« zurückzuführen sein. Die hübsch grünblauen, nur sparsam braunschwarz getüpfelten Eier dieser Drossel lassen jegliche Schutzfärbung vermissen und weisen darauf hin, daß sie in grauer Vorzeit zu den Höhlenbrütern gehörte, woran sich ja auch bei der nahe verwandten Amsel noch heutzutage Anklänge finden. Freilich sind nicht alle Vögel große Baukünstler, ebensowenig wie alle vorzügliche Flieger sind. Manche verraten vielmehr in der Anlage und Bauart des Nestes große Flüchtigkeit, ja geradezu bodenlosen Leichtsinn. Häufig scheinen diese der Brut so oft verhängnisvoll werdenden Eigenschaften rein individueller Art zu sein. So findet man z. B. beim Neuntöter neben recht solid und dickwandig gebauten Nestern auch sehr liederliche Bauwerke mit fast durchsichtigen Wänden. Wahrscheinlich gehören letztere jungen und unerfahrenen Weibchen an, denn es steht fest, daß die Vögel sich gewonnene trübe Erfahrungen sehr wohl zunutze zu machen wissen und im Laufe der Jahre sich in der Kunst des Nesterbauens immer mehr vervollkommnen. Besondere Sorglosigkeit und ein recht augenfälliges Ungeschick bei Errichtung ihrer Kinderwiegen verraten unsere sämtlichen Grasmücken. Ihre Nester sind so flüchtig zusammengefügt, daß oft die Eier durchschimmern und die junge Brut allen schädlichen Einflüssen von Wind und Wetter fast schutzlos preisgegeben ist. Sie sind wohl am leichtesten von allen Vogelnestern zu finden, da sie nicht selten fast völlig frei stehen, und es darf deshalb nicht wundernehmen, wenn unzählige Bruten zugrunde gehen. Viele Vögel suchen ihren gefährdeten Bruten dadurch erhöhten Schutz zu verleihen, daß sie gemeinsam in mehr oder minder großen Kolonien brüten, um so mit vereinten Kräften feindliche Angriffe abschlagen zu können. Meist finden wir diese Erscheinung bei Sumpf- und Wasservögeln, aber auch unter Singvögeln kommt sie vor, wie das Beispiel der Uferschwalbe beweist. Deren Brutgeschäft ist auch noch in anderer Beziehung interessant. Sie hat ebenso wie Eisvogel und Bienenfresser ihr Liebstes in den schützenden Schoß der Erde geflüchtet! Diese schwächlichen Vögelchen graben sich nämlich mit bewundernswerter Ausdauer bis 2 Meter lange Röhren in sandiges Erdreich an steilen Flußufern u. dergl., und erst an dem backofenförmig erweiterten Ende dieser Röhren befindet sich die eigentliche Nestmulde. Die Elternliebe der Schwalben ist ja fast sprichwörtlich geworden, aber bisweilen unterliegt sie doch dem bei diesen Vögeln so stark ausgeprägten Zugtriebe, der dann derart die überhand gewinnt, daß sie die letzten Jungen verspäteter Bruten hilflos dem Hungertode preisgeben, um rechtzeitig die große Reise nach dem Süden antreten zu können, wie ich dies gerade bei der Uferschwalbe unzweifelhaft feststellen konnte.

Nest des Goldhähnchens ( Regulus regulus [L.])

Schwanzmeise ( Aegithalus caudatus [L.]) am Nest.

Nest des Zaunkönigs ( Troglodytes troglodytes [L.])

Nest der Singdrossel ( Turdus musicus L.)

Nest des Neuntöters ( Lanius collurio L.)

Schwarzköpfige Grasmücke (Sylvia atricapilla [L.]) am Nest.

Brutkolonie der Uferschwalbe ( Clivicola riparia [L.])
Selbst bei den Eiern machen sich schon Schutzfarben geltend. Die Eier, welche in Baum- oder Felshöhlen abgelegt werden, also von außen nicht sichtbar sind, bedürfen ihrer allerdings nicht. Deshalb haben die Höhlenbrüter gewöhnlich rein weiße Eier, wie die Eulen, Spechte, Eisvögel, Bienenfresser, Blauracken, Hausrotschwänzchen u. a., oder lebhaft blaugrüne, wie Stare und Gartenrotschwänzchen. In ähnlich günstiger Lage befinden sich die Eier solcher Vögel, die geschlossene, vollkommen überwölbte Nester mit engem Flugloch erbauen, Eier, die daher entweder ebenfalls einfarbig weiß ( Mehlschwalben, Webervögel, Prachtfinken) oder auf weißem Grunde nur sparsam gefleckt sind ( Rauchschwalben, Zaunkönige, Schwanzmeisen, Laubsänger). Dagegen werden die in offenen Nestern liegenden Eier eine durch stärkere Fleckung und Zeichnung mehr verwaschene und verschwimmende Färbung vorteilhaft empfinden, und in der Tat zeigt sich uns eine solche bei den Grasmücken, Rohrsängern, Amseln u. a. Am meisten aber werden die in bodenständigen Nestern befindlichen Eier einer Schutzfärbung bedürfen, da sie naturgemäß den zahlreichsten Gefahren ausgesetzt sind. Die einfarbig olivenbraunen Nachtigalleneier sind denn auch zwischen dem alten Laube der Nestmulde und ihrer Umgebung sehr schwer zu sehen, und eine fast noch weiter gehende Anpassung finden wir bei den über und über gefleckten, getüpfelten und gewölkten Eiern der Pieper und Lerchen. Viele Vögel legen bekanntlich ihre Eier ohne eigentlichen Nestbau oder doch fast ohne solchen ohne weiteres auf die Erde, und doch sind gerade diese Gelege oft außerordentlich schwer zu entdecken, weil ihre Färbung so mit der Umgebung in Einklang steht, daß sie für das minder geübte Auge vollständig mit ihr verschwimmen. Wer selbst einmal Kiebitzeier gesucht hat, wird mir recht geben; denn es ist viel leichter, sie durch Beobachtung der alten Vögel zu gewinnen, als durch Absuchen des Bodens, wo man dicht an ihnen vorüberlaufen, ja sie zertreten kann, ohne sie zu sehen. Der Austernfischer legt seine ziemlich großen Eier offen in das Steingeröll am Seestrande, aber es gehört ein recht scharfes Auge dazu, sie da herauszufinden. Noch mehr gilt das von den hübschen Eiern des Flußregenpfeifers, die auf ihrer sonnendurchglühten Kiesbank überaus schwer sichtbar sind, da sie in nichts sich von ihrer Umgebung unterscheiden, sondern selbst genau wie geäderte Kieselsteine aussehen. Die großen Herren und die wehrhaften Recken in der Vogelwelt brauchen eine solche Schutzfärbung der Eier viel weniger, da sie im Notfälle stark genug sind, ihre Brut nachdrücklich zu verteidigen, und sich deshalb so leicht kein Räuber an diese heranwagt. Bei den offen aus den höchsten Waldbäumen stehenden Reisigburgen der Raubvögel ist deshalb von Schutzfärbung keine Rede, nicht einmal bei den kleinen Arten, wie z. B. beim Sperber. Auch die gelbweißen Schwaneneier leuchten uns schon von weitem aus dem großen Neste entgegen, aber die wachsamen und starken Schwäne lassen auch so leicht kein Raubzeug in die Nähe kommen. Die Enten sind da schon übler dran; sie decken deshalb beim jedesmaligen Verlassen des Nestes das Gelege sorgfältig mit den zarten Daunenfedern zu, die sie sich selbst in treuer Mutterliebe aus dem Bauchgefieder ausrupften, um so die Eier den lüsternen Blicken der beutegierigen Krähen und Rohrweihen zu entziehen. Nur zu oft ist ihre aufopfernde Fürsorge vergeblich!

Nest des Sperbers ( Astur nisus [L.])
Wie wir gesehen haben, besitzen also die Vögel eine Menge Mittelchen, um den mannigfachsten Gefahren zu begegnen, aber das ist auch bitter nötig, denn sie gehören zu den meistverfolgten Geschöpfen der Erde, und die Zahl ihrer Feinde ist Legion. Und obenan steht der Mensch, sei es absichtlich als Jäger, Würger und Fänger, sei es unabsichtlich durch die rastlose Ausdehnung seiner Kultur, die überall die natürlichen und urwüchsigen Verhältnisse in einer für das gefiederte Volk wenig günstigen Weise ummodelt, so viele Vogelarten ihrer Brutplätze beraubt und sie rücksichtslos verdrängt, wenn sie es nicht verstehen, sich den veränderten Verhältnissen anzupassen und ihr Leben auf neue Faktoren einzustellen. Wie viele Vögel fallen nicht auf ihren Wanderungen den in finsterer Nacht auch für ihr scharfes Auge unsichtbaren Telegraphendrähten zum Opfer, wie viele rennen sich nicht an den erleuchteten Scheiben der Leuchttürme den Schädel ein, von den Millionen und aber Millionen ganz zu geschweigen, die für menschliche Genußsucht und Eitelkeit ihr frischfröhliches Leben lassen müssen! Ich habe ja alle diese Verhältnisse in meinem »Deutschen Vogelbuch« ausführlicher behandelt und kann es mir daher ersparen, dieses traurige Kapitel hier nochmals zu erörtern. Aber auch die »allgütige« und »allweise« Mutter Natur, sie ist eine gar strenge Lehrmeisterin und merzt unnachsichtig, oft mit geradezu raffinierter Grausamkeit alle schwächlichen oder geilwuchernden Triebe am Lebensbaume aus. Ich will hier nicht reden von den Tausenden und aber Tausenden Gefiederter, die auf der Reise nach dem Süden alljährlich in den Meereswogen ihr Grab finden, nicht von den Hekatomben, die ein Nachwinter mit tiefem Schneefall verschlingt, nicht von den Unmengen von Nestern, die dem Hochwasser und anderen Naturereignissen zum Opfer fallen – ich will mich darauf beschränken, auf einige weniger bekannte, aber um so interessantere Fälle hinzuweisen, wo die Natur selbst geradezu als Vogelfängerin auftritt. Auch sie stellt ihre Fallen und Fangapparate auf, und manches Vöglein findet darin unbeachtet einen frühen und grausamen Tod. So sah ich im ungarischen Nationalmuseum in Budapest einen ausgestopften Steinschmätzer, der sich die Kehlfedern derart in die Dornen eines dichten Brombeergestrüpps verwickelt hatte, daß dieses ihn unentrinnbar festhielt und einem langsamen, qualvollen Hungertode überlieferte. Ich selbst fand die eingetrocknete Mumie einer Rauchschwalbe aus den klebrigen Kletten einer Distel. Bei schlechtem Wetter, wo in den höheren Luftschichten keine Insekten fliegen, jagen die Schwalben bekanntlich ganz niedrig und rütteln auch vor Wänden und Pflanzen, um darauf befindliche Kerfe zu erbeuten. Das mochte auch unser Schwälbchen über der verhängnisvollen Distel getan haben, sein Flügel war an den Kletten bei unvorsichtigem Flattern kleben geblieben, bei den hastigen Befreiungsversuchen hatte es sich immer mehr verwickelt, und in wenig Augenblicken war aus dem pfeilgeschwinden, fröhlichen Segler der Lüfte ein an den Marterpfahl gehefteter, dem Hungertode geweihter, armer und hilfloser Gefangener geworden. Klebrige Samen, an denen es ja in der Natur nicht fehlt, mögen den Vögeln öfters auch insofern gefährlich werden, als sie sich in größerer Menge im Gefieder festsetzen, dadurch die Flugfähigkeit beeinträchtigen und so bald den gefiederten Raubrittern ein willkommenes Opfer in die Fänge liefern. Einmal beobachtete ich ein bauendes Pirolpaar und freute mich seines kunstfertigen Fleißes. Aber am nächsten Morgen hing das arme Weibchen als starre Leiche neben dem angefangenen Neste. Beim Umwickeln des Zweiges mit Bastfasern muß der sonst so geschickte Vogel es irgendwie versehen haben und mit dem Kopfe in die selbstgefertigte Schlinge geraten sein, die ihm mörderisch die Kehle zuzog. Bei mit Agavefasern bauenden Prachtfinken oder Webern kann ja der Vogelzüchter zu seinem Leidwesen nicht allzu selten die gleiche Erfahrung machen. Tiefe und enge Baumhöhlen werden oft zu wahren Vogelfallen, und man hat schon Dutzende vermoderter Vogelleichen in solchen entdeckt. Die auf der Nestersuche befindlichen Vögel fanden wohl Einlaß in die tückische Röhre, vermochten aber nicht, sich wieder aus ihr emporzuarbeiten. Wenn man sich solche Szenen so recht vergegenwärtigt – dieses hilflose Geflatter, dieses ängstliche Gepiepe, diese verzweifelten Anstrengungen, diesen vergeblichen tagelangen Kampf, dieses schreckliche Ringen und Sehnen nach dem zum engen Eingang hereinschimmernden Tageslicht, diesen qualvollen Hungertod –, dann muß man wirklich sagen, daß die Natur eine furchtbar strenge Lehrerin, eine entsetzlich grausame Zuchtmeisterin ist.

Nest des Pirols ( Oriolus oriolus [L.])
Ich bin überzeugt, daß überhaupt wenige Vögel in freier Natur eines »natürlichen« Todes sterben. Und auch diese wenigen – man findet sie nicht. Der Vogel, dieses poetischste Geschöpf unserer Fluren, er umgibt auch sein einsames Sterben mit dem Schleier des Geheimnisses. Fühlt er sich krank und elend, so meidet er die fröhliche Schar der Genossen, die ihrerseits in ihrem brutalen, aber gesunden Egoismus sich ohnehin des die Sicherheit der Gesamtheit gefährdenden Schwächlings baldmöglichst zu entledigen trachten und dabei auch vor den rohesten Mißhandlungen nicht zurückschrecken. Das dichteste Blättergewirr im verworrensten Dornendickicht, die einsamste Spalte im kahlen Gestein, den verstecktesten Winkel im unzugänglichen Sumpfe sucht sich der Sterbende aus, um seinen letzten Seufzer auszuhauchen. Und lange liegt die kleine Leiche auch an den entlegensten Plätzen nicht. Spüren Fuchs oder Iltis, Igel oder Ratten, Krähen oder Katzen den Kadaver nicht gleich am ersten Abend auf, um ihm in ihrem Magen einen Platz anzuweisen, so wittern ihn doch die Totengräber, jene hübschen Käfer, die an allerlei Tierleichen ihre Eier legen, dann unter ihnen mit rastloser Behendigkeit und Beharrlichkeit die Erde weggraben und so die kleinen Sänger in überraschend kurzer Zeit im Schoße der Allmutter betten. Deshalb finden wir so selten Vogelleichen. Elementarereignisse bewirken oft wahre Katastrophen in der Vogelwelt. Glatteis im Winter macht die spärlichen Nahrungsquellen unzugänglich und überliefert an einem Morgen Tausende von Vögeln dem qualvollen Hungertode. Ein einziges Hochwasser vernichtet sämtliche Vogeljunge der Gegend in bodenständigen Nestern.
Dies legt die Frage nahe, wie alt Vögel in freier Natur überhaupt werden können. Sie ist schwierig genug zu beantworten, denn zu direkter Beobachtung findet sich nicht leicht Gelegenheit. Zumeist werden wir vielmehr auf die Beobachtung an gefangenen Vögeln angewiesen sein, und auch hierüber finden sich in der ornithologischen Literatur nicht eben zahlreiche Mitteilungen. Der freilebende Vogel, sofern er überhaupt eines natürlichen Todes stirbt, dürfte im allgemeinen ein etwas höheres Alter erreichen, als der im menschlichen Haushalt verweichlichte und im Käfig weit zahlreicheren Krankheitsfällen ausgesetzte. So gehört es zu den größten Seltenheiten, daß im grünen Walde ein Vogelweibchen die genossenen Liebesfreuden mit dem Leben bezahlen muß (mir ist aus meiner Praxis überhaupt nur ein einziger derartiger Fall bekannt), aber unsere Vogelzüchter wissen ein trauriges Lied davon zu singen, wie viele der besten Zuchtweibchen in der Vogelstube beim Legegeschäfte zugrunde gehen. Bei den kleinen Singvögeln kann man wohl ein Durchschnittsalter von 12-20 Jahren als feststehend annehmen. Genauere Beobachtungen hierüber sind aber dringend erwünscht und bei einigen Arten auch gar nicht schwierig. So könnte man z. B. über die Altersgrenze der Schwalben in wenigen Jahrzehnten Klarheit erlangen, wenn man die Brutschwalben an unseren Häusern durch Zelluloid-Fußringe in nach den Jahrgängen verschiedenen Farben zeichnen würde, etwa so, wie es die Hühnerzüchter mit ihren Rassestämmen tun. Bei Spatzen, Meisen, Rotschwänzchen, Dohlen, Krähen u. a. ließe sich Ähnliches ebenfalls leicht durchführen. Solche Versuche, die überhaupt viel Interessantes zutage fördern müßten und auch über manche andere wichtige ornithologische Frage erwünschten Aufschluß geben könnten, seien hiermit nachdrücklichst angeregt! Gerade solche Fälle zeigen wieder so recht, wie erfolgreich auch der verständnisvolle Laie mitarbeiten kann an den zahllosen, geheimnisvollen Problemen, mit denen das Leben unserer gefiederten Freunde heute noch für unser wißbegieriges Auge verschleiert ist. Im allgemeinen hat es sich herausgestellt, daß die Vögel ein überraschend hohes Alter erreichen und daß nicht wenige von ihnen nicht einmal an die biblischen siebenzig Jahre gebunden sind, die uns Menschen beschieden zu sein pflegen. Schon die noch in die Klasse der Singvögel gehörenden Raben werden erstaunlich alt. Naumann gibt für den Kolkraben eine Altersgrenze von nicht weniger als 100 Jahren an und stützt sich dabei auf bestimmte Notizen über in der Gefangenschaft gehaltene Exemplare. Gurney erwähnt ebenfalls einen Raben, der im Käfige 69 Jahre alt wurde. Im Volksglauben wird diese Langlebigkeit des sagenhaften Galgenvogels noch stark übertrieben. So soll nach Hesiod ein Rabe neunmal so lange leben als ein Mensch, und auf den Färöern gibt es eine Redensart, nach der ein Mensch so lange lebt wie drei Pferde, eine Krähe so lange wie drei Menschen und ein Rabe so lange wie sieben Krähen. Die Elster hat man schon über 30 Jahre im Käfig gehalten, so daß ihre Altersgrenze auf 35-40 Jahre anzusetzen sein dürfte. Überraschender dürfte sein, daß auch die zierliche Lachtaube nachgewiesenermaßen das gleiche Alter erreicht. Bechstein führt in seiner bekannten Naturgeschichte der Vögel eine Reihe von Vogelgreifen auf, die er in den Käfigen befreundeter Liebhaber sah und teilweise auch wohl selbst pflegte, so eine Nachtigall von 25, eine Lerche von 24, einen Stieglitz von 23 und eine Drossel von 17 Jahren. Und dabei müssen wir bedenken, daß zu Bechsteins Zeiten, also vor reichlich 100 Jahren, die Vogelpflege noch arg in den Kinderschuhen stak und man damals die eingesperrten Sänger keineswegs so sachgemäß zu behandeln verstand als heute. Ich selbst sah in Wien einen 22jährigen Kanarienvogel, der allerdings bereits erblindet und so altersschwach war, daß er nicht mehr auf sein Stängelchen hüpfen konnte, trotzdem aber noch mit großem Fleiß und Feuer seinen schönen Gesang vortrug. Als sehr langlebige Vögel gelten allgemein die Papageien, wozu Humboldts bekannte Erzählung von dem die Sprache eines untergegangenen Indianerstammes kauderwelschenden Aturenpapagei, den Curtius auch in einem schönen Gedichte verewigt hat, nicht wenig beigetragen haben mag. Doch erwähnt auch der englische Ornithologe Gurney, der sich besonders mit der Ergründung des Vogelalters befaßt hat, einen zweifellos 81 Jahre alten Kakadu, von einem 120jährigen Graupapagei abgesehen, wo die bezüglichen Angaben nicht sicher genug verbürgt erschienen. Unsere großen Raubvögel dürften übrigens den Papageien an Langlebigkeit kaum nachstehen. Ein 1881 auf der dänischen Insel Laaland geschossener Adler trug um den Hals ein Messingkettchen mit einer kleinen Kapsel, die einen Zettel mit folgendem Inhalt in dänischer Sprache barg: »Gefangen und in Freiheit gesetzt Anno 1792 von R. und C. Andersen, Bolö auf Falster, Dänemark.« Fitzinger teilt mit, daß in der Schönbrunner Menagerie bei Wien ein Steinadler von 1615-1719 lebte (dies ist aktenmäßig bewiesen), und nach Knauers Angaben verendete ebenda 1824 ein Gänsegeier, der 1706 eingeliefert worden war. Kaum glaublich erscheint dagegen die Nachricht, daß 1903 in Slavonien ein Steinadler erlegt worden sei, der um den Hals einen Stahlring mit dem Namen und Wappen einer slavonischen Adelsfamilie und der Jahreszahl 1646 (!?) getragen habe. Im zoologischen Garten zu Amsterdam lebt noch heute ein Gaukler seit bereits 58 und ein Kondor seit 56 Jahren. Der letzte Lämmergeier der Schweiz, der schließlich vergiftet aufgefunden wurde, war als »altes Wyw« der ganzen Gegend wohlbekannt, denn die ältesten Bewohner der umliegenden Dörfer hatten ihn schon seit ihrer frühesten Jugend jahraus, jahrein auf dem Eismeere des Grindelwaldgletschers sitzen sehen. Der bekannte englische Ornithologe Meade-Waldow besaß bis vor wenigen Jahren einen 71 Jahre alten Uhu, der sich bis zuletzt des besten Wohlseins erfreute und zusammen mit seinem Weibchen im Laufe der Jahre nicht weniger als 93 Junge großgezogen hatte. In Dänemark soll 1859 ein Uhu nach gerade 100 jähriger Gefangenschaft gestorben sein, und unter seiner zahlreichen Nachkommenschaft befand sich auch schon wieder ein 69jähriges Exemplar. Meinem Freund Grote versicherte ein alter Förster, daß er während seiner 40jährigen Dienstzeit ein und denselben Kuckuck in seinem Waldbezirke alljährlich rufen gehört habe; dieser Vogel sei an seinem fehlerhaften Rufe leicht kenntlich gewesen. Grote veranschlagt danach die Lebensdauer des Gauchs aus 45-50 Jahre. Die im Mittelalter so beliebte und verbreitete Beizjagd hat auch manchen wertvollen Beitrag zur Bestimmung der Altersgrenze der Vögel geliefert, da man den nicht zu schwer verletzten Reihern einen Metallring um den rechten Ständer zu legen pflegte, auf dem das Datum der Erbeutung eingraviert war, um ihm dann die Freiheit wieder zu schenken. Auf diese Weise konnte es geschehen, daß mancher Reiher wiederholt durch den schnellen Falken dem Menschen in die Hände geliefert wurde. So wurde z. B. 1728 in Bayern ein Reiher gebeizt, dessen Ring die Jahreszahl 1668 trug. Überhaupt erreichen die größeren Sumpf- und Wasservögel ein sehr hohes Alter. Im zoologischen Garten zu Rotterdam lebt ein Pelikan seit 45 Jahren, in dem zu London verendete unlängst ein Kranich nach 40jähriger Gefangenschaft, Gurneys Vater pflegte einen Schwarzstorch 30 und eine Silbermöwe 45 Jahre lang. Anfang 1887 wurde von dem Schiffe » Duchess of Argyla« beim Kap Horn ein Albatros gefangen, der am Halse ein Kompaßgehäuse trug mit der Inschrift, daß er 1840 in der Mitte des Atlantischen Ozeans von der Bemannung des amerikanischen Schiffes » Columbus« gekennzeichnet worden sei. Unter den sicher verbürgten Fällen führt Gurney auch eine 80jährige Gans auf. Der Bevölkerung Londons war ein im St. James-Park untergebrachter Schwan unter dem Namen » Old Jack« wohlbekannt, der 1840 im nachweislichen Alter von 72 Jahren starb, und aus Holland liegt gar ein Bericht über einen 120 jährigen Schwan vor; endlich soll in Alkmar 1675 ein Schwan gestorben sein, der ein Metallhalsband mit der Jahreszahl 1573 trug. Auch 100jährige Eiderenten finden sich in der Literatur erwähnt. Wenn wir nun rückblickend all diese immerhin recht spärlichen Angaben miteinander vergleichen, so drängt sich uns unwillkürlich die Wahrnehmung auf, daß Vögel mit geringer Nachkommenschaft Die großen Adler und Geier legen nur 1-2 Eier. besonders langlebig sind, und umgekehrt, und wir erkennen auch hier wieder das weise, ausgleichende Walten der Natur, die, ohne sich um das Geschick des Individuums zu kümmern, doch stets auf die Erhaltung der Art bedacht ist, sei es nun durch starke Vermehrungsfähigkeit oder durch lange Lebensdauer des Individuums.

Spechthöhle
Aber verlassen wir nun die toten Vogelgreise und sehen wir uns einmal den Schlaf der lebenden an. Die Vögel schlafen sitzend! Das ist etwas so allgemein Bekanntes, daß es einem schon gar nicht mehr auffällig vorkommt. Wir sehen, die Vögel schlafen zumeist in sitzender Stellung auf Zweigen, fragen uns aber weiter gar nicht nach dem Grunde dieser eigentlich doch höchst merkwürdigen Erscheinung. Die Vögel nehmen bekanntlich während des Schlafes eine geduckte Stellung an, bei der durch die Last des Körpers der Unterschenkel auf den Lauf gedrückt wird. Hierdurch werden die Sehnen der einzelnen Zehen fest angezogen und umspannen so unwillkürlich den Zweig wie eine Klammer. Durch diesen einfachen mechanischen Vorgang wird der Vogel ohne eigene Anstrengung durch die Last seines eigenen Körpers auf dem Zweige festgehalten. Die Spechte schlafen sogar in hängender Stellung, die scharfen Klauen tief in die rissige Baumrinde oder in die Innenwand ihrer Nisthöhle eingeschlagen (ein von mir gepflegter Buntspecht hing sich für die Nachtruhe regelmäßig am Drahtgitter seines Käfigs auf), weil dies für ihre Veranlagung noch bequemer ist als das ihnen nicht zusagende Quersitzen auf einem Zweige. Strandläufer überraschte ich am Strande des Kurischen Haffs wiederholt im tiefsten Schlafe, wobei sie truppweise auf einem Beine zusammenstanden und den Kopf tief unter den Flügel gesteckt hatten, während die leise anrauschenden Wogen ihnen öfters das Bauchgefieder netzten und der Wind ihnen die Rückenfedern auseinanderblies. Ich habe mich immer gewundert, daß diese zarten Vögelchen in scheinbar so unbehaglicher Stellung süßem Schlummer sich hinzugeben vermochten und nicht öfters von Wind und Wellen einfach umgeworfen wurden. Schwimmvögel schlafen häufig auf dem Wasser, den Kopf unter dem Flügel, und lassen sich so ohne Ruderschlag gemächlich treiben. Da kann es ihnen passieren, daß sie in allzugroße Nähe des gefahrvollen Ufers gelangen und hier einen unsanften Empfang finden. Manche Vögel haben einen sehr festen, andere einen sehr leisen Schlaf. Schlafende Meisen kann man, wenn man sich ihnen nur halbwegs vorsichtig nähert, mit der Hand ergreifen, sie blinzeln einen dann noch sekundenlang mit einem unsäglich-komischen Gesichtsausdruck ganz schlaftrunken an, ohne sich gleich der Gefahr bewußt zu werden, in der sie schweben. Umgekehrt bemerken Eulen, die sich ja überhaupt durch ein ungewöhnlich scharfes Gehör vor anderen Vögeln auszeichnen, auch im tiefsten Schlummer jede Annäherung, machen sich schlank und blinzeln unter wiegenden Bewegungen des Vorderkörpers argwöhnisch nach dem Beobachter hinüber. All die kleinen Sänger sind schon mit Sonnenaufgang munter, begeben sich aber dafür auch sehr zeitig zur Ruhe. Indessen erleidet auch diese Regel ihre Ausnahmen. Auch unter dem rastlosen gefiederten Volke, dessen unstete Beweglichkeit so oft unser Auge ergötzt und unsere Verwunderung erregt, gibt es einige arge Langschläfer, und sie gehören sonst nicht zu den trägen Arten. Da ist z. B. der farbenduftige Alpenmauerläufer, diese gefiederte Alpenblume mit dem gaukelnden Schmetterlingsflug. Erst wenn die liebe Sonne schon recht hoch am Himmel steht und sich gleißend in den Schneematten, Firnen und Gletschern spiegelt, verläßt er seinen nächtlichen Schlupfwinkel, eine Gesteinsspalte in einer einsamen, schwer zugänglichen Felsenwand, um hüpfend, mit halb gelüfteten Flügeln die steilen Wände zu beklettern und mit seinem langen, feinfühligen Schnabel nach Spinnen und anderen Kerfen zu durchstochern. Würde er schon in den ersten Morgenstunden diesem Nahrungserwerb nachgehen, so würde er die Felswände vereist und ohne Insektenleben vorfinden, gar nicht ordentlich Fuß fassen können, dann von der auftauenden Eisschicht im Gefieder völlig durchnäßt und so in seiner Flugfähigkeit stark beeinträchtigt werden. So zwingen ihn die eigenartigen Verhältnisse seiner rauhen Bergheimat, hübsch abzuwarten, bis seine Felswände völlig trocken geworden sind und die immer heißer herabbrennenden Sonnenstrahlen die Insekten aus ihren Schlupfwinkeln hervorgelockt haben. In schönen, mondhellen Frühlings- und Sommernächten wollen unsere kleinen Freunde überhaupt gar nicht so recht zur Ruhe kommen, der allgewaltige Paarungstrieb läßt sie nicht schlafen, und halb im Traume zwitschern sie leise ihre weichsten und sehnsüchtigsten Strophen. Viele singen fast die ganze Nacht, um die vorüberziehenden Weibchen anzulocken, im Anfang sogar mit voller Kraft, wie ja nicht wenige Tagvögel während der Zugzeit zu Nachtvögeln werden, indem sie die stillen Nachtstunden zur Wanderung benutzen, in der Morgen- und Abenddämmerung ihrer Nahrung nachgehen, den größten Teil des Tages über aber ausruhen, ihn auch wohl in einem geeigneten Versteck verschlafen. Träumen die Vögel im Schlafe? Ich möchte diese Frage bejahen, wenn auch sicherlich kein Vogel ein auch nur annähernd so reiches Traumleben besitzt, wie etwa der Hund. Immerhin wird man bei aufmerksamer Beobachtung an Käfigvögeln öfters die Wahrnehmung machen können, daß sie tatsächlich träumen, im Schlafe Lock-, Angst-, Warn- oder Balzrufe ausstoßen, abgebrochene Strophen aus ihrem Gesänge vernehmen lassen, durch Sträuben oder Glätten des Gefieders, Flügel- und Schwanzbewegungen und selbst Veränderungen des Gesichtsausdrucks (von einem solchen kann man bei Vögeln sehr wohl reden!) ihre jeweilige Gemütsstimmung bekunden. Häufiger freilich noch ist der Schlaf des Vogels von geradezu bleierner Schwere, ruhig und völlig traumlos. Würde ihm der Schlaf auch nur für kurze Stunden entzogen, so wird er ihm zum obersten Bedürfnis, dessen Nichtbefriedigung seinen Körper bald völlig erschöpfen würde, und er schläft dann auch fest und traumlos in der ungewohntesten Umgebung, unter den verändertsten Verhältnissen, selbst angesichts der dringendsten Gefahr. Auf dieser Kenntnis beruhte ja auch in der Hauptsache die ganze Dressurkunst der Falkoniere, die den blitzschnellen Jäger der Lüfte ihren Zwecken dienstbar zu machen verstanden, weil sie eben sehr wohl wußten, daß nichts auch den kräftigsten, scheuesten und boshaftesten Vogel (man denke nur an den Habicht!) so rasch und sicher mürbe mache als zeitweise Entziehung des Schlafes.

Waldkauz ( Syrnium aluco [L.])
Das verhältnismäßig große Schlafbedürfnis des Vogels, dem er sich oft auch während der heißen Mittagsstunden hingibt, wird erklärlich, wenn wir bedenken, welch ungeheure Arbeitsleistung der Vogelkörper im Laufe des Tages zu vollbringen hat. Wenn wir z. B. der Turmschwalbe zusehen, wie sie pfeilgeschwinden Fluges jagend die Lüfte durcheilt, unermüdlich ihre Flugbahnen zieht, stundenlang ohne jede Unterbrechung, nur für Sekunden hier und da sich zum Ausruhen an einen vorspringenden Stein des rastlos umflatterten Turmes sich anklammernd, da werden wir uns vor Staunen kaum fassen können über die gewaltige Arbeitsleistung des kleinen Vögelchens, dessen Muskeln und Sehnen von Stahl zu sein, dessen nimmermüde Schwingen die Frage des perpetuum mobile fast gelöst zu haben scheinen. Sinkt dann endlich der Sonnenball unter den Horizont, dann muß auch der leichtbeschwingte Vogel sich unter die unabänderlichen Gesetze der ewigen Natur beugen und in tiefem Schlummer genügend Kräfte sammeln zu neuer Tätigkeit. Die Rauchschwalbe bringt ihren eben ausgeschlüpften Jungen durchschnittlich wohl jede halbe Minute Nahrung, macht also täglich mindestens tausend Touren vom und zum Neste, wozu noch die Arbeit des Insektenfangens kommt. Selbst der winzige Zaunkönig mit den kurzen Flügelchen und dem mühsam schnurrenden Flug wurde innerhalb 7¼ Stunden 110mal am Neste futterbringend beobachtet, und wenn er gar, wie es nicht selten der Fall ist, einen unersättlichen Kuckuck als Stiefkind aufzuziehen hat, genügt selbst dieser Bienenfleiß noch nicht, und er muß für den Schreihals Bissen von einem Umfang herbeischleppen, daß schon das Tragen solcher eine gehörige Anstrengung für den kecken Knirps mit dem Stelzschwänzchen bedeutet. Im Einklang mit der großen Arbeitsleistung des Vogels steht nun aber wieder sein ungemein reger Stoffwechsel, sein heißes, leidenschaftliches Blut, sein gewaltiger Appetit. »Er ißt wie ein Vögelchen« ist eines der auf ganz falscher Naturbeobachtung und kindlich-naiver Verkennung aller Maßstäbe beruhenden Sprichwörter, denn in Wirklichkeit ist das Nahrungsbedürfnis des Vogels im Verhältnis ein sehr viel größeres als das des Menschen. Nicht wenige gerade der kleinsten und zartesten Insektenfresser nehmen an Nährstoffen täglich annähernd ebensoviel zu sich, als ihr eigenes Körpergewicht beträgt. Die Körnerfresser sind in dieser Beziehung genügsamer, was ja auch schon daraus hervorgeht, daß man den Käfig eines solchen wöchentlich nur einmal, den eines Weichfressers dagegen dreimal reinigen muß, wobei noch zu bemerken ist, daß der Nahrungsverbrauch gefangener Vögel infolge der verminderten Beweglichkeit und der starken Einschränkung in Flug und Nahrungssuche sicherlich viel geringer ist als in freier Natur. Beim Rotkehlchen z. B. würde einer aufgestellten Berechnung zufolge ein 2 m langer Regenwurm gerade das tägliche Nahrungsbedürfnis decken; ein Mensch müßte im gleichen Verhältnis täglich eine Riesenwurst von 8 m Länge und 22cm Durchmesser vertilgen. Eine Drossel verspeist zu einer Mahlzeit bequem die größte Schnecke, was dem Verhältnis einer guten Kalbskeule zum Menschen entsprechen würde. Ein uns Menschen weniger angenehm berührendes Beispiel unersättlicher Freßgier ist auch der Fischfresser Kormoran. Sein scharfer, eine ungemein rasche Verdauung bewirkender Magensaft mag das meiste dazu beitragen, daß er täglich ein ganz unverhältnismäßiges Quantum Fische verbraucht. Er pfropft sich, wenn er es haben kann, buchstäblich mit den wohlschmeckenden Schuppenträgern voll, so daß ihm der Schwanz des zuletzt verschluckten zum Schlunde herausragt, aber nach wenigen Stunden hat er schon wieder frischen Appetit. »Sie sind geschäftig wie die Ameisen und gefräßig wie die Wölfe,« schreibt nicht umsonst ein alter Schriftsteller. Brehm stellte fest, daß ein von ihm in der Gefangenschaft gehaltener Kormoran am Vormittag 26 und in den Nachmittagsstunden weitere 17 Weißfische von durchschnittlich 20 cm Länge verzehrte. Man hat Aale von fast 2 Fuß Länge aufgefunden, deren Kopf im Magen des schwarzen Fischräubers schon halb verdaut war, während das Schwanzende des zählebigen Fisches zum Schnabel heraussah und noch Leben und Bewegung zeigte. Einfach scheußlich! Da muß auch der enragierteste Vogelfreund verstummen.

Zaunkönig ( Troglodytes troglodytes [L.])

Kormoran ( Phalacrocorax carbo [L.])
Und dabei muß sich der Vogel jeden Bissen – und oft Bissen winzigster Art – erst selbst aufsuchen und erjagen, häufig genug unter recht ungünstigen Umständen, denn nur sehr wenige Vögel sammeln zu Zeiten des Überflusses Vorräte für die Tage der Not. Der Hamburger Ornithologe Krohn, der dieser Seite des Vogellebens eine besondere Arbeit gewidmet hat, leugnet überhaupt, daß das Vorrätesammeln nach Art gewisser Insekten und Säugetiere in unserer heimischen Vogelwelt vorkomme. Darin irrt er aber entschieden. Von dem Zusammentragen großer, für Monate berechneter Vorräte kann freilich keine Rede sein, und solche wären ja auch zwecklos, da die Vögel bekanntlich keinen Winterschlaf halten. Doch habe ich oft genug feststellen können, daß Eulen, namentlich Schleiereulen, die bei anhaltend stürmischem und regnerischem Wetter nur ungern ausfliegen und dann auch nur wenig Mäuse finden, in ihren Schlupfwinkeln ein Dutzend und mehr Mäuse zusammenschleppen und von diesen in solchen ungünstigen Nächten so lange zehren, bis ein günstiger Umschwung in der Witterung eingetreten oder aber ihr Vorrat schon früher erschöpft ist und der Hunger sie nun doch hinaustreibt. Wer jemals selbst einen Futterplatz im Winter unterhalten und auf diesem den munteren »Gschaftlhuber« Kleiber zu Gast gehabt hat, wird auch gesehen haben, wie dieser kecke Bursche sich zum Schaden der anderen Kostgänger in unverschämter Weise vordrängt, 2 bis 3 Kürbis-, Hanf- oder Sonnenblumenkerne ergreift, sie aber nicht sofort verzehrt, sondern mit ihnen davonfliegt, einige Augenblicke später wieder zur Stelle ist und dieses Spiel geraume Zeit hindurch fortsetzt. Es ist unglaublich, welche Mengen von Körnern er auf diese Weise verschwinden läßt. Was macht er damit? Nähere Beobachtung wird uns bald hinter seine Schliche kommen lassen. Er trägt die Körner zu einem alten, knorrigen Baume und keilt sie hier in die Risse und Spalten der Rinde ein, um sie bei späterer Gelegenheit zu verzehren, wenn – der leichtlebige Gesell seinen mühsam genug aufgespeicherten Vorrat bis dahin nicht längst vergessen hat. Auch gefangene Kleiber pflegen allerlei Körner in den Winkeln ihres Käfigs zu verstecken und so den Futtertrog in überraschend kurzer Zeit zu leeren. Dem Buntspecht scheint ein ähnlicher Sammeltrieb innezuwohnen, nur daß er sich dabei nicht so leicht belauschen läßt wie die zutrauliche Spechtmeise. Zu ungleich höherer Vollendung aber ist er bei exotischen Spechten gediehen. H. de Saussure hat in Mexiko so wunderbare Tatsachen über die Anlage von Magazinen durch Spechte ( Melanerpes formicivorus) beobachtet, daß ich mir nicht versagen kann, sie hier wiederzugeben. Vergl. Marshall, Die Spechte. Als der Gelehrte im Monat April »die Einöden um den Zuckerhutvulkan Pizarro in Mexiko besuchte – trostlose Wüsteneien voll vulkanischen Sandes, Gerölles und Lava und mit keiner Spur pflanzlichen Lebens, nur mit den abgestorbenen Stengeln einer kleinen Aloe und eines Liliengewächses, der sogenannten Yukkapalme, geschmückt –, war er erstaunt, sich von zahlreichen Scharen von Spechten umgeben zu sehen. Die Vögel flogen ab und zu, von der Yukka zur Aloe und von der Aloe zur Yukka und machten sich mit ihren Schnäbeln hämmernd und pochend an beiden Pflanzen zu schaffen. Der überraschte Naturforscher fühlte sich veranlaßt, dieser auffallenden Sache auf den Grund zu gehen, und machte eine der merkwürdigsten Entdeckungen, die überhaupt je auf dem Gebiete der Lebensgewohnheiten der Vögel erfolgt sind. Er sah die dürren Aloestengel, die aus nichts bestehen als der stark kieselhaltigen, derben Rindensubstanz und die infolge des Schwundes des Innenmarkes hohl sind, von zahlreichen runden, unregelmäßig übereinanderstehenden Löchern durchbohrt, die offenbar von den in Rede stehenden Vögeln gemacht worden waren. Er spaltete einige dieser Stengel, und sein Erstaunen wuchs, als er fand, daß sie mit Eicheln gefüllt waren. Er hatte Futtermagazine, Speisekammern des Melanerpes formicivorus vor sich! Die Vögel waren damals gerade damit beschäftigt, das, was sie in der Zeit gespart hatten, in der Not zu verwenden; sie holten sich die Eicheln und trugen sie zu den Yukkapalmen, in deren Rinde sie geeignete Löcher – ›Eichelbecher‹ – hergestellt hatten, um in diese die Eicheln einzukeilen, sie zu spalten und ihren Inhalt zu verzehren.« Wie groß muß also der Sammeltrieb dieser Spechte gewesen sein, daß er sie veranlassen konnte, wegen ein paar Eicheln jedesmal den weiten Flug von den entfernten Eichenwäldern bis zu den Einöden am Pic Pizarro zu machen! Marshall vermutet wohl mit Recht, daß hier die große Nahrungskonkurrenz ausschlaggebend war, indem Mexiko das mit Eichhörnchen gesegnetste Land der Erde ist, und diesen zierlichen Nagern gegenüber die Spechte auf ihr Flugvermögen zurückgreifen mußten, um ihren Anteil an der Eichelernte sich zu sichern. Auch unser Eichelhäher, der elegante Hochstapler mit dem schönen blauen Flügelschild, sammelt gern Eicheln, versteckt sie aber nach Rabenart in der Erde. Da auch er wie der Kleiber für seine Vorratskammern ein recht kurzes Gedächtnis zeigt und sie häufig vergißt oder nicht wiederfindet, so fangen solche Eicheln häufig an zu keimen, und der gefiederte Strauchritter wird dadurch unabsichtlich zu einem der tätigsten und erfolgreichsten Verbreiter des herrlichsten der deutschen Waldbäume, eine schätzenswerte Eigenschaft, die ihm in Frankreich geradezu den Volksnamen » Le planteur« eingetragen hat. Was der Eichelhäher für die Eiche, das bedeutet der Nußhäher für die Zirbelkiefer unserer alpinen Wälder, da deren schmackhafte Nüßchen seine Lieblingsspeise bilden und zur Zeit der Samenreife oft in großer Menge von ihm in der Erde versteckt werden, bis er sie im harten Gebirgswinter wieder unter dem Schnee hervorscharrt. Da aber auch er oft genug seine Vorratskammer vergißt, macht er sich um die unfreiwillige Verbreitung dieses angenehmen Gebirgsbaumes recht verdient. Auch die mehr berüchtigten als in Wahrheit gekannten »Schlachtbänke« unserer Würger dürften wenigstens teilweise mit dem Sammeltriebe dieser Vögel in Verbindung stehen, denn daß der Dorndreher seine Opfer aus bloßer wollüstiger Grausamkeit aufspießt, wie der Volksmund gerne glauben machen möchte, ist natürlich eine ganz willkürliche und durch nichts gerechtfertigte Annahme. In der Natur geschieht nichts ohne Zweck, und bis zu sinnloser Grausamkeit hat sich nur der Mensch verirrt da, wo er entnervte oder zur Bestie entartete. Auch die in solchen Fällen immer als Beispiel angeführte Katze ist meiner Überzeugung nach nicht bewußt grausam, denn das grausame Spielen mit dem Opfertier hat, wie jedes tierische Spiel, einen bestimmten Zweck, den der Übung im Erhaschen der Beute. Freilich habe ich ein anderes und gewichtigeres Bedenken gegen das scheinbare Aufspeichern von Nahrungsmitteln durch die Würger. Diese doch ziemlich stattlichen Vögel vermögen auffallenderweise ihre Nahrung nur in verhältnismäßig kleinen Bissen zu verschlingen, während die Bewältigung größerer ihnen viele Schwierigkeiten macht, wenn sie sie unter allerlei komischen Drehungen und Wendungen des dicken Kopfes mühsam und ungeschickt genug durch den engen Schlund hinunterwürgen. Ich glaube auch, daß der Name »Würger« eher von dieser Eigentümlichkeit herrührt, als von ihren gelegentlichen Nesterplünderungen und Strauchrittertaten, denn von diesen dürften unsere Altvordern schwerlich viel gewußt haben. Auch die Eigenart der Würger, größere Beutestücke aus Dornen aufzuspießen und erst nach und nach zu verzehren, dürfte vielleicht eher mit der Absicht zusammenhängen, einen umfangreichen Braten bequem in kleinen Bissen zu sich nehmen zu können, als mit dem Triebe, Nahrungsmittel für den Notfall aufzuspeichern, was wenigstens in den nahrungsreichen Sommermonaten (und mit Ausnahme des großen Lanius excubitor sind ja alle unsere Würgerarten weichliche Sommervögel) auch gar keinen rechten Zweck hätte.
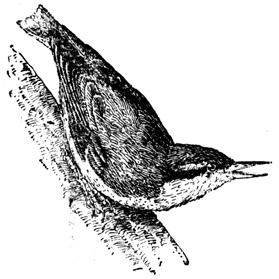
Kleiber ( Sitta europæa L.)
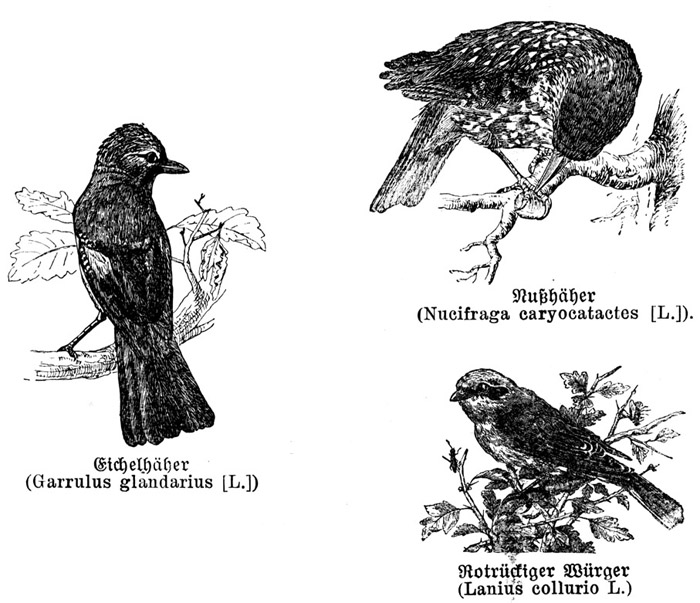
Nußhäher ( Nucifraga earyocatactes [L.]).
Eichelhäher ( Garrulus glandarius [L.])
Rotrückiger Würger ( Lanius collurio L.)
Zu keiner Zeit gewährt die Beobachtung des Vogellebens eine solche Fülle intimer Reize und köstlicher Einblicke in das geheimnisvolle Walten der Natur als im Frühling, wenn die allgewaltige Minne ausschließlich Besitz nimmt von all den kleinen, leidenschaftlichen, heißblütigen Vogelherzen, wenn alle die verliebten Vogelmännchen nach Kräften bemüht sind, ihre Vorzüge zu entfalten, ihr Weibchen zu berücken, den Nebenbuhler auf diese oder jene Art aus dem Felde zu schlagen. Ist das dann ein Singen und Klingen, ein Kosen und Flüstern, ein Jagen und Haschen, ein Streiten und Kokettieren, ein Huschen und Flattern im grünen Blättermeer, im verschwiegenen Gebüsch, im unzugänglichen Dorngestrüpp! In erster Linie dient der Gesang oder ihm entsprechende anderweitige Lautäußerungen dazu, das spröde Herz der vielumworbenen Schönen zu gewinnen. Nur zur Paarungszeit ertönt er in voller Schönheit, Fülle und Kraft, und all die kleinen Künstler bieten ihr Bestes auf, in diesem Sängerkriege obzusiegen, was keine leichte Aufgabe ist, denn der Mitbewerber sind gar viele. Ist es doch eine feststehende Tatsache, daß bei den meisten Singvögeln die Männchen beträchtlich zahlreicher sind als die Weibchen, was sich auch zur Erhaltung der Art als sehr notwendig erweist, da jene infolge ihres auffallenderen Benehmens und ihrer lebhafteren Farben in ungleich höherem Grade den verschiedensten Nachstellungen ausgesetzt sind als diese. Oft ist der werbende Liebessang mit einem eigenartigen Balzflug verbunden, durch den auch die körperlichen Vorzüge des Männchens in das rechte Licht gesetzt werden sollen. Der Baumpieper z. B. steigt von einer Zweigspitze aus trillernd in schräger Linie unter langsamen Flügelschlägen in die Lüfte empor, den Kopf weit zurückgebogen, den Schnabel nach aufwärts gerichtet, die Augen wie in Verzückung halb geschlossen, das Gefieder ballonförmig aufgeplustert. In einem prächtigen Bogen kehrt er dann flatternd zum Ausgangspunkte zurück, und sein kanarienvogelartiger Gesang erstirbt allmählich in gleichförmigen, immer leiseren und immer zärtlicheren, wie Wassertropfen hervorperlenden Tönen. Ähnlich machen es die Dorngrasmücke, der Steinschmätzer, die Blaumeise und viele andere. Mit bis zur Unkenntlichkeit aufgeblähtem Gefieder huscht der Flußregenpfeifer mit unheimlicher Behendigkeit wie eine Maus kreuz und quer auf seiner Kiesbank herum und stößt dabei unausgesetzt schwerfällige Triller und rasche Wirbel aus, die schließlich in einen jauchzenden Jodler übergehen. Der Kiebitz sucht in wuchtelndem Gaukelflug seine lebhaften Kontrastfarben zur Geltung zu bringen, indem er sich bald auf diese, bald auf jene Seite wirft oder gar in der Luft einen kunstgerechten Purzelbaum vollführt. Oder er kokettiert mit seinem schönen Federschopf, ein anmutiges Fächerspiel, in dem ihn der bunte Wiedehopf noch übertrifft. Die Bekassinenmännchen stürzen sich aus hoher Luft jäh mit steif gehaltenen Schwingen nach unten, wodurch das eigentümlich meckernde Geräusch entsteht, das ihnen beim Volke die Bezeichnung »Himmelsziege« verschafft hat, während ihre im sumpfigen Grase verborgenen Weibchen ihnen mit melancholischem »Tücke tücke« antworten. Die Rohrdommel gibt gar ihrer Liebesbegeisterung durch eine Art Rülpsen Ausdruck, indem sie die in den geräumigen und sehr dehnbaren Kehlsack eingepumpte Luft durch den steil nach oben gerichteten Schnabel mit solcher Wucht ruckweise wieder ausstößt, daß man das dadurch verursachte schauerliche Getön in stillen Nächten viertelstundenweit zu vernehmen vermag, »Ü prumb, ü plump pump« dringt es dann aus dem heimlichsten Winkel des Seeufers tief und dumpf an unser lauschendes Ohr, gleich als wolle der Vogel eine finstere Wahrheit verkündigen, über deren erste Sätze er selbst nicht hinwegzukommen vermöchte. Und alle diese mannigfachen Naturlaute dienen dem gleichen Zwecke wie auch das Flügelklatschen der verliebten Tauber und Nachtschwalben, das Trommeln der Spechte, das unheimlich jauchzende Heulen und Bellen der Eulen, das Schnabelklappern der Störche, das Blasen und Rodeln der Birkhähne, und sie alle verschmelzen mit dem Rauschen des Laubes und dem Flüstern der Rohrhalme zu einer einzigen, ungeheuren, alles überwältigenden Symphonie, der Ouvertüre zum Sommernachtstraum, schöner als selbst ein Mendelssohn sie sich erdenken und vertonen konnte!
Selbst Tanz und Turnei sind der Vogelwelt als Werbemittel nicht fremd. Die sonst so ernsthaften und würdevollen Kraniche werden zur Paarungszeit von einer förmlich ausgelassenen Lustigkeit befallen und ergehen sich dann in den possierlichsten Luftsprüngen und sonderbarsten Bewegungen; selbst die Weibchen beteiligen sich bisweilen an diesen eigenartigen Gesellschaftstänzen. Unter unseren Kleinvögeln ist das zierliche Blaukehlchen der vorzüglichste Tänzer, und das herrliche Azurblau seiner sangeskundigen Kehle kommt bei diesen bald mit steifer Grandezza, bald mit hinreißender Leidenschaft vollführten Tanzbewegungen so recht zur Geltung. Die Kampfhähne führen aus besonderen Turnierplätzen im verschwiegenen Moor zur Paarungszeit regelrechte Lanzenstechen auf, wobei der lange Schnabel als Speer, die federnde Halskrause als Schild dienen muß. Eigentümlich ist es, daß manche Vögel (z. B. Stare und Schwalben) im Herbst kurz vor dem Wegzuge nochmals zum Neste zurückkehren, hier aus- und einschlüpfen, singen und zwitschern, als stünde die Zeit der frühlingsgrünen Minne erst bevor, um schließlich nach kurzem Aufenthalte wieder davonzufliegen. Sollte dies nicht eine atavistische Erscheinung sein aus der Zeit, wo ein das ganze Jahr hindurch gleichmäßig mildes Klima den gefiederten Sängern jederzeit, also auch in unseren jetzigen Herbst- und Wintermonaten, das Fortpflanzungsgeschäft gestattete? Dann treibt das rauhe Herbstwetter den größten Teil unserer Vögel von dannen, und vor unseren Augen entrollt sich alljährlich zweimal eines der wunder-, geheimnis- und rätselvollsten Naturphänomene, das Schauspiel des Vogelzuges auf ungebahnten Luftstraßen in ungekannte Fernen.
Über die wirtschaftliche Bedeutung der Vögel und über den praktischen Schutz der nützlichen Arten ist schon so viel Tinte verschrieben worden, und ich selbst habe diesen Verhältnissen in meinem »Deutschen Vogelbuch« zwei so ausführliche Kapitel gewidmet, daß ich es mir wohl versagen kann, hier nochmals näher darauf einzugehen. Nur einige weniger bekannte Punkte möchte ich kurz berühren. Und da möchte ich zunächst eine Lanze einlegen für die Geächteten unter dem gefiederten Volk, für die vom Kulturmenschen so unerbittlich verfolgten und teilweise in unseren Landen schon der Ausrottung nahegebrachten Raubvögel, die doch mit wenigen Ausnahmen keineswegs so ungeheuer schädlich sind, als der Laie gewöhnlich annimmt. Früher freilich galt eigentlich alles, was krummen Schnabel und krumme Klauen hatte, für schädlich, also auch für vogelfrei, und leider ist dies auch heute noch mehr oder weniger der Fall in solchen Gegenden, wo man von jeher harte Köpfe und wenig Verständnis für Belehrung und Aufklärung gehabt hat. Anderwärts ist heutzutage schon manches besser geworden. Da läßt der vernünftige Landwirt wohl schon einmal auf seiner Hutung eine hohle Weide für die Eulen stehen, die er früher als Warnungszeichen ans Scheunentor nagelte, und der Jäger richtet nicht mehr seine mörderische Schrotspritze auf das nützliche und zierliche Turmfälkchen. Aber den Schlangenadler oder den Wespenbussard wird er doch noch meist totschießen, weil er sie ganz einfach nicht kennt und mit anderen schädlichen Arten verwechselt. Über unseren häufigsten Raubvogel, den Mäusebussard, sind die Akten immer noch nicht geschlossen, und so sehr der einsichtige Landmann in ihm allmählich den eifrigen Mäusejäger hat schätzen lernen, so grimmig befehden ihn immer noch die meisten Jäger. Wir dürfen aber doch die Bedeutung eines Vogels in volkswirtschaftlicher Beziehung nicht nach einem vereinzelten Wirtschaftszweige abschätzen wollen, sondern dürfen gerechterweise nur nach der Gesamtheit aller urteilen, wobei der wichtigste den Ausschlag zu geben hat, falls Widersprüche sich geltend machen sollten. In dieser Beziehung wird leider von der Jägerwelt noch sehr viel gesündigt. Der denkende und gebildete Jäger sollte sich immer bewußt bleiben, daß er dem gefiederten Raubzeug gegenüber Ankläger, Richter und Urteilsvollstrecker zugleich ist, daß er also eine dreifache Verantwortung zu tragen hat und deshalb nicht ohne weiteres jeden Raubvogel herunterknallen und überall schonungslos verfolgen darf, sondern daß er sich zuerst und vor allem in objektiver Weise ein Gesamtbild seiner Ernährung und damit seines Nutzens und Schadens machen muß. Erst prüfen und dann richten! Ich bin selbst leidenschaftlicher Jäger und deshalb gewiß der letzte, der die große volkswirtschaftliche und erzieherische Bedeutung der Jagd für die Gegenwart verkennen möchte; deshalb darf man sich aber doch nicht starrsinnig der Einsicht verschließen, daß der Ackerbau für das Volkswohl noch ungleich wichtiger ist als die Jagd, daß also ein Raubvogel, der, wie der Bussard, der Jagd nur geringen Schaden zufügt, für die Landwirtschaft aber als großartiger Mäusevertilger ungemein nützlich ist, Schonung oder doch wenigstens keine rücksichtslose Verfolgung verdient. Im großen Haushalte der Natur erfüllen die Raubvögel die wichtige Aufgabe, die kranken und schwächlichen, von Natur aus schlecht begabten und wenig zur Fortpflanzung und Erhaltung der Art geeigneten Individuen zu vertilgen. Dies ist eine im Interesse der betreffenden Art selbst gelegene Notwendigkeit. Denn eine Art, die gar keine natürlichen Feinde mehr hat, degeneriert und verkommt sehr schnell, vermehrt sich ins Ungemessene und ist dann verheerenden Krankheiten und Seuchen ausgesetzt, die ganz anders unter ihr aufräumen, als es natürliche Feinde tun, die überall nur das wohltätige Gleichgewicht herstellen. Und dann kommt gerade beim Raubvogel noch ein anderes Moment in Betracht, das meines Erachtens in der Vogelschutzfrage überhaupt das grundlegende und ausschlaggebende sein sollte, nämlich das ästhetische.

Mäusebussard ( Buteo buteo [L.])
Wenn wir an einem schönen, klaren Sommertage aus der beängstigenden Schwüle der dunstigen Großstadt hinausziehen in unseren herrlichen deutschen Wald, wenn wir hier den harzduftenden Forst durchwandern und dann hinaustreten auf eine mit smaragdenem Rasen geschmückte Blöße, da sehen wir wohl in der blauen Luft hoch über uns ein Pärchen großer Vögel mit gewaltigen Fittichen seine stillen Kreise beschreiben, sich fast ohne Flügelschlag höher und immer höher schrauben, bis es uns nur noch als zwei winzige Punkte erscheint, erhaben fast über alles Irdische, und beinahe instinktiv sagen wir uns, daß es Raubvögel waren, die wir soeben beobachteten. Denn fast nur in ihren Reihen finden wir solch großartige Flieger, solch souveräne Beherrscher des weiten, schrankenlosen Luftmeeres. Niemals vermögen wir ohne aufrichtige Bewunderung ihren herrlichen Flugspielen zuzusehen, niemals ohne eine Anwandlung von Neid darüber, daß diese gefiederten Geschöpfe sich so selbstverständlich, so ohne Angst und Mühe im Luftraume bewegen, ja ihn vollständig beherrschen, was doch dem sonst so erfinderischen, an die schwere Erdscholle gebundenen Menschen noch immer nicht recht hat gelingen wollen. Wahrhaft ideal erscheint uns diese Art der Bewegung, reine Poesie dieses Schwimmen im Äther. Deshalb verbinden wir auch mit der Erscheinung des Königs der Lüfte, des Raubvogels, den Begriff ungebundener und schrankenloser Freiheit, wie sie der zivilisierte Kulturmensch Europas kaum noch dem Namen nach kennt, und wie sie so schön zum Ausdruck gelangt in den Worten des zum kreisenden Raubvogel ausschauenden Dichters:
»Kajak, kajak!
Ich bin der Aar
Und steig' zur Höhe sonnenklar
Auf sturmesschnellen Schwingen.
Da lass' ich durch die weite Welt,
Durch Tal und Wald und Wies' und Feld
Den Adlerschrei erklingen:
Kajak, kajak!
Tief unter mir schweigen
Die Firnen und streben,
Tief unter mir neigen
Sich Wolken und schweben. –
Jetzo vom Äthersitz
Fahr' ich beschwingter Blitz
Jach erdenwärts.
Leben, dem flutenden,
Leben, dem glutenden,
Schlag' ich ins Herz.
Ich trink' es warm,
Ich schlürf' es heiß,
Ein lustberauschter Zecher,
Wie nur durch Tod zu würzen weiß
Natur den Lebensbecher.
Kajak, kajak!«

Schreiadler ( Aquila pomarina Br.)
Nicht nur als Sinnbild der Freiheit, der Kraft und der Macht erscheint uns der Raubvogel in solchem Maße, daß die stolzesten Adelsgeschlechter und die mächtigsten Staaten ihn sich zu ihrem Wappentiere wählten, sondern auch als Vorbild rast- und rücksichtslosen, durch nichts zu beirrenden, durch keine kleinliche Schranke zu hemmenden Auswärtsstrebens. Wie manchem kummerbeladenen Menschen, der sich hohe Ziele gesteckt hatte, und dessen idealen Geistesflug allerlei Hemmnisse immer und immer wieder unterbrachen, hat schon ein Blick auf den stolz emporsteigenden Raubvogel Trost und neue Kraft verliehen, weiter zu ringen und zu kämpfen, weiter vor- und auswärts zu streben, bis er das heiß ersehnte Ziel schließlich doch erreichte, sich und der Mitwelt zum unvergänglichen Ruhme, oder bis er, mutig für eine edle und gute Sache kämpfend, als ein wackerer und unerschrockener Kämpe auf der Walstatt blieb, das Horazische » Impavidum ferient ruinae« auf den erbleichenden Lippen. Dann haben wir das Bild des Raubvogels, der flugunfähig und wehrlos mit gebrochenen Schwingen im Staube liegt, mit weit vorgestreckten Krallen den letzten hoffnungslosen Kampf kämpfend und, edlen Trotz im brechenden Auge, das unvermeidliche Schicksal erwartend; also ganz das Bild eines hochbegabten und ideal strebenden Menschen, den widrige Verhältnisse hinderten, zu leisten, was er hätte leisten können, dem ein grausames Geschick frühzeitig die stürmische Kraft gebrochen.
Dies alles führt uns unmerklich wieder auf die hohe ästhetische Bedeutung des Vogels zurück, die ich ganz besonders betonen möchte in unserer materiellen Zeit, in der man sich gewöhnt hat, den Wert eines jeden Geschöpfes und damit auch seine vorgebliche Existenzberechtigung zu messen nach dem Nutzen oder Schaden, den es dem Haushalte kleinlicher Menschlein zufügt. Da vergißt man ganz, daß jedes Geschöpf im großen Haushalte der Natur eine wichtige und bedeutungsvolle Ausgabe zu erfüllen hat und deshalb stets nützlich ist, wenn wir mit unserem kurzsichtigen Auge dies oft auch nur höchst unvollkommen erkennen. Ist es nicht unsäglich kleinlich und traurig, jedes Tier nur danach zu beurteilen, was es frißt, und nicht auch die Freude und das Vergnügen in Anschlag zu bringen, das sein Erscheinen, seine Bewegung und Stimme, sein Benehmen und Gebaren dem empfänglichen Menschenherzen gewährt, nicht auch zu berechnen, welch herrlichen Schmuck der Natur jeder lebende Vogel darstellt? Oder möchten wir wohl die stolzen Räuber der Lüfte wirklich gänzlich missen? Möchten wir nie mehr das fröhliche Kichern des Turmfalken mitten in der Großstadt vernehmen, nie mehr den Bussard über unseren einförmigen Feldern seine wundervollen Kreise ziehen, nie mehr den schönen Gabelweih sich über unseren Wäldern drehen, nie mehr den reckenhaften Adler majestätisch um die schnee- und eisbedeckten Zacken und Grate des Hochgebirges schweben sehen? Es würde uns, gäbe es keine Raubvögel mehr, doch wohl etwas fehlen in dem gewohnten Landschaftsbilde, mit dem sie so innig verwachsen sind. Freilich fügen uns viele von ihnen mehr oder minder empfindlichen Schaden zu. Dann stelle man ihnen fleißig nach mit Pulver und Blei, mit Fallen und Uhu, man vermindere ihre Überzahl, aber man rotte sie nicht gänzlich aus! Dazu hat der Mensch kein Recht, denn er darf das harmonische Ganze der Natur wohl nach seinem Nutzen und Gefallen regeln und modifizieren, keineswegs aber vernichten und zerstören. Die völlige Ausrottung einer Tierart, und sei sie scheinbar noch so schädlich, hat noch niemals Gutes mit sich gebracht, selbst nicht in rein wirtschaftlicher Beziehung. Das muß schon ein recht scheeler, engherziger und selbstsüchtiger Charakter sein, der, wenn sich sein Auge werdet an der herrlichen Erscheinung des kreisenden Raubvogels, sich diesem Naturgenusse nicht für einige Augenblicke mit reiner Freude und ehrlichem Wohlgefallen hingibt, sondern der sofort an den Junghasen oder das Küchlein denkt, das der gefiederte Raubritter vielleicht im Magen haben könnte. Krasser Egoismus in allen Ständen und Lebenslagen ist ja der traurige Fluch unseres Zeitalters, und die schuldlose, von der Kultur ohnehin hart bedrängte Vogelwelt hat nicht am wenigsten darunter zu leiden. Lasse man doch wenigstens der Natur und ihren lieblichsten Kindern gegenüber auch noch idealere Gefühle gelten!
Die hoch entwickelte Heilkunde der Gegenwart hat uns in neuester Zeit darüber aufgeklärt, daß die Vögel nicht nur eine volkswirtschaftliche, sondern auch eine nicht zu unterschätzende hygienische Bedeutung haben. Wir wissen ja jetzt, daß gewisse Insekten als Vermittler gefährlicher Krankheiten eine verhängnisvolle Rolle spielen, so die Schnaken bei der Malaria, die Stubenfliegen bei der Cholera. Infolgedessen müssen die mücken- und fliegenvertilgenden Vögel, also vor allem die Schwalben, Segler und Fliegenschnäpper, für den Menschen namentlich in ungesunden Gegenden von hohem Nutzen sein. Gerade der gute Ruf dieser Vogelgattungen war einigermaßen ins Wanken geraten, seit ihnen die Entomologen haarklein nachgewiesen hatten, daß sie viele der hochnützlichen Ichneumoniden wegfangen, die bekanntlich als Larven in Raupen schmarotzen und zur Bekämpfung einer Raupenkalamität so wirksamer und entschiedener beitragen als die Vögel selbst. Nun ist das zwar meiner unmaßgeblichen Meinung nach der enormen Vermehrungsfähigkeit der Schmarotzerinsekten gegenüber kaum von irgendwelcher praktischen Bedeutung, aber es bereitete sich doch auf Grund dieser namentlich von Bau und Placzek verfochtenen Ansicht schon langsam ein gewisser Umschwung in der Vogelschutzfrage beim großen Publikum vor, und namentlich die Land- und Forstwirte sowie die Behörden wurden unseren gefiederten Lieblingen gegenüber bereits ersichtlich gleichgültiger, da die praktisch-wirtschaftliche Veranlassung zu weitergehenden Schutzmaßnahmen zu entfallen schien, – sehr zum Leidwesen der zahlreichen Vogelfreunde. Da kam diesen die Erkenntnis von der hygienischen Bedeutung der Vögel zu Hilfe, der gegenüber die verzehrten nützlichen Insekten nicht in die Wagschale fallen können. Ich habe bereits als blutjunger Anfänger während der Hamburger Choleraepidemie dies erkannt und in der »Gefiederten Welt« auch öffentlich darauf hingewiesen, aber meine Worte verhallten damals ungehört. Jetzt endlich ist im Anschlusse an die Kochschen Malariaforschungen ein Teil des Publikums darauf aufmerksam geworden, welch eifrige Verbündete wir an unseren lieblichen Singvögeln auch in hygienischer Beziehung besitzen. Da aber diese Tatsache noch wenig bekannt und gewürdigt ist, sei sie hier gebührend hervorgehoben, und es sei zu Beobachtungen über diesen hochinteressanten Punkt angeregt. Einige tatsächliche Beweise sind mir gerade in diesen Tagen bekannt geworden. So berichtet Krebs aus einem Vogesenstädtchen des mittleren Elsaß, daß die zahlreichen dortigen Gerbereien im Hochsommer Luft und Wasser in dem tieferen Stadtteile verpesteten und dadurch eine Mückenplage und einen Malariaherd schufen. »Der obere Stadtteil, den meine Familie bewohnte, war gänzlich frei von jener Plage. An den wenigen Hektometern Weges und den wenigen Dekametern größerer Höhe konnte das nicht liegen. Auch der Bergwind, der sich in der heißen Zeit mit großer Regelmäßigkeit einstellte und die Hänge bis tief ins Tal herab reinfegte, genügte nicht; denn er kam erst nach Sonnenuntergang und wich vor Sonnenaufgang. Die Erklärung jenes örtlichen Vorzugs lieferten vielmehr Hunderte von Schwalben – gelegentlich wurden bis 500 gezählt –, die ihren gewöhnlichen Sitz auf einigen Leitungsdrähten hatten, die über einen tiefer gelegenen Straßenzug ausgespannt waren. Zeitweise schwirrten die Schwalben unter lautem Gezwitscher aus, wie nach Verabredung alle auf einmal und unternahmen einen kleinen Bogenflug nach dem von Mückenschwärmen wimmelnden Tale zu. Die lebendige Mauer, die tatsächlich bis in die Abendstunden keine Mücke heraufgelangen ließ, waren also die Schwalben. Zur Nachtzeit wurden sie vom Bergwinde abgelöst.« Für manche von der Mückenplage oder von der Malaria stark heimgesuchten Orte wäre es demnach ungemein wichtig, Mittel und Wege zu finden, um Schwalben in ähnlicher Weise einzubürgern, dauernd zu fesseln und zu vermehren, wie es mit Hilfe der Nistkästen vielfach so erfolgreich bei den Staren geschehen ist.
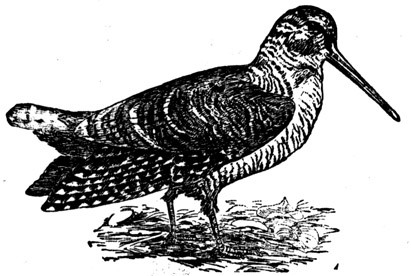
Waldschnepfe ( Scolopax rusticola L.)
Da wir uns schon auf dem Gebiete der Medizin und Hygiene befinden, will ich gleich noch einen anderen hochinteressanten Umstand erwähnen, der in fast sagenhaftes Dunkel gehüllt ist und dringend weiterer Aufklärung durch sorgfältige, gewissenhafte und vorurteilslose Beobachtungen bedarf; ich meine die Selbsthilfe verwundeten Federwildes. Mancher alte Weidmann schwört darauf, daß sich die Waldschnepfe Schußverletzungen, soweit sie sich eben selbst behelfen kann, selbst verbindet und insbesondere verletzte Ständer kunstgerecht mit Moos und den eigenen Federn umwickelt. Ähnliches ist mir auch über Nebelkrähen von zuverlässigen Jägern mitgeteilt worden. Diese betonten insbesondere, daß die an den Schußwunden angeklebten und von ganz anderen Körperteilen herrührenden Federn unmöglich durch Zufall dorthin gelangt sein konnten, sondern sicherlich absichtlich an die Wunde angedrückt worden waren. Im vorigen Jahrgange (1906) der »Österreich. Forst- und Jagdzeitung« finde ich ferner folgende positive Beobachtung eines bekannten Herrenjägers, dem jedes Jägerlatein gewiß fernlag, und der außerdem in der Lage war, sich auf einen weiteren Gewährsmann als Augenzeugen zu berufen. Er schoß beim Morgenanstande mit grobem Schrot auf eine ziemlich hoch ziehende Stockente, die zwar deutlich zeichnete, aber weiterstrich. Mit unbewaffnetem Auge konnte er erkennen, daß sich die Ente später zu senken begann und schließlich auf ein Wintersaatfeld einfiel. Nach geraumer Suche fand er sie verendet vor. Beim Aufnehmen machte er die erstaunliche Wahrnehmung, daß in die unter dem Flügel befindliche Schußwunde weiche Grashalme tief hineingestopft waren, die er einzeln herauszuziehen vermochte. Die Ente mußte sich also die Halme selbst in die Wunde eingeführt haben, um die Blutung zum Stillstand zu bringen! Die Wissenschaft fertigt solche Erzählungen in der Regel mit einem ungläubigen Achselzucken ab und murmelt etwas von Zufall oder Jägerlatein. Meines Erachtens sehr mit Unrecht, denn die positive Beobachtung steht höher als jede Spekulation. Ich persönlich halte solche Vorkommnisse durchaus nicht für unmöglich, und sie werden weniger erstaunlich erscheinen, wenn wir bedenken, welches Verständnis z. B. kranke Stubenvögel ihrem Pfleger entgegenbringen, wie geduldig sich der ungeberdigste Papagei einpinseln oder verbinden oder ins Dampfbad setzen läßt, sobald er erst einmal eingesehen hat, wie gut ihm das tut, und daß man ihm damit nur zu Hilfe kommen will. Und welche Intelligenz, welche Überlegung, welche List und welche Kombinationsgabe entwickeln viele Vögel drohenden Gefahren gegenüber oder beim Fortschaffen ihrer bedrohten Jungen oder bei der Anlage des Nestes, wo sie sich böse Erfahrungen aus früheren Jahren meist sehr wohl zunutze zu machen wissen, allerdings oft auch dabei in das entgegengesetzte Extrem verfallen, gerade wie naiv denkende Menschen.
Überhaupt wage ich auf Grund zahlreicher und eingehender Beobachtungen zu behaupten, daß die Vögel ein verhältnismäßig hoch entwickeltes Verstandes- und Seelenleben besitzen. Ich weiß sehr wohl, daß ich mit diesem Ausspruch in einer Zeit, wo ein Brehm als ein Scharlatan und die Altums und Wasmanns als oberste Koryphäen der Wissenschaft gelten, gewissermaßen in ein Wespennest hineingreife, da es geradezu Mode geworden ist, solche Ansichten als »rückständig« mit dem schönen Worte »anthropomorphistisch« zu verspotten. Aber in unserer »Kosmos«-Gemeinde, wo die Zell, Bölsche, Francé und andere wackere Streiter schon gehörige Breschen in die dichte Phalanx der Gegner gebrochen haben, wird mir doch so mancher beipflichten, der nicht gewöhnt ist, blindlings angeblichen Autoritäten nachzubeten, sondern selbständig zu denken, scharf zu prüfen und zu wägen, ehe er urteilt. Erst forschen, dann glauben! Ist es nicht eine auffällige Tatsache, daß all die übermächtigen Bestrebungen, das Tier zur willenlosen Reflexmaschine herabzudrücken, im Grunde genommen immer wieder von derselben Kaste ausgehen, die an dem endgültigen Siege dieser verhängnisvollen Irrlehre ein sehr selbstsüchtiges Interesse hat? Muß man da nicht schließlich die Absicht merken und verstimmt werden?
Wenn man versucht hat, den Vögeln jeden Charakter abzustreiten, so ist mir dies einfach unverständlich; er ist vielmehr bei Vögeln ein und derselben Art unendlich verschieden, also rein individuell, was mir jeder aufmerksame Vogelliebhaber und Vogelzüchter ohne weiteres bestätigen wird und was jeder Dresseur als die erste Grundlage seiner Kunst berücksichtigen muß. Mindestens die Keime zu einem Seelenleben sind auch in der Vogelwelt schon in unverkennbaren Spuren vorhanden. Der Papagei weiß sehr wohl, was ihm verboten ist, und fürchtet oder schämt sich gar, wenn er dieses Verbot übertreten hat. Anfänge von ästhetischem Empfinden zeigen sich z. B. in dem Steinchenschmuck der Laubenvogelnester, in dem Eintragen von stets frischen, grünen Zweigen in den Horst des Wespenbussards, von farbenschönen Blumen in die Starkästen. Reicht man nistenden Vögeln verschiedenfarbige Wollfäden, so wird man bald bemerken, daß sie ganz bestimmte Farben bevorzugen und an ihnen ein ersichtliches Wohlgefallen haben. Die Zugvögel zeigen die zäheste Anhänglichkeit an ihre Heimat und die erstaunlichste Ortskenntnis, denn Storch und Schwalbe kehren alljährlich aus Innerafrika Tausende von Kilometern weit durch unzählige Fährnisse hindurch wieder zu dem alten Neste zurück. Daß der Vogel auch rein seelische Freuden kennt, beweist u. a. der von Brehm erwähnte Gimpel, den die frohe Aufregung tötete, als er nach jahrelanger Trennung seinen Herrn wieder erblickte, beweist ferner das jubelnde Gezwitscher der Schwalben, denen man ein herabgefallenes Junges wieder ins Nest gesetzt hat. Mut im edelsten Sinne des Wortes zeigt die Verteidigung von hilflosen Nestjungen durch die Vogeleltern gegen oft weit überlegene Gegner, und die dabei häufig entfalteten Verstellungskünste lassen auf einen hohen Grad von Überlegung und Besonnenheit schließen. Der Käfigvogel vertraut diesem Menschen rückhaltlos, mißtraut jenem grenzenlos und beweist dabei oft mehr Scharfblick und Menschenkenntnis als homo sapiens selbst. Die Rabenvögel vergessen nicht leicht erlittene Kränkungen und suchen sie noch nach langer Zeit zu rächen. Wie soll man es anders nennen als Mitleid, wenn z. B. eine Bachstelze eine verwaiste Brut Rotkehlchen mühevoll auffüttert und mit der größten Aufopferung großzieht? Wie oft können wir ein inniges Freundschaftsverhältnis zwischen ganz verschiedenartigen, von Natur aus vielleicht geradezu feindseligen Tieren (z. B. Star und Katze) beobachten!
Aus alledem und aus unzähligen tatsächlichen Beobachtungen erfahrener Tier- und Vogelkundiger geht wohl zur Genüge hervor, daß es nicht angeht, jegliche Verstandestätigkeit und jegliches Seelenleben bei unseren gefiederten Freunden vollständig abzuleugnen. Wenn sich einer unserer Gegner von seinem einseitigen Standpunkte aus sogar dazu hinreißen ließ, die Darstellungsweise Brehms, dieses Meisters der deutschen Prosa, »anekelnd lächerlich« zu nennen, so werden dagegen mit mir die zahllosen Verehrer dieses genialen und unerreichten Schilderers des Tierlebens nachdrücklichst protestieren. Mag der große und allzu früh verstorbene Forscher hier und da geirrt, mag ihn bisweilen seine dichterische Begabung zu weit vom Standpunkte des kühl wägenden Naturforschers hinweggetragen, die rege Phantasie ihn zu Übertreibungen verleitet haben –, in Tausende von empfänglichen Herzen hat sein beredtes Wort die Liebe zur Tierwelt ausgesät, und dafür müssen wir ihm gerade jetzt in der Zeit des Reflexmaschinen-Vogels dankbar sein, ihm, der den Sinn für den deutschen Wald und seine fröhliche Vogelwelt neu geweckt hat, und deshalb wollen wir uns die Freude an unseren gefiederten Sängern nicht durch Sophistereien verderben lassen, sondern sie hegen und pflegen, sie lieben und schätzen als das, was sie sind: die lieblichsten Gebilde unserer herrlichen Wälder!