
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Taufrischer Morgen auf herbstlicher Flur! Welch wunderbare Bilder entrollt er vor unsren entzückten Augen! Schwerlich gibt es etwas Schöneres in der heimischen Natur, und selbst der holde Frühling mit all seinem Blumenduft und Zwitschersang kann sich mit ihm kaum messen. Wenigstens kommt man zu dieser Ansicht in den Jahren, wo man den Altar der Venus abbricht und dafür dem Bacchus einen neuen errichtet. An Farbenzauber kann es jedenfalls der Lenz mit dem Herbst nicht aufnehmen. In flammendem Rot und leuchtendem Gelb prahlt der durchsichtig gewordene Wald, und das düstere Blau- und Schwarzgrün der Nadelbäume sticht unvermittelt dazwischen. Aus dem fahl verbleichenden Wiesengras leuchten weiße Pilze als frohe Flecken, recken die Herbstzeitlosen ihren schlanken, rosenfarbenen Lilienleib. Von Baum zu Baum zieht das muntere Turnervölkchen der stillgeschäftigen Meisen, über die kahlen Stoppelfelder hoppelt der Hase, streichen schwerfälligen Fluges krächzende Krähen, und der Knall eines Schusses am Waldesrand verkündet, daß die frischfröhliche Jägerzeit wieder begonnen hat. Wunderbar klar und von köstlicher Frische ist die alles in den schärfsten Umrissen abzeichnende Luft, die liebe Sonne lacht von einem fast unwahrscheinlich blauen Himmel herab, und ihre Strahlen zaubern Millionen und aber Millionen von sprühenden Demantfunken auf taufeuchte Blätter und Gräser. Weithin aber ist alles übersponnen von silbernem, duftigem Schleierflor. Die Stoppeln und Gräser überzieht er, alle Wegweiser und Stämme, alle Zäune und Planken hüllt er ein, fliegt uns als Silberschleier an die Kleidung und ins Gesicht, ja selbst die alte Stiefelruine auf dem Zaun und die häßliche Vogelscheuche auf dem Feld erscheinen wie von gütigen Feenhänden geschmückt, und auch den duftigen Düngerhaufen deckt ein reich mit Tauperlen durchstickter Silberteppich. Das ist der vielgerühmte Altweibersommer, dem der Volksmund noch mancherlei andere Namen gegeben hat, wie Marien-, Herbst-, Sommer-, Matthias- und Gallusfäden, fliegender Herbst-, Nach-, Mädchen- und Indianersommer, Mariengarn, Garn der heiligen Jungfrau, Baumwollregen usw. Wie man sieht, spielt die heilige Jungfrau Maria dabei eine große Rolle, aber wahrscheinlich ist sie auch hier nichts anderes als eine Übertragung altgermanischen Götterglaubens auf den christlichen Kultus. Die fromme Sage erzählt, daß sie mit 12 000 Jungfrauen am frühen Morgen diese Fäden spinne, während unsere germanischen Vorfahren sie mit ihren Schicksalsgöttinnen, den zumessenden Metae (daraus verstümmelt »Mädchensommer«), in Beziehung brachten.
Jedenfalls ist die Menschheit schon sehr frühzeitig auf dieses wunderbare Schauspiel der Natur aufmerksam geworden, aber es hat lange genug gedauert, bis man sich über seine Art und Weise ins klare kam und unzweifelhaft feststellte, daß Millionen kleiner Spinnen es sind, die den Zauberteppich bereiten. Zwar nahm schon der alte Aristoteles als selbstverständlich an, daß die Sommerfäden nichts anderes seien als Spinnenfäden, aber das abergläubische Mittelalter hat diese einfache Erklärung schnell wieder vergessen und gefiel sich in allerlei absonderlichen Vorstellungen. Der »englische Homer«, Geoffrey Chaucer († 1400), war der erste, der den Altweibersommer ausführlich beschrieb, und 1670 fand Hulse wandernde Jungspinnen auf den Fäden. Aber trotzdem war der Aberglaube so rasch nicht auszurotten. Noch Stoy hielt die Herbstfäden für eingetrocknete Pflanzensäfte, und der treffliche englische Naturforscher Robert Hooker, der diese Erde, die für den armen verwachsenen Teufel ein wahres Jammertal war, 1703 verließ, meinte, daß es sich um ein Erzeugnis der Atmosphäre handle. Andere erblickten in den Sommerfäden in der Luft schwebende Algenfäden; sogar Ephraim Goeze, Pfarrer zu Quedlinburg, ein Bruder des Hamburger Hauptpastors und Gegners von Lessing, sonst ein ausgezeichneter Beobachter, hielt sie für eine harzähnliche Ausschwitzung, und das Volk sah darin nach wie vor das Schleppkleid der Jungfrau Maria oder wohl auch ein bedenkliches Warnzeichen vor Pest, Hungersnot und Wintergraus. Ebenso war man sich über die treibende Kraft der Fäden im unklaren und führte sie bald auf Verdunstung des Taus, bald auf elektrische Abstoßung zurück. Auch Zoologen, die den tierischen Ursprung der Gewebe erkannten, schrieben ihn doch z. T. nicht den Spinnen, sondern gewissen Käfern und Schildläusen zu, oder, wenn sie doch in Spinnen die Künstlerinnen sahen, hielten sie die Fäden für gewöhnliche Fangapparate, wenn die Menschheit so lange über die Natur der Marienfäden im Zweifel sein konnte, so ist dies wohl darauf zurückzuführen, daß ihre allzugroße Massenhaftigkeit verblüffte und daß man so selten Spinnen auf ihnen fand. Dies ist freilich einfach genug zu erklären: die betreffenden Beobachter sind eben zu spät aufgestanden.
Will man die Spinnen in ihrer Tätigkeit belauschen, so muß man schon bei Sonnenaufgang aus den Federn sein, andernfalls wird man meist nur schon verlassene Gewebe antreffen, oder die Spinnchen machen sich bei der leisesten Erschütterung ihres Gespinstes aus dem Staube. Hat man aber Glück und ist man an einem warmen, ruhigen und sonnigen Herbstmorgen zur Stelle, so kann man die Tierchen zu Hunderten auf erhöhten Punkten sitzen sehen oder sie zu Dutzenden von den Grashalmen abstreifen. Die ganze Erscheinung erinnert an das Meeresplankton im Wasser, denn sie stellt gewissermaßen das Plankton der Luft dar, ein Schweben in der Atmosphäre und zugleich die einzige Schwebeart bei Landtieren. Der Zweck der Einrichtung ist klar: Die Tiere wollen wandern und Reisen machen, um den Verbreitungsbezirk ihrer Art zu vergrößern und dadurch zugleich den kannibalischen Mitbewerbergelüsten der eigenen Kameraden männlichen und weiblichen Geschlechts zu entgehen. Wir haben also eine Parallelerscheinung zu den geflügelten Samen vieler Pflanzenarten vor uns. Da nun die Spinnen weder zu ausdauernden Wanderungen geeignete Beine haben noch Flügel besitzen wie die Vögel und Kerfe, so werden sie einfach zu Luftschiffern und benutzen dazu ein Floß von denkbar einfachster Bauart, das aber doch seinen Zweck vollkommen erfüllt. Es ist die praktischste Art und Weise der Ortsveränderung, die sich für flügellose Tiere ersinnen ließe. Allerdings bezweifeln selbst neuere Naturforscher, wie z. B. Schiner, daß das Wandern der Zweck der Herbstfäden sei, weil diese ja ein regelloses Spiel der Winde darstellen, und neigen der Ansicht zu, daß es sich nur um überschüssig geworbene Gewebe handelt, die ihren Zweck verfehlt haben, weil sie nicht angeheftet werden konnten und deshalb nun mit dem Winde umhertreiben. Aber auf eine regelrechte Richtung kommt es bei dieser Wanderung ja auch gar nicht an, wenn sie nur das Tier eine genügende Strecke weit von seinem bisherigen Aufenthalt entführt. Gewisse Eigentümlichkeiten in der Verbreitung mancher Spinnenarten lassen sich überdies nur durch solche Luftreisen erklären.
Es handelt sich bei diesen Wanderern keineswegs um eine besondere Spinnenart, sondern es sind eine ganze Reihe verschiedener Formen an solchen Luftschiffahrten beteiligt, hauptsächlich Wolfspinnen und Krabbenspinnen, also Arten, die keine Fangnetze verfertigen. Es ist nicht schwer, die Tierchen beim Antritt ihrer abenteuerlichen Reise zu beobachten, wenn man nur über ihre Lebensgewohnheiten einigermaßen Bescheid weiß. Bei Sonnenaufgang haben sie sich massenhaft auf erhöhten Punkten, also auf Sträuchern, Zäunen, Grenzsteinen und dgl., angesammelt und warten nun die Erwärmung des Bodens ab, um ihr Luftsegel loszulassen. Früher glaubte man, daß sie einfach einen langen Fadenstrahl aus ihren Spinnwarzen gewissermaßen herausschießen, wie ein Fischer dem Ertrinkenden ein Tau zuwirft, bis er imstande sei, sie zu tragen. Aber das ist nicht richtig, und es müßte ja auch eine besondere Muskulatur zu derartig heftigem Herausschießen des Spinnstoffs vorhanden sein, die man bisher nicht gefunden hat. Der Vorgang spielt sich vielmehr folgendermaßen ab: Die Spinnen – es sind ausschließlich junge Tiere, meist zwischen der dritten und vierten Häutung – befestigen zunächst auf dem zum Abflug ausersehenen Punkte einige Fäden, heben fortspinnend den Hinterleib hoch und stellen sich dabei mit der Stirne gegen den Wind, so daß dieser den immer weiter heraustretenden Hauptfaden zu einer Art Schlinge ausbeult (Abb. 1). Ist sie lang genug geworden, so beißt die Spinne den Faden an der Befestigungsstelle ab, läßt plötzlich die Unterlage mit allen Beinen zugleich los und erhebt sich nun (sie wiegt ja höchstens 1/30 g) auf ihrem flatternden Floße in die Luft, getragen von der Luftströmung, die von dem erwärmten Erdboden aus nach oben emporsteigt. So segelt sie höher und höher – oft genug hat man sie ja schon auf den höchsten Kirchtürmen gefunden –, bis sie auf eine andere Luftströmung trifft, die von der Seite her wirkt und stärker ist als die bisherige. Nun werden die kühnen Luftschiffer von dieser erfaßt und weit, weit fortgetrieben, gewöhnlich 30–50 km. Sie haben es aber in der Gewalt, sich zur Erde herabzulassen, indem sie einfach den Faden aufrollen und verkürzen und infolgedessen mit ihrem gebrechlichen Luftschiff langsam zum Boden herabsinken. Es läßt sich denken, daß bei der Masse der Spinnen die Fäden sich oft verwirren, dadurch unbrauchbar werden und neu gesponnen werden müssen, wodurch sich ihre Massenhaftigkeit an manchen Stellen erklärt. Die Wanderung führt nicht selten überraschend weit und ebensooft ins sichere Verderben. So erzählt Darwin, daß ein Schiff, auf dem er fuhr, 100 km von der Küste entfernt, plötzlich mit einer Unzahl von aus der Luft herabfallenden kleinen Spinnen bedeckt wurde, und der Kapitän eines Segelschiffs berichtet gar, daß dieses in einer Entfernung von 350 km von der amerikanischen Küste plötzlich von Massen winziger roter Spinnchen wimmelte. Wo die Sommerfäden in ungewöhnlicher Menge niedergehen, vermögen sie geradezu lästig zu werden, namentlich in Gegenden, wo das Grumt spät gemäht wird, indem sie dieses derart überspinnen, daß es wegen des den Läden anhaftenden Taus unter dieser Überdeckung nicht trocken werden kann. Dadurch werden die sonst so nützlichen Spinnen dem Landwirt unter Umständen auch schädlich.
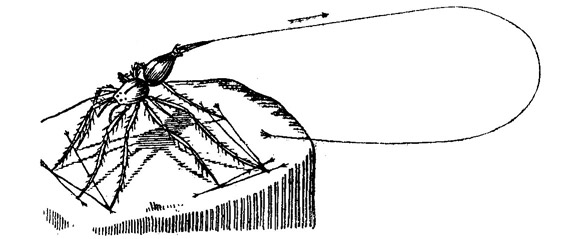
Abb. 1. Junge Wolfspinne, einen Faden des »Altweibersommers« spinnend.
Ebensowenig kann der Jäger mit dem Altweibersommer sich befreunden, denn nicht selten verklebt er dem suchenden Hunde Augen und Nase derart, daß er seine Arbeit nicht leisten kann, sondern beständig zu tun hat, um den lästigen Schleier mit den Pfoten vom Gesicht herabzustreifen.
Wie schon gesagt, sind die meisten der Luftwanderer Wolfspinnen (Lycosidae), kleine, unansehnliche Arten, die nicht, wie unsere Kreuz- und Hausspinnen, listige Netzsteller sind, sondern frei auf der Jagd herumschweifen und mit wölfischer Wildheit über ihre Beute herfallen, die sie mit Ausdauer beschleichen und in kühnen, katzenartigen Sprüngen erhaschen. Anmutige Tiere sind diese Wolfspinnen nicht, aber durch lange und starke Gliedmaßen, kräftigen Körperbau und verhältnismäßig gute Augen vortrefflich zum Räuberhandwerk ausgerüstet. Sie fallen sofort auf durch die Schnelligkeit ihres Laufes, die Wildheit ihrer Bewegungen, das plötzliche Hervorstürzen aus ihren Schlupfwinkeln. Viele Beobachter finden ihr Betragen allerdings mehr abstoßend als anziehend, namentlich ihr Liebesleben, denn schon der brave alte de Geer hat vor 160 Jahren mit Grauen und sittlicher Entrüstung festgestellt, daß die weibliche Wolfspinne die unangenehme Gewohnheit hat, ihren Ehegatten aufzufressen, wenn sie ihn erwischen kann, nachdem oder selbst bevor er seine Schuldigkeit getan hat. Aber versöhnend wirkt auf den Beobachter dann doch wieder die bewunderungswürdige Mutterliebe dieser Tiere. Widerwärtige Megären mögen sie sein, aber dafür sind sie auch wieder musterhafte Mütter, die ihre Nachkommen sorgsam behüten und beschützen und bis zur eigenen Aufopferung gegen übermächtige Feinde verteidigen. Da ihre Jungen noch im gleichen Sommer den Eiern entschlüpfen, haben sie es nicht nötig, ihnen ein schützendes Winterquartier zu bereiten, und bei ihrer rastlos herumschweifenden Jagdweise können sie auch eins feste Wohnung nicht gut bewachen; deshalb schleppen sie die mollig in Seide eingepackten Tierchen auf Schritt und Tritt mit sich herum.
Schon die Art und Weise, wie sie den Eierkokon anfertigen, ist höchst interessant. Der Naturforscher Henking, der sie dabei belauscht hat, schildert, wie die Spinne in einer stillen Ecke ihres Käfigs zunächst Fäden von einer der zusammenstoßenden Wände zur andern hinüberspann, dann Verbindungsfäden einwob und auf diese Weise eine weitmaschige Decke, eine Art Lappen herstellte. Hierauf begibt sich die Spinne in die Mitte dieses lockeren Gewebes, sämtlichen Spinnwarzen entquellen reichlich weiße Fäden, und unter Hin- und Herdrehen des Körpers, namentlich des Hinterleibes, wird eins runde Lagerscheibe von etwa ¾ cm Durchmesser geschaffen, ein Polster für die Eier, dessen Herstellung etwa 40 Minuten Zeit erfordert. Nach einer kurzen Ruhepause treten dann plötzlich die Eier in einem Guß aus der Geschlechtsöffnung hervor, begleitet von einer gelblichen Flüssigkeit. Während so der glänzende Eierhaufen auf dem Polster höher und höher sich türmt, schrumpft zusehends der Hinterleib der Spinne mehr und mehr zusammen. In kaum zwei Minuten sind die etwa 60 kugelrunden Tierchen auf dem Polster abgelegt, von der gelben Flüssigkeit wie von einem Hof umgeben. Nun heftet die Spinne an dem einen Rand des Polsters eine Reihe von Fäden an und führt sie im Zickzack über den Eierhaufen hinweg, der bald unter dem dicht und dichter werdenden Gewebe verschwindet. Dann wird durch Zerbeißen der Verbindungsfäden der Kokon, der bereits seine linsenförmige Gestalt angenommen hat, von der Unterlage gelöst, die Spinne nimmt ihn mit dem vorletzten Beinpaar vor und unter sich, wie ein Radfahrer das Vorderrad seines Fahrrades, und setzt ihn drehend in rasend schnelle Bewegung, wobei sie ihn mit einer ganz andersartigen, schmutziggrünlichen Seide umspinnt, zunächst bloß an der Naht, wo sich der grüne, bandartige Gürtel sehr hübsch von dem schneeweißen Kokon abhebt. Allmählich aber wird dieser ganz von den grünen Fäden überzogen, und so vergehen etwa 45 Minuten, bis er fertig ist. Ich selbst habe Wolfspinnen im Freien bei der Eiablage beobachten können und gesehen, daß sie hier zur Aufnahme des Grundpolsters erst eine kleine Grube in lockeres Erdreich graben. Der fertige Kokon wird an den Spinnwarzen befestigt und nun überall mit herumgetragen(Abb.2), aber nur im Notfalle auch noch mit den Tastern festgehalten. Er ist fast so groß wie das Tier selbst, und es sieht aus, als ginge dieses auf den Zehen, weil es beim Laufen die Beine weit auseinanderspreizen muß, um der Riesenkugel Platz zu machen. Wenn die Jungen ausschlüpfen, lockern sie das Gewebe auf, durchbrechen es an der Nahtstelle und steigen dann ihrer Mutter auf den Buckel. Diese läßt den bis dahin so sorgsam behüteten Kokon fallen, sobald sie die ganze Kinderschar vollzählig auf ihrem Rücken versammelt weiß. Er ist dann ganz von der munteren Nachkommenschaft bedeckt, und der Laie meint dann wohl, die bedauernswerte Spinne wimmele von Läusen. Die Kleinen nehmen auf ihrem hohen Sitz an allen Jagdausflügen der Mutter teil, die sie auch förmlich spazieren trägt, um ihnen die Wohltat eines Luft- und Sonnenbades zu verschaffen. Die Jungen entfernen sich dann auch wohl von ihrer eigenartigen Zufluchtstätte, klettern und turnen an den Grashalmen herum, spielen förmlich miteinander, flüchten aber beim geringsten Anzeichen von Gefahr wieder zur Mutterspinne zurück und werden von ihr schleunigst in den Schlupfwinkel getragen.

Abb. 2. Wolfspinne mit Kokon.
Nimmt man einer Spinne den Eikokon weg, so ist es spaßig zu sehen, wie sie verwirrt und rastlos danach sucht und unverkennbare Freude bekundet, wenn sie ihren Schatz wiedergefunden hat. Eine gewisse Gedächtnisgabe der Tierchen läßt sich bei solchen Versuchen nicht wegleugnen. Eine Spinne erkannte z. B. nach einer halben Stunde voller Aufregung und nach dem Verlust eines Beines den eigenen Kokon doch sofort wieder und fuhr fort, ihn mit grüner Seide zu überspinnen, wenn auch nur langsam und mit sichtlichem Zögern. Das Wegnehmen des Kokons ist übrigens gar nicht so einfach, denn die Spinne setzt sich wütend zur Wehr und wird leicht dabei verletzt; ohne den Verlust eines Beines geht es selten ab, aber die treue Mutter läßt sich dadurch in der weiteren Ausübung ihrer Pflichten keineswegs anfechten. Findet sie den gestohlenen Kokon nicht gleich wieder, sondern den einer andern Spinne gleicher Art, so entsteht um den begehrten Schatz zwischen den beiden Müttern ein erbitterter Kampf auf Leben und Tod. Dagegen werden Kokons anderer Spinnenarten beharrlich verschmäht. Gibt man einer Wolfspinne statt des fortgenommenen Kokons eine ungefähr gleich große Kugel aus Baumwolle oder zusammengedrücktem Löschpapier, so betastet und untersucht sie diese zunächst mit vielem Eifer, läßt sie aber nach kurzer Prüfung mißmutig wieder fallen. Anders gestaltet sich die Sache, wenn man auf der Papierkugel ein Stückchen vom Gewebe des echten Kokons befestigt. Dann nimmt die Spinne die Kugel ruhig an und schleppt sie unverdrossen mit sich, ohne den ihr gespielten Schabernack zu bemerken. Ein Spinnenhinterleib, den Henking an Stelle des Kokons seinen Versuchstieren anbot, wurde zwar aufgehoben, aber bald wieder fallen gelassen, da er sich seiner glatten Oberfläche wegen nicht recht befestigen ließ. Aus alledem geht wohl zur Genüge hervor, daß der Geruchsinn die Spinne bei ihrem Verhalten leitet. Leere Kokons, die älter als l4 Tage sind, werden verschmäht, denn offenbar hat sich bei ihnen der anziehende Kokongeruch schon verflüchtigt. Nebenbei kommt es aber anscheinend auch auf die Oberflächenbeschaffenheit der Eierhülle an, und außerdem muß betont werden, daß es auch unter den Spinnen verschieden gute Mütter gibt, daß deshalb die einen leichter, die anderen schwerer einen falschen Kokon sich unterschieben lassen. Menges Wolfspinnen nahmen sogar Kuchenkrümchen an, deren Geruch ihnen offenbar zusagte, lehnten dagegen Kreidestückchen trotz ihrer weißen Farbe und ihrer rauhen Oberfläche beharrlich ab. Zu leicht darf der Ersatzkokon nicht sein? sinkt sein Gewicht unter den vierten Teil eines echten Kokons mit 50 Jungen, so wird er nicht mehr angenommen. Dagegen scheint merkwürdigerweise eine Gewichtsgrenze nach oben kaum zu bestehen. Henking machte sich den Spaß, Schrotkügelchen, die in Seidenpapier gewickelt und dann mit echter Kokonhülle umkleidet waren, seinen Versuchstieren anzubieten, und solche verhältnismäßig ungeheure Lasten wurden willig aufgenommen und bis zur völligen Erschöpfung der Spinnen herumgeschleppt. Diese selbst sind ungemein leicht (es gehen etwa 25 Muttertiere auf ein Gramm), und doch vermögen sie gewaltige Lasten zu tragen. Während die Spinne selbst nur 0,0378 g wiegt, ein echter Kokon mit 50 Jungen 0,02 g, die Papierkugel 0,0264 g, wurden doch Schrotkugeln von 0,213 g dauernd herumgeschleppt und sogar solche von 0,451 g wenigstens zwei Tage lang, bis die Spinne infolge völliger Erschöpfung verendete, hatte sie doch eine Last tragen müssen, die das zwanzigfache Gewicht eines gewöhnlichen Kokons besaß! Wenn die Zeit zum Ausschlüpfen der Jungen herangekommen war, und aus den Papierkugeln trotzdem nichts zum Vorschein kommen wollte, warfen die Spinnen ihre Last schließlich in das Wasser des Trinkgefäßes, holten sie aber wieder heraus, um zu sehen, ob sich die erhofften Jungen denn immer noch nicht zeigen wollten.
Die Wolfspinnen können ihre Beutetiere nicht durch listig gestellte Netze fangen, sondern müssen sie nach Ratzenart beschleichen und sich dann mit plötzlichem Sprunge auf sie stürzen. Ihre Gewandtheit ist ihr einziges Jagdmittel, aber daran fehlt es ihnen so wenig, daß sie die Fliegen sogar an senkrechten Wänden mit großer Sicherheit wegfangen. Mit solch fabelhafter Geschwindigkeit stürzen sie sich auf ihr Opfer, daß man die einzelnen Bewegungen gar nicht mehr zu unterscheiden vermag. Mit ihren langen Beinen halten sie das summende Beutetier förmlich umschlungen, während die Chelizeren (Kieferfühler, d. s. die vordersten, als Oberkiefer dienenden kürzeren Gliedmaßenpaare der Spinnentiere) den tödlichen Giftbiß beizubringen suchen. Die Opfer wehren sich nach Kräften mit ihren Flügeln, und großen Fliegen gelingt es auch manchmal, die Spinne abzuschütteln. Bei der Jagd werden die Wolfspinnen, obwohl sie verhältnismäßig gut sehen, wohl weniger durch das Gesicht geleitet, als von ihrem Gefühlsinn, der von wunderbarer Feinheit ist, und dem sich noch ein empfindliches Gehör beigesellt. Die Spinne fühlt und hört die Bewegungen der Beutetiere und vermag danach die Richtung abzuschätzen. Wie ihre Verwandten, trinkt auch die Wolfspinne viel und gern. Sie hält dann die hintersten Beinpaare am Uferrande, während die vordersten auf dem Wasser ruhen, ohne bei dem geringen spezifischen Gewicht des Tieres einzusinken.
Manche Wolfspinnen begnügen sich nicht mit der Jagd auf festem Lande, sondern verfolgen ihre Beute sogar noch aufs Wasser hinaus, was namentlich die sogen. Jagdspinne tut. Noch weiter geht in dieser Beziehung die Floß- oder Piratenspinne ( Dolomedes fimbriatus), eine 20 mm große und sehr hübsch gefärbte Art, leicht kenntlich an zwei gelblichen Seitenbinden auf der Oberfläche des Hinterkörpers (Abb. 4). Sie baut sich nämlich zur Jagd auf Wasserinsekten ein richtiges Floß von etwa 5 qcm aus dürren Pflanzenteilen, die sie mit ihren Fäden zusammenwebt, wie schiffbrüchige Seeleute Holzplanken mit Seilen zusammenbinden. Der unternehmende achtbeinige Fischer braucht zu seinen kühnen Fahrten weder Kompaß noch Segel, sondern läßt sein gebrechliches Floß einfach von Wind und Wellen treiben, wohin es eben sei. Aufmerksam aber späht die Spinne von ihrem Sitze aus nach einer Fliege, Motte oder Mücke, die etwa ins Wasser gefallen ist, und wenn sie eine solche erblickt oder durch die leise Erschütterung des Wassers wahrgenommen hat, verläßt sie ihr Schifflein, stürzt sich mit wildem Ungestüm auf das hilflose Opfer, schleppt es auf ihr Floß und hält hier triumphierend das Siegesmahl. Reich ist die Ernte des Wassers, und dem gefräßigen Flößer entgeht so leicht kein Beutetier. Cook sah diese Spinne sogar mit einem 8 cm langen Fischchen ringen, es überwältigen und glücklich ans Ufer schleppen. Naht sich etwas Verdächtiges, so begibt sich die Piratenspinne auf die Unterseite ihres Floßes, hängt sich hier an und ist so jedem Blicke entzogen.
Zur Familie der Wolfspinnen gehört auch die berüchtigte Tarantel (so genannt nach der apulischen Stadt Tarent), von der die Italiener wahre Schauermärchen zu erzählen wissen. Sie (Abb. 3) gilt beim Volk für sehr giftig, ist es aber nur in ganz geringem Grade. Ich bin selbst öfters von Taranteln gebissen worden, habe aber nie größere Unannehmlichkeiten dabei gehabt als nach einem tüchtigen Bienen- oder Wespenstich. Angeblich sollen die von der Tarantel Gebissenen in wildes Gebaren und rasende Tänze (Tarantella) verfallen, oder es wurden ihnen solche als Gegenmittel verordnet. Das Ganze ist heute lediglich ein Mittel, neugierigen Vergnügungsreisenden das Geld aus der Tasche zu locken, worauf man sich in Italien bekanntlich überhaupt gut versteht. Allerdings hat der schwedische Arzt Röhler in der Tat eine »Tarantella-Krankheit« festgestellt, aber sie ist nichts anderes als eine Art Milzsucht, an der namentlich die Frauen in Unteritalien oft lange Jahre zu leiden haben und die verursacht wird durch die sitzende Lebensweise dieser trägen Menschen in ihren schmutzigen Wohnspelunken. Da mag allerdings eine zeitweilige Tanzwut ein ganz geeignetes Gegenmittel sein, wie wenig aber der sogen. Tarantellismus in Wirklichkeit mit unseren Spinnen zu tun hat, geht schon daraus hervor, daß diese Geisteskrankheit als Musterbeispiel einer rätselhaften Massenpsychose im Mittelalter auch in Deutschland weite Landstriche ergriff, obwohl es bei uns gar keine Taranteln gibt.
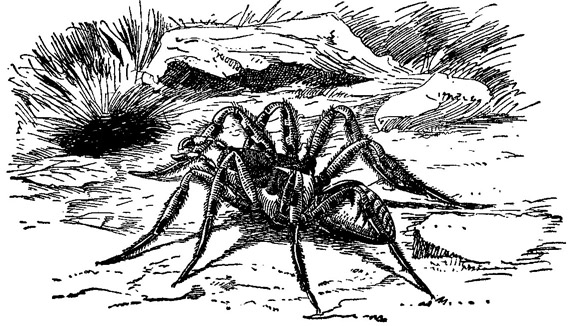
Abb. 3. Tarantel.
Ungeachtet der Zerstörung ihres sonderbaren Nimbus bleibt die Tarantel doch ein höchst interessantes Geschöpf wegen ihrer in mancher Beziehung merkwürdigen Lebensweise. Sie ist ein Nachttier und sitzt tagsüber in ihrer Wohnröhre, aus der nur die vier Vorderaugen wie Diamanten hervorfunkeln, gewissermaßen als die Fernrohre der Spinne, während die vier anderen Augen versteckt bleiben. Die Wohnröhren haben eine Länge von 30–50 cm und etwa 2,5 cm Durchmesser, verlaufen zunächst senkrecht, machen aber dann eine plötzliche, fast rechtwinklige Biegung, so daß die ganze Höhle strumpfförmige Gestalt gewinnt (Abb. 5). Die Wände sind schön und sauber mit Seide austapeziert, und an ihnen wird auch der 2–300 Eierchen enthaltende Kokon aufgehängt. Stößt die Spinne beim Graben auf einen flachen Stein, so umgeht sie ihn, obwohl ihr dadurch eine ungeheure Mehrarbeit erwächst. Erber beobachtete auf der Insel Lesina eine Tarantel beim Bau ihrer Wohnung. Das fleißige Tier schleppte Erdkrümchen um Erdkrümchen sorgfältig nach
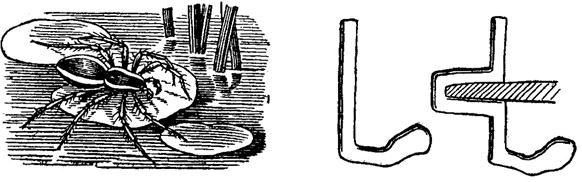
|
|
|
Abb. 4. Floß- oder Piratenspinne. |
Abb. 5. Wohnröhren der Tarantel. |
einer mehrere Meter entfernten Grube und ließ sie erst hier fallen, um jede Spur seiner Tätigkeit zu verbergen. Während der vier mondhellen Nachtstunden, in denen Erber ihr bei ihrer mühevollen Tätigkeit zusah, machte diese Tarantel den weiten Weg etwa 200mal hin und zurück, und das Ergebnis ihrer ganzen Arbeit in dieser Nacht war doch nur die Vertiefung der Wohnröhre um weitere 12 mm. Für die Jagd auf Beutetiere ist das Gift der Tarantel aber vollkommen ausreichend und wirkt selbst einer kräftigen Biene oder Wespe gegenüber fast augenblicklich tödlich. Die Tarantel versteht es aber auch, im Kampf mit solch wehrhaften Gegnern, die selbst einen gefährlichen Giftstachel besitzen, ihre Kieferklauen mit unheimlicher Sicherheit gerade in das Nervenzentrum am Genick einzuschlagen. Sie muß also ebenso wie z. B. die Dolchwespe oder die höher stehenden Raubtiere gewisse anatomische Kenntnisse besitzen und Lage und Bedeutung des Nervensystems ganz genau kennen. Ob die einzelne Tarantel diese Erfahrung erst allmählich erwirbt, oder ob sie ihr schon angeboren ist, möchte ich einstweilen dahingestellt sein lassen. Sogar große Kreuzspinnen werden von der Tarantel verzehrt, wobei sie sich merkwürdigerweise mit ihnen auf den Rücken wirft.
Das kleinere und schwächere Männchen der Tarantel gibt sich bei weitem nicht so viel Mühe mit Anlage der Wohnung wie das Weibchen und schweift viel mehr umher. Wenn es sich dem Weibchen nähern will, springt es öfters über dessen Wohnröhre hinweg oder stößt einen Grashalm oder ein Erdklümpchen hinein, um die Aufmerksamkeit der Umworbenen zu erregen, flüchtet dann aber schleunigst in ein Versteck, da es alle Ursache hat, vor der gewalttätigen Liebsten auf der Hut zu sein. Sie kommt schließlich, ungehalten über die Störung, aus ihrer Höhle heraus, um zu sehen, was es gibt, und diesen Augenblick benutzt das lauernde Männchen, um sich mit einem kühnen Sprung auf den Rücken des Weibchens zu werfen. Gelingt ihm das, so hat die Holde gegen die vollzogene Tatsache nicht viel einzuwenden; mißlingt aber der entscheidende Sprung, so wird das ungeschickte Männchen unbarmherzig gepackt und aufgefressen – wahrlich strengste Zuchtwahl im wahren Sinn des Wortes, von 10 Männchen entgehen nach den Beobachtungen Erbers kaum 2 bis 3 dem traurigen Schicksal des Gefressenwerdens. In jedem Fall ist die Xanthippe bemüht, mit dem auf ihrem Rücken sitzenden Männchen wieder in die Wohnröhre zu gelangen, was der waghalsige Freier mit allen Kräften zu verhindern sucht, denn wird er erst einmal in die unterirdische Behausung geschleppt, so ist es auch um den armen Schelm geschehen. Er wird nach vollzogener Befruchtung einfach ausgesogen, und seine leere Hülle liegt am nächsten Morgen unter den Resten anderer Beutetiere kläglich vor dem Eingang zum Hochzeitshause. Solche Überbleibsel werden aber von der Spinne baldmöglichst wieder entfernt, um den Schlupfwinkel nicht zu verraten. An dessen Eingang türmt die Tarantel gern einen Schutzwall aus zusammengesponnenen Holzstückchen, Halmen, Steinchen und dgl. auf, namentlich aus der Seite, die durch das abfließende Regenwasser bedroht ist, um eine Überschwemmung ihres Heims zu verhüten.
Die jungen Taranteln krabbeln auf dem Rücken der Mutter herum und nehmen wie diese während des Winters keinerlei Nahrung zu sich. Auf einem Weibchen, das im Februar in ganz abgezehrtem Zustande aufgefunden wurde, saßen nicht weniger als 291 Kinderchen.
Während also die Tarantel den üblen Ruf der Giftigkeit eigentlich nicht verdient, gibt es doch in Südeuropa richtige Giftspinnen, die in der Tat recht gefährlich werden können. Das sind die Malmignatten, zierliche, dunkel gefärbte Spinnen von schlankem Leibesbau (Abb. 6). Durch ihre Nahrung zwar werden sie uns nur nützlich, denn sie fangen hauptsächlich Heuschrecken und treten deshalb in Verbindung mit diesen periodisch besonders zahlreich auf. Die Spinne sucht sich im Gras der Steppe oder im steinigen Geröll, wo die Schnarrheuschrecke lebt und der Steinschmätzer seine zierlichen Knickse macht, einen vielbegangenen Insektenpfad auf und spannt über diesen in einem Engpaß niedrig über dem Erdboden ein paar Fangfäden aus. Kommt nun ein Insekt des Weges, so bleibt es mindestens mit einem Bein an den Fangfäden hängen und verwickelt sich immer ärger darein, je mehr es loszukommen sucht. Während es sich noch vergeblich abarbeitet, springt die in der Nähe lauernde Malmignatte ihrem Opfer auf den Rücken, klebt da einen neuen Faden an, befestigt ihn an einem benachbarten Grashalm und wiederholt dieses Verfahren rasch hintereinander ein dutzendmal und öfter, bis das Beutetier schließlich derart gefesselt ist, daß es sich nicht mehr zu rühren vermag und widerstandlos den tödlichen Biß über sich ergehen lassen muß. Die Kiefer der Malmignatte sind ungewöhnlich scharf, und obwohl das Tier viel kleiner ist als eine feiste Kreuzspinne, vermag es doch ungleich kräftiger zu beißen. Auch die größte Kreuzspinne kann mit ihren Chelizeren z. B. die menschliche Haut nicht durchbohren, die Malmignatte dagegen sogar die viel dickere Haut von Rindern, Pferden und Kamelen. Wenn diese Tiere aus der Weide mit Malmignatten in Berührung kommen, fährt die jähzornige Spinne sofort auf sie los und beißt sie in die Lippen oder in die Zunge, und ihr Gift ist so stark, daß in Gegenden, die reich an Malmignatten sind, alljährlich viele Weidetiere durch sie zugrunde gehen. Merkwürdigerweise sind die sonst so zähen Kamele am wenigsten widerstandsfähig gegen das Spinnengift; Pferde bedeutend mehr und Rinder noch mehr. Während von gebissenen Kamelen etwa 33% sterben, gehen von den Pferden nur 16% und von den Rindern nur 12% zugrunde. Schafe sind durch ihre wollige Bekleidung und ihre harten Lippen mehr geschützt, aber keineswegs etwa unempfindlich gegen das Gift. An der unteren Wolga wurden einmal in einem Jahr 7000 Rinder durch die Giftspinnen getötet, und wenn die Kirgisen merken, daß die Malmignatte überhand nimmt, die von ihnen (es handelt sich um die Art Lathrodectes tredecimguttatus) Karakurt, d. h. Schwarzer Wolf, genannt wird, dann brechen sie ihre Filzzelte ab und suchen andere Weidegründe auf, weil sie nicht ihre wertvollen Kamelherden aufs Spiel setzen wollen.

Abb. 6 Malmignatte.
Der Mensch ist glücklicherweise nicht übermäßig empfänglich für das Spinnengift, von 48 gebissenen Personen, die der russische Arzt Schtschenowicz behandelte, starben nur zwei. Die Kirgisen und Kalmücken tauchen das gebissene Glied in Kumyß (gegorene Stutenmilch) oder saure Milch und sollen damit gute Heilerfolge erzielen. In jedem Falle ist aber ein solcher Spinnenbiß eine schmerzhafte und langwierige Geschichte, denn 7–10 Tage dauert die Erkrankung mindestens und läßt oft noch gefährliche chronische Entzündungen zurück. Als Symptome stellen sich bald nach dem Biß ein: brennender Schmerz, kalter Schweiß, Schwindel, Unfähigkeit zum Gehen, Druckgefühl, Gallenbrechen, Harndrang, Fingerkrämpfe, hohes Fieber, Schlaflosigkeit und schließlich völlige Erschöpfung des Nervensystems. Die europäischen Ärzte verordnen deshalb vor allem schmerzlindernde, schweißtreibende und schlafbringende Mittel. Das Gift selbst, das einige Ähnlichkeit mit dem Skorpionengift besitzt, ist ein Eiweißkörper, der als Blutgift wirkt, indem er die roten Blutkörperchen zerstört, das Fibrin zum Gerinnen bringt und schließlich Herz und Zentralnervensystem lähmt. Kobert hat durch eingehende Versuche festgestellt, daß schon die jungen Spinnchen, ja sogar die Eier der Malmignatte giftig sind. Offenbar wird der eiweißartige Giftstoff von der weiblichen Spinne in den Geschlechtsteilen abgelagert und hier den Eiern einverleibt, weshalb er sich auch in den eben ausgekrochenen Jungen beiderlei Geschlechts wiederfinden muß. Der Karakurt, der mit seiner pechschwarzen Färbung und 13 blutroten Flecken eigentlich ein recht hübsches Tier ist, wird in seiner Heimat derart gefürchtet, doch z. B. in Taurien die Arbeiter doppelt und dreifach bezahlt werden müssen, wenn sie an solchen Stellen arbeiten sollen, wo Malmignatten vorkommen, während sie vor den Taranteln keine Angst haben. Wie der bekannte dortige Tierzüchter Falz-Fein mitteilt, scheinen übrigens die Schweine gegen den Biß der Malmignatte vollständig geschützt zu sein, denn sie fressen diese Giftspinnen massenhaft, ohne den geringsten Schaden davonzutragen. Schon im Altertum war die Gefährlichkeit der Malmignatte bekannt, und man hielt die aus ihr selbst bereitete Arznei für das beste Gegenmittel, vgl. z. B. Xenophons Memorabilien I, 3. Der gelehrte Araber Avicenna (geb. 980), der in dem spinnenreichen Buchara lebte, kannte die Wirkung des Bisses und das Tier selbst auch recht gut. Der alte Volksglaube von der Giftigkeit der Spinnen ist also kein Spinnstuben- oder Ammenmärchen, ja bis zu einem gewissen Grade, wie er zum Töten kleiner Beutetiere nötig ist, erscheint eigentlich fast jede Spinne (die Hausspinne wohl nicht) giftig. Selbst unserer sonst so harmlosen Kreuzspinne ist in dieser Beziehung nicht ganz zu trauen, denn Koberts eingehende Versuche haben bewiesen, daß ihr Gift doch recht wirksam ist. Zwar vermag sie, wie schon gesagt, die menschliche Haut nicht zu durchbeißen, aber trotzdem erscheint der in »Brehms Tierleben« von Taschenberg gegebene Rat, die Kinder jede Spinne anfassen zu lassen, um ihnen den Abscheu vor häßlichen Tieren zu benehmen, wenig angebracht, denn es könnte doch sein, daß eine kräftige Kreuzspinne die zarte Kinderhaut an einer besonders dünnen Stelle, etwa an den Lippen, zu durchbeißen vermöchte, und die Folgen würden dann wohl recht unangenehm sein. Ich führe auch den raschen Tod einer kerngesunden Schamadrossel, die mir ihres herrlichen Gesangs wegen besonders ans Herz gewachsen war, darauf zurück, daß ich sie zu reichlich mit lebenden Kreuzspinnen fütterte. Allerdings betrachten fast alle Vögel Spinnen als einen großen Leckerbissen, und bei den Vogelliebhabern alten Schlags gelten in Öl getauchte Spinnen sogar als eine Art Allheilmittel gegen die verschiedensten Krankheiten ihrer Pfleglinge.
Man hat früher die Untaten der Malmignatten irrtümlich auf eine andere Gruppe der Spinnentiere übertragen, die in den gleichen Gegenden der vorderasiatischen Steppenregion lebt, aber auch in Südafrika heimisch ist, nämlich auf die Walzenspinnen, die von den Kalmücken »Zauberwurm« oder »Großmütterchen« genannt und mit Unrecht sehr gefürchtet werden (Abb. 7). Unheimlich genug sehen diese großen, plumpleibigen, hochbeinigen, fahlgelblichen, dicht und filzig behaarten Spinnen allerdings aus, wenn sie nachts den Reisenden beim Lagerfeuer oder im Zelte durch ihr rasches, lautloses Hin- und Herhuschen oder durch ihre drohenden Abwehrstellungen erschrecken.
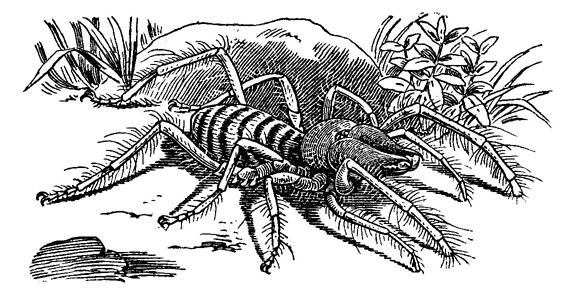
Abb. 7 Walzenspinne
Der lange Hinterleib, an dem sich neun gegliederte Abschnitte noch deutlich erkennen lassen, die ungemein kräftigen, scherenartigen Kieferfühler, die langen, zu einem fünften Beinpaar umgebildeten Kiefertaster und das Vorhandensein von nur zwei Augen weisen darauf hin, daß wir es hier nicht mehr mit echten Spinnen zu tun haben, sondern mit Tieren, die in mehrfacher Beziehung einen Übergang von diesen zu den Skorpionen bilden. Ich habe die Walzenspinnen namentlich unter den Hohlräumen der Eisenbahnschienen in der transkaspischen Wüste zahlreich angetroffen und bin hier beim Käfersammeln oder Eidechsenfangen auch von ihnen gebissen worden. Angenehm war das gerade nicht, denn sie vermögen recht empfindlich zu kneifen, daß Blutstropfen hervorquellen, und in der Wüstenglut ist der Körper des Europäers ohnedies leicht in gereiztem Zustande und deshalb doppelt empfindlich. Aber abgesehen von einer kleinen Anschwellung oder örtlichen Entzündung, die vielleicht durch Verschmutzung der Chelizeren oder durch den Einfluß des Speichels hervorgerufen wurde, traten keinerlei üble Folgen ein, und nach wenigen Tagen war an der Bißstelle überhaupt nichts mehr zu sehen. Einreibungen mit Solpugenöl, das aus den Spinnen selbst hergestellt wird, beschleunigen die Heilung und lassen überhaupt kein Schmerzgefühl aufkommen. Auch Haustieren schadet der Biß der Walzenspinne gar nichts. Andere Zoologen, die in denselben Gegenden gesammelt haben, wie Radde, Walter und Heymons, haben die gleichen Erfahrungen gemacht. Man darf deshalb wohl sagen, daß ältere Berichte, obwohl sie teilweise von Ärzten herrühren, ebenso wie die Aussagen der Eingeborenen über die Giftigkeit der Walzenspinnen auf Irrtum beruhen oder auf eine Verwechslung mit dem Karakurt hinauslaufen, obwohl diese kleine schwarze Spinne der großen, hochbeinigen und gelbhaarigen Walzenspinne eigentlich wenig ähnlich ist. Im Einklang damit steht es, daß ein Giftdrüsenapparat bei der Zergliederung von Walzenspinnen bisher überhaupt noch nicht nachgewiesen werden konnte. Kleinere Bläschen an den Kiefertastern, die man früher dafür hielt, sind in Wirklichkeit Fang- und Hefteinrichtungen, die das Tier instandsetzen, sogar an glatten Glaswänden in die Höhe zu klettern. Die Wirkung des Bisses ist also eine rein mechanische und beruht lediglich auf der großen Kraft der scherenartigen Kiefer. Wenn die Walzenspinnen so oft ans Lagerfeuer kommen, so geschieht dies wohl deshalb, weil sie durch die beim hellen Schein sich ansammelnden Kerfe angelockt werden, auch wohl die Helligkeit der Flamme an sich einen physiologischen Reiz auf sie ausüben mag. Niemals aber fällt es ihnen ein, bei solchen Gelegenheiten angriffsweise gegen den Menschen vorgehen zu wollen, sondern sie setzen sich nur nach Kräften zur Wehr, wenn sie sich in die Enge getrieben sehen. Dann richten sie den Hinterleib in die Höhe, bäumen den Vorderleib hoch auf und stoßen durch Aneinanderreiben der Chelizeren fauchende und zischende Laute aus, was alles zusammen ein ängstliches Gemüt wohl in Schrecken zu setzen vermag.
Dieselbe Schreck- und Abwehrstellung nehmen die Walzenspinnen auch ihren natürlichen Feinden gegenüber ein, und dann mag es wohl manchem von diesen nicht rätlich erscheinen, mit einem solch boshaften und bissigen Spinnentier anzubinden. Sie scheinen übrigens wenig natürliche Feinde zu haben, wenigstens in erwachsenem Zustande. Heymons hat in dieser Beziehung die schöne Blauracke in Verdacht, die in der Lehmsteppe Vorderasiens häufig ist, und ich selbst habe in der transkaspischen Wüste den von den Sammlern so begehrten Saxaulhäher als Vertilger der Walzenspinnen kennen gelernt. Die jungen Walzenspinnen fallen wohl auch zahlreich den dort massenhaft vorhandenen Eidechsen zum Opfer, aber der größte Feind der Walzenspinne ist jedenfalls sie selbst. Die Unverträglichkeit der Spinnen scheint bei ihnen bis zu einer wahren Berserkerwut gesteigert zu sein. Wo immer sie sich begegnen, fällt die stärkere grimmig über die schwächere her und frißt sie auf. Tagsüber sitzen die Tiere verborgen unter Steinen, in Erdspalten, in verlassenen Mause-, Ziesel- oder Schildkrötenlöchern und beginnen erst herumzuschweifen, wenn der glühende Sonnenball sich anschickt, zur Küste zu gehen. Beständig von einem wahren Heißhunger erfüllt, gehen sie eigentlich jedem Geschöpf, das sie überhaupt bewältigen zu können glauben, zu Leibe und verschmähen in ihrer Gefräßigkeit selbst solche Kerfe nicht, die scharfe und ätzende Körpersäfte besitzen, wie z. B. die Maiwürmer ( Meloé-Arten). An gefangengehaltenen Walzenspinnen hat man beobachtet, daß sie selbst junge Kröten, Frösche, Eidechsen und große Heuschrecken verzehrten, aber ihre Hauptnahrung bilden doch wohl Käfer, nach meinen Beobachtungen namentlich die dort so häufigen Mistkäfer. Deren harter Chitinpanzer wird von den scharfen Chelizeren der Walzenspinnen ohne weiteres durchbohrt und die Fleischmasse aus dem entstandenen Loch herausgesogen, so daß der leere Panzer unzerstückelt liegen bleibt und man in der Wüste allenthalben diese kennzeichnenden Überbleibsel der Spinnenmahlzeiten findet, von ihren Artgenossen selbst verzehren sie namentlich die saftigen Schenkel, während der weiche Hinterleib mit der riesigen Leber oft verschmäht wird. Kleinere und weichere Beutetiere, wie Fliegen, werden dagegen vollständig durchgekaut und beim Schluß der Mahlzeit die Chelizeren durch kräftiges Aneinanderreiben gereinigt. Selbst den Kampf mit dem wehrhaften Skorpion scheut die Walzenspinne nicht und bleibt dabei infolge ihrer größeren Gewandtheit gewöhnlich Siegerin, obgleich sie keineswegs unempfindlich gegen das Skorpionengift ist und deshalb unterliegen muß, wenn der Gegner sie mit seinem Stachel zu treffen vermochte. Geleitet wird die Walzenspinne bei ihren Jagden durch das Gesicht, das allerdings hauptsächlich auf sich bewegende Gegenstände eingestellt ist, denn solche, denen Heymons die Augen verklebte, vermochten ihre Opfer kaum zu finden und zu erkennen. Auch das Gefühl muß sehr ausgeprägt sein, denn das Haarkleid dieser Tiere ist zu einer großartigen Entfaltung gelangt, spottet aber bei seiner außerordentlichen Formenmannigfaltigkeit und bei dem Vorhandensein aller nur erdenklichen Übergänge jeder systematischen Einteilung und Beschreibung (Abb. 8). Die Geschlechter sind bei den Walzenspinnen oft abweichend gefärbt, was entweder auf verschieden starker Pigmentierung des Chitins oder auf verschiedener Färbung der Haare beruht. Dabei waltet beim Männchen meist die Neigung zu dunklerer, beim Weibchen die zu hellerer Färbung vor. So hat bei Galeodes araneoides, der gewöhnlichsten Art, das Weibchen nur eine dunkle Binde in der Mitte des gelben Hinterleibs, während dieser beim Männchen ganz schwarz ist. Die Mandibeln der Männchen tragen auch noch sekundäre Geschlechtsmerkmale in Gestalt der ungemein verschiedenartigen »Flabelli«, außerdem eine höchst mannigfaltige Bezahnung, Bedornung und Beborstung. Sogar an den Hinterbeinen finden sich noch gestielte Sinnesorgane, die sogen. »Malleoli«, über deren Bedeutung man sich aber ebensowenig klar ist, wie über die der Flabellen.

Abb. 8 Schenkel einer Walzenspinne unten die »Malleoli«
Das Geschlechtsleben ist auch bei diesen Spinnen reich an merkwürdigen Einzelheiten. Das herumschweifende Männchen vermag mit seinen nach oben gerichteten Augen das Weibchen wohl kaum zu erkennen, solange es sich ruhig verhält, bemerkt aber sein Vorhandensein durch das Gefühl infolge der vielen langen Sinneshaare und sicherlich auch durch den Geruch, denn es gerät schon in deutliche Erregung, wenn es noch ein ganzes Stückchen von dem Gegenstande seiner Sehnsucht entfernt ist. Dieser verhält sich zunächst gleichgültig oder nimmt, wie beim Herannahen jedes anderen größeren Tieres, die übliche Abwehrstellung ein. Aber das Männchen, obwohl kleiner und schwächer, läßt ihm nicht viel Zeit dazu, denn es fackelt nicht lange, sondern springt mit einem kühnen Satz auf die Gesponsin los, erwischt sie an der Oberseite des Hinterleibs und kneift nun seine starken, scherenförmigen Chelizeren mit roher Gewalt ihr in die Weichen, so daß man meint, sie müsse empfindlich dabei verletzt werden, was aber nur ausnahmsweise der Fall ist. Dagegen hat dieser kühne Griff in anderer Weise eine geradezu verblüffende Wirkung. Das Weibchen erscheint nämlich dadurch wie gelähmt und muß nun willenlos alles über sich ergehen lassen, was das Männchen mit ihm vornimmt. Es erleidet zweifellos einen starken Nervenschock, der alle Willenstriebe hemmt und alle Abwehrbewegungen lähmt. Die Natur hat hier offenbar, um überhaupt bei solch widerborstigen und unverträglichen Tieren eine Paarung herbeiführen zu können, ihre Zuflucht zu einer Art Hypnose genommen. So vollständig ist diese, daß das Männchen, wenn ihm der Platz zur Hochzeitsfeier nicht geeignet erscheint, das große Weibchen wie einen leblosen Ball hurtigen Laufes oft mehrere Meter weit fortträgt. Zu einer eigentlichen geschlechtlichen Vereinigung kommt es bei den Walzenspinnen ebensowenig wie bei den echten Spinnen, sondern das Männchen muß sich damit begnügen, ein Viertelstündchen lang den spröden Leib der borstigen Jungfer abzutasten und dann seine Samenpakete mit den Chelizeren an die für sie bestimmte Stelle zu bringen. Das geschieht, nachdem vorher die zähe und klebrige Samenmasse ausgestoßen und auf den Boden abgesetzt wurde, in einer so rohen und gewaltsamen, sozusagen überhasteten Weise, daß man unwillkürlich Mitleid mit dem mißhandelten Weibchen empfindet. Zum Schluß kneift der Wüterich noch die weibliche Geschlechtsöffnung brutal zusammen, um ein Zurückgleiten des Samens zu verhüten, und macht sich nun schleunigst aus dem Staube, denn im gleichen Augenblick ist auch der Bann gebrochen und das Weibchen aus seiner Betäubung erwacht, und wenn der Galan infolge seiner längeren Beine und seines schmächtigeren Leibes nicht schon einen tüchtigen Vorsprung erlangt hat, wird sein abgematteter Leib zu einem stärkenden Hochzeitsmahl verwendet. Hat das Männchen das Pech, an ein schon befruchtetes Weibchen zu geraten, so läßt sich dieses seine Annäherung überhaupt nicht gefallen, sondern macht kurzen Prozeß und frißt den Bewerber auf. Es ist also auch hier dafür gesorgt, daß die Bäume nicht in den Himmel wachsen können, und wir sehen immer wieder, wie die Natur viel mehr aus die Erhaltung der Art, als aus die des Individuums bedacht ist.
Zur Eiablage gräbt sich das Weibchen dicht unter der Erdoberfläche eine etwa 20 cm lange und 3 cm breite Röhre, die meist in mehreren Windungen und Krümmungen verläuft. Das ist in dem von der Sommersonne zu einer steinharten Masse ausgedörrten Boden der Lehmsteppe kein leichtes Stück Arbeit, und man muß auch hier wieder die Kraft des Tieres bewundern, das mit seinen Chelizeren die Erdteilchen förmlich herausbeißt und dabei doch so schnell vorwärts kommt, daß es schon nach einer Viertelstunde unter der Erdoberfläche verschwunden ist. Die Eiablage strengt die Spinne ersichtlich viel mehr an, denn sie sitzt danach ganz zusammengeschrumpelt mit eingefallenen Weichen träge und freßunlustig, grau und mißfarbig neben den 80–120 gelblichen, perlmutterglänzenden, etwa 4–5 mm großen Eiern. Im Gegensatz zu den echten Spinnen verhält sich die Mutter hier völlig gleichgültig und wird aus ihrer starren Teilnahmlosigkeit auch nicht aufgerüttelt, wenn die Jungen ausschlüpfen. Dies geschieht nach den Beobachtungen von Heymons merkwürdigerweise schon nach 24 oder spätestens 48 Stunden. Aber die am Hinterleibe noch mit einem Stückchen der glänzenden Eischale bedeckten Jungtiere befinden sich in einem völlig hilflosen Zustande und lassen fast keine Lebensäußerungen erkennen. Das ändert sich erst, wenn sie nach 2–3 Wochen ihre erste Häutung durchgemacht haben, die etwa eine halbe Stunde in Anspruch nimmt und vorn am Kopfbruststück beginnt. Sie vergrößern dabei ihren Leibesumfang um reichlich 2/3, und es ist sehr interessant, daß sich in ihrem ganzen Körper, selbst in den Beinen, kleine Gasbläschen vorfinden, die wohl die Aufgabe haben, eine größere Ausdehnung der zunächst noch weichen Chitinhaut zu ermöglichen.
Nun endlich steigen die Jungen mit langsamen und ungeschickten Bewegungen steifbeinig und unbehilflich genug umher, werden aber bald sicherer und lebhafter und zerstreuen sich dann allmählich in der Umgebung. Dann wimmelt es in der Steppe plötzlich wieder von kleinen Walzenspinnen, während in der heißesten Jahreszeit, wo das Pflanzen- und Tierleben unter dem glühenden Hauch der Sonne fast völlig erstorben und deshalb für alle Geschöpfe Schmalhans Küchenmeister geworden war, auch von den Walzenspinnen fast nichts bemerkt werden konnte. Die Männchen waren ohnedies bald nach der Begattung gestorben, sofern sie nicht schon die Hochzeitsfreuden mit ihrem Leben hatten bezahlen müssen. Die Jungtiere werden im nächsten Frühjahr zu geschlechtsreifen Wesen und häuten sich inzwischen noch mehrmals. Wenn eine solche Häutung sich vorbereitet und der Chitinpanzer sich lockert, verlieren die Hauptwaffen, die Chelizeren, alle Kraft und Schärfe, und auch auf den Beinen könnten die Tiere währenddem kaum in der bisherigen Weise laufen. Sie sind also dann ebenso unbehilflich und wehrlos wie etwa ein Butterkrebs und ziehen sich deshalb in einen stillen Schlupfwinkel zurück, wo sie in eine Art Erstarrungszustand verfallen, den Heymons als Torpor-Stadium oder Häutungsstarre bezeichnet hat. Sie bleiben währenddem so unbeweglich wie eine Schmetterlingspuppe und sitzen wie tot in einer bestimmten Stellung da. Offenbar ist diese Einrichtung für das Tier ganz zweckmäßig. Denn wenn es sich bewegen würde, würde es die Aufmerksamkeit seiner Feinde auf sich ziehen und wäre diesen in seinem unbehilflichen Zustande wehrlos preisgegeben. In seiner starren Leichenruhe aber wird es entweder für tot gehalten und deshalb verschmäht oder entgeht doch viel leichter einer unliebsamen Aufmerksamkeit.
Zu den auffallendsten aller Spinnentiere gehören weiter die Kanker ( Phalangidae), die auch dem Laien wohlbekannt sind und deshalb eine ganze Reihe volkstümlicher Namen führen, wie Weberknecht, Weber, Mähder, Habergeitz, Zimmermann, Holz- und Glückspinne, Schneider, Schuster, Geist und Tod. Ängstliche Gemüter pflegen in helles Entsetzen zu geraten, wenn in der Gartenlaube plötzlich ein solch langbeiniges Spinnentier oben vom Gerüst herab auf den sauber gedeckten Kaffeetisch fällt oder jemandem eilig über die Kleider läuft. Und doch sind gerade die Kanker die friedfertigsten und harmlosesten aller Spinnen und setzen sich nicht einmal dann zur Wehr, wenn die hoffnungsvolle Jugend ihnen die zuckenden Beine Stück für Stück aus dem Leibe reißt, um dann diesen zu verzehren, von dem die Buben hoch und teuer versichern, er schmecke wie süße Nuß. Die Kanker gehören aber ebensowenig wie die Walzenspinnen zu den echten Spinnen, da sie gleichfalls keine Gewebe verfertigen und auch sonst in mancherlei Beziehung abweichen. Die Natur hat sie etwas stiefmütterlich ausgestattet, denn sie besitzen nur zwei Atemöffnungen an den Hüften der Hinterbeine und auch nur zwei Augen, die in der Mitte des Kopfbruststückes auf einer höckerigen Erhöhung sitzen. Auffallend sind an den Weberknechten aber vor allem ihre geradezu unwahrscheinlich langen und dünnen Beine, denen gegenüber der rundliche und oft mit Dornen besetzte Leib fast winzig erscheint, indem er z.B. bei dem gewöhnlichen Hauskanker ( Opilio parientinus) kaum 5 mm mißt. Die Beine brechen im Hüftgelenk sehr leicht ab und vollführen dann noch lange Zeit hindurch krampfhaft zuckende Bewegungen. Zweifellos haben wir darin ein Schutzmittel des Tieres zu erblicken, das mit dem bekannten Schwanzabwerfen unserer Eidechsen in eine Reihe gestellt werden kann. Die langen Beine bieten ja jedem Gegner eine ausgedehnte, durch nichts zu verteidigende Angriffsfläche, und deshalb ist es besser, das Tier rettet sein Dasein dadurch, daß es das bedrohte Glied durch einfaches Abwerfen opfert und, während der Feind noch mit diesem beschäftigt ist, auf seinen übrigen sieben Beinen sich schleunigst aus dem Staube macht, geradeso wie die Eidechsen ihren langen Schwanz dem Gegner überlassen, damit durch seine tanzenden Bewegungen die Aufmerksamkeit von ihnen selbst abgelenkt werde. Doch besitzen die Weberknechte nicht das großartige Regenerationsvermögen der Eidechsen und namentlich der Krabben, die das in Verlust geratene Glied immer wieder zu ersetzen vermögen. Immerhin ist nach meinen Erfahrungen das Wiedererzeugungsvermögen der Spinnen doch nicht so gering, wie es von anderen Forschern hingestellt wird. Junge Spinnen wenigstens vermögen das verlorene Bein bei der nächsten Häutung so ziemlich wieder zu ersetzen, vorausgesetzt, daß sie sich in guten Ernährungsverhältnissen befinden. Je älter aber das Tier wird, desto unvollkommener fällt der Ersatz aus und hört schließlich ganz auf. Mundteile und Augen werden nie ersetzt, wenn auch die Wunden sehr gut zu verheilen pflegen. Ein anderes Schutzmittel der Weberknechte besteht darin, daß sie sich, an der Wand sitzend, beim geringsten Anzeichen von Gefahr zu Boden fallen lassen, wobei sie wie die Katzen, immer auf die Füße zu stehen kommen. Für gewöhnlich ist der kleine Leib durch das Gewirr der langstieligen Beine ja ohnedies schon gegen ein rasches Zufassen geschützt, und sowie das Tier an seinen Füßen eine Belästigung merkt, läuft es sofort mit großen, hastigen Schritten nach der anderen Seite davon, wobei der Körper in Wellenlinien auf- und niederbewegt wird.
Die Weberknechte, die von den Tierkundigen als Afterspinnen von den echten Spinnen unterschieden werden, weichen von diesen auch hinsichtlich der Nahrung sehr ab, denn sie sind keine Raubtiere, sondern Aasfresser. Zwar wird in den meisten älteren Werken und auch in »Brehms Tierleben« angegeben, daß sie sich wie die Wolf- und Hüpfspinnen mit katzenartigen Sprüngen auf kleine Kerfe stürzen, ja, sie werden sogar als hochnützliche Vertilger der schädlichen Fichtenläuse und von allerlei Milbengeschmeiß gepriesen, aber neuere Beobachtungen haben dies durchaus nicht bestätigt, sondern vielmehr gezeigt, daß die Kanker höchst schüchterne und furchtsame Geschöpfe sind und schon der kleinsten Fliege oder Mücke ängstlich aus dem Wege gehen. Ihre schwachen Chelizeren wären auch gar nicht imstande, die zähe und dicke Milbenhaut zu durchbeißen, besitzen überdies keinerlei Giftdrüsen und können deshalb nur zum Aufgreifen und Fortschaffen der Nahrung verwendet werden. Diese besteht ausschließlich aus kleinen Tierleichen, bei manchen Arten auch aus vermodernden Pflanzenstoffen. Wohl sieht man häufig Milben an ihren Beinen sitzen, aber dann handelt es sich nicht um Beutetiere, sondern um lästige Schmarotzer, die den armen Ranker arg quälen. Solange eine Fliege nur noch ein Bein rührt, wagt sich dieser nicht an sie heran. Dagegen kann man auf stillen Wald- und Wiesenpfaden häufig beobachten, wie die Weberknechte zertretene Fliegen fortschaffen, um sie irgendwo in Ruhe aussaugen zu können. Gefangene Ranker lassen sich außer mit zerdrückten Fliegen, Ameisen und Blattläusen sehr gut auch mit gekochtem Reis, eingeweichtem Weißbrot, geschabtem Obst, geriebenen Möhren und dgl. füttern und fressen, nach Menges Versicherung, am allerliebsten gekochte Bohnen. Nur dürfen an all diesen guten Dingen nicht etwa schon Schimmelpilze sich angesetzt haben. Beim Fressen gehen die Chelizeren wie ein paar Hämmer abwechselnd auf und nieder, und im gleichen Rhythmus öffnen und schließen sich die Scheren an ihren Enden, offenbar zu dem Zwecke, um aus den ergriffenen Nahrungsmitteln die ernährende Flüssigkeit auszupressen, die dann mit Hilfe einer besonderen Saugvorrichtung dem Verdauungskanal zugeführt wird. Doch bewältigen die Weberknechte auch ganze Muskelmassen, und im Einklang damit steht, daß ihre Exkremente fest und walzenförmig sind, nicht flüssig, wie bei den echten Spinnen. Beim Trinken strecken die Kanker die Beine lang von sich und drücken den Leib bis zur Wasseroberfläche herab. Henking fand einmal Blätter, die infolge anhaltender Trockenheit stark verstaubt waren, aber doch auf ihrer Oberfläche kleine, glänzende, feucht und klebrig erscheinende Flecke hatten, die von einem Blattlausstich oder irgendeiner Blattausschwitzung herrühren mochten. Auf solche Stellen nun senkten die Weberknechte ihren Leib nieder und hoben das Hinterteil in die Höhe, als ob sie die Mundöffnung möglichst nahe heranbringen wollten, und schienen von der Materie zu lecken. Auch die Kanker sind Nachttiere und kommen aus ihren Schlupfwinkeln, am liebsten etwas feuchten Hohlräumen, meist erst mit Einbruch der Dunkelheit zum Vorschein und rennen dann geschäftig hin und her. Doch sieht man sie nicht selten auch bei Tage auf Baumblättern ein Sonnenbad nehmen, wobei sie die dünnen Beine in ihrer ganzen Länge nach vorn und hinten ausstrecken und den Leib niedergedrückt halten. Sie sind dann ganz schlaftrunken und ergreifen erst die Flucht, wenn man sie mit dem Finger berührt, springen aber auch nur zögernd von Blatt zu Blatt und gehen sobald als möglich wieder in die geschilderte Ruhestellung über. Bisweilen werden die Beine zur Reinigung auch gemächlich durch die Kiefer gezogen, was aber bei ihrer Länge und großen Zahl eins recht zeitraubende Arbeit ist.
Die grimmige Unverträglichkeit der echten Spinnen ist den Kankern fremd, denn auch untereinander sind sie durchaus friedfertig und gemütlich. Begegnen sich zwei, so gibt es ein gegenseitiges Beklopfen und Betasten, aber dann zieht ruhig jeder wieder seines Weges. Ja, man sieht sie oft sogar gemeinsam fressen, wobei sie sich so eng aneinanderdrängen, daß die langen Beine sich gegenseitig verwirren. Das Gefühl scheint bei ihnen hauptsächlich im zweiten Beinpaar zu liegen, mit dem sie beim Lausen fortwährend in der Luft herumfuchteln und richtige Ellipsen beschreiben, um jeden unangenehmen Gegenstand rechtzeitig signalisiert zu bekommen. Von den echten Spinnen werden sie ohne weiteres aufgefressen, da sie ja keine Waffen haben, sich gegen diese Räuber zu verteidigen. Gerät ein gewöhnlicher Kanker in ein Spinnennetz, so wird er von dessen Besitzerin trotz der langen Beine sofort umsponnen, nur daß die Netzspinne ab und zu erschrocken zurückfährt, wenn diese Riesenbeine immer und immer wieder in zuckende Bewegung verfallen. Es gibt aber doch in der Gattung Platylophus, zu der z. B. der auf Nadelbäumen lebende und durch seine weiße Färbung sofort kenntliche Tannenkanker ( Platylophus pinetorum) gehört, auch Arten, die mit Netzspinnen in Tischgenossenschaft leben. So fand Heller den Platylophus corniger fast stets auf Spinnennetzen, wo er sich an den Überresten der Spinnenmahlzeiten gütlich tat. Setzte der Beobachter versuchsweise einen solchen kleinen Kanker in ein Spinnennetz, so stürzte die Spinne zwar schleunigst hervor, zog sich aber sofort wieder zurück, ohne dem unfreiwilligen Gaste etwas zuleide zu tun.
Aus dem Gesagten läßt sich leicht mutmaßen, daß die Hochzeitsfeier für die Kankermännchen keine so gefährliche Sache ist wie bei den echten Spinnen. Zwar raufen die Männchen untereinander, zerren sich hin und her und schütteln sich in ihrer Eifersucht gegenseitig gehörig ab, aber diese Turniere sind doch recht harmloser Art, und nur ausnahmsweise kommt einer der Kämpen dabei zu Schaden. Die Begattung wird in aufrechter Stellung vollzogen, und merkwürdig ist nur, daß der in eine Scheide gehüllte Penis des Männchens fast ebenso lang ist, wie sein ganzer Körper, während die äußerst biegsame und elastische Legeröhre des Weibchens sogar dessen zwei- bis dreifache Länge erreicht. Die gespaltene und mit seinen Borsten besetzte Ausmündung dieser Legeröhre muß ein ungemein empfindliches Instrument sein. Das Weibchen führt mit dieser Legeröhre im lockeren, aber nicht etwa feuchten und klebrigen Erdreich hin und her, bis es tastend einen geeigneten Hohlraum zum Eindringen gefunden hat, und senkt nun die Legeröhre so weit als möglich ein, gleichzeitig den Körper herabdrückend (Abb. 9). Hat man bei der Beobachtung Glück, so kann man die undurchsichtigen weißen
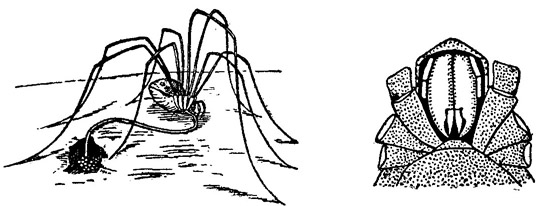
|
|
|
Abb. 9. Kankerweibchen, eierlegend. |
Abb. 10. Wanzenkanker. (Kopfstück in starker Vergrößerung). |
Tierchen wie Perlen auf einer Schnur in der Legeröhre hinabgleiten sehen. In dieser haben sie noch ellipsoide Gestalt, nehmen aber gleich beim Austreten die Kugelform an. Während die alten Kanker mit Einbruch des Winters absterben, nachdem ihre Bewegungen nach und nach immer träger und matter geworden sind, zeigen sich die Eier wenig frostempfindlich und können deshalb ohne Schaden den Winter in der Erde überstehen. Allerdings geht ihre Entwicklung währenddem sehr langsam vor sich, und makroskopisch ist von einer solchen überhaupt erst nach etwa 150 Tagen etwas zu bemerken, wenn die dunklen Augen anfangen durchzuschimmern. Im ganzen vergeht von der im Herbst erfolgenden Ablage der Eier bis zu ihrem Ausschlüpfen im Frühjahr ziemlich genau ein halbes Jahr. Im Ei liegen die jungen Weberknechte natürlich sehr beengt, namentlich die langen Reine, mit denen sie förmlich sich selbst umarmen müssen. Wenn sie daher die Eihülle endlich gesprengt haben, wobei ein am Kopfstück befindlicher Eizahn mithelfen muß, so wissen sie zunächst mit ihren langen Gliedmaßen gar nichts Rechtes anzufangen, denn diese waren ja so lange Zeit hindurch auf engstem Raume zusammengerollt und müssen erst lernen, sich zu strecken. Die jungen Kanker liegen deshalb zunächst fast regungslos da, als wollten sie dieser schnöden Welt schon wieder Lebewohl sagen, nachdem sie kaum das Licht des irdischen Jammertals erblickt haben. Aber wie der dem Schoß der Erde entsteigende Bergmann sein schmutziges Gewand abstreift, so auch der Kanker alsbald seine erste Leibeshülle, die ohnedies beim Herausarbeiten aus dem Erdreich unansehnlich und schadhaft geworden ist. Mit lang ausgebreiteten Beinhülsen bleibt sie nach erfolgter Häutung liegen, während Junker Weberknecht mit seinen kohlschwarzen Funkelaugen und seinem schneeweißen Gewand in ein recht munteres Bürschlein sich verwandelt hat und alsbald auf Abenteuer auszieht, um den Kampf ums Dasein zu bestehen. Erst allmählich bekommen die Tierchen dann die unansehnliche Färbung der Alten. Bis zur Geschlechtsreife müssen sie fünf bis zehn Häutungen durchmachen, und es erscheint bemerkenswert, daß dabei auch die Linse der Augen mit abgeworfen wird, wie Henking festgestellt hat. Auf mikroskopischen Schnitten kann man nämlich gelegentlich bemerken, daß unter der gelockerten alten Linse bereits Material für die neue abgeschieden ist. Diese zukünftige neue Linse ist aber nicht etwa nach außen vorgewölbt, sondern zeigt im Gegenteil eine grubenförmige Vertiefung, die der gekrümmten Unterseite der alten Linse entspricht, hieraus folgt einerseits, daß das neue Linsenmaterial weich sein muß, damit es sich nach dem Abwerfen der alten Linse vorkrümmen kann, und andererseits, daß der Kanker während oder kurz nach der Häutung eine Zeitspanne fast völliger Blindheit durchzumachen hat, die so lange anhält, bis die Linse wieder ihre normale Form angenommen hat.
So sind die Weberknechte, die als Überreste einer alten Tierordnung eigentlich gar nicht mehr recht in die heutige Zeit passen wollen, nicht nur auffallende, sondern in vieler Beziehung auch recht interessante Tiere. Wenn wir von den Trilobiten absehen, stellen sie heute die ältesten Vertreter der Gliedertiere vor, denn ihre Reste finden sich schon im Jura von Solnhofen, in den Gipsen von Aix und ganz besonders im Bernstein. Haeckel sieht in ihnen den Überrest jenes alten Solifugenastes, aus dem die echten Spinnen sich entwickelten. viele Arten erscheinen trotz ihres zarten und zerbrechlichen Aussehens außerordentlich wetterhart. So lebt der Eiskanker ( Opilio glacialis) vergnüglich in der unwirtlichen Gletscherregion der Schweiz, wo man ihn schon in 3344 m Meereshöhe aufgefunden hat. Ganz abweichend sieht die Gruppe der Wanzerkanker ( Trogulidae) aus, deren wanzenartige Gestalt mit dem hochbeinigen Weberknecht kaum noch etwas gemein hat (Abb. 10).
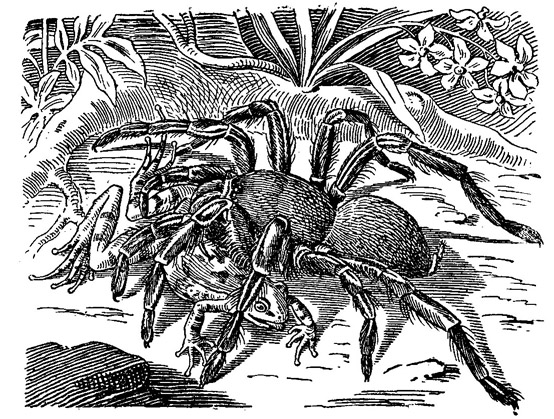
Abb. 11. Vogelspinne.
Die Haut dieser Tiere ist nämlich mit zahlreichen kleinen Höckerchen besetzt, und aus ihnen schwitzt ein klebriges Drüsensekret aus, an dem natürlich stets Bodenbestandteile haften bleiben. Dadurch paßt sich das seltsame Wesen in höchster Vollkommenheit der Farbe seiner Umgebung an und erscheint vortrefflich geschützt. Aber die Mundteile müssen vor der allgemeinen Verstaubung reingehalten werden und befinden sich deshalb, eng aneinandergelegt, im sauberen Innenraum eines merkwürdig gestalteten Kopfschildes, der sogen. Kapuze. Becker berichtet, daß er diese Tierchen, die sich hauptsächlich von modernden Pflanzenstoffen ernähren, drei Jahre lang in der Gefangenschaft gehalten habe, wonach sie sich also von allen anderen Kankern unterscheiden würden, die in jedem Herbste absterben, demnach nur ein Alter von 6-8 Monaten erreichen.
Millimetergroße Zwerge finden sich im Spinnenreiche genug, aber eigentliche Riesen hat es unter den Landspinnen nie gegeben; doch erreichen ihre größten Vertreter, die tropischen Vogelspinnen ( Mygale)(Abb. 11), immerhin eine Körperlänge von 5 und eine Gesamtlänge von 18 cm und sehen mit ihrem feisten schwarzen Leib, den dicken Beinen und der rauhborstigen, fuchs- oder braunroten Behaarung unheimlich genug aus. Sie sind jedoch nicht giftig, und ihr Biß vermag zwar vorübergehende örtliche Entzündungen hervorzurufen, tut aber sonst keinerlei Schaden. Ihren Namen haben sie deshalb erhalten, weil man früher glaubte, daß sie sich hauptsächlich von kleinen Vögeln ernähren, und in phantasievollen Naturgeschichtsbüchern sind sogar die aus dicken Fäden bestehenden Riesennetze solcher Spinnen abgebildet, in denen arme, farbenschimmernde Kolibris sich zu Tode flattern. Die Sache stimmt aber schon insofern nicht, als die Vogelspinnen ebensowenig wie die Kanker imstande sind, Fangnetze herzustellen. Sie leben vielmehr in Mauerlöchern, an Hauswänden, unter Steinen und dgl. oder graben sich selbst Wohnröhren von ½ bis ¾ m Tiefe und 5 cm Durchmesser, hausen also an Örtlichkeiten, wo sie schwerlich mit der lichtliebenden Vogelwelt in Berührung kommen werden, zumal sie ausgesprochene Nachttiere sind und sehr schlecht sehen. Bei alledem soll jedoch nicht geleugnet werden, daß sie gelegentlich wohl auch einmal ein hilfloses Jungvögelchen verspeisen, wenn es ihnen bei ihren Streifzügen gerade aufstößt oder sich im Schlafe überraschen läßt. Menges zahme Vogelspinne zerkaute z.B. einen Frosch mit Haut und Knochen zu Brei und verschluckte ihn, gab aber später die Knöchelchen in einer Art Gewölle wieder von sich. Sieht sich die Vogelspinne bedroht, so setzt sie sich mit erhobenem Vorderkörper in Verteidigungsstellung und bringt durch Aneinanderreiben gewisser kleiner Stacheln einen sonderbaren Ton hervor, wie wenn man mit einem Messerrücken über die Zähne eines Kammes fährt. Die eigentliche Vogelspinne ( Mygale avicularia) ist in Südamerika zu Hause, aber eine verwandte von ihr lebt in den Vereinigten Staaten und ist gleichfalls ein schlecht sehendes Nachttier, bei dem der Tastsinn die Hauptrolle spielt. Eigentümlich ist es, daß das Männchen, ehe es sich auf die Suche nach einem Weibchen begibt, im Freien bei Tageslicht ein schiefgeneigtes, festes Netz anfertigt, das sogen. Spermanetz, aus dessen Oberseite es einen etwa ½ ccm großen Spermatropfen absetzt. Dann begibt es sich unter das Netz, hält seine Palpen (Fühler) unter den Spermatropfen und saugt diesen innerhalb 1–2 Stunden in die Palpen ein. Nun erst wird es brünstig, verläßt sein Spermanetz und wandert unruhig umher, bis es mit den langen Vorderbeinen an ein Weibchen stößt. Die Werbung um die Gunst der Schönen besteht darin, daß das Männchen ihr mit den vier Vorderbeinen eifrig auf dem Körper herumtrommelt und dabei immer näher rückt. Die Erkorene verhält sich zunächst spröde, nimmt die Abwehrstellung ein und öffnet drohend die Chelizeren, die aber vom Männchen sofort mit den eigentümlichen Haken an den Vorderbeinen erfaßt werden. Diese Haken sind also eine Einrichtung zum Ergreifen der Weibchen und gleichzeitig ein Schutz des Männchens gegen die gefährlichen Beißwerkzeuge der stärkeren Gesponsin. Nun zwingt das Männchen unter heftigem Herumtrommeln auf der Brust den Vorderkörper des Weibchens gewaltsam zurück, und damit hört jeder Widerstand der Holden auf, deren sämtliche Körpermuskeln plötzlich derart erschlaffen, daß die Beine lang hinter dem Leibe herschleifen. Wir haben also auch hier wieder eine Art Hypnose zur Ermöglichung der Befruchtung vor uns.
Zu den bei uns häufigsten Spinnenformen zählen die kleinen Krabbenspinnen, die nächst den Wolfspinnen am meisten zur Bildung der Sommerfäden beitragen, und deren hintere Beinpaare erheblich kürzer sind als die vorderen. Ihren Namen haben diese Tiere von ihrem gedrungenen Aussehen wie auch davon, daß sie, wie die Krabben, mit gleicher Hurtigkeit vor-, rück- und seitwärts laufen können. In der Ruhe strecken sie sämtliche Beine lang aus und drücken den Leib fest gegen die Unterlage. Man findet unter ihnen mancherlei recht abenteuerlich gestaltete Formen, die durch dornartige Höcker, blasenartige Auftreibungen, plattenartige Verbreiterung und Verflachung des Hinterleibes und allerlei Anhängsel an den Beinen so seltsam verändert sind, daß man sie kaum noch als Spinnen zu erkennen vermag. Gewöhnlich hat diese absonderliche Gestalt den Zweck irgendwelcher Maskierung zum Schutze gegen Feinde oder zum leichteren Erhaschen der Beutetiere, und die Krabbenspinnen, die sich gern in Astwinkel oder ähnliche Hinterhalte drücken, wissen von diesem Vorteil auch sehr wohl Gebrauch zu machen, viele Arten sitzen z.B. mit Vorliebe an der Unterseite von Blüten, die ja gern von allerlei Insekten besucht werden, und lauern hier geduldig auf ein Opfer. Läßt sich ein solches nektarsuchend auf der Blüte nieder, so greifen plötzlich die langen, mörderischen Vorderbeine der tückischen Spinne um die Blütenblätter herum nach ihm, und ein Biß ins Genick macht bald allen weiteren Raufereien ein Ende. Sogar die blütenbesuchenden Bienen und Wespen werden von den Krabbenspinnen überwältigt, denn sie sind zu diesem Zwecke an den kräftigen Vorderbeinen auch noch mit spitzen Stacheln ausgerüstet und wissen damit ihr Opfer so fest und sicher zu umarmen, daß der Giftstachel der Biene ins Leere sticht, ohne den unheimlichen Gegner zu treffen. Eine der bekanntesten Arten ist Thomisus virescens, die sich auf den Blütensträußen der Schafgarbe aufzuhalten pflegt. Lebhafte Färbung und Anpassung derselben an die Unterlage finden wir gerade bei Krabbenspinnen sehr häufig. So gibt es am Strande der Ostsee Arten, die genau die Färbung des Meeressandes oder der Kiesel haben. Bei anderen, die an den gleichen Örtlichkeiten leben, ist dies allerdings nicht der Fall, aber sie halten sich auch nicht auf dem freien Strande auf, sondern sie leben unter und zwischen den von der Brandung angespülten Meeresalgen und Tangmassen, wo sie eine Schutzfärbung nicht nötig haben. Im sonnendurchschimmerten Kiesgeröll der Fluß- und Bachbetten leben derb gesprenkelte Arten oder auch metallisch schimmernde Hüpfspinnen, die in keiner Weise auffallen, solange sie sich ruhig verhalten.
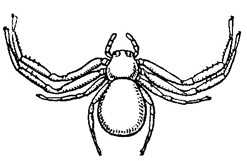
Abb. 12. Misumena calycina
Sehr schön ausgeprägt finden wir die Schutzfärbung bei solchen Spring- und Krabbenspinnen, die an alten Baumstämmen ihrer Nahrung nachgehen und deren Zeichnung haargenau diejenige der Baumrinde nachahmt, wie z.B. bei der einheimischen Philodromus poecilus, die sich auf rissigen Obstbäumen in den Gärten herumtreibt. Dagegen haben die auf Bretterplanken lebenden Spinnen die schwarzgraue Färbung alter, verwitterte Umzäunungen. Die Zebraspinne mit ihrer scharfen, schwarzweißen Streifung auf dem Hinterleib und an den Beinen würde an sich sehr auffallen, wenn sie nicht, wie dies ihre Gewohnheit ist, ruhig auf schwarzweiß gebändeltem Granitgestein säße, wo sie vollständig in ihrer Umgebung verschwimmt. In der Farbenflut blühender Wiesen verschwinden sowohl die grünen Weibchen wie die gelben, mit einem roten Längsstreif gezierten Männchen der Micrommata virescens vollständig. Die allerschönsten Anpassungen haben solche Arten aufzuweisen, die auf Blüten leben. So sitzt auf roten Rosen sehr gern eine Krabbenspinne, die 6 mm große Thomisus globosus, schön rosenrot gefärbt mit purpurrot gezackten Rückenstreifen, also ganz und gar nicht von ihrer Unterlage sich abhebend. Eine andere Art, Misumena calycina (Abb. 12), lebt teils auf weißen, teils auf gelben Blüten und ist z.B. auf Holunder elfenbeinweiß, auf Raps dagegen gelb. Ja, sie vermag sogar ihre Färbung abzuändern, denn wenn man eine weiße Spinne dieser Art etwa auf eine Sonnenblume setzt, so wird sie nach 2–3 Tagen gelb: also das richtige Spinnen-Chamäleon! Selbst unsere Kreuzspinne besitzt in bescheidenem Maße dieses Farbenanpassungsvermögen, indem sie auf Planken und Felsen in der Regel überwiegend grau, an Pflanzen gelbbraun wie dürres Laub und an den jungen Trieben der Nadelhölzer lebhaft zimtfarbig erscheint wie diese selbst.
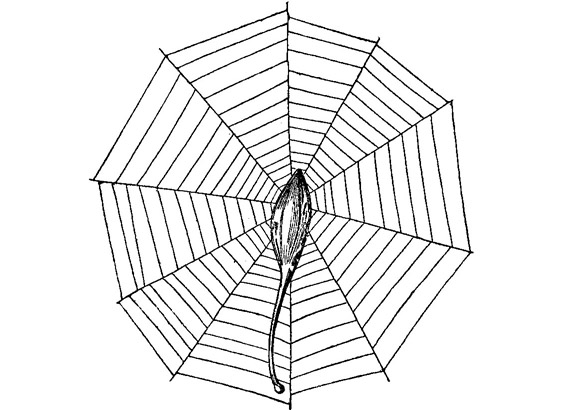
Abb. 13. Poltys-Art aus Sumatra.
In noch viel großartigerem Maße finden sich solche Anpassungen in den Tropen, namentlich bei Angehörigen der Gattung Poltys (Abb. 13). Die hier abgebildete Art stammt aus Sumatra und konnte meines Wissens noch nicht näher bestimmt werden, da das Tier seiner vorzüglichen Maske wegen eben nur höchst selten einmal aufgefunden wird. Wessen Augen sind auch scharf genug, um inmitten der üppigen Urwaldvegetation mit ihrer eigentümlichen Beleuchtung und allen nur erdenklichen Abstufungen von Grün, die das Auge blenden und verwirren, das Wahre vom Falschen zu unterscheiden und unter dieser Schutzmaske, in dieser wundervoll getreuen Nachahmung einer Blattknospe die Spinne zu erkennen? Der Entdecker des Tieres wurde auf seinem täglichen Wege öfters durch ein Spinnennetz belästigt und sah in der Mitte desselben einen Körper hängen, der vollständig einem in das Netz zufällig hineingewehten Blatt glich. Es sah aus, als ob aus der Blattoberfläche einige kleine Rostflecken sich befänden, und als ob der Blattstiel schon etwas welk, dürr und braun wäre. Als nun der Beobachter einmal, ohne sich etwas dabei zu denken, das Blättchen beim Stiel ergriff, wurde es plötzlich lebendig, auf seiner Rückseite kamen braune, krabbelnde Spinnenbeine zum Vorschein, die eiligst zu entfliehen trachteten, denn das vermeintliche Blättchen war die Spinne selbst. Eine andere Art dieser Gattung ist in Natal heimisch und gleicht täuschend einer Leuchtzikade. Eine dritte, nur 5 mm lange Form ist von dunklerer Färbung und ahmt den darzustellenden Gegenstand durch ein besonderes Gewebe in ihrem Netze nach, das im niedrigen Strauchwerk ausgespannt und äußerst fein ist. Man erblickt in ihm einen anscheinend gefangenen kleinen Schmetterling, eine weiße Motte, die fast durchsichtig zarten Flügel auf 30–35 mm ausgebreitet. Erst bei sehr genauem Hinsehen erkennt man, daß dieses Gebilde von der Spinne selbst wie eine seine Stickerei aufgetragen ist, während die Künstlerin in der Mitte sitzt und gewissermaßen den Rumpf des dargestellten Schmetterlings bildet. Dieses wundervolle Truggebilde wird von der Spinne an jedem Morgen nach Sonnenaufgang neu angefertigt, wozu kaum 10 Minuten fleißiger Arbeit nötig sind. Am Abend rollt die Künstlerin ihre Stickerei wieder zusammen, und angeblich soll sie statt des Schmetterlings ab und zu auch einmal eine Raupe ausstellen (?).
Ebenso wunderbar muß eine andere Art von Mimikry erscheinen, bei der die Spinnen das Aussehen von Vogelkot nachahmen. Der englische Naturforscher Forbes verfolgte einmal auf Java einen seltenen Schmetterling und sah ihn schließlich auf einem Häufchen Vogelmist an einem Baumblatt sich niederlassen. Als er ihn aber hier ergreifen wollte, zerriß zu seiner Überraschung der Schmetterling, und ein Teil seines Körpers blieb anscheinend an dem Exkrement kleben. Um sich von dessen Klebrigkeit zu überzeugen, berührte Korbes es mit den Fingerspitzen und fand nun zu seinem grenzenlosen, aber freudigen Erstaunen, daß das geschulte Forscherauge ihn vollkommen getäuscht hatte, und daß der vermeintliche Vogelkot in Wirklichkeit eine Spinne war. Das Aussehen solcher Vogelexkremente ist ja bekannt genug: in der Mitte eine dichtere kalkweiße Masse, durchsetzt von schwarzen Streifen, umgeben von einem dünnen und mehr flüssigen weißen Rande, der gewöhnlich noch ein Stück am Blatt herunterläuft. Die Spinne ( Phrynarachne rothschildi) (Abb. 14) gehörte zur Familie der Thomisiden mit dickem, warzigem Körper und verbreitertem Hinterleib und war größtenteils kalkweiß, teilweise aber auch kohlschwarz gefärbt. Sie hatte sich nun auf der Oberseite des Blattes ein feines Häufchen von Spinnfäden angelegt, das in einen Streifen auslief, und selbst in seiner Mitte Platz genommen, stellte also hier mit ihrer schwarzweißen Färbung den dickeren Mittelteil des Exkrementes vor, während das umgebende dünne Gewebe den flüssigen Teil vortäuschte. So konnte sie unter dieser großartigen Maske sich wohl vor allen Feinden geborgen fühlen und ihrerseits geduldig auf ein Opfer warten.

Abb. 14. Vogelkotspinne.
Die Netzspinnen sind ja im allgemeinen von mehr unansehnlicher Färbung, die ihnen aber auch zustatten kommt, wenn sie sich bei Gefahr sofort auf den Boden herabfallen lassen. Immerhin wissen auch sie manchmal recht täuschende Masken anzufertigen. So gibt es eine bei uns häufige Art, Cyclosa conica, die sich aus dürren Pflanzenteilen und ausgesogenen Insektenleichen eine Art Hülse zusammenspinnt, in deren Mitte an einem freigebliebenen Plätzchen die Spinne selbst sitzt, mit ihrem dunklen, höckerigen und regungslosen Körper auch für das schärfste Äuge unsichtbar. Die Kürbisspinne ( Aranea cucurbitana) hängt ihr kleines Radnetz an sonnigen Zweigspitzen auf, und an solchen Plätzen kommt ihr ihre Ähnlichkeit mit einer grünen Blattknospe sehr zu statten. Die grüne Diaeadorsata hat einen braunen Klecks auf der Mitte des Hinterleibs und gleicht so einem rostfleckigen Blatt, wodurch die Fliegen zu ihrem Verderben getäuscht werden, die mit Vorliebe auf solchen Blattstellen sich niederlassen. Spinnenarten mit sehr langen Beinen und schmächtigem Leib sitzen oft so, daß sie »alle achte« lang von sich strecken und ähneln dann in hohem Maße einem dürren Zweiglein oder Grashalm, zumal auch ihre Färbung eine entsprechende zu sein pflegt, wie dies bei vielen Arten der einheimischen Gattung Tetragnatha (Abb. 16) der Fall ist. Als eine durchgängige Regel dürfen wir noch feststellen, daß die durch Schutzfärbung oder Mimikry bevorzugten Spinnenarten eine wesentlich geringere Eierzahl erzeugen als die weniger geschützten Formen. Die Natur ist eben immer bemüht, ausgleichend zu wirken.
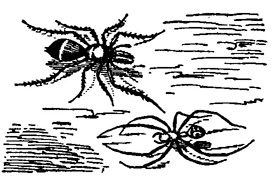
Abb. 15. Ameisenspinnen.
Ameisen werden bekanntlich ihrer scharfen Körpersäfte wegen von vielen Insektenfressern als Nahrungsmittel verschmäht, und infolgedessen muß es natürlich für andere Kleintiere von Vorteil sein, wenn sie solchen Ameisen ähnlich sehen. Dies trifft nun auch für verschiedene Spinnenarten zu, die einen entsprechend langgestreckten Körper haben und bei denen die Leibeseinschnitte der Ameisen zwar nicht vorhanden sind, wohl aber durch die Zeichnung und Schattierung vorgetäuscht werden. Dahl erwähnt z.B. eine orientalische Krabbenspinne, die der dort sehr häufigen Papierameise zum Verwechseln ähnlich sieht, nur daß die Reihenfolge der Körperteile umgekehrt ist, indem die Augen der Ameise durch zwei dunkle Flecken am Hinterleib der Spinne dargestellt werden (Abb. 15). Eine an den Uferfelsen Neuseelands lebende Spinne ist dagegen den Fliegen nachgebildet, und es ist klar, daß sie unter einer solchen Maske ihren Opfern mit größter Aussicht aus Erfolg sich nähern kann. Ja, die Ähnlichkeit erstreckt sich sogar auf die Bewegungen, denn diese Spinnen reiben ihre Palpen in derselben eigentümlichen Weise gegeneinander wie die Fliegen ihre Vorderfüße, also geradeso wie ein Schacherfritze vergnüglich seine Hände, wenn er ein gutes Geschäft gemacht hat. Weiter ist eine Springspinne ( Ballus depressus) bekannt, die einem harmlosen Rüsselkäfer gleicht, mit dem sie auf denselben Sträuchern lebt, und Herman führt aus Ungarn eine andere Springspinne ( Salticus formicarius) an, die einem dort vorkommenden Käfer aus der Gattung Paederus ähnelt. Aber nicht nur Mimikry und Schutzfärbung finden sich im Spinnenreiche, sondern auch Warn- und Trutzfarben, die den Gegner aus die Ungenießbarkeit oder Gefährlichkeit der betreffenden Spinne aufmerksam machen sollen. So darf man wohl die tiefroten Flecke auf dem schwarzen Körper der Malmignatten als solche Warnungszeichen auffassen. Nicht selten stehen die Trutzfarben auf der Unterseite, kommen also erst zum Vorschein, wenn das Tier sich drohend zur Schreckstellung aufrichtet und dabei seine Giftklauen zeigt. Bisweilen bestehen die Warnzeichen nicht in leuchtenden Farben, sondern in abenteuerlich geformten Dornen und Höckern oder in riesig verlängerten Stacheln. So erinnert z.B. die tropische Gasterocantha arcuata mit ihren mächtigen Hörnern (Abb. 17), die allerdings nicht nach vorn, sondern nach hinten weisen, eher an einen Hirsch- oder Bockkäfer als an eine Spinne. Solche Arten sind gewöhnlich auf dem mehr oder minder verbreiterten Hinterleib hart gepanzert und liefern aus diesem Grunde keinen schmackhaften und leicht verdaulichen Bissen. In der Regel sind die Spinnen auf der Unterseite lichter gefärbt als auf der Oberseite, und Dahl hat nachgewiesen, daß dies nicht nur eine Wirkung der Beleuchtung ist, sondern auch einen schützenden Zweck hat, indem dadurch das reliefartige Hervortreten des Tieres auf dem Untergrunde erheblich vermindert wird, es also flacher erscheint und demgemäß leichter übersehen wird. Die scheinbare Ausnahme, die die einheimische Gattung Liyphia macht, bestätigt nur die Regel, denn diese Tiere sitzen unter ihren baldachinartig über den Boden gespannten Netzen mit der Rückenseite nach unten und mit der Bauchseite nach oben. Bei ihnen muß daher die Farbenabtönung gerade umgekehrt sein, wenn sie sie vor dem Späherblick ihrer Feinde schützen soll.
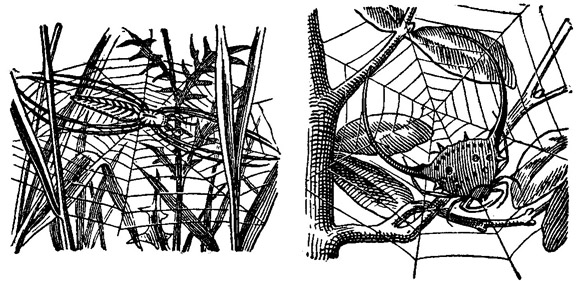
|
|
|
Abb. 16. Tetragnatha. |
Abb. 17 Gasterocantha |
In der interessanten Gruppe der Springspinnen finden wir auch Schmuckfarben, die zur Paarungszeit eine große Rolle spielen und darauf hinweisen, daß das Sehvermögen dieser Tiere ein besseres sein muß, als bei anderen Spinnen. In der Tat ist dies der Fall, denn die Springspinnen sind mit ungewöhnlich großen Augen ausgerüstet, mit denen sie auf ziemliche Entfernung gut zu sehen vermögen, ja sogar ein gewisser Farbensinn ist ihnen sicherlich eigen. Bald trägt der Vorder-, bald der Hinterkörper die auffallenden Schmuckfarben, und entsprechend wird bei den Balzstellungen bald diese, bald jene Seite dem Weibchen zugewandt, um die Schönheit des Männchens ins rechte Licht zu setzen. So haben die Männchen der auch in Deutschland vorkommenden Gattung Philaeus einen schön roten Hinterleib mit schwarzer, die der Gattung Micrommata einen grünen mit roter Längsbinde, die der Gattung Philodromus ein tief schwarzes Abdomen, während die Weibchen von all dieser Schönheit keine Spur aufzuweisen haben, sondern in ein unscheinbares Schutzgewand gehüllt sind. Von geradezu bestechender Farbenpracht selbst für das menschliche Auge sind die Angehörigen der australischen Springspinnengattung Ascyltus, bei denen der ganze Oberkörper und das vorderste Beinpaar mit metallisch glänzenden Schüppchen besetzt sind, wie die Schmetterlingsflügel; ja am Vorderkopfe verdichten sich diese Schuppen zu einer Art Spiegel von wundervollem Metallschimmer. Dabei ist dieser bei den Geschlechtern verschieden, denn die Männchen glänzen smaragdgrün, die Weibchen aber rubinrot, so daß wir hier eine vollständige Parallelerscheinung zu den Edelpapageien vor uns haben. Kein Wunder, daß man früher überhaupt die Geschlechter für verschiedene Arten hielt und als solche beschrieb.
Die Springspinnen sind überhaupt höchst ulkige Kerlchen. Ihr bekanntester Vertreter bei uns ist die schwarzweiße Harlekinspinne ( Epiblemum scenicum = Salticus scenicus) (Abb. 18), die durch ihre ruckweisen und energischen Bewegungen und ihre oft ans Komische grenzenden Stellungen sofort auffällt. Es gibt in dieser Gruppe aber auch viel schöner gefärbte Arten, wie z.B. die Karminspinne ( Eresus cinaberinus), die sammetschwarz ist, aber auf der Oberseite des Hinterleibs brennend karminrot mit vier tiefschwarzen Punkten. Man könnte die Springspinnen als die ritterlichsten aller Spinnen bezeichnen, denn weder legen sie Fangnetze an, noch erlauern sie nach Art der Krabbenspinnen ihr Opfer in einem Versteck, sondern sie beschleichen es wie kleine Tiger, wobei sie förmliche Berechnung und einen richtigen Angriffsplan entwickeln, der je nach den Umständen ganz verschieden sich gestalten kann. Keulenartige Borsten an den Füßen ermöglichen ihnen ein sicheres Festhalten selbst an senkrechten Wänden und ein geräuschloses Anschleichen, das so langsam und behutsam vor sich geht, daß man eine Bewegung kaum zu erkennen vermag. Wenn aber die Spinne auf etwa 3 cm an das Beutetier herangekommen ist, so springt sie urplötzlich mit gewaltigem Satz zu wie eine Katze und verfehlt fast niemals ihr Ziel. Verhältnismäßig dreimal so weit ist dieser Satz wie der des gewandtesten Tigers. Hat die erspähte Fliege etwa an der Wand gesessen, so fällt sie mitsamt der Spinne herunter, aber beide erreichen nicht den Boden, denn der Räuber hat sich beim Anspringen jedesmal erst an einem Faden, dem einzigen, den sein Geschlecht zu spinnen vermag, wie an einem Sicherheitskabel verankert. Die Spinne pendelt deshalb plötzlich mitsamt ihrem Opfer frei in der Luft, murkst es hier ab und steigt dann wieder an ihrem Faden in die Höhe, um irgendwo in einem stillen Winkel die Mahlzeit abzuhalten. Viel mehr als andere Spinnen wird sie bei solchen Jagden durch das Gesicht geleitet, viel weniger durch Tastsinn und Gehör. Verklebt man diesen zielsicheren Sprungkünstlerinnen die Augen, so vermögen sie kaum eine Beute zu erhaschen, ja nicht einmal die Weibchen der eigenen Art wahrzunehmen. Neckt man dagegen eine Springspinne mit dem Finger, so folgt sie aufmerksam dessen Bewegungen, wendet sich vor-, rück- und seitwärts, und wenn man ihr gar zu sehr auf den Leib rückt, springt sie plötzlich mit einem Riesensatz in die Luft hinaus, dabei aber wiederum an ihrem Sicherheitstau hängen bleibend.
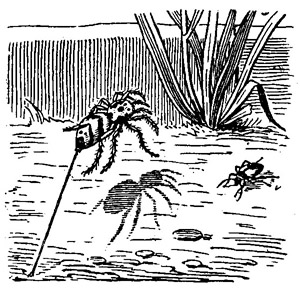
Abb. 18 Harlekinspinne im Sprung auf einen Käfer (nach Ellis).
Die Hochzeitsfeier der Hüpfspinnen vollzieht sich in ungleich anmutigeren Formen als bei den anderen Gruppen, denn hier finden wir nicht Mord und Totschlag, sondern höchstens ritterliche Turniere der Männchen, zudem groteske Balzstellungen und richtige Tänze, wie bei gewissen Vögeln. Schon auf eine Entfernung von 25 cm erblickt das Männchen ein Weibchen der eigenen Art, gerät in Aufregung und beginnt mit dem Tanze, wobei es in immer enger werdenden Spiralen die Erkorene umkreist und dabei den Körper so weit auf die Seite legt, als es nur möglich ist, ohne umzufallen; plötzlich wirft es sich dann auf die andere Seite und wiederholt dieses Schauspiel dutzendemal – in einem beobachteten Falle sogar 111mal – hintereinander, ohne müde zu werden. Wenn es ganz nahe an die Schöne herangekommen ist, wirbelt es wie wahnsinnig um sie herum, und nun tut auch das Weibchen eifrig mit. Erst wenn der Tanz mit völliger Erschöpfung geendigt hat, darf das Männchen den süßen Lohn für seine anstrengende Liebesmühe ernten. Die erwähnten australischen Springspinnen der Gattung Ascyltus tanzen auf den Hinterbeinen und heben die glänzenden Vorderbeine und den metallisch schimmernden Kopfspiegel hoch (Abb. 19). Solche Arten dagegen, die, wie die Gattung Peckhamia (so benannt nach dem englischen Ehepaar Peckham, das diese Tänze zuerst beobachtet und geschildert hat) ihre Prunkfarben auf der Hinterseite tragen, kehren beim Tanzen in wenig galanter Weise dem umworbenen Weibchen den Hintern zu, machen im tollsten Reigen plötzlich eine Pause und halten den knallrot gefärbten Hinterleib etwa eine halbe Minute lang steif in die Höhe oder vollführen mit ihm langsam drehende Bewegungen, um ihre Schönheit im hellsten Lichte erstrahlen zu lassen.
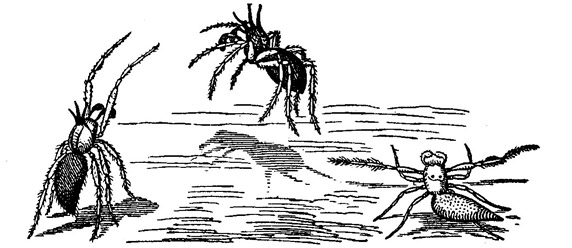
Abb. 19. Tanzende Springspinnen (nach Hesse-Doflein).
Die höchst entwickelte Gruppe der Spinnentiere sind nun aber zweifellos die Netzspinnen, schon wegen ihrer großartigen Spinntätigkeit und der dabei entfalteten bewunderungswürdigen Kunstfertigkeit. Sie stellen also gewissermaßen die schönste Blüte dieses Tierstammes dar. Wenn wir bisher die Spinntätigkeit der Spinnen nur, wie bei anderen Gliedertieren auch, zur Anfertigung schützender Hüllen für die Brut in Verwendung sahen oder höchstens zur Herstellung einfacher Sicherheits- und Wanderfäden oder zum Austapezieren von Wohnröhren, so finden wir sie nun ausgenützt zur Errichtung regelrechter Fangnetze, deren sinnvoll berechnete Bauart die Bewunderung jedes Beobachters hervorrufen muß. Ehe wir aber hierauf näher eingehen können, müssen wir erst über den eigenartigen Körperbau der Webspinnen ein wenig uns unterrichten, da sonst auch ihre Lebensweise uns kaum recht verständlich werden würde. Der Laie rechnet gewöhnlich die Spinnen ohne weiteres zu den Insekten, obgleich eigentlich die Unterschiede zwischen beiden Tiergruppen ganz gewaltig sind und schon auf den ersten Blick auffallen müssen. Der Insektenleib ist in drei scharf gegliederte Abschnitte geteilt, der Spinnenleib nur in zwei. Die Insekten haben nie mehr als drei Beinpaare, die Spinnen stets vier. Die Insekten haben Flügel, die Spinnen keine; jene haben Fühler, diese nicht. Die Augen der Insekten sind zahlreich, sechsseitig und treten in verschieden großer Zahl zur Bildung sogen. Facettenaugen zusammen. Die Spinnen dagegen haben niemals mehr als acht Augen, diese sind rund und bleiben stets einzeln. Die Spinnen haben stark entwickelte Kiefertaster mit einer Giftdrüse, die sich in der Klaue nach außen öffnet, während bei Insekten dergleichen nie vorkommt. Das Gefäßsystem der Insekten besteht aus einem langen Rückengefäß, wogegen die Spinnen ein wirkliches und sogar recht großes Herz haben und nicht wenige Blutgefäße. Die Atmungsorgane der Insekten sind nach außen durch mehrere Löcher mündende, aus spiralig aufgedrehten Fäden von Hornstoff gebildete, im Körper sich mehr und mehr verzweigende Röhren, während die Spinnen sogen. Lungen besitzen, wenigstens zum Teil. Die Insekten machen eine verwickelte Verwandlung (Metamorphose) durch, die Spinnen dagegen schlüpfen als fertige Tiere aus den Eiern. Zu alledem besitzen sie noch ihre wundervoll eingerichteten Spinnwerkzeuge, aus denen die Seide zunächst als zähflüssige Masse wie aufgelöstes Gummiarabikum hervortritt, dann aber an der Luft rasch erstarrt, von ihrer Zartheit und Dünne kann man sich kaum eine Vorstellung machen und darf nie vergessen, daß auch die stärksten Spinnenfäden kaum den hundertsten Teil eines Menschenhaares ausmachen. Dabei sind sie noch ungemein elastisch, denn der berühmte Physiker Arago stellte fest, daß sie sich bis auf das Fünffache ihrer Länge ausziehen lassen. Der Spinnstoff ist durch Wasser, Essigsäure, Äther und Alkohol unlöslich, wird aber durch Schwefel und Salpetersäure zerstört. Durch eine entsprechende chemische Behandlung läßt er sich so zubereiten, daß er zum Nähen verwendet werden kann. Die für den Eikokon verwendeten Spinnfäden müssen unbedingt auch Nährstoffe enthalten, denn es ist klar, daß die jungen Spinnchen etwa während der ersten 8–10 Tage ihres Daseins ausschließlich von ihnen leben. Ich habe schon oft versucht, junge Spinnen groß zu ziehen, aber sie verschmähten jede andere Nahrung und blieben trotzdem für den genannten Zeitraum munter und gesund. Erst wenn die Kokonmasse ihre Farbe verloren hatte, und zugleich locker und schwammig geworden war, sahen sich die Tierchen nach anderen Nährstoffen um, die sich ihnen aber schwer bieten lassen, so daß sie in diesem Zeitraum dann gewöhnlich zugrunde gehen. Der ganze Leibesbau der Spinne mit dem verhältnismäßig kleinen und sehr sparsam angelegten Rumpf, den langen, dünnen Beinen, und dem geringen spezifischen Gewicht ist dem Leben auf dem zarten Netzwerk angepaßt. Auf dieses eingestellt ist auch die hohe Entwicklung des Tastsinns bei verhältnismäßig gutem Gehör, während die Augen, die hier doch nicht von sonderlichem Nutzen sind, viel zu wünschen übrig lassen. Die freilebenden Wolf-, Luchs-, Krabben- und Springspinnen zeigen gleich einen ganz anderen, viel derberen Körperbau mit ungleich besser entwickelten Augen bei schwächer werdendem Tastsinn.
Ein Hauptkennzeichen des Spinnenleibes ist die feste Verwachsung von Kopf- und Bruststück, die bei den Insekten scharf getrennt bleiben. Das hat gewisse Nachteile für Augen und Kauwerkzeuge, bietet aber den Vorteil großer Kraft und Festigkeit, und das ist für die Spinnen als ausgesprochene Raubtiere schließlich die Hauptsache. Jenen Nachteil hat die Natur dadurch auszugleichen gesucht, daß sie den Spinnen eine größere Zahl von Augen verlieh, deren Achsen auf verschiedene Richtungen eingestellt sind, während sie sie bei den Krebsen auf lange und bewegliche Stiele stellte. Von den acht siebengliedrigen Beinpaaren, die ausschließlich am Vorderkörper angewachsen und ähnlich angeordnet sind wie die Teile eines Fernrohrs, ist das scheren- oder zangenförmige erste, die sogen. Chelizeren, in den Dienst der Raub- und Freßtätigkeit getreten, entspricht also den Unterkiefern oder den den Spinnen fehlenden Fühlern, während das zweite Paar die sogen. Palpen darstellt, die in ihrem Endglied als Taster, im Basalglied aber gleichfalls als Kauplatten dienen, so daß für die Gehtätigkeit bloß die letzten vier Beinpaare übrig bleiben, von denen das erste oder zweite zugleich die hauptsächlichsten Tastorgane trägt und dafür oft der Fußklauen entbehrt. Die Spinnen haben also nur zwei paar Mundwerkzeuge, die sich bei den ungiftigen Walzen- und Vogelspinnen in senkrechter Richtung bewegen, was eine größere Kraftentfaltung gestattet, bei den mit Giftdrüsen versehenen Gattungen dagegen in wagerechter Richtung. Die eigentlichen Beine spielen nun aber bei den Netzspinnen mehr oder minder auch im Dienste der Webetätigkeit eine große Rolle, wobei oft auch ein besonderer Webstachel ( Calamistrum) zur Verwendung gelangt und zum Kräuseln der Fäden benutzt wird. Am Ende der Füße stehen die schönen, zwei- oder dreiklauigen Webeorgane. Ihr Hauptteil ist die paarige Einschlagklaue, an der Zinken oder Zähne mehr oder weniger dicht in Form eines Kammes aneinander gereiht sind, was unter dem Mikroskop ein sehr hübsches Bild abgibt (Abb. 20). Die zweiklauigen Arten machen dichte, filzartige Gewebe, die dreiklauigen dagegen knüpfen das Netz und bilden Maschen. Es geht ganz zu, wie am Webstuhl. Den spinnenden Fingern entsprechen die Spinnwarzen, dem Tritt des Webstuhls die Trittklaue der Spinne, und der Einschlag geschieht mit einer bei beiden ganz gleichartigen Vorrichtung. Beide drücken die Kreuzungsfäden nieder und befestigen sie.
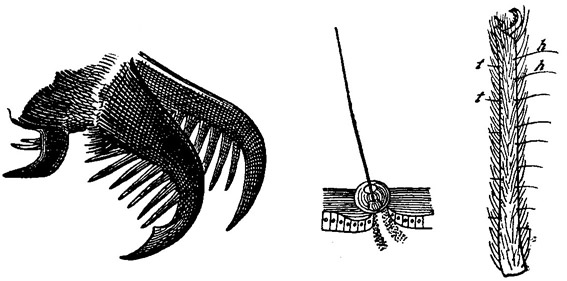
|
|
|
Abb. 20 Fußklaue einer Webspinne (Vergrößert.) |
Abb. 21. Hörhaare der Spinnen. f = Fühlhaare, h = Hörhaare. Links ein Hörhaar in starker Vergrößerung. |
Der Spinnenkörper ist im allgemeinen reichlich behaart, besonders jedoch an den Beinen, wo die gewöhnlichen Haare mehr oder minder der Vermittlung des Tastsinnes dienen müssen. Außerdem befinden sich hier aber noch andere, sehr feine, eigentümlich eingelenkte und sehr bewegliche Haare, die Dahl nach Bau und Beschaffenheit als Hörhaare erkannt hat. Daß die Spinnen verhältnismäßig gut hören, kann ja keinem Zweifel unterliegen, und schon Wagner schildert, wie man eine Spinne aus ihrem Schlupfwinkel hervorlocken kann, wenn man eine Fliege davor brummen läßt. Man kann diesen Versuch auch insofern abändern, als man einer gefangenen Spinne, etwa einer Wolfspinne, in einiger Entfernung eine brummende Fliege vorhält, ohne daß sie sie sehen kann, also etwa hinter einer Gazewand. Sofort wird die Spinne in der Richtung des Brummtons vorstürzen, vorausgesetzt, daß sie überhaupt hungrig ist. Trotzdem besitzt sie keine äußerlich sichtbaren Ohren oder auch nur ähnliche Gebilde. Aber schon der Umstand, daß die erwähnten Haare (Abb. 21) in besonderen Sinnesbechern stehen und so scharf von den Tasthaaren sich unterscheiden, läßt darauf schließen, daß ihnen eine bestimmte andere Aufgabe zukommt. Es ist nicht schwer, sich darüber Aufklärung zu verschaffen. Man braucht nur eine der im Vorsommer bei Sonnenschein überall massenhaft herumlaufenden Wolfspinnen einzufangen, nach Hause zu bringen, ihr hier im Interesse der Wissenschaften Bein zu amputieren und dieses bei hellem Tageslicht und 600facher Vergrößerung auf den Objektträger zu legen. Läßt man nun einen einfachen Ton anklingen, etwa auf der G-Saite einer Mandoline, so sieht man deutlich, wie das Haar in Schwingungen gerät, aber sofort damit aufhört, sobald man den Ton wieder abdämpft. Freilich hält diese Erscheinung nur wenige Minuten an, denn die Haare verlieren ihre Empfindsamkeit und Beweglichkeit, sobald das Blut geronnen ist. Die Verteilung und Anordnung der Hörhaare auf dem Spinnenkörper ist eine sehr eigenartige und regelmäßige, so daß man diesen Umstand mit Erfolg auch bei der schwierigen systematischen Einteilung der Spinnen ausgenutzt hat. Übermäßig reich an Arten (man kennt gegenwärtig etwa 1200) ist ja das Spinnenheer nicht, aber dafür umfassen einzelne Arten einen ungeheuren Reichtum an Individuen und auch ihre Verbreitungsbezirke sind oft ganz gewaltige. Wenn auch im allgemeinen die Zahl und die Schönheit der Arten mit der Nähe der Tropen zunimmt, so finden wir doch Spinnen überall bis in die Nachbarschaft der Pole hinauf, in den heißen Wüsten sowohl wie neben dem ewigen Schnee und Gletschereis der Hochgebirge, in tropischen Urwäldern wie auf dürrer Heide, aus den höchsten Turmspitzen, hinter stäubenden Wasserfällen und in fahrenden Bahnzügen, aber auch in Bergschächten von 300 Meter Tiefe und in Höhlen, die 2500 Meter vom Tageslicht entfernt sind, nirgends jedoch häufiger als in der Nähe des Wassers, weil sich ihrer Mordlust hier die meisten fliegenden Kerfe bieten. Für viele Gegenden sind die Spinnennetze geradezu kennzeichnend, und ein vernachlässigtes altes Haus, eine unbewohnte Stube, ja selbst den düsteren Kerker können wir uns ohne Spinnweben kaum vorstellen.
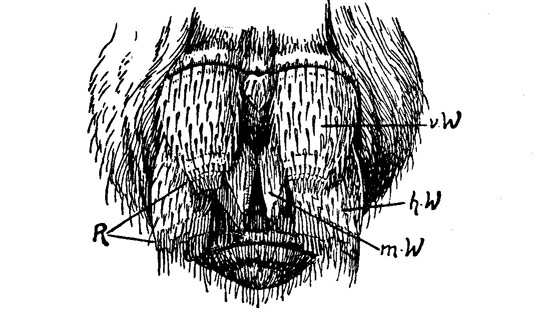
Abb. 22. Spinnwarzen der Kreuzspinne. (Vergrößert.) vW, mV und hV = vordere, mittlere und hintere Spinnwarzen, R Spinnröhren.
Bei der überragenden Wichtigkeit, die der Spinnvorrichtung im Leben dieser Tiere zukommt, muß sie naturgemäß auch den besten Platz erhalten, da ja sehr viel davon abhängt, daß die Spinnfäden in genau bestimmten Richtungen entsendet werden. Deshalb steht der Spinnapparat am Ende des beweglicheren Hinterkörpers und nimmt hier den Platz ein, der bei anderen Gliedertieren den Geschlechtsorganen zukommt. Diese müssen deshalb nach der Bauchseite und weiter nach vorn rücken.
Um nun auch über den Spinnapparat selbst (Abb. 22) einige Worte zu sagen, so besteht er aus drei (selten zwei) Paaren kegelförmiger, in einem Hornring eingesetzter und sehr beweglicher Warzen, deren Einzelglieder nach dem Muster des zusammenschiebbaren Fernrohrs gebaut sind, und die aus ihrer abgestutzten Endfläche das mit zahlreichen seinen Röhrchen besetzte Spinnfeld tragen. Die Gesamtzahl dieser Spinnröhrchen beträgt z.B. bei der Kreuzspinne gegen 400 und die sanft vorgewölbten Endflächen der Spinnwarzen sehen deshalb aus wie die von zahlreichen Löchern durchsetzte Brause einer Gießkanne. Je weniger die betreffende Spinne Weberin ist, desto geringer ist auch die Zahl der Spinnröhrchen, und die kleinen Springspinnen z.B. haben deren nur 14. Gewöhnlich stehen zwei Paar Spinnwarzen von ungleicher Größe in einem Viereck, und das dritte, stets kleinere Paar, hinter dem der After liegt, in der Mitte desselben. Nur bei der Gattung Cyclosomia erscheint der Spinnapparat vom Hinterleib nach dem Unterleib gerückt, und es hängt dies wohl damit zusammen, daß jener bei diesen Spinnen merkwürdig scheibenförmig gestaltet ist und sie wahrscheinlich mit ihm ihre Wohnröhre wie mit einem Deckel verschließen. Schon die rauhe und erdfarbige Beschaffenheit des Hinterleibs, der am Erdboden auch für das schärfste Auge kaum wahrnehmbar ist, legt diese Vermutung nahe. Dann müssen natürlich die empfindlichen und für das Tier so wichtigen Spinnwarzen nach einem geschützteren Punkt verschoben werden. Die von den einzelnen Spinndrüsen erzeugten Seidenfäden sind nun aber keineswegs gleichartig, sondern oft schon in der Farbe verschieden. So kennt man eine amerikanische Spinnenart, in deren Gewebe sich schwarze, rote und goldgelbe Fäden mischen. Gut, daß diese unvorsichtige Spinne nicht vor Ausbruch der Revolution in Deutschland lebte, sonst hätte sicherlich die »aufrührerische« Farbenzusammenstellung ihrer Gewebe bedenkliche »Maßnahmen« »seitens« »einer hohen Behörde« veranlaßt! Bei unserer gewöhnlichen Kreuzspinne kann man fünf verschiedene Arten von Fäden unterscheiden. Mit den Fadenmassen der kleinen Röhren werden die gefangenen Kerfe in breite Seidenbänder eingewickelt, die größeren Röhren in der Mitte liefern die klebrigen Fangfäden, noch andere Röhrchen die trockenen Fäden des Netzes und wieder andere die Seide zur Anfertigung und Einhüllung der Eikokons, die schon durch ihre gelbe (bei anderen Arten grünliche oder rosenrote) Farbe auffällt. Die Spinne hat es vollständig in ihrer Gewalt, welche Art von Seide sie erzeugen will.
Wunderbar, daß die Kreuzspinnen zur Errichtung ihres verwickelten Baus bei fleißigem und ungestörtem Arbeiten nur etwa 40 Minuten benötigen, und zwar schaffen sie hauptsächlich in der Morgendämmerung, damit das Netz schon zum Fang gestellt ist, wenn die Insekten bei Sonnenschein zu fliegen anfangen. Es erscheint deshalb auch die bekannte Sage nicht unglaublich, daß Mohammed auf seiner Flucht, als er in einer Höhle verborgen war, durch eine Spinne gerettet wurde, die über den Höhleneingang ihr Netz spann und so die Verfolger täuschte. Infolgedessen gilt die Spinne noch heute den Mohammedanern als heilig. Marshall meint in seiner launigen Weise: »Wie es wohl in der Welt aussähe, wenn damals keine gefällige Spinne bei der Hand gewesen wäre! Wahrscheinlich gäbe es keine orientalische Frage, und die Zeitungen würden einen nicht mit bulgarischen Wirren langweilen. Die Schuljugend würde nicht mit 7½ Kreuzzügen, nämlich sieben richtigen und einem Kinderkreuzzug, gequält werden. Aber die armen Gymnasiasten hätten statt mit dem gegenwärtigen kleineren mit einem viel größeren Übel zu kämpfen; müßten sie doch ganz gewiß um so mehr Latein und Griechisch lernen, denn dann wäre ja auch die Bibliothek von Alexandria nicht verheizt worden. So hängt das Schicksal der Völker und die Beschaffenheit der Osterzensur oft an einem »Spinnenfaden«. Aber auch bei anderen Völkern hat die Spinne durch ihre Webekunst von jeher in hohem Grade die Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Stammt sie doch von Arachne ab, der kunstfertigen Mäonierin, die sich erkühnte, die altjüngferliche Pallas Athene zum Wettstreit herauszufordern, dabei der stirngeborenen Tochter des Zeus unterlag und sich aus Verzweiflung darüber an ihrem Gürtel aufhing. Damit war jedoch die Rachsucht der »blauäugigen« Göttin, wie sie der gute Voß schulmeisterlichen Angedenkens mehr eigenartig als schön benannte, noch lange nicht gestillt. Sie bespritzte die Unglückliche mit dem Saft von Zauberkräutern, so daß sie alsbald jämmerlich zusammenschrumpfte und sich in eine häßliche Spinne verwandelte, die zur Strafe Tag und Nacht Fäden ziehen muß. Wage es einer, die Rache einer alten Jungfer herauszufordern! Die Sorte ist zäh. Anmutiger klingt eine andere Sage, wonach der Dichter die Kreuzspinne von dem durch Minerva verschütteten Nektartropfen naschen läßt. Sie sog damit das höchste Gut ein, das sie nur mit dem Menschen teilt: die Kunst. Die Adepten des Mittelalters schworen darauf, daß eine unter besonderen Umständen eingetrocknete Spinne in einen Diamanten sich verwandle. Schade, daß das nicht wahr ist. Freilich wäre dann wohl die halbe Menschheit ständig auf der Spinnenjagd. Winkelmann – aber nicht etwa der berühmte Kunsthistoriker, denn der war viel zu vernünftig dazu – sagt, daß man aus Spinnen eine heilsame Salbe bereiten könne, nur müßten sie unbedingt in einer Kirche gefangen sein. Die alten Germanen glaubten, daß ein Haus, an dem eine Kreuzspinne ihr Netz webe, nicht vom Blitz getroffen werde, weil sie Donars Rune, den Hammer, auf ihrem Rücken trage. Jedenfalls war diese heidnische Auffassung nicht schlechter als die spätere christliche, wonach es dem übel ergehen soll, der durch Zufall eine Kreuzspinne und damit das Unglück in ein Haus einschleppt. Der auffallenden Kreuzzeichnung unserer Spinne (Abb. 23) scheinen übrigens unter Umständen phosphoreszierende Eigenschaften innezuwohnen, wodurch vielleicht das gegenseitige Sichfinden der Tiere in der Nacht erleichtert wird.

Abb. 23 Kreuzspinne.
So schreibt mir Herr Lehrer Tappe aus Sonneborn: »Ende April kam ich abends bei starker Dämmerung in mein Bienenhaus, in dem es schon völlig dunkel war, um meine Pfeife zu holen. Als meine Augen sich nach etwa zweiminutigem Suchen an die Dunkelheit gewohnt hatten, bemerkte ich an der Wand einen gelblichweiß phosphoreszierenden Punkt, der sich ab und zu bewegte. Ich holte Streichholzer, suchte das Leuchtende wieder, sah es und machte Licht. Zu meinem Erstaunen war es eine ziemlich große Kreuzspinne.«
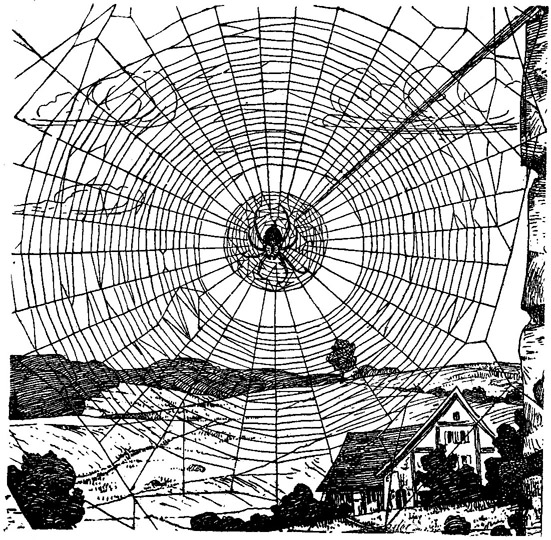
Abb. 24. Radnetz der Kreuzspinne.
Wir finden unter den Spinnennetzen alle möglichen Abstufungen und dürfen als vollkommenste Form wohl das Radnetz ansehen, als niedrigste dagegen das regellose Fadengewirr, das manche Arten zwischen den Grashalmen über dem Erdboden ausspannen. Das Radnetz der Kreuzspinne ( Epeira diademata) z. B. (Abb. 24), steht seiner kunstvollen Anlage nach eigentlich noch über dem menschlichen Fischernetz, denn es ist eine Vereinigung von Netz und Leimrute, also eine geradezu raffinierte Vorrichtung, wie sie sich sonst in der ganzen Natur nicht wieder findet. Schon die Länge des erzeugten Spinnfadens ist in hohem Maße bewundernswert, denn auf menschliche Verhältnisse übertragen, würde er einem Tau von 5 km Länge entsprechen. Ein Netz von 18 cm Durchmesser mit 20 Speichen und 24 Reihen Spiralfäden braucht 18 m Faden, der von einem Tierchen erzeugt wird, dessen spinnender Hinterleib doch kaum 10 mm lang und 7 mm breit ist. Obendrein kann die Spinne, ohne frische Nahrung zu sich zu nehmen, dieses Netz im Notfalle 4–6mal erneuern, also 72–108 m Faden erzeugen, wozu noch diejenige Seide kommt, die zur Anlage der Wohnung nötig ist. Dabei hat der Wunderbau eines solchen Netzes nicht nur die vollkommenste, regelmäßig geometrische Gestaltung, sondern auch eine sorgsam berechnete Spannung. Das Netz besteht nur aus geknüpftem Gewebe, Wohnung und Bruthülle dagegen aus filzartigem. Alter und Erfahrung spielen beim Netzbau eine nicht zu unterschätzende Rolle. Jungspinnen verfertigen schüchtern ganz kleine Netze, aber mit jeder Häutung wächst ihre Geschicklichkeit und ihre Unternehmungslust. Namentlich in Gebirgswäldern trifft man oft ganz riesige Netze an mit einer Rahmenhöhe von 8–10 m, und es erscheint bemerkenswert, daß die Spinne auch noch auf solche Entfernung die geringste Erschütterung ihres Netzes fühlt, weil eben ihr ganzer Körper gewissermaßen ein empfindliches Mikrophon vorstellt, das jede zitternde Bewegung der Umgebung wahrnimmt, ja selbst noch die leisesten Schwingungen, die sich dem menschlichen Sinnesvermögen entziehen. Immer ist die Spinne bemüht, den Rahmen trapezartig zu gestalten, aber das ist oft nicht so einfach, und schon die richtige Wahl des Ortes verursacht mancherlei Verlegenheiten, mehr noch die Einspannung des Rahmens in die umgebenden Haltpunkte. Gewöhnlich ist der Platz sehr geschickt ausgesucht, und wenn das Netz nur von einer Seite Beuteanflug zu erwarten hat, so befindet sich doch zumeist etwas dahinter, das die Insekten anlockt, etwa eine sonnige Mauer oder Bretterwand, auf der Fliegen und Mücken gern zum Ausruhen sich niederlassen. Bevor sie mit der Arbeit beginnt, läuft die Spinne oft lange hin und her, als ob sie nachdenke, wie der Netzrahmen am besten zu spannen sei, und in der Tat ist dazu eine gewisse Überlegung nötig, da ja die Beschaffenheit der Örtlichkeiten eine überaus wechselvolle ist und der Rahmen daher bald so, bald so gespannt werden muß. Es handelt sich hier eben nicht um ein rein maschinenmäßiges Tun, um einen bloß reflektorischen Vorgang, sondern dieser ist zweifellos von Bewußthandlungen einfachster Art begleitet und beeinflußt, wovon man sich leicht überzeugen kann, wenn man ein noch unfertiges Spinnennetz teilweise zerstört, indem die Spinne dann nicht etwa automatisch und instinktiv weiterbaut, sondern zunächst die entstandenen Schäden zweckmäßig auszubessern bestrebt ist. Sie benutzt bei ihrer Arbeit, namentlich wenn es sich um die Überbrückung eines Baches handelt, auch die Kraft des Windes, gerade wie die jungen Wolfspinnen, ehe sie ihre abenteuerliche Luftreise antreten. Fährt man im Kahn auf einem schmalen Wassergraben entlang und ergreift man dabei einen der vom einen Ufer herüberflatternden Spinnfäden, so wird es deshalb nicht lange dauern, bis auf diesem die Spinne selbst anmarschiert kommt, weil sie glauben muß, daß ihr ausgeworfenes Rahmenseil irgendwo Anker gefaßt habe. Anthony stellte fest, daß jeder dieser starken Rahmenfäden bei der Kreuzspinne aus 200 Einzelfäden zusammengesetzt ist.
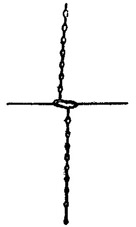
Abb. 25. Spiralfäden eines Spinnennetzes mit Leimtröpfchen. (Vergrößert.)
Sobald der Rahmen fertig ist, schlägt die Spinne die Radien, indem sie immer abwechselnd von dem durch das Ziehen der Diagonalfäden gewonnenen Mittelpunkt aus einen Faden zum oberen und einen zum unteren Rande führt, so daß das Ganze beständig straff ausgespannt bleibt, verliert trotzdem einmal ein Faden seine Straffheit, so spannt ihn die Spinne durch besondere Hilfsfäden von neuem. Um diese Speichen genügend zu versteifen, werden sie doppelt angefertigt, indem die Künstlerin jedesmal auf einem frisch ausgezogenen Radius wieder zum Mittelpunkte zurückkehrt und dabei einen neuen Faden zieht, der mit dem alten verschmilzt. Die Fäden des Rahmens und der Speichen sind trocken und hart und dienen nicht nur als Gehsteige, sondern teilweise auch als Telegraphenleitung oder, richtiger gesagt, als ein Klingelzug, der der Spinne alle im Netz sich ereignenden Vorgänge meldet. Dagegen sehen die lose gespannten und erst zuletzt angelegten Spiralfäden, die die eigentlichen Fangfäden sind, unter dem Mikroskop ganz anders aus (Abb. 25), weil sie glatt, weich und schlaff und in bestimmten Zwischenräumen mit unzähligen winzigen Tröpfchen einer klebrigen Flüssigkeit besetzt sind. Die Spinne setzt diese Tausende von Tröpfchen nun aber nicht etwa einzeln ab, was ja in so kurzer Zeit auch kaum möglich wäre, sondern es handelt sich um eine zugleich mit der Seidenmasse aus besonderen Drüsen gleichmäßig ausgeschiedene leimige Flüssigkeit, die sich wie Öl bei den durch die arbeitende Spinne bewirkten Erschütterungen des Fadens in winzige Kügelchen zusammenballt. Diese Fangfäden werden von außen nach innen in immer enger werdenden Spiralen geführt. Herman hat beobachtet, welch wichtige Dienste dabei der Spinne die Beinpaare leisten: »Beim Bau des Spiralfadens dient das erste Fußpaar als Meßinstrument, mit dem sie die Abstände der Spiralen bestimmt. Mit Hilfe des zweiten und dritten Paares geht sie von Speiche zu Speiche; das vierte Fußpaar leistet seinen Dienst durch Fadenziehen und -knüpfen, welch letzteres unendlich interessant ist. Von Speiche zu Speiche gehend zieht die Spinne nämlich mit dem vierten Fußpaar den Faden aus den Spinnwarzen auf die Art, daß sie abwechselnd bald mit dem einen, bald mit dem andern Fuß sich den Spinnwarzen nähert, damit sie den Faden weiter entwickle, d.h. herausziehe. Mit dem Entwickeln bis zur nächsten Speiche angelangt, druckt sie mit dem einen Fuß des nämlichen Beinpaares den Faden ein wenig nieder, mit dem andern Fuß dagegen knüpft sie ihn durch den Druck der Einschlagklauen an die Speiche« (Abb. 26). Sehr beachtenswert erscheint in dieser Hinsicht eine Beobachtung des Engländers Banks, wonach Spinnen, die durch einen unglücklichen Zufall ein oder mehrere Beine verloren hatten, das Netzweben aufgaben und sich nach Art der Wolfspinnen von freier Jagd ernährten, bis günstigenfalls ihre Gliedmaßen durch Regeneration nach mehreren Häutungen wieder tauglich zur Webearbeit geworden waren. Daß die Spinne nicht selbst an ihren Klebefäden hängen bleibt, verdankt sie der Vorsicht ihrer eigenen Bewegungen, noch mehr aber einem Schutzmittel gegen den Leim, der aus weiteren Drüsen ausgeschwitzt wird. Neben dem Netze errichtet sie sich aus filzigem Gewebe noch eine Wohn- und Zufluchtstätte, die bei schlimmem Wetter oder Gefahr aufgesucht wird. Auch dieser Wohnungstrichter ist durch einen Klingelzug mit dem Netz verbunden, so daß die Spinne sofort erfährt, wenn ein Insekt sich gefangen hat und durch seine Befreiungsversuche den luftigen Bau erschüttert.
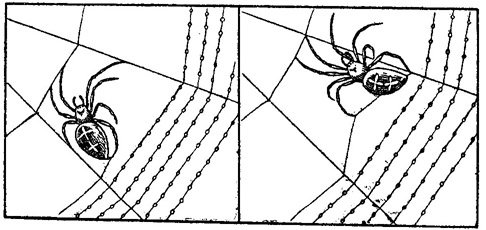
Abb. 26. Das Einspannen der Klebfäden (nach Ellis).
Mit eilfertiger Behendigkeit stürzt sie nun hervor, um weitere Beschädigungen des Netzes zu verhüten und sich ihrer Beute zu bemächtigen. Sie drückt dazu ihren Hinterleib mit den Spinnwarzen an eine beliebige Stelle der gefangenen Fliege, zieht dadurch Fäden aus, packt ihr Opfer mit dem dritten und vierten Beinpaar und wirbelt es nun mit fabelhafter Geschwindigkeit herum, wodurch es von einem breiten Seidenband überzogen wird. Dies geht so fix, daß auch eine dicke Brummfliege schon nach wenigen Sekunden eingesponnen und wehrlos gemacht ist. Selbst Tiere, die der Spinne an Größe bedeutend überlegen sind, werden auf diese Weise von ihr überwältigt, indem sie die erste Fessel wie einen Lasso über sie auswirft. An gefangenen Kreuzspinnen konnte ich feststellen, daß sie täglich mindestens drei bis vier feiste Stubenfliegen nötig haben, um bei Kräften zu bleiben und ihre Spinnfähigkeit zu behalten. Der Insektenforscher wird immer gut tun, auf die Spinnennetze zu achten, denn er findet hier oft allerlei Getier, von dessen Vorhandensein in der Gegend er bis dahin trotz eifrigen Suchens keine Ahnung hatte, und kann so manche wichtige Feststellung machen, wenn auch die Ausbeute sich nicht mehr in die Sammlung einreihen läßt, da es sich ja nur um ausgesogene und verstümmelte Leichname handelt. Im allgemeinen ist die Spinne übrigens bemüht, ihr Netz sauber und rein zu halten und die Überreste der Mahlzeiten baldmöglichst wieder zu entfernen. Fällt der Fang reichlich aus, so sammelt sie als sorgsame Hausfrau Vorrat für schlechte Zeiten, indem sie eingesargte Fliegen in ihren Schlupfwinkel schleppt. Sie verzehrt nur selbstgefangene Beute, niemals Kadaver, ja es erscheint sicher, daß ihre Opfer meist noch leben, wenn sie ihnen die Körpersäfte aussaugt, was wahrscheinlich am lebenden Körper auch leichter vonstatten geht. Die übelriechenden Blattwanzen werden in der Regel verschmäht. Fängt sich viel kleines Geschmeiß, etwa Gelsen, die der Spinne als gar zu winzige Bissen erscheinen, aber durch ihre Masse das Netz verunzieren und in seiner Brauchbarkeit beeinträchtigen, so verläßt sie es lieber und baut sich ein neues. Westindische Arten haben zu Reinigungszwecken ihre besonderen Dienstmädchen, nämlich kleinere Spinnen, die die gefangenen Gelsen wegfressen und so das Netz sauber erhalten. Das Wasser können die Spinnen nicht entbehren, und mit Wonne schlürfen sie die Tautropfen, die sich als funkelnde Demanten im Netz niedergeschlagen haben und ihm im goldenen Lichte der Morgensonne ein märchenhaft schönes Aussehen verleihen. Auch bei Gefahren kommt das Netz in einer eigentümlichen Weise zur Verwendung. Vom Gegner überraschte Spinnen versetzen nämlich ihr Gewebe öfters durch Schwingen in lebhaft zitternde Bewegungen, so daß namentlich bei blendendem Sonnenschein das flitterige Ganze vor dem Auge verschwimmt und man die Spinne selbst kaum wahrnehmen kann.
Von einer eigentlichen Ehe kann auch bei der Kreuzspinne keine Rede sein, denn man hat beobachtet, daß ein Männchen mehrere Weibchen begattete, wenn es nicht vorher aufgefressen wurde, und daß umgekehrt auch das Weibchen von mehreren Männchen sich begatten ließ. Ehe es geschlechtsreif wird, macht es in einem besonderen glockenförmigen Gespinst eine letzte Häutung durch, und in der Nähe warten dann in der Kegel schon mehrere Männchen auf das ersehnte Erscheinen der Jungfrau. Diese legt sich nun zunächst ein neues Radnetz an, und an dessen Rande befestigt das hinzukommende Männchen einen besonders starken Faden, den stärksten, den die Kreuzspinne überhaupt zu spinnen vermag und der nun als Liebes- und Lebensbrücke dienen muß. Mit beiden Vorderbeinen zupft der verliebte Freier öfters ungeduldig an diesem Faden und erregt dadurch die Aufmerksamkeit des im Netze sitzenden Weibchens, das schließlich auf der Brücke ihm entgegen kommt und sich betasten läßt. Beide Tiere sind aber noch immer äußerst mißtrauisch gegen einander, und das Männchen muß jeden Augenblick darauf gefaßt sein, von der stärkeren Gesponsin gepackt und getötet zu werden. Im günstigen Fall rückt es näher und führt mit den Beinen und dem Hinterleib erregte Bewegungen aus, bis auch das spröde Weibchen durch Zucken mit den Vorderbeinen ein Zeichen der Willfährigkeit zu erkennen gibt. Nun wirft sich das Männchen mit einer gewissen Gewalttätigkeit im Sprung auf die Umworbene und läßt sie nicht eher los, als bis es den samenbeladenen Taster wiederholt eingeführt hat. Dann aber heißt es auch hier schleunigst ausreißen.
Für die Aufnahme der Eier fertigt auch die Kreuzspinne mit mütterlicher Sorgfalt ein weiches Seidenbettchen an, und nicht selten geht ihre Aufopferung so weit, daß die Mutter mit dieser Hülle zugleich das eigene Leben zu Ende webt und erschöpft oder tot neben der Kinderwiege niedersinkt. Die anfangs kugeligen Eier nehmen mit fortschreitender Entwicklung, die lediglich von der Luftwärme besorgt wird, eine mehr längliche Gestalt an und gleichen schließlich richtigen Puppen, durch deren faltig gewordene Haut man schon die Glieder der jungen Spinnen durchschimmern sieht. Beim Ausschlüpfen kommt zuerst der Kopf zum Vorschein, zuletzt die Füße, die wie in Handschuhen stecken und durch abwechselndes Ausstrecken und Zusammenziehen mühsam befreit werden müssen. Diese jungen Spinnen erinnern an bleiche Maden im reifen Käse, haben einen noch ganz weichen, fast gallertigen Körper, sind ungemein zart und zerbrechlich, und Wind und Regen, Dürre und Nässe spielen ihnen deshalb übel mit. Die meisten gehen schon in den ersten Lebenstagen zugrunde, und nach dem Gesetze des Ausgleichs steht es durchaus im Einklang damit, daß bei den an geschützten Plätzen lebenden Arten die Zahl der Jungen viel geringer ist als bei solchen, die den Unbilden der Witterung und den tierischen Feinden schutzloser preisgegeben sind. So birgt ein Kokon der Kreuzspinne 600–2000 Junge, der gewisser Höhlenspinnen dagegen nur 4–5. Anfangs sitzen die Kleinen fast regungslos im Nest, da ihre Spinnorgane noch von einer Haut umschlossen sind und erst durch die erste Häutung frei werden. Dann bilden die Tierchen einen gelben Klumpen, und wenn man diesen berührt, schießen sie plötzlich als ein goldener Nebel auseinander, indem jedes am Ende eines fast unsichtbar dünnen Seidenfadens davonflieht. Ist die Störung vorüber, so drängen sie sich alsbald von neuem auf einen Haufen zusammen. Ein solches Jungspinnchen, das außer Eidotter und Spinnmasse noch gar keine Nahrung zu sich nahm, ist doch bereits imstande, einen 4 Meter langen Faden herzustellen, und alles dies, der Seiler und das Seil, war schon in dem winzigen Eikügelchen enthalten, woraus am besten ersichtlich ist, bis zu welch unendlicher Feinheit der Spinnstoff verdünnt werden kann. Erst wenn der Appetit auf nahrhaftere Kost erwacht, trennen sich die jungen Spinnen, denn nun machen sich bei ihnen alsbald kannibalische Gelüste und die ihnen eigene Unverträglichkeit geltend. Sie müssen in den nächsten 6 – 16 Wochen noch eine ganze Reihe von Häutungen durchmachen, bis bei der vorletzten die Geschlechtsunterschiede, also das »Schloß« des Weibchens und die Anschwellungen am Taster des Männchens, auftreten und bei der letzten vollständig werden, und die Schnelligkeit dieser Entwicklung ist in hohem Maße abhängig von den Nahrungsverhältnissen. So wird z. B. die Rohrspinne (Epeira cornuta), die ja am Wasser einen besonders reichlichen Insektenanflug hat, viel früher fortpflanzungsfähig als die gewöhnliche Kreuzspinne. Bis dahin unterscheiden sich die Geschlechter lediglich durch die Größe, da mit Ausnahme der Wasserspinne das Männchen stets beträchtlich kleiner ist als das Weibchen. Bei tropischen Arten tritt dies noch viel mehr hervor. So ist z. B. bei der Gattung Nephila (Abb. 36) das Weibchen zehnmal so lang und bis fast tausendmal so schwer als das Männchen.
Die Unverträglichkeit der Spinnen bedingt ferner ihre Ungeselligkeit und ihren Hang zu einsiedlerischem Wesen, indessen hat man neuerdings doch verschiedene Arten aufgefunden, die nicht nur gesellig beisammen leben, sondern bis zu einem gewissen Grade sogar ein förmliches Staatswesen bilden. So beschreibt Simon eine in Venezuela heimische Kreuzspinne, deren Weibchen sich nachbarlich zusammenschließen. Zunächst baut allerdings jede ihr eignes Fangnetz. Rückt aber die Zeit der Eiablage heran, so vereinigen sich fünf bis sechs der Tiere und fertigen aus gelblichem Gewebe ein gemeinsames, wolliges und rundliches, im Gesträuch angebrachtes Gehäuse an, an dessen Innenwand zehn bis zwölf gestielte Eiersäckchen ausgehängt werden, neben denen die fürsorglichen Mütter Wache halten. Zu Hunderten sogar finden sich die Weibchen einer kleineren Spinnenart zusammen, die in Südamerika auf den Kaffeebäumen wohnt und aus durchsichtigem Gewebe so umfangreiche Nester baut, daß sie oft die ganze Baumkrone umhüllen. In den Abteilungen dieses Baumwerks laufen die Spinnenmütter geschäftig hin und her, betasten sich gegenseitig wohlwollend, wenn sie sich begegnen, und verzehren sogar gemeinsam größere Kerfe. Noch weiter ausgebildet ist der gemeinsame Haushalt der tropischen Republikanerspinne. Das Nest besteht aus einem Mittelraum, in dem sich besonders die nach Hunderten zählenden Männchen aufhalten, während die Weibchen am Rande ihre Radnetze errichten. Kommt es aber zum Eierlegen, so geben die Männchen den Mittelraum frei, die Weibchen ziehen ein, hängen ihre wie bräunliche Blatttrümmer aussehenden Eikokons an den Wänden auf und hocken selbst als steife und unbewegliche Wächter daneben. Livingstone fand in Südafrika gleichfalls eine Spinnenart in so zahlreicher Gesellschaft beisammen, daß ihre riesigen Gespinste ganze Baumstämme oder Hecken unter einem dichten Schleier verbargen, und Darwin traf in den La-Plata-Staaten eine große schwarze, auf dem Rücken rubinrot gefleckte Kreuzspinne, die gesellig Netz neben Netz wohnte, so daß die starken Rahmenfäden den benachbarten Netzen gemeinsam waren. Auch bei uns kann man bisweilen eine gewisse Vergesellschaftung verschiedenartiger Spinnen antreffen, etwa so, daß eine Baldachinspinne ihr wagerechtes Segel ausgespannt hat und unter diesem dann anschließend das Radnetz einer kleinen Kreuzspinne sich befindet (Abb. 27).
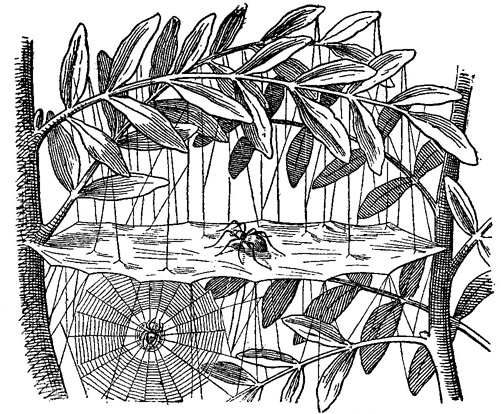
Abb. 27. Vergesellschaftung von Baldachin- und Kreuzspinne (nach Ellis).
In Istrien gibt es eine Kreuzspinnenart, die vom Mittelpunkt bis zum Verbindungsfaden eine richtige Zickzacktreppe aus Seidenmasse sich anlegt und auf dieser mit unheimlicher Geschwindigkeit sich bewegt. Noch weiter geht in dieser Beziehung eine amerikanische Art, die außer der Wendeltreppe auch noch ein seidenes Schild in der Mitte des Netzes verfertigt, das den Zweck hat, die Festigkeit des ganzen Bauwerks zu erhöhen, und der Spinne nicht nur als Ruheplätzchen, sondern auch zum Schutze dient, indem sie bei Störungen schleunigst auf die andere Seite sich begibt. Andere Kreuzspinnennetze fallen dadurch auf, daß ein Sektor von den Spiralfäden freibleibt. Ganz reizend sieht das Netz der nordamerikanischen Federfußspinne aus (Abb. 28).
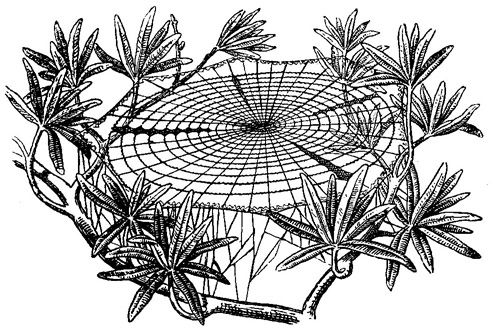
Abb. 28. Netz der Federfußspinne (nach Ellis).
Während unsere Kreuzspinnen das Netz senkrecht oder nur mit leichter schräger Neigung (bis zu 30°) aufstellen, spannt sie das ihrige wagerecht aus und führt vom Mittelpunkt zum Rande mehrere gezackte breite Bandstreifen. Diese sollen natürlich nur das leichte Gewebe besser stützen und versteifen, und man darf dabei nicht etwa an einen Schönheitsinn der Spinne denken, so reizend ihr Kunstwerk für das menschliche Auge auch aussieht. Fast noch hübscher ist das Netz einer weiteren amerikanischen Art. Es wird nämlich durch unten verankerte, scharf angespannte Fäden in eine prachtvolle Glocken- oder Kuppelform gezogen.
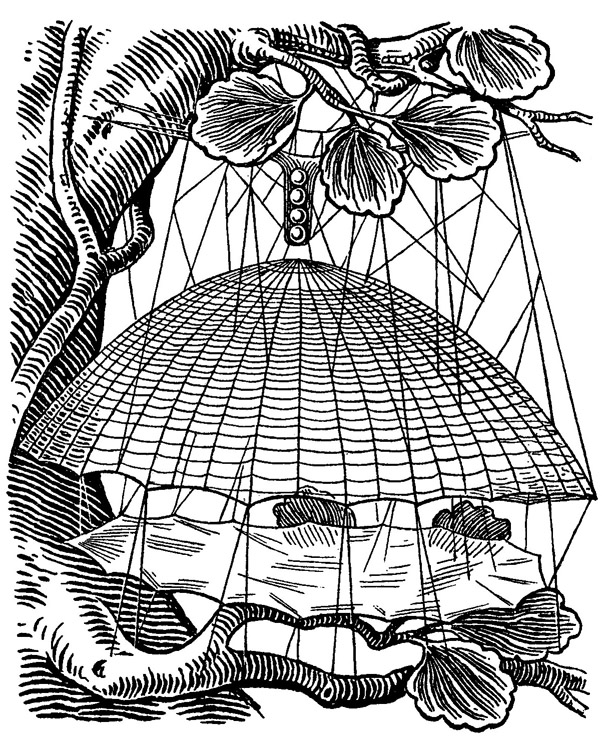
Abb. 29. Netz der Glockenspinne(nach Ellis).
Oben an der Kuppel befinden sich in einer länglichen Röhre die Eikokons und das Ganze erhält dadurch das Aussehen eines umgekehrten Regenschirms (Abb. 29). Geradezu raffiniert verfährt die gern in Felsspalten hausende Strahlenspinne. Sie befestigt nämlich nach Ellis an ihrem Netz einen sehr starken Faden und nimmt diesen zu ihrer Warte mit sich, wo sie ihn straff anzieht und wie das Garn von einer Strähne so weit als möglich zu einem Knäuel aufwickelt, den sie mit sämtlichen Füßen festhält (Abb. 30). Verrät ihr nun die Erschütterung des Fadens, daß ein Opfertier das Netz berührt hat, so läßt sie die Fangleine rasch mit den Vorderfüßen los und hält sie nur noch mit den Hinterfüßen fest. Dadurch verlängert sich plötzlich die Fangleine, und das verderbliche Netz klappt über dem Beutetier zusammen. Ich muß dabei unwillkürlich an unsere Krähenfänger auf der Kurischen Nehrung denken, die ja ganz ähnlich verfahren.
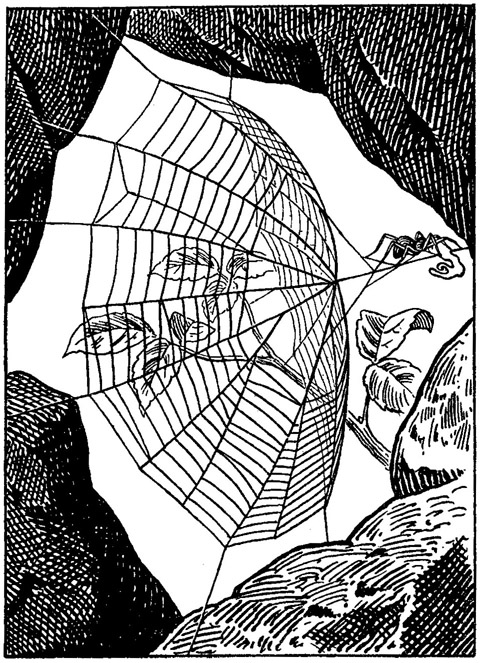
Abb. 30 Netz der Strahlenspinne (nach Ellis).
Wesentlich andere Netze bauen die Baldachinspinnen, deren bekanntester Vertreter unsere gewöhnliche Hausspinne ist. Wir wissen ja, daß sie im Winkel der Stubenwände, am liebsten nahe der Decke, ein nach unten gewölbtes Segeltuch ausspannt, das aus filzigem Gewebe besteht und im hintersten Winkel zu einem Wohntrichter sich verengert. Hinterlistig kann man dieses Netz eigentlich kaum noch nennen, denn es ragt wie das Bramsegel eines Mastes offen und weithin sichtbar hervor. Wenn es auch nicht so kunstvoll ist wie die Bauten der Kreuzspinne, so geht doch auch die Hausspinne bei seiner Anlage mit einer gewissen Überlegung vor, weiß sich den verschiedensten Örtlichkeiten anzupassen und ihre Netzform entsprechend abzuändern. So fand Herman ihre Wohnröhren an fünf Seidenschlingen frei an der Decke aufgehängt, und das Fangsegel in der gleichen Weise offen davor ausgebreitet. Viele Baldachinspinnen halten ihr Gewebe dadurch in Spannung, daß sie den Eikokon an ihm aufhängen und ihn häufig noch durch eingewebte Steinchen und dgl. beschweren. Ein ähnliches Segelnetz verfertigen die Linyphia-Arten, indem sie das Segel im Heidekraut oder Waldgestrüpp wagerecht ausspannen und selbst lauernd auf seiner Unterseite sitzen. Um nicht den brennenden Sonnenstrahlen ausgesetzt zu sein, fügen sie der Oberseite des Gewebes bisweilen einige trockene Blätter bei. Bei Theridium formosum wird das Segel durch einen Schirm von fingerhutartiger Form vertreten, in den Holz- und Blattstückchen, Samenkörnchen und dgl. eingewebt sind. Das Tier sucht diese Stoffe auf dem Erdboden auf und schleppt sie mühsam 1–2 Meter hoch ins Gesträuch bis zu seiner Wohnung, wobei es sie an einem Hinterfuß befestigt und sorgsam darauf achtet, nirgends anzustoßen. Ist die Last gar zu schwer, so macht die Spinne von Zeit zu Zeit halt und bindet ihr Paket derweil an, so lebhaft an einen Menschen erinnernd, der mit einem allzu schweren Koffer über den Bahnsteig eilt und atemschöpfend stehen bleibt. Allbekannt ist die Labyrinthspinne, eine unserer häufigsten Arten, deren wagerechte Gewebe man überall auf Sträuchern und Hecken antrifft, wo sie in der Morgenfrühe weithin von den anhaftenden Tautropfen funkeln. Sie verengern sich unten zu einem Trichter und schließlich ziemlich plötzlich zu einer Röhre, die aber nicht geschlossen ist, sondern immer ein Ausfallpförtchen hat, durch das die Bewohnerin im Notfall entwischen kann. Oben kreuzt und verwickelt sich alles zu einem Chaos von Schlingen, einem wirren Labyrinth, aus dem ein hineingeratenes Kerbtier nimmermehr herausfindet. Die Trichterspinnen hängen mehr als die Radspinnen an ihrem mit einem großen Aufwand von Spinnstoff hergestellten Gewebe und verlassen es nur im äußersten Notfall, um sich ein neues anzufertigen. Zur Fortpflanzungszeit errichtet nun die weibliche Labyrinthspinne noch einen anderen, kunstvolleren Bau aus weißem, zartem Musselin in Form und Größe eines Hühnereies. Dieser durchsichtige Behälter ist aber nur ein Wachhaus, und erst in ihm finden wir, wie der berühmte Insektenforscher Fabre festgestellt hat, den eigentlichen Eierbehälter, der in Form einer mattweißen Tasche an strahlenförmig verlaufenden Fäden in der Mitte aufgehängt ist und, sorgsam in Watte verpackt, etwa 100 verhältnismäßig große, bernsteingelbe Eierchen enthält. Damit ist aber die mütterliche Sorgfalt der Labyrinthspinne noch nicht erschöpft, denn sie umgibt das Ganze schließlich noch mit einer Lehmschicht, um ihre Nachkommenschaft vor den verderblichen Stichen der Schlupfwespen zu schützen.
Überhaupt stoßen wir bei den Brutgehäusen der Spinnen auf eine nicht minder große Kunstfertigkeit und Mannigfaltigkeit als bei den Fangnetzen, und wer einmal auf solche Dinge zu achten gelernt hat, wird auch in unseren heimischen Fluren geradezu märchenhafte Gebilde von wunderbarer Eigenart, von feenhafter Zartheit und Schönheit entdecken können. Groß ist ja der Haß der Spinnen, aber größer noch ihre Liebe, wenigstens die Mutterliebe, und sie kommt bei der Herstellung dieser Kunstwerke in wahrhaft rührender Weise zum Ausdruck. Die Eikokons haben vor allem den Zweck, durch eine feste wasserdichte Hülle die zarten Eierchen gegen die Unbilden der Witterung zu beschirmen, weiter sie durch möglichste Schutzfärbung und dgl. den scharfen Blicken der Vögel und anderer Feinde zu entziehen, endlich durch dicke Wände die gefährlichen Schlupfwespen abzuhalten. So können wir öfters an Grashalmen der Waldwege rundliche Erdklümpchen erblicken, die man für Kotspritzer halten möchte, wie sie vom Rade eines vorüberfahrenden Wagens gegen die Halme geschleudert werden. Bei näherer Betrachtung fällt uns aber die große Regelmäßigkeit und das gleichartige Material dieser Gebilde auf, und wenn wir sie öffnen, finden wir im Innern die in Seide gehüllten Eier einer Spinne, Agroeca brunnea, die im Moosteppich des Waldbodens eine streng nächtliche Lebensweise führt. Wenn sie ihre Kokons 30–50 cm hoch aufhängt, so geschieht es deshalb, um sie den Nachstellungen einer flügellosen, gleichfalls im Moosteppich wohnenden Schlupfwespe zu entziehen. Die Erdfarbe der Kokons kommt daher, daß sie mit einer Art Zement überzogen sind, den die Spinne in rastloser Arbeit aus Erde und Lehmkrümchen unter Zusatz von klebrigem Speichel und Spinnstoff anfertigt und zu einer sehr festen betonartigen Masse verknetet, da sie ja sonst vom ersten tüchtigen Regenguß aufgelöst werden würde. In einer Nacht spinnt das Tier die eigentlichen Kokons, in einer zweiten überzieht sie sie mit der Lehmschicht. Solange das noch nicht geschehen ist, sehen die Gebilde, die die Form eines winzigen umgedrehten Weinglases von etwa 5 mm Länge haben, wunderhübsch aus, und nicht umsonst hat das in seinen Ausdrücken oft so glückliche Volk sie als »Feenlampen« bezeichnet. Das Innere dieser Feenlampen weist zwei Abteilungen auf, wovon die eine zur Aufbewahrung der Eier, die andere als erster Aufenthalt für die Jungen dient. Die Einhüllung in Lehm hat wohl weniger den Zweck der Schutzfärbung als vielmehr den, die Eier für den Stachel der Schlupfwespen unzugänglich zu machen. Wo die Schicht zu dünn aufgetragen wurde oder abbröckelte, findet man oft genug Schlupfwespen im Innern. Natürlich haben die Jungen Mühe, sich aus dieser harten Hülle herauszuarbeiten, und bringen es nur nachts fertig, wenn das Gebilde vom Tau durchfeuchtet und weicher geworden ist. Hebt man dagegen die Kokons im trockenen Zimmer auf, so können die Jungen nicht ausschlüpfen, ja nicht einmal die kräftigeren, etwa vorhandenen Schlupfwespen, sondern die ganze Gesellschaft stirbt ab.
An der abstehenden Rinde alter Bäume sieht man nicht selten hemdknopfartige, atlasweiße Körperchen, nämlich die Eikokons der kleinen Atlasspinne (Clubiona holosericea). Zur Paarungszeit hausen beide Geschlechter dieser Spinnen ganz friedlich in einem gemeinsamen Wohnsack, der nur durch eine gesponnene Scheidewand in zwei Lagerstätten getrennt ist, und auch die Eier und Jungen werden gemeinsam von den Eltern bewacht, die sich also ganz gut vertragen. Sonst schweift gerade dieses Spinnchen nach Vagabundenart umher und frißt dabei mit Vorliebe die Eier anderer Spinnen. In noch ausgesprochenerem Maße tun dies die amerikanischen Mordspinnen, die, ihrem Namen entsprechend, überhaupt mörderisch über jede andere Spinne herfallen. Theridium formosum baut einen zuckerhutförmigen Eikokon und tapeziert seine Wände mit Holzstückchen, Sämereien und dgl. aus oder behängt sie mit ausgesogenen Kerfen wie ein Indianer seinen Wigwam mit den Skalpen erschlagener Feinde. Man darf dabei aber nicht etwa an den Schönheitsinn der Laubenvögel denken, sondern auch hier hat diese Ausschmückung offenbar nur den Zweck, den Kokon unscheinbar zu machen und ihn seiner Umgebung anzupassen. Die Erdkrümchen und Pflanzenreste werden deshalb auch immer nur der nächsten Nachbarschaft entnommen. Ähnlich verfährt Enyo germanica, die ihre erbsengroßen, backofenförmigen Wohnungen in der gleichen Weise austapeziert. Noch schönere Eikokons finden wir in den Tropen und in Nordamerika. Da ist vor allem die Korbspinne zu nennen, deren 1000 Eierchen in einem silberweißen, aber zähen Kokon untergebracht sind, der die Form einer zierlichen Weinkaraffe hat und mit goldenen Fäden an den umstehenden Halmen aufgehängt wird (Abb. 31).

Abb. 31. Kokon der Korbspinne (nach Ellis).
Eine andere Art derselben Gattung ( Argyope) verfertigt Kokons von Becherform, deren oft zwei übereinander stehen, jedes oben mit einem gezackten Deckel von goldgelber Seide fest verschlossen (Abb. 32). Die Schwanzspinne (Abb. 33) läßt in ihrem Radnetz den Zwischenraum zwischen zwei Speichen frei und hängt hier perlenförmige, erbsengroße Eiernestchen zu drei bis acht übereinander auf, während die sorgsame Mutter wachehaltend im Mittelpunkte des Netzes sitzt, also unmittelbar vor dem ersten Kokon. Viele dieser Spinnenarten begnügen sich übrigens nicht mit dem Wachehalten, sondern bleiben auch später noch als Hüterin bei den Jungen, vergrößern im Bedarfsfalle die Kinderstube durch einen weiteren Anbau und füttern auch die Kleinen mit Blattläusen oder winzigen Ameisen. So ließe sich noch eine große Menge der wundervollsten Kokongebilde auszählen, wenn der Platz dazu ausreichen würde. Aber jeder kann bei seinen Streifereien in Wald und Flur in dieser Beziehung sehr hübsche Entdeckungen machen, wenn er nur die Augen offen hält und überhaupt Sinn und Verständnis für solche unansehnliche und kleine Geschöpfe hat.
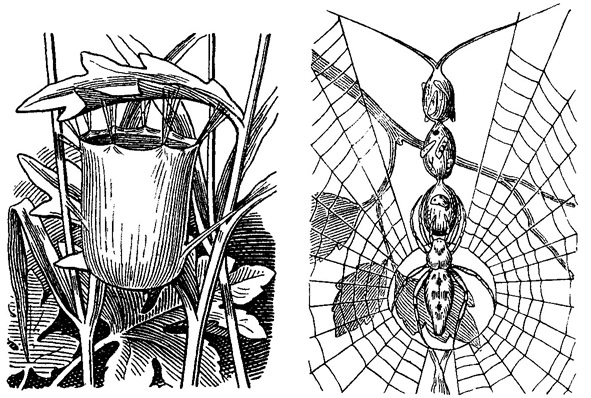
|
|
|
Abb. 32. Kokon der Argyope (nach Ellis). |
Abb. 33. Kokons der Schwanzspinne (nach Ellis). |
Die Röhrenspinnen hausen im allgemeinen ähnlich, wie wir dies schon von den Wolfspinnen und Taranteln kennengelernt haben. Viele bauen oben an der Röhrenmündung aus zusammengesponnenem Genist einen Schutzwall gegen das Regenwetter und erhöhen ihn wohl gar zu einem kleinen Türmchen, das dann auch als Aussichtswarte dienen muß. Besonders merkwürdige Vertreter dieser Gruppe sind aber die hauptsächlich in Südeuropa heimischen Minierspinnen, die ihre Wohnröhre mit einer richtigen Falltür zu verschließen gelernt haben (Abb. 34). Diese Tür wird aus mehreren Schichten von Erd- und Spinnmasse gebildet und oben mit Sand oder Erdkrümchen überkleidet, so daß sie sich in keiner Weise von ihrer Umgebung abhebt. Sie geht in richtigen Angeln aus Seidenfäden und fällt von selbst wieder zu, wenn die Spinne ihre Behausung verläßt. Der Klausner ist zu bequem, seine Haustür zu verschließen, und würde sie offen stehen bleiben, so wäre der Schlupfwinkel des einsiedlerischen Tierchens ja bald verraten. Will man eine solche Tür aufheben, so muß man dazu ziemliche Gewalt anwenden, denn die auf der Innenseite sitzende Spinne hält sie kräftig zu, wobei sie ihre Füße in zu diesem Zwecke freigelassene Grübchen der Türwand stemmt. So dicht ist der Verschluß, daß weder Staub noch Wasser eindringen können. Am liebsten graben die Minierspinnen an steilen Abhängen, auf denen sich kein Regenwasser ansammeln kann, ihre 30-60 cm tiefen, strumpfförmig gestalteten Wohnröhren, die ihrer ganzen Länge nach mit schimmernder Seidentapete ausgeschlagen sind. Einige Zentimeter unter der Erde zweigt sich von dem Röhrengange noch ein zweiter ab, der schräg aufwärts führt und von dem Hauptgange durch eine zweite Falltür getrennt ist. Dringt also wirklich ein Gegner in die Hauptröhre ein, so kann die Spinne immer noch in den Notgang flüchten und dürfte hier in den allermeisten Fällen vor jeder Gefahr geborgen sein. So sehr ist dieses Tier dem Leben in unterirdischer Kellerluft angepaßt, daß es sich draußen nur bei Nacht wohl fühlt, bei Tage dagegen bald matt und kraftlos wird, ja wie gelähmt erscheint, wenn man es den Sonnenstrahlen aussetzt.
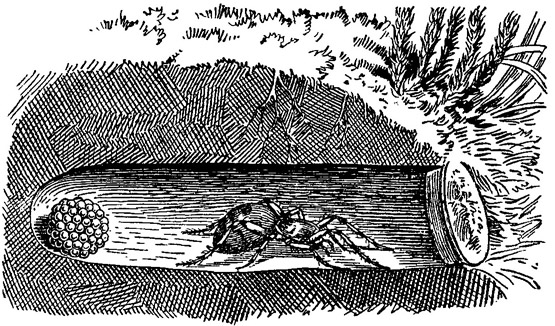
Abb. 34. Wohnröhre der Minierspinne (nach Hesse-Doflein).
Nicht minder merkwürdig ist eine andere einheimische Spinne, die Wasserspinne (Abb. 35), die ihrem Namen gemäß als einzige Vertreterin ihrer Familie dem Leben im Wasser sich angepaßt hat, wo sie mit der Gewandtheit eines Schwimmkäfers herumschwimmt und dabei die kräftigen Beine als Ruder braucht. Trotzdem sind ihre Atmungsorgane auf die atmosphärische Luft angewiesen, aber sie kommt nicht nach Art der Molche zu jedem Atemzuge luftschnappend an die Oberfläche empor, sondern verfährt ungleich pfiffiger, indem sie einen atembaren Luftvorrat im Wasser selbst sich anlegt. Ermöglicht wird ihr dies durch das zwar kurze, aber sehr dichte, samtartige Haarkleid ihres Körpers, zwischen dem Luftteilchen haften bleiben, wenn die Spinne zur Oberfläche emporkommt und den Hinterleib herausstreckt. Die Luft sammelt sich dann beim Wiedereintauchen in Gestalt einer großen Blase am Hinterleib an und wird wohl noch von einem durch besondere Drüsen abgesonderten Firnis überzogen, jedenfalls aber durch einen Seidenfaden verankert, so daß die Blase nicht wieder nach oben emporsteigen kann. Die Wasserspinne lebt hauptsächlich in stehenden oder recht langsam fließenden Gewässern mit recht viel Wasserlinsen, Dickichten von Utricularia und dgl., sowie reichem Kleintierleben und erbaut sich hier aus dünnem, aber sehr dichtem und vollkommen undurchlässigem Gewebe eine glocken-, tassen-, birnen- oder urnenförmige Behausung von der Größe einer Walnuß, die mit Haltetauen an einigen Wasserpflanzen verankert wird. In diese Wohnglocke bringt sie die gesammelten Luftblasen, bei deren Abstoßen die Beine mithelfen, und sitzt dann vergnüglich in ihrem Palast, den atmenden Hinterleib in der Luft, den Vorderkörper im Wasser. Im grünlichen Wasser schimmert die Wohnglocke wie reines Silber und bietet so dem Auge des Naturfreundes einen entzückenden Anblick. Ist die in ihr enthaltene Luft ausgenützt, so läßt die Spinne sie durch einen in die Glockenwand genagten Riß entweichen, flickt alsbald den Spalt wieder zu und holt frische Luft herbei. Einige am Eingang ausgespannte Fangfäden müssen den Nahrungsunterhalt verschaffen, und wenn zu wenig Beutetiere in die Nähe kommen, zieht die Spinne auch frei auf Raub aus. Sie geht zu diesem Zwecke ebenso wie zur Häutung gelegentlich auch einmal an Land, um eine Fliege oder Mücke zu erhaschen, doch konnte ich bei im Aquarium gehaltenen Wasserspinnen feststellen, daß sie sich mit Dipteren allein auf die Dauer nicht ernähren lassen, sondern unbedingt auch richtige Wassertiere haben müssen, also Mückenlarven, kleine Krebschen und dgl., vor allem aber Wasserasseln, die ihr Hauptwild bilden. Dagegen werden Schnecken, selbst die kleinsten, nie belästigt, wohl aber überwintert die Wasserspinne gern in leeren Schneckenhäusern, deren Eingang sie zuspinnt. Während die Männchen sich gegenseitig Eifersuchtskämpfe liefern, leben die Ehegatten friedlich beisammen und hängen ihre Luftschlösser an benachbarten Stengeln auf. Der Silberpalast muß aber nicht nur als Wohn- und Eßzimmer und Speisekammer dienen, sondern auch als Kinderstube. Bei der großen Zahl der Kleinen wird dann die Atemluft natürlich rasch verbraucht. Während sich nun die Jungtiere fest an die Wände der Wohnung klammern, wird diese von der Mutter aus der senkrechten Lage in eine wagerechte gebracht, worauf die ganze schlechte Luft mit einem Ruck entweicht und die alte Spinne nun schleunigst frische herbeiholt.
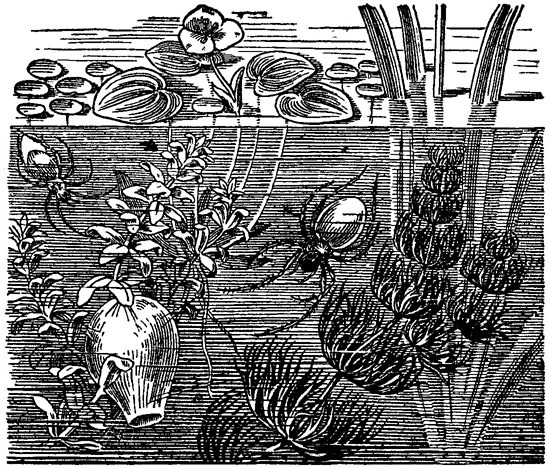
Abb. 35. Wasserspinne mit Wohnglocke.
Obwohl der Prophet Jesaias warnend sagt: »ihr Spinnweb tauget nicht zu Kleidern«, liegt es doch nahe, an die Verwertung der schönen Spinnenseide auch für menschliche Zwecke zu denken. Schon in einem alten Schmöker aus dem 17. Jahrhundert ist zu lesen, daß einmal bei Merseburg die ganze Gegend von »bläulichem« Spinngewebe überzogen war, und daß die Frauen zum Andenken an dieses Ereignis sich Strumpfbänder und dgl. daraus webten. In der Tat besitzt Spinnenseide trotz ihrer außerordentlichen Feinheit (die Fadenstärke beträgt nur 1/5 der gewöhnlichen Raupenseide) eine größere Festigkeit als diese, eignet sich sehr gut zum Verweben und liefert ein prachtvolles, schön glänzendes Fabrikat. Freilich sind 90 Spinnenfäden erforderlich, um die Stärke eines Seidenfadens zu erzielen, und 18000, um einen starken Nähfaden herzustellen. Der Raum verbietet es, hier näher auf die mannigfachen und wechselvollen Bestrebungen einzugehen, die schon zur planmäßigen Gewinnung von Spinnenseide unternommen worden sind. Ein französischer Beamter, Bon de Saint-Gilaire, war der erste, der 1709 mit solchen Vorschlägen an die Öffentlichkeit trat, aber der damals noch junge, später so berühmt gewordene Reaumur ließ ihm eine derbe Abfertigung zuteil werden, die allerdings in mancher Beziehung auch über das Ziel hinausschoß. Später hat der spanische Abt Termeyer die Sache wieder aufgenommen, aber trotz 30jährigen Experimentierens vermochte er doch nicht mehr als 673 Gramm Spinnenseide zu sammeln. Inzwischen sind namentlich auf den Pariser Weltausstellungen öfters schon Handschuhe und andere Gegenstände aus Spinnenseide zur Schau gestellt worden, einmal sogar ein ganzes Brautkleid. Billig sind solche Dinge freilich nicht, da das Kilo Gespinst auf 2000 Franken zu stehen kommt, aber dafür sollen sie um so dauerhafter sein. Etwas aussichtsvoller gestaltete sich die Sache, als der Missionar Camboué in Madagaskar die großen tropischen Arten der Gattung Nephila (Abb. 36) heranzog und namentlich auch ihre Eikokons nutzbar machte, die immerhin durchschnittlich je ½Gramm Seide liefern.

Abb. 36 Nephila madagascariensis.
Der Genannte gewann von einer Spinne in zehn Tagen einen Faden von 1900 m Länge, von einer anderen in 27 Tagen 4000 m. Er klemmte zu diesem Zweck die Tiere in hohle Korkstückchen ein, so daß der Hinterleib hervorsah, hielt ihnen eine Fliege vor, so daß sie instinktiv Faden schießen ließen, fing diesen auf einer Haspel auf und wickelte ihn ab (Abb. 37). Neuerdings hat man diese Methode sehr vervollkommnet und kann mit einer solchen Vorrichtung einer ganzen Anzahl von Spinnen gleichzeitig den Faden entziehen, sowie die Fäden zu einem einzigen zusammendrehen (Abb. 38 u. 39). Die Fadenfestigkeit beträgt bei 17° C und 68° Luftfeuchtigkeit 3,26 g, die Elastizität 12,5 %. Obschon der Spinnenseide der Seidenleim vollständig fehlt, sind doch ihre Hauptbestandteile dieselben wie bei der Raupenseide, also Glykol, Alanin und Tyrosin. Trotz alledem wird es wohl kaum jemals zur Bildung einer »General-Spinnweb-Seidenfabrik- Aktiengesellschaft« kommen, denn die Haltung und Fütterung der Spinnen, die ja nur lebendes Getier verspeisen wollen, ist an sich schon viel zu umständlich. In den Tropen wäre bei billigen Arbeitskräften noch am ehesten an so etwas zu denken, und Spinnenseide da zu verwenden, wo es besonders auf Haltbarkeit und Elastizität ankommt, also etwa bei der Luftschiffahrt, oder auch da, wo Frauen reicher Geldleute besonderen Wert auf eine sehr schöne, kostbare und seltene Seide legen. Bis vor kurzem hat man die Spinnenseide vielfach auch als Mikrometerfäden in optischen Instrumenten an Stelle feiner Silberfäden benutzt, da diese immer noch 0,028 mm Durchmesser haben, die feinsten Spinnenfäden dagegen nur 0,0068–0,0034 mm.
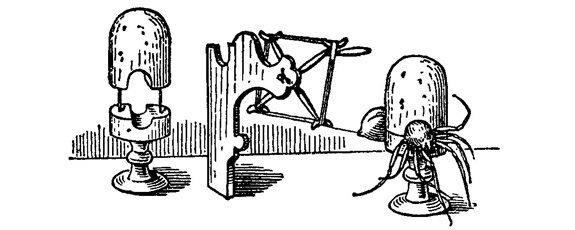
Abb. 37. Einfache Vorrichtung zur Gewinnung von Spinnseide.
Mehr in die Augen springend ist der Nutzen, den uns die Spinnen durch Vertilgung zahllosen Ungeziefers gewähren, indem die Natur sie als regulierende Kraft gegen allerlei sonst übermäßig sich vermehrendes Kleingetier eingesetzt hat. In der Tat vermögen die Spinnen für solches Geschmeiß geradezu eine undurchdringliche Wand zu bilden, wobei sich die einzelnen Arten gegenseitig in ihrer Wirksamkeit aufs beste ergänzen. So sehen wir z. B. im Sumpfgelände alles mit mückenfangenden Spinnen besetzt: oben in den Rohrhalmen und -kolben weben die Rohrspinnen ihre Netze, und so geht es hinunter bis ins Wasser, wo die Wasserspinne ihr Wesen treibt und die Mückenlarven wegfängt. Auch alle Zwischenräume sind ausgefüllt von den an den Sumpfpflanzen herumkletternden Wolf- und Luchsspinnen, und auf der Wasserfläche selbst treibt das Piratenschiff der Floßspinne. Ähnlich verhält es sich im Hause von der Winkelspinne des Dachbodens an bis zur Kellerspinne. Ebenso sind die Tages- und Nachtzeiten unter die einzelnen Arten verteilt, und so vermögen die Spinnen tatsächlich manche Örtlichkeiten für den Menschen überhaupt erst bewohnbar zu machen.

Abb. 38. Verbesserte Vorrichtung zur Gewinnung von Spinnseide: Kasten mit eingespannten Spinnen.
Auch ihre hygienische Bedeutung möchte ich nicht unterschätzt wissen, denn als Mückenvertilger tragen sie sicherlich viel zur Bekämpfung der gefährlichen Malaria bei. Bekannt ist ferner das Geschichtchen von dem Manne, der an seinem Obstspalier rücksichtslos jede Spinne tötete und zur Strafe dafür niemals Obst erntete, weil eben alles durch das in Abwesenheit der Spinnen unheimlich sich vermehrende Ungeziefer vernichtet wurde. Auch weiß jeder Pferdepfleger, daß die Pferde in einem Stall mit viel Spinnen sich ungleich wohler fühlen, weil sie dort naturgemäß viel weniger von den Fliegen gequält werden. Und dem Schriftsteller, der an einem schönen Sommertage in der Gartenlaube an seinem Buche arbeiten will, rate ich dringend, die Spinne, die an der Fensteröffnung ihr Netz webt, ungeschoren zu lassen. Es kommen dann keine lästigen Fliegen und Mücken herein, denn das Spinnennetz ersetzt vollkommen ein Gazefenster. Eigentlich sollte man die Spinnen auch im Hause schonen, wenn sie sich nicht gar zu breit machen; sie selbst bringen ja keine Unreinlichkeit mit sich, wohl aber ist ihre Anwesenheit meist ein Zeichen schon vorhandener Unreinlichkeit und Vernachlässigung.
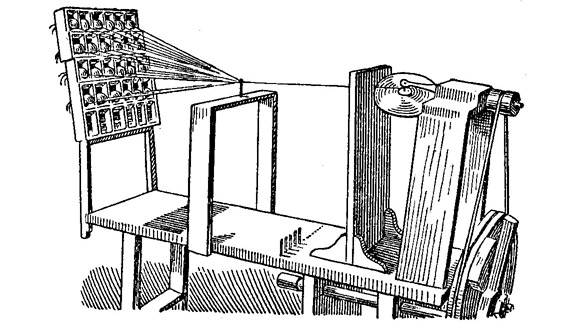
Abb. 39. Verbesserte Vorrichtung zur Gewinnung von Spinnseide: Spulapparat.
Der weise König Salomo duldete auch nicht, daß die Spinnen mit dem Kehrbesen aus seinem Palaste vertrieben wurden, empfahl sie vielmehr den Höflingen als Muster des Fleißes, der Klugheit, Enthaltsamkeit und Tugend. Ebenso hatte Aristoteles, dieser umfassendste Geist des Altertums, eine gewisse Vorliebe für die Spinnen, die als Sinnbild großer Kunstfertigkeit und umfassenden Fleißes der Athene Ergane, der werktätigen Göttin, geheiligt waren. Im finsteren Mittelalter dagegen wurde die Spinne ein Gegenstand des Abscheus und galt als giftiges Tier, dem man allerlei alberne Märchen andichtete, und erst 1678 betrat der Engländer Lister den verachteten Spinnen gegenüber wieder den Weg objektiver Forschung, und der biedere Thomas Muffet meinte sogar, die Spinnen hätten eine feine Haut wie die zarten Mädchen und feine lange Finger wie die schönen Jungfrauen. Und in der Tat müssen dem, der ein Auge für solche Dinge besitzt, auch die verachteten Spinnen in ihrer Art schön und vollendet erscheinen, jedenfalls ihre Organisation hochinteressant und ihre an wunderbaren Eigentümlichkeiten reiche Lebensweise überaus fesselnd.