
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
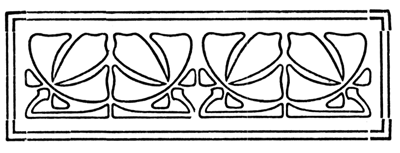
Ein klarer, schöner Wintertag mit mäßigem Frost und frischem Neuschnee. Keusch und rein, in flimmernder Pracht steht er da, unser herrlicher deutscher Wald, die dunkelgrünen Nadelzweige wie überzuckert von den zierlichen Schneekristallen; von köstlicher Frische ist die Luft, wolkenlos der Himmel, und die Sonnenstrahlen vermögen wohl alles in die denkbar schärfste Beleuchtung zu rücken und das Auge förmlich zu blenden, aber noch nicht zu erwärmen. Leise knirscht der Schnee unter unseren Füßen, sonst aber ist es still im Walde, totenstill wie auf einem Friedhofe, daß man fast das Zweiglein zu Boden taumeln hört, das sich dort von einer alten Kiefer losgelöst hat. Der Wind schläft im schneebeladenen Geäst, und eine fast andachtsvolle Stimmung überkommt den einsamen Wanderer. Lange muß er gehen in dieser hehren Einsamkeit, bis einmal das leise »Sitt sitt« eines herumschweifenden Meisenschwarms an sein Ohr dringt oder das kräftige Gelock der Kreuzschnäbel oder die wehmütig-süßen Flötenrufe der Gimpel. Aber welch entzückender Anblick, wenn dieser behäbige Vogel selbst in den dichten Nadelbüschen sichtbar wird und seine brennend rot gefärbte Brust sich so wundervoll abhebt von dem glitzernden Silberweiß der die Zweige deckenden Schneelast! Ja, schön ist unser deutscher Wald auch zur rauhen Winterszeit, schön und eigenartig selbst dann noch, wenn düsteres Gewölk den Himmel deckt, eisige Nordwinde heulend an den dürren Wipfeln rütteln und sie ächzend aneinanderschlagen, wenn der Schneesturm markerstarrend über die Fluren fegt und der wilde Flockentanz jeden Blick in die Ferne benimmt und alles Leben zudeckt mit dem weiten, weißen Leichentuche.
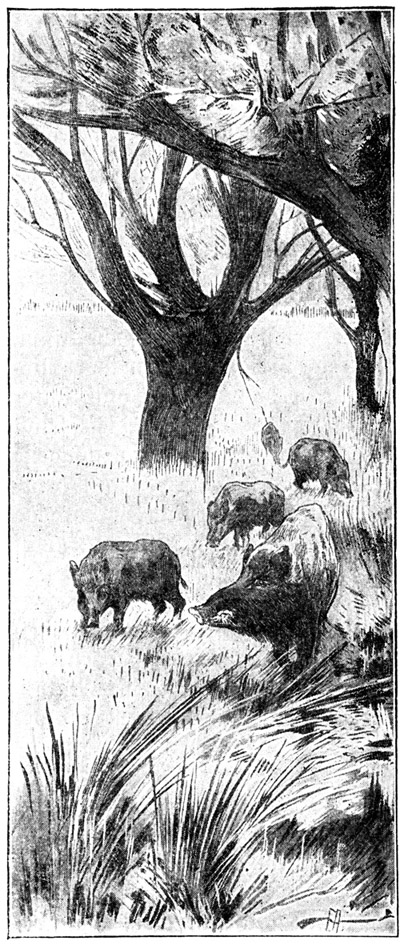
Aber ist denn der so oft gebrauchte Vergleich der Schneedecke mit einem Leichentuche wirklich richtig? Ich glaube kaum, sondern halte ihn sogar für grundfalsch. Das Leben hört niemals auf, sondern kreist und schafft, webt und wirkt auch unter und über der alles verhüllenden Schneedecke. Und diese selbst ist durchaus kein Leichentuch, vielmehr eine weit aufgeschlagene Seite in dem großen Buche der Natur, beschrieben mit deutlichen Lettern, die uns so manches, sonst sorgsam verborgene Geheimnis verraten, die uns erzählen vom unerbittlichen Kampf ums Dasein, von Haß und Mord, aber auch von der Liebe Allgewalt, die sich ihr Zepter auch vom rauhesten Winter nicht entreißen läßt. Man muß es nur verstehen, mit offenen Sinnen und kundigen Augen zu lesen in diesen Zeilen, die Geheimschrift zu entziffern mit dem scharfen Blick des Naturbeobachters. Der Förster, der dort am Waldessaum in Begleitung seines treuen »Karo« so vergnüglich einherstapft, die qualmende Pfeife zwischen den Lippen, der versteht's, der weiß, daß ein solcher Neuschnee ihm das Vorhandensein so manches Raubtieres verraten muß, das durch seine versteckte und nächtliche Lebensweise bis dahin aller menschlichen Aufmerksamkeit entgangen war. Auch das scheueste Tier muß notgedrungen nächtlicherweise auf Nahrung ausziehen und dann wohl oder übel seine Spur im Neuschnee hinterlassen.
Deshalb ist die Fährtenkunde nicht nur für den weidgerechten Jäger, sondern auch für den angehenden Naturforscher ein so überaus wichtiges Hilfsmittel. Wir alle wissen ja aus den Indianergeschichten unserer Knabenjahre, bis zu welch unglaublicher Vollkommenheit menschlicher Scharfsinn die Fährtenkunde auszubilden vermag, und auch unter den Grünröcken vom alten Schlage ist noch so mancher, der uns nach einem kaum sichtbaren Fußabdruck nicht nur den Namen des Tieres, sondern auch sein Alter und Geschlecht und manches andere mit vollster Sicherheit mitteilen kann. Ganze Geschichten vermag uns eine solche Fährte am frischen Wintermorgen zu erzählen, und im Geiste erleben wir dann alle Stunden des Tierlebens aus der letzten Nacht mit, Stunden ruhelosen Herumtreibens bei knurrendem Magen, Stunden getäuschter Hoffnung und dann das endliche Erblicken eines Beutetieres, das vorsichtig-lüsterne Anschleichen, die zitternde Erwartung, den entscheidenden Sprung, den verzweifelten Kampf, das gierige Schlürfen des dampfenden Blutes, das wollüstige Schwelgen im lang entbehrten Überfluß. Hierauf das gespannte Lauschen nach dem durch den verschneiten, nächtlich-stillen Wald tönenden Sehnsuchtsruf der Liebe, den Dauerlauf durch dick und dünn zum Stelldichein, die Rauferei mit dem Nebenbuhler, die gemächliche Rückkehr bei grauendem Tageslicht an der Seite der Erkorenen und in erbittertem Kampfe Erstrittenen nach der schützenden Höhle – all diese Bilder vermag das kundige Auge aus den kreuz und quer verlaufenden Fährten im jungen, lockeren Schnee herauszulesen, während der Großstädter, dessen abgestumpfte Sinne der Natur entfremdet sind, achtlos daran vorüberschlendert.
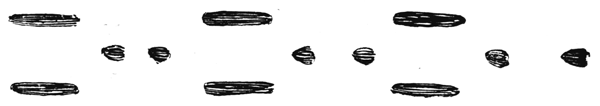
Abb.1 Hoppeln des Hasen
Unsere Bilder werden besser als langatmige Beschreibungen dem Leser die Fährten unserer wichtigsten Säugetiere veranschaulichen. Hier ist ein Hase in aller Seelenruhe über den Waldweg gehoppelt und hat dabei eine Fährte hinterlassen, die so charakteristisch ist, daß sie auch vom Laien mit keiner anderen verwechselt werden kann. Das Mißverhältnis seiner schwachen und kurzen Vorderfüße zu den langen und kräftigen Hinterfüßen ist so groß, daß er diese nicht unabhängig voneinander bewegen kann, sondern sie immer gleichzeitig nebeneinander über die hintereinander gestellten Vorderfüße hinweghebt. Beim gemächlichen Hoppeln berühren die Hinterläufe mit der ganzen Sohle den Boden und hinterlassen deshalb im Schnee einen länglichen Strich (Abb. 1). Ist aber der jederzeit ängstliche Freund Lampe durch irgend etwas erschreckt worden, ergreift er in weiser Vorsicht das Hasenpanier und saust er nun mit größtmöglicher Geschwindigkeit dahin, dann treten auch die Hinter»läufe« nur mit der Spitze auf und kommen etwas schräg hintereinander zu stehen, so daß die Fährte so wie auf unserer Abb. 2 aussieht. Ganz ähnlich nimmt sich auch die Fährte des Kaninchens aus, nur daß alle Größenverhältnisse entsprechend kleiner sind. Hier verrät uns die Schneefläche auch gleich noch, was den Hasen veranlaßte, sich so plötzlich in Galopp zu setzen. Meister Reineke war beutelüstern herangeschlichen, hatte es aber für diesmal doch versehen, und Lampe vermochte sein vielverfolgtes Leben noch in Sicherheit zu bringen. Gewöhnlich bewegt sich der Fuchs in einer Art Trab, die in der Weidmannssprache als »Schnüren« bezeichnet wird und insofern eine leicht kenntliche Fährte liefert, als dabei die einzelnen Tritte fast genau hintereinander stehen, also etwa den Eindruck machen als wären sie an einer Schnur aufgereiht (Abb. 3). Damit ist zugleich auch ein gutes Unterscheidungsmerkmal gegenüber der Spur gleichgroßer Hunde gegeben, denn der Hund »schränkt«, d. h. er stellt im Trabe den Körper schief zur Bewegungsrichtung und setzt Vorder- und Hinterlauf derselben Seite schief nebeneinander. Anders gestaltet sich auch beim roten Freibeuter das Bild, wenn er flüchtig wird, wo dann die Vorder- und Hinterfüße schräg nebeneinander gestellt werden, also etwa die Form eines Paralleltrapezes entsteht (Abb. 4,1) Hier bekommen wir Abdrücke sowohl der Vorder- wie der Hinterpfoten zu sehen, die sich dadurch unterscheiden, daß jene am Hinterballen nach innen eingebuchtet, diese dagegen nach außen abgerundet sind. Beim ruhigen Schnüren dagegen bedeckt der Fuchs die Tritte der Vorderfüße mit denen der Hinterfüße, so daß nur diese sichtbar bleiben. Liegt der Schnee recht hoch, so gewahrt man auch wohl noch den Eindruck, den der buschige Schwanz, die »Standarte«, dieses Mephisto unter den Tieren, beim Nachschleifen auf seiner Oberfläche hinterlassen hat. Da der weniger geschulte Beobachter die Fuchsspur leicht mit der Hundespur verwechseln könnte, stellen wir hier beide im Bilde einander gegenüber, wo die schlankere, mehr ovale Rundung der Fuchspfote und ihre schärferen Nägel sofort in die Augen fallen (Abb. 5).

Abb. 2 Fluchtspur des Hasen.

Abb. 3. Schnüren des Fuchses.

Abb. 4. Verschiedene Fährten (1 = Fuchs, 2 = Iltis, 3 = Reh, 4 = Hirsch).
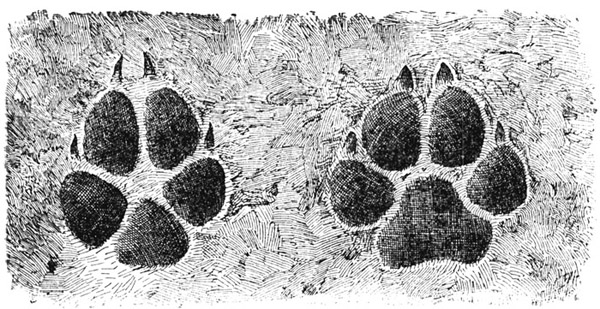
Abb. 5. Spur des Fuchses und des Dachshundes.

Abb. 6. Tritt der Wildkatze.
Während sich also bei Fuchs und Hund die Klauen mit abdrücken, ist dies bei der noch runderen Fußspur der Katze nicht der Fall (Abb. 6), da sie ja die Krallen beim Laufe einzieht, sie aber sofort hervorstreckt, sobald sie an einem Baumstamme angelangt ist und hier aufwärts klimmt, wo man die von den nadelscharfen Krallen beim Einschlagen in die Rinde hinterlassenen Spuren gewöhnlich recht gut erkennen kann. Je größer eine solche Katzenspur ist, um so eher liegt die Möglichkeit vor, daß wir der echten, in unseren Wäldern schon so selten gewordenen Wildkatze hinter ihre Schliche gekommen sind.
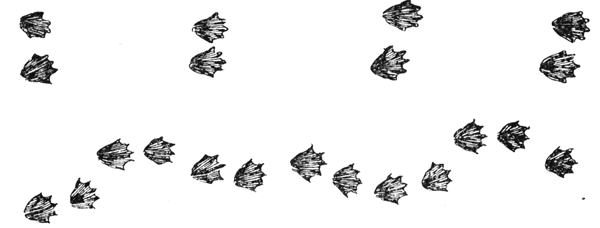
Abb. 7. Spur des Fischotters, oben Sprungspur, unten Schrittspur.
Auch der Fischotter, der eifrig verfolgte Mitbewerber unserer Fischer, schleppt manchmal den Schwanz leicht auf der Schneefläche nach. Das beste und untrüglichste Zeichen seiner dem Jägerauge so willkommenen Fährte ist aber der deutliche Abdruck der sich zwischen den weit auseinandergespreizten Zehen ausbreitenden Schwimmhaut (Abb. 7). Im Sprung hält er die Füße in ziemlich gerader Linie, während die Schrittspur in Gestalt einer Wellenlinie verläuft. Ähnlich nimmt sich auch die Fährte des griesgrämigen Einsiedlers mit dem feisten Hängebäuchlein, des Dachses, aus, nur daß ihr natürlich die Schwimmhäute fehlen. Auch sind die zu zweit schräg hintereinander gestellten Fußtapfen von Meister Grimbart an den auffallend langen Klauenabdrücken sehr kenntlich (Abb. 8).

Abb. 8. Spur des Dachses.
Die abgebildete Fluchtspur des Edelmarders (Abb. 9) könnte ebensogut für die des Steinmarders gelten, da die beiden Marderarten in dieser Hinsicht kaum voneinander zu unterscheiden sind. Da kann nur die Umgebung einen Anhalt gewähren, denn wenn wir im Walde eine Marderspur finden, die zu einem hohen Baume führt, so haben wir es wohl sicherlich mit dem Edelmarder zu tun, während eine zwischen den menschlichen Gehöften verlaufende Spur meist dem Steinmarder angehören dürfte. Unter ganz besonders günstigen Verhältnissen, z. B. auf feuchtem, plastischem Lehmboden, macht sich aber für ein schärfer blickendes Auge doch insofern ein Unterschied geltend, als bei dem in der Regel auch etwas kleineren Tritt des Steinmarders seine nackten Zehenballen etwas schärfer zum Abdruck kommen, als die behaarten des Edelmarders (Abb. 10). Diese vielgewandten Tiere bekunden auch in ihren Bewegungsarten große Mannigfaltigkeit, und deshalb weisen die Marderspuren viele Verschiedenheiten und Unregelmäßigkeiten auf. Charakteristisch aber ist in den meisten Fällen das nahe Zusammenrücken der einzelnen Fußtapsen. Am seltensten wird man Galoppspuren finden, bei denen die Fußtapfen paarweise nebeneinander stehen, denn nur ungern bequemen sich die Marder zu dieser Gangart. Etwas geringer erscheint die Fährte des zur gleichen Sippe gehörenden Iltis (Abb. 4,2). Die einzelnen Fußtapfen rücken hier noch näher zusammen so daß bisweilen ihrer zwei ineinander verfließen. Auch die Fährte des sich meist in schlangenartigen Windungen fortbewegenden Hermelins zeigt in der Regel die Gestalt des Paralleltrapezes (Abb. 11), während bei der entsprechend schwächeren Spur des kleineren Wiesels der Paartritt vorherrscht (Abb. 12).

Abb. 9. Fluchtspur des Edelmarders.
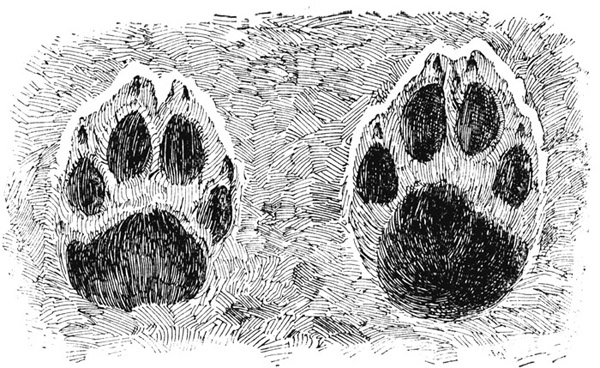
Abb. 10. Tritt des Steinmarders und des Edelmarders, je Vorderlauf.

Abb. 11. Spur des großen Wiesels.
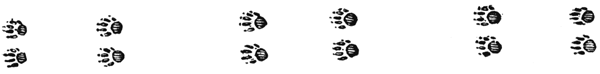
Abb. 12. Spur des kleinen Wiesels.

Abb. 13. Spur des Eichhörnchens.

Abb. 14. Spur der Mäuse.
Ein ziemlich auffallendes Bild liefert die Fährte des Eichhörnchens (Abb. 13). Es hat vorn vier, hinten fünf lange Zehen, die stark auseinandergespreizt werden. Die Hinterbeine sind dabei immer nach außen gerichtet. Das zierliche Tierchen verfügt nur über eine einzige Gangart, in der es die Hinterbeine bei jedem Sprunge seitlich an den Vorderbeinen vorbeiwirft. Zahllose feine Pünktchen im Schnee, die paarweise angeordnet sind, aber sonst kreuz und quer durcheinanderlaufen, verraten uns die Anwesenheit von Mäusen, und man sieht beim Betrachten dieser winzigen Fährten ordentlich das Huschen und Rennen der munteren Nager im Geiste vor sich (Abb. 14). Hirsche zeigen bei ruhiger Gangart die Eigentümlichkeit des »Schränkens«, d. h. die Läufe derselben Körperseite werden nicht auf eine einzige Linie gesetzt, wie es der Fuchs beim »Schnüren« tut, sondern kommen auf zwei parallel verlaufende Gerade zu stehen, deren Abstand voneinander in der Jägersprache als »Schrank« bezeichnet wird (Abb. 4,4). Die einzelnen Abdrücke kommen dabei fast aufeinander zu liegen. Immer lassen die Fährten von Hirsch und Reh den feinen, zweigespaltenen Huf erkennen, und zwar werden beim ruhigen Ziehen die »Schalen« – so nennt der Weidmann die hornigen, gespaltenen Hufe der Hirsche, Rehe, Gemsen und Sauen – eng aneinander gehalten, so daß eine herzförmige Figur entsteht, beim Flüchtigwerden jedoch weit gespreizt, wobei dann auch noch die Afterklauen (die beiden Zehen hinten an jedem Fuß) zum Abdruck gelangen, wie unsere Abb. einer flüchtigen Rehfährte (4,3) erkennen läßt. Im allgemeinen kann man wohl sagen, daß bei den Hirschen und Rehböcken das Schränken stärker zum Ausdruck gelangt, die einzelnen Fußtritte sich also weiter von der Mittellinie des Körpers entfernen, als bei dem weiblichen Wild, den »Tieren« und »Ricken«. F. v. Raësfeld gibt für den Tritt eines starken Bockes und den einer starken Ricke außerdem folgende Unterscheidungsmerkmale an: »Der Tritt des Bockes ist etwa um 2-4 mm breiter als der der Ricke, er ist geschlossen, d. h. die Schalen stehen vorn eng beieinander, und ist stumpfer als der der Ricke, indem die vordere Umrißlinie fast einen Halbkreis darstellt. Der Tritt der Ricke ist dagegen gespreizt und daher weder geschlossen noch stumpf; ihre Ballen drücken sich nur in ganz weichem Boden ab; zwischen den beiden Schalen bleibt fast immer ein ununterbrochener Streifen Erde stehen; die Ricke ›schiebt‹ mehr als der Bock; dadurch wird der Tritt ›unrein‹, unklar, verwischt; da der Bock zudem mehr ›zwängt‹, d. h. mit den Schalen im vertrauten Ziehen den Boden zusammenzieht, auch die Ballen tiefer eindrückt, so ist der ›Burgstall‹ (kleine, längliche Erhabenheit im Abdruck der Schalenhöhlung) bei ihm scharf ausgeprägt, während er bei der Ricke fehlt. Das sind bei der Kleinheit der Tritte zwar nur feine Unterschiede; sie sind aber für denjenigen, der sich die Mühe gibt, sein Auge darauf einzuüben, durchaus erkennbar« (Abb. 15). Werfen wir zum Schluß noch einen Blick auf die Fährte des Wildschweins (Abb. 16), so bemerken wir auch an dessen Fußabdrücken zwei ziemlich weit auseinander klaffende Schalen, von denen die innere wegen stärkerer Abnützung meist etwas kürzer ist, so daß man leicht den linken und rechten Fuß unterscheiden kann. Bei ruhigem Gang wird der Hinterfuß fast auf den Tritt des Vorderfußes gesetzt. Die vier Punkte, die wir bei tieferem Schnee dahinter sehen, rühren von den Afterklauen her.
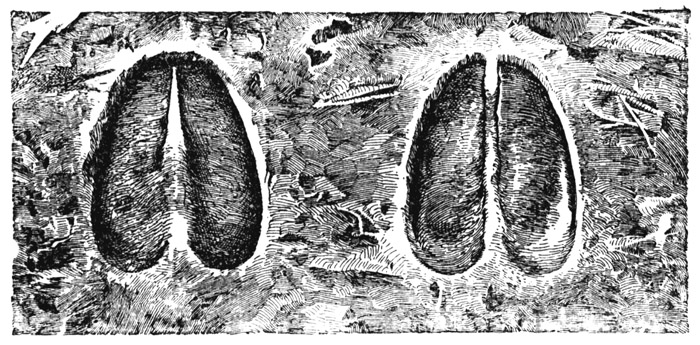
Abb. 15. Tritt des Bocks und der Ricke.

Abb. 16. Ziehen des Wildschweins.
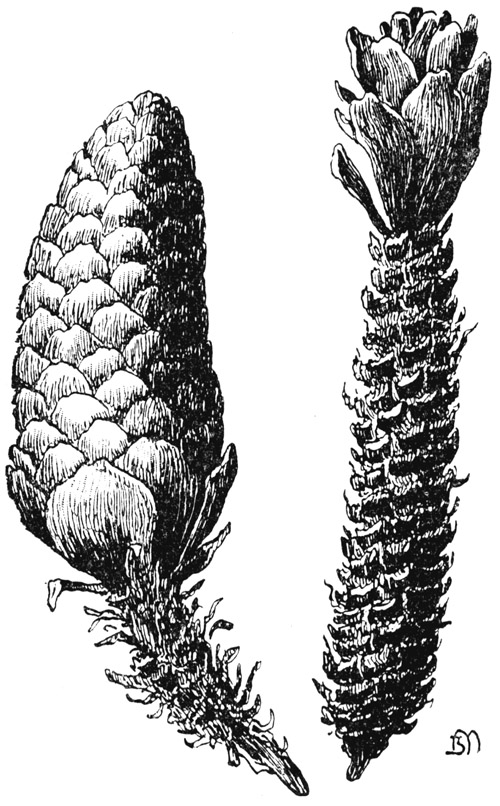
Abb. 17. Vom Eichhörnchen angefressene Fichtenzapfen.
Wer sich erst einmal näher in die Fährtenkunde vertieft hat und in ihre Geheimnisse eingedrungen ist, der wird bald eine große Vorliebe für sie gewinnen, da er bei genügender Schulung imstande ist, mit ihrer Hilfe die reizvollsten Einzelheiten, die feinsten Intimitäten des Tierlebens kennen zu lernen. Und nicht nur im Winter bei Neuschnee leistet sie dem Kundigen die trefflichsten Dienste, sondern er kann sie mit Vorteil auch zu jeder anderen Jahreszeit verwerten, wenn er es nur versteht, solche Plätze ausfindig zu machen, wo die Tiere Spuren zurücklassen müssen. Dies ist z. B. an durchfeuchteten Fluß- oder Teichufern der Fall, an denen das Wild oder das Raubzeug zur Tränke kommt; ferner im losen Sande oder nach Regengüssen auf den aufgeweichten Waldwegen. Der Fährtensucher wird dabei auch die oft sehr kennzeichnende Losung (Exkremente) der einzelnen Tierarten kennen lernen und aus ihrer Zusammensetzung Schlüsse auf die Ernährung ziehen dürfen. Fraßstücke geben ihm einen weiteren Anhalt zur Beurteilung der im Verborgenen hausenden Räuber oder Näscher. Finden wir z. B. auf dem Waldboden Fichtenzapfen, die in der Weise ausgefressen sind wie auf unserer Abb. 17, so dürfen wir mit Sicherheit auf das Eichhörnchen als Übeltäter schließen. Der muntere Tannenaffe im Fuchspelz bricht sich die Zapfen am Stiele ab, setzt sich auf einem Aste mit aufgeschlagenem Schwänze behäbig nieder, führt den Zapfen mit den Vorderpfoten zum Maule und beißt nun mit seinen scharfen Zähnen eine Schuppe nach der anderen ab, um die Samenkerne zu verspeisen. Oft aber sagt dem verwöhnten Kletterer der Geschmack nicht zu, und er wirft dann den Zapfen herunter und holt sich lieber einen neuen, der vielleicht das gleiche Schicksal teilt, bis sich dann endlich einer findet, der ihm behagt. So findet man oft ganze Haufen von verstümmelten Zapfen am Fuße solcher Bäume, die den Lieblingsaufenthalt dieses dadurch wie auch durch andere Ausschreitungen oft recht schädlich und lästig werdenden Nagers bilden. Bekanntlich verzehrt das Eichhörnchen mit Vorliebe auch Haselnüsse, wobei es derart verfährt, daß es die enthülste Nuß mit possierlicher Geschwindigkeit in den Vorderpfoten hin und her dreht und dabei an der Naht eine Kerbe einfeilt, bis die Schalen auseinanderplatzen. Das Tier besitzt in dieser angenehmen Beschäftigung eine außerordentliche Gewandtheit und Fertigkeit. Einmal wurde ich an einem heißen Sommertage im Walde Zeuge eines Vorfalles, der mich stark zum Lachen reizte. Eine Spechtmeise, die trotz der drückenden und alles andere Getier einschläfernden Hitze keine Siesta halten wollte, hatte irgendwo im alten Laube eine vorjährige Haselnuß gefunden und in eine Astgabel eingeklemmt, wo sie sie mit Schnabelhieben bearbeitete, um die Schale zu sprengen und zu dem süßen Kern zu gelangen. Aber jedesmal schnellte dabei die Frucht aus der Astgabel heraus und fiel wieder herunter aus den Moosteppich, und jedesmal wurde sie von dem emsig vor sich hin zwitschernden Vögelchen aufgelesen, das unermüdlich seine Arbeit von neuem begann, aber immer mit dem gleichen Mißerfolge. Von oben her hatte ein Eichhörnchen der Fleißigen schon lange zugesehen. »Ich kann's besser,« mag's bei sich gedacht haben. Jetzt stieg's langsam von Ast zu Ast herunter, setzte sich mit philosophischer Ruhe dem erstaunten Vogel ein Weilchen gerade gegenüber und nahm ihm dann ohne weiteres die Nuß weg. Ein hastiges Herumdrehen in den Pfoten, ein scharfes Knacken, und die Schalen fielen zu beiden Seiten herunter. Während das Eichhörnchen behaglich die Frucht mit seinen Backenzähnen zermalmte, kam auch die Spechtmeise aus ihrer starren Verwunderung allmählich zu sich selbst und flog nun laut schimpfend davon. Ich aber hatte bei dieser Gelegenheit gelernt, daß auch Vögel ein verblüfftes Gesicht machen können.
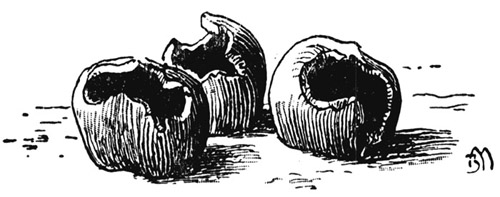
Abb. 18 Vom Siebenschläfer aufgenagte Haselnüsse.
Die auf solche Weise vom Eichhörnchen regelrecht geknackten Haselnüsse sehen natürlich ganz anders aus als die hier abgebildeten, die der freßgierige Siebenschläfer in der Arbeit gehabt hat. Er hat mit seinen messerscharfen Mausezähnchen einfach ein gut Teil der Schale oben oder an der Seite abgeschabt und abgemeißelt und sich dann das Innere zu Haselnüsse. Gemüte geführt, sobald die Öffnung groß genug war, um dem lüsternen Zünglein Eingang zu gewähren. Öfters können wir in den Haselnußhecken aber auch Nüsse finden, die noch in den Hülsen und fest am Zweige sitzen und von deren Schale nur ein winziges Stückchen abgetragen ist, so daß wir uns erstaunt fragen müssen, wie es denn möglich sei, mit Hilfe einer so kleinen Öffnung den Kern zu verspeisen. Wenn uns das Glück einmal recht günstig ist, können wir an einem schwülen Hochsommerabend den kleinen Näscher wohl belauschen, und der Anblick, den wir dabei genießen, ist einer der anmutigsten, den die heimische Natur uns bieten kann, wohl wert, daß wir seinetwegen ein paarmal vergeblich zum Beobachten hinausgegangen sind. Wie das huscht und wispert, turnt und klettert, rennt und raschelt, knuspert und flüstert im Zweiggewirr und zwischen den von einem leisen Windhauche bewegten Blättern! Eine Familie der wunderniedlichen Haselmäuse ist's, die sich hier gütlich tut. Mit drolliger Geschäftigkeit, mit fast geisterhafter Behendigkeit laufen die anmutigen Geschöpfchen hin und her, setzen sich alle Augenblicke nieder, biegen mit den Vorderpfoten eine Nuß herunter, halten sie fest und setzen die scharfen Nagezähnchen ein, um mit der Meißel- und Schabearbeit zu beginnen. Die großen, tiefschwarzen Perlaugen, die so weit aus dem Kopfe hervorstehen, daß man unwillkürlich befürchtet, sie müßten jeden Augenblick aus dem Gesichte herausfallen, sehen uns dabei mit der Miene der rührendsten Unschuld an, so daß wir den kleinen Näschern unmöglich ernstlich böse sein können. Da, eine unvorsichtige Bewegung des Beobachters – und im Nu stiebt die ganze, eben noch so zutrauliche, lustige und übermütige Gesellschaft entsetzt auseinander. Wie mit einem einzigen Husch sind die kleinen Kobolde auseinandergeblasen, spurlos verschwunden wie spukhafte Geisterchen, und es wird auch dem schärfsten Auge kaum gelingen, sie an ihren lauschigen Schlupfwinkeln bei der unsicheren Dämmerbeleuchtung zu entdecken, zu sehen, wie die eine, vor Furcht an allen Gliedern zitternd, sich ins Steingeröll auf den Boden geduckt hat, die andere ängstlich aus einem Mauseloche hervorlugt, die dritte sich in einem Büschel verdorrten Grases verkrochen hat.
Das Eichhörnchen, um nochmals auf dieses zurückzukommen, ist überhaupt ein ganz gewiegter Feinschmecker, der aber leider und zum großen Ärger des Forstmannes im Übermut oft weit mehr zerstört und zu Boden wirft, als er zum schnurrbartbesetzten Maule führt. Sehr begreiflich finde ich seine große Vorliebe für Pilze. Ganz besonders ist dieses Leckermaul (sein wissenschaftlicher Name Sciurus bedeutet »der sich mit dem eigenen Schwanz Beschattende«, ist also vorzüglich gewählt) auf Hirschtrüffeln erpicht, die es mit großer Sicherheit wittert und geschickt aus der Erde herausgräbt, und ebenso auf die jungen Exemplare des Speisetäublings und des Steinpilzes. Aber während es die von uns Menschen hochgeschätzten Gelböhrchen ihres scharfen Geruches wegen verschmäht, nascht es doch sehr gern und ohne Schaden zu nehmen von den giftigen Birkenreizkern und Fliegenpilzen, vielleicht weil ihm deren narkotische Eigenschaften angenehm sind, wie ja auch die Bewohner Kamtschatkas aus Fliegenschwämmen ein berauschendes Getränk zu bereiten verstehen. Herrscht Überfluß an Pilzen, so trägt sich dieser biologische Vertreter der Affen im deutschen Walde auch Vorräte der köstlichen Speise ein, und zwar spießt er sie dann an die dürren Zacken in der Baumkrone in der Nähe seines Nestes. Der brave Spießbürger, der an einem schönen Sonntagnachmittage mit Kind und Kegel in den Wald zieht und zufällig einen Blick auf einen derartig besteckten Baum wirft, ist nicht wenig erstaunt über diesen überraschenden Anblick und zerbricht sich vergeblich den Kopf darüber, welch absonderlicher Spaßvogel denn wohl die schönen Pilze da oben auf die Baumzacken gesteckt haben könne. Die Hauptnahrung des Eichhörnchens aber bilden neben den harzreichen Sämereien der Nadelhölzer die ölhaltigen Eicheln und Bucheckern, und gerade dadurch scheint auch seine außerordentliche Beweglichkeit bedingt zu werden, da solche Stoffe bei einer beschaulichen Lebensweise, wie sie ja den meisten Säugern zukommt, kaum richtig verdaut und ausgenutzt werden könnten. Nahrung und Temperament stehen ja überall im Tierreiche, den Menschen durchaus nicht ausgenommen in den innigsten Wechselbeziehungen, und unser rotes Waldäffchen mit dem Fuchsschwanze darf wohl als ein ausgesprochener Sanguiniker gelten, dessen ganzer zierlicher, gelenkiger und beweglicher Knochenbau schon auf eine sehr muntere und regsame Lebensweise schließen läßt.
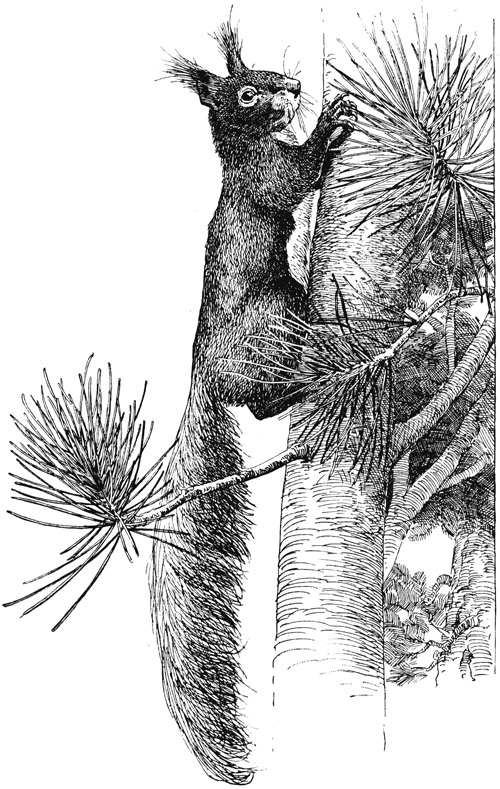
Abb. 19. Eichhörnchen.
Der Umstand aber, daß sich das Eichhörnchen für die Zeiten der Not auch Vorräte einsammelt, bringt uns noch auf etwas anderes. Während es nämlich ziemlich allgemein bekannt ist, daß die Säugetiere durch Verschleppen von klebrigen oder mit Haftorganen ausgerüsteten Sämereien zur Verbreitung der Pflanzenwelt beitragen, ist ihre hierauf bezügliche Bedeutung nach einer anderen Seite hin noch nicht genügend erkannt und gewürdigt worden. Wie manche Vögel, so z. B. Eichel- und Tannenhäher durch Verpflanzen von Eicheln, Bucheln und Zirbelnüssen unfreiwillig im Dienste der Forstwirtschaft tätig sind, weshalb der erstere in Frankreich geradezu » le planteur« genannt wird, so auch unser Eichhörnchen. Es versteckt hier eine Eichel oder Buchel, dort einen Obstkern im Moos, zwischen Erdspalten oder an ähnlichen Orten, vergißt aber später in seinem Leichtsinn den geheimen Schatz, so daß das Samenkorn schließlich ausschlagen, Wurzeln treiben und im Laufe der Zeit einen neuen, mächtigen Baum liefern kann, der dann vielleicht der Nachkommenschaft desselben Hörnchens zum Tummelplätze dient. Rings um die unterirdische Burg des Dachses findet man in buntem Durcheinander oft förmliche Anlagen der lieblichsten Beerensträucher, die nur dem mürrischen Einsiedler ihr Dasein verdanken. Freund Grimbart ist nämlich ein großer Verehrer der verschiedensten Beeren und läßt sich ihr süßes Fruchtfleisch bei jeder Gelegenheit vortrefflich schmecken. Die Samenkörner gehen aber unverdaut durch seinen Darmkanal hindurch, wobei sich nur ihre Hülle etwas lockert, so daß die Keimfähigkeit dadurch geradezu erhöht wird, wie auch die Beigabe des düngenden Kotes später das Wachstum des Pflänzleins zu befördern geeignet ist. Nach Wurm werden selbst Trüffeln auf diese Weise durch den Absatz unverdauter Sporen von Dachs, Schwein, Eichhorn und Waldmaus verbreitet. Noch ein drittes kommt hinzu, und das darf ja nicht unterschätzt werden: durch ihr Stechen und Wühlen, ihr Graben und Scharren lockern Dachse, Schweine, Rehe und andere Tiere den Waldboden, machen ihn so »wund« und damit zur natürlichen Besamung geeigneter.
Nagetiere knabbern überhaupt gern an allem möglichen herum, oft aus bloßer Spielerei oder um ihrem natürlichen Nagebedürfnis zu genügen, da die Nagezähne Die meißelförmigen, gebogenen Nagezähne wachsen von der hohlen Wurzel aus fortwährend nach und sind nur auf der Vorderseite mit Schmelz bekleidet, der sich naturgemäß weniger rasch abnutzt als die Knochensubstanz der Hinterseite, was die Bildung einer äußerst scharfen Schneide zur Folge hat. infolge ihrer eigentümlichen Struktur eine unausgesetzte Abnützung erfordern, wenn sie nicht ins Ungemessene wachsen und dann ihrem Besitzer bei der Ernährung große Schwierigkeiten machen sollen. Eine besondere Vorliebe bekunden sowohl Eichhörnchen wie Mäusearten für das Benagen von alten, abgeworfenen Rehstangen, die das Hörnchen gar nicht selten auch in seine Nester verschleppt, wobei an den öfters in der Literatur erwähnten Fall erinnert sei, daß einmal ein Eichhörnchen einem nach Rehstangen suchenden Förster eine solche von oben her auf den Kopf warf. Außer dem schon erwähnten Spiel- und Nagebedürfnis dürfte dabei auch der reiche Gehalt der Rehgehörne Dies ist der übliche und auch weidmännisch allein für »gerecht« geltende Ausdruck. Zoologisch richtiger aber wäre entschieden » Rehgeweih«, denn die Geweihe der Hirsche, Rehe und Renntiere stehen auf zapfenförmigen Verlängerungen der Stirnbeine, sind massiv, bestehen aus echter Knochensubstanz und werden alljährlich erneuert, während die Hörner der Antilopen, Rinder, Schafe und Ziegen zeitlebens stehenbleiben, hohl sind und aus verhornten Epithel- und Gewebezellen bestehen, also keinerlei Knochensubstanz, Salze oder Blut enthalten. an aromatischen und den körperlichen Organismus stärkenden, insbesondere die Bildung gesunden Blutes befördernden anorganischen Nährsalzen eine Rolle spielen, und dazu kämen endlich noch die organischen Stoffe, deren selbst ein schon stark verwittertes Rehgehörn keineswegs völlig bar ist. Lassen doch in lauem Wasser aufgeweichte Geweihe und Gehörne noch nach Jahren Blut austreten. Wenn ich auch auf Fuchsbauten öfters alte Rehstangen gefunden habe, so möchte ich dafür namentlich den letztgenannten Umstand verantwortlich machen, und wahrscheinlich haben sich die spielenden Jungfüchse weidlich an den sonderbaren Gebilden gelabt, wie ja auch Hunde leidenschaftlich gern an ihnen herumketschen. Deshalb findet man auch so selten im Walde alte Rehstangen, und deshalb sind die Hunde so leicht dazu abzurichten, sie aufzusuchen und zu apportieren. Eine mir bekannte Dame in Ostpreußen besaß einen rassigen Foxterrier, der es darin zur Meisterschaft gebracht hatte und seiner Herrin selbst die schweren Elchschaufeln getreulich herbeizuschleppen suchte, wobei die kleine, sehnige »Miß« freilich alle Kräfte anspannen mußte. Selten aber wird man eine schon längere Zeit im Walde liegende Rehstange finden, die nicht bei näherer Betrachtung die unverkennbaren Eindrücke von Nagezähnen auswiese, denn alle Nager scheinen mit Vorliebe die Kraft ihres Gebisses an diesen widerstandsfähigen, eckigen und angenehm salzig schmeckenden Gebilden zu erproben. Selbst Hirschkühe sollen den abgeworfenen Kopfschmuck ihrer Eheherrn beknabbern und zu diesem Zwecke immer wieder aufsuchen; bei der leidenschaftlichen Vorliebe dieser Tiere für alles Salzige wäre das ja auch weiter gar nicht verwunderlich.

Abb. 20. Von Rehen verbissene Fichtentriebe.
Wo wir in den Fichtenschonungen Endtriebe antreffen, die in der Weise verbissen sind wie der linke Zweig auf Abb. 20, dürfen wir mit Sicherheit auf die dem Forstmann wenig erwünschte, dem Jäger und Naturfreund freilich um so erfreulichere Fraßtätigkeit von Rehen schließen. Im Frühjahr verrät dieses anmutigste unserer Waldtiere seine Anwesenheit dem Auge des Kundigen auch noch durch das Vorhandensein von sogenannten Fegebäumen, d. h. weichen Hölzern, an denen der Bock durch Reiben sein neu gebildetes Gehörn von dem es überziehenden Baste zu befreien sucht, wobei er die Rinde abwetzt und dadurch den Baum schädigt. Über diesen interessanten Vorgang waren früher selbst in Jäger- und Zoologenkreisen ganz irrtümliche Anschauungen verbreitet, und wir sind darüber eigentlich erst in neuester Zeit durch die schönen Untersuchungen Bergmillers einigermaßen aufgeklärt worden, obwohl auch jetzt noch so mancher Punkt in Dunkel gehüllt bleibt und der näheren Erforschung harrt. »Der Bast ist zur Zeit des Fegens weich und feucht, mit Nähradern durchzogen, deren Inhalt noch nicht vertrocknet, sondern höchstens geronnen ist, und mit der hart gewordenen Stange durch eine viel Feuchtigkeit und Schweiß enthaltende Zellschicht so lose verbunden, daß er sich bis zu einem gewissen Grade über den Stangen hin und her schieben läßt. Er ist also nicht trocken und kann nicht in feinste Teilchen zerrieben werden, wie die bisherige Lehre der Jagdzoologen lautete, sondern wird als feuchtes, schweißiges Gebilde, der abgestreiften Haut einer Feldmaus nicht unähnlich, in bald größeren, bald kleineren Fetzen entfernt. Ja, unter Umständen streift der Bock das Gefege als fast unversehrte Hülle, nachdem er es durch Einklammern eines Stämmchens ringsum über der Rose durchgewetzt hat, mit ziehender Bewegung über die Stange hinweg, und man vermag an diesen Basthüllen, die teils nur unten offen, teils außerdem noch an einer Seite aufgeschlitzt sind, die Form der Stange zu erkennen.« Ganz frisch gefegte Gehörne haben eine mehr gelbliche Farbe, denn die schöne, dunkle, vom Sammler so geschätzte Tönung erhalten sie erst durch äußere Einflüsse, wobei die Gerbsäure der Fegebäumchen und des Moorbodens die erste Rolle zu spielen scheint. Die abgestreiften Basthüllen und -fetzen finden an den Mäusen eifrige Liebhaber, und auch der Fuchs soll sie als besonderen Leckerbissen betrachten und zur Fegezeit planmäßig aufsuchen, weshalb es wohl auch so selten glückt, abgefegte Baststücke im Walde zu finden.

Abb. 21. Rehbock mit Bastgehörn.
Wie wir bereits sahen, kann eine frisch gefallene Schneedecke für den fährtenkundigen Forscher und Jäger als das beste Hilfsmittel gelten, um das Vorhandensein der verschiedensten Säugetierarten untrüglich festzustellen, aber die Spuren vieler Arten, von deren Anwesenheit wir uns im Sommer zu überzeugen vermochten, werden wir trotzdem vergeblich suchen. Diese Formen sind eben dem in unserem nordischen Winter so erschwerten Kampfe ums Dasein nicht gewachsen, müssen ihn also zu vermeiden suchen und zeitweise von der Bühne der heimischen Natur verschwinden. Den Vogel, der in dieselbe unangenehme Lage kommt, trägt sein leichtbeschwingter Flügel fast mühelos über Berg und Tal, über Ströme und Meere zu den milderen Gegenden des Südens, wo eine reichbesetzte Tafel seiner harrt und er sorglos im Überflüsse schwelgen kann, bis der allmählich erwachende Paarungstrieb ihn unwiderstehlich in die alte Heimat zurücktreibt, wo er einst das Licht der Welt erblickte und nun selbst zur schönen Frühlingszeit auf die Vermehrung seiner Art bedacht ist. Weit weniger günstig ist in dieser Beziehung das Säugetier daran, dem die Gabe des Fluges versagt blieb und das zeitlebens an die Erdscholle gefesselt erscheint. Deshalb gibt es auch im Säugetierreiche keine Wanderungen, die sich an Bedeutung und Großartigkeit dem uns in vieler Beziehung noch so rätselhaften Vogelzuge an die Seite stellen könnten. Wohl wissen wir, seitdem der deutsche Jagdschutzverein die Wildmarkierung eingeführt hat, daß abgeschlagene Rehböcke und Hirsche, ja selbst der schwerfällige Elch ungeahnt weit umherschweifen, wohl ist es allbekannt, daß die nordischen Lemminge unter gewissen Verhältnissen sich zu Heerzügen von Hunderttausenden versammeln und dann mit fast krankhafter Rastlosigkeit und Beharrlichkeit einem unbekannten Ziele zueilen, alle Hindernisse mit beispielloser Zähigkeit und Selbstaufopferung überwindend, unterwegs erbarmungslos gezehntet von einer Unzahl von Feinden, blindlings ins sichere Verderben eilend. Auch unsere Feldmäuse entschließen sich bei eintretender Übervölkerung bisweilen zum Auswandern, wobei sie regelmäßig bald in Unmassen zugrunde gehen; in harten Wintern kommen heißhungrige Wölfe aus den schneebedeckten Gefilden Rußlands in unsere Gaue herüber. Von einem regelmäßigen und planmäßigen Ausweichen vor der Not des Winters durch seit Jahrtausenden instinktiv vererbte Wanderung kann jedoch bei alledem nicht die Rede sein, denn auch das schnellfüßigste Säugetier vermag in dieser Beziehung mit dem rasch fördernden Flügelschlag auch des langsamsten Vogels keinen Vergleich auszuhalten. Eine Ausnahme scheint es aber doch zu geben, und sie betrifft naturgemäß diejenige Ordnung der Säuger, die von der Natur wenigstens bis zu einem gewissen Grade mit dem Flugvermögen begabt wurde: die Fledermäuse.
Freilich muß da zunächst vorausgeschickt werden, daß über die mehr aus indirekten Wahrnehmungen vermuteten Wanderungen unserer Flattertiere erst wenige sichere Beobachtungen vorliegen, weshalb die hier in Betracht kommenden und schwierig genug aufzuklärenden Verhältnisse noch dringend der weiteren Aufhellung bedürfen. Sie bilden geradezu ein Schulbeispiel dafür, welch klaffende Lücken die Naturgeschichte selbst unserer gewöhnlichsten Säuger noch aufzuweisen hat, und wie durchaus irrig die Annahme sein würde, es gäbe auf diesem auch von den Fachzoologen arg vernachlässigten Gebiete nichts mehr zu erforschen, nichts nachzuprüfen, nichts Neues mehr festzustellen. Ich halte vielmehr die eingehende Erforschung der Biologie namentlich unserer kleineren Säuger für eine der lohnendsten Aufgaben, die sich dem Forschergeiste noch darbieten und an denen auch der naturwissenschaftlich gebildete und scharf beobachtende Laie sehr verdienstvoll mitarbeiten kann. Hat doch selbst die Naturgeschichte unserer schon unzähligemale ausführlich geschilderten Jagdtiere noch überraschend viel dunkle Punkte und geheimnisvolle Kapitel aufzuweisen! Und wie viele Menschen gibt es denn bei uns, die mit liebe- und verständnisvoller Sorgfalt auf das versteckte Leben der zahlreichen, vom Laien kaum unterschiedenen, kleinen Nager oder der im Volke so wenig bekannten Spitzmäuse achten, die gar gewillt wären, das lichtscheue Treiben der Fledermäuse zu beobachten? Diese blitzgeschwinden Nachtgeistchen werden ja von nicht aufgeklärten Leuten höchstens mit Abscheu, wenn nicht gar mit abergläubischem Entsetzen betrachtet und ernten, obgleich sie doch so wertvolle und rastlos tätige Verbündete der Forst- und Landwirte sind, dafür immer nur Undank. Schon die hohen Ansprüche, welche die Fledermäuse an ihre Umgebung stellen, die unverkennbare Launenhaftigkeit, die sie in der Wahl ihrer Aufenthaltsorte bekunden, und die Empfindlichkeit, die viele Arten als ursprüngliche Kinder des Südens den klimatischen Schwankungen und örtlichen Witterungsverhältnissen gegenüber an den Tag legen, bedingen von vornherein eine gewisse Wanderlust dieser bewegungsfrohen Tiere, und naturgemäß wird dies bei den langflügeligen und fluggewandten Vesperugo-Arten in weit höherem Maße zutreffen als bei den kurzflügeligen, nur plump einher flatternden Angehörigen der Gattungen Vespertilio und Rhinolophus. So hat man unzweifelhaft festgestellt, daß die Umberfledermaus ( Vesperugo nilssoni), die ihren Verbreitungsbezirk überhaupt am weitesten nach dem Pole zu vorschiebt, im Hochsommer noch ausgedehnte Vorstöße nach Norden unternimmt, um beim Scheine der Mitternachtssonne unter den Myriaden von Mücken in den Moossteppen des nördlichen Rußlands aufzuräumen, daß dieselbe Art aber, um sich im Winterschlafe nicht dem eisigen Klima ihrer Heimat auszusetzen, im Herbste südwestwärts wandert und sich im mittleren und südlichen Deutschland Winterquartiere sucht. Im vergangenen Winter wurde mir diese Art mehrfach aus den Rheingegenden zugeschickt, wo sie während des Sommers eine ganz unbekannte Erscheinung ist. Gerade um geeignete Schlafplätze für die lange Winterruhe ausfindig zu machen, in deren Wahl sie eine große Umsicht und Überlegung verraten, schweifen viele Fledermäuse weit im Lande herum und lassen sich dann vorübergehend an Orten blicken, wo sie sonst nicht zu Hause sind. Gebirgsbewohner wie die zweifarbige Fledermaus ( Vesperugo discolor) kommen zum Überwintern in die geschützteren Täler herab, und umgekehrt zieht die Wasserfledermaus ( Vespertilio daubentonii) im Herbste aus der wasserreichen Ebene in die Vorberge, weil sie nur dort geeignete Höhlen zum Überwintern vorfindet. Von der Abendfledermaus ( Vesperugo noctula), die überhaupt wohl der beste, sicherste, rascheste und ausdauerndste Flieger unter den einheimischen Arten ist, hat man an der Donau schon große, aus Hunderten oder gar Tausenden bestehende Züge beobachtet, die eilfertig gen Westen zogen, und die Afrikareisenden berichten uns, daß die dortigen Fledermäuse den Wanderungen der Herdentiere folgen, weil sie durch den Insektenreichtum an deren jeweiligen Aufenthaltsorten angelockt werden. Überhaupt scheint ein guter Teil des wanderfrohen Fledermausvölkchens dem selbstsüchtigen Worte » Ubi bene, ibi patria« zu huldigen, indem es sich eben überall da zeitweise niederläßt, wo es recht heimliche und ungestörte Schlupfwinkel für den zu verschlafenden Tag und recht viel fette Kerfe für die zu durchjagende Nacht gibt. Damit steht wohl auch im Zusammenhange, daß die Verbreitungsbezirke dieser Tiere in beständiger Verschiebung begriffen sind und daß namentlich die selteneren Arten bald da, bald dort vorübergehend auftauchen, ohne sich doch dauernd in der betreffenden Gegend heimisch zu machen. Jedenfalls bekunden sie eine größere und dauerndere Anhänglichkeit an ihre winterlichen Schlafplätze als an ihre sommerlichen Jagdgründe. Alles in allem kann man gewisse Fledermausarten etwa mit den Strichvögeln in Parallele stellen, niemals aber mit den echten Zugvögeln.
Dies wird schon dadurch bedingt, daß das Flugvermögen auch der gewandtesten Fledermäuse doch immerhin nur ein recht beschränktes ist. Niemals schwingt sich der Hautflatterer auf zu dem prachtvollen Schweben und Gleiten, zu dem schrankenlosen Beherrschen des Luftmeeres, das den Vögeln eigen ist, dem Naturfreunde zur schönsten Augenweide dient und im Menschen stets ein leises Gefühl des Neides erregt. Das verbietet schon die ganze körperliche Organisation des Säugers, der weder die hohlen, luftführenden Knochen des Vogels noch dessen ausdehnbare Luftsäcke besitzt und auch nicht über ein so ideales Steuer verfügt, wie es der Vogelschwanz darstellt. Deshalb bleibt der Flug der Fledermäuse immer nur ein bloßes Schlagen der Luft mit den ausgespannten Flughäuten, und es leuchtet ohne weiteres ein, daß eine solche Flugweise auch bei der kräftigsten Brustmuskulatur, an der es unseren Tieren keineswegs fehlt, höchst ermüdend wirken muß und öftere Ruhepausen notwendig macht, so daß von einem vogelartigen Wandern über ganze Erdteile hinweg nun und nimmer die Rede sein kann. Man hat beim Betrachten und Verfolgen des Fledermausfluges, mag er noch so schnell vor sich gehen, noch so geknitterte Bahnen beschreiben, noch so unvermutete und geschwinde Wendungen vollführen, doch immer das unwillkürliche Gefühl, daß es sich um etwas Unsicheres und Unvollkommenes, um etwas durchaus an die Erdscholle Gebundenes und gewissermaßen Kleinliches handelt. Niemals werden wir dabei das ästhetische Hochgefühl empfinden, das uns erfüllt, wenn der stolze Aar um die höchsten Zacken und Zinnen des Hochgebirges im blauen Äther mit majestätischer Ruhe und mit der Regelmäßigkeit eines Pendels seine prachtvollen Kreise zieht.
Eine merkwürdige Beziehung besteht augenscheinlich zwischen der Ausbildung der Flughäute und der der übrigen Hautgebilde: diese sind um so mehr entwickelt, je kleiner die Flughäute, je beschränkter demzufolge das Flugvermögen. Demgemäß haben die kurzflügeligen Vespertilio-Arten die ungeheuerlichsten Ohrmuscheln, die bei der Ohrenfledermaus die verhältnismäßig riesenhafte Länge von 3,6 cm erreichen und obendrein noch zwei Dutzend Querfalten aufweisen, und die größten und am mannigfaltigsten gestalteten Ohrdeckel ( Tragus). Ferner besitzen die gleichfalls herzlich schlecht fliegenden Rhinolophus-Arten die abenteuerlichsten Hautgebilde und die sonderbarsten Zieraten auf der Nase. Die Fledermäuse sind ja überhaupt Hauttiere im ausgedehntesten Sinne des Wortes, und ihr Hautsystem ist in einer Weise entwickelt und nach der Oberfläche zu vergrößert wie bei keiner anderen Tierklasse. Dabei bedarf es aber sorgfältiger und ständiger Pflege, um in gutem Zustande zu bleiben und tadellos zu funktionieren. Die Tiere besitzen auf ihrem Schweineschnäuzchen zwischen den Nasenlöchern und den Augen einige Drüsen, die ein öliges, gelbliches Sekret absondern. Damit reiben sie sich die Flughäute fleißig ein und erhalten sie so geschmeidig. Kränkelt eine Fledermaus, so versagen diese Drüsen ihren Dienst, und die Flughäute werden dann sehr schnell trocken und brüchig, erhalten bei dieser Gelegenheit Risse und können schließlich überhaupt nicht mehr zum Fliegen verwendet werden. Das hoch entwickelte Hautsystem der Tiere bedingt einen ungemein feinen Gefühlssinn, der auf der nervenreichen Flughaut längs des Unterarmknochens am empfindlichsten ist. Wenigstens fahren die Tiere bei der geringsten Reizung dieser Hautpartie sofort nervös zusammen, oft schon bei der bloßen Annäherung eines Fremdkörpers. Bei ihren nächtlichen Jagdzügen werden die Fledermäuse neben dem Gehör ja hauptsächlich durch den Tastsinn geleitet. Die großen Ohren und das hübsche rote Zünglein in dem trotz seiner Kleinheit furchtbaren Gebiß zeigen eine gute Ausbildung von Gehör und Geschmack an, ja meine zahmen Fledermäuse haben sich immer als wahre Leckermäuler erwiesen. Auch scheinen sie mit den fast in ständiger Bewegung befindlichen Nasenlöchern ganz vorzüglich zu wittern.
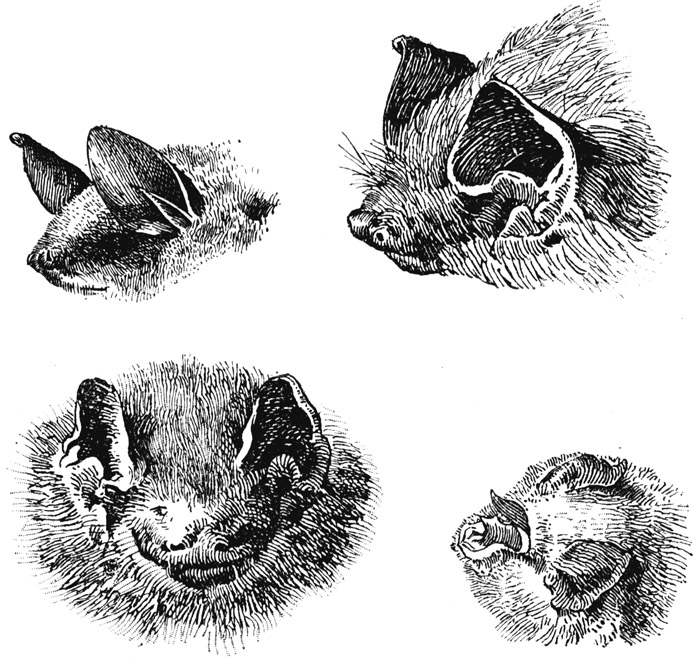
Abb. 22. Verschiedene Fledermausköpfe zur Veranschaulichung der Hautgebilde in Ohr und Nase.
Zells Einteilung in Nasen- und Augentiere hat gewiß vieles für sich und vermochte manche biologischen Fragen mit hellem Lichte zu übergießen, aber ich glaube doch, daß man die Sache nicht zu weit treiben darf und sich vor allem hüten muß, dabei in eine einseitige Anschauung zu verfallen, da eine solche leicht zu argen Trugschlüssen Veranlassung geben könnte. Zweifellos gibt es trotz des anerkannten Sparsystems in der Natur auch eine ganze Reihe von Tieren, bei denen zwei und mehr Sinne fast gleichmäßig gut entwickelt sind und demzufolge die Handlungsweise des Tieres in nahezu gleich starkem Maße beeinflussen. Und hierher scheinen mir auch die Fledermäuse zu gehören, die zwar mit ihren kleinen, oft tief im Pelze versteckten, aber recht klug blickenden Äuglein nur schlecht sehen und wohl auch hochgradig kurzsichtig sind, dagegen Gefühl, Geruch und Gehör ziemlich gleichmäßig zur Ausbildung gebracht haben, mag auch vielleicht das Gehör ein wenig überwiegen, wie es ja schon äußerlich durch die Größe und Gestalt der Ohren zum Ausdruck kommt. Auch ein hochgradiger Ortssinn ist den Fledermäusen eigen. Nach den ausgedehntesten Ausflügen finden sie mit unfehlbarer Sicherheit den oft so versteckten und engen Eingang zu ihrem Schlupfwinkel wieder, selbst wenn sie erst einmal dort geruht haben, und es hält deshalb auch gar nicht schwer, gefangene Fledermäuse an das freie Ein- und Ausfliegen zu gewöhnen.
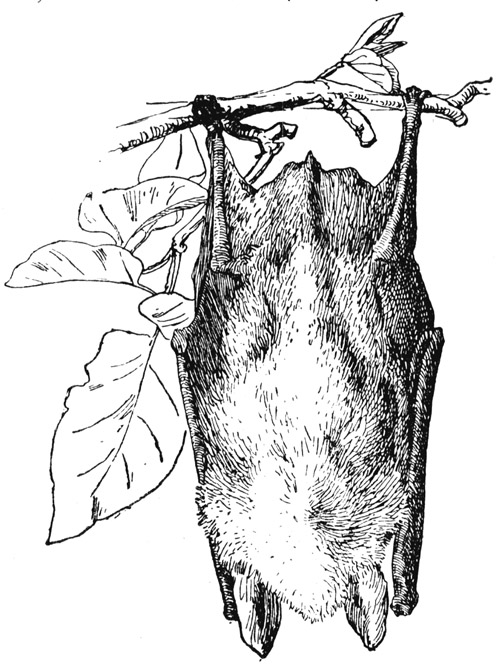
Abb. 23. Fledermaus in Schlafstellung.
Höchst eigentümlich ist die Schlafstellung, wobei sich die Tiere gewöhnlich an den Krallen der Hinterfüße aufhängen und die Flughäute seitlich andrücken, also dem ganzen Körper die Richtung kopfabwärts geben; die Hufeisennasen hüllen sich dabei in ihre Flughäute förmlich ein wie in einen weiten Mantel, und die Ohrenfledermäuse stecken ihre Riesenohren teilweise unter die Flügel, während andere Arten sie möglichst ausrecken und den für die Fledermäuse so charakteristischen Ohrdeckel ( Tragus) lüften. Wir sind so an diesen Anblick gewöhnt, daß wir uns kaum noch etwas Besonderes dabei denken, und doch müßte eine solche Stellung, wie sie auch die nach dieser Eigentümlichkeit benannten Fledermauspapageien im Schlafe einnehmen, nach unserer gewöhnlichen Auffassung eine höchst unbequeme, ja naturwidrige sein, da sie bei dem notwendigerweise damit verbundenen Blutzufluß nach dem Gehirn die Gefahr eines Schlagflusses mit sich führt, zumal wenn man bedenkt, daß die Tiere während ihres Winterschlafes monatelang in dieser absonderlichen Lage verharren. Welche Mittel die Natur eigentlich angewendet hat, um dem entgegenzuwirken, ist meines Wissens noch gar nicht näher erforscht worden, obgleich diese merkwürdige Erscheinung einer eingehenden Bearbeitung wohl wert wäre. Will eine aus diese Weise aufgehängte Fledermaus ein gewisses Geschäft verrichten und dabei eine Verunreinigung des eigenen Körpers vermeiden, so ist sie genötigt, ihn in eine wagerechte Lage zu bringen, also einen der Hinterfüße loszulassen, sich durch Abstoßen in eine schaukelnde Bewegung zu versetzen und dann mit der Daumenkralle des ausgestreckten Armes sich irgendwo festzuhaken. Das Harnen können sie aber auch so besorgen, daß sie sich nur mit den beiden Daumenkrallen anhängen und den Hinterkörper frei herabhängen lassen. Übrigens entleeren sie sich häufig auch im Fluge.
Der Stoffwechsel der Fledermäuse ist, ihrem heißblütigen und sanguinischen Wesen entsprechend, überhaupt ein fabelhaft reger, und ihr Nahrungsbedürfnis demgemäß ein ungeheuer großes. Meine zahmen Fledermäuse verzehren bequem 30 feiste Mehlwürmer zu einer Mahlzeit und sind kurze Zeit darauf schon wieder hungrig. Freilich scheint es, als ob die Verdauung eine ziemlich unvollständige sei, die eingeführten Nahrungsstoffe also nicht voll zur Ausnützung gelangten. In stark besuchten Schlafhöhlen kommt es zu richtigen Guanobildungen, die unter Umständen sogar technisch ausgenützt werden können. Auch das Trinkbedürfnis der Fledermäuse, die sich in der Gefangenschaft als große Liebhaber von Milch erweisen, ist ein sehr starkes. Wie mögen sie es im Freien wohl befriedigen? Sollten sie im Fluge trinken wie die Schwalben? Die traurige Erfahrung, daß ich wiederholt zahme Fledermäuse, denen ich freien Flug im Zimmer gestattete, ertrunken im Aquarium auffand, brachte mich zuerst auf diesen Gedanken, und einige Zuschriften, die ich in letzter Zeit erhielt, scheinen meine Vermutung vollauf zu bestätigen. So schreibt mir eine Dame aus dem Hannoverschen: »Neulich gegen 7 Uhr abends sah ich eine Fledermaus – augenscheinlich eine gemeine – längere Zeit über einem Teiche hin und her fliegen, wobei sie häufig die Oberfläche des Wassers streifte, ganz wie es die Schwalben zu tun pflegen. Ob das Tier wirklich mit dem Munde Wasser aufnahm, ließ sich bei der Entfernung nicht erkennen, aber die ganze Lage des Körpers und die deutliche Furchung des Wassers ließen mit Bestimmtheit darauf schließen.«
Das hübsche, sammetweiche Pelzchen der Fledermäuse wimmelt leider ebenso wie das Federkleid der anmutigen Schwalben oft in der ekelhaftesten Weise von widerwärtigen Schmarotzern. Namentlich sind es gewisse Spinnenfliegen (z. B. Nycteribia bechsteini), von denen die armen Flatterer bis aufs Blut gepeinigt werden, und zwar in des Wortes wörtlichster Bedeutung. – Öfters, als es der Laie ahnt, bekommt man die Fledermäuse auch am Tage zu sehen, besonders im Frühjahr, unmittelbar nach ihrem Erwachen aus dem Winterschlafe, wo sie wohl der durch das lange Fasten geschärfte Hunger hinaustreibt, um auf die ersten Kerfe Jagd zu machen. Sie eilen dann nicht nur hinter fliegenden Insekten her, die sie mit wunderbarer Sicherheit wegschnappen und dabei womöglich erst unter ihre Flughäute bringen, um sie bequemer erhaschen zu können, sondern sie »rütteln« auch förmlich vor blühenden Sträuchern und schlagen hier mit ihren Flügeln geschickt die daraufsitzenden Kerfe herunter, die sie dann beim Herabfallen blitzgeschwind auffangen. So konnte ich Mitte März 1908 bei abnorm warmem Wetter zur Mittagszeit im blendendsten Sonnenschein in den Straßen von Stuttgart zahlreiche Fledermäuse beobachten, und diese Erscheinung war eine so auffällige, daß sie die allgemeine Aufmerksamkeit der Passanten auf sich zog. Von diesen wurden die hungrigen Flatterer, die sich in ziemlicher Höhe tummelten, freilich zumeist für – Schwalben gehalten, und die sonst leider so verachteten und verabscheuten Nachtsegler hatten daher die ungewohnte Ehre, mit Jubel als Frühlingsboten begrüßt zu werden.
Also auch die fluggewandtesten Fledermausarten sind, wenn sie auch gern und häufig streichen, nicht imstande, große Wanderungen nach Art der Zugvögel zu vollführen und sich so durch einen zeitweisen Aufenthalt in warmen Ländern den Unbilden unseres Winters zu entziehen. Wie kommen sie nun über die rauhe Jahreszeit hinweg, während der doch offenbar ihre hauptsächlichsten Nährtiere, die nächtlich fliegenden Insekten, völlig fehlen? Da ist die erfinderische Natur auf ein Aushilfsmittel verfallen, so frappierend einfach und doch so großartig, so wunderbar und ungelöster Rätsel voll, daß dieser eigenartige Vorgang wohl zu den anziehendsten Problemen gehört, die sich dem suchenden Forschergeiste darbieten, zu dem Unerklärlichsten, was das Menschenauge im heimischen Walde beobachten kann. Da sie das Leben während des Winters nicht erhalten konnte, so ließ sie es eben einfach entschlummern, aber entschlummern nur zu einem starren Scheintode, um es unter dem Dornröschenkuß der wärmenden Frühlingssonne zu neuer Tätigkeit zu erwecken. Sie versenkte ihre Kinder in den Winterschlaf, einen eigentümlichen Erstarrungszustand, der noch keineswegs diejenige Beachtung und das eingehende Studium der zünftigen Naturforscher gefunden hat, die er mit Recht beanspruchen darf. Wie der Wanderzug der Vögel, mag auch er durch Anpassung an die eigentümlichen Verhältnisse der Eiszeit entstanden sein, und wie dieser harrt auch er noch einer endgültigen Erklärung.
Die Natur macht nirgends unvermittelte Sprünge, sondern überall gibt es ausgleichende Übergänge. Bei manchen Tieren äußert sich der Winterschlaf nur durch eine unüberwindliche Schlaftrunkenheit, die sie den weitaus größten Teil des Tages in ihrem Versteck verträumen läßt ( Eichhörnchen z. B. schlafen nach meinen Feststellungen in den 3 Wintermonaten durchschnittlich 22? Stunden täglich), andere schlafen zwar wochenlang fest, wachen aber doch hin und wieder auf, nehmen Nahrung zu sich und verlassen an schönen, milden Tagen für kurze Zeit ihren Schlupfwinkel, noch andere endlich liegen den ganzen Winter über steif und unbeweglich in todesähnlicher Erstarrung ( Lethargie), was die vollkommenste Art des Winterschlafes darstellt. Alle drei Arten von Winterschlaf können bei ein und derselben Spezies nebeneinander vorkommen, wobei wohl den klimatischen Faktoren der ausschlaggebende Einfluß zukommt. Während beispielsweise sonst die Fledermäuse echte Winterschläfer sind, sollen die großen Hufeisennasen in dem milden Klima von Somerset in England nach Coward überhaupt nicht in Erstarrung verfallen, sondern sich lediglich in ihre Höhlen zurückziehen und hier kriechend auf Spinnen, Mistkäfer und andere Insekten jagen. Wie leicht die echten Winterschläfer dazu neigen, in den bewußtlosen Erstarrungszustand zu verfallen, der sie aller Sorgen und Mühseligkeiten dieses irdischen Jammertales enthebt, läßt sich schon daraus entnehmen, daß man Igel und Siebenschläfer auch mitten im Sommer in künstlichen Winterschlaf versetzen kann, wenn man sie in kalten Kellern unterbringt, ebenso Ziesel, wenn man ihnen zeitweise die Nahrung entzieht oder sie auch nur unzweckmäßig füttert. Ja, sogar in freier Natur setzen bei Haselmäusen und gewissen Fledermäusen (besonders ist es von V. noctula nachgewiesen) kürzere Schlafperioden auch im Sommer ein, wenn für längere Zeit ungewöhnlich kaltes und regnerisches Wetter herrscht. Umgekehrt bewirken in südlichen Ländern die alles verdorrende und versengende Hitze und der damit verbundene Nahrungsmangel bei manchen Säugern einen richtigen Sommerschlaf, der dem Winterschlaf an Intensität nur wenig nachgibt. So soll der furchtsame Stachelheld Igel nach Barkow am Senegal einen dreimonatlichen Sommerschlaf abhalten und während seiner Dauer keinerlei Nahrung zu sich nehmen. Bei manchen echten Winterschläfern, wie bei der frühfliegenden Fledermaus, sinkt die Körpertemperatur schon während des gewöhnlichen Tagschlafes ganz bedeutend und übersteigt dann nur um wenige Grade die der umgebenden Atmosphäre, und die Atmung wird so schwach und unvollkommen, daß ein solches Tier 10 Minuten unter Wasser aushalten kann, ohne Schaden zu nehmen. Es leuchtet ohne weiteres ein, daß schon eine verhältnismäßig geringfügige Änderung genügen muß, um solche »Schlafmützen« in den Zustand völliger Erstarrung fallen zu lassen. Mit diesem wollen wir uns nun in den folgenden Ausführungen etwas näher befassen, als mit einem Naturwunder, das die Grenze zwischen Leben und Tod zu überbrücken geeignet ist und um so rätselhafter erscheinen muß, als es doch Geschöpfe betrifft, die auf der obersten Stufenleiter der tierischen Entwicklung stehen und deren komplizierter Körperbau und verwickelte Organisation von vornherein am allerwenigsten ein solches zeitweises und fast völliges Anhalten des ganzen Mechanismus und der meisten Funktionen vertragen zu können scheinen.
Wer da etwa meinen sollte, daß die Winterschläfer, die doch mehrere Monate lang sich jeder auffälligeren Lebensäußerung enthalten haben, dafür während ihres kurzen Sommerlebens um so regsamere Tiere sein müßten und nicht viel Schlaf bedürften, der würde sich einer gründlichen Täuschung hingeben. Ganz im Gegenteil sind die Winterschläfer – zum großen Teil ja nächtlich lebende Tiere – auch im Sommer äußerst ruhebedürftig und verschlafen auch dann noch die größere Hälfte ihres Erdendaseins. Nicht umsonst ist eines unserer Nagetiere vom Volke » Siebenschläfer« getauft worden, und es ist kaum eine Übertreibung, wenn es in irgendeinem alten Liede vom Dachs, diesem unübertrefflichen Virtuosen im Faulenzen, heißt: »Drei Viertel seines Lebens verschläft der Dachs vergebens.« Und selbst unser munteres und lustiges Eichhörnchen liegt auch an den schönsten Sommertagen volle 11-12 Stunden im tiefsten Schlafe. Eine derart beschauliche und bequeme Lebensweise muß natürlich bei dem Nahrungsüberflusse des Spätsommers und Frühherbstes eine starke Fettansammlung begünstigen, und gerade das ist es ja, woraus die Natur hinarbeitet, denn das vor Eintritt des Winters in oft erstaunlicher Menge aufgespeicherte Fett soll dazu dienen, das glimmende Lebensfünkchen während des langen Totenschlafes zu unterhalten. Mit dicken Fettpolstern und hängendem Bäuchlein beziehen die Tiere im Spätherbste das Winterquartier, und klapperdürr und abgemagert, aber gesund und frisch kommen sie im Frühjahr wieder zum Vorschein und suchen durch eifrigen Fraß so rasch als möglich wieder eine anständige Körperfülle zu erlangen. Und das gelingt ihnen auch recht bald und bis zum Herbste sehr gründlich. Siebenschläfer und Haselmäuse haben sich dann derart angemästet, daß die kleinen Beinchen mit den zierlichen Zehen kaum noch aus der Fettmasse des Körpers heraussehen. Andere, wie der Hamster, mästen sich noch, nachdem sie sich bereits in die Winterhöhle zurückgezogen und hier eingeschlossen haben. Der reichliche Schlaf im Sommer ist also die wichtigste Quelle der Fettbildung, die ihrerseits wieder die Nahrungsstoffe für den Winterschlaf liefert. Wenig bekannt dürfte es sein, daß die Winterschläfer auch noch einen besonderen Apparat, eine vierteilige Drüsenansammlung ohne Ausführgänge, auf den Halsseiten oder an der oberen Brust besitzen, dessen Zellen gelbes Fett absondern und der wohl dazu dient, eine besondere Umwandlung des Fettes zu bewirken, es zum Verbrauch durch den körperlichen Organismus geeigneter zu machen. In ihrer wachen Zeit zeigen sich allerdings viele Winterschläfer als ungemein bewegliche, reizbare, empfindliche, rastlose und nervöse Geschöpfe, und diese hochgespannte Lebenstätigkeit bedingt wohl auch einen besonders starken Säfteverbrauch, der wiederum eine starke Erschlaffung, eine gewisse Übermüdung zur Folge hat, für deren Ausgleich der gegenteilige Prozeß der langen und vollkommenen Winterruhe gewiß nicht ohne Bedeutung ist.
Über die Einbuße an Körpergewicht, der die Winterschläfer durch den allmählichen Verbrauch des eigenen Fettes unterworfen sind, liegen ziemlich genaue Beobachtungen vor, aus denen im allgemeinen hervorgeht, daß die Tiere durchschnittlich einen Gewichtsverlust von ¼ ihres Körpergewichtes erleiden, der sich aber sogar bis auf ? steigern kann. Eine von Helm im Zimmer gehaltene Haselmaus wog beim Beginn ihres Winterschlafes am 18. November 25 g, am 25. 24 g, am 2 7. und 30. je 23 g, am 4. Dezember 22,5 g, am 10. 22 g, am 31. 21 g, am 5. Januar 20 g, am 11. 19,75 g, am 15. 19,5 g, am 26. (inzwischen war das Tier vorübergehend erwacht und hatte gefressen) 19,65 g, am 31. 19 g. Dieses Miniatur-Hörnchen war also in 74 Tagen von 25 auf 19 g heruntergekommen und hatte demgemäß 6/25 = 24 % an Gewicht verloren. Von A. Müller beobachtete Haselmäuse büßten allerdings nur 1/12 bis 1/9 ihres Gewichtes ein, aber dabei ist zu berücksichtigen, daß der Gewichtsverlust in freier Natur jedenfalls erheblich größer ist, weil der Winterschlaf gefangener Exemplare doch öfters durch Pausen und (im Freien ausgeschlossene) Nahrungsaufnahme unterbrochen wird. Fledermäuse, die ich selbst unter genauer Kontrolle hielt, wiesen einen Gewichtsverlust von 20-28 % auf.
Das sich zum Winterschlaf zurückziehende Tier muß unbedingt eine instinktive Ahnung von dem haben, was ihm bevorsteht, denn in der zweckmäßigsten Weise trifft es seine Vorkehrungen, um dem scheintoten Leben eine gewisse Sicherheit vor äußeren Einflüssen und Feinden zu wahren und das Erwachen im Frühjahr vorzubereiten. Ich habe dabei immer an die indischen Fakire denken müssen und an die verschiedenen Manipulationen, die sie vorzunehmen pflegen, ehe sie sich mit angehaltenem Atem in den Sarg legen und für einige Wochen begraben lassen. Diese Vorsicht zeigt sich zunächst schon in der Wahl der Schlafquartiere, wobei z. B. die Fledermäuse – meiner Ansicht nach überhaupt nicht die stupiden Geschöpfe, für die man sie gewöhnlich hält, sondern vielmehr geistig hochbegabte und sehr intelligente Tiere – eine wahrhaft staunenswerte Umsicht und Überlegung bekunden. Unter den vielen Höhlen, die ihnen in unseren Mittelgebirgen zur Verfügung stehen, sagen ihnen nur die allerwenigsten wirklich zu. Da werden ganz genau die klimatische und örtliche Lage, die Wind-, Luft-, Zug- und Feuchtigkeitsverhältnisse berücksichtigt, und in der schließlich ausgewählten Höhle wird wieder nur ein kleiner, ganz besondere Verhältnisse aufweisender Teil zum Bewohnen geeignet gefunden. Sehr gern haben es die Tiere, wenn der vordere Teil der Höhle unter Wasser steht, weil dadurch die Marder und Iltisse abgehalten werden, die sonst leicht den größten Teil der ahnungslos schlummernden Flatterer abwürgen, wenn sie auf ihren Streifzügen erst einmal ein solches Massenquartier ausfindig gemacht haben. Aber das wichtigste Erfordernis ist und bleibt stets ein ganz bestimmter Feuchtigkeitsgehalt der Luft, weil sonst die Scheintoten durch Vertrocknen zu wirklich Toten umgewandelt werden und nicht wieder aus ihrem tiefen Schlafe erwachen, sondern als starre Mumien schließlich zu Boden fallen. Die Ziesel verschütten den eigentlichen Eingang zu ihrem Bau, legen aber gleich eine neue Röhre bis kurz vor die Oberfläche an, so daß sie diese dann im Frühjahr bloß zu durchstoßen brauchen, um von neuem das alles belebende Tagesgestirn zu erblicken. Auch der mürrische Hamster verschließt sorgfältig den Eingang zu seiner schönen und geräumigen Winterwohnung, die 1½ – 3 m unter der Erde gelegen ist (die Sommerwohnung nur 1 – 5/4 m) und füttert sie mollig mit ganz klein zerbissenem Stroh aus, das sich wie feinste Seide anfühlt. Daneben sind noch mehrere Kornkammern angelegt und überreichlich mit sauber geschichteten Vorräten angefüllt. Wer es versteht, die Bauten dieses Geizhalses unter den Tieren, der mehr aufzuspeichern pflegt, als er beim besten Willen verzehren kann, ausfindig zu machen, der kann damit ganz gute Geschäfte machen, denn oft birgt eine solche Diebeshöhle 30 bis 35 kg des schönsten Getreides, das man auswaschen, trocknen und dann wie jedes andere vermahlen kann. Der faule Gauch frißt sich davon vor dem Einschlafen noch ordentlich fett und zehrt auch nach dem Erwachen wochenlang von seinen Schätzen, ehe er sich wieder zur Erdoberfläche empor wagt, während er sie als echter Winterschläfer im Winter selbst nicht anrührt, da er dann keinerlei Nahrung zu sich nimmt. Er pflegt schon Mitte Februar zu erwachen, öffnet seine stille Klause aber kaum vor Mitte März und ist demgemäß einen vollen Monat lang auf seine wohlgefüllte Speisekammer angewiesen.
Auch die oberirdisch lebenden Winterschläfer fertigen sich z. T. besondere Schlafnester an, die ihnen vor den Unbilden des Winters den größtmöglichen Schutz gewähren und sie zugleich den Blicken ihrer Feinde entziehen sollen. Ganz allerliebst sieht das wundernette Winternest der liebenswürdigen Haselmaus aus, eine halb auf, halb in der Erde sitzende, zierlich gedrechselte Kugel von etwa 9 cm Durchmesser, dicht und fest aus schmalem Bandgras, Baumbast, Moos und trockenen Blättern geflochten, mit etwa 2 cm starken Wänden, alles durch den wie trockener Schneckenschleim glänzenden Speichel des Tierchens verbunden und verkittet. In dieser Graskugel liegt eine kaum merklich atmende Pelzkugel mit krampfhaft an die Wangen gedrückten und zu winzigen Fäustchen geballten Zehen, abstehenden Schnurrhaaren, fest geschlossenen Augen, eingezogenen Mundwinkeln, eingeklemmten Wangen und über Kopf und Stirn geschlagenem Schwänze: die in tiefster Erstarrung schlafende Haselmaus, die Besitzerin dieses kleinen, heimlichen Palastes. Der Igel bereitet sich an einem recht versteckten Plätzchen ein weiches Lager von trockenem Laub, Heu, Moos und auch wohl Fichtennadeln. Seitdem der alte Lenz geschrieben hat, daß der Igel das alte Laub zu seinem Winterneste in der Weise hinschaffe, daß er sich auf ihm herumwälze, es so aufspieße und nun als wandernder, hochbepackter Möbelwagen sein eigen Hausgerät dahinführe, findet sich diese Angabe in fast allen Naturgeschichten. Aber wer hat die Tatsache wirklich selbst beobachtet und mit eigenen Augen gesehen? Wenn man da genauere Nachfrage hält, ist in der Regel ein verlegenes Schweigen die Antwort. Zwar den von manchen Zweiflern angeführten Einwand, daß der Igel gar nicht imstande sei, derartig aufgespießtes Laub wieder von den Stacheln abzustreifen, möchte ich nicht gelten lassen, denn ich habe mich an gefangenen Igeln überzeugt, daß sie das sehr wohl vermögen, indem sie seitlich an Zweige, Steine oder andere Vorsprünge anstreifen. Und einer meiner Freunde, ein ebenso tüchtiger wie gewissenhafter Beobachter, teilte mir noch 1907 mit, daß er die von Lenz geschilderte Art des Laubeintragens in seiner Jugend selbst beobachtet habe, wobei er sich aber leider der näheren Umstände nicht mehr zu erinnern vermochte. Braeß meint, daß unser Stachelheld das abgefallene Laub mit den Vorderpfoten zusammenscharre und so in seine nur seichte Schlafhöhle schiebe. Dagegen schreibt mir Herr Lehrer Jahn aus Osnabrück: »Ich habe es anders gesehen. Einst kam ich in den Herbstferien durch einen Birken- und Buchenbestand. Als ich quer hindurchging, hörte ich ein Rascheln im Laube. In der Meinung, es mit einer Schlange zu tun zu haben, ging ich näher hinzu und fand unseren Freund Igel, wie er sich Laub für seinen Winterbau sammelte. Aber zu meinem Erstaunen mußte ich bemerken, daß der fleißige Bursche – allen Naturbeschreibungen zum Trotz – sich nicht im Laub wälzte, sondern gemütlich eine Schnauze voll nach der andern seinem Baue zutrug. So habe ich es gesehen und halte seitdem die andere Ansicht für irrig.« Der letzte Satz geht nun doch wohl zu weit, denn man darf nicht gleich das Kind mit dem Bade ausschütten und muß sich in den Naturwissenschaften immer sehr davor hüten, eine Einzelbeobachtung vorschnell zu verallgemeinern. Es sei nur an die alte Erfahrung erinnert, daß gleichartige Tiere lokal oft ganz verschiedene Gewohnheiten annehmen. Im allgemeinen dürfte aber wohl das Eintragen des Baumaterials mit dem Maule das übliche sein, schon weil es das einfachste und naturgemäßeste ist. Noch weniger glaublich als die Beförderung von altem Laub auf dem Stachelrücken erscheint der gleichfalls oft behauptete Transport von Obst auf diese sonderbare Weise, denn hier würde das nachträgliche Abstreifen in der Tat schon große Schwierigkeiten machen. Tiere, die schon öfters überwintert haben, wissen sich die dabei gemachten Erfahrungen sehr wohl zu nutze zu machen. So hörte ich in Rußland von einem Bären, der sein Winterlager 10 m über dem Erdboden im Geäste einer alten Weißtanne aufgeschlagen hatte, weil Meister Petz im Vorjahre in seiner Schneehöhle auf ebener Erde von Jägern in recht unsanfter Weise aus seinem behaglichen Schlummer aufgestört worden war.
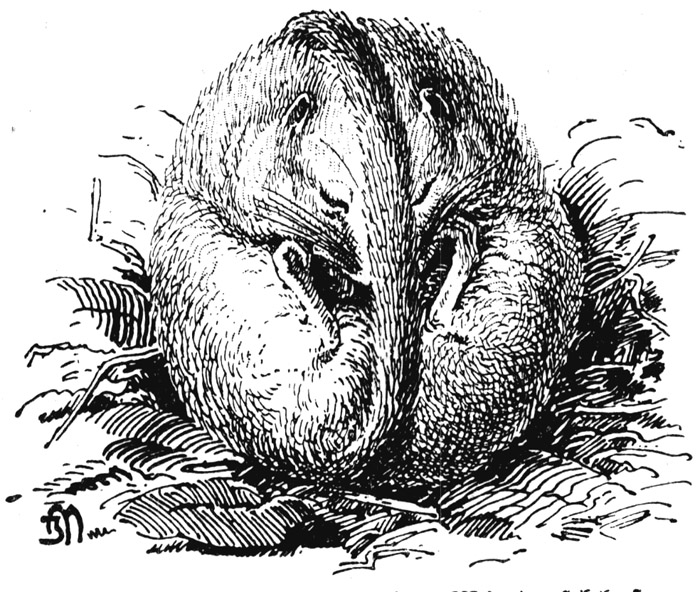
Abb. 24. Haselmaus im Winterschlaf.
Dem eigentlichen Winterschlafe geht verminderte Freßlust, Trägheit und Schläfrigkeit voraus. In den letzten Tagen vor Eintritt der Erstarrung entleeren sich die Tiere vollständig und nehmen keinerlei Nahrung mehr zu sich, so daß sie mit vollständig leerem Magen und Darm in den Winterschlaf eintreten. Dies gilt auch von solchen, die wie der Hamster noch nach dem Abschließen des Winterquartiers durch hastiges Fressen ihren Fettvorrat noch im letzten Augenblick zu ergänzen bestrebt sind, und scheint mir eine wesentliche, ja vielleicht unerläßliche Voraussetzung für ein gutes Überstehen des langen Scheintodes zu sein. Wissen wir doch auch von den indischen Fakiren, die sich zu dem vielbesprochenen, vielbestaunten und vielbezweifelten, aber in einigen Fällen doch mit Sicherheit nachgewiesenen Begrabenwerden und Wiederauferstehen hergaben, daß sie schon einige Tage vorher ihren Körper durch starke Purgiermittel von allen Speiseresten reinigen und dann nichts mehr zu sich nehmen. Nach dem völligen Eintritt der Lethargie liegt das schlafende Tier gewöhnlich auf der Seite, gegen den Bauch zu eingekrümmt und mehr oder weniger zusammengerollt, die Füße krampfhaft angezogen, Augen, Mund und After fest geschlossen. Es muß auffallen und sollte zum Nachdenken anregen, daß die Stellung aller Winterschläfer, soweit sie mir bisher wenigstens bekanntgeworden ist, ganz oder fast ganz der Lage des Embryos bei derselben Tierart gleicht. Deshalb ist auch der im Winterschlafe erstarrte Igel nicht zu der vollkommenen Stachelkugel zusammengerollt, die uns entgegenstarrt, wenn unser Hund im Sommer den von ihm so gehaßten »Swinegel« irgendwo aufgestöbert hat und in ohnmächtiger Wut anbellt, sondern er ist nur halb eingerollt, so daß die Füßchen und das pfiffige Schweineschnäuzlein sichtbar bleiben. Manche Tiere schlafen einsam wie der Hamster, andere familienweise wie das Murmeltier, noch andere in Massenquartieren wie viele Fledermäuse.
Jüngere Tiere verfallen später in Erstarrung als ältere, und ihr Schlaf ist auch weniger fest und vollständig und wird leichter durch Pausen des Wachseins unterbrochen. Im übrigen aber hat sich der Winterschlaf nachgerade zu einem naturgemäßen Bedürfnis des körperlichen Organismus der betreffenden Tiere herausgebildet, und seine gewaltsame Unterbrechung oder gar Verhinderung bringt deshalb die schwersten Schädigungen der Gesundheit mit sich. Eines dieser Tiere, das den ganzen Winter über wach gehalten wurde, ist ein fast ebenso sicherer Todeskandidat wie ein Vogel, der nicht vermausert hat. Deshalb ist es auch nach meinen Erfahrungen so schwer, winterschlafende Tiere in der Gefangenschaft in gesundem Zustande zu erhalten, was besonders von den Fledermäusen gilt, denn das Erwecken, der schroffe Temperaturwechsel und die mit dem Transport verbundene mehrmalige Unterbrechung des Schlafes genügen meist schon, den Todeskeim in die Ärmsten zu legen; sie erliegen dann rasch einer Art Blutvergiftung, die oft mit Lähmungserscheinungen verbunden ist. Ein seiner natürlichen Behausung entrissener, dadurch, wenn auch nur auf kurze Zeit, erweckter, ins Zimmer und damit in ganz andere Luft- und Feuchtigkeitsverhältnisse verbrachter Winterschläfer ist ein durch und durch krankes Tier, und deshalb möchte ich mich gegen alle an solchen Exemplaren gemachte Beobachtungen äußerst skeptisch verhalten. Um über den Winterschlaf ins reine zu kommen, sind unbedingt Beobachtungen in freier Natur nötig, die freilich ungemein schwierig anzustellen sind. Es kann uns daher nicht verwundern, wenn noch so viele unrichtige und falsche Vorstellungen über diese wunderbare Naturerscheinung verbreitet sind, wenn hier noch so viel Unkenntnis und Unklarheit herrscht, wenn wir betreffs des wahren und innersten Wesens des Winterschlafes ehrlicherweise offen zugestehen müssen: Ignoramus (wir kennen es nicht).
Wie tief der echte Winterschlaf ist, wie niedrig alle Lebensfunktionen währenddem zurückgeschraubt sind, geht wohl am besten daraus hervor, daß sogar die Entozoen oder Innenschmarotzer den totenähnlichen Erstarrungszustand ihrer Wirtstiere unfreiwillig mitmachen müssen. Von der im Magen des Igels schmarotzenden Physaloptera clausa wenigstens ist das nachgewiesen. Vollkommen bewegungslos sieht man diese Schmarotzer an den Innenwänden eines im Winter rasch ausgenommenen und aufgeschnittenen Igelmagens hängen, aber sie erwachen sofort und beginnen sich zu bewegen, wenn man den Magen in warmes Wasser legt, um von neuem zu erstarren, wenn man kaltes Wasser zugießt. Danach ist der Schlaf der Innenschmarotzer also wohl sicherlich auf die mit der Lethargie verbundene und sehr beträchtliche Erniedrigung der Körpertemperatur ihrer Wirtstiere zurückzuführen. Die sonst homöothermen (warmblütigen) Winterschläfer werden während ihres Erstarrungszustandes nahezu zu pökilothermen (kaltblütigen oder wechselwarmen) Tieren, eine Tatsache, die geeignet erscheint, die große Kluft zwischen Warmblütern und Kaltblütlern einigermaßen zu überbrücken. Während die Körpertemperatur der wachenden Winterschläfer der der übrigen Säuger keineswegs nachsteht, wir vielmehr gerade in ihren Reihen die warmblütigsten aller Vierfüßer finden (so die Zwergfledermaus mit 39½ und die frühfliegende Fledermaus mit 40° C.), ist sie während der Lethargie nur wenig höher als die der umgebenden Luft und kann an warmen Wintertagen sogar niedriger sein. Bei in Höhlen aufgehängten Fledermäusen fand ich die Temperatur meist zwischen 5 und 10° und durchschnittlich nur 1° höher als die der Luft. Beim Igel und anderen weniger vollkommenen Winterschläfern soll dagegen die Körperwärme nicht leicht unter 8° sinken. Je intensiver der Winterschlaf, um so niedriger im allgemeinen die Körpertemperatur und umgekehrt. Infolge der geschützten Lage der sorgsam ausgewählten Schlafplätze hält sie sich im allgemeinen immer einige Grade über dem Gefrierpunkte, aber es sind auch schon Fälle beobachtet worden, wo sie nur ½° betrug und vorübergehend selbst auf 0 sank, ohne daß es dem Tiere geschadet hätte. Dauern aber derartige Verhältnisse länger an, so erwacht der Schläfer und stirbt, wenn nicht bald mildere Witterung eintritt, die sein Blut wieder etwas erwärmt und ihm so das Weiterschlafen möglich macht. Auch im Sommer zeigt die Blutwärme der Winterschläfer bei Kälte, Hunger und Krankheit eine große Neigung zu raschem Sinken, in welcher Beziehung sich aber nicht nur artliche, sondern vielfach auch individuelle Unterschiede geltend machen.
Die Atmung erscheint während des Winterschlafes auf ein Mindestmaß herabgesetzt, und ältere Forscher behaupten sogar übereinstimmend, daß sie beim Eintritt der gänzlichen Lethargie wenigstens zeitweise völlig aufhöre. In der Tat muß man schon sehr scharf aufpassen, um die seltenen und kaum merklichen Atembewegungen beispielsweise einer Zwergfledermaus wahrzunehmen. Nach Tiemann machte ein schlafendes Ziesel, dessen Körperwärme 10° betrug, nur alle 50-56 Sekunden einen leisen Atemzug, also täglich deren etwa 1630, während dasselbe Tier in wachendem Zustande in der Minute etwa 30mal, am Tage also 43 200 mal atmete, seine Respirationstätigkeit somit fast das 30fache betrug. Aber schon die leiseste Berührung ruft eine sofortige Beschleunigung der Atmung hervor, selbst die bloße Erschütterung des Erdbodens durch Gehen, ganz sicher aber die Wärme der menschlichen Hand. Legt man den Schläfer in diese, so erfolgen meist einige tiefe, schnarchende, lange und unregelmäßige Atemzüge, die allmählich leiser, kürzer und regelmäßiger werden, bis das Tierchen schließlich erwacht. Barkow vermutet, daß die Respiration während des Winters von Reizen ausgelöst wird, die vom Darmkanal und Gefäßsystem ausgehen. Die Lungen liegen während des ganzen eigentlichen Winterschlafes schlaff und zusammengefallen neben der Wirbelsäule, enthalten fast gar keine Luft und befinden sich also im Zustande der höchsten Exspiration (Ausatmung). Hochinteressant und für die Frage des Winterschlafes von vielleicht ausschlaggebender Wichtigkeit, trotzdem sonderbarerweise in wissenschaftlichen Kreisen seit Jahrzehnten in unverdiente Vergessenheit geraten ist nun aber das, was Barkow beim Igel feststellte, bei dem Gaumen und Kehlkopf ganz eigentümliche gegenseitige Verhältnisse aufzuweisen haben. Die Epiglottis (der Kehldeckel) verklebt sich nämlich während des Winterschlafes ziemlich fest durch ihre hintere Fläche mit der unteren Fläche des weichen Gaumens, so daß die Verbindung zwischen Mundhöhle und Rachen dadurch nahezu aufgehoben wird. Beim Erwachen des Tieres wird diese unterbrochene Verbindung zuerst an den Seiten wieder hergestellt, so daß alsdann an jeder Seite des Kehldeckels ein kleiner Eingang in den Rachen geschaffen wird, während seine Mitte zunächst noch festgeklebt bleibt. Es ist sehr bedauerlich, daß diese Verhältnisse der Aufmerksamkeit der vergleichenden Anatomie völlig entgangen zu sein scheinen und daher nicht auch bei anderen Winterschläfern näher untersucht worden sind. Wahrscheinlich würde ein eingehendes hierauf bezügliches Studium bei Fledermäusen, Siebenschläfern u. a. zu ähnlichen Ergebnissen führen.
Und auch hier muß ich unwillkürlich wieder der indischen Fakire gedenken, die sich willkürlich durch künstliches, in jahrelangen, mühsamen Vorbereitungen eingeübtes Einhalten des Atems in wochenlangen Scheintod zu versetzen vermögen. Meiner unmaßgeblichen Ansicht nach ist dieser rätselhafte Todesschlaf der Fakire nichts als ein künstlich herbeigeführter tierischer Winterschlaf, ermöglicht nur durch genaueste Kenntnis der dabei mitwirkenden natürlichen Faktoren und erleichtert vielleicht durch eine uralte atavistische Veranlagung des Menschen zum Winterschlaf. Der Fakir erreicht einen gewissen notwendigen Abschluß der Atemwege durch das Umstülpen der Zunge. Richard Schmidt Fakire und Fakirtum im alten und modernen Indien, Berlin 1907. sagt hierüber: »Daß es nicht jedem Menschen gegeben ist, dieses Kunststück nachzuahmen, und daß es nur durch eine anhaltende vieljährige Übung erlernt werden kann, daran ist kein Zweifel. Wie ich mir habe sagen lassen, so haben solche Leute das Bändchen unter der Zunge zerschnitten oder ganz abgelöst, wobei sie vermittels Einreibung mit Butter, welche mit Bertramwurzel vermischt ist, und mit Ziehen an der Zunge dieselbe so lang hervorragend bekommen, daß sie bei ihren Experimenten des Scheintodes sie sehr weit zurücklegen können, um damit die Öffnung der Nasenhöhlen im Rachen zu bedecken und die Luft im Kopfe eingesperrt zu halten … Man erzählt, daß der Fakir, von dem die Rede ist, einige Tage vor der Vergrabungsszene ein Purgiermittel eingenommen und darauf mehrere Tage hindurch eine spärliche Milchdiät gebraucht habe. Am Tage der Vergrabung selbst soll er statt des Essens einen 3 Finger breiten und über 30 Ellen langen Streifen Leinwand allmählich hinuntergeschlungen, ihn aber auch allsogleich wieder herausgezogen haben, um den Magen zu reinigen, worauf er sich auch die Gedärme auf die oben beschriebene Art mit Wasser ausspülte … Sind die gedachten Zubereitungen geschehen, so verstopft er sich alle Körperöffnungen, die oberen, und unteren, die vorderen und hinteren mit aromatischen Wachsstöpseln, legt die Zunge nach oben umgeschlagen tief in den Rachen zurück, kreuzt die Hände über die Brust und erstickt sich in Gegenwart eines großen Zuschauerkreises durch Atemanhalten. Bei der Wiederbelebung ist es eine der ersten Operationen, ihm die Zunge aus dem Hinterteile des Rachens vermittels eines Fingers hervorzuziehen, worauf ein warmer, gewürzhafter Teig aus Hülsenfrüchtenmehl auf seinen Kopf gelegt und ihm in die Lungen und in die von den Wachsstöpseln befreiten Ohrgänge Luft eingeblasen wird, worauf die Stöpsel aus der Nase mit Geräusch herausgetrieben werden. Dies soll das erste Anzeichen der Rückkehr zum Leben sein.« Also Punkt für Punkt ein nahezu vollkommenes Seitenstück zu den Erscheinungen bei der Lethargie des echten Winterschlafes! So erklärt sich das anerkannt größte Wunder der Fakire auf die denkbar einfachste und natürlichste Weise, und die Spiritisten und Okkultisten tappen gar arg in die Irre, wenn sie hier Verbündete oder Beweise zu finden glauben.
Der Igel, um von den Wundern der Fakire wieder auf unseren stacheligen Freund zurückzukommen, erscheint auch insofern den Verhältnissen des Winterschlafs besonders gut angepaßt, als er eine längere und stärkere Atmungsfähigkeit besitzt als die keinen Winterschlaf haltenden Säuger und imstande ist, das letzte Sauerstoffrestchen in einer gegebenen Luftmenge für sich aufzubrauchen. So lebte nach den Untersuchungen von Saissy ein Igel in nicht mehr die Verbrennung gestattender Luft noch 65 Minuten, ein Kaninchen dagegen nur 25 und eine Ratte nur 5 Minuten, während ein Sperling sofort darin erstickte. Weitere experimentelle Versuche von Saissy, Barkow, Hall, Czernak und Spallanzani beweisen unwiderleglich, daß die Respiration während des intensivsten Winterschlafes auf ein kaum faßbares Minimum herabgesetzt ist. So hielten Murmeltiere und Fledermäuse in Kohlensäure, in der Vögel und Ratten sofort starben, volle 4 Stunden aus, ohne Schaden zu nehmen. Dasselbe war der Fall bei einer Fledermaus, die 2 Stunden im Stickstoff verblieben war. Im luftleeren Raume hielten Fledermäuse 7 Minuten, unter Wasser 16 Minuten aus, ein Igel sogar 22 Minuten. Es geht nicht gut an, derartige scheinbar unmenschliche Versuche grausam zu schelten, denn während des Winterschlafes geht den Tieren jedes Schmerzgefühl so vollständig ab, daß man sie sogar köpfen kann, ohne daß sie etwas davon bemerken. Man hat auch den Sauerstoff gemessen, den diese in wachem Zustande sehr viel Oxygen verbrauchenden Tiere während ihrer Lethargie einer sie umgebenden und genau abgegrenzten Luftschicht entnahmen, und dabei gefunden, daß der Verbrauch an Sauerstoff innerhalb 3 Stunden kaum nachweisbar war, und daß innerhalb 60 Stunden nur soviel Sauerstoff verzehrt wurde, wie sonst innerhalb 30 Minuten.
Auch die Herztätigkeit ist während des Winterschlafes in hohem Maße vermindert, und die Herzbewegungen sind dementsprechend ungemein schwach und langsam. Während man bei Fledermäusen in wachem Zustande 100-200 Herzschläge in der Minute zählte, betrug ihre Zahl zu Beginn der Lethargie nur 14-28. Beim Igel beobachtete man in jenem Falle 75, in diesem 25 Herzschläge, bei der Haselmaus 200-250 und 10-20, beim Hamster 150-200 und 14 bis 15, beim Murmeltier 90 und 10-12. Natürlich wird so der Blutkreislauf stark gehemmt und das Blut mit Kohlenstoff gesättigt, was sich an der dunkleren Färbung des arteriellen Blutes zu erkennen gibt. Doch ist das Blut selbst während des Winterschlafes lebenskräftiger als sonst, wie sich dies aus dem späteren Eintreten der Fäulnis, der langsamen Gerinnung und der zögernden Trennung von Blutkuchen und Serum unschwer nachweisen läßt.
Alle echten Winterschläfer gehen mit leerem Magen in den Winterschlaf, und es tut ihnen durchaus nicht gut, wenn sie aus ihrer Lethargie geweckt und zum Verzehren von Nahrung verleitet werden, ist vielmehr ihrer Gesundheit höchst nachteilig. Igel, die man erweckte und Fleischstückchen verzehren ließ, starben schon nach wenigen Tagen, und das Fleisch fand sich völlig unverdaut in ihrem Magen vor, – ein Zeichen, daß dieser seine Funktionen eingestellt hatte, wie er denn auch während der Dauer der Lethargie ganz eng zusammengeschrumpft erscheint. Beim Dachs und anderen Arten, die nur einen unvollkommenen Winterschlaf halten und hin und wieder von ihren Vorräten zehren, ist dies allerdings nicht der Fall. Die Sekretionen der Magenschleimhaut und der Darmdrüsen sind nahezu aufgehoben. Die Geschlechtsorgane werden vor Eintritt der Lethargie stark rückgebildet, Samenfäden sind schließlich gar nicht mehr vorhanden, Samenblase und Prostata (Vorsteherdrüse) bis zur Unkenntlichkeit zusammengeschrumpft. Aber nach dem Erwachen schwellen die Drüsen überraschend schnell wieder an und strotzen bald förmlich von Geschlechtsprodukten, wie ja auch die Begattungszeit der meisten Säuger ins Frühjahr fällt, wenn im Lenzesglanz die ganze Natur Liebe zu atmen scheint. Spermatozoen (Samentierchen) zeigen sich schon wenige Tage nach dem Erwachen, anfangs freilich nur die Köpfchen, während die Schwänze erst später sich entwickeln. Während des eigentlichen Winterschlafes finden keine Harnentleerungen statt (doch bei Unterbrechungen), wohl aber langsame Harnabsonderungen, so daß die Blase kurz vor dem Erwachen bis zum Platzen mit wässerigem, wenig salzigem Harn angefüllt erscheint. Der ewige Wechsel der Materie hört also auch während der Lethargie keineswegs vollständig auf, wie dies ja auch aus dem allmählichen Verbrauch der angelegten Fettpolster hervorgeht, die als innere Nahrung herhalten müssen und durch ihr Schwinden eine so auffallende Veränderung des Körpergewichtes bedingen.
Je tiefer die Lethargie, desto geringer wird die Muskelkraft der erstarrten Schläfer. Feuert man z. B. in einer von überwinternden Fledermäusen bevölkerten Höhle einen blinden Schuß ab, so fallen viele der schlummernden Flatterer regungslos zu Boden, weil ihre Füßchen nicht mehr Kraft genug besitzen, der Lufterschütterung genügenden Widerstand entgegenzusetzen. Oft kommt es vor, daß selbst gute Tierkenner ihnen im Winter überbrachte Fledermäuse achtlos wegwerfen oder gar dem Ofen überantworten, weil sie den Zustand der völligen Lethargie nicht von dem des wahren Todes zu unterscheiden wissen, jedenfalls ein Beweis mehr dafür, wie unheimlich ähnlich sich beide sind, wie vollkommen hier die Brücke vom sonnigen Leben zur ewigen Nacht geschlagen erscheint. Eine gewisse Feuchtigkeit der Luft erscheint für die Winterschläfer unabweisbares Bedürfnis, da ihr säftearmer Körper sehr zum Vertrocknen neigt, was den Tod des Tieres zur Folge hat. Bezeichnend ist es, daß es dann gewöhnlich nicht verwest, sondern zu einer dürren und hutzligen Mumie zusammenschrumpft, die dann später in einzelne Stücke zerfällt. Auch von dem häßlichen Kadavergeruch, der bei Tierleichen sonst unsere Nase beleidigt, ist nichts zu verspüren, im Gegenteil konnte ich feststellen, daß im Winterschlaf gestorbene Ziesel ganz angenehm nach Weinsäure, Fledermäuse sogar unverkennbar nach Veilchen dufteten.
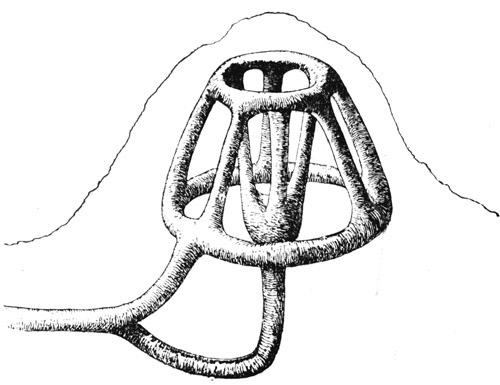
Abb. 25. Maulwurfsbau.
Schon aus der sorgfältigen Art und Weise, in der viele Winterschläfer sich ihr Schlafquartier herrichten, konnten wir entnehmen, daß es auch im Reiche der Vierfüßler ganz hervorragende Baukünstler gibt, die ihre Talente sowohl über wie unter dem Erdboden zu entfalten vermögen. Aber nur in den wenigsten Fällen ist das Winterquartier mit der sonstigen Behausung oder mit der Kinderstube identisch, sondern meist werden für diese verschiedenen Zwecke auch ganz verschiedenartige Bauten angelegt. Der Maulwurf, der Schwimmer im Erdreich mit dem Sammetpelz und den schaufelförmigen Grabpfoten, ist der Besitzer eines ganz verwickelt, aber höchst zweckmäßig entworfenen unterirdischen Palastes. Den Mittelpunkt dieser umfangreichen Burg bildet ein trichterförmiger, etwa 50 cm unter der hier zu einem ansehnlichen Hügel aufgeworfenen Erde liegender Kessel von etwa 25 cm Durchmesser, mit dessen Außenwand in etwa 30 cm Abstand eine ringförmige Röhre parallel läuft. Darüber liegt ein zweiter, etwas kleinerer Kreisgang, der durch 3 schräge Schächte mit dem Kessel und durch 5-6 andere mit dem großen Ringgang verbunden ist. Von dem mit weichem, oft erneuertem Grase ausgepolsterten Kessel führt als Notausgang ein fast senkrechter Fluchtschacht nach unten, der dann später umbiegt und in die die Wohnung mit dem Jagdgebiet verbindende Laufröhre einmündet. Von dem äußeren Kreisgang strahlen nach den verschiedensten Seiten weitere Röhren aus, die schließlich alle wieder in einem Bogen in den Laufgang zurückführen. Nach diesem Schema pflegen wenigstens die alten Maulwürfe meistens zu bauen. Wo man unvollkommenere Maulwurfsbauten antrifft, gehören sie in der Regel jüngeren Exemplaren an. Dieser ist ziemlich flach, aber so breit, daß sich der Maulwurf darin bequem bewegen und daher mit der überraschenden Schnelligkeit eines trabenden Pferdes dahineilen kann, dabei oft 50 m und mehr lang, denn so weit pflegt meistens die an einem geschützten Plätzchen angelegte Wohnung von dem aus freierem Gelände befindlichen Jagdgebiet entfernt zu sein. Das Erdreich über dem Laufgange, der sich äußerlich durch eine schwache Senkung des Bodens und das Absterben der auf ihm wachsenden Pflanzen einigermaßen kenntlich macht, wird nicht zu Haufen aufgeworfen, sondern fest in die Seitenwände angedrückt, und auch der Boden der Röhre erscheint infolge der starken Benützung wie festgestampft. Da der Maulwurf nämlich täglich viermal zur Jagd hinauszieht (morgens, mittags, abends und um Mitternacht) und nach erfolgter Sättigung jedesmal wieder zu seinem Kessel zurückkehrt, um ein wenig zu ruhen, so muß er täglich achtmal den Weg durch die Laufröhre machen. Seine ungeheure Gefräßigkeit bedingt auch ein entsprechend starkes Trinkbedürfnis, und da er dieses nicht immer leicht befriedigen kann, legt er sich auch noch besondere Schächte an, in denen sich das Grund- und Regenwasser sammelt, so daß man ohne Übertreibung von »Maulwurfsbrunnen« sprechen kann.
Das Graben selbst muß dem gefräßigen Einsiedler in der schwarzen Künstlersammetjacke sehr leicht werden. Sein ganzer Körperbau ist ja auf diese Wühltätigkeit eingestellt und ihr in vollendetem Maße angepaßt. Die ungeheuren Schaufelfüße, die gewaltig entwickelte Nackenmuskulatur, der walzenförmige Leib mit dem leichten Hinterteil und dem dichten Haarpelz, die verschließbaren Ohren und die winzigen, tief im Pelz versteckten Augen, dies alles sind Eigenschaften, die nur einem vollendeten Erdtier zukommen können. Wie ein Schraubendampfer durch die Fluten, wie eine Schneepfluglokomotive durch zusammengewehte Schneemassen, so wühlt sich dieser mit Riesenkräften begabte Zwerg durch das Erdreich, und wenn dieses locker und sandig ist, gibt seine Schnelligkeit der eines langsam schwimmenden Fisches kaum etwas nach. Wer selbst einmal einen Maulwurf, etwa in einer mit Glaswänden versehenen Kiste, bei seiner Wühlarbeit belauscht hat, der wird mich verstehen, wenn ich seine Fortbewegungsart am liebsten eine schwimmende nennen möchte. Die ihm lästig werdenden Erdmassen werden dabei von Zeit zu Zeit zu den bekannten Maulwurfshügeln aufgeworfen, eine verhältnismäßig ganz gewaltige Kraftleistung, die aber unser unterirdischer Held spielend bewältigt. Auf ihn paßt die Zellsche Theorie vorzüglich, denn er ist ein Nasentier im weitestgehenden Sinne des Wortes, wie man es sich ausgesprochener und einseitiger entwickelt kaum denken kann. Wohl sind auch Gehör und Gefühl ziemlich scharf, aber bei allen seinen Handlungen wird der Maulwurf doch im wesentlichen von seiner ungemein feinen, ständig in schnüffelnder Bewegung begriffenen und überaus empfindlichen Nase geleitet. Schon ein ganz leichter Hieb auf diese genügt, seinen Tod herbeizuführen, zumal auch sein Schädeldach auffallend dünn ist und leicht bricht, was bei einem unterirdisch lebenden Tier eigentlich verwunderlich ist. Selbst oben auf der Erdoberfläche liegende Beutetiere wittert der Maulwurf mit Sicherheit, die Erde hebt sich an der betreffenden Stelle ein wenig, ein spitzes Schweineschnäuzchen mit gierig geöffnetem Gebiß kommt für einen Augenblick zum Vorschein, schnappt rasch zu, und um den Regenwurm ist es geschehen. Sogar oben auf den Grashalmen sitzende Schnecken werden auf diese Weise gewittert und heruntergeholt.
In dem geistigen Wesen des Maulwurfes wird man wenig sympathische Züge entdecken können; unersättliche Gefräßigkeit, unbändige Mordlust und unverträgliche Zanksucht sind seine hauptsächlichsten Eigenschaften. Er vertilgt ganz unglaubliche Mengen Nahrung, täglich etwa das Anderthalbfache seines Körpergewichtes, verdaut aber auch unheimlich rasch, ist deshalb wenige Stunden, nachdem er sich bis zum Platzen vollgepfropft, schon wieder hungrig und vermag überhaupt nur ganz kurze Zeit ohne Nahrung auszuhalten. Da er ein ausschließlicher Fleischfresser ist, muß er also als ein in seiner Art geradezu fürchterliches Raubtier bezeichnet werden. Auch im Winter gibt dieser ewig bewegliche Herkules in Zwerggestalt, diese lebendige Wühllokomotive, wie ihn die Gebrüder Müller nennen, keine Ruhe. Er denkt gar nicht daran, einen Winterschlaf zu halten, sondern er folgt einfach seinem Hauptwild, den Regenwürmern, in die tieferen Erdschichten herab und scheint gerade dort ganz besonders greuliche Verwüstungen unter diesen wehrlosen und vielverfolgten Tieren anzurichten. Er schwelgt dann förmlich im Überfluß und legt sich daher auch Vorräte für kargere Zeiten an, indem er an bestimmten Stellen seines weitverzweigten Röhrenbaues wahre Unmengen von Regenwürmern zusammenschleppt, denen er einige Körpersegmente abbeißt; er hindert sie so am Fortkriechen, ohne sie doch zu töten. Die Kröten sind sehr lüstern nach diesen Speisekammern und plündern sie nach Möglichkeit, dürfen sich aber dabei nicht vom Maulwurfe erwischen lassen, denn sonst ist's um sie geschehen. Aber auch die Fischer sind ihm um seiner Vorräte willen neidisch und geben sich alle Mühe, sie ausfindig zu machen (was freilich nicht gerade leicht ist), weil sie dann für Wochen hindurch aller Sorgen um die im Winter so schwer zu beschaffenden Angelwürmer enthoben sind. Kann man doch aus einem einzigen Bau eine große Gießkanne der schönsten Würmer wegtragen! Dahls wog einen so gefundenen Würmervorrat und fand ihn 2,13 kg schwer, wozu auch noch eine Partie Engerlinge kam. Die größten Vorräte findet man immer in den sogenannten Mutterhaufen, d. h. den Wohnplätzen der trächtigen Weibchen, die wohl schon für die Zeit ihrer Niederkunft vorsorgen, während die Männchen sich weniger mit dem Vorrätesammeln abgeben. Doose, der als eifriger Sportfischer die Sache selbst praktisch erprobt hat, sagt, daß die Vorräte gewöhnlich in den Röhren liegen, die strahlenförmig von der Wohnkammer ausgehen und dann zur großen Laufröhre umbiegen, und zwar vorzugsweise in den westlich des Burgzentrums befindlichen.
Der schwarze Burgherr ist in seinem Revier von finsterer Unduldsamkeit. Wehe dem Lebewesen, das seine Gänge kreuzt und ihm dabei vor die Nase kommt! Es wird mit grimmiger Wut angefallen und unbarmherzig aufgefressen. Blindschleichen und Ringelnattern verfallen regelmäßig diesem Schicksal, aber man sagt, daß der Maulwurf selbst den Kampf mit der gefährlichen Kreuzotter nicht scheue, und viele behaupten sogar, daß er gegen ihren todbringenden Giftzahn gefeit sei. Ersteres will ich gerne glauben, denn der kleine schwarze Teufel fürchtet sich eben überhaupt vor keinem Geschöpf, mit dem er halbwegs anbinden zu können glaubt, letzteres aber möchte ich denn doch stark bezweifeln. Maulwürfe gleichen Geschlechtes oder außerhalb der Paarungszeit selbst die verschiedenen Geschlechter betrachten sich gleichfalls als Todfeinde, der Brotneid erstickt jede andere Regung, und wo sie sich bei ihren unterirdischen Streifzügen zufällig begegnen, da beginnt auch sofort ein erbitterter Kampf auf Leben und Tod. Der Unterlegene wird von seinem Bezwinger einfach aufgefressen, denn zu den vielen häßlichen Eigenschaften des grimmigen Wühlers gehört auch ein ausgesprochener Kannibalismus. Wie manches blutige Drama mag sich, jedem Auge verborgen, unter der verschwiegenen Rasendecke in den Maulwurfsröhren abspielen! Nicht selten aber trifft der jedenfalls durch einen ganz hervorragenden Mut ausgezeichnete Maulwurf in seinem Laufgange auch auf einen überlegenen Gegner. Da ist es vor allem das flinke, geschmeidige Wiesel, dem der plumpe, schwarze Ritter nach tapferer Gegenwehr regelmäßig erliegen muß. Nur ausnahmsweise wird es uns einmal glücken, den Maulwurf außerhalb seines unterirdischen Reiches auf freiem Boden zu beobachten. Am ehesten ist das noch in der Paarungszeit der Fall, wo die Leidenschaft und Eifersucht die stets sehr in der Überzahl befindlichen Männchen bisweilen dazu verlockt, ihre Kämpfe auch über der Erde fortzusetzen, so daß man ein ganzes Knäuel von ihnen fauchend und zwitschernd, beißend und strampelnd an einem sonnigen Wiesenhang antreffen kann. Oder an einem recht stillen und ungestörten Plätzchen kommt der mürrische Einsiedler wohl auch nach einem Regenschauer zum Vorschein und sucht mit großer Behendigkeit die Fahrgeleise nach Regenwürmern ab. Reeker sah sogar im Februar einen Maulwurf bei tiefem Schnee und 3° Frost aus einem Haufen alten Laubes hervorkommen und frei über einen 2 m breiten Weg nach einer Hecke laufen, wobei er unterwegs haltmachte, um sich sein Fell zu putzen. Am häufigsten sieht man in manchen Jahren und in gewissen Gegenden die Tiere im Hochsommer auf der Oberfläche, aber ihr ganzes Benehmen hat dann etwas Krankhaftes, sie kratzen sich fortwährend und laufen unruhig durcheinander, ohne zu kämpfen: es ist offenbar eine verheerende und ansteckende Seuche unter ihnen ausgebrochen. Wenig bekannt ist es, daß die Maulwürfe auch ganz vortrefflich und mit großer Ausdauer schwimmen, wozu sie ja freilich die ganze Art und Weise ihrer Fortbewegung von vornherein in hohem Maße befähigt. Albinos sind unter den Maulwürfen gar keine Seltenheit, aber es kommen sogar sechs- und siebenfarbige Varietäten vor.
Geräumig und zerklüftet, behäbig und sauber ist Burg Malepartus, das Heim Meister Grimbarts, des bequemen Dachses. Er ist ein auf peinlichste Ordnung und Reinlichkeit haltender Hausherr, ein Pedant unter den Tieren, ein »Meister beschaulichen Stillvergnügtseins, eine wohltuende Abnormität in unserem jagenden, hastenden, galoppierenden Säkulum«. Mich hat sein ganzes Gebaren immer an einen behäbigen Rentner erinnert, der sein Schäfchen ins Trockene gebracht und nun auf Gottes weiter Welt nichts Rechtes mehr zu tun hat, als sich der lieben Sonne zu erfreuen und recht viel an seiner Wohnung herumzubasteln, der dabei von Mißtrauen gegen alle Welt erfüllt ist und jedes Ereignis von der schwärzesten Seite ansieht, der seine Umgebung gern mit seinen verdrießlichen Launen plagt, obwohl er im Grunde der gutmütigste und ehrlichste Kerl und selbst einem derben Späßchen gelegentlich keineswegs abgeneigt ist. All diese Charaktereigenschaften kommen auch dem Dachse zu. Seine Reinlichkeitsliebe geht so weit, daß er seinen Bau niemals mit dem eigenen Kote verunreinigt, sondern sich 3-4 eigene Aborte in der Nähe der Haupthöhle anlegt, kurze Röhren oder auch nur trichterförmige Gruben, in denen er ausschließlich seinen Unrat absetzt und dann regelmäßig mit großer Sorgfalt verscharrt. Es wirkt geradezu komisch, wie er sich fortwährend an diesen Aborten zu schaffen macht und immer noch etwas an ihnen auszubessern hat. Wenn Junge im Bau sind, hat die Dächsin ihre liebe Not, die nötige Reinlichkeit herzustellen. Sie gräbt dann dicht neben dem Hauptkessel im Bau selbst eine Abortröhre und leitet ihre tolpatschige Nachkommenschaft an, alle Bedürfnisse daselbst zu verrichten, schleppt auch unverdrossen alle Nahrungsüberbleibsel aus der Kinderstube nach dieser Senkgrube. Von den zahlreichen Röhren des Dachsbaues stehen nur wenige in ständiger Benützung (der Jäger nennt sie »befahren«), die übrigen dienen lediglich als Notausgänge. Da der sehr schön und dicht mit Moos ausgepolsterte Wohnkessel meist tief unter der Erde liegt, wird ihm die nötige Luft durch einige besondere Luftschächte zugeführt. Der Platz vor der Hauptröhre ist festgestampft wie eine Tenne, und von ihm aus führen deutlich erkennbare Pfade nach den bevorzugten Jagdgebieten in der Umgebung. Die gewaltigen Scharrklauen kommen dem Dachse beim Graben sehr zustatten, und wenn ihn die Hunde in seiner Burg belagern und bedrängen, sucht er sich rasch noch weiter einzugraben, zu »verklüften«, wie es in der Weidmannssprache heißt. Der Durchmesser der einzelnen Röhren ist ein ziemlich großer, denn der plumpe Burgherr braucht schon einen gehörigen Platz für seinen feisten Leib. Die Beobachtung einer Dächsin mit ihren spielenden Jungen vor dem Bau ist ein Hochgenuß, der aber dem Naturfreunde nur äußerst selten zuteil wird, denn Freund Grimbart ist ein gar vorsichtiger Bursche, der sich nur höchst ungern in die Karten gucken läßt und sein stilles Tun und Treiben dem Auge des Menschen nach Möglichkeit zu entziehen strebt.

Abb. 26. Dachs vor dem Bau.
Es gehört deshalb die ganze Geduld und Ausdauer eines erfahrenen Jägers dazu, den Dachs vor seinem Baue zu belauschen. Schon beim Herauskommen aus seiner unterirdischen Behausung bekundet der Einsiedler das ängstlichste Mißtrauen und streckt den schwarz-weiß gefärbten Kopf wohl ein halb dutzendmal witternd und schnüffelnd zum Loche heraus, ehe er den plumpen, schwerfälligen Körper nachzuschieben sich entschließt. Ruhe und ungestörte Einsamkeit sind für ihn die ersten und unerläßlichsten Voraussetzungen des Wohlbefindens, und wo sie vorhanden, legt er seinen Bau wohl gar auf freiem Felde an, wenn ihm auch zerklüftetes und bewaldetes Gelände immer lieber ist. Nicht überall ist er so scheu wie bei uns; in Rußland und Kleinasien habe ich ihn viel vertrauter und umgänglicher gefunden, und sogar in Ostpreußen begegnete ich ihm einmal am hellen Tage mitten auf einer stillen, durch jungen Kiefernwald führenden Landstraße. Gefräßig kann man eigentlich den Dachs nicht nennen und noch viel weniger mordgierig, aber bei seiner beschaulichen Lebensweise schlägt ihm eben alles vortrefflich an, so daß er meist eine starke Fettschicht unter seiner dicken Schwarte hat. Beim Ausgraben der Regenwürmer, die wohl seine Hauptnahrung bilden, sticht er mit seinen kräftigen Klauen trichterförmige Löcher in den weichen Waldboden, wodurch er dem Auge des Kundigen seine Anwesenheit leicht verrät. Eine gewisse Leckerhaftigkeit ist ihm entschieden eigen, wie sich schon aus seiner Vorliebe für Brombeeren, Weintrauben, Fallobst, junge Maiskolben und Hummelnester schließen läßt. Trotzdem ist er kein Kostverächter, denn auch Frösche, Kröten und Schlangen müssen für ihn herhalten. Der unbefangene Beobachter, der einen Dachs in freier Natur vor sich sieht, wird beim Anblick des schwerfälligen, hübsch gerundeten Tierkörpers sicherlich an ein Schwein erinnert werden, zumal der Dachs ähnlich grunzt wie dieses, nun und nimmer aber an ein grimmiges Raubtier denken, wenn er sieht, wie Freund Grimbart so still-gemütlich und harmlos-friedlich im lockeren Erdreich nach Wurzeln und Engerlingen gräbt. Und doch haben es die Herren Systematiker fertiggebracht, unseren beschaulichen Klausner mit den blutgierigen Mardern, einen gemütlichen Fettwanst mit den überschlanken, mordlüsternen Wieseln zusammenzustellen!

Abb. 27. Nest der Zwergmaus.
Das schönste oberirdische Nest verfertigt unter allen Säugetieren wohl zweifellos die Zwergmaus, die an Kunstfertigkeit den besten Baumeistern in der Vogelwelt wenig oder nicht nachsteht. Diese winzigste, friedlichste, gewandteste und anmutigste aller Mäuse ist hauptsächlich auf sumpfigem Gelände zu Hause, und hier errichtet sie fast nach Rohrsängerart gewöhnlich an Rohrhalmen oder auf Schilfbinsen ihren kleinen Wunderbau. Man findet ihn jedoch auch im Dorngestrüpp oder Getreidefeld, ja selbst auf Disteln. Er hat ungefähr Form und Größe eines Gänseeies und eine Schlupföffnung an der Seite, die von der Mutter jedesmal sorgsam verschlossen wird, wenn sie genötigt ist, zur Beschaffung von Nahrung auszugehen und die Wochenstube mit der nackten Kinderschar sich selbst zu überlassen. Wie der Buchfink ist auch die Zwergmaus klug genug, als äußeres Nistmaterial nur solche Blätter zu wählen, wie sie in der nächsten Umgebung wachsen, damit sich das Nestchen nicht etwa auffällig von dieser abhebe. Jedes Binsenblatt usw. zieht sie erst wiederholt zwischen ihren scharfen Zähnchen durch, um es so in ganz feine Streifen zu zerfasern, bis ihr diese gut genug zur Verwendung dünken. Nach innen zu wird dieses Baumaterial immer feiner und zarter, und die eigentliche Auspolsterung besteht dann aus seidiger Rohrkolben- und Weidenwolle, die flockenweise mit Speichel fest an die Wand gedrückt wird. Diese kunstvolle, lauschig versteckte und deshalb schwer zu findende Kinderwiege wird nur ein einzigesmal benützt und jedesmal eine neue angelegt, sobald das Mäuslein wieder Mutterfreuden entgegensieht. Noch in einer anderen Beziehung ist die Zwergmaus bewundernswert, nämlich als Kletterkünstlerin, wobei ihr der bewegliche, lange Wickelschwanz sehr zustatten kommt. Mit unvergleichlicher Zierlichkeit klettert der hübsche Nager, von dem man früher irrtümlich annahm, daß er auf Sibirien und Ostrußland beschränkt sei, während er auch in ganz Mitteleuropa durchaus keine Seltenheit ist, an den dünnsten Zweigen des Gebüsches, an Rohr- und Getreidehalmen, an schwanken Gräsern und Schilfblättern in allen nur denkbaren Stellungen herum, sich so drehend und wendend, als ob das schmucke Fellchen gar nicht an dem zwerghaften Körperchen festgewachsen wäre, und man wird nicht müde, ihm dabei zuzuschauen. Ebenso schwimmen die Zwergmäuse gern und vorzüglich, führen am Wasser überhaupt eine halb amphibische Lebensweise.
Als kunstreichster Baumeister der gesamten Tierwelt aber hat von jeher der Biber eine gewisse Berühmtheit erlangt. Gerade diese ward ihm nebst seinem schönen Pelz zum Verderben, denn sie vertrug sich nicht mit dem Eigennutz des Menschen und seiner selbstsüchtig geordneten Forstwirtschaft, und damit war das Zeichen zum Vernichtungskampfe gegeben und das Schicksal des großen Nagers entschieden. Heute ist er in Deutschland fast ausgerottet und im wesentlichen nur noch an der mittleren Elbe in der Gegend der Saalemündung zu finden. Wer nun aber etwa dorthin reisen wollte, in der Absicht, die vielbewunderten Biberdämme, die das Tier zur Ableitung oder Aufstauung von Wasser aufführt, um dessen Spiegel immer auf gleicher Höhe zu erhalten, aus eigener Anschauung kennen zu lernen, der würde meist eine Enttäuschung erleben, denn solche Riesenbauten führt der Biber nur da auf, wo er sich in unberührter Waldeseinsamkeit gänzlich ungestört und unbehelligt weiß. An der Elbe kommt es dazu nur selten. Hier beschränkt sich das Tier nach den übereinstimmenden Berichten von Mertens und Kraft gewöhnlich darauf, Wohnbauten in steilen, lehmigen Uferwänden anzulegen. Eine unter der Oberfläche des Wassers ausmündende Röhre von allerdings nicht weniger als 10-15 m Länge führt in einen geräumigen, schön gewölbten und hübsch mit trockenem Grase ausgefütterten Kessel, der aber nicht etwa mehrere »Gemächer« enthält, wie man wohl gefabelt hat. Außer dieser Hauptröhre findet sich gewöhnlich auch noch eine kurz gebogene Nebenröhre. Droht dieser Behausung eine Überschwemmung durch Hochwasser, so richtet sich der Biber in den überfluteten Weidengehegen durch schnelles und geschicktes Übereinanderlegen selbstgeschnittenen Weidenreisigs eine meterhoch aus dem Wasser hervorragende sichere Zufluchtsstätte her und bringt auf ihr im Notfalle seine beiden Jungen in Sicherheit. Ferner legt sich dieser intelligente Nager gern auch an geeigneten Stellen lauschige Faulenzerplätzchen dicht über dem kühlen Wasser an, die auf der Flußseite durch Schilf und Rohr, auf der Uferseite durch überhängendes Gebüsch gut verdeckt sind, und wo er auf weicher Grasunterlage manches Stündchen im warmen Sonnenscheine verträumt. Nach Mertens schneidet der Biber dort hauptsächlich Eichenstämme von 15-30 cm Durchmesser ab und richtet dadurch bedeutenden forstlichen Schaden an. Er steigt auch auf schräge Äste und klettert sogar dünne Zweige entlang, um die Rinde zu schälen und die Spitztriebe wie mit einem Messer abzuschneiden und fortzutragen. Um so dankbarer ist es anzuerkennen, daß die dortige Forstverwaltung den seltenen und so hochinteressanten Tieren nicht den Vernichtungskrieg angekündigt hat, sondern sie an dieser ihrer letzten Zufluchtsstätte im Deutschen Reiche ziemlich ungestört gewähren läßt. Die oft geschilderte Benützung des ruderförmigen Biberschwanzes als Maurerkelle beim Bauen wird übrigens von neueren Beobachtern wie Dahms entschieden bestritten.

Abb. 28. Biber.
Auf Grund vielfacher eigener Beobachtungen bin ich zu der Überzeugung gekommen, daß auch die Säugetiere ebenso wie die Vögel die bei der Anlage ihrer Wohnbauten und Wochenstuben gemachten Erfahrungen sehr wohl praktisch zu verwerten, einmal begangene Fehler ein zweitesmal klüglich zu vermeiden und sich in weitgehender Weise den jeweiligen Umständen und Verhältnissen anzupassen oder sie auszunützen wissen. So siedelten sich z. B. Feldmäuse, die ja sonst bekanntlich in seichten Röhrenhöhlen wohnen, der vielen mehlhaltigen Grassämereien halber auf einem sumpfigen Wiesengelände an und errichteten hier auf Inselchen überirdische, äußerst warm und festwandig aus seinen Grashälmchen geflochtene Kugelnester. Solche kann man in ausnehmend trockenen Jahren selbst auf den Feldern finden, wenn infolge anhaltender Dürre dort das Erdreich so steinhart geworden ist, daß den Mäusen ihre Wühlarbeit dadurch zu sehr erschwert wird. Liederlich gefertigte, tellergroße Nestklumpen der Feldmaus nebst den Jungen darin hat man auch schon auf Maulwurfshaufen gefunden – allerdings bei der bekannten Mordgier des unterirdischen Einsiedlers eine recht gefährliche Nachbarschaft. Der Siebenschläfer, der faule Gauch, hat sich neuerdings in manchen Gegenden sehr an die von Vogelfreunden ausgehängten Starkästen gewöhnt und schlägt mit Vorliebe in ihnen sein Heim auf, und der Gartenbesitzer hat sich dann an Stelle der gefiederten Beschützer seiner Obstbäume einen genäschigen und verschwenderischen Obstdieb angelockt. Auch von einer Igelmutter hörte ich, die in einer zum Katzenfang ausgestellten Kastenfalle ihr Wochenbett ausgeschlagen hatte und hier stillvergnüglich eine achtköpfige Kinderschar säugte.
Einer der Hauptunterschiede zwischen den stammverwandten Hasen und Kaninchen besteht bekanntlich darin, daß letztere Erdhöhlenbewohner sind. Es scheint aber fast, als ob sie diese Gewohnheit nach und nach ablegen und Freilandbewohner werden wollten, worauf neuerdings namentlich Liebe, L. Schuster und Otto hingewiesen haben. In den dichten Wäldern Hessens halten sie kaum noch die Anlage von Bauen für nötig, sondern beziehen an geschützten Plätzchen freie Standlager wie der Hase, der ursprünglich wohl ebenfalls Höhlentier war und sich erst allmählich zu seinen jetzigen Gewohnheiten entwickelte. Sie machen sich dort in dicht verwachsenen Kieferschonungen förmliche Gänge auf dem niedrigsten Astwerk und wechseln regelmäßig über sie hinweg. In Australien, wo das Kaninchen sich bekanntlich massenhaft vermehrt hat und zu einer wahren Landplage geworden ist, hat es unter dem Zwang der Verhältnisse sogar die schwierige Kunst des Kletterns erlernt. Zäh, schlau und anpassungsfähig sind ja die Wildkaninchen im höchsten Grade, dabei oft auch von verblüffender Frechheit und Dreistigkeit. So hatte ein Weibchen seine Wochenstube aus einem Kartoffelfelde unweit einer großen Fabrik und belebten Straße und nur 1½ Schritt von einem durch ein Drahtgeflecht abgetrennten und von großen Doggen bewohnten Hundezwinger aufgeschlagen. Sehr gern hecken die Kaninchen aus Zimmermannsplätzen, wo sie vor den Wachthunden leicht unter die aufgestapelten Holzstöße flüchten können und durch deren Anwesenheit vor den ihnen gefährlicheren Katzen beschützt werden. Auch die vom Grünspecht in die Ameisenhaufen geschlagenen Löcher benützt das Kaninchen, wie L. Schuster mitteilt, gern zur Herstellung seines Lagers, wird aber hier öfters vom Fuchs wie in einer Mausefalle abgefangen und erwürgt. Viele Kaninchen wohnen ohne Bau in von Heidekraut üppig durchwucherten Abzugsgräben, in Reisighaufen, Feldbrandziegelöfen, ausgestapelten Zementröhren und ähnlichen Schlupfwinkeln. Nur für seine Nachkommenschaft legt das Weibchen noch besondere kleine Satzbaue an, hauptsächlich wohl um die Jungen vor den kannibalischen Gelüsten des lieblosen Herrn Papa zu schützen. Der Kessel wird mit der eigenen Bauchwolle der Alten ausgefüttert, die ihr Geheimnis ängstlich zu hüten bestrebt ist und ihre Kinder nur nachts ganz verstohlen besucht, um sie zu säugen, worauf sie die Röhre zuscharrt und die Stelle nach den Angaben Ottos sorgfältig mit Losung und Urin verwittert. Wie die meisten Nager sind auch die Kaninchen sehr reinlich und setzen ihre Losung gewöhnlich an der gleichen Stelle ab, die auch von anderen Individuen aufgesucht wird, so daß förmliche Kaninchenaborte entstehen. Obwohl diese Tiere sonst durchaus keine Freunde von Feuchtigkeit und Nässe sind, siedeln sie sich doch bisweilen auch im Sumpfe an und springen hier geschickt von einer Kaupe (festen Stelle) zur anderen. Charakteristisch für das Kaninchen ist seine Neugierde, bei deren Erwachen es die »Löffel« (Ohren) in ganz eigentümlicher Weise nach vorn überneigt, während es freudiger Erregung durch Hakenschlagen auf der Stelle und komische Kreuzsprünge Ausdruck verleiht und von seinem Mißbehagen durch ablehnendes Kopfschütteln und zuckendes Hinauswerfen der Hinterläufe Kunde gibt, gleich als habe es das bekannte Wort vorausgeahnt, daß die Nörgler den Staub von den Pantoffeln schütteln möchten. Am Tage nicht sehr scharfsichtig, sieht es doch im Dämmerlicht wesentlich besser als wir Menschen. Der Geruch ist sehr gut entwickelt, und das Tempo, in dem das feine, stets vibrierende Näschen bewegt wird, ist der beste Gradmesser für den jeweiligen Seelenzustand des munteren Tieres. Das Gehör steht dem des Hasen entschieden nach, ist zwar nicht schlecht, aber doch nicht so gut, wie man nach der Länge der Löffel vermuten sollte. Liebe meint, daß das Vibrieren der feinen, auf der Innenseite der Löffel stehenden und gegen jede Berührung äußerst empfindlichen Härchen die Gehörswahrnehmung mit unterstütze. Eine Art Kaninchensprache hat sich ausgebildet durch verschiedenartiges Aufstampfen mit den Hinterläufen, wodurch die mannigfaltigsten Signale zustande kommen. Der Schall wird dabei wahrscheinlich nicht durch die Luft, sondern durch den Erdboden weiter geleitet, und gerade gegen diese Laute scheint das Kaninchenohr sehr empfindlich zu sein, das sich überhaupt gegen verschiedene Arten von Tönen sehr verschieden verhält. Am meisten und intensivsten werden diese Stampfsignale von den unternehmungslustigen Rammlern benutzt.
In der Nähe ihrer Bauten bekunden die meisten Säuger eine ganz besondere Vorsicht, die so weit gehen kann, daß sie in deren unmittelbarer Nachbarschaft auffällige Mordtaten und Plünderungen nach Möglichkeit vermeiden. Namentlich vom Fuchs wird dies von gewissenhaften Jägern seit alters mit aller Bestimmtheit behauptet. Ich muß gestehen, daß ich mich gegen solche Angaben früher äußerst skeptisch verhalten habe und dem roten Freibeuter eine solch überlegende Schlauheit denn doch nicht recht zuzutrauen vermochte. Aber neuere Beobachtungen scheinen sie in der Tat zu bestätigen. So lese ich in einer Jagdzeitung, daß ein angeschossener Hase in einen Fuchsbau flüchtete, ohne daß der Fuchs ihn tötete. Am folgenden Tage wurden beide ausgegraben, und der Hase war noch immer nicht »gerissen« (getötet). Auch das noch immer nicht genügend aufgeklärte friedliche Zusammenleben von Fuchs und Höhlenente in demselben Bau kann vielleicht auf diese Weise enträtselt werden, wenngleich hier wahrscheinlich auch noch andere Faktoren mitspielen.
Wie dem Baumeister Biber, so hat die rastlos vorwärtsschreitende und alles nivellierende menschliche Kultur auch dem größeren vierbeinigen Raubzeug gar übel mitgespielt. Es hieße Nekrologe schreiben, wenn man die so interessante Naturgeschichte unserer großen Raubtiere abfassen wollte. Bär und Luchs sind fast völlig verschwunden aus dem deutschen Walde, der Wolf ist nur noch an den äußersten Grenzen unseres Vaterlandes gelegentlich zu finden, Wildkatze und Nerz sind schon überall zu recht seltenen Erscheinungen geworden. Der deutsche Jäger kann all diese prächtigen Räubergestalten zumeist nur noch in ausgestopftem Zustande in den Museen bewundern, und auch da handelt es sich, wie der uns begleitende Cicerone ganz stolz erklärt, häufig genug um »die letzten Mohikaner«. Der wahre Naturfreund aber wird bei diesem Gedanken kaum ein Gefühl des Bedauerns unterdrücken können.
Der stattliche Bär, Meister Petz, uns von den Kindertagen her als der beliebte »Tanzbär« noch eine vertraute Erscheinung, scheint jetzt auch in den Ländern, die ihm bisher noch eine wenig gestörte Zufluchtsstätte boten, rasch von der Bildfläche zu verschwinden. In Schweden z. B., wo in den letzten 50 Jahren noch 2762 Bärenpelze erbeutet wurden, geht es jetzt mit seinem Bestande so rasend schnell bergab, daß sich die Staatsforstverwaltung veranlaßt fühlte, dem Parlamente einen Gesetzesentwurf zu unterbreiten, wonach Freund Braun künftig als seltenes »Naturdenkmal« unter Schutz gestellt werden soll. Auch im Okkupationsgebiet (Bosnien und Herzegowina) haben die leidigen Giftbrocken und selbst in Rußland die militärischen Jagdkommandos und die die Winterlager der Bären aufspürenden und dann für sündhaft teures Geld an deutsche, englische und französische Sportsleute verkaufenden Bauern ganz gewaltig mit Meister Petz aufgeräumt. Freilich kann der Bär da, wo er sich daran gewöhnt hat, die menschlichen Gehöfte heimzusuchen, ganz erheblichen Schaden anrichten. So las ich, daß einer in einer Stunde 15 Kühe umbrachte, ein anderer in einer Nacht 5 Kühe und 17 Pferde tötete. Ebenso werden Bienenstöcke und Haferfelder mit Vorliebe von den Bären geplündert. Aber das sind immerhin seltene Ausnahmen, denn die im einsamen Gebirgswalde lebenden Bären, die mehr Pflanzen- als Fleischfresser sind und namentlich den Heidelbeeren gerne nachgehen, sind keine besonders schädlichen Tiere und gewöhnlich auch recht harmloser Natur. Die erste Nahrung der Jungbären im Frühjahr pflegt in Ameisen zu bestehen.
Dagegen ist der Wolf in Rußland noch so häufig, daß der von ihm angerichtete Schaden volkswirtschaftlich ziemlich schwer ins Gewicht fällt. Nach der letzten Statistik wurden im europäischen Rußland als den Wölfen zum Opfer gefallen angemeldet: 438 Pferde, 1517 Füllen, 313 Kühe, 1158 Kälber, 1510 Schweine, 2052 Ferkel, 7674 Schafe und 3347 Stück Geflügel, zusammen also 18 009 Stück Haustiere mit einem Schätzungswerte von mindestens 400 000 Mark. Im Winter kommen russische Wölfe nicht allzu selten über die Grenze in die großen Forsten Ostpreußens und selbst Schlesiens, werden hier aber gewöhnlich sehr bald von der aufmerksamen Jägerei zur Strecke gebracht. In Siebenbürgen zerrissen die Wölfe in dem harten Winter 1906/07 noch zahlreiche Menschen. In Frankreich wurden 1891 noch 149 alte und 253 junge Wölfe erlegt, die meisten in der Dordogne. Auch in dem doch so dicht bevölkerten und hoch kultivierten Lothringen ist der Wolf noch jetzt keine Seltenheit. Bei Metz wird der hungrige Isegrim jeden Winter gespürt, und in Diedenhofen kommt er mit dreister Unverschämtheit bis aufs Glacis der Festung. Noch im Januar dieses Jahres schrieb mir Herr Hübschmann, daß sich die Wölfe wieder zahlreich im oberelsäßischen Kreise Altkirch zeigten, sich bis dicht an die Dörfer heranwagten und Wild wie Haustiere den Bestien vielfach zum Opfer fielen. Wolfsjagden sind deshalb in unseren Reichslanden ein beliebter Sport der Gutsbesitzer und Offiziere. Daß der Wolf sich in dortiger Gegend so lange halten konnte, daran ist die eigentümliche Art und Weise der Forstkultur mit ihrer Hackwirtschaft schuld, wodurch sich undurchdringliche Buschwälder bilden, die dem Raubzeuge prachtvolle Schlupfwinkel bieten.

Abb. 29. Wolf.
Vom Nerz, dessen kostbares Pelzwerk wir besser kennen als seine überaus versteckte Lebensweise, wage ich zu hoffen, daß er im nördlichen Deutschland doch noch etwas öfter vorkommt, als man anzunehmen pflegt, gewöhnlich aber nicht bemerkt und noch seltener richtig erkannt wird. Seine westlichste Fundstelle dürfte Blockland bei Bremen sein. Im August 1902 wurde ein Exemplar bei Skiowieth in Ostpreußen geschossen, und 6 Jahre vorher war es mir vergönnt gewesen, dieses schon so seltene Wasserwiesel den ornithologisch zu einer gewissen Berühmtheit gelangten Möwenbruch bei Rossitten auf der Kurischen Nehrung durchschwimmen zu sehen. Mehrere Jahre lang hatte ich schon diesen Bruch zur Vogelzugzeit fast täglich abgesucht, aber bis dahin noch niemals das Geringste vom Nerz bemerkt, gewiß auch ein Beweis dafür, wie ausgezeichnet sich dieses vorsichtige und scharfsinnige Tier dem beobachtenden Auge des Menschen zu entziehen versteht.
Das Auftauchen einer Luchsfamilie wurde mir im Vorjahre aus dem mit finsteren Wäldern bedeckten niederösterreichischen Ybbstale gemeldet. Die öfters in Jagdzeitungen auftauchenden Klagen, daß man gerissenes Rehwild mit vollständig abgetrenntem Kopfe gefunden habe, lassen mit Sicherheit darauf schließen, daß bisweilen auch noch einzelne Luchse aus den russischen Wäldern in unsere östlichen Reviere herüberwechseln.
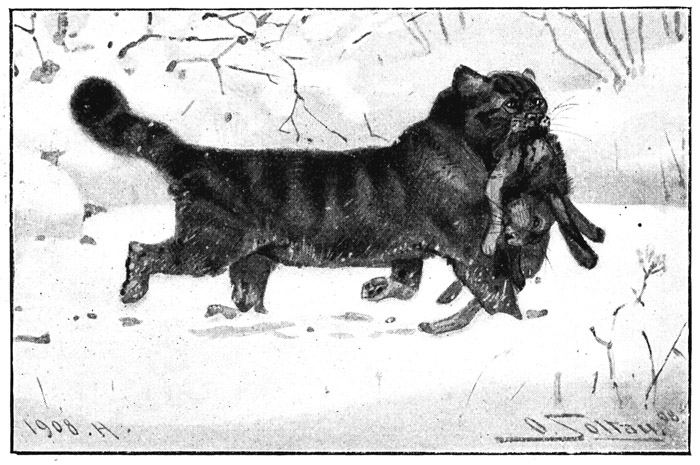
Abb. 30. Wildkatze.
Ungleich häufiger ist noch die Wildkatze, obwohl ein guter Teil der in der Jagdpresse als erlegt gemeldeten Wildkatzen unter die Rubrik »verwilderte Hauskatzen« zu setzen ist, vielfach auch Kreuzungen vorkommen. Als bestes Kennzeichen der echten Wildkatze gilt der schwarze Sohlenfleck. Mir selbst ist es noch nicht vergönnt gewesen, diesen Panther des deutschen Waldes, diesen riesenstarken Zwerg mit dem Löwenmut und dem Tigerherzen in unseren Forsten zu beobachten. Dagegen bin ich auf meinen Streifzügen im südlichen Marokko häufig mit der Wildkatze zusammengetroffen und habe ihrer dort viele erlegt und gefangen. Im Käfig erwiesen sich diese schönen Tiere gar nicht so ungebärdig, wie man es immer in den Naturgeschichtsbüchern angegeben findet, vertrugen sich recht gut mit Ginsterkatzen und Ichneumons, legten viel Intelligenz an den Tag, wurden leidlich zahm und paarten sich ohne Umstände mit meinen Hauskatzen, mit denen sie fruchtbare Blendlinge erzeugten. Wie grimmig sich die in die Enge getriebene und angeschossene Wildkatze zur Wehr setzen kann, geht aus einer Erzählung meines verstorbenen Vaters hervor, der in seiner Jugend ein leidenschaftlicher Jäger gewesen war. Ihm war im Thüringerwald ein verwundeter Wildkater wütend direkt auf die Brust gesprungen und hatte diese mit seinen Krallen derart zerfleischt, daß die Narben noch viele Jahre später deutlich sichtbar waren.
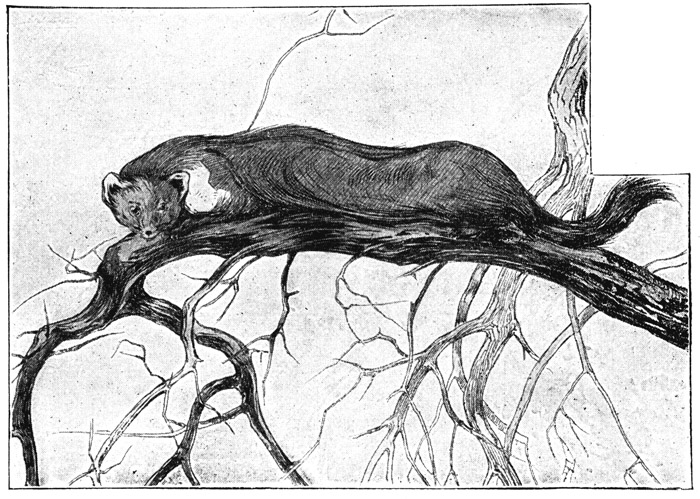
Abb. 31. Baummarder.
Weit zahlreicher als die bisher erwähnten Räuber ist in unseren Wäldern und Fluren die Familie der Marder vertreten, und ich will hier nur in aller Kürze einige neuere Beobachtungen über die verschiedenen Mitglieder dieser blutdürstigen Sippe mitteilen. Ein echtes Waldtier ist der Edel- oder Baummarder, an der gelben Kehle leicht von dem mehr in der Nähe menschlicher Ansiedlungen sich aufhaltenden, weißkehligen Steinmarder zu unterscheiden, obwohl die nicht allzu selten vorkommenden und wahrscheinlich auch ihrerseits wieder fruchtbaren Mischlinge zwischen beiden die Bestimmung bisweilen sehr erschweren. Einmal traf ich noch im Juli junge Edelmarder an, die vor einer hohlen Eiche spielten und ihren Spielplatz durch häufige Benützung so platt getreten hatten wie eine Tenne. Als sie mich schließlich bemerkten, flüchteten sie in den im Wurzelwerk des Baumes gelegenen Eingang zu ihrer Kinderstube, und ein hörbar werdendes Geräusch ließ vermuten, daß sie an der hohlen Innenseite in die Höhe zu klimmen versuchten. Alsbald erschien auch die Alte am Eingang, zornig keckernd und augenscheinlich bereit, ihre Nachkommenschaft mit Einsatz des eigenen Lebens zu verteidigen. Bisweilen richtet sich der Baummarder auch in alten Elsternestern häuslich ein, die er dann mit Moos und Gras sorgfältig auspolstert. In recht stillen und einsamen Waldungen zieht dieser schöne Räuber auch am hellen Tage auf Beute aus, und sein Mut wird nur von seiner Gewandtheit, diese von seiner Mordlust übertroffen. Er ist der grimmige Todfeind der flinken Eichhörnchen, stiehlt im Dohnenstieg nicht nur die gefangenen Drosseln, sondern auch die Ebereschen, läßt kein Vogelnest in seiner Nähe aufkommen, holt namentlich die jungen Stare und Spechte aus ihren Bruthöhlen und beraubt sogar die wehrhaftesten Raubvögel ihrer Nachkommenschaft. So berichtet Schacht, daß ein Edelmarder junge Wanderfalken im Horste erwürgte und im nächsten Jahre sich das Gelege des gleichen gefiederten Raubritters gut schmecken ließ. Doch frißt der Edelmarder recht gern auch allerlei Waldbeeren und geht im Winter bei Nahrungsmangel selbst an Aas.
Eine noch größere Vorliebe für süßes Obst, namentlich für Stachelbeeren und Birnen, bekundet der Steinmarder. Außerdem ist er ein großer Liebhaber von Vogel- und Hühnereiern, die er durch alle nur denkbaren Listen und Schliche zu ergattern sucht. Kleinere Eier zerdrückt er einfach im Gaumen, größere dagegen hält er mit den Vorderpfoten fest, beißt mit dem Reißzahn ein kleines Loch in die Schale, kippt das Ei ein wenig zur Seite, schlürft nun gierig den Inhalt und verzehrt zum Schluß auch noch einen Teil der Schale, wohl weil ihm deren Kalkgehalt angenehm und zuträglich ist. Wo ihm die Nachlässigkeit des Bauern Eingang in die Geflügel- oder Kaninchenställe oder Taubenschläge verschafft, wütet der Marder wie der grimmigste Tiger, schwelgt nur im rauchenden Blut und leckeren Hirn und läßt alles übrige liegen. So ist mir ein Fall bekannt, wo er in einer Nacht 15 Gänse ermordete. Manche Marder lernen es sogar, die Schieber an den Hühnerställen aufzuheben, so daß nicht einmal diese vollkommenen Schutz gewähren. Seinen Schlupfwinkel schlägt der Steinmarder am liebsten in alten, halb verfallenen Scheuern auf und schließt unter Umständen mit den gleichfalls dort auf Mäuse jagenden Katzen gute Freundschaft. Seine sehr spielerisch veranlagten und die heimkehrende Mutter stets mit lebhaft keckerndem Geschrei empfangenden Jungen verteidigt der Steinmarder mit wahrhaft erhabenem Mute selbst gegen weit überlegene Gegner. Übrigens ist er ebenso wie der Iltis ein ungemein lebenszähes Geschöpf und kann schon einen tüchtigen Puff vertragen. Er ist der gewandtesten Räuber einer, fällt wie die Katze stets auf die Füße und vollführt Sprünge von 2 m Weite, wobei er den buschigen Schwanz geschickt als Luftsteuer verwertet. Quält ihn der Hunger, so schreit er wie eine heisere Katze, aber bedeutend lauter, tiefer und unangenehmer. Beim Fressen knurrt er anhaltend, und im Ärger artet dieses Knurren in ein wütendes, helles Kreischen aus. Auch ein eigenartiges Glucksen, ähnlich dem des Eichhörnchens, kann man von ihm vernehmen, endlich zur Paarungszeit auch noch einen miauenden Sehnsuchtsschrei. »Kommt er,« so schreibt Karl Müller, »einmal in Verlegenheit, so daß er im ersten Augenblick nicht weiß, wo hinaus er seinen Rückzug antreten soll, dann nickt er sonderbar wie ein altes Weib mit dem Kopfe, steckt diesen in etwa vor ihm befindliche Vertiefungen, zieht ihn aber rasch wieder zurück, wirft sich wohl auch in eine verteidigende Stellung und zeigt das blendend weiße Gebiß. Auch habe ich ihn in solchen Augenblicken, gleich dem Fuchs in ähnlicher Situation, die Augen zudrücken sehen, als ob er irgendeinen Schlag zu erwarten habe, was sich höchst possierlich ausnimmt und ihn in seinem Betragen einem feigen Studenten auf der Mensur vollkommen ähnlich macht.«
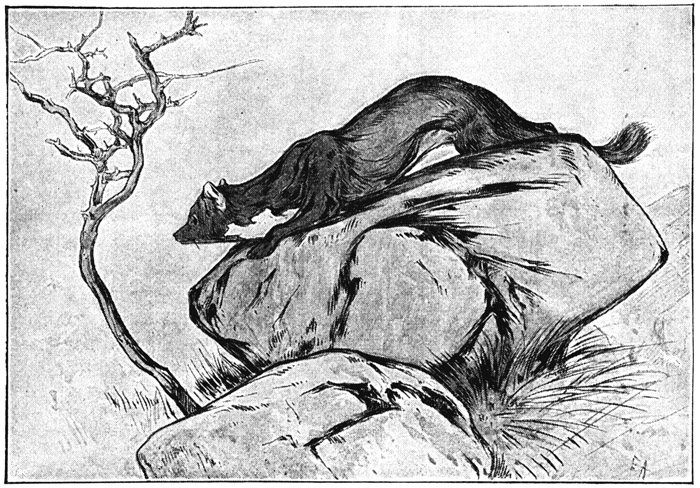
Abb. 32. Steinmarder.

Abb. 33. Der Iltis.
Bekanntlich legen viele Hühnerzüchter Porzellaneier in die Hühnerställe, um dadurch ihre gackernden Eierlieferantinnen an bestimmte Nester zu gewöhnen Wiederholt nun habe ich in Erfahrung gebracht, daß solche Porzellaneier vom Iltis weggeschleppt wurden, und es muß einigermaßen auffallend erscheinen, daß der sonst so scharfsinnige Räuber diese künstlichen Gebilde nicht von echten Eiern zu unterscheiden vermag. Übrigens läßt sich, verbürgten Nachrichten zufolge, auch das Hermelin durch solche Hühnereier täuschen, und ebenso habe ich schon die verschiedensten wildlebenden Vogelarten, selbst Adler, damit für Narren gehalten. Das blindwütende Morden der Marder und Wiesel kennt unser Ratz oder Stänker in dem Maße nicht, sondern er begnügt sich meist mit dem, was er wirklich zu verzehren vermag. Kein Meister im Klettern, hält er sich mehr an bodenständige Tiere und vergreift sich auch nur selten am Geflügel. Aber dafür haben die widerwärtigen Ratten an ihm einen geschworenen Feind, der allnächtlich unter ihnen fürchterliche Musterung hält. Gern schlägt der Iltis sein Lager, in dem er mit großer Zähigkeit bis zum letzten Augenblick auszuhalten pflegt, in Getreidediemen auf, die er dann eifrig von Mäusen säubert. Auf Frösche ist er ebenfalls erpicht, und wenn er ihrer mehrere beisammen erwischt, beißt er erst einem nach dem anderen das Rückgrat entzwei, damit keiner entfliehen kann. Kröten beißt er zwar tot, rührt sie aber weiter nicht an. Eine weitere schätzenswerte Eigenschaft von ihm ist es, daß er mutig den Kampf mit der giftigen Kreuzotter aufnimmt, sie tötet und verspeist. Ob er wirklich gegen Schlangengift gefeit ist, möchte ich freilich dahingestellt sein lassen. Tatsache ist aber jedenfalls, daß er verhältnismäßig ungeheure Portionen von Strychnin verträgt. Schade, daß das muntere Kerlchen ein so abscheulicher Stänkerfritze ist; sonst würde, ihn im Zimmer zu halten, dem Liebhaber sicherlich viel Vergnügen gewähren.
In geradezu raffinierter Weise zum blutigen Räuberhandwerk ausgerüstet erscheinen unsere beiden kleinsten Raubtiere, das im Winter bis auf die schwarze Schwanzspitze schneeweiß werdende Hermelin, dessen schöne Fellchen würdig befunden wurden, den Krönungsmantel der Kaiser und Könige zu bilden, und sein noch winzigerer Vetter, das zierliche, in unserem Klima auch während des Winters gewöhnlich braun bleibende Wiesel. Ihr fast überschlanker Körper ist von der denkbar größten Geschmeidigkeit und vermag sich in die engsten Spalten und Risse förmlich hineinzuschlängeln; alles an dem Tier ist Muskel und Sehne, Kraft und Biegsamkeit, die Krallen nadelscharf, das Gebiß trotz seiner Kleinheit geradezu fürchterlich, lüstern glühen die funkelnden Augen; dazu kommen eine Beweglichkeit, Rastlosigkeit und Behendigkeit ohnegleichen, Unternehmungslust, scharfe Sinne, tollkühner Mut, ungestüme Tapferkeit und hervorragende Intelligenz, wahrlich alles Eigenschaften, die es begreiflich erscheinen lassen, wenn diese gelenkigen Geschöpfe den Schrecken der gesamten Kleintierwelt bilden und selbst an Größe weit überlegene Gegner ihnen gerne aus dem Wege gehen. Die Bewältigung eines halbwüchsigen Hasen macht dem Hermelin kaum Schwierigkeiten; es springt seinem Opfer einfach auf den Rücken, reitet förmlich auf ihm und tötet es schließlich durch Zerbeißen der Schlagader. Auf Schachts Hausboden schlachtete ein Hermelin 19 erwachsene Stare ab, ließ aber die nackten Nestjungen unberührt. Es ist dabei am Tage ebenso rege wie in der Nacht und vollführt seine Mordtaten mit einer geradezu verblüffenden Sicherheit und unheimlichen Schnelligkeit.
Das Wiesel ist wohl der vollkommenste und beste all der zahlreichen Mausjäger, die die Natur hervorgebracht hat, da es die Nager nicht nur vom Erdboden wegzufangen oder an ihren Schlupfröhren zu erlauern braucht wie seine Mitbewerber, sondern vermöge seines schlanken Leibesbaues ihnen auch in ihre Löcher selbst folgen und ihnen dort den Garaus machen kann. Die Rastlosigkeit dieses reizenden Räuberzwerges hat geradezu etwas Nervöses, und seine grenzenlose Neugierde und Dreistigkeit verschafft dem ruhigen Spaziergänger manch unvermutetes und unterhaltendes Zusammentreffen mit dem quecksilbernen Geschöpf. So erinnere ich mich, daß ich einmal vor Jahren in einem ungarischen Walde auf einen Fuchs anstand und mich schließlich ermüdet auf einen am Wegrande aufgeschichteten Holzstoß niedergelassen hatte. Auf einmal kam zwischen den aufgetürmten Buchenscheiten in all seiner Eleganz und Zierlichkeit ein braunes Wieselchen herausgeschlüpft, machte ein artiges Männchen, äugte mit edler Frechheit nach mir herüber, der ich mich völlig regungslos verhielt, verriet dabei auch nicht die mindeste Spur von Angst oder Aufregung und begann nun, sein munteres, lustiges Spiel zu treiben, als sei es ganz allein im Walde, als stände nicht drei Schritte von ihm der »Herr der Schöpfung« mit geladener Flinte. Überall schlüpfte das flinke Kerlchen herum, verschwand jetzt auf einen Augenblick, steckte dann da, dann dort das kluge Köpfchen heraus, huschte um den Holzstoß herum, lief mir direkt über die Füße und leckte sogar schließlich mit dem feinen, roten Zünglein an dem nach unten gehaltenen Flintenlauf, während ich mit angehaltenem Atem mich nicht sattsehen konnte an diesen Bewegungen entzückendster Anmut eines scheinbar aus elastischem Gummi geformten Geschöpfes. Nur aufs Klettern versteht sich unser Heermännchen nicht besonders, und an Reinlichkeitsgefühl wird es von der von ihm so arg verfolgten Nagersippe entschieden übertroffen. Dem Hasenfang huldigt aber selbst dieses kleine Kerlchen und zwar mit ganz überraschendem Erfolg. Unter einem von einem Wiesel bewohnten Holzstoße wurden die Reste von nicht weniger als 32 Junghasen aufgefunden! Daß aber eine vernünftige Erziehung selbst den scheinbar unersättlichen Blutdurst auch dieses kleinen Tigers zu unterdrücken vermag, beweist der Fall, daß ein zahmes Wiesel in friedlichster Gemeinschaft mit einem Wiedehopf zusammenlebte. Droht den jungen Wieseln irgendwelche Gefahr, so werden sie von der besorgten Alten an einen besser gesicherten Platz verschleppt. Der schweizerische Zoologe v. Burg hat unlängst darauf aufmerksam gemacht, daß die sonst noch ganz nackten Jungen im Nacken einen verhältnismäßig stark behaarten und ziemlich großen Fleck haben, der gerade so weit reichen dürfte, als die auffallend dehnbare Nackenhaut vom alten Wiesel erfaßt werden kann.

Abb. 34. Wiesel.
Vom Fischotter möchte ich hier nur erwähnen, daß einer der bekanntesten Fischzüchter der Gegenwart, Herr C. von Scheidlin in Ustron, mir wiederholt brieflich versicherte, dieses Tier müsse eigentlich Krebsotter heißen, da es ungleich mehr Krebse als Fische verzehre. Wer jemals im Otterbassin eines zoologischen Gartens diese wunderbar geschmeidigen Tiere mit der elegantesten Sicherheit Fisch auf Fisch erhaschen sah, wird freilich doch gelinde Zweifel in diese Äußerung setzen und sehr geneigt sein, sie für die liebevolle Übertreibung eines warmherzigen Naturfreundes zu halten. Aber wohltuend berührt dergleichen immer, zumal aus dem Munde eines Fischzüchters, da diese Herren sich sonst nicht gerade durch eine vorurteilslose und gerechte Würdigung ihrer Mitbewerber aus dem Tierreiche auszeichnen. Und hat man wohl jemals in einem Tiergarten den Versuch gemacht, einen Otter mit Krebsen zu füttern? Tatsache ist jedenfalls, daß man in der graugrünen Losung des Otters außer Fischschuppen sehr häufig auch Krebsschalen findet, allerdings nach den bestimmten Versicherungen glaubwürdiger Beobachter niemals beides zusammen, und so scheint es fast, als ob sich die Ottern in einer Gegend fast ausschließlich von Fischen, in einer anderen fast ausschließlich von Krebsen nährten. Da der Otter sehr viel Nahrung bedarf (angeblich täglich 2½ kg Fischfleisch) und zudem eine ausgesprochene Vorliebe für die wertvollen Forellen bekundet, so vermag er allerdings unter Umständen beträchtlichen Schaden anzurichten, wozu noch kommt, daß er auch Fasanen und Wildenten reißt, wenn sich ihm Gelegenheit dazu bietet. Anderseits soll nicht verschwiegen werden, daß die schädlichen Wasserratten an ihm einen furchtbaren Feind haben und er seine Mahlzeiten öfters auch auf Frösche beschränkt, Erscheint ihm ein Jagdrevier nicht mehr ergiebig genug, so wandert er wohl auch aus und legt dann weite Strecken zu Lande zurück. An Flüssen betreibt er seine Fischerei gewöhnlich so, daß er aussteigt, eine Strecke stromaufwärts über Land geht, dann ins Wasser fährt und stromabwärts fischt. Ich halte den Otter für das geistig höchststehende und intelligenteste von allen unseren Raubtieren und stelle ihn in dieser Beziehung auch weitaus über den vielgerühmten Schelm Reineke, den Dichtung und Sage etwas gar zu überschwenglich verherrlicht haben. Das beweist auch des Otters überaus anziehendes Gebaren in der Gefangenschaft. So besaß einer meiner Universitätsfreunde zwei aufgezogene Ottern, die so zahm waren, daß sie ihm wie Hunde auf der Straße nachliefen und er sie ruhig auf die Studentenkneipe mitnehmen konnte, wo sie ebenso manierlich auf einem Stuhle saßen wie der besterzogene »Korps-Hund«. Täten wir nicht vielleicht besser daran, ein so begabtes Tier als nützlichen Fischereigehilfen in unsere Dienste zu stellen, statt es aufs bitterste zu hassen und zu verfolgen, es mit Pulver und Blei und Fallen schonungslos zu bekämpfen und zu vernichten? Die vielverspotteten langzöpfigen Chinesen sind uns auch hierin wieder einmal mit gutem und sehr nachahmenswertem Beispiel vorangegangen!

Abb. 35. Der Fischotter.
Die Spitzmäuse sind vielleicht die grimmigsten Raubtiere auf Erden. »Ein Blick in den geöffneten Rachen eines Kerfjägers,« sagt Karl Vogt, »überzeugt uns unmittelbar, daß diese Tiere nur Fleischfresser sein können, noch fleischfressender, wenn man sich so ausdrücken darf, als Katzen und Hunde, welche das System vorzugsweise Fleischfresser nennt. Die beiden Kiefer starren von Spitzen und geschärften Zacken; dolchähnliche Zahnklingen treten bald an der Stelle der Eckzähne, bald weiter hinten über die Ebenen der Kronzacken hervor; scharfe Pyramiden, den Spitzen einer auf zwei Reihen doppelt geschärften Säge ähnlich, wechseln mit Zahnformen, welche den Klingen der englischen Taschenmesser nicht unähnlich sind.« Und sehr bezeichnend fügt Brehm hinzu: »Ein wahres Glück ist es, daß die Spitzmäuse nicht Löwengröße haben: sie würden die ganze Erde entvölkern und schließlich verhungern müssen.« Und dabei erreichen diese blutdürstigen Liliputtiger nicht einmal die Größe der gewöhnlichen Mäuse, und in ihren Reihen findet sich das winzigste aller Säugetiere. Kein anderer Räuber überfällt Opfer, die ihn selbst an Größe so wesentlich übertreffen, wie die Spitzmäuse. Vergreifen sie sich doch sogar an Geschöpfen, die das Sechzigfache ihres eigenen Gewichtes besitzen! Ein unersättlicher Heißhunger stachelt sie zu immer neuen Jagdzügen an, und eine feiste Maus ist das mindeste, dessen sie zu ihrer täglichen Sättigung bedürfen, wie sie auch nur wenige Stunden ganz ohne Nahrung aushalten können. Da sich aber ihre Mordlust hauptsächlich gegen schädliche Insekten und deren Larven sowie gegen Mäuse richtet, können wir vom menschlichen Standpunkte aus mit den Buschkleppertaten der Spitzmäuse nur zufrieden sein, denn sie kommen unseren von so vielen gefräßigen Schädlingen bedrohten Kulturen in hohem Maße zugute.
Nur die kräftige Wasserspitzmaus kann gelegentlich lästig werden, da sie nicht nur Frösche massenhaft hinschlachtet, sondern auch unbehilfliche, am Wasser lebende Jungvögel, wie Bachstelzen und dergleichen, abwürgt und mit Vorliebe den Fischen nachstellt, ja selbst alte Karpfen überfällt und ihnen grausam Augen und Gehirn ausfrißt. Der Charakter der Spitzmäuse hat viel Ähnlichkeit mit dem des Maulwurfs, ist also entsprechend abscheulich, und ihre geistige Begabung scheint eine recht geringe zu sein. Außer der unbändigen Mordlust und unstillbaren Freßsucht sind Neid, Zanksucht, Unverträglichkeit und Selbstsucht ihre hervorragendsten Eigenschaften. Wo sich zwei Spitzmäuse gleichen Geschlechtes begegnen, gibt es meist sofort einen mit Bulldoggenwut geführten Kampf auf Leben und Tod, und der Sieger hält auf dem Leichnam des Unterlegenen sofort eine schwelgerische Kannibalenmahlzeit. Fleisch und Fleisch und immer wieder Fleisch ist eben ihr einziger Gedanke. Die Spitzmäuse sind womöglich noch ausgesprochenere Nasentiere als der Maulwurf, denn ihr Gesichtssinn ist so hochgradig verkümmert, daß sie bei hellem Sonnenschein fast gar nichts sehen, ja grelle Sonnenhitze ihnen äußerst zuwider ist und sie geradezu zu töten scheint, wenn sie sich ihr nicht bald wieder entziehen können. Es sind demgemäß echte Finsterlinge, die als wahre Strauchritter das Tageslicht hassen und meiden, nur in der Dämmerung und Dunkelheit zum Vorschein kommen und sonst unter der Erde ihre Mordtaten vollführen. Sie graben sich seichte Gänge im lockeren Erdreich, beziehen aber weit lieber ein ihren Bedürfnissen entsprechendes Mäuseloch, nachdem sie die rechtmäßige Eigentümerin vorher getötet und verspeist haben. Auf der Unterseite besitzen sie zwei Drüsen, die einen starken und widrigen Moschusgeruch ausströmen. Deshalb werden die Tierchen von Katzen, Mardern, Iltissen usw. zwar erbissen, aber nicht verzehrt, sondern mit allen Zeichen des Ekels und Abscheus liegen gelassen, so daß es viel leichter ist, tote Spitzmäuse zu finden, als diese versteckt lebenden Geschöpfe in ihrem Tun und Treiben zu beobachten. Nur die Eulen und Störche fressen die von ihnen gefangenen Spitzmäuse auch wirklich, wieder einmal ein Beweis dafür, wie schwach der Geruchssinn der Vögel entwickelt ist.

Abb. 36. Wasserspitzmaus.
In ihrem Gebaren stimmen die einzelnen Spitzmausarten fast vollständig überein, d. h. man hat bei dem Mangel an guten und eingehenden Beobachtungen die feineren Eigenheiten der verschiedenen Formen noch nicht recht ausfindig zu machen gewußt. Als eine wahre Furie, als ein boshafter Zwerg mit den Kräften eines Riesen und dem Blutdurst eines Tigers muß die Waldspitzmaus bezeichnet werden, wohl die zänkischste und unverträglichste Art dieser kriegerischen Familie. Wälder aller Art, aber gelegentlich auch Parkanlagen und größere Obstgärten sind die Heimat dieses teuflischen Räubers, der sonst mit seinem schlanken, oberseits rotbraunen, unterseits trübweißen Körperchen, den langen Schnurrhaaren und dem beständig schnuppernden Rüsselschnäuzchen einen recht angenehmen Eindruck macht, den die blöden, winzigen und ausdruckslosen Augen allerdings wesentlich herabmindern. Das kleinste unserer Säugetiere ist – wie bereits erwähnt – die winzige, in den Flanken fuchsig überhauchte Zwergspitzmaus, die wir namentlich an feuchten, dicht beschatteten Plätzen finden. Bei der Hausspitzmaus gehen die braungraue Ober- und die hellgraue Unterseite fast unmerklich ineinander über. Sie bewohnt hauptsächlich Felder und Gärten, von wo sie mit Beginn des Winters in die Gehöfte und Häuser kommt und sich hier namentlich in Scheunen und Kellern aufhält. Obgleich sie nach Mäuseart gerne an Speck und Fleisch nascht, stiftet sie doch weit mehr Nutzen durch Vertilgen lästigen Ungeziefers, und es ist deshalb töricht, sie wegzufangen, zumal sie ja auch kein Nager ist, also die verhaßte Tätigkeit der Nagezähne bei ihr in Wegfall kommt. Eine ganz ähnliche Lebensweise führt die ungleich seltenere Feldspitzmaus, bei der das gesättigte Schwarzgrau der Oberseite sich ziemlich scharf von der weißlichen Unterseite abhebt. Die Alpenspitzmaus ist ein Hochgebirgstier, aber nicht etwa auf die Alpen beschränkt, sondern auch schon vom Brocken, vom Riesengebirge und selbst vom Zobten nachgewiesen, ist also auch wohl noch auf anderen deutschen Gebirgen anzutreffen, wo man sie bisher lediglich übersehen hat. Die kräftigste und größte Art der Familie, die oberseits schön sammetschwarze Wasserspitzmaus, führt eine etwas abweichende Lebensweise. Körperbau und Behaarung sind in vorzüglicher Weise dem Wasser angepaßt, ohne daß doch das kleine Teufelchen einseitig auf dieses angewiesen wäre. Am murmelnden Gebirgsbach wie am mit Wasserlinsen bedeckten Teiche ist sie zu finden, und da sie sich weit häufiger am Tage zeigt als ihre Verwandten, bietet sich dem Naturfreunde öfters Gelegenheit, ihr bei ihrer rastlosen Tätigkeit zuzuschauen. Sie beherrscht das feuchte Element meisterhaft, denn sie schwimmt und taucht nicht nur vorzüglich, sondern vermag auch wie die Wasseramsel auf dem Grunde des Baches entlang zu laufen. Namentlich zur Paarungszeit ist es ein allerliebster Anblick, diesen flinken und nervösen, ständig erregten Tierchen zuzusehen, wie sie sich im Wasser necken und verfolgen, dann wieder ans Ufer kommen und mit unheimlicher Behendigkeit zwischen dem überhängenden Wurzelwerk dahinhuschen, bis endlich das in die Enge getriebene Weibchen sich dem drängenden Ungestüm seines heißblütigen Verehrers fügen muß.

Abb. 37. Waldspitzmaus.
Zur Ordnung der Kerfjäger, der wir die Spitzmäuse beizählen, gehört auch unser alter Freund Igel, der freilich ein ungleich gemütlicherer und harmloserer Bursche ist und sich, mit einer guten Portion Phlegma begabt, schlecht und recht durchs Leben schlägt. In einer Beziehung aber wird auch er zum Helden, wenn er nämlich mutig der giftigen Kreuzotter auf den Leib rückt und ihr mit kraftvollen Bissen das Genick zermalmt, ohne sich viel um die fauchende Wut und die ohnmächtigen Bisse des Reptils zu kümmern. Den meisten Lesern werden ja wohl die köstlichen Schilderungen bekannt sein, die Altmeister Lenz uns über die von ihm veranstalteten Kämpfe zwischen Igeln und Kreuzottern hinterlassen hat und die ja auch auszugsweise in A. E. Brehms weitverbreitetes »Tierleben« übergegangen sind. Danach muß man wohl zu der Überzeugung kommen, daß der kleine stachelige Biedermann wenigstens bis zu einem gewissen Grade giftfest ist. Ich habe früher selbst vielfach solche Duelle nach Lenzschem Muster veranstaltet, kann also aus eigener Erfahrung sprechen. Gewöhnlich beschnüffelte der Stachelheld die Kreuzotter zuerst nur und fuhr erschrocken zurück, wenn sie sich in Verteidigungsstellung setzte und ihn anzischte. Bald war er aber wieder zur Stelle und suchte die Gegnerin am Nacken oder in der Leibesmitte mit den Zähnen zu packen. Ihre Bisse fing er sehr geschickt wie mit einem Schilde auf, indem er den Kopf senkte, und der Feindin die stachelbewehrte Scheitelfläche bot. Dagegen habe ich nie gesehen, daß er sich völlig zusammengerollt hätte. Schließlich und meist schon nach kurzer Zeit hatte er den Schlangenleib an der richtigen Stelle gefaßt, dann ein kurzes Zähneknirschen und Knochensplittern, und das Giftreptil war in zwei zuckende und sich windende Hälften zertrennt, die der Sieger langsam und unter behaglichem Schmatzen und Kauen samt Kopf und Giftzähnen herunterlutschte wie ein Gourmand eine Spargelstange. Bei alledem ließ es sich oft nicht vermeiden, daß der Igel einige Bisse abbekam, was ich wiederholt deutlich selbst gesehen und auch durch Zeugen habe feststellen lassen; allerdings hatte dann die Schlange ihr Gift gewöhnlich schon so ziemlich an den Stacheln verspritzt. Immerhin erhielten die Igel doch auch einigemale ganz zu Anfang des Turniers kräftige Bisse ins Gesicht oder in die Vorderfüße, aber – geschadet hat's ihnen nicht, ja es schien ihnen nicht einmal vorübergehendes Unbehagen zu verursachen. Aber eines war bei alledem doch auffallend: Igel, die mehrmals kurz hintereinander solche Kämpfe bestanden und die getöteten Kreuzottern verzehrt hatten, waren dann 2-3 Wochen lang an solche nicht mehr heranzubringen, zogen sich vielmehr ängstlich zurück. Nach Ablauf dieser Erholungsfrist jedoch zeigten sie sich wieder als dieselben unerschrockenen Kämpen wie vorher. Aus alledem möchte ich fast schließen, daß das Blutserum des Igels in der Tat einen bestimmten, noch näher zu erforschenden und zu bestimmenden Schutzstoff gegen Schlangengift enthält, der aber bei häufiger und rasch hintereinander wiederholter Inanspruchnahme erschöpft wird und deshalb erst in einer längeren Ruhepause von neuem erzeugt werden muß, eine Notwendigkeit, deren sich das Tier instinktiv bewußt zu sein scheint. Verhält es sich so, dann ist es sehr wahrscheinlich, daß aus Igelserum sich auch ein den Menschen gegen Schlangenbiß (wenigstens gewisser Arten) immunisierendes Impfmittel herstellen läßt. Dies könnte von allergrößter Bedeutung werden für solche Länder, die, wie Indien und Brasilien, allzu reichlich mit gefährlichen Giftschlangen »gesegnet« sind, und wo jährlich Tausende von Menschen den tückischen Reptilien zum Opfer fallen.
Wie alle Fleischfresser, läßt sich natürlich auch der sonst so harmlose Igel, dieser trotz aller Täppischkeit so ausgezeichnete Mäusejäger und nützliche Kerbtiervertilger, gelegentlich Übergriffe in die angemaßten Vorrechte des Menschen zuschulden kommen. So kann man öfters lesen, daß der Igel da oder dort ein Vogelnest zerstört, Hühnereier weggeschleppt, Kücken geraubt oder gar einer unvorsichtigen alten Henne im Stalle den Garaus gemacht habe. Doch sind mir auch entgegengesetzte Fälle bekanntgeworden, wo z. B. ein Igel im Hühnerstalle sein Wochenbett aufgeschlagen hatte, junge wie alte Hühner aber vollkommen unbehelligt ließ und sich nicht einmal an ihren Eiern vergriff, obgleich man ihn in dieser Beziehung auf die Probe stellte und absichtlich zu verführen suchte. Jedenfalls muß man sich immer sehr hüten, solche gelegentlich beobachtete Einzelfälle gleich zu verallgemeinern und daraus voreilige Schlüsse zu ziehen, denn solche werden meist grundfalsch sein. So ist es entschieden ein arger Fehlgriff, wenn, wie mir Herr Oberlehrer Reuß aus Chemnitz mitzuteilen so freundlich war, unser Stachelheld im Lande der »hellen Sachsen« als »Raubtier« (!) verfolgt wird und sogar Prämien auf seine Erlegung ausgesetzt sind, leider mit solchem Erfolge, daß von 1896-1905 nicht weniger als 6404, 1906 allein 993 und 1907 weitere 846 Igel als »zur Strecke gebracht« gemeldet wurden. Es ist ja traurig genug, daß bei uns alles mögliche harmlose und nützliche Getier von rohen, unwissenden oder abergläubischen Menschen totgeschlagen wird, noch viel trauriger aber, wenn selbst Behörden und Jagdschutzvereine durch solche törichte und zwecklose Prämienausschreibungen auch noch an der Vernichtung unserer schon so spärlich gewordenen Tierwelt mitarbeiten, statt, wie es ihre Pflicht wäre, sie in Schutz zu nehmen und aufklärend zu wirken. Es gibt wohl wenig Tiere, denen man nicht gelegentlich eine »Schandtat« nachweisen könnte, und man möge auch berücksichtigen, daß solche »Schandtaten« gewöhnlich durch die Sorge des Muttertieres um seine hungernden Jungen hervorgerufen werden. Zugegeben, daß der Igel in einem solchen Fall wohl mal ein Fasanen- oder Rebhühnernest ausplündert, aber das ist doch kein Grund, dem landwirtschaftlich so hochnützlichen Tiere gleich den Vernichtungskrieg zu erklären und Belohnungen auf die Zerstörung seines armseligen Daseins auszusetzen! Die einseitige Berücksichtigung der Jagd hat leider vielfach eine vollständige Verdrehung der logischen Begriffe »nützlich« und »schädlich« bewirkt. Hasen, Rehe und Hirsche, so sehr wir als Jäger und Naturfreunde sie auch lieben mögen, sind doch unleugbar land- und forstwirtschaftlich recht schädliche Tiere, und demgemäß müßten wir eigentlich ihre natürlichen Feinde als nützliche Geschöpfe erklären. Aber wie steht's in Wirklichkeit damit?
Die Ummodelung des freien Waldes mit seiner bunten Tierwelt in eine große Hasen- und Fasanenvoliere kann doch unmöglich das Ideal des Tier- und Naturfreundes sein, meiner bescheidenen Ansicht nach nicht einmal das eines echten Weidmanns von altem Schrot und Korn. Ich bin selbst Jäger, aber gerade deshalb sage ich es offen heraus, daß so manches in der modernen Jagdgebarung mein sittliches Empfinden und die mir von Kindheit an anhaftende heiße Naturliebe auf das tiefste empört. Auf die Gefahr hin, als ein fürchterlicher Ketzer verschrien zu werden, gestehe ich offen, daß ich, wäre ich noch glücklicher Besitzer einer eigenen Jagd, mich niemals dazu hergeben würde, z. B. Fuchs und Wildkatze, Adler und Uhu schonungslos zu verfolgen, auch vom rein sportlichen Standpunkte aus nicht, da es mir ungleich mehr Freude macht, einen Fuchs beim Waldgange zu schießen, als auf einer Treibjagd einige Dutzend Hasen »umzulegen«. Die Natur reguliert sich am besten von selbst, denn sie hat kein Geschöpf hervorgebracht, das nicht seine Bedeutung hätte als ausgleichender Faktor bei der harmonischen Gestaltung des großen Ganzen, des Kosmos. In der bunten Mannigfaltigkeit unserer Tierwelt, in dem wunderbaren Ineinandergreifen all der kleinen und kleinsten Rädchen im Haushalte der Natur liegt ja der unendliche Reiz, den unser schöner deutscher Wald auf das Menschengemüt ausübt, aber er muß verblassen und unwirksam werden, wenn die stümpernde Menschenhand alles nach ihrem Gutdünken regeln, alles nach der kurzsichtigen Auffassung einseitiger Fanatiker über einen Kamm scheren will. Glücklicherweise kommt man ja neuerdings mehr und mehr zu der Einsicht, daß auch dem Raubzeug seine hohe Bedeutung für die Jagd zukommt, daß es – energisch niedergehalten zwar, aber nicht blindwütig ausgerottet – das wirksamste Mittel darstellt, einen urgesunden, kräftigen, widerstandsfähigen Wildstand herauszubilden, der in strenger natürlicher Zuchtauswahl wirklich kapitale Böcke und Hirsche zeugt, deren auf mühsamer Pirsch erbeutete Geweihe das Jägerherz im Leibe lachen lassen müssen. Wann hatten wir denn stärkeres Wild in unseren Forsten, früher, als sie noch Bären, Luchse, Wölfe und Wildkatzen in reicher Anzahl bargen, oder jetzt, wo alles Raubzeug in schonungslosem Kampfe mit Flinte, Gift und Fallen nahezu ausgerottet ist und dafür eifrig mit Wildleckpulvern und allen möglichen anderen kleinlichen Apothekermitteln gearbeitet wird, wo in den Forstkanzleien und Jagdzeitungen Fluten von Tinte verschrieben werden über die Beförderung der Geweihbildung? Aber auch der Jäger, der mir nicht beipflichten mag, der mich vielleicht nicht einmal verstehen kann, weil ihm die starren Dogmen unserer modernen Jagdkunde mit ihren prahlerischen Schußlisten zu sehr in Fleisch und Blut übergegangen sind, der lasse bei dem unerbittlichen und unaufhörlichen Kampfe gegen das vielgehaßte Raubzeug wenigstens eines nicht außer acht: das Gebot der Menschlichkeit! Fallen, die dem Tiere stundenlang die fürchterlichsten Qualen verursachen, gehören in eine mittelalterliche Folterkammer, aber nicht in den freien Wald, und das Auslegen von Giftbrocken ist meiner Meinung nach eines weidgerechten Jägers direkt unwürdig, fast hätte ich gesagt: ein Armutszeugnis, das er selbst seinen jagdlichen Fähigkeiten ausstellt.
Viele Säuger treten wenigstens zeitweise in solchen Massen auf, daß sie in dieser oder jener Weise eine merkliche Rückwirkung auf die Interessen des Menschen ausüben müssen. In dieser Beziehung stehen wohl die Nager obenan. So kann der Siebenschläfer da, wo er in größerer Menge vorkommt, was allerdings nur ausnahmsweise der Fall ist, recht lästig werden. Er plündert dann in empfindlichster Weise die Obstbäume und frißt namentlich eine Unmasse von Birnen an; da er aber nur deren Kerne verzehrt, zerstört er eine große Anzahl der schönsten Früchte. Ebenso fällt ihm im Frühjahr manches Singvogelnest zum Opfer. Im Walde schadet er durch Verzehren der Eicheln und Bucheln. Nach den Behauptungen der Gebrüder Müller läßt er sich auch Knospenfraß und Ringelungen zuschulden kommen, was ich aber nach meinen eigenen Beobachtungen nicht als erwiesen ansehen möchte. Dagegen beobachtete Cöster, daß er im Vorsommer gern die jungen Keimpflanzen der Waldbäume aus der Erde zieht und die Keimblätter wie die Stammknospe verzehrt, das übrige aber wegwirft. Der Gartenschläfer plündert namentlich die Obstspaliere und klettert auf diesen bis in die Zimmer, wo er mancherlei Unfug anzurichten vermag Doch macht er dies teilweise dadurch wieder gut, daß er auch viele Schnecken und Kerfe verzehrt. Dabei ist sein Nahrungsbedürfnis ein sehr großes; so fraß ein im Käfig gehaltenes Exemplar in einer Nacht 27 Maikäfer und 2 große Hausmäuse. Leider ist auch er gerade auf die edelsten Birnensorten am meisten erpicht. Von den Früchten des Waldes genießt er hauptsächlich die der Esche, die er auch als Vorrat einträgt, wobei ihre Samenflügel gleich als wärmendes Polster für das Nest dienen müssen. Der Schaden, den die allerliebste Haselmaus in den Haselbüschen anrichtet, kommt wohl kaum ernstlich in Betracht, und man kann dem sehr genügsamen Tierchen die paar Nüsse schon gönnen. Dagegen ist das Eichhörnchen bei all seiner Possierlichkeit ein recht schädliches Tier, und weder der Forstmann noch der Vogelschützer kann seine allzu große Vermehrung mit gleichgültigen Augen ansehen. Wiederholt habe ich selbst den hübschen Strolch beim Ausplündern von Vogelnestern ertappt und ihn einmal von einem Baume herabgeschossen, wie er ein ganzes Finkennest samt Inhalt im Maule fortschleppte. Wer Singvögel in seinem Garten haben will, kann darin unmöglich Eichhörnchen dulden. Die Gipfeltriebe junger Nadelhölzer werden vom Eichhörnchen massenhaft abgebissen und die jungen Stämmchen spiralig geringelt und dadurch vielfach zum Eingehen gebracht. Weniger schädlich ist das ja auch nur in einzelnen Gegenden Deutschlands vorkommende Ziesel, da es sich zumeist an öden, unkultivierten Örtlichkeiten ansiedelt und hier überwiegend von Unkrautsämereien lebt.
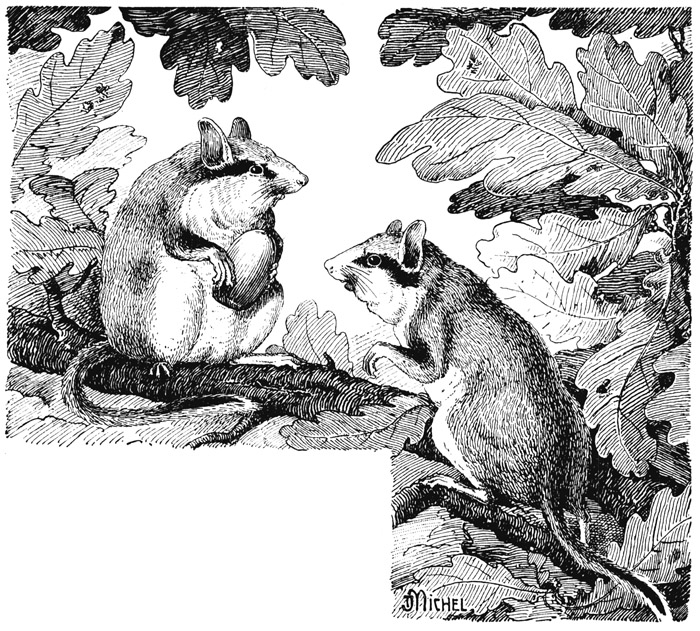
Abb. 38. Gartenschläfer.
Daß die Ratten höchst unangenehme Gäste sind und auch den friedfertigsten und tierfreundlichsten Menschen zur Verzweiflung bringen können, bedarf wohl kaum besonderer Erwähnung. Dazu kommt noch ihre Gefährlichkeit als die Überträger furchtbarer Seuchen, wie der Pest. In ihrer Fraßgier fallen diese zudringlichen Tiere alles an, was sie halbwegs bewältigen zu können glauben. Fetten Schweinen fressen sie bei lebendigem Leibe Löcher in den Speck, den Mastgänsen die Schwimmhäute zwischen den Zehen heraus, die jungen Enten ziehen sie unters Wasser, um sie hier elendiglich zu ersäufen, aus den Taubennestern holen sie die hilflosen Jungen, und aus den Hühnerställen schleppen sie die Eier weg. Höchst unliebsam machen sie sich auch in den zoologischen Gärten bemerkbar. Das Tollste ist wohl, daß sie dem bekannten Tierhändler Hagenbeck sogar 3 wertvolle junge Elefanten töteten, indem sie diesen gewaltigen Tieren die Fußsohlen zernagten. Vor ihren zerstörungslustigen Zähnen ist überhaupt nichts sicher, und deshalb ist der Aufenthalt an Orten, wo die Ratten sehr überhandgenommen haben, wie es öfters auf einsamen Inseln zu geschehen pflegt, für den Menschen kaum zu ertragen. Dem großen Soldatenkaiser Napoleon I. wurden seine letzten Lebenstage auf der öden Felseninsel St. Helena durch die Ratten gründlich verbittert. Der gefangene Schlachtenlenker mußte hier nun mit seinem treu gebliebenen Gefolge förmliche Schlachten gegen die unverschämten Nager schlagen, um nur wenigstens seine Mahlzeiten in Ruhe genießen zu können, die ihm die Engherzigkeit des englischen Gouverneurs bekanntlich ohnehin nur in kärglichem Maße zukommen ließ. Die spitzbübischen Näschereien der Hausmaus in Küche, Keller und Speisekammer, so ärgerlich sie auch manchmal für die Hausfrau sein mögen, ließen sich schon noch in Kauf nehmen, wenn nur das abscheuliche Genage dieser niedlichen Plagegeister in Bibliotheken und Sammlungen nicht wäre, wodurch sie oft schon in wenigen Stunden unschätzbare Werte zerstört haben. Wenn sich die als Getreideverwüster so schädlichen Feldmäuse stark vermehren, also ein sogenanntes Mäusejahr eintritt, dann ist die Ernte stark bedroht, und weder die glücklicherweise so zahlreichen natürlichen Feinde der gefräßigen Nager noch die künstlichen Hilfsmittel des erfinderischen Menschen vermögen der Plage völlig zu steuern, bis die Natur selbst Einhalt gebietet und durch ansteckende Seuchen furchtbar aufräumt unter dem wimmelnden Gesindel. Böttgers Meinung, daß die Feldmäuse ihre Nahrung überhaupt ausschließlich dem Pflanzenreich entnehmen, vermag ich jedoch nicht zu teilen, sondern habe im Gegenteil gefunden, daß sie auf animalische Kost sehr erpicht sind. Bei mir nahmen sie nicht nur Kerfe aller Art, sondern fraßen auch eine Anzahl Zwergfledermäuse auf, mit denen zusammen sie in einem Kistchen verschickt worden waren, nachdem sie die trennende Zwischenwand durchgenagt hatten. Und nicht immer ist die vegetabilische Ernährungsweise der Mäuse derart, daß sie uns unangenehm wird. So trägt die Schermaus nach Fischer-Sigwart mit Vorliebe die verkürzten und verdickten unteren Stengelglieder des Paternostergrases als Wintervorrat ein, indem sie die wie auf einem Rosenkranz aneinander gereihten Kügelchen sorgfältig herauspräpariert; diese Pflanze aber ist ein lästiges und schwer ausrottbares Unkraut, ihre Bekämpfung also vom landwirtschaftlichen Standpunkte aus sehr erwünscht. Die nette Waldmaus ist zwar in ihrem Gebaren ein geradezu entzückendes, dabei aber entschieden schädliches Tierchen, zudem von recht gewalttätiger Natur. Bei dem Maler Soffel überfielen sie sogar Wachteln im Käfig und fraßen ihnen das Gehirn aus. Ebenso vernichten sie viele Vogelbruten, verzehren allerdings auch Insekten und schwächere Mäusearten. Ich selbst traf einmal eine Waldmaus an, die ganz gemütlich in einem Drosselneste saß und die Eier verspeiste. In den Gärten holen sich diese klettergewandten Nager die Puffbohnen und Erbsen aus den Schoten. Kurz – die ganze Mäuse- und Rattengesellschaft ist für den Menschen überwiegend schädlich, oft in so hohem Maße, wie kaum eine andere Familie unserer höheren Tierwelt.
Auch von der Sippe der Hasen läßt sich eigentlich nicht viel Rühmliches sagen. Ich will hier ganz von Freund Lampe absehen, da er ja die Zeche mit Fell und Braten bezahlen muß und so eine hohe jagdwirtschaftliche Bedeutung erlangt hat, und nur erwähnen, daß er nach Otto auch die Rinde des giftigen Goldregens frißt, ohne dadurch Schaden zu erleiden. Sein kleinerer Vetter, das flinke Kaninchen, kann dem Forstmann den Kopf schon ordentlich warm machen, zumal es die unangenehme Angewohnheit besitzt, immer wieder dieselben Plätze heimzusuchen, bis dort alles ratzekahl gefressen ist. Seine Lieblingsspeise bilden nach den eingehenden Beobachtungen L. Schusters junge, womöglich einjährige Kieferpflanzen. Hier werden die zarten Nadeln bis auf 2-15 mm lange Stümpfe abgenagt, teilweise auch die diesjährigen, harzigen, sanft rotbraunen Triebansätze von 6-12 cm Länge sowie die netten, 5 cm langen, neuen Fruchtzäpfchen, und ebenso wird stellenweise das Astholz entrindet. Im Laubwalde werden Hainbuchen und Eschen durch Schälen arg mitgenommen, und auf den Feldern richten die Kaninchen mehr Schaden an als Hase und Reh zusammen. Selbst die scharfen Stacheln der Hundsrose vermögen diese nicht vor dem Benagtwerden zu schützen. Im Winter sollen die Karnickel auch die für die Vögel ausgelegten Fleischbrocken und Speckstreifen angehen. Zu einem wahren Fluch aber vermögen sie, wie die häßlichen Wasserratten, den Damm- und Dünenbauten zu werden, indem sie diese durch ihre unablässigen Wühlereien unterminieren und so bei Hochwasser und Überflutungen Veranlassung zu einem Dammbruch und damit zu unsagbarem Unglück werden können. Daß der Hamster, freilich ein Feld- und kein Waldbewohner, mit seiner geizigen Sammelwut in Getreidegegenden ein äußerst schädliches Tier ist, dessen unablässige Bekämpfung unser eigenes Wohl gebieterisch verlangt, kann keinem Zweifel unterliegen. Wie unheimlich häufig er noch heute in manchen Landstrichen ist, mag man daraus ersehen, daß auf der Stadtgemarkung von Quedlinburg im Jahre 1898 24 910 Hamster gefangen und mit fast 540 Mark bezahlt, und daß in Hechtsheim bei Mainz in einer (!) Woche nicht weniger als 1480 alte und 4100 junge Exemplare eingeliefert wurden.
Daß umgekehrt die Namensvettern der Mures, die lichtscheuen und gefräßigen Spitzmäuse, überaus wertvolle Verbündete des Landwirtes sind, die sorgfältig zu schonen in seinem eigenen Interesse liegt, haben wir bereits gesehen. Womöglich noch nützlicher aber ist die Ordnung der Fledermäuse, die leider aus Dummheit und Aberglauben bei uns vielfach noch immer als geächtete Finsterlinge gelten. Mußte ich es doch selbst erleben, daß, als vor einigen Jahren ein Herbststurm im Wiener Prater eine alte Eiche niedergeworfen hatte und ihren Höhlungen Hunderte schlaftrunkener Speckfledermäuse entflatterten, sofort eine schreiende und johlende Menge mit Stockhieben und Steinwürfen die armen Tiere ins Jenseits beförderte (wohlgemerkt: es waren auch sogenannte »bessere Leute« und »gebildete« Gymnasiasten dabei!). O sancta simplicitas! möchte man da ausrufen oder vielmehr: Pfui, über solch entsetzliche Roheit! Den Fledermäusen fallen naturgemäß hauptsächlich die nächtlich fliegenden Schmetterlinge zur Beute, und unter diesen befinden sich bekanntlich gerade die forstschädlichsten Arten, die sonst im höheren Tierreich außer dem Ziegenmelker wenig natürliche Feinde haben. Für den Forstmann, dessen mühsam herangezogene Kulturen fast schutzlos den Angriffen so zahlreicher Pflanzenverwüster preisgegeben sind, gibt es daher kaum nützlichere Tiere als die vielgeschmähten Fledermäuse. Auch für den Maulwurf möchte ich ein gutes Wort einlegen. Festzuhalten ist vor allem, daß er niemals irgendwelche Pflanzenteile verzehrt, sondern sich ausschließlich an tierische Kost hält, von der die schädlichen Maulwurfsgrillen und Engerlinge ein gut Teil ausmachen. Auf Feld und Wiese, in Wald und Flur lasse man den unterirdischen Wühler deshalb ruhig gewähren, denn er vergilt die ihm erwiesene Schonung tausendfach. Im Garten freilich können seine Wühlereien in den Blumen- und Gemüsebeeten recht zuwider werden, so daß man zu Gegenmaßregeln gezwungen ist. Aber muß man denn deshalb immer gleich zur Spitzhacke und zum Maulwurfsgalgen greifen? Das nasenempfindliche Tier läßt sich ja doch so leicht auch auf unblutige Weise vertreiben. Ich wenigstens habe diesen Zweck durch einfaches Einstreuen von Naphthalin in seine Gänge stets prompt erreicht.
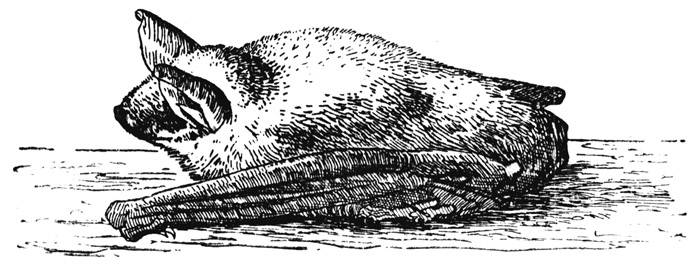
Abb. 39. Speckfledermaus.
Nicht einmal den Fuchs halte ich für das ränkevolle Ungeheuer, für den Ausbund an Schädlichkeit, als der er gewöhnlich hingestellt wird, um seine erbarmungs- und schonungslose Verfolgung einigermaßen zu rechtfertigen. Freilich hat der rote Lumpazivagabundus manche Gans und manches Huhn, manchen Hasen (vielleicht sogar ein Rehkitz) auf dem Gewissen, aber zwischen diesen Übeltaten, zu denen er ja geradezu herausgefordert wird durch die Gleichgültigkeit und Sorglosigkeit, die der Bauer seinem Geflügelstalle gegenüber oftmals zu bekunden pflegt, liegen doch auch wieder lange Wochen, in denen der Schelm lediglich auf den Stoppelfeldern herumschleicht und sich hier so ausschließlich dem Mäusefang widmet, daß er dem am Waldrande herumhoppelnden Hasen kaum einen flüchtigen Blick zuwirft. Und ähnlich steht's auch mit der Wildkatze, die überdies in unseren Wäldern schon viel zu selten geworden ist, als daß der von ihr angerichtete Schaden mehr als engbegrenzte lokale Bedeutung haben könnte. Ein noch viel harmloserer Geselle aber ist der Dachs, dessen gemütlich-phlegmatischem Wesen alle raubtierhafte Wildheit ja so völlig abgeht. Um in den Dörfern Geflügeldiebstähle auszuführen, dazu ist Grimbart bei uns viel zu ängstlich, um Hasen und Fasanen zu fangen, viel zu plump. Seine Hauptnahrung bilden immer und überall Würmer, Schnecken, Käfer, Engerlinge, Mäuse, Schlangen, Hummel- und Wespenwaben, Beeren und andere Waldfrüchte. Womit hat er es also eigentlich verdient, daß man ihn so unerbittlich und grausam verfolgt, ihm nicht die geringste Schonzeit gewähren will, ihn sogar lebendigen Leibes mit einem scheußlichen, korkzieherartigen Instrument anbohrt, wenn er sich vor den ihn bedrängenden Teckeln zu verklüften sucht? Die meisten Jäger wüßten wohl selbst nicht, was sie auf diese Frage antworten sollten. Und doch macht sich der Dachs gerade um die Jagd noch besonders verdient, indem er die Puppen der das Wild so fürchterlich quälenden Rachenbremsen vertilgt. Ein bißchen Fallobst kann man ihm dafür schon gönnen. Einzig und allein in Weinbergen wird der Dachs durch seine Vorliebe für die süßen Trauben wirklich schädlich, zumal ihn seine Tolpatschigkeit viel mehr verwüsten, als wirklich verzehren läßt. Dort also halte man ihn fern, aber im übrigen gönne man ihm sein stillvergnügtes, friedliches Dasein!
Der schöne Edelmarder ist freilich ein arger Mordbube, aber vergessen dürfen wir doch nicht, daß sein Hauptwild die schädlichen Eichhörnchen sind, die durch ihre flinken Kletterkünste anderen Feinden meist entrinnen und sich überall da ganz ungebührlich vermehren, wo man in kurzsichtiger Verblendung die Marder vollständig ausrottet. Man sehe den schlanken Räubern streng auf die »Finger« und lasse sie mit ihrem wertvollen Fell für ihre Untaten büßen, aber man lasse sie nicht aussterben! Wie der Baummarder der geschworene Todfeind der Eichkätzchen ist, so der Steinmarder der der Ratten, die er weit wirksamer bekämpft als die Hauskatze, denn deren Zucht hat man so vernachlässigt, daß große, starke und mutige Katzen, die mit den wehrhaften Ratten ordentlich aufräumen, zu einer Seltenheit geworden sind. Noch leichter als mit dem Steinmarder kann der Landwirt mit dem Iltis auskommen, wenn er nur seine Hühnerställe abends sorgfältig schließt und die Kücken ein wenig beaufsichtigt. Nutzen und Schaden dürften sich beim Iltis mindestens die Wage halten, wenn nicht jener gar überwiegt, wie es namentlich in Hamstergegenden der Fall sein wird. Auch Hermelin und Wiesel, diese vorzüglichsten aller Mausjäger, sind wohl mehr nützlich als schädlich, obwohl sie allerdings viele Vogelbruten vernichten. Der Bauer wenigstens hat alle Ursache, sie zu schonen, zumal diese unternehmenden Räuberchen auch größeren Kerfen nachjagen.
Wenn wir nun schon vom engherzig-einseitigen Standpunkte des Kulturmenschen den Nutzen und Schaden der einzelnen Tierarten feststellen wollen und dabei Urteile fällen, die bei dem Übereifer vieler Jäger und der Kurzsichtigkeit der Fanatiker nur zu leicht zu Todesurteilen werden können, so dürfen wir dabei doch keinen Augenblick vergessen, daß jedem Tier, und sei es das unscheinbarste und verachtetste, außerdem noch eine seinen Fähigkeiten angemessene Rolle im großen Haushalte der Natur zukommt. Den meisten außerdem noch eine mehr oder minder große ästhetische Bedeutung, die es schon mit Rücksicht auf die Rechte der Allgemeinheit verbieten sollte, ein Tier aus kleinlichem Sonderinteresse bis zur Vernichtung zu bekämpfen. Freilich erscheinen gerade die Säuger in letztgenannter Beziehung weitaus weniger günstig gestellt als etwa die Vögel oder selbst die Schmetterlinge u. a., denn ihr Tun und Treiben ist mit wenigen Ausnahmen ein so verstecktes, daß es dem bloßen Spaziergänger kaum zum Bewußtsein kommt. Obendrein prangen sie weder in leuchtenden Farben, noch erfreuen sie unser Ohr durch süße Sangesweisen, ja viele lassen sogar die Anmut der Bewegung vermissen, und noch andere führen überhaupt eine ausgesprochen nächtliche Lebensweise. Und doch, wer möchte wohl den gewaltig orgelnden Brunftschrei des Hirsches missen im herbstlich bunt gefärbten Walde, den schlanken Rehbock mit dem stolzen Gehörn auf der vom Abendrot in die zartesten Rosatinten getauchten Waldwiese, wer das muntere, possierliche Eichhörnchen am borkenrissigen Eichenstamm, wer das hoppelnde Häslein am dämmernden Waldesrande, wer den roten Freibeuter in der unterirdischen Burg Malepartus, die Stachelkugel des Igels im Vorgebüsch, das geschmeidige Wiesel am Wegesrande, wer selbst die gespenstisch huschende Fledermaus an der zerfallenen, nebelumhüllten Burgruine! Ich nicht, und so mancher meiner Leser hoffentlich auch nicht! Jedes dieser Tiere bildet ja doch einen unersetzlichen Bruchteil der heimischen Natur, ist ein innig mit unserem lieben Walde verwachsenes Geschöpf, das zu dessen bunter Belebung schlecht und recht auf seine Weise beiträgt.
Schon in meinem Kosmosbändchen über die Vögel des deutschen Waldes habe ich darauf aufmerksam gemacht, daß selbst diese flüchtigsten aller Geschöpfe in ihrer Verbreitung mindestens indirekt stark von der geologischen und petrographischen Beschaffenheit des Geländes abhängig sind. Bezüglich der an die Scholle gebundenen Säugetiere muß dies natürlich noch in weit höherem Maße zutreffen. Leider sind aber über diese hochinteressanten Verhältnisse nähere Untersuchungen noch kaum angestellt worden. Nur vom Siebenschläfer oder Bilch hat Cöster nachgewiesen, daß er eine ausgesprochene Vorliebe für Kalkboden zeigt, wohl seiner größeren Trockenheit und stärkeren Bestockung wegen, während er auf dem angrenzenden Buntsandstein fast völlig fehlte. Das Tier ist ferner ersichtlich bestrebt, seinen Verbreitungsbezirk nach Norden auszudehnen. So ist es in den letzten Jahren in auffallender Zahl aus Böhmen längs des Elbetales in Sachsen eingewandert und hat hier alle an großen Obstgärten und lichtem Laubwald reichen Gebiete besiedelt, sich hier vielfach auch in Steinbrüchen oder Spechtlöchern niedergelassen. Als ausgesprochenes Nachttier gewöhnlich wenig beachtet oder auch ganz übersehen, macht sich der Bilch doch leicht bemerkbar, sobald er in größerer Menge auftritt, was namentlich der Fall ist, wo sein natürlicher Todfeind, der Marder, durch unablässige Verfolgung zu sehr abgenommen hat; dann findet man im Garten massenhaft die von ihm zerfressenen Birnen oder überrascht die Schläfer beim Reinigen der Starhöhlen, oder die Katze bringt einen von ihr gefangenen Bilch ins Haus geschleppt, oder es sitzt einer in der Mausefalle und beweist damit, daß er es war, der in der Speisekammer an allen Süßigkeiten naschte. Beim Fressen nimmt der Siebenschläfer die uns vom Eichhörnchen her vertraute Stellung ein, sitzt aber doch nicht ganz so aufrecht wie dieses, denn er hält den Kopf immer mehr in der Nähe des Bodens, und der Rücken bildet daher nur einen flachen Bogen, während der buschige Schwanz flach der Erde aufliegt und die Nahrung gar zierlich in den Vorderpfoten gehalten wird. Die Nagefähigkeit des Tieres ist übrigens nicht sonderlich groß. Dagegen ist der überaus muskelkräftige Bilch ein Meister im Klettern, obwohl er sich dabei nur ausnahmsweise nach Eichhornart zu weiteren Sprüngen entschließt. Auch im dünnsten Gezweig tummelt er sich mit unübertrefflicher Gewandtheit, klettert selbst kopfabwärts oder im Käfige die Decke entlang, hängt sich sogar an den Häkelkrallen der Hinterfüße frei in der Luft schwebend auf und frißt und putzt sich in solchen Stellungen; letzteres übt er als ein wahrer Reinlichkeitsfanatiker alle Augenblicke. Nur im Gezweig fühlt er sich sicher und flüchtet deshalb, obschon er auch auf dem Boden ganz flink zu laufen vermag, stets sofort nach oben, indem er an dem erstbesten Gegenstände in die Höhe klettert, sei dies auch der ihn verfolgende Mensch selbst. Naht ihm dagegen Gefahr, während er im Gezweige spielt, so drückt er sich einfach regungslos an einen stärkeren Ast und wird hier im unsicheren Dämmerlicht fast immer übersehen. Sein Hauptsinn ist das Gehör, und die rundlichen Ohren befinden sich deshalb fortwährend in zitternder Bewegung. Er ist übrigens ein verdrießlicher, mürrischer und bissiger Gesell, der es namentlich sehr übelnimmt, wenn man ihn in seinem über alles geliebten Schlafe stört. Dann läßt er ein unwilliges Knurren hören, während er seiner Zufriedenheit durch ein kurzes, hohes Pfeifen Ausdruck verleiht. Im Zorn gebraucht er zunächst die Krallen und erst bei wirklicher Bedrängnis das scharfe Gebiß. Der Geselligkeit zugeneigt, hat der übelgelaunte Patron doch mit seinesgleichen fortwährend zu raufen und zu streiten, wobei es bösartige Bisse absetzt, ja es sind sogar schon öfters Fälle von Kannibalismus bekanntgeworden. Eine Eigentümlichkeit dieser Tiere ist es, daß das Schwanzende sehr brüchig ist und die Schwanzhaut schon bei unvorsichtigem Anfassen leicht reißt. Das Fleisch der Bilche soll gar nicht übel munden, was sich schon daraus folgern läßt, daß die Römer diese Tiere eigens für ihre schwelgerischen Gastmähler mästeten.

Abb. 40. Siebenschläfer.
Der nahe verwandte Gartenschläfer liebt mehr bergige Hänge, die mit Gebüsch, Laubwald und Obstbäumen bestanden sind, nicht aber die Weinberge, da er Weintrauben trotz seiner sonstigen Genäschigkeit nicht anrührt. Beide Arten nehmen recht gern auch animalische Kost zu sich und mögen daher wohl manches Vogelnest ausplündern. Das lieblichste und anmutigste, das unschädlichste und harmloseste Mitglied dieser verschlafenen Sippe ist entschieden die possierliche Haselmaus mit den zierlichen Greiffüßchen und den unschuldig glotzenden Perlaugen. So bestechend aber auch die Zutraulichkeit und Zahmheit, die Hurtigkeit und Sauberkeit dieser hübschen Tierchen wirkt, möchte ich ihnen doch keine höhere geistige Begabung zusprechen, sie vielmehr in dieser Beziehung recht tief stellen. Gegen äußere Eindrücke sind sie wenig empfindlich, fast stumpfsinnig, und gewonnene Erfahrungen zweckentsprechend zu verwerten, scheinen sie nur wenig imstande zu sein. Auch diese Zwerghörnchen gehen gern an süßes Obst, nicht aber an weinsaures. In der Erregung lassen sie bisweilen ihre Stimme hören, die an die der Haubenmeise erinnert, aber viel schwächer klingt: sie ist ein kurzer, aus drei Tönen zusammengesetzter Triller.
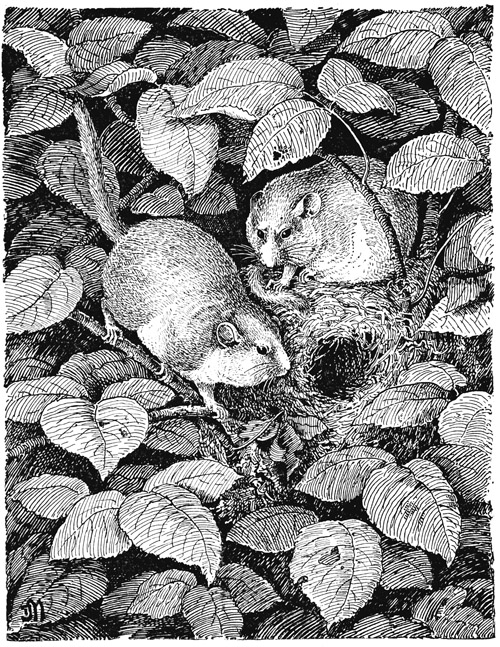
Abb. 41. Haselmaus.
Da legt das Ziesel ein ungleich intelligenteres und aufgeweckteres Wesen an den Tag. Es würde sich deshalb sehr zum Halten im Zimmer eignen, wenn sein ungemein großes Nagebedürfnis und sein abscheulicher Geruch nicht wären. Es besitzt nämlich um den After herum drei Stinkdrüsen, die bei jeder Erregung emporgereckt werden und dann stumpfe Kegel von Hirsekorngröße bilden; auf dem Gipfel dieses Kegels mündet ein Ausführungsgang, dessen reichlich abgesondertes Sekret dem Tiere und seinen Entleerungen einen eigentümlich scharfen Geruch mitteilt. Ich kann es nicht recht begreifen, wenn das Ziesel vielfach als ein bissiges und mürrisches Geschöpf geschildert wird, denn die von mir gehaltenen Exemplare zeigten sich ausnahmslos äußerst zahm, gutmütig und liebenswürdig. Sie ließen sich schon nach kurzer Zeit ruhig in die Hand nehmen und streicheln, ohne jemals von ihren scharfen Zähnen Gebrauch zu machen oder sonstwie Widerstand zu versuchen. Keineswegs ist das Tier auf trockene Getreidegegenden beschränkt, wie man gewöhnlich angegeben findet. Ich traf es vielmehr auch in feuchten Laubwaldungen, so z. B. recht zahlreich im Wiener Prater, wo ich das flinke Kerlchen öfters über die belebte Fahrstraße unweit des »Lusthauses« rennen sah. Auch dieses Tier hat sich in neuerer Zeit seinen Verbreitungsbezirk erweitert, und zwar westwärts, indem es sowohl im Donautale wie in Mittelschlesien in dieser Richtung vordringt.
Die schwärzliche Hausratte kann als der Typus eines im Kampfe ums Dasein unterlegenen Tieres gelten. Das unwiderstehliche Vordringen der stärkeren grauen Wanderratte gen Westen brachte ihr den Untergang. Ist es doch eine altbekannte Tatsache, daß gerade die nächstverwandten Arten sich auf das grimmigste und schonungsloseste bekämpfen, sobald sie als Nahrungskonkurrenten im gleichen Wohngebiete zusammentreffen. So sind die Hausratten an Zahl zusammengeschmolzen wie der Schnee in der Frühlingssonne und überraschend schnell aus den meisten Gegenden unseres Vaterlandes völlig verschwunden. Der Mensch hat dabei keinen guten Tausch gemacht, denn war schon Mus rattus ein lästiger Gast in Scheune und Keller, in Haus und Hof, so ist die viel unverschämtere M. decumanus ein geradezu abscheulicher Patron, für den auch der warmherzigste Tierfreund nicht viel Sympathie wird empfinden können. Am besten hat sich die Hausratte noch im nordwestlichen Deutschland gehalten, wo sie vielerorts auch heute noch vereinzelt vorkommt. In Bremen flüchtete sie vor den Nachstellungen der Wanderratte in die oberen Stockwerke und suchte förmlich beim Menschen Schutz, gegen den sie sich auffallend zutraulich zeigte, seitdem ihr der bissige Vetter den Raum abgewann. Ganz neuerdings scheint sich ihr Bestand in manchen Gegenden wieder zu erholen. So hörte ich, daß sie im Schweizer Jura in der Zeit von 1870-1890 fast völlig ausgestorben war, seitdem aber langsam wieder zunahm und heute in manchen Landstrichen fast häufiger ist als M. decumanus, wobei man auch festgestellt haben will, daß sie an Größe gegen früher beträchtlich zugenommen habe. Wanderratten, die ja leider durch den Schiffsverkehr schon über die ganze Welt verschleppt worden sind, entwickeln sich namentlich auf einsamen Inseln, wo sie wenig natürliche Feinde und viel Nahrung haben, die Verhältnisse ihnen auch sonst zusagen, trotz der unvermeidlichen Inzucht zu ungewöhnlicher Größe; ich maß selbst Riesenexemplare von fast 50 cm Länge. Auch sie, so geschickt, sich in die verschiedensten Verhältnisse zu finden, kann zum echten Waldtiere werden. So wimmelte es in einem prächtigen Orangenwalde unweit Azimur im westlichen Marokko von Ratten. Zu Dutzenden kletterten die häßlichen Nager am hellen Tage zwischen dem sattgrünen Gelaub herum und taten sich an den golden schimmernden Früchten gütlich. Während der Tage, wo ich an diesem idyllischen Erdenflecke mein einsames Zeltlager aufgeschlagen hatte, litten wir nicht wenig unter der Zudringlichkeit dieses gefräßigen Gesindels und suchten es deshalb nach Kräften zu vernichten, wobei die zahllosen Schleiereulen, die sich an diesem Punkte angesammelt hatten und nachts ihre widerwärtige Schnarchmusik vollführten, unsere besten Verbündeten waren.
Zu einem Allerweltstier im Gefolge des Menschen und infolge ihrer riesigen Vermehrungsfähigkeit trotz aller Nachstellungen zu einem überaus häufigen ist auch die Hausmaus geworden, und wir würden sie sicherlich ein höchst anmutiges und zierliches Tierchen nennen, wenn sie nicht durch ihre Genäschigkeit unseren Haß in so hohem Maße herausforderte. Die in den überschwenglichsten Lobeshymnen als vierbeinige Kanarienvögel verherrlichten » Singmäuse« sind nichts als bedauernswerte Patienten, denn ihr anspruchsloses Gezwitscher kommt lediglich durch eine eigentümliche Erkrankung der Luftwege zustande. Die durch ihre scharf abgesetzte, weißliche Unterseite ausgezeichnete Waldmaus verdient – streng genommen – ihren Namen nicht recht, denn wenn sie auch im Walde vorkommt und sich namentlich in niedrigen Eichenbeständen gern ansiedelt, so findet sie sich doch ebenso gut auch an allen möglichen andern Örtlichkeiten, selbst im freien Felde, und kommt im Winter auch zahlreich in die Häuser. Sie ist ein sehr munteres und schmuckes Tierchen, entschieden begabter, zutraulicher, mutiger, kriegerischer, flinker und gewandter als die Hausmaus, auch in viel höherem Grade Tagtier als diese. Soffel sah sie in Bogensprüngen von drei- bis vierfacher Körperlänge flüchten. Nach meinen eigenen Beobachtungen kommt aber selbst dabei ihr ausgeprägtes Reinlichkeitsbedürfnis zum Ausbruch, indem sie plötzlich ihre Flucht unterbricht, sich auf die Hinterbeine setzt und mit den Vorderpfoten in putziger Behendigkeit von den Ohren zur Schnauzenspitze übers Gesicht streicht. Doch scheint mir dieses charakteristische Sichputzen der Mäuse bisweilen lediglich ein Ausdruck der Angst und Verlegenheit zu sein, gerade wie die im Luftmeer trillernde Lerche mit verdoppeltem Eifer singt, wenn ein Baumfalke sich anschickt, auf sie Jagd zu machen, oder wie der Gelbspötter erst recht sein Lied erschallen läßt, wenn man mit einem Steine nach ihm geworfen hat. Die Waldmaus muß sehr schlecht sehen, denn manchmal kann man sie mit Händen greifen, obwohl sie den Beobachter unausgesetzt mit ihren großen, weit vorstehenden, ausdruckslosen Perlaugen anstarrt. Die Stimme ist quietschend oder leise pfeifend. Detmers berichtet, daß sie bei ihren geselligen Beißereien in allen Tonarten grunzen, quieken und piepen und dabei in äußerst drolliger Weise die Vorderpfoten hoch halten, so daß der Anblick einer solchen großen Mäusebalgerei unwillkürlich zum Lachen reizt. Nach den Beobachtungen Kammerers dürfte auch die Erscheinung der absonderlichen Tanzmäuse auf einer lediglich krankhaften Veranlagung beruhen. Eine von ihm gepflegte Waldmaus wurde nämlich zur »Tanzmaus«, nachdem sie durch Zufall ein längeres Fasten hatte durchmachen müssen; gleichzeitig war ihr aber auch die Kletterfähigkeit abhanden gekommen, und ebenso die frühere Zahmheit des Tierchens völlig entschwunden. Leverkühn fand eine Maus bei Hasel im südlichen Schwarzwalde tief im Inneren der Erdmannshöhle, die Scheffel im »Trompeter« als »Zauberhöhle« besungen hat, ohne feststellen zu können, wie sie an diesen sonst nicht das geringste Tierleben aufweisenden Ort gekommen war. Die an dem schwarzen Rückenstreifen auf dem rotbraunen Fellchen leicht kenntliche Brandmaus ist in ihren Bewegungen entschieden ungeschickter und schwerfälliger als ihre Verwandten, anscheinend auch wesentlich dümmer, aber anderseits gutmütiger und harmloser. Ein gemütliches Phlegma scheint der Grundzug ihres wenig komplizierten Charakters zu sein. Vom Klettern, das die Waldmaus so gerne und so meisterhaft ausübt, ist die Brandmaus bei ihrer behäbigen Leibesfülle gar kein Freund, um so mehr aber vom Vorrätesammeln.

Abb. 42. Waldmaus.
Von den kurzschwänzigen Wühlmäusen ist die überaus schädliche Wasserratte an Teichen, Flüssen und sumpfigen Gräben heimisch, während sie in trockenen Gegenden niemals gefunden wird. Ihre in den Uferböschungen angelegten Schlupfröhren münden halb über, halb unter dem gewöhnlichen Wasserspiegel aus, senken sich zunächst etwas, steigen dann wieder und führen schließlich in einen mit Binsen, Moos und Gras ausgepolsterten Kessel. Doch hat man auch schon freistehende Nester von ihr im Schilf gefunden. Vom Neste aus führen förmliche Gänge unter den überhängenden Uferwänden und zwischen dem dichten Pflanzenwust hindurch zu aus dem Wasser hervorragenden, hübsch trockenen, festgetretenen, aus umgeknickten Rohrstengeln, Schilf und Seggengras bestehenden Plätzen, auf denen die Tiere ihre Mahlzeiten einnehmen, sich sonnen und putzen, spielen und schlafen. Das Tier läuft zwar schlecht, schwimmt aber ausgezeichnet und ist ungemein räuberisch veranlagt, was namentlich die umwohnende Vogelwelt in der empfindlichsten Weise zu spüren bekommt. Krebse packt sie sehr geschickt von hinten aus um den Leib und nagt sie von unten bei lebendigem Leibe an, ohne daß der arme Panzerritter sich wehren und von seinen kräftigen Scheren Gebrauch machen kann. Die kleinere, stets sehr vorsichtige Schermaus macht sich durch ihre unablässigen Wühlereien namentlich den Gärtnern sehr verhaßt, die oft fälschlich den Maulwurf für den Übeltäter halten, und vergrößert den Schaden noch dadurch, daß sie alle Wurzeln benagt und dadurch die Pflanzen zum Absterben bringt. Spargelbeete z. B. kann sie auf diese Weise völlig zugrunde richten. Während die eigentliche Wohnung der Schermaus ziemlich tief liegt, verlaufen ihre gewöhnlichen Grabgänge sehr seicht, so daß sie sich nach oben auswölben und bei sprödem Boden die flache Erddecke vielfach zerspringt. Das gegen Licht und Zugluft sehr empfindliche Tier sucht solche Schäden immer wieder auszubessern und kann dabei leicht gefangen werden. Ebenso schädlich wie die Schermaus im Garten ist die Waldwühlmaus oder Rötelmaus im Forste, wo sie sich nicht damit begnügt, die Wurzeln zu zerbeißen, sondern auch noch die Rinde der jungen Stämmchen bis zu ziemlicher Höhe in der abscheulichsten Weise zernagt. Davon werden besonders Buchen und Lärchen betroffen. Die Waldwühlmaus klettert vorzüglich und errichtet sich im Gebüsch niedrig über der Erde ein Nest aus abgenagten Holzfasern und Grashalmen. Der schädlichste aller Nager ist die Feldmaus. Sie ist es, bei deren massenhafter Vermehrung wir von »Mäusejahren« sprechen; sie ist es, die ganze Ernten zerstört und ganze Pflanzungen vernichtet, die den Wohlstand ganzer Länder in Frage stellen kann, die in ihrer Milliardenzahl all ihrer zahllosen Feinde und aller menschlichen Nachstellungen zu spotten vermag. Ihre Verwandte, die etwas plump erscheinende Erdmaus, verlegt das Feld ihrer Tätigkeit mehr in den Wald und macht wenigstens einen geringen Teil des Schadens, den sie durch das Benagen der Kulturpflanzen verursacht, durch Vertilgung von Engerlingen wieder gut. Bemerkenswert erscheint es mir, daß Feld- und andere Mäuse in Dünengegenden ein mehr sandfarbiges Fell haben, also in dieser Beziehung eine hübsche Parallelerscheinung zu den Haubenlerchen und anderen Bodenvögeln darstellen.

Abb. 43. Brandmaus.
Wie tief ein einmal verbreiteter Irrtum sich in das Bewußtsein des Volkes einfressen kann und wie schwer er dann wieder auszurotten ist, das beweist schlagend das allgemein geglaubte und auch in fast allen Naturgeschichtsbüchern dem vertrauensseligen Leser aufgetischte Märlein, daß der Hase mit offenen Augen schlafe, weil seine Lider zu kurz seien, als daß sie über die Augäpfel gezogen werden könnten. Nun ergibt freilich schon die bloße Betrachtung des erstbesten geschossenen Hasen die Unrichtigkeit dieser Angabe. Wenn sich das Märlein, das uns wieder einmal so recht deutlich zeigt, wie unendlich viel es noch in der Naturgeschichte unserer allergewöhnlichsten einheimischen Tiere zu tun und aufzuklären gibt, trotzdem so lange zu erhalten vermochte, so liegt das ganz einfach daran, daß es auch dem behutsamsten Beobachter in freier Natur nur äußerst selten glücken wird, einen wirklich schlafenden Hasen zu sehen. Sichere Angaben über den Hasenschlaf stammen deswegen erst aus neuerer Zeit, seit man in den zoologischen Gärten bequeme Gelegenheit fand, einwandfreie Beobachtungen zu machen. In Wahrheit verhält sich die Sache so, daß dem in seinem Lager ruhenden Hasen sein ungemein scharfes Gehör auch im Schlafe die Annäherung eines Menschen gewöhnlich schon viel früher verrät, als dieser selbst ihn zu sehen vermag. Lampe rückt sich dann natürlich gleich zurecht, um bei allzugroßer Annäherung seines Todfeindes rasch aufspringen und entwischen zu können. Natürlich öffnet er dazu die bis dahin geschlossenen Augen. So kommt es, daß, wenn wir einen Hasen in seinem Lager zu überraschen glauben, er uns längst bemerkt hat und mit offenen Augen anstarrt, auch wenn er im Vertrauen auf seine vorzügliche Schutzfärbung sich vorläufig noch ganz ruhig verhält und uns näher und näher kommen läßt. Wenig bekannt ist es, daß der Hase ganz gut schwimmen kann und von dieser Fertigkeit in sumpfigen Gegenden auch freiwillig oft genug Gebrauch macht. Als ich im Frühjahr 1897 den Vogelzug an den Sümpfen des ungarischen Alföld beobachtete, traf ich dort viele Hasen an; wenn ich sie aufscheuchte, machten sie des Wassers wegen nur selten einen Umweg, sondern schwammen meist ohne Umstände über Wasserflächen von 30 und mehr Meter Breite hinweg. Schon in den ältesten Volksmärchen wird Lampe als Schnelläufer gefeiert, allerdings trotz seiner langen Beine beim Wettlauf vom pfiffigen Igel überlistet. Ein Arzt hat unlängst die Schnelligkeit des Hasen auf originelle Weise mit Hilfe des Automobils genau festgestellt. Er schreibt darüber in der »Augsburger Postzeitung«: »Durchfährt man im Automobil wildreiche Gegenden bei Nacht, so kommen nicht selten Hasen in den Bereich der Scheinwerfer und ergreifen natürlich schleunigst die Flucht. Da ist es dann ergötzlich für den Automobilisten, der keine bösen Absichten auf das Leben dieser Tiere hat, den Renneifer eines Hasen zu beobachten. Er läuft und läuft schnurstracks geradeaus, unmittelbar vor der Maschine her und merkt nicht, daß ein Sprung seitwärts in den Straßengraben ihn prompt vor der Verfolgung retten könnte. Was ist nun das Verhängnis, das dem Hasen den rettenden Ausweg verbirgt? Die Scheinwerfer, die ihren blitzenden Lichtstrahl in schmalen Streifen geradeaus werfen. Das geblendete Tier sieht nur einen Ausweg: die vom Scheinwerfer grell erleuchtete Straße, rechts und links ist schwarze Finsternis, ihm ein gähnender Abgrund, und erst wenn die Straße eine Wendung macht, und der Schein auf das Feld und in den Graben fällt, findet es Rettung aus der Gefangenschaft der Lichtstrahlen, um dann plötzlich, wohl zu seinem nicht geringen Erstaunen, im Dunkel zu sitzen. Bei diesem Wettlauf kann man die Geschwindigkeit eines Hasen leicht feststellen. Sobald ihn die Lichtstrahlen eingefangen haben, mäßigt man die Geschwindigkeit des Automobils, bis der Abstand zwischen Automobil und Tier gleichbleibt. Ein Blick auf den Junghans-Geschwindigkeitsmesser, der sich dazu mit seiner durch ein Radiumpräparat erhellten Skala vorzüglich eignet, zeigt uns die momentane Geschwindigkeit, und wir wissen dann, daß ein Hase auf ebener Straße 22-25 km Stundengeschwindigkeit erreicht, bergab aber bringt er es kaum auf 20 km pro Stunde.« Das Quäken des Hasen ertönt, soweit meine Erfahrungen reichen, nur bei starker, körperlicher Schmerzempfindung als gequälter Ausdruck der Todesangst, nicht aber bei bloß psychischer Erregung. Solcher gibt er vielmehr lediglich durch das Spiel der langen Löffel und durch Aufstampfen und Ausschnellen mit den Läufen Ausdruck. Ein entsprechendes Trommelsignal mit den Hinterläufen scheint auch zur Warnung der Jungen zu dienen.
Das Evangelium der Natur ist die Erhaltung der Art. Deshalb ist das eingehende Studium des Liebeslebens der Tiere so außerordentlich interessant, so wertvoll und unentbehrlich für das Verständnis ihrer Eigenart. Mit fast unheimlicher Macht ergreift zu gewissen Zeiten der Fortpflanzungstrieb Besitz von dem ganzen Denken und Sinnen des Tieres und herrscht in ihm so unumschränkt, daß selbst der Ernährungstrieb, die sonst so stark entwickelte Freßgier, völlig in den Hintergrund tritt und das brunftige Tier nur das Allernotwendigste zu sich nimmt. Feiglinge werden dann zu Helden, Einsiedler suchen die Gesellschaft, Finsterlinge kommen ans Tageslicht, Faulpelze unternehmen ausgedehnte Wanderungen; eine wunderbare Umwandlung scheint sich im ganzen Tierreiche zu vollziehen. So anmutige Liebesspiele, ein so inniges Eheleben, ein so treues Zusammenhalten in Leid und Freud wie bei unseren gefiederten Lieblingen, den Vögeln, finden wir bei den Säugern freilich nur in seltenen Fällen. Die Liebe erscheint hier vielmehr fast allen poetischen Reizes entkleidet, und das rein Sinnliche tritt mit nackter Deutlichkeit hervor. Das ganze Benehmen des Männchens ist weniger darauf eingerichtet, das Gefallen des Weibchens zu erwecken, als vielmehr darauf, etwaige Nebenbuhler herauszufordern und abzuwehren. Das Weib gehört ohnedies dem Sieger, die natürliche Zuchtwahl herrscht mit brutaler Gewalt und merzt unnachsichtlich alles Schwächliche aus, das zur Fortpflanzung nicht tauglich erscheint. Im Sturm wird der Minnesold errungen, und übersättigt vom reichlichen Genuß, vergißt der männliche Teil bald genug, daß die Sorge um die Nachkommenschaft auch Pflichten auferlegt, die deshalb zumeist ganz oder fast ganz dem Weibchen überlassen bleiben. Besonders bissige und unverträgliche Tiere, wie die Hamster, gehören nur für wenige Tage im Rausch der Sinnlichkeit einander an, um dann, nachdem der Zweck des kurzen Zusammenseins erfüllt ist, gefühllos voneinander zu scheiden und sich gegenseitig auf Tod und Leben zu bekämpfen und wohl gar aufzufressen, falls der Zufall sie später außerhalb der Paarungszeit wieder zusammenführen sollte. Bei vielen Säugern, so bei Füchsen und Hasen, bei Mäusen und Flatterern herrscht unumschränkt die Venus vulgivaga, und nicht nur huldigen die Männchen in ausgedehntestem Maße der Polygamie, sondern ebenso auch die Weibchen der Polyandrie. Bei anderen, wo die Männchen durch Größe, Stärke und besondere Waffen den Weibchen weitaus überlegen sind, finden wir eine ausgesprochene Harems- und Paschawirtschaft, so bei den Hirschen.
Es sind gewiß schöne, herrliche Tiere, unsere Damhirsche, anziehend sonst gerade durch ihr sanftes, gutartiges Wesen, das sie zu Lieblingen der Frauenwelt gemacht hat, aber wenn sie so ganz und gar von dem unstillbaren und unersättlichen Geschlechtstrieb erfüllt werden, der ihnen ein abstoßend wildes Aussehen und einen widerwärtigen Geruch verleiht, dann kann sie wohl nur noch der Weidmann schön finden, der nach langer vergeblicher Pirsch endlich das todbringende Rohr auf den Verliebten anlegt. Ist doch selbst das Wildbret des brunftigen Damhirsches kaum zu genießen, wenn es nicht sofort nach dem Schuß ausgeweidet wurde. In noch höherem Grade gilt das von den Gemsböcken. Die Gemse ist ja überhaupt nicht die schlanke Gazelle des Gebirges, das ewig muntere und flinke Geschöpf, als das die Dichter sie verherrlichen, sondern nur eine gedrungene, muskulöse, den alpinen Verhältnissen angepaßte, zumeist recht träge und faule Gebirgsantilope, aber während der im November beginnenden Brunft machen die ihre Geißen unter dumpf blökenden Tönen treibenden Böcke einen fast widerlichen Eindruck, zumal wenn man nahe genug ist, um den abscheulichen Geruch wahrnehmen zu können, der den hinter den Krücken oder Krickeln (Hörnern) befindlichen schwammartigen Brunftdrüsen entströmt. Auch den Zweikämpfen der eifersüchtigen Gemsböcke fehlt vollständig das Grandiose, fesselnd Wilde der Hirschkämpfe. Ihr Kampfruf ist nur ein knurrendes Grunzen und murrendes Plärren, und so ernst ihre Duelle auch gemeint sind, so erbittert sie auch geführt werden mögen, wirken sie auf den Zuschauer doch immer mehr erheiternd und komisch.
Aber höher schlagen macht es unser Herz, wenn zum ersten Male wieder der gewaltig orgelnde Brunftschrei des Edelhirsches durch den herbstlich stillen, bunt gefärbten Wald ertönt, wenn wir gar im wogenden Nebel den stolz geweihten Recken selbst zu sehen bekommen, wie er den heißen, dampfenden Atem hinausstößt in die kalte Morgenluft. Er muß durch seinen Schrei Luft machen den gewaltig tobenden Leidenschaften, die ihn beherrschen, und ganz verschieden klingt der urwüchsige Ruf, je nachdem er Kampfeslust, Zorn, Wut, Eifersucht, Sehnsucht oder Langeweile ausdrücken soll. Da antwortet vom benachbarten Hügel der Schrei eines Nebenbuhlers. Donnernd, wutbebend rollt der Ruf des starken »Platzhirsches« daraufhin durch den stillen Wald. Näher und näher kommen sich beide, in immer kürzeren Pausen ertönt die Aufforderung zum Kampf, und dann haben sich die Gegner endlich erblickt, zornigen Mutes stürzen sie aufeinander los, klappernd schlägt Geweih gegen Geweih, mit fest in die Erde gestemmten Läufen, bis zur letzten Faser gespannten Muskeln stehen sie sich gegenüber auf dem moosigen Waldboden. Wie alte, geübte Fechter suchen sie trotz des in ihnen kochenden Ingrimms einander lauernd eine Blöße abzugewinnen, während aus dem Hintergrund die Tiere neugierig herüberäugen – fürwahr ein wunderbares Bild urwüchsiger Naturkraft, das erhabenste, schönste und herrlichste vielleicht, das unser deutscher Wald uns bieten kann. Aber während die alten Recken ihre Kräfte messen, schleichen junge Hirsche im verborgenen Waldesdickicht lüstern an die lauschenden Tiere heran, und nicht selten gelingt es solch einem unansehnlichen »Schneider«, rasch das vorweg zu genießen, um das die beiden Alten auf Tod und Leben kämpfen. Die ominöse Nebenbedeutung, die das Hirschgeweih in arte amandi erlangt hat, entbehrt deshalb keineswegs der naturgeschichtlichen Berechtigung.
Nicht immer ist der männliche Teil allein der begehrende und unersättliche, denn oft übertrifft ihn darin noch der weibliche, wie man das namentlich beim Hasen beobachtet hat. Ein gut Teil Koketterie steckt in jedem weiblichen Lebewesen, und nicht immer ist das Männchen der Verführer, vielmehr häufig genug der Verführte.
Namentlich beim Elchwild auf der Kurischen Nehrung habe ich das beobachten können. Da dort nämlich zwar Hirsche, aber verkehrterweise aus falschen Schonrücksichten niemals »Tiere« (weibliche Hirsche) abgeschossen werden, sind zu viele alte Gelttiere (Tiere, die kein Kalb bringen) vorhanden, die jedoch den Freuden der Liebe keineswegs zu entsagen gesonnen sind, vielmehr eine große Vorliebe für Junghirsche zeigen und diese keiner Geschlechtsgenossin gönnen mögen. Manch köstliches, oft stark ans Komische streifende Familienbildchen aus dem Leben des plumpen Riesenhirsches habe ich dort im verschwiegenen Erlendickicht erlauschen können. Die »alte Tante« tyrannisiert ihren jugendfrischen Ehegemahl ganz gehörig und stellt an seine Leistungsfähigkeit die größten Ansprüche, bewacht ihn mit grenzenloser Eifersucht und duldet keine Nebenbuhlerin. So kommt es, daß gerade die Junghirsche sich zwecklos und bis zum Übermaße an den Gelttieren abbrunften, die Jungtiere aber teils ganz unbeschlagen bleiben, teils mit abgelebten Hirschen vorliebnehmen müssen und infolgedessen gewöhnlich auch nur ein Kalb setzen, während in Rußland und Schweden deren zwei die Regel sind. Wenn man den kleinen Restbestand des vorsintflutlichen Recken im äußersten Ostpreußen erhalten will, wird sich meines Erachtens daher ein mäßiger Abschuß auch der alten Tiere nicht umgehen lassen.
Unser Sprachgebrauch hat das Wort von der »tierischen Liebe« geprägt und damit wohl das Rohe, rein Sinnliche des Liebeslebens gerade der Säugetiere bezeichnen wollen. Von solcher Art Liebe ist aber das Gefühl der Eifersucht unzertrennlich, und in der Tat sehen wir diese in der ganzen langen Reihe unserer Säugetiere eine hervorragende Rolle spielen und Veranlassung zu den erbittertsten Kämpfen werden, die nicht selten mit dem Tode des Unterlegenen endigen. Um so merkwürdiger muß es erscheinen, daß gerade die heißblütigsten unserer Säuger, die Fledermäuse, von geschlechtlicher Eifersucht nahezu frei sind. Es scheint bei ihnen geradezu ein geschlechtlicher Kommunismus zu herrschen. Wenigstens hat man schon öfters beobachtet, daß mehrere Männchen dem Begattungsakte eines anderen ruhig und ohne jede eifersüchtige Regung zusahen und geduldig warteten, bis die Reihe an sie käme. Ebenso sind die Haselmäuse nach meinen Erfahrungen in Liebessachen sehr verträglich und nachsichtig. Das gebärende Fledermausweibchen hängt sich nicht wie in seiner gewöhnlichen Ruhestellung mit den Krallen der Hinterfüße auf, sondern vielmehr an den Daumen der Hände. Dazu krümmt es die Schwanzflughaut nach dem Bauche zu einwärts, so daß ein natürliches Becken entsteht, in das die beiden Jungen hineinfallen, um sich, nachdem die Alte die Nabelstränge durchbissen und sie abgeleckt hat, sofort an den beiden Zitzen der Mutter festzusaugen, die ihre Kinder in dieser Stellung nun auch während ihrer Ausflüge mit sich führt. Die Paarungszeit der Fledermäuse fällt in den Herbst, wo diese Tiere infolge der reichlichen Nahrung am kräftigsten und lebenslustigsten sind. Dann aber trennen sich die Geschlechter, und die Weibchen wohnen gemeinsam in großen Schlafhöhlen, während die Männchen ein mehr einsiedlerisches Leben führen. Die großen Fledermausgesellschaften, die man im Winter öfters in hohlen Bäumen findet, bestehen also ausschließlich aus befruchteten Weibchen, denn schon der ältere Brehm stellte fest, daß kein Männchen in diese Frauengemächer eindringen darf. Das Merkwürdigste ist aber nun, daß die Entwicklung des Embryo nicht gleich nach der Begattung im Herbste beginnt, was ja auch die Kräfte des Muttertieres während des langen, zehrenden Winterschlafes zu sehr in Anspruch nehmen würde. Der Samen bleibt vielmehr lebensfähig in der Gebärmutter aufgespeichert und befruchtet erst nach dem Erwachen aus dem Winterschlafe das sich erst dann vom Eierstock lösende Ei, worauf die Entwicklung sehr rasch vor sich geht und schon wenige Wochen später die Geburt erfolgt. Wir haben es hier also offenbar mit einer weitgehenden Anpassung des Geschlechtslebens an den so tief ins Leben dieser Tiere eingreifenden Winterschlaf zu tun.

Abb. 44. Trollender Elchhirsch in der ostpreußischen Wildnis.
Nach einer Zeichnung von
Rich. Friese.
Ähnliche Erscheinungen finden wir übrigens auch bei anderen Tieren, die gar keinen oder nur einen unvollkommenen Winterschlaf durchmachen, ein Beweis, daß beim Zustandekommen dieses Vorganges auch noch andere, wohl in den Nachwirkungen der Eiszeit zu suchende Faktoren mitgesprochen haben müssen. So fällt die Paarungszeit des Dachses in den Spätsommer, aber die Dächsin geht mindestens 6 Monate trächtig, weil das befruchtete Ei nach erfolgter Furchung ein längeres Ruhestadium durchzumachen hat. Im Februar kommen die Jungen in sehr unvollkommenem Zustande zur Welt, bleiben drei Wochen lang blind und entwickeln sich überhaupt äußerst langsam, so daß beim Eintritte eines strengen Nachwinters viele zugrunde gehen. Beim Reh findet die echte Brunft und damit die Befruchtung gleichfalls im Juli oder August statt. Das Ei verläßt alsdann den Eierstock, wird im Eileiter von dem ihm dort begegnenden Samen befruchtet und gleitet nach einigen Tagen in die Gebärmutter, wo die Weiterentwicklung bis Mitte Dezember, also über vier Monate lang, völlig unterbrochen wird und das im Durchmesser kaum ¼ mm große Ei überhaupt sehr schwer aufzufinden und nachzuweisen ist. Dann erst setzt plötzlich die Weiterentwicklung wieder ein und geht nun rasch vor sich. Lange galt diese hauptsächlich von Bischoff vertretene Theorie als unanfechtbar, aber in allerneuester Zeit sind doch wieder schwerwiegende Bedenken gegen sie geltend geworden, so daß die Frage heute noch als ungelöst angesehen werden muß. Wieder ein sprechender Beweis dafür, wie wenig gründlich wir noch selbst über die wichtigsten Vorgänge im Leben der häufigsten, schon in unzähligen Monographien aus das eingehendste geschilderten Jagdtiere unterrichtet sind, wie viel es noch auf diesem Gebiete zu tun gibt, das oberflächliche Beurteiler als längst abgebaut und erschöpft ansehen möchten.
So frei das Liebesleben der Säuger auch von jeder idealeren Regung ist, ein Gefühl vergoldet es doch mit einem weihevollen Hauch: das Gefühl reiner, selbstloser, aufopfernder Mutterliebe. Auch die selbstsüchtigsten Tiere werden in ihrem innersten Wesen durch die Mutterschaft verwandelt, die den tierischen Egoismus, die sonst stärkste Lebensregung, plötzlich bändigt, ja fast auslöscht in ihrem heiligen Dienst. Der rücksichtslose Mut, den viele weibliche Tiere entwickeln, wenn sie ihr Liebstes bedroht glauben, hat etwas Rührendes und Erhabenes in sich. Und wie eifrig schleppen sie Nahrung herbei in Hülle und Fülle, damit die Kinderschar rasch erstarkt, wie sorgsam leiten sie sie an in allem, was nötig ist, um sich durchs Leben zu schlagen! Freilich ist auch die Mutterliebe sehr verschieden entwickelt, durchläuft alle Grade und sinkt bei manchen Arten auf ein Minimum herab. So ist der sonst so bissige und buldoggenmutige Hamster am Neste ein erbärmlich feiger Gesell, der, wenn man ihn dort ausgräbt, nur auf die Rettung des eigenen Lebens bedacht ist und seine Nachkommenschaft schmählich im Stiche läßt. Derartige Fälle wurden mir erst kürzlich wieder mehrfach von Herrn Lehrer Wolf in Monsheim bei Worms berichtet.
Ungleich seltener ist bei den Säugern Vaterliebe zu finden, denn meist kümmert sich der Vater nach Befriedigung seiner geschlechtlichen Gelüste bis zur nächsten Paarungszeit überhaupt nicht mehr um das Weibchen, noch viel weniger um seine Nachkommenschaft, ja vielfach (bei Kaninchen, Ratten, Katzen) frißt er sie einfach auf, wenn er ihrer habhaft werden kann, so daß das Muttertier genötigt ist, sie sorgsam vor ihm zu verstecken und zu behüten. Eher scheinen sich väterliche Gefühle zu regen, wenn die Kinder schon etwas größer geworden sind, indem sich der Vater dann wenigstens vielfach dazu hergibt, mit ihnen zu spielen. So wissen wir vom Fuchs, daß er verwaiste Junge, die ihre Mutter verloren, mitleidig mit Nahrung versorgte, obwohl er bei der sehr weitherzigen Denkungsart der »Fähe« in puncto Liebe nicht einmal wissen kann, ob es wirklich seine Kinder sind. Wie wir bei den Vögeln den tiefgreifenden Unterschied der Nesthocker (die längere Zeit geatzt werden müssen) und Nestflüchter (die sogleich fähig sind, sich ihre Nahrung – meist unter Anleitung der Alten – zu suchen) haben, so kommen auch die Säugetiere teils hilflos, nackt und blind zur Welt (besonders unentwickelt erscheinen die kaum bohnengroßen Jungen des Maulwurfs), teils laufen sie schon von ihrem ersten Lebenstage an munter umher, wie die hochbeinigen Kälbchen der Hirsche; auch die Frischlinge der Wildschweine sind schon von Geburt an flink wie der Blitz. Die Trächtigkeitsdauer ist namentlich beim Schalenwild (Huftieren) erheblichen Schwankungen unterworfen, die mir vom Alter des Muttertieres und vom Geschlecht der Frucht abhängig zu sein scheinen.
Ich kenne nur eine einzige deutsche Oberförsterei, in der unsere sämtlichen drei Hirscharten nebeneinander in freier Wildbahn vorkommen: die Oberförsterei Tapiau in Ostpreußen, die sowohl Elch wie Rot- und Damwild beherbergt. Unvergeßlich schöne Stunden habe ich dort verlebt, als ich an prächtigen Herbsttagen auf den brunftenden Damhirsch pirschte und zugleich den dort ebenfalls noch heimischen, sonst in Deutschland so seltenen Uralkauz beobachten konnte. Waren das prächtige Augenblicke, als ich so zitternd vor Erregung hinter einem der uralten Stämme stand und hinüberspähte mit leuchtenden Augen zu dem wie eine Tenne festgestampften Brunftplatz, wo der Hirsch in toller Lust seine Tiere trieb! Leicht war es gerade nicht, da nahe anzukommen, da in einiger Entfernung vom Brunftplatze immer ein paar zerstreute Gelttiere stehen, die ganz ausgezeichnet aufpassen, äußerst mißtrauisch sind und bei der geringsten Unvorsichtigkeit des Beobachters sofort schmälend flüchtig werden. Jedenfalls hatte ich damals reichlich Gelegenheit zu vergleichenden Beobachtungen über die Sinnesschärfe unseres Schalenwildes, und sie fielen nicht zu ungunsten des Damwildes aus, das wir gewöhnlich ja nur als vertrautes, beinahe ziegenartig anmutendes Parkwild kennen, das aber in freier Wildbahn von überraschender Scheu und Unruhe ist. Leute, die ihre Tierstudien nur am grünen Tisch gemacht haben, stellen den Edelhirsch zu den Nasentieren und erklären ihn für hochgradig kurzsichtig; Jäger aber, die unser stolzestes Wild aus dem grünen Walde kennen, werden mir darin beipflichten, daß auch Gehör und Gesicht recht gut entwickelt sind, beide jedenfalls besser als bei uns Menschen. Die freie Natur läßt sich eben nicht immer in solche Schablonen hineinzwängen, und auch der Fuchs paßt nicht in eine solche kathedermäßige Einteilung, da auch bei ihm alle Sinne nahezu gleichmäßig entwickelt sind, wenn auch der Geruch obenan stehen mag.
Reineke Fuchs hat von jeher als ein Ausbund von Schlauheit gegolten. Ist das wirklich ganz richtig? Nun, jeder alte Jäger weiß, daß der rote Freibeuter mit dem Mephistogesicht manchmal auch verblüffend dumme Streiche macht. Wenigstens scheinen sie uns dumm, obwohl sie es vom Fuchsstandpunkte aus wahrscheinlich nicht waren, da der vierbeinige Gauner eben so handelte, wie es ihm nach seinen Sinneswahrnehmungen, die ja oft nicht mit denen des Menschen identisch sind, richtig erscheinen mußte. Jedenfalls ist so ein alter vielerfahrener Fuchs, der schon unzählige Male mit knapper Mühe dem Tode entrann, der schon alle Geschöpfe des Waldes überlistet und auch den sich so superklug dünkenden Menschen so und so oft für Narren gehalten hat, ein »mit allen Salben geschmierter« Bursche, den so leicht nichts in Verlegenheit setzt und dessen wirklich bewunderungswerte Geistesgegenwart auch aus den schwierigsten und verzweifeltsten Lagen noch immer einen allerletzten Ausweg zu finden weiß. Wenn auch vielleicht nicht der klügste, so ist er sicherlich doch der vielseitigste Charakter unter unseren Vierfüßlern und eben deshalb nicht nur eines der schwierigsten, sondern auch der interessantesten und lohnendsten Objekte der Tierpsychologie. Die aber ist gegenwärtig leider vollständig auf einem toten Punkte angelangt. Wir erleben hier die merkwürdige Erscheinung, daß sich die krassesten Materialisten mit den Verfechtern starren Bibelglaubens brüderlich die Hand reichen, denn für beide ist das Tier nichts als eine willenlose Reflexmaschine, ein festgeprägten Gesetzen folgender Mechanismus. Wir Beobachter der freien Natur können uns damit nicht einverstanden erklären, sondern schreiben aus Grund unserer Wahrnehmungen auch dem Tiere in mehr oder minder beschränktem Maße Verstand und Seelenleben zu. Die so hoch, aber so einseitig entwickelten Vögel haben meiner Ansicht nach mehr Gefühl als die Säuger, aber diese besitzen eine höhere Intelligenz. Erfreulich ist es, daß neuerdings auch die Anatomen, die sich gegen diese hochwichtige Streitfrage lange zurückhaltend oder gar gleichgültig verhalten hatten, sich in unser Lager begeben, da eben auch die Befunde des anatomischen Messers deutlich und unwiderleglich verkünden, daß den höheren Wirbeltieren Verstandestätigkeit zukommt. Es geht dies schon daraus hervor, daß bei vielen Säugern das Neuhirn ( Neencephalon) vollständig das Übergewicht über das die motorischen Reflexbewegungen bedingende Urhirn ( Palaeencephalon) gewonnen hat. Natürlich gibt es hier alle möglichen Übergänge, die aber ganz mit der geistigen Begabung der betreffenden Tiere im Einklang stehen. So halten sich bei den Mäusen die beiden Hirnteile ungefähr die Wage, und bei Maulwürfen und Igeln ist das Neuhirn nur wenig größer, aber es wird auch kein Naturbeobachter behaupten wollen, daß diese Tiere auf der Stufenleiter der Intelligenz obenan ständen. Edinger, der in allerjüngster Zeit eine sehr schöne tierpsychologische Arbeit vom anatomischen Standpunkte aus veröffentlicht hat, kommt zu dem Schlusse: »Es ist sicher falsch, dem Menschen auf allen Gebieten das größte Assoziationsvermögen (Fähigkeit unwillkürlicher Verbindung von Empfindungen und Vorstellungen im Bewußtsein) zuzuschreiben; die Ausbildung einzelner Hirnrindenteile läßt es vielmehr als durchaus wahrscheinlich erscheinen, was die populäre Meinung längst lehrt, daß nämlich viele Säuger auf bestimmten Einzelgebieten inbezug auf Beobachtungs- und Assoziationsfähigkeit dem Menschen weit überlegen sind.«
Ich kann hier aus Raummangel auf dieses Thema nicht näher eingehen, zumal ja der »Kosmos« größere tierpsychologische Untersuchungen und Veröffentlichungen plant. Nur etwas möchte ich noch betonen. Ich bin der Überzeugung, daß in der Tierpsychologie viel zu viel philosophiert und viel zu einseitig experimentiert wird, dagegen viel zu wenig wirklich beobachtet, am allerwenigsten in der freien Natur. Daran fehlt's! So mancher einfache Forstmann ist ein weitaus besserer Tierkenner als der Universitätszoologe, der das Tierleben in philosophische Dogmen kleiden oder mit Experimenten ergründen will, die von vornherein aus den Reflexmaschinenstandpunkt eingestellt sind und das Tier in eine unnatürliche Zwangslage versetzen, in der es seine natürlichen Fähigkeiten gar nicht entfalten kann. Wie viele von ihnen haben wohl schon wirklich im Tierauge zu lesen versucht? Ich getraue mir, nach einem Blick ins Auge eines Tieres dessen Charakter zu erraten. Das klingt freilich sehr »unwissenschaftlich«, aber wahr bleibt's doch. Und es ist auch gar kein Kunststück; jeder Reiter, der mit seinem Pferde sich eins fühlt, jeder Jäger, der seinen Hund selbst »abgeführt« hat (Abrichtung nach beendeter Stubendressur), jeder Tierbändiger, der nicht bloß mit der Peitsche arbeitet, kann's ebensogut und besser. Unlängst hatte ich ein Manuskript in der Hand, in dem ein alter Reiteroffizier seine Erfahrungen mit Pferden erzählt. Ein dort mitgeteilter Fall hat mich wahrhaft ergriffen. Der Erzähler war bei einer Attacke verwundet worden und lag stundenlang mit furchtbaren Schmerzen unter einem Haufen von Toten und Verwundeten. Da erschien sein reiterlos gewordenes treues Pferd auf der grausigen Stätte, suchte und fand ihn, zog ihn mit den Zähnen hervor, half ihm förmlich aufsteigen und trug ihn dann in sanfter Gangart zu den Resten seiner Schwadron. »Wer mir in diesem Augenblick,« so ungefähr schloß der Wackere, »gesagt hätte, mein Pferd habe nicht aus Anhänglichkeit zu mir und aus Verstand, sondern aus bloßem Instinkt so gehandelt, sei nur durch Reflexwirkungen dazu veranlaßt worden, der – ich weiß nicht, was ich ihm in dem Augenblicke angetan hätte!«
△