
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Es wird in unserer Papiergeldzeit merkwürdig berühren, wenn man vernimmt, daß früher wiederholt schöne Silbermünzen in Deutschland geprägt wurden – eines Tieres wegen. Obendrein handelte es sich dabei nicht etwa um ausgezeichnete Rennpferde oder um edle Hunde, sondern um ein unansehnliches Insekt, auf das der Durchschnittsmensch mit stolzer Verachtung herabzusehen gewöhnt ist, obschon es sich ihm von Zeit zu Zeit sehr nachdrücklich in Erinnerung zu bringen weiß. In einem alten Schmöker (Ernst Ludewig Rathlefs Pastoris primarii zu Diepholz Acridotheologia, Hannover 1748), der mir zufällig aufstieß, fand ich nicht weniger als fünf solcher Münzen aus den Heuschreckenjahren 1683 und 1748 fein säuberlich abgebildet, und zwei davon, die gar nicht übel sind, seien hier wiedergegeben (Abb. 1). Auf einer dritten sieht man auf der Vorderseite eine scheinbar brennende, in Wirklichkeit in Heuschreckenwolken eingehüllte, vieltürmige Stadt, während auf der Rückseite ein geflügelter Erzengel mit drohend erhobener Sense gegen die verderblichen Kerfe loszieht. Zu Ehren der Heuschrecken wurden diese schönen Münzen also nicht gerade geprägt, vielmehr zur traurigen Erinnerung an die fürchterlichen Verwüstungen, die diese ungebetenen Gäste aus dem Orient gelegentlich auch im Herzen Europas angerichtet haben. Gerade die ungeheure Schädlichkeit der Wanderheuschrecken hat schon seit uralten Zeiten die Aufmerksamkeit der Menschen auf diese Tierchen gelenkt, von denen bereits Diodor, Plinius und Aristoteles ausführliche Beschreibungen geben. Indische Dichter, ägyptische Denkmäler und die heilige Schrift geben von ihren Untaten grause Kunde, griechische und römische Schriftsteller sowie die mönchischen des Mittelalters erwähnen sie oft genug mit Entsetzen. Keiner aber hat ihre Wanderzüge mit so dichterischem Schwung und dabei doch naturwissenschaftlich richtig geschildert wie der Prophet Joel (II, 1–25): »Ein finstrer Tag, ein dunkler Tag, ein wolkiger Tag! Gleichwie sich die Morgenröte ausbreitet über die Berge, kommt ein groß und mächtig Volk, desgleichen vordem nicht gewesen ist und hinfort nicht sein wird zu ewigen Zeiten für und für. Vor ihm her gehet ein verzehrend Feuer und nach ihm eine brennende Flamme. Das Land ist vor ihm wie ein Lustgarten und nach ihm wie eine wüste Einöde, und niemand wird ihm entrinnen. Sie sind gestaltet wie Rosse und rennen wie die Reiter. Sie sprengen daher oben auf den Bergen, wie die Wagen rasseln, und wie eine Flamme lodert im Stroh, wie ein mächtig Volk, das zum Streit gerüstet ist. Die Völker werden sich vor ihm entsetzen, aller Angesichter werden bleich …«

Abb. 1. Erinnerungsmünzen aus Heuschreckenjahren.
Die Bibel (Exodus X) gibt uns auch Kunde von der ältesten, geschichtlich beglaubigten Heuschreckenplage, denn sie gehörte ja zu den sieben Übeln, die über den störrischen Pharao Ägyptens und sein Land verhängt wurden, damit er die Kinder Israels ziehen lasse: »Und sie kamen über ganz Ägyptenland und ließen sich nieder an allen Orten in Ägypten; so sehr viel, daß zuvor desgleichen nie gewesen ist, noch hinfort sein wird. Denn sie bedeckten das Land und verfinsterten es, und sie fraßen alles Kraut im Lande auf und alle Früchte auf den Bäumen, die vom Hagel waren überblieben; und ließen nichts Grünes übrig an den Bäumen und am Kraut auf dem Felde in ganz Ägyptenland.« Man wird leicht geneigt sein, die lebensvollen Schilderungen des Joel und des Moses für dichterische Übertreibung der orientalischen Phantasie zu halten, aber wer einmal selbst inmitten eines wandernden Heuschreckenheeres gestanden hat, weiß genau, daß sie nur die lautere Wahrheit reden. Ich selbst ritt einmal vor langen Jahren an der Spitze meiner kleinen Karawane über die Hochsteppe zwischen Marrakesch und Mogador, als mir plötzlich ein großes Kerbtier ins Gesicht flog. Ich haschte es und erkannte die übel berüchtigte marokkanische Wanderheuschrecke. Rasch mehrte sich die Zahl der einzeln so hübschen, im Massenzug so widerwärtigen Tiere. Fortwährend prallte es mir surrend gegen die Brillengläser, kroch in die Rockärmel und in den Halsausschnitt, flog dem Pferde in Augen und Ohren. Wie eine finstre Wolkenbank stieg es vor unsren geblendeten Blicken empor und kam mit der Unwiderstehlichkeit eines Lavastroms, dabei aber mit unheimlicher Schnelligkeit näher und näher wie eine Walze des Todes. Schon wateten die Lasttiere stampfend und gleitend in einem fettig-klebrigen, ekelhaften Brei zertretener Kerfe, von deren verstümmelten Leibern die eigenen Artgenossen alsbald gierig zu schmausen begannen. Millionen kauender Kinnbacken verursachten ein Geräusch wie Hagelschlag, die Luft knatterte vom Rascheln gespenstischer Flügel, glühende Hitze preßte uns den Schweiß aus allen Poren, und doch war die Sonne wie hinter einer finsteren Wolke verschwunden und auf wenige Schritte Entfernung kein Gegenstand mehr zu erkennen. Unmöglich, weiter gegen das brausende, immer mehr sich verdichtende Riesenheer anzureiten. Die braunen Gesichter meiner Araber erbleichten, die Pferde wurden scheu und strauchelten, die Esel waren nicht mehr von der Stelle zu bringen, die Kamele suchten ihre Last abzuwerfen und auszureißen, selbst die sonst so mutigen marokkanischen Windhunde (Slokis) suchten mit eingekniffenem Schwanze Schutz bei ihrem Herrn, der doch selbst ratlos dem überwältigenden Naturereignis gegenüberstand. Glücklicherweise befand sich eine umfangreiche Ruine in der Nähe, hinter deren ragenden Mauern Mensch und Tier, eng angeschmiegt, einigermaßen Schutz fanden. Aber die Außenseite des Trümmerwerks war bald so dicht mit Heuschrecken besetzt, daß weder Stein noch Lehmwerk mehr zu erkennen waren, sondern alles aussah, als sei es mit einem unruhig bewegten Moospolster überzogen. Stundenlang mußten wir in dieser Lage aushalten, bis es halbwegs möglich wurde, den Marsch fortzusetzen. Und doch war dies nur ein verhältnismäßig kleiner Heuschreckenzug, der verschwindend erscheinen muß, wenn man bedenkt, daß 1799 ganz Marokko innerhalb drei Tagen durch diese Schädlinge aller grünen Pflanzen beraubt und daß 1800 Kleinasien vom gleichen Schicksal betroffen wurde, worauf dann in beiden Ländern eine furchtbare Hungersnot die traurige und unvermeidliche Folge war. Und welch großartiges, aber auch beängstigendes Naturschauspiel muß es geboten haben, als im August 1747 ein ungeheures Heuschreckenheer, die Luft verfinsternd, viele Stunden lang ununterbrochen durch den Rotenturmpaß in Siebenbürgen zog, um in Mitteleuropa einzufallen; als im vorigen Jahrhundert ein anderes Heer in einer Frontbreite von 10 km über den Dnjepr setzte, wobei die Leichen der vorderen als Brücke für die Nachfolgenden dienen mußten; als man vollends in Amerika Schwärme von 20 km Breite und 100 km Länge feststellte, die ihren Verheerungszug 2800 km weit ausdehnten, also etwa die Strecke von Stockholm nach Gibraltar zurücklegten; als man einmal in Südafrika berechnete, daß gleichzeitig 2000 englische Quadratmeilen Landes mit Heuschrecken bedeckt waren; als 1890 das Schiff »Amalie« volle 33 Stunden lang auf dem Roten Meere durch dicht das Wasser bedeckende Heuschrecken fuhr, die der Wind hineingeweht hatte! Das sind unglaubliche Zahlen, und doch bergen sie bitterböse Wahrheit.
Wenn sich auch die meisten und größten Heuschreckenplagen in wärmeren Ländern abspielen, so ist doch Mitteleuropa keineswegs von ihnen verschont geblieben. Schon aus der Zeit Caracallas, dieses widerwärtigsten Scheusals, das je den römischen Kaiserthron verunziert hat, besitzen wir diesbezügliche Nachrichten, und weitere aus den Jahren 451 und 593, besonders aber 872/73, wo nach den Berichten der Fuldaer Klosterchronik ganz Franken und das Mainzer Becken greulich verwüstet wurden. Aus dem Mittelalter werden für Deutschland im ganzen einige dreißig ausgesprochene Heuschreckenjahre aufgezählt, und besonders reich war mit solchen noch das 18. Jahrhundert bedacht, wo in vielen Gegenden die Heuschreckennot das Elend des Siebenjährigen Krieges verdoppeln half. Besonders bedroht waren immer Schlesien und die Mark einerseits, Süddeutschland andrerseits, da die Heuschrecken entweder von Polen her oder durch die Lücke zwischen Sudeten und Karpathen oder durch Ungarn donauaufwärts hereinbrachen. Auch das 19. Jahrhundert hat noch einige Heuschreckeneinfälle nach Mitteleuropa aufzuweisen, doch hat die Häufigkeit der Erscheinung wie auch ihr Umfang im vergleich zum Mittelalter entschieden nachgelassen. Glücklicherweise bleibt sich die Fruchtbarkeit der Tiere nicht gleich, sondern ist, wie wir noch näher sehen werden, von verschiedenen Umständen abhängig, besonders von dem Zusammentreffen bestimmter Witterungsverhältnisse. Die Zeitabschnitte, in denen sie ihre größte Höhe erreicht, liegen jedenfalls erheblich weiter auseinander als bei Maikäfern, Feldmäusen und ähnlichen Verwüstern. Zuletzt erschienen die gefürchteten Tiere noch 1887/88 in Westpreußen und 1889 in der Mark; seitdem ist keine größere Einwanderung mehr erfolgt, eine Wiederholung jedoch keineswegs ausgeschlossen. Abgesprengte Trupps sind gelegentlich noch weit über Deutschland hinaus nordwärts vorgestoßen, so bis nach Dünaburg, ja über die Ostsee hinüber nach Schweden, wo vereinzelte Stücke noch unter dem 63.° n. Br. angetroffen wurden, und selbst über den Kanal hinüber nach England und Schottland, wo sie 1748 mit Edinburg ihren bisher nordwestlichsten Punkt erreicht haben. Von Hause aus sind die Wanderheuschrecken freilich ausgesprochene Steppentiere, weshalb auch Steppenländer wie Südrußland am meisten ihren Verheerungen ausgesetzt sind. Die gegenwärtig dort in so entsetzlichem Maße herrschende Hungersnot ist zum nicht geringen Teile auf die Heuschreckenplage 1920/21 zurückzuführen. Auch Spanien hatte während der letzten Jahre schwer durch Heuschreckenfraß zu leiden. Während des Weltkrieges gesellte sich zu den zahlreichen Feinden Deutschlands noch ein weiterer, der zwar an sich winzig, aber seiner Massenhaftigkeit halber durchaus nicht zu verachten war: die Wanderheuschrecke. Die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit und das Durchhalten unseres türkischen Bundesgenossen wurden auf das schwerste gefährdet durch ungeheure Heuschreckenschwärme, die 1915–1917 in Kleinasien und Syrien ihre verderbliche Tätigkeit entfalteten. Der durch sie angerichtete Schaden (allein 1915 in Anatolien für 100 Millionen Mark Getreide, nach türkischen Friedenswerten berechnet) läßt sich unter Berücksichtigung der Kriegslage überhaupt kaum in Geldwerten ausdrücken. Auf Veranlassung des einsichtsvollen damaligen Landwirtschaftsministers Mustafa Scheref Bey begab sich ein ganzer Stab deutscher Zoologen unter Führung von Dr. Bücher auf diesen neuesten Kriegsschauplatz und lieferte dem sechsbeinigen Feinde eine Reihe grimmiger Schlachten, die schließlich mit seiner Vernichtung endigten und so das Hungergespenst verscheuchten. Was dort in zweijähriger heißer Arbeit von den deutschen Gelehrten geleistet wurde, wird für immer ins Ehrenbuch deutscher Naturforschung einzutragen sein.
Unsere deutschen Bauern jammern schon, wenn einmal das zierliche Reh ein paar Roggenhalme verbeißt, und schreien Zeter und Mordio, wenn ein genäschiges Häslein in ihrem Kohlgarten sich unnütz macht. Was würden sie erst sagen, wenn ein richtiges Heuschreckenheer über ihre Felder herfiele! Wie sagt doch der Prophet Joel (VIII)?: »Heule wie eine Jungfrau, die einen Sack anlegt um ihren Bräutigam! Denn die Ackerleute sehen jämmerlich, und die Weingärtner heulen um den Weizen und um die Gerste, daß aus der Ernte auf dem Felde nichts werden kann! So stehet der Weinstock auch jämmerlich und der Feigenbaum kläglich; dazu die Granatbäume, Palmbäume, Äpfelbäume und alle Bäume auf dem Felde sind verdorret, denn die Freude der Menschen ist zum Jammer geworden.« Und der Portugiese Alfonsus Alvarez schreibt in dem Bericht über seine Reise zum König David von Äthiopien kurz und bündig: »Sie bedecken den Erdboden, sie füllen die Luft an, sie benehmen das Licht des Tages, wo sie gewesen sind, da ist's, als ob alles von Flammen weggesengt worden wäre.« Nicht nur Felder, Wiesen und Gemüsegärten werden völlig zerstört, sondern auch die Bäume stehen da wie Besenreiser und werden von den gefräßigen Tieren schließlich sogar auch noch der Rinde entkleidet. Die im Orient üblichen unteridischen Getreidespeicher sind keineswegs sicher vor diesen unheimlichen Kerfen, die dann außer den Körnern auch die Säcke mit verzehren. Wo sie in die Häuser eindringen, fällt ihren zermalmenden Kiefern alles zum Opfer, was nur halbwegs genießbar erscheint, namentlich auch Kleidungsstücke. Brehm schildert in seiner beredten Weise einen tropischen Urwald im Sudan, der nach dem Heuschreckeneinfall aussah, als habe in ihm verzehrendes Feuer gewütet, als sei er verbrannt oder jahrelanger Dürre zum Opfer gefallen. Nur mit verdorrten Blättern waren die Zweige noch bedeckt, aber diese Blätter entpuppten sich bei näherem Hinsehen als Heuschrecken, die nun, nachdem alles Grün verschwunden war, auch noch die Rinde abnagten. Lachende Fluren werden durch die Heuschrecken in wenigen Stunden zu traurigen Einöden verwandelt, in denen das Gespenst der Hungersnot seine Geißel schwingt. In Marokko sind nach Heuschreckenplagen wiederholt Tausende von Menschen vor Hunger gestorben; Männer haben dann ihre Frauen, Väter ihre Kinder um ein Brot verkauft. In Beßarabien wurden im Jahre 1860 128 367, im Gouvernement Cherson 240 000, in Taurien 130 000 Morgen Kulturland von den Heuschrecken vollständig kahl gefressen. Marshall erzählt, daß ein amerikanischer Farmer 20 000 Tabakpflänzchen rings um sein Haus herum angepflanzt hatte. Sie gediehen prächtig, aber als sie fußhoch geworden waren, erbarmte sich ihrer ein Heuschreckenschwarm, und innerhalb 20 – sage und schreibe zwanzig – Sekunden waren sie von der Erde verschwunden! Selbst im Tode werden diese verhängnisvollen Kerfe dem Menschen noch furchtbar. Wenn sie rasch und massenhaft absterben, strömen ihre verwesenden Kadaver einen entsetzlichen Leichengeruch aus und verpesten weithin die Gegend. Schon der Kirchenvater Augustin berichtet, daß aus diesem Grunde die Pest in Nordafrika ausgebrochen sei und 800 000 Menschen hinweggerafft habe. Im Jahre 571 sollen der gleichen Krankheit in Italien sogar eine Million Menschen zum Opfer gefallen sein. Barrows teilt aus Südafrika mit, daß einst ein großer Heuschreckenzug vom Sturmwind ins Meer geworfen und dann wieder am Strande ausgespült worden sei, wo die Heuschreckenkadaver eine 3–4 Fuß hohe Bank von einer Länge von 50 englischen Meilen bildeten und der fürchterliche Gestank der verfaulenden Tiere noch 150 englische Meilen weit landeinwärts zu spüren war. Auch Verkehrsstörungen sind schon durch Heuschrecken hervorgerufen worden, und selbst Eisenbahnzüge wurden durch die klebrige und fettige Unmasse zerquetschter Heuschrecken in Palästina und Syrien zum Stillstand gebracht. Fahrstraßen wurden durch die Heuschrecken ungangbar und das Wasser von Brunnen und Flüssen durch ihre verwesenden Leiber vergiftet.
Freilich hat der Mensch hier und da den Spieß umgedreht und seinerseits die Heuschrecken für eine wohlschmeckende und bekömmliche Speise erklärt. Schon Diodor, ein Zeitgenosse Cäsars, schreibt über die Akridophagen (Heuschreckenesser), einen kleinwüchsigen, mageren, tiefschwarzen Volksstamm Äthiopiens. »Diese Heuschrecken sind ihre beständige Speise, denn sie haben kein Vieh und keine Fische noch andere Lebensmittel. Sie legen sie in Haufen und streuen Salz darüber, das in ihrem Lande reichlich anzutreffen ist.« Strabo berichtet etwas abweichend: »Sie schneiden sie klein, besprengen sie mit Salzwasser und machen einen Teig daraus, den sie essen.« Ich selbst habe in Marokko flache Kuchen gesehen, die aus zerkleinerten Heuschrecken gebacken waren und in bösen Zeiten das fehlende Brot ersetzen müssen. Meine Araber knabberten gern über dem Kohlenbecken geröstete Heuschrecken, von denen aber dem Gebote des Koran gemäß Kopf, Flügel und Beine vor dem Verspeisen entfernt wurden. Es roch ganz appetitlich, so daß ich öfters in Versuchung kam, mitzuhalten, aber schließlich schauderte ich doch immer wieder vor dem Verzehren des fragwürdigen Gerichts zurück. Nach der Bibel soll ja bekanntlich Johannes der Täufer in der Wüste von Heuschrecken und wildem Honig gelebt haben, was recht wohl denkbar ist. Bezeichnet doch auch Moses (Leviticus XI, 22) die Heuschrecken als eine koschere (reine) Speise. In Arabien und Persien werden sie noch heutzutage gesotten und gesalzen in großer Menge auf die Wochenmärkte gebracht und beherrschen deren ganze Preisgestaltung. Ein Tuareg verspeist auf einen Sitz oft 300 geröstete Heuschrecken, und in Birma gelten sie in gebratenem Zustande, vermengt mit stark gewürztem Hackfleisch, als ein vornehmes Gericht. Von Europäern, die sich zum Genusse dieser Tierchen entschließen konnten, wurde mir versichert, daß sie wie etwas zu trocken gewordene Bückinge oder auch wie Garnelen schmecken. Pferde nehmen getrocknete Heuschrecken sehr gern, und auch in Deutschland hat man solche gelegentlich mit gutem Erfolg als billiges Schweinemastfutter verwendet. Ein wirklicher Leckerbissen sollen aber gekochte Heuschreckeneier sein, die also gewissermaßen den Kaviar der Wüsten und Steppenländer darstellen. Trotzdem gehören natürlich diese schädlichen Kerfe zu den bestgehaßten Tieren. Man hielt sie geradezu für Teufelskreaturen und Belialskinder, so daß ein gewisser Krell in Leipzig 1693 eine Schrift erscheinen ließ, in der er mit der schwülstigen Darstellungsweise jener Zeit und mit tiefer Gelehrsamkeit allen Ernstes die Frage erörterte, ob auch die Heuschrecken von Gott erschaffen seien. Trotz vieler Bedenken bejaht er schließlich doch diese Frage, worüber die Heuschrecken jedenfalls eine große Freude empfunden haben werden. Kein Wunder, daß auch der Aberglaube des Volkes sich von jeher viel mit diesen Tieren beschäftigt hat. Aus der verworrenen Zeichnung ihrer Vorderflügel wollte man allerlei Buchstaben herauslesen und daran Prophezeiungen knüpfen, worüber sich schon der tapfere Polenkönig Johann Sobiesky weidlich lustig gemacht hat. Meist deutete man die Schnörkel auf Ira Dei (Zorn Gottes), weil man allgemein die Heuschreckenzüge für ein Strafgericht Gottes hielt, oder besonders erleuchtete Geister auch auf B. E. S. als Abkürzung für »Bedeutet erschreckliche Schlachten« oder »Botschaft erstorbener Sünder«. »Aber niemand,« meint Weber, der Verfasser des lachenden Demokrit, »las daraus: Bist ein Schöps!«
Vergegenwärtigen wir uns nun einmal kurz, wie ein solcher Massenzug von Wanderheuschrecken zustande kommt. Der Paarungstrieb macht seine Rechte nach den Anstrengungen der Wanderschaft im Spätsommer oder Frühherbst geltend, und die Tiere bekunden auch dabei ihren ausgesprochenen Geselligkeitstrieb. Auf hektargroßen Flächen sieht man nur ein einziges Bild: Paar an Paar nebeneinander der Liebesgöttin opfernd. Schon hierbei spielt die Witterung eine große Rolle, denn wenn naßkaltes Wetter eintritt, vollzieht sich die mehrere Stunden dauernde Begattung nur unvollständig, und es werden weniger, vielfach auch nicht entwicklungsfähige Eier abgesetzt, während bei schönem und warmem Wetter das Umgekehrte der Fall ist. Mit Hilfe des harten Legestachels bringen die Weibchen ihre gelblichweißen Eierchen 3–4 cm tief im Boden unter, und zwar in jedem Loche 30–40 Stück, die von einer gemeinsamen, klebrig-schaumigen Hülle umgeben sind. Diese erstarrt dann zu einem mehr hornigen oder papierartigen Zylinder, der sog. Oothek, die so widerstandsfähig ist, daß sie die Eier vortrefflich gegen Hitze und Kälte, Nässe und Dürre schützt. Der amerikanische Naturforscher Riley hat durch eingehende Versuche festgestellt, daß die Eikokons vollständiges Einfrieren oder wochenlanges Unterwassersetzen vertrugen, ohne daß die Entwicklungsfähigkeit Schaden litt. Dasselbe ist der Fall, wenn die Kokons aus irgendwelchen Ursachen jahrelang in der Erde ruhen bleiben. Gewöhnlich schlüpfen die winzigen, 3–4 mm langen, zunächst gleichfalls gelblichweiß gefärbten Junglärvchen aber nach 9 Monaten aus, und die gern witzelnden Araber haben daraus naheliegende Vergleiche zu dem sich entwickelnden Menschenkinde gezogen. Jedes Weibchen zeitigt 2-4 solcher Kokons, im Durchschnitt etwa 150 Eier. Da die Larven aus schwerem Boden sich kaum würden herausarbeiten können, wird zur Ablage der Eier gewöhnlich dürrer Sandboden auf trockenen Hochflächen oder an sonnigen Hängen benützt, öfters auch an Flußufern. Beim Ausschlüpfen der Larven kommt es abermals viel auf die Witterung an. Hat frühzeitige Hitze das Erdreich zu hart gemacht, so können sie nicht zur Oberfläche und ersticken; werden sie draußen von kalten Regengüssen empfangen, so gehen sie alsbald massenhaft zugrunde. Mildes Schönwetter zeigt sich dagegen auch hier wieder als Freundin dieser Tiere. Ging das Ausschlüpfen gut vonstatten, so sitzen ihrer oft Hunderttausende auf einem einzigen Quadratmeter Raum und zeigen sich hier während ihrer ersten Lebenstage recht unbeholfen und träge, bis die Glieder erstarkt sind, der Hautpanzer fester, die Farbe dunkler geworden ist. Ihre öde und unfruchtbare Geburtsstätte bietet ihnen nicht viel für die bald zum Heißhunger gesteigerte Freßlust, und so begibt sich denn allmählich die ganze Gesellschaft auf die Wanderung, nachdem sie am siebten Tage die erste Häutung bestanden hat. Es geht zu Fuß, denn Flügel haben die Larven ja noch nicht. Zunächst zeigen sie sich auch noch als recht zaghafte Läufer, die täglich nicht mehr als 100–150 m zurücklegen, und auch im Alter von 14 Tagen bewältigen sie höchstens 1 km am Tage. Dann aber wird aus dem mühseligen Kriechen ein lustiges Hüpfen, und schon im Alter von drei Wochen rücken die tüchtigen Springer 10 km täglich vor. Bald beträgt ihre Sprungweite 60 cm bei 30 cm Sprunghöhe, und die tägliche Marschleistung erfährt noch eine weitere Steigerung. Schließlich sind nach der letzten (fünften) Häutung auch die Flügel kräftig genug geworden, um wie ein Paar Ruder die Luft zu durchschneiden, und das inzwischen in der Front mächtig verbreiterte und auf Milliarden, wenn nicht auf Billionen angeschwollene Heer rückt nun mit erstaunlicher Schnelligkeit und mit der Unwiderstehlichkeit einer Lawine vorwärts, wobei ein Rauschen entsteht, das man treffend mit dem eines Mühlrades verglichen hat, während die wandernden Larvenmassen sich anhören, als trample in der Ferne eine große Hammelherde vorüber. Die Ausrüstung dieser Tiere für ausgedehnte Reisen ist großartig. Sie tragen ein sehr praktisch grünlich oder bräunlich staubfarbenes Reisekleid, können trotz ihrer gräßlichen Gefräßigkeit lange hungern und auf ihren starken Flügeln gut 7–8 km in der Stunde zurücklegen, was für ein Kerbtier gewiß eine tüchtige Leistung ist. Betrachtet man die verhaßte Heuschrecke einmal von diesem Gesichtspunkte aus, so kann man nur ausrufen: wie zweckmäßig ist dieses Tier gebaut, wie kraftvoll, wie schön! Dabei sind die Wanderheuschrecken von einer verblüffenden Lebenszähigkeit. Der vom Rumpfe getrennte Kopf bleibt noch 20 Stunden lang lebendig und öffnet bei Reizung der Mundwinkel den Rachen, von dem der Prophet sagt: »Das hat Zähne wie Löwen und Backenzähne wie Löwinnen.« Der kopflose Rumpf springt noch stundenlang weiter, und erst ganz allmählich läßt die bewundernswerte Kraft der Beingelenke nach. Der abgetrennte Bauch macht sogar noch Zeugungsversuche. Im Wasser schwimmen sie 18 Stunden, selbst in 1–3prozentiger Sublimatlösung halten sie es mehrere Stunden aus. Und wie sie fressen – o wie sie fressen! Freilich geraten sie dabei auch manchmal an Giftpflanzen, und das wird ihnen dann zum Verderben. Mit Eintritt der Paarungszeit – etwa vier Wochen nach der letzten Häutung – ändern sich ihre Instinkte. Sie gehen dann nicht mehr an frisches Grün, sondern halten sich an die dürren Gräser, die auf den öden Brutplätzen zu finden sind. Bald nach beendigtem Fortpflanzungsgeschäft sterben Männchen wie Weibchen ab. Von Interesse dürfte es endlich noch sein, daß wandernde Heuschrecken bisweilen zu beträchtlicher Höhe in die Lüfte emporsteigen. Bei einer Ballonfahrt im bayrischen Allgäu wurden nach Weinland in dem Augenblicke, als der Ballon nach dem Ziehen der Reißleine sich langsam zur Seite neigte, auf der oberen Hülle Tiere sichtbar, die sich zum allgemeinen Erstaunen als Wanderheuschrecken entpuppten. In welcher Höhe (die erreichte Höchsthöhe betrug 4830 Meter) die Heuschrecken, wie ermüdete Zugvögel auf ein vorüberfahrendes Schiff, auf die Ballonhülle eingefallen waren, war vom Korb aus leider nicht beobachtet worden. Die Frage, ob ein Heuschreckenschwarm bei seiner unheimlichen Freßlust und bei der Schärfe seiner Kauwerkzeuge gelegentlich einen Ballon beschädigen und so einen Unfall herbeiführen kann, muß einstweilen offen bleiben. Sicher ist es bei Flugzeugen der Fall, wenn größere Mengen von Heuschrecken in die Maschinenteile geraten. So stürzte der Flieger Mauvais 1917 über Madrid infolge Zusammenstoßes mit einem Heuschreckenschwarm tödlich ab. Trotz aller Forschungsergebnisse aber haben wir in den Heuschreckenzügen noch immer ein Naturschauspiel vor uns, das verklärt wird durch den Schimmer des Rätselhaften und aus dem das vielfach noch unverstandene Bild unabänderlicher Gesetze uns seine Weisheit zuraunt.
Natürlich hat sich der Mensch von jeher gegen diese gefräßigen Kerfe nach Kräften zur Wehr gesetzt. Guten Erfolg konnten aber die Abwehrmaßregeln erst haben, als man sich über die Naturgeschichte des bekämpften Geschöpfes völlig im klaren war und nun den Feldzug mit einer gewissen Planmäßigkeit führen konnte. Im Altertum ging man den Heuschrecken mit schwelenden Feuern zu Leibe und trieb ihre Larven in wassergefüllte Gräben. Später hat man auch mit Kanonen auf die Heuschrecken geschossen, wobei aber wohl das entstehende Getöse die Hauptsache war. Heute bestehen in allen Kulturländern, die öfters von Heuschreckenplagen heimgesucht werden, behördliche Einrichtungen zur tatkräftigen Bekämpfung des Schädlings. So haben die Engländer auf Zypern ein militärisch organisiertes Heuschreckentötungskommando eingerichtet, das auch genau zu beobachten hat, wo die Eier abgelegt werden, damit schon diese vernichtet werden können. Freilich erforderte diese Einrichtung in den Jahren 1882–87 eine Ausgabe von 1½ Millionen Franken, aber sie hat sich gut bezahlt gemacht, indem die Insel seitdem jährlich für zwei Millionen Franken mehr an landwirtschaftlichen Erzeugnissen zur Ausfuhr bringt. Um welche Massen es sich schon bei den Eiern handelt, kann man daraus entnehmen, daß z. B. 1875 in der Umgegend des lombardischen Städtchens Villafranca innerhalb fünf Tagen über 600 kg Heuschreckeneier gesammelt und abgeliefert wurden. In der Türkei wurden 1917 nicht weniger als 7 240 000 kg Eipakete der Vernichtung zugeführt, wobei zu beachten ist, daß etwa 1500 Eipakete auf 1 kg gehen. Es wären demnach allein durch das Einsammeln der Eier 334 827 000 000 Individuen abgetötet worden! Ist die Plage trotzdem zum Ausbruch gekommen, so wird jung und alt, groß und klein gegen sie aufgeboten; die Schulkinder bekommen Heuschreckenferien, und sogar das Militär wird zu Hilfe gerufen. Ein Pascha von Tripolis sandte einmal eine ganze Armee von 4000 Mann gegen das gefräßige Ungeziefer aus mit der tröstlichen Versicherung, er werde jeden aufknüpfen lassen, der es etwa unter seiner Würde halten sollte, gegen einen so verächtlichen Feind zu kämpfen. Den deutschen Gelehrten, die während des Weltkrieges die türkische Heuschreckenplage bekämpften, standen dazu 10 000 Soldaten zur Verfügung, die also ihrer eigentlichen Aufgabe entzogen werden mußten. Bei der großen südrussischen Heuschreckenplage vom Jahre 1860 waren sogar 15 000 Mann Militär aufgeboten. In Algier waren 1888 nach Künckel d'Herculais 65 268 Leute mit zusammen 1 948 855 Arbeitstagen bei der Heuschreckenvertilgung beschäftigt. Man hat berechnet, daß dabei etwa 11 000 Milliarden Heuschrecken vernichtet wurden. Als ein gutes Vorbeugungsmittel hat sich das Feststampfen oder Festwalzen des mit Heuschreckeneiern bedachten Bodens erwiesen, weil die schwachen Lärvchen dann im Frühjahr nicht zur Oberfläche sich herauszuarbeiten vermögen. Auch die schon geschlüpften Larven sind in ihren ersten Lebenstagen durch solches Walzen verhältnismäßig leicht zu vernichten. Die großen Larvenzüge bekämpft man heute hauptsächlich mit der sog. Zinkmethode. Es werden dabei quer zur Wanderrichtung des Heuschreckenzuges Zinkblechstreifen von mehreren hundert Meter Länge so im Boden befestigt, daß sie noch mindestens 30 cm frei hervorragen, welche Höhe die Larven nicht zu überspringen vermögen. Anderswo verwendet man statt des Zinkblechs wohl auch glattes Wachstuch, das dieselben Dienste leistet. In gewissen Abständen werden längs der Zinkwand metertiefe Fanggruben ausgehoben und gleichfalls mit Blech ausgekleidet. Trifft nun die anmarschierende Larvenmasse auf die Blechwand, die ein für sie unübersteigliches Hindernis darstellt, so sieht sie sich genötigt rechts oder links abzubiegen, und dabei fallen die dicht gedrängten Tiere in die Fanggruben, wo man sie mit Handrammen zerquetscht. Die ganze Vorrichtung ist leicht aufzubauen und mit wenigen Leuten zu überwachen, ihr Erfolg bei richtiger Leitung aber großartig, da ganze Larvenheere in wenigen Tagen restlos vernichtet werden. Bredemann berichtet, daß 1917 in der Türkei mit einer 800 m langen Zinkfalle und 35–40 Bedienungsmannschaften in zwei Tagen allein etwa 100 000 kg Larven gefangen wurden. Den geflügelten Heuschrecken gegenüber versagt natürlich dieses Verfahren, und man arbeitet da heutzutage – echt modern! – hauptsächlich mit Gift, mit dem man Köderspeisen tränkt oder mit dem man die ganze Vegetation bespritzt. Das ursprünglich benützte arseniksaure Natron hat sich aber als zu gefährlich für die Haustiere und die nützlichen Heuschreckenfeinde erwiesen, und deshalb verwendet man heute nahezu ausschließlich das harmlosere Schweinfurter Grün in seiner verbesserten Form »Urania«. Die Heuschrecken sterben 19-36 Stunden nach dem Genuß der Lockspeisen oder vergifteter Pflanzen. Evans beobachtete 1895 bei südafrikanischen Heuschrecken eine verheerende Seuche, die auf die Gegenwart von Schmarotzerpilzen zurückzuführen war. Es glückte, diese im Bakteriologischen Institut zu Grahamstown in Reinkultur zu züchten und mit diesem Mittel die Heuschreckenplage erfolgreich zu bekämpfen, wie dies später nach anfänglichen Mißerfolgen auch in Deutsch-Ostafrika der Fall war. Noch bessere Folgen hatte die Entdeckung einer Art Heuschreckencholera durch Felix d'Herdle vom Pariser Pasteur-Institut. Ein bestimmter Bazillus (Coccobacillus acridium) hat eine solche Einwirkung auf die Heuschrecken, daß sie nach 17–36stündiger Krankheit unrettbar eingehen. Da ihr Darminhalt dann fast eine Reinkultur dieses Bazillus darstellt, ist die Seuche äußerst ansteckend und verbreitet sich mit unheimlicher Schnelligkeit über weite Flächen, denn geflügelte Heuschrecken legen im Anfangsstadium der Krankheit oft noch 30 km und mehr an einem Tage zurück. Auf diese Weise ist es gelungen, die großen Heuschreckenschwärme des Jahres 1911 in Argentinien, die die ganzen Pampas kahl zu fressen drohten, fast restlos zu vernichten. Ebenda hat man recht gute Erfahrungen auch mit Giftgasen gemacht. Die zu Boden streichenden Schwärme werden mit einigen Chlorwolken empfangen und gehen in ihnen zugrunde, bevor das Gas noch den Pflanzungen nennenswerten Schaden zuzufügen vermag. Fliegende Heuschreckenschwärme lassen sich bisweilen auch durch Rauchwolken oder durch großes Getöse von der ursprünglichen Zugrichtung ablenken, weshalb man bei ihrem Erscheinen in manchen Ländern große Feuer aus stark qualmenden Stoffen entfacht und sie überdies mit einer großartigen Katzenmusik empfängt, wobei Pfeifen, Trompeten, Trommeln, Gongs, Glocken, Blechdeckel, Schußwaffen und sogar Grammophone in ohrenbetäubende Tätigkeit gesetzt werden. Die Menschen bilden sich dann wenigstens ein, etwas getan zu haben, und trösten sich damit über ihre Ohnmacht gegenüber diesen furchtbaren Kerbtieren.
Glücklicherweise haben diese eine große Menge natürlicher Feinde, ja in wärmeren Ländern bilden sie nach meinen Erfahrungen geradezu eine Art Universalfutter für alle größeren Vögel. Ob man geschossene Bussarde oder Turmfalken, Reiher oder Störche untersucht, immer ist zur Heuschreckenzeit ihr Magen bis zum Platzen vollgepfropft mit diesen Kerfen. Auch Sperber, Weihen und andere Raubvögel, Bienenfresser, Kraniche, Trappen und Löffelhunde nehmen reichlichen Anteil an der Leckermahlzeit. Der Löffelhund ist ein nettes Füchschen, dessen abweichender Gebißbau aber schon auf eine besondere Ernährungsart schließen läßt, und in der Tat ist er ganz auf Insekten angewiesen, indem neben Heuschrecken die Termiten seine Hauptspeise bilden. Die Störche, die pro Kopf und Tag bis zu 2 kg Heuschrecken vertilgen, gehen dabei ganz planmäßig zu Werke, ähnlich wie die Pelikane beim Fischfang. Sie bilden also eine richtige Treiberkette und stellen sich in einer langen Linie vor der Front des Heuschreckenheeres auf, einer dicht neben dem anderen. Auf ein gegebenes Zeichen schwenken die beiden Flügel herum, und die ganze Storchlinie beginnt nun gleichzeitig den Angriff, wobei die Vögel mächtig mit den Flügeln schlagen und dadurch die Heuschrecken nach der Mitte zusammentreiben, um hier eine um so mühelosere und reichlichere Mahlzeit zu halten. Wo immer ein Heuschreckenzug sich blicken läßt, ist er alsbald umschwärmt von den verschiedenartigsten Vögeln, die ihm meilenweit folgen und sich an der fetten Kost ausgiebig laben. Die wütendsten aller Heuschreckenvertilger sind aber doch die schön gefärbten und mit einem Federschopf gezierten Rosenstare, die ihre ganze Lebensweise nach den Heuschrecken einrichten und deshalb gleich ihnen zu Zigeunern geworden sind. Als im Sommer 1889 Heuschrecken massenhaft in Bulgarien und im Anschluß daran später auch in Ungarn erschienen, waren alsbald auch Rosenstare zur Stelle und brüteten zahlreich in Gegenden, wo sie sich sonst nie hatten blicken lassen. Bei dem beständigen Genuß von Heuschrecken verschleimt den Rosenstaren der Schnabel sehr bald und wird derartig verklebt, daß sie ihn kaum noch zu öffnen vermögen. Die Ursache dieser Schleimbildung ist wahrscheinlich in dem klebrigen, bräunlichen Safte zu suchen, den die Heuschrecken aus den Mundteilen absondern, wenn sie ergriffen werden. Die Vögel müssen daher von Zeit zu Zeit ein Wasser aufsuchen, um den Schleim abzuspülen, weil sie sonst zugrunde gehen würden. Der alte orientalische Volksbrauch, beim Herannahen von Heuschreckennot »heiliges« Wasser aus irgendeinem Derwisch-Kloster als Abwehrmittel herbeizuschaffen, ist wohl auf die Erfahrungstatsache zurückzuführen, daß durch die Darbietung von Wasser die Rosenstare angelockt und ihnen das Verbleiben in einer sonst dürren Gegend ermöglicht wird.
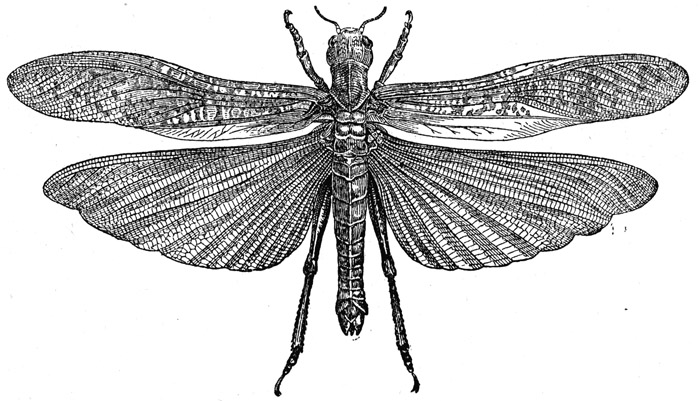
Abb. 2. Wanderheuschrecke. (Pachytilus migratorius.)
Die »Wanderheuschrecke« ist keine »Art« im zoologischen Sinne des Wortes, sondern man faßt unter diesem Sammelbegriff eine ganze Reihe von Arten aus der Gruppe der Feldheuschrecken zusammen, die eben unter bestimmten Verhältnissen die wanderlustigen Massenheere bilden und dann so ungeheuren Schaden anrichten. Jene Art, die wiederholt auch nach Deutschland vorgestoßen ist (z. B. 1844 so zahlreich, daß in der Mark Brandenburg auf einem Gelände von wenig mehr als 7700 Morgen 4425 Scheffel Eier gesammelt werden konnten), ist Pachytilus migratorius (Abb. 2). Für den Orient kommen dagegen als ärgste Verwüster hauptsächlich Stauronotus maroccanus und Schistocerea peregrina in Betracht. Südafrika wird namentlich von Pachytilus vastator heimgesucht, die im Jugendstadium rot gefärbt ist und deshalb von den Kolonisten und Buren »Rotröcke« genannt wurden wie die englischen Soldaten. In Südamerika und Australien treiben wieder andere Arten ihr Unwesen. Für Mitteleuropa kann man im allgemeinen wohl behaupten, daß sich eine Zunahme der Heuschrecken sowohl der Arten wie der Kopfzahl nach neuerdings unverkennbar geltend macht. Sie ist aber keineswegs auf das angebliche Wärmerwerden unseres Klimas, auf eine »wiederkehrende Tertiärzeit« zurückzuführen, wie Wilhelm Schuster meint, sondern auf die tiergeographisch ja überhaupt eine so große Rolle spielende Einwanderung aus dem Osten, die in um so höherem Grade einsetzen mußte, als Deutschland durch die Kultur aus einem Waldlande in eine künstliche Steppe verwandelt wurde. Ist doch kürzlich bei uns sogar eine rein sibirische Grasheuschrecke (Acridium sibiricum) aufgefunden worden.
Alle Heuschrecken gehören zu der sehr verschiedenartige Gestalten umfassenden und deshalb schwer zu begrenzenden Kerbtierklasse der Geradflügler oder Orthopteren, die sich biologisch den Schmetterlingen, Käfern u. a. gegenüber dadurch auszeichnen, daß sie nur eine unvollkommene Verwandlung (Metamorphose) haben, indem sie nämlich das ruhende Puppenstadium überspringen, also aus Larven meist unmittelbar zum geschlechtsreifen Tier (Imago) werden. Gemeinsam sind ihnen weiter die kauenden Mundwerkzeuge und der Kaumagen, aber äußerlich zeigen sie so tiefgreifende Unterschiede, daß es schwerfällt, sie sich als nahe Verwandte vorzustellen. Oder welcher Laie würde wohl auf den Gedanken kommen, daß die zierlich durch die Luft tänzelnde Eintagsfliege und die plumpe Maulwurfsgrille, daß das Sonnenkind Libelle und der lichtscheue Ohrwurm zur gleichen Sippschaft gehören, weil die gestrenge Systematik es nun mal so haben will? Ihre Larven hausen bald im Wasser, bald unter, bald auf der Erde, und ihre Flügel bekommen sie erst im erwachsenen Zustand, nachdem sie verschiedene Häutungen durchgemacht haben. Aber die einen tragen zwei Paar Flügel, die andern nur eines und manche gar keines. Hier sind die Flügel steif und hart, dort weich und zart; hier werden sie in der Ruhe zusammengefaltet, dort angelegt auf dem Rücken getragen. Der merkwürdige Kaumagen läßt bei den größeren Arten schon mit bloßem Auge eine Reihe von Zähnchen erkennen, von deren Härte man sich durch einen Fingerdruck leicht überzeugen kann. Die Bedeutung dieser Einrichtung ist nach Schönichen offenbar eine doppelte. Die Zähnchen werden infolge der Muskeltätigkeit des Organs in den mit viel unverdaulichen Stoffen durchsetzten Nährbrei hineingestoßen, und hierdurch erhalten die in den Magen hineingeleiteten Verdauungssäfte die Möglichkeit, in die Nährstoffe einzudringen und sie in Lösung überzuführen. Es handelt sich also nicht eigentlich um einen Kauapparat, sondern um einen Walkapparat, der das Durchkneten der aufgenommenen Speisen besorgt. Die übrigen Teile der Chitinausrüstung, d. h. die Deckel und Rinnen, stellen wohl einen Filterapparat dar, durch den die Nährflüssigkeit absickern kann, ohne durch unverdauliche oder erdige Brocken beschwert zu werden. Am hinteren Körperende der Geradflügler finden sich häufig ein Paar seltsame Anhänge, sogenannte Raifen (Cerci), wie sie mit einem sehr ungewöhnlichen deutschen Wort heißen. Die Kaukerfe sind ein uraltes Geschlecht, dessen versteinerte Überreste sich schon im Kohlengebirge, zahlreicher noch im lithographischen Schiefer und in den Tertiärschichten finden. Seien wir froh, daß seine heutigen Vertreter nicht mehr die Größe der damaligen erreichen, denn Wanderheuschrecken von mehr als Fußlänge – das ist in der Tat ein gruseliger Gedanke. Immerhin gehören zu dieser Ordnung auch heute noch die größten, d. h. die längsten, wenn auch nicht die schwersten Insekten, indem z. B. die Weibchen gewisser Gespenstheuschrecken eine Rumpflänge von fast 20 cm erreichen können. So kleine Arten wie bei den anderen Kerbtierordnungen kommen bei dieser überhaupt nicht vor, denn auch die kleinsten sind immer noch verhältnismäßig groß.
Die echten Heuschrecken, die nach Kopf- und Artenzahl den nächstverwandten Grillen weit überlegen sind, kennzeichnen sich durch die langen Springbeine und den gestreckten, ziemlich schlanken Leib, der im erwachsenen Zustande bei den meisten mit dachartigen Flügeln bedeckt ist. In der Jugend sind sie aber alle flügellos, und manche bleiben es ihr ganzes Leben hindurch. Die beiden großen Gruppen der Gras- oder Feldheuschrecken einerseits und der Baum- oder Laubheuschrecken andrerseits sind auf den ersten Blick leicht zu unterscheiden, denn bei jenen sind die Fühlhörner immer kürzer als der halbe Körper, bei diesen immer länger, oft so lang wie der ganze Körper. Die Weibchen der Laubheuschrecken sind mit einer auffallenden, säbelartigen Legeröhre ausgerüstet, während die der Feldheuschrecken kurz und unansehnlich bleibt. Eher haben die Laubheuschrecken eine gewisse Ähnlichkeit mit manchen Grillen, aber ihre Tarsen, d. h. die gegliederten Endstücke der Beine, bestehen stets aus vier Abschnitten, bei den Grillen dagegen nur aus drei. Auch biologisch sind die Unterschiede zwischen Gras- und Laubheuschrecken bedeutend, denn während jene fast ausschließliche Vegetarier und eben deshalb so große Schädlinge sind, verzehren diese überwiegend tierische Kost. Eifrige Musikanten sind beide, aber die Art und Weise, wie sie ihre Töne hervorbringen, weicht doch sehr voneinander ab, wie wir im folgenden noch näher sehen werden.
Wenn die großen Solokünstler der berauschenden Natursimfonie, die leichtbeschwingten Vögel, im Hochsommer zur Mauserzeit auf Urlaub gehen, dann treten die schwirrenden und klirrenden, zirpenden und klappernden Massenchöre der Heuschrecken, Grillen und Zikaden an ihre Stelle. Der sinnige Beobachter wird auch diese Laute trotz ihrer verzweifelten Eintönigkeit nicht missen wollen im großen Konzert der Natur, zumal sie zu einer Jahreszeit erschallen, in der die Fluren unter dem glühenden Kuß der Hochsommersonne still und verödet daliegen, verschlafen gewissermaßen, fast möchte ich sagen willenlos. Was wäre auch eine blumige Schwarzwaldwiese, was die dürstende, sandige Heide ohne das lustige Gefiedel des langbeinigen, grün- oder braunröckigen Heuschreckenvölkleins? Diese ganze Sippschaft ist gleich den Grillen und Zikaden sozusagen musikalisch, besonders wenn sie sich wohl fühlt, und im Hochsommer ist ja für sie Hochzeit. Die einfache Streichmusik der Kaukerfe hat deshalb im Grunde ganz dieselben Ursachen wie der wundervolle Vokalgesang der Vögel. Die Tierchen wollen vor allem dem weiblichen Geschlecht, das um diese Zeit auch besonders erregt und willfährig ist, sich in empfehlende Erinnerung bringen, aber sie geigen auch munter drauflos, wenn gar keine Schöne der eigenen Art in der Nähe weilt, also aus reiner Lust am Leben, aus bloßem Wohlgefühl, um dem sommerlichen Behagen Ausdruck zu verleihen. Wie schön mag wohl einem solchen Heupferd die Welt, wie wonnig das Dasein erscheinen, wenn die Mittsommersonne so angenehm wärmend vom blauen Himmel herunterlacht, wenn die üppig entfaltete Vegetation eine einzige große Freudentafel darzustellen scheint, wenn undurchdringliches Gras und Laubwerk reichlichen Schutz gegen die gierigen Vogelschnäbel gewähren und zugleich ringsum die süßen Freuden der Liebe winken! Da soll man nicht fiedeln? Und der Heuschreck tut's reichlich und gründlich, mit schier unermüdlichem Eifer. Fast gewinnt ihr Getön dann etwas von dem sehnsuchtsvoll wimmernden, sinnlich Aufpeitschenden, das die Araber in ihre für unser Ohr so wenig angenehmen, halb heulenden, halb winselnden Gesänge zu legen wissen. Die braunen Wüstensöhne schätzen denn auch das Heuschreckengezirp besonders hoch, und nicht umsonst haben sie die beiden berühmtesten Sängerinnen ihres Stammes, die unter dem Scheich Moawije Ben Bako, also noch vor Mohammed lebten, als »die beiden Heuschrecken Moawijes« bezeichnet. Auch die alten Griechen waren große Verehrer der ausdauernden und sprungfähigen Spielleute aus dem Insektenreiche, wußten auch recht gut, daß nur die Männchen die ausübenden Künstler sind, um durch ihr Getön die Weibchen anzulocken. Der Spötter Anakreon, der mit dem »schwächeren« Geschlecht keine guten Erfahrungen gemacht zu haben scheint, versteigt sich sogar zu den ungalanten Versen:
Glücklich leben die Heuschrecken,
Denn sie haben stumme Weiber!
's ist schändlich! Heuschrecken oder Zikaden wurden bei den Griechen zum Sinnbild der Musik, und ihr Bildnis schmückte deshalb die kostbaren Lauten schöner Sängerinnen. Nach heute noch findet die Streichmusik der Geradflügler bei anspruchslosen Völkern ihre Bewunderer. In manchen Gegenden Brasiliens wie auch Chinas setzt man die Tierchen in winzige Käfige aus Geflecht, um sich an ihren mit eiserner Beharrlichkeit wiederholten Tönen zu erfreuen, und man braucht noch nicht die gemütstiefe Einbildungskraft eines Dickens zu haben, um das Zirpen der Heimchen auf dem Herde gemütlich zu finden. Nützt aber dem geigenden Heuschreck alle Ausdauer und aller Eifer nichts, erscheint kein Weibchen nach seiner Liebesserenade auf der Bildfläche, nun, dann hat er ja seine prallen Sprungsschenkel und schnellt sich in gewaltigen Sätzen, die das Zwanzigfache der eigenen Körperlänge betragen, ein gut Stück weiter, um sein Konzert an einem Plätzchen wieder aufzunehmen, wo vielleicht mehr Erfolg sich erhoffen läßt.
Belauschen wir nun einmal einen dieser eigenartigen Künstler etwas näher! Wir wollen uns dazu an einem lauschigen Plätzchen auf der großen, sonnenbestrahlten Waldwiese ins duftende Gras legen und uns mäuschenstill verhalten. Ein überraschendes Kleintierleben entfaltet sich alsbald vor unseren erstaunten Augen. Bläulinge und Distelfalter gaukeln um die bunten Wiesenblüten, eine wie frischgewichstes Juchtenleder aussehende Wegschnecke zieht ihre glänzende Schleimspur über den Fußpfad, ein großer Laufkäfer eilt in grüngolden schimmernder Raubritterrüstung mordgierig durch das undurchdringliche Halmgewirr, fleißige Ameisen schleppen und plagen sich mit scheinbar viel zu schweren Lasten, feiste Raupen schmausen unbekümmert an saftigen Blättern, an den Halmen steigt es auf und klettert es nieder von allerlei rätselhaftem kleinem Kruppzeug und – da sind auch schon die ersten Feldheuschrecken. Gar nicht übel nehmen sie sich aus in dieser Umgebung mit ihrem steil abgestutzten Pferdekopf, den strammen Akrobatenbeinen, den muskelstrotzenden Froschschenkeln, den starren, fadenartigen Fühlern, dem weichen, seidigen Gelbbauch, der durch stoßweise Atemzüge heftig erschüttert wird. Kopfbedeckung und Frack sind malachitgrün, die Frackschöße aber braun wie Packpapier und können zu Flügeln entfaltet werden, die aber nicht viel taugen und deshalb auch nur wenig benutzt werden; der Mund ist gelblich, Augen und Knie tiefschwarz, die Schenkel hasengrau. Mit dem einen Fuß wird ein Fühler eingefangen, von unten bis oben durch den Mund gezogen und dann wieder losgelassen. Ein anderer benetzt die Tarsen der Vorder- und Mittelbeine mit Speichel, wohl um besser an glatten Halmen in die Höhe klettern zu können, denn er hört nicht eher mit dieser Beschäftigung auf, als bis die Füße fest haften. Man wird dabei unwillkürlich an die bekannte Arbeitersitte erinnert, vor festem Zupacken rasch noch in die Hände zu spucken. Ein Weibchen erhebt den Hinterleib und bäumt ihn unten im Kreis so herum, daß die Spitze der Legeröhre den Mund berührt und beleckt werden kann, bisweilen dringen eiweißartige Klümpchen aus ihr hervor, die gierig abgeleckt werden. Beim eifrigen Fressen werden öfters die Flügeldecken gehoben und wieder gefaltet, ohne daß doch ein Ton hörbar wird. Aber jetzt fängt einer der grünbefrackten Herren in seliger Verliebtheit zu musizieren an. Erst kratzen nur ein paar ziemlich mißglückte Gickser durch die sonnenzitternde Luft, aber bald kommt Ordnung in die Sache, und nun sirrt das schwirrende Heuschreckenlied über die Wiese, trotz seiner Eintönigkeit freundlich und anheimelnd wie der Ausklang eines halb vergessenen Wiegenliedes. Der Akridier stemmt dabei seine Hinterbeine gegen die inneren Flügeldecken, und bei genauem Hinsehen können wir eine feingezähnte Schenkelleiste bemerken, mit der er über eine hervorstehende Ader der Flügelfläche hinkratzt wie mit einer Feile oder einem Fiedelbogen. Der Ton ist leiser als bei den Laubheuschrecken, kaum 20 Schritte weit vernehmbar, hält aber dafür länger an und klingt mehr schwirrend, nicht so schnarrend, hauptsächlich durch die Masse des Orchesters wirkend, sehr ähnlich dem einfachen Liede eines Vogels, der nicht umsonst den Namen Heuschreckenrohrsänger trägt, aber um diese Jahreszeit schon verstummt ist. Auf einen Pulsschlag entfallen etwa zwei Töne, und sie werden sieben, bis zwanzigmal, ja dreißigmal ohne Pause wiederholt, zuletzt in etwas langsamerer Aufeinanderfolge. Dann tritt eine Pause in dem Singsang ein, und das offenbar sehr aufgeregte Tier sieht sich wie suchend nach allen Seiten um, ohne aber bei seiner Kurzsichtigkeit etwa vorhandene Weibchen zu bemerken, falls sie sich nicht schon in unmittelbarer Nähe befinden, verzweifelt beginnt es ein noch stürmischeres Geigenspiel, und nun läßt sich in der Tat eine der scheinbar gleichgültig herumspazierenden Heuschreckendamen von ihrem Wege ablenken und kommt schnurstracks auf den unermüdlichen Bewerber los.
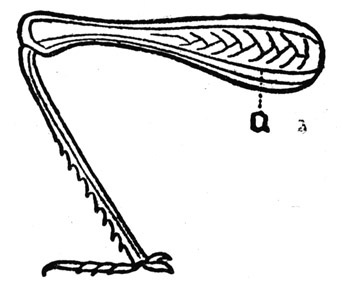
Abb. 3. Hinterbein der Feldheuschrecke.
Innenseite mit der Schrillader (
a).
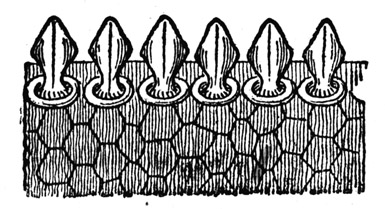
Abb. 4. Teil der Schrillader.
Wir wollen einen der glücklichen Ehemänner mit nach Hause nehmen, um mit Hilfe einer guten Lupe sein Musikinstrument noch näher zu untersuchen, wie wir schon gesehen haben, benutzt das Tier seine Hinterschenkel als Geigenbogen, indem es meist beide gleichzeitig, seltener sie abwechselnd spielen läßt. Nehmen wir ein solches Hinterbein unter die Lupe, so erkennen wir an seinem Oberschenkel auf der Innenseite eine etwas hervorragende Leiste, die mit einer großen Anzahl feinster Zähnchen besetzt ist (Abb. 3). Dies ist die sog. Schrillader. Die Zahl der Zähnchen (Abb. 4) ist je nach der Ort sehr verschieden, weshalb auch jede Spezies ihre eigene Musik macht, die sich von der der verwandten mehr oder minder unterscheidet. Bei den einzelnen Arten der Gattung Stenobothrus ( Grashüpfer) z. B. hat man 119–341 solcher Zähnchen gezählt. Aber auch individuell kommen sehr erhebliche Schwankungen vor, ja Haller fand einmal einen St. viridulus, der auf der einen Seite 98 und auf der anderen gar keine Zähnchen hatte. Neben der Schrillader buchtet sich eine ziemlich breite Schenkelrinne aus, in die beim Musizieren die eingeklappten Schienbeine gelegt werden. Der Schrillader entspricht nun an der Flügeldecke eine stark hervortretende Längsader, die durch einen chitinisierten Aufsatz die Form einer Leiste erhalten hat und im Querschnitt sphärisch dreieckig aussieht. Man nennt sie Schrillkante. Durch Auf- und Abstreichen der elastisch-beweglichen Zähnchen an dieser scharfkantigen Flügelader wird der zirpende Ton erzeugt. Bei der Gattung Tettix ( Spitzheuschrecke) sind die Flügeldecken verkümmert, und so kann der auffallend rein erklingende Singsang des Männchens nicht auf gleiche Weise hervorgebracht werden, hier streicht vielmehr der mit kammförmig zurückgebogenen Zähnchen und außerdem noch mit einer Masse kleiner Warzen versehene Hinterschenkel gegen eine seitliche Verlängerung des Halsschildes, die eine Menge kleiner, unregelmäßiger, grubenförmiger Vertiefungen enthält. In Südafrika lebt eine Gattung Pneumora, deren Hinterschenkel nicht verdickt sind, so daß diese Tiere nicht springen und nur schwach geigen können. Dafür besitzen aber die Männchen in dem zu einer großen Blase aufgetriebenen Hinterleib einen kräftigen Resonanzboden. Recht eigenartige Verhältnisse finden wir auch bei der merkwürdigen Gruppe der Klapper- oder Schnarrheuschrecken. Es sind schöne Tiere, deren Hinterflügel größtenteils lebhaft rot oder blau gefärbt sind, so daß sie im Fluge mehr an jene großen Nachtschmetterlinge erinnern, die als blaue oder rote Ordensbänder in vergangener Knabenzeit das Entzücken unserer jugendlichen Sammelwut bildeten. Möglicherweise soll durch diese Nachäffung auch ein Schmetterling vorgetäuscht werden, um solche Vögel abzuhalten, die zwar gern Heuschrecken fressen, aber aus Nachtschmetterlingen sich nichts machen. Die kleineren Arten erinnern wenigstens noch an Bläulinge und treiben sich gleich diesen mit Vorliebe auf sandigen Waldwegen herum. Wie bunte Fahnen und lustige Wimpel flattern dann ihre lebhaft gefärbten Unterflügel über den im Sonnenglast glitzernden Sandboden. So lebensvoll und kräftig diese Geschöpfe sich aber auch ausnehmen, als Geigenkünstler leisten sie doch nicht viel, sondern bringen nur sehr gedämpfte und leise Zirptöne hervor. Das rührt daher, daß sie statt der gezähnelten Schenkelader nur eine ziemlich glatte Leiste besitzen und daß die Schrillkante des Flügels zwar kuppelförmige Vorwölbungen aufweist, diese aber so plump und massig sind, daß sie keinen Wettbewerb mit den messerscharfen Spitzenleisten des Stenobrothus aushalten können. Diese Flügelader entspricht nicht genau der bei den Grashüpfern geschilderten, sondern ist viel kürzer, liegt in einem anderen Flügelfelde, entspringt nicht der Flügelwurzel und ist überhaupt keine Längsader, sondern durch Verschmelzung stark gewundener Queradern entstanden. Für das stümperhafte Geigenspiel entschädigen aber die Schnarrheuschrecken (Abb. 5) durch das lustige Geklapper, das sie beim Auffliegen (der Flug geht stets nur einige Meter weit) hören lassen, und zwar beide Geschlechter. Bei Pachytilus stridulus hat schon der treffliche Rösel von Rosenhof beschrieben, daß sie beim Fluge die Oberflügel nicht benutzt, sondern steil aufrecht hält, mit den Unterflügeln dagegen hastig auf und ab schlägt. Jedesmal nun, wenn sie mit deren stark entwickelten Adern die Oberflügel trifft, entsteht das eigenartige Klappern, das vielleicht auch dazu beitragen kann, etwaige Feinde abzuschrecken. Eine andere Art, Steteophyma grossa , streift nach Haller mit der Spitze der hinteren Schienbeine am oberen Rande der harten Flügeldecken her und schnellt sie dann jedesmal am Ende kraftvoll ab, wodurch das seltsame Knattern entsteht, das man im Sommer auf abgemähten Wiesen oft hören kann. Verfolgt man Schnarrschrecken längere Zeit, so wird das Geklapper allmählich schwächer und verstummt schließlich ganz, um nach einer gegönnten Ruhepause wieder mit alter Kraft zu erschallen. Offenbar ermüdet also diese anstrengende Tätigkeit die prächtigen Tierchen sehr.
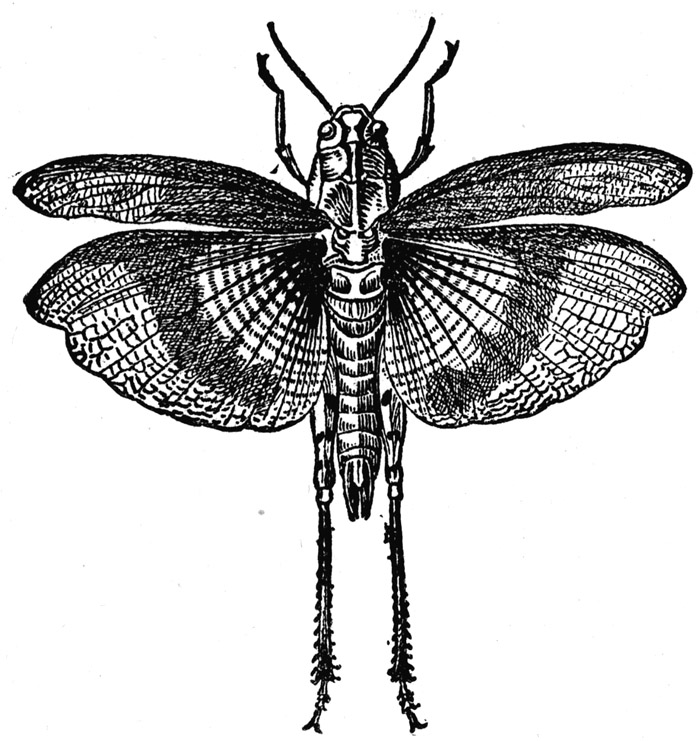
Abb. 5. Schnarrheuschrecke. ( Bryodema tuberculata.)
Die Laubheuschrecken, die sich mehr im Blätterwerk der Sträucher und Bäume aufhalten und deshalb in waldreichen Ländern, wie Brasilien, ihre zahlreichsten und prächtigsten Formen entwickeln, in waldarmen, wie Südafrika, aber ganz zurücktreten, musizieren auf andere Weise, und zwar ganz so wie die Grillen. Beide bringen ihre abgebrochenen Zirplaute dadurch hervor, daß sie ihre Vorderflügel, die sich im Ruhezustand decken, aneinander reiben. Eine starke Ader an der Basis des oben liegenden Flügels (bei Laubheuschrecken ist es der rechte, bei Grillen der linke) ist auf der Unterseite mit zähnchenartigen Platten besetzt und so zur Schrillader geworden, die auf der Schrillkante des unten liegenden Flügels hin und her streicht. Das laute »Zick zick«, das man im Hochsommer von Büschen und Bäumen am Feldrande erschallen hört, rührt meist von Locusta viridissima her, dem großen grünen Heupferd (Abb. 6), das aber seiner hellgrünen Färbung wegen schwer zu entdecken ist und dessen lange Fühler tatsächlich anmuten wie die verhängten Zügel eines Pferdchens. Das Streichen mit der gerillten Feile des einen Flügels auf der scharfkantigen Leiste des anderen vollzieht sich etwa so, als ob man die Zähne eines Kammes über die Tischkante schnarren ließe. Das an sich schwache Geräusch wird durch das Mitschwingen eines zarten, fast kreisförmigen Hautabschnittes der rechten Flügeldecke wesentlich verstärkt. Da dieser Hautabschnitt von kräftigen Adern gespannt erhalten wird, stellt er einen guten Resonanzboden dar, gewissermaßen ein winziges Tamburin. Die lauchgrüne Locusta cantans , die sich mehr in der Mitte der Sträucher als auf ihrer Spitze aufhält und beim Volke »Erntevogel« heißt, weil sie hauptsächlich zur Erntezeit »singt«, ist noch schwerer zu beobachten, denn sie zeigt sich sehr scheu, bemerkt die Annäherung eines Menschen schon von weitem und verstummt dann sofort. Ihr Zirpen ertönt besonders beim Aufgang und Untergang der Sonne und hält oft endlos an. Die Töne folgen nach den Feststellungen Wanckels schnell aufeinander, vier bis fünf auf einen Pulsschlag, und deshalb sind die einzelnen Laute viel weniger leicht zu unterscheiden. Auch ist ihre Stärke nicht immer gleich, sondern bisweilen schwellen sie auffallend an und nehmen wieder ab, und besonders wenn das Männchen in Hitze gerät, setzt ein plötzliches Krescendo und Forte ein. Nach zwei bis vier Takten, deren jeder 4/ 16 Noten enthält, folgt ein etwas höher gedehnter Ton und dann eine Pause, worauf das Gezirpe von neuem beginnt. Gegen Abend pflegen die Tonreihen länger zu werden und in der Nacht sehr lang, oft minutenlang anhaltend, ohne daß doch größere Pausen einträten. Der Klang beginnt mit einem rr, dem ein scharfes ss mit verstärktem ü-Laut folgt. Beide Töne tremulieren nebeneinander fort und sind doch innig verschmolzen. Gefangene Heuschrecken dieser Art blieben bei kühlem Wetter ziemlich stumm, aber bei warmem wurde ihr Getöse im Zimmer so stark, daß empfindlichere Personen Kopfschmerzen davon bekamen.
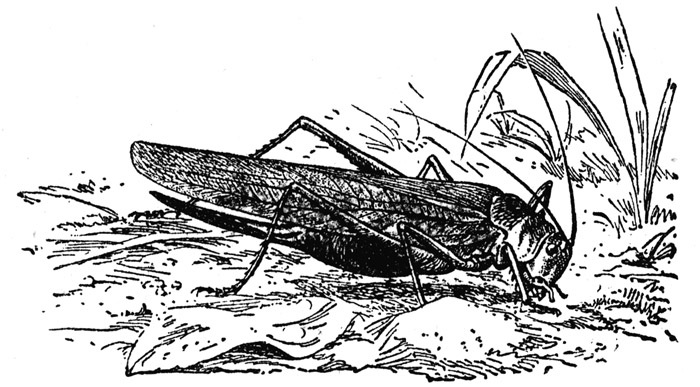
Abb. 6. Grünes Heupferd. ( Locusta viridissima.)
Die Oberflügel zirpender Feldgrillen bewegen sich nach Hesse-Doflein in einer Sekunde sechs- bis achtmal hin und her, und da beide Flügel gleichzeitig in Tätigkeit gesetzt werden, ist die Geschwindigkeit doppelt so groß. Die Verhältnisse liegen also so, daß die Schrillkanten 32mal in der Sekunde über die 131 bis 138 Zähnchen der ruhenden Schrillader hinweggeführt werden. Das gäbe einen Ton von 131x32 = 4192 Schwingungen, was mit der beobachteten Tonhöhe (c 5) gut übereinstimmt. Der an sich schwache Sington der Grillen wird durch vier in die Flügeldecken eingelassene, sehr resonanzfähige Trommelfelle derart verstärkt, daß er über 100 m weit zu hören ist. Im allgemeinen liegen alle diese Insektentöne sehr hoch, oft so hoch, daß sie vom menschlichen Ohr überhaupt nicht mehr vernommen werden können, aber so verzweifelt eintönig sie uns auch erscheinen mögen, die Tiere selbst wissen doch die verschiedensten Abtönungen und Gefühlsäußerungen nicht nur hineinzulegen, sondern auch zu verstehen. Das Männchen zirpt, wie Professor Regen ausgezeichnet hat, sein hohes, schrilles rrr in der Sekunde zweimal. Jeder dieser Zirplaute dauert nur ⅕ Sekunde, aber trotz dieser Kürze ist jeder einzelne in vier deutlich unterscheidbare Schwingungen eingeteilt, ja jede dieser Schwingungen zeigt wieder zwei Entwicklungsstufen, nämlich ein An- und ein Abschwellen, mit der Betonung auf der ersten Stufe. Zwischen je zwei solcher Betonungen vergeht nach Radestock genau 1/ 20 Sekunde. Die Tonzusammensetzung geschieht bei den Grillen nach der Meinung dieser Beobachter mit bewußt unterscheidender Absicht, und namentlich die öfters eingeschobenen scharf zwitschernden oder katzenähnlich schnurrenden Töne haben ihre besondere Bedeutung. Eine italienische Grillenart soll sich sogar zu bewußten Täuschungskünsten versteigen, will man nämlich so ein fortwährend zirpendes, aber überaus ängstliches und vorsichtiges Tierchen auf seinem Busch suchen, so verstummt es nicht etwa, sondern es zirpt einfach weiter und bleibt ruhig sitzen, klappt aber die beim gewöhnlichen Zirpen hoch aufgerichteten Flügeldecken herunter und erweckt durch die damit bewirkte Schalldämpfung den Eindruck, als säße es jetzt weiter entfernt auf einem andern Platz. Schon so mancher gewiegte Beobachter ist auf diese List der pfiffigen Grille hineingefallen. Der bekannte Tierstimmenkenner Cornel Schmitt erwähnt, daß die Grillenmännchen außer ihrem gewöhnlichen Zirpen auch noch ein anderes, ganz leises, nur auf wenige Schritte vernehmbares Geräusch hervorbringen, das dem Knistern von Stroh vergleichbar ist und eine stärkere Erregung des Tieres ankündigt. Die Grillen können also durch ihr Getöne verschiedenen Stimmungen und Gefühlen Ausdruck geben, haben also demgemäß schon eine Art Sprache. Professor Regen hat durch Versuche mit Feldgrillen festgestellt, daß ihre Musik durch das Telephon übertragbar ist und auch in diesem Falle von den Artgenossen sehr wohl verstanden wird. Nur durfte man kein zu starkes Telephon verwenden. Also scheinen diese Tiere ein sehr feines und empfindliches Gehör zu haben.
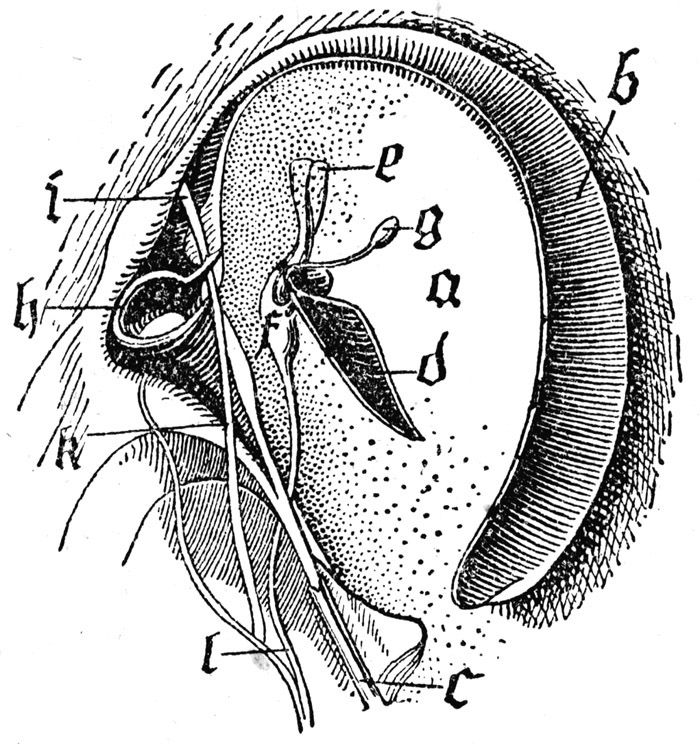
Abb. 7a. Gehörorgan der Heuschrecken nach V. Graber. (Innenseite.)
a Trommelfell.
b Einfassung des Trommelfells,
c Spannmuskel desselben,
d, e die beiden Verdickungen auf der Innenseite des Trommelfells,
f Endnervenknoten,
g birnförmiges Körperchen.
h Stigma.
i Öffnungs-,
k Schließmuskel.
l Gehörnerv.
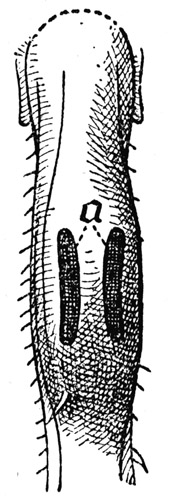
Abb. 7b. Gehörgang der Heuschrecken.
Oberer Teil der Vorderschiene,
a Spalten, die zum Gehörorgan fuhren.
Es ist ja klar, daß, wenn die ganze Geigerei der männlichen Geradflügler zur Betörung der Weibchen überhaupt einen Zweck haben sollen, diese doch einen gut entwickelten Gehörsinn besitzen müssen, um die ihnen gebrachten Ständchen auch würdigen zu können. In der Tat ist ein Gehörsinn vorhanden, und er scheint – wenigstens bei den Grillen – im weiblichen Geschlecht besser entwickelt zu sein als im männlichen. Schmitt neigt sogar der Ansicht zu, daß die männlichen Grillen überhaupt nicht hören, weil sie beim Zirpen lautes Singen, Geigenspiel, Pfeifen, Trompeten und selbst Pistolenschüsse vollkommen überhörten, vielleicht liegt gar eine Art Balztaubheit vor, wie beim schleifenden Auerhahn! Hochinteressant ist diese Frage gewiß, zumal regelrecht gebaute Gehörorgane sonst bei Insekten bisher kaum nachgewiesen werden konnten. Leider sind wir aber noch weit davon entfernt, über die Sache ganz im Klaren zu sein, denn die Forschung hat sich hier trotz schöner Einzelerfolge eigentlich in einem richtigen Kreislauf bewegt und steht heute wieder so ziemlich am Ausgangspunkt. Hören müssen die Tiere ja wohl, sogar recht gut, aber wo haben sie ihre Ohren? Es lag nahe, diese am Kopfe zu suchen oder an den Fühlern, die bei akustischen Reizen oft in zitternde Bewegung geraten, aber man konnte da durchaus nichts finden, trotz tausendfacher sorgsamster Zergliederung. Wer sollte auch auf die Vermutung kommen, daß es Tiere gäbe, deren Ohren an den Schienbeinen oder am Hinterleibe säßen! Burmeister, der berühmte Erforscher der brasilianischen Tierwelt, war wohl der erste, der die » tympanalen Sinnesorgane« bei Grillen und Heuschrecken erwähnte und ihr Vorhandensein feststellte, und Siebold hat dann diese Organe bei den Schnarrheuschrecken genau untersucht und beschrieben. Beiderseits des etwas angeschwollenen Abschnitts unter dem Knie der vorderen Tibia fand er in einer flachen Vertiefung einen ovalen Schlitz, der von einer trommelfellartigen Membran verschlossen war (Abb. 7). Schon äußerlich fallen diese Organe auch dem schärfer beobachtenden Laien auf als leicht sichtbare, bestimmt gefärbte und umgrenzte Felder auf beiden Seiten der Vorderschienen, hier sitzen sie wenigstens bei den Laubheuschrecken und Grillen, bei den Grasheuschrecken dagegen an den Seiten des ersten Hinterleibsringes, der trotz seiner starren Verbindung mit dem Bruststück an den Atembewegungen des Hinterleibs teilnimmt. Auch in Bau und Anlage zeigt sich manche Verschiedenheit, während die zur Übermittlung dienenden Sinneszellen selbst in ihren feinsten histologischen Einzelheiten weitgehend übereinstimmen. Im allgemeinen kann man sagen, daß die auf die trommelfellartigen Tympanalorgane auftreffenden Tonwellen durch einen kleinen Schlauch zu den im Hintergrunde wie Orgelpfeifen der Größe nach angeordneten winzigen Hörstiftchen geleitet und schließlich durch besondere Nerven dem Gehirn übermittelt werden. Regen ist der Ansicht, daß jedes dieser Stiftchen je nach seiner Größe einen ganz bestimmten, höheren oder tieferen Ton wiedergibt. Die Bezeichnung »Tympanalorgan« rührt von Graber her, der darunter ein Chorodontalorgan verstanden wissen wollte, das mit einem Tracheenstamm oder einer Tracheenblase derart in Verbindung getreten ist, daß ein solcher Luftbehälter die Schwingungen des Organs beeinflussen kann. Diese Wirkung braucht nicht unmittelbar zu sein, sondern es kann sich nach Demoll auch mittelbar darum handeln, durch Rückdrängen flüssiger oder plasmatischer Bestandteile aus der Umgebung des Sinnesorgans ein möglichst genaues Mitschwingen bei Erschütterungen zu gewährleisten, vielleicht war dies sogar die ursprünglichere Beziehung zwischen Tracheenstämmen und Sinnesorganen, und erst später wurden sekundär hier und da die Resonanzwirkungen durch ein unmittelbares Aufsetzen des Nervenapparates auf die Wand der Tracheen ausgenutzt.
Wir finden solche Tympanalorgane bei allen Geradflüglern, die Werkzeuge zur Hervorbringung von Tönen besitzen, aber sie sind auffallenderweise doch nicht auf die musizierenden Arten beschränkt. Die umschriebenen Felder offenbaren sich bei näherer Betrachtung als stark verdünnte Stellen der Oberhaut, die wie Trommelfelle (Tympana) in einem stark verdickten Rahmen aufgespannt sind. Bei den Grillen liegen sie meist ziemlich offen zutage, während sie bei den Heuschrecken tiefer gebettet und von einem schützenden Wulst überlagert sind. Jedes Trommelfell besteht nach Graber aus zwei Teilen: einem dünn-elastischen, silberig glänzenden Häutchen, das mit Ausnahme des Vorderrandes vom ganzen Umfang der ovalen Öffnung entspringt und nach vorne einen halbmondförmigen Ausschnitt frei läßt, und aus einem, diesen Ausschnitt ausfüllenden, schwarzbraunen, hornigen Gefüge. »Die Trachee ist unter dem Trommelfell eine Strecke weit gespalten und bekommt durch die Spaltwand eine erhöhte Festigkeit; ihr liegen die nervösen Endapparate des Organs, die sog. Endschläuche, in zwei oder drei Gruppen auf. Der Hauptbestandteil jedes Endschlauches ist die Sinneszelle, die in ihrem mittleren Teil von einer sog. Hüllzelle umgeben ist und ihre distalen Abschnitte in der Kopfzelle birgt, durch die sie in der Kutikula (Häutchen) befestigt und in einer gewissen Spannung erhalten wird. Die Sinneszelle setzt sich auf der einen Seite in die Nervenfaser fort, und am anderen Ende trägt sie ein charakteristisches Endorgan, den sog. Stift, der in einer gerippten Hauthülle den Endknopf der Nervenfibrille birgt. Diese Nervenfibrille durchzieht die Zelle, splittert in der Gegend des Kernes zu dünneren Fibrillen auf und geht dann wieder als einheitliches Gebilde in die Nervenfaser ein.« (Hesse-Doflein.)
Die seltsame Sage dieser fein entwickelten Gehörorgane muß aber stutzig machen, was schon Siebold empfunden hat. Die Fachleute sahen eben lange Zeit hindurch die Tympanalorgane einfach als Ohren an, ohne sich über ihre Funktion weiter den Kopf zu zerbrechen. Graber ist nun anderer Ansicht. Freilich weiß auch er nicht, welche Aufgabe den Tympanalorganen eigentlich zukommt, glaubt aber beweisen zu können, daß sie entweder nicht die eigentlichen Gehörorgane sind oder, wenn dies doch der Fall sein sollte, daß für den gleichen Zweck vermutlich noch andere akustische Apparate vorhanden sein müssen. Schon v. Brunner wollte die Bedeutung jener auf die Vernehmung des Rufes der zirpenden Männchen eingeschränkt wissen, wobei dann freilich die Frage offen bleibt, was die Tympanalorgane bei solchen Arten sollen, deren Männchen sich durchaus stumm verhalten. Freilich könnte der Fall auch so liegen, daß die Tiere zwar musizieren, die menschlichen Sinnesorgane aber nicht ausreichen, diese Töne zu vernehmen. Wo bei derartigen Formen aber die Tympanalorgane nicht zur Entwicklung gekommen sind, müßten die Tiere taub sein. Sie sind aber in Wahrheit gegen Töne und Geräusche der verschiedensten Art sogar recht empfindlich, und daraus folgert Graber, daß noch weitere Gehöreinrichtungen vorhanden sein müssen. Wenn das Tympanalorgan also überhaupt akustischer Natur ist, wird es nach dem Grundsatze der Arbeitsteilung eine besondere Spezialfunktion übernommen haben. Dafür spricht auch die Beobachtung der Tiere selbst, die sich allerdings in freier Natur schwer durchführen läßt, weshalb Graber sich an im Zimmer gekäfigte Feldgrillen gehalten hat. Seine zahlreichen, z. T. allerdings recht grausamen Versuche hatten folgendes Ergebnis: Die Grille reagiert auf sehr verschiedene Geräusche, aber nur, wenn diese eine gewisse Stärke haben, wenn die Schallquelle nicht zu weit entfernt ist und nicht zu vielerlei Schallschwingungen gleichzeitig auf das Tier einwirken, während der Nacht hören die Tiere besser als am Tage. Sehr starke Geräusche, namentlich solche gellender und kreischender Art, erregen offenbar schmerzhafte Empfindungen, da die Tiere sich dann ganz wild gebärden, in die Höhe springen, sich überkugeln, an allen Gliedern zittern usw. Die Erregbarkeit für Schallempfindungen wird durch die Abtrennung des Tympanalorgans durchaus nicht vernichtet, sondern bleibt völlig unverändert, wenigstens soweit man aus den Reflexwirkungen folgern darf. Die Schallempfindung durch den Tympanalapparat wurde namentlich deutlich gegenüber ziemlich leisen, aber hohen Tönen der Violine, die den von den Tieren selbst erzeugten Lauten ähnlich waren. Die Grille unterscheidet mit diesem Organ offenbar nicht nur die Stärke des Tons, sondern auch seine Höhe, was deutlich zutage trat, wenn man ihnen auf der Violine die Tonleiter vorspielte. Auf das Zirpen ihrer Artgenossen reagierten die Grillen auch dann noch, wenn ihnen die Vorderbeine ganz abgeschnitten waren. Graber hält es deshalb für wahrscheinlich, daß der eigentliche Sitz der Schallempfindung am Kopf liegt und daß auch die Fühler dabei eine Rolle spielen, wenigstens im Sinne der Aufsaugung und Weitergabe von Schallwellen. In freier Natur scheinen die Tiere das geringste Geräusch wahrzunehmen, namentlich das leiseste Rascheln im Grase oder Laub. Auch Rudow kam durch praktische Beobachtung zu der Ansicht, daß nicht die Tympanalorgane, sondern die Fühler die eigentlichen Gehörwerkzeuge sind. Amputierte er die Fühler, so blieben die Tiere gegen das Zirpen ihrer Artgenossen gleichgültig. Und doch! Es ist unleugbar, daß die Struktur der Tympanalorgane auf einen Gehörapparat hinweist, der geradezu das höchste und vollkommenste ist, was die Insekten ihrem ganzen Leibesbau nach überhaupt an akustischen Apparaten hervorbringen konnten. Man könnte also vielleicht daran denken, daß diese wunderbaren Organe insbesondere die feineren Klangempfindungen des Gezirps übermitteln, die es von dem der verwandten Arten entscheiden. Bedenklich dabei ist nur, daß dann diese Tiere gewissermaßen zweierlei verschiedene Ohren hätten, die noch dazu an ganz verschiedenen Körperteilen untergebracht wären, hier hat also künftige Forschung noch viele Rätsel zu lösen.
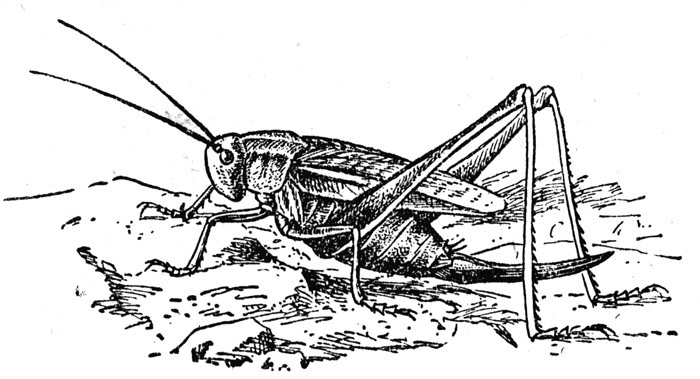
Abb. 8. Warzenbeißer. ( Decticus verrucivorus.)
Auch unsere einheimischen Heuschrecken treten gelegentlich als Schädiger der Kulturpflanzen auf, obschon sie sich glücklicherweise niemals zu so großen Massen zusammenrotten wie die Wanderheuschrecken. So macht sich z. B. der Warzenbeißer ( Decticus verrucivorus, Abb. 8) öfters in den Getreidefeldern unliebsam bemerkbar, selbst in Weinbergen, wo er Knospen und Triebe benagt, Blätter anfrißt und an den Beeren nascht. Das Heupferd ( Locusta viridissima) kann in den jungen Forstpflanzungen empfindlichen Schaden anrichten und durch seine Tätigkeit zahlreiche Stämmchen zum Absterben bringen. Selbst die sonst ziemlich harmlose Feldgrille wird aus ähnlichen Gründen vom Forstmann nicht gern gesehen, der ihr eine besondere Vorliebe für junge Eichens und Buchenpflanzen nachsagt. Das Heupferd ist übrigens kein so großer Sonnenfreund wie seine Verwandten, sondern hält sich lieber im Schatten auf; wenn ihm durch die Ernte die Felder genommen werden, geht es in die Bäume, oft hoch in die Wipfel und läßt von dieser Warte aus namentlich in den Abendstunden fleißig sein Zirpen hören. Im Mittelalter und zu Zeiten der Hungersnot hat man auch bei uns Heuschrecken als Nahrungsmittel verwendet, aber so recht in Aufnahme gekommen sind sie als solches doch nie. Zwar behauptet der englische Naturforscher Sheppard, der sich der Wissenschaft halber Graspferde in Butter braten ließ, daß sie sehr wohlschmeckend seien, aber er wird sie trotzdem schwerlich als ständiges Gericht auf seinem Familientische eingeführt haben. Eigentlich ist es ja merkwürdig, daß der Kulturmensch gegen den Genuß von Kerbtieren einen so starken und allgemeinen Widerwillen hegt. Krebse sind doch wahrhaftig auch nicht schöner und Austern erst recht nicht, und trotzdem opfert man für sie gern erhebliche Beträge.
Eine besonders interessante Art ist die Sattelheuschrecke (Ephippigera vitium), eigentlich ein Südländer, der aber auch in milderen Lagen Südwestdeutschlands seit jeher eine ganz gewöhnliche Erscheinung (sie wurde also keineswegs von W. Schuster bei Mainz »entdeckt«) und sogar dem Volke als »Herbstmorke« wohl bekannt ist; »Morke« bedeutet nämlich in diesen Gegenden so viel wie »Schweinchen«, und »Herbstmorke« ist ein Ehrentitel für die bei der Weinlese nicht gerade vor Sauberkeit strahlenden Winzerinnen. Die Sattelheuschrecke ist tatsächlich ein Herbsttier, denn hauptsächlich ertönt ihr Singsang im September, und sie ist so wenig empfindlich gegen rauhe Witterung, daß sie auch nach den kältesten Oktobernächten noch munter herumläuft und zirpt, wenn alles andere Insektenleben längst erstarrt ist. Mit ihrem etwas metallisch klingenden »Gesang« ist es freilich nicht weit her, und er erschallt auch nur recht leise in rasch aufeinanderfolgenden Doppeltönen. Ihr Lieblingsaufenthalt sind warme, trockene Kiefernwälder, zu deren dunkelgrüner Färbung auch ihre eigene Körperfarbe am besten paßt. Sie benagt aber nur im äußersten Notfall die bitteren Kiefernadeln und hält sich lieber an weichere und schmackhaftere Kost, namentlich an junges Laub und Gras, ohne tierische Stoffe völlig zu verschmähen. Von unnützer Bewegung ist diese Heuschrecke kein Freund, sondern sitzt am liebsten still, putzt sich die Mandibeln oder beleckt die Fußklauen. Ihr Sprungvermögen ist nur gering entwickelt. In der Mittagshitze pflegen diese Tiere zu verstummen, musizieren aber um so fleißiger in den Morgen- und Abendstunden, wobei sie sich gegenseitig antworten. Öfters findet man nach W. Schuster Weibchen, die noch den Spermatophor anhängen haben. Dieser ist anfangs milchweiß und von der erstaunlichen Größe einer kleinen Haselnuß, schrumpft aber vor dem nach acht Tagen erfolgenden Abfallen stark zusammen und sieht dann bernsteingelb aus. Bei der Begattung dieser Tiere wie auch anderer Laubheuschrecken kommt es nämlich nicht zu einem Besteigen und zu einer Vereinigung der Geschlechter, sondern Männchen und Weibchen sitzen einander parallel auf dicht benachbarten Zweigen, das eine mit dem Kopfe nach oben, das andere umgekehrt. Nur die Hinterleibspitzen nähern sich, bis das Männchen mit seinen Raifen den Hinterleib des Weibchens packen kann. Jetzt tritt der Samen aus, schwillt zu dem kapselförmigen Spermatophor an und wird vom Männchen an der Geschlechtsöffnung des Weibchens befestigt. Ein hübsches Gegenstück zur Sattelheuschrecke ist die durch abenteuerlich lange Beine und Fühler ausgezeichnete Saga serrata (Abb. 9), eine südeuropäische aber vereinzelt auch bei Wien vorkommende Raubheuschrecke, die seltsamerweise in Italien fehlt. Bei Wien wurden bisher immer nur Weibchen gefunden, und die Fortpflanzung im Herbste erfolgt deshalb nach Werner auf dem Wege der Jungfernzeugung. Also ein »Mädchen aus der Fremde« im wahrsten Sinne des Wortes! Selbst die Höhlen und Grotten des Karstes werden von Heuschrecken (Phalangopsis clavicola) bevölkert, die zwar sehr langbeinig sind, aber keine Flügel haben. Solche Höhlenheuschrecken erinnern an die in Ameisenhaufen vorkommenden Arten, haben aber zurückgebildete Augen wie ja auch die höhlenbewohnenden Käfer, Spinnen, Asseln, Tausendfüßer und Schnecken. In den Tropen gibt es auch viele prachtvoll gefärbte Heuschreckenarten, während bei uns die im Laub oder Gras lebenden Formen mehr oder minder grün, die bodenständigen dagegen braun oder grau gefärbt zu sein pflegen wie die Erde.
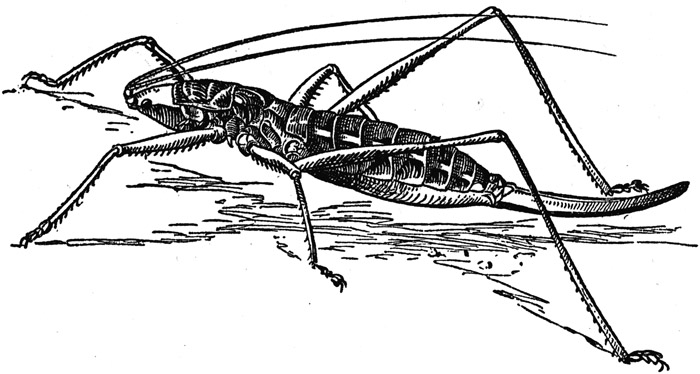
Abb. 9. Südeuropäische Raubheuschrecke. (Saga serrata.)
Die grüne Färbung der Heuschrecken ist nach Leydig auf die Anwesenheit eines durch Lösungsmittel leicht zersetzbaren Chlorophylls zurückzuführen, das aber mit dem Vorrücken der Jahreszeit einen absterbenden, mehr bräunlichen Ton annimmt, wie die Blätter der Bäume. Die Färbung der Chitinhaut ist oft ganz anders als die der untergelagerten Hypodermis. Dies ist nach Graber z. B. bei Laubheuschrecken und Feldgrillen der Fall, deren Hypodermis braun oder rot gefärbt ist, während die äußerlich ganz grüne oder schwarze Färbung teils durch die Lichtbrechung, teils durch die Eigenfarbe der darübergelagerten Chitinhaut zustandekommt. Weitgehende Anpassungserscheinungen bei der Färbung sind auch im Heuschreckenreiche häufig. So hat Vosseler bei den Heuschrecken der algerischen Sahara gefunden, daß die gleiche Art je nach Farbe und Beschaffenheit des Untergrundes, auf dem sie lebt, ganz verschieden gefärbt und gezeichnet sein kann. Auf gleichmäßigem Sandboden erscheint sie z. B. gelbbraun, bekommt aber unregelmäßige graue und braune Fleckung und Zeichnung auf gelblichem Untergrunde, sobald der Sand des Aufenthaltsortes mit Kies und Steinen untermischt ist. Die Fähigkeit zur Farbenveränderung ist aber nur unmittelbar nach der Häutung vorhanden und verschwindet, sobald die neue Haut erhärtet ist. Vosseler denkt dabei an eine Art von Farbenphotographie. Auch der Afrikareisende Zittl berichtet aus der Libyschen Wüste, daß auf braunem Wüstensande stets braune Heuschrecken angetroffen wurden, im eigentlichen Sandmeere stets gelbliche. Ähnliches läßt sich selbst bei unseren einheimischen Formen beobachten, wenn auch nicht in so auffälligem Maße. Bei den Larven gewisser Gespenstheuschrecken von Borneo fand Shelford diese merkwürdige Erscheinung noch viel ausgeprägter, indem diese Tiere alle möglichen Blumenarten, zwischen denen sie saßen, in der Färbung täuschend kopierten. Ja, unmittelbar nach der Häutung wurden die Larven sogar so weiß wie Papier, wenn man sie zwang, auf solchem zu sitzen. Ebenso kennen wir bei Heuschrecken eine ganze Reihe der merkwürdigsten Mimikry-Erscheinungen. So lebt in Argentinien eine Heuschrecke ( Rhomalea speciosa) in Gegenden, wo eine sehr stechlustige und in der Erregung einen widerlichen Geruch ausströmende Wespenart häufig ist, deren Leib stahlblau und purpurn schimmert, während die Flügel grellrot aufleuchten. Die sitzende Heuschrecke sieht unansehnlich aus und ist leidlich geschützt, aber im Fluge zeigt auch sie knallrote Hinterflügel und einen metallisch gleißenden Hinterleib, erinnert also stark an die ungemütliche Wespe, zumal sie ebenso langsam fliegt und sich ebenso furchtlos gebürdet wie diese. Ja, die eingefangene Heuschrecke biegt sogar nach Wespenart den Hinterleib herum, als wolle sie stechen, obwohl sie doch natürlich gar keinen Stachel besitzt. Vosseler hat in Deutsch-Ostafrika eine Heuschreckenart beobachtet, deren Larve man schon längst kannte und in der irrigen Meinung, eine ausgewachsene, aber ungeflügelte Form vor sich zu haben, als eigene Art beschrieben hat. Sie erhielt dabei den Namen Myrmeca nophana wegen ihrer verblüffenden Ähnlichkeit mit einer schwarzen Ameise (Abb. 10). Dreieckige helle Flecke an den Leibesseiten täuschen sogar die eng eingeschnürten Ameisentaille vor. Noch merkwürdiger ist aber das Benehmen des Tieres, das sich viel unruhiger und beweglicher gibt, als es sonst Heuschreckenart ist, und munter im grellsten Sonnenlicht zwischen den Ameisen herumspaziert. Wenn aber die Heuschrecke erwachsen ist (nun heißt sie Eurycorypha varia) und ihre breiten grünen Flügel bekommen hat, die ihr täuschende Ähnlichkeit mit einem Blatt verleihen, legt sie diese seltsame Regsamkeit gänzlich ab und nimmt eine stillbeschauliche Lebensweise an, die ihr in dem neuen Kleide ja am vorteilhaftesten sein wird. Bei Gefahr stellt sie sich tot. Mit Recht bezeichnen Hesse und Doflein diesen genau beobachteten Fall als »ein außerordentlich klares Beispiel für den engen Zusammenhang, den die instinktiven Gewohnheiten des geschützten Tieres zu seinem äußeren Ansehen haben müssen, wenn aus jener Ähnlichkeit überhaupt ein Nutzen erwachsen soll«. Es gibt auch Grillen, die gewissen Ameisen sehr ähnlich sehen, so Phylloscirtus macilentus aus Paraguay, die Fiebrig näher untersucht hat, ohne freilich sicher feststellen zu können, welcherlei Vorteile beiden Tieren aus ihrem Zusammenleben erwachsen. Die Ameisenähnlichkeit der Grille wird namentlich hervorgerufen durch den scharf abgesetzten, frei beweglichen, auffallend geformten und großen Kopf, durch die eigenartige Form des Bruststücks und durch die Verkümmerung der Flügel. Auch hier entspricht die Lebensweise dem Aussehen, denn die Grille hält sich an Orten auf, die stark von Ameisen besucht werden, namentlich von einer ähnlich aussehenden Art.
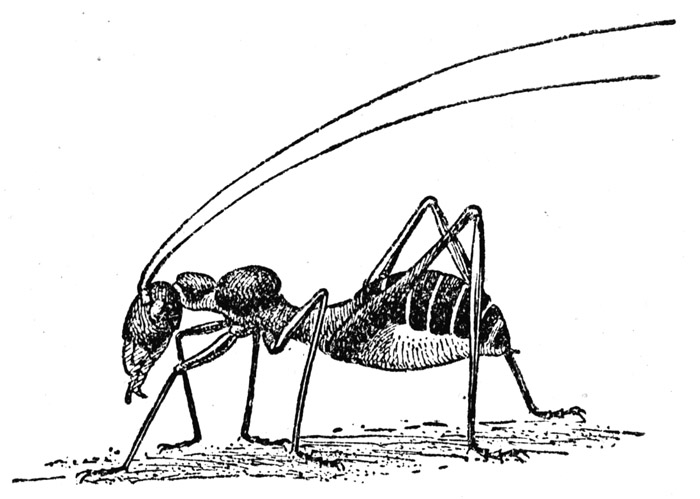
Abb. 10.
Eurycorypha varis im Larvenzustande.
Nach Doflein.
Die großartigsten Anpassungserscheinungen finden wir aber in der fast märchenhaft anmutenden Gruppe der Gespenstheuschrecken, deren flügellose Formen selbst für ein scharfes Auge kaum von einem dünnen Ästchen zu unterscheiden sind, während die geflügelten in ganz verblüffender Weise Gestalt und Färbung eines Blattes bis in die feinsten Einzelheiten hinein nachahmen. Bei beiden wird die Täuschung noch durch ihre stillsitzende, nächtliche Lebensweise erhöht, die so sehr jeder Aufregung bar ist, daß man diese Geschöpfe geradezu als die Faultiere unter den Kerfen bezeichnen könnte. Nur höchst ungern wechseln sie bei Tage ihren Platz, und bei Gefahr stellen sie sich lieber tot, was auch das klügste ist. das sie tun können. Nur bei ihren nächtlichen Schmausereien sind sie nicht faul, zeigen sich vielmehr als sehr gefräßig, und bei ihrer beschaulichen Lebensweise ist es für den Kundigen von vornherein klar, daß sie nur Pflanzenfresser sein können. Die sog. Wandelnden Blätter ( Phyllium, Abb. 11) sind im wesentlichen auf die Tropen beschränkt und namentlich in Indien großartig entwickelt. Ihre wunderbare Ähnlichkeit mit Blättern hat die Bewohner Surinams zu dem Glauben veranlaßt, daß diese Tiere als Blätter auf den Bäumen wachsen, dann herabfallen, herumkriechen und endlich fliegen lernen. Andere wilde Völker glauben umgekehrt, daß die Gespenstheuschrecken sich allmählich in Pflanzen verwandeln, indem sie auf den Boden herabkommen und hier ihre Füße einstemmen, die nun anfangen, bei Feuchtigkeit Wurzeln zu treiben. Zu verwundern sind solche naiven Ansichten nicht, denn die Blattähnlichkeit dieser Insekten ist in der Tat ganz vollkommen, indem auch die Blattnervatur genau nachgeahmt wird, bei manchen Arten sogar Faul-, Welk- und Schmutzstellen, Beschädigungen, Pilzhäufchen u. dgl., wie sie überall im Pflanzenreiche vorkommen. Nicht nur die Flügeldecken tragen zur Erzielung der Blattähnlichkeit bei, sondern auch noch flache Auswüchse an den Beinen, Hals und Kopf. So abenteuerlich können diese gestaltet und so bunt gefärbt sein, daß statt eines Blattes eine Blume vorgetäuscht wird. Man kennt aus Borneo und Südostasien Formen aus der Gruppe der Empusiden, die lebhaft an gewisse Orchideen erinnern. Solche Tiere sitzen zwischen den Blattrispen einer bestimmten Orchideenart und suchen hier nach Hesse-Doflein stets die lebhaft rot gefärbte Blüten tragenden Zweige auf, während die nur beblätterten Zweige vermieden werden. Ich selbst ruhte einmal auf der aphroditischen Insel Zypern an einem glühend heißen Tage nach anstrengender Vogeljagd auf einer freundlichen Rasenmatte aus, die von roten Kleeblüten durchstickt war. Während ich so vor mich hinträumte, gewann plötzlich eine der Kleeblüten neben mir Leben und Bewegung, und als ich näher hinsah, war es eine – Heuschrecke! Sie wanderte in das Sammelglas meines Begleiters, eines Berliner Entomologen, und ich habe später leider nichts mehr darüber gehört, welcher Art das merkwürdige Geschöpf angehörte, oder ob es nicht überhaupt eine neue Form vorstellte.
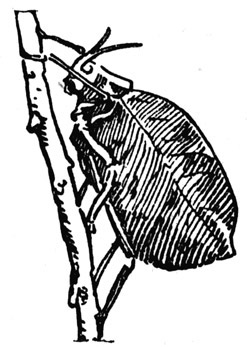
Abb. 11. Wandelndes Blatt. ( Phyllium.)
In ähnlich vollendeter Weise, wenn auch nach einer ganz anderen Richtung hin, ist die Nachäffung bei den Stabheuschrecken (Abb. 12) ausgebildet. Auch sie sind hauptsächlich Kinder der Tropen, wo Riesenformen von 20 cm Rumpflänge vorkommen, finden sich aber auch schon in Südeuropa, und eine Art ( Bacillus rossii) sogar in einigen milden Gegenden Deutschlands, z. B. bei Freiburg i. Br. Eine ostindische Art ( Dixippus morosus) ist mit Topfpflanzen in unsere Gewächshäuser eingeschleppt worden und hier schwer wieder auszurotten, da sie mühelos die glattesten Stämme und selbst Glaswände ersteigt und mit bewundernswertem Instinkt als Ruheplätzchen sich immer solche Stellen auswählt, wo ihr ihre großartige Mimikry am meisten zustatten kommt. Ein angenehmer Gast ist das an sich so interessante Tier nicht, denn bei der verschwenderisch gedeckten Tafel eines Gewächshauses paart sich ihre natürliche Gefräßigkeit bald mit Näscherei und Schleckerhaftigkeit, so daß sie an wertvollen Blattpflanzen recht empfindlichen Schaden anrichtet. Der Angriff auf die Blätter erfolgt stets vom Blattrande aus, wo an vielen Stellen halbkreisförmige Stücke herausgefressen werden (Abb. 13). Der Name der Stabheuschrecke, die der Unkundige, wenn er sie zum erstenmal sieht, überhaupt kaum für ein Tier halten möchte, solange sie sich nicht bewegt, ist kennzeichnend für diese sonderbaren Gesellen: ein langer, stabförmiger Leib, gefärbt wie ein Strauchzweig, wie dieser öfters mit Höckern oder Rinnen versehen, vorn ein gar nicht leicht zu erkennenden Kopf mit kräftigen Freßwerkzeugen und an dem überschlanken Gespensterleib sechs lange Spinnenbeine von unheimlicher Gelenkigkeit. Sie tasten beim Herumkriechen – fliegen oder auch nur hüpfen kann das Tier ja nicht – wie Windmühlenflügel in der Luft herum, und auch in der Ruhe werden sie nicht in der sonst üblichen Weise symmetrisch vom Körper abgehalten, sondern liegen windschief herum, als ob sie gar nicht mehr zu dem Tiere gehörten, das eine nach dieser, das andere nach jener Richtung ausgestreckt, oft auch lang nach vorn und hinten, wodurch die Stabähnlichkeit noch erhöht wird. Die gewöhnliche südeuropäische Art lebt hauptsächlich am Ginster und tritt hier sowohl in einer grünen wie in einer braungelblichen Form auf, wobei jene die frischen und diese die welken Triebe der Nährpflanze vortäuscht. So erstaunlich diese Nachahmung auch ist, so muß sie doch im Vergleich zu der der großen tropischen Arten als eine erbärmliche Stümperei bezeichnet werden.

Abb. 12. Stabheuschrecke. ( Bacillus rossii.)
Hier finden wir auch knorrige und dornige Baumzweige mit Auswüchsen, abgebrochenen Seitentrieben, Blattstummeln, Pilzflecken u. dgl. in meisterhafter Vollendung wiedergegeben, als sei ein Miniaturmaler am Werke gewesen. In der Sammlung erscheinen so abenteuerlich geformte Tiere als die auffallendsten, die es geben kann, in der freien Natur, namentlich in der verwirrenden Fülle des tropischen Urwaldes, gleiten selbst die geschärften Augen des Naturforschers achtlos über sie hinweg. Man kann vor einem Strauß stehen, auf dem Hunderte von Gespenstheuschrecken ruhen, ohne auch nur eine einzige wahrzunehmen. Die krakelig durcheinandergelegten Beine (eine symmetrische Stellung wäre viel auffallender), der gestreckte, wie aus Stengelgliedern zusammengesetzte Körper, die Gewohnheit der Tiere, sich in der Wachstumsrichtung der Pflanzenstengel zu setzen – dies alles zusammen schafft einen Fall nachahmender Zuchtwahl, wie er treffender kaum gedacht werden kann. Selbst ihre Eier sehen gewissen Pflanzenfrüchten viel ähnlicher als irgendwelchen Insekteneiern, denn sie sind groß und hartschalig, dunkelbraun mit gelber Ausschlüpfstelle. Man erkennt sie schon äußerlich im stark angeschwollenen Hinterleib der trächtigen Tiere.

Abb. 13. Ostindische Stabheuschrecke. ( Dixippus morosus.)
Von den in unsere Gewächshäuser eingeschleppten Dixippus morosus weiß man, daß sie sich viele Generationen hindurch ungeschlechtlich fortpflanzen können. Bei Bacillus gallicus, der in manchen Gegenden Frankreichs häufig genug ist, kennt man das Männchen überhaupt noch nicht; bei Bacillus rossii hat man es zwar gefunden, aber doch nur in auffallend geringer Anzahl. Doch steht fest, daß bei den Gespenstheuschrecken aus den Jungferneiern immer nur Weibchen entstehen, während zur Erzeugung eines Männchens das Eindringen eines Samenfadens in die Eizelle erforderlich ist. Die Zahl der Häutungen scheint innerhalb der einzelnen Arten gleichmäßig zu sein, aber innerhalb der Familie schwankt sie nach den Feststellungen des französischen Forschers Sinéthy zwischen vier und acht, und damit wird auch die ganze Entwicklungsdauer entsprechend verkürzt oder verlängert. Sie ist weiter sehr abhängig von der Temperatur und von den Ernährungsverhältnissen, aber auch von der allgemeinen Lebensweise, namentlich von der größeren oder geringeren Beschaulichkeit der Tiere. Manche von ihnen liegen viele Stunden hindurch regungslos da, sei es lang ausgestreckt auf einem Zweiglein, sei es zwischen zwei benachbarten Ästchen aufgehängt wie eine Hängematte. Das erste Larvenstadium ist zeitlich immer das längste, die folgenden dagegen von ziemlich gleicher Dauer. Schon 1–3 Tage vor der Häutung hört das Tier mit Fressen auf, verkriecht sich, und seine Formen schwellen an. Unmittelbar nach glücklich überstandener Häutung erscheint es deutlich größer und in der Farbe glänzender. Selbstverstümmelung (Autotomie) kommt vor, und zwar sowohl freiwillige wie erzwungene, aber die Gespenstheuschrecken bedienen sich dieses verzweifelten Mittels in sehr verschiedenem Grade, was ganz davon abhängt, inwieweit sie sonst durch Gestalt, Farbe, Lebensweise u. dgl. geschützt sind. Je vollkommener die Mimikry, um so unvollkommener die Autotomie und umgekehrt. Blutung tritt bei dieser nicht ein, aber trotzdem ist die Regeneration beschränkt. Kürzt man z. B. einen Fühler, so verschwindet er bei der nächsten Häutung ganz, ja oft auch noch der andere. Erst nach einer abermaligen Häutung sieht man den frischen Fühler erscheinen, der aber kleiner ist und zunächst nur aus 2–3 Gliedern besteht. Die Färbung ist sehr veränderlich; bei Bacillus gallicus z. B. hauptsächlich grün, aber je nach Umständen auch aschgrau, rostbraun oder hellgelb, ja selbst rote Bänderung kann auftreten. Sinéthy konnte eine Umfärbung von apfelgrünen zu strohgelben Stabheuschrecken schon in knapp drei Tagen erzielen. Meist, aber nicht immer hängt sie mit der Wahl der Aufenthaltsorte zusammen. Im frischen Gesträuch findet man deshalb hauptsächlich grüne Tiere, im absterbenden gelbliche, im vertrockneten graue oder bräunliche oder gestreifte. Die Beleuchtung übt dabei keinen besonderen Einfluß aus, nur Dixippus morosus zeigt sich in dieser Beziehung nach den Erfahrungen Sinéthys recht empfindlich. Vollständige Dunkelheit oder Lichtstrahlen von großer Wellenlänge rufen bei dieser Art nicht Albinismus (Weißfärbung) hervor, wie man vermuten möchte, sondern einen starken Melanismus (Schwarzfärbung).

Abb. 14. Gottesanbeterin ( Mantis religiosa) beim Angriff auf eine Wanderheuschrecke.
Wenn auch nicht so vollendete Anpassungserscheinungen, so doch ebenso abenteuerliche Formen wie bei den Gespenstheuschrecken finden wir bei den Fangheuschrecken vor, als deren bekanntester Vertreter die südeuropäische, aber mit vorgeschobenen Posten auch im Wiener Becken, in Mähren und Tirol, im Breisgau und selbst bei Frankfurt a. M. auftretende Gottesanbeterin ( Mantis religiosa, Abb. 14) gelten darf. Wer zum erstenmal ein solches Tier lebend näher angesehen hat, wird von ihm entzückt sein, und die Bewunderung für seine so zweckmäßige Organisation bleibt bestehen, auch wenn etwas wie sittliche Entrüstung über die abscheuliche Lebensweise dieser »scheinheiligen« Geschöpfe in uns aufsteigen will, sobald wir sie näher kennengelernt haben. Ihr systematisches Hauptkennzeichen besteht darin, daß ihre Vorderbeine nicht mehr zum Gehen dienen, sondern zu Raubbeinen umgewandelt sind. Wir finden ja solche Hilfsorgane zum Erfassen und sicheren Festhalten der Beute hauptsächlich bei solchen Raubinsekten, deren Kiefer nicht besonders kräftig entwickelt sind, wie dies auch bei den Fangheuschrecken zutrifft, während Räuber mit einem so zermalmenden Mundwerk, wie es z. B. die Laufkäfer besitzen, eine solche Einrichtung natürlich nicht nötig haben. Die kraftvollen Hüftstücke, die verlängerten Schienen und Schenkel dieser Fangbeine sind seitlich stark zusammengedrückt, und das Ganze endigt in einem Enterhaken, dessen Schärfe mit der spitzigsten Nadel wetteifert. Die eine Seite der Schenkel trägt eine mit starken Zähnchen beiderseits bewehrte Furche, in die die abgestreckte Schiene hineingeschlagen werden kann wie bei einem Taschenmesser die Klinge in das Heft (Abb. 15). In zusammengeklapptem Zustande sieht dieses Mordwerkzeug, in dem die Mantis eine ebenso eigenartige wie furchtbare Waffe besitzt, recht harmlos aus, zumal es gegen den steil aufgerichteten Vorderkörper gehalten wird, so daß das Tier wirklich den Eindruck einer verzückten Beterin macht. Keine drohenden Zangenkiefer trotzen in dem zierlichen Köpfchen, im Gegenteil ist das feine, spitzige Schnäuzchen »wie geschaffen zum Schnäbeln«, wie Fabre meint. Das seltsame Geschöpf nimmt sich auch sonst gar nicht übel aus mit seinem schlanken Wuchs, dem zierlichen Leibchen, den zarten Gazeflügeln, die glatt nebeneinander liegen und nicht dachartig zusammenstoßen wie bei den Grashüpfern, den gefälligen Gehbeinen und dem beweglichen Bruststück. Aber der Schein trügt, und das freundliche Aussehen ist nur Täuschung. Ruhig sitzt das Tier mit »betend« erhobenen »Händen« auf einer Stelle, schaukelt langsam auf seinen langen Laufbeinen hin und her und dreht das niedliche Puppenköpfchen mit den mächtigen Facettenaugen spähend nach allen Seiten. Es äugt scharf, viel besser als die Grashüpfer und Gespenstheuschrecken. Endlich läßt sich ein kleineres Kerbtier in der Nähe blicken. Da die Gottesanbeterin gerade hungrig ist – sonst würde das faule Geschöpf noch länger warten, bis das Opfer ihm sozusagen in den Rachen läuft – schleicht sie näher heran, ganz vorsichtig, leise und langsam, wie ein Tiger, ehe er sich zum Sprunge duckt. Der Vorderleib reckt sich dabei in fast gespenstischer Weise höher und höher, und fast gewinnt man den Eindruck, als ob die Mantis einen lähmenden und hypnotisierenden Einfluß auf ihr Opfer ausübe, wie man es ja auch von den Schlangen behauptet hat, denn das arme Ding rührt sich nicht, erscheint vor Schreck wie erstarrt und besitzt nicht mehr die Willenskraft zu eiliger Flucht oder verzweifelter Gegenwehr. Da – urplötzlich schleudern die scheinheilig zusammengefalteten Fangbeine sich nach vorn, klappen in allen drei Teilen lang auseinander, und ihre spitzen, krummen Endharpunen schlagen mörderisch in den Leib des Opfers, das nun beim Zurückziehen der Fangbeine zwischen die starrenden Stacheln der beiden Armteile wie in einen Schraubstock eingeklemmt wird und in dieser fürchterlichen Umarmung rettungslos verloren ist. Alsbald führt die Mörderin ihre Beute zum Munde, die Kauwerkzeuge beginnen ihre Tätigkeit, und in verhältnismäßig kurzer Zeit ist das Kerbtier im Magen der Heuschrecke verschwunden. Diese ist so gefräßiger Natur, daß sie sich oft zum Schaden der eigenen Gesundheit überfrißt, auch über viel größere und recht wehrhafte Tiere mörderisch herfällt. Von den großen tropischen Arten ist es nachgewiesen, daß sie sogar Eidechsen und kleine Vögel überwältigen, und unsere Mantis religiosa greift wenigstens die kräftigen Wanderheuschrecken und Kreuzspinnen ohne weiteres an und bleibt ihnen gegenüber regelmäßig Sieger, obwohl sie sich mit ihren starken Kiefern nach Möglichkeit verteidigen und die Heuschrecke mit ihren sägeartig gezackten Hinterbeinen der Gottesanbeterin den feisten und weichen Bauch aufzuschlitzen versucht. Auch den Honigbienen, auf die sie besonders erpicht ist, wird die Gottesanbeterin sehr gefährlich und weiß ihrem Giftstachel geschickt auszuweichen. Solch wehrhaftem Wild gegenüber verfügt die Gottesanbeterin noch über eine besondere Schreckstellung, die mit geradezu verblüffender Schnelligkeit blitzartig angenommen wird. »Der Übergang ist so rasch«, sagt Fabre in seiner malerischen Weise, »und die Mimik so drohend, daß ein nicht daran gewöhnter Beobachter stutzt und seine Hand zurückzieht, weil er eine unbekannte Gefahr befürchtet. Die Flügeldecken werden geöffnet und schräg seitwärts ausgespannt, die Flügel in ihrem ganzen Umfang wie parallele Segel emporgerichtet. Das Ende des Leibes rollt sich spiralförmig zusammen und streckt sich wieder, dann sinkt es herab und wird schlaff unter heftigen Erschütterungen mit einem Geräusch: Puff, puff!, ähnlich dem, womit der Truthahn vor seiner Henne das Schwanzgefieder aufklappt. Man könnte an das Zischen einer überraschten Natter denken. Trotzig auf seinen vier Hinterbeinen stehend, hält das Insekt seinen langen Vorderleib fast senkrecht empor. Die vorher zusammengefaltet und aufeinander gelegt vor der Brust gehaltenen Fangbeine öffnen sich ihrer ganzen Länge nach, strecken sich kreuzförmig vor und zeigen in den Achselhöhlen den Schmuck der Perlchen und die schwarzen Flecken mit dem weißen Augenfleck in der Mitte. Offenbar sind dies Kriegskleinodien, die jetzt enthüllt werden, um das Insekt schreckenerregend für die Schlacht zu machen.« Sitzt der Gegner erst einmal im unentrinnbaren Schraubstock der Fangbeine, so faltet die Mantis ihre Kriegsstandarde zusammen und bemüht sich, ihm möglichst rasch den Garaus zu machen, um alle weiteren Widerstandsversuche zu ersticken. Während das eine Fangbein den armen Schelm festhält, drückt das andere seinen Kopf so weit herunter, daß der Oberhals entblößt wird vom auseinanderklaffenden Chitinpanzer, und nun beißt die Siegerin gierig in diese verwundbare Stelle und zermalmt das Genick. Also auch hier wieder diese wunderbare anatomische Kenntnis der Raubinsekten von der lebenswichtigsten Stelle im Körper anderer Tiere, die noch kein Forscher zu erklären vermochte! Die Aufgabe der Flügel scheint übrigens mit ihrer Rolle bei der beschriebenen Schreckstellung erschöpft zu sein, denn noch niemand hat eine Gottesanbeterin fliegen gesehen. Wenn die Weibchen, die viel gewalttätiger und grausamer sind als die kleineren und ziemlich schüchternen Männchen, aus Eifersucht oder Futterneid sich wütende Duelle liefern, gehen sie gleichfalls in der Schreckstellung aufeinander los, und eine bloße Drohung ist dies wahrlich nicht, denn die Unterlegene wird von der Siegerin einfach aufgefressen. Die beiden Megären mißhandeln sich gegenseitig in der fürchterlichsten Weise mit Püffen, Stößen und Ohrfeigen, hauen wütend aufeinander los wie zwei ergrimmte Boxer, aber ihre Fäuste sind nicht in Handschuhe gehüllt, sondern mit Haken bewaffnet, die so messerscharf sind, daß sie auch die Haut des menschlichen Fingers blutig ritzen (man kann sie kaum wieder los bekommen, denn sie haften fest wie Kletten), der Gegnerin der Länge nach den Leib aufschlitzen und ein kleines Insekt mit einem einzigen Hieb in der Mitte glatt halbieren. Wer in Tiergesichtern zu lesen versteht, wird die Mantis von vornherein als ein äußerst leidenschaftliches Geschöpf bezeichnen, aber nie kommt die diesen Tieren eigene Unverträglichkeit abscheulicher und abstoßender zum Ausdruck als zur Zeit der süßen Minne, wo andere Tiere bemüht sind, sich von ihrer vorteilhaftesten Seite zu zeigen. Der Charakter des Weibchens ist ein entsetzliches Gemisch von Wollust und Grausamkeit. Es ist der richtige weibliche Blaubart!
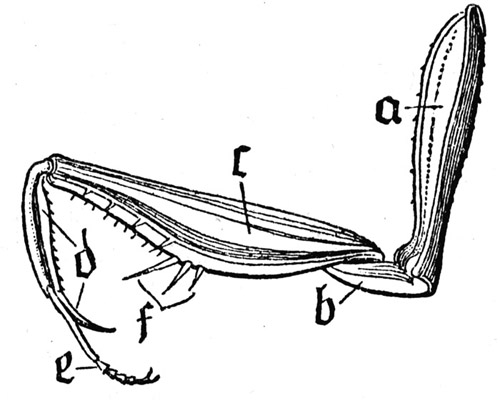
Abb. 15. Vorderbein der
Mantis religiosa. Nach Tümpel.
a Hüfte.
b Schenkelring,
c Schenkel.
d Schiene.
e Fuß,
f Schenkelstacheln.
Fruchtbar ist die Megäre wenigstens, denn nach den von Mertens an gefangen gehaltenen Gottesanbeterinnen gemachten Beobachtungen setzt jedes Weibchen drei papierartige, hornige, gelblich gefärbte Eierpakete ab, und jedes davon enthält 18–25 strahlig angeordnete Querreihen von Eiern mit je 6–8 Stück. Die Entwicklung der Eier nimmt mehrere Monate in Anspruch, kann aber durch Erhöhung der Temperatur abgekürzt werden, während ein beständiges Sinken der Temperatur unter 17° das Ausschlüpfen der Jungen überhaupt verhindert. Die bei hinreichender Ernährung ziemlich rasch heranwachsenden Larven zeigen sich beweglicher als die Alten, laufen munter auf Grasstengeln und im Dorngestrüpp umher und verstehen sehr geschickt, der haschenden Hand sich zu entziehen, wenn man sie fangen will. Von allem Anfang an verleugnen sie nicht die den Fangheuschrecken eigene Mordlust, fressen sich auch nach Möglichkeit gegenseitig auf. Sie müssen sieben bis elf Häutungen durchmachen, ehe sie zu reifen Geschlechtstieren werden, und suchen sich dabei immer irgendwo mit den Füßen gut festzuklammern, damit sie bequem und sicher aus der alten Haut heraussteigen können, die in der Rückenmitte einen Riß bekommt. Mertens rechnet die Fangheuschrecken zu den geistig begabtesten aller Insekten, und wer jemals diese hochinteressanten Tiere lebend im Terrarium gehalten hat, was ebensowenig Mühe und Schwierigkeiten macht wie bei den Stabheuschrecken, wird ihm darin beipflichten. Sie werden mit der Zeit völlig zahm, machen keine Fluchtversuche mehr, lassen sich ruhig mit der Hand ergreifen, nehmen Futtertiere von der Pinzette und verfolgen mit ihrem niedlichen Köpfchen aufmerksam alle Bewegungen ihres Pflegers. So gewähren sie nicht nur viel Unterhaltung, sondern sind zugleich auch sehr dankbare Beobachtungsobjekte für den wissenschaftlichen Forscher. Auch bei ihnen ändert ja die Färbung je nach dem Untergrunde ab, und manche Forscher folgern hieraus, daß diese Tiere völlig farbenblind seien, weil allein durch verschiedene Helligkeiten eines farblosen Grundes Farbenänderungen bei ihnen hervorgerufen werden können. In den Tropen gibt es viele schön gefärbte und abenteuerlich gestaltete Arten, so die stattliche Teufelsfangschrecke, die besonders durch die scharfrandige seitliche Verbreiterung des Halsschildes und des Hinterleibes auffällt; ihre Fangbeine starren von schrecklichen Dornen, und selbst der Kopf ist mit einer stattlichen Pickelhaube bekleidet. Eine afrikanische Art zeigt nach Kammerer in Aussehen und Haltung große Ähnlichkeit mit einem kleinen Gecko. Beide Tiere leben im Sudan auf alten Akazienstämmen und haben deren Rindenfärbung, beide laufen bei Annäherung eines Feindes in Spiralen um den Stamm herum und gehen dann plötzlich auf dessen abgewendeter Seite in den Zustand vollkommenster Ruhe über.
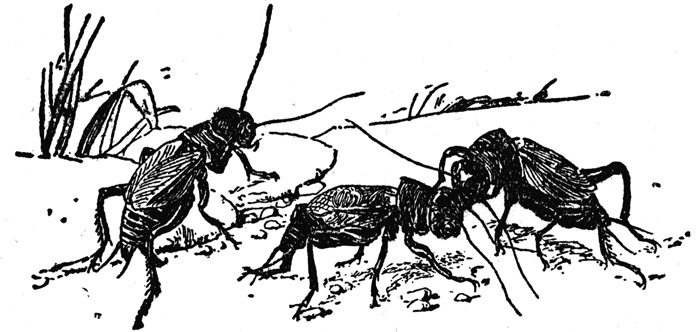
Abb. 16. Feldgrille. ( Gryllus campestris.)
Die Grillen lassen sich am besten kennzeichnen durch den Namen Grabheuschrecken, weil ihr vorderstes Beinpaar zum Graben eingerichtet ist, allerdings nicht immer. So beim Heimchen, von diesem, sowie von der Küchenschabe wurde hier abgesehen, weil beide Arten schon in dem Kosmos-Bändchen »Zwischen Keller und Dach«, ausführlich geschildert wurden. Die gleichfalls hierher gehörigen Termiten sollen später bei den staatenbildenden Insekten behandelt werden. Es sind Geradflügler von walziger Gestalt, mit dickem Kopf, einem Paar geringelter Raife am Hinterleibsende, mit wagerecht aufliegenden Vorder- und der Quere nach gefalteten Hinterflügeln, die unter jenen hervorragen. Sie bedürfen lockeren Bodens, und unsere Feldgrille ( Gryllus campestris, Abb. 16) siedelt sich am liebsten auf warmen, sandigen Hängen an, da, wo der Wald ans Feld stößt. Hier gräbt sie sich ihre senkrecht in den Boden gehenden Wohnhöhlen und musiziert von diesen aus fröhlich in die Welt hinaus. Als ängstliche Gesellen wagen sie sich nie weit von ihren Löchern weg. Begegnen sich zwei, so stoßen sie mit den Köpfen aneinander wie Ziegenbocke, was sehr drollig aussieht. Die im Juli ausschlüpfenden Larven, die gegenseitig auch Kannibalengelüste hegen, treiben sich frei im Grase herum und verkriechen sich erst im Herbst zur Winterruhe in die Erde. Im Frühjahr trifft man in den Höhlen nur Larven an, die sich noch mehrmals häuten müssen, ehe das Geschlechtstier fertig ist.
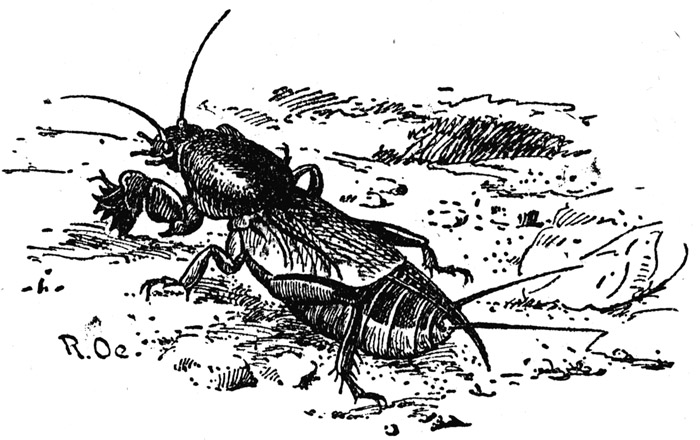
Abb. 17. Maulwurfsgrille. (
Gryllotalpa vulgaris.)
Nach der Natur gezeichnet.
Kein Tier wurde mir, als ich während des Krieges 1915 und 1917 an der Ostfront weilte, von den Soldaten so oft als ausländisches Wundertier zur Begutachtung überbracht wie unsere gewöhnliche Maulwurfsgrille ( Gryllotalpa vulgaris, Abb. 17), die natürlich beim Ausheben der Schützengräben den Feldgrauen oft genug in die Hände fiel. Wunderbar, daß so wenige dieses allerdings höchst auffallende Lebewesen kannten, wo es doch auch in der deutschen Heimat als Gartenschädling recht häufig vorkommt und eine ganze Reihe volkstümlicher Namen führt, wie Werre, Erdkrebs, Reutwurm, Reitkröte, Erdwolf, Mordwolf, Spitzwurm, Riedwurm, Gurkenwurm, Erdochse, Schrot- und Gerstwolf, Ackerweibel usw. Die Ähnlichkeit mit dem Maulwurf liegt ja, ganz abgesehen von der Lebensweise, auch schon äußerlich auf der Hand, wenn man die zu Grabschaufeln umgewandelten und mit pflugscharartigen Zähnen verstärkten Vorderbeine betrachtet. An einen Krebs erinnert namentlich das lange Halsschild, das wie das Kopfbruststück der Kruster anmutet. Bei »Reit« oder »Reut« muß man an die Reutmaus denken, wie die Wühlmaus oft genannt wird, und »Weibel« sei ein veraltetes Wort für Rüsselkäfer, bekunden die Sprachgelehrten. Ja, aber auch für Sergeant! Das scheint mir zu dem zänkischen Wesen dieses klugen, aber ungemütlichen Insekts weit besser zu passen. Es liebt gleichfalls lockeren, womöglich gut gedüngten Boden, in dem sich's hübsch wühlen läßt, meidet dagegen sumpfigen oder steinigen, auch lehmigen oder tonigen, weil es da mit der Grabarbeit nicht recht vorwärts gehen will. In Baumschulen und Waldwiesen hält es sich gern auf, namentlich aber in schön gepflegten Garten- und auch in Gurkenbeeten. Zu sehen ist von dem unterirdischen Wühler zunächst nichts, da er höchstens einmal nachts zur Erdoberfläche empor kommt, aber bald verrät er zum Verdruß des Gärtners seine Anwesenheit dadurch, daß die Blätter der Pflanzen gelb werden, welken und schließlich abfallen. Der Schaden ist oft viel ärger als der von Engerlingen verursachte, und auf der Tropeninsel St. Vincent haben die Werren einmal die ganze Zuckerrohrkultur in Frage gestellt. Aber auch in unseren Gemüsebeeten und Rübenfeldern hausen sie sehr übel, und selbst manches junge Bäumchen wird durch sie frühem Verderben geweiht. Früher glaubte man allgemein, daß eben ihre Hauptnahrung in zarten Pflanzenwurzeln bestände, aber neuere Forscher haben durch sorgsame Fütterungsversuche festgestellt, daß tierische Kost doch den Hauptbestandteil auf dem buntgemischten Speisezettel der Maulwurfsgrille ausmacht. Es ist viel Tinte über diesen Punkt verschrieben und manche hitzige Fehde zwischen den zoologischen Kampfhähnen darob ausgefochten worden, aber ich möchte Marshall beipflichten, der der Ansicht ist, daß sich allerdings die jungen Werren von zartestem Wurzelwerk ernähren (deshalb findet man auch die Werrennester so vielfach an stark mit Pferdemist gedüngten Stellen), daß sie aber dann mehr und mehr zu tierischer Kost übergehen, und daß die Alten nahezu ausschließlich von solcher leben. Wie versessen sie in ihrer blindwütenden Gefräßigkeit auf solche sind, das beweist ja schon die schauerliche Erzählung des alten Nördlinger, der einmal eine bei der Gartenarbeit ans Tageslicht beförderte Maulwurfsgrille mit dem Grabscheit halbierte und nun zu seinem Entsetzen sehen mußte, wie die Vorderhälfte das abgetrennte Hinterteil aufzufressen sich bemühte! Durch vertilgen von Drahtwürmern und Engerlingen schafft die Werre auch einigen Nutzen, in der Hauptsache aber hält sie sich an Regenwürmer. Sie bohrt diesen wehrlosen Geschöpfen den Gelenkstachel ihrer Grabbeine in den Leib, hält sie so fest und verschmaust sie nun mit ruhiger Behaglichkeit. Eine ganz unheimliche Muskelstärke ist dem mehr eigenartig als schön aussehenden Tier eigen, was man recht deutlich merken kann, wenn man es mit der geschlossenen Hand festhalten will; man tut übrigens gut, vorher Handschuhe anzuziehen, denn die Werre, die von leichtgläubigen Leuten für giftig gehalten wird, vermag wenigstens ganz empfindlich zu zwicken. Auch biegt sie in der Abwehrstellung drohend ihren dicken, plumpen Hinterleib herum, als wolle sie stechen, obwohl sie gar keinen Stachel besitzt. In höchster Not entleert sie als oft wirksames Schreckmittel überdies noch ihren schwarzen, stinkenden Kot in spritzendem Strahl. Die unleugbare Schädlichkeit der Werre ist also weniger auf Pflanzennahrung zurückzuführen, wie die alte Bücherweisheit wollte, als vielmehr darauf, daß sie bei ihren beständigen Grabarbeiten alle ihr im Wege stehenden Würzelchen zerschneidet oder abbeißt. Über der Nestkammer werden alle Pflanzen rücksichtslos zum Absterben gebracht, damit die wärmende Sonne leichter auf die Eier einwirken kann. Ihre fabelhafte Muskelkraft (sie soll bis zu 1½ kg schwere Gegenstände in Bewegung zu setzen vermögen!) kommt der Werre bei der schweren Grabarbeit natürlich sehr zustatten. Ihr gegenüber erscheint die Feldgrille, die trotz der ihr von der Fabel zugeschriebenen Neigung zu fröhlicher Trägheit doch auch recht hübsche Röhren und Gänge im Erdreich macht, als ein wahrer Stümper. Die Werrengänge ziehen sich in vielen Windungen hin und haben einen Durchmesser von etwa 3 cm, sind also zu eng für Maulwurfsgänge, aber zu weit für Engerlinge und deshalb immer leicht kenntlich. Ein besonders sorgfältig angelegter, spiralförmig verlaufender Gang führt zu der etwa 10–12 cm unter der Erdoberfläche befindlichen Brutkammer, die die Größe eines Hühnereis hat, und deren Wände mit Speichel sauber geglättet und ausgemauert sind (Abb. 18). Hier sind die 200–300 hirsekorngroßen gelblichen Eier zu einem ansehnlichen Haufen aufgetürmt, und daneben oder in dem 30 cm senkrecht nach unten führenden Fluchtschacht sitzt die glückliche Mutter und bewacht ihre Brut. Die nach 10–14 Tagen ausschlüpfenden Kinderchen sehen wie Ameisen aus und sind zunächst gelblichweiß, bis sie allmählich die erdbraune, samtglänzende Gewandung der Eltern bekommen. Wo Werren sich einmal im Garten eingenistet haben, sind sie schwer wieder zu vertreiben. Man kann wohl Steinkohlenteer oder Öl oder Petroleum in ihre Gänge gießen, aber das alles schadet unter Umständen auch den Pflanzen, und Seifenlauge ist zu wenig wirksam; man kann die Brutkammer ausgraben und die Eier samt dem Muttertier vernichten, aber das versteht nicht jeder; man kann glattwandige Töpfe in das Erdreich setzen, in die die nächtlich herumschwärmenden Werren hineinfallen, aber man fängt auf diese Weise doch immer nur einzelne. Das wirksamste Mittel ist zugleich das einfachste und älteste, denn schon Rösel von Rosenhof hat es empfohlen: Man übergieße solche Stellen, wo absterbende Pflanzen das Vorhandensein der Brutkammer verraten, reichlich mit kochendem Wasser.
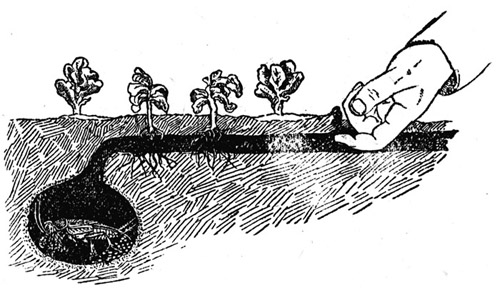
Abb. 18. Brutkammer der Maulwurfsgrille.
Ein ähnlicher Streit wie um die Ernährungsweise der Maulwurfsgrille und damit um Nutzen und Schaden des Tiers ist auch um die des Ohrwurms (Forficula auricularis, Abb. 19) geführt worden, und auch hier stehen sich die Ansichten der einzelnen Forscher scharf gegenüber.

Abb. 19. Ohrwurm. (Forficula auricularis.)
Wie überhaupt die Allesfresser im Tierreich, ist eben auch der Ohrwurm in dieser Beziehung sehr schwer zu beurteilen, Überblickt man aber kritisch prüfend alle dieser Beziehung seither gemachten Beobachtungen, so kommt man doch zu dem Schluß, daß der Ohrwurm im Gegensatz zur Maulwurfsgrille überwiegend Pflanzenfresser ist. Er verzehrt aber nicht nur frische, sondern auch welke und verwesende Bestandteile, und dadurch erklärt es sich, daß man in seinem Magen und Kropf so oft Pilze oder Pilzsporen findet, womit aber nicht gesagt sein soll, daß er nicht vielleicht auch Pilzrasen eigens abweidet. Bei auf Bäumen wachsenden Algen tut er dies sicherlich. Saftige Früchte, besonders Birnen und Himbeeren, benagt er namentlich dann, wenn es ihm an Wasser zur Stillung seines Durstes fehlt. Seine Leidenschaft sind aber die Staubbeutel der Georginen, Nelken und anderer Zierblüten, auch der Rebe und des Apfels, und an Obstspalieren kann er deshalb recht lästig werden, zumal er gern auch die jungen Pfirsich- und Birnenblätter verspeist. Nach Schwarz hat er eine besondere Vorliebe für Glyzinenblätter und hemmt dadurch das Wachstum dieser an Hauswänden so gern gezogenen Schlingpflanze. Daß er durch Zernagen der Rübenherzblätter dem Landwirt schädlich werden kann, hat ja Holbrung nachgewiesen. Nun frißt der Ohrwurm nebenbei freilich auch allerhand Getier, und namentlich durch Vertilgung von Blattläusen, Erdflöhen, Blattwespenpuppen und Gespinstmotteneiern macht er einen Teil des angerichteten Schadens wieder wett, aber allzu hoch ist sein Nutzen in dieser Hinsicht nicht zu veranschlagen, da er sich lieber an abgestorbene als an lebende Tiere hält. Er, kann auch nur weichhäutige Kerfe von geringer Bewegungsfähigkeit bewältigen, denn schon der Chitinpanzer einer Kohlweißlingspuppe ist für sein schwaches Gebiß zu hart. Ein Nützling ist er also gewiß nicht, aber auch sein Schaden fällt nicht schwer ins Gewicht, solange er nicht in ungewöhnlicher Massenhaftigkeit auftritt, wie dies in manchen Jahren und in gewissen Gegenden der Fall zu sein pflegt. Zudem ist seine Bekämpfung leicht, denn man braucht diesen lichtscheuen Tieren nur künstliche Verstecke zu bieten, etwa hohle Markknochen oder alte Scheuerlappen, und kann sie dann hier bequem vernichten. Mittelbar werden sie auch dadurch lästig, daß sie Himbeeren oder wertvolles Spalierobst mit ihrem krümeligen Kote verunreinigen oder mit ihren starken, phosphorartigen Ausdünstungen bedenken, es so unappetitlich machen und entwerten. Dieser Stinkstoff, dessen Geruch, genau genommen, dem einer Mischung von Kreosot und Karbolsäure gleicht, was wohl auf die Anwesenheit von Phenolen zurückzuführen ist, kann in einem feinen Dunstwölkchen 10 mm weit ausgestoßen werden und ist wohl sicherlich als Verteidigungswaffe anzusehen. Er wird in kleinen Bläschen erzeugt, die in Falten am dritten und vierten Hinterleibsring sitzen und sich mit einem feinen Spalt nach außen öffnen. Außerdem finden sich noch am ganzen Körper kleine, eingesenkte Hautdrüschen, deren Ausscheidung aber wohl nur den Zweck hat, den Leib einzusalben und so gegen Nässe zu schützen. Der üble Geruch, die unscheinbare Färbung, die nächtliche, lichtscheue Lebensweise, die drohenden Zangen am Hinterleib und die kriechenden und krümmenden Bewegungen, die unwillkürlich an einen rückgratlosen, einschmeichlerischen Halunken erinnern, haben vereint dazu beigetragen, das arme Ohrwürmchen in den Augen des Volkes zu einem abscheulichen und verachtungswürdigen Geschöpf zu stempeln. Man sagt ihm nach, daß es schlafenden Menschen in die Ohren krieche, mit seinen scharfen Zangen das Trommelfell durchkneipe und dann gar bis zum Gehirn vordringe, was soll es wohl da? Nun, es mag schon mal vorkommen, daß dieses Tier, das ja alle nur denkbaren Schlupfwinkel aufsucht, gelegentlich mal einem im Grase Schlafenden ins Ohr kriecht, aber es wird sich alsbald wieder aus dem Staube machen, schon weil ihm das Ohrenschmalz höchst ungemütlich vorkommen wird. Aber die gefährlichen Zangen, deren Hälften immer nur gleichzeitig nach außen oder innen bewegt werden können? Kneifen kann das Tier jedoch damit gar nicht, sondern sie haben eine viel harmlosere Aufgabe, wie wir gleich sehen werden. Die lederartigen Vorderflügel des Öhrlings sind bedeutend verkürzt, so daß sie den größeren Teil des Hinterleibes frei lassen. Trotzdem sind die sehr großen, dünnen und häutigen Hinterflügel vollkommen von ihnen verdeckt und daher gewöhnlich unsichtbar, weil sie nämlich kunstvoll wie ein Paket in der Längsrichtung zusammengefaltet und zweimal in der Querrichtung geknickt sind. Will nun der Ohrenkneifer seine Flügel gebrauchsfertig machen, so läßt sich dies nicht, wie etwa bei einem Käfer, durch bloße Körperbewegungen ermöglichen, sondern er bedarf dazu der Zangen, die übrigens auch Geschlechtskennzeichen sind, da sie beim Männchen eine schwache Kerbe und einen dornartigen Ansatz aufweisen. Das Tier hebt den Hinterleib derartig aufwärts und nach vorne, daß die Spitze der Zange unter die sich gleichzeitig etwas hebenden Flügeldecken geschoben werden kann. Der linke Zangenarm schiebt sich unter den rechten Flügel und entfaltet ihn durch streichende Bewegungen; während nun der rechte Flügel offen bleibt, verrichtet der rechte Zangenarm die gleiche Arbeit am linken Flügel. Dies alles geschieht mit zauberhafter Schnelligkeit, viel rascher, als die Beschreibung sich liest. Je schwieriger die Entfaltung der Flügel bei den einzelnen Arten ist, desto vollkommener sind ihre Zangen entwickelt. Solche Arten sind dann am schwersten zum Auffliegen zu bringen. Die gewöhnliche Forficula auricularis sieht man nur höchst selten einmal fliegen, viel häufiger den nur halb so großen und bei uns nicht so zahlreichen Zwergohrwurm (Forficula minor). Zwischen Mosel und Maas beobachtete v. Garvens ganze Schwärme dieser Kerfe. Sie zogen, jeder für sich, in schrägem Aufstieg nach oben und kamen dabei nur mäßig schnell vorwärts unter sichtlicher Anstrengung der wirbelnden Flügel. Des Fliegens ungewohnt, sind sie nicht fähig, weite Strecken zu durcheilen oder die eingeschlagene Richtung durch plötzliche Wendungen zu ändern, sondern es langt gerade, sich in der Luft schwebend zu erhalten und dabei langsam vorwärts zu kommen. Beim Landen gehen die Flügel ohne Mitwirkung der Zangen selbsttätig wieder in den Ruhezustand über, denn sobald die Außenrandader, die jeden Flügel wie eine Schirmstange gespannt hält, in ihren beiden Scharnieren einknickt, klappt der ganze Flügel wie von einer Feder zusammengeschnellt in sich zusammen. Am liebsten hausen die Ohrwürmer unter Steinen oder sich ablösender Baumrinde, und laufen hier wirr und ängstlich durcheinander, wenn man dem Tageslicht Zutritt zu ihrem verborgenen Schlupfwinkel verschafft. Nur wenn sie auf die Brautschau ausziehen, lassen sie sich auch bei Tage blicken. Die Begattung findet im Herbst statt, aber erst im folgenden Frühjahr legt das Weibchen in einem recht gut geschützten Versteck seine Eier, die es ebenso wie die nach 5–6 Wochen ausschlüpfenden Jungen mit eifersüchtiger Mutterliebe bewacht und behütet wie eine Glucke ihre Küchlein: ein hübsches und rührendes Bild, das man gerade bei den verachteten Ohrwürmern gewiß nicht zu finden erwartet hätte. Auch die Männchen werden ferngehalten, weil sie nicht übel Lust bezeigen, das Gelege zu verspeisen. Lieber läßt sich das Weibchen in Stücke reißen, ehe es sich von seinem Eierhäufchen trennen würde. Erscheint der Platz nicht mehr sicher genug, so schleppt der Ohrwurm seine Eier einzeln und mühsam, wie eine Katze ihre Jungen, in ein neues Versteck, meist eine selbstgegrabene, flache Grube. Diese wird später so weit vertieft, daß die Jungen, die offenbar auch mit Nahrung versehen werden, nicht herauskriechen können. Entfernen sie sich doch einmal zu weit von ihrer Beschützerin, so werden sie alsbald wieder zurückgeholt. Heymons beobachtete, daß die Weibchen auch untergeschobene fremde Eier der eigenen Art willig annehmen, sich dagegen mit gleichgroßen Eiern von Käfern und Spinnen nicht täuschen ließen, sondern das fremde Gut heraussuchten und wegschleppten, wenn sie es nicht auffraßen. Schließlich stirbt die treue Hüterin ab, nutzt aber auch im Tode noch ihrer Kinderschar die nun den Leichnam der Mutter aufzehrt. – Außer den schon genannten beiden Arten haben wir in Deutschland noch den selteneren, größeren und helleren, fast farblosen Riesenohrwurm ( Forficula gigantea), der sich mit Vorliebe auf sonnigen Heiden oder an Flußufern ansiedelt, und im Hochgebirge den Alpenzängler ( Anechura bipunctata), der im Frühjahr mutig der Schneeschmelze folgt und bis zu Höhen von 2600 m emporsteigt. Gern wohnt er hier auf den Viehweiden unter alten, verrotteten Kuhfladen, deren hart gewordene Kappe ihm guten Schutz gewährt. Bei dieser Art wenigstens hat Stäger mit Sicherheit festgestellt, daß die Jungen von der Alten mit den zartesten Blättern der würzigen Alpenkräuter versorgt und häufig beleckt werden, ja daß ein förmlicher Spielplatz für sie angelegt wird. Ferner daß das Weibchen auf seinen sehr ungleich großen Eiern tatsächlich sitzt, sie also zeitweise geradezu bebrütet. Es schleppt die Eier, die es gleichfalls fleißig beleckt, auch öfters zur Ausnützung der günstigsten Temperatur an eine andere Stelle und erinnert so an die Ameisen, die ja bei jeder Gelegenheit ihre »Puppen« herumtragen.
Die Mehrzahl der heutigen Systematiker stellt zu den Geradflüglern noch einige Gruppen wenig auffallenden und noch wenig erforschten Kleinzeugs, eigentlich wohl nur aus dem Grunde, weil sie sich nicht gut anderswo im System unterbringen lassen und weil sie mit den echten Orthoptern wenigstens die unvollständige Verwandlung gemeinsam haben. Ein paar kurze Worte seien ihnen deshalb gegönnt. Da sind zunächst die winzigen Blasenfüßer ( Physopoda), die man als Bindeglieder zur Ordnung der Schnabelkerfe auffassen könnte. An dem walzigen Kopf sind die Mundwerkzeuge ungewöhnlich weit nach hinten gerückt, so daß sie fast zwischen die Vorderbeine zu liegen kommen, und haben die Gestalt eines trichterförmigen Rüssels angenommen, der einige Stechborsten umschließt. Mit diesen sticht das Tier weiches Pflanzengewebe an und saugt ihm den Saft aus. Namentlich der Getreide-Blasenfuß ( Limothrips cerealium) wird dadurch im Roggen und Weizen schädlich, zumal seine Larve auch die milchigen Körner angeht. Die meisten Arten sind Ausländer, aber bei uns vielfach in die Gewächshäuser eingeschleppt worden, wo sie den Gärtnern als »schwarze Fliegen« bekannt und verhaßt sind, weil sie mit Vorliebe die Blüten der Kompositen heimsuchen. Ihren Namen führen diese Kerfe deshalb, weil ihre zweigliedrigen Füße nicht in Klauen, sondern in runde Haftscheiben auslaufen. – Im Hochsommer findet man auf der Unterseite von Baumblättern, namentlich an Eichenarten, häufig fischschuppenartige Gespinste und in diesen 8–15 perlmutterglänzende Eierchen. Sie rühren von Holzläusen ( Psocidse) her, deren Larven bei oberflächlicher Betrachtung in der Tat viel Ähnlichkeit mit Läusen haben, während sie in Wirklichkeit zu den Termiten hinüberleiten. Sie fertigen sich dann zum Schutz gegen die Herbststürme ein größeres Gespinst an und entwickeln sich darunter überraschend schnell zum fertigen Imago. Merkwürdigerweise sieht man an den befallenen Blättern keinerlei Fraßspuren, was die Vermutung nahelegt, daß die Larven ebenso wie die sehr trägen Geschlechtstiere in der Hauptsache von Schimmelpilzen sich ernähren. – Sehr wenig unterrichtet sind wir noch über die Lebensweise der Uferfliegen ( Perlidse), die schon sehr zeitig im Frühjahr an ruhigen Gewässern ihr stilles und in keiner Hinsicht auffallendes Wesen treiben. Obwohl sie vier breite und fast gleichgroße Flügel haben, erheben sie sich doch nur selten einmal bei warmem Sonnenschein zu kurzem Flug in die Lüfte, und auch die Paarung wird auf dem Lande vollzogen. Die an den Beinen mit langen Wimperhaaren und Schwimmborsten ausgestatteten Larven führen ein räuberisches Wasserleben.
Der Naturfreund wird seine Schritte mit Vorliebe immer wieder zum Ufer der Flüsse und Teiche lenken, denn hier herrscht erfahrungsgemäß das reichste Tierleben, hier wird ihm so manche ungeahnte Überraschung zuteil. Haben wir Glück, so können wir in einer schwülen, sommerlichen Vollmondnacht sogar ein – Schneegestöber uns vortäuschen lassen. So sieht es wenigstens von weitem aus, und erst beim Näherkommen bemerken wir, daß es sich um Millionen und aber Millionen geflügelter, weißlicher Insekten handelt, die gleich Schneeflocken durch die Luft wirbeln und sich bei Laternen oder anderen Lichtquellen zu ganzen Wolken ansammeln. Es sind Eintagsfliegen ( Ephemera vulgata, Abb. 20), ungemein zarte und weichhäutige, walzenschlanke und schmalleibige Kerfe mit großen, glänzenden, starrblickenden Puppenaugen, die beim Männchen fast den ganzen Kopf einnehmen, beim Weibchen aber erheblich kleiner sind, mit kaum bemerkbaren Fädchen statt der sonst bei Insekten oft so ungeheuerlich entwickelten Fühler, mit zierlichen, sehr ungleich langen Beinen und einem langen Schwanze, der durch drei dünne Afterborsten vorgetäuscht wird, leicht kenntlich an pomeranzengelben Flecken auf dem braunen Hinterleib und einer gelben Binde auf den fast dreieckigen Vorderflügeln. Schon Aristoteles und Aelian wissen gar Seltsames von diesen Tieren zu berichten, und bereits Linné schreibt, daß sie am gleichen Tage ihr Hochzeitsfest, ihr Kindbett und die eigene Leichenfeier abhalten. Dichter haben sie besungen und Denker über sie geschrieben, wenn die Sommernacht sie zu Millionen gebärt, dann gestaltet sich ihr Hochzeitsflug zu einem erhabenen Naturschauspiel, dem man nur mit inniger Bewunderung beiwohnen kann. Hoffmann hat es einmal bei Heidelberg erlebt: »Ihre Leiber regneten zu Millionen herab und bedeckten Geländer, Trottoir und Fahrstraßen. In den Spinnweben fingen sie sich zu langen Perlenschnüren, von den rastlosen Bewegungen der schillernden Geschöpfe war das Auge geblendet, von ihrem eigenartig scharfen Geruch die Gegend weithin erfüllt, und das ununterbrochene Schlagen der Flügelmilliarden erregte sausendes Brausen in der Luft.« Alle diese Tiere sind erst am gleichen Abend zu beflügelten Geschlechtstieren geworden, und alsbald nach vollzogener Begattung taumeln die Männchen sterbend zur Erde, während die Weibchen zum Wasserspiegel eilen, wo ihnen mit einem förmlichen Knall der Hinterleib platzt und die beiden befruchteten Eierstöcke entläßt, die im Wasser zu gallertigen Laichsträngen anschwellen und sich um Pflanzen schlingen oder zu Boden taumeln. Damit ist der Daseinszweck auch der Weibchen erfüllt, denn diese seltsamen Geschöpfe weihen ja ihr kurzes Leben allein der Liebe. Keinerlei prosaische Nahrungsaufnahme unterbricht ihren Venusreigen, denn selbst wenn sie fressen wollten, könnten sie es doch nicht, weil – sie überhaupt keine Mundwerkzeuge haben. Trotzdem ist der Name »Eintagsfliege« eigentlich nicht gut gewählt, denn erstlich sind diese Tiere keine Fliegen, sondern Geradflügler, und zweitens leben sie im geflügelten Zustande nicht einmal einen Tag, sondern nur einige Nachtstunden ( E. danica, allerdings mehrere Tage), die Larven aber 2–3 Jahre, weshalb auch die großen Hochzeitsflüge nur alle zwei oder drei Jahre zu erwarten sind. Noch in einer anderen Beziehung stehen die Eintagsfliegen, die von uraltem Tieradel sind, da riesenhafte, bis 12 cm große Vertreter von ihnen schon in den ausgedehnten Sümpfen der Steinkohlenzeit lebten und in den devonischen Schichten Nordamerikas gefunden werden, ganz einzig da in der gesamten Insektenwelt. Das der Larve entschlüpfende Flügeltier ist nämlich erst ein sogenannter Subimago, der sich nun nochmals häutet, um zum Geschlechtstier zu werden. Die leeren Hülsen der Subimagines findet man massenhaft an den Uferpflanzen haften; daher die Namen »Hafte« oder »Uferaas«. So elfenhaft zart und zerbrechlich die Flügel auch sind, sind sie doch in den Säftekreislauf des Körpers mit eingeschlossen und führen Blut, wie schon der Vater der Mikroskopie, Ehrenberg, ganz richtig vermutet hat. Neuerdings ist es dem belgischen Zoologen Berroets gelungen, durch Farbstoffe die Bewegung des Blutes im Flügel sichtbar zu machen. Es tritt durch die vordere Ader des Flügels in diesen ein und kehrt durch die hintere Ader wieder in den Körper zurück. Wenn die Eintagsfliegen schwärmen, haben die Fische gute Zeit und mästen sich förmlich an dieser leckeren Kost; selbst ausgesprochene Grundfische kommen dann zur Oberfläche herauf. Kellner bezeichnet diese Kerfe deshalb geradezu als das Manna der Fische. In Frankreich benützt man die Eintagsfliegen gern als wirksamen Forellenköder, obgleich sie sich leicht vom Angelhaken ablösen. Auch sonst ist der Mensch natürlich bestrebt gewesen, sich das Massenerscheinen dieser Kerfe nutzbar zu machen. Durch angezündete Feuer, Fackeln oder Petroleumlampen lockt man die Tiere an, damit sie geblendet auf die daneben ausgebreiteten Tücher fallen. In Ungarn ist die Ausbeute oft so groß, daß die »Theißblüte« zum Düngen der Felder dient, Aber auch an der unteren Elbe erntet ein Fischer in einer, Nacht nicht selten bis zu 30 kg »Weißwurm«. Die abgestorbenen Tiere werden in flachen Schichten 1–2 Tage zum Trocknen ausgebreitet, worauf dann beim Umschütten Flügel und Beine leicht abbrechen und nur die Leiber zurückbleiben, die ein ausgezeichnetes, sehr nährkräftiges Fisch- und Vogelfutter bilden und entsprechend teuer bezahlt werden. Die im Wasser lebende Larve läßt von der zarten, duftigen Schönheit des künftigen Tieres noch nichts ahnen, ist vielmehr ein vierschrötiger, plumper, flachgedrückter, recht gefräßiger und gewalttätiger Bursche mit drei Schwanzborsten und blattförmigen Anhängen an den vorderen Bauchringen, die die Atmungswerkzeuge darstellen. Sie haust in Löchern, die sie sich unter Wasser in die Uferwände bohrt, und zwar in U-Form, so daß sie sie jederzeit verlassen kann, ohne sich umdrehen zu müssen.
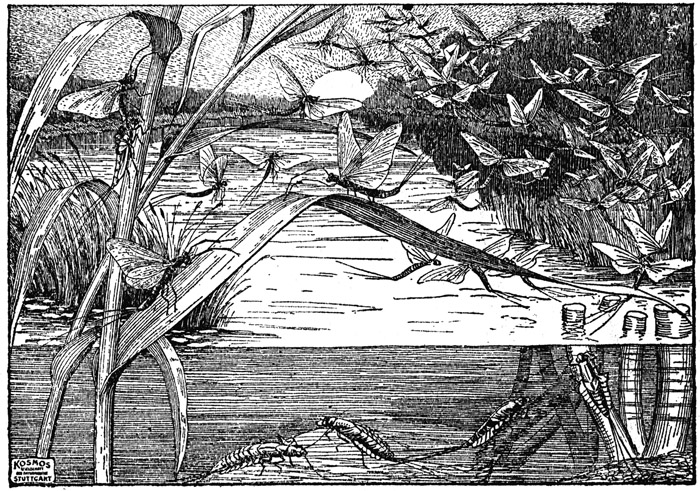
Abb. 20. Eintagsfliegen. ( Ephemera vulgata.)
Wenn wir einige von ihnen fürs Aquarium mitnehmen, um sie zu Hause näher beobachten zu können, erwischen wir dabei wohl unbeabsichtigt noch allerlei anderes Getier, das uns nun erst auffällt. Da kriecht ein braunes, häßliches und schmutziges, fast 4 cm langes Etwas auf sechs dürren, weit nach dem Kopfe zu vorgerückten Spinnenbeinen am Boden, schwenkt seinen wurstförmigen Hinterleib, hat einen widerwärtig plumpen, roh gezackten Rumpf und einen scheußlichen Krötenkopf. Eine Libellenlarve ist's, und zwar die des Plattbauchs ( Libellula depressa; Abb. 21). Drei stachelartige kurze Fortsätze am Hinterleibsende verraten die nahe Verwandtschaft mit den Eintagsfliegen. Auf dem Rücken sitzen schon ein paar kurze Flügelstummel. Gewiß, das Mammutgerippe im Museum ist imposanter, ausgestopfte Paradiesvogel bestechen das Auge mehr, die Löwen im Tiergarten wissen durch ihr Gebrüll die Aufmerksamkeit ganz anders auf sich zu lenken, aber so eine lebende Libellenlarve ist auch nicht ohne Reiz, vielmehr voll der geheimnisvollsten Wunder. Beobachten wir sie einmal! Aber das faule Ding will sich nicht von der Stelle rühren. Also ärgern wir sie ein wenig mit einem eingetauchten Glasstäbchen! Nun schwimmt sie wirklich davon. Aber wie! Das geht ruckweise mit förmlichen Puffen, wie ein kleiner Dampfer, und aus dem Enddarm wird dabei jedesmal Wasser mit erstaunlicher Kraft ausgestoßen. Um des Rätsels Losung zu finden, müssen wir uns vergegenwärtigen, daß die Atmung dieser Larven durch den mit Kiemenblättchen ausgerüsteten Enddarm besorgt wird. Aus dem umspülenden Wasser gelangt Sauerstoff in die Kiemenblättchen und Tracheen und von diesen Kohlensäure nach außen, wenn die Larve schwimmen will, öffnet sie mit Hilfe besonderer Muskeln den durch drei sternchenförmige Klappen verschlossenen After und erweitert den Enddarm. Sofort stürzt Wasser in den entstandenen Hohlraum und wird mit Nachdruck ausgestoßen, indem das Tier den Enddarm wieder kräftig zusammenzieht. Der dadurch im Wasser ausgelöste Stoß ist so kräftig, daß er die Larve etwa 10 cm vorwärts treibt, die nun ziemlich rasch davonschwimmt, indem sie das Einziehen und Auspressen von Wasser rhythmisch wiederholt. Nicht alle Libellenlarven bewegen sich auf die gleiche Weise fort. Die Larven der Schlankjungfern ( Agrion) schwimmen viel schlechter und langsamer unter schlängelnden Bewegungen, wobei die bei ihnen reich verzweigten und kammartig entwickelten Afterborsten als Ruder und Steuer dienen. Wenn die Entwicklung der Larven schon weiter vorgeschritten ist und sie bereits Flügelstummel tragen (dann heißen sie Nymphen), bilden sich an ihrem vorderen Körperringe ein paar Stigmen, die auch eine Luftatmung ermöglichen. Die Tiere kommen dann zum Atmen immer häufiger an die Wasseroberfläche empor, steigen auch wohl für kurze Zeit an Pflanzenhalmen an die Luft, um sich einen besonders lockenden Leckerbissen zu holen, am liebsten eigene Artgenossen, die eben ihre letzte Häutung bestanden haben und sich noch im weichen und hilflosen Zustande befinden. Die Segmentierung der Libellenlarven ist überhaupt merkwürdig, denn sie bringt uns die primäre Segmentierung es Insektenabdomns (Hinterleibs) in fast noch ganz reiner und unverfälschter Weise zur Geltung. Die Zwölfgliedrigkeit des Abdomens, die sonst nur noch bei jungen Embryonen beobachtet werden konnte, ist bei diesen Larven vielfach noch deutlich zu sehen, noch besser allerdings bei den geflügelten Geschlechtstieren. Was die Färbung anlangt, so sieht die Larve von Libellula depressa dem Lehmboden ihres Wohntümpels sehr ähnlich und ist dadurch gut geschützt, aber das ist z. T. nur anhaftender Schmutz, denn wenn wir sie rein waschen, sieht sie bedeutend dunkler aus, während auf Sandgrund lebende Larven heller sind. Rosenbaum denkt an einen chemischen Einfluß des Moorbodens auf das noch weiche Chitin der frisch gehäuteten Larven, etwa so, wie die Färbung der Rehbockgehörne und Hirschgeweihe durch Einwirkung des Baumsaftes beim Fegen und des Erdbodens beim Plätzen beeinflußt wird. Dafür spricht auch, daß helle Larven, die auf Sandboden lebten, auch durch Versetzung auf Moorboden nicht dunkler werden, wenn ihr Chitin schon erhärtet war. Von Mimikry ist also hier keine Rede.
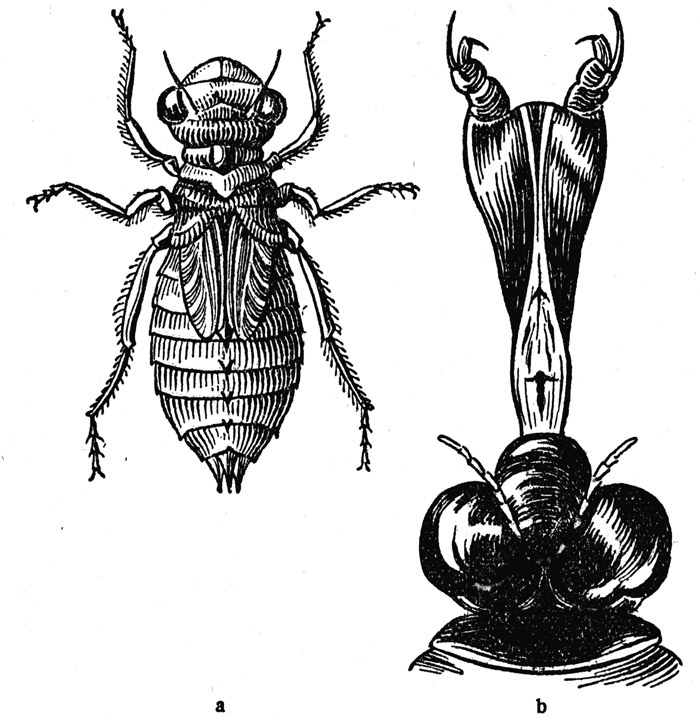
Abb. 21. Plattbauchlibelle. (
Libellula depressa.)
a
Nymphe,
b Kopf mit ausgestreckter Fangmaske.
Doch zurück zu unserer Libellenlarve im Aquarium Sie hat sich nach der kleinen Störung bald beruhigt und liegt nun wieder träge auf dem Boden. Eine der mitgebrachten Eintagsfliegenlarven läuft achtlos an ihr vorüber, eifrig mit den sieben Kiemenpaaren wirbelnd, die an ihrem Hinterleibe sitzen. Die Libellenlarve schielt tückisch zu ihr hinüber, hebt den Kopf ein wenig und – auf einmal zappelt das Opfer im Maule des Scheusals und wird unter hörbarem Knirschen verspeist, worauf sich der Räuber genießerhaft mit der Unterlippe übers Maul fährt, wie wenn sich jemand nach einem guten Zuge Bier mit dem Handrücken den Schnauzbart wischt. Das muß man gesehen haben! Wieder geht es: Schwapp! Eine Wassermilbe ist gefangen. Wieder Schwapp! Ein Wasserkäfer: aber an seinem glatten Chitinpanzer gleiten die mörderischen Zangen des Wegelagerers ab. Schwapp! Ein Würmchen windet sich im Maule der Larve, die uns bald das ganze Aquarium ausgeräubert haben wird, wenn es so weitergeht. Sie besitzt nämlich als Fangapparat eine ungeheure, einklappbare Unterlippe mit zwei Zangen vorn daran und bedient sich ihrer ganz so, wie das Chamäleon seiner vorstreckbaren Zunge, wir machen uns diesen absonderlichen Mordapparat am besten klar, wenn wir uns mit Brehm denken, daß einer unserer Arme statt an der Schulter am Halse eingelenkt wäre; wir legen dann den Oberarm abwärts an die Brust, biegen im Ellbogengelenk den Unterarm aufwärts und legen die Hand aufs Gesicht. Die Singer entsprechen dann den beiden Klauen der »Fangmaske«, wie man das merkwürdige Gebilde nennt. Wie wir dann den Arm in Schulter- und Ellenbogengelenk auf- oder vorwärts ausstrecken und so etwas ergreifen und zum Munde führen können, was um Armeslänge von uns entfernt war, so macht es auch die Libellenlarve, indem sie die in der Ruhe aufeinander liegenden Teile der Maske blitzschnell auseinander und nach dem Einschlagen der Haken in den Leib des Opfers wieder zusammenklappt. Von ihren Schwimmkünsten macht die Libellenlarve bei der Jagd nur selten Gebrauch, sondern lieber belauert sie ihre Beute oder beschleicht sie ganz langsam auf kurze Entfernung nach Katzenart, um dann urplötzlich die mörderische Maske vorzuschleudern. Diese Tiere sind von einer fabelhaften Gefräßigkeit besessen, und die größeren Arten bewältigen sogar Kaulquappen und kleine Jungfische, wodurch sie der Fischzucht merklichen Schaden zufügen können. Ihren gierig vorquellenden Augen sieht man die Mordlust förmlich an. Jäger hatte einmal 50 Fischchen von 1–1½ cm Länge gefangen und trug sie zusammen mit einer großen Libellenlarve nach Hause. Als er am anderen Tage nachschaute, hatte das Untier sämtliche Fischchen ohne Ausnahme getötet und größtenteils aufgefressen, so daß nur noch spärliche Reste vorhanden waren. Nicht umsonst hat man die Libellenlarve als den Haifisch unter den Insekten bezeichnet. Der ungeheuerlichen Freßtätigkeit entspricht eine ebenso rege Verdauung, und die Ausscheidung des Kotes erfolgt mit ganz ungewöhnlicher Energie. Da sitzt dieses Gemütsvieh knapp unter dem Wasserspiegel, sein After mit den drei spitzen Dornfortsätzen ist gerade nach oben gerichtet, es rülpst vernehmlich im Darm – da plötzlich ein hohes Aufspritzen, und der Kotballen klebt an der Aquariumscheibe oder auf der Nase des entrüsteten Beobachters.
Die großen Arten überwintern zweimal als Larven, während die kleineren schon im nächsten Sommer das fliegende Insekt ergeben. Auch unter sich sind die Larven recht unverträglich, zwicken und puffen sich bei jeder Gelegenheit. Nur dann läßt die Freßlust der Libellenlarven nach, wenn sie sich zur Häutung anschicken, besonders zur letzten, bei der ja auch die kräftige Unterlippenmuskulatur abgebaut wird und die Atmung durch Tracheenkiemen aufhört. Es ist etwas Wundersames um die Verwandlung der häßlichen, mißfarbigen Larve in die schlanke, farbensprühende Wasserjungfer. Das Tier steigt an einem Pflanzenstengel aus seinem seitherigen Lebenselement heraus, hält sich mit den Fußklauen ängstlich fest, atmet schwer und verhält sich lange Seit hindurch ganz ruhig. Unter pumpenden Bewegungen des Hinterleibes schwillt der Brustteil ersichtlich an, und plötzlich platzt seine Haut auf dem Rücken auf wie ein zu eng gewordener Frack. Den weiteren Verlauf des seltsamen Vorganges hat namentlich Rott genau verfolgt, und nach seinen Beobachtungen spielt sich die Sache etwa folgendermaßen ab: Aus dem Riß schiebt sich zuerst der Brustteil der Libelle hervor, hierauf zeigt sich der Kopf, dann wird Fuß um Fuß aus seiner Hülle gezogen, wie die Finger aus einem Handschuh, schließlich auch ruckweise die Hälfte des Hinterleibs. Das sichtlich erschöpfte Tier läßt nun eine längere Atempause eintreten und bleibt geraume Zeit kopfabwärts an der, Larvenhülle hängen, die rasch erhärtet und spröde wird (Abb. 22). Noch sind die Flügel erst durch kleine Stummel angedeutet, weich und durchsichtig, von der späteren Farbenpracht keine Spur vorhanden. Ab und zu geht ein schreckhaftes Zittern durch den ganzen Körper. Auf einmal krümmen sich die Flügelstummel abwärts und auswärts, mit einem plötzlichen Ruck wirft sich der hängende Körper nach aufwärts und klebt jetzt oben auf der Larvenhülle, aus der nunmehr auch der Hinterleib vollends herausschlüpft und in einem Bogen nach abwärts hängt. Die Flügel entfalten sich zusehends unter fortwährenden wippenden Bewegungen des vorläufig noch unscheinbar weißlichgrünen und dicken Hinterleibs. Man sieht jetzt so recht, daß sie nichts anderes sind als Ausstülpungen der Oberhaut, zwischen die Luft eingepumpt wird, bis sie ihre richtige Größe erreicht haben. Dabei vertiefen sich die Adern, die Flügel erhärten, was etwa zehn Minuten in Anspruch nimmt, stehen senkrecht vom Körper ab und werden immer klarer und durchsichtiger, während sie anfangs trübweiß gefärbt waren. Der hin und her pendelnde Hinterleib streckt sich erst innerhalb 1¾ Stunden zu seiner ganzen Länge aus, indem die einzelnen Abschnitte sich fernrohrartig auseinanderschieben. Nach drei Stunden sind die Flügel endlich vollends ausgebildet und in der richtigen Stellung, sind glashell geworden und schimmern mit prachtvollem perlmutterglanz, der sich später beim Fliegen wieder verliert. Nach vier Stunden wird der erste Flugversuch unternommen, der aber noch recht ungeschickt ausfällt. Die leuchtenden Metallfarben stellen sich erst nach Ablauf des ersten Tages unter dem Einfluß unmittelbarer Sonnenbestrahlung ein. Nunmehr ist endlich das häßliche, plumpe Wassertier zur leichtbeschwingten, in Farbenschönheit erstrahlenden Libelle geworden!
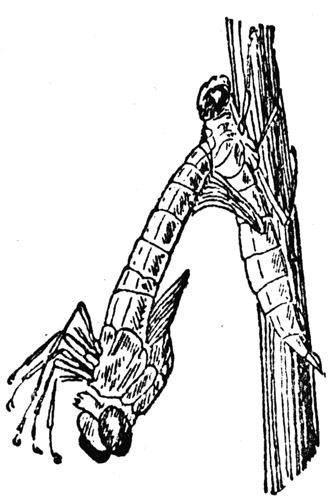
Abb. 22. Ausschlüpfen der Libelle aus ihrer Larve.
Die Libellen, auch Wasserjungfern oder Schillebolde genannt, französisch demoiselles, finden sich versteinert schon im Jura (Solnhofener Schiefer), in der Wealden-Formation, im Miozän und im Bernstein, während sie heute in etwa 1100 Arten über den größten Teil der Erde verbreitet sind, von denen rund 100 auf Europa und etwa 60 auf Deutschland entfallen. Sie gehören zu den Charaktertieren unserer Sommermonate und bilden dann mit ihrem schneidigen Flug und ihrem märchenhaften Farbengefunkei eine hervorragende Zierde wasserreicher Landschaften. Allenthalben sind ihre Arten anzutreffen, am Fluß und am Bach, am Teich und am Sumpf, in der Ebene wie im Gebirge, aber die großen Arten oft auch weitab vom Wasser auf einsamen Waldwegen, wo diesen flinken Jägern immer reiche Leute winkt. Leider ist die Zahl der schönen Geschöpfe ersichtlich im Abnehmen begriffen, und das ist um so mehr zu bedauern, als unsere einheimischen Arten den tropischen an Farbenpracht und Größe kaum nachstehen, wie es doch sonst meist im Tierreiche der Fall zu sein pflegt. In meiner Jugend gab es ungleich mehr Libellen als gegenwärtig. Dies ist neben dem Verschwinden geeigneter Brutgewässer wohl vor allem darauf zurückzuführen, daß jetzt zur Bekämpfung der Stechmückenplage viele Tümpel mit Öl oder Petroleum übergossen werden und so nicht nur die Mückenlarven, sondern leider auch all das andere mannigfaltige und wunderbare Kleintierleben des Süßwassers mit vernichtet wird. Früher galten die lieblichen Wasserjungfern als die Sendboten der Sommergöttin Frigga, aber seit das deutsche Naturempfinden »mit asiatisch-romanischer Brühe übergossen« wurde, wie Löns in seiner kräftigen Art sich ausdrückte, sind sie zu Teufelsbolzen und Satansnadeln umgedeutet worden. Sie gehören teilweise zu den größten und deshalb auffallendsten deutschen Insekten, so die weit verbreitete Edellibelle ( Aeschna grandis, Abb. 23) mit dem bunt geringelten Leib und die Libellenkönigin ( Anax formosus), die in so duftigem Himmelsblau schimmert. Jene mißt 8, diese gar 9 cm in der Länge, und die Flügelspannung beträgt noch ein weniger mehr. Das Flugvermögen der großen Arten ist herrlich. Auf vier glashellen, stark gegitterten Flügeln schießen sie mit reißender Schnelligkeit rauschend durch die Luft und stehen in dieser Beziehung neben gewissen Nachtschmetterlingen unter allen Insekten hoch obenan. Das macht, daß die Bewegung der Flügel bei ihnen durch Muskeln hervorgerufen wird, die am Flügel selbst angreifen, während sonst im Insektenreiche meist nur eine mittelbare Übertragung stattfindet. Die kleinen Arten freilich haben nicht den schneidigen Raubvogelflug ihrer großen Vettern, sondern die Bachjungfern ( Calopteryx) z. B. gaukeln in hüpfendem Fluge auf ihren vier dunklen Schaufelflügeln wie Schmetterlinge durch die Luft. Selbst im Ruhezustande prägt sich dieser Unterschied aus, denn die guten Flieger halten ihre Flügel dabei wagerecht ausgebreitet, während die schlechten Flieger sie schmetterlingsartig nach oben zusammenklappen. Daß es dem Libellenfluge auch an Ausdauer nicht fehlt, beweisen die Angaben glaubwürdiger Seefahrer, die fliegende Libellen 600 englische Meilen von jedem Festland entfernt angetroffen haben. Nächst der Schnelligkeit ihres Fluges sind die Libellen bei ihren Jagden hauptsächlich auf die Schärfe ihres Gesichts, also auf die Leistungsfähigkeit ihrer ungeheuerlich großen, halbkugelförmigen Facettenaugen angewiesen. In der Tat sind diese bis zur höchstmöglichen Steigerung entwickelt. Ihre Bildschärfe ist ja um so größer, je mehr Augenkeile innerhalb eines gegebenen Winkels Platz haben. Bei den Libellen nun umfassen nach Hesse-Doflein die Schenkel eines Winkels 30 bis 60 Augenkeile, also ganz ungewöhnlich viel, denn beim Ohrwurm z. B. nur 5–6. Die Libelle wird also etwa l0mal schärfer sehen als der Ohrwurm. Dazu kommt, daß die Libellen im Gegensatz zur großen Mehrzahl der anderen Insekten in der leichten Beweglichkeit ihres Kopfes ein Mittel besitzen, das Sehfeld der Augen zu vergrößern, insbesondere aber auch den aufs Korn genommenen Gegenstand zu fixieren, d. h. die Augen so zu richten, daß das Bild auf die Stelle deutlichsten Sehens fällt. Über den großen Nachteil des Facettenauges gegenüber dem Linsenauge, nämlich die geringe Lichtstärke, vermag freilich auch die Libelle nicht hinwegzukommen. Die oft in den wunderbarsten Farben schimmernden Augen sind bei Anax, Aeschna und Libellula so groß, daß sie unmittelbar zusammenstoßen, also von oben gesehen den ganzen Kopf einnehmen, während sie bei Calopteryx, Lestes u. a. durch einen Zwischenraum getrennt sind. Überhaupt fällt bei einem Vergleich mit den Eintagsfliegen der dicke Kopf der Libellen sehr auf. Die beißenden Oberkiefer dieser Tiere entwickeln ja eine erstaunliche Kraft, und dazu gehört nicht nur eine starke Ausbildung des Chitingerüsts, sondern auch eine solche der zugehörigen Muskelbündel, für die also am Kopfe Platz und Ansatzflächen vorhanden sein müssen. Die Unterlippe deckt den ganzen Apparat von unten und verhindert ein Ausgleiten der Nahrungsbrocken, die von den beiden Kieferpaaren zermalmt werden. Da der Kopf mit der Brust nur durch einen dünnen Stiel verbunden und der erste Brustring nicht fest verwachsen ist, erhält der ganze Körper eine ungewöhnliche Beweglichkeit. Die Vorderbeine dienen zum Festhalten der Beute, und ihre Schenkel und Schienen sind deshalb stachelig bewehrt. Oft sind die Geschlechter sehr verschieden gefärbt, die Männchen hell und lebhaft, die Weibchen düster und eintönig. Bei manchen Arten finden sich am Hinterleib farbige Hautsekrete, s. z. B. beim Männchen von Libellula depressa, wo diese Ausscheidung sich als ein puderartiger Belag von himmelblauer Farbe geltend macht. Leydig hält diesen leicht abwischbaren Überzug für einen wachsartigen Stoff, über dessen Bedeutung für das Tier man sich aber noch nicht recht klar geworden ist. Selbstverstümmelung (Autotomie) kommt bei Libellen namentlich an den Beinen vor. Hält man eine sitzende Wasserjungfer an einem Beine fest, so läßt sie dieses unfehlbar in unseren Händen und entflieht in verstümmeltem Zustande. Die Trennungsstelle ist durch eine eigenartige Anordnung der Muskulatur am Rumpfe schon vorgebildet, und das Abwerfen des Beines vollzieht sich deshalb überraschend leicht und wahrscheinlich ziemlich schmerzlos. Ganz ähnliche Verhältnisse finden wir auch bei den Larven, die später auch noch den stehengebliebenen Beinstumpf vollends abwerfen und dann das verlorengegangene Glied bei den folgenden Häutungen nach und nach wieder vollständig ersetzen. Dies ist sogar der Fall, wenn die Kiemen an der Spitze des Hinterleibs verletzt und dann vollends abgeworfen wurden.
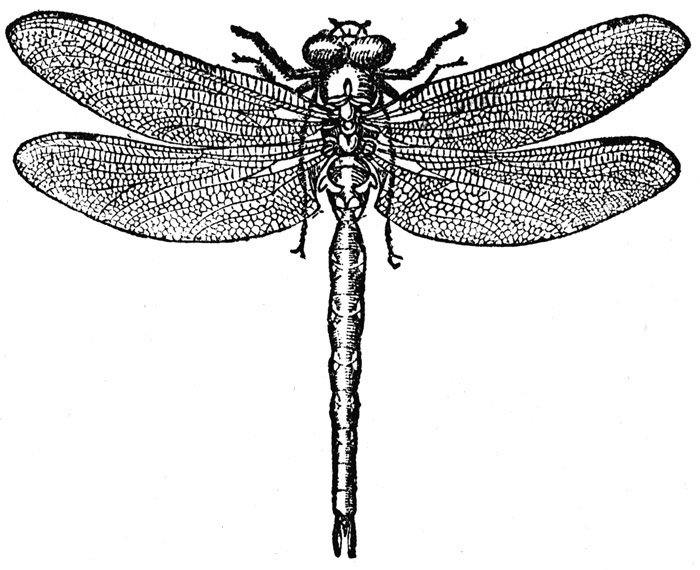
Abb 23. Edellibelle. ( Aeschna grandis.)
Nirgends habe ich auch nur annähernd so viele Libellen gesehen wie im Sommer 1917 in der Dobrudscha. Das flache Sumpfwasser lebte geradezu von Milliarden wimmelnder Larven, und die Mägen der geschossenen Wasservögel waren bis zum Platzen mit ihnen vollgepfropft. Die heiße Sumpfluft zitterte von Billionen glitzernder Flügelschläge, so daß einem die Augen wehe taten. Trotz dieser offenkundigen Übervölkerung konnte ich während meines wochenlangen Dortseins keine Anzeichen von einer Auswanderung der Libellen bemerken. Und doch wußte ich schon von der Kurischen Nehrung her, daß sich auch die Libellen bisweilen in großen Heerscharen auf die Wanderschaft begeben, und erinnere mich eines Tages, an dem der ganze Strand weithin mit toten Wasserjungfern bedeckt war, die bei ihrer Reise über dem Meere wohl durch Sturmwind verunglückt sein mochten. Schon der Abbé Chappé, der 1761 den Durchgang der Venus in Sibirien beobachten sollte, erwähnt einen solchen Massenzug von Libellen aus der Gegend von Tobolsk, aber im allgemeinen hat man später sträflich wenig auf diese hochinteressante Erscheinung geachtet, und erst in neuerer Zeit häufen sich diesbezügliche Mitteilungen. Hagen beobachtete große Libellenzüge in den fünfziger Jahren bei Stettin und Königsberg, Knauthe 1890 in Oberschlesien bei Ziegenhals, wo der Zug in einer Frontbreite von mehreren Kilometern vom zeitigen Morgen bis zum Mittag anhielt, Philippsen 1888 auf Amrum und 1897 auf Föhr, Tarnuzzer 1918 im Engadin, 1920 bei Chur und besonders großartig im heißen Juli 1921 bei St. Moritz, Rabes um dieselbe Zeit im Saaletal. Das äußere Bild solcher Wanderungen wird von allen Beobachtern ziemlich übereinstimmend geschildert, scheint also gleichmäßig zu sein. Ich greife ein beliebiges Beispiel heraus: Die Heerschar bildet ein stundenlang vorüberziehendes Band dicht gedrängter Tiere, die in etwa Haushöhe fliegen, ist etwa sechsmal so breit wie hoch und hebt sich um so schärfer ab, als die Luft rechts und links davon völlig frei ist von Insekten. Von der einmal eingeschlagenen Richtung wird nicht abgewichen; ein bestimmter Instinkt scheint die Tiere zu leiten. Die Schnelligkeit der Flieger ist ungefähr die eines kurzen Pferdetrabs, also verhältnismäßig unbedeutend gegenüber dem rasenden Flug, der sonst diese Tiere auszeichnet. Der eigentümliche Glanz der Flügel läßt erkennen, daß es sich durchgängig um frisch ausgeschlüpfte Stücke handelt. Sie rauben bei ihrer Wanderung nicht, auch wenn es ringsum von Fliegen und anderem Getier wimmelt, sondern ziehen unbeirrt, ruhig und gleichmäßig ihre Bahn, wie Bänder von Nebelwolken wallt die Gesellschaft durch die Luft, und wenn sie sich niederläßt, überziehen hunderttausende zitternder Glasflügel Bäume und Mauerwerk mit glitzernden Girlanden. Unsere Fischer sperren dann schleunigst ihre Hühner ein, weil der Genuß von Libellen angeblich die Legetätigkeit ungünstig beeinflussen oder gar schwere Verdauungsstörungen hervorrufen soll. Ob etwas Wahres an der Geschichte ist, vermag ich nicht zu sagen, hauptsächlich ist an solchen Massenzügen Libellula quadrimaculata beteiligt, demnächst auch L. depressa, L. striolata u. a. Schwieriger ist es, über das Warum solcher Wanderungen Klarheit zu gewinnen. Löns denkt im Anschluß an ähnliche Erscheinungen beim Lemming, Steppenhuhn, Heerwurm und Baumweißling an Übervölkerung und daraus sich ergebenden Nahrungsmangel, aber nach meinen in der Dobrudscha gemachten Erfahrungen vermag ich ihm darin nicht beizupflichten. Ein bestimmter Zweck muß aber doch vorliegen. Sollten die Tiere wirklich, wie Brehm vermutet, eine instinktive Ahnung davon haben, daß für die Masse der zu erwartenden Nachkommenschaft die seitherigen Brutgewässer mit ihren Nährtieren nicht ausreichen würden? Oder flüchten sie vielleicht nur vor Wetterstürzen und Stürmen aus offenen Gegenden in geschütztere? Beruht der geheimnisvolle Zwang, der sie vorwärts treibt, in diesem Falle auf besonderer Empfindlichkeit feiner Sinnesorgane gegen Schwankungen des Luftdrucks und der Luftelektrizität, wie wir es von den Zugvögeln wissen und wie es neuerdings auch für gewisse Schmetterlingsarten nachgewiesen wurde? Beobachtungen, die man bei den Libellenzügen in Südamerika gemacht hat, sprechen dafür. Dort gilt das Erscheinen von Libellenschwärmen als ein sicheres Vorzeichen für das baldige Losbrechen heftiger Steppenstürme, des gefürchteten Pampero, von dessen Herannahen der Mensch noch nichts ahnt, während die Libellen bereits vor ihm flüchten und ängstlich ein schützendes Gehölz oder Röhricht zu erreichen suchen. Auch hier sind also noch viele Rätsel des Tierlebens zu lösen, auf die erst künftige Forschung eine befriedigende Antwort finden kann. Sicher ist, daß auch unter gewöhnlichen Verhältnissen die Libellen gegen elektrische Spannungen in der Luft sich sehr empfindlich zeigen, und namentlich vor dem Ausbruche eines aufziehenden Gewitters bekunden sie eine große Unruhe, verlieren sie die ihnen sonst in so hohem Maße eigene Selbstsicherheit.
Merkwürdig genug verläuft die Hochzeitsfeier der Libellen. Das Männchen späht bei seinen Jagden immer lüstern nach einem Weibchen und vertreibt mit heftigem Flügelrascheln jeden Nebenbuhler. Bei diesen Eifersuchtskämpfen setzt es immer kleine Verletzungen ab, namentlich Flügelzerfetzungen, und bei manchen Arten ist es deshalb kaum möglich, ein ganz unbeschädigtes Männchen zu bekommen. Bisweilen wird bei dem heftigen Zusammenprall der Schwächere betäubt und taumelt hernieder, wo schon ein feister Frosch auf den großen Bissen lauert und so seine Kaulquappensippe rächt, die von der Libellenlarve gezehntet wurde. Ist ein Weibchen gefunden, so gibt es eine wilde Hetzjagd über Wasser und Schilf durch Baumwipfel und Sträucher, wobei die Fluggewandtheit der Tiere zum vollsten Ausdruck kommt, bis endlich die Schöne sich gibt. Das Männchen hält sie mit seiner Hinterleibszange im Genick fest, und so taumelt das glückliche Zweigespann weltvergessen durch die Lüfte, vom Willen des Stärkeren gelenkt, der immer vorne fliegt. Nun gibt's kein Entwischen mehr, und bald folgt die Begattung in der sonderbar verschlungenen und verkrümmten, sehr innigen Stellung, die Abbildung 24 veranschaulicht. Die Geschlechtsöffnungen liegen dabei aber einander nicht unmittelbar auf, und das Männchen muß also die Samenflüssigkeit noch irgendwie übertragen, worüber aber nichts Näheres bekannt ist. Bei manchen Arten läßt das Männchen auch nach vollzogener Begattung sein Weibchen noch nicht los, sondern fliegt mit ihm über dem Wasserspiegel einher und zwingt es zu wippendem Eintauchen des Hinterleibs, wobei jedesmal einige der befruchteten Eier entleert werden. Bei anderen Arten besorgt das Weibchen tänzelnden Fluges dieses Geschäft selbst und freiwillig, wieder andere, bei denen das Weibchen mit einem säbelförmigen Legebohrer ausgerüstet ist, fliegen paarweise zu einem Schilf- oder Binsenstengel. Hier sticht das Weibchen eine Schuppe vom Stengel los, schiebt ein Ei in das von Luftmaschen erfüllte Pflanzenmark, drückt das Schüppchen wieder an und setzt diese Arbeit, immer in Begleitung des Männchens, eifrig fort, indem es von oben nach unten steigt, bis es auf dem Boden angekommen ist. Es ist also den Tieren ganz gleichgültig, ob sie sich dabei in der Luft oder im Wasser befinden, und es macht auf den Zuschauer einen verblüffenden Eindruck, wenn das Liebespärchen plötzlich im feuchten Elemente untertaucht, wo vielleicht ein gieriger Fischrachen weiteren Ehefreuden ein vorzeitiges Ende bereitet. Siebold hat jedoch beobachtet, daß das Pärchen vor dem Eintauchen jedesmal die Vorsicht gebraucht, alle vier Flügel dicht aneinander zu legen, und daß das Weibchen erst dann wieder mit dem Eierlegen beginnt, wenn auch das rasch nachrückende Männchen vollständig unter Wasser ist. Libellula quadrimaculata pflegt ihre Eier in Gestalt umfangreicher Laichmassen an Wasserpflanzen abzusetzen, was aber ungewöhnlich ist. Die Weibchen vieler Agrion-Arten setzen sich auf die Blätter schwimmender Wasserpflanzen, biegen ihren Leib um den Blattrand herum und schieben dann die Eier in die Blattsubstanz der Unterseite. Eine höchst sonderbare und auffallende Beobachtung hat man neuerdings bei dem Männchen von Libellula candalis und Cordulea aenea gemacht. Die verbreiterte Hinterleibsspitze dieser Tiere weist nämlich auf der Unterseite eine geräumige, an den Rändern mit steifen Haaren beborstete Rinne auf, und in dieser Rinne hat man Häufchen entwicklungsfähiger Eier gefunden. Auf welche Weise sie dorthin gelangt sind, ist allerdings schleierhaft. Überhaupt bedarf diese absonderliche Erscheinung noch sehr der näheren Aufklärung, aber wenn sie sich bewahrheiten und einer kritischen Nachprüfung standhalten sollte, hätten wir hier den hochinteressanten Fall einer Brutpflege im männlichen Geschlecht bei Libellen vor uns. Auch Bastardbildungen zwischen verschiedenen Libellenarten sind schon öfters nachgewiesen worden.
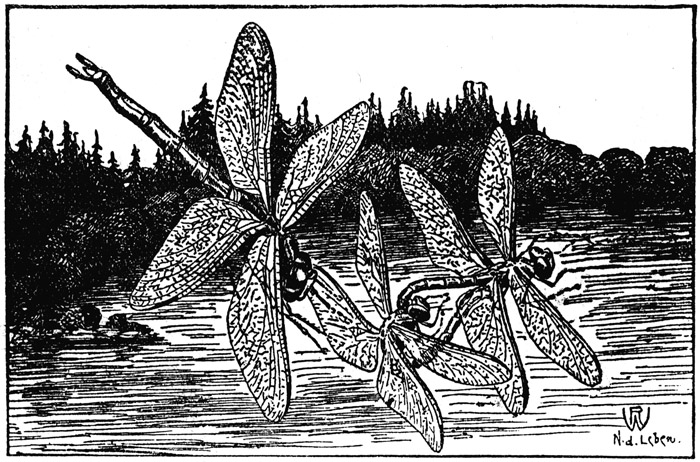
Abb. 24. Hochzeitsflug der Libellen.
Die Libellen sind ausgesprochene Sonnentiere wie die Eidechsen, die Tagschmetterlinge und die Schwalben. Nur bei Sonnenschein entfalten sie die ganze Anmut ihres Wesens, nur dann jagen, spielen, tändeln und lieben sie, während sie bei schlechter Witterung träge und mißmutig an den Wasserpflanzen sitzen. Nur die ganz großen und starken Arten fliegen auch noch in der Abenddämmerung oder tummeln sich im Schatten, und die düster gefärbte Abendjungfer vertritt gewissermaßen das Eulengeschlecht im Libellenreiche. Das bestechend schöne Aussehen der Libellen entspricht nicht ganz ihrem Wesen, denn sie sind gar wilde und leidenschaftliche Räuber und fast ebenso arge Fresser wie ihre Larven, was wohl mit dem starken Kräfteverbrauch während des Fluges zusammenhängt. Zwar die kleinen Rohrjungfern begnügen sich damit, Blattläuse und winzige Fliegen von den Schilfblättern abzulesen, aber die großen Arten sind die Raubvögel, die edlen Falken des Insektengeschlechts. Wie Falken stoßen sie schräg von oben blitzschnell auf ihre Opfer, und nur selten stoßen sie fehl. Stechmücken und Fliegen fallen den mittelgroßen, Bremsen und Schmetterlinge den ganz großen Arten zur Beute, namentlich Kohlweißlinge, denen sofort die Flügel abgebissen werden. Kleinere Tiere werden mit bewundernswerter Geschicklichkeit im Fluge verzehrt, große zu einer Schlachtbank geschleppt. Nicht selten kann man sehen, wie die Libelle das eben ergatterte Opfer in der Luft verschlingt und gleichzeitig schon mit den übermäßig großen Augen gierig nach einem neuen Umschau hält. Gern fliegen die »Schillebolde« über größeren Wasserflächen beständig im Kreise und schnappen dabei alles weg, was ihnen in die Quere kommt und halbwegs zu bewältigen ist. Wählerisch ist der Räuber nicht, sondern er nimmt alles, was nicht zu umfangreich und nicht zu hartschalig ist. Zweifellos werden sie uns durch Vertilgung lästigen Ungeziefers ebenso nützlich, wie ihre Larven sich der Fischzucht gegenüber als schädlich erweisen. Aber nicht um ihren geringen Nutzen oder Schaden darf es sich handeln, sondern ihre Bedeutung liegt auf ästhetischem Gebiet. Denn schön sind sie, wunderschön! Allein ihre Augen! Bei den blitzend goldgrünen Goldjungfern leuchtet es aus ihnen wie versunkenes Goldgeschmeide aus tiefgrünem See, funkelt es wie Smaragden in goldiger Fassung, wer Libellen näher beobachtet, diese stolzen Räuber der Lüfte mit dem Nadelleib und den Florflügeln, diese sechsbeinigen und vierflügeligen Edelfalken mit dem Kolibrikleid, der muß sie lieb gewinnen, welch entzückender Genuß für den sinnigen Naturfreund, wenn die Waldlibelle so nahe an ihm vorübersaust, daß er das köstliche Blau ihres schlanken Leibes und den Goldglanz ihrer Schwingen zu erkennen, daß er ihr rasendes Gleiten, ihr jähes Schweben und dann doch wieder die zielbewußte Gelassenheit ihres scheinbar so wilden Fluges zu erkennen vermag; wenn die zarten Schmaljungfern wie schimmernde blaue und grüne, rote und geringelte Metallnadeln durch die Luft sausen; wenn die kleinen Rohrjungfern mit gebrechlichen Silberflügelchen das goldgrüne Leibchen tragen; wenn gar die stolze Libellenkönigin das lasurblaue, schwarzverbrämte Seidengewand und die Goldfiligranflügel reißenden Fluges über dem Wasser im Sonnenlicht aufblitzen läßt! Wahrlich, neben den bunten Tagschmetterlingen sind die Libellen die schönsten aller Kleintiere, und das hat auch wohl der Dichter empfunden, als er beide zusammenstellte:
—————
—————