
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Als ich vor Jahren an der Westküste Marokkos meine kleine Karawane zusammenstellte, um nach der südlichen Hauptstadt Marrakesch zu ziehen, sagten mir die dortigen Europäer, ich solle in Marrakesch doch ja auf die Spatzen achten, denn sie seien auf der Oberseite blau und auf der Unterseite rot. Ich wußte zunächst gar nicht, was ich aus diesen merkwürdigen Spatzen machen sollte, aber schon der erste Morgen in Marrakesch brachte des Rätsels Lösung. Kaum hatte ich die Flügel der nach dem Hof führenden und zugleich die Stelle des fehlenden Fensters vertretenden Tür geöffnet, als auch schon ein Vogelpärchen unter fortwährenden metallischen Lockrufen und mit den graziösesten Bewegungen ohne alle Umstände ins Zimmer hereinhüpfte und dessen Boden nach etwas Genießbarem absuchte. Wie selbstverständlich und ohne jede Scheu durchstöberten sie alle Winkel, und ihre befriedigten Töne zeigten an, daß überall noch etwas Genießbares für ihren hungrigen Schnabel zu finden war. Setzte ich mich später zum Frühstück nieder, so kamen die dreisten Dinger auch auf den Tisch und nahmen hier dankbar die Brotkrumen an, die ich ihnen zuwarf. Sind sie gesättigt, so treiben sie sich doch noch lange im Zimmer spielend und tändelnd herum und besichtigen mit offenbarer Neugier alles Fremde und Ungewohnte. Oft, wenn ich las oder schrieb, setzte sich das Männchen auf meine Stuhllehne, machte es sich hier gemütlich und ließ eifrig sein schlichtes Liedchen erschallen. Ja, wenn ich mich ganz ruhig verhielt und keine den Vogel auf kurze Zeit verscheuchende Bewegung machte, ließ er sich wohl gar auf der Kante des aufgeschlagenen Buches, das ich in der Hand hielt, nieder, putzte emsig sein Gefieder und schaute mich aus seinen schwarzen Perläuglein so unschuldig und vertrauensselig an, als gäbe es gar keine vogelmordenden Menschen auf der Welt. Andere hatten inzwischen der Küche, dem Gesindezimmer und dem Stalle einen Besuch abgestattet, bis endlich die ganze Gesellschaft wieder in den Hof entflatterte, hier ein Bad nahm und sich dann pärchenweise singend und spielend im Gezweig der Granatapfelbäume niederließ. Lange dauerte die Siesta daselbst aber nie, dazu sind diese lieblichen Geschöpfe viel zu unruhig und quecksilbern; bald waren sie wieder auf dem Erdboden und trieben harmlos ihr stillgeschäftiges Wesen, um dann beim Mittagessen wieder meine willkommenen Gäste zu sein.
Der angebliche »Spatz« war die Sahara- oder Wüstenammer ( Emberiza saharae), und infolge ihrer vielen bestrickenden Eigenschaften und ihrer geradezu unglaublichen Zutraulichkeit hatte sie bald mein ganzes Herz gewonnen. Bei den Arabern, die sie »Bibert« nennen, gilt sie geradezu als heilig, da sie der Sage nach bei der Gründung von Marrakesch, vor den Erbauern herhüpfend, diesen die Lage und Länge der gewaltigen Stadtmauern bezeichnet haben soll. Kein Araber tut ihr etwas zuleide oder duldet, daß ihr von anderer Seite etwas geschieht, und ich mußte mit aller Vorsicht zu Werke gehen, als ich gezwungen war, einige der Wissenschaft zu opfern. Das Unpassendste an dem hübschen Vögelchen ist jedenfalls sein Name, denn es ist durchaus kein Wüstenvogel, fehlt der eigentlichen Wüste vielmehr völlig und ist daselbst nur in den größeren und besiedelten Oasen zu finden, über die es sich niemals hinauswagt, viel richtiger würde es meines Erachtens »Hausammer« heißen, denn es hat sich dem Menschen in einer so innigen Weise angeschlossen, wie keine andere mir bekannte Vogelart. Selbst unser Haussperling kommt ihm in dieser Beziehung lange nicht gleich; denn der Spatz weiß stets voll Mißtrauen und aus guten Gründen einen gewissen sicheren Abstand zwischen sich und dem Herrn der Schöpfung zu wahren, während die Hausammer, wie wir sie also lieber nennen wollen, diesem rückhaltlos vertraut und ihr bescheidenes Dasein mit dem des Menschen förmlich verwoben hat. Wo keine menschlichen Niederlassungen vorhanden sind, da gibt es auch keine Hausammern. In ihrem ganzen Wesen und Benehmen steht die Hausammer zwischen den Ammern und den Prachtfinken mitten inne, und so anspruchslos ihr bescheidenes Lied auch ist, besser als irgendeines der mir bekannten Ammerlieder klingt es doch immer noch. Ende Februar schleppt das Pärchen eifrig Material zum Bau des flachen und losen Muldennestes herbei, das in irgendeiner Mauernische errichtet wird. Nie habe ich darin mehr als drei Eier gefunden, wie ja überhaupt eine geringe Eierzahl für die meisten gefiederten Bewohner der nordafrikanischen Küstenländer charakteristisch ist. Was die Arglosigkeit der Vögel dem Menschen gegenüber anbelangt, kann man in Marokko überhaupt sein blaues Wunder erleben. Arten, die bei uns zu den allerscheuesten zählen, deren Beobachtung die Aufbietung aller nur denkbaren Jägerkniffe verlangt, treiben dort ungescheut in unmittelbarster Nähe des Menschen ihr anziehendes Wesen. In den zerbröckelnden Stadtmauern brüten überall Turm- und Rötelfalken, Blauracken und Wiedehopfe, auf den Kuppeln der Badehäuser Milane, und auf den Fleischmärkten spazieren die herrlich silberweißen Kuhreiher mitten im Menschengewühl. Daß die Hauptursache für diese den Europäer anfangs in hohem Maße verblüffende Erscheinung nur in der großen Tierfreundlichkeit des Mohammedaners zu suchen ist, liegt auf der Hand, und Indien bietet ja eine Menge Parallelerscheinungen. So oder doch ähnlich könnte es auch bei uns sein – und wie sieht es in Wirklichkeit aus?!
Die Neue Welt besitzt ein liebliches Gegenstück zur Wüstenammer in dem Hausgimpel ( Carpodacus familiaris) der westlichen Staaten Nordamerikas und Mexikos. Diese schönen Vögel, deren alte Männchen ein Kleid von mannigfach und zart schattiertem Purpur tragen, sind gleichfalls von einer geradezu rührenden Vertrautheit und brüten im März allenthalben im Winkelwerk der Häuser, aber auch in den Hecken und Sträuchern der Gärten. Sie sind sehr beweglich, von fröhlichem Wesen und von verträglichem und mildem Charakter. Im Herbste schlagen sie sich zu großen Flügen zusammen und brandschatzen während des Winters die Knospen der jungen Bäume. Diese kleine Unart machen sie aber im Frühjahr reichlich wieder wett durch ihren wahrhaft herzerfreuenden, zärtlichen und melodischen Gesang, der bald sanft trillert, bald hellauf schmettert. Auch an reizenden Gartenvögeln, die sich dem Menschen mehr oder minder innig angeschlossen haben, ist Nordamerika nicht arm, und nicht wenige davon gelangen ja auch öfters in die Hände unserer Liebhaber, die ihres Lobes voll sind. Dies gilt namentlich von dem in seiner Heimat allbeliebten Hüttensänger, in dessen Rückengefieder sich des Himmels reines Ätherblau zu spiegeln scheint. Auch der wirbelnde Gesang wirkt bei aller Einfachheit unendlich traulich und anheimelnd. Der heitere und zutrauliche Vogel ist ein Höhlenbrüter, der leider in manchen Gegenden durch die aus Europa eingeführten Spatzen verdrängt wird. Die Lebensweise des blauen Vögelchens, das bei aller scheinbaren Zartheit ein recht abgehärteter Bursche ist, klingt an die der Fliegenfänger und Steinschmätzer wie auch an die der Grasmücken und Erdsänger an, so daß es gewissermaßen einen biologischen Mischtypus darstellt. Meist erhascht es seine Beute laufend, und gern geht es auch hinter dem Pfluge des ackernden Bauern den Regenwürmern nach, während es sich im herbste mehr an Beerenkost hält. Künstliche Nisthöhlen nimmt der Hüttensänger gern und dankbar an, und das gleiche gilt von seiner Nachbarin, der stürmischen Purpurschwalbe, die also im Gegensatz zu unseren Schwalben Höhlenbrüterin ist. Sogar die ausgehöhlten Kürbisse bezieht dieser sehr gesellige Vogel, die häufig die Neger an langen Stangen für ihn aushängen.
Aber noch sehr viel zutraulicher, richtiger gesagt unerfahrener und dreister als solche Haus- und Gartenvögel sind die gefiederten Bewohner kleiner, nur selten vom Fuße des Menschen betretener Inseln in abgelegenen Teilen des großen Weltmeeres. Fast wie ein Märchen klingt z. B. das, was uns die Naturforscher von dem Vogelleben auf der Koralleninsel Laysan im nördlichen Stillen Ozean, 1600 Kilometer von Honolulu, erzählen (vgl. Schauinsland, »Drei Monate auf einer Koralleninsel«, Bremen 1899). Finken und Rallen liefen ihnen dort über die Füße, andere Arten ließen sich gern anfassen und streicheln oder kamen neugierig herbeigeflogen und sahen den großen zweibeinigen Rätselwesen freundlich prüfend ins Gesicht oder untersuchten voll Wissensdrang deren photographische Apparate. Nahm man seinen Weg durch die großen Albatroskolonien, so blieben die Tiere ruhig sitzen, so daß man um sie herumgehen mußte, um sie nicht zu verletzen. Kam man trotz aller Vorsicht mit ihnen in allzu nahe Berührung, so knuffen sie den Ruhestörer ganz gekränkt in die Waden, was in Anbetracht ihres kräftigen Schnabels nicht gerade ein Vergnügen zu nennen war. Hinter jedem Grasbüschel sah man dort das gutmütige Gesicht eines Albatroskindes, das in seiner beschaulichen Wohlgenährtheit und mit der Dunenhaube auf dem Kopf, in die der Wind hineinblies, einen äußerst drolligen Anblick gewährte. Übrigens legt jedes Albatrosweibchen nur ein einziges Ei und macht sich zu dessen Aufnahme aus dürren Halmen und Laub ein primitives Nest am grasigen Hang zurecht. Auch auf Laysan sind die geschilderten paradiesischen Zustände – gewesen, denn seit einigen Jahren wird die weltentlegene Insel auf Guano ausgebeutet, und damit ist es mit der idyllischen Ruhe für die Vogelwelt vorbei. Karrenweise schafft man die Eier der Albatrosse und der anderen Seevögel zur Ausfuhr nach den Schiffen. Die noch immer nicht verschwundene Dreistigkeit der Vögel verursacht dabei manchen tragikomischen Zwischenfall. So las ich, daß ein Japaner, der zwei große Eierkörbe zum Strande trug, von einem im Fluge anstreichenden Albatros mit einem so kräftigen Schwingenschlage getroffen wurde, daß er kopfüber in den gesammelten Eiervorrat stürzte und sich dann unter großem Gelächter seiner Gefährten in einem unbeschreiblichen Zustande aus seinem zertrümmerten Gut erhob. So wundervoll der Albatros auch das weite Meer beherrscht, so unbeholfen zeigt er sich am Lande. Sein Gang ist nur ein ungeschicktes Watscheln, wobei ihn die Riesenschwingen ersichtlich hindern, so daß er sich bemüht, sie immer möglichst hoch zu tragen. Auch im Tauchen leistet der offenbar nicht sehr intelligente und über eine unangenehm kreischende Stimme verfügende Vogel nicht viel, ist überhaupt zum Fischfang nicht flink und behende genug und muß sich daher in der Regel mit Krustern und Weichtieren begnügen. Diese Kost mag wenig nahrhaft sein, denn der Albatros wird unausgesetzt von einem wahren Heißhunger gequält und fällt deshalb plump auf den primitivsten Köder herein, den ihm gelangweilte Matrosen vom Bord des Schiffes aus zuwerfen. Ist der arme Meeresflieger dann widerstrebend an Deck gezogen, so hat der Reisende mit innerem Grauen oft Gelegenheit, seine wahrhaft erstaunliche Lebenszähigkeit kennen zu lernen. Weit mehr wird ihn der fliegende Vogel fesseln, der allenthalben auf der südlichen Halbkugel beutegierig den Schiffen zu folgen pflegt. Über dem Meere schwebend, ist er mit seiner fast 4 m betragenden Flugbreite eine wahrhaft imposante Erscheinung. In herrlichem Segelfluge gleitet er scheinbar ohne die geringste Anstrengung und unter geschickter Benutzung der Luftströmungen dahin und läßt sich selbst durch heftige Sturmwinde nicht beirren. Kaum scheint er, wenn er so in gleichmäßig-ruhigem Fluge tagelang ununterbrochen der Bahn des Schiffes folgt, ein Ausruhen nötig zu haben, denn nur selten einmal sieht man ihn auf der Oberfläche des Wassers sitzen. Er ist wohl der unermüdlichste aller Flieger.
Wenn auch nicht an Ausdauer, so doch an Schnelligkeit und Gewandtheit im Fluge wird der Albatros noch übertroffen von einem anderen Seevogel, der stolzen Fregatte, die man als den Geier der tropischen Meere bezeichnen könnte. Die Länge ihrer schmalen Flügel setzt sie instand, alle Landraubvögel an Flugfertigkeit zu übertreffen, und wenn der große, schlanke, dunkle und langschwänzige Vogel, von dem man fast nie einen Stimmlaut hört, unter dem tiefblauen Äther herrliche Spiralen beschreibt, gewährt er ein geradezu wunderbares, jedes ästhetisch geschulte Auge auf das höchste entzückendes Flugbild. Trotzdem er so mit wahrer Majestät das Luftmeer beherrscht, entfernt er sich doch nicht weit von den Küsten, wird also nicht weit draußen im Ozean angetroffen wie der Albatros. Dies mag damit zusammenhängen, daß er nicht oder nur schlecht zu schwimmen vermag und deshalb darauf angewiesen ist, seine Nachtruhe auf den Bäumen einsamer Inseln zu halten. Huf solchen brütet er auch am liebsten, und zwar ebenfalls kolonienweise. Er fängt mit Vorliebe und großer Fertigkeit fliegende Fische, die von den Delphinen aus dem Wasser aufgejagt werden, oder jagt auch wohl den Pelikanen ihre Beute ab. In diesem Zusammenhange sei als ein häufiger Begleiter der Schiffe in tropischen Meeren gleich auch noch der Tropikvogel erwähnt, der dem Reisenden durch seine rauh kreischende Stimme und durch sein blendend weißes Gefieder bald auffallen wird. Er ist viel kleiner, nach dem eleganten Typ der Seeschwalbe gebaut, aber wesentlich kräftiger als diese, wenn er in der reinen und ruhigen Luft seine wundervollen Kreise zieht und dabei von den Strahlen der untergehenden Sonne sein silbern schimmerndes Gefieder mit den zartesten Rosatinten übergossen wird, muß er als eine der schönsten und hervorragendsten Zierden warmer Meere bezeichnet werden. Er ist ein gewandter Fischer und erhascht seine schuppige Beute nach Seeschwalbenart stoßtauchend, wobei er oft tief ins Wasser eintunkt. Sein einziges Ei legt er in den Felsspalten einsamer Inseln und Klippen ab.
Von ähnlicher Vertrautheit am Brutplatze wie die Albatrosse sind auch die Riesensturmvögel und die Pinguine der Südpolarländer (Abb. 1), über deren höchst sonderbares Tun und Treiben wir durch die Berichte der neueren Forscher gut unterrichtet sind. Die Pinguine mit ihrer steif aufrechten Haltung, ihrem gravitätisch-würdevollen Benehmen, ihrer hochkomisch anmutenden Grandezza, ihrer blendend weißen Unter- und tiefschwarzen Oberseite haben mich immer unwillkürlich an junge Ballbesucher erinnert, die zum ersten Male in Frack und weiße Weste geschlüpft sind. Es sind gar sonderbare vogelgestalten, deren kurze Beine weit nach hinten eingesetzt und deren Flügel zu federlosen Flossen umgewandelt sind. In ihren großen Brutkolonien herrscht ein streng geordnetes Gesellschaftsleben, dessen Beobachtung dem durch die Einförmigkeit der Landschaft ermüdeten Seefahrer in jenen öden Gegenden manche trübe Stunde zu erheitern vermag. Er vergilt den harmlosen Vögeln diesen wertvollen Dienst aber mit krassem Undank, indem er die Geängstigten vom Meere, ihrem wahren Element, abschneidet und dann unerbittlich mit rohen Knüppelschlägen in den wehrlosen und unbeholfenen Massen wütet. Dauern diese grausamen und rücksichtslosen Verfolgungen, die oftmals nicht etwa durch bittere Notwendigkeit, sondern durch bloße Mordlust hervorgerufen werden, in dem bisherigen Maße fort, dann wird auch den interessanten Pinguinen früher oder später nicht das traurige Schicksal des Riesenalks erspart bleiben. Dieser ist bekanntlich nur noch in Museumsbälgen vorhanden, und seine Eier werden heute mit Tausenden von Mark bezahlt, während sie noch im vorigen Jahrhundert massenhaft von den Matrosen verzehrt oder gar zertreten wurden. Wie alles im Pinguinstaate hübsch ordentlich zugeht, so ordnen sie sich auch zum Fischfang nach Alter, Mauserzustand und vielleicht Geschlecht und üben dann in gemeinsamen Zügen das Fischergewerbe aus, wobei sie eine fabelhafte Geschicklichkeit im Tauchen bekunden. Sie sind ja echte Kinder des Meeres, aber nicht Flug-, sondern Tauchvögel. Zur Brutzeit besteigen sie in ungeheuren Scharen das Land und scharren sich hier zur Aufnahme des Nestes 60-90 Zentimeter lange Höhlen aus, die zum Teil unterirdisch miteinander in Verbindung stehen. Aufs Brüten sind sie so versessen, daß sie sich gegenseitig die Eier stehlen, weshalb immer ein Gatte bei dem Ei zurückzubleiben pflegt, um es zu bewachen und gegen Übergriffe der Nachbarn zu verteidigen. Da das dichte Dunenkleid der Jungen Wasser saugt, müssen diese lange Zeit im Neste sitzenbleiben und die volle Befiederung abwarten, ehe sie sich aufs Meer hinauswagen dürfen. Zwar ist der aufrechte Gang der Pinguine scheinbar unbeholfen, aber sie kommen dabei doch ziemlich schnell vorwärts, von ihren Ansiedlungen aus führen förmliche, gut ausgetretene Wege weit in das Innere der Inseln hinein, und auch die Brutkolonien selbst sollen mit einer gewissen Regelmäßigkeit angelegt sein. Die Fütterung der Jungen schildert Fitz-Roy: »Sie stellen sich auf einen Vorsprung und lassen ihre quakende oder brüllende Stimme ertönen; hierauf beugt die Alte den Kopf herab und öffnet den Rachen so weit als möglich. Das Junge steckt dann seinen Kopf hinein, um anscheinend etwas darin zu saugen, wahrscheinlich also den Kropfinhalt aufzunehmen.«

Abb. 1. Brillenpinguine.
Der Riesensturmvogel, den namentlich der bekannte Forschungsreisende v. den Steinen am Hefte beobachtet hat, läßt sich Belästigungen durch den Menschen nicht so ohne weiteres gefallen und verfügt außer über einen sehr kräftigen und tüchtig beißenden Schnabel noch über ein anderes eigenartiges, aber wirksames Verteidigungsmittel. Er speit nämlich seinen Mageninhalt in Gestalt einer wahren Höllenjauche von durchdringend aashaftem Gestank über den Störenfried aus. Am Lande watschelt auch der Riesensturmvogel mit hochgehaltenen Schwingen nur unbehilflich herum, vollführt aber trotzdem ein recht komisches Paarungsspiel. Das Männchen hat den halbgeöffneten Schnabel an die Kehle gezogen und stiert mit den Augen wie bewußtlos aufwärts, verneigt sich tief nach rechts hin und tief nach links hin. Immer schneller werden diese Bewegungen, und mit blitzschneller Wendung, aber völlig taktgemäß wird der Kopf aus einer Lage in die andere geworfen, bis mit einem plötzlichen Ruck der Hals wieder still und steif aufrecht steht und nun beide Gatten ein herzbewegendes Miauen dem sehnenden Busen entsenden. Es verdient noch erwähnt zu werden, daß das dem weißen Ei entschlüpfende Junge von schwarzer Farbe ist, im Alter aber weiß wird. Dieses auffallende schwarze Jugendkleid ist wohl als eine sekundäre Nützlichkeitserwerbung aufzufassen, da dann die Alten in der Schneelandschaft das Junge leichter auffinden können, wenn sie Futter bringen.
Das in der Einleitung erwähnte vogelfreundliche Verhalten der Mohammedaner und Hindus muß um so höher angeschlagen werden, als es sicherlich nicht in wirtschaftlichen Nützlichkeitsgründen, sondern in rein sittlichen Anschauungen seine Wurzel hat, wenn auch zweifellos ein gut Teil Trägheit und Gleichgültigkeit mit im Spiele ist. Überhaupt tritt ja in den von der Natur so verschwenderisch bedachten Tropen der Nutzen oder Schaden der einzelnen Vogelarten lange nicht so auffällig zutage, wie in unseren sorgfältig bewirtschafteten und intensiv ausgenutzten Kulturländern. Der Tisch ist dort so überreich gedeckt, daß die Erde allen Geschöpfen genügend Raum zur Entfaltung ihrer Eigenart bietet, weitaus die meisten Vögel heißer Länder sind daher für den menschlichen Haushalt vollkommen belanglos. Einige aber machen doch eine Ausnahme, indem sie entweder als eifrige Heuschreckenfresser zu wahren Wohltätern des Menschengeschlechts werden oder als arge Pflanzenverwüster den gerechtfertigten Zorn der Plantagenbesitzer auf sich ziehen. Zu den ärgsten und am schwersten zu bekämpfenden Feinden der menschlichen Kulturen in wärmeren Ländern gehören ja die Heuschrecken, und es muß deshalb als eine für den Menschen sehr glückliche Fügung der Natur bezeichnet werden, daß diese gefräßigen Tiere ihrerseits wieder eine Art von Universalfutter für fast alle größeren Vögel ihrer Heimat bilden. Selbst ausgesprochene Raubvogelarten ernähren sich dort überwiegend von den so mühelos zu erlangenden Heuschrecken. Keiner aber ist in der Vertilgung dieser Schädlinge so unermüdlich und so leistungsfähig wie der schöne Rosenstar (Abb. 2), der in großen Schwärmen den verderblichen Heereszügen der Wanderheuschrecken folgt und jeweils dort im Steingeröll seine Nistkolonien aufschlägt, wo es viele Heuschrecken gibt. Am eingehendsten habe ich die verdienstliche Tätigkeit des Rosenstars in Transkaspien beobachten können. Haben die in kleinen Trupps herumschwärmenden Kundschafter einen größeren Heuschreckenherd entdeckt, so bringen sie die willkommene Kunde alsbald dem Hauptschwarm, und nun stürzt sich dieser wie ein Reiterregiment schwadronsweise mit wahrer Wut zum Angriff auf das schädliche Ungeziefer. Ein bis zwei Heuschrecken packt der Rosenstar mit dem Schnabel, zwei bis drei mit den Krallen, aber selbst mit den Flügeln schlägt er noch um sich. Er hat die für den Menschen in diesem Falle sehr angenehme Eigenschaft vieler Tiere, daß er viel mehr vernichtet, als er zu verzehren vermag. Er schwelgt förmlich im Blute der verhaßten Kerfe, sein zartes, schönes Gefieder wird beschmutzt, getränkt und durchnäßt vom klebrigen Lebenssafte seiner zahllosen Opfer. Dann fliegt der Vogel zum nächsten Gewässer, badet und reinigt sich gründlich und eilt schleunigst wieder zum Schauplatze seiner Tätigkeit zurück, um das Morden unermüdlich fortzusetzen, bis das Hereinbrechen der Dämmerung endlich Einhalt gebietet. Die Eingeborenen verehren deshalb den am Körper schön rosa, am Schwanz und den Flügeln schillernd grünschwarz gefärbten und mit einem netten Schopf geschmückten Vogel sehr und halten ihn gewissermaßen für heilig, sehen es daher auch nur höchst ungern, wenn man auf Rosenstare Jagd macht. Auch die russische Regierung hat deren strengste Schonung angeordnet. Wie weit man in dieser Hinsicht geht, beweist ein mir bekannt gewordener Fall, wo der Bau einer angefangenen Brücke für mehrere Monate unterbrochen wurde, weil in dem dazu losgesprengten Felsgetrümmer sich eine Kolonie Rosenstare niedergelassen hatte. Wie unsere heimischen Stare sind auch die Rosenstare sehr gesellig, fliegen stets in Schwärmen, die genau das gleiche Flugbild darbieten, aber einen entzückenden Rosaschimmer ausblitzen, und musizieren des Abends auf den höchsten Räumen der Gegend.

Abb. 2. Rosenstar.
Ebenso muß der Heuschreckenstar Javas als ein durchaus nützlicher Vogel bezeichnet werden und als ein sehr angenehmer dazu, weil er die Nähe des Menschen und seiner Herden liebt. Eine javanische Landschaft mit weidendem Herdenvieh ist kaum denkbar ohne silberweiße, mit abgemessenen Schritten und eingezogenem Halse gravitätisch einherschreitende Reiher und die schwärzlichen Starvögel, die gemütlich auf dem Rücken der Büffel thronen, dann plötzlich von ihrem Reittier herab zur Erde springen und ein erspähtes Kerbtier erhaschen oder ihm mit großen, plumpen Sätzen nacheilen, wenn sie es nicht gleich beim ersten Anhieb erwischten. Auch die frisch geackerten Felder werden von den Heuschreckenstaren gern besucht und von Ungeziefer gereinigt, ferner der Kot der Herdentiere, ja selbst der des Menschen nach Larven durchsucht. Seine Nester in Baumlöchern kleidet dieser Star gern mit Stückchen von Schlangenhaut aus. Schon die alten Ägypter wußten die hohe Bedeutung der heuschreckenfressenden Vögel wohl zu würdigen. Den weißen Ibis, der ja in Steppengegenden fast ausschließlich der Heuschreckenjagd obliegt, hielten sie für heilig (er wird deshalb noch jetzt »heiliger Ibis« auch in den Naturgeschichtsbüchern genannt), und zu Tausenden finden sich noch heute seine einbalsamierten Leichen in den Pyramiden. Die moderne Zeit dachte weniger sentimental, und nachdem erst das leidige europäische Schießertum seinen Einzug in das sagenumwobene Land der Pharaonen gehalten hatte, waren die Tage des stattlichen Vogels bald gezählt. Schon Brehm traf ihn erst vom 17. Breitengrade an, während er früher auch im eigentlichen Ägypten ungemein häufig gewesen sein muß. Gegenwärtig ist er als kluger Vogel infolge der unablässigen Schießereien fabelhaft scheu geworden, während er früher dem Menschen gegenüber vertrauensselig gewesen sein soll. Jung aufgezogene Ibisse werden nach den geradezu begeisterten Schilderungen Brehms zahmer als irgendwelche Haushühner. Der heilige Ibis brütet gesellig auf dornigen, schwer zugänglichen Mimosen im Überschwemmungsgebiet des Nil.
Den verdienstvollen Heuschreckenvertilgern seien einige gefiederte Pflanzenschädlinge gegenübergestellt. Namentlich die Reisfelder haben oft arg unter ihren Angriffen zu leiden. Da ist z. B. der graue, mit einer schwarzen Kopfplatte versehene Reisfink, dessen unverschämt weißbäckiges Gesicht wir so oft in den Schaufenstern unserer Vogelhändler zu sehen bekommen, wo er zu fabelhaft niedrigen Preisen ausgeboten wird, für die unsere gewöhnlichsten einheimischen Vogelarten nicht zu haben sind. Solange die Reisfelder unter Wasser stehen und der angepflanzte Reis erst heranwächst, halten sich diese Vögel paar- oder familienweise in Gärten, Dorfgehölzen und Gebüschen auf und ernähren sich hiervon verschiedenen Sämereien, mancherlei kleinen Früchten, wohl auch Kerbtieren und Würmern. Sobald aber die Reisfelder sich gelb zu färben beginnen und durch Ablassen des Wassers trockengelegt werden, begeben sie sich in Scharen dorthin und beginnen nun ihrerseits mit der Ernte, wobei sie sich so unverschämt gebärden, daß sie der Reisbauer auf das grimmigste haßt und mit allen Mitteln fernzuhalten sucht. Auch noch auf den brachliegenden Feldern finden sie durch bei der Ernte verloren gegangene Halme ihren Tisch reichlich gedeckt, führen ein sorgloses Schlemmerleben und werden wohlbeleibt und fett dabei. Auch die Paperlinge, eine im sumpfigen Gelände heimische und dort lockere, bodenständige, Nester erbauende Stärlingsart, richten bisweilen böse Verwüstungen in den Reisfeldern an. Das gleiche gilt von dem sonst hochinteressanten Bootsschwanz ( Chalcophanes quiscalus), dessen Schwanz verkehrt, also bootsförmig ausgebogen ist, eine in der ganzen Vogelwelt einzig dastehende Erscheinung. Er zeichnet sich auch durch sein glänzendes Gefieder aus und bewohnt scharenweise sumpfige Gegenden Nordamerikas, wo er im Röhricht sein Nest errichtet.
Als ein äußerst schädlicher Vogel gilt der Pflanzenmäher oder die Rarita ( Phytotomus rara) aus Chile. Er hat einen dicken, kernbeißerartigen Schnabel mit deutlicher Einkerbung vor der Spitze, etwas mehr als Sperlingsgröße und trägt auch ein sperlingsartiges Wesen zur Schau, ist aber den menschlichen Kulturen noch weit nachteiliger als unser gefiederter Proletarier. Er ernährt sich nämlich von Kräutern und hat die fatale Gewohnheit, diese nicht eher zu fressen, bevor er nicht den Stengel dicht über der Wurzel abgesägt hat. Oft schneidet er aber mit dem scharfen Schnabel Pflanzenstengel auch zu seinem bloßen Vergnügen ab und verursacht so unendlichen Schaden in den Gärten, Weinbergen und Getreidefeldern, weshalb man ihn denn auch so ingrimmig verfolgt, daß er an Zahl schon wesentlich abgenommen hat. Papageien hausen zuweilen auch recht niederträchtig in den Pflanzungen. So ist der wegen seiner sprachlichen Begabung von den Vogelfreunden mit Recht so hochgeschätzte Jako oder Graupapagei ein gefürchteter Gast in den Mais- und Bananenfeldern Westafrikas. Sind sie in solchen Pflanzungen erst einmal eingefallen und haben sie mit der ihnen eigenen Vorsicht Wachposten ausgestellt, um gegen unliebsame Überraschungen geschützt zu sein, so hausen sie fast ebenso schlimm wie die Affen, da sie gleich diesen aus bloßem Übermut, Spielerei und Leckerhaftigkeit ungleich mehr zerstören und verwüsten als wirklich verzehren. Zu überraschen sind die klugen und scharfsinnigen Vögel dabei schwer genug. Kein Wunder, daß die ackerbautreibenden Eingeborenen herzlich schlecht auf sie zu sprechen sind und mit grimmigem Behagen die erlegten Graupapageien verspeisen, die übrigens gar nicht übel munden und namentlich eine vortreffliche Suppe abgeben sollen. Auch werden die schön roten Schwanzfedern zu allerlei Zieraten verwendet. Sonst erinnert das anziehende Tun und Treiben dieser hochbegabten Vögel sehr an das unserer Krähen und Stare. Wie diese ist auch der Jako höchst geselliger Natur. Namentlich nach glücklich beendigtem Brutgeschäft, das in schwer zugänglichen hohlen Bäumen vor sich geht, schlagen sich die verschiedenen Elternpaare mit ihrer Nachkommenschaft zu großen, äußerst schreilustigen Flügen zusammen und führen nun ein lustiges Vagabundenleben. Zum Übernachten kommen diese Schwärme aus den verschiedensten Himmelsrichtungen an besonders geeigneten Plätzen zusammen und schwingen sich hier unter vielem Gezänk in den Wipfeln der höchsten und ältesten Bäume ein, aber schon mit Sonnenaufgang geht es dann wieder fort zur Nahrungssuche, wobei die Vögel nach Art der Raben ganz bestimmte Luftstraßen innehalten. Während viele kleine Papageien ganz ausgezeichnete Flieger sind, der Wellensittich z. B. wie ein grüner Pfeil nach Schwalbenart die Lüfte durchschneidet, ist der Flug des Jako ziemlich mühsam und schwerfällig, wenn auch nicht eben langsam, und hat immer etwas unverkennbar Ängstliches an sich. Trotzdem werden weite Strecken zurückgelegt, um zu einer ergiebigen Nahrungsquelle zu gelangen, wobei nicht selten der Geierseeadler sich aus dem unter ohrenbetäubendem Gekrächz entsetzt auseinander stiebenden Schwarm einen leckeren Braten herausholt. Wo der europäische Einwanderer mit seiner intensiveren Kultur erst einmal festen Fuß gefaßt hat, geht es den feldschädlichen Papageien bald an den Kragen. Als typisches Beispiel dafür mag der hübsche Karolinensittich Nordamerikas gelten, ein in tiergeographischer Hinsicht interessanter Vogel, da er von allen Papageien seinen Verbreitungsbezirk am weitesten gegen Norden vorschiebt und sich in Übereinstimmung damit auch bei strenger Kälte noch behaglich fühlt. Die Vögel kriechen dann zur Nachtruhe in hohle Bäume, namentlich Platanen. Wilson fand große Flüge dieser den Pflanzern verhaßten Sittiche noch unter dem 40. Breitengrade, aber heute sind sie schon viel weiter nach Süden zurückgedrängt.
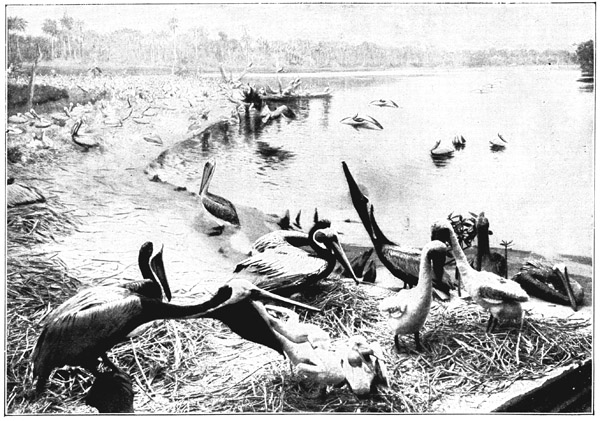
Brauner Pelikan, sein Junges fütternd.
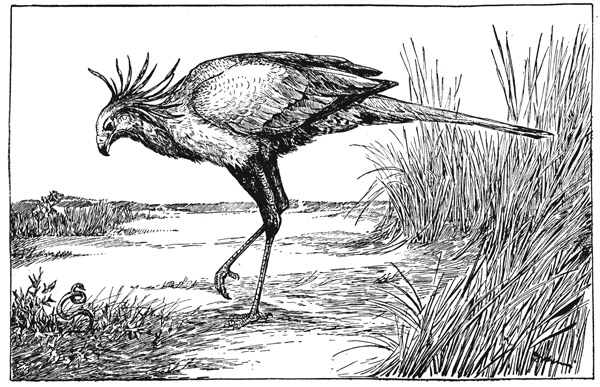
Abb. 3. Sekretär.
Neben den Heuschrecken sind die Giftschlangen die ärgste Plage der heißen Länder, und deshalb waren gefiederte Schlangenvertilger dem Menschen von jeher erwünschte Bundesgenossen im Kampfe gegen die unheimlichen und heimtückischen Reptile. In dieser Beziehung ist besonders der in Afrika heimische Kranichgeier oder Sekretär (Abb. 3) zu nennen, ein gar merkwürdiger und seltsamer Raubvogel mit Kranichhals, langen Storchbeinen, Federschopf und grauer Reiherfarbe, vielleicht ein auf die uralte Verwandtschaft zwischen Raub- und Watvögeln zurückgreifender Vermittlungstyp. Er ist ein Kind der freien Steppe und errichtet in dieser im hohen Buschwerk seinen Horst, der als Grundlage mit Lehm verkittete Reiser und in der flachen Mulde eine weiche Ausfütterung von allerlei Faserwerk und langer Pflanzenwolle hat. Alljährlich wird er ausgebessert und durch eine neu aufgetragene Schicht vergrößert, so daß schließlich der Bau recht stattliche Abmessungen erhält. Der Sekretär ist ein vorzüglicher Läufer, aber ein schlechter Flieger. Neben Kerfen und Lurchen bilden Schlangen seine Hauptnahrung. Erblickt er eine Giftschlange, so sträubt er den Schopf und stürzt sich dann in mächtigem Sprung auf den verhaßten Gegner, schlägt ihn mit den kräftigen Fängen zu Boden, springt wieder zurück und erneuert in fortwährendem hin- und herhüpfen seine immer unwiderstehlicher werdenden Angriffe, bis er das wütend um sich beißende Reptil völlig ermattet hat und ihm nun vollends den Garaus machen kann. Die Flügel gebraucht er dabei wie einen Schild, und auch an den gepanzerten hohen Beinen gleitet mancher matte Biß der Giftzähne ab. Giftfest ist der Sekretär aber keineswegs, muß vielmehr eine Unvorsichtigkeit in dem wütenden Kampfe mit dem Leben büßen. Seines großen Nutzens wegen ist er in Südafrika gesetzlich geschützt, und man hat auch versucht, ihn in anderen schlangenreichen Ländern einzubürgern. Auf Martinique sind solche Versuche nur an der leidigen Schießlust der dortigen Europäer gescheitert.
Eine in unseren Breiten wenig in Betracht kommende Tätigkeit gewisser Vögel ist in warmen Ländern von höchster Bedeutung: ihre Wirksamkeit als Gesundheitspolizei, hervorragendes in dieser Beziehung leisten die Geier (Abb. 4), von denen zwei Arten, der schlankere, weißhalsige, gelblichbraune Gänse- und der robuste, blauhalsige, schwarzbraune Kuttengeier sich ja bisweilen als seltene Irrgäste auch bis Deutschland verstreichen, beide ständig schon in Südeuropa seßhaft sind. Ersterer versucht immer wieder, sich in den Ostalpen anzusiedeln, aber immer fällt der große, jedoch völlig unschädliche Vogel nach kurzer Zeit dem Blei der Jägerei zum Opfer, wie die Geier auch im Orient rasch überall da zu entschwinden pflegen, wo der Europäer sich mit Schießgewehr und Polizeivorschriften breit macht. Der Gänsegeier horstet, oft einigermaßen gesellig, in den Felsennischen steiler Abstürze und legt in Spanien nach Key meist zwei, in Ägypten jedoch nach König stets nur ein Ei, während der Horst des Kuttengeiers auf besonders starken und schwer ersteigbaren Bäumen steht, im Laufe der Jahre zu einem ganz gewaltigen Bau anwächst und fast immer nur ein einziges Ei enthält. Tiefer in Afrika ist der riesenhafte Ohrengeier zu Hause, einer der gewaltigsten Vogelkolosse, der namentlich in seinem äußerst fördernden Fluge ungemein imposant wirkt; wenige Schwingenschläge genügen schon, um ihn aus dem Machtbereich des Menschen zu bringen, hoch in der Luft ziehen die Geier fast ohne Flügelschlag mit der Regelmäßigkeit eines Perpendikels ihre ruhigen Kreise, und ihre bewundernswert scharfen Augen suchen lüstern den Erdboden nach etwa gefallenen Tieren ab. Obwohl es schon oft und selbst von sonst tüchtigen Forschern behauptet wurde, ist es mir doch niemals glaubhaft erschienen, ja kommt mir einfach undenkbar vor, daß ein mit so kümmerlichen Geruchsnerven begabtes Geschöpf wie ein Vogel, der in diesem Falle viele hundert Meter über der Erde schwebt, seine Beute durch den Geruch finden solle, der dann noch viel feiner sein müßte als etwa bei Hund und Hirsch. Nein, nur ihr herrliches Auge ist es, das die Geier auf der Nahrungssuche leitet. Haben sie einen Kadaver erspäht und nach längerer Musterung, wobei sie sich in Spiralen tiefer herablassen, nichts Verdächtiges in dessen Nähe entdeckt, so legen sie plötzlich die riesenhaften Schwingen, die sie erst kurz vor dem Erdboden wieder entfalten, zusammen und stürzen wie ein Stein herab; ohne weitere Prüfung macht es auf Geiersehweite einer dem andern nach, um nur ja nicht bei dem zu erhoffenden leckeren Schmause zu kurz zu kommen. Überraschend schnell ist auf diese Weise eine größere Anzahl der mächtigen Vögel, von deren Vorhandensein man vorher keine Ahnung hatte oder die man höchstens als winzige Punkte in unerreichbaren Höhen kreisen sah, beim duftenden Aase versammelt. Hier entrollt sich nun ein eigentlich ekelhaftes Bild, dem doch eine unwiderstehliche Anziehungskraft für den Naturbeobachter eigen ist. Unter Hasten und Drängen, Stoßen und Balgen sucht jeder der Schwelgenden sich Magen und Kropf so schnell und so reichlich als möglich vollzupfropfen, und so verschwinden die Fleisch- und Weichteile auch eines großen Leichnams binnen unglaublich kurzer Zeit in gierigen Schlünden. Die hastende Eile, die die Geier bei ihrem unsauberen Geschäft bekunden, mag wohl mit darauf zurückzuführen sein, daß die sonst in sicherer Höhe schwebenden Vögel sich auf dem Erdboden nicht recht heimisch fühlen, da sie hier jeden Augenblick von Feinden und Gefahren überrascht werden und ihnen dann nicht schnell genug sich entziehen können. Stopfen sie sich doch bisweilen so voll mit stinkendem Aas, daß sie nur mit größter Anstrengung wieder auffliegen und Luft unter die mächtigen Fittiche bringen können. Rasch handeln und rasch fertig werden – das ist es, worauf es für sie ankommt. Großartig sind sie ausgerüstet zu ihrem eklen Gewerbe. Mit dem langen, nackten Hals können sie tief hineinfahren in die Leibeshöhle des durch kräftige Schnabelhiebe auf die Bauchdecke geöffneten Kadavers, ohne sich das Gefieder zu verschmieren, die leckeren Eingeweide packen und durch Rückwärtsspringen hervorzerren, und die scharfen Schnabelränder sind prachtvoll dazu geeignet, das Fleisch von den Knochen zu schaben und zu nagen. Auch stolzere und adligere Vögel, wie Steinadler und der früher in den Alpen heimisch gewesene, jetzt aber dort leider völlig ausgerottete Bartgeier, seinem ganzen Wesen nach ein interessantes Vermittlungsglied zwischen Geiern und Adlern, nehmen nicht selten an solchen Leichenschmäusen teil. Regelmäßig aber findet sich in Innerafrika dabei ein Watvogel ein, dessen ganze Körperbeschaffenheit ebenfalls dem Gewerbe der Leichenbestattung angepaßt erscheint. Es ist der Kropfstorch oder Marabu (Abb. 5), ein regelmäßiger Insasse unserer Tiergärten, dessen Kleingefieder in der Schmuckfedernindustrie eine Rolle spielt und namentlich zu Damenboas gern verwendet wird. Auch dieser ungemein gefräßige Patron, der selbst junge Krokodile hinunterwürgt, hat Kopf und Hals nur mit leichtem Flaum bedeckt, einen Kropf von gewaltiger Größe, der als natürliche Fleischkammer dienen kann, und großartig entwickelte Flugwerkzeuge, die ein stundenlanges Kreisen und Gleiten in hoher Luft und eine fabelhaft rasche Ortsveränderung ermöglichen. In seinem Äußeren erinnert er an einen griesgrämigen Philosophieprofessor, und in seinem Wesen paart er gravitätischen Ernst und komische Würde mit Verschmitztheit und dummpfiffiger Gerissenheit. Obschon er stundenlang scheinbar stumpfsinnig auf einem Bein steht, ist er doch zweifelsohne ein geistig ungewöhnlich begabter Vogel. Zu dieser Ansicht wird man sich bald bekehren, wenn man einmal gesehen hat, wie die Spielwut über den sonst so ernsten Vogel kommt; in seiner komischen Grandezza stellt er dabei Bilder, die die Lachmuskeln des Beobachters aufs höchste reizen.

Abb. 4. Geier-Versammlung. Photogr. Aufnahme nach dem Leben.

Abb. 5. Marabu.
Südamerika hat neben dem durch die bunte Färbung der nackten Fleischteile auffallenden Königsgeier und außer dem bekannten Kondor, dessen Organisation eine so erstaunliche Anpassung an das Leben in der dünnen Luft der höchsten und ödesten Andengipfel bekundet, namentlich eine Reihe kleiner, netter, oft hübsch befiederter Geier hervorgebracht, die weniger Luft- als mehr oder minder Bodenvögel sind, dabei auch trotz aller Freßneidigkeit ein ausgeprägtes Geselligkeitsbedürfnis haben. Genannt sei hier der Carancho ( Polyborus vulgaris) der Pampasländer. Gemächlichen Schrittes umwandelt er dort die Lagunenränder oder hockt, mit Aas vollgestopft, in stiller und träger, immer aber vorsichtiger Ruhe auf dem Erdboden. Zwar vermögen auch diese Geier zu schweben und zu kreisen, aber gewöhnlich ist der Flug weder hoch noch schnell noch weit. Der Horst steht auf niederen Bäumen oder auch im Schutze eines Schilfbüschels oder Distelstrauches einfach auf dem Boden. Der Chimango ( Milvago pezoporus) nistet gesellig fast immer im dichten, schwer zugänglichen Distelgestrüpp, wo ihm aber doch Stink- und Gürteltiere manches Gelege wegräubern, worüber dann die ganze Gesellschaft ein wenig harmonisches Klagekonzert anstimmt. Gern nagen beide Arten mit ihren scharfrandigen Schnäbeln längst gebleichte Gerippe auf den großen Rinderweiden immer und immer wieder ab, um auch das letzte Fleischpartikelchen loszubekommen, fangen sich aber nebenbei auch Heuschrecken, große Käfer und kleine Schlangen. Der Chimango ist etwas kleiner, noch häufiger und noch mehr Bodenvogel als die erstgenannte Art, kommt auch eher auf die menschlichen Gehöfte, um sie nach Schlachtabfällen abzusuchen. Übrigens sind diese kleinen Geierarten alle sehr zutraulich, da ihnen ja in ihrer Heimat niemand etwas zuleide tut, im Gegenteil ihr Abschießen vielfach unter Strafe gestellt ist. Am innigsten hat sich wohl der schwarzgefärbte, schwach metallglänzende Urubu ( Cathartes urubu) der Brasilianer dem Menschen angeschlossen. Für ihn sind die Schlachthäuser und Fleischmärkte die wichtigsten Nahrungsquellen, die Hausdächer die erwünschtesten Ruhesitze. Besonders versessen ist der Urubu auf Gedärme, und es sieht spaßhaft genug aus, wenn ihrer mehrere an einem in blinder Gier gemeinsam erfaßten Darme »Tauziehen« spielen und schließlich im wüsten Getümmel übereinander purzeln. Wird Schmalhans Küchenmeister, so nimmt der Urubu zu Regenwürmern seine Zuflucht, oder er sucht unter den Küchenhaufen und Kehrichtabfällen nach Kartoffelschalen und anderen wenig nahrhaften Magenfüllern. In seinem Benehmen hat dieser Vogel etwas unverkennbar Hühnerartiges. Oft stehen ganze Herden von ihnen verträumt auf dem Boden herum, ein Anblick, der gewiß mehr an Hausgeflügel denn an »Raubvögel« erinnert. Nach Regengüssen trachtet der Urubu immer so rasch als möglich wieder trocken zu werden, und sitzt dann mit ausgespannten Flügeln unbeweglich in der Sonne da, wie ein verkörperter Wappenadler.
Viele Vögel haben von jeher durch ihr buntes Prachtgefieder die Eitelkeit des Menschen gereizt, und die furchtbarsten Tragödien in der Geschichte der Vogelwelt knüpfen sich gerade an dieses Moment. Aber erst, seitdem die unersättliche Modelaune der alten Kulturmutter Europa auf die Schmuckfedern ihr begehrliches Auge geworfen hat. Zwar haben wir es in der Anfertigung kunstvoller Federnarbeiten niemals auch nur halbwegs so weit gebracht, wie schon in altersgrauer Zeit die Indianer Mittel- und Südamerikas, aber dafür haben wir es in blinder Habgier verstanden, innerhalb weniger Jahrzehnte der Mode zuliebe ganze Vogelgeschlechter auszurotten oder dem Aussterben nahezubringen. Der »rohe« Indianer verfährt nicht so grausam und rücksichtslos, auch nicht so kurzsichtig und töricht. Er schießt z. B. die wundervollen Quesals ( Calurus resplendens) nur mit schwach vergifteten Pfeilen, die den Vogel lediglich für kurze Zeit betäuben, damit man ihm die begehrten Schmuckfedern ausreißen und ihn dann wieder fliegen lassen kann, so daß nicht unmenschlicherweise die Art ausgerottet und nicht dummerweise die Federnquelle schließlich verstopft wird. »Wir Wilden sind doch bessere Menschen!« Das Männchen des Quesals zeichnet sich nicht nur durch wundervollen, in der Natur wohl unerreicht dastehenden Metallglanz, sondern auch durch die reiche Entwicklung des Gefieders aus, das den Körper wie ein langer Behang umhüllt. Die Schwanzfedern sind enorm verlängert, und der reiche Deckfedernschmuck wallt wie ein vergoldeter Schleier herab. Auf der Oberseite ist der Wundervogel brillant smaragdgrün, auf Brust und Bauch hoch scharlachrot. In den verlassenen Spechthöhlen, in denen er zu brüten pflegt, findet nur das der Schmuckfedern entbehrende Weibchen genügend Platz, weshalb das Männchen von jeder Beteiligung am Brutgeschäfte ausgeschlossen erscheint.
Im Laufe dieser kurzgefaßten Schilderungen werden wir noch zahlreiche Schmuckvögel kennen lernen, und wir wollen uns deshalb hier darauf beschränken, denjenigen anzuführen, dessen Federn seit alter Zeit sich der größten und weitesten Beliebtheit erfreuten, allen Veränderungen der launischen Mode siegreich trotzten und ein begehrter Handelsartikel wurden. Um ihretwillen wird neuerdings ihr Produzent vielfach auch künstlich gezüchtet, da die Ergiebigkeit der Jagden in den heißen Steppenländern Afrikas infolge allzu eifriger Ausübung in beängstigender Weise nachzulassen begann. Ich meine natürlich den altberühmten, sagenumwobenen Strauß, den schnellsten Läufer und größten Riesen in der Vogelwelt, dem aber dafür das Flugvermögen abhanden gekommen ist. Seine Naturgeschichte ist erst in neuester Zeit von mancherlei weitverbreiteten Irrtümern gereinigt und anderseits um viele hochinteressante Züge bereichert worden, wobei die praktischen Erfahrungen in der Straußenzucht der Wissenschaft nicht wenig zustatten kamen. So ist es nicht richtig, daß der Strauß beim Laufen die Flügel ausbreiten und gewissermaßen als Segel benutzen soll; sie werden vielmehr nur so weit gelüftet, daß sie das Spiel der gewaltigen Schenkelmuskulatur nicht beeinträchtigen. Ausgebreitet würden sie bei den langen, weit ausholenden Schritten, die der fliehende Strauß vollführt, ja auch nur hinderlich sein, während sie bei plötzlichen Wendungen im raschen Laufe allerdings mit großem Vorteil als Steuer verwendet werden können. Ebenso ist es falsch, daß der Hahn in Vielweiberei lebe, das Brutgeschäft während der Nacht allein besorge, es bei Tage aber größtenteils der lieben Sonne überlasse. In Wirklichkeit brüten beide Geschlechter abwechselnd, und zwar sowohl bei Nacht als auch am Tage. Die Eier müssen ja unbedingt auch tagsüber bedeckt werden, und zwar nicht nur der Affen und kleinen Raubtiere wegen, sondern namentlich auch zum Schutze gegen die Unbilden der Witterung, wie sie die häufig verheerend über die Steppe fegenden Hagel- und Regenstürme darstellen, zuallermeist aber zum Schutze gegen die Wirkung der direkten Sonnenstrahlen, die in jenen Gegenden so gewaltig ist, daß sie sicherlich das Leben in einem ungeschützten Ei abtöten würde. Man bedenke doch, daß die regelrechte Temperatur eines Brutapparats nur 40 Grad Celsius beträgt, das Thermometer dagegen am Boden der afrikanischen Steppe im Schatten oft genug 65 Grad aufweist, so daß man oft kaum seine Hand in den von der Sonne nahezu glühend gemachten Sandboden zu stecken vermag! Es ist also offenbarer Unsinn, wenn in manchen Naturgeschichtsbüchern angegeben wird, daß der Strauß bei Tage die Eier mit Sand bedecke und das weitere der Sonne überlasse. Am Tage brütet meist das Weibchen, dem dabei seine braungraue Schutzfärbung zustatten kommt, und nachts das Männchen, dessen schwarze Schutzfärbung alsdann vorteilhaft ist. Die Tiere haben beim Brüten die wohl nur aus reiner Langeweile hervorgegangene Gewohnheit, mit dem Schnabel Sand aufzunehmen und über den Körper hinwegzuwerfen. So entsteht allmählich im Sand eine für das Straußennest sehr kennzeichnende unregelmäßige Ringfurche. Die Jungen schlüpfen in äußerst unbehilflichem Zustande aus den berstenden Schalen der kinderkopfgroßen, gut eßbaren Eier, und es dauert volle 24 Stunden, bis sie nur einigermaßen auf den schwachen Beinchen zu stehen vermögen. Der Hahn zeigt sich während der Brütezeit als ein recht ungemütlicher, bösartiger und kampflustiger Geselle, wie ja überhaupt über den Charakter des Straußes nicht viel Rühmliches zu sagen ist, denn er ist reichlich dumm, ängstlich, störrisch und nicht selten tückisch, dabei sehr verfressen, denn ein Straußenmagen kann bekanntlich alles vertragen. So lese ich in einem neueren Berichte, daß ein Straußenhahn zum Frühstück mehrere Ellen Umzäunungsdraht, der in kleine Stücke zerschnitten war, verschluckte, außerdem ein halbes Dutzend Messingpatronen, die ihm allerdings schlecht bekamen. Nicht nur ein hurtiger Schnelläufer ist der Strauß, sondern er vermag auch über fünf Fuß hohe Zäune hinwegzusetzen und recht brav zu schwimmen. Das eigenartige »Walzen« dieser Riesenvögel schildert Schreiner folgendermaßen: »Die Tiere laufen ein paar hundert Ellen, machen dann alle Halt und setzen sich mit erhobenen Flügeln eine Zeitlang in schnelle drehende Bewegung, bis sie ganz schwindlig sind, wobei ein Beinbruch gelegentlich vorkommt. Eine Abteilung derartig walzender Vögel gewährt einen merkwürdig hübschen Anblick.« Die brüllende oder brummende Stimme, die der Straußenhahn bisweilen hören läßt, vermag er auffallenderweise nur im Stehen hervorzubringen, nicht aber im Laufen. Die irrtümlichen Berichte über die angebliche Vielweiberei des Straußes dürften dadurch entstanden sein, daß man öfters die Eier mehrerer Weibchen in einem einzigen Neste vereinigt findet. Ein solches Zusammenlegen erfolgt aber nur aus Not bei Mangel an geeigneten Nistplätzen. In Wirklichkeit wird aus einem solchen Riesengelege, das selbst ein Strauß nicht genügend zu bedecken vermag, nie etwas.
Die Pampas Südamerikas, die weiten Buschsteppen Australiens und die Urwälder der hinterindischen und ozeanischen Inselwelt haben besondere Straußenformen hervorgebracht, die dem afrikanischen Riesen zwar an Größe, nicht aber an Eigenart der Erscheinung und des Wesens nachstehen; es sind die Nandus, Emus und Kasuare. Erstere haben ebenso wie die afrikanischen Vettern eine ausgesprochene Vorliebe für die Nähe und den Umgang mit größeren Säugetieren, so daß man sie oft inmitten von Rudeln der schönen Pampashirsche oder der Vikunnas sehen kann, wie sie bisweilen sogar mit dem halbwilden Weidevieh gesellschaftliche Gemeinschaft halten. Zur Paarungszeit stößt der balzende Hahn weithin erschallende Rufe aus, die ein Klangbild seines Namens darstellen. Auch von den Nandus wird behauptet, daß der Hahn sich fünf bis sechs Weibchen zugeselle, die von diesen in ein gemeinsames Nest gelegten Eier allein bebrüte, sie beim Verlassen mit Sand bedecke und auch die Jungen allein aufziehe. Erst wenn diese selbständig geworden sind, sollen sich die Hennen wieder bei der Familie einfinden. Nach den Aufklärungen, die uns in neuerer Zeit über das Familienleben des afrikanischen Straußes zuteil geworden sind, möchte man das fast bezweifeln, und jedenfalls bedarf die Sache dringend weiterer Aufhellung. Da das Fleisch der Jungen als eine Delikatesse und auch das der Alten trotz seiner etwas derben Beschaffenheit als gut genießbar gilt, werden die Nandus von Indianern und Gauchos eifrig zu Pferde gejagt, indem man sie entweder bis zur Erschöpfung mit Hunden hetzt oder sie durch an Stricken befestigte Wurfkugeln, sog. Bolas, zu Fall bringt. An Intelligenz und Aufgewecktheit steht der Nandu entschieden über dem Afrikaner. Dagegen trägt der durch die bandförmig zerschlissenen Federn und die außerordentlich kleinen Flügel gekennzeichnete Emu ein recht gelassenes und einförmiges Wesen zur Schau. Bei ihm ist es unzweifelhaft festgestellt, daß er in Einehe lebt, ebenso, daß trotz seiner geringeren Größe die Brutzeit noch acht Tage länger dauert als bei den afrikanischen Straußen. Der Hahn preßt zur Balzzeit aus seinem Luftsack tiefe Baßtöne hervor. Mit dem Vordringen der Europäer in Australien wird leider auch dieser am liebsten Steppen- oder Hügellandschaften von parkartiger Beschaffenheit bewohnende Strauß immer seltener. Die Kasuare endlich sind richtige Waldstrauße und fressen als solche besonders Früchte und Beeren. Eigentümlich sind vielen von ihnen zellenreiche Helmgebilde auf dem Scheitel.
Es sei gestattet, in diesem Zusammenhange auch gleich den absonderlichen Schnepfenstrauß oder Kiwi Neuseelands mit zu erwähnen, ein vorsintflutliches Vogelrelikt und würdiges Gegenstück zu Schnabeltier und Erdpapagei, obgleich der merkwürdige Bursche mit den echten Straußen eigentlich wenig mehr als den Namen und die Flugunfähigkeit gemein hat. Ausgezeichnet ist dieses putzige Vogelgebilde durch völligen Mangel von Schwanz und äußerlich sichtbaren Flügeln, durch gleichmäßiges, haarartiges Gefieder, durch stämmige, überaus kräftige Beine und durch einen langen, dünnen Schnepfenschnabel. Schon dieses Äußere weist unverkennbar darauf hin, daß wir es mit einer im Aussterben begriffenen Form zu tun haben. Und in der Tat ist der Kiwi aus den kultivierteren Gegenden seiner Heimat bereits völlig verschwunden und fristet nur noch in abgelegenen Urwäldern ein kümmerliches, ständig von Menschen, Hunden und Katzen bedrohtes Dasein. Als ausgesprochener Nachtvogel hält er sich bei Tage in Erdlöchern und unter Baumwurzeln versteckt und kommt erst nach Einbruch der Dunkelheit zum Vorschein, um nach Schnepfenart mit dem langen Schnabel nach Kerfen und Gewürm zu stechen, wobei ihm der seine Tastsinn des Schnabels sehr zustatten kommt. Auch der Geruch scheint ausgeprägter zu sein als sonst im Vogelreiche; wenigstens schnüffelt der Kiwi fortwährend prüfend die Luft ein. Hat er einen Wurm in seiner Höhle ausfindig gemacht, so zieht er ihn mit dem Schnabel langsam und vorsichtig heraus, damit er nicht abreißt, und schlingt ihn dann mit einem plötzlichen Ruck hinunter. Treffen so bei der Nahrungssuche mehrere der auch geistig recht beschränkten Vögel zusammen, so entfalten sie unter gelegentlichen Neckereien ein ziemlich lebhaftes Treiben, das bei ihrer Mißgestalt im unsicheren Mondeslicht fast geisterhaft und koboldmäßig anmutet. Über das Brutgeschäft des so versteckt lebenden und schwer zu beobachtenden Vogels sind wir noch wenig unterrichtet, doch scheint nach den Erzählungen der Eingeborenen und Beobachtungen aus dem Londoner Tiergarten festzustehen, daß er nur ein einziges, unverhältnismäßig großes Ei (es wiegt ein Viertel vom Körpergewichte des Weibchens!) legt, und daß das Männchen dieses in seiner unterirdischen Wurzelhöhle bebrütet, wobei es auch die Wärme von Gärungsprozessen zu Hilfe nehmen soll, indem es das Ei mit Moos und Blättern bedeckt.
Raubvögel greifen in den Tropen viel weniger in die Interessensphäre des Menschen ein als bei uns, da ihnen ja eine verschwenderische Natur draußen in Wald und Flur den Tisch überreichlich gedeckt hat. Dies gilt selbst von dem furchtbarsten und blutdürstigsten aller gefiederten Räuber, der mächtigen Harpyie der südamerikanischen Urwälder, die die Wildheit und Mordgier des Habichts mit der Kraft und Kühnheit des Adlers in sich vereinigt. Als eine wahrhaft majestätische Erscheinung muß sie bezeichnet werden, wenn sie in stolzer und selbstbewußter Haltung von ihrem Thronsitz auf dem dürren Wipfel eines alten Waldriesen aus Umschau hält. Pfeilschnell ist sie im Fluge, geschwind in jeder Bewegung, todsicher im Stoße auf Affen, Faultiere, Steiß- und Hokkohühner, die ihre hauptsächliche Beute bilden. Was einmal in ihren gewaltigen Fängen, die an Kraft, Umfang und Schärfe die der stärksten Adler weit hinter sich lassen, blutet, ist verloren. Jählings und unvermutet, wie vom Blitz, wird das Opfer überfallen und von den entsetzlichen Krallen erdolcht. Die Federn des imposanten Vogels, der sich gewöhnlich im Waldesdunkel am Saume der Flußufer versteckt hält, gelten bei den Indianern als unentbehrlicher Häuptlingsschmuck und werden deshalb heiß begehrt. Jedes Einzelpaar beansprucht ein ungeheures Waldrevier und errichtet auf dessen unzugänglichstem Wipfel seine trutzige Räuberburg. Seines herrlichen Flugvermögens halber verdient auch der Gaukler, eine farbenschöne und überwiegend von Reptilien lebende Bussardform Innerafrikas, Erwähnung. Schier schrankenlos beherrscht der dem Menschen gegenüber sehr scheue und vorsichtige Vogel das Luftmeer und vollführt darin bei guter Laune aus bloßem Übermut die tollsten Kapriolen. Bald macht er förmliche Luftsprünge, bald läßt er sich ein Stück herabfallen, bald hält er die Flügel lange unbeweglich nach oben, bald schlägt er sie mit vernehmbarem Geräusch tief nach unten zusammen. So wundervoll sein Flugbild auch anmutet, das alle Forschungsreisenden mit wahrem Entzücken beschreiben, so wenig imponiert der ruhig dasitzende Vogel. Er bläst sich dann zu einem wahren Federklumpen auf, und der im Grunde recht gutmütige und wenig raubgierige, auch geistig gut begabte Gesell erinnert dann beinahe an einen Uhu.
Wo Raubvögel einmal am Hühnerhofe des amerikanischen Ansiedlers sich zu vergreifen Miene machen, da hat diesem die Natur einen vorzüglichen Wächter und Aufpasser, einen gefiederten Polizisten gewissermaßen, zur Verfügung gestellt in Gestalt der sogenannten Tyrannen. Frei und offen, ein Ritter ohne Furcht und Tadel, sitzt z. B. der namentlich in den Orangenhainen Floridas und in den Obstgärten der Mississippistaaten heimische Königsvogel ( Tyrannus carolinensis) auf seiner Warte. Stets kampfbereit späht er mit wachsamem Auge und gesträubter Haube nach dem Feind, von Zeit zu Zeit schrille Schreie ausstoßend. Feigheit ist ein ihm unbekannter Begriff, und mit heldenmütiger Tapferkeit stürzt er sich auch auf den größten Raubvogel. Sein herrliches Flugvermögen kommt ihm dabei sehr zustatten, mit unnachahmlicher Gewandtheit vollführt er blitzschnell Stoß auf Stoß gegen den Gehaßten, bis dieser das Hasenpanier ergreift und der mutige Tyrann unter weithin erschallenden Siegestrillern zu seinem Platze zurückkehren kann. Besonders angenehm ist es, daß der wackere Raufbold sich zutraulich gern bei den menschlichen Gehöften aufhält und sich kleineren Vögeln gegenüber durchaus friedfertig und verträglich erweist. Nur dem Raubgesindel gilt sein Haß, und so wird er zu einem wahren Beschützer der Geflügelhöfe. Besonders aufgeräumt, kampf- und schreilustig zeigt er sich zur Brutzeit, wo er spielend auch hübsche Flugmanöver in der Luft vollführt. Insekten, die er fliegend in der Luft erhascht, bilden seine ausschließliche Nahrung. Die artenreiche Familie der Tyrannen vertritt in der Neuen Welt unsere Würger und fällt dem Naturfreunde sofort durch keckes, ungebundenes Wesen, angenehme Gefiederfärbung und lebhaftes, oft katzenartig miauendes Geschrei auf.
In ganz merkwürdiger Weise macht sich ein gefiederter Afrikaner um den Herrn der Schöpfung verdient. Es ist der kaum drosselgroße, schlicht gefärbte Honiganzeiger, und sein Name besagt eigentlich schon alles Nötige. Er hat eine große Vorliebe für Bienenlarven, ist aber selbst nicht imstande, solche den stechlustigen Immen wegzuräubern. Aber wenn Menschen einen Stock wilder Bienen ausnehmen, kommt er auf seine Rechnung und hat daher allmählich begriffen, wie vorteilhaft dieser Vorgang für ihn und seinen Magen ist. Jetzt ist der Vogel in seinen Schlußfolgerungen schon so weit vorgeschritten, daß er den ersehnten Vorgang selbst herbeizuführen versucht. Wenn er ein Bienennest ausfindig gemacht hat, sucht er zunächst durch fortgesetztes Schreien und voranfliegen die Aufmerksamkeit des erstbesten Menschen zu erregen, der ihm begegnet, und ihn dann förmlich durch fortgesetztes Rufen und voranfliegen zu dem Stocke hinzuführen, damit der Mensch diesen des Honigs berauben, ihm selbst aber als Sohn für seine Späher- und Führerdienste die Immenbrut überlassen soll. Also ein richtiges Handelsgeschäft auf Gegenseitigkeit, wobei beide Teile gut auf ihre Rechnung kommen. Ornithologische Überkritiker haben freilich oft an der Wahrheit des Vorgangs gezweifelt, aber er ist durch einwandfreie Beobachtungen erwiesen, und ich bekam noch unlängst den Brief eines ostafrikanischen Farmers, der mir die wunderbare Tatsache ebenfalls in einer alle Zweifel ausschließenden Weise bestätigte.
Neben den Raubvögeln kommen noch die gefiederten Fischfresser als mitunter lästige Mitbewerber des Menschen in Betracht. Der gefräßigsten einer ist der seltsame Pelikan mit dem auffallenden Kehlsack, der als einstweiliger Behälter für die gefangenen Fische dient. So wunderbar plump und unbeholfen auch der auf der Erde herumwatschelnde Pelikan aussieht – ein Anblick, den wir von unseren Tiergärten her am meisten gewöhnt sind –, so elegant und majestätisch nimmt sich doch der fliegende Vogel aus. Trotz seiner massigen und scheinbar schweren Körperformen muß ihm doch das Fliegen sehr leicht werden, weil sein ganzer Leib unter der Haut von einem Luftpolster umgeben ist, das ihn anderseits freilich auch am Tauchen hindert, so daß er nur in seichten Buchten mit Hilfe seines Hamenschnabels dem Fischfang nachzugehen vermag. Mit mehr Recht als bei irgendeinem anderen mir bekannten Vogel kann man beim Pelikan das ohne jede sichtliche Anstrengung vor sich gehende Fliegen ein »Schwimmen in der Luft« nennen. Die Pelikane fliegen bald in Keilform, bald in langen Schlangenlinien, die sich wie die der Ibisse in fortwährender wellenförmiger Bewegung und Verschiebung befinden. Die Flugfigur wechselt unablässig und mit einer gewissen Regelmäßigkeit, so daß es mir immer den Eindruck gemacht hat, als ob die lachsfarbenen Riesenvögel eine wohlgeordnete Polonäse aufführten. Beim Fischen gehen sie ganz planmäßig zu Werke. Sie kreisen eine seichte Meeresstelle oder Bucht förmlich ein, treiben mit mächtigem Flügelschlage die geängstigten Fische auf einen Punkt zusammen und fahren dann mit den gewaltigen Hamenschnäbeln gierig unter das silbern glitzernde Gewimmel. Ein großartiger Anblick ist es, den eine solche fischende Gesellschaft von Pelikanen gewährt. Von weitem sieht man nichts als ein undeutliches, lachsrotes Gewimmel, aus dem sich erst beim Näherkommen die einzelnen Vogelgestalten abheben. Aber schon auf große Entfernung hin geht die ganze Schar auf, mit einem Ruck, ohne Geschrei, und ordnet sich in der Höhe im Bewußtsein ihrer Unerreichbarkeit mit philosophischer Ruhe zur keilförmigen Flugfigur, um dann meistens gleich weit wegzuziehen. Wundervoll sieht es aus, wenn die gewaltigen Vögel wie rosenrot von der Sonne durchglühte Schneeflocken in Masse durcheinanderflattern, und unwillkürlich setzt man den gespannten Flintenhahn in Ruhe, um sich zu werden an diesem Naturbild, das zu den großartigsten gehört und sich für immer tief in die Erinnerung eingräbt. Die Pelikane verschlingen Fische bis zu drei und vier Pfund Gewicht. Der fabelhafte Fischreichtum des Kaspischen Meeres wurde mir vor Jahren recht deutlich vor Augen geführt, als ich dort sah, welche Unmassen gefräßiger Fischräuber, außer den Pelikanen namentlich noch Seehunde, Reiher, Kormorane, Säger, Taucher und Möwen, es ernährt, ohne daß der Fischbestand dadurch eine auch nur im geringsten wahrnehmbare Veränderung erfährt. Im Gegenteile hat die Erfahrung gezeigt, daß bei einer gewaltsamen Verminderung der gefiederten Fischfeinde unter den sich dann ins Ungemessene vermehrenden Fischen bald furchtbare Seuchen und ansteckende Krankheiten ausbrechen, die ganz anders unter ihnen aufräumen, als das Heer ihrer Feinde jemals imstande wäre. Der Mensch, der übergenug auch für sein fast unersättliches Begehren vorfindet, läßt deshalb dort auch seine gefiederten Mitbewerber im allgemeinen ungeschoren. Nur gelegentlich jagt man auf Pelikane, aber weniger ihrer Fischereischädlichkeit als vielmehr ihrer als Pelzwerk geschätzten Brustfelle wegen.
Auch die überschlanken Schlangenhalsvögel sah Heinroth planmäßig und gesellig fischen. Es gesellen sich dann tausend, ja vielleicht zehntausend Stück zusammen, bilden eine dichtgedrängte Schwarmkette von hundert oder einigen hundert Meter Länge, durch die so leicht kein Fisch hindurchkommen kann, und rücken so in der Weise vor, daß die vordersten untertauchen, nun von den Fliegenden überholt werden, nach dem Auftauchen aber wiederum zuerst schwimmend und dann fliegend nacheilen und die Tauchenden von neuem überholen. Der ganze Zug bewegt sich so gewissermaßen walzenförmig fort. Sonst erinnern die durch gestreckte, taucherartige Körperform, langen Hals und spitzen Kopf ausgezeichneten Schlangenhalsvögel in ihrer ganzen Lebensweise lebhaft an unsere Kormorane. Der Flug ist nicht sonderlich, der Gang nur ein trauriges Watscheln, aber auf und im Wasser sind sie unübertreffliche Meister. Glauben sie sich beunruhigt, so senken sie beim Schwimmen den Körper so tief ein, daß nur noch der dünne, wenig Angriffsfläche bietende Hals hervorsieht. Ihre volle Gewandtheit aber zeigen sie erst unter Wasser, wo sie mit gelüfteten Flügeln, vorgestrecktem Hals, rudernden Füßen und steuerndem Schwanz so schnell wie die Fische selbst dahinschießen. Unter sich ziemlich necklustiger Natur, wissen sich die Schlangenvögel auch gegen überlegene Feinde durch blitzschnelles Vorwerfen des Kopfes mit dem spitzen, lanzenartigen Schnabel sehr nachdrücklich zu verteidigen.
Eine Reihe weiterer Vögel, namentlich Hühner- und Taubenarten, werden wegen ihres wohlschmeckenden Fleisches vom Menschen geschätzt und erfreuen sich als Jagdwild eines gewissen Wohlwollens, wenn es auch nur in seltenen Fällen in fernen Ländern zu so schonenden und verständnisvollen Jagdgesetzen und ihrer so strengen Durchführung gekommen ist, wie bei uns. Da sind zunächst einmal die wilden Stammeltern unseres Hausgeflügels, so der prächtige und einen ebenso feinen wie ansehnlichen Braten liefernde Bronzetruthahn der amerikanischen Wälder, in seinem Bestande leider schon stark vermindert und in die schwächer besiedelten Gegenden zurückgedrängt, dafür aber neuerdings mehrfach mit gutem Erfolg in Europa eingebürgert. Ferner das scheue Bankivahuhn aus den Hochwäldern der Sundainseln, dessen grelle Stimme dort so viel lauter und wilder erschallt als die von der Kultur umgemodelte unserer Haushühner. Weiter die Perlhühner in Afrika, bei denen die Geschlechter gleich gefärbt und die durch zänkisches Wesen und widerliches Geschrei ebenso ausgezeichnet sind wie durch ihr köstliches Fleisch; verwildert kommen diese polygam lebenden Vögel auch in Westindien vor. Endlich der stolze Pfau der indischen Dschungeln, der in der Nähe von Tempeln als heiliger Vogel auch im halbwilden Zustande gehalten wird; er ist erstmals durch die Eroberungszüge des großen Alexander zu uns gebracht worden. Zu demjenigen Federwild, das man bei uns vergeblich einzubürgern versucht hat, gehört die reizende Schopfwachtel Kaliforniens mit der gemütlichen Kugelgestalt und dem indianerhaften Federputz auf dem Kopfe. Diese schönen und beweglichen Vögel beleben mit ihren hellen Pfeifstimmen das Busch- und Hügelgelände und zeigen sich da als gewandte Läufer. Aufgescheucht fliegen sie jedoch auf Bäume und drücken sich da auf wagrechten Ästen nieder wie die Eichhörnchen. Auch das Nest pflegt am Stamme eines Baumes zu stehen. In Nordafrika und Mittelasien habe ich vielfach die durch die auffallend verlängerten ersten Schwungfedern gekennzeichneten, wüstenfarbigen Spießflughühner gejagt und ihr delikates Wildbret als eine sehr willkommene Abwechslung zwischen dem täglichen Einerlei von Reis mit Hammel und Hammel mit Reis schätzen gelernt. Sie sind Verwandte der durch faustförmig gestaltete Füße und spießförmige Schwanzfedern ausgezeichneten Steppenhühner, die 1863 und 1888 durch ihre überraschenden Masseneinwanderungen nach Europa so viel von sich reden machten.
Die unermeßlichen Urwälder Südamerikas besitzen in den stattlichen Hokkohühnern ein gar prächtiges Flugwild. Es sind völlig dem Baumleben angepaßte Formen von fast Truthahngröße, die das den Hühnern sonst eigene Scharren verlernt haben und fast nie auf den Boden herabkommen. Unter kräftigen Flügelschlägen und pfeifenden »Hui-Hui«-Rufen schwenken sie sich im dichtesten Wald geschickt durch das Gezweig und lassen sich dann auf einem der Baumriesen nieder, um ihrer Nahrung nachzugehen, die aus Früchten, Blättern, Kerfen und Schnecken besteht. Sowohl das glänzend schwarze Männchen als das bräunlich gefärbte Weibchen haben einen Helmschmuck von schön gekräuselten Federn und einen lebhaft gelben Fleischhöcker an der Wurzel des Oberschnabels. Sie leben paarweise und zeitigen nur zwei Eier. Die stark entwickelte und gewundene Luftröhre ermöglicht ihnen das Hervorbringen eines eigentümlichen Gebrumms in tiefster Baßstimme, gefolgt von einem gellenden Pfeifen; dies verrät sie dem spähenden Menschenauge, wenn sie hoch oben in den Wipfeln der Urwaldriesen sitzen, in denen sie sonst sicher nicht zu entdecken gewesen wären. Die Indianer verstehen es, diese Stimmlaute nachzuahmen und dadurch die sonst sehr scheuen Vögel, deren zartes Fleisch allgemein gerühmt wird, auf bequeme Schußweite herbeizulocken. Als das am besten schmeckende Federwild der brasilianischen Pampas gilt das schwanzlose, paarweis lebende, harmlose, aber auch recht beschränkte Steißhuhn oder Tinamu, das man vergeblich bei uns einzubürgern versucht hat. Gescheitert sind diese Versuche hauptsächlich an der in seiner Heimat sprichwörtlich gewordenen Dummheit und übermäßigen Ängstlichkeit des hauptsächlich in der Dämmerung regen Vogels, der sich absolut nicht in fremden Verhältnissen zurechtzufinden versteht. Die schön gefärbten Eier des Steißhuhns glänzen wie poliert, bilden daher eine hervorstechende und demgemäß begehrte Zierde der Sammlungen.
Persönlich habe ich das wie poliertes Mahagoniholz glänzende Fleisch der großen bordeauxroten Lorbeertauben von Teneriffa als das delikateste Federwildbret schätzen gelernt. Sein Wohlgeschmack mag damit zusammenhängen, daß die eichelartigen würzigen Früchte der Persea indica (Madeiralorbeer) und des Laurus canariensis die Hauptnahrung des im dichtesten Walde versteckt lebenden und kultivierte Gegenden ängstlich meidenden Vogels bilden. Gewöhnlich fand ich nur sie in ihrem Magen, außerdem aber auch die jungen Lorbeerblätter, in pfenniggroße, rundliche Stücke zerbissen, ferner ab und zu kleine Gehäuseschnecken. Die stattliche Größe, die mächtig gewölbte Brust, die dunkel weinrote Gefiederfärbung, die hellgelbe Iris und die roten Füße, nicht zuletzt die fabelhafte Scheu und Vorsicht sowie das aparte, einsiedlerische Wesen machen diese herrliche Taube zu einem wahrhaft aristokratischen Vogel. Hinsichtlich ihrer Fortpflanzung scheint sich diese schöne Taube an eine bestimmte Jahreszeit überhaupt nicht zu binden, sondern sie brütet mit Ausnahme der Mauserperiode wahrscheinlich das ganze Jahr hindurch und gleicht dadurch glücklicherweise wieder einigermaßen die Schwachheit ihrer Gelege aus. Sie legt nämlich nur ein einziges Ei in das nach Holztaubenart liederlich zusammengeschichtete Reisignest. Auch mit der Stammmutter all unserer Haustaubenrassen, der in ihrem Äußeren einer Feldtaube ähnelnden Felsentaube, bin ich auf Teneriffa vielfach zusammengetroffen, nachdem ich sie schon vorher in kahlen Felsgegenden Südeuropas, Vorderasiens und Nordafrikas vielfach kennen zu lernen Gelegenheit hatte. In wild zerklüfteten und zerrissenen Gebirgsketten suchte man sie ebensowenig vergeblich, wie in den steilen Felsabstürzen zum Meere. Viel unterhaltendes Leben herrscht in ihren Brutkolonien an schwer zu ersteigenden Felswänden, wo außer unzähligen Tauben auch noch zahlreiche Segler, Turmfalken und Raben brüten. Schwarmweise, aber stets unter Beobachtung der größten Vorsicht, pflegen diese Tauben auf den Feldern einzufallen; sie sollen unter Umständen daselbst auch erheblichen Schaden verursachen. Genußreiche Stunden habe ich auf der Jagd nach Felsentauben verbracht, wenn ich in wildromantischer Felsschlucht in einem aus Farnkräutern hergerichteten Verstecke bei spärlich tropfender Quelle saß, um die zur Tränke kommenden Tauben zu erlauern. Als beliebter Stubenvogel ist bei uns die niedliche Lachtaube sehr bekannt geworden, die wild massenhaft in Afrika und Indien lebt, wo man allenthalben ihr Gurren und Kichern zu hören bekommt. Infolge eines geglückten Einbürgerungsversuches lebt sie übrigens auch zahlreich auf den berühmten Borromeischen Inseln im Lago Maggiore.
Die größte aller Tauben ist die am Körper bläuliche Kronentaube von Neuguinea (Abb. 6), deren Scheitel ein hoher und breiter Fächer schön zerschlissener Federn schmückt; sie ist eine echte Erd- und Lauftaube, die nur zum Übernachten auf Bäume fliegt, tagsüber aber am Boden nach abgefallenen Früchten sucht und in ihrem Benehmen überhaupt viel Hühnerartiges hat, ja sogar das für die Hühner so charakteristische Scharren bei der Nahrungssuche ausübt. von eigenartiger Schönheit zeigt sich die Dolchstichtaube der Philippinen, deren Brust wie nach einem frischen Messerstich purpurner Lebenssaft zu entströmen scheint, so auffallend hebt sich der unvermittelte grellrote Fleck auf ihr von dem sonst lichten Gefieder ab. Noch mehr Bodenvogel als die Kronentaube ist die schon recht selten gewordene Mähnentaube von den Nikobaren und aus dem Malaiischen Archipel, denn sie brütet sogar auf der Erde und sucht auch zur Nachtruhe immer möglichst niedrige Äste auf. Verlängerte grasgrüne Kragenfedern von metallischem Goldglanz gereichen ihr sehr zur Zierde. Als das älteste all der zahlreichen Taubengeschlechter muß die im Aussterben begriffene Zahntaube von Samoa angesehen werden, ein entwicklungsgeschichtlich hochinteressanter Vogel mit drei Paaren sägeförmiger Einschnitte im Unterkiefer. Auffallend ist überhaupt die Beweglichkeit ihres Schnabels, wodurch sie an die Papageien erinnert, so nimmt sie auch nach Papageienart größere Stücke Nahrung zwischen die Zehen und zerkleinert sie nun erst mit dem Schnabel. Ferner trinkt sie nicht, wie sonst die Tauben, in großen Zügen, sondern nach Art anderer Vögel in kleinen Schlücken. Ebenso spricht die auffallend langsame Entwicklung der Zungen für das entwicklungsgeschichtlich hohe Alter dieses merkwürdigen Zwischentyps. Beeren und Früchte bilden die Nahrung. Wie so vielen harmlosen Geschöpfen der paradiesisch glücklichen Südseeinseln, ist auch den Zahntauben die Einführung der europäischen Haustiere zum Verhängnis geworden. Diesmal war die Katze der Missetäter, und der Umstand, daß die Zahntauben mit wahrhaft rührender Hingebung auf ihren Eiern brüten, erleichterte ihr nicht wenig das Vernichtungswerk, das leider in absehbarer Frist ein vollständiges sein wird.

Abb. 6. Kronentaube.
Ungleich furchtbarer noch ist aber die ergreifende Tragödie der nordamerikanischen Wandertaube, von der Audubon einst schreiben konnte, daß unter der Last ihrer Nester die Bäume im Walde brächen. Sie zeigt, wohin das zügellose Eingreifen des »zivilisierten« Menschen ins freie Naturleben führt. Noch 1884 heißt es bei Martin: »Zur Brütezeit ziehen Tausende von Menschen mit Äxten in die Wälder und fällen die dicht mit Nestern besetzten Bäume, deren Bewohner sie töten und einsalzen oder gleich verspeisen. was dieser Verwüstung entging, das fällt zum großen Teile im Herbste, wenn der Wanderzug beginnt, der Vernichtung anheim, die in der rohesten und abscheulichsten weise betrieben wird. Um diese Zeit fahren die Jäger, Fänger und Metzger mit der Eisenbahn den Taubenzügen entgegen, deren Richtung im ganzen Lande durch telegraphische Depeschen bekanntgemacht wird. Die Bauern schlagen die Tauben mit langen Stangen herunter, die Jäger benutzen die Gewehre, die Fänger stellen ihre Netze, in die sie Salz und Schwefel streuen, wenn die Wanderung im vollen Gange ist, folgt ein sonnenverfinsternder Zug dem anderen, und das Getöse des Mordens dauert bis in die tiefe Nacht, wo man Pechfackeln anzündet und mit Schwefel räuchert, wodurch Tausende den Erstickungstod erleiden. Die meisten Schlachtopfer werden am folgenden Morgen zwischen Eis in Fässer gepackt und nach den Städten verschickt, andere werden gerupft und eingesalzen. Zum würdigen Beschluß dieser Metzelei treibt der Mensch noch seine Schweineherden auf den Schauplatz seiner Taten, damit die gefräßigen Vielhufer die verwundeten und zertretenen Tauben auffressen.« Das ist denn doch wahrlich eine allem menschlichen Gefühl hohnsprechende Schlächterei, nur vergleichbar dem in den Prärien ebenso schonungslos geführten Vernichtungskriege gegen die Büffel! Wahrlich, das »freie« Amerika hat sich arg versündigt gegen die Natur und ihre Kinder, und der herrliche Yellowstonepark selbst oder die von Milliardären neuerdings erfreulicherweise immer häufiger gestifteten großen und kleinen Reservationen vermögen diese himmelschreiende Blutschuld nur zum geringsten Teile wieder gutzumachen. Noch 1879 versendete eine einzige Firma 1000 Fässer mit 40 000 Dutzend Wandertauben und lieferte nebstbei noch 20 000 lebende für den »edlen« Sport des Taubenschießens. Und was ist heute die Folge dieser wahnsinnigen Schlächterei? Nicht weniger als 10 000 Dollar wurden im Vorjahre ausgesetzt für die Ruffindung eines einzigen Wandertaubennestes! Man befürchtet nämlich, daß die letzten spärlichen Reste des einst so häufigen Vogels einer ansteckenden Seuche zum Opfer gefallen sind, er also bereits völlig ausgestorben ist. Den ausgesetzten Preis erhält der Finder eines besetzten Wandertaubennestes. In der Nähe eines solchen müssen sich nämlich bei dem ausgeprägt geselligen Charakter des Vogels noch weitere finden, und wenn man nur wenige Paare der Wandertaube wieder ermittelt hat, hofft man es dahin zu bringen, daß sie an Zahl wieder zunehmen, wenn es natürlich auch vollständig ausgeschlossen ist – selbst bei sorgfältigster Schonung – die ungezählten Millionen wieder zu gewinnen, die einst – vorhanden waren.
Manche ursprünglich harmlose Vögel sind auch erst durch das Eindringen der menschlichen Kultur in ihre stillen Wohngebiete zu Schädlingen geworden. Das am meisten typische Beispiel dafür ist der merkwürdige Kea oder Nestorpapagei Neuseelands, wohl der stammesgeschichtlich älteste Vertreter des weitverzweigten Papageiengeschlechts. In der busch- und felsenreichen subalpinen Region der dortigen Gebirge ist der einen rabenartigen Eindruck machende, düster gefärbte und halb nächtlich lebende Vogel zu Hause. Auch der strenge Winter, der dort oben herrscht, kann ihm nur wenig anhaben, denn der Boden ist mit dichtem, undurchdringlichem Gestrüpp bedeckt, stark genug, um wie ein Dach die darauf lastenden Schneemassen zu tragen. Der Kea findet daher in den natürlichen Hallen unter diesem Dache Nahrung und Wärme genug, indem er in geduckt falkenartiger Haltung flink auf dem Erdboden einhertrabt, Die Spitze seiner Zunge hat einen schmalen hornartigen Spatel mit bürstenförmiger Verlängerung aufzuweisen, der ähnlich wirken mag wie die rauhe Zunge einer Katze und wahrscheinlich mit den unglückseligen Raubtierinstinkten des Vogels im innigsten Zusammenhang steht. Ursprünglich war der Kea Allesfresser, aber überwiegend Vegetarier, und zwar besonders Wurzelgräber und Honigschlecker; nur nebenbei wurden auch Kerfe und andere tierische Stoffe verspeist, die für den Kea offenbar nicht ganz entbehrlich sind. Mit der Einführung der Schafzucht in jene Gegenden änderte sich aber das Bild. Wie mag nun der Kea darauf verfallen sein, truppweise die armen Wollträger anzufallen, sie zu töten oder ihnen gar bei lebendigem Leibe Stücke Fleisches herauszufressen? Man hat berichtet, daß eine dort massenhaft vorkommende, sonderbar blühende Pflanze ( Haastia pulvinaria), die in ihrem Aussehen ganz den Rücken eines Wollschafes vortäusche und auch in der Größe entsprechende, dicht geschlossene Polster bilde, die Ursache sei, da der Papagei zwischen ihr Nahrung zu finden gewohnt gewesen sei. Wahrscheinlicher noch erscheint es, daß die Papageien in den Lagern der Goldsucher Überreste geschlachteter Schafe oder in den Ansiedlungen zum Trocknen aufgespannte und nicht völlig von Fett und Fleisch gereinigte Schaffelle fanden und dabei Geschmack an dem so mühelos zu erlangenden Schaffleisch gewannen, zumal sie ja die Gewohnheit haben, an allem möglichen mit ihrem starken Schnabel herumzuknabbern. Das übrige ist dann leicht erklärt, heute verursachen die Keas der Schafzucht einen ganz empfindlichen Schaden, und es sollen ihnen in der subalpinen Region jährlich etwa fünf vom hundert der Schafherden zum Opfer fallen, in manchen Distrikten noch mehr. Kein Wunder, daß unter diesen nicht wegzuleugnenden Umständen die Schafzüchter den Kea mit dem grimmigsten Hasse verfolgen und bald seine völlige Ausrottung bewirkt haben werden, wenn man nicht noch rechtzeitig einige Pärchen in ein möglichst entferntes Schutzgebiet rettet, wo sie keinen Schaden tun können. Neuerdings hat Südafrika ein interessantes Gegenstück zur Keafrage geliefert. Dort ist der Rhinozerosvogel ( Buphaga erythrorhyncha) zu Hause, der seine Lebensaufgabe darin erblickte, die runzelige Panzerhaut der Nashörner von allerlei Ungeziefer zu befreien. Mit der fortschreitenden Abnahme der Rhinozerosse aber und der gleichzeitigen Zunahme der zahmen Pferde und Rinder schien es unserem Vogel geboten, mehr und mehr auf letztere überzusiedeln. Bei seinem vom Nashorn her gewöhnten kräftigen Hacken erwies sich indes die Haut der Haustiere als zu dünn, und so kam er bald auf Blut und Fleisch, das ihm natürlich besser schmeckte als die lederartigen Kerfe, und damit war das Unglück fertig.
Besonders fette Vögel zehntet der Mensch eben dieses Fettes halber, und im Haushalte des Nordländers spielen in dieser Beziehung namentlich Seevögel, die ihm zu seinem freudenarmen Lebensunterhalte überhaupt unentbehrlich geworden sind, eine große Rolle. Benutzt er doch die allerdings einem bloßen Fettklumpen gleichenden Jungen mancher Arten geradezu als Lampen, indem er ihnen einfach vom Schnabel bis zum After einen Docht durch den gerupften Körper zieht. Über auch die Indianer des tropischen Amerika haben einen solchen gefiederten Fett- und Öllieferanten, den Fettschwalk oder Guacharo ( Steatornis caripensis), von dessen berühmter venezolanischer Bruthöhle Caripe uns der große Humboldt eine so klassische Schilderung gegeben hat. Obwohl in systematischer Hinsicht mit unserer Nachtschwalbe verwandt, hat der Fettschwalk biologisch doch herzlich wenig mit ihr zu tun. Er ist überhaupt kein Nachtvogel, sondern treibt sich tagsüber geräuschlosen Fluges im Walde herum, fast ohne dazwischen einmal auf Bäumen auszuruhen, und wenn er auch Kerbtiernahrung nicht völlig verschmäht, so bilden doch seine Hauptkost die Beeren der Nekandrapalme, die er rüttelnd abreißt und dann gierig hinunterschlingt. Seine Verdauung muß eine sehr gesegnete sein, denn schon nach einer halben Stunde werden die Kerne dieser Beeren wieder ausgespien, während die im Magen erlegter Stücke gefundenen als ein gutes Fieberheilmittel (Guacharosamen) gelten und teuer bezahlt werden. Mit Einbruch der Dunkelheit zieht sich der Guacharo in seine geheimnisvollen Bruthöhlen zurück und vollführt hier, wenn man ihn bei Fackelschein aufscheucht, mit seiner auffallend starken, unangenehm krähenartigen Stimme einen wahren Höllenlärm. Der Riese dieser interessanten Familie ist der gleichfalls in Südamerika heimische bussardgroße Riesenschwalk ( Nyctibius grandis), der nach Art unserer Nachtschwalbe nach Eintritt der Dämmerung in gewandtem, aber geisterhaft leisem Fluge mit dem ungeheuren Rachen die großen Nachtfalter und Käfer der tropischen Urwälder erhascht und ihnen vor dem verschlingen die Flügeldecken abreißt. Prinz Wied sah ihn in den unvergleichlich schönen Mondnächten der brasilianischen Urwälder hoch in der Luft gleich einem Adler schweben und dem Insektenfang obliegen. Tagsüber sitzen dagegen die Riesenschwalke der Länge nach träge auf den Stummeln starker, abgebrochener Äste, über deren Ende nur ihr Kopf hervorschaut, so daß sie bei ihrem baumrindenfarbenen Gefieder trotz ihrer Größe nur sehr schwer zu entdecken sind. Sie brüten auch in ausgefaulten Baumästen und legen ihre beiden länglichen Tier in deren modernden Mulm. Die weithin hörbare Stimme erinnert bald an die des Uhus, bald an die des Bussards.
Ganz eigenartige Beobachtungen will der berühmte Erforscher der australischen Tierwelt, Gould, bei dem dortigen Riesenschwalm ( Podargus humeralis) gemacht haben. Dieser absonderliche Vogel, der am besten als »fliegende Kröte« zu charakterisieren ist, soll nämlich außer seinem Tagschlafe, aus dem er schon schwer genug zu erwecken ist, einen noch festeren winterlichen Schlaf halten, wobei er entweder wochenlang regungslos auf einem Aste sitzt (Übrigens quer nach gewöhnlicher Vogelsitte und nicht längs wie die echten Nachtschwalben) oder aber in einer Baumhöhle ruht, von einer späteren Bestätigung dieser Gouldschen Beobachtung ist mir allerdings nichts bekannt geworden. Sollte sie noch bestätigt werden, so müßte sie allerdings sehr zu denken geben, und der oft behauptete, aber niemals erwiesene sagenhafte Winterschlaf unserer Schwalben würde, wenn er auch heute nicht mehr vorkommt, in wesentlich anderem und sehr interessantem Lichte erscheinen. Auffallend ist auch, daß der Riesenschwalm die Baumheuschrecken, seine Lieblingsnahrung, nicht im Fluge erhascht, sondern ihnen kletternd im Gezweige nachsetzt. Von dem verwandten Hornschwalm ( P. auritus) Janas berichtet Bernstein, daß er auf Blattrippen im Rohr ein Nest nur aus den eigenen ausgerupften Flaumfedern baue; es ist so klein – dem kostbaren Baumaterial entsprechend –, daß der Vogel gar keinen Platz darin findet, sondern das einzige Ei derart bebrütet, daß er sich der Länge nach auf einen darüber hinwegragenden Rohrhalm setzt. Ähnlich verfahren ja auch die Baumsegler, eine Tatsache, die sehr für die nahe Verwandtschaft zwischen Nachtschwalben und Seglern spricht.
Der Baumsegler von Java ( Dendrochelidon clecho) baut sein merkwürdiges Nest nach den Untersuchungen Bernsteins in den höchsten Baumwipfeln an einen freistehenden, wagrecht verlaufenden Ast derart an, daß dieser die hintere Wand des Nestes bildet. Das Nest selbst ist ein ziemlich flacher, länglicher, halbrunder Napf, so winzig, daß er gerade das einzige Ei aufnehmen kann. Obendrein sind die aus Federn, Baumflechten und Rindenteilen mit Hilfe eines klebrigen Speichelsekrets zusammengepappten Seitenwände äußerst dünn und so zart wie Pergament. Diese fabelhafte Kleinheit und Gebrechlichkeit des Nestes erlaubt dem Vogel nicht, darin Platz zu nehmen, sondern er kann nur auf dem zugehörigen Aste sitzen und so allein mit dem Lauche das Nest und das darin befindliche Ei bedecken. Das ausgeschlüpfte Junge füllt schon nach wenigen Tagen die gnomenhafte Kinderstube vollkommen aus und ist daher bald genötigt, sie zu räumen. Es verläßt demnach das Nest und nimmt nun dieselbe Stelle ein, die früher das brütende Weibchen innehatte, also auf dem Aste, auf dem das Nest befestigt ist, und ruht nur mit dem Bauche in diesem. In diesem hilflosen Zustande würde es natürlich leicht eine Beute des Raubzeugs werden, wenn es nicht bei Gefahr zu rohrdommelartigen Verstellungskünsten instinktmäßig seine Zuflucht nähme. Es kauert sich dann derart nieder, daß von den Füßen nichts zu sehen ist, reckt aber den Hals steif in die Höhe, sträubt die Federn und verharrt in dieser Stellung völlig unbeweglich und – wie auch sonst – mäuschenstill, so daß man es meist übersieht, zumal auch sein dunkelgrün, weiß und braun geflecktes und marmoriertes Gefieder mit der Farbe der gewöhnlich mit grünlichweißen Flechten bedeckten Äste vortrefflich übereinstimmt.
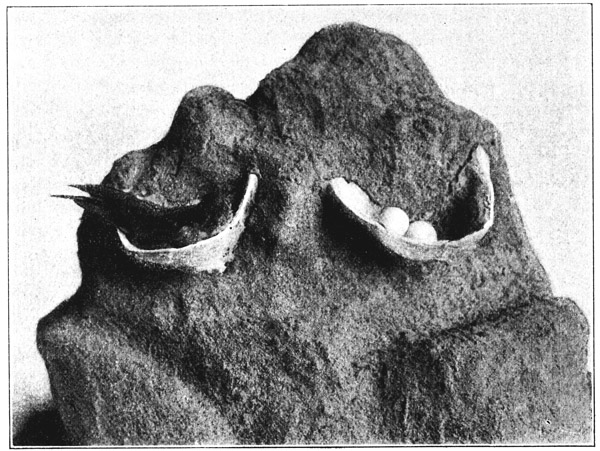
Gebr. Haeckel, Berlin phot. Abb. 7. Salanganen-Nester.
Wenn wir von Vogelnestern und Seglern sprechen, wird jeder unwillkürlich der berühmten eßbaren Vogelnester sich erinnern, die mit Lebensgefahr an den von einer tosenden Brandung umbrausten Steilküsten der Sundainseln gesammelt und als hochgeschätzter Leckerbissen zu hohen Preisen nach dem bezopften Reich der Mitte und neuerdings auch nach den großen Hotels der europäischen Hauptstädte und Luxusbäder verkauft werden, wo man eine sagoartige Suppe aus ihnen bereitet. Verfertigerin dieser Nester ist eine Seglerart, die Salangane. Die Nester (Abb. 7) selbst entsprechen in ihrer Form dem vierten Teil einer Eischale und haben am oberen Hinterrande beiderseits eine flügelförmige Verbreiterung, die eine genügend solide Befestigung an dem die Hinterwand bildenden Felsen ermöglicht. Die Nestsubstanz ist leimartig, wegen ihrer Dünne durchscheinend, mit deutlicher Querstreifung versehen, die das schichtenweise Aufträgen verrät, und von Farbe weißlich oder bräunlich. Je älter das Nest wird, desto mehr dunkelt es nach; die hellsten sind also die frischesten und gelten als die am besten schmeckenden, werden dementsprechend auch am teuersten bezahlt. Der Stoff, aus dem die eßbaren Schwalbennester bestehen, wird jetzt von der Chemie als Neossin bezeichnet und zu den Glykoproteiden gestellt; er enthält nach den Untersuchungen Collums u. a. 15 v. H. Zucker, 10 v. H. Stickstoff, 2 v. H. Schwefel, aber keinen Phosphor. Über seinen Ursprung hat man früher die abenteuerlichsten Vermutungen angestellt, und doch lag die Wahrheit eigentlich recht nahe, wenn man nur auf die Nistgewohnheiten anderer Seglerarten hätte achten wollen. Verwendet doch auch schon unser einheimischer Turmsegler als Bindematerial reichlich den eigenen, zähen und an der Luft rasch erhärtenden Speichel, und in noch ausgiebigerem Maße tun dies exotische Formen. Bei der Salangane nun erscheint der gleiche Vorgang einfach ins Extrem getrieben, so daß sie anderes Nistmaterial gar nicht mehr nötig hat, denn die vereinzelten Federchen, die man bisweilen in der Leimmasse findet, sind nur durch Zufall beim Nestbau an ihr kleben geblieben. Dagegen weisen die öfters sichtbaren Blutspuren in dem eßbaren Wundernest unverkennbar auf den Ursprung des Leimstoffes hin, denn sie verdanken zweifellos einer leicht erklärlichen Überreizung der Speicheldrüsen ihr Dasein. Im schönsten Einklänge damit steht es, daß die Salangane bei Beginn des Paarungsgeschäftes in Form von zwei großen, zur Seite der Zunge gelegenen Wülsten ganz enorm entwickelte Speicheldrüsen besitzt, die aber nach Beendigung der Brutzeit wieder verkümmern, wodurch doch ihr Zweck deutlich genug klargelegt ist. Sie sondern in reichlicher Menge einen dickflüssigen, aufgelöstem Gummiarabikum gleichenden, aber an der Luft rasch erhärtenden Schleim ab, der so zähe ist, daß man ihn mit einem Hölzchen in langen Fäden aus dem Schnabel hervorziehen kann, was die Feinschmecker mit so viel Behagen verspeisen, ist also nichts wie Vogelspeichel. Reichliche Ernährung begünstigt die Speichelabsonderung, beschleunigt somit den Nestbau. Bei seinem Beginn fliegen die Vögel wiederholt gegen die auserwählte Stelle und drücken dabei die Spitze ihrer Zunge gegen das Gestein, wodurch zunächst eine Halbkreis- oder hufeisenförmige Grundmauer aus Leimsubstanz entsteht. Ist der Bau so weit vorgeschritten, so klammern sie sich an der Felswand an und tragen nun unter abwechselnden Seitenbewegungen des Kopfes den Speichel schichtweise weiter auf. Schließlich findet man dann zwei glänzend weiße, ziemlich lange und spitzige Eier in dem »eßbaren« Neste.
Damit wären wir denn bei dem umfangreichen Kapitel besonders merkwürdiger oder kunstvoller Vogelnester angelangt. Bietet schon unsere einheimische Natur in dieser Beziehung Großartiges und Überraschendes auf Schritt und Tritt, wobei ich bloß an das Beutelnest des Pirols, an Zaunkönigs Moospalast, an des Rohrsängers schwebende Kinderwiege und an der Beutelmeise wundervollen Filzbau zu erinnern brauche, so können wir in überseeischen Ländern bei der dort so viel reicher und bunter entfalteten Schöpfungskraft der Natur erst recht unser Wunder erleben. Aber wenn es schon bei uns nicht leicht ist, vielmehr ein geübtes Auge und gute Vogelkenntnisse erfordert, Vogelnester zu finden, so ist dies hundert- und tausendmal schwerer noch in der undurchdringlichen Pflanzenwildnis des tropischen Urwaldes, und daher erklärt es sich auch ohne weiteres, daß wir über das Brutgeschäft so vieler, oft ganz gewöhnlicher ausländischer Vogelarten noch höchst mangelhaft unterrichtet sind. Im allgemeinen verdient hervorgehoben zu werden, daß der Einfluß der Jahreszeiten auf das Brutgeschäft in warmen Ländern ein viel geringerer ist als bei uns. So brüten auf den Bismarckinseln nach Heinroth sehr viele Vogelarten in allen Monaten und lassen eigentlich nur durch das Mausergeschäft eine kurze Unterbrechung eintreten, wenn auch manche unsere Sommer-, andere unsere Wintermonate bevorzugen. Deshalb erzeugt auch jede Mauser dort sofort das Brutkleid, und die besonderen Reise- und Winterkleider unserer Vogelwelt sind völlig unbekannt. Ferner ist zu betonen, daß das Brüten in warmen Ländern viel öfter und auf viel längere Zeit unterbrochen werden kann wie bei uns, ohne Gefahr für die Entwicklung der Eier befürchten zu müssen, eine Tatsache, die namentlich Strandvögel sich zunutze zu machen wissen.
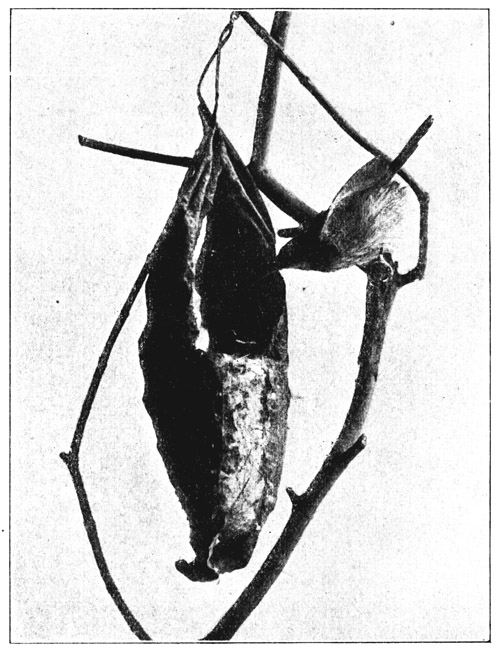
Gebr. Haeckel, Berlin phot. Abb. 8. Schneidervogel mit Nest.
Bleiben wir zunächst noch bei den Seglern und betrachten wir einmal den Bau des brasilianischen Acanthylis oxyurus. Sein äußerst merkwürdiges Nest besteht aus einem 30 cm langen und 8-10 cm im Durchmesser haltenden Zylinder, der im Walde an der unteren Fläche eines dicken Baumastes senkrecht aufgehängt wird. Er hat keinerlei Abteilungen oder Zwischenwände, sondern bildet eine einzige, glatte, nach unten offene Röhre. Die Wandung besteht aus gefiederten fliegenden Samen, deren Wolle oder Seide zu einem dichten, undurchdringlichen Gewebe zusammengefilzt ist, aber während diese kleinen Samenkörner mit ihrer Schale auf der Innenseite überall frei vorragen, ist die ganze Außenseite mit den verschiedenartigsten Federchen geschmückt, die schwach in das Gewebe angeleimt sind und ihm ein ungemein zottiges Aussehen verleihen, da sie überall bauschig vorstehen. Man sieht es dem Bau an, daß sein ganzes Material von dem Segler aus der Luft gefischt wurde, »wie es nun der Vogel anstellt,« sagt Euler, dem wir die erste Beschreibung dieses absonderlichen Nestes verdanken, »um in diesen nach unten klaffenden Zylinder Eier zu legen, ist mir ein Rätsel. Jedenfalls kann er nur in aufrecht angeklammerter Stellung im Neste verweilen, wie sie ja der Gattung eigen ist und auch beim Übernachten in Baumhöhlungen angenommen wird. Um aber bei der Form des Nestes in dieser Stellung brüten zu können, müßte er notgedrungen die Eier an die Nestwand anleimen.« Letzteres erscheint gar nicht so undenkbar, vielmehr bis zu einem gewissen Grade wahrscheinlich, da Brehm einen afrikanischen Segler ( Apus parvus) fand, der in der Tat das Gelege festklebt, um es bei heftigem Winde vor dem Herausfallen aus dem schwankenden Neste zu schützen.
Auch für die Stammesgeschichte der Vögel gibt die Entwicklung ihres Brutgeschäftes manchen wertvollen und interessanten Hinweis, der bisweilen blitzartig sonst dunkle Verhältnisse zu erhellen vermag, wir wissen, daß die Vögel aus den Kriechtieren hervorgegangen sind, und daß letztere zwar auch Eier legen, diese aber nicht selbst zu bebrüten vermögen, da ihrem Blute die dazu nötige Eigenwärme fehlt. Offenbar hat sich der Übergang auch in dieser Beziehung ganz allmählich vollzogen, und noch heute gibt es Vögel alter Stämme, die bis zu einem gewissen Grade in ähnlicher Lage sind, also selbst nicht genügend Brutwärme zu entwickeln vermögen und daher auf alle möglichen Hilfsmittel zu ihrer Erzielung angewiesen sind. Die Brutöfen der Wallnister, das Nichtbrüten der Kuckucke, das Einmauern der brütenden Nashornvögel, das gesellige Zusammenbrüten der Madenhacker u. a. lassen sich auf diese Weise gewiß am einfachsten und am naturgemäßesten erklären, wenn auch mancherlei andere Ursachen mitgewirkt haben mögen, daß gerade bei diesen Vogelgruppen eine so alte und primitive Brutweise bis auf unsere Tage erhalten blieb. Die eben erwähnten Wallnister oder Großfüßer Australiens, von den Ansiedlern gewöhnlich Busch- und Talegallahühner genannt, leben truppweise in den Waldungen und sind ausgezeichnet durch den kahlen Kopf und kräftige, mit sehr langen Nägeln bewehrte Füße. Sie brüten nicht selbst, sondern nehmen für die Entwicklung ihrer Eier natürliche oder künstlich erzeugte Wärme zu Hilfe. Am einfachsten liegt die, Sache für sie auf heißen vulkanischen Inseln, wo es immer Stellen gibt, deren Erdboden eine erhebliche Eigenwärme besitzt. Solche Stellen suchen sich die Vögel mit großer Umsicht aus und benützen sie dann jahrelang, solange sich die Wärmeverhältnisse des Bodens nicht verändern. Mit untrüglicher Sicherheit wissen sie dabei gerade die für die Entwicklung der Eier zweckmäßigste Temperatur herauszufinden. Gewöhnlich finden sich die schon äußerlich auffallenden Brutlöcher an schrägen hängen und führen ein wenig nach abwärts in die Bergwand hinein. Die Öffnung ist namentlich bei schon seit Jahren benutzten Bruthöhlen so groß, daß ein Mensch hindurchkriechen kann, aber rasch verengert sich der Gang auf Meterlänge trichterförmig und ist am Grunde ganz mit lockerer Erde angefüllt, zwischen der man beim Herumwühlen die Eier findet, während also hier die Wallnister nur eine einmalige Grabarbeit nötig haben, liegen die Verhältnisse im Busch des australischen Festlands schon erheblich schwieriger für sie. Hier sind sie ausschließlich auf das Gärungsvermögen verwesender Pflanzenteile angewiesen. Sobald die Brutzeit herannaht, scharrt das Männchen mit seinen starken Füßen allerlei lose Pflanzenstoffe zusammen und stapelt sie hinter sich zu einem großen Haufen auf. Da solche Haufen, wenn die Brut ungestört und glücklich verlief, jahrelang benutzt und dann nur in jeder Saison etwas ausgebessert und vergrößert werden, so erreichen sie schließlich die stattliche Höhe von mehreren Metern bei entsprechendem Umfang. In der Mitte des Hügels befindet sich eine Mulde, in die dann die Eier mit bestimmten Abständen aufrecht hineingestellt und hierauf mit verwesendem Pflanzengenist zugedeckt werden. Ihre große Zahl deutet darauf hin, daß mehrere Weibchen in ein Nest legen. Das Männchen soll mit großer Umsicht den nötigen Wärmegrad regulieren, indem es je nach den Verhältnissen die Niststoffe bald in größerer Menge anhäuft, bald zum Teile entfernt. Da die Eier in sehr verschiedenen Abständen in diesen natürlichen Brutofen eingebracht werden, entwickeln sie sich natürlich auch zu ganz ungleichen Zeiten. Die ausgeschlüpften Jungen bringen noch mindestens 12 Stunden unter der durchschnittlich etwa 40 cm hohen Nestdecke zu und kommen erst am zweiten Tage hervor, wenn ihr Dunengefieder bereits völlig abgetrocknet ist. Sie laufen dann schon munter im Sonnenschein umher, ziehen sich aber doch gegen Abend wieder an ihre Geburtsstätte zurück, wo sie vom besorgten Vater wieder warm zugedeckt werden. Aber schon in der nächsten Nacht sollen sie erstarkt genug sein, um die künstliche Wärme entbehren zu können, wie sie sich überhaupt ganz ungewöhnlich rasch entwickeln. Also alles in allem eine Brutmaschine comme il faut und mit »künstlicher Glucke« obendrein!
Noch viel merkwürdigere Verhältnisse treffen wir bei den schon durch ihr absonderliches Aussehen und den riesenhaften, hohlzelligen Schnabel ausfallenden Nashornvögeln (Abb. 9) an, die die farbenprächtigen Pfefferfresser der Neuen Welt in der Alten vertreten, hier stille Waldungen des heißen Tieflandes oder der Vorberge bewohnen und daselbst im allgemeinen ein rabenartiges Wesen zur Schau tragen. An einem hohen und astlosen Baumstamme suchen sich diese in inniger Ehegemeinschaft lebenden und daher auch außer der Brutzeit stets paarweise zusammenhaltenden Vögel eine geeignete Höhlung aus, deren Eingang sie zunächst mit dem kräftigen Schnabel erweitern. Sowie aber das Weibchen auf dem Gelege Platz genommen hat, vermauert das Männchen mit Erde und faulendem Holzmulm – Stoffe, die es mit seinem klebrigen Speichel zu einer später steinhart werdenden, einheitlichen und festen Masse verknetet – den Eingang bis auf einen engen Spalt, so daß das brütende Weibchen seine Wochenstube überhaupt nicht mehr zu verlassen vermag. Andere Forscher berichten, daß das Weibchen selbst der Baumeister sei und hauptsächlich den eigenen Kot verwende. Überhaupt weichen die Berichte über das Brutgeschäft dieser merkwürdigen Vögel in den Einzelheiten vielfach voneinander ab, und es scheint, als ob die einzelnen Arten der Nashornvögel sich dabei etwas verschieden verhielten. Übereinstimmend aber heißt es weiter, daß das Männchen sein eingesperrtes Weibchen mit Früchten, Fleisch und selbst Aas fleißig füttere, ebenso die ausgeschlüpften Jungen, und dabei einen solchen Eifer und eine solche Hingebung entwickle, daß ihm kaum selbst noch Zeit zum Fressen bleibt, es demgemäß jämmerlich abmagert, ja nicht selten an völliger Entkräftung elend zugrunde geht, während Gattin und Kinder dick und fett werden und daher bei den Eingeborenen als geschätzte Leckerbissen gelten, hat aber endlich die Erlösungsstunde für diese harte und entbehrungsreiche, reichlich zwei Monate währende Prüfungszeit geschlagen, so öffnet das Männchen von außen mit Aufgebot der letzten Kräfte die Trennungsmauer, und Mutter und Kinder entflattern ins Freie, erstere vom langen Sitzen in der Gefangenschaft so steif und ungelenk, daß sie sich zunächst kaum zu bewegen vermag. Mitunter soll auch gleich eine zweite Brut sich anschließen, wobei die Zungen der ersten die Nisthöhle verlassen, sobald die der zweiten die Eischalen durchbrochen haben. Die zweite Brut wird dann von beiden Eltern gemeinsam gefüttert, nachdem die Höhlung zur Hälfte wieder geschlossen worden ist. Höchst auffallend ist es nun aber, daß das Weibchen während seiner Gefangenschaft eine rapide und sehr vollständige Mauser durchmachen muß, so daß es während dieser Zeit zumeist halbnackt in seiner stillen Klause sitzt, die ausgefallenen Federn aber zur wärmenden Auspolsterung des Brutraumes verwenden kann, warum mag es denn aber wohl überhaupt eine in der Vogelwelt so einzig dastehende Klausur durchzumachen haben? Die Eingeborenen jener Länder waren mit einer der eigenen Denkungsweise entsprechenden Erklärung sehr rasch bei der Hand; sie meinten, daß der männliche Nashornvogel seine Gattin lediglich aus Eifersucht einmauere und sie durch verkleistern auch des letzten Spaltes mit dem Tode bestrafe, wenn er sie trotzdem auf einem Treubruch erwische, und es hat nicht an naiven Naturforschern gefehlt, die das auch getreulich nachgeschrieben haben. Näher lag schon die Vermutung, daß der aufgeführte Wall zum Schutze gegen Affen, Eichhörnchen und katzenartige Raubtiere dienen solle. Bernstein meint, daß er lediglich den Zweck habe, das Weibchen vor einem herausfallen aus dem Neste zu behüten, weil es sonst bei seiner durch die totale Mauser bedingten Flugunfähigkeit und Hilflosigkeit gar nicht imstande sein würde, die hochgelegene Bruthöhle wieder zu erreichen. Ich möchte aber doch Martin beipflichten, der der Ansicht ist, daß es sich auch hier wieder um eine notwendige Erhöhung der Brutwärme handle, die in diesem Falle durch den engen Verschluß der Höhlung und die starke Federauspolsterung bewirkt wird; daneben mögen ja die angeführten beiden anderen Gründe auch eine Rolle spielen. Bewundernswerte Einsicht des Vogels kommt jedenfalls ungleich mehr in Betracht als blinde Eifersucht. Da die Nashornvögel zusammengeheftete Zehen besitzen, vermögen sie sich auf dem Boden nur ziemlich ungeschickt zu bewegen, wobei sie mit beiden Füßen zugleich vorwärts Hüpfen. Dagegen ist der Flug hoch und ziemlich rasch, und Kopf und Hals mit dem mächtigen Schnabel werden dabei lang ausgestreckt. Kommt der Vogel näher, so vernimmt der Beobachter ein eigentümlich sausendes, taktmäßiges Geräusch, das vielleicht daher rührt, daß die in den auffallend großen und weiten Luftsäcken eingeschlossene Luft bei den heftigen Bewegungen der kräftigen Flugmuskulatur aus einem Behältnis in das andere gepreßt wird. Dem Menschen gegenüber zeigen sich die Nashornvögel sehr scheu, aber durchaus nicht von blinder Furchtsamkeit, bekunden vielmehr im Notfall viel Mut und vermögen mit ihrem Riesenschnabel auch ganz empfindlich zu hacken.
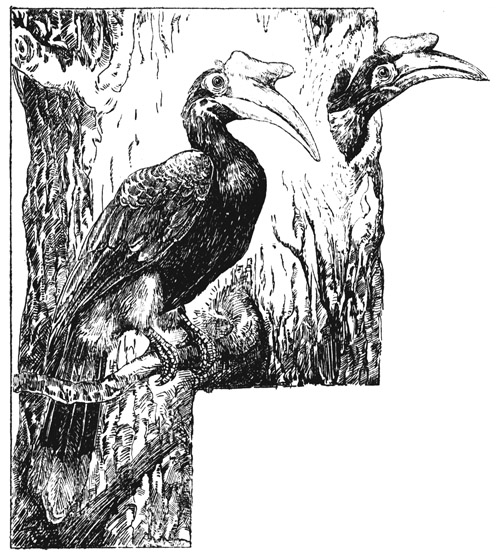
Abb. 9. Nashornvogel.
Es gibt auch in warmen Ländern Kuckucksformen, die die lästige Sorge um Eier und Junge ganz einfach anderen Vögeln überlassen, in deren Nester sie ihr Ei einzuschmuggeln wissen. So legt der hübsche, schlanke, mit einer kleinen Federhaube geschmückte und schon in Spanien vorkommende Straußkuckuck regelmäßig in die Nester von Krähen und Elstern. Daneben fehlt es aber auch nicht an Kuckucksarten, die sich selbst zum Brutgeschäft bequemen. So erbauen die Sporenkuckucke im niedrigen Steppengestrüpp ein kunstloses und liederliches Blätternest und brüten in diesem ihr Gelege selbst aus. Die dann ausschlüpfenden Jungen haben ein höchst abenteuerliches Aussehen, da ihre Haut von schwarzer Färbung ist und sie aus dem weiten Rachen eine brennend rote Zunge herausstrecken, so daß sie kleinen Teufelchen gleichen. Die Sporenkuckucke sind schlechte Flieger, aber äußerst gewandte Kletterer, Klimmer und Schlüpfer, fühlen sich daher im dichtesten und verworrensten, stellenweise förmlich verfilzten Savannengestrüpp am meisten heimisch. Noch weiter ist die Anpassung an das Bodenleben bei den Erdkuckucken Mexikos gediehen. Auch ihr Flugvermögen ist gering und wird nur selten ausgeübt, aber dafür sind sie um so hurtigere Läufer und vermögen überdies infolge der langläufigen, aber kurzzehigen Beine und mit Unterstützung der kurzen Flügel Sprünge von 3 m Höhe und entsprechender Weite auszuführen. Ihre Schnellfüßigkeit reizt nicht selten die reitlustigen Mexikaner zu ihrer Verfolgung, bei diesem Wettlauf bleibt der Kuckuck aber fast regelmäßig Sieger über das Pferd. Ganz eigenartige Kuckucke sind endlich die Madenfresser Südamerikas, schlanke Vögel von elsterartigem Bau und Wesen, deren zu einem hohen Kamm zusammengedrückter und im Oberkiefer hohlzelliger Schnabel im Verein mit der knappen Befiederung und dem nur aus acht Federn bestehenden Schwänze schon unverkennbar auf ein hohes stammesgeschichtliches Alter hinweist. Ohne Scheu vor dem Menschen treiben sich die in ein dunkel glänzendes Gefieder gehüllten Vögel auf den Viehweiden herum und sind hier redlich bemüht, die Haut der Weidetiere von quälenden Larven und Zecken zu reinigen, wie sie es in früheren Jahrhunderten ebenso mit den Hirschen und Wildschweinen gehalten haben mögen. Ihr noch keineswegs völlig aufgeklärtes Brutgeschäft muß das Interesse des denkenden Vogelfreundes im höchsten Maße dadurch erwecken, daß es zumeist gesellig ausgeübt wird, d. h. es legen und brüten mehrere Weibchen in einem Nest: eine in der Vogelwelt ganz einzig dastehende Erscheinung, zu der ebenfalls das Wärmebedürfnis Veranlassung gegeben haben mag. So fand Martin das umfangreiche, aber unordentlich zusammengetragene Nest etwas über mannshoch im dichten Baumgewirr, scheuchte vier oder fünf Weibchen heraus und entdeckte dann achtzehn Eier, deren grünliche Schalen mit einem zerreibbaren kalkigen Überzug versehen waren. Nur zwölf davon kamen aus, während sich die übrigen sechs beim Ausblasen als klar erwiesen, also offenbar von der Brutwärme gar nicht erreicht worden waren.
Echtem Brutparasitismus huldigen dagegen auch Vögel, die außerhalb der Kuckucksgruppe stehen, nämlich die schlicht gefärbten Viehstare der südamerikanischen Pampa, die deshalb von den Brasilianern als Gauderios = Betrüger bezeichnet werden. In vielköpfigen Trupps treiben sie sich das ganze Jahr hindurch unter krächzendem Gezwitscher bei den Kaffeeplantagen und auf den Viehweiden herum, suchen zutraulich im Rinderdung nach Mistkäfern, schnappen vom Rücken der Weidetiere aus nach vorübersummenden Fliegen und Bremsen oder lesen ihren vierfüßigen Freunden eifrig die Zecken ab. Aber schon der für einen Starvogel ungewöhnlich starke und kräftige Schnabel weist darauf hin, daß sie nebenbei auch Sämereien und Früchte nicht verschmähen, und in der Tat muß schon der Magen der zarten Dunenjungen auf solche Doppelnahrung eingerichtet sein, da die weiblichen Kuhstare ihre bald rein weißen, bald bunt gezeichneten, immer aber sehr veränderlichen Eier mit Vorliebe Körnerfressern anvertrauen, wobei der Morgenammerfink besonders bevorzugt zu werden scheint. Dessen häufiges Vorkommen scheint sogar bis zu einem gewissen Grade die Häufigkeit auch der Viehstare zu bedingen. Bei ihrem im allgemeinen zahlreichen Vorkommen und ihrem stets geselligen Auftreten sowie bei der Hast, mit der sich das stets so bald als möglich wieder zum Schwarme zurückkehrende Weibchen seines Eis zu entledigen sucht, ereignet es sich viel häufiger als bei unserem Kuckuck, daß mehrere Weibchen in das gleiche Nest legen. In diesem Falle wird von den Pflegeeltern aber doch immer nur ein Ei erbrütet oder wenigstens nur ein Junges großgezogen. Anscheinend erfolgt die Ablage der einzelnen Eier in größeren Abständen, als es sonst in der Vogelwelt üblich ist.
Hat schon unser Zaunkönig bekanntlich die Neigung, außer dem Brutnest auch noch besondere Spielnester zu errichten, so tritt diese Gewohnheit in noch viel ausgesprochenerem und eigenartigerem Maße bei den Laubenvögeln Australiens auf, star- bis dohlengroßen verwandten der Pirole und Paradiesvögel, deren eigentliches Brutnest an das unserer Drosseln erinnert. Ganz anders nehmen sich aber die von den sehr menschenscheuen Vögeln an den einsamsten Stellen im Walde errichteten Vergnügungsbauten aus, bei deren Anlage sie interessanterweise einen unverkennbaren Schönheitssinn entwickeln. Der Kragenlaubvogel z. B., der durch einen aus weichen, seidenartigen Federn von violetter Färbung gebildeten und sich seltsam von dem übrigen Gefieder abhebenden Kragen gekennzeichnet wird, schleppt zur Paarungszeit im überhängenden Grase Reisig herbei, steckt es schräg in die Erde und wölbt es oben dachartig zusammen, so daß eine reichlich meterlange, tunnelähnliche, vorn und hinten offene Laube (Abb. 10) entsteht, deren Boden sauber mit Gras ausgelegt wird. Besitzt sie noch Seitengänge, so läßt dies darauf schließen, daß sie von mehreren Pärchen benützt wird. Zur Ausschmückung ihres Lusthauses schleppen die Vogel nun aber noch aus oft weiter Entfernung und mit viel Fleiß und Anstrengung alle möglichen bunten Gegenstände herbei, schöne Papageifedern, farbige Zeuglappen, Muschelschalen, Schneckengehäuse, hübsch gefärbte Steinchen, weißgebleichte Knochen u. dgl., und zwar in so erstaunlicher Menge, daß man bisweilen einen halben Scheffel derartiger Dinge bei ihrem Tuskulum auflesen kann. Vielleicht sind die sprichwörtlich gewordenen Diebesgelüste unserer Rabenvögel auch noch ein atavistisches Überbleibsel ähnlicher Gewohnheiten? Die schweren Gegenstände werden vor dem Eingang der Laube niedergelegt, die Federn dagegen zwischen deren Reisigwände gesteckt. Begreiflicherweise dient die Laube vor allem als Balzplatz. Rundherum um den schön geschmückten Bau jagt das liebestolle Männchen das auserkorene Weibchen, geht dann zum Vorplatz der Laube und trommelt hier mit dem Schnabel auf den Muschelschalen herum, wobei es das Gefieder sträubt, bald den rechten, bald den linken Flügel in die Höhe hebt und dazu sonderbare Töne hören läßt, am Schlusse aber mit vor Aufregung weit hervorquellenden Augen lebhaft pfeift. Eine andere Art, Amblyornis subalaris, schmückt den ebenfalls tunnelartigen Lustbau mit bunten Käferflügeln, harten, glänzend blauen Beeren und weißen, sternchenförmigen Blüten, die von außen in das grüne Moos der Wände hineingesteckt werden und so ein ganz reizendes Bild abgeben. Der Spielplatz vor der Laube wird hübsch mit Moos und Zweigen belegt und ebenfalls mit Früchten und Blüten geschmückt, wobei aber die gelbe Farbe bevorzugt wird. Noch bemerkenswerter dürfte es sein, daß die Blumen beim Verwelken stets erneuert werden, was doch schlagend das tatsächliche Vorhandensein eines Schönheitssinnes beweist. Eine weitere Laubenvogelart, Scenopoeetes dentirostris, errichtet keine Laube, sondern nur eine Art Garten, zu welchem Zwecke ein Platz von 2½-3 m Länge und 1½ m Breite zunächst auf das sorgfältigste von Blättern, Zweigen und Gras gereinigt, gewissermaßen gefegt wird. Die Ausschmückung besteht dann aus einzelnen großen und schönen Blättern, die immer mit der Unterseite nach oben hingelegt und sofort durch frische ersetzt werden, sobald sie zu welken beginnen. Die Laubenvögel ernähren sich in der Hauptsache von Früchten und Beeren, müssen also den Fruchtfressern zugerechnet werden, obschon sie tierische Kost keineswegs verschmähen.
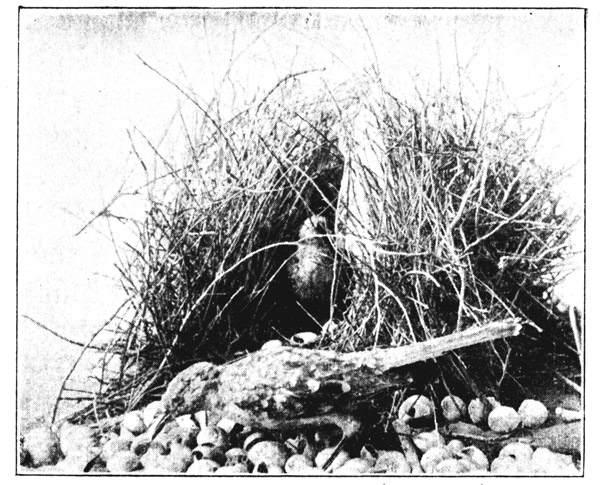
Gebr. Haeckel, Berlin phot. Abb. 10. Hochzeitslaube des Kragenlaubvogels.
Bei solchen mehr oder minder ausgesprochenen Fruchtfressern bietet auch die Aufzucht der Jungen manche nicht uninteressante Momente, wahrscheinlich verfüttern nämlich die Alten nur den Saft der in ihrem Schnabel ausgequetschten Früchte, der der Brut leicht in den Schlund hinabläuft, ja es scheint, als ob die Jungen richtige Schluckbewegungen erst nach dem Verlassen des Nestes auszuführen vermöchten, wenigstens quetschten die Nestjungen einer auf dem Bismarckarchipel heimischen und ausschließlich fruchtfressenden Starenart, Aplonis cantoroides, die Heinroth mit Universalfutter aufzupäppeln versuchte, aus diesem bloß den Wassergehalt heraus und gaben alles übrige alsbald in Wurstform durch den Schnabel wieder von sich. »Man kann sich denken, welche Mengen des eiweißarmen Fruchtsaftes dazu gehören müssen, um einen so rasch aufwachsenden jungen Star aufzuziehen, und einmal deshalb ist die geringe Zahl des Geleges verständlich (meist zwei Eier). Anderseits wäre auch das Fortschaffen so großer Kotmassen, wie sie eine nach unseren Begriffen vollzählige Starenbrut liefern würde, für die beiden Eltern wohl undurchführbar. Dafür brütet der Vogel fast das ganze Jahr hindurch und sichert sich dadurch die genügende Zahl der Nachkommenschaft.« Gesanglich unterscheidet sich dieser Star unserer Antipoden ebenfalls stark von unserem allbeliebten Starmatz, denn es fehlt die Liedbegleitung durch Flügelschlagen, die für den letzteren so charakteristisch ist, und auch die Strophen selbst ertönen nur ziemlich leise.
In unseren Tiergärten kann heutzutage jedermann als besonders kunstfertige Nestbauer die Webervögel (Abb. 11) Afrikas und Asiens beobachten, ja er kann sich dieses Vergnügen sogar leicht im eigenen Zimmer verschaffen, wenn er eine Ausgabe von etlichen Mark nicht scheut, da die Webervögel zu denjenigen Vogelarten gehören, die jederzeit und zu erstaunlich billigen Preisen auf dem Vogelmarkt zu haben sind. Freude machen diese sonst eigentlich nicht besonders anziehenden, sperlingsartigen Samenfresser auch noch dadurch, daß die Männchen zur Brutzeit in den grellsten und lebhaftesten Farben förmlich erglühen und aufleuchten, während sie sich das ganze übrige Jahr hindurch gleich den Weibchen mit einem gar einfachen Röcklein begnügen müssen, das stark an das Proletarierkleid unserer Spatzen erinnert. Das Männchen ist der eigentliche Baumeister und stellt das kunstvolle Grundgerüst fast allein her, während das Weibchen sich mehr um die innere Ausfütterung besorgt zeigt. Zu erklären ist die eigenartige Nistweise der Weber wie auch verwandter Vogelgruppen durch ihre berechtigte Furcht vor den Nachstellungen eierfressender Baumschlangen, denen durch die Nestanlage die Annäherung unmöglich gemacht werden soll und zumeist auch unmöglich gemacht wird. Und charakterisiert wird die ganze Nistweise weiter noch dadurch, daß der diesen Vögeln in so hohem Maße eigene Geselligkeitstrieb sich auch hierbei nicht verleugnet. Am schärfsten tritt dies bei dem Siedelweber zutage, dessen Nester zu Hunderten auf den dornigen und glattstämmigen Mimosen Innerafrikas unter einem gemeinsamen Dache vereinigt sind, so daß sich nicht selten die Äste unter ihrer Last biegen. Unter dem gemeinsamen Dach hängen klumpenweise die Einzelnester, oben an der Seite mit einem faustgroßen Eingangsloch versehen, und alljährlich vermehrt sich noch ihre Zahl, bis endlich solche riesige Ansiedlungen zustande kommen, wie sie uns Paterson und Livingstone beschrieben haben. Nicht weniger interessant erscheinen die Nester der indischen Bajaweber, die zwar nicht unter einem gemeinsamen Dache vereinigt sind, aber doch dutzendweise in friedlicher Nachbarschaft auf dem gleichen Baume hängen, und zwar der größeren Sicherheit halber zumeist unmittelbar über dem Wasserspiegel an der äußersten Spitze eines Bambuszweiges oder Palmblattes, hier doch so gut befestigt, daß auch ein starker Sturm sie nur selten herunterzuwerfen vermag. Die Aufhängung des einer Birne oder umgekehrten Retorte gleichenden Nestes erfolgt an dem dünnen, kaum zolldicken, aber dauerhaft aus Pflanzenfasern gedrehten Stiel, an dessen Ansatz sich die nach unten röhrenförmig sich fortsetzende Eingangsöffnung und gleich neben ihr der eigentliche, korbförmige Brutraum befinden. Da aber das Nest, in das allerdings auch die gewandteste Baumschlange nicht hineinzugelangen vermag, beständig im Winde hin und her schwankt, infolgedessen die Gefahr des Herausfallens für Eier und Junge groß ist, wird zwischen vor- und Brutraum noch eine solide, 4 cm hohe Scheidewand errichtet. Außer diesen den Weibchen und dem Brutgeschäft vorbehaltenen Brutnestern verfertigen sich die ungemein baulustigen Männchen aber auch noch besondere körbchenförmige Schlafnester, die als außergewöhnlichen Luxus sogar noch einen geflochtenen Quersitz aufzuweisen haben. Zur Herstellung dieser großen und kunstvollen Bauten benutzen die Vögel ausschließlich feine, schmale Grashalme und deren Blätter, die mit solch bewundernswerter Genauigkeit und Sorgfalt untereinander verflochten werden, daß das Nest ein überaus regelmäßiges, glattes und gefälliges Aussehen erhält. Diese festgefügte Bauart hat Anlaß gegeben zu der malaiischen Sage, daß derjenige, der eines der Brutnester auseinander zu nehmen vermag, ohne einen der es zusammensetzenden Halme zu zerbrechen, im Inneren eine goldene Kugel vorfindet. Zwar ist die Lösung dieser Aufgabe noch niemandem geglückt, aber eine Kugel wollten manche doch schon am Grunde der Wunderbauten vorgefunden haben, allerdings keine goldene, sondern nur eine solche aus Lehm, ja man hat sogar allen Ernstes gefabelt, daß an dieser regelmäßig ein Leuchtkäfer angeklebt sei, gewissermaßen als natürliche Lampe für das halbdunkle Nestinnere. Beruhen diese Mitteilungen überhaupt auf Wahrheit, so dienen die Lehmklumpen jedenfalls lediglich als Beschwerungsmittel für das im Winde schwankende Nest. Kein so großartiger Baukünstler ist der Feuerweber (Abb. 12), denn seine kugligen oder ovalen, mit einem seitlichen Eingang versehenen Nester sind so lose gewoben, daß man oft die himmelblauen oder spangrünen Eier durchschimmern sehen kann. Prachtvoll aber ist das Hochzeitskleid der Männchen, und sie verstehen es, diese Gefiederherrlichkeit bei der Balz auch recht zur Schau zu stellen, indem sie sich dick aufplustern, namentlich das Kopf- und Halsgefieder ganz merkwürdig hoch aufsträuben, dazu tanzende Bewegungen vollführen und eigenartig zischende Töne hören lassen.

Abb. 11. Nest des Webers ( Ploceus atr.).
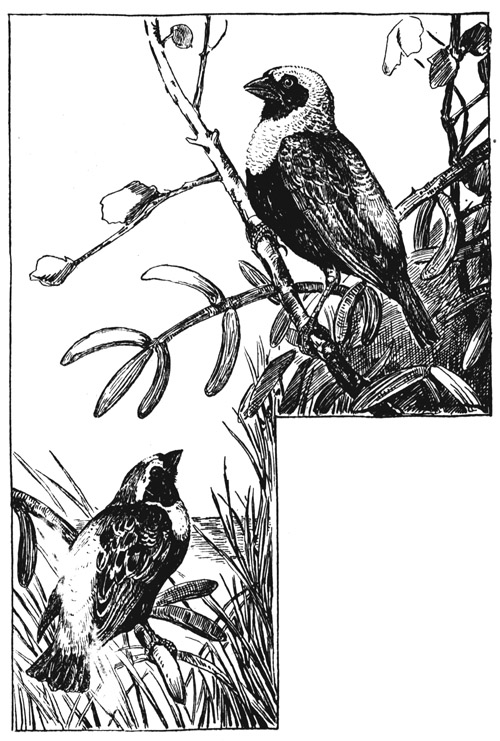
Ab. 12. Oben: Feuerweber. Unten: Ploceus abyssin.
Ebenso eitel auf ihre Gefiederschönheit scheinen die nahe verwandten und auch ähnliche Nester bauenden Widafinken oder Witwen der afrikanischen Savannen zu sein. Bei ihnen macht sich der zu Beginn der Brutzeit angesammelte Säfteüberschuß nicht nur durch Auftreten schönerer und lebhafterer Farben, sondern noch mehr in der Ausbildung der Schwanzfedern geltend, die zu ganz erstaunlicher Länge anwachsen und überdies eine ungewöhnliche, gehoben dachförmige Stellung erhalten. Um diese Zeit ebenso lebhaft und kampfeslustig wie die Webermännchen, steigen die so herrlich geschmückten Witwenmännchen balzend in schräger Richtung in die Lüfte empor, wobei sie den schweren und langen Schweif nicht ohne Mühe nachschleppen, vollführen förmliche Lufttänze und kehren dann in langsamem Gleitfluge wieder an den Ausgangspunkt zurück. Auch die liebreizenden und teilweise in der Gefangenschaft so leicht zu züchtenden Prachtfinken, diese winzigen, niedlichen und bunten Geschöpfchen, die wir eng zusammengehuschelt massenhaft in den Käfigen unserer Vogelhändler sitzen sehen, wo sie zu unglaublich niedrigen Preisen ausgeboten werden, gehören in diese Sippe. Naturgeschichtlich sind sie dadurch interessant, daß bei manchen von ihnen, die wir als ausgesprochene Halbhöhlenbrüter kennen, sich an der Schnabelwurzel der Nestjungen beiderseits kleine Papillen befinden, die im schönsten Blau phosphoreszieren, sobald der geringste Lichtstrahl auf sie fällt, während sie bei völliger Dunkelheit nicht zu leuchten vermögen. Die praktische Bedeutung dieser Einrichtung dürfte ohne weiteres klar sein: bei dem wenigen und zerstreuten Lichte des Nestinneren erleichtert sie den fütternden Alten in hohem Maße das rasche Auffinden der hungrig aufgesperrten Schnäbel ihrer hoffnungsvollen Kinderschar. Und noch ein weiteres kommt hinzu. Zwischen den blauen Papillen auf jeder Seite des Schnabelwinkels sitzen nämlich auch noch gelbe Wärzchen, die reichlich mit Tastkörperchen ausgestattet sind; durch ihre Berührung bringen die alten Vögel die kleinen ohne weiteres, also nur durch den reflektorischen Anreiz, zum Aufsperren des Schnabels.
Auch die so üppig entwickelte südamerikanische Vogelwelt hat Nester aufzuweisen, die sich den altberühmten Kunstbauten der Webervögel getrost an die Seite stellen können, ja sie in gewisser Hinsicht noch übertreffen. Es sind dies die originellen Kinderwiegen der Kaziken oder Beutelstare, staren- bis dohlengroßer Vögel mit halb starartigem, halb weberartigem Benehmen, weshalb man sie auch als Weberstare bezeichnen könnte, prangend in glänzend schwarzem Gefieder, das durch hochgelbe oder scharlachrote Schmuckpartien gar prächtig gehoben wird. Körperlich und geistig gleich gut begabt, keck und lebensfroh, verträglich und gesellig, munter und lebhaft, aufmerksam und vorsichtig, fesseln sie in hohem Maße das Interesse des Beobachters, der auch an ihren Gesangsvorträgen seine helle Freude haben wird. Flügelschlagend und die bunten Rückenfedern sträubend, singt das Männchen schwatzend und pfeifend sein fröhliches, wechselvolles, von angenehmen Flötentönen durchsetztes Starenlied. Auch eine hervorragende Spötterbegabung ist bei einzelnen Arten nachgewiesen. Die Hauptnahrung der Beutelstare besteht in Früchten, daneben werden auch Kerfe gern genommen, oder die Nester kleiner Vögel ausgeplündert. Die eigene Brut aber verstehen die Kaziken gegen Nachstellungen ganz wunderbar zu schützen, indem sie bei Anlage ihrer Nester denselben Bauplan befolgen, wie die Webervögel. An sorgfältig ausgewählten, meist über den Wasserspiegel sich neigenden Bäumen hängen kolonienweise ihre scheinbar lose, in Wirklichkeit aber überraschend fest aus Grashalmen geflochtenen Nester, deren Gestalt Martin sehr treffend mit der von Schrotbeuteln aus der guten alten Zeit vergleicht, die dabei mindestens fußlang sind, bei den größeren Arten aber die stattliche Länge von 1½ m bei 14-17 cm oberer Weite erreichen. Man kann sich vorstellen, wie diese Gebilde im Sturmwinde schwanken müssen. Wo die Beutelstare häufig auftreten, geben die in solcher Weise von ihnen mit Nestern bedachten Bäume der südamerikanischen Landschaft streckenweise geradezu ein charakteristisches Gepräge. Der Schwerpunkt des Nestes, deren jedes nur zwei Junge enthält, ist im Gegensatz zu dem der Webervögel immer nach der Unterseite gerückt, während sich die Eingangsöffnung oben befindet. Das Merkwürdigste ist, daß die Kaziken zum noch besseren Schutz gegen nesterplündernde Schlangen und Affen ein Bündnis mit wehrhaften Insekten, den mit Recht so gefürchteten Holzwespen, geschlossen haben. Sie suchen diese stechlustigen Kerfe geradezu auf und wählen ihretwegen zur Anlage der Brutkolonien oft auch Bäume, die sie sonst nach Standort und Beschaffenheit schwerlich für geeignet halten würden. Oft stehen die Vogelbauten so dicht bei den Wespennestern, daß die Vögel beim Anfliegen und Einschlüpfen letztere streifen müssen. Und doch hat man noch niemals gesehen, daß die sonst so jähzornigen und angriffslustigen Wespen einen Beutelstar angefallen hätten, sondern es herrscht im Gegenteile die schönste Harmonie zwischen den so ungleichartigen Bundesgenossen. Möglicherweise ist es der den Beutelstaren anhaftende widerwärtige Geruch, der die in dieser Beziehung ja recht empfindlichen Wespen so verträglich stimmt; ist er doch so stark, daß er noch lange an den Händen haftet, wenn man einen solchen Vogel angefaßt hatte. Möglicherweise haben aber auch die Wespen irgendeinen der menschlichen Beobachtung bisher entgangenen Vorteil bei dieser interessanten Symbiose. Sicherlich haben ihn aber die Kaziken, und zwar keinen geringen, Wehe dem Affen oder der Schlange, die sich einer solchen von Wespen beschirmten Brutkolonie nähert! »wie vom Blitz getroffen«, berichtet Kappler, »fällt sie zur Erde herab und peitscht diese vor Schmerz, da sie von den wütenden Wespen in die Augen gestochen wurde.«
Eine ähnliche Symbiose, hier mit Termiten, finden wir auch bei den Nageschnäblern oder Trogoniden: eine Familie, die übrigens schon 1884 nach Martin volle 28 wissenschaftliche Namen hatte: ein sprechender Beweis für die vielgerühmte »Einheitlichkeit« der lateinischen Nomenklatur. Die südamerikanischen Formen wetteifern an Farbenschimmer und Gefiederglanz mit den Paradiesvögeln und Kolibris, während die indischen Vertreter wesentlich bescheidener gefärbt erscheinen. Aber das stupide, träge und langweilige Benehmen der Vögel steht mit ihrem bestechenden Äußeren wenig in Einklang. Eigentümlich nimmt sich unser schöner Faulpelz im Fluge aus, wo das Männchen vermöge seines langen Schwanzes fast an einen Fasan erinnert, während doch das eigentliche Flugbild ausgesprochen spechtartig ist. Die Nageschnäbler sind Höhlenbrüter, und zwar hat ganz neuerdings Werner (vgl. »Mitteilungen über die Vogelwelt« 1911, Heft 2) wenigstens bei einer brasilianischen Art ( Trogon viridis) nachgewiesen, daß sie ihre Bruthöhlungen in bewohnte Termitenbauten einmeißelt, die sich an den dicken Baumstümpfen auf gerodeten Waldstellen vorfinden. Nach der Einteilung des berühmten Termitenforschers Escherich wäre der Trogon hier wohl zu den »indifferent geduldeten Einwohnern« zu rechnen, doch bedarf die interessante Tatsache dringend noch weiterer Aufklärung, um über das Verhältnis von Wirt und Mieter zueinander ins reine kommen zu können. – Die ebenfalls in den dichten Wäldern Brasiliens heimischen und durch ihre brummende Stimme ausgezeichneten Ameisenvögel ( Myiothera), die sich infolge ihrer eigenartigen Lebensweise und mit Hilfe der langen Beine auf Kosten der Flugfähigkeit zu gewandten Springern entwickelt haben, stehen, wie schon ihr Name vermuten läßt, in einem Abhängigkeitsverhältnis zu den Ameisen, und zwar insbesondere zu den Wanderameisen. Diese bilden nämlich die fast ausschließliche Nahrung der sehr gefräßigen Vögel, die daher genötigt sind, den Wanderzügen jener Insekten zu folgen, ähnlich wie die Rosenstare den Wanderheuschrecken. Dieses Verhältnis übt auf das Brutgeschäft insofern einen Einfluß aus, als der Vogel bestrebt sein muß, es nach Möglichkeit abzukürzen. Er legt also seine zwei bis drei Eier ohne alle weitere Vorkehrungen in irgendwelche Bodenvertiefung, und die ausschlüpfenden Jungen entwickeln sich mit einer für Nacktvögel ganz ungewöhnlichen Raschheit, um sobald als irgend möglich der immer reisefertigen Mutter nachfolgen zu können.
Ausgesprochener findet sich ein symbiotisches Verhältnis zur Brutzeit bei der unserem Steinkäuzchen ähnelnden, aber mit längeren Beinen ausgerüsteten und deshalb ungleich besser laufenden Prärieeule, einem Charaktervogel der einsamen und eintönigen südamerikanischen Pampa, die er durch sein possierliches Benehmen in der angenehmsten Weise zu beleben versteht. Frühere Forscher wenigstens berichteten übereinstimmend, daß dieses nette Eulchen paarweise in selbstgegrabenen Höhlungen oder den verlassenen Bauen der Viscachas, Ameisenfresser, Gürteltiere und Präriehunde lebe, sehr häufig aber auch als friedlicher und gern geduldeter Mieter noch bewohnte Baue dieser Tiere beziehe und dann gewissermaßen als treuer Wächter des Hauses Dienste tue. Neuerdings hat nun aber Sternberg die Naturgeschichte des anziehenden Vogels näher erforscht und ist zu dem Ergebnis gelangt, daß alle diese Berichte auf ungenauer Beobachtung beruhen, daß von einem gemeinsamen Zusammenwohnen nie die Rede sei, daß die Eule vielmehr fast immer ihre Bruthöhlen sich selber grabe, und daß eine bisweilen vorkommende enge Nachbarschaft mit bewohnten Viscachabauen lediglich auf Zufall zurückzuführen sei, indem beide Tiere wegen der im Winter oft sehr starken und heftigen Regengüsse notgedrungen trockene kleine Anhöhen zur Anlage ihrer Wohnungen wählen müssen. Bevorzugt werden solche Gegenden, wo der Boden trocken genug ist für die Grabarbeit, aber doch auch nicht zu hart, während es im übrigen dem Vogel ganz gleich ist, ob das Gelände menschenleer oder schon unter Kultur genommen ist. Der Brutkessel der Höhlung enthält als einziges Baumaterial eine ziemlich dicke Lage von Pferdemist, womit auch der Höhlengang und die unmittelbar vor dem Eingang befindliche Anhäufung ausgegrabener Erde bedeckt ist, hier noch untermischt mit den Brustschildern großer Mistkäfer, die die Hauptnahrung der kleinen Eule bilden, und die sie auch bei Tage im Fluge zu erhaschen versteht. Die wenig lichtscheuen Prärieeulen sind auch tagsüber viel in Bewegung, fliegen mit raschen, leisen Flügelschlägen umher, allerdings niemals weit, oder sitzen im Sonnenschein behaglich vor dem Eingang zu ihrer unterirdischen Behausung und lauern da auf Mistkäfer, Eidechsen und Mäuse, die sie mit großer Geschicklichkeit zu fangen wissen. Selbst Schlangen von ziemlicher Größe sollen sie bemeistern, auch giftige, vor deren Bissen sie sich durch den wie einen Schild vorgehaltenen Fittich zu schützen wissen. Sonst seien von exotischen Eulen hier wenigstens noch die stattlichen Fischeulen der Sundainseln genannt, deren Stimme einem hohlen, rauhen Gelächter vergleichbar ist und die sich auffallenderweise hauptsächlich von Fischen und Krabben ernähren, weshalb sie auch unbefiederte Fänge haben, wie ihnen auch der sonst für die meisten Eulen so charakteristische Gesichtsschleier völlig fehlt.
Große, melonenförmige, oben und an den Seiten regelrecht abgerundete Lehmklumpen auf wagrechten, armdicken Ästen einzeln stehender Bäume erregen in Brasilien bald die Aufmerksamkeit des Neulings, und er mag bei dem überraschenden Anblick zunächst wohl an Termitennester denken. Aber diese stehen niemals derart frei, sondern sind immer vorsichtig in einen Astwinkel eingezwängt, auch nicht so gleichmäßig gestaltet. Bei näherem Hinsehen entdecken wir dann auch ein ovales Flugloch und sehen einen stargroßen, rötlichgelben Vogel aus und ein schlüpfen. Es ist der Töpfervogel (Abb. 13) oder Lehmhans, den die Brasilianer Passerino catholico nennen, weil er ihrer Meinung nach am Sonntage nicht arbeitet. Beim Bau ihrer eigenartigen Burg verfahren die Vögel derart, daß sie zunächst aus dem roten Lehm der Fahrwege runde Klumpen von der Größe der Flintenkugeln herbeischleppen und diese auf dem Aste mit Schnäbeln und Füßen zu einer wagrechten Grundlage ausbreiten, wobei häufig auch Pflanzenteile mit eingeknetet werden. Auf diese Grundfläche werden dann Seitenmauern mit einer schwachen Biegung nach innen aufgesetzt. Hierauf warten die Vögel, bis jene erst völlig hart und trocken geworden sind, um nun weiter Schicht für Schicht hinzuzufügen, mit immer stärker werdender Wölbung, bis diese sich endlich oben zusammenschließt. Das Flugloch ist stets ein senkrecht stehender Halbkreis. Eine besondere Scheidewand teilt endlich noch im Inneren den eigentlichen Brutraum ab, der mit trockenen Halmen, Hühnerfedern und Baumwollbüscheln recht wohnlich ausgekleidet wird.
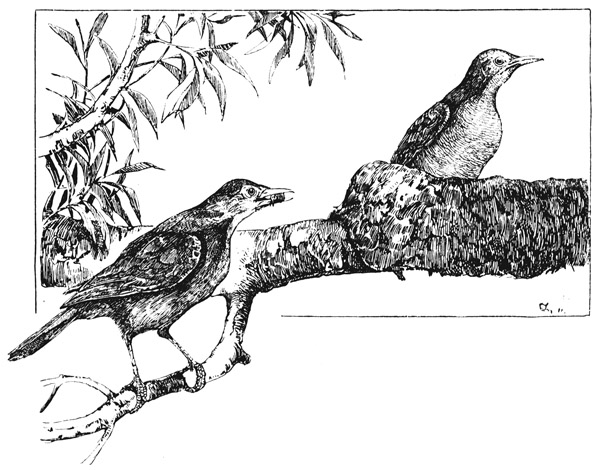
Abb. 13. Töpfervogel.
Kaum weniger merkwürdig, sicherlich aber noch viel kunstvoller sind die Nester der Schneidervögel (Abb. 8), die gleich den Töpfervögeln gewissermaßen eine Verkörperung menschlicher Handwerke innerhalb der gefiederten Welt darstellen. Da schlüpft z. B. in den Zäunen und Hecken der javanischen Dörfer ein kleines, lebhaftes Vögelchen umher, das bei seinem einfachen Gefieder kaum sonderlich unsere Aufmerksamkeit erregen würde, und das doch wegen seines wunderbaren Nestbaus unser Interesse im höchsten Maße verdient. Prinia familiaris – so lautet sein wissenschaftlicher Name – verbindet nämlich wie ein richtiger Schneider die Ränder eines großen oder mehrerer kleiner Blätter durch Pflanzenwollfäden miteinander und baut dann in die so gefertigte Tüte sein niedliches Nestchen. Hat der Vogel ein passend erscheinendes Blatt gefunden, so sucht er sich zunächst einige Pflanzenwollfäden, überzieht sie mit seinem klebrigen Speichel, bohrt dann mit dem Schnabel ein Loch in den Rand des Blattes, zieht den Faden zu zwei Dritteln durch und läßt ihn vorläufig so hängen. Da der Speichel klebrig ist und bald verdunstet, ist der Faden dann genügend befestigt, und der fehlende Knoten ebenso einfach wie sinnreich ersetzt. Auf diese Weise befestigt der geschickte kleine Schneidermeister im Federkleide nach und nach eine größere Anzahl Fäden auf der Fläche und namentlich an den Blatträndern. Hierauf werden letztere genähert und miteinander verbunden, während die Flächenfäden das eigentliche Nest tragen helfen. Dessen Inneres bildet eine sackförmige Vertiefung aus sehr feinem Material, also zartesten Hälmchen, Blattschuppen, Spinnen- und Raupengewebe.

1. Steganura unterwoodi, Reich. 4. Lophornis magnificus, Vieill. 2. Cephalolepsis delalandi, Vieill. 5. Sappho sparganura, Shaw. 3. Phaetornis eurynome, Less. 6. Calothorax lucifer, Sw.
Ganz unverhältnismäßig große Nester errichten die in keinem brasilianischen Sumpfe fehlenden Bündelnister, kleine Vögelchen von baumläuferartigem Wesen. Auf Bäumen oder Sträuchern in oder neben dem Sumpfe steht der kolossale Bau, der eine Länge von etwa 60 und eine Breite von etwa 30 cm hat, während die Flugröhre bei 28 cm Höhe einen Durchmesser von 7 cm besitzt. Er besteht aus einer erstaunlichen Anhäufung dürrer Reiser, in deren Mitte das eigentliche kleine, napfförmig aus dürren Binsen und Gräsern gedrehte, lose mit Pflanzenwolle ausgefütterte und drei Eier enthaltende Nestchen geborgen ist. In der Form gleicht das Ganze einer mit dem Hals nach aufwärts gekehrten Retorte, denn es bildet eine hohle Kugel, an der seitlich das immer aufwärts stehende Einflugsrohr wie ein Schornstein emporragt. Das Herbeischleppen der groben Reiser von Federkieldicke und bis zu 40 cm Länge muß den emsigen Vögelchen unendliche Mühe verursachen, und man kann auch öfters beobachten, wie sie dabei genötigt sind, unterwegs auszuruhen, um ein wenig Atem zu schöpfen. Scheinbar unordentlich stecken sie die mit so schwerer Arbeit herbeigetragenen Reiser kreuz und quer durcheinander, bis sie den gewünschten Hohlraum bilden, aber das Ganze wird schließlich doch ungemein fest und solid, obgleich kein Bindemittel zur Anwendung gelangt, und erlaubt auch keinem neugierigen Auge einen Einblick in das Innere. Die Flugröhre zeigt wenigstens an ihrer Ausmündung mehr Sorgfalt in der Bauweise, indem hier die sie bildenden Reiser regelmäßig und aufrecht nebeneinander stecken, so daß man an die Eingangstüren einer gewissen Art von Mausefallen erinnert wird. Sonst stehen überall die Spitzen der Reiser wie Stacheln auseinander, und man muß gestehen, daß sich so der Vogel in der Tat ein ganz famoses Kastell geschaffen hat. Eine andere Art, die an den Stämmen trockener Urwälder in der Weise unserer Baumläufer herumklettert und dabei ebenfalls den elastisch federnden Schwanz als Stütze gebraucht, benutzt mit schlauer Berechnung die von den Urwaldriesen herabhängenden Lianentaue, um daran ihre wie Reisigbündel aussehenden Schwebenester aufzuhängen. Auch ein brasilianischer Fliegenschnäpper hängt nach den Beobachtungen Eulers in ähnlicher Weise sein Nest an den Lianen auf. Es gleicht so täuschend einem Haufen dürrer Blätter, daß man es nimmermehr als Nest erkennen würde, wenn nicht zufällig der Vogel gerade aus und ein schlüpft. Das eigentliche Nest hat die Form eines länglichen, nach unten erweiterten Beutels mit großem Schlupfloch an der unteren Seite, wird aber vollständig verdeckt und verborgen durch einen schirmartigen, nach unten offenen Kegel aus dürren Blättern, der wie eine Düte darüber gestülpt ist. Der wissenschaftliche Name dieses kunstvollen Baumeisters ist Myiobius xanthopygius.
Das Nest des stattlichen Leierschwanzes aus Australien gleicht von weitem einem meterhohen und ebenso breiten Haufen trockener Reiser, wie sie nach Überschwemmungen zurückzubleiben pflegen, und befindet sich gewöhnlich etwas erhöht am Fuße eines Farnbaumes. Auf einer Unterlage von groben Reisern und Holzstückchen steht das aus feinen und biegsamen Wurzelfasern recht hübsch geflochtene und mit einer seitlichen Eingangsöffnung versehene eigentliche Nest, oben wieder mit einem Dach aus derbem Material versehen, das mit Blättern der Farnbäume durchflochten ist, die herunterhängend das brütende Weibchen teilweise verdecken. Diese obere Hälfte ist mit dem Nestnapf nur lose und elastisch verbunden, vielleicht um dem Vogel das Eintreten, das angeblich rückwärtsschreitend erfolgen soll, zu erleichtern, und läßt sich daher bequem abtrennen. Es ist nur ein einziges Ei vorhanden, das vom Weibchen allein vier Wochen hindurch bebrütet wird, also auffallend lange. Auch sonst verdient dieser eigenartige, leider im Aussterben begriffene Vogel, dessen edel geformter Schwanz eine so wundervolle Zierde für das Männchen bildet, in hohem Grade unser Interesse. Kann er doch in gewissen Sinne als ein vermittelndes Übergangsglied zwischen Hühnern und Singvögeln betrachtet werden. Größe und Gestalt, die Lebensweise, die lange Brutdauer und die auffallende Verschiedenheit der Geschlechter stellen ihn in die Nähe der ersteren, aber das Vorhandensein eines Singapparates weist ihn den letzteren zu. Der Beobachter ist nicht wenig überrascht, in dem hühnerartigen Vogel einen ganz hervorragenden Sänger kennen zu lernen, dem namentlich ein bedeutendes Nachahmungstalent eigen ist, so daß er alle möglichen Laute aus seiner Umgebung mit wahrer Vollendung wiedergibt. Er ist übrigens schwer genug zu belauschen, denn infolge der vielfachen Nachstellungen ist er überaus menschenscheu geworden und hält sich überdies mit Vorliebe in den unzugänglichsten und halsbrecherischsten Teilen der einsamen Gebirgswälder auf. Den herrlichen Schweif trägt das Männchen gewöhnlich wie ein Fasan, also nieder- und zusammengelegt, was ja auch zu seiner Schonung im dichten Gestrüpp unbedingt erforderlich ist. Aber zur Balzzeit scharrt es sich einen kleinen Hügel auf, trippelt unter eifrigem Singen fortwährend darauf herum und entfaltet dabei unter sichtlicher Selbstgefälligkeit sein herrliches Schmuckstück. Selten werden von diesen Vögeln die Flügel gebraucht, aber rennend und springend durchmessen sie ungeheure Strecken auf schwierigstem Gelände. Auch bei der Nahrungssuche verfahren sie scharrend wie die Hühner und wälzen dabei mit überraschender Kraft ansehnliche Steine zur Seite.
Auch ein storchartiger Geselle, der durch fast messerartig scharf zusammengedrückten Schnabel und den Besitz einer in beständiger Bewegung gehaltenen Federhaube ausgezeichnete afrikanische Schattenvogel, baut ein recht merkwürdiges Nest. Zwischen den Astgabeln solcher Baumriesen, die sich über den Wasserspiegel eines Flusses neigen, oder auch im steilen Felsengeklüft errichtet er einen soliden, oben gedeckten, nach unten zu spitz zulaufenden Reisigbau von 50-90 cm Höhe, der im oberen Umfang nicht weniger als 2-3 m hält und einem mit der Basis nach unten gekehrten Kegelstutz nicht unähnlich sieht. Den eigentlichen Brutraum darin stellt eine abgesonderte Kammer dar, zu der eine viereckige, 15 bis 25 qcm messende, sich bisweilen auch noch gangförmig ins Innere hinein verlängernde Öffnung führt. Die Nestwände sind mehr oder weniger mit Erde als Zement verdichtet, und so kann es nicht wundernehmen, daß ein solcher Kolossalbau selten weniger als einen Doppelzentner wiegt. Im Inneren sowohl wie in den Wänden finden sich zur Ausschmückung massenhaft kleine, gebleichte Knochenstückchen, so daß also auch diesem Vogel offenbar ein gewisser Schönheitssinn nicht abzusprechen ist. Der Flug der Schattenvögel ist schön und leicht, ihre Stimme quakend, und ihre ganze Lebensweise klingt sowohl an die der Störche wie an die der Reiher und Ibisse an.
Aus dem großen Heere der Papageien, die ja als ausgesprochene Höhlenbrüter keine großen Baukünstler und aus dem gleichen Grunde in ihrem Vorkommen zumeist auf große Waldungen mit riesigen alten Baumstämmen angewiesen sind, verdient hier eigentlich nur der überaus schreilustige südamerikanische Mönchssittich Erwähnung, weil er der einzige ist, der in Form einer freistehenden Stachelkugel von 1 m Durchmesser ein eigentliches Nest zu bauen versteht. Das Männchen schleppt die Unmenge des zu dieser Burg nötigen Materials herbei, und das Weibchen formt daraus die charakteristische Stachelkugel, deren Inneres sorgsam mit Gras ausgepolstert wird, und deren Eingang sich unten oder an der Seite befindet, im letzteren Falle aber stets mit einem besonderen Schutzdächlein versehen wird. Er führt zunächst in eine Art Vorhalle, an die sich dann erst der eigentliche Brutraum anschließt. Auffallend ist es nun aber, daß später auch Kinder, Schwiegerkinder und Enkel sich an diesem elterlichen Heim anbauen, wobei jedes Pärchen einen besonderen Brutraum mit Eingang und Schutzdach besitzt, so daß das Nest, an dem die Vögel fortwährend zu basteln und auszubessern haben, immer größer wird und schließlich ein Gewicht von vier Zentnern erreicht. Doch hat man nie mehr als zwölf Pärchen in einer solchen gemeinsamen Behausung, die auch außerhalb der Brutzeit als Zufluchtstätte und Schlafquartier dient, gefunden, wohl aber öfters kleine Enten in zufällig leerstehenden Wohnungen, so daß also auch hier wieder ein Fall von Symbiose in der Vogelwelt vorliegt. In seiner Heimat gilt der Mönchssittich, der sich im Zimmer als ein unausstehlicher Schreihals erweist, für sehr schädlich, weshalb die mit ihm bei uns angestellten und teilweise auch geglückten Einbürgerungsversuche nicht unbedenklich erscheinen. Die wegen ihrer innigen, von sentimentalen Schriftstellern freilich arg übertriebenen Gattenliebe berühmt gewordenen Inseparables oder Unzertrennlichen aus Afrika kleiden ihre Bruthöhlungen mit feinen Rindenstreifen aus, die sie auffallend genug transportieren. Sie schieben sie nämlich unter ihre Bürzelfedern und tragen sie so in vorsichtigem und langsamem Fluge zur Nisthöhle.
Die Honigsauger oder Nektarinien, die die Zuckervögel Amerikas in der Alten Welt vertreten, haben ihren Namen davon, daß sie mit der weit vorstreckbaren, langen und röhrenförmigen, gespaltenen Zunge Honig und Kerfe aus Blüten herausholen. Sie zeichnen sich nicht nur durch Glanz und Pracht des Gefieders, sondern auch durch den überaus kunstvollen Nestbau aus. So hat das meist völlig vom Blätterwerk verdeckte Nestchen von Dicaeum rubrocanum eine birnförmige oder verkehrt-eiförmige Gestalt und ist mit seinem oberen schmalen Teile hängend an dem äußersten und dünnsten Zweige eines Baumes, ja oft nur an einem Blattstiel befestigt. Bei Arachnothera longirostra aus Java ist das Nestchen an den aufrechtstehenden, mehrere Fuß langen Riesenblättern der Curcuma longa derart befestigt, daß der innere Nestraum der Blattfläche zugewendet ist, diese also gleichzeitig die abschließende Rückwand bildet. Die Verbindung zwischen Nest und Blatt ist seitlich und unten sehr eng und wird von Pflanzenwollfäden gebildet, die in ähnlicher Weise zur Verwendung gelangen wie beim Schneidervogel, während nach oben eine spaltförmige Öffnung frei bleibt, durch die der Vogel aus und ein kriecht. Trotz ihrer Kleinheit und des metallisch glänzenden Gefieders haben die Honigsauger mit den Kolibris in systematischer Hinsicht nichts gemein, stehen vielmehr in schroffem Gegensatz zu ihnen, da sie kurze Flügel und ganz anders gestaltete Beine besitzen. Aber auch sie bilden einen wunderbaren Schmuck der Natur.
Übrigens gibt es auch unter den im wesentlichen auf Südamerika beschränkten Kolibris ganz hervorragende Baukünstler. So befestigt Phaetornis squalidus sein Nestchen etwa fünfzehn Fuß über dem Erdboden am unteren Ende fast senkrecht herabhängender langer und schmaler Baumblätter im Walde (Abb. 14). (Es bildet einen nach oben offenen Beutel, der mit der einen Seite vollständig an die Blattfläche angeklebt ist, so daß das Ganze etwa den Eindruck von gewissen Taschenuhrbehältern in Pantoffelform macht, wie sie in den Schlafzimmern unserer Großeltern zu hängen pflegten. Pflanzenwolle bildet das hauptsächlichste Baumaterial, doch ist die ganze Außenseite mit feinen Moosen besetzt und mit Spinngewebe überzogen. Mit Honigsaugern und Kolibris sind wir nun zu solchen exotischen Vögeln gelangt, die durch glühende Farbenpracht und herrlichen Metallschimmer im Gefieder unser Auge bestechen, und denen wir in unserer einheimischen Vogelwelt schlechterdings nichts an die Seite stellen können, da auch deren farbenreichste Vertreter solchem Funkeln und Leuchten gegenüber verblassen. Damit soll indes nicht gesagt sein, daß die sanft abgetönte Farbenharmonie unserer Vögel in ihrer Art für ein ästhetisch geschultes Auge nicht ebenso schön wäre. Man kann die Kolibris kaum besser charakterisieren, als wenn man sie die Insekten in der Vogelwelt nennt, denn namentlich an die Sphingiden (Schwärmer) weist ihr Gebaren in der Tat ganz verblüffende Anklänge auf. Wie fliegende Rubine oder Smaragde, wie blitzende Feuerfunken zucken sie durch die duftgeschwängerte Luft, und so pfeilschnell ist ihr Flug, daß ihm das menschliche Auge nicht zu folgen vermag, plötzlich und unvermutet tauchen sie in unserem Gesichtsfeld auf, halten rüttelnd vor einer Blüte, senken den langen Schnabel in deren Inneres, und – husch! sind sie wieder spurlos verschwunden. Wenn sie so die Blüten nach Honig und kleinen Kerfen durchsuchen, ist ihre Flügelbewegung, durch die sie sich rüttelnd auf der gleichen Stelle in der Luft erhalten, gleichfalls eine so fabelhaft rasche, daß man die einzelnen Flügelschläge mit dem Auge nicht zu unterscheiden vermag und die Gestalt der langen, schmalen Fittiche zu einem den oft nur hummelgroßen Körper des Vögelchens umhüllenden Mantel verschwimmt, gleichzeitig aber ein durch die hastige Flügelbewegung erzeugter summender Ton an unser Ohr dringt. Wenn auch die Kolibris durch ihr glänzendes Gefieder und ihr lebhaftes Benehmen im Walde selbst dem oberflächlichen Beobachter jederzeit sofort auffallen, so schützen ihre Kleinheit und Schnelligkeit sie doch vortrefflich gegen die meisten Gefahren, so daß ihr Bestand trotz der geringen Zahl von nur zwei weißen Tierchen im Gelege jedenfalls zunehmen würde, wenn nicht die leidige Modelaune ihr Prachtgefieder zum Schmuck der Damenhüte ausersehen hätte und daher diesem unersättlichen Moloch alljährlich hunderttausende der liebreizenden Vögelchen geopfert würden. Dem Würger Mensch gegenüber ist auch der flinke Kolibri verloren, aber gegenüber tierischen Feinden, mögen sie noch so überlegen erscheinen, bekundet er einen geradezu erhabenen Mut und bewundernswerte Tapferkeit, so daß es ihm oft genug gelingt, sie aus dem Felde zu schlagen, zumal sein langer und spitziger Schnabel eine gar nicht zu unterschätzende Waffe darstellt. Sogar mit der nach den Nestjungen lüstern sich emporringelnden Baumschlange nehmen sie es erfolgreich auf. Früher oder später erhält sie im stürmischen Anfliegen einen wohlgezielten Schnabelstich ins Auge, ehe sie noch von den Giftzähnen Gebrauch machen konnte, windet sich in ohnmächtigem Schmerz und taumelt hilflos zu Boden. Schon die ganze Körperhaltung der Kolibris verrät ja zur Genüge Kraft und Selbstbewußtsein. Selbst beim Ausruhen nehmen sie eine steil aufrechte Haltung ein und sitzen niemals so lässig wagrecht, wie man es häufig falsch abgebildet oder an ausgestopften Stücken sieht, wie überhaupt die richtige Darstellung von Kolibris zu den schwierigsten Aufgaben für den Tierzeichner und Präparator gehört. Naturgeschichtlich interessant ist das mannigfach verwickelte Verhältnis zwischen den einzelnen Kolibriarten und den Blumen, die ihnen Nektar und Blütenkerfe geben, dafür im Befruchtungsprozeß durch ihre Gäste unterstützt werden, wie wir dies ja auch von den Insekten wissen. Es unterliegt keinem Zweifel, daß die oft höchst abenteuerliche Gestalt der Kolibrischnäbel im innigsten Zusammenhang steht mit dem Bau der von der betreffenden Art bevorzugten Blumen, und daß die Kolibris solchen Blumenarten zuliebe weite Wanderungen unternehmen, um die Blütezeit in den einzelnen Höhenlagen recht auszunützen, obschon ich mir nicht gut denken kann, daß sie dabei, wie Martin will, durch den Geruch geleitet werden. Aber nicht nur Blüten, sondern wenigstens gelegentlich auch Früchte gehen die Vögelchen an. So machte Landbeck in Chile die Wahrnehmung, daß seine aufgehängten Weintrauben von Kolibris (es war Trochilus sephanoides) angehackt und des Saftes entleert wurden, so daß nur die leeren Schalen übrigblieben, eine Erfahrung, die uns zugleich einen wertvollen Wink für die Eingewöhnung der so schwer lebend zu haltenden Gnomen gibt. Die ganze hurtige Emsigkeit und den vollen Liebreiz ihres Wesens entfalten die Kolibris beim Nestbau. Oft, wenn sie im schnellsten Fluge Baumaterial herbeigebracht haben, stehen sie länger summend vor der angefangenen Kinderwiege, bis ihr scharfes Auge die richtige Stelle erkannt hat, wo der mitgebrachte Stoff am besten hinpaßt und nun weiterverarbeitet werden kann. In der Hauptsache werden weiche, baumwollenartige Stoffe verwendet, und dazu kommen noch andere Pflanzenteile zartester Beschaffenheit, besonders Baumflechten und die braunen Schuppen der Farnkräuter. Eine Art ( Trochilus euryhomus) benutzt nach Burmeister mit Vorliebe die rote Flechte ( Spiloma roseum) Brasiliens, und das Nest erhält hierdurch nicht nur ein sehr hübsches Aussehen, sondern unter der Brutwärme des Vogels entwickelt sich auch der eigentümliche rote Farbstoff der Flechte und färbt die ursprünglich rein weißen Eier lebhaft karminrot, und zwar auffälligerweise ganz gleichmäßig.
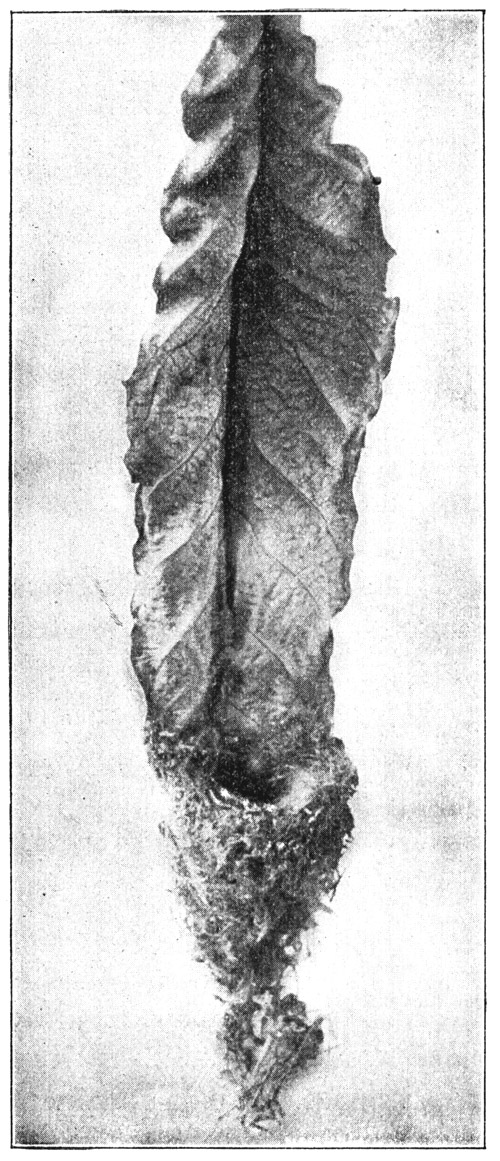
Gebr. Haeckel, Berlin phot. Abb.14. Kolibrinest an der Spitze eines Blattes.
Der südamerikanische Urwald ist ungemein reich an farbenprächtigen Vogelgeschlechtern. Mit den ersten Platz nehmen in dieser Beziehung die schlanken und lebhaften Zuckervögel oder Pitpits ein. Ein ganz prachtvolles, aber nicht metallisches Blau in Verbindung mit samtenem Schwarz und leuchtendem Gelb bildet die Farben des männlichen Hochzeitskleides, dessen Träger sich der verräterischen Gefährlichkeit solch auffallend leuchtender Farben wohl bewußt zu sein scheint, da er sich um diese Zeit viel mehr verborgen hält als die in der Hauptsache laubgrün gefärbten Weibchen und Jungen. Sonst sind die reizenden Zuckervögelchen eigentlich recht zutrauliche, ja kecke Geschöpfe. Nach Meisenart durchstreifen sie zur Strichzeit truppweise die Gärten und kommen dabei sogar ins Innere der Häuser. Nur gegen Störungen am Nest zeigen sie sich sehr empfindlich. Die kugelrunden, mit einem seitlichen Schlupfloch versehenen, aus Gras und Seidenwolle erbauten Nester hängen in der Spitze des Gesträuches, oft in unmittelbarer Nähe der Waben der gefährlichen Papierwespen, mit denen also die Vögelchen in einem ähnlichen Bündnis zu stehen scheinen, wie die Beutelstare. Auch sie nähren sich hauptsächlich von Blumenhonig und Blütenkerfen, halten sich aber dabei nicht wie die Kolibris rüttelnd in der Luft vor den Kelchen, sondern steigen kletternd an den Pflanzenstengeln empor. Daneben verzehren sie auch weiche Früchte und stehen überdies im Verdachte des Zuckerraubes. An Farbenpracht des Gefieders, nicht aber an Anmut und Beweglichkeit des Wesens stehen ihnen die in denselben Gegenden vorkommenden Tangaren würdig zur Seite. Der weite, stille Urwald ist ihre Heimat, und sie führen hier im ganzen ein recht zurückgezogenes, ruhiges und behäbiges Dasein, um nur zur Zeit der Fruchtreife familienweise in die Pflanzungen zu kommen, wo sie dann nach Meisenart lautlos im Gelaub der Bäume herumklettern. Dazwischen sitzen sie nach reichlichem Fruchtgenuß auch wieder stundenlang still und fast regungslos, lediglich der Verdauung obliegend. Noch ausschließlicher als die Tangaren auf Fruchtnahrung angewiesen sind die ihnen an Schönheit wenig nachgebenden Organisten, weshalb auch ihr Wagen lediglich in einer kropfartigen Erweiterung des Schlundes besteht: eine physiologisch höchst bemerkenswerte Tatsache. Sie vermögen aus dem gleichen Grunde nur ganz kurze Zeit ohne Nahrung zu leben und sind wie alle Fruchtfresser sehr gefräßig, trotzdem aber im Benehmen munterer und liebenswürdiger wie die Tangaren, eher unseren Zeisigen vergleichbar. Woher diese Vögelchen eigentlich ihren seltsamen Namen haben, ist nicht recht klar, zwar hört man bisweilen im einsamen Waldesdickicht ihren eine Oktave umfassenden, leise bauchrednerischen und nur von einzelnen helleren und lauteren Tönen unterbrochenen Gesang, aber man müßte sich schon der liebevollen Übertreibung mitschuldig machen, die den amerikanischen Ornithologen bei Beurteilung der gesanglichen Leistungen ihrer gefiederten Lieblinge eigen ist, wenn man nicht einräumen wollte, daß die Organisten trotz ihres vielversprechenden Namens in gesanglicher Beziehung doch arge Stümper sind. – Auch die zerklüfteten Gebirgswaldungen Südamerikas besitzen in dem eigenartigen Klipphahn einen gefiederten Bewohner von schier berückender Farbenschönheit. Brennend orangegelb ist fast das ganze Gefieder des etwa taubengroßen Sonderlings, und ein helmartiger Federkamm zieht sich als absonderlicher Schmuck von der Nase bis zum Scheitel. Merkwürdig genug muten die von widerwärtigem Geschrei begleiteten Balzspiele des Klipphahns an, die nach den Beobachtungen Martins folgendermaßen verlaufen: In den Morgenstunden versammeln sich beide Geschlechter in größerer Zahl bei einem auf seiner Oberseite ebenen Felsblock, auf dem sich zunächst ein Männchen als Solotänzer aufspielt, während die übrigen im nahen Gesträuch als Zuschauer Platz nehmen. Indem der gefiederte Künstler die wunderlichsten Verbeugungen und Verdrehungen macht, bald die Flügel öffnet, bald den Kopf nach allen Seiten wirft, bald mit den Füßen scharrt, beginnt der Tanz. Mit steifer Grandezza hüpft er dabei beständig auf der gleichen Stelle empor und schlägt schließlich mit dem Schwänze auch noch Räder trotz einem Truthahn, bis er endlich völlig erschöpft ist, mit seltsamem Geschrei davonfliegt und einem anderen seinen Platz auf der Bühne überläßt. So geht es stundenlang weiter. Absonderlich, wie fast alles an diesem Vogel, ist auch sein in Felsspalten stehendes Nest. Die Wurzelfasern, aus denen es gebildet ist, schwitzen nämlich ein Harz aus, das den Bau fest ankittet und zugleich seine Wände so stark und widerstandsfähig macht, daß sie jahrelang aushalten und daher der Vogel das gleiche Nest immer wieder benutzen kann.
Weitere Prachtvögel des südamerikanischen Urwalds, und zwar echte Baumvögel, die nur selten auf den Erdboden herabkommen, sich aber hüpfend im Gezweig mit um so größerer Gewandtheit und Geschicklichkeit bewegen, sind die Pfefferfresser (Abb. 15), in ihrem Benehmen als Allesfresser an unsere Krähen erinnernd, soweit nicht ihr abenteuerlicher Leibesbau besondere Eigenheiten zur Notwendigkeit macht. So legen sie im Schlaf den Schwanz wie ein Eichhörnchen über den Rücken und verbergen den mächtigen Schnabel zwischen ihm und dem Rückengefieder, während sie ihn beim wechselvollen Fluge lang ausstrecken, wenn sie zur Fortpflanzungszeit die feierliche Stille des Urwaldes durch ihre deutlich betonten, wohlklingenden Balzrufe unterbrechen, legen sie den Kopf zurück, so daß der aufgesperrte Riesenschnabel senkrecht in die Höhe steht, und vollführen mit ihm dazwischen unter sonderbaren Körperbewegungen und lautem Schütteln des Gefieders auch ein storchartiges Geklapper. Da die lebhaften und beweglichen Vögel sowohl ihres wohlschmeckenden Fleisches wie ihres farbenprächtigen Balges wegen stark verfolgt werden, sind sie dem Menschen gegenüber äußerst scheu und flüchtig, soviel Keckheit und Selbstbewußtsein sie auch sonst zur Schau tragen. Die Indianer, die sich aus den bunten Federn der Pfefferfresser ihre bekannten Kopfbinden anfertigen, schießen auch diese Vögel gleich den Quesals mit stumpfen, schwach vergifteten Pfeilen und lassen sie dann wieder fliegen, nachdem sie ihnen die begehrten Federn ausgerupft haben. Der europäische Eindringling hingegen kennt solche Schonung der Natur nicht und richtet daher die Bestände auch dieser schönen Tiere rasch zugrunde, wo er einmal festen Fuß gefaßt hat. Gegen andere Vögel zeigen sich die Pfefferfresser streitlustig und unverträglich, gelten auch als arge Nestplünderer, obschon ihre Hauptnahrung sicherlich in gewissen Früchten besteht, wie dies ja bei den meisten Prachtvögeln der Fall ist, so daß man auf den Gedanken kommen könnte, daß gerade diese Fruchtnahrung die Ausbildung leuchtender Farben begünstige. Ihre beiden weißen Eier legen die Pfefferfresser in möglichst unersteigbaren Baumhöhlungen ab. – Als Vertreter unserer Meisen im südamerikanischen Urwalde dürfen die drolligen Manakine oder Schnurrenvögel gelten, winzige Buschbewohner von lebhaft meisenartigem Wesen und mit einem Stutzschwänzchen à la Zaunkönig, deren Männchen als Hauptfarbe ein tiefes Samtschwarz zeigen, auf Kopf und Rücken unterbrochen durch die denkbar brennendsten Farbtöne, während die Weibchen ein einfach graugrünes Kleid tragen. Ihre Zwerggestalt, Farbenpracht und rastlose Beweglichkeit machen diese putzigen Gnomen des Urwaldes zu höchst anziehenden Geschöpfen. Am besten lassen sie sich in den frühen Morgenstunden beobachten, während sie sich beim Höhersteigen der Sonne mehr und mehr in das dichteste Gestrüpp zurückziehen. Nicht wenig wird man überrascht, wenn man aus dessen geheimnisvollem Dunkel dann ihre Stimmlaute zu hören bekommt, denn diese sind höchst seltsamer Art, erst ein eigentümliches Knacken, dann ein leises Zwitschern oder ein tiefes, unheimliches Brummen und Knurren, so daß man eher an ein in seinem Versteck lauerndes boshaftes Raubtier als an einen kleinen harmlosen Vogel denkt. Eine Art ( Pipra caudata) läßt dem kurzen, pfeifenden Lockruf langgedehnte, laute Töne folgen, die lebhaft an die Stimme eines Stieres erinnern.

Abb. 15. Pfefferfresser.

Abb. 16. Paradiesvogel.
Ihr größtes Meisterstück in der Ausbildung von Schmuckfedern hat die erfinderische Schöpfungskraft der Natur aber zweifellos bei den wunderbaren Paradiesvögeln Neuguineas (Abb. 16) vollbracht, denn was hier lange Isolierung, insulares Klima, senkrechte Sonnenbestrahlung, überwiegende Früchtenahrung und geschlechtliche Zuchtwahl in gemeinsamem Zusammenwirken an erstaunlicher Formenfülle und überwältigender Farbenpracht hervorgezaubert haben, das läßt die Vorstellungen auch der kühnsten Phantasie weit hinter sich. Feengebilde aus einem traumhaften Märchenland glauben wir da vor uns zu haben. Nur die Männchen tragen das Prachtgefieder, auch sie nur in vorgerücktem Alter und nur während der Paarungszeit, während sie sonst gleich den Weibchen und den jüngeren Geschlechtsgenossen in ein schlichtes rabenartiges Gewand gehüllt sind. An den Leibesseiten haben sich besondere Schwielen ausgebildet, die mit oft auffallend langen, prachtvoll gefransten und leuchtend gefärbten, durch ein besonderes Muskelsystem aufrichtbaren Federn besetzt sind. Ebenso sind die Mittelfedern des Schwanzes meist stark verlängert, oft in edlen Linien gekrümmt oder zu drahtartigen, fast bartlosen Gebilden umgeschaffen. Metallisch glänzende Schmuckfedern zieren den Scheitel, andere Rücken und Schultern. Oft erreicht die Ausbildung des Schmuckgefieders einen derartigen Grad, daß das hochzeitlich geschmückte Männchen in seinen Bewegungen dadurch ernstlich behindert und allen Gefahren in verdoppeltem Maße preisgegeben erscheint, zumal es immer ängstlich auf Schonung seines Prachtgefieders bedacht ist. Im Morgengrauen versammeln sich solche Männchen zur Balz auf blätterlosen Wipfeln ganz bestimmter alter Bäume und stellen sich hier in ihrer ganzen Herrlichkeit zur Schau, indem sie die Flügel lüften, die Schmuckfedern sträuben und aufrichten, sie in fortwährender zitternder Bewegung erhalten und so kokett von Zweig zu Zweig hüpfen und tänzeln. Sonst haben diese herrlichen Vögel in ihrem Benehmen eigentlich wenig Anziehendes, denn sie sind träge und dummscheu, erinnern in ihrem Wesen an Pirole und Raben, besitzen aber keine Spur von der listigen Gerissenheit der letzteren, weisen dafür aber stark alle Merkmale lange isoliert gewesener Inselformen auf. Daß die leidige Mode bald ihren begehrlichen Blick auf diese Wundergebilde der Vogelwelt warf und sie dadurch rasch vermindert wurden, erscheint beinahe selbstverständlich. Mit um so größerer Genugtuung ist es zu begrüßen, daß in unserem Schutzgebiete strenge Vorschriften erlassen wurden, die geeignet erscheinen, die völlige Ausrottung der sagenumwobenen Paradiesvögel zu verhindern. Ein Verwandter der Paradiesvögel ist der interessante Hopflappenvogel ( Heteralocha gouldi), eine jedenfalls uralte Form der an absonderlichen Tiergebilden so reichen Doppelinsel Neuseeland, leider auch schon im Aussterben begriffen infolge der Putzsucht der Maoris und der Bälgewut unserer Museumsornithologen. Merkwürdig ist er namentlich dadurch, daß beide Geschlechter völlig verschiedene Schnäbel besitzen, denn während der Schnabel des Männchens gerade und spechtartig verläuft, ist der des Weibchens doppelt so lang und in starkem Bogen säbelartig nach unten gekrümmt, ein sehr geeignetes Werkzeug zum Herausziehen von Larven aus Rindenspalten und faulem Holze. Im Gegensatz zu den Paradiesvögeln hält sich der Hopflappenvogel viel auf dem Erdboden auf und hüpft hier in großen Sprüngen einher, läßt dabei auch seine sanft pfeifende Stimme erschallen, die täuschende Ähnlichkeit mit dem Weinen kleiner Binder besitzt.
Wenigstens kurz genannt seien hier noch die gleichfalls überwiegend von Früchten lebenden, geselligen, lebhaften und lebensfrohen Glanzstare Asiens und Afrikas, die aussehen, als habe man sie in eine prachtvoll schimmernde Metallösung getaucht. Ferner die an Buntheit des Gefieders mit den Papageien wetteifernden Pisang- oder Bananenfresser, die die großen, geschlossenen Waldungen Mittelafrikas beleben, weiter die schönen Bienenfresser, von denen eine Art ( Merops apiaster) sich ja als Seltenheit auch zu uns verirrt, ja ausnahmsweise sogar schon in Deutschland gebrütet hat. Ihr gewandter Flug einerseits und ihre Farbenschönheit anderseits stellen sie gewissermaßen mitten zwischen Schwalben und Eisvögel, während die Bananenfresser verwandte der Kuckucke sind. Schließlich die Prachtdrosseln oder Pittas aus den undurchdringlichen Dschungeln und Buschwäldern Südasiens, Afrikas und Australiens. Ihre gedrungene Gestalt und ihr kurzer Schwanz, den sie jedesmal in eigentümlicher Weise bewegen, wenn sie nach einigen großen und weiten Sprüngen für einen Augenblick auf einer Erdscholle haltmachen, erinnert lebhaft an unseren Wasserstar, aber ihre Färbung ist ungleich schöner und lebhafter. Ihr überaus scheues und verstecktes Wesen erschwert die Beobachtung sehr, und auch das kunstlose, hinter Erdschollen geborgene Nest ist nicht leicht zu finden. Endlich die indischen Atzeln, starartige Burschen, aber von robusterem Körperbau und mit lebhaft gefärbten Hautlappen sowie samtartiger glänzender Befiederung am Kopf. Im Gegensatz zu den meisten anderen Prachtvögeln stehen die lebhaften, überwiegend von Vegetabilien lebenden und sehr gefräßigen, aber trotzdem lebhaften Atzeln auch geistig auf einer hohen Stufe und zeichnen sich überdies durch Umfang und Wohllaut der Stimme aus, ja besonders begabte Stücke sollen sogar menschliche Worte nachsprechen lernen. Aus allen diesen Gründen sind die Atzeln in ihrer Heimat beliebte Käfigvögel und werden schon seit alter Zeit mit Vorliebe in den Vorhöfen der Tempel gehalten, wo ihnen früher sogar göttliche Verehrung gezollt worden sein soll.

Abb. 17. Erzlori.
Aus dem bunten Heere der Papageien haben wir gerade die farbenprächtigsten Arten auch noch nicht erwähnt. Es sind die kleinen, durch die pinselartige Zerfaserung der Zunge und die Ernährung mit Blütennektar ausgezeichneten Loris (Abb. 17) des fünften Erdteils und seiner Inselwelt einerseits, die großen, wehrhaften Araras der südamerikanischen Urwälder anderseits. Möglicherweise hängt der außergewöhnliche, immer aufs neue die Blicke des Beobachters überraschende und entzückende Farbenreichtum der Loris gerade mit ihrer merkwürdigen Honignahrung zusammen, die die Haltung dieser wunderhübschen Papageichen im Käfig so erschwert, da sie sich eben niemals voll ersetzen läßt, die aber auch sie im Gegensatz zu den körnerfressenden Papageien zu für den Menschen völlig unschädlichen Geschöpfen stempelt. Die langschwänzigen Araras, deren wuchtiger Riesenschnabel empfindliche Verletzungen beibringen kann, führen paarweise im tiefen Innern stiller und wenig vom Menschen betretener Urwälder ein sehr zurückgezogenes und menschenscheues Dasein, halten aber zähe an den einmal erwählten Nistplätzen fest, selbst wenn sie dort Verfolgungen erleiden mußten. Am ehesten machen sie sich noch durch ihr geradezu furchtbares, in der Tonlage an den Kolkraben erinnerndes Geschrei bemerkbar. Auch die behäbigen und in ihrem Wesen etwas langweiligen Edelpapageien von Neuguinea gehören zu den farbenprächtigsten Vögeln. Sie erscheinen noch dadurch besonders merkwürdig, daß bei ihnen im Gegensätze zu anderen Papageien eine so starke Farbendifferenzierung der Geschlechter stattfindet, daß man früher Männchen und Weibchen für ganz verschiedene Arten hielt. Ein sehr verzeihlicher Irrtum, wenn man bedenkt, daß z. B. bei der bekanntesten und regelmäßig in unsere Tiergärten gelangenden Form das Männchen in der Hauptsache grasgrün, das Weibchen dagegen wundervoll scharlachrot ist; die prächtigere und auffallendere Färbung kommt also hier sonderbarerweise einmal dem »schwächeren« Geschlechte zu. Unter dem Einflusse der menschlichen Kultur sind nicht nur manche Papageienarten dem Aussterben nahegebracht, sondern auch andere, an sich noch häufige, wenigstens in ihrem Verbreitungsbezirk stark eingeengt worden. So wurde der bekannte Halsbandsittich zur Römerzeit aus Tergedum (20. Grad n. Br.) nach Europa gebracht, während heute schon der 16. Breitengrad seine nördliche Verbreitungsgrenze bildet. Die Schönheit, Klugheit, Zahmheit und vor allem das erstaunliche Sprachvermögen der Papageien hatten diesen Vögeln schon die Zuneigung der alten Römer erworben, und diese Papageienliebhaberei hat sich bis auf unsere Tage ungeschwächt erhalten, ja sie hat noch einen neuen Anreiz bekommen durch die leichte Züchtbarkeit mancher kleinerer Arten. Keine von ihnen erfreut sich so allgemeiner Beliebtheit wie der niedliche Wellensittich (Abb. 18), zumal er unsere Ohren nicht mit abscheulichem Geschrei beleidigt, sondern im Gegenteil ein ganz wohllautendes Gezwitscher und Geschwätz zum besten gibt. In seiner australischen Heimat lebt dieser kleine und langschwänzige, durch den reißenden, pfeilgeschwinden, schwalbenartig eleganten Flug ausgezeichnete Papagei sehr gesellig, fliegt in der Morgenfrühe schwarmweise zum Baden und Trinken ans Wasser, dann unter kreischenden Rufen hinaus in die Ebene, um sich an allerlei Grassämereien satt zu fressen, hierauf zurück in die gewaltigen Gummibäume, in deren Blätterkronen er die heißesten Tagesstunden in fast regungsloser Ruhe verbringt. Auch das Brutgeschäft wird gemeinsam erledigt, und die Vögel benutzen dabei entweder natürliche Höhlungen oder nagen sich solche selbst, und zwar mit Vorliebe in alte Platanen, wobei es gar nicht selten vorkommt, daß zwei bis drei Weibchen gemeinsam in einer Höhlung nisten. Sobald die Jungen flügge geworden sind, schlagen sich die einzelnen Gesellschaften zu riesigen, wolkenartigen Schwärmen zusammen und streichen nun zigeunernd im Lande umher. Auch die Kakadus muß man zu den schönsten Vögeln des fünften Erdteils und seiner Inselwelt rechnen, obwohl ihre Hauptfarbe nur ein reines Milchweiß ist, freilich wundervoll gehoben durch zartes Rosa und prächtiges Schwefelgelb, wo ihre Schwärme eingefallen sind, sehen Wald und Flur aus, als wären sie mit Schneeballen bedeckt, und meilenweit vernimmt man das durchdringende Geschrei der lebhaften Vögel. Namentlich gegen Abend, wo sie hohe Äste am Waldrand stehender Riesenbäume als Spiel- und Ruheplätze aufzusuchen pflegen, machen sich die Kakadus sehr bemerkbar. Geradezu herrlich ist ihr Flug, zumal sie auch dabei das Spielen nicht lassen können und oft die Schwingen nach Weihenart stark nach oben halten. Stets und überall zeigen sie sich scheu und vorsichtig, auch da, wo nur selten Europäer mit ihren Feuerwaffen hinkommen, denn die Eingeborenen stellen ihnen mit Pfeil und Bogen oder mit dem Bumerang auch weidlich nach, teils des Fleisches, noch mehr aber der als Schmuck geschätzten Haubenfedern wegen. Der Name »Kakadu«, den die Eingeborenen gefangenen Stücken immer so bald als möglich beizubringen versuchen, ist malaiischen Ursprungs und bedeutet eigentlich »Alter Vater«. Wie es als sprichwörtlich gewordene Seltenheiten weiße Raben gibt, so als Gegenstück dazu auch schwarze Kakadus. Es ist der durch einen nackten roten Wangenfleck gezierte, sonst aber völlig schwarze Ararakakadu ( Microglossus aterrimus), auch dadurch interessant, daß er mit seinem gewaltigen Schnabel sogar die eisenharten Nüsse der Kasuarinen zu öffnen vermag, wobei er zum besseren Festhalten der glatten Frucht noch ein Blatt in den Schnabel nimmt, und diesen Bäumen oder vielmehr ihren Früchten zuliebe nach Art unserer Kreuzschnäbel eine zigeunernde Lebensweise führt.
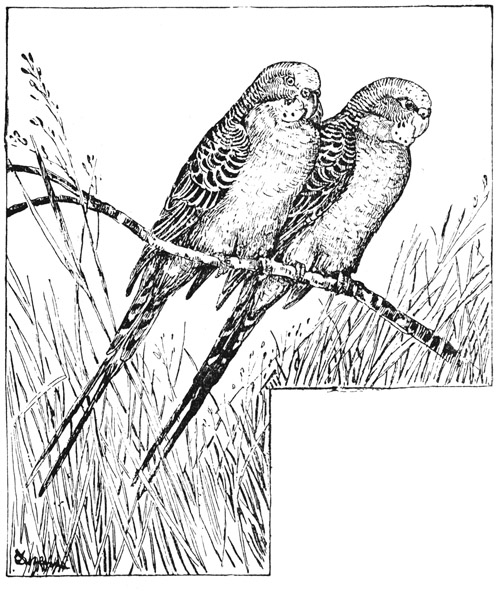
Abb. 18. Wellensittich.
Die Fasanenhähne müssen mehr oder minder alle zu den Prachtvögeln gezählt werden, aber den Schönheitspreis unter ihnen verdient trotz seiner etwas gedrungenen Figur unbedingt der stattliche Glanzfasan, der in losen Trupps, oft vergesellschaftet mit den dortigen Wildschafen und Steinböcken, in den Himalajaländern lebt und sich nur durch die Härte des dort so rauhen Winters, der auch seine sonst überaus große Scheu und Vorsicht mildert, in die tieferen Täler herabdrücken läßt. (Er ist wohl einer der prachtvollsten Vögel überhaupt, denn sein straffes Gefieder gleißt und schimmert wunderbar in allen möglichen Metallfarben. Diese Schönheit kommt fast mehr noch als im Laufen bei seinem eigenartigen Schwebeflug zur Geltung, in dem er ohne Flügelschlag dahinstreicht, aber dafür die Fittiche in beständiger zitternder Bewegung erhält. Den eigenartigen pfauengroßen Argusfasan aus den schattigen Urwäldern der Sundainseln dürfen wir schon deshalb nicht mit Stillschweigen übergehen, weil Darwin den herrlichen Pfauaugenflecken auf seinen gewaltig verlängerten hinteren Armschwingen eine so berühmte und gründliche Untersuchung gewidmet hat. Auch das Betragen dieses Fasans ist durchaus pfauenartig, denn er sitzt fast wagrecht mit herabhängenden Flügeln, läuft geschickt auf stärkeren Baumästen entlang, springt auch von einem zum andern, fliegt aber selten und schwerfällig und läßt bis zum Überdruß seine übermäßig laute Stimme hören, besonders in der Dämmerung, wo er sich am lebhaftesten zu zeigen pflegt. Er gehört überhaupt zu denjenigen Vögeln, die man ungleich mehr zu hören als zu sehen bekommt, denn seine Vorsicht und sein Mißtrauen sind fabelhaft. – Die flinken und niedlichen Laufhühnchen, von denen eine Art schon im südlichen Spanien vorkommt, aber wegen ihres versteckten Lebens im dichten Buschwerk nur schwer zu beobachten ist, verdienen deshalb eine kurze Erwähnung, weil bei ihnen die Weibchen nicht nur schöner gefärbt und größer sind, sondern auch fleißig balzen und um die Männchen aufs hitzigste Kämpfen, letztere dagegen als sanftmütige Pantoffelhelden die Geschäfte des Haushalts besorgen, also Eier ausbrüten und Junge warten müssen, so daß hier die üblichen Verhältnisse vollständig umgekehrt erscheinen. In manchen Ländern hat man sich die Kampfwut dieser kleinen Amazonen sogar für Sportzwecke nutzbar gemacht und läßt sie unter dem Beifall begeisterter Zuschauer auf einer kleinen Arena wie Kampfhähne sich duellieren.
Trotz seiner barocken Gestalt, der Stelzbeine, des übermäßig langen und schlanken Halses, des viel zu kleinen Kopfes mit dem merkwürdig geformten Schnabel möchte ich auch den wegen seiner schmackhaften Zunge von den alten Römern so hoch geschätzten Flamingo entschieden zu den durch Schönheit hervorragenden Vögeln rechnen, denn seine wundervolle, zart hingehauchte Rosenfarbe macht alle diese Mißverhältnisse einer verunglückten Figur überreichlich wieder gut. Unvergeßlich werden mir immer die Stunden sein, da ich große Scharen von Flamingos im Sumpfe stehen sah, durch den sie sich wie eine Rosengirlande hindurchzogen, wahrhaft wunderbar sich abhebend von dem satten Grün ihrer Umgebung, dem scharfen Gelb des Dünensandes, dem leuchtenden Blau des unbewölkten Himmels, dem schimmernden weiß der im Hintergründe sich auftürmenden Araberstadt. Der Laie ist gewöhnlich geneigt, den Flamingo wegen seiner übermäßig entwickelten Beine ohne weiteres den Watvögeln zuzurechnen, aber dies ist grundfalsch, denn erstlich hat der Flamingo Schwimmhäute zwischen den Zehen, und zweitens gehört er gar nicht zu den Nesthockern, da seine Jungen gleich nach dem Verlassen der Eischale sich schwimmend aufs Wasser begeben, während sie das Fliegen allerdings erst später erlernen. Ihr Schnabel ist anfänglich noch gerade und erhält erst später die charakteristische Krümmung. Ihre Nahrung nehmen die Flamingos derart zu sich, daß sie mit umgekehrtem Lamellenschnabel in das Nahrung versprechende Schlammwasser fahren und es so nach Entenart durchschnattern. Sie trippeln dabei emsig herum wie die Kiebitze, aber es hält sehr schwer, genügend nahe zur Beobachtung an die klugen Vögel heranzukommen, denn gewöhnlich erheben sie sich noch weit außer Schußweite zum schönen Kettenflug. Ihr Fortpflanzungsgeschäft ist noch immer nicht völlig aufgeklärt, doch wissen wir, daß sie in großen Kolonien brüten und im seichten Wasser kegelförmige Schlammhaufen zusammenscharren, die einen halben Meter Höhe erreichen und oben die flache Nestmulde enthalten, obgleich auch andere Nestanlagen, besonders in sandigen Gegenden, vorzukommen scheinen. Pflanzenwust dient zur besseren Versteifung der Schlammkegel, und auch die Mulde wird mit einigen Schilfblättern ausgelegt. Beim Bebrüten der beiden bläulichweißen, mit einer Kalkkruste überzogenen Eier nimmt der Vogel dieselbe Stellung ein, wie ein brütender Storch, reitet also nicht etwa auf seinem Nestkegel, wie man früher gefabelt und in älteren Naturgeschichtsbüchern abgebildet hat.
Nicht zu den hervorragend prächtigen und glanzvollen, wohl aber zu den lieblichsten Erscheinungen in den heißen Ländern der Alten Welt gehören die niedlichen und zutraulichen Brillenvögel, Gestalten von laubsängerartigem Charakter, die ihren Namen von einem das Auge umgebenden weißen Federkranz haben. Auch der Lockton, den sie beim Durchschlüpfen des Gesträuches häufig hören lassen, ist weich und laubsängerartig, und der etwas zu leise vorgetragene Zwitschergesang hört sich ebenfalls recht nett an. Sehr gesellig durchschlüpfen und durchklettern diese Vögelchen unermüdlich das Buschwerk, um nach kleinen Kerfen zu fahnden oder Beeren abzupflücken, oder sie treiben sich als gewandte Turner nach Zeisigart in den Baumkronen herum, um dort feine Samenkörner auszuklauben. Das von Erlanger entdeckte Nest einer afrikanischen Form steht in einer Astgabel im Unterholz des halbdunklen Gebirgswaldes, ist nach Stieglitzart kunstvoll aus Moos und Flechten erbaut und innen mit ganz feinen Hälmchen ausgelegt. Auch die Kinderwiege des indischen Brillenvogels ist ein wahrer Kunstbau, denn sie schwebt frei zwischen zwei dünnen Zweigen, mit denen sie durch rohe Seide von Spinnerkokons oder Tierhaare verbunden ist. So zart und gebrechlich erscheint das kleine, aus Moos und Samenwolle zusammengefügte, ovale Näpfchen, daß es das Gewicht des alten Vogels wirklich kaum tragen zu können scheint, und doch vermag es mit drei Jungen darin Stürmen zu trotzen, die die Nester von Drosseln und Hähern unfehlbar herabwerfen würden.
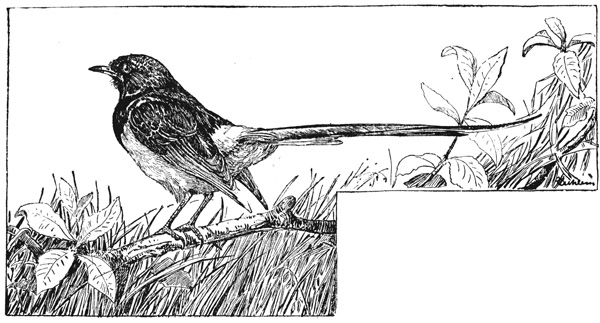
Abb. 19. Schamadrossel.
Oft hört man die Meinung äußern, daß die exotische Vogelwelt zwar reich sei an schimmernden Farben und auffallenden Formen, daß ihr aber im wesentlichen die köstlichste Eigenschaft unserer heimischen Gefiederten fehle, das, was den Vogel eigentlich erst unserem Herzen lieb und wert macht, sein seelenvoller Gesang. Nun ist es freilich richtig, daß viele gerade der am schönsten gefärbten tropischen Vögel an Stelle des Gesangs nur kurze, oft mehr eigenartige als wohllautende Rufe haben, und doch ist nichts falscher als eine vorschnelle Verallgemeinerung der angeführten Behauptung. Nein, auch im geheimnisvollen Urwald Brasiliens, im undurchdringlichen Dschungel Indiens, im australischen Buschwald, auf weiter Steppe und selbst in öder Wüste klingt und singt und jubelt es aus tausend glücklichen Vogelkehlen. Und gerade derjenige Vogel, dem ich vor allen die Sängerkrone überreiche, den ich also noch über unsere Sängerkönigin Nachtigall stellen möchte, ist ein Ausländer. Ich meine die in den verworrensten und unzugänglichsten Dschungeldickichten Indiens heimische Schamadrossel (Abb. 19). Ungesellig und menschenscheu führt dort der elegant und rassig gebaute, schön gefärbte und durch einen langen Schwanz ausgezeichnete Vogel ein verborgenes und geheimnisvolles Dasein, wobei er sich mehr auf dem Boden als im Gezweig herumtreiben soll. Gegen Abend aber läßt er seinen weithin erschallenden und überraschend melodienreichen Gesang ertönen, der diese wundervollen Einöden mit einer Fülle von Lieblichkeit übergießt und eine geradezu zauberhafte Wirkung auf den Hörer ausübt. Mag sein, daß ihrer Kehle nur ausnahmsweise so süß klagende, so rührend schluchzende Strophen entquellen wie Philomelen, aber dafür übertrifft sie diese unendlich an Kombinationsgabe und Melodienreichtum. Der Gesang der Nachtigall besteht aus fest gegliederten, stets wiederkehrenden Strophen, aber bei der Schamadrossel kann man niemals sagen, was jetzt folgt, und täglich fast überrascht sie uns mit neuen, bis dahin niemals vorgetragenen Touren, während ich diese Zeilen schreibe, singt eine gekäfigte Schama neben meinem Arbeitstisch seit zwei Tagen erst schlagen die Buchfinken draußen im Garten, und sofort hat sie sich deren taktvollen Schlag zu eigen gemacht und bringt ihn nun in solcher Vollendung, daß ich mich beim ersten Anhören selbst täuschen ließ. Ihr Nachahmungstalent ist überhaupt erstaunlich groß, und man kann sich deshalb die vollendetsten Gesangskünstler erziehen, wenn man der Schama lauter gute Sänger als Zimmergenossen gibt. Geradezu erstaunlich ist der Umfang ihrer Stimme und deren wundervoll zarte Abtönung vom leisen Liebesgeflüster bis zum jubelnden Fortissimo. Freilich kommt gerade bei der Schama die alte Wahrheit zur Geltung, daß bei guten Singvögeln die Begabung individuell sehr verschieden ist, daß sich neben hervorragenden Künstlern immer auch arge Stümper finden, wer aber eine gesanglich gut begabte Schama sein eigen nennt, der besitzt meiner Überzeugung nach das Ideal eines Käfigvogels, denn mit ihren gesanglichen Talenten vereinen sich noch schöne Färbung und angenehme Figur, Munterkeit, Klugheit und Zahmheit, Anspruchslosigkeit und Ausdauer, um diesen Indier zu einem solchen zu machen. Ferner hat auch der Tierpsychologe an der Schama ein sehr dankbares Beobachtungsobjekt, denn sie ist bei ihrem neugierigen, kampflustigen, erregbaren und jähzornigen Charakter geradezu ein Schulbeispiel für das sanguinische Temperament in der Vogelwelt. Auch Nordamerika besitzt in seiner von Forschern und Dichtern fast übermäßig verherrlichten Spottdrossel einen gesanglich hervorragend begabten Vertreter dieser Familie. Im Gegensatz zur Schama meidet diese schlicht, aber angenehm gefärbte und gleich der Genannten ein edles und selbstbewußtes Wesen zur Schau tragende Gesangskönigin der amerikanischen Vogelwelt die Nähe des Menschen nicht, siedelt sich vielmehr lieber in bebauten Gegenden als im Innern der Wälder an, mit besonderer Vorliebe in den Orangengärten, wo sie im dichten, stacheligen Gewirr immergrüner Bäume und Sträucher unter kluger Berücksichtigung der Verhältnisse ihr Nest anlegt. Ihre gesangliche Begabung ist womöglich noch verschiedener als bei der Schama, und ihr größtes Talent besteht darin, allerlei fremde Töne aus ihrer Umgebung auf ansprechende weise zu einem musikalischen Quodlibet zu verbinden. Die im Walde lebende Spottdrossel pfeift deshalb vorzugsweise die Lieder anderer Waldvögel nach, die in der Nähe menschlicher Siedlungen hausende mischt dagegen unter die Stimmen der Hausvögel, Hunde, Katzen usw. auch das pfeifen der Lokomotive, das Knarren der Wetterfahne und andere nicht immer angenehme Tagesgeräusche. Amerikanische Vogelkenner äußern sich geradezu begeistert auch über den Gesang des roten Kardinals, des bunten Papstfinken und des eigenartig schönen rosenbrüstigen Kernbeißers. Deutsche Liebhaber, die diese Arten im Käfig hielten, zeigen sich von ihren gesanglichen Leistungen freilich viel weniger entzückt, aber man muß gerechterweise berücksichtigen, daß ein Vogelgesang im Freien und in seiner natürlichen Umgebung immer ganz anders wirkt wie im Zimmer, und daß ferner die meisten Käfigvögel jung zu uns herüberkommen, ehe sie noch Gelegenheit hatten, sich die weisen des Vaters vollständig zu eigen zu machen.
Und soll ich daran erinnern, daß der unscheinbare graugrüne Stammvater unseres goldgelben gefiederten Hausfreundes noch heute wild auf jenen gesegneten Eilanden im Atlantischen Ozean lebt, die durch ihn Weltruf erlangt haben? Ich habe selbst das Glück gehabt, monatelang dem Gesang wilder Kanarienvögel in den Orangenhainen, Mandelgärten und Lorbeerwäldern Teneriffas lauschen zu können, und nur mit stillem Entzücken vermag ich heute zurückzudenken an die wundervollen Genüsse, die so ein taufrischer Frühlingsmorgen auf den blütengeschmückten und düftegeschwängerten, vom Schlag der Kanarienvögel durchhallten Inseln der Glückseligen bietet. Und ich kann durchaus nicht finden, daß der wunderliebliche Gesang des Wildlings schlechter sein soll als der unserer Harzer Roller, im Gegenteil ist er sicherlich wechselvoller, die Stimme umfangreicher, silberner und von bezauberndem Wohllaut. Einige Triller erinnern an die Lerche, gewisse andere Strophen an den Stieglitz, aber alles verschönt, gewissermaßen idealisiert. »Schappen« kommen vor, aber man nimmt sie wegen der Weichheit und Süße des Tons gerne mit in den Kauf. Die meisten Touren aber würden auch vor den Augen unserer gestrengen Züchter Gnade finden. Die Rollen sind kurz, aber rein, wunderbar anschwellend; die Flöten sehr voll und weich, niemals spitz und hart; die Knorre tief und schön. Ich hörte von begabteren Männchen ganz wunderbare Strophen, aus denen sich später jedenfalls Hengst-, Lach-, Wasserrollen und andere wieder verloren gegangene Touren entwickelt haben. Die verliebten Männchen haben auch einen eigenen Balzflug, flach schräg aufwärts mit ganz langsamen, gerundeten Flügelschlägen, dick aufgeplustertem Gefieder und weit ausgebreitetem Schwanz. Die im Gewirr der Besenheide stehenden und vom zart rosenroten Blütenflor dieses Strauches überdeckten Nester sind auf den ersten Blick stets daran kenntlich, daß die zierliche Mulde immer dicht mit schneeweißer Pflanzenwolle ausgepolstert ist.
Asiens Steppen bergen eine Fülle sangesreicher Lerchenarten. Da ist z. B. die interessante Mohrenlerche, ein Charaktertier der öden Salzsteppen, ein höchst eigenartiger, spielerischer, verliebter, eifersüchtiger, in jeder Beziehung leidenschaftlicher Vogel, dessen Männchen tiefschwarze Trauerkleider anlegen, wenn der Schnee des Winters schmilzt und der heiße Sommer seinen Einzug hält. Lang und mannigfaltig, wechselvoll und voller Wohlklang ist ihr Lied; die heimeligen Triller unserer Feldlerche gibt sie in sanft abgetöntem Baß wieder, und dazwischen finden sich auch Strophen, die an den wirren Sang der Rohrsänger anklingen. – Die Messaria, die weite Ebene im Innern der Insel Zypern, stellt mit ihren weiten, kahlen, schuttbedeckten Flächen, ihrem völligen Mangel an Bäumen und Buschwerk und ihren armseligen, nur durch mühsame künstliche Bewässerung möglich gemachten Feldern einen der trostlosesten Erdenwinkel dar, den ich auf meinen Reisen kennen gelernt habe. Von Vögeln ist wenig zu sehen und zu hören, und die wenigen vorhandenen Arten wirken bald ebenso wie das ganze Landschaftsbild ermüdend und einförmig auf den Beobachter. Nur die massenhaft vorhandenen Kalanderlerchen vermögen durch ihre herrlichen, jubelnd vorgetragenen weisen frisches Leben in diese trostlose Einsamkeit zu bringen, wenn sie jauchzend von der öden, sonnenverbrannten Fläche zum blauen Himmel wie tönende Raketen emporsteigen, ein Strahl von Hoffnung in trüber Dunkelheit. Das sind Augenblicke, in denen man die unschätzbare ästhetische Bedeutung des Vogelgesangs erst recht begreifen, achten und würdigen lernt, und mit neuem Lebensmut zieht man dann weiter, frohe Dankbarkeit im Herzen gegen den lieben, kleinen, melodienreichen Sänger. Buch die Kalanderlerche, deren Lied, der robusteren Gestalt entsprechend, lauter ertönt als bei unserer Feldlerche, ja bisweilen zu grell und schrill, ist ein vorzüglicher Spötter und versteht es vortrefflich, allerlei fremde Vogelstimmen zu einem wohltönenden Potpourri zu verweben.
Recht schmucke Burschen nicht nur – in ihrem lebhaft gefärbten Gefieder herrscht ein sattes Gelb neben Schwarz und weiß vor –, sondern auch vorzügliche Sänger sind die südamerikanischen Trupiale, von denen eine Art, der Baltimoretrupial, seinen Verbreitungsbezirk bis weit in die vereinigten Staaten hinein vorschiebt. Auch ihr starartiges Betragen ist von großer Anmut und macht dem Beobachter viel Freude, zumal sich die munteren Vögel als kunstvolle und gesellig brütende Nestbauer erweisen; man sagt ihnen nach, daß sie zum Bau ihrer schönen, an die der Kaziken erinnernden Beutelnester gern das Garn von der Bleiche stehlen. In gesanglicher Beziehung dürfte unter ihnen der Flötentrupial Brasiliens obenan stehen, worauf schon der Umstand hinweist, daß für besonders gut begabte Stücke schon an Ort und Stelle von begeisterten Liebhabern 120 Mark und mehr bezahlt werden. Der liebenswürdige Vogel gilt auch als hervorragender Spötter, soll aber seinem überaus wechselvollen, hauptsächlich aus sanft flötenden Weisen zusammengesetzten Lied niemals unangenehme oder rauhe Töne beimischen. – Der beliebteste Käfigvogel der Nordchinesen ist die anmutige Rubinnachtigall ( Calliope kamtschatkensis), die in Haltung und Benehmen stark an unser Rot- oder eigentlich noch mehr an unser Blaukehlchen anklingt und mit einer prachtvoll rubinroten Kehle geschmückt ist. wenn ich eben von einem Käfigvogel sprach, so darf dies nicht ganz wörtlich genommen werden, denn die Söhne des himmlischen Reiches haben, wie in allem, auch bei der Vogelliebhaberei ihren eigenen Zopf. Sie halten nämlich ihre Lieblinge zumeist gar nicht in Gebauern, sondern gewöhnlich auf einem galgenartigen Stellholz, an dem der Vogel durch einen Bindfaden angekettet ist und so gern auch auf Spaziergängen mitgenommen wird; es ist merkwürdig, wie gut und rasch sich die Vögel an diese uns zunächst recht tierquälerisch anmutende Art der Unterbringung gewöhnen. Im Freien läßt die schmucke Rubinnachtigall ihren angenehmen Gesang, der sich durch nachtigallartigen Anschlag, lange Triller und sanft klagende Strophen auszeichnet, in stolzer und edler Haltung vom Wipfel eines kleinen Baumes aus erschallen. Während dieser Lieblingsvogel der Nordchinesen leider nur höchst selten in die Hände unserer Liebhaber gelangt, ist dies um so häufiger und regelmäßiger mit dem bekanntesten Käfigvogel Südchinas der Fall, dem Sonnenvogel, der in großer Zahl unsere Vogelhandlungen zu bevölkern pflegt. Die Händler nennen ihn gewöhnlich chinesische Nachtigall, was aber mindestens als liebevolle Übertreibung bezeichnet werden muß, so voll und schön der verschlungene, pirolartige Flötenpfiff des munteren und buntgefärbten Sängers an sich auch tönen mag. Viel treffender ist der Brehmsche Name Drosselmeise, da der Sonnenvogel in seinem Benehmen in der Tat Züge dieser beiden Vogelfamilien vereinigt.

Abb. 20 Glockenvogel.
Häufiger als durch anmutige und längere Vogellieder wird die geheimnisvoll-heilige Stille des weiten südamerikanischen Urwalds durch kurze, auffallende Rufe unterbrochen, die aber teilweise ebenfalls von großem Wohllaute sind. So erschallt häufig ein amboßartiger Schlag, und auf diesen folgt ein tiefes, sonores »Ba-um«, dessen gedehnter Nachklang täuschend wie verhallendes Glockengeläute klingt. Meist folgen drei solcher Glockentöne aufeinander, worauf das Ganze mit einem abermaligen Hammerschlage abschließt. Hervorgebracht werden die eigenartigen Töne von dem nackthalsigen, drosselgroßen Glockenvogel (Abb. 20), dessen alte Männchen merkwürdigerweise in ein schneeweißes Federkleid gehüllt sind. Er gehört zur Gruppe der Kropfvögel. Diese besitzen am unteren Kehlkopf elastische, erbsen- bis kirschgroße Fleischkörper, die mit luftführenden Geweben in Verbindung stehen und sich als sehr bewegliche, zur Verstärkung der Stimmlaute dienende Luftkammern zu erkennen geben. Nicht immer aber sind die Töne von solch entzückendem Wohlklang wie beim Glockenvogel, häufig vielmehr grelle Mißtöne. So stößt der durch einen aufrichtbaren, helmartigen Federbusch und befiederte Hautlappen am Halse ausgezeichnete Schirmträger ein höchst unangenehmes Geschrei aus, das an fernes Stiergebrüll erinnert und geradezu schauerlich klingt, wenn mehrere Vögel gleichzeitig ihre Stimmen erschallen lassen. Sie neigen dabei den Kopf, breiten die Federhaube schirmartig aus und schwenken die Hautlappen wie in toller Verzückung hin und her.
Kaum weniger originell als das Glockengeläut und die Amboßschläge des Glockenvogels durchhallen die melodischen Töne des Flageolettvogels den brasilianischen Urwald. Ganz begeistert schreibt Martin: »Das tropische Amerika birgt in seinen Urwäldern Vögel, die, wenn sie auch nicht mit dem Schlag der Nachtigall wetteifern können, doch an Reinheit der einzelnen Töne diesen weit übertreffen. Namentlich solche Töne, die denen einer Glasharmonika gleichen, hört man oft und kennt manchen ihrer Urheber, obgleich einzelne durch ihr verstecktes Leben sich beharrlich jeder Nachforschung zu entziehen trachten. Zu diesen geheimnisvollen Sängern gehört auch der Flageolettvogel, von dessem glockenreinem, fast überirdisch klingendem Gesang man überall in den Küstenstädten zu hören bekommt. Wenn die wunderbaren Glockentöne des Glockenvogels im Dämmerlicht des hereinbrechenden Tages verklungen sind, dann fangen im dichten Urwald reiner gestimmte Kehlen an, das kurze Morgenrot mit ungeahnten Zauberklängen zu begrüßen. In unbeschreiblicher Klarheit hört man anfangs einige sanfte, im schönsten Akkord abgerundete Töne, die den Hörer unwillkürlich festbannen. Nach einer Weile ertönen dieselben Klänge aufs neue und wechseln im strengen Rhythmus mit anderen ab, welche die zweite Strophe der wunderbaren Arie bilden, worauf eine dritte und vierte von ungeahnter Vollendung folgen. Wird der geheimnisvolle Sänger durch unsere Neugierde nicht gestört, so treibt er sein entzückendes Glockenspiel weiter und weiter fort; fühlt er sich aber in seiner Ruhe irgendwie beeinflußt, so bricht er urplötzlich ab, und einige kreischende Töne beschließen den schönen Melodienfluß.« Nordamerika aber besitzt ein hübsches Gegenstück zu diesem Sänger in dem kaum drosselgroßen, mit unseren Fliegenschnäppern verwandten, hübsch blaugrau gefärbten und mit einem weißen Ring um die Augen versehenen Klarinettenvogel. In seinem ganzen Benehmen erinnert das sanfte, ruhige und stille Geschöpf an den Seidenschwanz, nur daß ihm dessen starker Geselligkeitstrieb völlig fehlt, da der Klarinettenvogel im Gegenteil ein großer Freund der Einsamkeit ist. Im wilden, unzugänglichen Gefels der Berge, fernab von allem menschlichen Verkehr, geht der scheue Vogel seinen Geschäften nach und sucht sich den hungrigen Magen mit Kerfen und Beeren zu füllen. Hier erschallt auch klar und melodisch sein eigenartiger, mit keinem anderen Vogellied zu verwechselnder Gesang. Von einer gewissen Einförmigkeit ist er nicht freizusprechen, aber dafür ist jeder einzelne Laut glockenrein, unendlich lieblich, gewissermaßen sprudelnd. Er erschallt auch mitten im eisigen Winter, da der Klarinettenvogel zu den ausgesprochenen Standvögeln seiner Heimat gehört. – Inmitten der Städte Zentralamerikas wird man nicht selten die Grakel ( Quiscalus macrurus) antreffen, die sich der Zivilisation schon so weit angepaßt hat, daß sie da, wo elektrische Beleuchtung vorhanden ist, vielfach zu einem Nachtvogel geworden ist. Überhaupt zeigt sich dieser langgeschwänzte, elsterngroße, in Vielehe lebende und gesellig brütende Vogel wie so viele Allesfresser als ein ganz hervorragend intelligenter Bursche von rabenartigem Benehmen, der in allen Sätteln gerecht ist und schlau jede Lage zu seinem Vorteil auszunutzen weiß. Seine Stimme ist auffallend genug, denn er reimt eigenartige Flötentöne zu einer kurzen Strophe zusammen, was genau so klingt, als ob ein Flötist auf seinem Instrument einen schwierigen Lauf fünf- bis sechsmal hintereinander einübe, um die nötige Sicherheit zu erlangen. Anders während der eigentlichen Balz, wo der Vogel geradezu karikaturenhafte Bewegungen ausführt, indem er das Gefieder sträubt, den Hals stark nach unten biegt und verdreht und dabei unter krampfhaften Zuckungen des ganzen Körpers kurz kollernde Töne ausstößt. Es sieht aus, als habe der drollige Gesell etwas Unrechtes gefressen und bemühe sich nun, es unter schmerzhaften Anstrengungen wieder los zu werden. Die stillen Urwälder derselben Länder erhalten ein schwermütiges und reizvolles Gepräge durch die eigenartigen Stimmlaute der auch über Südamerika verbreiteten Momots oder Sägeschnäbler, die ihren Namen deshalb führen, weil die Ränder des rabenartigen Schnabels mit einer Reihe sägeartiger Ausschnitte versehen sind. Im Körperbau erinnern sie sonst an die Racken, und auch deren glänzende Lasurfärbung in Blau und Grün ist ihnen eigen, jedoch kommt dazu noch ein kleiner Büschel verlängerter schwarzer, oft himmelblau eingefaßter Kehlfedern, der an die Kehlbüschel der Truthühner erinnert und überhaupt vielen amerikanischen Vogelformen eigentümlich ist. Auf Kuba läßt der in selbstgegrabenen Erdlöchern, aber auch in Baumhöhlungen nistende Todi oder Plattschnäbler, ein Verwandter der Tyrannen, aber mit völlig flachgedrücktem Schnabel, das melancholische »Tototo« ertönen, das ihm zu seinem Namen verholfen hat. Nach Braunellenart durchschlüpft er das Gebüsch, ist aber im allgemeinen ebenfalls ein recht fauler Bursche, denn stundenlang sitzt er mit gesträubtem Gefieder, eingezogenem Halse und hochgehaltenem Schnabel still und unbeweglich da und lauert wie ein Fliegenschnäpper auf vorübersummende Kerfe. So sehr vergißt er darüber seine ganze Umgebung, daß ein sich langsam näher schleichender und nicht ganz ungeschickter Mensch ihn mit dem Schmetterlingsnetze wegfangen kann. – Wer jemals indianische Niederlassungen im Inneren Südamerikas besuchte, der wird dort wahrscheinlich auch die Bekanntschaft des Trompetervogels gemacht haben, eines kranichartigen Burschen, der allenthalben in gezähmtem Zustande freilaufend gehalten wird und in den Dörfern die Rolle eines klugen Behüters und tatkräftigen Beschützers des Hausgeflügels spielt, aber auch mit seinen indianischen Herren auf sehr freundschaftlichem Fuße steht, indem er sogar die Gemütsstimmungen des Menschen versteht und teilt. Merkt er z. B., daß man vergnügt ist, so überkommt auch ihn alsbald unbändige Heiterkeit, und er bemüht sich, durch drollige Sprünge und komische Tänze auch das Seinige zur Erhöhung der Stimmung beizutragen. Kein Wunder, daß die mit so viel Verständnis für das Tierleben begabten Indianer den hochintelligenten Vogel so liebhaben. Im Freien belebt der Trompetervogel gesellig den Hochwald und legt hier auf dem Erdboden bis zehn blaugrüne Eier. Er ist nämlich zwar ein vorzüglicher Läufer, aber sein Flugvermögen ist stark verkümmert und eigentlich gleich Null. Merkwürdig ist auch bei ihm wieder die Stimme. Gewöhnlich klingt sie dumpf und bauchrednerisch, aber außerdem vermag er noch mit Hilfe von zwei großen, halbkugelförmigen Säcken in der Brusthöhle sehr tiefe, unheimlich brummende Töne hervorzubringen.
Von Afrikanern verdient an dieser Stelle vor allen der Hornrabe Erwähnung, so genannt, weil er ein Horn auf dem mächtigen Schnabel trägt, das sich jedoch bei den Nestvögeln noch nicht vorfindet, also erst später zur Ausbildung gelangt. Auch seine Stimme ist ein mehrfach wiederholtes tiefes Gebrumm von ganz absonderlicher Wirkung. Er bewohnt Steppenländer und geht hier zumeist auf dem Erdboden seiner Nahrung nach. Obschon er Allesfresser ist, scheint er doch Lurche jeder anderen Nahrung vorzuziehen und auch kleine Vögel und Mäuse mit Vorliebe zu verspeisen. In geistiger Beziehung halte ich ihn für einen sehr hochstehenden Vogel, obgleich ihn die meisten Tiergärtner als scheu und widerspenstig schildern, ja ihn teilweise geradezu der Tücke und Boshaftigkeit anklagen, wobei feststeht, daß er mit feinem scharfschneidigen Schnabel äußerst schmerzhafte Verletzungen beizubringen vermag. Wie ich erst unlängst beobachten konnte, versteht sich der überhaupt sehr spielerisch veranlagte Vogel vortrefflich auf die Kunst des Sichtotstellens und führt dann seine Rolle mit unerschütterlicher Beharrlichkeit durch. Unzählige Male habe ich mich im nordwestlichen Afrika an der klangvollen Strophe des zu den Bülbüls gehörigen Feigenfressers ( Ixos obscurus) erfreut. Trotz seines schlichten und düsteren Federkleides hat gerade dieser Vogel sehr viel Anziehendes für den Beobachter. Alles an ihm ist quecksilberne Beweglichkeit, stürmische Rastlosigkeit, ewige Unruhe, alles wilde Leidenschaft, echt afrikanisches Temperament. Wo nur ein paar verkümmerte Feigenbäume und eine verwahrloste Kaktushecke nach maurischen Begriffen einen »Garten« darstellen, da findet auch der Feigenfresser sich ein, und die von ihm bewohnten Örtlichkeiten weiß er zu beleben, wie kaum ein anderer Vogel. Äußerst wohllautend klingt der aufjubelnde, taktmäßig vorgetragene Gesang. Früchte und Kerfe aller Art bilden die Nahrung des Feigenfressers, der nebenbei auch wohl noch kleinere Sämereien naschen mag. Eine besondere Vorliebe hat er für Datteln, Oliven, Feigen und Orangen sowie für die schönen Früchte des Erdbeerbaumes, deren mehlig-süßer Geschmack ja auch manchen Menschenkindern zusagt. – Nicht auf Afrika beschränkt, sondern in den warmen Ländern beider Welten heimisch sind die gesellig lebenden, munteren, zu den Höhlenbrütern und Allesfressern zählenden Bartvögel, gekennzeichnet durch einen aus langen, nach vorwärts gerichteten Borsten bestehenden »Bart« an der Wurzel des breiten und dicken Schnabels. Ihre lauten Stimmen vereinigen sich mit denen der Artgenossen zu einem weithin ertönenden Konzert, wobei zwar jeder, unbekümmert um den andern, seine eigene Weise singt, das Ganze aber trotzdem gar nicht übel klingt.

Abb. 21. Jägerliest.
Verhältnismäßig reich an merkwürdigen und auffallenden Vogelstimmen ist dann wieder der fünfte Erdteil. Wer hätte nicht schon vom »lachenden Hans« der Ansiedler gehört, den die Ornithologen Jägerliest (Abb. 21) nennen und der zu den Eisvögeln gehört, obschon er mit unserem »fliegenden Smaragd«, dem Königsfischer, eigentlich nichts gemein hat als den gedrungenen Körperbau, den langen Schnabel und den kurzen Stummelschwanz, denn er besitzt im Gefieder weder leuchtende Farben, noch lauert er am Wasser auf Fische. Er ist auch viel größer als unser Eisvogel und verzehrt als Bewohner der trockenen Buschsteppe hauptsächlich Heuschrecken, Mäuse, namentlich auch Schlangen und gilt deshalb mit Recht für so nützlich, daß sein Abschuß von den Behörden mit hoher Geldstrafe geahndet wird. Jedermann hat den meist truppweise auftretenden Vogel gern, denn sein tolles, wieherndes, ausgelassenes Fastnachtsgelächter, das von komischen Klappertönen unterbrochen wird, trägt nicht wenig zur Ergötzung und Erheiterung der einsamen Farmbewohner in jenen einförmigen Gegenden bei. Ebenda sieht man auf vereinzelt stehenden Bäumen oft auch einen schwarzweißen, krähenartigen Vogel sitzen, der den Wanderer mit klangvollen, weithin vernehmbaren Rufen begrüßt, die trotz ihres melancholischen Ausdrucks das eintönige Gelände in der angenehmsten Weise beleben. Es ist der Flötenvogel, ein ständiges Inventarstück unserer Tiergärten und in seiner Heimat als Heuschreckenvertilger gleichfalls allbeliebt, obschon er gelegentlich auch den Früchten nachgeht. Im Käfig zeigt er viel Gelehrigkeit und Nachahmungstalent, lernt auch Lieder tadellos nachpfeifen. Neuseeland beherbergt in dem kleineren Pastorvogel eine ebenso anziehende und begabte Vogelart. Schwarzgrün schimmert sein stahlglänzendes Gefieder, aber dazu trägt er einen gestickten Kragen, und vorn am Halse schmücken ihn zwei wie angehängt aussehende Büschel von kugelig zusammengerollten, schneeweißen Federn, an die Beffchen der evangelischen Geistlichen erinnernd. Er ist Waldbewohner und mit einer Pinselzunge ausgerüstet. Das Wesen des intelligenten, aufmerksam und verständnisvoll auf alle Vorgänge in seiner Umgebung achtenden Vogels ist rastlos und geräuschvoll, lebhaft und drollig. Er verfügt über eine Reihe klangvoller, pirolartiger Rufe, die bald laut, bald leise vorgetragen und allerdings auch öfters von unschönen Lauten unterbrochen werden. Ferner soll ihm, der unzweifelhaft einer der fleißigsten Sänger ist, auch eine starke Nachahmungsgabe eigen sein, ja er soll bei genügend sorgfältiger Abrichtung sogar menschliche Worte nachsprechen lernen und deshalb in seiner Heimat gern als Käfigvogel gehalten werden.
Neuseeland mag uns gleich noch ein Beispiel dafür liefern, wie hochgradig die allmähliche Anpassung an besondere Ortsverhältnisse eine Vogelform umzumodeln vermag. Es lebt dort nämlich ein Papagei, der als Nacht-, Eulen- oder Erdpapagei (Abb. 22) vollständig zum Nacht- und Bodenvogel geworden ist, wobei seine Flugfähigkeit und sein Klettervermögen naturgemäß arg verkümmern mußten, zumal größere tierische Feinde dort nicht vorhanden, und kleinen Räubern gegenüber der kräftige Schnabel und die starken Krallen genügend wirksame Waffen waren. Obwohl der Erdpapagei – von den Eingeborenen, die sein zartes, weißes Fleisch sehr lieben, Kakapo genannt – sich bei Tage streng verborgen hält und erst nach Einbruch der Nacht sein geheimnisvolles Wesen treibt, ist es doch mit seiner Eulenähnlichkeit nicht so weit her, wie man vielfach gefabelt hat, zumal schon seine Augen viel zu klein sind, als daß sie einen eulenartigen Eindruck hervorrufen könnten. Und daß ein eine solche Lebensweise führender Nachtvogel kein buntes Papageiengefieder haben kann, wird ohne weiteres einleuchten. Die Baumwurzeln auf Neuseeland wachsen zum Teil oberirdisch, und die zwischen ihnen vorhandenen Höhlungen, die durch Wegschaffen des Erdreichs noch künstlich erweitert werden, bilden die liebsten Schlupfwinkel für den Kakapo. Hier legt er auch in einer seichten Mulde vermodernden Holzes sein Nest an. Früher war er in diesen verstecken sicher genug und kaum daraus hervorzustöbern, aber mit der Einführung von Hunden schlug auch für diesen interessanten Vogel die Todesstunde, und sein Aussterben ist leider wohl nur noch eine Frage der Zeit. Zum Fliegen entschließt sich der Kakapo nur ungern, und sein Flug ist herzlich ungeschickt, stets nur kurz und führt immer ins Astwerk eines niedriger stehenden Baumes, in dem er dann mit Hilfe von Schwanz und Schnabel mühselig genug wieder in die Höhe klettert. Aufwärts scheint er dagegen überhaupt nicht fliegen zu können. Die Stimme ist ein heiseres Krächzen und mißtöniges Kreischen. Neben zarten Pflanzenschößlingen und jungen Blättern bildet allerlei Wurzelwerk die Hauptnahrung des eigentümlichen Vogels, wobei der absonderlich gestaltete Schnabel die Dienste eines Spargelstechers versieht und wohl auch das Geruchsvermögen beim Aufsuchen der unterirdischen Leckerbissen eine Rolle spielt.

Abb. 22. Erdpapagei.
Als Typus vollendeter Buschschlüpfer seien hier die in unserer südwestafrikanischen Kolonie häufigen Mausvögel erwähnt, seltsame Gestalten von Zinkengröße, aber mit langgestrecktem, walzigem Körper, kurzläufigen, aber in den Zehen ungemein beweglichen Füßen und haarartigem, rötlich mausgrauem Gefieder. Truppweise schlüpfen sie mit unglaublicher Behendigkeit im dichtesten Gewirr des von Schlingpflanzen überwucherten Dorngestrüpps herum und sehen dabei eher wie dahinhuschende Mäuse als wie Vögel aus, während sie beim kurzen Flug von einem Gestrüpp zum andern, wobei sie lebhaft zu schreien pflegen, infolge des langen Schwanzes abgeschossenen Pfeilen gleichen. Sie verstehen auch ganz gut zu klettern und sollen an den Dattelpalmen einigen Schaden anrichten. Ein anderes Extrem besonderer körperlicher Ausbildung stellt das südamerikanische Blätterhühnchen ( Parra jassanna) dar. Mit ihren fabelhaft langen Füßen und den riesigen Zehen erscheinen diese zierlichen Vögel wie geschaffen dazu, um mit bewundernswerter Schnelligkeit über die Blätter der Seerosen, die dort so reichlich stille Teiche bedecken, dahinzulaufen und auch über trügerischen Schlamm- und Pflanzenwust, in dem jedes andere Wirbeltier versinken würde, leicht, elegant und sicher dahinzugleiten, als würden sie von unsichtbaren Händen gehoben und getragen. Doch kommt das Blätterhühnchen häufig genug auch an freiliegenden Teichen mit offenem, nicht verwachsenem Wasserspiegel vor, wo es sich dann lediglich als Watvogel betätigen muß, zumal es mit seiner Schwimmkunst nicht weit her ist, es sich dabei vielmehr recht ungelenk und unbehilflich zeigt. Dagegen ist der bald schwirrende, bald gleitende Flug des lebhaften Vogels recht gut, und die schön gelbe Farbe der Schwingen kommt dabei vorteilhaft zur Geltung. Auch durch seine lachende Stimme zieht das Blätterhühnchen die Aufmerksamkeit bald auf sich, aber um so besser weiß es sein Nest zu verbergen.
In den fruchtbaren Sandwüsten Turkmeniens habe ich in dem Saxaulhäher einen Vogel kennen gelernt, der eine äußerst interessante Anpassung des Hähertypus an das Leben in der Wüste vorstellt. Der Vogel ist hier zu einem sandfarbigen Schnelläufer geworden und hat auch sonst noch allerlei seltsame Manieren angenommen. Noch heute steht mir lebhaft mein erstes Zusammentreffen mit dem seltsamen Vogel vor Augen; war ich doch eigens nach der Kosakenstation Repetek im trostlosesten Teile der Wüste gekommen, um sein Leben zu studieren und zu näheren Untersuchungen womöglich einige Stücke zu sammeln. Zuerst vernahm ich ein metallisches, überraschend lautes Schwirren: »Türrr, türrr, türrr«. während ich noch überlegte, ob diese Stimme wohl dem Saxaulhäher angehören könne, kam auch schon der begehrte Vogel unter einem Saxaulstrauche hervor und lief spornstreichs nach dem nächsten saxaulbewachsenen Sandhügel hinüber, wie prachtvoll, wie schneidig, elegant und rassig war seine Erscheinung! In der ersten Überraschung fehlte ich; überhaupt gehört ein sehr sicherer Schütze dazu, einen laufenden Saxaulhäher im Saxaulgestrüpp zu treffen. Der Vogel flog auf den Schuß hin auf und verschwand gleich darauf hinter der nächsten Dünenkette. Ärgerlich eilte ich ihm nach. Aber inzwischen war die Sonne schon höher heraufgestiegen, und ihre glühenden Strahlen machten sich bei dem schnellen Marsche hügelauf, hügelab in dem losen Flugsande immer unangenehmer bemerkbar. Ich war wohl schon über eine Meile weit in die Sandwüste hinein vorgedrungen, und noch immer ließ sich kein neuer Saxaulhäher blicken. Der Sand war so heiß geworden, daß es unmöglich war, sich zum Ausruhen darauf niederzulassen, und die Läufe des Gewehrs glühten dermaßen, daß man sie nicht mehr anfassen konnte. Der Schweiß rann in Strömen von der Stirn und der mich entsetzlich quälende, Hals und Gaumen ausdörrende Durst wurde immer unerträglicher. Aber wenigstens einen Saxaulhäher wollte ich doch haben! Und endlich wurde meine Ausdauer belohnt, wieder hörte ich das metallische Schwirren, wieder sah ich den farbenduftigen Nenner von einem Strauche zum andern eilen, aber diesmal fehlte ich nicht. Entzückt hob ich meine Beute aus und erkannte ein altes Exemplar mit dem schönen schwarzen Kehlfleck. O, über diese trotz aller Strapazen köstlichen Minuten ornithologischen Hochgefühls!
□