
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Es war im Laufe des Jahres 1526, als sich in Loudun, das zu jener Zeit zu den bedeutendsten Städten Poitous zählte, eine Anzahl von Ursulinerinnen niederließ. Dieser Orden war erst vor kurzer Zeit gegründet worden. Die Päpste Paul III. und Gregor XIII. hatten ihn anerkannt, und dank einer königlichen Verfügung, die durch Heinrich de Goudi, Bischof von Paris, vermittelt worden, war den Ursulinerinnen das Recht verliehen worden, in ganz Frankreich Klöster zu gründen.
Sie machten den umfassendsten Gebrauch von diesem Rechte; bald hernach waren sie in Bordeaux, wo der Kardinal de Sourdis sie unter seinen ganz besonderen Schutz nahm.
Von da kamen sie im Jahre 1618 nach Poitiers, einige Jahre später ließen sich acht der frommen Schwestern in Loudun nieder. Der Bischof selbst hatte sie dazu veranlaßt, da die Honoratioren der Stadt ihn dazu gedrängt hatten. Die Nonnen mieteten für den bescheidenen Preis von zweihundertfünfzig Franken ein zwar geräumiges, aber völlig verwahrlostes und häßliches Haus in der Straße Paquin. Dieses Haus war schon seit langer Zeit von keiner lebenden Seele bewohnt gewesen. Die alten Frauen bekreuzigten sich, wenn sie vorüberkamen und erzählten, daß böse Geister darin umgingen.
Die Ursulinerinnen richteten sich, so gut es eben gehen wollte, in dieser traurigen Wohnung ein, sie waren sehr arm, denn man hatte sie ohne einen roten Heller, ohne Vorräte und Möbel von Poitiers nach Loudun geschickt. Mitleidige Seelen verschafften ihnen Betten, aber als die Oberin von Poitiers dies erfuhr, befahl sie, daß man die Betten sofort zurückgeben und sich mit einfachen Strohsäcken begnügen solle. Diesen unglücklichen Frauen fehlte es oft sogar an Brot und Wäsche. Die ersten Monate ihrer Niederlassung in Loudun erschienen ihnen daher sehr lang und traurig. Das bescheidene Kloster, das gleichzeitig als Erziehungsanstalt für junge Mädchen aus der Stadt dienen sollte, hatte noch keine Pensionärinnen. Man war daher fast vollständig isoliert. Indessen besserte sich die Lage der Schwestern sehr bald. Die Oberin war eine sehr gescheite Frau, die sich in allen Lebenslagen zu helfen wußte, und ihre Gefährtinnen halfen ihr nach Kräften und scheuten nicht die rauhesten Arbeiten, um ihr tägliches Brot zu gewinnen. Die katholische Bevölkerung von Loudun erfuhr endlich von der traurigen Lage, in der die Nonnen sich befanden, und nahm sich ihrer, von Mitleid ergriffen, tatkräftig an. Nach einem Jahre schon hatten die Ursulinerinnen eine kleine Zahl von Pensionärinnen, und das Pensionat fing an, sich einen guten Namen zu machen, als die Oberin in Anerkennung ihrer Verdienste abberufen wurde, um fortan eine Stellung anzunehmen, die ihren Fähigkeiten würdiger war. Nicht ohne tiefes Bedauern sahen ihre Genossinnen sie aus dem Kloster scheiden, das sie mit Hilfe dieser guten und klugen Frau gegründet und das unter ihrer ebenso tapfern wie weisen Führung so schnell Bedeutung erlangt hatte. Sie trugen sich mit einer gewissen Unruhe, ob die neue Oberin sie mit ebensoviel Klugheit und Güte führen und ob der Reiz des engen Miteinanderlebens nicht unter diesem Wechsel leiden würde. Ihre Unruhe wandelte sich in Schrecken, als sie erfuhren, welche Wahl in dem Mutterhause von Poitiers getroffen worden war. Die neue Oberin hieß Schwester Jeanne des Anges. Sie war am 2. Februar 1605 im Schlosse Cozes in Saintonge geboren als Tochter des vornehmen und mächtigen Herrn Louis Béclier, Baron de Cozes, Herrn von Eschillais und de la Ferrière und der Dame Charlotte Goumart d'Eschillais, die einem ebenso edlen und alten wie vornehmen Geschlechte entstammte.
Ihre Eltern, die reich und hoch angesehen waren, wünschten, ihr eine ihrer Geburt entsprechende gute Erziehung zu geben. Zu diesem Zwecke wurde das Kind einer ihrer Tanten, der Priorin der Abtei von Saintes vertraut. Jeanne de Béclier war damals zehn Jahre alt. Sie war ein sehr lebhaftes, schwieriges Kind, mit einem höchst eigentümlichen bizarren Charakter. Trotz aller Sorge, mit der die Priorin sie umgab, konnte sie sich doch niemals an die Lebensweise der Abtei gewöhnen – dennoch blieb sie fünf Jahre dort. Aber zuletzt war sie derartig unausstehlich geworden und legte so unnatürliche Neigungen an den Tag, daß ihre Tante, die gänzlich daran verzweifelte, je Herrin dieser perversen Natur werden zu können, sie ihren Eltern zurückschicken mußte. So kehrte also Jeanne im Alter von 15 Jahren in das väterliche Schloß zurück, aber sie machte ihrer Familie große Sorgen, da weder gute Ratschläge noch ernster Tadel den geringsten Eindruck auf sie machten. Sie schien von beiden nur gelangweilt zu werden, und so geschah es, daß sie eines Tages ihre Familie durch die Mitteilung überraschte, daß sie den Entschluß gefaßt habe, in das Kloster zu gehen.
Es konnte nun wirklich kaum jemand geben, der weniger für das Klosterleben prädestiniert erschien, als Jeanne. Indessen gab man auch diesmal wieder ihrer seltsamen Laune nach. Es war gerade zu der Zeit, als in Poitiers der neue Orden der Ursulinerinnen gegründet worden, und Jeanne erklärte, daß sie diesem beizutreten wünsche. Während der ganzen Zeit ihres Noviziats zeichnete sie sich durch außerordentlichen Eifer, gleichzeitig aber auch durch die seltsamsten Neigungen aus. So hatte sie eine besondere Liebhaberei dafür, die abschreckendsten körperlichen Gebrechen und Wunden zu pflegen. Eine Nonne, die infolge von Drüsenleiden mit Geschwüren bedeckt war, wurde Gegenstand ihrer besonderen Vorliebe. Ein anderes Mal unternahm sie es, eine arme Pensionärin zu heilen, die ganz »mit Grind, Krätze und Ungeziefer bedeckt war«, und sie benutzte zu diesem Zwecke Quecksilbersalben, die sie selbst zubereitet hatte.
In der Zeit ihres Noviziates verlor sie plötzlich zwei Brüder und vier Schwestern. Der älteste Louis de Béclier, der zweite seines Namens, wurde 1627 bei dem Einfall der Engländer auf der Insel Rhé getötet.
Ihre trostlosen Eltern boten alles auf, um Jeanne zu bewegen, zu ihnen zurückzukehren. Aber Jeanne des Anges zeigte sich eigenwillig und erklärte, daß sie den festen Entschluß gefaßt habe, Nonne zu werden. Am 8. September 1623 legte sie die bindenden Gelübde ab.
Von diesem Augenblicke an erkannten ihre Gefährtinnen schnell ihre vielen Fehler. Gleichzeitig phantastisch, eitel und verstellungssüchtig, wurde sie bald der Gegenstand schwerer Sorge für die ganze Kongregation. Sie mußte alle Tage die ernstesten Ermahnungen über sich ergehen lassen. Aber weder Bitten noch Drohungen konnten sie rühren, oder vermochten es, auch nur den kleinsten Einfluß auf ihren Charakter auszuüben. Das einzige Resultat aller Bemühungen um sie war, daß sie des Klosterlebens plötzlich überdrüssig wurde und der Wunsch in ihr rege wurde, es wieder zu verlassen. Da indessen ihre Familie ungewöhnlich reich und das Kloster sehr arm war, lag es im Interesse des Ordens, sie zu behalten, und ihre Gefährtinnen wurden deshalb angewiesen, all ihren Launen und Phantasien nachzugeben. Nun erst entschloß sie sich zu bleiben. Als dann geplant wurde, in Loudun ein neues Kloster zu gründen, erwachte das glühende Bedürfnis nach Abwechslung und nach allem Neuen, das einen Grundzug ihres Charakters bildete, in ihr, und – wie wir aus ihren Memoiren ersehen werden, – wußte sie so geschickt zu intrigieren, daß sie als eine der acht Nonnen, deren Aufgabe es war, unter Leitung der Oberin die Filiale des Ordens zu gründen, nach Loudun geschickt wurde.
Dort angekommen, überraschte Jeanne ihre Genossinnen durch ein völlig verändertes Betragen. Sie benahm sich gehorsam, respektvoll und schien sehr fromm geworden zu sein. Niemals hatte man sie so gesehen. Ihre Wandlung war eine vollständige. Sie erwies sich voll zartester Aufmerksamkeiten für die Oberin, überhäufte sie mit Liebenswürdigkeiten und Schmeicheleien und wußte durch ihr zuvorkommendes bescheidenes Wesen alle berechtigten Vorurteile, die man bisher gegen sie gehabt, zu zerstreuen.
Sie strebte unablässig nur dem einen Ziele zu, selbst Oberin des Klosters zu werden; sie hatte keinen andern Gedanken und wußte mit einer seltenen Ausdauer alle Hebel in Bewegung zu setzen, die ihr dienlich sein konnten, ihren Plan zu verwirklichen. Sie brauchte nicht allzu lange darauf zu warten. Die Priorin blieb nur ein Jahr in Loudun und vor ihrer Abreise bestimmte sie, daß Schwester Jeanne des Anges, die sie so geschickt zu umgarnen gewußt hatte, ihre Nachfolgerin sein solle.
Zu listig, um ihre Freude darüber zu verraten, machte diese erst einige Schwierigkeiten, ehe sie den ehrenvollen Posten annahm. Sie drückte mit heuchlerisch bescheidenen Worten ihr tiefes Bedauern darüber aus, daß man sie zu einer solchen Stellung erkoren habe, während doch verschiedene ihrer Gefährtinnen weit eher berechtigt und auch würdiger seien, diese auszufüllen. Kurz, sie wußte so geschickt zu manövrieren, daß man ihr Zögern für Bescheidenheit nahm und es ihr einfach zur Pflicht machte, die Stellung anzunehmen.
Sie war listig genug, sich den Anschein zu geben, als erfülle sie nur die eine Pflicht des Gehorsams. So sah sie sich schon im Alter von fünfundzwanzig Jahren an der Spitze einer Kongregation, deren Bedeutung täglich wuchs. Und von dem Augenblicke an war es ihr einziger Ehrgeiz, den Orden, dem sie angehörte, mehr und mehr zu vergrößern, ihn zu bereichern und ihm einen bedeutenden Ruf zu verschaffen. Sie verstand es, die Töchter aus den ersten Familien der Stadt um sich zu vereinigen, um dadurch dem Kloster Glanz und Ansehen zu verleihen.
Die Zahl der Nonnen, die anfangs nur acht gewesen, erhöhte sich sehr bald auf siebzehn. Um sich eine Vorstellung von dem machen zu können, was das Pensionat der Ursulinerinnen unter der Direktion von Madame de Béclier bedeutete, sei es gestattet, die Namen einiger der frommen Schwestern hier aufzuführen:
Madame Claire de Sazilly, (deren Klosternamen Claire de Saint-Jean war), eine nahe Verwandte des Kardinals Richelieu.
Die beiden Damen de Barbezieres, aus dem Hause der Nougeret, Diese beiden Nonnen waren mit der Priorin verwandt und zwar durch ihre gemeinsame Großmutter Charlotte de Boulainvilliers, die in erster Ehe Pierre de Béclier, Baron de Cozes, Großvater der Jeanne, geheiratet hatte. Nachdem sie Witwe geworden, verheiratete sie sich später mit Louis de Barbezières, Kammerherrn des Königs und Kapitän der Garde. (mit dem Klosternamen Louise de Jesus und Catherina der Opferung Mariä).
Madame de la Motte, Tochter des Marquis de la Motte-Barace in Anjou. (Schwester Agnes de Saint-Jean.)
Madame d'Escoubleau de Sourdis, die aus derselben Familie stammte wie der berühmte Erzbischof von Bordeaux. (Schwester Jeanne des heiligen Geistes.)
Die beiden Damen Dampierre, die Schwägerinnen von Jean Martin, Baron de Laubardemont, und Verwandte des Herren de la Roche-Pozay, Bischofs von Poitiers. Sie waren durch ihre Mutter Helene Chasteigner mit der Familie des Bischofs von Poitiers, Heinrich Ludwig Chasteigner de la Roche-Pozay verwandt.
Die zweite Priorin, Madame de Fougère, nannte sich Schwester Gabriele der Inkarnation. Die Namen der andern Nonnen sind uns nur unvollkommen erhalten, indessen gehörten sie alle, wie ihre Oberin, dem Adel oder doch den höchsten bürgerlichen Kreisen an, bis auf eine, die Schwester Seraphine Archer.
Mit solchen Mitgliedern mußte es ja dem Kloster glücken; denn der Bürgerstand, der immer eitel ist, hielt es für eine Ehre, seine Töchter dahin zu schicken, weil sie dort durch wirklich vornehme Damen erzogen und im guten Ton und in den feinen Manieren unterrichtet wurden. Von jetzt an war man des Erfolges sicher, und das Pensionat der Ursulinerinnen erfreute sich bald einer Beliebtheit, die die kühnsten Hoffnungen überstieg.
Jeanne des Anges hatte jedoch kaum den Rang der Superiorin erworben, als sie sich jeden Zwangs entäußerte und ihren Launen und Einfällen keinerlei Schranken mehr auferlegte. Sie füllte ihre Zeit damit aus, allerlei Intrigen zu spinnen, anstatt sich mit Andachtsübungen zu beschäftigen. So demütig und bescheiden, wie sie sich während eines ganzen Jahres erwiesen hatte, ebenso hochmütig und unverträglich benahm sie sich jetzt – zur Verzweiflung ihrer Mitschwestern. Sie verbrachte ganze Tage im Sprechzimmer, um sich nur immer im Laufenden über alle in der Stadt sich zutragenden Ereignisse zu halten, und sie verfolgte mitlebhaftem Vergnügen alle Gerüchte und Klatschereien, die man sich erzählte. In ganz Loudun gab es keinen Menschen, der besser wie sie über alles informiert gewesen, was sich im Städtchen ereignete. Ihre Memoiren liefern uns interessante Details über ihre Beschäftigungen, und es ist sehr leicht, ihre Gedanken darin zwischen den Zeilen zu lesen.

Wie die Tiere den Satansruch der Hexe wittern.
Zu jener Zeit nun war es besonders ein Mann, der die ganze öffentliche Aufmerksamkeit für sich in Beschlag nahm; es war dies der Pfarrer der Kirche Saint-Pierre du Marché, Urbain Grandier. Stolz, spöttisch und stark sinnlich veranlagt, dabei aber von einer überraschenden geistigen Ueberlegenheit und mit einer bestechenden Ueberredungskunstbegabt, beherrschte und unterjochte dieser Mann damals die ganze alte Stadt Loudun.
Grandier, der einer der glänzendsten Schüler des Jesuitenkollegs in Bordeaux gewesen war und der von seinen Lehrern stark begünstigt und geschoben worden war, wurde schon mit siebenundzwanzig Jahren an der Hauptpfarre von Loudun, und später mit dem Titel eines Domherren an der Kirche des heiligen Kreuzes angestellt. Sein Aeußeres war so verführerisch wie möglich; er war von hoher schlanker Statur und ebenmäßigem Wuchse. Ein Porträt aus jener Zeit zeigt ihn als vollkommenen Kavalier mit jenem eleganten Schnurr- und Spitzbart, so wie Richelieu und Philipp de Champaigne ihn trugen. Es konnte nicht fehlen, daß ein von der Natur so reich ausgestatteter Mann wie Grandier überall freundlich aufgenommen wurde. Besonders die Frauen schienen ganz vernarrt in ihn zu sein, und da der Pfarrer von Saint-Pierre eine galant veranlagte Natur hatte, so verstand er es, seinen Nutzen aus der allgemeinen Vorliebe des weiblichen Geschlechtes für ihn zu ziehen. Er wendete sich niemals vergebens an trostlose Witwen und an Frauen, die keine Befriedigung in ihrer Ehe gefunden. Die Chronik erzählt uns, daß nur die ganz Alten und Häßlichen sich rühmen konnten, nicht vor ihm kapituliert zu haben. Die folgenden Zeilen, ein Auszug aus den Prozeßakten, die Dreux, Generalleutnant von China, seinerzeit veröffentlichte, zeigt uns nur zu deutlich, wie groß die Macht der Verführung war, die Grandier auf die Frauen ausübte. Drei den besten Familien der Stadt angehörende Frauen gaben folgende Aussagen ab: Die erste erklärte, daß an demselben Tage, an dem sie die Kommunion aus den Händen des Angeklagten erhalten – bei welcher Handlung der Priester sie starr angesehen habe – sie von einer heftigen Liebe für ihn überrascht worden sei, die damit angefangen habe, daß all ihre Glieder von leichtem Zittern ergriffen worden seien. Die zweite erklärte, daß, nachdem er sie auf der Straße angeredet habe, sie ebenfalls von einer starken Leidenschaft für ihn erfaßt worden sei, und die dritte berichtet, daß, nachdem er sie an der Pforte der Kirche der Karmeliter, durch die er mit seiner Prozession gezogen sei, angeblickt habe, sie sofort eine heiße Liebe für ihn und den Wunsch empfunden habe, bei ihm schlafen zu dürfen, obwohl er ihr bisher gleichgültig gewesen und sie sehr tugendhaft sei und sich des besten Rufes erfreue.
Er machte sich aber auch hinter junge Mädchen her, und zwar hinter solche aus guten Familien. Er verführte Philippine Trincaut, die Tochter des Staatsanwaltes. Als dann eine kompromittierende Schwangerschaft diesem skandalösen Verhältnisse ein Ende machte, warf er die Augen auf die Tochter eines der königlichen Räte, auf die schöne Magdalene de Brou. Diese jedoch gab sich ihm nicht eher, als bis er ihr ein Heiratsversprechen machte. Um ihretwillen geschah es, daß Grandier die berühmt gewordene Abhandlung über das Zölibat der Priester verfaßte, ein neue Ideen verfechtendes und gewagtes Werk, in dem jedoch unglücklicherweise auf mehr als einer Seite die Lehre von dem stillschweigenden Vorbehalte zum Durchbruch kommt, die er von seinen Lehrern, den Jesuiten, übernommen hatte.
An dem Skandal, den ein solcher Lebenswandel heute in einer kleinen Provinzstadt erregen würde, möge man ermessen, wie groß die allgemeine Empörung darüber vor zwei Jahrhunderten in dem katholischen Loudun war. Da war kaum einer, der nicht einen Stein auf den Priester geworfen hätte, und nicht ohne Grund. Eifersüchtige Ehemänner, beleidigte Väter, verlassene Frauen, Matronen, die sich ihm angeboten, ohne Erhörung gefunden zu haben, alle schalten und tobten. Füge man noch den Neid jener Landgeistlichen hinzu, die nicht so gut dotierte Stellungen einnahmen, wie Grandier, den Haß der Mönche, denen Grandier die Beichtkinder geraubt, die Sarkasmen, mit denen er von der Kanzel herab die Barfüßler, die Kapuziner und Franziskaner überhäufte, und man wird leicht begreifen, daß eine so viel Aufsehen erregende Persönlichkeit unmöglich der perversen Neugierde Jeannes des Anges entgehen konnte.
Wie alle andern sollte sie dem Zauber unterliegen, den
der magische Namen Grandiers auf die weibliche Bevölkerung Louduns ausübte. Sie beschloß, um jeden Preis den Zauberer zu sehen und ihn kennen zu lernen. Ihre exaltierte Einbildungskraft suggerierte ihr Gedanken, die einer Nonne unwürdig sind, und da sie weit davon entfernt war, wirklich von Herzen fromm zu sein, versuchte sie es nicht einmal, eine keimende Leidenschaft zu bekämpfen, die von Tag zu Tag mehr Gewalt über sie erlangte.
Die Mutter Priorin erschien so von ihrer Leidenschaft erfüllt, daß sie von nichts anderm wie von Grandier sprach und erklärte, daß er der Gegenstand all ihrer Liebe sei ...
(Auszug aus den Akten, loc. cit.) Endlich bot sich ihr eine Gelegenheit, sich in Beziehung mit Grandier zu setzen. Sie beschloß, diese nicht ungenützt vorübergehen zu lassen.
Als die Ursulinerinnen sich in Loudun niedergelassen, hatten sie, wie das die allen Klöstern gemeinsame Regel vorschreibt, einen Gewissensrat erwählen müssen. Der Bruder ihres Mietsherren, der Prior Moussaut, stellte sich ihnen zur Verfügung und bot der Oberin an, die Beichte der Schwestern zu empfangen und jeden Tag in dem Kloster die Messe zu lesen.
Da jedoch Moussaut hochbetagt war und unter den Beschwerden des Alters litt, war er natürlich wenig dazu geeignet, der Führer junger Nonnen zu sein. Auf den Geist der Madame Béclier übte er auch nicht den kleinsten Einfluß aus; Jeanne verstand die Kunst, sich zu verstellen, viel zu gut, um diesen alten Beichtvater etwas von der Leidenschaft merken zu lassen, die sie verzehrte. Der arme Moussaut wurde ganz irregeführt durch das heuchlerische Gebaren seines Beichtkindes, und vom ersten bis zum letzten Tage gelang es ihm niemals, einen Einblick in diese Seele zu erlangen, die so wenig für das Kloster gemacht erschien.
Jeanne des Anges war und blieb ein vollständiges Rätsel für alle, die sie umgaben. Trotz aller ihrer Fehler besaß sie eine gewisse Verführungsmacht. Vor allem war es die seltene Schönheit ihres Gesichtes,
Ihr Gesicht, sagt P. Surin, war von einer seltenen Schönheit, aber es lag ein affektierter Zug darin, und das Spiel ihrer Augen war unheimlich. auf die sie sehr stolz war, die alle sofort gefangen nahm, und man vergaß gern über dem Reize ihrer Unterhaltung
Der Teufel selbst hatte sie in der zu jener Zeit beliebten geistreichen Art des Gesprächs unterrichtet, in der sie so beschlagen war, daß sie alle entzückte, die je Gelegenheit hatten, sich mit ihr zu unterhalten. Sie zitierte die Kirchenväter mit Geist und Beredsamkeit, sie liebte es, Gesellschaft zu empfangen und bewegte sich mit solcher Grazie darin, daß alles sie bewunderte. Zu all diesen Vorzügen hatte der Teufel sie noch mit einer Schönheit begabt, die sie geradezu bezaubernd erscheinen ließ.
Boudon, Aus dem Leben des Paters Surin. und über ihren kleinen koketten Manövern, daß ihr Wuchs und die Bildung ihrer Taille und Schultern nicht ganz einwandfrei waren. Uebrigens wußte sie auch diese körperliche Unvollkommenheit mit großem Geschick zu verbergen.
Der Prior Moussaut starb im Juni 1631, und es galt nun, einen neuen Gewissensrat für das Kloster zu suchen. Jeanne des Anges ergriff eifrig diese Gelegenheit, um Beziehungen mit Grandier anzuknüpfen, und sie ließ ihm die Stelle eines Beichtvaters des Klosters anbieten.
Gegen alles Erwarten jedoch gab dieser ihr einen abschlägigen Bescheid. Der Pfarrer antwortete, daß seine zahlreichen Beschäftigungen ihm nicht gestatteten, jeden Tag den Pflichten, die man ihm vertrauen wollte, ein paar Stunden zu opfern. Diese Antwort war jedoch offenbar nur ein höflicher Vorwand dafür, das ihm gemachte Anerbieten abzulehnen. Es war sehr leicht zu erraten, daß es der Einfluß von Magdalene de Brou, der Maitresse Grandiers war, die ihm eine solche Antwort eingegeben hatte. Jeanne des Anges täuschte sich keinen Augenblick darüber. Sie begriff sofort, daß dies ein Streich ihrer Rivalin sei, und sie schwor, sich dafür zu rächen.
Sie wandte sich jetzt mit ihrem Anliegen an den Domherren Mignon. Diese Wahl war eine sehr bedeutungsvolle, und Grandier sollte dies nur zu bald zu seinem Schaden erfahren. Mignon war durch seine Mutter ein Neffe von Trincaut, dem Staatsprokurator, und mit fast allen Feinden des Pfarrers verwandt. Seine Familie war sehr zahlreich, und er hatte Beziehungen zu allen Klassen der Gesellschaft Louduns. Er genoß eines gewissen Einflusses, den er vielleicht mehr seinem Vermögen, wie seinem Verdienste verdankte. Seine persönliche Erscheinung war nicht gewinnend. Er hinkte sehr stark und hatte den geistlichen Stand nur deshalb ergriffen, weil sein körperliches Gebrechen ihn hinderte, einen andern zu wählen. Ueberaus ehrgeizig und rachsüchtig, wie er war, hatte er mit eifersüchtigem Auge die Erfolge Grandiers verfolgt, der, obgleich er noch jung und kein Kind des Landes war, doch sich der allgemeinen Gunst erfreute. Er hatte ihm von den ersten Tagen seines Erscheinens in Loudun an einen unerbittlichen Haß geschworen, den er jedoch klugerweise mehrere Jahre lang zu verheimlichen wußte. Zu scharfsichtig, um nicht zu erkennen, daß er dem neuen Ankömmling gegenüber ohnmächtig sei, erwartete er mit Geduld den passenden Moment, um ohne Gefahr ganz offen Partei gegen ihn zu nehmen. Das skandalöse Abenteuer seiner Cousine bot ihm die beste Gelegenheit hierzu, und von jetzt an brauchte er sich nicht mehr zu bezwingen und seine wahren Gefühle zu verheimlichen. Er führte einen erbitterten Krieg gegen den Pfarrer und bediente sich dabei einer Waffe, in deren Führung er Meister war: der Verleumdung. Sehr gerissen in der Führung derartiger Angelegenheiten, wußte er Grandier in eine Reihe von verdrießlichen Händeln zu verwickeln, die ihn vor das Gericht führten. Obwohl Mignon bisher nichts damit erreicht hatte, da es Grandier stets gelungen war, seine Unschuld zu beweisen, so setzte er dennoch unermüdlich seine Angriffe fort in der Hoffnung, endlich seinen Gegner zu ermüden und zu veranlassen, das Land zu verlassen.
Grandier war jedoch ein nicht zu unterschätzender Feind, was sich besonders bei Gelegenheit eines Prozesses erwies, den das Kapitel des Heiligen Kreuzes gegen ihn angestrengt hatte, dessen geistiger Urheber jedoch Mignon war. Das Kapitel wurde verurteilt und die Folge davon war, daß der neue Beichtvater der Ursulinerinnen viel von seinem Ansehen einbüßte. Seit diesem Tage kannte seine Erbitterung gegen Grandier keine Grenzen mehr. Mit Anstrengung seines ganzen Scharfsinns wußte er seinem Gegner immer neue Schwierigkeiten in den Weg zu legen, er hetzte einen Teil seiner Familie gegen ihn und ließ ihn sogar von einem seiner Onkel namens Barol, einem reichen kinderlosen Greise, gröblich beleidigen. So war der Mann, an den Jeanne des Anges sich gewandt, um den alten Moussaut zu ersetzen. Wie man sieht, konnte sie keine Wahl treffen, die für Grandier unangenehmer gewesen wäre.
Einige Monate nach diesem Ereignisse wurde Jeanne des Anges, die sich schon seit einiger Zeit in einem Zustande vollständiger Anämie befand, der Raub einer heftigen Nervenkrisis. Sie hatte ihre Phantasie so sehr durch das Lesen gewisser mystischer Bücher überreizt, daß sie wirkliche Halluzinationen hatte. Anfangs war es der alte Beichtvater des Klosters, der ihr in der Nacht erschien und sie aufforderte, für die Ruhe seiner Seele zu beten. Sehr bald aber nahm Grandier dessen Stelle ein – Grandier – den sie zu jener Zeit persönlich noch nicht kannte, mit dem sich jedoch ihre Gedanken schon lange ausschließlich beschäftigten. Er nahte sich ihr im Glanze einer bezaubernden Schönheit: »Er sprach mit ihr von Liebe, überhäufte sie mit ebenso unkeuschen wie beleidigenden Zärtlichkeiten und bedrängte sie, ihm das zu bewilligen, was zu verschenken ihr nicht mehr gestattet war, seit sie sich dem Himmelsbräutigam, durch ihr Gelübde angetraut hatte.«
Diese Erscheinungen hatten derartige ernste Störungen des Nervensystems bei Jeanne verursacht, daß ihr ganzes, von dem Bilde Grandiers erfülltes Leid nur noch ein Schrei der Wollust war.
Endlich empfand sie dennoch eine gewisse Scham über ihre Schwäche, und sie erzählte einigen ihrer Gefährtinnen von den nächtlichen Erscheinungen ihrer irregeleiteten Einbildungskraft, vergaß jedoch niemals hinzuzufügen, daß sie stets allen Anfechtungen des Versuchers tapfer standgehalten habe. Man legte sich in dem Kloster strenge Fasten auf und verdoppelte die Gebetstunden, um die Oberin von solch unkeuschen Erscheinungen zu befreien: mehrere Nonnen, Schwester Jeanne an ihrer Spitze, griffen zur Geißel und unterwarfen sich schweren Selbstzüchtigungen. Diese widernatürliche Disziplin, deren Zweck es ist, das Fleisch zu töten, um den Geist zu stärken, brachte ihr organisches Leben ganz aus dem Gleichgewicht und zeitigte bald genug die übelsten Folgen. Nach Verlauf von wenigen Tagen klagten mehrere Nonnen über nächtliche Erscheinungen und Anfechtungen.
Zur selben Zeit teilte Jeanne des Anges ihrem Beichtvater Mignon den Namen des Mannes mit, der ihr nachts erschien und sie zur Sünde verleiten wollte. Der brave Beichtvater erkannte sofort, welchen Nutzen er aus dieser seltsamen Erscheinung ziehen könne. Weit entfernt davon, sein Beichtkind zu beruhigen, suchte er sie vielmehr in der Idee zu bestärken, daß sie dem Satan verfallen sei, und er wußte es durch seine beängstigenden Einflüsterungen bald dahin zu bringen, daß die Furcht vor Geistern der vor den höllischen Dämonen wich.
Gleichzeitig benachrichtigte Mignon den Staatsanwalt, sowie die hauptsächlichsten Feinde Grandiers von dem, was vorging.
Alle, die von der seltsamen Neuigkeit hörten, waren der Ansicht, daß diese ganze Affäre eine ganz außerordentliche Aehnlichkeit mit der jenes Gaufridis habe, der Pfarrer in Marseille gewesen, und den man lebendig verbrannt hatte, weil er Magdalene de la Paul behext habe. Man meinte, daß bei einiger Geschicklichkeit und schlauer Benutzung der eigentümlichen Umstände diese Geschichte sehr wohl geeignet sei, den Feind in das Verderben zu stürzen. Man kam daher dahin überein, daß Mignon fortfahren solle, Jeanne des Anges, sowie die andern Nonnen glauben zu machen, daß sie von einem bösen Dämon besessen seien, daß in dieser Besessenheit allein der Ursprung ihrer Halluzinationen und nervösen Leiden zu suchen sei, und daß, wenn man Herr darüber werden wolle, es durchaus notwendig sei, eine Teufelsbeschwörung vorzunehmen.
Nachdem man sich über diesen Plan geeinigt hatte, wandte sich Mignon an die Karmelitermönche, sowie an einen Fanatiker namens Barre, Pfarrer der St. Jacqueskirche von Chinon, um ihm bei der schweren Aufgabe der Teufelsaustreibung beizustehen.
Nachdem dann all die Unglücklichen gehörig abgerichtet worden und man ihnen genau eingetrichtert hatte, wie sie sich nach dem Rituell zu benehmen hätten, verbreitete man in der Stadt die Nachricht, daß die Nonnen verzaubert und vom Teufel besessen seien.
Von diesem Augenblicke an herrschte im Kloster eine tolle Furcht. Die seltsamen Zeremonien der Teufelsaustreibung – man hatte tagelang damit verbracht, den bösen Feind zu beschwören, damit er aus dem Körper der angeblich Besessenen weiche – gaben der Gesundheit Jeannes des Anges den letzten Stoß, sie wurde von heftigen Krampfanfällen heimgesucht. Ihre Gefährtinnen, die Zeuginnen dieses schrecklichen Schauspieles waren, glaubten, daß Jeanne immer noch von dem Teufel besessen sei; sie verloren vollständig den Kopf, und von Schrecken gepackt, dabei von dem Wirbel erotischer Gedanken erfüllt, die die Reden ihrer Oberin in ihnen erweckt, brach eine nach der andern zusammen und wurde von ebensolchen Krämpfen und Delirien erfaßt.
Grandier indessen – dessen Namen während der Teufelsbeschwörungen auch keinen Augenblick von Jeannes Lippen gekommen war – blieb nicht müßig. Von seinen Feinden angeklagt, Unheil über das Kloster gebracht zu haben, und sehr wohl verstehend, in welchen Abgrund man ihn stürzen wollte, wandte er sich entschlossen an den Amtmann von Loudun, einen Mann von anerkannter Rechtschaffenheit und von bestem Rufe, und bat ihn dringend, für Privathaft und für Trennung der Nonnen Sorge zu tragen. Aber obwohl der Amtmann den offiziellen Befehl dazu gab, gelang es ihm doch nicht, die Teufelsbeschwörer zum Gehorsam zu zwingen, und um einen Konflikt zwischen der geistlichen und der weltlichen Autorität zu vermeiden, ersuchte er Grandier, sich direkt an seinen Bischof zu wenden.
Zu jener Zeit war der bischöfliche Stuhl von Poitiers durch Heinrich Ludwig Chasteigner de la Rochepozay besetzt. Geboren am 6. Sept. 1557 zu Tivoli und am 30. Juli 1651 auf seinem Schlosse Dissais an einem Sohlaganfall gestorben. Er war ein leichtsinniger und jähzorniger Prälat, »böser wie der Teufel«, und von den Bewohnern Poitiers verachtet, weil er während der Unruhen von 1614 sich nicht gescheut hatte, auf sie schießen zu lassen. »Es sind zweihundert Familien außerhalb der Stadt, die nicht darin zurück können, weil sie dem von Eurer Majestät geschickten Gouverneur treu geblieben und dafür von diesem Bischof, der böser wie der Teufel ist, mit Flintenschüssen bedroht worden sind. Möge Eure Majestät verfügen, daß sie in ihre Häuser zurückkehren dürfen. Ich verlange Gerechtigkeit gegen die unerhörte Frechheit dieser Priester.« Brief Heinrich II. von Bourbon an Maria von Medicis. Geschichte der Prinzen von Condé.
Der Pfarrer von St. Pierre hatte schon einmal Zwist mit dieser traurigen Persönlichkeit gehabt und auf deren Befehl eine strenge Haft in den Kerkern des Bischofssitzes erdulden müssen. Er hatte zwei Monate gefangen darin geschmachtet, und als er dann die Freiheit erhielt, wurde er dazu verurteilt, jeden Freitag bei Wasser und Brot zu fasten, während voller fünf Jahre nicht in der Diözese Poitiers, und niemals in der Stadt Loudun die Messe lesen zu dürfen. Aber der Erzbischof von Bordeaux, Heinrich d'Escoubleau de Sourdis, hatte dieses Urteil nicht bestätigt, sondern Grandier vollständige Absolution gewährt, worauf dieser triumphierend und mit einem Lorbeerzweig in. der Hand wieder nach Loudun eingezogen war.
Wie leicht begreiflich, war dieser Erfolg keineswegs dazu angetan, um ihn in der Gunst Herrn de la Rochepozays zu befestigen, und als der Pfarrer eine Audienz bei ihm erbat, um sich wegen der Verleumdungen, die während der Teufelsbeschwörungen gegen ihn verbreitet worden, zu rechtfertigen, wurde ihm diese abgeschlagen.
Grandier wandte sich deshalb abermals an den Erzbischof von Bordeaux und übersandte ihm eine beredte Bittschrift. Der Prälat schickte seinen Leibarzt nach Loudun, und dieser erklärte, daß die Nonnen keineswegs Besessene seien; dann verbot der Erzbischof Mignon und seinen Genossen ihre Teufelsbeschwörungen und verhängte endlich die Privathaft über die Nonnen, die Grandier und der Magistrat bisher vergeblich gefordert hatten.
Solche weisen Maßregeln machten den Krampfanfallen und Zuckungen der Nonnen wie mit einem Zauberschlage ein Ende, und während einiger Monate erschien – wenigstens äußerlich – die Ruhe des Klosters ungestört.
Indessen war es mit dem Ansehen, dessen die Ursulinerinnen im Lande genossen, vollständig vorbei, man sprach nur noch mit verächtlicher Gleichgültigkeit von ihnen. Man holte so schnell wie möglich die jungen Mädchen der Stadt, die man der Erziehung der Ursulinerinnen anvertraut hatte, aus dem Pensionate zurück. Ihre Eltern wollten nach all diesen skandalösen Vorfällen nichts mehr von den Ursulinerinnen wissen und verweigerten sogar, ihnen die bescheidene Rente zu zahlen, die man ihnen bisher gewährt hatte. Die unglücklichen Frauen waren sehr bald dem äußersten Elend preisgegeben; sie mußten, um nur ihr Leben fristen zu können, die mühsamsten Handarbeiten herstellen, da ihnen alle andern Hilfsquellen abgeschnitten waren. »Es ist ganz gewiß« – so heißt es in einem Bericht, den Richelieu über die Lage der Ursulinerinnen machte – »daß sie von aller Welt verlassen und ebenso von allen Menschen verachtet wurden.«
Infolge dieser traurigen Lage versank Jeanne des Anges in die tiefste Melancholie. Es ist wahr, daß infolge der weisen Maßnahmen Herrn von Sourdis, der Mignon den Spuk der Teufelsbeschwörungen vollständig untersagte, ihre Krampfanfälle ganz aufhörten, aber ihre Gesundheit verschlechterte sich auffallend. Sie litt an Nasenbluten und Bluterbrechen, das manchmal dreißig bis vierzig Stunden andauerte und sich in keiner Weise stillen ließ. Die Blutarmut, an der sie infolge des starken Blutverlustes litt, verdoppelte ihre Halluzinationen, und mehr als je wurde sie von dem Bilde Grandiers verfolgt. Außerdem wurde sie von unzüchtigen Versuchungen gequält, und zwar in einer Weise, die geradezu entsetzlich war. Ihre Gefährtinnen wurden von demselben Uebel erfaßt. Es war ein klägliches Schauspiel, diese Unglücklichen wie brünstige Weiber Tag und Nacht durch die Alleen ihres Gartens irren zu sehen und sie laut nach diesem einen Manne rufen zu hören, dessen Bild sie bezauberte.
»Ganz im Banne dieses Zaubers waren sie von einer heftigen Leidenschaft für Grandier erfüllt, einer sündigen, sinn- und schrankenlosen Leidenschaft, deren die Hölle selbst (da Gott es zuläßt), sich zuweilen gegen die unschuldigsten Personen bedient. Sie dachten nur noch an ihn, den sie nicht einmal von Angesicht kannten, sie verlangten nur nach ihm, und es geschah zuweilen, daß, wenn sie ihn überall gesucht, vergebens das Gartenhaus, den Speicher durchforscht und nach ihm geseufzt hatten, ihre überreizte Phantasie ihnen seine verklärte Erscheinung vorgaukelte ... etc.«
So war die Lage des Klosters, als in Loudun der Staatsrat Jean Martin de Laubardemont ankam, der auf Befehl des Königs die Festungswerke des Schlosses schleifen sollte.
Dieser Mann, der sich mit vollem Rechte eines höchst bedenklichen Rufes erfreute, hatte sich bei verschiedenen Gelegenheiten durch seinen Eifer und seine Tätigkeit bemerkbar gemacht. Geschickt und schlau, ohne jede religiöse Ueberzeugung und Skrupel, strebte er nur danach, sich dem Meistbietenden zu verkaufen; so hatte er die Gunst des ersten Ministers zu erlangen gewußt. Von ihm stammt das berühmte zynische Wort, durch das er sein Glück gemacht: »Gebt mir zwei schriftliche Zeilen eines Mannes, das genügt mir, um ihn an den Galgen zu bringen.« Sein unermüdliches Genie für das Böse sollte in Loudun reiche Gelegenheit sich zu entwickeln finden.
Als naher Verwandter der Jeanne des Anges und als Schwager der Damen Dampierre, die beide dem Orden der Ursulinerinnen angehörten, Laubardemont hatte Eleonore Therese Pouret geheiratet, eine Tochter David Fourets, Baron de Dampierre und der Helene Chasteigner. hatte Laubardemont nichts Eiligeres zu tun, als ihnen seinen Besuch zu machen. Er fand das Kloster noch vollständig außer Fassung, unter der Nachwirkung der Ereignisse, die sich vor einigen Monaten dort zugetragen hatten. Ganz gerührt von ihrer traurigen Lage, versprach der Staatsrat ihnen zu Hilfe zu kommen und sich zu diesem Zwecke mit dem Kardinal Richelieu in Verbindung zu setzen.
Gleichzeitig hatte Laubardemont sich beeilt, die Feinde Grandiers aufzusuchen. Er hatte von ihnen erfahren, daß der Pfarrer von Saint-Pierre in der Frage der Schleifung des Schlosses ein Gegner des allmächtigen Ministers sei, und, was mehr bedeutete, daß er der bisher unbekannte Autor eines gewissen Pamphlets sei, das unter dem Titel: »Brief der Schustersfrau von Loudun an Herrn von Barradas,« verbreitet worden war.
Nachdem seine Mission beendet war, kehrte der Staatsrat nach Paris zurück. Er erzählte Richelieu alles, was er gesehen und gehört hatte. Der Kardinal glaubte nicht an die Teufel von Loudun, aber er hatte es nicht vergessen, daß er früher einmal mit Grandier in Streit über den Vorrang geraten war. Als er erfuhr, daß dieser Priester sich der Ausführung seines Befehles widersetzte, und mehr noch, daß er eine verrufene Flugschrift geschrieben habe, zögerte er keinen Augenblick, den Entschluß zu fassen, ihn zu verderben und sich in schrecklichster Weise an ihm zu rächen.
Auf seinen Befehl kehrte Laubardemont nach Loudun zurück und ließ Grandier verhaften. Sofort stürzte sich eine Legion von Teufelsbeschwörern auf das Kloster, und dank der Manöver dieser Fanatiker wurden die armen Ursulinerinnen bald wieder eine Beute des bösen Dämons. Alle Tage beschäftigte man sich in verschiedenen Kirchen der Stadt damit, ihnen den Teufel auszutreiben. Vor allem andern aber machte sich Jeanne des Anges bemerkbar, sowohl durch die Heftigkeit ihrer Krampfanfälle, als durch die Obszönität ihrer Sprache und ihrer zynischen Gebärden.
Natürlich verfehlte dieses traurige und schreckliche Schauspiel, das alle Tage in den Kirchen von Loudun öffentlich aufgeführt wurde, nicht, eine Menge Neugieriger herbeizuziehen. Die gesunde Vernunft empört sich bei der Erzählung dieser extravaganten und entwürdigenden Szenen, die sich während der Prozedur der Teufelsbeschwörungen – sie dauerten monatelang – immer wieder abspielten. Man würde all dies nicht für möglich halten, wenn nicht der ganze Hergang in den umfangreichen Prozeßakten niedergelegt wäre, die meistens von Laubardemont selbst verfaßt sind. Die ungeregeltsten, wildesten Gebilde der Einbildungskraft würden doch niemals die Wahrheit erreichen können. Die Feder sträubt sich, die zynischen Akte niederzuschreiben, an die sich Jeanne des Anges und ihre Gefährtinnen gewöhnt, und die obszönen Anträge zu wiederholen, die sie unaufhörlich machten. Es waren Orgien sinnlicher Wut und unkeuschen Geschreis, zu deren Zeugen Laubardemont und die Teufelsbeschwörer, seine würdigen Helfershelfer, sich nicht entblödeten, die jungen Mädchen der Stadt zu machen. –
So lange diese empörenden Vorgänge dauerten, war von seiten der Regierung das Spionieren und Verleumden zur Tagesordnung geworden, und wenn die Mönche selbst von der Kanzel herab sich mit Angebereien beschäftigten, so hielten sie dies für ihre Pflicht, ja sogar für eine Tugend. Der Magistrat der Stadt, der Amtmann an der Spitze, der sich keines Unrechts bewußt war, sondern seine Pflicht auf das treuste erfüllt hatte, wurde gezwungen zu schweigen; man beunruhigte und klagte ihn sogar selbst der Magie an. Laubardemont war die verdammte Seele dieser unheimlichen Farce, in der die unglücklichen, an Halluzinationen leidenden Nonnen die Hauptrolle spielten. Er hielt die Fäden des Spieles in Händen und ließ die Puppen tanzen, so wie es ihm beliebte. Wo es sich darum handelte, die Absichten seines Herrn durchzusetzen, da schreckte er vor keinem Manöver zurück. Er fühlte sich erhaben über jedes Schamgefühl. Er wählte selbst mit größter Sorgfalt die Justizbeamten, aus denen die Kommission gebildet wurde, die über Grandier zu Gericht zu sitzen bestimmt war, aber all diese Männer hatten sich im voraus dadurch verkauft, daß sie die ungeheuerliche, ihnen von Laubardemont und den Mönchen oktroyierte Lehre anerkannten: »daß der böse Geist durch die Exorzitien gezwungen sei, die Wahrheit zu sagen.« Man begreift sehr wohl, daß von diesem Augenblick an jeder durch den Alpdruck des Scheiterhaufens beunruhigt wurde.
Der unglückliche Grandier, den man eines eingebildeten Verbrechens beschuldigte, machte durch die Würde seiner Haltung all seine früheren Fehler vergessen. Er erscheint uns von jetzt an nur noch wie ein von vorne herein verdammtes Opfer, dessen ungeheueres Unglück unser volles Mitleid beansprucht. Als man ihn den sogenannten Besessenen gegenüberstellte, die sich laut schreiend in Krämpfen auf dem Boden wälzten, begegnete er ihren unsinnigen Anklagen mit unwandelbarer würdiger Ruhe und beteuerte seine Unschuld.
Es war alles vergebens. Der Teufel hatte ihn durch den Mund dieser unter dem Bann von Halluzinationen stehenden Frauen angeklagt, und das war untrüglich. Obwohl es Grandier gelang, sein Alibi nachzuweisen und ebenfalls zu beweisen, daß er die Nonnen niemals gesehen, wurden doch die Denunziationen dieser kranken Mädchen als Ausdruck reinster Wahrheit angenommen. Am 18. August 1634, um 5 Uhr morgens, verurteilte die Kommission unter Laubardemonts Vorsitz den unglücklichen Pfarrer dazu, noch an demselben Tage lebendig verbrannt zu werden. Er wurde sofort in die Folterkammer geführt, wo man ihn der entsetzlichen Marter der spanischen Stiefel unterwarf. Zwei Mönche, die ehrwürdigen Väter Tranquillus und Lactantius, schlugen selbst die scharfen Keile mit Hammerschlägen ein und zerbrachen die Beine des Unglücklichen, der sich von einer bewunderungswürdigen Ruhe und wahrem Heldenmute erwies. Darauf begleiteten sie ihn im Namen und zu Ehren der Religion der Liebe und des Vergebens auf den Marktplatz, wo der Scheiterhaufen errichtet war. Dort angekommen, verhinderten sie den Henker, wie dies sonst üblich war, die Qualen des Verurteilten durch Erdrosselung abzukürzen, und legten das Feuer an den Scheiterhaufen.
Diese entsetzliche Hinrichtung machte jedoch dem Zustande der Besessenen kein Ende; im Gegenteile. Einige Zeit nachher traten bei Jeanne des Anges, die nun unter andern Halluzinationen litt, höchst befremdende Erscheinungen zutage. Isaakaaron, der Dämon der Unzucht, der in sie gefahren und Besitz von ihr genommen hatte, erschien ihr während der Nacht und suggerierte ihr den Wahn daß sie schwanger sei. Von diesem Augenblicke an wurde diese Illusion bei ihr so vollständig, daß sie alle verschiedenen Empfindungen, die die Schwangerschaft mit sich bringt, so genau schilderte, als ob sie sie wirklich empfände. Sobald sich diese Nachricht in der Stadt verbreitete, schütteten die Hugenotten die ganze Schale ihres Spottes über Jeanne des Anges und ihre Teufelsbeschwörer aus.
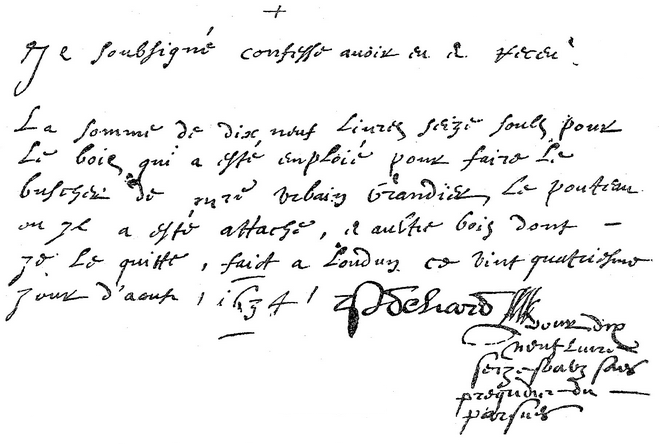
Rechnung des Henkers für Holz und Scheiterhaufenpfahl bei der Hinrichtung Urbain Grandiers, 24. Aug. 1634.
Der Skandal war ein derartiger, daß Laubardemont gezwungen war, einzugreifen und den Kardinal von Richelieu von diesem Ereignisse zu benachrichtigen. »Es ist wirklich eine höchst seltsame Sache,« schrieb er, »aber es läßt sich nicht leugnen, daß alle bei ihr zutage tretenden Erscheinungen auf eine Schwangerschaft deuten. Ihr ist fortgesetzt sehr übel zumute, sie erbricht sich oft, klagt über Magenschmerzen, die Menstruation ist seit drei Monaten ausgeblieben, und aus ihren Brüsten scheidet eine weiße milchartige Flüssigkeit.« Da er fürchtete, nicht recht verstanden zu sein, kam er noch einmal mit einer gewissen Dringlichkeit auf den Zustand Jeannes des Anges zurück, drückte sich aber diesmal in der lateinischen Sprache aus und zwar folgendermaßen: »Illa nimirum a tribus mensibus patiebatur menstrui sanguinis moram importunam cujus congerie uterus intumescebat et ejusdem refluxu serositas admomum lactis albicans e mammis stillabat continue, quasi foetum ista portenderent.« Über den Zustand der Ursulinerinnen. Bericht an Richelieu. Der Kardinal hätte in der Tat über dem Euphemismus, den sein Agent anwendete, um zu sagen, daß bei Jeanne die Regel drei Monate lang ausgeblieben sei, irregeführt werden können.
Diese durch Teufelsblendwerk verursachte Schwangerschaft versetzte Laubardemont in größte Verlegenheit. In einer so wichtigen Angelegenheit hielt er es doch für durchaus notwendig, das Urteil der Aerzte in Anspruch zu nehmen. »Zu diesem Zwecke,« so sagt er in seinem Bericht an den Kardinal, »ließ ich Herrn du Chesne aus Mans kommen, der einer der bedeutendsten Vertreter der ärztlichen Fakultät ist.«
Jeanne des Anges war nicht weniger beunruhigt. Ihr neuer Zustand versetzte sie in die größte Aufregung, und sie beunruhigte und ängstigte sich besonders darum, was man in Loudun dazu sagen würde. Fortwährend unter dem Banne von Halluzinationen, sah sie »eine menschliche Gestalt, die ihr darlegte, daß selbst die milddenkendsten Leute niemals an ihre Unschuld glauben würden, und daß sie Gegenstand der Verachtung und des Abscheus ihres ganzen Ordens und besonders dieses Hauses sein würde.« Um allen übeln Nachreden zu entgehen, faßte sie in ihrem hysterisch überreizten Gehirn einen unsinnigen Entschluß. Sie beschloß zu sterben. Zu diesem Zwecke wußte sie sich Drogen zu verschaffen und bereitete sich abtreibende Getränke. Aber die Furcht, daß das kleine Geschöpf, welches sie in ihrem Schoße zu tragen glaubte, dadurch ein Raub der Hölle würde, hielt sie von diesem Vorhaben ab; sie beschloß, sich des unheilvollen Trankes, den sie gebraut, nicht zu bedienen, und schüttete ihn fort.
Es kam ihr darauf ein anderer Einfall, den sie selbst später für diabolischen Ursprungs hielt; sie wollte sich den Bauch an der Seite aufschneiden, das Kind herausziehen und es taufen, weil sie glaubte, dadurch sein Seelenheil zu retten. Da sie sich jedoch bewußt war, daß sie durch diese Operation ihr Leben gefährden könne, beschloß sie, vorher zu beichten, »ohne jedoch,« wie sie sagte, »ihrem Beichtvater von ihrem Plan Mitteilung zu machen.« Am Morgen des 2. Januar 1635 spielte sich dann ein Drama ab, von dem man kaum weiß, ob das burleske oder das mystische Element das vorherrschende war. Schwester Jeanne, die jetzt fest entschlossen war, der Sache ein Ende zu machen, zog sich in ein kleines Kabinett zurück, indem sie in der einen Hand ein großes Messer, in der andern eine mit Wasser gefüllte Vase trug, um das Kind zu taufen. Ehe sie jedoch ihr furchtbares Vorhaben ausführte, warf sie sich zu Füßen des Kruzifixes und bat Gott in inbrünstigem Gebete, »meinen und den Tod dieses kleinen Geschöpfes zu vergeben für den Fall, daß durch meine Tat sein und mein Leben zugrunde gehen sollte, denn ich war fest entschlossen, das Kind zu ersticken, nachdem ich es getauft haben würde«. Nachdem sie diese religiösen Vorbereitungen getroffen, entkleidete sie sich, jedoch nicht ohne dabei fortwährend von einer gewissen Furcht geplagt zu werden, daß, wenn sie während ihrer Tat sterben sollte, sie der ewigen Verdammnis anheimfallen würde; indessen war diese Angst doch nicht stark genug, um sie von der Ausführung ihres schrecklichen Planes zurückzuhalten. »Sie machte zuerst mit einer Schere einen großen Schnitt in ihr Hemd, ergriff dann das Messer und fing an, es sich zwischen die beiden dem Magen zunächstliegenden Rippen zu stoßen, mit dem festen Vorsatz, ihren Plan bis zum Ende durchzuführen.« – Diesesmal aber war es doch zuviel für ihr überhitztes Hirn, sie verlor die Besinnung, und die Szene endete ohne ernsten Blutverlust mit einem sehr heftigen hysterischen Anfall.
Unterdessen war der berühmte Arzt, den man aus Mans berufen hatte, in Loudun angekommen. Einem formellen Befehle Laubardemonts sich beugend, mußte Jeanne des Anges sich dem Besuche und der Untersuchung des Arztes unterwerfen. Aber trotz all seines Wissens ließ auch Chesne, wie alle andern, sich durch den äußern Anschein täuschen und konstatierte, daß Jeanne sich sogar schon in einem ziemlich weit vorgeschrittenen Zustand der Schwangerschaft befinde, übrigens wird der Teil ihrer Biographie, der dieses Ereignis behandelt, uns erklären, daß es kaum anders der Fall sein konnte. Erst in den allerletzten Jahren ist die Frage der eingebildeten hysterischen Schwangerschaft ernstlich studiert worden.
Vor dem Urteil des Arztes mußte Laubardemont sich natürlich beugen. Nur durch ein Wunder konnte Jeanne des Anges aus dieser völlig unerklärlichen Lage gerettet werden. Der Agent Richelieus war sich dieser Tatsache voll bewußt, und er wandte sich daher an die Teufelsaustreiber, die mit den gewöhnlichen Zeremonien den Dämon beschworen, »sein eignes Werk nun auch selbst zu zerstören,« was dieser auch tat. Jeanne bekam ein heftiges, langandauerndes Bluterbrechen, das sich zwei- oder dreimal wiederholte, worauf alle auf eine Schwangerschaft deutenden Anzeichen verschwunden waren.
Dieses Wunder ereignete sich in Gegenwart von Herrn du Chesne, der im höchsten Grade erstaunt und tief erschüttert davon war.
Einige Tage später kehrte der berühmte Arzt in seine Heimat in Mans zurück, um aller Welt von den seltsamen Erscheinungen zu erzählen, deren Schauplatz die Stadt Loudun geworden.
Trotz des kläglichen Zustandes ihrer Gesundheit dachte jedoch Jeanne des Anges an die traurige Lage ihres Klosters. Um dieser ein Ende zu machen, wandte sie sich an Laubardemont, ihren Verwandten und Schützer. Dieser, der sehr bereit war, ihr zu Hilfe zu kommen, schrieb dem Kardinal in folgenden Ausdrücken: »Die Mutter Priorin hat mir gesagt, daß zweitausend Franken jährlich für sie hinreichen würden, um sich und ihre Korporation ehrlich zu erhalten. Man brauchte also nur ungefähr fünfhundert Taler aufzubringen, um sie aus dem äußersten Elend zu ziehen
Richelieu beeilte sich, diese Bitte zu erfüllen und beauftragte Herrn de Bulion, Claude de Bulion, Herr von Bonelles, Finanzrat und Staatsminister und Siegelbewahrer des Königs; er starb am 22. Dezember 1640. die nötigen Mittel zum Unterhalte der Nonnen nach Loudun gelangen zu lassen. Bis zu dem Tode des Kardinals wurden diese zweitausend Franken den Ursulinerinnen auch treulich ausbezahlt. Laubardemont begnügte sich übrigens nicht damit, seinem Schützling gefällig zu sein, er verletzte das Eigentumsrecht, bemächtigte sich mit bewaffneter Hand des Kollegs der Protestanten und installierte dann die Ursulinerinnen darin.
Während dieser ganzen Zeit jedoch mehrten sich die Fälle der Besessenheit trotz der Teufelsbeschwörungen der Kapuziner und Barfüßler, die schon halb verrückt waren von der unausgesetzten Ausübung eines solchen Geschäftes, das sich ins Unabsehbare hinzuziehen drohte. Laubardemont, der unzufrieden mit den Teufelsbeschwörern war, beschloß, sie abzudanken und durch andere zu ersetzen. Diesesmal wandte er sich an die Jesuiten, in der Hoffnung, daß es ihrer wohlbekannten Schlauheit und Geschicklichkeit gelingen würde, die in tiefen Mißkredit gekommene Besessenheit wieder etwas im Ansehen zu heben. Auf sein Ersuchen kamen am 20. Dezember 1634 die Patres Surin, Rosseau, Anginot und Bachellerie nach Loudun, um gleich am andern Morgen, dem St. Thomastage, ihres Amtes zu walten. Der königliche Kommissar hatte sich nicht geirrt. Mit den Neuangekommenen nahm die Besessenheit abermals einen Aufschwung und trat sehr bald in eine neue Phase, in die Phase der Wunder.
Der Jesuit, der damit beauftragt wurde, die Teufelsbeschwörung bei Jeanne des Anges vorzunehmen, hieß Pater Jean-Joseph Surin. Er war damals 34 Jahre alt. Er war ein sogenannter Illuminat (Erleuchteter), und wie wir beweisen werden, ausgesprochen hysterisch. Eine solche Wahl erschien seltsam, und sie vollzog sich nicht ohne Schwierigkeiten. Es bedurfte in der Tat des ganzen Einflusses des Orden-Provinzialen Arnauld Boyre, um von dem Abt des Klosters von Marennes, in dem sich der Pater Surin befand, die Erlaubnis zu erhalten, ihn zum Exorzisten zu machen. Keiner eignete sich weniger zu diesem Amte. »Er war schon seit mehreren Jahren schwer leidend und erduldete körperliche und seelische Schmerzen, die ihn fast unfähig zu jeder Art von Arbeit machten. Er hatte einen so schwachen Körper, daß er sich nicht ernstlich mit etwas beschäftigen konnte, ohne große Schmerzen zu empfinden, und er war ebenso unfähig zu jeder Lektüre, da er unausgesetzt von Kopfschmerzen geplagt wurde. Diese Qualen hatten in den letzten Jahren so sehr zugenommen, daß seine Seele davon verdunkelt und bedrückt erschien, und seine körperlichen Leiden nahmen derartig überhand, daß er glaubte, es sei unmöglich, in diesem Zustande lange zu leben.«
So also war der Mann, dem Jeanne des Anges anvertraut wurde. Zwei Monate schon nach der Ankunft dieser mystischen und blutarmen Persönlichkeit verdoppelte sich die Zahl ihrer Nervenkrisen und Halluzinationen. Der Jesuit, der selbst von einem erotischen Delirium besessen und heftigen hysterischen Krisen unterworfen war, Es war am Karfreitag im Hause der Nonnen, daß er zum ersten Male von einer schweren Nervenkrisis heimgesucht wurde. Der Dämon hatte dem Pater schon einige Tage vorher gedroht, daß ihm eine Passionszeit bevorstehe; und in der Tat ließ er ihn während der ganzen Karwoche schwer leiden. Als er sich nach dem Frühstück zurückgezogen hatte, fühlte er plötzlich heftige Herzschmerzen, die so stark wurden, daß sie ihn der Gewalt über seine Glieder beraubten und er mit Händen und Füßen um sich schlug, Zuckungen bekam, sich wie ein Besessener auf dem Boden wälzte. Außerdem war der Pater Surin unausgesetzt unkeuschen Versuchungen ausgesetzt, die Isaakaaron, der Dämon Schwester Jeannes, in ihm erregte. ließ ihr Tag und Nacht keine Ruhe. Er zwang sie, sich vollständig nackt vor ihn zu stellen und unter dem Vorwande, Isaakaaron, den Dämon der Unkeuschheit, von dem sie besessen sei, auszutreiben, befahl er ihr, sich selbst zu geißeln. Jeanne führte die Befehle dieses Halluzinierten gehorsam aus. Uebrigens erklärte sie jedesmal nachher, »nichts von der Geißelung empfunden zu haben, auch nichts zu wissen von allem, was sie gesagt und getan. Nur eine ganz unklare Erinnerung sei ihr geblieben, daß sie sich ausgekleidet und wieder angezogen habe.«
Wir verzichten darauf, Näheres über die extravaganten und unzüchtigen Handlungen mitzuteilen, die diese beiden Hysterischen vornahmen. Das Gesagte genügt für unsern Zweck. Die Jesuiten haben übrigens durch, die Herausgabe der nachgelassenen Schriften Pater Surins dafür gesorgt, daß der Hergang dieser traurigen Extravaganzen festgestellt ist, und wir verweisen daher diejenigen unserer Leser, die mehr davon zu wissen wünschen, auf dieses Buch. Bisher ungedruckte Briefe des Paters Surin, Paris 1845, Verlag Paul Mellier, Lyon. Geistiger Führer zur Vollkommenheit, Paris 1828, Verlag der katholischen Gesellschaft des Sacré-Coeur. Triumph der göttlichen Liebe, Avignon 1828, Verlag von Leguin senior.
Was aber auch immer geschehen sein mag, ganz gewiß ist, daß der Skandal ein solcher wurde, daß der Provinzial von Guienne gezwungen war, diesen Teufelaustreiber der Jeanne des Anges nach Bordeaux zurück zu berufen. Es war die höchste Zeit, denn der Unglückliche hatte bei dem traurigen Amte, womit man ihn betraut, den letzten Rest seines Verstandes eingebüßt.
Ein andrer Jesuit, der Pater Ressès (Antonius) wurde bestimmt, sein Nachfolger zu werden, und in seinem ungeduldigen Wunsche, sich vor seinem ganzen Kollegium auszuzeichnen, debütierte er mit einem Meisterstücke: er bewirkte die wunderbare Heilung Jeannes des Anges.
Seit man die Oberin der Ursulinerinnen den Händen Pater Surins anvertraut, hatte ihre Gesundheit ernstlich gelitten. Sie teilte ihrem neuen Teufelsbeschwörer ihre Leiden mit, dieser aber, von schönem Eifer ergriffen, nahm keine Rücksicht auf das, was sie ihm sagte, »wie das seine Vorgänger zu tun die Gewohnheit hatten«, und bestand darauf, daß sie sich sofort seinen Prüfungen zu unterwerfen habe. Außerdem »hatte der fromme Vater große Lust, sofort eine Teufelsaustreibung vorzunehmen, da er an diesem Tage eine auserwählte Gesellschaft bei sich sah. Er machte sich also gleich an die Arbeit, die derartig ausfiel, daß Jeanne in heftiges Fieber verfiel und eine Brustfellentzündung bekam.«
Der Arzt Fanton, an dessen Wissen sich zu wenden man sich denn doch unter solchen Umständen entschloß, zögerte nicht, die heftigen Schmerzen, die Schwester Jeanne in der Seite empfand, für »Zeichen einer Rippenfellentzündung zu erklären.« Sein Irrtum läßt sich bis zu einem gewissen Punkte erklären und entschuldigen, da die schöne Entdeckung der Auskultation der Lungen erst zu Anfang dieses Jahrhunderts gemacht wurde. Aber was sich schwerer entschuldigen und erklären läßt, das ist die Behandlungsweise, der dieser Arzt seine Patientin unterwarf. Freilich war es eine Manie jener Zeit, unter allen Umständen den Kranken zur Ader zu lassen, und dieses Manöver hat Fanton in der Zeit von vierzehn Tagen zehnmal bei seiner Patientin ausgeführt. Das Resultat dieser Behandlungsweise ließ denn auch nicht auf sich warten. Jeanne des Anges bekam wieder Nervenanfälle und hatte Halluzinationen. Sie verfiel in einen solchen Schwächezustand, daß auf das Drängen der Unterpriorin Fanton an Laubardemont schreiben mußte, um ihm Mitteilung über den beunruhigenden Zustand zu machen, in dem sich Jeanne befand.
Während dieser Zeit verbreiteten die Teufelsbeschwörer das Gerücht, daß die Oberin der Ursulinerinnen in den letzten Zügen liege, und sie beschlossen, ihr die letzte Oelung zu geben. Die Patres Ressès und Bastide vollzogen diese heilige Handlung. »Sie empfing das heilige Sakrament mit größter Andacht und Ergebung, obwohl sie sich im Zustande äußerster Schwäche befand. Kurz darauf trat die Agonie ein; ihr Gesicht veränderte sich und wies alle Zeichen des Todes auf; sie stieß zwei tiefe Todesseufzer aus, und man erwartete, daß sie mit dem dritten und letzten ihre Seele aushauchen würde. Statt dessen geschah etwas völlig Unerwartetes. Die Sterbende verwandelte sich plötzlich und richtete sich auf und nahm ohne jede Hilfe eine sitzende Stellung ein; dann, als erscheine ihr eine wunderbare Vision, blickte sie mit weitgeöffneten Augen himmelwärts und ihr Gesicht nahm einen verzückten Ausdruck an, der es wunderbar verschönte und verklärte.«
Nachdem die Vision entschwunden, erklärte Jeanne des Anges, daß sie jetzt vollständig geheilt sei. Groß war das Erstaunen des Arztes, als er am andern Morgen (am 7. Februar 1637) in das Kloster kam, um nach seiner Patientin zu sehen, und als ihm diese, von zwei Nonnen geführt, schon auf der Treppe entgegenkam, um ihm ihre wunderbare Heilung zu verkünden. Der heilige Joseph, so erklärte sie, sei ihr in der Nacht erschienen und habe ein feines Oel in der Hand gehabt, dessen Duft von unbeschreiblicher Lieblichkeit gewesen. Er habe es ihr dargereicht, es aber nicht selbst auflegen wollen, um ihre wohl bekannte Keuschheit zu schonen. Der Schutzengel Schwester Jeannes war nicht so skrupulös, er rieb ihre schmerzende Seite mit dem Oele ein, und in demselben Augenblicke fühlte sie eine große Erleichterung. Als Beweis ihrer wunderbaren Erzählung zeigte sie Fanton, der ganz verdutzt dastand, fünf Tropfen des wunderbaren Heilmittels, die auf ihr Hemd geträufelt waren.
Der Arzt glaubte, daß man sich über ihn lustig machen wolle, er erklärte den Nonnen, daß er in Zukunft darauf verzichte, sie zu behandeln, und zog sich wütend zurück.
Nach zwei Tagen erinnerte sich Jeanne des Anges der wunderbaren Oelung, durch die sie geheilt worden und die sie nur mit ihrem Hemde abgewischt hatte. Sie berief die Mutter Unterpriorin zu sich und bat sie, ihre Seite zu untersuchen und zu sehen, woraus diese Oelung bestand. Sie schloßen sich ein, und als die Oberin sich entkleidet hatte, atmeten sie beide einen wunderbar köstlichen Duft ein, der Jeannes Hemd entströmte; sie fanden die Zeichen des göttlichen Oeles darin, das fünf große Flecken hinterlassen hatte. Die ehrwürdige Mutter beschloß sogleich, dieses Hemd aufzuheben; sie nahm ein anderes und schnitt das Hemd, in dem sich in Taillenhöhe die köstlich duftenden Tropfen befanden, in zwei Stücke. Der untere Teil wurde weggeworfen und der obere sorgfältig bewahrt. Man hätte gern den obern Teil dieses Hemdes gewaschen, aber man fürchtete, dadurch die fünf kostbaren Tropfen zu verlieren, die einen so wunderbaren Duft verbreiteten, und die unter allen Umständen unversehrt bleiben mußten. Endlich kamen sie auf den Einfall, einen Faden um die köstlichen Flecken zu ziehen, um genau ihren Platz zu merken, dann einen Faden darum zu binden und mit diesem das kostbare Stück hoch aufzustecken. Auf diese Weise seiften und wuschen sie die herabhängenden Reste des Hemdes, ohne den die wunderbaren Tropfen enthaltenden Teil zu berühren. Aus den Memoiren des Paters Surin.
Wir dürfen nicht vergessen, hier ein Detail hinzuzufügen, das wirklich von einiger Wichtigkeit ist. Jeanne des Anges exzellierte, wie schon früher angedeutet, in der Kunst, Salben und wohlriechende Essenzen zu bereiten, und sie verbrachte stets einen Teil ihrer Zeit damit, solche herzustellen.
Den fünf Tropfen, die der heilige Joseph gerade zur rechten Zeit beschert hatte, verdankte man bald eine ganze Menge der wunderbarsten Heilungen. Die Frau von Laubardemont, die damals in Tours gefährlich krank lag, dazu hoch schwanger war, war die erste, die ihre segenbringende Wirkung erfahren, sollte. Ihr Gatte, der immer praktisch war, gab den Befehl, das wundertätige Hemd sofort nach Tours zu bringen. Kaum hatte man es auf den Bauch der Kranken gelegt, als ein glückliches Uebereintreffen der Umstände es mit sich brachte, daß sie von heftigen Wehen erfaßt wurde und ein totes Kind gebar, das nach dem Ausspruch der Aerzte schon seit sieben bis acht Tagen gestorben war.

Wie Satan mit seinen Kindern Feste feiert.
Von diesem Augenblicke an pilgerten alle schwangeren Frauen nach Loudun, um das Oel des heiligen Joseph zu berühren, und Wunder folgte auf Wunder, aus dem ausgezeichneten Grunde, weil es im ganzen doch ziemlich selten ist, daß eine Geburt unheilvolle Folgen nach sich zieht.
Wir dürfen übrigens, um der Wahrheit die Ehre zu geben, nicht verschweigen, daß es nicht nur schwangere Frauen waren, die durch die Berührung dieses wundertätigen Hemdes geheilt wurden. Eine Nonne aus dem Orden Fontrevault, Madame de Saint-Aubin, die an einem seltsamen Geschwüre am Bein litt, erlangte ebenfalls die volle Genesung durch die gläubige Berührung der Tropfen St. Josephs. –
Der Provinzial von Paris, der Jesuit Jacquinot, war so begeistert von der Wirkung dieses Wunderbalsams, daß er – wohlverstanden, ohne den geringsten Beweis für seine Behauptungen beizubringen – soweit ging, dem Jesuitengeneral nach Rom zu schreiben: »Ich habe gesehen, daß Blinde sehend wurden, und daß Gelähmte wieder gingen.« Aber die wunderbarste und phantastischste aller Heilungen war jedenfalls die, welche sich} in der guten Stadt Saumur ereignete.
Dort lebte eine dem Ursulinerorden angehörige Nonne, die schon seit mehreren Jahren im Krankenhause war, da sie an einer großen Reihe der seltsamsten Uebel litt; sie wurde geheilt, nachdem sie ein Stückchen Papier verschlungen, mit dem man vorher die heiligen Oeltropfen berührt hatte. Ihre Heilung war eine so vollständige, daß jedem offenbar werden mußte, daß hier ein göttliches Werk vollbracht sei.
Nachdem sie einmal den Weg der Wunder betreten, kannte Jeanne des Anges kein Zurück mehr.
Die Rückkehr Pater Surins nach Loudun – er war zwei Jahre von dort abwesend gewesen – hatte nicht wenig dazu beigetragen, diese wunderbaren Resultate zu erzielen.
Am 15. Oktober 1637 beschloß dieser hysterische, immer kranke und unter dem Banne von Halluzinationen stehende Mönch, den Behemot, einen der Teufel, der mit Isaakaaron in Jeanne des Anges gefahren sei, auszutreiben, und als Zeichen, daß diese Austreibung wirklich gelungen sei, befahl er dem Dämon, die Namen Jesus, Maria, Joseph und Franz von Sales auf die Hand der Mutter Priorin zu schreiben. Behemot, den man zur rechten Zeit von dem benachrichtigt hatte, was man von ihm erwartete, hütete sich wohl, ungehorsam zu sein. Es war am Tage der heiligen Therese, daß alle, die der Messe beigewohnt, zu ihrem höchsten Erstaunen sich mit ihren eigenen Augen davon überzeugen konnten, daß diese Namen wirklich auf der linken Hand Jeannes des Anges imprägniert waren.
Man begreift, daß dieses neue Wunder im ganzen Königreiche lebhaft besprochen wurde. Jeanne des Anges, die, wie die meisten Hysterischen, sehr eitel war, hielt den Augenblick für gekommen, um die Situation auszunützen und sich sehen zu lassen. Zu diesem Zwecke redete sie ihrem Teufelsbeschwörer vor, daß sie immer noch von einem bösen Geiste besessen sei, und daß dieser letzte Dämon nur an dem Grabe des heiligen Franz von Sales aus ihr weichen würde. Mit oder ohne Willen mußte er sie nach Annecy führen. Zu ihrer außerordentlichen Befriedigung fuhr man aber nicht direkt dahin, sondern machte den Umweg über Paris, wo Laubardemont ihr während der ganzen Dauer ihres Aufenthaltes die umfassendste Gastfreundschaft erwies.
Der Staatsrat verband einen besonderen Plan damit, als er Surin veranlaßte, mit Jeanne des Anges einen solchen Umweg zu machen. Richelieu lag damals krank in seinem Schlosse Ruel. Er hatte eine Geschwulst am Arme, an der er furchtbar litt. Juif, seinem Chirurgen, und Citoys, seinem Arzte, war es nicht gelungen, ihm einige Erleichterung zu verschaffen. Außerdem aber litt der Kardinal sehr stark an Hämorrhoiden. Um sich von diesem Leiden zu befreien, das so heftig war, daß er ganz hypochondrisch davon wurde, hatte er mit großem Pompe die Reliquien des heiligen Fiacre von Meaux kommen lassen. Zu jener Zeit war allgemein der Glauben verbreitet, daß diese Reliquien die Macht besäßen, an Hämorrhoiden leidende Kranke zu heilen. Aber der Kardinal befand sich offenbar nicht im Zustand der Gnade, denn selbst die Auflegung der Reliquien auf den kranken Körperteil blieb ganz wirkungslos.
An dem Hofe und in Paris sang man Spottlieder, in denen in grober und zynischer Weise die mystisch-religiösen Fantasien des Kardinals verhöhnt wurden, ja, man ging sogar so weit, Verse zu veröffentlichen, deren Inhalt so obszön war, daß man sie kaum wiedergeben kann.
Es war gerade dieser Mißerfolg mit den Reliquien des heiligen Fiacre, der Laubardemont veranlaßte, den Kardinal zu bestimmen, einen Versuch mit den wunderbaren Eigenschaften des Oeles des heiligen Joseph zu machen. Der Brief des Paters Jacquinot an den Jesuitengeneral in Rom über die durch die einfache Berührung damit erzielten Heilungen hatte etwas so Ueberzeugendes, daß der Staatsrat glaubte, unter allen Umständen das Abenteuer wagen zu müssen. Er sagte sich mit Recht, daß, wenn dieses Unternehmen glücken sollte, Richelieu nicht ermangeln würde, ihm seine Dankbarkeit zu erweisen, und daß er ihn mit neuen Wohltaten überhäufen würde. Dies war der Grund, weshalb er Jeanne des Anges mit auf das Schloß von Ruel nahm. Der Kardinal war an dem Tage ihrer Ankunft sehr leidend und hatte sich zu Bett legen müssen. Trotz seines leidenden Zustandes hatte er sich jedoch beeilt, den fremden Besuchern eine Audienz zu gewähren. Jeanne des Anges und Laubardemont wurden gegen alle Regeln der Etikette sofort in sein Zimmer eingelassen. Nachdem die Mutter Priorin sich seinem Bette genähert und seinen Segen empfangen hatte, überreichte sie ihm das Stück des Hemdes, auf dem sich die vielbesprochenen heiligen Oelflecken befanden. Als er es sah, wurde er von tiefer Ehrfurcht und Rührung ergriffen, denn schon ehe er es mit seinen Händen berühren konnte, erkannte er trotz seiner Krankheit die Echtheit des Stückes, atmete tiefbefriedigt den ihm entströmenden köstlichen Duft ein, küßte es zweimal und sagte: »Wie köstlich es duftet!« – Dann bat er, ein zu Häupten seines Bettes befindliches Reliquienkästchen damit zu berühren. Und während er »dieses Hemd voll Verehrung und Bewunderung in den Händen hielt,« erzählte Jeanne des Anges ihm die Geschichte ihrer wunderbaren Heilung.
Unglücklicherweise war aber die Krankheit des Kardinals keine solche, die sich durch Reliquien heilen ließ: der heilige Joseph war nicht glücklicher als der heilige Fiacre. Die Geschichte erzählt uns, daß Richelieu bis zu seinem Tode weder von der Geschwulst seines Armes, noch von seinen Hämorrhoiden befreit wurde.
Um jedoch Jeanne des Anges die Befriedigung zu bezeugen, die ihr Besuch ihm verschaffte, machte er ihr ein Geschenk von fünfhundert Talern und beauftragte einen Edelmann aus seinem Gefolge, sie während der Dauer ihrer Pilgerschaft zu begleiten und Sorge dafür zu tragen, daß ihr nichts abgehe. –
Der Erzbischof von Sens, Octave de Saint-Lavy de Bellegarde, ihr Onkel, Ein Halbbruder von Charlotte Goumart, der Mutter Jeannes des Anges. empfing sie mit derselben Güte, und der Kommandant de Sillery, der beim Anblick der Stigmata, die Jeannes linke Hand zierten, ganz starr vor Staunen war, stellte ihr seinen Wagen zur Verfügung, um sie nach Annecy zu bringen.
Als der König und die Königin die Anwesenheit der berühmten Nonne und die Nachricht ihrer bald bevorstehenden Abreise nach Annecy erfuhren, beauftragten sie Laubardemont, Jeanne zu ihnen nach Saint-Germain zu führen.
Anna von Oesterreich war zu jener Zeit im sechsten Monate ihrer Schwangerschaft. Jeanne des Anges benutzte diesen Umstand, um ihr die Oeltropfen des heiligen Joseph zu zeigen. Die Königin atmete »mit Entzücken« ihren wunderbaren Duft ein, und in ihrem Enthusiasmus nahm sie der Mutter Priorin das feierliche Versprechen ab, nach Saint-Germain zurückzukehren, sobald sie ihren Besuch an dem Grabe des Bischofs von Genf ausgeführt haben würde, damit, so fügte sie hinzu, »in der Stunde der Gefahr das gebenedeite Hemd in ihrer Nähe sein könne.« Ms. des Paters Surin.
So erfreute sich also Frankreich nun des eigentümlichen Schauspieles, eine Nonne von Ort zu Ort ziehen zu sehen, um ihre Stigmata und ihr parfümiertes Hemd zur Schau zu stellen. Nachdem sie ihre Pilgerschaft vollendet, die Jeanne des Anges in ihren Memoiren ausführlich beschreibt, kehrte sie nach zwei Monaten wieder nach Saint-Germain zurück, wo man sie mit Ungeduld erwartet hatte. Sie war kaum im Schlosse angekommen, als Anna von Oesterreich, die schon in der Nacht heftige Geburtswehen gehabt, dringend danach verlangte, daß man ihr das berühmte Hemd auflege. Dies geschah denn auch, und dank dieses Wundermittels wurde genau um elf Uhr morgens die Gemahlin Ludwig XIII. glücklich entbunden. Am 5. September 1638. Und der heilige Joseph erwies bei dieser Gelegenheit einmal wieder seine ganze Macht, indem er nicht nur der Königin eine glückliche Niederkunft verschaffte, sondern auch Frankreich einen König schenkte, der eine unvergleichliche Macht auszuüben bestimmt war, der reich an Geistesgaben war, eine bewunderungswürdige Klugheit besaß und dabei – – ebenso fromm wie sittenrein war.
In demselben Palaste, wo eine Königin von Frankreich das Beispiel lächerlichsten Aberglaubens gab, spotteten und lachten die Ehrendamen ganz offen über solche Scherze. und die Höflinge benützten sie als Motiv zu den beißendsten Epigrammen.
Aber das Hemd der Jeanne des Anges war und blieb darum doch heilig! Nachdem der königliche Stempel darauf gedrückt worden, und nachdem ihm die außerordentliche Ehre zuteil geworden, die Haut der Königin berühren zu dürfen, war es selbstredend, daß es fortfuhr, Wunder zu vollbringen, und daß es dem Orden der Ursulinerinnen in Loudun zahllose Wohltaten einbrachte. Schwester Jeanne des Anges wußte diese Situation während der siebenundzwanzig Jahre, die sie noch lebte, sehr geschickt auszunützen.
Ihre lange Abwesenheit war für ihr Kloster auch noch in andrer Weise sehr nützlich und segensreich gewesen, denn nicht nur daß sich die Kasse wieder füllte, genossen die Ursulinerinnen auch, nachdem sie dem aufregenden Einflusse ihrer Oberin entrückt waren, endlich einmal wieder eine relativ höchst schätzenswerte Ruhe.
Das Ende des Jahres 1638 machte der Besessenheit in Loudun ein Ende. Tatsache ist, daß zwei der Exorzisten, nämlich die Patres Lactantius und Tranquillus darüber wahnsinnig geworden und gestorben sind. Dem Zivilleutnant Louis Chauvel und einem Chirurgen René Mannoury erging es ebenso, und nicht zu zählen sind diejenigen, deren Verstand ernstlich darunter gelitten hat.
Von diesem Zeitpunkte an wurde sowohl die geistliche, wie die weltliche Leitung des Klosters der Sorge des Domherren de Moran, als des Stellvertreters des Bischofs von Poitiers vertraut. Dieser neue Beichtvater, der ein ziemlich gewöhnlicher, unwissender und bornierter Mensch war, scheint keinen großen Einfluß auf den Charakter Jeannes des Anges ausgeübt zu haben. Außerdem war er beinahe gelähmt, da er sehr von Rheumatismus gequält wurde und kaum imstande war, seinen kirchlichen Obliegenheiten nachzukommen. Da er schon ein paar Monate später starb, beschäftigte man sich damit, einen geschickteren Nachfolger für ihn zu finden; die Wahl des Bischofs von Poitiers fiel auf einen Jesuiten, den Pater Saint-Jure. Saint-Jure (Jean Baptiste) geboren in Metz 1588 und gestorben in Paris am 30. April 1657. Er war ein ernster, kalter Charakter, dessen Gesicht einen asketischen Ausdruck hatte, und der ganz vollgepfropft von mystischen Ideen war. Er brachte eine ganze wohl ausgewählte Bibliothek von schwerverständlichen theologischen Schriften mit nach Loudun.
Von dem Tage an, daß dieser Jesuit seines Amtes waltete, erfuhr der Charakter Jeannes des Anges eine vollständige Umwandlung. Sie erscheint von einer Menge religiöser Skrupel bewegt und erfüllt mit größtem Eifer alle kleinen Pflichten der Frömmigkeit. Aber nicht nur, daß sich ihr Gesichtskreis nun; immer mehr verengt, sie fühlt sich auch mehr als je von Zweifeln geplagt. Gegen die Regel, und dank der Befürwortung des Bischofs von Poitiers. hatte man sie abermals zur Priorin des Klosters erwählt. Diese Frau, die früher die Welt so sehr geliebt hatte, daß sie ganze Tage im Sprechzimmer verbrachte, legte nun ihren Gefährtinnen eine außerordentlich strenge Regel auf. Oft und bitter bereuten, es die armen Schwestern, daß sie dieser alten hysterischen Büßerin ihre Stimme gegeben hatten.
Trotz alledem wurde Jeanne des Anges unausgesetzt von unreinen Halluzinationen geplagt, aber auch ihr guter Engel erschien ihr von Zeit zu Zeit, um ihre Stigmata zu erneuern. Ihr religiöser Wahnsinn nahm eine erotisch mystische Richtung an, und da sie nicht mehr das Bild eines Mannes wie Grandier oder selbst nur wie Pater Surin vor Augen hatte, sondern nur mit dem Jesuiten Saint-Jure, diesem eiskalten gemessenen Theologen verkehrte, bildete sie sich, dem Beispiel der heiligen Theresa folgend, ein, daß Jesus Christus in ihr wieder geboren sei.
Aber selbst jetzt noch gewann von Zeit zu Zeit ihre sinnliche Natur die Oberhand, und so sehen wir, wie diese alternde Frau, um Herr über den Dämon der Fleischeslust zu werden, sich vergebens geißelt und »sich auf Dornen und glühenden Kohlen wälzt, ohne Erleichterung zu finden«.
Während dieser ganzen Periode – nämlich von 1646 bis 1657 – entspinnen sich zwischen ihr und ihrem Beichtvater theologisch-mystische Gespräche, die jedoch heute nur noch ein relatives Interesse haben und in denen sie sich sehr besorgt um das Heil ihrer Seele zeigt. Um diese Zeit nahmen die hysterischen Zustände, unter denen Jeanne litt, endlich eine etwas mildere Gestalt an, wie dies in einem gewissen Alter bei derartigen Kranken stets der Fall ist. Die körperlichen Erscheinungen verlieren nach und nach ihren krampfhaften Charakter. Indessen hat die Erkrankung ihrer Nerven bei ihr so tiefe Wurzel gefaßt, daß sie sich körperlich durch die Stigmata und geistig durch fortgesetzte Halluzinationen kundgibt, die zwar in gewissem Sinne modifizierter sind, aber noch mystischer und geheimnisvoller erscheinen.
In dieser Zeit erinnerte sie sich der Lehren des Pater Surin und setzte sich in direkte Verbindung mit Jesus Christus. »Eine Verbindung, die Jesus selbst herstellt, indem er sich ganz mit einer Seele vereinigt und sie mit seinem göttlichen Wesen erfüllt. Dies geschieht durch eine körperliche Berührung, die eine heiße Liebe entfacht und der Seele nicht nur durch den Glauben, sondern auch durch die Erfahrung kundtut, was Gott ist.«
Die Wirkung, die durch eine solche göttliche Liebe erzielt wird, ist eine solche Liebe, daß die Seele sich nur schwer von ihrem Himmelsbräutigam trennen kann, so daß sie sagt:
»Wenn ich gläubig mich ihm nahe,
Die als Braut er sich erlesen,
Fühl ich ganz mich ihm vereinigt,
Völlig eins mit Jesu Wesen,
Das mein Herz mit Wonne füllet.«
Jeanne des Anges sieht also Jesum, der sich ihr in seiner ganzen großen Schönheit zeigt und sich ihr gegenüber sehr verliebt erweist: »speciosus prae filiis hominum«, und er spricht folgendermaßen zu ihr: »Betrachte mit Muße meine Schönheit, und möge dir dieser Anblick dazu dienen, niemals den Anblick vergänglicher Dinge zu ersehnen, weil alles vorübergeht, ich aber bleibe in Ewigkeit. Ich bin derjenige, der wirklich ist: alles übrige ist nichts. Es gefällt mir, in den Seelen meiner Auserkorenen zu wohnen, die keine andre Stütze als in mir haben ... Ich werde dich lieben wie meine Tochter und meine Gattin. Das ist die Lehre, die ich dir gebe, über die du viel nachdenken sollst. Du mußt dich zwingen, in meiner Gegenwart alle andern Gedanken zu unterdrücken und an mich, nur an mich zu denken und dich stets daran zu erinnern, daß ich allein es verdiene, dein Herz zu besitzen. Ich bin eifersüchtig auf dich, teile mich mit niemand und blicke oft auf meine Schönheit.« Einige wunderbare Details aus dem Leben der Mutter Jeanne des Anges, von Pater Surin.
Aber neben diesen ganz bestimmten Halluzinationen, die bald durch die geistreichen Briefe Pater Surins, bald durch die mystischen Unterhaltungen mit ihrem Beichtvater hervorgerufen wurden, genügte die geringste Veranlassung, auch noch andre hervorzurufen.
Als am 30. April 1657 der Jesuit Saint-Jure gestorben war, beschwört die Schwester ihn, ihr in einer ihrer Halluzinationen zu erscheinen, und erfährt von ihm, »daß er sich großen Ruhmes erfreue, weil er stets mit Eifer gestrebt habe, die Menschwerdung unsres Herrn Jesus Christus durch Worte und Schriften der Welt bekannt und lieb zu machen, und daß er deshalb rasch wie ein Blitz durch das Fegefeuer geglitten sei –«
Von diesem Tage an beginnt das peinliche Schauspiel des geistigen Verfalles dieser Frau, die, wenn sie auch eine mangelhafte Bildung genossen, doch wenigstens einen leuchtenden Geist hatte und eine starke Einbildungskraft besaß, deren treuen Widerschein wir in ihren Halluzinationen finden.
Selbst diese beginnen von jetzt an einen langweiligen und banalen Charakter zu tragen, und Jeanne des Anges, die fortwährend von der Furcht vor der ewigen Verdammnis verfolgt ist, ruft die Seelen der vor kurzem gestorbenen Schwestern des heiligen Augustin an »und bittet sie, Fürsprache für sie einzulegen und ihre Vermittler vor Gott zu sein.«
Bis zum Juli 1661 trägt sie immer noch die Stigmata zur Schau, aber durch eine letzte hysterische Anstrengung von Autosuggestion gelingt es ihr, sich dann davon zu befreien. Sie ist es doch endlich müde geworden, der unausgesetzte Gegenstand der Neugierde von seiten der Fremden zu sein, die fortwährend in Loudun zusammenströmen.
In dieser Zeit verliert Jeanne des Anges allmählich alle physische und moralische Kraft. Sie kann nicht mehr schreiben. Der letzte von ihr geschriebene Brief, den wir besitzen, trägt das Datum des 8. Mai 1661. Ihre ganze rechte Seite ist gelähmt. Wie die meisten Gelähmten verfällt sie in vollständige Nervenschwäche und stirbt am 29. Januar 1665 an einer Lungenentzündung.
Am 21. April desselben Jahres starb auch Pater Surin, der wie sie schwer unter verschiedenen Krankheiten leiden mußte.
Die letzten Tage des unglücklichen Jesuiten waren nicht glücklich gewesen. Wie Jeanne des Anges dies auch getan, hatte er sich immer mit Selbstmordgedanken herumgetragen. Der Versuch, den er machte, sich das Leben zu nehmen, hatte sehr üble Folgen. Er stürzte sich zum Fenster hinaus, zerbrach den Schädelknochen und blieb davon lahm.
Da sein nervöser Zustand ihn ganz unausstehlich machte, suchten die Jesuiten sich seiner zu entledigen und brachten ihn eine Zeitlang in einem befreundeten Hause unter. »Da seine Schwäche so sehr zugenommen hatte, daß er weder gehen, noch sich in irgend einer Weise allein helfen konnte, war man genötigt, ihm eine Wärterin zu geben, die ihn pflegen und ihm beistehen sollte. Diese Person nun, die wahrscheinlich von dem Geiste des Bösen getrieben wurde, schien einen wahren Haß gegen den Pater zu nähren, und obgleich dieser ihr nicht die kleinste Veranlassung dazu gab, mißhandelte sie ihn nicht nur mit Worten, sondern vergriff sich auch tätlich an ihm, und zwar mit einer Grausamkeit, die uns wahrhaft schaudern macht. Sie traktierte ihn unerbittlich mit Faustschlägen und Ohrfeigen und ging oft so weit, ihn mit einem Stocke wütend auf das Gesicht und den Kopf zu schlagen. Man kann nicht leugnen,« fügt Boudon naiverweise hinzu, »daß dieses Vorgehen allerdings ein etwas ungewöhnliches war.«
Nach dem Tode Jeannes des Anges vergaßen die Ursulinerinnen sehr rasch des Grolls, den sie in den letzten Jahren gegen ihre Oberin gehegt hatten, und dachten nur daran, sich schöne Einnahmen zu verschaffen, indem sie aufs neue die Leichtgläubigkeit des Publikums ausbeuteten. Zu diesem Zwecke wußten sie das Gerücht zu verbreiten, daß ihre Oberin als Heilige gestorben sei. Sie legten ihren Kopf in einen prachtvollen Reliquienschrein und stellten ihn der Verehrung der Gläubigen aus. Nicht zufrieden mit dieser Schaustellung, beschafften sie sich ein die letzte Teufelsbeschwörung ihrer Priorin darstellendes Gemälde und wiesen diesem einen hervorragenden Platz in ihrer Kapelle an. Dumoustier de Lafond, der dieses Gemälde gesehen hat, gibt uns davon folgende Beschreibung: »Man sieht Jeanne des Anges mit einer Stola um den Hals in Extase vor dem Pater Surin knien, der die Exorzismen mit ihr vornimmt. Der Herzog von Orléans, die Herzogin, seine Gemahlin, der Kapuzinermönch Pater Tranquillus und der Barfüßler Pater Thomas sind als Zuschauer dieser Zeremonie dargestellt. Der heilige Joseph mit einem Heiligenschein und von Seraphin und Cherubin umgeben ist als Erscheinung gedacht. Der Heilige hält drei Donnerkeile in der Hand, kraft derer er eine Menge von Teufeln und Teufelchen aus dem Munde der Nonne treibt. Im Hintergrunde des Bildes sieht man ein Fenster, durch das viel Volk der Zeremonie zuschaut.« Essays aus der Geschichte der Stadt Loudun. II. Teil S. 31-32.
Dieser schmachvolle Handel dauerte bis zum Jahre 1750. Zu dieser Zeit kam ein Bischof von Poitiers, Herr de Caussade de la Marthome, auf einer kirchlichen Inspektionsreise nach Loudun, der mit vollem Rechte dieses Bild derartig skandalös fand, daß er den Befehl erteilte, es sofort zu entfernen. Aber die frommen Schwestern hüteten sich, ihm Gehorsam zu leisten, und wußten einen Ausweg zu finden, indem sie ein Christusbild, dessen Rahmen größer war und das das anstoßerregende Gemälde völlig deckte, darüber hingen.
Von diesem Augenblicke an ging es rückwärts mit den Geschäften der Ursulinerinnen. Der Eifer der Pilger erlahmte, und die Almosen verringerten sich von Tag zu Tag. Außerdem machte ihnen das neu eröffnete Pensionat der »Damen der christlichen Gemeinschaft« scharfe Konkurrenz und raubte ihnen die wenigen Pensionärinnen, die ihnen bisher treu geblieben waren. Aus dem Briefe Jouyneau-Desloges, der im Journal von Poitiers am 23. Brumaire des Jahres XII erschienen ist.
Sie waren gezwungen, Schulden zu machen, und wurden hart von ihren Gläubigern bedrängt. Da sie allgemein verachtet und auch in der Tat verachtungswürdig waren, appellierten sie vergebens an das Solidaritätsgefühl der andern Ursulinerklöster. Man würdigte ihre Bittschreiben nicht einmal einer Antwort, und niemand kam ihnen zu Hilfe. Der Bischof von Poitiers, Herr de Beaupoil de Saint-Anlair, dem man von diesen Vorgängen Mitteilung machte, und der so rasch wie möglich solch skandalösen Zuständen ein Ende zu machen wünschte, griff zu einem durchgreifenden Mittel, er löste nämlich die Kongregation der Ursulinerimien einfach auf und verteilte die Nonnen in verschiedene andere Klöster. Es ist wahrscheinlich, daß das Kloster der Damen der Christlichen Gemeinschaft einige der Ursulinerinnen als Pensionärinnen aufgenommen hat, wenigstens scheint dies aus den Akten des städtischen Archivs von Loudun hervorzugehen. In diesen Akten wird die Beerdigung der Schwester Jeanne de Linacier bestätigt, einer Nonne, die vormals der Genossenschaft der Ursulinerinnen angehört und seit deren Aufhebung als Pensionärin bei den Damen der Christlichen Gemeinschaft gelebt habe.
Ihr Mobiliar wurde versteigert, ihre andern Güter den Damen der Heimsuchung Mariä und denen der Christlichen Gemeinschaft zur Verfügung gestellt, unter der Bedingung, daß sie dafür die Schulden, mit denen die Ursulinerinnen überlastet waren, bezahlen sollten.
Außerdem wurde den letzteren das Kloster der Ursulinerinnen eingeräumt, und sie haben bis zum Jahre 1789 darin gewohnt. Seit dem Jahre 1789 hat das alte Kloster der Ursulinerinnen in Loudun verschiedene Male die Eigentümer gewechselt. Im Jahre 1886 wurden mehrere Haushaltungen darin geführt. Die Kapelle war in einen Schuppen verwandelt, in dem ein Bäcker das Holz bewahrte. Dies in der Straße Abreuvoir liegende Gebäude trägt die Nr. 10. Wahrscheinlich war es im Laufe der Jahre von 1772–1782 gewesen, daß sie dem Mutterhause in Tours das hier vorliegende Manuskript liehen oder auch ganz überließen.
Und die Reliquien, wird man fragen, die berühmten Reliquien? Was ist aus denen geworden? Unglücklicherweise sind alle Nachforschungen, die wir über deren Verbleib angestellt haben, vollständig resultatlos geblieben. Das Haupt dieser Hysterischen, vor dem sich mehr als ein Jahrhundert lang eine unwissende und abergläubische Menge anbetend geneigt hat, ist vollständig verschwunden oder wird vielleicht auch in einem religiösen Frauengemach verborgen gehalten. Auch das wunderbare Hemd, durch das so viele Wunder vollbracht wurden und das dem Jesuiten Jacquinot den überraschenden Ausdruck entlockte: »Coeci vident, claudi ambulant,« ist und bleibt spurlos verschwunden. Was das die Exorzismen Jeannes des Anges darstellende Bild betrifft, so wissen wir, daß die Ursulinerinnen, um zu verhüten, daß es an den Meistbietenden verkauft werde, es einem Domherren des heiligen Kreuzes von Loudon gaben, dem Herrn Duchesne-Duperron. Von der Zeit an blieb es verschollen, und man hat niemals erfahren, was daraus geworden ist. Es ist sehr wahrscheinlich, daß die Ursulinerinnen den Kopf und das Hemd Jeannes des Anges in derselben Weise verschwinden ließen.
Es bedurfte kaum des Sturmes der Revolution, um den Ruf des Wunders zu zerstören, der der Besessenheit Jeannes des Anges anhaftete. Die Legende davon hat schwer unter der allgemeinen Verachtung gelitten. Und heute? Was ist davon geblieben? Eine Erinnerung – – – aber was für eine??