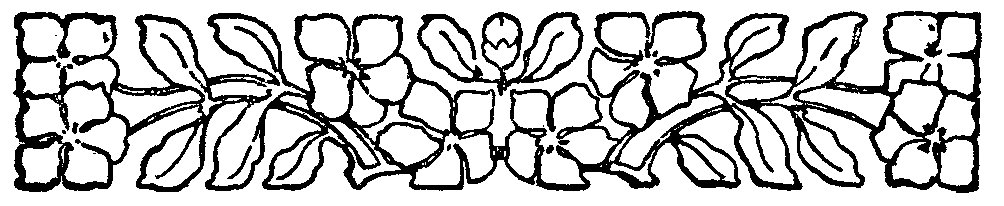|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Nichts schrecklicher kann dem Menschen geschehen,
Als das Absurde verkörpert zu sehen! –
Lasset walten, lasset gelten,
Was sich wunderlich verkündigt!
Dürftet ihr die Guten schelten,
Die mit ihrer« Zeit gesündigt.
Goethe.
Korona Schröter hatte an dem Abend in Tiefurt, als sie – erschüttert von jener Begegnung im Park – mit Einsiedel zu Tische saß, ihrem treuen Verehrer das Versprechen völliger Offenheit über ihre Vergangenheit gegeben.
Vertrauensvoll wollte sie ihm endlich die Gründe darlegen, welche sie hinderten, sein Liebeswerben anzunehmen. Es ward ihr sichtlich schwer, seinem Flehen und Drängen um Aussprache zu willfahren, aber sein Zweifeln an ihrer Empfindung für ihn, seine trübe Klage über seinen Unwert, seine ungenügende Begabung, Stellung, Besitz – für sie, die er so hoch hielt – rührten ihr Herz tief.
Die schöne Sängerin saß wenige Tage später, den Freund erwartend, bang und niedergeschlagen in ihrem Zimmer; das siegreiche Auge gesenkt, die Wange bleich, war sie mit den im Schoß gefalteten Händen kein Bild glücklicher Liebe.
Vor ihr stand die dicke, kleine Freundin, ihr, wie so oft schon, vergeblich Trost zusprechend.
»Es muß sein; und wenn er alles weiß, wird es besser mit mir werden!« seufzte Korona. »Sorge dich nicht um mich, Minchen, ich muß es überstehen! Und laß uns allein, wenn er kommt, denn was wir in dieser Stunde miteinander ausringen, darf niemand, auch das treueste Freundesherz nicht, teilen.«
Bald darauf hörten sie Einsiedels Schritt auf dem Hausflur. Wilhelmine sprang hin, ihm zu öffnen, und schlüpfte dann, mit einem traurigen Blick auf die Freundin, hinaus.
Korona erhob sich und streckte dem Kommenden die Hand entgegen; ihre Glieder bebten, und sie mußte sich niedersetzen, um nicht hinzusinken.
Er eilte auf sie zu, preßte ihre Hand an Lippen und Herz und sah sie mit dem warmen Blick besorgter Liebe an.
»Wie bleich, Korona!« flüsterte er; bewegt aber fuhr er fort: »Was werden Sie mir Großes, Trennendes zu sagen haben? O, ich schwöre Ihnen im voraus: ich nehme es mit jedem Feinde, jedem Hindernisse auf! Sobald ich nur weiß, um was es sich handelt, bin ich zur Tat bereit.«
»Ich danke Ihnen für diesen Enthusiasmus der Liebe, der Ihrer still-träumerischen Art seltsam, aber herzbestrickend läßt. Armer Freund! Sie und ›Er‹, welch ein ungleicher Kampf. Armes, unschuldiges, vertrauendes Kind, möchte ich sagen, wenn ich Sie mir ihm gegenüber denke!«
»Korona! Schonen Sie mein männliches Selbstgefühl und sprechen Sie es endlich aus: wer dieser ›Er‹, dieser Gewaltige, Unbezwingliche, Ihr Herr und Tyrann, der Spender jener unheimlichen Sammetschleife ist? Und was er Ihnen ist?«
»Wir sind zu diesem Zwecke heute beisammen,« erwiderte sie mit dem tiefsten Ernst. »Was er mir ist? O, Einsiedel! – Er ist – mein Gemahl!«
Sie sank zurück und bedeckte ihr Gesicht mit den Händen.
»Korona!« schrie er auf, »Sie, Sie vermählt? Das also ist jenes Hindernis! – Schrecklich!« –
Er ging mit starken Schritten in dem kleinen Zimmer auf und ab und trat wieder vor sie hin. Ihr mit sanfter Gewalt die Hände von den tränenfeuchten Augen nehmend, sah er sie liebevoll an und bat: »Erzählen Sie mir alles; sagen Sie mir, wie Sie ihm verbunden wurden und wer er ist?«
»Ja,« entgegnete sie, sich aufraffend, »das Furchtbare ist ausgesprochen, es wird mich erleichtern, alles erklären, Ihnen aus tiefster Seele beichten zu können.«
Er setzte sich zu ihr, nahm dann und wann ihre Hand und lauschte mit ganzer Hingabe ihren Worten. Korona hub an: »Als ich zwölf Jahre alt war, kam ich mit Eltern und Geschwistern nach Leipzig und sang ein paar Jahre darauf in den großen Konzerten. Der treffliche Kapellmeister Hiller bildete mich aus, und ich lebte von ganzem Herzen in der Musik. Ich mußte mich anstrengen, denn ich sah eine hochbegabte, alles verdunkelnde Rivalin mit mir um die Gunst des Publikums ringen; Sie wissen, wen ich meine: Demoiselle Schmehling, die jetzige Frau Mara. Dieser Ansporn, Tüchtiges zu leisten, erhob mich und bewahrte mich vor Tändeleien. Ich hatte nur Herz und Sinn für das eine: groß zu werden in meiner Kunst!
Mein Vater fand ein anderes günstiges Engagement und zog mit der Familie fort, ich blieb, für die Konzerte angestellt, in Leipzig. Sie werden es nicht für eitle Prahlerei halten, lieber Freund, wenn ich erwähne, daß mir von manchen Seiten gehuldigt wurde. Der Enthusiasmus des Jünglings und das ernstgemeinte Werben des Mannes kamen mir entgegen, aber mein Herz schwieg, ich hielt mich selbst für kühl, für unfähig, mich dem vielgepriesenen Gefühl der Liebe zu erschließen. Wieder war es meine Kunst, von der ich überzeugt war, daß sie mich ganz ausfülle.
Da, kaum ein Jahr vor meinem Scheiden aus Leipzig, fiel mir in einem Konzert ein schlanker Mann in schwarzer Sammetkleidung auf, der mich mit seinen dunklen Augen unablässig verfolgte. Die Angst und Pein, welche ich unter seinen Blicken litt, steigerte sich derartig, daß es mir schwer wurde, meine zweite Arie zu Ende zu singen.
Noch beklommen von jenem Eindruck, schloß ich mich zum Nachhausewege einer bekannten Familie an und hatte, als die Freunde mich verließen, nur noch ein kurzes Gäßchen bis zu meiner Wohnung zu durchschreiten. Als ich hier einbog, trat eine Gestalt auf mich zu, in der ich, zu meinem unaussprechlichen Schrecken, den imposanten Fremden erkannte.
Er redete mich an und lobte meinen Gesang; ich verstand anfänglich in großer Verwirrung kaum, was er sagte, und erschrak zugleich über dies mir so fremde Gefühl von Angst und Scheu.
Er begleitete mich, ohne daß ich es ihm zu wehren vermochte, bis zu meinem Hause und bat beim Abschied, mich morgen besuchen zu dürfen. Obwohl ich überzeugt war, daß ich die Bitte nicht gewährte, wußte ich doch, daß er kommen würde.
Die Nacht verbrachte ich schlaflos und unter dem Druck einer beklemmenden Spannung, wie in Erwartung eines großen und folgenschweren Ereignisses, eines über mir schwebenden Verhängnisses. O, wie haben sich meine damaligen bösen Ahnungen bestätigt! Am anderen Morgen wartete ich mit Zittern auf seinen Besuch und sah ihn gegen Mittag bei mir eintreten.
Es entspann sich nun ein ganz wunderbares Verhältnis. Mir ward nie wohl in seiner Nähe, ich sehnte mich nie nach seinem Kommen, aber ich mußte seine Nähe dulden, denn die Kraft ihn abzuweisen, besaß ich nicht. Zergrübelt habe ich mir den Kopf, um herauszufinden, worin seine Macht bestehe, die er vom ersten Augenblicke an über mich gewonnen hatte.
Er war weder jung noch schön, aber alles an ihm trug das Gepräge der Vornehmheit, Sicherheit, Herrschgewißheit. Ich, sonst nicht ohne Selbstgefühl, kam mir in diesem Verhältnis vor, wie die Sklavin dem Sultan gegenüber, wie der Vogel im Bann der Schlange, kurz, wie ein ganz willenloses und hilfloses Wesen.
Er sagte mir nach einigen Wochen – nichts von Liebe oder Leidenschaft – nein, nur, daß er wünsche, mich sein zu nennen. Und ich, erschrocken, aber nicht überrascht, ich – willigte ein.
Weshalb ich's tat, das blieb mir selbst ein Rätsel. Als er gegangen war, regte sich meine alte Selbständigkeit, ich schalt mich, ich zürnte mir, ich beschloß, mein Jawort zurückzunehmen, ihn nie mehr zu empfangen, keine Überredung zu dulden; als er aber kam, Pläne entwarf und mich seine ›verehrte Braut‹ nannte, schwieg ich und bemühte mich, seinen Wünschen nachzukommen.
Ist es Ihnen nie geschehen, Hildebrand, daß Sie schier unwillkürlich Dinge taten, Worte sprachen, die Sie eigentlich nicht tun, nicht sagen wollten? Mir ist dies Mißgeschick oder diese Schwachheit dem Grafen gegenüber oft begegnet. Ich weiß nicht zu sagen, was mich trieb oder hinriß, aber ich ging immer weiter, als meine Absicht war. Soll ich's Furcht nennen? War's Eitelkeit, die ihm genügen wollte? Oder war es beides und der zwingende Einfluß seiner Persönlichkeit dazu? Der merkwürdige Mann besaß ein fast übernatürliches Wissen. Er kannte alle Länder und vermochte auf das lebhafteste von bedeutenden Menschen und fernliegenden Verhältnissen zu erzählen; ja manchmal schien sein genaues, persönliches Kennen sich auf längst Vergangenes zu beziehen, so daß ich ihm mit starrem Schrecken zuhörte. Die Gedanken las er mir von der Stirn, beantwortete Fragen, die ich noch nicht ausgesprochen, war plötzlich dicht neben mir, ohne daß ich sein Kommen gehört, und beschäftigte so ausschließlich meine Gedanken, daß ich doch manchmal glaubte, ich liebe ihn.
Er hatte mir längst gesagt, daß er in Dresden wohne, aber Franzose sei, Graf Saint-Germain heiße, und daß er wünsche, da ich hier weder eine eigene Familie, noch seinem Range ebenbürtige Freunde besitze, die uns eine Hochzeit rüsten könnten, sich still mit mir in Dresden zu vermählen. Ich solle vorläufig meinen Kontrakt nicht lösen, sondern, bis er sein Haus eingerichtet und gewisse Hindernisse beseitigt habe, wieder hierher zurückkehren.
Ich ging in meiner Vezauberung und Willenlosigkeit auf seine Vorschläge ein und reiste mit ihm nach Dresden.
Wir kamen gegen Abend an und stiegen vor einem düsteren Hause der Vorstadt ab. Pierre, sein französischer Kammerdiener, den ich schon früher mit ihm in Leipzig gesehen hatte, empfing uns. Wir fanden in einem großen Zimmer mit weißgetünchten Wänden einen blumengeschmückten Altar, auf dem reiche Armleuchter mit brennenden Kerzen standen, Vorkehrungen, die, obwohl sie mir nicht unerwartet kommen konnten, mich mit plötzlicher Angst erfüllten.
Der Graf führte mich in ein anstoßendes Kabinett, wo ich meine Toilette ordnete; der Brautkranz lag für mich bereit.
Als ich in das große Zimmer zurückkehrte, stand ein Geistlicher am Altar und zwei würdige, mir fremde Herren als Zeugen bereit. Die heilige Zeremonie begann sogleich; ich ward dem Grafen angetraut und fand, trotz innersten Widerstrebens, auch hier in der letzten Minute nur das von ihm verlangte: Ja!
Nach der Trauung geleitete mich mein Gemahl in das Kabinett zurück, umarmte mich, bat mich, da ich zitterte und tief ergriffen war, der Ruhe zu pflegen, die Reise habe mich angestrengt, er wolle sich dem geistlichen Herrn und seinen Freunden, den Zeugen, empfehlen, ich solle, wenn ich mich erholt habe, ihn im anstoßenden Zimmer erwarten, wo wir miteinander soupieren würden.
Nach kurzer Zeit kehrte ich in das große Zimmer zurück. Der Altar mit den Armleuchtern war fortgenommen, dafür stand ein Eßtisch mit zwei Kuverts inmitten des Raumes, ein paar Lehnsessel daneben und irgendwo zur Seite ein mattbrennendes Licht. Ermüdet, wie ich war, setzte ich mich in einen der Sessel und wartete.
Ich befand mich in zu großer Erregung, um schlafen zu können, aber ein Gefühl von Schwindel kam über mich.
Mein Blick war starr auf die große, weiße Wand vor mir gerichtet, und mechanisch verfolgte ich die schwebenden Schatten, welche bei dem schwachen Lichte jener einen herabgebrannten Kerze darüber hinfuhren.
Plötzlich dichteten sich jene Schatten, ich erkannte die Umrisse einer Gestalt – sie glitt, mit schleppendem Kleide auf dem Estrich wandelnd, heran. Es war eine Frau, doch in fremder Tracht. Als sie mir gegenüberstand, sah sie mich bekümmert an, hob die Hände wie klagend und sagte mit Jammertönen: ›Armes Weib! – Armes Weib!‹ damit schritt sie vorüber.
Ich wollte aufspringen, schreien, aber ein kaltes Entsetzen lähmte meine Glieder.
Schon folgte der ersten eine andere. Sie war nicht wie ihre Vorgängerin gekleidet, auch sahen mich noch bleichere Gesichtszüge an, dunkles Haar fiel über ihre Schultern.
›Auch du verloren?‹ sagte sie mit schneidendem Ton. ›Auch du von ihm verlockt?‹ Sie rang die Hände und schwebte vorbei.
Ich lag starr, gelähmt, nur Auge und Ohr.
Die dritte sprach: ›Wir starben alle in der Brautnacht! Er erdrosselt jede, die er sein nennt! Fliehe, fliehe!‹ Sie riß ihr Tuch herunter, und ich sah ein rotes Mal an ihrem Halse.
Mit einem Angstschrei, der mich selbst entsetzte, schlug ich vom Stuhl zu Boden.«
Einsiedel war aufgesprungen und stand ihr gegenüber; er hatte die Arme untergeschlagen, um sein laut pochendes Herz, seine zitternden Nerven zusammenzupressen, jetzt rief er: »Du träumtest, Korona! Dies war keine Wirklichkeit!«
»Höre nur weiter,« sagte sie matt.
»Als ich die Augen wieder öffnete, stand er, mit seinen gespannten Mienen, seinem eisigen Blick, über mich geneigt.
Ich sprang auf, wehrte ihn ab und warf mich ihm von Todesangst getrieben, um Gnade flehend, zu Füßen.
Er verschränkte die Arme und sah mit einem spöttischen Ausdruck des Triumphes auf mich nieder.
›Gräfin Saint-Germain bist und bleibst du,‹ sagte er kühl. ›Das Wie, darüber läßt sich handeln.‹
Und wir handelten, Hildebrand, wir handelten, aber seine erste Bedingung breche ich jetzt. Ich mußte ihm schwören, nie unsere Verbindung und meine Erlebnisse zu verraten, nie das Liebeswerben eines anderen Mannes anzunehmen, stets ihm zu gehorsamen und als Zeichen meiner Treue für ihn diese schwarze Sammetschleife zu tragen.
Da hast du mein Geheimnis! Auch die treue Wilhelmine kennt es nur halb.
Nachdem ich jene mir von ihm vorgeschriebenen Bedingungen mit den heiligsten Eiden beschworen hatte, gab er mich äußerlich frei und gestattete mir, in derselben Nacht, mit einem von ihm herbeigeschafften Wagen, allein nach Leipzig zurückzureisen.«
»Teufel von einem Manne!« rief Einsiedel aus. »Was konnte ihm daran liegen, diese Komödie, dieses Bubenstück mit dir aufzuführen? Denn, daß alles Lug und Betrug war, glaube ich fest. Ich meinte, er habe dich doch, trotz äußerer Kühle, mit heißer Leidenschaft geliebt. Er habe dich besitzen wollen. Wenn dies aber ausgeschlossen ist, wozu die Mühe, dich zu umgarnen?«
»Dieselbe Frage habe ich mir anfänglich oft vorgelegt. Vielleicht ist in ihm etwas von der Jagdlust des Raubtiers, welches sich an den Qualen der Beute freut, dem das Erhaschen, Zappelnsehen eine Wollust ist. Und dann: er konnte mich in meiner Abhängigkeit gebrauchen! Wie oft habe ich von ihm Befehle empfangen und befolgt, an deren Ausführung ihm vielleicht etwas lag. Ich war stets sein willenloses Werkzeug für geheime Intrigen und bin infolge meiner Stellung als Künstlerin mit vielen einflußreichen Leuten in Berührung gekommen. Ja, ich gehorchte ihm, denn ich zitterte und zittere noch, ihn zu erzürnen. Ich bin wie ein hilflos flatternder Schmetterling in seiner starken Hand, er gönnt mir Luft zum Atmen, solange es ihm gefällt, drückt er die Hand zu, ist alles aus.
Sein vor Zeugen ihm angetrautes Weib bin und bleibe ich, in Scheidung wird er nie willigen; lehne ich mich gegen ihn auf, so kann er Rechte geltend machen, an die nur zu denken mich mit Entsetzen erfüllt!«
Hildebrand von Einsiedel, der Poet und Idealist, der feine Hofmann und doch so treue kindliche Mensch, war nicht gemacht, die Geliebte aus diesem Netz geheimer Ränke zu befreien. Wäre er aber auch ein Haudegen, ein energischer, welterfahrener Mann gewesen, Koronas grenzenlose Angst vor ihrem Gebieter, ihre Furcht, nur an die Kette zu rühren, die sie umschlossen hielt, würden seine Tatkraft gelähmt haben.
Sie wollte weiter nichts, als ihm begreiflich machen, daß an eine eheliche Verbindung zwischen ihnen beiden nicht zu denken sei, und Hildebrands weichem, passivem Charakter gegenüber glückte ihr dies Vornehmen bald.
Er gelobte ihr Schweigen und endlich doch nach längerem Kampf – Entsagung.
Sie versprach, ihn ewig als Freund, als Bruder zu lieben. So schieden sie.
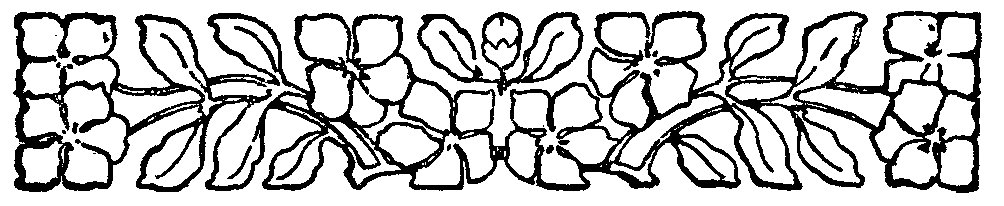
Was ich irrte, was ich strebte,
Was ich litt und was ich lebte,
Sind hier Blumen nur im Strauß;
Und das Alter wie die Jugend,
Und der Fehler wie die Tugend
Nimmt sich gut in Liedern aus.
Goethe.
Bald nach dem Abendfeste in Tiefurt kam am 25. August der Ludwigstag heran, den man als Namenstag der Herzogin Luise feierte.
Die hohe Frau hatte durch ein wenig mehr Entgegenkommen und Freundlichkeit neulich in Tiefurt Goethe so tief bewegt und wieder so sehr für sich eingenommen, daß er sich sofort mit Plänen trug, ihren festlichen Tag zu verherrlichen. Er fand zu seiner Überraschung diesmal auch in der feindlichen Partei – das heißt bei Görtz und seinen Anhängern – eine rege Teilnahme.
Neuerlicher Gewitterregen hatte eine Überschwemmung des Sterns herbeigeführt, wo anfänglich ein Festspiel beabsichtigt war, daher mußte man jetzt einen anderen Plan entwerfen.
Am linken Ufer der Ilm führte, vom Fürstenhause aus gangbar, ein erhöhter Weg her; etwas flußaufwärts stand eine Mauer, um als Kugelfang vom Schießhause aus die Umgegend zu schützen; diese sowie ihre Umgebung lagen hoch und trocken. Hinter der Mauer befand sich ein Platz mit herrlichen alten Eschen und Gebüsch, derselbe konnte jede Art von Überraschung bergen; davor, den weiteren Ausblick versperrend, ließ man in den bis zum Fest noch übrigen drei Tagen heimlich eine hübsche kleine Einsiedelei aufbauen, mit Strohdach und Borkenbekleidung, deren Wände man vorn und hinten verschiebbar einrichtete.
Goethe und Seckendorf, der talentvolle Poet und Komponist, hatten mittlerweile ihr Festspiel fertig und mit den anderen Freunden einstudiert. Sie wollten in Mönchskutten erscheinen, erzählen, ihr Kloster sei durch die Fluten vernichtet, dies Häuschen habe man gerettet, und hierher lade man die Gesellschaft zur frugalen Kost, dann sollten sich des Borkenhäuschens Türen auftun und man einen bescheiden besetzten Tisch sehen, auf dem sich nichts befinde als eine irdene Schüssel mit Bierkalteschale, ein Laib Brot, Zinnteller und Holzlöffel. Wenn die Hofgesellschaft dastehe, nicht wissend, was aus dem Scherz zu machen sei, solle sich die hintere Wand des Häuschens öffnen und unter den alten Eschen wohlbesetzte Hoftafeln, geputzte Gäste und symphonische Musik sie einladend begrüßen, worauf dann die Glückwünsche der Anwesenden an die gefeierte Fürstin den Übergang zum festlichen Schmause bilden sollten.
Diesem Plane gemäß spielte sich das Fest am Mittag des 25. ab. Der Herzog, seine Gemahlin, Herzogin Amalie und ihre nähere Umgebung hörten die Reden der Mönche, als welche Prinz Konstantin, Goethe, Seckendorf, Knebel, Wieland, Einsiedel und einige andere auftraten, standen erstaunt am Tisch mit der Kalteschale und atmeten erfreut und lachend auf, als bei dem Wegziehen der Wand das festlich heitere Bild sie einlud.
Die Mönche machten anfänglich Miene, ihre Gäste zu bedienen, und Goethe, der Pater Dekorateur, hielt sich hinter dem Stuhle der Herzogin Luise, um ihr wenigstens die Suppe zu reichen. Dann aber mußten die würdigen Herren in ihren weißen Kutten sich zwischen die Gäste an die Tafel setzen und an den Freuden des Mahls wie alle anderen teilnehmen.
In den Pausen des Diners schlossen sich den Instrumentalvorträgen Gesangsstücke der Sängerinnen Korona Schröter und Luise Rudorf an, worauf die gern gesehenen jungen Mädchen an einem der Nebentische ihren Platz wieder aufsuchten.
Goethe hatte sich heute einmal wieder das Kuvert neben Korona gewählt. Bei solchen festlichen Gelegenheiten durfte er nicht hoffen, neben der Freundin zu sitzen, die, als Gattin des Oberstallmeisters, in der Nähe der höchsten Herrschaften ihren Platz fand.
Korona, die schöne, liebenswürdige Künstlerin, übte eine große Anziehungskraft auf ihn aus, wenn er auch wußte, daß ihr Herz seinem Freunde Einsiedel gehörte, der auf ihrer anderen Seite saß.
Aber weder für den einen noch für den anderen ihrer Nachbarn fand Korona heute die rechte Aufmerksamkeit; sie antwortete zerstreut, starrte auf einen Punkt, wechselte oft die Farbe und bezeigte besonders Goethen gegenüber eine seltsame Scheu.
Einsiedel fragte sie flüsternd, was ihr fehle, ob ihre Bekenntnisse gegen ihn sie ängstigten; auf seine Verschwiegenheit und vollkommene Hingabe an ihren Willen dürfe sie doch bauen.
»Das ist es nicht, Hildebrand,« entgegnete sie gleichfalls leise und mit Vorsicht, »ich habe einen Auftrag vom Meister, der gewiß Übles bezweckt und mich furchtbar beunruhigt. O, daß ich ausersehen bin, den dunkelsten Plänen als Werkzeug zu dienen!«
Der Freund bat sie, ihm ganz zu vertrauen, ihm alles mitzuteilen, was sie bedrücke, was sie tun solle. Vielleicht lasse sich doch etwas ändern. Sie lehnte aber in ängstlicher Weise ab, sagte, der Graf müsse hier sein, sie könne doch nicht umhin zu gehorchen. Das Verhängnis über ihr treibe sie wider ihren Willen! Er möge nicht weiter in sie dringen, sondern ihr Ruhe und Schonung gönnen.
Nach dem Mittagessen wurden von hurtigen Lakaien die Tische fortgeräumt und von den Musikern die Instrumente zu einer Polonaise gestimmt.
Man wollte sich nicht so bald trennen, der Abend versprach herrlich zu werden, die Gesellschaft war lustig und guter Dinge; der Herzog, nach einigen Gläsern Champagner sehr aufgeräumt, erfreut von der Überraschung, entzückt von dem neu entdeckten, fast unbekannten Platz, erklärte, die Gesellschaft müsse zusammen bleiben.
So spazierte man unter den Eschen umher, scherzte, lachte, saß in Gruppen beisammen, versuchte ein Tänzchen und unterhielt sich in der gehobenen Stimmung ganz vortrefflich.
Goethe hatte Korona zur Polonaise aufgefordert, sie aber dankte, da Einsiedel sie eher darum gebeten habe, den nächsten Kontertanz solle er bekommen. Er war einverstanden und trat jetzt mit ihr, strahlend vor Heiterkeit und Jugendlust, in die Reihen.
Die Ungebundenheit der Dinerstimmung fügte es, wie er glaubte, daß er sich plötzlich der Herzogin Luise mit dem Oberhofmeister Graf Görtz gegenübersah, und heimlich lachend sagte er sich, daß der hochmütige Graf samt seiner edlen Partnerin zu anderen Zeiten wohl erlesenere Gegentänzer gesucht haben würden, als ihn mit der Sängerin.
Auch der Herzogin fiel diese Fügung unangenehm auf, und sie deutete ihrem Kavalier an, wie sie erstaunt sei, daß er nicht für ein passenderes Visavis gesorgt habe.
Der Graf entschuldigte sich mit nichtssagenden Redensarten. Luise dachte, der Wein mache ihn konfus, und dann begann die Musik, ehe sich etwas ändern ließ.
Hinter Goethe und Korona stand der kleine Baron von Göchhausen, heute infolge des wohltätigen Tranks aus den Händen des Wundermanns ganz besonders leicht und heiter gestimmt. Er sah dem Tanze zu, wiegte sich in den Hüften und schien seine ganze Teilnahme dem Treiben der Jugend zu widmen.
Plötzlich, als Goethe und Korona, ihren Platz verlassend, vortanzten, schoß er in den Kreis und raffte ein weißes Etwas vom Boden auf; er sah es nicht näher an, sondern verließ seinen bisherigen Standort und begab sich in die Nähe des Herzogs, der gleichfalls in dieser Quadrille und mit Luise von Göchhausen tanzte.
»Sie müssen zugeben, Tuselchen,« sagte Karl August fröhlich, »daß dies wieder eine Fete ist, die unserem Zauberer drüben alle Ehre macht! Steckt er auch in der weißen Fahne von einer Kutte, der Goldjunge, die alle die anderen Männer miserabel kleidet, so sieht er doch immer aus wie ein junger Gott, und es ist die pure Unmöglichkeit, wenn man auch Ursache dazu hatte, ihm böse zu sein!«
»Durchlaucht haben recht, amüsant ist's heute, und ich bin hexenvergnügt!« rief das kleine Fräulein und ließ ihre lachenden, lebhaften Augen durch den Kreis herum und zu ihrem Partner fahren. »Dero Hätschelhans scheint nachgerade allen Leuten genehm,« fügte sie mit einem boshaften Seitenblick auf Graf Görtz hinzu, der eben mit vieler Grandezza ein pas seul vor Goethe und Korona tanzte.
Der Herzog lachte laut auf: »Himmlischer Anblick das! Wie er es nur eingerichtet hat, Freund Wolf, Luise als Gegentänzerin zu bekommen? Ich dachte, sie bisse sich lieber den kleinen Finger ab, als meinem armen Parvenü die Ehre zu erzeigen! Na, mich freut's, wenn sie Raison annimmt, wenn er sie herumkriegt.«
Der Kontertanz wurde beendigt; als der Herzog, nach der Verabschiedung von seiner Tänzerin, sich wandte, stand der kleine Baron Göchhausen vor ihm, tief dienernd, submissest lächelnd und offenbar mit einem Anliegen auf dem Herzen.
»Eh, Baron, was wollen Sie? Wo drückt der Schuh?« fragte der Fürst gnädig.
»Durchlaucht verzeihen, Durchlaucht gestatten –« murmelte der kleine Mann. »Supponiere, daß dies Schreiben – meine ergebenste Pflicht und Schuldigkeit Dero Einsicht zu unterbreiten.«
Damit hielt er dem Herzog einen zusammengefalteten, adressierten, aber nicht gesiegelten Brief hin. Karl August griff mechanisch danach.
»Goethes Handschrift und an Luise! Gewiß ein poetischer Erguß, ein Festcarmen? Wie kommen Sie dazu?«
»Durchlaucht zu dienen, der Brief fiel aus der Tasche des Herrn Legationsrat Goethe, als er in der Quadrille avancierte. Ich stand hinter ihm und enlevierte das Schreiben.«
Als der Oberkämmerer sah, daß er nicht weiter beachtet werde, zog er sich mit einigen Bücklingen zurück. Der Herzog aber trat zur Seite und entfaltete sonder Arg und Bedenken den Brief.
Aber welch ein Wechsel auf seinem Antlitz! Flammende Röte und fahle Blässe, eine zornig gefaltete Stirn, zerbissene Lippe und endlich, wilden Griffs ein Zerknittern, Zusammendrücken des Papiers, das er mit plötzlichem Ruck in die Tasche schob. Ohne sich umzusehen, ohne zu zaudern, verschwand er hinter der Schießmauer und verfolgte mechanisch den Weg an der Ilm her, der ihn zum Fürstenhause führte.
Die Musik zu einem Menuett, Gläserklirren und lachende Stimmen folgten ihm; er aber hörte nichts davon, seine Gedanken wühlten und bohrten zu gewaltig in ihm; das Blut kochte in seinen Adern, und jede Spur froher Weinlaune, die ihn belebt hatte, war erstorben.
In seinem Palais angekommen, befahl er: »Ein Pferd!« und ritt wenige Minuten später allein im Gesellschaftsanzug zum Tor hinaus. Da hing er wie willenlos und gebrochen im Sattel, in seinem roten, goldgestickten Sammetrock, schlaff eine Reitpeitsche haltend, die sein Groom ihm eingehändigt hatte.
Die Stallbedienten, welche ihm nachsahen, schüttelten die Köpfe.
»Wenn er noch wetterte und fluchte, wär's mir lieber,« sagte ein alter Kutscher.
»Das schöne Zeug, die weiße Seidenhose ist hin,« meinte bedauernd ein junger Reitknecht.
Der aber, dem diese Bemerkungen galten, ahnte nicht, daß er etwas tue, was auffallen müsse. Er hatte überhaupt kein anderes Gefühl als das eine, entsetzliche: sein Freund, sein Liebling, sein herrliches Vorbild – war ein gemeiner Heuchler und verriet ihn unter gleißendem Scheine; Irrtum schien ihm unmöglich. Er hatte die ganze Sachlage mit eigenen Augen gesehen; Göchhausen stand hinter Goethe, Luise tanzte ihm gegenüber, gewiß hatte dieser es so eingerichtet, um ihr den Brief zu geben!
Was nur Luise zu dem Briefe gesagt hätte? Er mußte doch mit ihr schon seiner Sache gewiß sein, um dies zu wagen! Also auch sie eine Scheinheilige? Sie, die Strenge, gegen ihn so Kühle. Aber freilich, ein Apoll, ein genialer Feuertopf, wie Goethe! Er wußte und fühlte es ja selbst, wie ihm die Herzen zuflogen! Ein tiefer Seufzer hob seine Brust. Nein, dies konnte er ihm nicht verzeihen! Liebte er auch Luise nicht innig, so war sie doch lein Weib, die Herzogin, die Hüterin seiner Ehre!
Trennung von beiden, war der einzige, der Endgedanke aller Überlegungen. Wo hatte er nur seine Augen gehabt, daß er nicht längst gesehen, wie der Freund sie wärmer verehrte, als recht war? Freilich, so wie es der Brief aussprach, das hätte er doch nicht gedacht. Und es war nicht allein Goethes Handschrift, es waren Redewendungen, Worte, wie er sie oft von ihm gehört, und doch dies Unglaubliche, diese kecke Sprache sinnlicher Leidenschaft! Er wiederholte sich einzelne Sätze, die sich seinem Gedächtnis eingebrannt.
»Süßer, verschmähter Engel, den zu besitzen, zu entschädigen mir Seligkeit wäre!« – »Ich sehe und träume nichts als die Himmelssterne Deiner Augen; o Luise, wenn Du Dich zu mir herabneigen, mich glücklich machen wolltest!« – »Er, der Dich nicht zu würdigen weiß, entbehrt auch nichts!« –
»Seine Liebe für die Stein ist fingiert, ist ihm ein Deckmantel,« fuhr der Herzog in seinem Selbstgespräche fort. »Die Frau ist seine Vertraute, Hehlerin, Zwischenträgerin.
Welch ein erbärmliches, verworfenes Gezücht, unter dem ich lebe! Ich, dem das Höchste ist: ein edler Menschenkreis!«
Sein Pferd blieb in diesem Augenblicke an einem Gebüsche stehen und zupfte Blätter ab.
Jetzt erst kehrte er zur Gegenwart zurück, sah sich um, wo er sich befand, und nahm die Zügel fester. Er war, ohne es zu wissen, den Weg an Goethes Gartenhaus vorbei, nach Oberweimar geritten.
Die Sonne sank bereits; am liebsten wäre er landein gesprengt, hatte alles, was Klärendes und Trennendes geschehen mußte, brieflich abgemacht, aber so im Staatskleide, ohne Vorbereitung und Begleitung? Er nannte sich selbst feige und riß plötzlich sein Pferd herum. Ein wilder Zorn flammte in ihm auf; er schlug mit der Peitsche über des Rosses Flanke und flog in sausendem Galopp den Weg in wenigen Minuten zurück, für den er vorhin im träumenden Verweilen so lange Zeit gebraucht hatte. Die rasche Bewegung tat ihm wohl; die Sonne war jetzt im Untergehen, ein schönes, tiefglühendes Abendrot verklärte die Gegend; er mäßigte die rasche Gangart seines Pferdes, hielt sich gerüstet für alles, was geschehen mußte, und fühlte sich älter, aber auch fester geworden.
Sein Empfinden der bitteren Erfahrung war aus dem dumpfen Wehgefühl in das Begreifen der Sachlage übergegangen. Er erkannte, daß er kurz und kräftig mit den Dingen fertig werden müsse.
So weit in seinem Gemüte gekommen, wurde er durch einen Anruf aus seinem Gedankengange aufgeschreckt; unwillkürlich hielt er beim Tone dieser Stimme sein Pferd an und wandte den Blick hinauf, woher der Ruf kam.
Da stand Goethe in seiner Alltagskleidung auf dem Altan, vom warmen Abendrot umflossen, mit heiter strahlenden Blicken und rief ihn noch einmal an: »Mein lieber, gnädiger Herr, wohin sind Sie uns entflohen? Warum verließen Sie das Fest?«
»Elender!« knirschte der Herzog. Er wollte ihn ja nicht wiedersehen; hielt es unter seiner Würde, je wieder ein Wort mit ihm zu wechseln; dennoch, bei seinem herzbewegenden Anblick, dem Ruf dieser geliebten Stimme, widerstand er nicht. Rasch entschlossen, wollte er jetzt alles gleich persönlich mit ihm abmachen, das war der einzig richtige, männlich tapfere Entschluß!
Er sprang vom Pferde, Philipp nahm die Zügel an, und Karl August eilte ins Haus.
Schon auf der Treppe zog er den verhängnisvollen Brief hervor, glättete denselben mit zitternden Händen und reichte ihn dem verräterischen Freunde, als dieser ihm oben entgegenkam.
»Was soll dies Papier?« fragte Goethe.
»Lies!« herrschte der Fürst ihn an.
Beide traten, mechanisch vorgehend, in Goethes Zimmer; dieser wandte sich zum Fenster, um bei dem scheidenden Lichte sehen zu können, was ihm der Herzog gegeben.
»Ein Brief von mir?« fragte er erstaunt, »und an die Herzogin?«
Der Herzog lachte höhnisch auf; der andere hatte diesen Ton nie von ihm gehört.
»Dein neuestes Gedicht!« sagte er mit verbissenem Ingrimm.
Goethe las und erstarrte.
»Meine Schrift!« sagte er. »Manches von meinen Gedanken und Redewendungen, und doch so – das ist infam!«
Er warf in tiefem Widerwillen den Brief mitten ins Zimmer und rief: »Durchlaucht, das schrieb ich nicht!«
»Du – du leugnest?«
»Ich leugne nicht allein, ich beschwöre, bei allem, was es Heiliges gibt: ich weiß gar nichts von diesem Briefe!«
»Wäre es möglich? Soll – darf – kann ich glauben?«
»Nicht ohne Beweis; wir müssen den Urheber dieser Schandtat entdecken!«
»Den Urheber? Göchhausen, der alte Tropf, gab mir den Brief; er hatte ihn aus deiner Tasche fallen sehen.«
»Welch ein Gespinst von Lug und Trug! Dahinter steckt ein anderer als dieser blöde Baron!«
»Ein anderer? Wer?«
Goethe starrte zu Boden; er wußte recht gut, wer ihn hier los sein wollte, wer stets gegen ihn intrigierte. Dies aber war doch ein gewagtes Spiel. Wer konnte einen solchen Brief verfassen, so täuschend gemacht? Das war eine im Betrug geübte Hand! Da tauchte ihm plötzlich das feinste Gaunergesicht auf, das er je, wenn auch nur flüchtig, neulich, als Korona so sehr erschrak, in Tiefurt gesehen.
»Hat der Landgraf Adolf Euer Durchlaucht nicht gesagt, daß der Wundermann Saint-Germain ein besonderes Geschick besitze, jede Handschrift nachzuahmen?«
Der Herzog starrte ihn an: »Saint-Germain! Wie kommst du auf den? Welchen Grund sollte er haben, mich mit dir zu entzweien?«
»Den, im Trüben fischen zu wollen. In Kassel findet er keine dauernde Stellung, vielleicht möchte er meinen Platz einnehmen? Ich weiß, er hat sich an verschiedenen deutschen Höfen festzusetzen versucht.«
»Und wenn auch; vermag er den Brief in deine Tasche zu zaubern?«
»Der Brief war nicht in meiner Tasche.«
»Woher kam er denn zu Göchhausen?«
Eine Pause folgte; endlich sprach Goethe gepreßt: »Meine Partnerin Korona steht in Verbindung mit dem Grafen, wie wir wissen.«
»Ja, durch Kaufmann. Sie sollte auf sein Geheiß den Brief verloren haben? Komm, hin zu ihr!«
Goethe raffte den Brief auf, erklärte sich einverstanden und schritt mit dem Fürsten durch den dämmerigen Abend der Stadt zu. Schweigend, aber innerlich beschäftigt, kreuzten sie die Straßen und standen bald vor der Tür der Sängerin.
Minchen Probst öffnete auf ihr Anpochen das Wohnzimmer, ein Licht in der Hand, und lebhaft erschreckend, als sie die Herren sah.
»Korona ist krank vom Fest gekommen,« sagte sie mit weinerlicher Stimme.
Aus dem Nebenzimmer hörte man ein krampfhaftes Schluchzen.
Der Herzog ließ sich nicht abweisen.
»Hier handelt es sich um höhere Rücksichten, gutes Kind, als die Schonung eines hysterischen Anfalls!« sagte er barsch und trat mit dem Freunde ein. Er nahm das Licht aus des Mädchens Hand und ging den kläglichen Tönen nach; Goethe folgte.
Gleich darauf standen sie vor Korona, die noch im Gesellschaftskleide sich mit tränenüberströmtem Angesicht von einem kleinen Ruhebette aufrichtete. Sie starrte die Männer an und zuckte sichtlich zusammen, als sie Goethe gewahrte.
»Kennen Sie diesen Brief, Korona?« fragte der Herzog und hielt ihr das zusammengefaltete Schreiben entgegen.
Die Sängerin verhüllte ihre Augen und begann aufs neue zu schluchzen.
»Das ist Schuldbewußtsein!« rief der Herzog triumphierend.
»Arme Korona! Was hat Sie dazu bewogen, gegen mich so häßlich zu intrigieren?« fragte Goethe milder.
Das schöne Mädchen rang die Hände: »O, ich bin ein willenloses Werkzeug des Schrecklichen!«
»Saint-Germains?« rief der Herzog.
»Ja!« hauchte Korona und verhüllte ihr Gesicht.
»Also doch!«
»Ich war davon überzeugt und freue mich, mein Fürst, daß Sie diese Warnung empfingen.«
»Ist der Graf hier? Mit wem steckt er zusammen? Hat er Ihnen selbst das Schreiben gegeben?«
»Nein; Graf Görtz in seinem Auftrage. Mit diesem hält er zusammen.«
»Aha!« rief der Herzog mit einer gewissen Schadenfreude; das, war jemand, den er erreichen und strafen konnte.
»Verzeihung! Gnade! Sie wissen nicht, wie elend ich bin, wie ich zu dem gezwungen wurde, was ich so ungern tat!« jammerte Korona, glitt vom Sofa herab auf ihre Kniee und hob flehend die Arme empor.
Sie sah in ihrer Erregung so schön aus, es freute den Herzog so sehr, den Druck von seinem Gemüte abwerfen zu können, den Freund gerechtfertigt zu finden, daß er der Flehenden gnädig die Hand reichte, sie sogar bat, sich zu beruhigen, er werde sich und ihr vor dem Übeltäter Frieden verschaffen, werde aufzuräumen wissen, sie solle, bei so sichtlicher Reue, seiner und Goethes voller Vergebung gewiß sein.
Nachdem sie Schonung und Verschwiegenheit gelobt hatten, gingen die beiden Freunde Arm in Arm davon.
Die Qual, auseinandergerissen zu werden, war ihnen vorahnend zu teil geworden, deshalb empfanden sie wärmer denn je füreinander.
»Die Schelme konnten leicht ihren Zweck erreichen,« sagte der Herzog jetzt nachdenklich. »Ich war in meinem Sinne entschlossen, dich nie wiederzusehen, da Irrtum mir unmöglich schien. Als du aber, vom Abendgolde umglänzt, über mir auf dem Altan standest und mich riefst, hörte alles Denken und Wollen auf, da mein Herz mich zu dir riß!«
»Heil diesem edlen, die Wahrheit erkennenden Herzen!« rief Goethe bewegt.
Dann überlegten sie gemeinschaftlich, wie die Lage zu klären, wie aufzuräumen und zu strafen sei.