
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
1921-1922
Wer kennt Dich, Du liebliches Städtchen, Du leuchtend rote Moosrose Bezeichnung für Osterode durch Heinrich Heine in seiner Harzreise. am grünen Harzrand entsprossen?
Viele Tausend sagen: »Wir kennen Dich!« Und ich sage: Viele Tausend kennen Dich nicht! Ihnen fehlen die Augen und die Ohren und das Herz, womit sie Dein innerstes Wesen erfassen können.
Die Auserkorenen aber, die allein wissen, was Du bist und wie Du bist, das sind nur wir, »die mit dem Wasser der Söse Söse heißt der Fluß, an dem Osterode liegt. Getauften!«
Wir haben Dich mit den ungetrübten Augen der Jugend gesehen, jedes Geräusch Deiner alten Straßen und Gassen hat uns wie melodische Weisen in die Ohren geklungen. Das Geläute der Glocken, das Klingeln der Haustüren, das Knarren der Langholzwagen, das Jauchzen der Kinder, das Bellen der Hunde, wem ist diese wundersame Musik wohl trauter als uns?
Und Ihr? Ihr kennt ja noch nicht einmal die Osteroder Glocken! Das wuchtigste Geläute kommt von dem hohen Turm der Marktkirche. Es klingt wie andächtiger Männerchor, wenn das Sausen und Brausen in schwindelnder Höhe beginnt.
Und doch freut sich der »Neustädter«, oder wer sonst in einem der herrlichen alten Fachbauten der Oberstadt wohnt, viel mehr, wenn die jungfräulichen Glocken der Schloßkirche ihr Lied vom Winde forttragen lassen.
»Mein-Mariechen« aber hat auch ein Stimmchen und ruft die andächtigen Beter aus »Klein-Paris« in seine Dornröschenkirche nach dem Lindenberg.
Die Osterbotschaft bringt den alten Mütterchen das Glöckchen im luftigen Turm von dem Stift Sankt Eobaldi.
Aus so hohem Geschlecht wie die geistlichen Glocken sind die Haustürschellen freilich nicht. Aber auch sie haben eine Seele. Es ist zwar nicht die Seele eines Menschen, sondern die eines treuen Hundes, der Haus und Hof bewachen soll. Sie bellen bald freudig, bald geheimnisvoll und manchmal auch keck und böse.
Seelenlos allein sind die Schulglocken, sonst würden sie nicht so unbarmherzig sein und die fröhlichen Spiele der Kinder mit ihrem schrillen Kommandowort unterbrechen. Wie haben wir als Kinder über diese Glocken geschimpft!
Ein sommerliches Geläute voll eigener Harmonie hätte ich bald vergessen: die Kuhglocken. Es ist noch gar nicht lange her, da zog die braune Herde konzertierend morgens und abends durch alle Straßen Osterodes und Tante Julchen paßte auf, ob auch ja nicht die schwarze Kuh – es waren nur wenig Ostfriesen bei der Herde – an der Spitze marschierte, denn das bedeutet Regen.
Zu der Familie der Glocken und Schellen gehört auch noch die »Bimmel« des städtischen Ausrufers:
| / | ‿ | ‿ | ‿ | / | ‿ | ‿ | ‿ | |
| Bimm, | bimm, | bimm, | bimm! | Bimm, | bimm, | bimm, | bimm, | |
| / | ‿ | ‿ | ‿ | |||||
| Bimm, | bimm, | bimm, | bimm, | — |
Dann kommt eine große Pause. Fenster öffnen sich quietschend. Der Ausrufer verkündet mit großem Pathos, daß das Wasser abgestellt wird oder daß bei Frau Krug Schellfisch eingetroffen ist. Da kommen die Langholzwagen angefahren. Die herrlichen Worte gehen verloren. Und mürrisch schließen sich die Fenster. –
Die Langholzwagen. Sie übertönen jedes Geräusch. Ein Stöhnen und Aechzen erfüllt die Luft, eine schauerliche Grabesmusik. Sie sind die Leichenwagen für die ungefügen Gebeine erstarrter Riesen, die im Kampf mit den beutegierigen Menschen gefallen sind.
Jene klobigen Gesellen sind sogar im Tode noch gefährlich. Muß doch bei ihrem Leichenbegängnis ein Wächter zu ihren Häupten und ein Wächter zu ihren Füßen sie begleiten. Dabei sind sie mit Ketten und starken Strängen gefesselt. So will es die hohe Obrigkeit. Und das mit Recht!
Mit ihren letzten Zuckungen versuchen sie noch einmal verzweifelt, ihren gewaltsamen Tod an der Menschheit zu rächen. Man sehe sich nur an, wie sie gegen die beiden ersten Häuser der Johannistorstraße gewütet haben. Streich auf Streich ist an ihnen festzustellen. Die Backe eines Waffenstudenten kann nicht durch mehr Hiebe verziert sein.
Nur die Straßenjugend findet das Schlenkern und Schaukeln der langen Stämme ergötzlich. Und in einem unbewachten Augenblick hat ein behender Junge sich an den längsten Stamm gehängt und läßt sich zum größten Neid seiner Gespielen auf- und niederschnellen. Wie im Geflügelhof ein Huhn dem andern kein Korn gönnt, so ertönt es auch schon von den weniger flinken Jungen im Chor:
»Sitzt wer hinter'm Wagen,
Kutscher kann nicht fahren!«
Dies Anklagelied wird immer von neuem wieder angestimmt, bis ein derber Fluch und ein Peitschenknall den blinden Passagier vertreiben.
Doch die Ruhe wird damit auf der Straße noch längst nicht wiederhergestellt. Das wissen auch die Herren auf dem Rathaus, sonst hätten sie Stadtschreiberei und Kämmerei nicht nach der Hinterfront des Hauses verlegt.
Jede Musik lenkt den Geist beim Arbeiten ab. Nun aber erst solche Musik!
Ich wundere mich nur, daß die Herzöge von Grubenhagen Näheres über diese in der »Chronik der Stadt Osterode am Harz« von Hans Erich Giebel all die Jahrhunderte hindurch bei diesem fortissimo in der Marktkirche so ruhig haben schlafen können. Ich glaube auch nicht, daß sie immer geschlafen haben. Recht müde werden sie allerdings sein, denn von dem Rasseln der Wagen bleiben sie nur verschont, wenn Gottesdienst abgehalten wird und draußen auf der Straße zwei aufgestellte Holzböcke für einige Stunden den Fährverkehr sperren.
Es gab aber eine Zeit, da habe auch ich nicht an einen unruhigen Schlaf der toten Herren und Edelfrauen geglaubt. Da wußte ich, sie waren stumm, taub und starr, ganz in Stein verwandelt. Versteinert wie die Fische, Schnecken und Farrenkräuter, die mein Großvater mir als kostbaren Schatz anvertraute. Von jener Zeit und den versteinerten Rittern will ich erzählen.
Ein kleiner Junge war ich. Noch stieg jedes Jahr der Weihnachtsmann schwerbeladen von der »Feenhöhe« herab, stampfte durch den verschneiten Wald und brachte polternd den artigen Kindern in Osterode Walnüsse, Marzipankartoffeln und bunte Siebenfachen. Wehe den bösen Buben und Mädchen! Sie steckte er in seinen großen Sack und nahm sie mit in die Berge. Nur einmal hat er einen solchen Bösewicht weit hinter Fuchshalle aus dem Sack geschüttelt und zu seinen Eltern zurückgeschickt.
Noch versteckte der Osterhase zwischen grünen Buchsbaumbüschen und blauen Märzenblumen in unserem Garten seine selbstgelegten Ostereier, die viel schöner waren als die weißen Eier unserer schwarzen Minorkas. Blau, gelb, rot und grün leuchteten die Haseneier und waren sogar schon gekocht. Bei schlechtem Wetter legte der Osterhase seine Eier bei uns ins Haus. Dann waren sie meistens aus Schokolade und innen hohl. Die Schokoladeneier waren zwar nicht so gut wie die Schokolade in Tafeln, dafür bargen sie aber in ihrem Bauch die kostbarsten Dinge: Ringe, die aussahen, als seien sie aus echtem Golde, silberne Herzen mit einer Oese, durch die man ein Seidenband ziehen konnte, und dergleichen Kinderherrlichkeiten mehr.
Einen Klapperstorch gab es damals auch noch. Denn sonst wäre mein dickes Schwesterchen nicht eines Tages dagewesen, worüber ich so böse war, daß ich sie jedem für 5 Pfennig verkaufen wollte. Aber niemand hat mir 5 Pfennig dafür geboten. Jetzt ist sie längst verheiratet, und mein Vater hat auch keinen Pfennig für sie erhalten.
Und dann gab es damals noch Riesen und Zwerge. Gab gute und böse Geister und andere unheimliche Wesen. Wie die Heidenmenschen in dem Plätschern einer Quelle, in dem Flüstern einer Fichte, in jedem Naturereignis und in jedem Unerklärlichen das Wirken überirdischer Geister vermuteten, so war meine sonnige Knabenphantasie verdunkelt von dem Glauben an Gespenster und schreckliche Märchengestalten. Ich hatte meine Geisterwelt für mich, mit der ich lebte und die ich fürchtete, mehr als die täglichen Prügel, die mir mein Vater bei den Mahlzeiten als Nachspeise verabfolgte, denn ich war ein richtiger Suppenkaspar.
So griff ich denn die Mär auf von den letzten Herzögen und Herzoginnen von Grubenhagen.
Philipp der Aeltere war gestorben und wurde mit großem Prunk zu Grabe getragen.
Als die Träger den Sarg unter dem Chor der Marktkirche beisetzen wollten, entglitt er plötzlich ihren Händen und fiel in die Tiefe. Es war, als ob eine unsichtbare Last sich auf den Sarg gelegt hatte, der die Kraft der Träger nicht gewachsen war.
Zaghaft stiegen einige Gefolgsmannschaften in die Gruft. Da wurden sie von einem neuen Entsetzen befallen.
Der Deckel des Sarges hatte sich gelöst, und in dem offenen Schrein lag ihr entschlafener Landesfürst, ganz zu Stein verwandelt.
Die plötzliche Verwandlung des Körpers in schweres Gestein hatte den Sturz des Sarges bewirkt. Die Zahl der Träger wurde verdoppelt und der versteinerte Herzog zur ewigen Ruhe gebettet.
Ganz Grubenhagen aber erfaßte ein Grauen. Niemand wußte das böse Omen zu deuten. Nur daß es kein gutes Zeichen war, das fühlten alle. –
Und wieder trug man einen Herzog zu Grabe. Und wieder ward er zu Stein.
Wie ein Alp lastete dies seltsame Geschehen auf Volk und Fürstenhaus.
Ein Flüstern und Raunen erhob sich im Lande. Erst leise und im Verborgenen, dann lauter und lauter werdend und das Tageslicht nicht mehr scheuend. Düstere Vermutungen erhärteten sich in den Köpfen zu Wirklichkeiten.
Da machte sich der dumpfe Druck verzweifelt durch Klageschreie Luft.
Das Rätsel war gelöst. Mit einem Male wußte jeder, daß mit der Versteinerung der herzoglichen Leichen kundgetan wurde, daß die Linie derer von Grubenhagen am Erlöschen war.
Ein Wink sollte es sein für die letzten Stammesangehörigen, noch bei Lebzeiten die Regierungsnachfolge im Lande zu ordnen.
Aber das Schicksal hat es anders gewollt. Philipp der Letzte schloß die Augen, bevor er sich dazu herbeilassen konnte, Land und Leute einem Nachfolger zu übergeben.
So ist auch er nicht verwest und bildet den Schlußstein in der Reihe seiner Ahnen, in des Wortes ureigenster Bedeutung.
Verschiedene Geschlechter herrschten seitdem über das Land, und das Volk vergaß im Laufe der Jahrhunderte das Wunder, das einst hoch und niedrig mit Angst und Schrecken erfüllt hatte.
Da ließ – es ist noch gar nicht so lange her – ein Malersmann mit wallendem Bart geheimnisvoll seine Stimme vernehmen. Als die Osteroder die Ohren spitzten, wurden sie von ihm daran erinnert, daß in der Gruft der Marktkirche die letzten ihres alteingesessenen Fürstengeschlechtes in Stein gebannt auf Erlösung harrten. Erlöst aber könnten sie werden, nur müsse man den rechten Augenblick abpassen. Und dieser Augenblick sei gegeben, wenn ein Wechsel in der Regierungsgewalt über das grubenhagensche Land eintrete. Komme das Land unter segenspendende Hände, so würden die Steingestalten, mit Salz überschüttet, noch einmal zum Leben erwachen und dann auf ewig entschlummern und vermodern wie alle anderen Menschen.
Auf diese Kunde hin öffnete man die schon verfallenen Grüfte und fand unter Schutt die herzoglichen Steinmumien.
Sie wurden an das Tageslicht gebracht und an der Wand um den Altar der Marktkirche aufgestellt. Damit war jedem Gelegenheit gegeben, den Zauber zu vertreiben, Erlösung zu bringen und zu erfahren, ob dem Lande Glück beschieden sei.
Aber niemand hat bisher gewagt, die Salzprobe an den Menschensteinen zu versuchen. Es geht das Gerücht, der Anblick würde unerträglich sein, wenn der Stein sich wieder zu Fleisch verwandele, wenn der Tod dem Leben weiche und das Leben wieder dem Tode.
So steht die steinerne Schar auch heute noch um den Altar herum. Wartet wie wir auf eine bessere Zeit, in der zu erwachen es sich lohnt, wenn auch nur für einen Augenblick, um selig dann wieder zu entschlafen. Wartet auf eine bessere Zukunft unseres Landes. Unseres großen deutschen Vaterlandes.
Darum ist es mir manchmal auch heute noch, als sei alles wirklich so, wie ich es soeben erzählt und wie mein Glaube gewesen ist, als ich noch vor Beginn der Schulzeit den Kindergottesdienst besuchte. –
Wenn ich damals Sonntags die Kirche betrat, betrachtete ich mit immer neuem Grausen die bewaffneten Herren und ihre steifmodischen Damen. Das Schlimmste aber war für mich, daß die ganz kleinen Knaben ihren Platz auf den niedrigsten Bänken dicht vor den Schreckensgestalten hatten. Mußte man da nicht wirklich Angst haben, es könne jemand kommen und die versteinerten Körper mit Salz bestreuen? Mir war es, als hörte ich schon das Scharren ihrer Füße, das Rauschen ihrer Gewänder, das Rasseln ihrer Panzer, das Klingen ihrer Waffen.
Ich saß gewöhnlich mit dem Rücken gegen den schwarzen Philippus und schielte voll Bangen zu seiner Frau Clara hin, die mir die unheimlichste Gestalt von allen war. Wenn ich mir die Begegnung mit einem Schloßgespenst ausmale, so tritt mir noch jetzt – bei aller Hochachtung vor der verstorbenen Frau – die Herzogin Clara vor Augen.
Menschlicher schien mir der alte Philippus, der Mann mit dem Vollbart, welcher die Sakristei bewacht.
Tasteten die Sonnenstrahlen durch die gotischen Fenster, und huschten ihre Schlagschatten über die stummen Männer und Frauen an der Wand, so wurde ich selbst in einen Bann versetzt; dann sahen meine Augen, was sonst niemand sah: bald zuckte ein Ritter mit dem Arm, bald hob ein anderer den Kopf und bewegte den Mund, als wollte er mit mir reden. Wie hypnotisiert stierte ich auf die Gesichter, die ihr Leben von der Sonne borgten. Ich aber erstarrte mehr und mehr und wurde selbst langsam zu Stein.
Lange Zeit habe ich den Kindergottesdienst gemieden. Die brennenden Weihnachtsbäume fanden mich erst in der Kirche wieder. Hunderte von Kindern, die ich sonst nie bei dem sonntäglichen Gottesdienst antraf, füllten dann die Bänke. Sie alle lockten freundliche Bilder und fromme Wandsprüche, welche als Weihnachtsgaben verteilt wurden. Ich war jedoch noch aus einem anderen Grunde erschienen. Wegen des großen Andranges, der an diesem Tage stets zu sein pflegte, konnte ich mich dorthin setzen, wo es mir gefiel, – weit ab von den Gespenstern aus Sandstein und Schiefer.
Beim Schreiben dieser Zeilen muß ich unwillkürlich stille Vergleiche ziehen zwischen dem verzauberten Kaiser Barbarossa im Kyffhäuserberg, den die Raben umfliegen, und den versteinerten Herzögen von Grubenhagen, deren »Alte Burg« Fledermäuse und Eulen umflattern. – – So harren Kaiser und Herzöge weiterhin der Erlösung.
Die alte Burg. Auch sie habe ich früher nur gefürchtet, ja sogar gehaßt. Und das kam so.
Bei Ausgrabungen vor dem zerborstenen Turm hatte man verkohltes Holz, Knochen und das Siegel der letzten Bewohnerin der Burg gefunden. Mein Vetter erzählte nun wahre Räubergeschichten von den Dingen, die man dort angetroffen. Die Hauptrolle spielte dabei ein ungeheures Pferdegerippe, welches, fest zusammenhängend, gesattelt und gezäumt zu Tage befördert sei. In dem großen Mauerspalt, welcher die Turmruine in zwei Teile zerlegt, habe man es eingeklemmt. Wenn der Wind die alte Burg umtose, so höre man es klappern. Abends aber stecke es den weißen Schädel aus dem Mauerspalt und unterbreche die Kirchhofsstille mit einem schauerlichen Wiehern.
Der Gedanke an dies gräßliche Pferdegerippe ließ mich nicht los. In mein kindliches Abendgebet flocht ich stets die Bitte hinein, der liebe Gott möge mich nicht von diesem Pferde träumen lassen. Denn Abend für Abend erschien mir im Traum die Alte Burg und der grinsende Pferdeschädel. Schweißgebadet wachte ich jedesmal auf und fand mich nur schwer wieder in den Schlaf hinein.
Lief ich am Tage nach dem Kirchhof und sah mir die Burg genau von allen Seiten an, so konnte ich mich stets davon überzeugen, daß in der großen Mauerspalte nur abgebröckeltes Gestein und dünne Grashalme vorhanden waren.

Alte Burg.
Begann es aber zu dämmern, so gewahrte ich schon von weitem – in die Nähe wagte ich mich ja dann nicht mehr – wie sich die weißen Knochen deutlich von dem grauen Gestein abhoben.
Ist es zu verwundern, daß ich den Anblick der Ruine mied, wo ich nur konnte?
Wenn die Alte Burg von weitem auftauchte, so drehte ich den Kopf sofort nach der entgegengesetzten Richtung, solch Grauen flößte sie mir ein.
Mit besonderem Unbehagen ging ich abends durch die »Freiheit«. Bei jeder Lücke, welche zwischen den Häusern war, drohte mir die Burg vom Berge her, und ich war froh, wenn ich die Häuser von »Klein Venedig« erreicht hatte und unbesorgt nach rechts und links schauen konnte. –
Ich habe mich längst mit der Alten Burg ausgesöhnt. Mit den Jahren verlor sie für mich alles Schreckhafte, und oft haben wir Jungens in dem Burghof getollt. Mein liebster Spielkamerad, der große »Sösekönig« (Gockel), wußte einen Weg, auf dem er fast bis zur Mitte der Ruine gelangte. Er stand dann plötzlich hoch über uns, und übermütig schallte sein helles Jauchzen von einem der Turmeingänge herab.
Der Krieg hat ihn still gemacht, und traurig winkt das Bäumchen auf dem Turm, wenn es auf seinen Grabhügel herniedersieht.
Wenn wir auch auf dem Kirchhof nicht lärmen durften und der alte Wärter uns oft genug fortjagte, wir waren immer wieder auf dem Burghof zu finden.
In dem Wall ist eine kammerartige Oeffnung; hier hausten wir, als wären wir die Burgherren, und richteten uns dort wohnlich ein.
Als vor Jahren eine kinderreiche Familie durch eine Feuersbrunst obdachlos wurde, hat sie in diesem Gemäuer längere Zeit zubringen müssen. Trotz aller Not hatte sie kein besseres Unterkommen gefunden. –
Eine seltsame Neugier trieb uns auch zu den vielen Grabgewölben, deren es damals noch eine größere Anzahl gab und die nur durch eine Holztür von der Außenwelt abgeschlossen waren. Diese Türen hatten Luftlöcher, durch die wir nur ganz behutsam guckten, denn jeder Osteroder Junge weiß, daß man davon eine »dicke Nase« bekommen kann.
Weniger scheu waren wir, wenn wir an der alten Johanniskirche vorbeigingen. Dann hatte jeder eine Hand voll Steine und warf damit in die dunkle Kelleröffnung, bis die Zinnsärge mürrisch mit ihrem »Peng« antworteten.
Die größte Anziehungskraft besaß für uns Jungens die Schildwache mit der Stadtmauer und den kleinen Befestigungstürmen.
Die Schildwache. Zerbrochene Teller, Glasscherben, Spiralfedern, Konservendosen, Asche, Brennesseln und Wucherblumen. Trübe Pfützen und Steingeröll. Weiter will ich das Bild nicht ausmalen. Am Tage nicht begangen, weil man sehen konnte, nachts nicht begangen, weil man nicht sehen konnte und Laternen sich noch nicht in die Schildwache wagten.
Hatte es geregnet, so war die Gasse mit einem dicken schwarzen Brei angefüllt, welcher eine rührende Anhänglichkeit für die Stiefel, Schuhe und Holzpantinen zeigte und sie vor lauter Liebe verschluckte. Uns war der schlammige Kot Kuchenteig. Mit zwei Holzstücken formten und walzten wir die zähe Masse wie die Mutter vor Weihnachten den Honigkuchen.
Bedeckte der Winter das Moosrosental mit Schnee und Eis, so wurde die Schildwache die Lehrstätte für die kleinen Schlittschuhläufer.
Die ganze Schildwache war eine große Gosse, mit einem rauhen, mehrschichtigen Eise überzogen.
Wer Schlittschuh laufen konnte, floh diese wenig verlockende, holprige Eisfläche. Die Anfänger aber zog sie umsomehr an, weil ihr jede Glätte fehlte und sie daher nicht so heimtückisch war wie der Lehm-, der Kuh- oder der Pferdeteich. Die ganz Aengstlichen schnallten sich nur einen Schlittschuh unter, stießen mit dem unbelasteten Fuß auf den Boden und waren stolz, wenn sie auf dem einen Schlittschuh eine Strecke über das Gosseneis flogen, ohne hinzufallen. Die Mutigeren rutschten knickebeinig gleich auf zwei Schlittschuhen daher, hier und dort eine unfreiwillige Ruhepause machend.
Weckte die Frühjahrssonne die verträumten Gräser und Moose aus dem Schlaf, so daß sie neugierig aus allen Ritzen der Stadtmauer hervoräugten, so erwarteten uns in der Schildwache neue Freuden.
Dann gab es ein Klettern um die Wette, und mit katzenartiger Geschicklichkeit stiegen wir auf den höchsten Mauerrand. Wie die Turmseilkünstler liefen wir auf der Mauer entlang, ganz um Osterode herum. Wir waren zwar keine gern gesehenen Gäste bei den Gartenbesitzern, denn mancher Stein löste sich und fiel auf die Krokus- und Hyazinthenbeete, aber unsere jungen Beine trugen uns bald aus greifbarer Nähe.
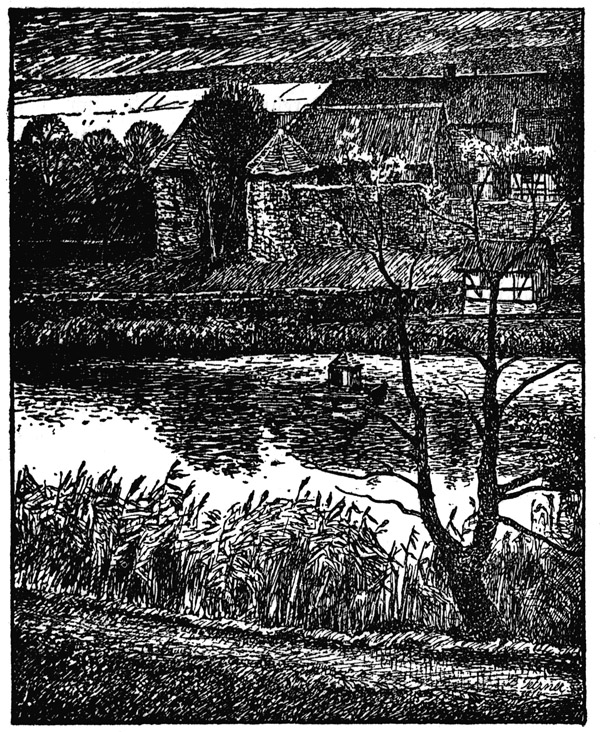
Sonnenturm und Pulverturm in der Schildwache.
Einer besonderen Verehrung erfreute sich der Pulverturm unweit des Neustädter Tores. Hier vermuteten wir die wunderlichsten Dinge. Wir meinten, er müßte vollgepfropft sein mit Kriegsgeräten aus vergangenen Jahrhunderten. Unsere Patrouillenvorstöße waren ähnlich wie bei dem Kellerloch der Sankt Johanniskirche. Wir warfen Steine in die Turmöffnung und horchten auf den Klang. Es hallte aber immer nur ein dumpfer Aufschlag aus der Tiefe.
Unsere Einbildungskraft sagte uns sofort, daß dort unten im Turm eine große Trommel brumme. Diese wollten wir um jeden Preis uns holen. Nach verschiedenen mißglückten Versuchen gelang es auch dem Größten unter uns Kleinen, in die Tiefe des Turmes zu steigen. Er suchte und suchte. Fand aber nur abgebröckeltes Mauerwerk und morsche Balken. Mit Mühe kam er wieder nach oben und berichtete von dem, was er gesehen. Wir glaubten ihm nicht. Die große Trommel müsse dort unten liegen. – Und sie liegt dort auch heute noch.
Nur im Sommer war die Schildwache nicht unsere besondere Freundin. Da gab es doch jenseits der Stadtmauern luftigere Plätze zum Spielen.
Wenn aber der Herbstwind von den Obst- und Nußbäumen die Blätter pflückte und den befestigten Rundgang um die Stadt damit schmückte, dann waren wir Jungens dort wieder versammelt. Hier und da bildeten sich Trüppchen: Neustädter und Krummebrucher, Marktbürger und Marienvorstädter. Wehe, wenn zwei solche Abteilungen aufeinanderstießen. Dann hagelte es Steine, und mit Hurra ging es zum Nahkampf über.
Die gefährlichsten Gesellen waren die Marienvorstädter. Diese zogen gleich ihre Taschenmesser und hatten meistens ihre »großen Brüder« bei sich. Besonders schlimm war es, wenn ein Angehöriger eines anderen Stadtteiles den Weg durch die Marienvorstadt antreten mußte. Gewaltige Prügel hatte er zu erwarten, und oft kam einer mit blutigem Kopf nach Hause. Darum war der Ruf: »Warte, ich schnappe dich doch noch und sage es meinem großen Bruder!« mit Recht sehr gefürchtet.
Nicht zu vergessen sind die Freiheiter, welche besonders bei den Kämpfen um das Osterfeuer den Marienvorstädtern an Erbitterung nicht nachstanden. Noch heute habe ich neben meinen Mensurnarben einen kleinen Denkzettel auf dem Kopf, den ein Stein der Freiheiter bei mir zurückgelassen hat.
Die Kämpfe in der Schildwache waren gewöhnlich die Ausartung von unserem Soldatenspielen. Das Spielen war das Manöver und die Prügeleien die Schlacht.
Drei ruhende Pole gab es allein in der Schildwache, die sich von allem Leben und Treiben nicht stören ließen und die zu allen Jahreszeiten und bei jeder Witterung anzutreffen waren.
Jeden Sonnabend, nachdem der Wochenlohn gezahlt, standen sie bei dem Hintergebäude von Vollmers Färberei und ließen den Schnapsbuddel kreisen. Das Kollegium begann mit langen ernsten Reden und endete gewöhnlich mit Schimpfworten und mühsamem Lallen. Dies Bild hat man jahrelang beobachten können. In guten Zeiten erhöhte sich die feierliche Runde wohl auf fünf.
Die Furcht vor dieser Trinkerecke hatte Frauen und Mädchen die Schildwache verleidet, und es ist sehr zu bedauern, daß hierdurch ihr Ruf gelitten hat.
Jetzt sind alle erwähnten Uebelstände längst beseitigt. Manch ernster Forscher geht dort sinnend seinen Weg, sich im Geist in die Zeiten alter Bürgerherrlichkeit früherer Jahrhunderte zurückversetzend. Denn wenig Städte gibt es noch, deren Stadtbefestigung in solch hervorragender Weise erhalten ist wie bei uns. Die trotzigen Mauern sollten wir darum als eine seltene Zierde unseres Stadtbildes betrachten und als historisches Denkmal lieb und wert halten.
All die Spottverse, die wir den glucksenden Männern nachsangen, darf ich leider nicht wiedergeben; ich könnte sonst wegen Beleidigung vor den Kadi zitiert werden. Nur der eine sei erwähnt:
»Schimmeler ist dicke,
hat den Buddel in der Ficke.«
Niemand wird aber wohl etwas dabei finden, wenn ich eingehender von anderen Typen erzähle, die lange Zeit notwendig zum alten Inventar der Stadt Osterode gehörten.
Gustchen. Sie ist jetzt tot. Das ist wirklich schade!
Sie wirkte so herzerfrischend, so belebend mit ihrer originellen Dummdreistigkeit. Sie hatte niemanden zum Feind. Sie war die Freundin aller, und gern gab ihr jeder, bei dem sie vorsprach. Jeder war mit ihr vertraut, und jeder hatte für sie das liebe »Du«.
Ich habe sie kennen gelernt als ganz kleiner Knirps und als Visitenkarte von ihr eine Handvoll – Roßäpfel ins Gesicht geworfen bekommen. Das war in der Dörgestraße vor dem Kurpark. Sie kehrte gerade einen Haufen Pferdemist zusammen, und wir frechen Bengels riefen ununterbrochen: »Gustchen, 's ist ja doch wahr! Gustchen, 's ist ja doch wahr!« Sie ließ uns immer näher kommen und arbeitete in stoischer Ruhe weiter. Dann drehte sie sich mit einem plötzlichen Ruck um, und ehe ich fortlaufen konnte, hatte ich meinen Lohn. Mit lautem Gezeter, die eine Hand kampfbereit erhoben, in der anderen eine korbähnliche Tasche, die sie immer begleitete, ging sie zur Offensive auf uns über. Wir Lausejungens waren aber schneller als sie und entrannen der zweiten Ladung ihrer gefürchteten Geschosse.
Sie war zu menschenfreundlich, sich der Steine zu bedienen. Sie hat stets die gleichen Kampfmittel angewandt, die, obgleich ungefährlich, in der Wirkung doch noch abschreckender waren als die dicken »Käserlinge« Umbildung für Kieserlinge = Steine. aus der Schildwache.
Warum ihr seelisches Gleichgewicht Jahr aus Jahr ein durch den Ruf »'s ist ja doch wahr!« gestört wurde, habe ich nie mit Sicherheit ermitteln können. Die Ansichten der Osteroder waren hierin, wie in so manchen andern Dingen, sehr verschieden.
Die meisten behaupteten, sie sei die Tochter eines reichen Bürgermeisters, der einen stattlichen Landbesitz gehabt hätte. Gustchen hätte ihn beerbt, und aus purem Geiz wohne sie im »Heiligen Geist«. Ihre Schätze aber habe sie sicher versteckt. Wenn sie nun schmutzig und ärmlich einherging und man ihr vorhielt, daß sie aus guten Verhältnissen stamme und daß sie viel Geld habe, dann wollte sie davon nichts wissen. »Gustchen, 's ist ja doch wahr!« rief man ihr darum immer und immer wieder zu.
Daß sie habgierig war und geizig zugleich, läßt sich nicht abstreiten. Sie sammelte alles auf, was sie bekommen konnte. Sie war aber auch mit jedem zufrieden, was man ihr gab. Das zeigte schon ihr Aeußeres. Ihr linker Fuß steckte in einem gelben Damenschuh, der rechte in einem zerrissenen Männerschaftstiefel. Eine dunkle, stets schief sitzende Haube schmückte ihren Kopf. Die übrige Kleidung war unkontrollierbar. Sie wurde verdeckt von einem großen, faltigen, blau gedruckten Umhang, wie ihn die Marktfrauen über den Kiepen tragen. So war sie jedem bekannt und schlenkerte mit ihrem Sammelkorb in die ihr vertrauten Reviere, wo mitleidige Menschen wohnten und ihr gerne das reichten, was von den Mahlzeiten für sie übrig blieb oder an Kleidung zu entbehren war. Wozu sie die Kleidung und die nicht eßbaren Geschenke verwandt hat, hat man nie erfahren.
Böse Menschen legten freilich den oben erwähnten Neckruf anders aus und dichteten ihr die unglaublichsten Schreckenstaten an. So soll sie ein Kind gehabt und dieses, mit Mostrich bestrichen, verspeist haben. Wenn sie das zu hören bekam, dann wurde sie fuchsteufelswild, und nicht schnell genug konnten die naseweisen Fragesteller ihrem Zorn entfliehen.
Die historische Untersuchung, »was doch wahr war,« überlasse ich anderen. Irgend etwas muß aber wahr gewesen sein, das das Blut dieser sonderbaren Person immer wieder in Erregung brachte.
Traf man Gustchen auf der Straße, so hörte man schon von weitem ihr »Hihi, n' Tag, hihi, Leber noch frisch? Hihi?« Und jeder begrüßte sie, blieb wohl auch bei ihr stehen und hatte für sie einige Scherzworte.
Wenn Gustchen einheimsen ging, war sie stets bescheiden und unaufdringlich. Sie stand an der Tür und ließ nur in einem fort ihr bekanntes »Hihi« ertönen. Fragte man sie, was sie wollte, so lachte sie nur. Hatte sie ihre Spende erhalten, so wünschte sie Gesundheit und langes Leben und lachte sich zum Hause hinaus.
Regelmäßig machte sie ihre Besuche zum Jahreswechsel. Und wenn sie einmal nicht erschien, so wurde sie geradezu vermißt. Man hatte sich an sie wie an ein gutmütiges Haustier gewöhnt.
Gustchen hatte auch eine gute Nase. Und als einst in der Northeimerstraße eine nette, runde Hochzeit gefeiert wurde, erschien sie prompt, um sich von Mutter Liese, ohne die ja in Osterode keine Taufe, Konfirmation oder Hochzeit gefeiert werden konnte, einen kräftigen Küchenhappen zu erbitten. Gustchen, bescheiden und unaufdringlich wie immer, war in der Abenddämmerung erschienen, gerade als das Brautpaar sich heimlich auf die Hochzeitsreise begeben wollte. Draußen stand schon der Wagen. Dankbaren Herzens wollte Gustchen den Neuvermählten ihre Glückwünsche darbringen. So stellte sie sich in dem Vorgarten auf, und als das Hochzeitspaar schnell in dem Wagen verschwinden wollte, sang sie laut und vernehmlich:
»Stille Nacht,
Heilige Nacht.
Alles schläft,
Einsam wacht usw. usw.« –
Die Ritter schauten mutig drein und in den Schoß die Schönen ......
Nicht gerade nach jedermanns Geschmack war es, Gustchen beim Stiefelputzen zuzusehen, eine Arbeit, die ihr hier und da anvertraut wurde. Damit die Schuhe ja auch recht schön glänzten, leckte sie an die Auftragbürste, tupfte diese in die Schuhwichse und fuhr dann damit über das Leder her. So kam es, daß Stiefel und Zunge nach kurzer Zeit sich durch ein wundervolles, tiefglänzendes Schwarz auszeichneten.
Man darf nicht kleinlich sein: der Erfolg heiligt eben die Mittel!
Gustchens Gesicht hat sich die langen Jahre unserer Bekanntschaft hindurch nicht verändert. Alt, runzelig und doch lustig waren die Hauptmerkmale. Ich kann mir nicht denken, daß Gustchen auch einmal jung gewesen ist. Nur ihr Sinn war manchmal empfänglich für den Werdegang der Zeit, und so fügte sie während des Krieges ihren Begrüßungsworten stets den Spruch hinzu: »Gott strafe England!«
Was würde Gustchen jetzt wohl rufen?
Kinder und Narren sprechen die Wahrheit. Und die Wahrheit zu hören, wäre uns heute so bitter nötig.
Gustchen aber sagt nichts mehr.
Sie ist tot.
Das ist wirklich schade. –
Kuckuck-lala. Auch er lebt nicht mehr. Er war ein feiner Mann und pflegte mit dem jeweiligen königlich preußischen Landrat in einem Atem genannt zu werden.
Er stand mit ihm auf ein und derselben Liste und hatte sogar die Ehre, daß sein Name mit an erster Stelle stand; dann kamen noch einige andere Herren, die sich auch durch etwas Besonderes auszeichneten und erst ganz zum Schluß der Herr Landrat.
Deine Gedanken, lieber Leser, sind durch die vielen Wahlen verwirrt. Du hast eine Kandidatenliste für den Reichstag oder den Landtag vor Augen, vielleicht auch schwebt dir eine Liste für die Wahl zur verfassunggebenden Kirchenversammlung oder ein sonstiges Gebilde vor, welches mit einer Wahl in verwandtschaftlichen Beziehungen steht. Weit gefehlt.
Die Liste, von der ich spreche, stellte die Behörde selbst auf, und der Landrat setzte dann zum Schluß seinen Namen als Unterschrift darunter. Freilich konnte nicht jeder ohne weiteres darin eingetragen werden. Gewisse Voraussetzungen mußten gegeben sein. Und die hatte Kuckuck-lala erfüllt: er trank.
Diese Liste war es aber, die Kuckuck-lala die Freude am Dasein nahm. In jeder Schenke, in jedem Schnapsladen prangte sie an der Wand, und tränenden Auges floh Herr Kuckuck-lala die ungastlichen Stätten.
Mit verbittertem Gesicht zog er darum durch die Straßen. Wo aber das kleine, verhutzelte Männchen erblickt wurde, hallte ihm der Ruf entgegen: Kuckuck-lala, Kuckuck-lala. Ob er auch drohte und fluchte, wie ein Schwarm lästiger Stechmücken umtänzelte ihn das junge Volk, und von Straße zu Straße pflanzte sich der Kuckucksruf fort.
Eigentlich hätte er darüber gar nicht böse sein sollen. Denn nur außergewöhnliche Menschen erfreuen sich besonderer Huldigungen.
Aber ihm fehlte jeder Ehrgeiz, und außerdem war ihm jene marktschreierische Reklame für die Ausübung seines lichtscheuen Gewerbes recht hinderlich.
Wenn seine Firma auch nicht im Handelsregister oder in sonst einem Gewerbeverzeichnis stand, so war seine Tätigkeit in Osterode doch nicht verborgen geblieben.
Er weissagte. Und sein Handwerkszeug bestand aus einem selten schmierigen Spiel Karten.
Mit diesem fand er Einlaß zu den besten Häusern.
Auf der Straße nahm er seine Karten nicht aus der Tasche. Der Kunde mußte sich bequemen, mit ihm eine Wirtschaft aufzusuchen. Hier wurde für Kuckuck-lala eine Brause oder ein Zitronenwasser, für den Kunden ein doppelter »Wiederholt« bestellt. Ohne daß der Wirt es merkte, hatte Kuckuck-lala die Getränke vertauscht und kam so, trotz Säuferliste, immer wieder zu seinem Rausch.
Von seiner Persönlichkeit ist eigentlich nichts Beachtenswertes zu berichten. Auch weiß ich nicht, warum man ihm diesen harmonischen, klangvollen Namen nachrief, der die dunklen Straßen in einen lichten Frühlingswald verwandelte, wenn die Jungens und Mädels ihn fröhlich von einer Häuserecke zur anderen weitergaben.
Aber gerade die Musik seines Beinamens ist es, die ihn bekannt gemacht hat und die vielen unvergeßlich geworden ist.
Eigenartig war Kuckuck-lalas Tod. Nachdem im Krankenhaus sein Ableben bereits festgestellt war, fing er plötzlich wieder an, sich zu regen, und verlangte nach Brot. Drei Tage darauf starb er zum zweiten Male und wachte nicht wieder auf.
Was dem einen »sin Uhl«, ist dem andern »sin Nachtigall«.
Und so fand ich den Namen » Kikeriki-mäh«, den wir einem großen Manne mit schwarzem Vollbart nachriefen, häßlich, ja sogar wehtuend für die Ohren, ganz das Gegenteil von Kuckuck-lala.
Vielleicht kam der Eindruck auch daher, weil uns »Kikeriki-mäh« unheimlich war und wir vor ihm Angst hatten, während wir über Kuckuck-lala lachten. Das »Kikeriki- (Pause) -mähhh« schrien wir nur aus ganz großer Entfernung hinter seinem Träger her, welcher bei seiner Rüstigkeit uns leicht hätte verprügeln können. Dazu hätte er wirklich Grund gehabt, denn er war ein ehrenwerter Mann.
Und doch mied Kikeriki-mäh die belebten Straßen und ging gewöhnlich durch einsame Gassen, die Schildwache bevorzugend.
Man sagte von ihm, er habe einst einem Hahn den Hals durchgeschnitten und das warme Blut getrunken. Das Tier habe in seiner Todespein so laut gekräht, daß die Schafe im Stall ihre Teilnahme durch anhaltendes Blöken kundgaben. Das ist natürlich dummes Zeug, das kein ernsthafter Mensch glauben wird. Die guten Nachbarn indessen sorgten dafür, daß das komische Orchester ihm den Namen einbrachte: Kikeriki-mäh. –
Eine andere Straßenerscheinung. » Bertha-singemal!« Und sie sang. Für zwei Kupferpfennige hattest du eine Sondervorstellung. Sie stellte sich in einen »Tritt« Hauseingang mit Stufen. und leierte das Lied vom »Kleinen Postillon« herunter. Immer dasselbe Lied. Ein Ton dem andern gleich, wie eine Negerweise.
Bertha-singemal verdiente am Tage ihr Geld durch Kiesgraben im Sösebett. Ihren Nebenerwerb durch Singen betrieb sie abends auf dem Heimwege. Mir hat die alte Frau eigentlich immer recht leid getan, und oft gab ich ihr ein Zweipfennigstück und schenkte ihr gern obendrein den Gesang.
Wenn ich in meinem Skizzenbuch weiterblättere, muß ich leider manche Seite überschlagen, die Kunde geben würde von Gestalten, die noch nicht so von der Gegenwart losgelöst sind, als daß ich sie in das grelle Licht meiner Betrachtungen ziehen könnte. Vielleicht komme ich später auf sie zurück.
Nur noch einen sonderbaren Heiligen will ich erwähnen. Er ist nicht aus Fleisch und Blut. Er hört nicht, sieht nicht, fühlt nicht. Er hat geschwollene Backen und doch keine Zahnschmerzen. Die fleißigen Kirchenbesucher der Schloßgemeinde sind oft über ihn mit den Augen geglitten, aber nur wenige werden ihn kennen gelernt haben.

Der alte Amtshof mit Schloßkirche.
Es ist einer der zwölf Apostel, welcher seinen Platz am linken Flügel des Altars hat. Als den geschnitzten Heiligenbildern ein neues Oelfarbenkleid angezogen wurde, übersah der tüchtige Meister, daß der hölzerne Jünger einen Backenbart trug und pinselte das ganze Gesicht, einschließlich Bart, mit heller Fleischfarbe über.
Mir würde vielleicht auch diese Verunstaltung entgangen sein, wenn nicht ein kleiner Altersgenosse, die Seele voll Sonnenschein und den Schalk im Nacken, in der Kirche zu Hause gewesen wäre und mir den frommen Mann persönlich vorgestellt hätte.
Wenn wir mit unseren Kinderaugen in der Kirche Umschau hielten, so wußten wir uns auch so manches andere nicht zu deuten. Da waren zur Linken und zur Rechten der hannoverschen Königsloge je ein schwarzer Teufel. Teufel sind aber doch böse Geister! Was haben die in der Kirche zu tun? Nach unserem Empfinden mußten dort pausbäckige Engelknaben schweben.
In dem Raum über der Sakristei stöberten wir ein uraltes hölzernes Wappen auf, welches als Wappenbild einen – Kamm trug. Einen richtigen Kamm zum Kämmen. War das nicht spaßig? Die ehrwürdige Kirche mag über unser helles Lachen den mit der Turmspitze gekrönten Kopf geschüttelt haben. –
Viele Jahre sind seitdem verflossen. Wenn ich jetzt an diese glücklichen Kindertage zurückdenke, ist mir das Weinen näher als das Lachen. In Frankreich liegt der Jugendfreund begraben. Die Mauer der Schloßkirche trägt einen Gedenkstein an ihn.
Nicht weit von der Schloßkirche der Rollberg, die Straße, welche der Stadt den Charakter gibt. Eine große Familie ist hier versammelt: Haus steht neben Haus, Zusammengehörigkeit und verwandtschaftliche Züge verratend.
Man sieht ordentlich, wie sich die drei roten Backsteinbauten schüchtern in den Hintergrund drängen, als wüßten sie, daß sie gar nicht hierher gehören und Fremdlinge am Rollberg sind.
Sie sind entstanden in einer Zeit, wo Osterode sprichwörtlich die Stadt der Brände war, wo ein Schadenfeuer wie etwas Alltägliches empfunden wurde. Wenn man damals Osterode auf einige Tage verlassen hatte, so fragte man bei der Rückkehr seine Lieben:

Der Rollberg.
»Hat es noch nicht wieder gebrannt?«, etwa in dem Tone: »Hat es geregnet? Sind Briefe angekommen?«
So hatte der Rollberg durch Feuersbrunst einige alte, schöne Häuser verloren, die man leider durch schablonenhafte Gebäude aus rotem Backstein ersetzte. Mit Liebe errichtete, stilgerechte Fachwerkhäuser hätten sich als rechtmäßige Nachkommen der Rollbergfamilie dort wohlgefühlt. Den gleichen Fehler beging man, als mehrere Häuser auf dem Spritzenhausplatz niedergebrannt waren. Auch hier ist das Stadtbild, das ehemals mit reichgeschnitztem Balkenwerk prahlte, durch die neuen Steinhäuser beleidigt.
Das vornehmste Mitglied der Rollbergfamilie heißt Ritter- oder Gespensterhaus. Es hat bisher allen Feuersbrünsten und Stürmen der Zeit Trotz geboten. Nicht ohne gelinden Schauer gehen die älteren Sösebürger an ihm vorüber. Sie wissen, daß es dort nicht geheuer ist und können mancherlei Spukgeschichten von ihm erzählen. Das Hausgespenst ist ein geharnischter Ritter, welcher schwere Ketten hinter sich herschleift. Wenn das Gespenst umgeht, knarren die Treppen, und ein Rasseln und Poltern durchdröhnt das ganze Haus, daß die Bewohner aus dem tiefsten Schlaf aufschrecken.
Selten hat jemand gewagt, dem Ritter entgegenzutreten. Und doch war es das einzige Mittel, den Spuk für längere Zeit zu bannen. Fühlte sich das Gespenst von Menschenaugen erblickt, so flüchtete es in den Keller und verschwand dort spurlos. Monate, ja Jahre gingen darüber hin, bis es wieder auftauchte.
Mit Vorliebe trieb es sein unheimliches Wesen, wenn Unwetter tobte, wenn Schnee oder Regen gegen die Fenster klatschten und der Sturmwind die Ziegel von den Dächern löste. Dann konnte man mit Sicherheit auf seinen Besuch rechnen. Die früheren Bewohner des Ritterhauses hatten darum die größte Last, im Herbst oder zur Winterszeit ein Hausmädchen zu bekommen. Trotz hohem Lohn war keine zu bewegen, im Ritterhaus eine Stellung anzunehmen.
Es war sonderbar, daß es sich jedesmal wie ein Lauffeuer durch ganz Osterode verbreitete, wenn der Geist erschienen, und das allgemeine Tagesgespräch war dann: gestern hat es im Ritterhaus wieder »gespükt«. Am besten waren darüber die Schneiderinnen, Plätterinnen und Waschfrauen unterrichtet. Und es ist Tatsache, wenn ich behaupte, daß es auch jetzt noch eine große Zahl von Leuten in Osterode gibt, die einen heiligen Eid darauf ablegen würden, daß die Spukgeschichten wahr sind. Ich sprach heute gerade mit meinem alten Freund Peter Knötchen aus dem Krummenbruch darüber, und dieser erklärte mir allen Ernstes, er wolle lieber wohnungslos sein, als im Ritterhaus nächtigen.
Wir Jungens schrieben dem geschnitzten Ritter an der Ecke des Hauses besondere Wunderkräfte zu. Wir meinten, er stiege nachts von seinem Sockel und sei selbst das Gespenst, welches die Hausbewohner erschreckte. Auch hieß es, man brauche um Mitternacht, kurz bevor er den Sockel verließ, ihn nur auf die rechte große Zehe zu drücken, dann würde er über die Zukunft Auskunft geben. Leider wurden wir immer schon lange vor Mitternacht ins Bett geschickt, so daß uns die Gelegenheit fehlte, die Weissagungsgabe des Ritters zu erproben.
Etwas Wahres muß daran sein. Denn schon vor Ausbruch des Krieges vertauschte er seine glänzende silberne Rüstung mit einer feldgrauen, zu einer Zeit, wo das Soldatenlied noch Geltung hatte:
Zweifarbig Tücher,
Schnauzbart und Sterne
Haben die Mädchen
Alle so gerne.
Die Mimikry ist für ihn bedeutungslos geworden, denn unser tapferes Heer hat den Feind nicht in unser Land marschieren lassen.
Von größtem Dunkel ist aber die Sage umgeben, daß das Ritterhaus mit einem geheimen Gang in Verbindung steht, der sich von der Alten Burg unter der Stadt herzieht und unter dem Wachtturm auf dem Uehrder Berge mündet. Von dem Keller eines der ältesten Häuser der Neustadt aus soll man auf diesen Gang gestoßen sein. Doch nur wenige Schritte habe man ihn betreten können, weil man ihn ganz zusammengefallen vorgefunden habe. Ich weiß nicht mehr genau, was man aus ihm zu Tage gefördert haben will. Ich glaube, es waren eine verrostete Sturmhaube und die Knochen eines großen Vogels. Obwohl die Entfernung von dem Wachtturm bis zur Alten Burg recht groß ist, so ließe die Kalksteinbildung des Uehrder Berges immerhin die technische Möglichkeit zu. Haben wir doch während des Krieges kilometerlange Gänge in den Kalksteingegenden Frankreichs gefunden, die Dorf mit Dorf verbanden und Zufluchtsstätten aus früheren Jahrhunderten waren.
Ich habe den Uehrder Berg nicht nach unterirdischen Gängen durchsucht. Wir Jungens zogen zu ihm hinaus, wenn die Bäumchen im Brautgewand des Wonnemonats standen. Wie des Jägers Herz beim Aufgang der Jagd auf den roten Bock höher schlägt, so konnten wir die Zeit nicht abwarten, bis die ersten Maikäfer surrten. Mit Zigarrenkisten bewaffnet, kletterten wir in die Bäume, schüttelten und lasen eifrig die Krabbeltiere auf. Wir unterschieden Könige, Müller und Schornsteinfeger. Die Könige prunkten anstelle eines Purpurmantels mit einem roten Brustschild. Den Müllern war das Brustschild mit feinen weißen Härchen bewachsen, daß es aussah, als hätten sie in Mehl gewühlt. Für gewöhnlich tragen aber die Maikäfer schwarze Schilder, und so bestand der größte Teil der Jagdbeute aus Schornsteinfegern.
Zwei zusammenhängende Maikäfer nannten wir eine Kutsche. Sie galt als besonders wertvoll und wurde sogar gegen Könige ausgetauscht. Wollten wir am nächsten Morgen die Kutschen aus den Maikäferkisten hervorsuchen, so waren sie stets auf unerklärliche Weise verschwunden, und wir ärgerten uns, die schönen Könige fortgegeben zu haben.
Am ertragreichsten für die Maikäferjagd waren die Bäume zwischen dem Galgenturm und dem König Georg-Pavillon. Errichtet auf dem Platz, wo früher der Galgen stand, hat der Pavillon die Tradition seines Vorgängers dadurch hochgehalten, daß er mit seinem freiliegenden Gebälk Lebensmüden Gelegenheit bietet, sich dort bequem in aller Ungestörtheit aufzuhängen. Und mancher hat auch davon Gebrauch gemacht. Wir Jungens spähten darum stets schon von der Rückseite des Pavillons aus durch die kleinen Ritzen, ob auch niemand in ihm baumele. Dann erst birschten wir weiter und füllten die größten Zigarrenkisten mit Käfern und Käferinnen.
Die gesamte Jagdbeute wurde den Hühnern als Futter gereicht. Maikäfer sind nämlich das beste Mittel, daß die Hühner »glucksch« werden. Bei unseren Minorkas hat es aber doch oft nicht angeschlagen. Jetzt weiß ich auch warum ...
Die Maikäfer mußten ferner zu allerhand Zeitvertreib herhalten. Sie ließen sich so schön den ängstlichen Mädchen ansetzen, die fürchterlich schrien, wenn solch ein Ungetüm sie am Hals zwickte. Abends, wo die Maikäfer nicht träge liegen, sondern gern in alle Welt fliegen, bekritzelten wir kleine Zettel, banden sie an ein Beinchen und sandten so Grüße in die Ferne. Hierbei sangen wir wohl dutzendmal die Strophe:
Maikäfer flieg,
Dein Vater ist im Krieg,
Deine Mutter ist in Pommerland,
Pommerland ist abgebrannt.
Maikäfer flieg!
Ein richtiger Osteroder Junge zeigte auch den Mädchen, daß er ein Junge ist. Er biß den Maikäfern in ihrer Gegenwart die Köpfe ab und schluckte sie herunter. Wenn die Mädchen dann entsetzt fortliefen und schrien, so wurde ihnen gegenüber mit ruhigem Ernst behauptet, die Köpfe schmeckten süß wie Zucker und in anderen Gegenden würde sogar Suppe von ihnen gekocht. Guten Appetit!
War die Maienzeit vorbei und folgten den Blättern überall die Blüten, dann stellten sich andere Lieblinge der Jugend ein: die Schmetterlinge. Auf der großen Wiese vor Fuchshalle haben wir sie gehascht: den kaiserlichen schwarz-weiß-roten Admiral (Malitaea cynthia), den neutralen, aufdringlichen Kohlweißling (Pieris Brassicae), das freundlich dreinschauende Tagpfauenauge (Vanessa Jo), den großen und den kleinen Fuchs (Vanessa polychloros und urticae), den goldenen Silberstrich (Argynnis Paphia), den behaarten, braunen Bär (Arctia Caja), den kleinen seidigen Bläuling (Lycaena Argus), den düsteren Trauermantel (Vanessa Antiopa) und den kanariengelben Zitronenfalter (Rhodocera rhamni).
Ein Sonnentag mußte es sein, wie man sie so selten im Leben hat. Strahlender Himmel, kein Wölkchen weit und breit und schlafende Winde. Sonst war alles Hoffen vergebens, und die bunten Sommervögel ließen sich nicht blicken.
Nur diese Vögel waren es, die wir fingen. Die gefiederten Sänger haben wir stets in Ruhe gelassen. Wenn wir auch keine Musterknaben waren (und auch keine geworden sind), Vögel haben wir nie getötet und Nester auch nicht ausgenommen. Das war uns ganz selbstverständlich und hätte der Ermahnungen unserer Lehrer garnicht bedurft.
Wohl manches Nest haben wir entdeckt, aber nie wurde es angerührt. Ja, wenn wir es gefunden hatten, so wurde sogar ausgemacht, niemandem die Entdeckung mitzuteilen, damit nicht neugierige oder rohe Hände das kleine Kunstwerk zerstörten. Von Zeit zu Zeit schlichen wir zu dem Busch oder dem Baum, um mit heiliger Scheu aus der Ferne den Fortschritt des Brutgeschäftes zu verfolgen.
Ich will nicht verraten, wo viel Brutstätten zu finden sind und welche Vogelarten wir angetroffen haben. Jeder Garten und jedes Gebüsch kann davon erzählen. Selbst in den Ritzen der Stadtmauer hatten sich lustige Vogelfamilien häuslich eingerichtet. In den jungen Schonungen längst der Söse nisteten die Vögel am liebsten.
Hier haben wir uns des schweren Verbrechens schuldig gemacht, unbefugt die Fischerei ausgeübt zu haben. (Reichsstrafgesetzbuch § 370, Abs. 4.)
Zentnerweise haben wir nun freilich die Sösefische nicht fortgeschleppt, und Angeln und Netze kannten wir auch nicht. Wir betasteten unterwärts die großen Steine. Ein kurzer Griff, und das silberne Maifischlein war unser. In eine kleine Konservenbüchse, halb mit Wasser gefüllt, wurden sie gesetzt. Hatte jeder von uns zwei oder drei Schuppenträger, dann traten wir den Heimweg an. Von der Rumpelkammer wurde das verstaubte Fischglas herbeigeschafft, für 5 Pfg. Ameiseneier gekauft, und wie eine kostbare Jagdtrophäe wurden die schwimmenden Silberlinge in ihrer neuen Behausung stolz auf den großen Familientisch gestellt. Nicht gerade zur Freude der lieben Eltern.
Um die Fische vor Langeweile zu bewahren, ergänzten wir unser Aquarium mit Wassermolchen und -molchinnen.
Bährs Wiese wird von einer Reihe Gräben durchquert. Im Sommer sind diese mit Schilf bewachsen. In dem bräunlichen Wasser wimmelt es von Wasserkäfern, Blutegeln und Molchen.
Uns interessierten nur diese.
Sie sind nicht so flink und gewandt wie die Fische, darum fiel es uns nicht schwer, sie zu greifen. Es gab allerdings auch Jungens, die sie nicht anfassen mochten, weil sie weich und schlüpfrig sind und so leicht Ekel erregen. Dies ist die einzige Verteidigungswaffe, von der sie den Menschen gegenüber mit Erfolg Gebrauch machen können.
Die Vettern der Wassermolche, die Feuersalamander, waren vor uns nicht sicher, wenn nach einem sommerlichen Regen plötzlich der Sonnenschein durchgebrochen war. Dann leuchteten die Söseniederungen in den habsburgischen Farben schwarz und gelb. Ueberall krochen die trägen Reptilien umher, ihren heimlichen Schlupfwinkeln zustrebend. Wir lasen sie auf, um sie als Ungeziefervertilger in die Gärten zu setzen. Ich habe über 20 Jahre lang beobachten können, daß die Salamander den neuen Heimplätzen treu geblieben sind. In meinen Augen waren diese Tiere verzauberte Märchengestalten, und ich hätte mich nicht gewundert, wenn ich einen Feuersalamander mit einem Goldreif auf dem Kopf gefunden hätte. Ich zähle diese Tiere mit zu den schönsten der Schöpfung und stelle sie auf dieselbe Stufe wie den einsamen Eisvogel, der an Wintertagen bald hier, bald dort am »Spazierweg« aufleuchtet.
Was da krabbelt, fliegt, kriecht und schwimmt für uns Jungens, was da blüht, duftet und grünt für die Mädels!
Bornemanns Kuhle Bei dem Sattelweg nach Schwiegershausen. ist übersät mit goldenen Himmelschlüsselchen.
Mädchen haben immer Angst, allein zu gehen. Drum waren wir stets bei ihnen, wenn es galt, dicke Sträuße von diesen dankbaren Frühlingsblumen zu pflücken.
Um den Klinkerbrunnen und die Jettenhöhle herum duftet es schwer von Maiglöckchen. Ich will nicht sprechen von der Zaubermusik, die aus dem klingenden Brunnen emporschwebt; ich will nicht die düstere Unheimlichkeit der Jettenhöhle schildern, die, Jahrtausende alt, mit ihrem Atem beengenden Eingang, ihren Felsblöcken, Schluchten, Seen und Teichen jedem unvergeßlich bleiben wird. Ich denke heute nur zurück an selige Maientage, wo wir bei Vogelgezwitscher die feingeformten und doch so giftigen Maiglöcken brachen.
Der Weg dorthin war zwar etwas weit. Und doch haben wir ihn heimlich oft gemacht.
Und dann der Lichtenstein!
Welch bunte Flora fanden wir dort! Ueberzeuge Dich selbst, schöne Leserin. Warte den Lenz ab und die Sonne, dann schenkt Dir der Lichtenstein den schönsten Strauß. Und hast auch Du Angst, allein zu gehen, – ich will Dich gern geleiten ...
Oder gehörst Du zu den spröden Mädchen, denen man zu Pfingsten Blaue vor die Tür streut?
Ich glaube es nicht. Du bist sicherlich eine von denen, die am Pfingstmorgen durch zwei Maienbäume hindurchgehen, die nächtlicher Weise an ihren Hauseingang genagelt sind. Es liegt etwas Edles in dieser alten Sitte, die Geliebte seines Herzens mit jungfrischem Grün zu ehren. Schade nur um die Bäumchen, die doch auch einmal ein Baum werden wollten.
Oder ist für die Liebste nichts zu schade?
Ich will diese Frage offen lassen. Ich würde vielleicht selbst in Gewissenskonflikte geraten. Ich bin früher sogar so dumm gewesen, den kleinen Mädchen all die Stellen zu verraten, wo im Frühling der Waldmeister, im Sommer die Walderdbeeren und im Herbst die Brommelbeeren üppig gediehen. Jetzt, wo ich älter, ich will nicht sagen klüger, geworden bin, behalte ich mein Wissen für mich.
So will ich denn auch schweigen von den Plätzen, wo über Nacht Champignons, Pfifferlinge, Reitzker, Maronen-, Stein- und andere Pilze auftauchten. Du hast es jetzt ja auch viel bequemer, Dir eine Pilzmahlzeit zu verschaffen. Du hast es nicht mehr nötig, mühsam Wald und Feld nach Pilzen zu durchstreifen. Unweit des Südbahnhofes sprießen jetzt die Champignons in ungezählten Mengen aus der Erde, überdeckt von Dächern und Türmchen, die wie Soldaten in Reih und Glied aufmarschiert sind.
Du sollst nicht von mir denken, verehrte Leserin, daß ich zum krassen Egoisten geworden bin, darum will ich Dir wenigstens etwas verraten, nämlich den Ort, wo es gute Weinbergschnecken gibt. Am oberen Rande der Freiherrlich v. Minigerodeschen Wiese zu Beginn des Uehrder Berges wirst Du recht viele finden. Ich gebe dies Geheimnis um so lieber preis, weil ich weiß, daß Du sie wahrscheinlich – doch nicht ißt, während sie mir früher schon recht gut geschmeckt haben und ich sie auch heute noch gern verzehre.
Wenn Du genügend Schnecken gesammelt hast, eile nicht sofort nach Haus. Steige bis zur Höhe des Uehrder Berges und genieße erst den Blick auf die Talstadt Osterode. Auch ohne Maler und Dichter zu sein, wirst Du immer wieder neue Schönheiten deiner Heimat herausfühlen.
Marktkirche, Alte Burg: zwei Eckpfeiler, an denen das Auge nicht vorbeigleiten kann. Jener im Dächerrot, dieser im Blättergrün.
Des Himmels Blau spiegelt sich wieder in den beiden Mönchteichen vor der zerborstenen Stadtmauer.
Hier und da rauchen Fabrikschlote: der Industriestadt Festfackeln.
Klar und übersichtlich Haus neben Haus. Jeder kann sein eigen Obdach erkennen. Das Ganze eingebettet in blaugrüne Bergwellen.
Zwischen den roten Blättern der Moosrose ein runder schwarzbrauner Fleck: die Blutbuche auf dem ehemals Schachtruppschen, später Döringschen Grundstück jetzt Spielplatz des Luisenlyzeums.
Alle Singvögel in den Gärten der Stadt haben dort ihr Stelldichein, und viele Hochzeitspärchen bauen sich in ihren Zweigen ein luftiges Heim. Nachts hörst Du in dem höchsten Wipfel ein unsichtbares Käuzchen klagen.
Es klagt um den Tod der jungen Frau, die unter dem Blutbaum begraben liegt. Wohl sind es schon einige hundert Jahre her, als die Verzweiflungstat geschah, aber die Eule hat sie nicht vergessen und wird darum ihr markdurchdringendes Seufzen vernehmen lassen, solange die Buche ihre Zweige in den Himmel wachsen läßt.
Was weiß ich von der unglücklichen Margaretha? Nicht viel. Nur daß die Lilien sich beugten vor der Reinheit ihrer Seele und die Rosen vor der strahlenden Schönheit ihrer Gestalt. Halb Kind, wurde sie vermählt mit einem reichen Bürgersmann, bei dem ihr Vater tief in Schulden saß. Sie aber war zugetan dem Jugendgespielen Ericus, der die Lateinschule in Osterode besuchte. All ihr Flehen, sie nicht zu dem Bunde mit dem ungeliebten Manne zu zwingen, war vergebens gewesen. Sie bot ihrem Vater das größte Opfer ihrer Liebe an: der Welt zu entsagen und den Schleier der Braut mit dem der Nonne zu tauschen. Der Vater blieb stumm, und seinem Gläubiger erschien sie nur umso begehrenswerter.
Da geschah das Entsetzliche.
Während des Hochzeitsschmauses drang Ericus in den Festsaal und erstach sie in den Armen ihres soeben angetrauten Mannes. Ericus' Kopf fiel nach dem Richtspruch, der zwischen den »Drei Linden« gefällt. Im Garten des hochzeitlichen Hauses, – bei dem großen Brande 1545 ist es mit vernichtet, – wurde die jungfräuliche Frau beigesetzt, nachdem ein Priester die Erde geweiht. Ihr zum Gedächtnis pflanzte man eine junge Buche auf das Grab, die zu einem gewaltigen Baum heranwuchs.
Als sie vor ungefähr 150 Jahren einging, wurde sie, wie es im Laufe der Zeit auch mit den »Drei Linden« geschehen ist, durch einen neuen Baum ersetzt, der jetzt als einziges Denkmal auf jene Begebenheit hinweist. –
Aus dem Munde einer hehren Frauengestalt, die in aufblühender Jugend an todwundem Herzen starb, habe ich, noch ein kleiner Knabe, diese Sage vernommen.
Die Sagenwelt mißt nicht mit geeichten Maßen.
Sie umfaßt die ganze Weltgeschichte, ohne selbst Geschichte zu sein.
Sie ist in steter Berührung mit den geschichtlichen Begebenheiten und stützt sie doch wieder ab.
Für den Forscher ist es darum recht schwer, Sein von Nichtsein zu unterscheiden, um zu dem geschichtlichen Kern zu gelangen. Einen heftigen Widerstand findet er in der Volksseele selbst. Sie läßt sich ihre farbigen Sagenbilder nicht durch die alles durchdringenden Strahlen der Wissenschaft verblassen. Ja, sie hängt mit Zähigkeit gerade an dem Phantastischen, Unwahrscheinlichen. –
Es steht einwandfrei fest, daß die Riesenrippe, welche an zwei eisernen Ketten über dem Eingang zum Ratskeller schwebt, von einem vorsintflutlichen Ungeheuer herrührt. Sie ist in den Kalkschichten in der Umgebung der Stadt gefunden, wo ja auch Überbleibsel von Höhlenbären und anderem längst ausgestorbenem Getier zu Tage befördert sind. Und doch will mancher nichts von dieser nackten Tatsache wissen. Er sucht lieber nach etwas Geheimnisvollem, wenn er über den Ursprung dieser Rippe nachgrübelt.

Als es noch Riesen im Harz gab, da habe auch die Rathausrippe in einer gewaltigen Männerbrust ihren Platz gehabt. Sind doch gerade in der Harzgegend Riesen ansässig gewesen. Von ihnen zeugt die bekannte Sage vom Bodetal, wo ein solcher Hüne mit seinem Streitroß vom Hexentanzplatz auf die Roßtrappe gesprungen und dabei ein tiefes Mal im Felsen zurückgelassen hat.
Grotesk ist freilich die Meinung, die Osteroder Rippe habe einst Adam gehört. Sie sei es gewesen, aus welcher Gott die sündenschöne Eva geschaffen. Auf meine Entgegnung, Adam und Eva seien nicht größer gewesen als wir, wurde ich dahin belehrt, die Menschheit wäre von Geschlecht zu Geschlecht kleiner Wissenschaftliche Messungen haben gerade das Gegenteil ergeben. Schon die Ritterrüstungen aus dem Mittelalter sind unserem jetzigen Geschlecht zu klein. geworden. »Als wir in die Schule kamen«, so wurde mir gesagt, »waren wir viel größer als die jetzigen ABC-Schützen. Und besonders bei den Konfirmanden können wir beobachten, daß sie noch richtige Kinder sind, während wir schon, inbezug auf die Körpergröße, fast erwachsen waren. Und die gleichen Feststellungen haben unsere Eltern und Großeltern gemacht.« Wenn dem nun auch wirklich so wäre, ich könnte doch nicht einsehen, warum gerade hier der Eingang zum Paradies gewesen sein soll und warum sich die ersten Menschen den Harzrand als Niederlassungsort erwählt hätten.
Alles leugnende Spötter wollen wissen, daß die Rippe – aus Eisen gegossen und weiß angestrichen ist.
Jeder wird nach seinem Glauben selig!