
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Flughühner, Waldhühner
Die Scharrvögel ( Rasores) sind Weltbürger, in Asien aber am reichsten entwickelt. Jeder Erdteil oder jedes Gebiet beherbergt gewisse Familien mehr oder weniger ausschließlich. Als bevorzugte Wohnstätte darf man den Wald ansehen, die einzige aber ist er nicht; denn auch die pflanzenlose Ebene, die nur mit dürftigem Gesträuch und Gräsern bedeckten Berggehänge der Alpen unter der Alpen unter der Schneegrenze und die ihnen entsprechenden Moossteppen des Nordens werden von Scharrvögeln bevölkert. So weit man nach Norden hin vordrang: ein Schneehuhn hat man auf jedem größeren Eilande gefunden, und wo man auch sein mag in der Wüste: ein Flughuhn wird man schwerlich vermissen. Fast die ganze Erde ist in Besitz genommen worden von den Mitgliedern dieser Ordnung; wo die einen verzweifeln, ihr Leben zu fristen, finden andere das tägliche Brot. Wie sie es ermöglichen, ihren Unterhalt zu erwerben an den Orten, wo entweder die Glut der Sonne oder die Kälte der monatelangen Nacht unserer Erde Öde und Armut bringen, vermögen wir nicht zu sagen, kaum zu begreifen, obgleich wir wissen, daß ihnen eigentlich alles Genießbare recht, daß sie zwar vorzugsweise Pflanzenfresser, aber doch auch tüchtige Räuber sind, daß sie mit Stoffen sich begnügen, welche nur Raupen mit ihnen teilen oder höchstens einzelne Wiederkäuer zur Atzung nehmen.
Die Scharrvögel vermögen im Fluge nicht mit andern Vögeln zu wetteifern; die meisten sind mehr oder weniger fremd auf den Bäumen, weil sie sich hier nicht zu benehmen wissen, und alle ohne Ausnahme scheuen das Wasser. Ihr Reich ist der flache Boden. Sie sind vollendete Läufer; ihre kräftigen und verhältnismäßig hohen Beine gestatten ihnen nicht nur einen ausdauernden, sondern auch einen sehr schnellen Lauf. Reicht die Kraft der Beine allein nicht aus, so werden auch die Flügel mit zu Hilfe genommen, mehr um den Leib im Gleichgewicht zu halten, als um ihn vorwärts zu treiben. Zum Fliegen entschließt sich der Scharrvogel in der Regel nur, wenn er es unbedingt tun muß, wenn er laufend das Ziel seiner Wünsche und Absichten entweder nicht rasch oder nicht sicher genug erreichen zu können glaubt. Der Flug der meisten Arten erfordert viele, rasche Schläge der kurzen, runden Fittiche, gestattet den sie bewegenden Muskeln keine Ruhepausen und ermüdet daher sehr bald. Aber auch in dieser Hinsicht gibt es Ausnahmen. Die Stimme ist sehr eigentümlich. Wenige Arten dürfen schweigsam genannt werden; die meisten schreien gern und viel. Von angenehmen Tönen wird aber wenig vernommen, falls man von dem Ausdruck der Zärtlichkeit, den die Hühnermutter ihren Küchlein gegenüber anwendet, absieht und den eigentlichen Liebesruf des Hahnes allein berücksichtigt. Dieser Ruf wird zwar von den wortarmen Welschen Gesang genannt; wir hingegen wenden zu seiner Bezeichnung Ausdrücke, meist Klangbilder, an, die treffender sind: unsere Sprache läßt die Hähne » krähen, kollern, knarren, balzen, schleifen, wetzen, schnalzen, schnappen, worgen, kröpfen«; an Gesang denkt nicht einmal der Waidmann, in dessen Ohr die Laute mancher Hähne angenehmer klingen als der Schlag der Nachtigall.
Gesicht und Gehör unserer Vögel scheinen scharf, Geschmack und Geruch wenigstens nicht verkümmert zu sein; über das Gefühl müssen wir uns des Urteils enthalten. Die Scharrvögel beweisen, daß sie zwar ein gutes Gedächtnis, aber wenig Urteilsfähigkeit haben. Sie lernen verstehen, daß auch sie von Feinden bedroht werden, selten aber zwischen diesen unterscheiden; denn sie benehmen sich den gefährlichen Tieren oder Menschen gegenüber nicht anders als angesichts ungefährlicher: ein Turmfalk flößt ihnen dasselbe Entsetzen ein wie ein Adler, der Ackersmann dieselbe Furcht wie der Jäger. Fortgesetzte Verfolgung macht sie nur scheuer, nicht aber vorsichtiger, mißtrauischer, jedoch nicht klüger. Und wenn die Leidenschaft ins Spiel kommt, ist es mit ihrer Klugheit vorbei. Leidenschaftlich in hohem Grade zeigen sich alle, auch diejenigen, die wir als die sanftesten und friedlichsten bezeichnen. Den Hennen Wird nachgerühmt, daß sie sich zu ihrem Vorteile von den Hähnen unterscheiden; sie verdienen diesen Ruhm jedoch nur teilweise: denn auch sie sind zänkisch und neidisch, wenn nicht wegen der Hähne, so doch wegen der Kinder. Sie, die ihre Küchlein mit erhabener Liebe behandeln, ihretwegen der größten und augenscheinlichsten Gefahr sich aussetzen, ihnen zu Liebe hungern und entbehren, die selbst fremdartigen Wesen zur treuen Mutter werden, wenn dieselben durch die Wärme ihres Herzens zum Leben gerufen wurden, kennen kein Mitgefühl, keine Barmherzigkeit, kein Wohlwollen gegen die Kinder anderer Vögel, die Küchlein anderer Hennen: sie töten dieselben durch Schnabelhiebe, wenn sie auch nur argwöhnen, daß die eigene Brut beeinträchtigt werden könnte. Im Wesen der Hähne tritt der Widerspruch zwischen guten und schlechten Eigenschaften noch schärfer hervor. Die Paarungslust wird bei vielen von ihnen zu einer förmlichen Paarungswut, wandelt ihr Wesen gänzlich um, unterdrückt, wenigstens zeitweilig, alle übrigen Gedanken und Gefühle, läßt sie geradezu sinnlos erscheinen. Der paarungslustige Hahn kennt nur ein Ziel: eine, mehrere, viele Hennen. Wehe dem Gleichgesinnten! Ihm gegenüber gibt es keine Schonung, ihm zu Leide werden alle Mittel angewendet. Kein anderer Vogel bekämpft seinen Nebenbuhler mit nachhaltigerer Wut, wenige streiten mit derselben nie ermattenden Ausdauer. Alle Waffen gelten; jedes Mittel scheint im voraus gerechtfertigt zu sein. Zum Kampfe reizen Schönheit und Stimme, Stärke, Gewandtheit und sonstige Begabung; gekämpft wird mit einer Erbitterung ohnegleichen, unter gänzlicher Mißachtung aller Umstände und Verhältnisse, unter Geringschätzung erlittener Wunden, glücklich überstandener Gefahr; gekämpft wird im buchstäblichen Sinne auf Leben und Tod. Im Herzen beider Kämpen herrscht nur das eine Gefühl: den andern zu schädigen an Leib und Leben, an Liebesglück und Liebeslöhnung. Alles wird vergessen, solange der Kampf währt, auch die Willigkeit der Henne, die dem Ausgange des Kampfes scheinbar mit der größten Gemütsruhe zusieht. Die Henne verhält sich den Liebesbewerbungen des Hahnes gegenüber passiv, aber sie macht in ihrer Hingabe ebensowenig einen Unterschied zwischen diesem und jenem Hahn wie der Hahn zwischen ihr und andern Hennen.
Weitaus die meisten Scharrvögel brüten auf dem Boden. Ihr Nest kann verschieden sein, wird jedoch niemals künstlerisch angelegt. Die Mutter beweist gewisse Sorgfalt in der Auswahl des Platzes, scheint es aber für unnötig zu halten, das Nest selbst auszubauen. Da, wo die Gegend buschreich ist, wird die seichte Vertiefung, die die Eier aufnehmen soll, unter einem Busche, da, wo es an Gebüsch mangelt, wenigstens zwischen höherem Grase oder im Getreide, jedenfalls an einem möglichst versteckten Orte, angelegt, so daß das Nest immer schwer aufzufinden ist. Viele Arten verwenden einige Reiserchen und auch wohl Federn zur Auskleidung, andere füttern die Mulde gar nicht aus. Das Gelege pflegt vielzählig zu sein. Die Eier sind verschieden, aber doch übereinstimmend gezeichnet. Viele Hühner legen einfarbige, reinweiße, grauliche, braungelbliche, bläuliche Eier, andere solche, die auf ebenso gefärbtem oder rötlichem Grunde entweder mit seinen Pünktchen und Tüpfelchen oder mit größeren Flecken und Punkten von dunkler, oft lebhafter Färbung gezeichnet sind. Es gibt keinen Vogel, der sich mit größerem Eifer seiner Nachkommenschaft widmet als eine Henne, und das schöne Bild der Bibel ist also ein in jeder Hinsicht wohl gewähltes. Die brütende Henne läßt sich kaum Zeit, ihre Nahrung zu suchen, vergißt ihre frühere Scheu und gibt sich bei Gefahr ohne Bedenken preis.
Die jungen Scharrvögel verlassen das Ei als sehr bewegungsfähige und überhaupt begabte Wesen. Sie nehmen vom ersten Tage ihres Lebens an Futter auf, das die Alte ihnen bloßlegt, folgen deren Rufe und werden von ihr gehudert, wenn sie ermüdet sind oder gegen rauhe Witterung Schutz finden sollen. Ihr Wachstum geht ungemein rasch vor sich. Wenige Tage nach dem Ausschlüpfen erhalten sie Schwingen, die sie in den Stand setzen, zu fliegen, mindestens zu flattern; in verhältnismäßig kurzer Zeit erwachsen auch an andern Stellen des Leibes Federn, anstatt der ersten buntfarbigen, immer aber dem Boden entsprechend gefärbte Daunen. Die Schwingen erweisen sich bald als ungenügend, die inzwischen größer gewordene Last des Leibes zu tragen, werden aber so oft gewechselt, daß sie ihre Dienste niemals versagen; der Fittich eines Huhnes, das zum ersten Male die Tracht der ausgewachsenen Vögel seiner Art anlegt, hat einen drei- bis viermaligen Federwechsel zu erleiden. Bei den meisten Arten geht die Umkleidung schon vor Beendigung des ersten Jahres in die der alten Vögel über; andere hingegen bedürfen eines Zeitraumes von zwei und selbst drei Jahren, bevor sie als ausgefiedert gelten können. Jene pflegen sich bereits im ersten Herbste ihres Lebens zu paaren, brechen mindestens schon eine Lanze zu Ehren des andern Geschlechtes; diese bekümmern sich, bevor sie erwachsen sind, wenig um die Weibchen.
Die Scharrvögel haben so viele Feinde, daß nur ihre ungewöhnlich starke Vermehrung das Gleichgewicht zwischen Vernichtung und Ersetzung herzustellen vermag. Alle Raubtiere, große und kleine, stellen den Hühnern eifrig nach, und der Mensch gesellt sich überall als der schlimmste Feind zu den sozusagen natürlichen Verfolgern. Die Hühner sind es, die allerorten zuerst und mehr gejagt werden als die übrigen Vögel zusammen genommen. Aber der Mensch hat auch bald einsehen gelernt, daß diese wichtigen Tiere sich noch ganz anders verwerten lassen. Er hat schon seit altersgrauer Zeit wenigstens einige von ihnen an sich zu fesseln gesucht und sie von den Waldungen Südasiens über die ganze Erde verbreitet, unter den verschiedensten Himmelsstrichen, unter den verschiedensten Umständen heimisch gemacht. Es ist wahrscheinlich, daß er sich die brauchbarsten unter allen ausgewählt; es unterliegt aber auch keinem Zweifel, daß er viele von denen, die gegenwärtig noch wild leben, unter seine Botmäßigkeit zwingen und in ihnen nützliche Haustiere gewinnen können wird. Das Bestreben der Neuzeit, fremdländische Tiere bei uns einzubürgern, kann durch keine Tierordnung besser gerechtfertigt und glänzender belohnt werden als durch die Scharrvögel, deren Schönheit, leichte Zähmbarkeit und Nützlichkeit von keiner andern Vogelgruppe übertroffen wird.
*
An die Spitze der Ordnung Pflegt man die Flughühner (Pteroclidae) zu stellen. Ihr bekanntester Vertreter ist das Faust- oder Steppenhuhn, »Sadscha« der Russen ( Syrrhaptes paradoxus). Es gehört einer gleichnamigen Sippe ( Syrrhaptes) an und ist ohne die verlängerten Mittelschwanzfedern neununddreißig Zentimeter lang und ohne die verlängerten Schwingenspitzen sechzig Zentimeter breit; die Fittichlänge beträgt achtzehn, die Schwanzlänge zwölf, einschließlich der verlängerten Mittelfedern ungefähr zwanzig Zentimeter. Das Weibchen ist etwas kürzer und schmäler. Der Oberkopf, ein Streifen, der, vom Auge beginnend, nach den Halsseiten verläuft, dieser und die Kopfgegend sind aschgrau, Kehle, Stirn und breiter Streifen über dem Auge lehmgelb, Brust und Brustseiten, die durch ein drei- oder vierfaches, aus seinen weißen und schwarzen Streifen bestehendes Band von dem Kopfe getrennt werden, graulich isabellfarben; der Oberbauch ist braunschwarz, der Unterbauch wie die unteren Schwanzdeckfedern licht aschgrau, der Rücken auf lehmgelbem Grunde mit dunkleren Querstreifen gebändert; die Schwingen sind aschgrau, die vordersten außen schwarz, die Hinteren innen graulich gesäumt, die Schulterfedern bräunlich, vorn gelblich und an der Spitze weiß gesäumt, die inneren Flügeldeckfedern sandbraun mit schwarzbraunen Endtupfen, die Schwanzfedern auf gelbem Grunde dunkel gebändert, die Federn, die die Läufe bekleiden, falb weißlich. Das Weibchen unterscheidet sich vom Männchen durch den Mangel des Brustbandes, die lichtere, bräunliche Färbung des Unterbauches und das lichtere Gelb des Gesichtes sowie endlich durch das mehr gefleckte als gebänderte Gefieder der Oberseite, dessen Zeichnung auch an den Halsseiten sich fortsetzt.

Faust- oder Steppenhuhn ( Syrrhaptes paradoxus)
Pallas beschrieb das Steppenhuhn im Jahre 1770, teilt aber nichts über seine Lebensweise mit, über die vielmehr erst Radde und Swinhoe berichten. Ersterer erzählt:
»Zur Zeit, wenn Thermopsis und Cymbaria geblüht und die ersten Knospen der schmalblättrigen Lilie sich entfaltet haben, bietet das Tierleben in den Steppen wesentlich andere Erscheinungen als im Frühjahre zur Blütezeit der Irideen. Es ist die Brutzeit der Vögel und die Zeit der Geburt der meisten wilden Steppentiere. Wir wollen also, um jenen Unterschied kennen zu lernen, uns abermals zum Tarai-nor, und zwar heute in seine wüstesten Gegenden, nach der Grenze, versetzen, wo einige erhöhte Inseln aus dem hier weichen Schlammboden auftauchen. Die Reise zu ihnen über die hohen Steppen zeigt uns ein wahres Sommerbild hiesiger Gegend. Die Hitze der Mittagssonne macht die Murmeltiere besonders lustig; in weitem Bogen hoch in der Luft kreisen die Schreiadler; geduldiger als sie sitzt der Bussard stundenlang auf einem Hügel; das angenehme Zwitschern der mongolischen Lerche läßt sich vernehmen; die Pfeifhasen beginnen ihre langwierigen Arbeiten; die zahlreichen Herden ziehen zu den sumpfigen Süßwasserpfützen des Tarai; das Lärmen der Kraniche, das sich häufig im Frühjahre hören ließ, hat aufgehört; keine Gans, keine Ente ist sichtbar; nur selten zieht eine Möwe hoch an uns vorüber, ihr folgt in weiten Fernen eine zweite und dritte. Die ausstrahlende Wärme umflimmert in breiten Wellen alle Umrisse; die Inseln im Tarai schwimmen förmlich in einem beständigen, wellenden, luftigen Grunde. Kein Baum, kein Strauch bezeichnet die Ferne; nur hier und da scheinen plumpe, tierische Körpermassen über dem Boden zu schweben, durch ihre scheinbare Größe täuschend. Aber der Salzboden ist nicht tot, nicht so tot wie das Bereich der Luft. Im Gegenteil, ein Vogel, der ebenso merkwürdig durch seinen Bau wie durch seine Lebensweise und Verbreitung ist, überrascht uns hier durch seine Häufigkeit: das Steppenhuhn.
»Zur Zeit, wenn der Schnee an den Hügeln der Hochsteppe noch liegt, um die Mitte des März, zieht er aus Süden hierher und lebt dann in kleinen Gesellschaften, aber immer schon gepaart. In gelinden Wintern trifft man ihn am Nordostrande der hohen Gobi an; er erscheint aber auch nach strengen Wintern schon so zeitig und brütet dann so früh, daß er auch in dieser Hinsicht ›auffallend‹ ist. Seine Eier findet man bereits in den ersten Tagen des April und zu Ende des Mai zum zweiten Male. Nach vollbrachter zweiter Brut wechselt er wahrscheinlich oft den Aufenthaltsort, und während der Wintermonate schweift er bis zum Südrande der Gobi in die Vorberge der nördlichen Himalajaverflachungen. Schon am zehnten März 1856, als die Kälte über Nacht noch bis zu dreizehn Grad Réaumur fiel und die Wärme um die Mittagszeit sich auf zwei Grad Réaumur belief, kam die erste kleine Schar Steppenhühner zum Tarai-nor. Sie fliegen in ganz geschlossenen Ketten, ähnlich den Regenpfeiferarten, halten sich im Frühjahr in kleinen Trupps, die aus bereits gepaarten Vögeln (vier bis sechs Paare) bestehen, zusammen, bilden aber im Herbst oft Flüge von mehreren hundert Stück. Während des Fluges lassen sie ein recht vernehmliches Schreien hören, das Veranlassung zu der bei den Mongolen gebräuchlichen Benennung Njüpterjün gegeben hat. Die Paare bleiben auch während des Fluges beisammen.
Im Frühling erscheinen die Steppenhühner sehr regelmäßig zu ganz bestimmter Zeit am süßen Wasser, um zu. trinken. Sie ziehen dann aus allen Richtungen herbei und schreien, sobald sie das Ufer gewahr werden, worauf die bereits anwesenden antworten und jene sich diesen gesellen. Am Rande des Wassers stehen sie in Reihen, meistens zu zehn bis zwölf beieinander. Ihre Ruhe hier währt aber nicht lange; sie ziehen dann wieder fort, um förmlich zu äsen, und zwar zu den weißen Stellen in der Steppe, auf denen Salz ausgewittert ist, und zu den kleinen Höhen, die mit Gräsern bewachsen sind. Sie verschmähen nicht die junge saftreiche Sprosse der Salicornien und weiden diese förmlich ab, also in der Art, wie der Trappe es mit Gräsern tut. Im Frühling fand ich im Schlund und Magen die Samen der Salsole. Typische Salzpflanzen, die bei uns durch die Arten Salicornia herbacea, den bekannten am Meeresstrande überall häufigen Glasschmalz, und Salsola kali, das an gleichen Orten seltenere Salzkraut, vertreten sind. Herausgeber. Im Sommer sonnen sie sich gern; auch hierbei traf ich gesonderte Paare, aber meistens mehrere derselben beisammen. Wie die Hühner scharren sie sich dann flache Vertiefungen in die weißgrauen, salzdurchdrungenen, geringen Erhöhungen, die hier und da am Ufer des Tarai-nor weite Strecken bilden und die Salzpflanzen ernähren. Ich habe sie in dieser Ruhe einigemale lange beobachtet. Anfangs laufen sie noch emsig umher, gleichsam suchend; sind sie ganz satt, so beginnt ihre Ruhe, gewöhnlich gegen elf Uhr, wenn es recht heiß wird. Dann scharren sie Vertiefungen und hocken sich in dieselben, suchen sich auch ganz wie die Haushühner recht gemächlich in den gelockerten Boden einzuwühlen, wobei sie den Körper seitwärts hin- und herbewegen und das sonst so glattanliegende Gefieder aufblähen. Wachen stellen sie dabei nicht aus. So sitzen sie ganz ruhig, und man kann sie kaum bemerken, da ihr gelbgraues, schwarz gesprenkeltes Gefieder dem Boden recht ähnlich ist. Ein Falk schießt im Pfeilfluge über die ruhenden dahin; sie raffen sich auf und entziehen sich bald unsern und des begierigen Räubers Blicken. Ihr Notruf weckt die nächsten Genossen; auch diese erheben sich und eilen davon, durch ihr Geschrei ganze Banden zur Flucht aufmunternd; denn alle, die den Angstruf vernehmen, folgen, auch wenn sie nicht derselben Bande angehören, dem Beispiel der aufgescheuchten. So erfüllt sich die Luft in kurzer Zeit mit unzähligen kleinen Scharen dieser eigentümlichen Hühner. Ihr Lärmen läßt sich von allen Seiten her vernehmen, und im Nu schießen die Vögel an uns vorüber, ehe wir zum Schusse kommen. Aber ebenso rasch, wie diese Ruhe gestört wurde, stellt sie sich wieder ein. Die Steppenhühner lassen sich nieder, laufen anfangs furchtsam über die weiße Salzstelle, bis sie abermals auf flache Erhöhungen sich legen und wie vorher sich Verhalten. Sie dürften übrigens kaum dem geschicktesten Edelfalken zum Raube werden. Ihr Flug ist schneidender und rascher als der der Tauben. Daß sie aber zugleich ausdauernde Laufvögel sind, bezweifle ich; denn ihre Bewegungen zu Fuß sind zwar rasch, aber nicht anhaltend.
Sehr sonderbar ist das Fortziehen zahlreicher Steppenhühnerbanden im Sommer. Es liegt mir hierüber eine eigene Beobachtung vor, die entschieden dafür spricht. Als ich mich in den letzten Tagen des Mai zu den im Tarai-nor gelegenen Aralinseln begeben wollte, mußte ich weite Uferstrecken am jetzt ausgetrockneten See zurücklegen und stieß vormittags auf eine Unzahl kleiner Banden dieser Vögel, die insgesamt ein Gebiet bewohnten, aber so scheu waren, daß ich mich ihnen auf keine Weise nähern konnte. Nach vielen vergeblichen Versuchen, sie zu schießen, gab ich die Jagd bis zum Abend auf. Mit Sonnenuntergang hatten sich alle Vögel in zwei große Schwärme, deren jeder wohl tausend Stück zählen mochte, vereinigt und lärmten auf das eifrigste. Ich hoffte sie nun beschleichen zu können, hatte mich aber geirrt; denn weder zu Pferde noch kriechend konnte ich mich ihnen nähern. Nach mehrmaligem Auftreiben verließen sie endlich die Ufer des Tarai-nor und flogen östlich zu den Höhen der Steppe, wo sie sich an zwei Orten niederließen. Diese Plätze waren im Winter die Lagerstätten zweier Herden gewesen; eine dicke Schicht schwarzen, schon festgetretenen Mistes hatte sich auf ihnen erhalten, und durch diese Decke war keiner der schwachen Pflanzenkeime gedrungen. Hier blieben sie ungestört, da die einbrechende Dunkelheit mich an der weiteren Jagd verhinderte. Aber immer noch lärmten sie fort. Am nächsten Tage waren sie spurlos verschwunden. Niemals, sooft ich im Laufe des Sommers zum Tarai ging, fand ich wieder einen von ihnen. Erst als ich im Oktober in den südlichsten Gegenden der Steppe auf die Antilopenjagd zog, als schon lange der Herbstzug des Geflügels beendigt war, sah ich jenseits des Argunj die Steppenhühner wieder. Kettenzüge von ihnen flogen schnell und hoch jetzt nach Norden, auf russisches Gebiet, wo ich sie aber im Bereich der Steppe nicht wiederfand.
Das Nest ist sehr kunstlos und den Flughuhnnestern wohl ganz ähnlich. Es brüten mehrere Paare gemeinschaftlich, doch nie viele. In den salzdurchdrungenen Gründen am Tarai-nor, meistens auf dessen jetzt seit Jahren trockengelegtem Boden selbst, wird es durch eine flach ausgeworfene Vertiefung von etwa zwölf Zentimeter Durchmesser gebildet, deren Rand mit einigen Salsolasprossen und Gräsern umlegt wird, welche letztere jedoch auch bisweilen fehlen. Die Anzahl der Eier beträgt vier. In ihrer Gestalt ähneln sie den Flughuhneiern; sie zeichnen sich aus durch ihre rein eirunde Form, sind jedoch zuweilen an dem einen Ende etwas spitzer als am andern. Die Grundfarbe wechselt von hellgrünlichgrau bis schmutzigbräunlichgrau, letztere ist die gewöhnlichere. Auf diesem Grunde findet sich die meistens feinfleckige, erdbraune Zeichnung in zwei verschiedenen Tönen.«
Unsere Kenntnis der Lebenskunde des Steppenhuhns wurde schon ein Jahr nach dem Erscheinen des Raddeschen Werkes infolge eigentümlicher Umstände wesentlich bereichert. Bereits im Jahre 1860 war es durch Schlegel und Moore wissenschaftlich festgestellt worden, daß einzelne Steppenhühner in Mitteleuropa sich gezeigt hatten. Es waren solche auf den Dünen Hollands und in Großbritannien erlegt worden; ja, man hatte, falls Collett recht unterrichtet ist, Mitte August 1861 einen aus vierzehn oder fünfzehn Stück bestehenden Flug von ihnen bei Mandal in Norwegen beobachtet und ebenfalls mehrere geschossen. Diese vereinzelten Zuzügler waren als Irrgäste betrachtet worden und ihren wiederholten Besuchen größere Bedeutsamkeit nicht beigelegt worden. Auf welchem Wege diese Einwanderung geschehen ist, läßt sich mit ziemlicher Sicherheit nachweisen. Man hat den Zug der Steppenhühner beobachtet von Brody in Galizien bis Naran an der Westküste von Irland und von Biscarolle in Südfrankreich bis Thorshavn auf den Färöerinseln; man hat erfahren, daß die Einwanderer in Sokolnitz in Mähren am 6. Mai, in Tuchel in Westpreußen am 14., in Polkwitz in Schlesien am 17., in Wöhlau in Anhalt am 20., auf Laaland an demselben Tage, auf Helgoland und an den englischen Küsten (Northumberland) am 21., auf Borkum, Staffordshire und an der Küste von Lancashire am 22., auf den Färöern in den letzten Tagen des Mai angekommen oder wenigstens wahrgenommen worden waren. Ein allmähliches Vorrücken in der gegebenen Richtung ist also vollkommen bewiesen, und die Reisefähigkeit der Steppenhühner steht mit den ermittelten Zeiten nicht im Widerspruch. Etwas kühner, aber immer noch gerechtfertigt ist diese Schlußfolgerung: die Steppenhühner sind von der Mongolei in einem großen Fluge aufgebrochen und in der angegebenen Richtung weitergezogen. Da ihre Reise kurz vor oder während ihrer Brutzeit stattfand, haben sich Paare oder Trupps von dem Hauptheer getrennt und seitabführende Wege eingeschlagen oder sich auf Stellen, die ihnen passend erschienen, niedergelassen. Viele von denen, die die Meeresküste erreichten, sind wohl auch wieder umgekehrt und in das Innere des Landes zurückgeflogen.
Einem der wenigen Vogelkundigen, die tierisches Leben aufzufassen verstehen, Altum, wurde das Glück zuteil, die Fremdlinge während ihres Sommerlebens in der Fremde wiederholt zu beobachten und durch sachverständige Nachfrage noch mehr in Erfahrung zu bringen. Die Steppenhühner zeigten sich auf Borkum, dem Beobachtungsfelde des Genannten, am 21. Mai, und zwar in kleineren Abteilungen von zwei bis zwölf Stück. Vom 23. Juni bis zum 1. Juli wurden sie nicht gesehen, dann jedoch wieder in großen Schwärmen. Altum und von Droste sahen am 8. August vier von ihnen in reißender Geschwindigkeit mit leichten, raschen Flügelschlägen ihres Weges dahinziehen und hörten während des Fluges beständig wie »Quick, quick, quick« klingende, der Stimme kleiner Regenpfeifer entfernt ähnliche Locktöne ausstoßen. Sie fielen auf einem offenen Watt ein und gesellten sich zu einem zahlreichen Schwarme anderer ihrer Art, die regungslos nebeneinander saßen und für Goldregenpfeifer hätten angesprochen werden können, wäre nicht die Haltung eine zu wagrechte gewesen. Näher als auf zweihundert Schritte ließ der Schwarm Droste nicht herankommen, obgleich dieser die gewöhnlichen Kunstgriffe beim Herangehen an scheue Vögel nicht unterließ. Plötzlich erhoben sich die Hühner unter vernehmbarem Brausen und Ausstoßen ihrer Stimmlaute, die einzeln gehört wie »Köckerick« zu klingen schienen, aber bei dieser Masse zu einem Gewirr zusammenschmolzen. Niedrig, einem Schwarm vom Felde heimkehrender Tauben ähnelnd, strichen sie über die weite Sandfläche fort, bildeten einen breiten Zug, flogen mit reißender Schnelligkeit und beschrieben sanfte, durch Aufsteigen und Senken gebildete Bogen.
Jenes Watt mußte eines ihrer Lieblingsplätze sein; denn man bemerkte sie fortan hier oftmals. Sie suchten diejenigen Stellen, die mit Suaeda maritima bewachsen sind, da sie den Samen dieser Pflanzen sehr zu lieben scheinen. Immer wählten sie freie Flächen, am liebsten an der Grenze jener Pflanzenbestände. Außer dem Samen pflückten sie auch Blättchen ab, ganz wie die Hühner. Doch fand Altum in dem Kropf mehrerer ausschließlich den Samen, bei andern die Frucht einer Grasart, wahrscheinlich Artropis distans, gemischt mit unreifen Kapseln von Spergularia marginata. Ebenfalls eine typische, am Meeresstrand wachsende Salzpflanze, deutsch Gänsefüßchen genannt. Gleiches gilt von Atropis distans, dem sogenannten Salzschwaden, einer Grasart, und von Spergularia marginata, der Randschuppenmiere, die zu den Nelkengewächsen gehört und im Binnenlande nur in Salzgegenden vorkommt (Staßfurt usw.). Herausgeber. Die Kröpfe waren stets ganz gefüllt, der Nahrung wenig gröbere Sandkörner beigemischt; in den gleichfalls gefüllten Magen war dagegen der Sand in auffallender Menge vorhanden. Bald nach jenem verunglückten Versuch traf Droste ein einzelnes Huhn auf einer rings von Dünen umgebenen, etwa einhundert Morgen großen Niederung. Es war bei weitem nicht so scheu als der ganze Schwarm. Er bemerkte es beim Hervorkommen aus dem Versteck im Laufen; es war jedoch auf dem weißen Sand so schwer zu sehen, daß beim Stillstehen seine Umrisse nicht mehr wahrgenommen werden konnten. Sehr hoch flogen nur versprengte Vögel; die vereinigten Ketten strichen höchstens zehn Meter über dem Boden dahin. Aufgetrieben, eilten sie niedrig über das Watt durch die Dünentäler, bis sie aus dem Gesichtskreis verschwunden waren, kehrten jedoch gern wieder um und fielen wohl auch auf demselben Platz wieder ein, wenn hier alles Verdächtige verschwunden; dünkte ihnen der Platz nicht sicher, so strichen sie abermals weit fort und ließen sich auf einem andern ihrer Lieblingsplätze nieder. Als auf einen fliegenden Schwärm ein Rohrweih stieß, teilte sich die Masse und ließ den Raubvogel durch. Bei stiller See machten sich die Schwärme auch in weiten Entfernungen durch ihr weithin schallendes, ununterbrochenes »Köckerick« oder »Köcki, köcki, köcki« leicht bemerklich. Das Bild des Vogels war übrigens so eigentümlich, daß man ihn, auch wenn er lautlos seines Weges zog, nicht mit andern verwechseln konnte.
Auf dem erwähnten von Dünen umgebenen Watt wurden die mongolischen Fremdlinge gewöhnlich des Morgens bis gegen neun Uhr angetroffen. Sie schienen hier an bestimmten Stellen bis zu jener Stunde zu verweilen und die einmal gewählten Sitzplätze regelmäßig wieder aufzusuchen; wenigstens konnte man dies aus der vielen Losung schließen. Wenn sie nichts Ungewöhnliches bemerkt hatten, saßen sie ruhig dicht nebeneinander, meistens nach einer Seite gewendet, zu je zweien oder doch wenigen beisammen. Gegen zehn bis elf Uhr schienen sie regelmäßig das große Watt zu besuchen und dort der Nahrung nachzugehen, fielen mindestens um diese Zeit oft daselbst ein, und suchten dann eifrig nach Samen und Knospen. Nachdem sie eingefallen waren, blieben sie wohl zwanzig Minuten lang bewegungslos sitzen, alles um sich her musternd; alsdann begannen sie mit ihrer Äsung, indem sie, über den Boden trippelnd und rutschend, in derselben Richtung vorwärts liefen und emsig Samen aufpickten. Einzelne Trüppchen sprengten sich auch wohl seitwärts ab oder blieben ein wenig zurück, hielten sich jedoch immer zum Schwärm. Dagegen bemerkte man ein einzelnes Stück, das fast jedesmal weit zurückblieb oder sich seitwärts zu schaffen machte und den Wächter abzugeben schien. Als von Droste einmal, hinter einem ungefähr einen halben Meter hohen Hügel auf dem Bauch liegend, den ganzen Schwärm beobachtete, hatte ihn dieser eine Vogel bemerkt, stieg hierauf sofort auf einen kleinen Hügel, reckte sich, hob den Kopf und stieß laut sein »Köckerick« aus. Auf dieses Zeichen lief fast der ganze Schwärm dicht zusammen und blieb unbeweglich sitzen. Droste schoß, der Schwärm brauste fort; aber der alte Hahn, der den Streich gespielt hatte, empfahl sich unter lautem Geschrei erst, nachdem der verblüffte Jäger sich schon erhoben hatte. Während die Steppenhühner umherliefen, riefen sie leise »Köck, köck«; wenn zwei einander zu nahe kamen, hoben sie die Flügel, zogen den Kopf, nahmen eine drohende Stellung ein und riefen schnell »Kikrikrik«. Auch sprangen sie wohl gegen einander in die Höhe, und dann erhoben sich immer einige andere, vielleicht in dem Glauben, daß Gefahr vorhanden sei, ließen sich aber schnell wieder nieder. In den Mittagsstunden schienen sie regelmäßig die trockenen, heißen Dünen aufzusuchen, um sich im Sande zu baden. Sie hatten auch hier ihre bestimmten Plätze, und zwar jene großen öden Sandflächen, auf denen der dürftigste Pflanzenwuchs durch Stürme zerstört worden. Einmal hatte man dreizehn Steppenhühner einfallen sehen, war rasch herbeigeeilt, hatte mit dem Fernrohr die ganze Fläche von dem Versteck aus abgesucht, aber kein Vogel war zu entdecken, bis sich endlich zufällig einer im Gesichtsfeld des Fernglases bewegte. Selbst in einer Entfernung von vierzig Schritten hielt es schwer, diese Sandvögel genau zu sehen, und in einer Entfernung von zweihundert Schritten war es fast unmöglich, sie zu entdecken, auch wenn man genau die Stelle kannte, auf der sich ihrer fünfzig bis sechzig niedergelassen hatten. Anfangs waren die Kinder der Steppe wenig scheu gewesen; die heillose Verfolgungswut der Badegäste aber machte sie bald vorsichtig und schließlich so ängstlich, daß es auch dem geübtesten Jäger kaum möglich war, sie zu überlisten.
Nachdem die Steppenhühner fünf Monate lang auf Borkum wie in ihrer Heimat gelebt hatten, verschwanden sie nach und nach gänzlich von der Insel. Am 1. Oktober wurden mit dem Fernrohr noch vierundfünfzig Stück von ihnen gezählt, am 10. waren noch acht, am 12. noch fünf, am 13. noch zwei beobachtet worden; sie waren die letzten. Vom 1. bis 15. Oktober hatte sich also der ganze Flug allmählich entfernt. Ungefähr um dieselbe Zeit wurden sie wiederum hier und dann im Inneren Deutschlands beobachtet; so, laut Altum, im Oldenburgischen und nach meinen eigenen Beobachtungen in der Nähe von Hamburg. Sie waren aber keineswegs gänzlich verschwunden, wie Altum behauptete, sondern wurden noch im folgenden Jahre in Deutschland bemerkt; so im Juni 1864 in der Gegend von Plauen, und viel später noch, zu Ende Oktober desselben Jahres, bei Wreschen in Posen; sie haben sich ebenso in der Nähe Hamburgs, ungefähr um dieselbe Zeit, noch gezeigt, höchst wahrscheinlich also auch gebrütet, wie im Jahre 1863 in Jütland und auf mehreren dänischen Inseln. Über letztere hat Reinhardt berichtet. Die ersten Eier wurden kurz nach Ankunft der Vögel gefunden und genanntem Forscher am 6. Juni übersendet. Das Nest hatte drei Eier enthalten. Nach Mitteilung eines Berichterstatters hatte der betreffende Jäger zwei Nester und sein Nachbar ein drittes gefunden; auf diesen Nestern waren dann die brütenden Vögel, erst die Hennen, dann die Hähne, gefangen worden. Zwei nahe nebeneinander stehende Nester hatten drei und bezüglich zwei Eier enthalten. Das erste bestand aus einer kleinen mit etwas trockenem Sandrohr ausgekleideten Vertiefung im Sande; das zweite war im Heidekraut angelegt und mit etwas verdorrtem Grase ausgefüttert. Im Verlauf des Juni fand man noch mehrere Nester auf den Dünen? sie waren alle in derselben Weise gebaut. Noch am 27. Juli trieb jener Jäger ein Steppenhuhn vom Nest auf und sah, daß es drei Eier enthielt, setzte Schlingen, kehrte nach einigen Stunden zurück und fand, daß die Henne gefangen war; der Hahn wurde in derselben Weise erbeutet. Inzwischen war ein Küchlein ausgeschlüpft, und ihm folgte später ein zweites; doch starben beide am ersten Tage, wahrscheinlich aus Mangel an geeigneter Pflege. Diese Beobachtungen beweisen also, daß das Steppenhuhn in Einehe lebt, und daß der Hahn sich am Brüten beteiligt.
Unmittelbar nach Eintreffen der ersten Steppenhühner in Deutschland hatte ich um deren Schonung gebeten, weil ich es, wenn auch nicht gerade für wahrscheinlich, so doch für möglich hielt, daß sie sich in Deutschland einbürgern konnten. Ich predigte tauben Ohren. Man zog mit Gewehr und Netz, Schlingen und vergifteten Weizenkörnern gegen die harmlosen Fremdlinge zu Felde und verfolgte sie auf das rücksichtsloseste, solange man sie verfolgen konnte. Viele fanden auch durch eigenes Verschulden ihren Tod? so wurden mehrere eingeliefert, die gegen Telegraphendrähte geflogen waren und sich dabei lebensgefährlich verletzt hatten. So konnte es nicht ausbleiben, daß binnen zwei Jahren alle vertilgt wurden.
Seit jener großartigen Einwanderung sind die Steppenhühner, soviel mir bekannt, nicht wieder in Deutschland erschienen; wohl aber haben sie ihr Verbreitungsgebiet inzwischen weiter nach Westen ausgedehnt und sich im Südosten Europas seßhaft gemacht. Der russische Forscher Karelin beobachtete zuerst, daß unser Huhn den Ural überschritt; Henke, ein verläßlicher Sammler, fand, daß es inzwischen weiter nach Westen hin vorgerückt ist und nicht allein an der unteren Wolga, sondern bereits am Don in der Steppe sowohl wie in unmittelbarer Nähe der Getreidefelder kleinrussischer Niederlassungen sich festgesetzt hat, so daß es gegenwärtig als europäischer und zwar keineswegs seltener Brutvogel bezeichnet werden muß.
Zur Vervollständigung vorstehender Mitteilungen will ich die wenigen Beobachtungen, die ich auf meiner Reise nach Sibirien sammeln konnte, hier folgen lassen. Schon von Semipalatinsk an, woselbst das Fausthuhn zuweilen vorkommt, hatte ich mich fleißig nach ihm umgesehen, in ganz Nordwestturkestan aber nur das Ringelflughuhn zu Gesicht bekommen. Erst in der öden Steppe am südlichen Fuße des Altai, ebenda, wo wir die Wildpferde antrafen, begegneten wir ihm und zwar in namhafter Menge, obschon nur in Paaren oder kleinen Flügen, die aus einem oder zwei Paaren mit ihren Jungen bestehen mochten. Der Flug unseres Vogels ist ungemein schnell, polternd beim Aufstehen, brausend und schrillend beim Dahinfliegen, geht, unter fortwährenden, gleichmäßigen Flügelschlägen meist gerade aus und entbehrt jäher Wendungen, nicht aber auch gewandter Schwenkungen; solche werden im Gegenteil vor dem Niedersetzen regelmäßig ausgeführt. Auf dem Boden läuft das Fausthuhn trippelnden Schrittes sehr rasch dahin, erscheint hier aber, weil es die Flügel vom Leibe abhält, etwas plump, kurz und breit, und deshalb schwerfällig. Wahrscheinlich hält es sich nur auf solchen Stellen der Steppe auf, deren Bodenfärbung der seines Gefieders gleicht; infolgedessen aber ist es ungemein schwierig, es aufzufinden, sobald es sich gesetzt hat und ruhig verhält. Während es läuft, läßt es dann und wann einen leisen, während es fliegt, fortwährend einen lauteren Ruf vernehmen. Alle Paare oder Trupps, die wir sahen, waren auch hier sehr scheu und erhoben sich bereits in einer Entfernung von achtzig, mindestens sechzig Schritten vor dem herannahenden Jäger oder Beobachter.
Infolge der Einwanderung im Jahre 1863 gelangten mehrere in Deutschland gefangene Steppenhühner in unsere Käfige und gaben verschiedenen Vogelkundigen Gelegenheit, Betragen und Wesen der Fausthühner eingehend zu beobachten. Ich habe im ganzen sieben Stück, die einen kürzere, die anderen längere Zeit gepflegt und die Freude gehabt, sie zur Fortpflanzung schreiten zu sehen. Meine Fausthühner haben sich bei einfacher Nahrung im Sommer wie im Winter recht wohl befunden, jahraus jahrein in demselben Bauer ausgehalten, auch nur selten von der ihnen zustehenden Freiheit, sich in den bedeckten und teilweise durch Glas geschützten Hinterraum dieses Käfiges zu verfügen, Gebrauch gemacht. Bei Regenwetter zogen sie sich gern an eine geschützte Stelle zurück; hatte es aber längere Zeit nicht geregnet, so verweilten sie etwa eine halbe Stunde lang im unbedeckten Teil des Käfigs und ließen sich ihr Gefieder einnässen; dann erst trippelten sie ins Innere. Kälte behelligte sie nicht; sie haben den strengen Winter von 1863 zu 1864 ohne anscheinende Beschwerde überstanden und sich auch in ziemlich tiefem Schnee noch mit großer Geschicklichkeit bewegt. Wenn es nicht gerade schneite, blieben sie immer draußen, drängten sich dann aber dicht zusammen; denn während sie im Sommer zwar truppweise, aber doch nicht unmittelbar nebeneinander zu schlafen pflegten, legten sie sich im Schnee so nebeneinander, daß alle fünf gleichsam nur eine Masse bildeten. Dabei lagen sie nicht in einer und derselben Richtung, sondern zwei oder drei mit den Köpfen nach dieser, die übrigen nach der andern Seite, so daß in der Tät kaum ein Zwischenraum blieb. Aus dieser Lage ließen sie sich nicht einmal durch Schneefall vertreiben, sondern lieber teilweise manchmal bis auf die Köpfe einschneien. Im Schnee schien ihnen jede Bewegung schwer zu fallen. Sie mußten dann den Vorderteil ihres Körpers buchstäblich wie einen Schlitten durch den Schnee schieben, und bildeten dadurch eine ziemlich tiefe, der Breite ihres Vorderleibes entsprechende Bahn, die in der Mitte durch zwei tiefere Furchen die eigentlichen Fährten zeigte, falls man hier noch von Fährten reden darf, da die einzelnen Fußstapfen nicht mehr ausgedrückt waren, sondern unmittelbar ineinander übergingen.
Anfang Juni 1864 zeigten sich die sonst so friedlichen Hähne unruhig und begannen schließlich miteinander zu kämpfen. Sie nahmen dabei eine Stellung an, die von der ihrer Verwandten, den Flughühnern, sehr verschieden war; denn sie erhoben sich mit dem Vorderteil ihres Leibes, sträubten alle Federn des Halses, der Brust und des Oberrückens, lüfteten die Flügel etwas, fuhren nun ziemlich eilfertig aufeinander los, wohlgezielte, aber, wie es schien, wenig empfindliche Schnabelhiebe austeilend. Der eine wurde regelmäßig in die Flucht geschlagen und der andere begab sich dann siegesstolz zu einem der Weibchen, hinter und neben dem er eine Zeitlang umhertrippelte. Am 6. Juni wurde ein unzweifelhaft von diesem Weibchen herrührendes Ei gefunden. Im Jahre 1865 zeigten sich die Steppenhühner schon im Mai paarungslustig, und dieselbe Henne, die im vorigen Jahre Hoffnungen wachgerufen hatte, legte diesmal am 14., 19. und 21. Mai ihre drei Eier. Ein Nest wurde nicht gebaut, nicht einmal eine Vertiefung gescharrt, und jedes Ei an einer verschiedenen Stelle abgelegt, obgleich ich angeordnet hatte, daß das erste unberührt blieb und das zweite zu diesem gebracht wurde. In der Hoffnung, daß die Henne doch noch brüten werde, ließ ich die Eier länger liegen, als ihnen gut war, und schließlich mußte ich sie wegnehmen, ohne weitere Versuche anstellen zu können. Am 22. Juni begann die Henne zum zweiten Male zu legen, und wiederum waren es drei Eier, die sie brachte: aber auch diesmal berücksichtigte sie diese nicht, sondern betrachtete sie ungefähr mit derselben Gleichgültigkeit wie Steine. Diesmal sollte ein Brutversuch angestellt werden; leider war aber eine geeignete Haushenne nicht zu schaffen, und so unterblieb die Brütung. Brutmaschinen kannte man damals leider noch nicht. Herausgeber.
Die Eier sind sich sämtlich in hohem Grade ähnlich. Ihr Längendurchmesser beträgt vierzig, ihr größter Querdurchmesser sechsundzwanzig Millimeter. Sie sind eirund, an beiden Enden fast gleich abgestumpft, feinkörnig und kaum glänzend. Die Grundfarbe ist ein grünliches Graugelb; die Zeichnung besteht aus licht graubraunen Unter- und dunkel graubraunen Oberflecken, die sich im ganzen gleichmäßig über die Oberfläche des Eis verbreiten, bei einzelnen jedoch um das eine Ende kranzartig stellen; zwischen den Flecken zeigen sich Kritzeln, Schmitzen und Punkte.
*
Die zweite Familie umfaßt die Waldhühner ( Tetraonidae), die reichhaltigste Gruppe der ganzen Ordnung. Sie dürfen als Weltbürger bezeichnet werden. Um die Übersicht zu erleichtern, empfiehlt es sich, die Familie in vier Unterfamilien zu zerfällen. In der ersten vereinigen wir die Rauchfußhühner ( Tetraoininae). Ihre Kennzeichen sind gedrungener, kräftiger Leib, kurzer, dicker, sehr gewölbter Schnabel und niedrige, starke Füße, deren Fußwurzeln mehr oder weniger befiedert sind, kurze oder höchstens mittellange Schwingen und kurzer, gerade abgeschnittener, ausnahmsweise aber auch verlängerter, keilförmig zugespitzter oder gegabelter Schwanz sowie reiches, dichtes Gefieder, das nur über dem Auge oder am Hinterhalse kleine Stellen freiläßt, von denen diejenigen über dem Auge mit roten hornigen Plättchen bekleidet ist. Bei vielen Rauchfußhühnern tragen die Zehen eigentümliche Horngebilde, sogenannte Fransen, die man als verkümmerte Federn anzusehen hat.
Der Norden der Erde ist die Heimat der Rauchfußhühner. Sie verbreiten sich vom Himalaja und von den ostasiatischen Gebirgen an über ganz Asien und Europa, fehlen in Afrika gänzlich, treten aber wiederum, und zwar vielzählig, in Nordamerika auf. Waldungen bilden ihren bevorzugten Aufenthalt; einzelne bewohnen Steppen und Tundren, andere gebirgige Halden in der Nähe der Schneegrenze, ohne sich viel um Gebüsch oder Bäume zu kümmern. Alle, ohne Ausnahme, sind Standvögel, die jahraus, jahrein in derselben Gegend verweilen und höchstens unregelmäßig streichen. Sie leben während der Brutzeit paarweise oder einzeln, sonst immer in Gesellschaften. Waldfrüchte mancherlei Art, Beeren, Knospen, Blätter, auch Nadeln des Schwarzholzes, Sämereien, Kerbtiere und Kerbtierlarven dienen ihnen zur Nahrung: einzelne fressen zeitweilig fast nur Blätter und Knospen, weil ihre arme Heimat ihnen dann kaum mehr bietet.
Die Rauchfußhühner gehen gut, schrittweise und sehr schnell, fliegen aber schwerfällig, unter rauschenden Flügelschlägen und, wie es scheint, mit Anstrengung, deshalb auch selten weit und niemals hoch. Ihre Sinne sind scharf, und zumal die beiden edelsten wohl entwickelt; die geistigen Fähigkeiten hingegen scheinen auf ziemlich tiefer Stufe zu stehen.
Einzelne Arten leben in geschlossener Ehe, die übrigen in Vielehigkeit. Die Paarungslust ist bei ihnen überaus lebhaft, und die Hähne leisten während der Paarungszeit außerordentliches durch Gebärden und Laute, förmliches Vergessen der gewohnten Lebensweise und ein Benehmen, das wir toll nennen würden, wenn es uns nicht allzu anziehend erschiene. Dies Liebesspiel ist so ausgeprägt, so eigentümlich, daß es im Jägermunde unter dem Namen »Balze« oder »Falz« eine besondere Bezeichnung erhalten hat. Alle Arten vermehren sich stark. Das Weibchen legt acht bis sechzehn, einander sehr ähnliche, rein eiförmige, glattschalige und auf gelblichem Grund braun gefleckte Eier. Ein eigentliches Nest wird nicht gebaut, an einem versteckten Plätzchen höchstens eine seichte Vertiefung ausgescharrt, und diese unordentlich mit etwas Genist, vielleicht auch mit einigen Federn ausgekleidet. Dagegen widmen sich die Hennen dem Brutgeschäfte mit regem Eifer, gehen erst dann vom Nest, wenn ihnen die augenscheinlichste Gefahr droht, gestatten, daß Veränderungen in der Nähe desselben vorgenommen werden, verlassen ihre Eier oder Küchlein überhaupt nie, bemuttern die ausgeschlüpften Jungen bis zum Flüggewerden mit der innigsten Zärtlichkeit, und setzen ohne Besinnen ihr Leben ein, wenn sie glauben, dadurch das der Küchlein retten zu können. Letztere wachsen sehr rasch heran, müssen aber mehrere, auch äußerlich sichtbare Entwicklungsstufen durchleben, bevor sie das Alterskleid anlegen. Älter geworden, wechseln sie nicht bloß ihr Gefieder, sondern auch ihre Nägel, indem dieselben förmlich abgestoßen und nach und nach durch neue ersetzt werden, denen die alten bis zum Losfallen zum Schutze dienen. Nach mir mitgeteilten Beobachtungen verschiedener Auerhuhnpfleger erneuern gewisse Arten, so die Auerhühner, mit der Mauser sogar den hornigen Überzug des Schnabels, der zuerst in der Gegend der Nasenlöcher sich zu lösen beginnt und in kleinen Teilen absplittert, dessen Spitzenteil aber im ganzen abgeworfen wird.
Der Mensch ist es nicht gewesen, dem wir die Erhaltung der Rauchfußhühner verdanken; denn er hat unter diesem edlen Wilde ärger gehaust als die schlimmsten Raubtiere und verfolgt es rücksichtslos noch heutigentags. Nur da, wo eine geordnete Forstwirtschaft eingeführt ist und das edle Waidwerk von zünftigen Grünröcken gehandhabt wird, genießen jene des ihnen so notwendigen Schutzes; da, wo sie noch häufig sind, stellt ihnen jeder Bauer ohne Schonung, ohne Barmherzigkeit nach, und wahrscheinlich steht ihnen dort dasselbe Schicksal bevor wie in Mitteleuropa: sie werden nach und nach ausgerottet werden, wie der Stolz unseres Waldes, das Auerhuhn, in vielen Gauen und Gegenden bereits ausgerottet wurde. Dies ist zu beklagen, aber nicht aufzuhalten. Sie bringen zwar dem Forst keinen ersichtlichen Nutzen, verursachen aber auch nur ausnahmsweise wirklich empfindlichen Schaden und würden nach wie vor jenem zur Zierde gereichen können, wäre unser deutscher Wald nur noch als solcher zu bezeichnen. Die forstliche Bewirtschaftung desselben, nicht die rücksichtslose Verfolgung, gereicht ihnen zum Verderben.
*
Das größte und edelste aller Rauchfußhühner ist das Auer- oder Urhuhn ( Tetrao urogallus), einer der größten Landvögel Deutschlands, die Zierde der Wälder, die Freude des Weidmanns. Es vertritt die Sippe der Waldhühner ( Tetrao). Der Scheitel und die Kehle sind schwärzlich; der Hals ist dunkel aschgrau, schwarz gewässert, der Vorderhals schwärzlich aschgrau gewässert, der Rücken auf schwärzlichem Grund sein aschgrau und rostbraun überpudert, der Oberflügel schwarzbraun, stark rostbraun gewässert; die Schwanzfedern sind schwarz mit wenig weißen Flecken; die Brust ist glänzend stahlgrün, der übrige Unterkörper, besonders dicht der Steiß, schwarz und weiß gefleckt. Das Auge ist braun, die nackte, aus einzelnen dünnen Blättern bestehende oder mit solchen besetzte, einen besonderen Farbstoff enthaltende Braue über demselben und die nackte, warzige Stelle um dasselbe lackrot, der Schnabel hornweiß. Die Länge beträgt einhundert bis einhundertzehn, die Breite einhundertdreißig bis einhundertvierundvierzig, die Fittichlänge vierzig bis fünfundvierzig, die Schwanzlänge vierunddreißig bis sechsunddreißig Zentimeter, das Gewicht fünf bis sechs Kilogramm. Jüngere Hähne unterscheiden sich nur wenig von den alten. Die Henne ist um ein Drittel kleiner und sehr bunt. Kopf und Oberhals sind schwärzlich, rostgelb und schwarzbraun in die Quere gestreift; auf dem übrigen Oberkörper zeigt sich die Befiederung als ein Gemisch von Schwarzbraun, Rostgelb und Rostgraugelb; die Steuerfedern sind auf schön rostrotem Grund schwarz in die Quere gebändert, die Kehle und der Flügelbug rostrotgelb; die Oberbrust ist rostrot, der Bauch auf rostgelblichem Grund unterbrochen schwarz und weiß in die Quere gebändert. Hahnfederige, dem Männchen ungemein ähnliche Hennen kommen nicht selten vor. Die Länge beträgt zweiundsiebzig bis achtundsiebzig, die Breite einhundertacht bis einhundertzwölf, die Fittichlänge fünfunddreißig, die Schwanzlänge zweiundzwanzig Zentimeter, das Gewicht drei Kilogramm.
In früheren Zeiten hat das Auerhuhn unzweifelhaft alle größeren und zusammenhängenden Waldungen Nordasiens und Europas bewohnt; gegenwärtig ist es in vielen Gegenden gänzlich ausgerottet. Vom Balkan nach Norden hin findet man den Vogel noch heutigentags in allen Hoch- und Mittelgebirgen; so längs der ganzen Alpenkette und auf den Karpathen, auf dem Jura, in der Hardt, dem Odenwalde, dem Fichtelgebirge, Erzgebirge und Riesengebirge, dem Böhmer und Thüringer Wald und im Harz, überall aber einzeln, nirgends häufig. In Deutschland geht sein Bestand in demselben Maß zurück, wie der forstwirtschaftliche Betrieb der Waldungen sich hebt; die neuzeitliche Bewirtschaftung der Forsten, insbesondere wohl deren Entsumpfung, rottet es, trotz aller ihm gewährten Schonung, sicher und unaufhaltsam aus. Erst im Norden Europas, in den großen Waldungen Skandinaviens und Rußlands, tritt es zahlreich auf, und in den unermeßlichen Wäldern ganz Nordasiens ist es häufig.
Das Auerhuhn bevorzugt Gebirgswaldungen denen der Ebene, ohne jedoch letztere zu meiden. Vor allem andern verlangt es zusammenhängende Bestände mit feuchtem, stellenweise moorigem Grund. Da, wo es gemischte Waldungen gibt, nimmt es am liebsten in diesen seinen Stand; nächstdem siedelt es sich besonders gern im Schwarzwald an, obgleich auch der Laubwald ausnahmsweise zu seinem Wohnsitz werden kann. Der Vogel verlangt altstämmige Forsten, in denen es nicht an Bächen, Quellen und andern Wässern fehlt, und die neben dem hohen Bestand Dickichte oder Stellen mit Heide, niedrigem Gestrüpp und Beerengesträuch aufweisen. Es ist ein Standvogel, wenn auch nicht im vollsten Sinne des Wortes. Bei anhaltender strenger Kälte und tiefem Schnee verläßt es im Hochgebirge zuweilen seinen Stand und geht in einen tieferen Gürtel herab, pflegt aber bei eintretender milder Witterung regelmäßig nach der Höhe zurückzukehren; im Mittelgebirge oder im Hügellande zieht es sich zuweilen aus einem Gebiet nach dem andern, ohne daß man einen eigentlich schlagenden Grund dafür anzugeben wüßte. Doch muß hierbei bemerkt werden, daß über dieses Streichen bei uns zulande noch nicht Beobachtungen gesammelt worden sind, die jeden Zweifel ausschließen; denn wie schon mein Vater anführt und Geyer bestätigt, geschieht es, daß das Auerwild im strengen Winter zuweilen wochenlang auf den Bäumen sich aufhält, ohne auf den Boden herabzukommen, daß also der Beobachter dadurch leicht getäuscht und zu der Meinung verleitet werden kann, das Wild habe sich einem andern Standort zugewendet. »Merkwürdig ist es«, sagt mein Vater, »daß das Auerhuhn im Winter oft mehrere, sogar acht Tage auf einem Baum stehen bleibt und fast alle Nadeln auf demselben verzehrt.« Ganz ebenso spricht sich Geyer aus, ohne Vorstehendes gekannt zu haben. »Es fiel mir bei Gelegenheit des Fuchsbestattens oder Eingreifens auf, daß ich kein Stück Auerwild spürte. Ich fragte hin und wieder nach der Ursache dieser Erscheinung, aber kein Mensch konnte mir einen Aufschluß geben über die ständig gewordene Behauptung, ›das Auerwild hat seinen Standort gewechselt‹. Als ich jedoch zufällig einmal eine Kette von einigen zwanzig Stück Hähnen und Hennen an einem Abhange, an den sich die Sonne stark anlehnte, aufgebäumt fand, war mir das Rätsel mit einem Male gelöst. In dieser Strecke haben wir sie tagelang beobachtet, Knospen und Nadeln von Fichten und Tannen äsend, ohne in der ganzen Strecke auch nur ein Stück Auerwild auf dem Schnee zu spüren.« Anders ist es im Norden, insbesondere in Rußland. Im Ural z.B. durchwandert das Auerhuhn, den Wacholderbeeren nachgehend, ziemlich weite Strecken, tagtäglich zwölf bis fünfzehn Kilometer zurücklegend. Sind die Beeren verzehrt, so kehrt es allmählich wieder auf seinen früheren Stand zurück, besucht die Lärchen, um hier von deren Knospen zu äsen, und nimmt endlich wiederum die zarten Triebe der Fichten an.
Gewöhnlich hält es sich übertags auf dem Boden auf und wählt sich, wenn es sein kann, solche Stellen, die die ersten Strahlen der Morgensonne empfangen und kleine offene Weideplätze besitzen, die mit Dickicht aus Waldbäumen, Heidel-, Brombeer- und Heidegesträuch abwechseln, auch klares Wasser in der Nähe haben. Hier läuft es umher, durchkriecht das Gestrüpp und das niedere Gesträuch, sucht seine Nahrung und erhebt sich nur, wenn ihm etwas Auffallendes begegnet. Gegen Abend steht es auf; Hahn und Henne trennen sich, und beide treten mit Einbruch der Nacht zu Baume, um hier ihre Nachtruhe zu halten. Sie erheben sich fast nie zum Wipfel, sondern bleiben regelmäßig in der Mitte des Baumes stehen, schlafen und bäumen mit Anbruch des Morgens wieder ab. Auf ihren beliebtesten Stand- und Schlafplätzen benehmen sie sich zuweilen ganz anders als sonst, lassen sich beispielsweise von Hunden verbellen und gestatten, ihre ganze Aufmerksamkeit dem Hunde zuwendend, dem Jäger, sie zu unterlausen. Bei tiefem Schnee und strenger Kälte schläft übrigens auch das Auerwild im Schnee, indem es sich eine Höhle von anderthalb bis zwei Meter Länge ausscharrt und im blinden Ende derselben ruht. Merkt es Gefahr, so kehrt es nicht zum Ausgange zurück, sondern wirst beim Aufstehen die Schneedecke einfach ab und zur Seite. So erfuhr ich von erfahrenen Jägern des Ural.
Die Äsung des Auerwildes besteht in Baumknospen, Blättern oder Nadeln, Klee- und Grasblättern, Waldbeeren, Sämereien und Kerbtieren. Der Hahn nimmt mit gröberer Nahrung vorlieb als die Henne oder die Jungen. »Bei zehn Hähnen, deren Kropf ich in der Balzzeit untersuchte«, sagt mein Vater, »fand ich nichts als Tannen- oder Fichten- oder Kiefernadeln, und es scheint, daß sich der Hahn während der Balze gar nicht die Zeit nimmt, lange nach Nahrung zu suchen, vielmehr das frißt, was er gleich in der Nähe haben kann. Es ist mir aber auch wegen der gänzlichen Verschiedenheit im Geschmack des Wildbrets des Hahnes und der Henne höchst wahrscheinlich, daß ersterer meist Knospen von Fichten, Tannen und Kiefern verzehrt, während die letztere sich gewöhnlich von zarteren Gewächsteilen nährt. Daher mag es wohl auch kommen, daß das Fleisch des alten Auerhahns hart, zähe, strohern und bei gewöhnlicher Zubereitung kaum genießbar, das der Henne dagegen sehr zart und wohlschmeckend ist. Das Wildbret der halbjährigen Hähne ist ebenfalls sehr gut; aber bis zu diesem Alter sind sie auch mit der Mutter gelaufen und haben an ihrem Tische gegessen.« Ich will Vorstehendes dahin erweitern, daß der Hahn im Frühjahr in Nadelwäldern fast ausschließlich von Nadeln, in Buchenwäldern ebenso von Buchenknospen äst, in gemischten Waldungen aber Nadeln bevorzugt. Kleine Kiesel, Erde oder Sand scheinen zur Verdauung der ausgenommenen Nahrung unbedingt nötig zu sein. Zum Wasser kommt das Auerhuhn mehrmals im Laufe des Tages.
Unter den mir bekannten Beschreibungen der Eigenschaften unseres Wildes halte ich die von meinem Vater im Jahre 1822 veröffentlichte für die ausführlichste und beste. Ich werde sie deshalb hier folgen lassen und nur hier und da einige Worte einschieben, wobei ich namentlich die »Auerhahnbalze« meines Freundes, des Forstmeisters Dominik Geyer, eines leidenschaftlichen Auerhahnjägers, zu berücksichtigen habe. »Das Auerwaldhuhn«, sagt mein Vater, »ist ein plumper, schwerfälliger und scheuer Vogel. Sein Gang ist geschwind, jedoch lange nicht so schnell wie der der Feldhühner, Trappen, Regenpfeifer und Läufer. Es trägt den Leib fast wagerecht, nur wenig nach hinten gesenkt, und den Hals etwas vorgelegt. Aus den Bäumen ist seine Stellung verschieden. Der Körper wird bald wagerecht gehalten, bald aufgerichtet, der Hals bald vor-, bald in die Höhe gestreckt. Es steht übrigens aus den Bäumen nicht bloß auf den unteren Asten, sondern, wenn die Wipfel stark genug sind, auch weit oben; ich habe Hähne und Hennen auf den Baumspitzen gesehen. Auf der Erde läuft es herum, wenn es Nahrung sucht. Der Flug ist schwerfällig, rauschend, durch schnelle Schwingenschläge beschleunigt, fast geradeaus und nicht anhaltend. Hahn und Henne fliegen nur kurze Strecken und stellen sich dann stets auf die Bäume. Beim Aufschwingen des Auerwildes von der Erde auf einen Baum ist das Getöse der rauschenden Schwingen sehr stark. Hahn und Henne sind in der Regel ungemein scheu. Ihr Gesicht und Gehör, nicht aber ihr Geruch, sind äußerst scharf, und sie benutzen diese Feinheit ihrer Sinne, um einer Gefahr von weitem zu entgehen.« Geyer sagt genau dasselbe und fügt zum Belege folgendes hinzu: »Um mich von der Feinheit der Geruchswerkzeuge zu überzeugen, habe ich während der Balze Auerhähne unter allen möglichen Winden angesprungen, ohne jemals bemerkt zu haben, daß sie mich mittels des Windes wahrgenommen hätten; hieraus schloß ich also, daß ihre Geruchswerkzeuge weniger ausgebildet sein müssen.« Schlechtes Wetter, auch bevorstehende Stürme scheinen die Scheu des Auerwildes zu vermindern. »Wir wissen ein Beispiel«, fährt mein Vater fort, »daß nach einem Auerhahn, der im Winter einige Tage auf einem Baum gestanden hatte, mehrere Schüsse getan wurden, ohne daß er fortflog; überhaupt kommt man im Winter oft viel leichter als im Sommer schußrecht an dieses scheue Wild an. Die Hennen sind, weil sie geschont werden, weniger vorsichtig als die Hähne und zur Paarungszeit oft so kirr, daß sie sehr gut aushalten.« In seinem Wesen zeigt sich das Auerwild als echtes Huhn. Der Hahn ist ein unverträglicher, jähzorniger, streitsüchtiger Vogel, der, falls man von gefangenen auf freilebende schließen darf, jahraus, jahrein mit andern seines Geschlechts im Streite liegt und deshalb notwendigerweise ein einsiedlerisches Leben führen muß. Er zeigt sich aber auch den Hennen gegenüber herrschsüchtig und zornwütig: denn so liebestoll er sich während der Paarungszeit gebärdet, so gleichgültig scheint er außerdem gegen seine Gattin zu sein. Gefangene haben mich belehrt, daß es gefährlich sein kann, ein Paar Auerhühner zusammenzuhalten, weil der Hahn manchmal, ohne erklärliche Veranlassung, über die Henne herfällt und sie in abscheulicher Weise mißhandelt. Birkhennen darf man noch weniger mit ihm zusammenbringen, weil sie von ihm nicht allein beständig gequält, sondern unter Umständen getötet werden. Das Gegenteil eines solchen Betragens ist allerdings auch beobachtet worden; hat man ja doch in der Gefangenschaft schon Blendlinge von Auerhahn und Birkhennen erzielt. Zwischen zwei Hähnen entspinnen sich leicht ernste Kämpfe; aber auch in dieser Hinsicht finden Ausnahmen statt; es kommt vor, daß da, wo das Auerhuhn häufig ist, sich im Spätsommer und Herbst zuweilen viele Hähne zusammenscharen und, wie es scheint, längere Zeit gemeinschaftlich umherstreifen.
Wenn der Auerhahn zu balzen beginnt, ist es noch still im Walde. Höchstens Amsel-, Mistel- und Singdrossel lassen sich bereits vernehmen; für die übrigen Sänger ist der Frühling noch nicht erschienen. Im Hochgebirge liegt der Wald im Schnee begraben; selbst in der Tiefe hat er sich nur hier und da von ihm befreit. Ist der März reich an schönen Tagen, so hört man schon um diese Zeit einen und den andern Hahn balzen; folgt den schönen Tagen schlechte Witterung, so gefriert den Hähnen, wie sich Gadamer passend ausdrückt, auch der Schnabel wieder zu. Im Mittelgebirge balzt der Auerhahn vom 10. oder 12. April an regelmäßig, während die eisige Kälte des Hochgebirges seine Liebe meist noch einen ganzen Monat in Banden legt. Die Balze selbst geschieht folgendermaßen: Mit Beginn derselben sammeln sich die Auerhähne, die sich vorher vereinzelt hatten, auf bestimmten Waldplätzen, gewöhnlich auf Berglehnen, die gegen Morgen abhängen und mit jungem und altem Holz bewachsen sind. Hier finden sich auch die Hennen aus der Umgegend ein, in der löblichen Absicht, den ihnen zu Ehren stattfindenden Liebesspielen beizuwohnen. Beide Geschlechter kommen abends gegen sieben Uhr stumm gestrichen und schwingen sich auf einzelne Bäume unter starkem Geprassel ein. Hartig hat manchmal beobachtet, daß die Hennen im Fluge einen hell kläffenden Ton, wie ein kleiner Jagdhund, von sich geben; Geyer sagt, im Einklänge mit meinen Beobachtungen, daß der Hahn, nachdem er sich eingeschwungen, mehrere Minuten bewegungslos steht, alles um sich mit außergewöhnlicher Aufmerksamkeit mustert und beobachtet, auch durch das geringste Geräusch, das ihm verdächtig vorkommt, zum Abstehen bewogen wird. Bleibt alles ruhig, so gibt er gewöhnlich unter sonderbarem Halsbewegen einen Laut von sich, den man mit dem Ausdruck »Morgen« oder »Kröpfen« bezeichnet, mit dem Grunzen eines jungen Schweines vergleicht und als ein gutes Zeichen für die nächstmorgige Balze hält. Damit ist jedoch noch nicht gesagt, daß diese am nächsten Morgen auch wirklich stattfinden wird; denn der Hahn beweist, wie alle selbstbeobachtenden Jäger behaupten, ein außerordentlich seines Gefühl für kommende Witterung. »Man bemerkt nicht selten«, sagt Geyer, »während der Zeit der Balze, daß oft, beim schönsten Morgen, an dem dem Jäger ohnehin schon das Herz vor Freude lacht und er seiner Sache sicher zu sein glaubt, eine arge Täuschung der gehegten Erwartungen folgt, nämlich, daß kein Hahn sich meldet. Tritt ein solcher Fall ein, so kann man überzeugt sein, binnen vierundzwanzig Stunden schlechtes Wetter zu haben. Namentlich scheint der Hahn das Herannahen von Schnee zu wittern. Ebenso tritt oft der umgekehrte Fall ein. Ich beobachtete, daß in der Nacht heftiges Schneegestöber begann, bis Mitternacht fortdauerte und dann aufhörte, und daß sich die Hähne am nächsten Morgen dennoch meldeten, wie in der besten Zeit der Balze. Auf ein derartiges Vorkommnis folgt gewöhnlich anhaltend schönes Wetter.« Nicht allzuselten geschieht es, daß der Hahn schon am Abend förmlich balzt, d.+h. sich gleich nach dem Einschwingen meldet, dann auch wohl auf die Erde herabfällt, hier spielt, die Hennen, wenn solche in der Nähe sind, unter allen möglichen, höchst erheiternden Sprüngen vor sich hertreibt und sie schließlich betritt. Dies aber sind Ausnahmen. Bei schlechtem Wetter, namentlich bei Schneegestöber, balzt der Hahn in seltenen Fällen, und wahrscheinlich hat Geyer recht, wenn er annimmt, daß solche Liebestollheit bloß durch die Jugend der betreffenden Hähne erklärt werden kann. Sobald sich am Morgen weiße Streifen im Osten zeigen, ungefähr gegen drei oder etwas nach drei Uhr in der Frühe, beginnt die Balze.
Sie hebt mit dem sogenannten »Schnalzen« oder »Schnappen« an, »und von jetzt steigert sich die Aufmerksamkeit des Jägers, bis der erste Schlag hörbar wird, der für so viele Sphärenmusik ist und jedem, der die Balze kennt, die Pulsschläge beschleunigt«. »Der Hahn«, sagt mein Vater, »streckt bei der Balze den Kopf vor, jedoch nicht jedesmal gegen Morgen, wie behauptet worden ist, hält ihn in schräger Richtung nach vorn, sträubt die Kopf- und Kehlfedern und gibt nun die schnalzenden Töne von sich, die immer schneller aufeinander folgen, bis der Hauptschlag erschallt und das Schleifen anfängt. Dieses besteht aus zischenden Lauten, die dem Wetzen eines eisernen Werkzeuges sehr ähnlich sind und in mehreren aneinandergereihten Sätzen sich folgen; der letzte Ton wird lang gezogen. Gewöhnlich gleich beim Anfang des Balzens, seltener in der Mitte des aus klappenden Lauten bestehenden Satzes hebt er den Schwanz etwas, so daß derselbe zwischen senk- und wagerechter Richtung mitten inne steht, breitet ihn fächerförmig aus und hält die etwas gesenkten Flügel vom Leibe abstehend. Beim Klappen trippelt er bisweilen auf dem Aste; beim Schleifen sträubt er fast alle Federn und dreht sich nicht selten herum. Doch geht das Balzen nicht immer so regelmäßig vor sich. Einige hören im Klappen vor dem Hauptschlage, andere nach ihm, andere mitten im Schleifen auf, noch andere lassen nur einige klappende Töne hören; ja, zuweilen geschieht es, daß ein Auerhahn an einem und demselben Morgen mit ordentlichem und unordentlichem Balzen wechselt.« Besonders eigentümlich ist die geringe Stärke der Laute. Sie klingen, als ob jemand zwei dünne, geglättete Stäbchen aneinander schlage, lassen mit Bestimmtheit keinen Selbstlauter heraushören, sind weder dumpf noch voll, weder laut noch leise, obwohl schwach, so doch auf vier- bis sechshundert Schritte weit im Walde vernehmbar, fallen beim Näherkommen während des Anspringens kaum schärfer ins Ohr als vorher und können doch schon in ziemlich bedeutender Entfernung genau unterschieden werden. Der ganze Satz beginnt mit langsam aufeinander folgenden, abgebrochenen Schlägen; die Zwischenzeiten werden aber in beinahe gleichmäßiger Steigerung immer kürzer und die Schläge zuletzt so rasch nacheinander ausgestoßen, daß sie sich selbst verkürzen und erst nach dem Hauptschlage eine kurze Pause eintritt. »Der erste Schlag«, sagt Geyer, »ist vergleichbar mit dem Ausruf ›Töd‹; dann folgt ›Töd, töd, töd, töd‹ und endlich immer schneller ›Töd öd öd öd öd öd‹ usw., bis der sogenannte Hauptschlag, der ungefähr wie ›Glack‹ klingt und stärker hörbar als die vorhergehenden ist, geschieht. Dann beginnt das fabelhafte Schleifen, Wetzen, Einspielen, auch das ›Vers- oder sogenannte Gesetzelmachen‹ benannt, das bis jetzt, trotz aller möglichen Versuche und Bemühungen, keinem Sterblichen auch nur annäherungsweise nachzuahmen gelang und wahrscheinlich nie gelingen wird. Es dauert ungefähr dreieinhalb, aber nie über vier Sekunden, läßt sich einigermaßen mit dem Wetzen eines langen Tischmessers an einer Sense vergleichen und klingt etwa wie ›Heide Heide Heide Heide Heide Heide Heide heiderei‹.« Ich will meinen alten Freund Geyer nicht des Irrtums zeihen, muß aber doch sagen, daß die von Lloyd gegebene Übertragung der Laute des Einspielens: »Pellöp, pellöp, pellöp« usw. und des Hauptschlages »Klikop« mir besser zusagt als die seinige, bemerke dazu jedoch ausdrücklich, daß die Laute, die man als Gaumenlaute bezeichnen darf, durch Schriftzeichen überhaupt nicht wiedergegeben werden können. Wohl aber ist es möglich, dieselben mit dem Munde so täuschend nachzuahmen, daß man schwören möchte, den Hahn zu hören. An einem von mir gepflegten Auerhahn, der in jedem Frühjahr regelmäßig und höchst eifrig balzte, habe ich, und zwar in einer Entfernung von kaum einem Meter, beobachtet, daß das Schnalzen bei geöffnetem Schnabel hervorgebracht und höchst wahrscheinlich durch eine große Anstrengung der Kehlkopfmuskeln bewirkt wird. Das Ausstoßen des Hauptschlages wenigstens erschüttert den Kehlkopf genau in derselben Weise wie ein kräftiges Zungenschnalzen den unsrigen. Jedes neue Einspielen erregt den Hahn mehr und mehr. Er geht auf dem Aste auf und nieder, läßt häufig seine Losung fallen, greift mit einem oder dem andern Ständer in die Luft, springt auch wohl von einem Ast zum andern oder steht nach, wie der Jäger sagt, kurz, befindet sich in einer gewissen Verzückung, die ihn zuweilen alles um sich her vergessen läßt. Dies geht so weit, daß er sich sogar um den Knall eines Feuergewehrs nicht kümmert, selbst wenn der Schuß ihm gegolten hat, vorausgesetzt natürlich, daß er nicht von einem Schrotkorn berührt wurde. »Im Schwerhören beim Schleifen«, fährt mein Vater fort, »sind alle Auerhähne einander gleich; aber mit dem Sehen ist es anders. Wir gingen einst auf die Auerhahnbalz, und als einer von uns, um einen Auerhahn zu unterlaufen, eine Blöße überschreiten mußte, stiebte der Auerhahn mitten im Schleifen ab und schwieg gänzlich, ein deutlicher Beweis, daß er den Schützen bemerkt hatte. Ein anderes Mal schlugen wir während des Schleifens eines Auerhahnes Feuer unter ihm. Das Geräusch des Feuerschlagens hörte er nicht, aber die Funken sah er recht gut. Ein drittes Mal bemerkten wir, daß ein Auerhahn mitten im Schleifen abbrach, als ein weißes Taschentuch unter ihm geschwenkt wurde.« Mein Vater glaubte, daß die starke Pressung der von ihm bewegten Luft, das Geräusch, das er selbst verursacht, die Ursache dieser Schwerhörigkeit sei; ich kann mich jedoch seiner Ansicht nicht anschließen, sondern muß Gadamer recht geben, der die sogenannte Taub- und Blindheit ansieht als die Wirkung einer aus das höchste gestiegenen Brunst oder Sinnlichkeit, die den Vogel alles um sich her vergessen läßt. Jeder Beobachter, der einen Auerhahn in der Gefangenschaft balzen sah, kommt zu der Überzeugung, daß die Sinnestätigkeit des verliebten Gecken einzig und allein durch seine auf das höchste gesteigerte Aufregung beeinträchtigt werden kann. Während des eigentlichen Einspielens pflegt er den Kopf senkrecht in die Höhe zu heben, und so kann es recht wohl vorkommen, daß sein Auge das unter ihm Vorgehende nicht wahrnimmt, auch abgesehen davon, daß sich die Nickhaut seines Auges während dieser Kopfbewegung regelmäßig über mehr als die Hälfte des Augapfels zieht. Daß er aber sieht und hört, unterliegt keinem Zweifel, und ich kann die von Gadamer geschickt angestellte Untersuchung durch eigene Beobachtungen an meinen Pfleglingen bestätigen. »Ich besaß«, so erzählt letztgenannter Forscher, »einen Auerhahn, der zahm war, an vier Jahre lebend und hatte das Vergnügen, ihn jedes Frühjahr balzen zu hören. Nun fiel es mir ein, sein Gehör und Gesicht zu prüfen, wozu mir mein Vater behilflich war. Wie genau der Versuch ausfallen mußte, erhellt daraus, daß der Hahn auch eifrig fortbalzte, wenn man so nahe bei ihm stand, daß man ihn mit der Hand berühren konnte. Ich selbst stellte mich neben ihn und ließ meinen Vater mit geladenem Gewehr an vierzig Schritte weit gehen, doch so, daß er den Beginn des Schleifens genau hören konnte, um im rechten Augenblick den Schuß abzugeben. Als der Hahn schleifte, schoß mein Vater ab. Der Hahn wandte hastig den Kopf der Gegend zu, aus der der Schuß gekommen war, und bewies durch sein Benehmen, daß er den Knall wohl gehört hatte, ließ sich aber im Schleifen durchaus nicht stören. Dieser Versuch wurde wohl an zehnmal wiederholt und jedesmal dieselbe Bewegung seitens des Hahnes bemerkt. Dann ließ ich Kupferhütchen abbrennen; auch diese hörte er. Während der Balzzeit war er sehr bösartig und hieb nach allem, was sich ihm näherte. Dies gab mir Veranlassung, sein Gesicht zu prüfen. Während er schleifte, streckte ich die Hand aus, als wolle ich seinen Kopf berühren. Ich mußte aber jedesmal die Hand zurückziehen, denn im vollen Schleifen hieb er nach derselben; ja noch mehr, wenn er schleifte und uns den Rücken zuwendete, kam er sogleich angesprungen, wenn man ihn z.+B. am Schwanze greifen wollte.«
Die ungewöhnliche Aufregung, in der sich der Vogel während der Balz befindet, läßt es einigermaßen erklärlich erscheinen, daß er zuweilen die unglaublichsten Tollheiten begeht. So berichtet Wildungen von einem Auerhahn, der sich plötzlich auf sägende Holzmacher stürzte, sie mit den Flügeln schlug, nach ihnen biß und sich kaum vertreiben ließ. Ein anderer flog, nach Angabe desselben Schriftstellers, sogar auf das Feld heraus, stellte sich den Pferden eines Ackersmannes in den Weg und machte diese scheu; ein dritter nahm jedermann an, der sich seinem Standort näherte, versuchte sogar mit den Pferden der Forstleute anzubinden. In der Regel versteigt sich der Mut des Auerhahnes nicht so hoch; eine gewisse Kampflust aber zeigt er während seiner Balze unter allen Umständen. Ein alter Hahn duldet keinen jungen in einem Umkreise von ungefähr dreihundert Schritten, gibt es auch nicht zu, daß ein junger balzt, und kämpft mit jedem Nebenbuhler, der sich widersetzt, nach Ritterart auf Leben und Tod. Im günstigsten Falle bringt einer dem andern schwere Verwundungen am Kopfe bei; nicht allzuselten aber bleibt einer der Kämpen tot auf dem Platze liegen. Junge Hähne, die in ihrer Nähe einen alten starken Balzhelden wissen, lassen sich, laut Geyer, nur leise hören.
Das Balzen währt bis nach Sonnenaufgang und pflegt am lebhaftesten zu sein, wenn der Tag anbricht. Man will bemerkt haben, daß alle Hähne besonders eifrig balzen, wenn in den Morgenstunden die Mondsichel am Himmel steht; die Ursache dürfte wahrscheinlich nur in der größeren Helle des Morgens zu suchen sein. Nachdem der Tag vollkommen angebrochen ist, steht der Hahn ab und verfügt sich zu den Hennen, die sich in einiger Entfernung von ihm herumtreiben. Zuweilen geschieht es, daß eines der verliebten Weiber lockend dem balzenden Hahne naht und ihn mit zärtlichem »Bak, bak« zu sich einladet. Einer solchen Lockung vermag sein Herz nicht einen Augenblick lang zu widerstehen; er fällt, wenn er die Liebeslaute hört, wie ein Stein vom Baum herab und tanzt nun einen sonderbaren Reigen auf dem Boden. In der Regel aber muß er die Hennen aufsuchen und nicht selten ziemlich weit nach ihnen fliegen. »In der Nähe der Hennen«, schreibt mein Vater, »balzt er jedesmal auf dem Boden, geht dabei um diese herum und betritt sie, nachdem sie sich ganz auf den Boden niedergekauert haben. Wieviele Hennen ein Hahn an einem Morgen betreten kann, läßt sich nicht bestimmen, weil er selten mehr als ihrer drei bis vier um sich hat und schwerlich so viele zusammenfindet, als er sich wünschen mag. Die Hennen scheinen zu einem Hahn mehr Zuneigung zu haben als zum andern; daher entstehen auch die hitzigen Kämpfe, die übrigens niemals während der eigentlichen Balz, sondern stets in der Nähe der Hennen und auf dem Boden ausgefochten werden. Dabei werden die Hähne so wütend, daß man zuweilen einen von ihnen mit Händen greisen kann. Manche Hähne gelangen gar nicht zur Begattung und balzen dann noch im Mai, ja selbst im Juni und Juli; doch ist dies ein äußerst seltener Fall.«
In der dritten oder vierten Woche der Balz streichen die befriedigten Hähne nach ihren gewohnten, von den Balzplätzen oft weit entfernten Standorten zurück, und die Hennen schreiten nunmehr zum Nestbau. Jede von ihnen wählt hierfür einen passenden Platz und trennt sich von andern ihres Geschlechtes. Das Nest ist eine seichte Vertiefung neben einem alten Baumstock oder einer einzelnstehenden, buschigen, kleinen Fichte, zwischen Heidekraut oder im Beerengesträuch, und wird höchstens mit etwas dürrem Reisig ausgekleidet. »Leider«, sagt Geyer, »ist die Henne nicht vorsichtig genug, um einen Platz zu suchen, der dem Raubzeug und ebenso bösen Menschen wenig ausgesetzt ist. In der Regel geschieht das Gegenteil, und die meisten Nester werden an gangbaren Wegen oder Fußsteigen jeden Schutzes bar gefunden, daher sich auch die geringe Fortpflanzung des Auerwildes erklären läßt.« Die Anzahl der Eier eines Geleges schwankt je nach dem Alter der Mutter. Junge Hennen legen selten mehr als sechs bis acht Eier, ältere deren zehn bis zwölf. Die Eier sind im Verhältnis zum Vogel klein, nur sechzig bis siebzig Millimeter lang und achtundvierzig bis zweiundfünfzig Millimeter breit, länglich, oben zugerundet, wenig bauchig, unten stumpfspitzig, ziemlich dünn- und glattschalig, glänzend, mit wenig bemerkbaren Poren und auf gelbgrauem oder schmutziggelbem, seltener graubräunlichgelbem Grunde dichter oder spärlicher mit graugelben, braunschmutziggelben, hellen und kastanienbraunen Flecken und Punkten gezeichnet, zuweilen auch dunkler gewässert. Die Brutzeit währt durchschnittlich siebenundzwanzig Tage, bei günstiger Witterung vielleicht einen weniger, bei ungünstiger einen mehr. Die Eier werden von der Mutter mit einer Hingabe bebrütet, die wahrhaft ergreifend ist. So kann man z.+B., laut Geyer, die Henne, wenigstens in der letzten Zeit der Bebrütung, mit den Händen von ihrem Nest aufheben und sie wieder hinsetzen, ohne daß sie irgendeine Furcht zeigt oder ihr Nest durch Wegfliegen verläßt. »Es ist somit die Möglichkeit geboten, alle jene Nester, die größerer Gefahr ausgesetzt sind, zu schützen, indem man eine Art Einzäunung oder Einfriedigung ringsum zieht und für die Aus- und Einkehr der Henne einen Raum offen läßt, der gerade zum Durchschlüpfen genügt. Dieses Verfahren wird mit dem Ausdruck ›Hudern‹ bezeichnet und seitens der Henne ohne Anstand geduldet.
Sind die Jungen einmal ausgefallen, so laufen sie nach Verlauf einiger Stunden, nachdem sie gehörig abgetrocknet, mit der Mutter weg und werden von jetzt an mit einer ungewöhnlichen Liebe und Sorgfalt behütet. Es ist rührend zu sehen, wenn man so unverhofft unter eine Kette kommt, mit welchem Geschrei und Lärm die Alte einen empfängt. Im Nu sind alle Jungen verschwunden, und sie wissen sich so gut zu verstecken, daß es wirklich schwer hält, eins von ihnen zu entdecken. Dies verdanken sie hauptsächlich ihrer Färbung. Ich hatte öfters, namentlich auf alten Holzschlägen, die ganze Kette unter meinen Füßen? sie waren noch nicht flügge, und dennoch war ich selten so glücklich, eines von ihnen aufzufinden. Trauriger sieht es freilich mit einer Kette aus, wenn Herr Reineke mit seiner unfehlbaren Nase dahinterkommt. Glückt die allbekannte List der Mutter, immer drei bis vier Schritte vor dem Fuchs dahinzulaufen und dahinzuflattern, sich zu stellen, als wäre sie an den Flügeln gelähmt, und Reineke so aus dem Bereiche der Jungen zu führen, so steht sie Plötzlich auf, streicht nach dem Platze, wo sie zuletzt ihre Jungen ließ, und gibt durch wohlbekannte Töne ›Gluck, gluck‹ kund, daß die Gefahr vorüber ist, worauf sie sich mit ihnen in entgegengesetzter Richtung eiligst auf und davon macht; gelingt dies aber nicht, so sieht es leider oft traurig aus, und nicht selten bleibt keines der Jungen übrig.«
Im günstigsten Falle wachsen die Küchlein unter dem treuen Geleit der Mutter rasch heran. Ihre Nahrung besteht fast nur in Kerbtieren. Die Alte führt sie an geeignete Stellen, scharrt versprechenden Boden auf, lockt sie mit dem zärtlichen »Back, back« herbei, legt ihnen eine Fliege, einen Käfer, Larve, Raupe, einen Wurm, eine kleine Schnecke und dergleichen auf den Schnabel und gewöhnt sie so zum Fressen. Eine Lieblingsnahrung von ihnen sind die Puppen aller deutschen Ameisenarten. Die Alte läuft oft mit den Jungen an die Ränder des Waldes, um die auf den Wiesen und Rainen stehenden Ameisenhaufen aufzusuchen. Findet sie einen, dann scharrt sie, bis die Larven zum Vorschein kommen, und lockt nun das ganze Volk zusammen, das eilig die gute Mahlzeit verschlingt. Wenn die Jungen heranwachsen, fressen sie fast alles, was die Mutter selbst verzehrt. Schon nach wenigen Wochen sind sie so weit befiedert, daß sie bäumen oder wenigstens flattern können; ihr eigentliches Federkleid erhalten sie aber erst viel später. Im Spätherbst trennt sich die junge Familie nach dem Geschlecht: die Weibchen bleiben bei der Mutter; die jungen Hähne streifen gemeinsam umher, lassen ab und zu ihre Stimme vernehmen, kämpfen zuweilen und beginnen im nächsten Frühjahr die Lebensweise der alten.

Auerhahn ( Tetrao urogallus) und Birkhahn ( Tetrao tetrix)
Außer dem Fuchs und dem Habicht stellen noch viele Feinde dem Auerhuhn nach. Die alten Hähne sind freilich vor den meisten Raubtieren gesichert, dank ihrer Vorsicht und ihres Baumlebens; die zarten Jungen hingegen und noch mehr die Eier werden von allerlei Raubgezücht hart mitgenommen und auch die schwächeren Hennen größeren Raubtieren, so namentlich dem Adler und Uhu, öfter zur Beute. Die Eier sind von sämtlichen Raubsäugetieren und außerdem noch von Krähen bedroht, fallen auch leider oft genug rücksichtslosen Menschen in die Hände; mancher Hirt, mancher Holzhauer erlabt sich abends an einem Eierkuchen, den er seinen Haushennen nicht verdankt. Da, wo die Jagd von zünftigen Grünröcken gehandhabt wird, verfährt man überall mit der nötigen Schonung. Kein Waidmann erlegt eine Auerhenne; die Jagd gilt ausschließlich dem Hahn, und auch ihm nur während der Zeit seiner Balze. Das begreift derjenige, der, und wäre es auch nur einmal, selbst hinausgegangen ist in früher Morgenstunde, um den balzenden Auerhahn zu belauschen und womöglich zu erlegen. Es ist dies ein Jagdstück; denn der Hahn bleibt auch während seiner Liebestollheit in der Regel noch vorsichtig und läßt sich nur von dem geübten Jäger berücken. Aber gerade die Schwierigkeit erhöht die Jagdfreude. Ein Hauptreiz der Jagd liegt in der Zeit und Örtlichkeit. »Beim Mondschein vor Tage«, schildert von Kobell, »geht es in die waldigen Gründe, oder im Falle der Himmel trüb, zündet man eine Fackel an, bis man in die Nähe des Balzplatzes kommt. Da geht der Weg oft zwischen alten Bäumen hindurch, die sich in der Beleuchtung der brennenden Späne phantastisch ausnehmen, oder er führt in einen Filzgrund mit verkrüppeltem Krummholz, das einen in seltsamen Gestalten anschaut, und die Stimmung wird eine mehr und mehr gespannte. Von Zeit zu Zeit lauscht man in die Nacht hinein nach dem Balzruf, nach dem sich der Jäger vielleicht noch mehr sehnt als die Henne, der er gilt. Dabei taucht mancherlei Besorgnis auf, daß der Hahn etwa nicht Luft habe zu balzen, wie es öfter geschieht. Sowie nun aber aus der dunklen Wildnis das Schnalzen ertönt und das leise Wetzen, da rührt sich das Jägerblut, da ist alle Aufmerksamkeit auf das Anspringen während des Wetzens oder Schleifens gerichtet.« Das Anspringen selbst will geübt sein; denn eine einzige unbedachtsame Bewegung reicht hin, den Hahn zu verscheuchen, während dieser dem geübten Jäger fast regelmäßig zum Opfer fällt. »Nach einem jedesmaligen Hören des Hauptschlages bzw. des sogenannten Einspielens«, lehrt Geyer, »nähert sich der Jäger mit zwei oder drei Sprüngen oder großen Schritten, und er wartet dann wieder ruhig den Vers ab, ohne aber nebenbei alle mögliche Vorsicht aus den Augen zu lassen. Auf diese Art wird das Anspringen fortgesetzt, bis man aus dem Balzen des Auerhahnes wahrnimmt, daß man sich demselben bis auf Schußweite genähert. Hat man endlich den Vogel erblickt, so spannt man den Hahn des Gewehrs, schlägt während des Einspielens an, erwartet ruhig den nächsten Vers und schießt ihn herab.« Das klingt, als ob die ganze Jagd recht einfach wäre, während ich aus eigener Erfahrung versichern muß, daß solches keineswegs der Fall ist. Das Jagdfieber bemächtigt sich auch des ruhigsten Schützen; es wird diesem schwer, den lauten Herzschlag zu dämpfen, das Maß der Schritte einzuhalten, ruhig bis zum nächsten Einspielen zu warten. Gar häufig kommt es vor, daß man das Stillstehen kaum aushalten kann; nicht selten geschieht es, daß der Hahn den Schützen auch trotz der größten Vorsicht, die dieser beobachtet, rechtzeitig erspäht und davonfliegt, während der Jäger ihn bereits in seiner Gewalt wähnt. Und selbst wenn man glücklich bis unter den Baum gelangte, hat man meist noch seine Not, den großen Vogel zu sehen; denn die Morgendämmerung ist kaum erst eingetreten, wenn die rechte Zeit zur Jagd erschienen, und es hält trotz der Größe des Hahnes schwer, ihn in der dunklen Krone einer Fichte zu unterscheiden, noch schwerer, ihn mit Sicherheit aufs Korn zu nehmen. »Wenn aber der Schuß glückt, wenn er fallend herunterrauscht durch das Gezweige und schwer auf den Boden plumpt, wenn man ihn hat, den mächtigen Vogel, und der erste Morgenstrahl ihn beschauen läßt als einen federweichen, alten Pechvogel, dann ist es wohl lustig, und man steckt gern die schönen schwarzen, am Ende weiß gesprenkelten Schaufelfedern auf den Hut.«
Gefangene Auerhühner gehören zu den Seltenheiten in allen Tiergärten. Es ist nicht leicht, sie an ein ihnen zusagendes Futter zu gewöhnen, und überaus mühsam und schwierig, Junge aus Eiern aufzuziehen. Da, wo Auerwild noch ständig vorkommt, gelangt man ohne besondere Anstrengungen in Besitz der Eier, und eine Truthenne, selbst eine Haushenne, brütet diese auch aus, obgleich letztere sechs Tage länger als auf eigenen Eiern sitzen muß; eine große Schwierigkeit gedeihlicher Aufzucht beruht jedoch darin, daß die durch Haushennen ausgebrüteten Auerhühnchen auf den Ruf ihrer Pflegemutter durchaus nicht hören wollen und ihr fortlaufen. Sperrt man Bruthenne und Pflegeküchlein in einen engen Raum, so geschieht es, laut Pohl, wohl manchmal, daß die Küchlein, durch die Wärme angezogen, unter die Bruthenne schlüpfen und sich dann an letztere gewöhnen; am sichersten aber gelingt die Aufzucht, wenn man die wirkliche Mutter brüten läßt.
Das Birkhuhn, Spiel- und Moorhuhn ( Tetrao tetrix) ist verhältnismäßig schlank gebaut, der Fuß nicht bloß auf die Zehen herab, sondern auch auf den Spannhäuten, zwischen jenen, befiedert, der Schwanz beim Weibchen seicht abgeschnitten, beim Männchen hingegen so tief gegabelt, daß die längsten Unterdeckfedern über die kürzesten mittleren sechs, an Länge gleichen Steuerfedern hinausreichen, nach außen hin aber gesteigert und horn- oder leierförmig gebogen, so daß der ganze Schwanz eine leierartige Gestalt annimmt. Das Gefieder des Männchens ist schwarz, auf Kopf, Hals und Unterrücken prächtig stahlblau glänzend, auf den zusammengelegten Flügeln mit schneeweißen Binden gezeichnet, die durch die an der Wurzel weißen Armschwingen und großen, übrigens glanzlosen und schwarzen Oberflügeldecken gebildet werden, das Unterschwanzgefieder reinweiß; die Schwingen sind außen schwarzbraun, grau verwaschen und weiß geschaftet, die Steuerfedern schwarz. Das Auge ist braun, der Seher blauschwarz, der Schnabel schwarz, die Zehen sind graubräunlich, die Augenbrauen und eine nackte Stelle ums Auge hochrot. Das Weibchen ähnelt der Auerhenne; die Färbung seines Gefieders ist ein Gemisch von Rostgelb und Rostbraun mit schwarzen Querbinden und Flecken. Die Länge des Männchens beträgt sechzig bis fünfundsechzig, die Breite fünfundneunzig bis einhundert, die Fittichlänge dreißig, die Schwanzlänge zwanzig Zentimeter; das Weibchen ist um etwa fünfzehn Zentimeter kürzer und um zweiundzwanzig Zentimeter schmaler.
Das Birkhuhn hat ungefähr dieselbe Verbreitung wie das Auerhuhn, geht aber nicht so weit nach Süden hinab und etwas weiter nach Norden hinauf. Auf dem spanischen und griechischen Gebirge kommt es nicht mehr vor, und auch in Italien wird es nur in den Hochalpen, hier aber sehr häufig gefunden. In Deutschland lebt es wohl noch in allen Staaten und Provinzen, keineswegs aber überall, vielmehr nur in seinen Bedürfnissen zusagenden Waldungen der Ebene wie des Hochgebirges; denn es zeigt sich wählerisch hinsichtlich der Örtlichkeit, nicht aber rücksichtlich der Gegend. Mehr oder minder häufig ist es noch auf allen deutschen Mittelgebirgen, nicht selten im Vogtlands, der Mark und Lausitz, in Schlesien, Posen, Oft- und Westpreußen, Pommern, Hannover und stellenweise in Nordschleswig und Jütland, häufig ebenso im ganzen Alpengebiet, gemein in Livland und Estland, in Skandinavien und Rußland sowie endlich in Sibirien, bis zum Amurlande hin. Immer und überall trifft man das Birkhuhn nur da an, wo das Gelände seinen Anforderungen entspricht. Es verlangt urwüchsige, verwilderte und durch Feuer zerstörte bzw. schlecht oder besser nicht gepflegte Waldungen, nicht aber geschlossene und wohlbewirtschaftete Forsten, Gegenden, die reich an niederen Gesträuchen sind, sei es, daß diese durch die Heide, sei es, daß sie durch Dickichte gebildet werden. Sein Wohnbaum ist die Birke. Sie zieht sie jedem andern Bestände vor; Nadelwaldungen bilden in seinen Augen immer nur einen Notbehelf. Nirgends tritt es so häufig aus als in ausgedehnten Birkenwaldungen; selbst kleine Bestände dieses Baumes vermögen es zu fesseln. Aber auch im Birkenwalde muß der Grund mit jungem, dichtem Aufschlage, Heidekraut, Heidelbeeren, Ginster und anderm niederm Gestrüpp bedeckt sein, wenn es ihm behagen soll. Ebenso liebt es Moorgrund ganz außerordentlich; denn man begegnet ihm auch da, wo die Sumpfpflanzen vorherrschen und die Heide oder das Gestrüpp zurückdrängen, obschon nicht in den eigentlichen Brüchen oder Morästen. Im mittleren Deutschland ist das Birkhuhn ein Standvogel, wenn auch vielleicht nicht im strengsten Sinne; aus dem Hochgebirge und im Norden aber tritt es ziemlich regelmäßige Wanderungen an. So verläßt es, laut Tschudi, in der Schweiz zweimal im Jahre seinen Wohnort und fliegt umher. In den nördlichen Gegenden werden diese Wanderungen regelmäßiger.
»Das Birkhuhn«, schildert mein Vater, der es ebenfalls vortrefflich beobachtet hat, »ist zwar auch schwerfällig wie das Auerhuhn, aber in allen seinen Bewegungen gewandter. Es läuft schneller als das Auerhuhn und trägt dabei den Leib wenig nach hinten gesenkt und den Hals vorgelegt. Aus den Bäumen ist seine Stellung bald aufgerichtet, bald wagerecht; der Hals wird bald eingezogen, bald in die Höhe gestreckt. Es steht lieber auf Laub- als auf Nadelholzbäumen und ist weit öfter aus dem Boden als das Auerhuhn. Ungeachtet der kurzen Schwingen ist sein Flug doch sehr gut, geht geradeaus, mit ungemein schnellem Flügelschlage und oft ganze Strecken in einem Zuge fort. Er rauscht zwar auch, aber weit weniger als der des Auerhuhnes und scheint viel leichter zu sein. Die Sinne sind sehr scharf. Es sieht, hört und riecht vortrefflich, ist auch unter allen Umständen vorsichtig.« Nur äußerst selten läßt es sich leicht berücken; in der Regel nimmt es, wie die Taube, das Gewisse fürs Ungewisse und sucht jeder Gefahr sobald als möglich zu entrinnen. Die Stimme ist verschieden, je nach dem Geschlecht. Der Lockton ist ein helles, kurz abgebrochenes Pfeifen, der Ausdruck der Zärtlichkeit ein sanftes »Back, back«, das Lallen der Kinder ein feines Piepen; während der Balzzeit aber entwickelt der Hahn einen Reichtum an Tönen, die man dem sonst so schweigsamen Vogel kaum zutrauen möchte.
Hinsichtlich der Nahrung unterscheidet sich das Birkhuhn wesentlich vom Auerhuhn; es äst unter allen Umständen von zarteren Dingen als dieses. Baumknospen, Blütenkätzchen, Blätter, Beeren, Körner und Kerbtiere bilden seine Äsung. Im Sommer pflückt es Heidel-, Preißel-, Him- und Brombeeren, im Winter Wacholderbeeren, verzehrt nebenbei die Knospen des Heidekrauts, der Birken, Haselstauden, Erlen, Weiden und Buchen, lebt auch wohl ausnahmsweise von jungen, grünen Kieferzapfen, wie uns Untersuchung der Kröpfe alter Hähne gelehrt hat, verschmäht dagegen Nadeln fast immer. Ebenso gern wie Pflanzenstoffe nimmt es tierische Nahrung zu sich, kleine Schnecken, Würmer, Ameisenlarven, Fliegen, Käfer und dergleichen; zumal die Jungen werden fast ausschließlich mit zarten Kerbtieren geatzt. Die Wanderungen, die der Vogel im Norden unternimmt, geschehen hauptsächlich der Nahrung halber. Wenn in Sibirien Frostwetter eintritt, sieht man das Birkhuhn, laut Radde, in den Vormittagsstunden auf den Kronen der Balsampappeln sitzen, deren dünne Zweige durch den Schnabel ziehen und so die harzigen Knospen abstreifen; dasselbe tut es auch mit den Ruten der Weißbirke und anderer Laubbäume. Körnerfutter verschmäht es nicht; in Sibirien sahen wir es aus der großen Landstraße im Pferdemist nach unverdauten Haferkörnern scharren und wühlen, und in der Gefangenschaft gewöhnt es sich leicht an derartige Nahrung. Sandkörnchen sind auch ihm Bedürfnis.
Vom Auerhuhn unterscheidet sich das Birkhuhn durch große Geselligkeit. Die Geschlechter leben, jedes für sich, in mehr oder minder zahlreichen Flügen zusammen. Auch unter den Birkhähnen gibt es einzelne, die die Geselligkeit meiden, einsam ihre Tage verleben und erst gegen die Balzzeit hin wieder bei ihresgleichen sich einfinden: ihrer sind jedoch wenige. Die Regel ist, daß sich die alten Hähne niemals wirklich trennen, die Hennen nur während der Brutzeit vereinzeln und beide Geschlechter wiederum sich scharen, sobald die Jungen das volle Kleid erlangt haben. Dann bleiben nur noch die Weibchen bei der Mutter, wogegen die Männchen älteren ihresgleichen sich gesellen und mit diesen fortan bis zur nächsten Balze gemeinsam und friedlich leben. Diese Tatsache erklärt die außerordentlich zahlreichen Schwärme der Hähne im Gegensatz zu den stets schwachen Ketten der Hennen. Während wir in Sibirien zu Ausgang des Winters mehrmals Flüge von zwei- bis vierhundert Hähnen sahen, kamen uns immer nur schwache Ketten von Hennen zu Gesichte, sie aber häufiger als jene großartigen Versammlungen. Das Leben des Birkhuhnes ist übrigens ziemlich wechselvoll, schon wegen der Wanderungen, die im Winter unternommen werden. Um diese Zeit haben die Vögel zuweilen auch ihre liebe Not um das tägliche Brot; bei tiefem Schneefall z.+B. müssen auch sie schon ihre Nahrung oft recht kümmerlich erwerben, und dann kann es geschehen, daß sie sich lange Gänge unter dem Schnee graben, um etwas Genießbares aufzufinden.
Der Auerhahnjäger mag behaupten, daß die Balz seines Lieblingsvogels von dem Liebesspiele irgendeines andern Vogels unmöglich übertreffen werden könne; der Nichtjäger wird ihm kaum beistimmen können. Und selbst unter den Waidmännern gibt es viele, die glauben, daß die Birkhuhnbalz das schönste sei, die der Frühling bringen kann. Gewiß ist das eine; derjenige, der auch nur einmal aus der Birkhahnbalz war, wird sie niemals vergessen. Es trägt vieles dazu bei, den Liebesreigen des Hahnes zu einem überaus anziehenden Schauspiele zu stempeln; die Örtlichkeit und die weiter vorgerückte Jahreszeit, die Menge der Hähne, die balzen, die Abwechslung ihrer Tänze, die Schönheit und Gewandtheit sowie die weithin den Wald belebende Stimme des Tänzers, der den Reigen begleitende Vogelgesang aus hundert begabten Kehlen und anderes mehr.
In Deutschland beginnt die Balz, wenn die Knospen der Birke aufschwellen, also gewöhnlich in der zweiten Hälfte des März, währt aber während des ganzen April fort und dauert bis in den Mai hinein. In dem Hochgebirge wie in den Ländern des Nordens tritt sie später ein und kann bis zur Mitte des Juni, ja selbst bis zum Juli anhalten. Auch im Spätherbst hört man zuweilen einzelne Birkhähne eifrig kollern, gleichsam als wollten sie sich vorbereiten und einüben; diese schwachen Versuche haben jedoch mit der eigentlichen Balz kaum Ähnlichkeit.
Der Birkhahn wählt zu seinem Liebesspiel einen freien Platz im Wald, am liebsten eine Wiese oder Lehde, auch wohl einen Schlag, auf dem die junge Baumsaat ihn noch nicht hindern kann. Er erscheint am Abend in der Nähe desselben, tritt zu Baum und balzt hier in Unterbrechungen bis zum Einbruch der Nacht. Früh in der Morgendämmerung verläßt er die Schlafstelle und begibt sich auf den Boden herab. Wo das Birkwild häufig ist, sammeln sich auf günstigen Plätzen viele an, im Norden oft ihrer dreißig bis vierzig, manchmal hundert. Der erste Hahn, der sich zeigt, gibt beim Einstieben einige quiekende Töne von sich, schweigt hierauf einige Zeit und beginnt nun zu blasen oder zu schleifen, worauf die eigentliche Balz anfängt. Im März und in den ersten Tagen des April wird sie noch oft unterbrochen; später währt sie den ganzen Morgen fort, und jeder einzelne Hahn beweist dann eine Ausdauer, die uns in Erstaunen setzt; in Lappland hörte ich den Birkhahn von elf Uhr abends an bis früh um zwei Uhr ununterbrochen balzen. Bei uns pflegt er erst mit Anbruch des Morgens zu beginnen, und so ist es, laut Tschudi, auch im Hochgebirge. »Vor Eintritt der Morgendämmerung, beinahe eine Stunde vor Sonnenaufgang, hört man in den Alpen zuerst den kurzen Gesang des Hausrötlings eine Weile ganz allein; bald darauf erweckt der hundertstimmige Schlag der Ringamseln alles Vogelleben, vom düsteren Hochwalde bis zu den letzten Zwergföhren hinan, und erfüllt alle Flühen und Bergtäler; unmittelbar darauf, wohl eine starke halbe Stunde vor Sonnenaufgang, tönt der klangvolle erste Balzruf des Birkhahnes weit durch die Runde, und ihm antworten hier und dort, von dieser Alpe, von jener Felsenkuppe, aus diesem Krummholzdickichte und von jenem kleinen Bergtalwäldchen herauf die Genossen. Mehr als eine halbe Stunde weit hört man das dumpfe Kollern und zischende Fauchen jedes einzelnen aus allem Vögeljubel deutlich heraus.« Die Balz selbst ist Liebestanz und Liebesgesang zugleich. Auf das erste Pfeifen oder Quieken, das man vom einstiebenden Hahne vernimmt, folgt das sogenannte Blasen oder Schleifen, ein merkwürdiges hohles Zischen, das Nilsson nicht übel durch die Buchstaben »Tschjo – y« wiedergibt, obwohl es vielleicht noch richtiger durch »Tschj – chsch« ausgedrückt werden dürfte, und unmittelbar daran reiht sich das sogenannte Kollern, das Bechstein durch die Silben »Golgolgolgolrei«, Nilsson aber, und meinem Gefühle nach richtiger, durch die Laute »Rutturu – ruttu – ruiki –urr – urr – urr – rrrutturu – ruttu – rucki« zu übertragen versuchte. Wenn der Hahn sehr hitzig ist, balzt er in einem fort, so daß Kollern und Schleifen beständig abzuwechseln scheinen und man den Anfang und das Ende eines Satzes kaum mehr unterscheiden kann. Es kommt bei ihm nur selten vor, daß er wie der Auerhahn alles um sich her vergißt und sozusagen taub und blind ist; ich kenne übrigens doch Fälle, daß einzelne, auf die während des Schleifens geschossen wurde, nicht von der Stelle wichen, sondern zu der Meinung verleiteten, daß sie den Knall nicht vernommen. Seine Bewegungen während der Balz sind erregt, lebhaft und absonderlich. »Vor dem Kollern«, schildert mein Vater sehr richtig, »hält er den Schwanz senkrecht und fächerförmig ausgebreitet, richtet Hals und Kopf, an dem alle Federn gesträubt sind, in die Höhe und trägt die Flügel vom Leib ab und gesenkt; dann tut er einige Sprünge hin und her, zuweilen im Kreise herum und drückt endlich den Unterschnabel so tief auf die Erde, daß er sich die Kinnfedern abreibt. Bei allen diesen Bewegungen schlägt er mit den Flügeln und dreht sich um sich selbst herum.« Je hitziger er wird, um so lebhafter gebärdet er sich, und schließlich meint man, daß man einen Wahnsinnigen oder Tollen vor sich sehe. Am meisten steigern sich alle Bewegungen, wenn mehrere Birkhähne auf derselben Stelle einfallen; dann werden aus den Tänzern wütende Streiter. Ihrer zwei stellen sich wie Haushähne gegeneinander auf, fahren mit tief zu Boden gesenkten Köpfen aufeinander los, springen beide zu gleicher Zeit senkrecht vom Boden auf, versuchen sich zu hauen und zu kratzen, fallen wieder herab, umgehen sich unter wütendem Kollern mehrmals, nehmen einen neuen Anlauf und streben, sich gegenseitig zu packen. Wird der Kampf ernsthaft, so muß jeder der Kämpfer Federn lassen; aber trotz der Wut, mit der sie kämpfen, kommen kaum, vielleicht niemals ernsthafte Verwundungen vor. Doch geschieht es, daß der stärkere den schwächeren beim Schopfe packt, wie einen Gefangenen eine Strecke weit wegschleppt, ihm dann noch einige Hiebe versetzt, ihn zu flüchten zwingt und hierauf frohlockend zum Kampfplatz zurückkehrt, um weiter zu balzen. Starke Hähne pflegen im Laufe des Morgens verschiedene Balzplätze zu besuchen, offenbar in der Absicht, ihre Kraft an mehreren Gegnern zu erproben; sie werden unter Umständen der Schrecken aller jüngeren, minder geübten Hähne, die sich ihnen wohl oder übel unterwerfen müssen. Der geschlagene Hahn kehrt übrigens gewöhnlich ebenfalls wieder zum Kampfplatz zurück und beginnt von neuem zu streiten oder fliegt einem zweiten Balzplatz zu, um dort sich mit einem andern Hahne zu messen.
Die Balz lockt gewöhnlich, doch nicht immer, die Hennen herbei, so daß die Hähne nach Abschluß des Liebesreigens den Lohn ihrer Mühe ernten können. In Skandinavien hat man beobachtet, daß ein gefangener Hahn, der in einem umzäunten Garten balzte, wiederholt von freilebenden Hennen besucht wurde! bei uns bemerkt man die Hennen nur ausnahmsweise in der Nähe der Balzplätze, und die Hähne müssen oft weit nach ihnen fliegen. Haben die Weibchen sich eingefunden, so treten die Hähne mit ihnen in den späteren Morgenstunden zu Baum, kollern noch einige Zeit hier fort und begeben sich sodann gemeinschaftlich nach den Weideplätzen, woselbst die Begattung zu erfolgen pflegt. Ein starker Hahn betritt unter Umständen vier bis sechs Hennen im Laufe des Morgens, ist jedoch nur selten so glücklich, eine derartige Anzahl um sich versammeln zu können.
Gegen Mitte Mai macht die Birkhenne Anstalt zum Brüten. Ihr Nest ist ebenfalls nur eine seicht ausgescharrte, höchstens mit etwas Genist belegte Vertiefung in einer möglichst geschützten Stelle zwischen hohen Gräsern, unter kleinen Büschen usw. Das Gelege enthält sieben bis zehn, bisweilen wohl auch zwölf Eier von etwa neunundvierzig Millimeter Längs- und fünfunddreißig Millimeter Querdurchmesser, die auf graugelbem, blaßgrauem oder rötlichgelbem Grunde mit dunkelgelben, rost- oder ölbraunen und grauen Flecken und Punkten dicht bestreut sind. Die Henne brütet zwar nicht so eifrig wie die Auerhenne, aber doch immer noch mit warmer Hingabe, auch ebenso lange, versucht, nahende Feinde durch Verstellungskünste vom Nest abzulenken, und widmet sich im günstigsten Falle der Aufzucht ihrer Kinder mit der innigsten Zärtlichkeit. Das Jugendleben der Küchlein ist ungefähr dasselbe, und auch der Kleiderwechsel der Jungen geht fast in gleicher Weise wie beim Auerhuhne vor sich. Die Küchlein wissen sich vom ersten Tage ihres Lebens an geschickt zu verbergen, lernen bald flattern und sind schon nach einigen Wochen imstande, den Alten überall hin zu folgen. Demungeachtet haben sie noch viele Gefahren auszustehen, bevor ihr Wachstum vollendet ist.
Die Birkhuhnjagd wird von allerlei Raubgezücht und auch allerorten von den Menschen eifrig betrieben. In Deutschland erlegt man die alten Hähne während der Balz und die jüngeren im Spätherbste beim Treiben. Auf den Hochgebirgen und in den nördlichen Ländern stellt man ihnen, mit Ausnahme der Brutzeit, während des ganzen Jahres nach. Die anziehendste Jagd bleibt unter allen Umständen die während der Balz, schon deshalb, weil um diese Zeit der Waidmann, auch wenn er nicht glücklich war, durch das wundervolle Schauspiel, das er genießt, genugsam entschädigt wird. Im Norden lauert der Jäger auf solchen Waldplätzen und Mooren, wo Birkhähne zu balzen pflegen, von ein Uhr des Morgens an in einer aus Reisern zusammengebauten Schießhütte auf die sich einstellenden Birkhähne, bis sich einer von ihnen schußrecht naht. Der Knall verscheucht die Gesellschaft; der Schütze aber bleibt ruhig in seiner Hütte sitzen. Nach einiger Zeit beginnt ein Birkhahn wieder zu kollern, ein anderer stimmt ein, ein dritter läßt sich ebenfalls vernehmen, eine Henne lockt dazu, das Kollern auf den Bäumen wird lebhafter, und nach Verlauf von etwa einer Stunde erdreistet sich endlich wieder einer, zum Boden herab zu kommen, beginnt zu blasen, gibt damit den anwesenden das Zeichen, daß der Tanz von neuem beginnen kann, und bald ist der Plan wiederum mit den Tänzern bedeckt. Ein zweiter Hahn wird geschossen; das alte Spiel erfolgt wie vorher, und wenn der Jäger Glück hat, kann er ihrer drei und vier an einem Morgen erlegen. In manchen Gegenden baut man sich auch da, wo Birkhähne bei Sonnenaufgang einzufallen pflegen, Schießhütten zum Versteck. Geübte Schützen locken die verliebten Hähne durch Nachahmung des Blasens oder durch den Laut der Hennen herbei oder betören die Jungen dadurch, daß sie den Ruf der Mutter hören lassen; kurz, es werden die allerverschiedenartigsten Jagdweisen in Anwendung gebracht. In ganz Rußland und Sibirien betreibt man mit besonderer Vorliebe die Jagd mit der Puppe. Hierunter versteht man einen gut ausgestopften oder aus Werg und Tuch trefflich nachgebildeten Birkhahn, der im Spätherbst als Lockvogel benutzt wird. Zu diesem Zweck begibt man sich vor Tagesanbruch in den Wald und stellt nun mit Hilfe einer Stange die Puppe auf einem der höchsten Bäume der Umgegend so auf, daß sie mit dem Kopf dem Winde entgegensteht. Aus einer geeigneten Stelle am Fuß des Baumes hat man eine dichtwandige Hütte errichtet, von der aus der Baumwipfel überblickt werden kann. Sobald die Puppe aufgepflanzt ist, werden die benachbarten Wälder abgetrieben. Das hier sich aufhaltende Birkwild erhebt sich, gewahrt die in scheinbarer Sicherheit ruhig dasitzende Puppe, fliegt auf sie zu und bäumt dicht neben ihr auf. Auf den ersten Schuß, der in der Regel einen Hahn fällt, stieben die andern zwar ab; bei der außerordentlichen Häufigkeit des Wildes aber erscheinen fortwährend neue, und die Jagd kann zumal für gute Schützen, die sich einer Erbsenbüchse bedienen, äußerst lohnend ausfallen. Sibirische Jäger versicherten mich, im Laufe eines schönen Morgens bis vierzig Birkhähne, dank der Puppe, erlegt zu haben. In Tirol und in den bayerischen Hochgebirgen wird dem Birkhahne besonders eifrig nachgestellt, weil seine Schwanzfedern als ein beliebter Schmuck von jungen Burschen am Hute getragen werden.
Alt eingesungene Birkhühner lassen sich bei geeigneter Pflege jahrelang am Leben erhalten, schreiten, wenn man ihnen genügenden Spielraum gibt, auch zur Fortpflanzung. Nach meinen Erfahrungen ist es unbedingt notwendig, ihnen einen größeren Raum anzuweisen, der zwar gegen Zug geschützt sein, im übrigen aber gänzlich im Freien stehen muß. Bepflanzt man den Boden dieses Raumes mit dichtem Gestrüpp, so wird man mit ziemlicher Sicherheit auf Nachkommenschaft rechnen dürfen; denn der Birkhahn balzt in der Gefangenschaft womöglich noch eifriger als im Freien, läßt sich regelmäßig in jedem Herbst hören, beginnt im Frühling mit dem ersten warmen Tag und balzt bis gegen Juni hin ununterbrochen fort. Auch von mir gepflegtes Birkwild hat sich im Käfige fortgepflanzt, und mir befreundete Liebhaber sind so glücklich gewesen, wiederholt Birkhühner zu züchten. Die dem Ei entschlüpften Jungen verlangen dieselbe Pflege wie junge Auerhühner, verursachen, einmal groß geworden, aber kaum mehr Umstände als Haushühner.
Das Rackelhuhn oder Mittelhuhn ( Tetrao hybridus), der Blendling zwischen Auer- und Birkhuhn, steht, was Gestalt und Färbung anlangt, ziemlich in der Mitte zwischen seinen beiden Stammeltern, gibt sich aber keineswegs »auf den ersten Blick hin« als Blendling zu erkennen. Besonders merkwürdig wird es aus dem Grunde, weil seine Färbung eine sehr regelmäßige, d.+h. bei den einzelnen Stücken im wesentlichen gleichartige ist. Der Hahn ist auf dem Oberkörper entweder rein schwarz und glänzend oder auf schwarzem Grunde überall mit grauen Punkten und feinen Zickzacklinien gezeichnet, auf dem Oberflügel schwärzlichbraun und grau durcheinander gewässert; über die Schwungfedern zweiter Ordnung verläuft eine breite, unreinweiße Binde und eine solche Spitzenkante; der seicht ausgeschnittene Schwanz ist schwarz, am Ende der Federn zuweilen weiß gesäumt, das Gefieder der Unterseite schwarz, auf dem Vorderhals und Kopf purpurschillernd, an den Seiten grau überpudert, auch wohl weiß gefleckt, die Befiederung des Beines weiß, die der Fußwurzel aschgrau. Das Auge ist dunkelbraun, der Schnabel hornschwarz. Das Weibchen ähnelt bald der Auer-, bald der Birkhenne, unterscheidet sich aber von jener immer durch geringere, von dieser durch bedeutendere Größe. Sehr häufig mag es für eine Birkhenne angesehen werden. Die Länge des Männchens beträgt fünfundsechzig bis fünfundsiebzig, die des Weibchens fünfundfünfzig bis sechzig Zentimeter.
Das Rackelhuhn ist überall gefunden worden, wo Auer- und Birkhähne nebeneinander leben: in Deutschland, in der Schweiz, vornehmlich aber in Skandinavien. Hier werden, laut Nilsson, alljährlich derartige Blendlinge gefangen oder erlegt. Am häufigsten hat man sie in dem nördlichen Teile von Wermeland beobachtet; auch in Norwegen können sie nicht selten sein, da, laut Collett, allwinterlich einige auf den Wildmarkt zu Christiania gebracht werden. Der Rackelhahn hat keine besonderen Balzplätze, sondern findet sich auf denen des Birkhahnes, seltener auf denen des Auerhahnes, ein, regelmäßig zum Ärger der balzenden Hähne und der Jäger; denn im Bewußtsein seiner Stärke geht er mit allen Birkhähnen Kämpfe ein, jagt sie auseinander und treibt sie schließlich in die Flucht, stört mindestens das gewöhnliche Zusammenleben der balzenden Hähne auf das empfindlichste. Die Laute, die er beim Balzen ausstößt, bestehen in einem röchelnden und grobgurgelnden »Farr, farr, farr«, das etwas mehr Ähnlichkeit mit dem Balzen des Birkhahnes als mit dem des Auerhahnes hat. Er schleift aber weder, noch tut er einen Hauptschlag wie der Auerhahn, sondern bläst gegen Ende des Balzens hin wie der Birkhahn, nur weit stärker. Kein einziger Beobachter will gesehen haben, daß er nach dem Balzen die Birkhennen betritt; doch hat diese Behauptung wenig zu bedeuten, da man auch von der Begattung des Auer- und Birkwildes nur in Ausnahmefällen Zeuge wird und das vereinzelte Vorkommen des Rackelhahnes die Beobachtung noch besonders erschwert.
*
Neben dem Auer- und Birkhuhn lebt in den europäischen Waldungen noch ein drittes Mitglied der Familie, das Hasel- oder Rotthuhn ( Tetrastes bonasia), das als Vertreter einer besonderen Sippe angesehen wird. In der Gestalt ähnelt unser Huhn den bisher besprochenen Verwandten; seine Fußwurzel ist aber nur bis zu drei Viertel ihrer Länge befiedert, und die Zehen sind nackt; der abgerundete Schwanz besteht aus sechzehn Steuerfedern; die Scheitelfedern sind stark verlängert und zu einer Holle aufrichtbar. Beide Geschlechter ähneln sich in Größe und Färbung des Gefieders, obwohl sie sich noch leicht unterscheiden lassen. Das Gefieder ist auf der Oberseite rostrotgrau und weiß gefleckt, der größte Teil der Federn auch mit schwarzen Wellenlinien gezeichnet; auf dem Oberflügel, dessen Färbung ein Gemisch von Rostgrau und Rostfarben ist, treten weiße Längsstreifen und weiße Flecke deutlich hervor; die Kehle ist weiß und braun gefleckt; die Schwingen sind graubraun, auf der schmalen Außenfahne rötlichweiß gefleckt, die Steuerfedern schwärzlich, aschgrau getuscht und die mittleren rostfarben gebändert und gezeichnet. Das Auge ist nußbraun, der Schnabel schwarz, der Fuß, soweit er nackt, hornbraun. Dem Weibchen fehlt die schwarze Kehle, und die Färbung seines Gefieders ist minder lebhaft, namentlich mehr grau als rostrot. Die Länge beträgt durchschnittlich fünfundvierzig, die Breite zweiundsechzig, die Fittichlänge neunzehn, die Schwanzlänge dreizehn Zentimeter. Das Weibchen ist etwa um ein Fünftel kleiner als das Männchen.
Der Verbreitungskreis des Haselhuhnes erstreckt sich von den Pyrenäen an bis zum Polarkreis und von der Küste des Atlantischen bis zu der des Großen Weltmeeres. Innerhalb dieser ausgedehnten Länderstrecken findet es sich jedoch keineswegs allerorten, sondern nur in gewissen Gegenden. Es bevorzugt Gebirge der Ebene, hält sich aber auch dort bloß hier und da ständig auf. Im Alpengebiete, in Bayern, Schlesien, Posen, Ost- und Westpreußen ist es nicht gerade selten; in den Rheinländern, Hessen-Nassau, dem südlichen Westfalen und Franken, auf dem Harz und Erzgebirge noch immer heimisch, in Pommern bereits sehr zusammengeschmolzen. In ganz Norddeutschland, Holland, Dänemark und Großbritannien kommt es nicht vor. Häufig und allverbreitet ist es erst im Norden und zumal im Nordosten Europas, namentlich in Schweden und Norwegen, Rußland und Sibirien. Große, dunkle und gemischte Wälder, insbesondere solche, die aus Eichen, Birken, Erlen und Nußbäumen, mindestens aus Nadelbäumen, Birken und Espen bestehen, und hier auf der Südseite liegende, wenig besuchte, an steinige, mit Beerengestrüpp bedeckte Halden grenzende Gehänge bilden seine Lieblingsaufenthaltsorte, während es im reinen Nadelholzwalde selten und immer nur einzeln angetroffen wird. In Waldungen, die seinen Anforderungen entsprechen, wählt es sich dichte Bestände zu seinem Wohnorte, und nach ihnen zieht es sich bei jeder Gefahr zurück. Je wechselreicher der Wald, um so angenehmer scheint er ihm zu sein. An gewissen Waldstellen findet man es jahraus jahrein, während es andere zeitweilig verläßt, um kurze Streifzüge zu unternehmen. Namentlich die Hähne streichen im Herbst ziemlich regelmäßig nach angrenzenden kleinen Wäldern oder Schlägen, um sich dort an verschiedenen Beeren zu laben. Dabei geschieht es denn, daß einzelne oft zehn bis zwanzig Kilometer weit in die Felder und das Feldgesträuch fliegen und förmlich verschlagen werden; doch kehren die meisten gegen Ende des Monats nach den großen Waldungen wieder zurück. Auch im übrigen Jahr wechselt das Haselhuhn mit seinem Aufenthaltsorte.
Das Haselhuhn lebt gern versteckt und macht sich deshalb wenig bemerklich. Nur selten und bloß zufällig, oder wenn man sich still und versteckt hält, gewahrt man es am häufigsten noch im Laufen, wenn es, von einem Gebüsch nach dem andern rennend, einmal eine freie Stelle überschreiten muß, in der rauhen Jahreszeit auch wohl auf stärkeren Ästen eines Baumes sitzend, wo es sich oft der Länge nach hindrückt und auch den Kopf darauf hinstreckt, so daß es sich recht gut verbirgt. Von dünnen Zweigen aus fliegt es, aufgescheucht, meist schnell weg und verbirgt sich im Gesträuch am Boden; vom Boden aus dagegen erhebt es sich, wenn man es hier überrascht, regelmäßig zu einem der nächsten Bäume, um von der Höhe aus den Störenfried neugierig zu betrachten. Gewöhnlich sitzt und geht es sehr geduckt, wie ein Rebhuhn, wenn es sich unsicher fühlt, dagegen mit mehr erhobenem und im Laufen mit vorgestrecktem Hals. Es ist überraschend schnell und gewandt, kann auch vortrefflich springen. »Ich belauschte eins«, erzählt Naumann, »beim Ausbeeren einer Dohne, das mit Hilfe der Flügel über anderthalb Meter senkrecht in die Höhe sprang, die erschnappten Beerenbüschel in die Höhe riß, und als es mich in demselben Augenblick gewahr wurde, schnell damit unter die nahen Wacholderbeerbüsche rannte.« Die Henne trägt im Laufen die wenig verlängerten Scheitelfedern glatt niedergelegt, während der mit mehr Anstand einherschreitende Hahn die Haube lüftet.
Männchen und Weibchen unterscheiden sich nicht unwesentlich durch die Stimme, und namentlich die Hennen lassen vielfach wechselnde Laute vernehmen. Die jungen einjährigen Hühner ändern, wie Leyen behauptet, ihren Lockruf mit dem zunehmenden Alter bis zum September des ersten Jahres fünfmal. Es ist schwer, diesen Ruf mit Worten wiederzugeben. Er beginnt im hohen, auf- und absteigenden Diskant und endet in derselben Tonart mit einem kürzeren oder längeren Triller. Die erstjährigen Haselhühner locken, solange sie zusammen in der Kette leben, einfach: »Pi, pi, pi, pi«, und zwar die Hähne ebenso wie die Hennen. Sind die Jungen schon paarungsfähig, wenn auch noch in der Kette, so lassen sie einen Ton vernehmen, der etwa durch »Tih« oder »Tihti« ausgedrückt werden kann, später fügen sie noch einen dritten zu, so daß der ganze Stimmlaut »Tih tih – titi« oder »Tih tih – tite« klingt. Der ausgebildete Hahn pfeift ein förmliches Liedchen, das man durch die Silben »Tih tih – titi diri« wiederzugeben versucht hat. Dieser Ruf wird übrigens ebensowohl im Anfang wie am Ende mehrfach verändert. Die alte Henne unterscheidet sich durch ihre Stimme auffallend von dem Hahn und läßt, namentlich wenn sie davonfliegt, einen sogenannten Läufer hören, der sehr fein und leise beginnt, immer lauter und breiter wird und endlich in möglichst schnell aufeinander folgenden Tönen endigt. Leyen versucht das ganze durch die Silben »Tititititititititikiulkiulkiulkiulkiul« auszudrücken, und Kobell bemerkt, daß ihn die Jäger Oberbayerns durch die Worte »Zieh, zieh, zieh, bei der Hitz in die Höh« zu übersetzen pflegen.
Hinsichtlich der Sinnesanlagen übertrifft das Haselhuhn wahrscheinlich das Birkhuhn, zeichnet sich mindestens durch überaus scharfes Gehör aus. Wesen und Lebensart unterscheiden es von den bisher geschilderten Verwandten. Es gehört nicht zu den Hühnern, die in Vielehelichkeit leben, sondern hält sich paar- und familienweise zusammen. Schon im September wählt sich der junge Hahn eine Gefährtin, ohne jedoch die Kette zu verlassen; gegen das Frühjahr hin trennt er sich mit ihr, um zur Fortpflanzung zu schreiten. Auch er hat eine Balz, wie Auer- und Birkhahn, tanzt aber nicht in der ausdrucksvollen Weise wie die genannten, sondern begnügt sich, durch Aufrichten seiner Scheitel-, Ohr- und Kehlfedern und sehr lebhaftes Trillern und Pfeifen der Gattin seine Gefühle kundzugeben. Wenn er recht hitzig ist, pfeift und trillert er, gewöhnlich auf einem geeigneten Baum und in mittlerer Höhe der Krone stehend, von Sonnenuntergang an fast die ganze Nacht hindurch bis zum späten Morgen. Zum Boden herab kommt der balzende Hahn nur unmittelbar vor der Begattung. Die Henne, die sich auf demselben oder einem benachbarten Baum aufzuhalten pflegt, soll um diese Zeit den Hahn so an sich zu fesseln wissen, daß er sich keinen Augenblick von ihr trennt und nicht einmal durch das Pfeifen anderer Hähne zum Kampf und Streit verlocken läßt, während er sonst einer derartigen Aufforderung unter allen Umständen nachkommt. Erst wenn die Henne brütet, wird seine Kampflust wieder rege oder doch bemerklich.
Am Fortpflanzungsgeschäft nimmt er wenigstens in einem gewissen Grade Anteil. Nach der ersten Begattung sucht die Henne einen möglichst gut versteckten Platz unter Gebüsch und Reisern, hinter Steinblöcken, im Farnkraut usw., legt in eine Mulde ihre acht bis zehn, auch wohl zwölf und mehr, verhältnismäßig kleinen, etwa vierzig Millimeter langen, dreißig Millimeter dicken, glattschaligen, glänzenden, auf rötlichbraunem Grund rot und dunkelbraun gefleckten und getüpfelten Eier und bebrütet sie drei volle Wochen lang so eifrig, daß man in ihre unmittelbare Nähe kommen kann, ehe man sie verscheucht. Während sie sitzt, und so lange die Jungen noch klein sind, treibt sich der Hahn nach eigenem Belieben umher, zumeist allerdings in der Nähe der Gattin, zuweilen aber auch in entfernteren Strichen, zu denen ihn der Lockton eines andern Hahnes gerufen, und erst wenn die Jungen größer geworden, findet er sich wieder bei der Familie ein, um fortan derselben als treuer Führer und Wächter zu dienen. Das Nest ist äußerst schwer zu finden, weil sein Standort mit größter Vorsicht gewählt wird und die Henne bei Annäherung eines Feindes nicht davon hinkt und flattert, sondern still und geräuschlos davonschleicht, während sie, wenn sie die Eier aus freien Stücken verläßt, nie verfehlt, dieselben mit den Niststoffen sorgfältig zu bedecken. Auch die ausgeschlüpften Jungen werden nur zufällig einmal bemerkt. Nach ihrem Eintritt ins Leben hudert sie die Henne noch eine Zeitlang im Nest, bis sie vollkommen abgetrocknet sind; dann führt sie die Kinderschar baldmöglichst geeigneten Weideplätzen zu. Sobald sie Gefahr wittert, gebraucht sie alle Verstellungskünste, die in ihrer Familie üblich sind, und die kleinen, dem Erdboden täuschend ähnlich gefärbten Küchlein drücken sich so geschickt zwischen Moos und Kraut, Steine, Baumwurzeln und dergleichen, daß wohl die feine Nase eines Fuchses oder Hühnerhundes, nicht aber das Auge eines Menschen sie wahrnehmen kann. Anfänglich werden sie an sonnige Stellen geführt und hier fast ausschließlich mit Kerbtieren ernährt; später nehmen sie dieselbe Nahrung zu sich wie die Alten, noch immer viele Kerbtiere, aber auch Beeren, Grasspitzen, Blätterknospen und Blütenblättchen der verschiedenen Pflanzen. Sie lernen sehr bald fliegen und vertauschen dann ihren nächtlichen Ruheplatz unter der Mutterbrust mit niederen und höheren Baumästen, auf denen sie sich dicht neben und noch teilweise unter die Mutter niederzusetzen pflegen. Mit dem Flugbarwerden trifft nun auch der Vater wieder bei der Familie ein, und nunmehr bildet die ganze Gesellschaft ein Gesperre, das bis zum Herbst treu zusammenhält.
Leider wird das Haselhuhn bei uns zulande, trotz des ihm von den Menschen gern gewährten Schutzes, von Jahr zu Jahr seltener. Raubsäugetiere und Raubvögel mögen viele Jungen wegnehmen; es müssen aber auch noch andere Ursachen zu dieser in mancher Hinsicht auffallenden Verminderung beitragen. In vielen Gegenden, wo es früher Haselhühner gab, sind sie jetzt verschwunden, ohne daß man eigentlich sagen kann, warum. Dagegen wandern sie in einzelne Waldungen auch wieder ein. So ist es geschehen in einigen Wäldern an dem südlichen Abhange des Erzgebirges, woselbst man gegenwärtig bereits wieder namhafte Flüge antrifft.
Da, wo das Haselhuhn häufig ist, wird es in Menge erlegt: denn sein Wildbret ist unbestritten das köstlichste, das die Ordnung der Scharrvögel überhaupt gewährt. Die Jagd wird entweder mit Hilfe des Vorstehhundes oder, und wohl mit größerem Vergnügen, vermittels der sogenannten Locke betrieben. Letztere ist eine Pfeife, auf der der Ruf des Hahnes täuschend nachgeahmt und jedes kampflustige Männchen herbeigezogen wird. Glücklicherweise gehört zu dieser Jagdart eine gewisse Kunstfertigkeit oder mit andern Worten ein zünftiger Jäger. Wie bei andern Hühnern erregen die letzten schönen Herbsttage auch das Haselhuhn und machen es geneigt, mit andern seinesgleichen zu kämpfen, zu streiten. Diese sogenannte Kampfzeit währt von den ersten Tagen des September an bis Ende Oktober, und sie ist es, die zur Jagd benutzt wird; namentlich die ersten Tage des September sind hierzu geeignet, falls die Witterung günstig ist. Der Jäger, der auf der Locke mit Erfolg Haselhühner jagen will, muß nicht nur die Jagdart, sondern auch den Wald genau kennen; denn die Hauptsache ist und bleibt, einen geeigneten Standort zu wählen und während des Ganges möglichst wenig Geräusch zu verursachen. In der Frühe des Morgens bricht man auf, schleicht durch den Wald und stellt sich da, wo man Haselhühner weiß oder vermutet, hinter einem hochschaftigen Baum auf. Hauptbedingung des Standortes ist ein im Umkreise von dreißig Schritten freier, d.+h. nicht mit Gestrüpp oder Heide bedeckter Boden, weil der herbeigelockte Haselhahn nicht immer geflogen, sondern sehr oft gelaufen kommt, dann selbstverständlich jede Deckung benutzt und regelmäßig den Schützen eher entdeckt, als dieser sein Wild. Der schulgerechte Jäger stellt oder lehnt sich, nachdem er den passenden Standpunkt gefunden, an seinen Baum, bringt sein Gewehr von der Schulter in die Hand, spannt den Hahn, nimmt die Locke und ruft nun zunächst als jüngerer Haselhahn. Bei günstigem Wetter kommt der getäuschte Hahn auf den ersten Ton geflogen, und zwar so schnell, daß der Jäger kaum Zeit hat, die Locke aus dem Munde zu nehmen. Er erkennt aus der größeren oder geringeren Stärke des Aufbrausens, ob der Hahn von einem Baum auf den andern geflogen ist oder sich von dem Baum auf die Erde geworfen hat, weiß also im voraus, von welcher Seite sein Wild ankommen wird, stellt sich günstig zurecht, lockt noch einmal, um jenem die Stelle genau zu bezeichnen, sieht schußfertig nach der betreffenden Gegend hin und wird so in der Regel den ankommenden Hahn schon von weitem wahrnehmen können. Läuft dieser auf dem Boden dahin, so wartet der Schütze, bis er hinter eine Baumwurzel oder hinter eine Erdvertiefung tritt, benutzt diesen Augenblick zum Anschlag, zielt ruhig und drückt ab, sobald der Hahn auf fünfzehn, zwanzig oder höchstens dreißig Schritte zum Vorschein kommt; denn es handelt sich auch darum, daß der Vogel im Feuer zusammenbricht. Ein angeschossenes Huhn geht fast regelmäßig verloren, sei es, indem es sich unter eine Baumwurzel verkriecht oder in Moos vergräbt, oder sei es, indem es fliegend einen dichtästigen Baum erreicht, in dessen Krone es sich bis zum Verenden verbirgt. Erscheint das Wild nicht nach dem ersten Locken, so muß der Jäger wenigstens fünf Minuten lang ruhig sitzen, bevor er wieder ruft, weil er in den meisten Fällen annehmen darf, daß sein Wild die Lockung doch vernommen und dann von selbst kommt, um nachzusehen. Fliegt der Hahn auf den Lockruf herbei, so muß in demselben Augenblick, in dem er sich auf den Baumast wirft, geschossen werden; denn sobald der Vogel den Menschen wahrnimmt, geht er auf und davon. Ein alter Hahn, der früher durch Verscheuchung, Fehlschüsse oder unrichtiges Locken betrogen und mißtrauisch gemacht wurde, kommt weder gehend noch fliegend unmittelbar auf die Locke, sondern läuft oder fliegt in solcher Entfernung rundum, daß man selten zum Schuß kommt. Lockt ein Haselhahn entgegen, so will er damit sagen, daß er nicht Lust oder Mut hat, sofort zu erscheinen. Dann heißt es für den Jäger geduldig warten; doch tut er wohl, wenn er ein- oder zweimal lockt, um jenem seinen Standpunkt möglichst richtig anzudeuten. Der Haselhahn antwortet darauf gewöhnlich noch einigemal und verstummt wieder. Aber nach fünf bis zehn Minuten geschieht eine Überraschung. Man hört plötzlich Aufbrausen; der Hahn kommt in einem Zuge heran und wirft sich vor die Füße des Jägers, oft mit solcher Heftigkeit, daß vorhandenes, trockenes Laub förmlich ausstiebt. In der festen Überzeugung, auf diesem Punkte seine Kameraden zu finden, bemerkt er zwar etwas, das nicht aussieht wie Holz, erkennt aber doch nicht sofort den Menschen und schickt sich dann langsam zum Abmarsch an. Diesen Augenblick der Verblüfftheit muß der Jäger zum Schuß benutzen. Gerät der Schütze zwischen viele Haselhühner, die getrennt, einzeln oder paarweise in hörbarer Weite voneinander sich befinden und rundum gleichzeitig antworten und locken, so kommt ans seinen Anruf nur zufällig ein Haselhuhn herbei. Der geübte Jäger weiß aber in solchen Fällen Rat, indem er als Henne lockt; dann wird es ruhig, und er kann nunmehr seine Jagd beginnen. Oft geschieht es, daß er von einem und demselben Standpunkt aus mehrere Hähne erlegt; denn der Knall des Gewehrs stört diese nicht, solange der Jäger seinen Stand nicht verläßt oder sich überhaupt nicht bewegt. Dies darf erst geschehen, wenn sich der Schütze einem zweiten Stande zuwendet. So beschreibt Leyen sachgemäß und richtig diese anziehende Jagd.
*
Eine der merkwürdigsten und anziehendsten Gruppen der Familie ist die der Schneehühner ( Lagopus), ebensowohl wegen des auffallenden und noch keineswegs genügend erforschten Federwechsels als auch wegen der Lebensweise ihrer Mitglieder.
Der Abend eines der letzten Maitage war schon ziemlich vorgerückt, als wir, mein junger Begleiter und ich, die an der Landstraße von Oslo nach Drontheim gelegene Haltestelle Fogstuen auf dem Dovrefjeld erreichten. Wir hatten eine lange Reise zurückgelegt und waren müde; aber alle Beschwerden des Weges wurden vergessen, als sich uns der bereits erwähnte norwegische Jäger Erik Swenson mit der Frage vorstellte, ob wir wohl geneigt seien, auf »Ryper« zu jagen, die gerade jetzt in vollster Balz stünden. Wir wußten, welches Wild wir unter dem norwegischen Namen zu verstehen hatten, weil wir uns bereits tagelang bemüht hatten, dasselbe ausfindig zu machen. Das Jagdgerät wurde rasch instand gebracht, ein Imbiß genommen und das Lager aufgesucht, um für die morgende Frühjagd die nötigen Kräfte zu gewinnen. Zu unserer nicht geringen Überraschung kam es aber für diesmal nicht zum Schlafen; denn unser Jäger stellte sich bereits um die zehnte Stunde ein und forderte uns auf, ihm jetzt zu folgen. Kopfschüttelnd gehorchten wir, und wenige Minuten später lag das einsame Gehöft bereits hinter uns.
Die Nacht war wundervoll. Es herrschte jenes zweifelhafte Dämmerlicht, das unter so hohen Breiten um diese Zeit den einen Tag von dem andern scheidet. Wir konnten alle Gegenstände auf eine gewisse Entfernung hin unterscheiden. Wohlbekannte Vögel, die bei uns um diese Zeit schon längst zur Ruhe gegangen sind, ließen sich noch vernehmen; der Kuckuckruf schallte aus dem nahen Birkengestrüpp uns entgegen; das »Schak, schak« der Wacholderdrossel wurde laut, so oft wir eins jener Dickichte betraten; von der Ebene her tönten die hellen, klangvollen Stimmen der Strandläufer und die schwermütigen Rufe der Goldregenpfeifer; der Steinschmätzer schnarrte dazu, und das Blaukehlchen gab sein köstliches Lied zum besten.
Unser Jagdgebiet war eine breite, von aufsteigenden Bergen begrenzte Hochebene, wie sie die meisten Gebirge Norwegens zeigen, ein Teil der Tundra. Hunderte und Tausende von Bächen und Rinnsalen zerrissen den fahlen, gelblichen Teppich, den die Flechte auf das Geröll gelegt hatte, hier und da zu einer größeren Lache sich ausbreitend, auch wohl zu einem kleinen See sich vereinigend. Das Gestrüpp der Zwergbirke säumte die Ufer und trat an einzelnen Stellen zu einem Dickicht zusammen. Aus der Hochebene selbst war der Frühling bereits eingezogen; an den sie einschließenden Berglehnen hielten hartkrustige Schneefelder den Winter noch fest.
Diesen Berglehnen und Schneefeldern wandten wir uns zu, schweigsam, erwartungsvoll und aus die verschiedenen Stimmen, die um uns her laut wurden, mit Aufmerksamkeit und Wohlgefallen hörend. Etwa vierhundert Schritte mochten wir in dieser Weise zurückgelegt haben, da blieb unser Führer stehen und lauschte und äugte wie ein Luchs in die Dämmerung hinaus. Daß seine Aufmerksamkeit nicht den erwähnten Vögeln galt, wußten wir; von dem Vorhandensein anderer Tiere aber konnten wir nicht das geringste wahrnehmen. Erik Swenson jedoch mußte seiner Sache wohl sicher sein: denn er begann, nachdem er uns Schweigen geboten, mit dem erwarteten Wilde zu reden, indem er mit eigentümlicher Betonung einige Male hintereinander die Silben »Djiake, djiake, dji-ak, dji-ak« ausrief. Unmittelbar nach seinem Lockruf hörten wir in der Ferne das Geräusch eines aufstehenden Huhnes, und in demselben Augenblick vernahmen wir auch einen schallenden Ruf, der ungefähr wie »Err-reck-eck-eck-eck« klang. Dann ward wieder alles still. Aber der Alte begann von neuem zu locken, schmachtender, schmelzender, hingebender, verführerischer, und ich merkte jetzt, daß er die Liebeslaute des Weibchens jenes Hühnervogels nachahmte. Auf das »Djiak«, das den liebesglühenden Hahn aufgerührt hatte, folgte jetzt ein zartes, verlangendes und Gewährung verheißendes »Gu, gu, gu, gurr«; der erregte Hahn antwortete in demselben Augenblick, das Flügelgeräusch wurde stärker, wir fielen hinter den Büschen nieder, und unmittelbar vor uns, auf blendender Schneefläche, stand ein Hahn in voller Balz. Es war ein Anblick zum Entzücken! Aber das Jägerfeuer war mächtiger als der Wunsch des Forschers, solch Schauspiel zu genießen. Ehe ich wußte, wie, war das erprobte Gewehr an der Wange, und bevor der Hahn einen Laut von sich gegeben, wälzte er sich in seinem Blute.
Der Knall des Schusses erweckte den Widerhall, aber auch die Stimmen aller gefiederten Bewohner unseres Gebietes. Von den Bergen hernieder und von der Talsohle herauf ließen sich Stimmen vernehmen; wenige Schritte vor uns rauschte eine Entenschar vom Wasser aus; ein aufgescheuchter Kuckuck flog durch das Dämmerungsdunkel an uns vorüber; Regenpfeifer und Strandläufer trillerten und flöteten. Allmählich wurde es wieder ruhig, und wir setzten unsern Weg fort, den aufgenommenen Hahn mit Waidmannslust betrachtend. Schon wenige hundert Schritte weiter lieh der Alte wieder seine verführerischen Laute hören, und diesmal antworteten anstatt eines Hahnes deren zwei. Ganz wie vorhin wurde der hitzigste von ihnen herbeigezaubert; jetzt aber gönnte ich mir die Freude der Beobachtung.
Am entgegengesetzten Ende des Schneefeldes fiel der stolze Vogel ein, betrat leichten Ganges die Bühne und lief gerade auf uns zu. Es war noch hell genug, daß wir ihn schon in der Ferne deutlich wahrnehmen konnten. Aber der liebesrasende Gesell dachte nicht an Gefahr und kam näher und näher, bis auf einige Schritte an uns heran. Das Spiel halb erhoben, die Fittiche gesenkt, den Kopf niedergebeugt, so lief er vorwärts. Da mit einem Male schien er sich zu verwundern, daß die Lockungen geendet hatten, und nun begann er seinerseits sehnsüchtig zu rufen. Mehrmals warf er den Kopf in sonderbarer Weise nach hinten, und tief aus dem Innersten der Brust heraus klangen, dumpfen Kehllauten vergleichbar, abgesetzte Rufe, die man durch die Silben »Gabâu, gabâu« einigermaßen deutlich ausdrücken kann; dieselben Laute, die die Norweger durch die Worte » Hvor er hun« – wo ist sie? – übersetzen. Und der Alte war wirklich so kühn, mit seiner Menschenstimme zu antworten, den Hahn glauben zu machen, daß das Weiblein, die ersehnte Braut, sich bloß im Gebüsch versteckt habe. Leiser und schmachtender als je rief er wiederholt in der vorhin angegebenen Weise, und eilfertig rannte der Hahn mit tiefgesenktem Kopf und Flügeln herbei, dicht an uns heran und buchstäblich über unsere Beine weg; denn wir lagen natürlich der Länge nach auf dem Schnee. Doch jetzt mochte er seinen Irrtum wohl eingesehen haben; er stand plötzlich auf, stiebte davon und rief allen Mitbewerbern ein warnendes, leises Knurren zu. Und nunmehr mochte der alte Jäger locken, wie er wollte, das Liebesfeuer der zahlreich versammelten Hähne schien gedämpft zu sein, ihre Brunst wurde durch ein wohlberechtigtes Bedenken überwogen.
Doch wir zogen weiter und verhielten uns auf eine Strecke von mehreren Minuten ganz ruhig, bis unser Führer glaubte, daß wir in das Gebiet noch ungestörter Hähne eingetreten wären. Dort wurde die Jagd fortgesetzt, und ich erlegte nach den ersten Lockungen einen zweiten und wenige Minuten später den dritten Hahn. Jetzt aber schienen die Vögel gewitzigt worden zu sein; es war vorüber mit der Jagd, nicht jedoch auch vorüber mit der Beobachtung. Denn zu meiner Freude bemerkte ich, daß fortan die Weibchen, die sich bisher ganz unsichtbar gemacht hatten, das Amt des Warners übernahmen, um ihre Liebhaber von dem Verderben abzuhalten. Wir wandten uns daher dem Gehöft zu, störten unterwegs noch viele, viele Paare der anziehenden Vögel auf und kamen mit Anbruch des Tages in unserer zeitweiligen Wohnung wieder an.

Moorschneehuhn ( Lagopus albus)
So lernte ich einen der häufigsten und anziehendsten Vögel des hohen Nordens, das Moorhuhn, kennen. Später bin ich noch manche Nacht hinausgezogen, um Schneehühner zu erlegen, und oben in Lappland und Sibirien habe ich sie auch unter anderen Verhältnissen ihres Lebens beobachtet, nicht bloß in jenen stillen Stunden, in denen die
»Mitternachtssonne auf den Bergen lag.
Blutrot anzuschauen«,
sondern auch um die Mittagszeit, wenn sie ihrer Nahrung nachgehen oder wenn die mütterliche Henne die Schar ihrer reizenden Küchlein führt. Und immer und unter allen Umständen hat mich dieser Vogel zu fesseln gewußt.
Das Moorhuhn ( Lagopus albus) steht in der Größe zwischen Birk- und Rebhuhn ungefähr mitten inne; die Länge des Hahnes beträgt vierzig, die Breite vierundsechzig, die Fittichlänge neunzehn, die Schwanzlänge elf Zentimeter; das Weibchen ist um zwei Zentimeter kürzer und fast ebensoviel schmaler. Im Winter trägt das Moorhuhn ein zwar einfaches, aber dennoch schönes Kleid. Sein ganzes Gefieder ist bis auf die äußeren Schwanzfedern blendend weiß; die Schwanzfedern hingegen sind tiefschwarz, weiß gekantet und weiß an der Wurzel; die sechs großen Schwungfedern zeigen auf der Außenfahne einen langen, braunschwarzen Streifen. Im Hochzeitskleide sind Oberkopf und Hinterhals rostfarbig, fuchsrot oder rostbraun, schwarz gefleckt und gewellt, die Schulter-, Rücken-, Bürzel- und die mittleren Schwanzfedern schwarz, zur Hälfte rostbraun oder dunkelrostgelb in die Quere gebändert und alle Federn weiß gesäumt, die Schwanzfedern verblichen und ihre Endkanten abgeschliffen, die Handschwingen weiß wie im Winter, die Armschwingen braun wie der Rücken, Gesicht, Kehle und Gurgel rostrot, gewöhnlich ungefleckt, Kopf, Oberbrust und Weichen rostfarben oder rostbraun, sein schwarz gespitzt und gewellt, die Federn der Mittelbrust schwarz, rostfarbig und weiß gefleckt, die des Bauches und der Beine weiß, die Unterschwanzdeckfedern schwarz mit rostgelben und braunen Bändern und Zickzacklinien gezeichnet; unter dem Auge und an dem Mundwinkel stehen weiße Flecke. Die Grundfärbung kann lichter oder heller sein; es kann vorkommen, daß die Federn auf lichtbraunem Grunde schwarz gezeichnet sind usw. Im Laufe des Sommers bleichen die Federn aus. Das Weibchen ist stets lichter, erhält auch sein Sommerkleid immer früher als das Männchen. Gleichzeitig mit der Anlegung der dunklen Befiederung hebt und rötet sich der Brauenkamm, und während der Paarungszeit trägt er zum Schmuck des Vogels nicht unwesentlich bei.
Gewichtige Gründe, vor allem die dem Moorhuhn vollkommen gleichartigen Sitten und Gewohnheiten, sprechen dafür, daß das Schottenhuhn oder »Grouse« der Engländer ( Lagopus scoticus), das die Moore Großbritanniens, insbesondere Schottlands, bevölkert, als Abart des Moorhuhnes, nicht aber als selbständige Art angesehen werden darf. Es ist ebenso groß wie letzteres und unterscheidet sich einzig und allein dadurch von ihm, daß es im Winter nicht weiß wird und daß seine Schwingen braun, die Beine aber grau sind. Somit ähnelt es dem Moorhuhn im Sommerkleide bis auf die erwähnten Unterschiede in jeder Beziehung, und die Annahme, daß es nur ein Erzeugnis des milden britischen Klimas sei, läßt sich mit stichhaltigen Gründen kaum widerlegen.
Das Moorhuhn verbreitet sich über den Norden der Alten und Neuen Welt, kommt jedoch nicht überall in gleicher Menge vor. Innerhalb der Grenzen unseres Vaterlandes bewohnt es gegenwärtig nur noch den nordöstlichsten Winkel. In den Mooren Preußisch-Litauens zieht es diejenigen Stellen vor, an denen Wald und offenes Moor abwechseln. Die Ränder des Waldes, niemals aber dessen Inneres, bilden hier seine beliebtesten Aufenthaltsorte, vorausgesetzt, daß der Grund naß, mindestens sehr feucht ist. Auf den Hochebenen Skandinaviens und in der Tundra ist es stellenweise unglaublich häufig, häufiger gewiß als jedes andere Huhn. Ein Paar wohnt dicht neben dem anderen, und das Gebiet des einzelnen Paares ist so wenig ausgedehnt, daß man es schon mit fünfhundert Schritten und weniger durchschreitet. Während der Frühlingszeit verteidigt der Hahn seine Grenze eifersüchtig gegen jeden Eindringling.
Das Moorhuhn gehört zu den regsamsten und lebendigsten Hühnern, die ich kenne, ist gewandt, deshalb auch selten ruhig, und versteht es, sich unter den verschiedensten Verhältnissen geschickt zu bewegen. Die breiten, dicht befiederten Füße gestatten ihm, ebenso rasch über die trügerische Moosdecke als über den frischen Schnee wegzulaufen, befähigen es wahrscheinlich auch zum Schwimmen. Sein Gang ist verschieden. Gewöhnlich läuft es schrittweise in geduckter Stellung, mit etwas gekrümmtem Rücken und hängendem Schwänze dahin, jeder Vertiefung des Bodens folgend und nur, wenn etwas Besonderes seine Aufmerksamkeit reizt, einen der kleinen Hügel erklimmend, um von hier aus zu sichern; wenn es sich aber verfolgt sieht, rennt es mit kaum glaublicher Eile seines Weges fort. Beim Sichern streckt es sich so lang aus als es kann, hebt den Kopf hoch auf und erscheint nun auffallend schlank. Der Flug ist leicht und schön, dem unseres Birkwildes ähnlicher als dem des Rebhuhnes, jedoch von beiden verschieden. Vom Boden sich erhebend, steigt das Huhn, insbesondere das Männchen, zunächst bis zu einer Höhe von ungefähr vier Meter über dem Boden auf, streicht hierauf, abwechselnd die Flügel schwirrend schlagend und wieder gleitend, drei-, vier-, fünf-, auch sechshundert Schritte weit in derselben Höhe über dem Boden fort, klettert plötzlich jäh empor und senkt sich nun rasch hernieder, um einzufallen, oder aber setzt, genau in derselben Weise wie früher fliegend, den Weg noch weiter fort, steigt noch einmal auf, schreit und fällt ein. Bei kurzen Flügen läßt das Männchen während des Aufstehens regelmäßig sein lautschallendes »Err-reck-eck-eck-eck«, unmittelbar nach dem Einfallen die dumpfen Kehllaute »Gabâu, gabâu« vernehmen; das Weibchen hingegen fliegt immer stumm. Im Schnee gräbt es sich nicht bloß tiefe Gänge aus, um zu seiner im Winter verdeckten Nahrung zu gelangen, sondern stürzt sich auch, wenn es von einem Raubvogel verfolgt wird, senkrecht aus der Luft herab und taucht dann förmlich in die leichte Decke ein. Bei strengem Wetter sucht es hier Zuflucht, um sich gegen die rauhen Winde zu schützen; zuweilen soll man den Flug dicht aneinandergeschart antreffen, und zwar so, daß die ganze Gesellschaft unter dem Schnee vergraben ist und nur die einzelnen Köpfe herausschauen. Die scharfen Sinne erleichtern ihm, nahende Gefahr rechtzeitig zu erkennen, und es versteht meisterhaft, sich dann bestmöglichst zu schützen. Gleichwohl ist es in der Regel nicht scheu, meist sogar auffallend dreist und mutig; zumal einzelne unbeweibte Männchen zeigen sich oft überaus sorglos und lausen längere Zeit ungedeckt vor dem Wanderer oder Jäger einher, gleichsam als müßten sie sich die ausfallende Erscheinung des Menschen erst recht betrachten. Hierbei nimm: es gewöhnlich die gebückte Haltung an, duckt sich auch auf allen spärlich mit Zwergbirken bestandenen Stellen der Tundra noch mehr als gewöhnlich, um sich unsichtbar zu machen, kann jedoch nicht unterlassen, von Zeit zu Zeit wenigstens den Hals hoch aufzurichten, um zu sichern.
Die Nahrung besteht hauptsächlich aus Pflanzenstoffen, im Winter fast nur aus den Blätterknospen der erwähnten Gesträuche und verdorrten Beeren, im Sommer aus zarten Blättern. Blüten, Sprößlingen, Beeren und verschiedenen Kerbtieren, die gelegentlich mit erbeutet werden. In den preußisch-litauischen Mooren äst es, zumal im Winter, oft fast ausschließlich, von einer dort häufig vorkommenden schwarzen Beere, die im Volksmunde »Ratenbeere« genannt wird, wahrscheinlich der Rauschbeere, und gräbt sich ihr zuliebe tiefe und lange Gänge im Schnee. Körner aller Art werden, wie die gefangenen beweisen, gern gefressen. Nach eigenen Beobachtungen äsen die Moorhühner im Sommer und, wie wir durch Barth erfahren, auch im Winter nur in der Nacht, im Sommer etwa von zehn Uhr abends bis zwei Uhr morgens, im Winter schon merklich früher. Um diese Zeit begeben sie sich in der Dämmerung bergabwärts und bei Tagesanbruch an ihre Lagerplätze zurück. Von der Mitte des März bis zur Mitte des April sieht man sie in Norwegen wohl auch am Vor- und Nachmittag in den Kronen der Birken stehen, deren Knospen ihnen um diese Zeit so gut wie ausschließlich zur Nahrung dienen, und es gewährt dann einen wundervollen Anblick, wenn Hunderte dieser weißen Vögel von dem dunkeln Gezweige abstechen.
Mitte März gesellen sich die Paare und beginnen bald darauf zu balzen. Noch während der Balz legt das Weibchen seine Eier. An sonnigen Abhängen der Hochebene, zwischen dem bereits schneefreien Gestrüpp der Heide, zwischen Heidel-, Mehl- und Moosbeeren, im Gebüsch der Saalweide oder Zwergbirke, in Wacholderbüschen und an ähnlichen versteckten Plätzen hat es sich eine flache Vertiefung gescharrt und mit einigen dürren Grashalmen und anderen wenigen trockenen Pflanzenteilen, auch mit eigenen Federn und mit Erde ausgelegt, den Standort des Nestes aber unter allen Umständen so wohl gewählt, daß man es schwer findet. Der Hahn zeigt jetzt seinen vollen Mut; denn er begrüßt jeden Menschen, jedes Raubtier, das sich naht, durch das warnende »Gabâu, gabâu«, stellt sich dreist auf einen der kleinen Hügel, fliegt aufgescheucht nur wenige Schritte weit und wiederholt das alte Spiel, unzweifelhaft in der Absicht, den Feind vom Nest abzubringen. Gegen andere Hähne verteidigt er sein Gebiet hartnäckig. Die Henne bleibt bei Gefahr möglichst lange ruhig sitzen, scheint sich anfangs gar nicht um das ihr drohende Unheil zu bekümmern und schleicht erst weg, wenn man unmittelbar neben ihrem Nest steht, dann freilich unter Aufbietung aller in der Familie üblichen Verstellungskünste. Gegen andere Hennen soll auch sie sich sehr streitsüchtig zeigen, und zudem behaupten die Norweger, daß eine Henne der anderen, falls dies möglich, die Eier raube und nach ihrem Nest bringe. Auch während der Brutzeit noch sind Moorschneehühner um Mitternacht am lebhaftesten; man vernimmt ihr Geschrei selten vor der zehnten Abendstunde.
Das Gelege ist Ausgang Mai, sicher Anfang Juni vollzählig und besteht aus neun bis zwölf, zuweilen auch aus fünfzehn, sechzehn, selbst zwanzig birnförmigen, glatten, glänzenden Eiern von durchschnittlich zweiundvierzig Millimeter Länge und dreißig Millimeter größter Dicke, die auf ockergelbem Grunde mit zahllosen leberbraunen oder rotbraunen Fleckchen, Pünktchen und Tüpfelchen bedeckt sind. Die Henne widmet sich dem Brutgeschäft mit größter Hingebung; der Hahn scheint an ihm keinen Teil zu nehmen, sondern nur als Wächter zu dienen. Geht alles gut, so schlüpfen schon Ende Juni oder Anfang Juli die niedlichen Küchlein aus den Eiern, und nunmehr steht man die ganze Familie vereinigt im Moor, auch da, wo dasselbe sehr wasserreich ist. Jetzt verdienen unsere Tiere den Namen Moorhühner in jeder Hinsicht; sie sind wahre Sumpfvögel geworden und scheinen sich auch auf dem flüssigsten Schlamm mit Leichtigkeit bewegen zu können. Wahrscheinlich suchen sie gerade diese Stellen zuerst auf, um ihren Kleinen eine dem zarten Alter am besten entsprechende Nahrung bieten zu können, Stechmücken und ihre Larven nämlich, von denen die Moore während des Sommers wimmeln. Mit Hilfe eines guten Fernrohres, in der Tundra auch mit bloßem Auge, hält es nicht schwer, eine solche Familie zu beobachten. Der Hahn, der an der Erziehung der Kinder den wärmsten Anteil nimmt, geht mit stolzen Schritten, hochgehobenen Hauptes immer voraus, beständig sichernd und bei Gefahr durch sein »Gabâu« warnend, führt die ganze Familie zu nahrungversprechenden Plätzen und zeigt sich überhaupt äußerst besorgt. Die niedlichen Küchlein tragen in den ersten Tagen ihres Lebens ein Daunenkleid, das einem Bündel der Renntierflechte zum Verwechseln ähnlich sieht. Sie sind rasch und behend wie alle wilden Küchlein, laufen leicht und gewandt über Schlamm und Wasserrinnen hinweg und lernen schon nach den ersten Tagen ihres Lebens die kleinen, stumpfen Schwingen gebrauchen. So ist es erklärlich, daß sie den meisten Gefahren, die ihnen drohen, entgehen. Die Gleichfarbigkeit ihres Kleides mit dem Boden täuscht selbst das scharfe Falkenauge, und die Örtlichkeit, auf der sie sich umhertummeln, sichert sie vor Reinekes oder seines Verwandten, des Eisfuchses, unfehlbarer Nase. Lustig wachsen sie heran, wechseln die anfänglich braun und schwarz gewässerten Schwingen bald mit Weißen, erneuern auch diese noch ein oder mehrere Male und haben Ende August oder Anfang September bereits so ziemlich die Größe ihrer Eltern erreicht. Stößt man in der selten von Menschen besuchten Tundra auf ein Moorhuhngesperre, so erhebt sich zunächst der Hahn in der geschilderten Weise, und gleichzeitig mit ihm, wenn nicht schon früher, stehen die Jungen auf, gewöhnlich alle mit einem Male, seltener nur einzelne, ihrer zwei, drei und vier nacheinander. Die ganze Kette stiebt, genau wie ein Volk Rebhühner, zuerst auseinander, um dann gemeinschaftlich einem bestimmten Ziele, mindestens einer bestimmten Richtung zuzustreben. Nachdem die Jungen ungefähr einhundert bis zweihundert Schritte, selten mehr, durchflogen haben, fallen sie einzeln ein und liegen nunmehr so fest, daß es schwer hält, sie noch einmal aufzutreiben, wissen auch selbst auf nur mit Renntierflechten bewachsenem Boden sich so vortrefflich zu verstecken, daß man sie entweder nicht oder doch nur nach längerem Suchen wahrnimmt. Das Weibchen folgt immer zuletzt, vorausgesetzt, daß es durch den nahenden Menschen nicht allzusehr erschreckt wurde. Unmittelbar nach dem Aufstehen sucht es womöglich durch die bekannten Künste abzulenken, humpelt und taumelt vor dem Feinde einher und gibt sich rücksichtslos preis; dann erst erhebt es sich und fliegt den Jungen nach, gewöhnlich weit über sie wegstreichend und zum Einfallen oft einen ganz andern Ort als das Männchen wählend.
Um Mitte oder gegen Ende August sind die Jungen ausgewachsen. Von nun an verweilen sie, laut Barth, noch etwa einen Monat an dem Brutort; dann aber, gegen Ende September oder Anfang Oktober, vereinigen sie sich mit andern Ketten, bilden die weiter oben erwähnten Schwärme und werden nunmehr so scheu, daß es nur selten gelingt, einen sicheren Schuß auf sie abzugeben.
Das Moorhuhn bildet eines der geschätztesten Jagdtiere. Seine erstaunliche Häufigkeit gewährt dem nur einigermaßen geschickten Jäger ergiebige Ausbeute, und deshalb sind viele Normannen diesem Weidwerk mit Leidenschaft ergeben. In welcher Anzahl zuweilen Schneehühner gefangen werden, mag man daraus ermessen, daß ein einziger Wildhändler im Laufe eines Winters aus Dovrefjeld allein vierzigtausend Stück sammeln und versenden konnte. Gegenwärtig erstreckt sich der Handel mit diesem Wilde nicht bloß auf Stockholm oder Kopenhagen, sondern in jedem einigermaßen strengen Winter auch bis nach Deutschland und Großbritannien. Das Wildbret junger Moorhühner steht dem unseres jungen Rebhuhnes vollkommen gleich und zeichnet sich noch außerdem durch einen prickelnden Beigeschmack aus; das Fleisch alter Vögel hingegen bedarf erst längerer Beize, bevor es genießbar wird.
Das Schneehuhn, Alpen-, Felsen- oder Bergschneehuhn ( Lagopus mutus) tritt, je nach der Lage und Beschaffenheit seines Wohngebiets, in mehr oder weniger abweichenden, ständigen Ab- und Unterarten auf und wird daher von einzelnen Forschern in mehrere Arten getrennt, von anderen wiederum als gleichartig betrachtet. Schon in einem und demselben Gebiet ändert es, zumal im Sommerkleide, vielfach ab. Auf den Schweizer Alpen ist es, laut Schinz, nach der Jahreszeit so verschieden, daß man sagen kann, im Sommer sei seine Färbung in jedem Monat verändert. Zu allen Jahreszeiten sind beim Männchen der Bauch, die unteren Deckfedern des Schwanzes, die vorderen Deckfedern der Flügel, die Schwungfedern und die Läufe weiß; die Schwungfedern haben schwärzliche Schäfte, und der Schwanz ist schwarz. Im Sommer aber sehen die übrigen Teile sehr verschieden aus. Die Frühlingsmauser, die Mitte April beginnt, bringt hin und wieder schwärzliche Federn zum Vorschein, und der Vogel ist weißlich und bunt gescheckt; Anfang Mai sind Kopf, Hals, Rücken, die oberen Deckfedern der Flügel und die Brust schwarz, rostfarben und weißbunt, die Federn nämlich entweder ganz schwarz mit ganz undeutlichen rostfarbenen Querstreifen, oder schwarz, hellrostgelb und weißlich gebändert; an Kehle und den Seiten des Halses tritt das Weiße am meisten hervor. Die Federn selbst stehen bunt untereinander, nicht selten mit einigen ganz weißen gemischt; alle aber bleichen nach und nach so ab, daß Ende August oder September besonders der Rücken schön hell aschgrau und schwärzlich punktiert erscheint, die rostfarbenen Bänder an Hals und Kopf fast ganz weiß geworden sind, meist aber noch einige ganz unregelmäßige, rostgelb und schwarz gebänderte unter den andern sich finden. Beim Weibchen sind alle diese Teile schwarz und rostgelb gewellt, die Bänder viel breiter und deutlicher. Im Winter werden, mit Ausnahme der schwarzen, jetzt licht gesäumten Steuerfedern, beim Männchen auch derjenigen, die den Zügel bilden, alle Federn blendend weiß; doch kommt es vor, daß einzelne bunte Federn stehen bleiben. Während der Herbstmauser, die im Oktober beginnt, sehen die Schneehühner ganz bunt aus; schon im November aber sind sie schneeweiß geworden. Die mittleren Oberdeckfedern des Schwanzes verlängern sich so, daß sie bis zum Ende des Schwanzes reichen, und es scheint, als ob die Mitte des Schwanzes weiß sei. Über den Augen steht eine rote, warzige, am oberen Rande ausgezackte Haut, die aber beim Männchen viel stärker ist. Das Auge ist dunkelbraun, der Schnabel schwarz. Die Länge beträgt fünfunddreißig, die Breite sechzig, die Fittichlänge achtzehn, die Schwanzlänge zehn Zentimeter.
Von dieser Form weichen die nordischen Schneehühner mehr oder weniger erheblich ab, und zwar ebenso hinsichtlich ihrer Größe wie der Färbung ihres Sommerkleides; da dieses aber immer dem Felsgestein, auf dem sie leben, entspricht, die Größe auch bei andern Rauchfußhühnern abändert, die Lebensweise aller Schneehühner dagegen dieselbe zu sein scheint, läßt sich die Artverschiedenheit aller Formen nicht erweisen.
Das Schneehuhn bewohnt die Alpenkette in ihrer ganzen Ausdehnung, die Pyrenäen, die schottischen Hochgebirge, alle höheren Berggipfel Skandinaviens, Island, die Gebirge Nordsibiriens oder Nordasiens überhaupt, den Norden des festländischen Amerika und Grönland. Von den Alpen verfliegt es sich bis auf den Schwarzwald, von den Pyrenäen aus nach den Bergketten Asturiens und Galiziens und von dem Festlande Asiens aus vermutlich bis nach Nordjapan, falls ein von den dortigen Eingeborenen herrührendes Gemälde wirklich nach einem im Lande erbeuteten Alpenschneehuhn gefertigt wurde. Nach Norden hin hat man es überall gefunden, wo man das Festland oder eine größere Insel betrat. Im Gegensatz zum Moorhuhn lebt es nur auf kahlen, nicht mit Gebüschen bekleideten Stellen, deshalb auf den Alpen immer über dem Gürtel des Holzwuchses, nahe an Schnee und Eis, in Norwegen auf den nackten, mit Geröll bedeckten Berggipfeln und nur in Island und Grönland während der Brutzeit in tieferen Gegenden, in den Niederungen selbst in unmittelbarer Nähe des Meeres. Aber das isländische und das grönländische Schneehuhn das jenen entsprechend lebt, bringt wenigstens noch einen großen Teil des Jahres auf den Bergen zu. Aus Raddes Bericht geht hervor, daß es in Ostsibirien ebenfalls nur im Hochgebirge, und zwar über der Grenze der Alpenrosen, zwei- bis dreitausend Meter über dem Meere, sich ansiedelt.
Das Alpenschneehuhn unterscheidet sich in seiner Lebensweise auffallend von seinen Verwandten. Sein Wesen ist ruhiger. Im Laufen und im Fliegen kommt es mit letzteren so ziemlich überein, ja diese Bewegungen sind vielleicht noch leichter als beim Moorhuhn. Aber nur selten, da, wo es noch nicht verfolgt wurde, niemals, fliegt es weit in einem Zuge. In einer Fertigkeit scheint unser Huhn seine Verwandten entschieden zu übertreffen. »Ich habe mehrmals bemerkt«, sagt Holboell, »daß das Schneehuhn nicht allein im Notfall schwimmen kann, sondern dies zuweilen selbst ohne solchen Grund tut. Im September 1825 lag ich mit einer Galeasse auf der sogenannten Südostbucht bei Grönland; wir hatten einige Tage Nebel, und mehrere Schneehühner kamen auf das Schiff. Eines von ihnen flog so gegen das Segel, daß es ins Wasser fiel. Ich ließ, da es fast stilles Wetter war, ein Boot aussetzen, in der Meinung, es werde mir zur Beute werden; aber es erhob sich mit größter Leichtigkeit vom Wasser und flog davon. Im nächsten Winter sah ich bei zehn Grad Kälte zwei Schneehühner von den Udkigsfelsen bei Godhavn herabfliegen und sich ohne Bedenken auf das Wasser setzen. Gleichfalls habe ich Schneehühner in einem kleinen Gebirgswasser sich baden und auf selbigem herumschwimmen sehen.« Die Stimme ist von der des Moorhuhns auffallend verschieden und höchst eigentümlich. Sie ist ein merkwürdig dumpfes, röchelndes, tief aus der Kehle kommendes »Aah«, mit dem sich übrigens noch ein Schnarren verbindet, das sich mit Buchstaben wohl kaum ausdrücken läßt. Faber, Holboell und Krüper übersetzen diesen Laut durch »Arrr« oder »Orrr«; ich meine aber, daß man den R-Laut nicht so deutlich vernimmt, wie dadurch angedeutet werden soll. Den Lockruf des Weibchens ahmte mein norwegischer Jäger durch einen Laut nach, der an das Miauen junger Katzen erinnert und ungefähr »Miu« klingt. »Bei Nebelwetter«, bemerkt Schinz, »laufen sie am meisten auf dem Boden umher und glauben sich vor allen Nachstellungen am sichersten; aber auch bei warmem Sonnenschein sind sie sehr zahm« und lassen dann, wie Tschudi hinzufügt, »auf offenen Gipfeln den Menschen oft bis auf zehn Schritt nahekommen«. Bei kaltem Wetter sollen sie scheuer sein, wahrscheinlich schon deshalb mit, weil sie sich im Winter zu größeren Scharen vereinigen.
Die Nahrung besteht vorzugsweise in Pflanzenstoffen. Auf den Alpen findet man ihren Kropf mit Blättern der Alpenweide und des Heidekrautes, mit Knospen der Tannen, der Alpenrosen, mit Preißel-, Heidel- und Brombeeren, verschiedenen Blumen und dergleichen angefüllt; auf den Landstraßen sieht man sie beschäftigt, Haferkörner aus dem Mist der Pferde und Maultiere aufzusuchen, und im Sommer stellen sie allerhand Kerbtieren nach. Im Norden bilden die Knospen und Blätter der Zwergweiden und Birkenarten, die Blätter- und Blütenknospen der verschiedensten Alpenpflanzen wie der auf jenen Höhen noch wachsenden Beerengesträuche und die Beeren selbst, im Notfall auch Flechtenteile, die sie von den Steinen abklauben, ihre Äsung. Falls Faber richtig beobachtet hat, tragen sie sich Nahrungsvorräte für den Winter ein.
Im Mai sieht man Schneehühner gepaart, und beide Gatten halten sich, solange die Bebrütung der Eier währt, zusammen. Wenn aber die Jungen ausgeschlüpft sind, entfernt sich der Hahn zeitweilig von der Familie und zieht den höheren Gebirgen zu, um hier die wärmste Zeit des Sommers zu verbringen. Während er früher still und traurig war, wird er lebhaft, läßt oft seine Stimme vernehmen, erhält vom Weibchen Antwort, fliegt sehr geschwind, mit kaum bewegten Flügeln zum Vergnügen in die Luft, indem er schräg emporsteigt, einen Augenblick mit zitternden Schwingen still steht und sich dann plötzlich wieder niederwirft, gefällt sich zuweilen auch in Stellungen, die einigermaßen an die Balztänze anderer Rauchfußhühner erinnern, ohne ihnen jedoch zu gleichen. Er nimmt weder an dem Brutgeschäft noch an der Führung der Jungen teil. Die Henne sucht sich um die Mitte oder zu Ende des Juni unter einem niedrigen Gesträuch oder auch wohl einem schützenden Stein eine passende Stelle zum Nest aus, scharrt hier eine seichte Vertiefung, kleidet sie kunstlos mit welken Blättern aus, legt ihre neun bis vierzehn, auch wohl sechzehn Eier, die etwa fünfundvierzig Millimeter lang, dreißig Millimeter dick und auf rotgelbem Grunde mit dunkelbraunen Flecken getüpfelt sind, und beginnt mit Hingebung zu brüten. Nach Verlauf von ungefähr drei Wochen entschlüpfen die Jungen. Sobald sie einigermaßen abgetrocknet sind, führt sie die Henne vom Nest weg auf nahrungversprechende Plätze. Droht Gefahr, so erhebt sie sich, um durch ihr Wegfliegen die Aufmerksamkeit des Feindes auf sich zu lenken; die Jungen zerstreuen sich auf dieses Zeichen hin augenblicklich und haben sich im Nu zwischen den Steinen verborgen, während jene dem Jäger fast unter die Füße läuft. Das Flaumkleid der Küchlein ist zwar sehr bunt, aber doch in demselben Grade wie das anderer junger Hühner mit dem Boden gleichfarbig. Über den bräunlichen Rücken verlaufen unregelmäßig schwarze Streifen, und ein hellbräunlicher Fleck auf dem Hinterkopfe wird von einem solchen eingeschlossen. Stirn, Kehle, Hals und Bauch sind weißlich, die Brust und die Seiten rötlich überflogen, die Läufe mit graulichen Daunen bekleidet.
Auf Island und Grönland, woselbst die Schneehühner oft auch in den Tälern brüten, sieht man, laut Faber und Holboell, die Familien Ende August noch in der Tiefe; Anfang Oktober aber geht die Alte mit ihren nunmehr vollständig ausgewachsenen Jungen auf die hohen Berge, und fortan vereinigen sich die einzelnen Völker oft zu sehr zahlreichen Scharen. Diese verweilen hier gewöhnlich während des ganzen Winters und führen ein ziemlich regelmäßiges Leben. Man sieht sie bereits bei Tagesanbruch mit Futtersuchen beschäftigt, aber bis nach Mittag selten fliegen. Dann erheben sie sich, streichen, zu kleinen Trupps vereinigt, zu Tale, an die Seeküste usw. und kehren wieder zu den Bergen zurück. Sind jedoch die Täler schneefrei, so verweilen sie hier längere Zeit, und ebenso flüchten sie sich zur Tiefe herab, wenn oben in der Höhe sogenannter Eisschlag fällt und sie im Aufsuchen ihrer Nahrung gehindert werden. Doch muß es schon hart kommen, wenn sie sich zu derartigen Streifereien entschließen; denn bei regelmäßigem Verlauf der Dinge wissen sie sich auf ihren Höhen vortrefflich zu bergen. Die dicke Schneedecke, die ihnen ihre Äsung überschüttet, ficht sie wenig an; sie graben sich mit Leichtigkeit tiefe Gänge im Schnee, bis sie zu der gesuchten Äsung gelangen, kümmern sich überhaupt wenig um die Unbill des Wetters. Dieselbe Schneedecke dient ihnen auch als Schutz gegen rauhe Winde und dergleichen; sie lassen sich, wenn es arg stürmt und weht, mit Behagen einschneien, so daß bloß die Köpfe hervorschauen und der geübte Jäger ihr Vorhandensein dann nur an den schwarzen Zügelstreifen bemerken kann. Wahrscheinlich errichten sie sich Winterwohnungen, tiefe Löcher im Schnee, in der Nähe ihrer Vorratshaufen. Ein solches mit Grasblättern förmlich ausgelegtes Loch fand Krüper auf einem großen Schneefelde Islands. Abgesehen von jenen unregelmäßigen Streifzügen treten die Schneehühner im Winter, namentlich im Norden Amerikas, auch weitere Wanderungen an. Auf Labrador kommen, wie Audubon erzählt wurde, allwinterlich Tausende von Alpenschneehühnern an und bedecken alle Berge und Gehänge. Aber auch in Skandinavien hat man ähnliche Fälle beobachtet.
Die Armut und Unwirtlichkeit der Wohnplätze des Alpenschneehuhnes wird diesem nicht selten verderblich. So anspruchslos es auch sein mag, so geschickt es Sturm und Wetter zu begegnen weiß, aller Unbill der Witterung ist es doch nicht gewachsen. Wenn im Winter bei ruhiger Luft tagelang Schnee herunterfällt, wird unser Huhn kaum gefährdet; wenn aber Lawinen von den Bergen herabrollen, wird manches von den Schneemassen erdrückt, und wenn sich eine harte Eiskruste über die Schneedecke legt, muß manches verkümmern und dem Hunger erliegen. Aber nicht bloß die Natur tritt den harmlosen Vögeln hart, ja fast feindlich entgegen, sondern auch, und in viel höherem Grade, der Mensch und das gesamte Raubgezücht. Tausende und Hunderttausende werden alljährlich gefangen: nicht wenige fallen dem mit dem Gewehr ausgerüsteten Jäger zur Beute, und ebensoviele, wie die Menschen für sich beanspruchen mögen, müssen unter dem Zahn der Füchse und des Vielfraßes oder in der Klaue des Jagdfalken und der Schnee-Eule verbluten.
*
Die Feldhühner ( Perdicinae), die die zweite, wohlumgrenzte Unterfamilie bilden, unterscheiden sich von den Rauchfußhühnern durch ihre schlanke Gestalt, den verhältnismäßig kleinen Kopf und die unbefiederten Läufe. Das Gefieder liegt meistens ziemlich glatt an; seine Färbung unterscheidet die Geschlechter gewöhnlich nicht.
Mit Ausnahme des hohen Nordens bewohnen die Feldhühner alle Länder der Alten Welt und alle Gegenden, vom Meeresgestade an bis zu den bedeutendsten Berghöhen empor. Ihrem Namen entsprechend bevorzugt die große Mehrzahl allerdings offene, waldlose Stellen; demungeachtet gibt es viele, die gerade in Waldungen sich ansiedeln und hier ebenso versteckt leben wie irgendein anderes Huhn. In ihrem Wesen zeichnen sie sich in mancher Hinsicht aus. Sie sind behender und gewandter als viele ihrer Ordnungsverwandten, fliegen zwar etwas schwer, aber doch noch ziemlich rasch, wenn auch selten hoch und weit, vermeiden aber soviel wie möglich, auf Bäumen sich niederzulassen. Sie sind scharfsinnig und fügen sich leicht in die verschiedensten Verhältnisse, bekunden eine gewisse List, wenn es gilt, Gefahren auszuweichen, andererseits auch wieder Mut und Kampflust. Soviel bis jetzt bekannt, leben alle unserer Familie angehörigen Arten in Einweibigkeit. Am Brutgeschäft nehmen die Männchen regen Anteil, bekümmern sich mindestens angelegentlich um die Sicherheit der brütenden Weibchen und später ihrer Jungen. Die Henne legt eine beträchtliche Anzahl einfarbiger oder auf lichtgelblichem und bräunlichem Grunde dunkelgefleckte Eier in ein einfaches Nest. Während der Brutzeit lebt jedes Paar für sich, erobert sich ein Gebiet und verteidigt dieses gegen andere derselben Art, auch wohl gegen fremdartige Eindringlinge. Nachdem die Jungen erwachsen sind, schlagen sich oft mehrere Familien in zahlreiche Ketten zusammen. Hinsichtlich der Nahrung unterscheiden sich die Feldhühner insofern von den Rauchfußhühnern, als sie fast nur zarte pflanzliche wie tierische Stoffe verzehren. Alle Arten jagen den verschiedensten Kerbtieren und deren Larven eifrig nach, und die meisten scheinen Körnern andere Pflanzenteile, namentlich Blätter und dergleichen, vorzuziehen.
An die Gefangenschaft gewöhnen sich die Feldhühner leicht; viele von ihnen halten bei einigermaßen geeigneter Pflege jahrelang im Käfig aus, und die meisten schreiten im Käfig auch zur Fortpflanzung. Manche schließen sich so innig dem Menschen an, daß sie ihm wie ein Hund auf dem Fuße nachfolgen, sich förmlich als Mitglieder des Hauses zu betrachten scheinen und mehr oder minder an den Leiden und Freuden ihrer Pfleger Anteil nehmen.
Die für uns wichtigste, weil auch innerhalb der deutschen Grenzen vorkommende Art der Sippe der Berghühner ( Caccabis) ist das Steinhuhn ( Caccabis saxatilis). Die Oberseite und die Brust sind blaugrau mit rötlichem Schimmer, ein die weiße Kehle umschließendes Band und ein solches, das sich unmittelbar an der Schnabelwurzel über die Stirn zieht, sowie je ein kleiner Fleck am Kinn an jedem Unterkieferwinkel schwarz, die Federn der Weichen abwechselnd gelbrotbraun und schwarz gebändert, die übrigen der Unterseite rostgelb, die Schwingen schwärzlichbraun mit gelblichweißen Schäften und rostgelblichen Streifen an der Kante der Außenfahne, die äußeren Steuerfedern rostrot. Das Auge ist rotbraun, der Schnabel korallenrot und der Fuß blaßrot. Die Länge beträgt fünfunddreißig, die Breite fünfzig bis fünfundfünfzig, die Fittichlänge sechzehn, die Schwanzlänge zehn Zentimeter; das Weibchen ist, wie gewöhnlich, etwas kleiner und durch den Mangel der Sporenwarze am Lauf leicht zu unterscheiden.
Im sechzehnten Jahrhundert lebte das Steinhuhn in den felsigen Bergen am Rhein, namentlich in der Gegend von Goar; gegenwärtig findet man es nur noch im Alpengebiet, und zwar in Oberösterreich, Oberbayern, Tirol und der Schweiz. Häufiger ist es auf der südlichen Seite des Gebirges, in Südtirol und Italien, wo es namentlich die Gebirge Liguriens und der Provinz Rom besiedelt, und gemein in ganz Griechenland, der Türkei, in Kleinasien, Palästina und Arabien.
Es ist wenigstens der Beachtung wert, daß dasselbe Steinhuhn, das auf den Alpen die Höhe der Tiefe entschieden vorzieht und am häufigsten auf sonnigen, etwas begrasten Schutthalden zwischen der Holz- und Schneegrenze sich findet, im Süden auch die Ebene bevölkert. Zwar trifft man es in Griechenland nur da, wo der Boden felsig oder wenigstens wüstenhaft ist, aber keineswegs ausschließlich in Höhen, die jenem Alpengürtel entsprechen, sondern auch auf kleinen Inseln, deren höchste Spitzen kaum hundert Meter über den Meeresspiegel sich erheben. In der Schweiz lebt es, laut Tschudi, »am liebsten auf sonnigen Gehängen zwischen Krummholz und Alpenrosenstauden, unter den hohen Mauern der Felsenwände, in Geröllschluchten und Schneebetten, zwischen Steinblöcken und Kräutern« und steigt bloß im Winter nach tieferen Steinhalden herab, oft bis in die Nähe der Bergdörfer und selbst der Ortschaften des Tieflandes. Diesen Angaben entsprechen die Beobachtungen, die Mountaineer im Himalaja anstellte; auch hier erscheint es um die Mitte des September in zahlreichen Ketten auf den bebauten Feldern, nahe bei den Dörfern des tieferen Landes.
Das Steinhuhn zeichnet sich wie alle seine Verwandten, deren Lebensweise uns bekannt geworden ist, durch Behendigkeit, Scharfsinnigkeit, Kampflust und leichte Zähmbarkeit vor andern Hühnern sehr zu seinem Vorteil aus. Es läuft außerordentlich rasch und mit bewunderungswürdigem Geschick über den Boden dahin, gleichviel, ob derselbe eben oder uneben, steinig oder mit Gras bestanden ist, klettert mit Leichtigkeit über Felsblöcke oder an seitlichen Abhängen empor und vermag sich noch auf Flächen zu erhalten, die dem Anschein nach einen so schwerleibigen Vogel in seinem Fortkommen auf das äußerste behindern. Im Vergleich mit andern Hühnerarten hat es einen leichten, geraden, schnell fördernden und auffallend geräuschlosen Flug; demungeachtet streift es selten weit in einem Zuge fort, sondern läßt sich sobald wie möglich wieder auf dem Boden nieder, weil es auf die Kraft seiner Schenkel doch noch mehr vertraut als auf die verhältnismäßig sehr starken Brustmuskeln. Ungezwungen fliegt es nie auf höhere Bäume, wie es überhaupt alle waldigen Stellen fast ängstlich meidet; im Notfall verbirgt es sich aber doch in den Nadelzweigen der Wettertanne. Unter den Sinnen steht das Gesicht, dessen Schärfe jedem Jäger wohlbekannt ist, obenan. Während das Steinhuhn auf den innerasiatischen Gebirgen sich vor dem mit der Büchse jagenden Menschen nicht einmal deckt, eher noch auf eine Felsenplatte heraustritt, um die selten gesehene Gestalt zu betrachten, ist es in unsern Alpen unter allen Berghühnern das scheueste und vorsichtigste, achtsam auf alles, was rundum vorgeht, unterscheidet den Schützen sehr wohl von dem ihm ungefährlichen Hirten, wie es überhaupt seine Feinde genau kennenlernt, und versteht meisterhaft, den verschiedensten Nachstellungen sich zu entziehen. Aber es fügt sich, gezwungen, auch sehr leicht in veränderte Umstände und wird gerade deshalb in überraschend kurzer Zeit zahm und zutraulich gegen seinen Pfleger. Die Stimme erinnert in mancher Hinsicht an das Gackern der Haushühner. Der Lockruf ist ein schallendes »Gigigich« oder »Tschattibit, tschattibiz«, der Laut, der beim Auffliegen ausgestoßen wird, ein eigentümliches Pfeifen, das man durch die Silben »Pitschii, Pitschii« ungefähr wiedergeben kann. Da, wo es viele Steinhühner gibt, glaubt man sich, wie von der Mühle sagt, zur Paarungszeit in einen Hühnerhof versetzt, so vielfältig erschallt der Ruf dieser anmutigen Geschöpfe von allen Seiten her.
Die Nahrung besteht aus verschiedenen Pflanzenstoffen und aus Kleingetier mancherlei Art. Im Hochgebirge nähren sich die Steinhühner von den Knospen der Alpenrose und andern Hochgebirgspflanzen, von Beeren, zarten Blättern und verschiedenen Sämereien, nebenbei aber auch von Spinnen, Kerfen, deren Larven und dergleichen; in der Tiefe besuchen sie die Felder, namentlich solange das Getreide noch niedrig und frisch ist, und verzehren dann zuweilen nichts anderes als die Spitzen von jungem Weizen und anderm grünenden Getreide; im Winter gehen sie auch wohl die Wacholderbeeren an oder nehmen selbst mit Fichtennadeln vorlieb.
Da, wo Steinhühner häufig sind, vereinigen sich, wie schon bemerkt, im Spätherbst oft mehrere Völker zu zahlreichen Ketten, in Indien, laut Mountaineer, zu solchen, die bis hundert Stück zählen können. Mit dem Beginn des Frühlings sprengen sich diese Vereine wieder, und nunmehr wählt sich jedes einzelne Paar einen besonderen Standort, inmitten dem es zu brüten gedenkt. Hier verbringt es, laut Girtanner, die Nacht an gesicherter Stelle unter Alpenrosen- oder Legföhrengebüsch, tritt am Morgen zur Äsung aus freiere Stellen heraus und läuft dabei viel umher, zieht sich um Mittag unter Gebüsch zurück oder nimmt ein Sandbad, verweilt in träger Ruhe bis gegen Abend, halb schlafend, im kühlen Schatten und zieht gegen Abend wiederum äsend seinem Schlafplatz zu. Der Hahn ist der Gattin gegenüber sehr zärtlich, balzt mit hängenden Flügeln, halb gestelztem und halb gebreitetem Schwänze, ruft jedem anderen seines Geschlechtes kampflustig zu, verteidigt sein glücklich errungenes Gebiet mit Heldenmut und bekämpft auch dann noch, wenn die Henne bereits brütet, jeden Eindringling seiner Art mit Leidenschaftlichkeit. »Legt man sich«, sagt Girtanner, »während die Henne brütet, wenn auch in ziemlicher Entfernung, auf die Lauer, und ahmt man den Hahnenruf nach, so kommt der Vogel in größter Erregtheit dahergerannt. Die Wut macht ihn so blind, daß er unter solchen Umständen oft sehr nahe an dem gedecktstehenden Beobachter vorbeischießt, ja selbst beinahe mit der Hand ergriffen werden kann. Nach vermeintlich sehr gut besorgter Vertreibung des Störenfriedes kehrt er stolz zurück.« Nach Lindermayers Behauptung legt das Steinhuhn in Griechenland schon Mitte Februar, nach Krüpers Beobachtungen in den letzten Tagen des März, selten früher, nach den Angaben der Schweizer Forscher in den Alpen erst gegen Ende Mai, Anfang Juni und selbst im Juli seine Eier. Das Nest ist eine einfache Vertiefung, die unter niedrigen Zwergtannen oder Gesträuch, unter vorragenden Steinen und andern geschützten und verborgenen Orten ausgescharrt und mit etwas Moos, Heidekraut, Gras und dergleichen ausgekleidet wird. Die Ausfütterung geschieht im Hochgebirge mit größerer Sorgfalt als in tieferen Gegenden und zumal im Süden, wo die Henne zuweilen eine einfache Mulde im Sande schon für hinreichend hält. Zwölf bis fünfzehn auf blaßgelblichweißem Grunde mit sehr feinen, blaßbräunlichen Strichen gezeichnete Eier von ungefähr sechsundvierzig Millimeter Längs- und dreiunddreißig Millimeter Querdurchmesser bilden das Gelege. Die Henne brütet etwa sechsundzwanzig Tage sehr eifrig und führt dann die Küchlein in Gesellschaft ihres Gatten auf die ersten Weideplätze. Die Färbung der Jungen im Daunenkleide spielt, nach Stölker, in einem hellen Steingrau; die Kopfplatte und ein Strich vom Auge zum Ohr sind braun, die Oberteile dunkelbraun, von zwei helleren Seitenlinien eingefaßt und einer solchen Mittellinie durchzogen, die Schultern und Weichen ebenfalls braun. Das erste Federkleid ist auf bräunlichgrauem Grunde bunt gefleckt, indem die Rücken-, Flügeldeck- und Brustfedern hellgelbe Spitzenflecke, die Außenfahne der Schwingen solche Rundflecke tragen, die Kopfplatte hellbraun. Später treten oberseits mehr einfarbig graubraune Federn auf, und im November ähneln die Jungen fast gänzlich den Alten. »Die Küchlein«, sagt Tschudi, »haben, wie die Alten, eine außerordentliche Fertigkeit im Verstecken und sind verschwunden, ehe man sie recht gewahrt. Stört man eine Familie auf, so stürzt sie nach verschiedener Richtung, fast ohne Flügelschlag mit dem ängstlichen Ruf ›Pitschii, Pitschii‹, seitwärts oder abwärts, meist bloß vierzig Schritt weit, und doch ist man nicht imstande, in den Steinen oder Sträuchern auch nur eines wieder zu entdecken. Hat aber der Jäger etwas Geduld und versteht er es, mit einem Lockpfeifchen den Ruf der Henne nachzuahmen, so sammelt sich bald das ganze Volk der geselligen Tiere wieder.« In Griechenland, wo das Steinhuhn, wie überall, ein sehr geschätztes und gesuchtes Wildbret ist, zieht man schon im Monat Juni zur Jagd desselben aus; diese aber hat, laut Powys, insofern besondere Schwierigkeit, als das aufgescheuchte Volk sich nach allen Richtungen hin zerstreut, ohne daß eins sich um das andere zu bekümmern, vielmehr jedes darauf bedacht zu sein scheint, sich möglichst schnell und sicher zu Verstecken. Gelingt es dem verfolgten Steinhuhn, einen guten Versteckplatz, eine dichte Hecke z.+B., aufzufinden, so läßt es sich so leicht nicht wieder auftreiben, und der Jäger hat dann gewöhnlich das Nachsehen. Da, wo die Hühner häufig sind, gewährt die Jagd aber trotzdem reiche Ausbeute und viel Vergnügen. Außer dem Menschen treten Füchse, Marder, Wiesel, Raubvögel und Raben als Feinde des Steinwildes auf: rollende Steine mögen auch manche erschlagen; am meisten aber gefährdet sie ein strenger Winter.
In Südwesteuropa wird das Steinhuhn durch seinen nächsten Verwandten, das Rothuhn ( Caccabis rubra) ersetzt. Dieser schöne Vogel unterscheidet sich von jenem hauptsächlich durch die vorherrschend rötliche Färbung der Oberseite und durch das breitere, nach unten hin in Flecke aufgelöste Halsband. Das Rothuhn bewohnt nur den Südwesten unseres heimatlichen Erdteils, von dem südlichen Frankreich an die nach Süden hin gelegenen Länder und Inseln, namentlich Spanien, Portugal, Madeira und die Azoren. Auf Malta gehört es bereits zu den Seltenheiten; weiter nach Osten hin wird es wahrscheinlich nicht mehr gefunden. Vor etwa hundert Jahren hat man es in Großbritannien eingebürgert, und gegenwärtig lebt es hier in einigen östlichen Grafschaften zahlreicher fast als das Rebhuhn, dem es im übrigen in seiner Lebensweise außerordentlich ähnelt.
*
Unser Reb- oder Feldhuhn ( Perdix cinerea) unterscheidet sich von den Rothühnern, abgesehen von der Färbung, durch die Beschilderung der Füße, die an der Vorder- und Hinterseite zwei Reihen bildet, das Fehlen einer Sporenwarze und den Bau des Flügels und des Schwanzes. Das Kleid, das nach der Gegend, Örtlichkeit und Lage des Wohnsitzes vielfach abändert, steht an Schönheit dem der Rothühner zwar nach, ist aber doch sehr ansprechend. Die Stirn, ein breiter Streifen über und hinter dem Auge, die Kopfseiten und die Kehle sind hellrostrot; den bräunlichen Kopf zeichnen gelbliche Längsstriche, den grauen Lücken rostrote Querbänder, lichte Schaftstriche und schwarze, seine Zickzacklinien; ein breites, auf aschgrauem Grunde schwarzgewelltes Band ziert die Brust und setzt sich zu beiden Seiten des Unterleibes fort, wird hier aber durch rostrote, beiderseitig weiß eingefaßte Querbinden unterbrochen; auf dem weißen Bauche steht ein großer, hufeisenförmiger Fleck von kastanienbrauner Farbe; die Schwanzfedern zeigen die in der Familie gewöhnliche rostrote Färbung, die mittleren Federn aber sind, wie die Bürzelfedern, rostbraun und braunrot quergestreift und die Handschwingen auf matt braunschwarzem Grunde rostgelblich quergebändert und gefleckt. Das Auge ist nußbraun, ein schmaler, nackter Ring um dasselbe und ein Streifen, der sich von ihm aus nach hinten verlängert, rot, der Schnabel bläulichgrau, der Fuß rötlichweißgrau oder bräunlich. Das kleinere Weibchen ähnelt dem Männchen, ist aber minder schön, der braune Fleck auf dem Bauch nicht so groß und nicht so rein, der Rücken dunkler. Die Länge beträgt sechsundzwanzig, die Breite zweiundfünfzig, die Fittichlänge sechzehn, die Schwanzlänge acht Zentimeter.
Das Rebhuhn bewohnt Deutschland, Dänemark, Skandinavien, Großbritannien, Holland, Belgien und Nordfrankreich, ganz Ungarn, die Türkei, einen Teil von Griechenland, Norditalien und ebenso Asturien, Leon, Hochkatalonien und einige Gegenden von Aragonien, ist häufig in Mittel- und Südrußland, in der Krim, in Kleinasien, und wird in Asien durch eine ihm sehr ähnliche Art vertreten. Auf Neuseeland hat man es eingebürgert. Ebenen zieht es unter allen Umständen den Gebirgen vor; in der niederen Schweiz z.+B. begegnet man ihm häufig, in den Berghöhen bis zu eintausend Meter über dem Meere. Zu seinem Wohlbefinden beansprucht es gut angebaute, wechselreiche Gegenden; es siedelt sich zwar im Felde an, bedarf aber Buschdickicht zu seinem Schutze und liebt deshalb Striche, in denen es hier und da Wäldchen, bebuschte Hügel oder wenigstens dichte Hecken gibt. Den Wald meidet es, nicht aber seine Ränder und die Vorgehölze, und ebensowenig scheut es sich vor nassen, sumpfigen Stellen, vorausgesetzt nur, daß diese hier und da mit Holz bestanden sind und kleine Inselchen, die sich etwas über dem Wasser erheben, umschließen.
Es gibt wenige Vögel, die strenger an dem einmal gewählten Gebiet festhalten als das Rebhuhn. Erfahrungsmäßig bleiben die auf einer Flur erbrüteten Jungen hier wohnen, und wenn einmal ein Revier verödet, währt es oft lange Zeit, bevor sich von den Grenzen her wieder einzelne Paare einfinden und die verlassene Gegend neu bevölkern. Gleichwohl hat man im nördlichen Deutschland beobachtet, daß fast in jedem Herbst wandernde Rebhühner erscheinen. So sah ein Bruder Naumanns einst eine Schar von vielleicht fünfhundert Stück, die in größter Eile, halb fliegend, halb laufend, nach Westen zog, dabei über einen etwa dreihundert Schritt im Durchmesser haltenden Raum sich ausdehnte und unaufhaltsam so weiterrückte, daß alle in derselben Richtung fortrannten, die Hinteren über die vorderen wegflogen und der ganze Schwärm rasch dem Gesichtskreise des Beobachters entschwand. Ein anderer Beobachter schreibt mir, daß er im Posenschen einmal mindestens tausend wandernde Rebhühner bemerkte, am folgenden Tage aber kein einziges mehr auf derselben Stelle antraf. Die Feldhühner, die Nordrußland und das östliche Sibirien bewohnen, verlassen die nördlichen Striche allwinterlich und suchen in den südlichen Steppen der Tatarei auf Sandhügeln und in Sümpfen, wo Schnee nicht liegenbleibt, Herberge. In Schweden hat man die Rebhühner erst eingeführt, und zwar, wie es heißt, vor etwa dreihundertfünfzig Jahren. Nach Nilssons Versicherung verbreiten sie sich gleichzeitig mit dem fortschreitenden Anbau des Landes immer weiter, so daß sie nunmehr nach Gegenden vorgedrungen sind, in denen sie vor drei oder vier Jahrzehnten nicht gesehen wurden. Von den weiten, an Saatfeldern reichen Ebenen Schoonens, wo sie vordem am zahlreichsten vorhanden waren, haben sie sich aufwärtsgezogen und kommen jetzt nicht bloß auf den größeren Ackerfeldern und Flächen in den übrigen Landschaften bis nach Upland und Gestrickland, sondern auch in Helsingland vor. In Norwegen haben sie, wohl aus Schweden zuwandernd, im Süden des Landes sich eingefunden, auch das Gebirge bis zu eintausend Meter unbedingter Höhe erobert, sogar das Dovrefjeld überstiegen und bis zum vierundsechzigsten Grad sich angesiedelt, sind hier aber durch strenge Winter mehrmals gänzlich vertilgt worden.
Ruhigen Ganges schreitet das Rebhuhn mit eingezogenem Halse und gekrümmtem Rücken gebückt dahin; wenn es Eile hat, trägt es sich hoch und den Hals vorgestreckt. Das Versteckenspielen versteht es ebensogut wie seine Verwandten, benutzt jeden Schlupfwinkel und drückt sich im Notfall auf den flachen Boden nieder, in der Hoffnung, wegen der Gleichfarbigkeit seines Gefieders mit jenem übersehen zu werden. Der Flug ist zwar nicht gerade schwerfällig, erfordert aber doch bedeutende Anstrengungen und ermüdet bald. Beim Aufstehen arbeitet es sich mit raschem Flügelschlage empor; hat es jedoch einmal eine gewisse Höhe erreicht, so streicht es streckenweit mit unbewegten Fittichen durch die Luft und gibt sich nur zeitweise durch rasche Schläge wieder einen neuen Anstoß. Ungern erhebt es sich hoch, fliegt auch selten weit in einem Zuge, am allerwenigsten bei heftigem Winde, der es förmlich mit sich fortschleudert. Wie seine Verwandten bäumt es nie, wenigstens solange es gesund ist; es gehört schon zu den größten Seltenheiten, wenn ein Rebhuhn einmal auf dem Dache eines Gebäudes sich niederläßt. Dagegen übt es unter Umständen eine Fertigkeit, die man ihm nicht zutrauen möchte; es versteht nämlich zu schwimmen. Wodzicki beobachtete zwei Ketten, die bei Gefahr jedesmal einem wasserreichen Bruch oder Fluß zuflogen und schwimmend ihre Sicherheit suchten. »Als wir diese Erfahrung gemacht hatten«, erzählt er, »ließen wir eines Tages die Hühner auftreiben und legten uns am entgegengesetzten Ufer platt nieder. Bald sahen wir denn auch die Vögel in das seichte Wasser waten, ohne Zögern dem alten Hahn folgend, dann dicht nebeneinander schwimmend, scheinbar ohne Anstrengung. Sie trugen dabei die Schwänze in die Höhe gehoben, die Flügel etwas vom Leibe entfernt. Als sie herauskamen, schüttelten sie das Gefieder wie Haushühner nach einem Sandbade und schienen gar nicht ermüdet zu sein.« Die Stimme, die man gewöhnlich vernimmt, ist ein lautes, weittönendes »Girrhik« und wird ebensowohl im Fluge wie im Sitzen ausgestoßen. Der alte Hahn ändert diesen Lockton in ein »Girrhäk« um und gebraucht ihn ebensowohl, um seine Gattin und Kinder herbeizurufen, als um einen Gegner zum Kampf aufzufordern. Geängstigte Hühner lassen ein gellendes »Ripripriprip« oder ein schnarrendes »Tärt« vernehmen; junge piepen wie zahme Küchlein und rufen später ein von der Stimme der Alten wohl zu unterscheidendes »Tüpegirr tüp«. Der Ausdruck der Behaglichkeit ist ein dumpfes »Kurruck«, der Warnungsruf ein sanftes »Kurr«.
Das Rebhuhn ist vorsichtig und scheu, wird durch Erfahrung gewitzigt und zeigt viel Geschick, sich in verschiedene Lagen des Lebens zu fügen. Es ist gesellig, friedliebend, treu und aufopferungsfähig, äußerst zärtlich gegen den Gatten oder gegen die Kinder, bekundet aber alle diese guten Eigenschaften mehr innerhalb der Familie im strengsten Sinne des Wortes als andern Tieren und selbst andern der gleichen Art gegenüber. Wenn es gilt, den Besitz zu verteidigen, kämpft ein Hahn wacker mit dem andern, und wenn zwei Familien sich verbinden wollen, geht es ohne Beißereien nicht ab; dagegen nimmt sich eine Familie verwaister Jungen sehr oft an, und die führenden Alten erweisen den Fremdlingen dieselbe Zärtlichkeit wie den eigenen Kindern.
Mit dem Schmelzen des Schnees regt sich der Paarungstrieb. Schon im Februar sprengen sich die Völker, die während des Winters treu zusammenhielten, in Paare, und jeder Hahn wählt einen ihm Passenden Standort. Tritt nochmals winterliches Wetter ein, so vereinigen sich die Paare wohl auch wieder auf kurze Zeit; jedenfalls aber trifft sie der kommende Frühling vereinzelt. Jetzt vernimmt man in den Morgen- und Abendstunden das herausfordernde Rufen der Hähne, sieht auch wohl zwei von ihnen ernsten Streit um ein Weibchen ausfechten. Dabei springen beide gegeneinander und versuchen, sich mit Krallen und Schnabel gegenseitig zu schädigen. Der Schwächere muß weichen, und der Sieger kehrt frohlockend zur Gattin zurück.
Gegen Ende April, gewöhnlich erst Anfang Mai, beginnt die Henne zu legen. Ihr Nest ist eine einfache Vertiefung auf dem flachen Boden, die mit einigen weichen Halmen ausgefüttert und oft an recht unpassenden Plätzen angelegt wird. Bisweilen deckt es ein Busch; in den meisten Fällen aber steht es mitten im früh aufschießenden Getreide, namentlich in Weizen-, Erbsen- und Rübsenfeldern, im Klee oder im hohen Grase der Wiese, auch wohl auf jungen Schlägen am Rande kleiner Feldhölzer. Das Gelege zählt neun bis siebzehn Eier; wenigstens nimmt man an, daß diejenigen Nester, in denen man mehr fand, nicht von einer einzigen Henne allein benutzt wurden. Hat eine Henne weniger als neun Eier, so läßt sich hieraus mit Wahrscheinlichkeit folgern, daß das erste Gelege durch irgendeinen Zufall verunglückte. Die Eier sind durchschnittlich dreiunddreißig Millimeter lang, sechsundzwanzig Millimeter dick, birnförmig, glattschalig, wenig glänzend und blaßgrünlichbraungrau von Farbe. Die Henne brütet volle sechsundzwanzig Tage mit unglaublicher Hingebung, so anhaltend, daß ihr nach und nach fast alle Bauchfedern ausfallen, und verläßt das Nest nur so lange, als unbedingt erforderlich, um die notwendige Nahrung aufzusuchen. Während sie brütet, weicht das Männchen nicht aus der Nähe, hält vielmehr gute Wacht, warnt die Gattin vor jeder Gefahr, gibt sich auch gewöhnlich dieser preis und kehrt, wenn es verscheucht wurde, wieder zur alten Stelle zurück. Wird der Hahn getötet, so steht auch ihr ziemlich sicher der Untergang bevor. Fortgesetzte Nachstellung kann ein Rebhuhnpaar übrigens, so sehr es die Brut auch liebt, doch vom Nest verscheuchen.
Die Jungen sind allerliebste Geschöpfe, schon soweit es sich um das Äußere handelt. Ihr Daunenkleid zeigt auf der Oberseite eine Mischung von Gelbbraun, Rostgelb, Rostbraun und Schwarz, während auf der Unterseite lichtere Farben vorherrschen; die Zeichnung besteht aus unterbrochenen Fleckenstreifen. Sie bewegen sich vom ersten Tage ihres Lebens an mit vielem Geschick, verlassen das Nest sogar schon, ehe sie vollkommen trocken geworden oder von allen Anhängseln der Eischalen befreit sind, lernen auch sehr rasch, sich den Unterweisungen ihrer Eltern zu fügen. Vater und Mutter nehmen an ihrer Erziehung gleichen Anteil; der Vater bewacht, warnt und verteidigt, die Mutter führt, ernährt und hudert sie. Verliert eines der Eltern sein Leben, so übernimmt das andere die Pflege, also auch der Vater die Pflichten der Mutter. »Rührend ist es«, schildert Naumann, »die unbegrenzte Sorgfalt der Eltern um ihre lieben Kleinen zu beobachten. Ängstlich spähend, von welcher Seite Unglück drohe, oder ob es abzuwenden sei, läuft der Vater hin und her, während ein kurzer Warnungslaut der Mutter die Jungen um sich versammelt, ihnen befiehlt, sich in ein Versteck zu begeben, schnell einem jeden ein solches im Getreide, Grase, Gebüsch, hinter Furchen, in Fahrgeleisen und dergleichen anweist und, sobald sie alle geborgen glaubt, mit dem Vater alles aufbietet, um den Angriff zu vereiteln oder abzuwenden. Mutig stellen sich beide Eltern nun dem Feinde entgegen, greifen ihn, im Gefühl ihrer Schwäche, jedoch nicht an, sondern suchen seine Aufmerksamkeit von den Jungen ab und auf sich zu lenken, ihn von den Jungen abzuziehen, bis sie glauben, ihn weit genug entfernt zu haben. Dann fliegt zuerst die Mutter zu den Jungen, die ihr angewiesenes Versteck indessen um keinen Fuß breit verlassen haben, zurück und versucht, diese eiligst ein Stück weiter fortzuschaffen. Sieht endlich der Vater alle seine Lieben in Sicherheit, so enttäuscht auch er seinen Verfolger und fliegt davon. Sobald nun ringsumher alles wieder ruhig und die feindliche Störung verschwunden ist, läßt er seinen Ruf hören, den die Mutter sogleich beantwortet, worauf er sofort zu seiner Familie eilt. Kein Raubtier kann die Wachsamkeit der zärtlichen, sorgsamen Eltern hintergehen, weder bei Tag noch bei Nacht, wenn nicht besondere Umstände den Feind begünstigen. Aber auch die unbedingte Folgsamkeit, die liebenswürdige Anhänglichkeit der Kinder zu den Eltern hat man oft zu bewundern Gelegenheit.« Wenn die Küchlein erst größer geworden sind, verändern sie und ihre Eltern das Betragen. Naht ihnen jetzt ein Feind, so erheben sie sich, fliegen zusammen ein Stück fort und fallen wieder ein; werden sie nochmals ausgestört, so sprengen sie sich in einzelne Trupps oder Stücke, fliegen nach verschiedenen Richtungen hin von dannen, lassen sich nieder und drücken sich entweder platt auf den Boden oder suchen sich durch Laufen oder anderweitiges Verstecken zu retten. Meint der Vater, daß die Gefahr vorüber sei, so beginnt er zu locken; eines um das andere von den Kindern antwortet, und die treuen Eltern versammeln nun nach und nach wieder die ganze Schar, indem der Vater eins von den Jungen nach dem andern herbeiholt und zur Mutter bringt, die die bereits vereinigten unter ihre Führung genommen hat. Später müssen die Jungen dem Vater einen Teil seiner Sorge abnehmen, nämlich auf Vorposten treten und Umschau halten. Dieses Wachestehen, das abwechselnd von allen jungen Hühnern geübt wird, befördert ihre Ausbildung wesentlich. Verlieren die Jungen ihre Eltern, so vereinigen sie sich mit fremden Völkern.
In der frühesten Kindheit fressen die Rebhühner fast nur Kerbtiere, später nebenbei Pflanzenstoffe, zuletzt diese beinahe ausschließlich. Bis zur Ernte hin treiben sich die Völker hauptsächlich aus den Getreidefeldern umher; nach der Ernte fallen sie auf Kartoffel- oder Krautäckern ein, weil sie hier die beste Deckung finden. Im Spätherbst suchen sie Stoppeln und noch lieber Sturzäcker auf, in deren Furchen sie sich verstecken können. Naheliegende Wiesen werden der Heuschrecken, benachbarte Schläge der Ameisenpuppen halber gern begangen; die Nachtruhe aber hält das Volk immer auf freiem Felde. Es verläßt am Morgen sein Lager und begibt sich zunächst auf trockene Stellen im Felde, sucht sich hier sein Frühstück, wendet sich sodann den Wiesen zu, auf denen der Nachttau nunmehr abgetrocknet ist, legt sich, wenn die Mittagssonne drückt, in die Büsche, nimmt wohl auch ein Staubbad, geht nachmittags in die Stoppeln zurück und fliegt gegen Abend der Schlafstelle wieder zu. In dieser Weise währt das Leben fort, bis der Winter eintritt. Er ist eine schlimme Zeit und bringt ihnen oft den Hungertod. Nicht die Kälte schadet ihnen, sondern der Schnee, weil dieser die Äsung zudeckt und zuweilen so hart wird, daß sie nicht imstande sind, bis zur nahrungbergenden Erde sich durchzugraben. Solange sie scharren können, geht alles gut; sie kennen die Feldflächen, auf denen Wintersaat oder Raps steht, sehr genau und nähren sich hier immer noch ziemlich leicht; wenn aber wechselndes Wetter eine Eiskruste auf die Schneedecke legt, geraten sie in die größte Not, ermatten mehr und mehr, werden leicht eine Beute der Raubtiere oder sterben buchstäblich den Hungertod. In strengen Wintern vergessen sie alle Scheu vor den Menschen, nahen den Dörfern, suchen in den Gärten Schutz und Nahrung, kommen selbst ins Gehöft, in die Hausflure herein und stürzen sich gierig auf die Körner, die eine mildtätige Hand ihnen zuwarf. Zuweilen werden die Hasen ihre Retter, indem sie durch Scharren verborgene Nahrung bloßlegen. In mehr als einem Revier stirbt während eines harten Winters der ganze Hühnerbestand aus. Doch ebenso schnell, wie das Elend eintritt, kann es sich wieder zum guten wenden. Sowie der Tauwind und, die Sonne im Verein nur hier und da offene Stellen schaffen, sind die Hühner geborgen, und haben sie sich erst einige Tage nacheinander sattgefressen, kehrt auch die frohe Lebenslust, die sie so sehr auszeichnet, bald wieder in ihr Herz zurück.
Alle vierfüßigen Raubtiere bedrohen namentlich die Eier und die junge Brut unseres Rebhuhns; Habicht und Edelfalk, Sperber, Bussard, Weih, Rabe und Häher sind alt oder jung fortwährend auf den Fersen. Wenn man sich die Gefahren vergegenwärtigt, denen ein Rebhuhn ausgesetzt ist, bevor es sein volles Wachstum erreicht hat, und bedenkt, daß es der schlimmen Witterung noch außerdem standhalten muß, begreift man kaum, wie es möglich ist, daß es überhaupt noch Feldhühner gibt. Dichte Hecken oder kleine Dickichte, sogenannte Remisen, dazu bestimmt, ihnen eine Zuflucht zu gewähren, sollten in allen Fluren angelegt und aufs beste unterhalten werden, und außerdem sollte man noch überall bedacht sein, die Not, die jeder strenge Winter bringt, möglichst zu mildern, indem man in der Nähe solcher Remisen Futter ausstreut und den Tisch auch für diese Hungrigen deckt. Das Rebhuhn bringt nirgends und niemals Schaden, trägt zur Belebung unserer Fluren wesentlich bei, erfreut jedermann durch die Anmut seines Betragens, gibt Gelegenheit zu einer der anziehendsten Jagden und nutzt endlich durch sein vortreffliches Wildbret.
Jung aufgezogene und verständig behandelte Rebhühner werden ungemein zahm, schließen sich ihren Pflegern innig an, unterscheiden sie auf das genaueste von andern, beklagen in jedermann verständlicher Weise ihr Fernsein und begrüßen sie bei ihrem Erscheinen mit Freudenrufen. Zur Fortpflanzung schreiten gefangene Rebhühner jedoch nur in einem großen, stillen Fluggebauer.
*
Unsere Wachtel ( Coturnix Communis) vertritt eine nach außen hin scharf umgrenzte Sippe, deren Merkmale in dem kleinen, schwachen Schnabel, dem niedrigen, sporenlosen, langzehigen Fuße und dem außerordentlich kurzen und gewölbten Schwanz liegen. Die Wachtel ist auf der Oberseite braun, rostgelb quer- und längsgestreift, auf dem Kopf dunkler als auf dem Rücken, an der Kehle rostbraun, am Kropf rostgelb, auf der Bauchmitte gelblichweiß, an den Brust- und Bauchseiten rostrot, hellgelb in die Länge gestreift; ein licht gelbbrauner Streifen, der an der Wurzel des Oberschnabels beginnt, zieht sich über dem Auge dahin, am Hals herab und umschließt die Kehle, wird hier aber durch zwei schmale, dunkelbraune Bänder begrenzt; die Handschwingen zeigen aus schwärzlichbraunem Grund rötlichrostgelbe Querflecke, die zusammen Bänder bilden; die erste Schwinge wird außen durch einen schmalen, gelblichen Saum verziert; die rostgelben Steuerfedern haben Weiße Schäfte und schwarze Bindenflecke. Beim Weibchen sind alle Farben blasser und unscheinbarer; auch tritt das Kehlfeld wenig hervor. Das Auge ist hell braunrötlich, der Schnabel horngrau, der Fuß rötlich oder blaßgelb. Die Länge beträgt zwanzig, die Breite vierunddreißig, die Fittichlänge zehn, die Schwanzlänge vier Zentimeter.

Wachtelpärchen ( Coturnix communis)
Man kennt wenig Länder der Alten Welt, in denen unsere Wachtel noch nicht beobachtet worden ist. In Europa kommt sie vom sechzigsten Grad nördlicher Breite an nach Süden hin überall, wenn auch erst vom fünfzigsten Grad an regelmäßig vor; in Mittelasien lebt sie in einem etwas südlicher gelegenen Gürtel an geeigneten Orten, zumal in der Steppe, nicht minder häufig, und da sie nun von hier- wie von dort aus alljährlich Wanderungen nach dem Süden antritt, durchstreift sie auch ganz Afrika und ganz Südasien.
Ihre Wanderungen sind in jeder Beziehung merkwürdig. Sie geschehen alljährlich, weichen aber gleichwohl von dem Zuge anderer Vögel nicht unwesentlich ab. Einzelne Wachteln scheinen fast während des ganzen Jahres auf der Wanderung zu sein, und auch diejenigen, die sich während des Sommers der Fortpflanzung halber eine Zeitlang fest ansiedeln, verlassen das gewählte Gebiet keineswegs zu gleicher Zeit. Einzelne erscheinen schon Ende August in Ägypten; eine größere Anzahl trifft hier im September ein; in demselben Monat aber findet man, und keineswegs selten, in Deutschland noch brütende Weibchen oder Junge im Daunenkleide. Der Zug geschieht allerdings hauptsächlich im September, währt aber den ganzen Oktober hindurch und manchmal sogar bis in den November hinein. Viele überwintern auf den drei südlichen Halbinseln Europas, einige schon in Südfrankreich, in gelinden Wintern sogar in Deutschland; die Mehrzahl aber wandert bis in die Aquatorländer Afrikas und Asiens, und einige finden auch dort noch nicht Rast, sondern reisen bis in die Länder am Vorgebirge der Guten Hoffnung. Vom Anfang September an wimmelt es in allen Feldern längs der Küste des Mittelmeeres von Wachteln.
Alle reisenden Wachteln benutzen das Festland soweit sie können und kommen deshalb an der Spitze der südlichen Halbinsel in zahlreichen Scharen zusammen. Bei widrigem, d.+h. in der Reiserichtung wehendem Wind stockt der Zug; sowie aber Gegenwind eintritt, erhebt sich der Schwärm und fliegt nun ins Meer hinaus und in südwestlicher Richtung weiter. Wenn der Wind beständig bleibt und nicht zum Sturm anwächst, geht die Reise glücklich vonstatten. Die Wanderschar fliegt ihres Weges dahin, solange die Kraft ihrer Schwingen es ermöglicht; tritt übergroße Ermüdung ein, so läßt sich, wie ich von glaubwürdigen Schiffern versichert worden bin, die ganze Gesellschaft auf den Wellen nieder, ruht hier eine Zeitlang aus, erhebt sich von neuem und fliegt weiter. Anders verhält es sich, wenn der Wind umschlägt oder zum Sturm anwächst. In der Zugrichtung wehender Wind erschwert die Reise übers Meer in hohem Grade, Sturm macht sie unmöglich. Unter solchen Umständen stürzen sich die zum Tode ermatteten Wachteln wie besinnungslos auf einzelne Klippen oder auf das Deck der Schiffe, liegen hier lange Zeit, ohne sich zu regen, und werden durch solches Mißgeschick so ängstlich und verwirrt, daß sie, wenn das Wetter umgeschlagen und der Wind wiederum günstig geworden ist, noch tagelang auf solchem Zufluchtsorte verweilen, bevor sie sich zur Weiterreise entschließen. Dies hat man beobachtet; wie viele von ihnen aber in die Wellen geschleudert und hier ertränkt werden mögen, weiß man nicht.
Wenn man während der eigentlichen Zugzeit an irgendeinem Punkte der nordafrikanischen Küste auf die Wachteln achtet, ist man nicht selten Zeuge ihrer Ankunft. Man gewahrt eine dunkle, niedrig über dem Wasser schwebende Wolke, die sich rasch nähert und dabei mehr und mehr sich herabsenkt. Unmittelbar am Rande der äußersten Flutwelle stürzt sich die totmüde Masse zum Boden hernieder. Hier liegen die armen Geschöpfe anfangs mehrere Minuten lang wie betäubt, unfähig fast, sich zu rühren. Aber dieser Zustand geht rasch vorüber. Es beginnt sich zu regen; eine macht den Anfang, und bald huscht und rennt es eilfertig über den nackten Sand, günstigeren Versteckplätzen zu. Es währt geraume Zeit, bis eine Wachtel sich wieder entschließt, die erschöpften Brustmuskeln von neuem anzustrengen; während der ersten Tage nach ihrer Ankunft erhebt sie sich gewiß nicht ohne dringendste Not. Für mich unterliegt es keinem Zweifel, daß die Reise von dem Augenblick an, wo die Schar wieder festes Land unter sich hat, zum größten Teil laufend fortgesetzt wird; denn von nun an begegnet man den Wachteln überall in Nordostafrika; niemals aber sieht man fliegende Scharen; immer und überall stößt man auf vereinzelte, freilich hier und da auch auf eine ziemliche Anzahl. Zu ihren Wohnsitzen erwählen sie sich Örtlichkeiten, die ihren Wünschen entsprechen, namentlich Stoppelfelder, die mit Halfa bedeckten und die bebauten Gelände, vor allem jedoch die Steppe. Daß alle Wintergäste, solange sie in Afrika verweilen, umherwandern, ist mir wahrscheinlich geworden. Mit Beginn des Frühlings treten sie allgemach den Rückzug an, und im April sammeln sie sich an der Küste des Meeres, nie aber zu so zahlreichen Scharen wie im Herbst. Ihre Weiterreise scheint langsam vonstatten zu gehen; denn man beobachtet, daß sie, die in Südeuropa zu Ende des April massenhaft sich einstellen, bis auf diejenigen Paare, die zum Nisten hier bleiben, nach und nach verschwinden.
Ihren Sommerstand nimmt die Wachtel am liebsten in fruchtbaren, getreidereichen Ebenen. Hochgelegene, gebirgige Länderstriche meidet sie, und schon im Hügellande ist sie seltener als in der Tiefe. Das Wasser scheut sie ebenso wie die Höhe, fehlt daher in Sümpfen oder Brüchen gänzlich. Unmittelbar nach ihrer Ankunft hält sie sich zunächst im Weizen- oder Roggenfeld auf; später zeigt sie sich weniger wählerisch; demungeachtet darf als Regel gelten, daß sie sich da, wo kein Weizen gebaut wird, nicht heimisch fühlt und hier höchstens in der Zugzeit angetroffen wird. Während der Reise fällt sie zuweilen in Gebüsch ein; im Sommer verläßt sie das Feld nicht.
Man kann die Wachtel weder einen schönen noch einen begabten Vogel nennen; gleichwohl ist sie beliebt bei jung und alt. Dies dankt sie ihrem hellen, weitschallenden Paarungsruf, dem bekannten »Bückwerwück«, der von jedem gern vernommen wird und zur Belebung der Gegend entschieden mit beiträgt. Außer diesem Ruf läßt sie noch mehrere andere Laute vernehmen, die jedoch meist so leise ausgestoßen werden, daß man sie nur in der Nähe hört. Der Lockton beider Geschlechter ist ein leises »Bübiwi«, der Liebesruf ein etwas lauteres »Prickick« oder »Brübrüb«, der Ausdruck der Unzufriedenheit ein schwaches »Gurr, gurr«, der Furcht ein unterdrücktes »Trülilil, trülil«, der Laut des Schreckens ein ebenfalls nicht weit vernehmbares »Trül reck reck reck«, das bei größter Angst in ein Piepen umgewandelt wird. Dem Paarungsruf des Männchens pflegt ein heiseres »Wärre wärre« vorauszugehen; diesem Vorspiel folgt das »Bückwerwück« mehreremal nacheinander. Je öfter es ausgestoßen wird, um so mehr schätzt man den Hahn.
In ihren Eigenschaften und Sitten, in ihrer Lebensweise und im Betragen unterscheidet sie sich in vieler Hinsicht von dem Rebhuhn. Sie geht rasch und behend, aber mit schlechter Haltung, weil sie den Kopf einzieht und den Schwanz gerade herabhängen läßt, also kugelig erscheint, nickt bei jedem Schritt mit dem Kopf und nimmt nur selten eine edlere Haltung an, fliegt schnell, schnurrend und ruckweise fortschießend, viel rascher und gewandter als das Rebhuhn, schwenkt sich zuweilen auch sehr zierlich, durchmißt jedoch nur ungern weitere Strecken in einem Flug, erhebt sich bloß während des Zuges in bedeutendere Höhen und wirft sich baldmöglichst wieder zum Boden herab, um laufend weiter zu flüchten. Ihre Sinne, zumal Gesicht und Gehör, dürfen als wohl entwickelt bezeichnet werden. Man kann sie nicht gerade scheu nennen; furchtsam und ängstlich zeigt sie sich jedoch stets, und wenn sie sich hart verfolgt sieht, läßt sie sich wahre Tollheiten zuschulden kommen, so daß es scheint, als ob sie sich gesichert glaubt, wenn sie nur ihren Kopf verborgen hat. Gesellige Tugenden sind ihr fremd; nur die Not, nicht die Neigung vereinigt sie. Der Hahn verfolgt jeden anderen mit blinder Wut, kämpft mit ihm bis zum letzten Atemzug und mißhandelt oft auch die Henne, die seine Begierde im allerhöchsten Grad entflammt. Die Henne zeigt sich als gute Mutter und nimmt sich verwaister Küchlein mit warmer Liebe an, wird aber von diesen schnöde Verlassen, sobald sie ihrer nicht mehr bedürfen. Um andere Tiere bekümmert sich die Wachtel nur, insoweit sie dieselben fürchtet; ein geselliges oder freundschaftliches Verhältnis geht sie mit keinem einzigen ein. Solange die Sonne am Himmel steht, hält sie sich möglichst still und verborgen zwischen den Halmen und Ranken der Felder auf; während der Mittagsstunden Pflegt sie ein Sandbad zu nehmen, behaglich hingestreckt sich zu sonnen oder auch zu schlafen; gegen Sonnenuntergang wird sie munter und rege. Dann vernimmt man ihren Schlag in fast ununterbrochener Folge und sieht sie laufend oder fliegend außerhalb ihrer Versteckplätze, die sie nunmehr verläßt, um der Nahrung nachzugehen, oder um sich zum andern Geschlecht zu gesellen und mit einem Nebenbuhler zu kämpfen.
Ihre Nahrung besteht aus Körnern verschiedener Art, Blattspitzen, Blättern und Knospen und zu gleichen Teilen etwa aus allerhand Kerbtieren. Letztere scheinen den Pflanzenstoffen stets vorgezogen zu werden, aber zu ihrem Gedeihen wenigstens nicht unbedingt notwendig zu sein, da erfahrungsgemäß feststeht, daß sich Wachteln monatelang mit Weizenkörnern ernähren lassen. Kleine Steine, die die Verdauung befördern, und frisches Wasser zum Trinken sind ihr Bedürfnis; aber es genügt ihr zur Stillung ihres Durstes schon der Tau aus den Blättern, und deshalb sieht man sie auch nur selten an bestimmten Tränkstellen sich einfinden.
Höchst wahrscheinlich lebt die Wachtel in Vielehigkeit; es deuten mindestens alle Beobachtungen darauf hin, daß an wirkliches Eheleben der verschiedenen Geschlechter nicht gedacht werden kann. Der Hahn übertrifft an Eifersucht womöglich alle Verwandten, versucht, aus seinem Gebiet sämtliche Nebenbuhler zu vertreiben und streitet um die Alleinherrschaft auf Leben und Tod. Gegen die Henne zeigt er sich begehrlich und stürmisch wie kaum ein anderer Vogel, mißhandelt sie, wenn sie sich seinen Anforderungen nicht gutwillig und sofort fügen will, begattet sich sogar mit irgendeinem andern beliebigen Vogel, der hierzu aufzufordern scheint. Naumann sah, daß ein Wachtelmännchen in verliebter Raserei einen jungen Kuckuck, der gefüttert sein wollte, betrat, erwähnt, daß man beobachtet habe, wie ein paarungslustiger Hahn auf tote Vögel sprang und hält deshalb die alte Sage, daß der Hahn sich sogar mit Kröten begatte, wenigstens für erklärlich. Die Henne schreitet erst spät, d.+h. kaum von Anfang des Sommers, zum Nestbau, scharrt, am liebsten auf Erbsen- und Weizenfeldern, eine seichte Vertiefung, kleidet diese mit einigen trockenen Pflanzenteilen aus und legt auf letztere ihre acht bis vierzehn verhältnismäßig großen, durchschnittlich neunundzwanzig Millimeter langen, zweiundzwanzig Millimeter dicken, birnförmigen, glattschaligen, auf lichtbräunlichem Grund glänzend dunkelgrün oder schwarzbraun gefleckten, in Färbung und Zeichnung vielfach abweichenden Eier. Sie brütet mit Eifer achtzehn bis zwanzig Tage lang, läßt sich kaum vom Nest scheuchen, wird deshalb auch oft ein Opfer ihrer Hingebung. Währenddem schweift der Hahn noch ebenso liebestoll wie früher im Feld umher und treibt es mit einer Henne wie mit der andern, ohne sich wegen der Nachkommenschaft zu sorgen. Die Jungen laufen sofort nach dem Ausschlüpfen mit der Mutter davon, werden von ihr sorgsam auf die Weide geführt und zum Fressen angehalten, anfänglich bei schlechtem Wetter auch gehudert, überhaupt bestens gewartet, wachsen auffallend rasch heran, achten bald des Lockrufes der Mutter nicht mehr und versuchen nötigenfalls, sich allein durchs Leben zu schlagen. Schon in der zweiten Woche ihres Daseins flattern sie, in der fünften oder sechsten haben sie ihre volle Größe und genügende Flugfertigkeit erlangt, um die Herbstreise antreten zu können.
Nicht selten findet man noch zu Ende des Sommers eine alt« Wachtel mit kleinen, unreifen Jungen, denen der herannahende Herbst schwerlich noch genügende Zeit zu ihrer Entwicklung läßt. Solche Brüten gehen wohl regelmäßig zugrunde. Aber auch diejenigen, die rechtzeitig dem Ei entschlüpften, haben von allerlei laufendem und fliegendem Raubzeug viel zu leiden, und jedenfalls darf man annehmen, daß kaum die Hälfte von allen, die geboren werden, bis zum Antritt der Herbstreise leben bleibt. Die Reise selbst bringt noch größere Gefahren mit sich; denn nunmehr tritt der Mensch als schlimmster aller Feinde auf. Längs der nördlichen, westlichen und östlichen Küste des Mittelmeeres wird mit Beginn dieser Reise ein Netz, eine Schlinge, eine Falle an die andere gestellt. Die Insel Capri ist berühmt geworden wegen der Ergiebigkeit des Wachtelfanges; frühere Bischöfe, zu deren Sprengel das Eiland gehörte, hatten einen bedeutenden Teil ihres Einkommens dem Wachtelfang zu danken. In Rom sollen, wie Waterton berichtet, zuweilen an einem Tage siebzehntausend Stück unserer Vögel verzollt werden. An der spanischen Küste ist der Fang, der hier übrigens hauptsächlich im Frühjahr stattfindet, nicht minder bedeutend. Erwägt man, daß von denen, die den Menschen und den Raubtieren entrinnen, noch Tausende im Meer ihr Grab finden, so begreift man kaum, wie die starke Vermehrung alle entstehenden Verluste ausgleichen kann.
Gefangene Wachteln gelten mit Recht als liebenswürdige Stubengenossen. Sie verlieren mindestens teilweise ihre Scheu, lassen sich leicht erhalten und verunreinigen die Zimmer oder ihr Gebauer nur wenig. Wenn man ihnen die nötigsten Erfordernisse zu behaglichem Leben gewährt, werden sie bald in dem umgitterten Raume heimisch, schreiten auch leicht in ihm zur Fortpflanzung.
Die Stelle der altweltlichen Feldhühner vertreten in Amerika die ihnen sehr ähnlichen Baumhühner (Odontophorinae), die man ebenfalls in einer besonderen Unterfamilie zu vereinigen pflegt. Sie sind klein oder mittelgroß, zierlich gebaut; der Schnabel ist kurz, sehr hoch, seitlich zusammengedrückt, an der Schneide des Kiefers oft gezahnt, der Fuß hochläufig, langzehig und unbespornt. Das Gefieder ist reich, bei den meisten Arten nicht besonders lebhaft, bei vielen aber doch sehr schön gefärbt und immer ansprechend gezeichnet. Mittelamerika ist als die eigentliche Heimat der Baumhühner zu betrachten; im Süden und im Norden kommen verhältnismäßig wenige Arten vor. Auch sie bewohnen die verschiedensten Örtlichkeiten. Einige leben im Feld und in der Ebene, andere im Gebüsch, einzelne auch im Hochwald; diese erinnern durch ihre Lebensweise an das Haselwild, jene an die Rebhühner, obwohl hierbei festgehalten werden muß, daß sie sämtlich ihren Namen verdienen. Wesen und Eigenschaften kennzeichnen den Kern der Familie als nahe Verwandte der Feldhühner, während diejenigen, die in ihrer Gestalt an die Haselhühner erinnern, letzteren auch in der Lebensweise ähneln. Alle sind bewegliche, scharfsinnige und befähigte Geschöpfe. Sie laufen rasch und gewandt, fliegen leicht, wenn auch nicht ausdauernd, benehmen sich im Gezweig der Bäume mit Geschick, sehen und hören scharf und lassen sich ohne besondere Schwierigkeit zähmen. Ihre Anmut und Zierlichkeit wirbt ihnen in jedem, der sie kennenlernt, einen Freund; ihre Fruchtbarkeit und Unschädlichkeit hat weitgehende Hoffnungen erweckt. Man versucht diejenigen, die den Norden Amerikas bewohnen, bei uns heimisch zu machen, und hat eine Art von ihnen bereits in Großbritannien eingebürgert; andere Arten gereichen einstweilen mindestens unsern Tiergärten zur Zierde.
Das Baumhuhn, das sich europäisches Bürgerrecht erworben hat, ist die Baumwachtel, auch wohl Colinhuhn genannt ( Ortyx virgianus), Vertreter einer gleichnamigen Sippe ( Ortyx). Das etwas glänzende Gefieder verlängert sich auf dem Kopf zu einer kleinen Haube. Alle Federn der Oberseite sind rötlichbraun, schwarz gefleckt, getüpfelt, gebändert und gelb gesäumt, die der Unterseite weißlichgelb, rotbraun längsgestreift und schwarz in die Quere gewellt; ein weißes Band, das auf der Stirne beginnt und über das Auge weg nach dem Hinterhals läuft, die weiße Kehle, eine über dem lichten Bande sich dahinziehende schwarze Stirnbinde und eine solche, die, vor dem Auge entspringend, die Kehle einschließt, sowie endlich die aus Schwarz, Weiß und Braun bestehende Tüpfelung der Halsseiten bilden vereinigt einen zierlichen Kopfschmuck; auf den Oberflügeldeckfedern herrscht Rotbraun vor; die dunkelbraunen Handschwingen sind an der Außenfahne lichter gesäumt; die Armschwingen unregelmäßig brandgelb gebändert, die Steuerfedern, mit Ausnahme der mittleren graugelblichen, schwarz gesprenkelten, graublau. Das Auge ist nuß-, der Schnabel dunkelbraun, der Fuß blaugrau. Das Weibchen unterscheidet sich durch blassere Färbung und undeutlichere Zeichnung des Gefieders, hauptsächlich aber durch das Gelb der Stirn, der Brauen, der Halsseiten und der Kehle. Das Geschlecht, der Jungen, die dem Weibchen ähneln, läßt sich an der mehr oder minder deutlichen Zeichnung bereits erkennen. Die Länge beträgt fünfundzwanzig, die Breite fünfunddreißig, die Fittichlänge elf, die Schwanzlänge sieben Zentimeter.
Kanada bildet die nördliche, das Felsengebirge die westliche, der Meerbusen von Mexiko die südliche Grenze des Verbreitungskreises der Baumwachtel. In Utah, auf Jamaika und St. Croix sowie in England hat man sie eingebürgert, in Westindien mit vollständigem, übrigens mit teilweisem Erfolg. Ihren Stand wählt sie in ähnlicher Weise wie unser Rebhuhn. Sie bevorzugt das Feld, verlangt aber Buschdickichte, Hecken und dergleichen Schutzorte, scheint auch gelegentlich die Tiefe des Waldes aufzusuchen. Im Süden der Vereinigten Staaten ist sie ein Standvogel; im Norden tritt sie im Winter Streifzüge an, die zu förmlichen Wanderungen werden können.
Die Schilderungen der amerikanischen Forscher lassen erkennen, daß die Baumwachtel in ihrer Lebensweise und ihrem Betragen unserm Rebhuhn ähnelt. Der Lauf ist ebenso behend, der Flug wohl noch etwas rascher, die übrigen Begabungen stehen ungefähr auf derselben Höhe, die Stimme aber besitzt mehr Klang und Wechsel als die des Rebhuhnes. Sie besteht aus zwei Lauten, die zuweilen noch durch einen Vorschlag eingeleitet, meist oft nacheinander wiederholt werden und wie »Bobweit« klingen. Diese Laute können leicht nachgeahmt werden und haben der Baumwachtel den volkstümlichen Namen » Bob White« verschafft. Der Ausdruck der Zärtlichkeit ist ein sanft zwitschernder Laut, der Angstruf ein ängstliches Pfeifen.
Die Baumwachtel eignet sich ebenso sehr zur Zähmung wie zur Einbürgerung in solchen Gegenden, die ihre Lebensbedingungen erfüllen. Gefangene und verständig behandelte Baumhühner dieser Art söhnen sich schon nach einigen Tagen mit ihrem Los aus, verlieren bald alle Scheu und gewöhnen sich in überraschend kurzer Zeit an ihre Pfleger. In unsern Tiergärten brüten Baumwachteln am sichersten, wenn man sich möglichst wenig um sie bekümmert. Ihre erstaunliche Fruchtbarkeit ist der Vermehrung überaus günstig. Wollte man bei uns zulande denselben Versuch wagen, den die Engländer bereits ausgeführt haben, es würden fünfzig bis einhundert Paare genügen, um zunächst eine Fasanerie und von dieser aus eine der Vermehrung günstige Gegend mit dem vielversprechenden Wild zu bevölkern.
Die Jagd der zierlichen Hühner, deren Wildbret als vortrefflich gilt, wird von den Amerikanern gern betrieben, obgleich sie nicht so leicht ist wie die auf unser Rebhuhn. Die Baumwachtel läßt sich nicht vom Hund stellen, sondern sucht, wenn sie Gefahr sieht, sich laufend zu retten, und steht erst im äußersten Notfall einzeln, gewöhnlich dicht vor den Füßen des Jägers auf. Noch schwieriger wird die Jagd, wenn ein Volk glücklich den Wald erreicht hat, weil hier alle, die sich erheben, zu bäumen und auf den starken Ästen sich platt niederzudrücken, somit auch dem scharfen Auge zu entziehen pflegen. Dagegen folgen sie der Locke, und derjenige, der den Ruf des einen oder andern Geschlechts nachzuahmen versteht, gewinnt reiche Beute. In Amerika wendet man Netz und Schlinge viel lieber an als das Feuergewehr.
Die Laufhühner ( Turnicidae) kennzeichnen sich durch geringere Größe, gestreckten Leib, mittellangen, dünnen geraden, zusammengedrückten, auf der Firste erhabenen, gegen das Ende leicht gebogenen Schnabel, dessen Nasenlöcher seitlich liegen und zum Teil durch einen kleinen, nackten Hautschild bedeckt werden, langläufige, schwache Füße mit drei, ausnahmsweise auch vier Zehen, mittellange, abgerundete Flügel und kurzen, von den Deckfedern fast gänzlich verdeckten Schwanz.
Das Laufhühnchen, »Torillo« der Spanier ( Turnix sylvatica), gehört zu den größeren Arten seiner Familie. Die Länge des Männchens beträgt fünfzehn, die des merklich größeren und um ein Dritteil schwereren Weibchens neunzehn, die Fittichlänge jenes acht, dieses neun, die Schwanzlänge vier Zentimeter. Beide Geschlechter unterscheiden sich nicht durch die Färbung. Die Federn des Oberkopfes sind dunkelbraun, durch lichtrötliche Ränder und breite, dunkle Schaftstriche gezeichnet, die der Kopfmitte, einen Längsstreifen bildend, grauweißlichfahl, die Mantel- und Schulterfedern auf dunkelbraunem Grunde in der Mitte äußerst fein, aber unregelmäßig gewellt und zickzackförmig hellbraun oder bräunlichgelb quergebändert, seitlich durch breite schwarze Längsstreifen und meist auch durch licht fahlgelbe Ränder gezeichnet, die Federn des Unterrückens und Bürzels sowie die Oberschwanzdeckfedern ganz ähnlich gefärbt und geschmückt, die der Wangen und der Kehle auf gelblichweißem Grund durch schmale, die der ganzen Seiten vom Hals an bis zu den Weichen aus blaß rostgelblichem Grund durch mehr und mehr sich verbreiternde, halbmondförmige schwarze Endflecke geziert, die der Kehle ähnlich geschuppt, die der Kropfmitte einfarbig rostgelb, die der übrigen Unterseite blaß rostisabell, die Unterschwanzdeckfedern ockergelb, die Schwingen- und Schwanzfedern braun, auf der Außenfahne schmal gelblichweiß gesäumt. Das Auge ist licht gelblichbraun, der Schnabel schmutzig fleischfarben an der Wurzel, schwärzlich an der Spitze, der Fuß lichtbraun.
Man darf wohl annehmen, daß wir unser Laufhühnchen Afrika verdanken. Hier, im ganzen Nordwesten, von den Grenzen Ägyptens bis zum Adriatischen Meer und von der Straße von Gibraltar bis zum Senegal, vielleicht noch weiter südlich, ist die wahre Heimat des noch heutigen Tages wenig bekannten Hühnchens zu suchen, und von hier aus wird es sich wahrscheinlich in Spanien und aus Sizilien eingebürgert haben. Weiter nach Norden hin hat man es zwar ebenfalls, jedoch nur als verflogenen Besuchsgast gefunden. So soll es nicht allzu selten in Südfrankreich vorkommen und so einmal in Oxfordshire erlegt worden sein. Südspanien und Portugal bewohnt es vielleicht in größerem Umfang und auch auf Sizilien tritt es, soviel bis jetzt bekannt, in verschiedenen Gegenden auf. über seinen Bestand kommt man nie ins klare; denn es lebt so versteckt und läßt sich so schwer zu Gesicht bringen, daß man so leicht nicht sagen kann, ob es selten oder häufig ist. Man weiß nicht einmal, ob es wandert oder nicht. Zu seinen Wohnsitzen erwählt es sich am liebsten wüste, mit Zwergpalmengestrüpp dicht bedeckte Ländereien, gleichviel ob dieselben unmittelbar an der Seeküste oder tiefer im Lande oder am Gebirge gelegen sind, und diese Wohnplätze entsprechen auch vollständig den Sitten und Gewohnheiten, wie sie in Afrika beobachtet worden find.
Seine Lebensweise schildert am besten Major Loche, der als langjähriger Bewohner Algeriens die meiste Gelegenheit hatte, das Vögelchen zu beobachten. Auch hier bewohnt das Laufhühnchen dicht bebuschte Örtlichkeiten. Jedes Paar lebt nur für sich und vereinigt sich nie mit andern seinesgleichen; wenigstens sieht man es in der Regel allein. Scheu und vorsichtig versucht es, ihm geltenden Nachstellungen immer rechtzeitig zu entrinnen, bedient sich jedoch hierzu im äußersten Notfall seiner Schwingen und läuft so lange, als es vermag, zuletzt einem so gut wie undurchdringlichen Gebüsch zu, in dem es, namentlich wenn es bereits einmal aufgetrieben wurde, so fest liegt, daß es sich eher von der Hand oder einem geschickten Hund ergreifen läßt, als daß es zum zweiten Male fliegend aufstehe. Kerbtiere und Sämereien in annähernd gleicher Menge bilden seine Nahrung. Loche fand in vielen von ihm zergliederten Stücken Sämereien und sonstige Pflanzenstoffe, Überbleibsel von Ameisen und anderer und kleine Kiesel in buntem Durcheinander. Sein Nest legt das Weibchen in einem Grasbüschel oder einem dichten Busch an. Es ist nichts anderes als eine kleine Vertiefung im Boden, die mit trockenem Gras, zuweilen auch gar nicht ausgelegt, immer aber in einem so vortrefflichen Versteck angebracht wird, daß man es nur selten findet. Wie es scheint, brütet das Paar zweimal im Jahre; ältere Weibchen legen, nach Loches Ansicht, zuerst im Mai und das zweitemal im August, jüngere im Juni und beziehentlich im September. Das Gelege besteht aus vier bis fünf Eiern von durchschnittlich vierundzwanzig Millimeter Längs- und achtzehn Millimeter Querdurchmesser, graulich- oder gelblichweißer Grundfärbung und ziemlich dichter blaßpurpurner oder dunkelbrauner Fleckenzeichnung. Beide Geschlechter wechseln im Brüten ab, und wenn das Weibchen getötet wird, übernimmt das Männchen allein die mütterlichen Sorgen. Sobald die Jungen selbständig geworden sind, wandeln sie ihre eigenen Wege, und die Eltern schreiten zur zweiten Brut. Wie die meisten Scharrvögel entlaufen jene dem Nest, nachdem sie trocken geworden sind, und ebenso wie ihre Verwandten werden sie anfänglich mit zärtlichster Sorge von beiden Eltern behütet und durch ein sanftes »Kru« zusammengerufen. Abgesehen von diesem Stimmlaut vernimmt man, namentlich in der Morgen- und Abenddämmerung, einen höchst eigentümlichen, tiefen, dröhnenden Laut, den man mit dem bekannten brüllenden Schrei der Rohrdommel vergleichen kann, nur daß er bei weitem schwächer und leiser ist. An gefangenen beobachtete Loche, daß sie beim Ausstoßen des letzterwähnten Lautes den Bauch ein- und den Kopf zwischen die Schultern ziehen und nunmehr, ohne den Schnabel zu öffnen, nach Art eines Bauchredners jenen Laut ausstoßen.
Gefangene Laufhühnchen, die zuweilen, obwohl recht selten, auch in unsere Käfige gelangen, dauern bei einigermaßen entsprechender Pflege vortrefflich im Käfig aus und schreiten in ihm, wie Loche erfuhr, selbst zur Fortpflanzung.
*
In der vierten Familie vereinigen wir die Fasanvögel ( Phasianidae). Auch bei ihnen ist der Leib noch gedrungen, aber doch gestreckter gebaut als bei den Waldhühnern. Ihr Schwanz ist gewöhnlich lang und breit, der Kopf teilweise nackt, oft mit Kämmen und Hautlappen, zuweilen auch mit Hörnern und ebenso mit Federbüschen geziert, das Gefieder farbenprächtig und glänzend, nach Geschlecht und Alter regelmäßig verschieden.
Alle Arten bewohnen bewaldete, mindestens bebuschte Gelände, in denen sie Deckung finden, die einen aber hohe Gebirge, die andern das Tiefland. Sie sind Standvögel, die das einmal gewählte Gebiet nicht verlassen, bei der Wahl aber bedachtsam zu Werke gehen. Alle haben das Bestreben, nach der Brutzeit einigermaßen im Lande umherzuschweifen und dabei Örtlichkeiten zu besuchen, auf denen man sie sonst nicht findet. Wirkliches Reisen verbietet ihnen die Mangelhaftigkeit ihrer Bewegungswerkzeuge. Sie gehen gut und können, wenn sie wollen, im schnellen Laufe fast mit jedem andern Huhne wetteifern, fliegen aber schlecht und erheben sich deshalb auch nur im äußersten Notfall. Leibliche Anstrengung scheint sie nicht zu vergnügen; selbst während der Paarungszeit benehmen sie sich ruhiger als andere Hühner. Gewöhnlich gehen sie gemächlich und bedachtsam einher, den Hals eingezogen oder geneigt, den schönen Schwanz, ihre hauptsächlichste Zierde, soweit erhoben, daß die Mittelfedern eben nicht auf die Erde schleifen; bei rascherem Lauf beugen sie den Kopf zum Boden herab und heben den Schwanz ein wenig mehr empor, nehmen auch im Notfall die Flügel mit zu Hilfe. Der Flug erfordert schwere Flügelschläge und bringt deshalb, namentlich beim Aufstehen, polterndes Rauschen hervor; hat jedoch der Fasanvogel erst eine gewisse Höhe erreicht, so flattert er wenig, sondern schießt mit ausgebreiteten Flügeln und Schwanz in einer schiefen Ebene abwärts rasch dahin. Im Gezweige höherer Bäume pflegt er sich aufrecht zu stellen oder mit gänzlich eingeknickten Beinen förmlich auf den Ast zu legen und das lange Spiel fast senkrecht herabhängen zu lassen. Die Sinne sind wohl entwickelt. Unter sich leben die Fasanen, solange die Liebe nicht ins Spiel kommt, in Frieden, Paarungslust aber erregt den männlichen Teil der Gesellschaften ebenso wie andere Hähne auch und verursacht Kämpfe der allerernstesten Art.
Bis gegen die Paarungszeit hin verbergen sich unsere Vögel soviel wie möglich. Sie bäumen, ungestört, nur kurz vor dem Schlafengehen und halten sich während des ganzen übrigen Tages am Boden auf, zwischen Gebüsch und Gras ihre Nahrung suchend, offene Stellen fast ängstlich meidend, von einem Versteck zum andern schleichend. Größere Gesellschaften bilden sich nicht, und wenn wirklich einmal solche zusammenkommen, so bleiben sie in der Regel nur kurze Zeit beieinander. Außer der Brutzeit ist das Aussuchen der Nahrung ihre größte Sorge. Sie fressen vom Morgen bis zum Abend und ruhen höchstens während der Mittagsstunden, wenn irgend möglich in einer staubigen Mulde und unter dem reinigenden Staub halb vergraben, von ihrem Tagewerk aus. Am frühen Morgen und gegen Abend sind sie besonders rege und zum Umherschweifen geneigt; mit Sonnenuntergang begeben sie sich zur Ruhe. Ihre Äsung besteht in Pflanzenstoffen der verschiedensten Art, vom Kern bis zur Beere und von der Knospe bis zum entfalteten Blatte; nebenbei verzehren sie Kerbtiere in allen Lebenszuständen, Schnecken, Weichtiere, auch wohl kleine Wirbeltiere und dergleichen, stellen insbesondere jungen Fröschen, Echsen und Schlangen nach.
Ein Hahn sammelt, wenn andere es ihm gestatten, fünf bis zehn Hennen um sich. An Eifersucht steht er hinter andern Hähnen durchaus nicht zurück, kämpft auch mit Nebenbuhlern äußerst mutig und wacker, gibt sich aber keineswegs besondere Mühe, um die Gunst der Henne sich zu erwerben. Wohl tritt auch er auf die Balz und bewegt sich während derselben weit lebhafter als gewöhnlich; niemals aber gerät er in jene verliebte Raserei, die die männlichen Waldhühner so anziehend erscheinen läßt. Er umgeht die Hennen in verschiedenen Stellungen, breitet die Flügel, erhebt Federholle, Federohren und Kragen auf, ebenso den Schwanz etwas mehr als gewöhnlich, bläht dehnbare Hautlappen auf, läßt sich auch wohl herbei, einige tanzartige Bewegungen auszuführen, und kräht oder pfeift unter wiederholtem Zusammenschlagen seiner Flügel. Sofort nach geschehener Begattung bekümmert er sich nicht mehr um die Hennen, die er überhaupt weniger sucht als sie ihn, sondern streift nach Belieben im Walde umher, gesellt sich vielleicht auch zu andern Hähnen, kämpft anfänglich noch ein wenig mit dem einen oder dem andern, lebt jedoch, wenn die männliche Gesellschaft anwächst, mit den Teilnehmern derselben in Frieden. Die Henne sucht ein stilles Plätzchen, scharrt hier eine Vertiefung aus, belegt sie nachlässig mit Geniste und Blätterwerk und beginnt zu brüten, sowie sie ihre sechs bis zehn, vielleicht auch zwölf Eier gelegt hat. Die Küchlein sind hübsch gezeichnet, behend und gewandt, wachsen rasch heran, lernen in der zweiten Woche ihres Lebens flattern, bäumen in der dritten und mausern nach Ablauf von zwei bis drei Monaten, bleiben jedoch bis gegen den Herbst hin unter der Obhut der Alten.
Die Feinde der Fasanenvögel sind dieselben, die auch andere Wildhühner bedrohen. Der Mensch verfolgt, des trefflichen Wildbrets halber, alle Arten der Familie, Raubtiere der drei oberen Klassen stellen ihnen nicht minder eifrig nach, und Naturereignisse werden wenigstens vielen von ihnen verderblich. Doch gleicht ihre starke Vermehrung unter günstigen Verhältnissen alle Verluste, die ihr Bestand erleidet, bald wieder aus.
*
Als erste der Unterfamilien, in der auch diese Gruppe zerfällt, pflegt man die Prachthühner ( Lophophorinae) anzusehen. Sie unterscheiden sich von den übrigen Familienangehörigen hauptsächlich durch kurzen, sanft gerundeten Schwanz, dessen Federn nicht dachartig gestellt sind, sondern in einer Ebene liegen.
Hoch oben in den Waldungen des Himalaja von den Vorbergen an, die gegen Afghanistan abfallen, bis nach Sikim und Butan, dem äußersten Osten des Gebirges hin, bewohnt die zwischen zwei- bis dreitausend Meter über dem Meer liegenden Höhen ein prachtvolles Huhn, vielleicht der schönste aller Scharrvögel, das Glanzhuhn, von den Bewohnern des Himalaja Monaul, von den Forschern gewöhnlich Glanzfasan genannt ( Lophophorus impeyanus).
Von der Farbenpracht des Monaul ist schwer eine Beschreibung zu geben. Der Kopf, einschließlich des wie aus goldenen Ähren zusammengesetzten Busches und die Kehle sind metallischgrün, der Oberhals und Nacken schimmernd purpur- oder karminrot, mit Rubinglanz, der Unterhals und Rücken bronzegrün, goldglänzend, der Mantel und die Flügeldeckfedern, der Oberrücken und die Oberschwanzdeckfedern violett- oder bläulichgrün, ebenso glänzend wie das übrige Gefieder, einige Federn des Unterrückens weiß, die Unterteile schwarz, auf der Brustmitte grün und purpurn schimmernd, auf dem Bauch dunkel und glanzlos, die Schwingen schwarz, die Steuerfedern zimmetrot. Das Auge ist braun, die nackte Stelle um dasselbe bläulich, der Schnabel dunkel hornfarben, der Fuß düster graugrün. Beim Weibchen sind Kehle und Gurgelgegend weiß, alle übrigen Federn auf blaß gelbbraunem Grund dunkelbraun gefleckt, gewellt und gebändert, die Handschwingen schwärzlich, die Armschwingen und die Steuerfedern schwarz und braungelb gebändert. Die Länge des Hahnes beträgt fünfundsechzig, die Breite fünfundachtzig, die Fittichlänge dreißig, die Schwanzlänge einundzwanzig Zentimeter. Die Henne ist merklich kleiner.
Über das Freileben des Monaul, dessen Verbreitungsgebiet über den ganzen südlichen Himalaja und Kaschmir sich erstreckt, haben wir einen ausführlichen Bericht durch Mountaineer erhalten. »Von dem ersten höheren Kamm über den Ebenen bis zur Waldgrenze hinauf bemerkt man den Monaul in jeder Höhe, und inmitten des Gebirges ist er einer der häufigsten Jagdvögel. Während des Sommers begegnet man ihm selten, weil die üppig grünenden Schlingpflanzen dann dem Auge das Innere des Waldes verschließen; dagegen gewahrt man ihn um diese Zeit in ziemlicher Anzahl in der Nähe der Schneefelder, namentlich morgens und abends, wenn er hier erscheint, um zu äsen. Doch würde niemand imstande sein, von denjenigen, die er sieht, auf die Anzahl der wirklich vorhandenen zu schließen. Wenn die kalte Jahreszeit heranrückt, die Rankengewächse und die den Boden bedeckenden Pflanzen verdorren, scheint der Wald von ihnen erfüllt zu sein. Sie schlagen sich jetzt in Ketten zusammen, und in mancher Gegend kann man mehr als hundert im Laufe eines Tages aufjagen. Im Sommer steigen fast alle Männchen und einige Weibchen im Gebirge empor; im Herbst wählt alt und jung diejenigen Stellen des Waldes, wo der Boden dick mit abgefallenem Laub bedeckt ist, weil jetzt hier die meisten Larven und Maden gefunden werden. Je mehr der Winter herannaht und das Gebirge mit Schnee bedeckt, um so mehr ziehen sie sich nach unten hinab. In strengen Wintern und bei tiefem Schnee vereinigen sie sich in Waldungen auf südlichen Gehängen des Gebirges, wo der Schnee noch am ersten schmilzt, kommen selbst bis ins Hügelland herab, wo der Schnee nicht so tief liegt oder bald wegtaut und wo sie imstande sind, unter Büschen oder beschirmten Stellen sich bis zum Boden durchzuarbeiten. Weibchen und Junge verweilen dann gern in der Nachbarschaft von Walddörfern und werden oft haufenweise in den Feldern gesehen; doch bleiben auch viele, aber wohl nur alte, Männchen selbst während des kältesten Wetters, wenn ein Schneefall nach dem andern den Boden dick belegt hat, in den höheren Waldungen zurück. Im Frühling ziehen alle, die ins Tal herabgedrückt wurden, allmählich, sowie der Schnee schmilzt, wieder nach oben.
Den Lockruf, jenes laut klagende Pfeifen, hört man im Walde zwar zu allen Stunden des Tages, am häufigsten aber doch vor Tagesanbruch und gegen Abend. In der kalten Jahreszeit tönt der Wald wieder von dem Geschrei der jetzt zahlreich Versammelten, insbesondere kurz bevor sie sich auf einzelne hohe Bäume oder auch wohl Felszacken zum Schlafen aufsetzen wollen.
Der Monaul nährt sich von Wurzeln, Blättern, jungen Schößlingen, verschiedenen Grasarten und Kräutern, Beeren, Nüssen und andern Sämereien, aber auch von Kerbtieren aller Art. Im Herbst sucht er letztere unter den abgefallenen Blättern zusammen; im Winter äst er oft in den Weizen- und Gerstenfeldern. Er beschäftigt sich, seinen hierzu besonders geeigneten Schnabel angemessen verwendend, jederzeit eifrig, nicht selten mehrere Stunden nacheinander, mit Graben. In den höhergelegenen Wäldern sieht man zuweilen auf Blößen oder offenen Stellen, die frei von Unterholz sind, Massen von Monauls in voller Arbeit.
Die Brutzeit beginnt bald nach Eintritt des Frühjahrs. Die Henne bereitet ihr Nest unter einem kleinen, deckenden Busch oder einem Grasbüschel und legt fünf Eier, die auf düsterweißem Grunde mit rötlichbraunen Punkten und Flecken getüpfelt sind. Die Küchlein entschlüpfen Ende Mai diesen Eiern.«
Manche Jäger achten das Wildbret des Monaul dem Fleisch des Truthahns an Güte gleich, andere behaupten, daß es kaum eßbar wäre; Mountaineer versichert, daß namentlich Weibchen und Junge im Herbst und Winter einen ausgezeichneten Braten liefern, während das Wildbret gegen Ende des Winters an Güte verliert. Entsprechend der Jahreszeit bietet die Jagd größere oder geringere Schwierigkeiten; bei der Häufigkeit dieses prachtvollen Wildes erzielt der geschickte Jäger aber doch regelmäßig reiche Beute.
Es ist leicht, alt gefangene Monauls im Käfig zu erhalten; demungeachtet zählt der prachtvolle Vogel in unsern Tiergärten noch zu den Seltenheiten. In Indien kann man geeigneten Ortes so viele gefangene Glanzhühner erhalten, wie man will; die Kinder der luftigen Höhe vertragen aber die Hitze der Tiefe nicht, und die meisten sterben während der Reise. Lady Impey brachte die ersten lebenden Monauls nach England und ließ es sich viel Mühe und Geld genug kosten, sie hier einzubürgern. Sie führen auch in der Gefangenschaft ein möglichst verstecktes Leben, verbergen sich gern vor dem Beobachter, zeigen sich immer etwas ängstlich, graben beständig, bearbeiten die Rasenplätze in ihrem Käfig ohne Unterlaß und verunstalten sehr bald ihr Gebauer. Den Winter überstehen sie ebenso leicht wie unsere Fasanen. In dem Tierpark des Lord Derby gelang es zuerst, gefangene Glanzhühner zur Fortpflanzung zu bringen; später haben solche in den Tiergärten zu London, Antwerpen, Köln und Berlin gebrütet. Da man den Gefangenen hier die Eier wegnimmt, um diese von Haushennen ausbrüten zu lassen, erzielt man in der Regel zehn bis vierzehn Eier von einem Paar, selten aber mehr als fünf bis sieben Junge. Die Küchlein ähneln denen anderer Hühner in Gestalt und Färbung, lassen sich aber an ihrer bedeutenden Größe leicht erkennen. Ihr Daunenkleid ist auf dunkelbraunem Grunde lichter gestreift und dunkel gemarmelt; die Unterseite pflegt einfarbig gelblichweiß zu sein. Sie wachsen rasch heran, sind aber zart, und viele gehen während der letzten Mauser zugrunde.
*
Eine zweite Unterfamilie bildet man aus den Kammhühnern ( Gallinae), denen wir unser Haushuhn verdanken. Indien und die malaiischen Länder sind die Heimat dieser Hühner. Sie bewohnen den Wald und führen, obgleich sie sich durch ihre Stimme sehr bemerklich zu machen wissen, ein verstecktes Leben.
Die berechtigtste Anwartschaft auf die Ehre, Stammart unseres Haushuhnes zu sein, gebührt dem Bankivahuhn oder Kasintu der Malaien ( Gallus ferrugineus). Kopf, Hals und die langen, herabhängenden Nackenfedern des Hahnes schimmern goldgelb; die Rückenfedern sind purpurbraun, in der Mitte glänzend orangerot, gelbbraun gesäumt; die ebenfalls verlängerten, herabhängenden Oberdeckfedern des Schwanzes ähneln in der Färbung denen des Kragens; die mittleren Deckfedern der Flügel sind lebhaft kastanienbraun; die großen schillern schwarzgrün, die dunkelschwarzen Brustfedern goldgrün; die Handschwingen sind dunkelschwarzgrau, blasser gesäumt, die Armschwingen auf der Außenfahne rostfarben, auf der inneren schwarz, die Schwanzfedern ebenfalls schwarz, die mittleren schillernd, die übrigen glanzlos. Das Auge ist orangerot, der Kopfschmuck rot, der Schnabel bräunlich, der Fuß schieferschwarz. Die Länge beträgt fünfundsechzig, die Fittichlänge zweiundzwanzig, die Schwanzlänge siebenundzwanzig Zentimeter. Bei der kleineren Henne steht der Schwanz mehr wagerecht, Kamm und Fleischlappen sind eben nur angedeutet, die länglichen Halsfedern schwarz, weißgelblich gesäumt, die des Mantels braunschwarz gesprenkelt, die der Unterteile isabellfarben, Schwingen und Steuerfedern braunschwarz.
Der Verbreitungskreis des Bankivahuhnes umfaßt ganz Indien und die malaiischen Länder. Über seine und aller übrigen Wildhühner Lebensweise liegen auffallenderweise nur dürftige Mitteilungen vor; es mag auch schwierig sein, sie zu beobachten. Der von ihnen bewohnte Wald legt dem Forscher wie dem Jäger oft unüberwindliche Hindernisse in den Weg. Sie halten sich gern in der Nähe der Wege auf, weil sie hier in dem Kot der Herdentiere oder Pferde reichliche Nahrung finden; auch treiben die Hunde, wenn sie seitab von den Wegen umherlaufen, viele von ihnen zu Baum; man sieht sie auf den Feldern, die in der Nähe der Wälder liegen und von ihnen gern besucht werden, oder beobachtet sie endlich gelegentlich der Jagden, zu denen sie Veranlassung geben. Trotzdem bekommt man sie, so häufig man die Hähne auch hört, nur selten zu sehen. Am leichtesten glückt dies noch am frühen Morgen, weil sie alsdann, wenn sie sich sicher glauben, die Dickichte verlassen und an offenen Plätzen ihre Nahrung suchen, die in mancherlei Sämereien und Knospen, ganz besonders aber in Kerbtieren besteht. Sehr gern fressen sie Termiten und suchen dieselben daher häufig auf.
Von dem Haushuhn unterscheiden sich die Wildhühner hauptsächlich durch ihre Stimme. Das Krähen klingt laut Tennent wie »George-Joye«, es ist nach Bernstei zweisilbig und tönt heiser wie »Kükrüü, kukrü«, ist alles in allem ein höchst sonderbarer, gebrochener Laut, eine unvollständige, aber unbeschreibliche Art von Krähen. »Es ist sehr unterhaltend«, sagt v. Möckern, »frühmorgens die vielen Hähne krähen zu hören, ihre stolzen Spaziergänge und ihre Gefechte anzusehen, während die Hennen mit ihren Küchlein zwischen Bäumen und Gebüschen umherschweifen.« Auch Tennent rühmt, daß ein Morgen auf den Waldbergen Ceylons durch das noch in der Nacht beginnende und lange fortwährende Krähen des Dschungelhahns einen Hauptreiz erhalte.
Über die Fortpflanzung liegen mehrere Berichte vor. »Die Bankivahenne«, sagt Jerdon, »brütet vom Juni an bis zum Juli, je nach der Örtlichkeit, und legt acht bis zwölf Eier von milchweißer Färbung oft unter einen Bambusstrauch oder in ein dichtes Gebüsch, nachdem sie vorher vielleicht auch einige abgefallene Blätter oder etwas trockenes Gras zusammengescharrt und daraus ein rohes Nest bereitet hatte.« Der Hahn bekümmert sich nicht um die Aufzucht der Jungen; die Henne aber bemuttert diese mit derselben Zärtlichkeit, wie unsere Haushenne die ihrigen. Jerdon versichert auf das bestimmteste, daß Vermischungen der nebeneinander wohnenden Hühnerarten nicht selten vorkommen und unterstützt dadurch die Vermutung, daß mehrere der als Arten beschriebenen Wildhühner nur als Blendlinge angesehen werden müssen.
Die Wildhühner werden wenig gejagt, weil ihr Wildbret, das sich vom Fleisch des zahmen Huhnes dadurch unterscheidet, daß es bis auf den weißen Schenkelmuskel braun aussieht, nicht besonders schmackhaft sein soll. Dieser Angabe widerspricht Jerdon, der versichert, daß das Wildbret junger Vögel den köstlichsten Wildgeschmack habe. Dieser Forscher rühmt auch die Jagd als höchst unterhaltend und sagt, daß sie hauptsächlich da, wo einzelne Dschungeldickichte zwischen Feldern liegen, sehr ergiebig ist.
Alle Wildhühner lassen sich zähmen, gewöhnen sich aber keineswegs so rasch an die Gefangenschaft, wie man vielleicht annehmen möchte. »Altgefangene«, sagt Bernstein, »werden nie zahm, und selbst wenn man die Eier durch Haushühner ausbrüten läßt, sollen die Jungen, sobald sie erwachsen sind, bei der ersten Gelegenheit sich wieder wegmachen. Ob sie sich in Gefangenschaft fortpflanzen oder mit Haushühnern paaren, kann ich aus eigener Erfahrung nicht mitteilen; man hat mir jedoch von verschiedener Seite versichert, daß jung aufgezogene wiederholt Eier gelegt haben.« In unsern Tiergärten pflanzen sich zwar alle Arten fort; niemals aber darf man mit Bestimmtheit darauf rechnen. Es muß uns daher rätselhaft bleiben, wie es der Mensch anfing, die freiheitliebenden Wildhühner zu vollendeten Sklaven zu wandeln. Keine Geschichte, keine Sage gibt uns über die Zeit der ersten Zähmung Kunde. Schon die ältesten Schriften erwähnen das Haushuhn als einen niemand mehr auffallenden Vogel. Von Indien aus wurde es über alle Teile der östlichen Erde verbreitet. Die ersten Seefahrer, die die Inseln des Stillen Meeres besuchten, fanden es hier bereits vor; in geschichtlicher Zeit wurde es nur in Amerika eingeführt. Besonders beachtenswert scheint mir zu sein, daß es nirgends verwilderte. Man hat versucht, es in geeigneten Gegenden einzubürgern, d.+h. Waldungen mit ihm zu bevölkern, um in ihm ein Wild zu gewinnen; die Versuche sind jedoch regelmäßig fehlgeschlagen. In den Steppendörfern Innerafrikas und selbst um die mitten im Walde gelegenen Hütten lebt das Haushuhn massenhaft, fast ohne Pflege der Menschen, muß sich sein Futter selbst suchen, brütet unter einem ihm passend scheinenden Busch oft in einiger Entfernung von der Hütte seines Besitzers, schläft nachts im Walde auf Bäumen; aber nirgends habe ich es verwildert gesehen. Die verschiedensten Umstände erträgt es mit bewunderungswürdiger Fügsamkeit. Unter einem ihm eigentlich fremden Klima behält es sein Wesen bei, und nur in sehr hohen Gebirgen oder im äußersten Norden soll es an Fruchtbarkeit verlieren; da aber, wo der Mensch sich seßhaft gemacht hat, kommt es wenigstens fort; es ist eben zum vollständigen Haustier geworden. Auf dieses einzugehen, kann ich mir wohl versagen.
*
Die nächsten Verwandten der Hühner sind die Fasanen ( Phasianinae). Ihr Leib ist schlank, der Hals kurz, der Kopf klein, der Schnabel etwas gestreckt, stark gewölbt, schwach, aber hakig, der Fuß mittelhoch und kräftig, glatt, beim Männchen mit einem nicht besonders großen Sporn bewehrt, der Flügel sehr kurz und stark gerundet, der Schwanz lang oder sehr lang. Das Gefieder bekleidet, mit Ausnahme der nackten Wangen und Fußwurzeln, den ganzen Körper. Die Weibchen sind kleiner als die Männchen, namentlich bedeutend kurzschwänziger; die Färbung ihres Gefieders ist einfacher und unscheinbarer.
Der Silberfasan ( Gennaeus nycthemerus) gilt als Vertreter einer besonderen, ihm gleichnamigen Sippe ( Gennaeus). Er hat einen langen, aus zerschlissenen Federn bestehenden, hängenden Kopfbusch und keilförmig verlängerten, dachartigen Schwanz, dessen mittlere Federn sich nicht mehr seitlich hinausbiegen und nur noch seicht herabkrümmen. Der lange und dicke Farbenbusch am Hinterkopf ist glänzend schwarz, der Nacken und der Vorderteil des Oberhalses weiß, die ganze übrige Oberseite weiß, mit schmalen, schwarzen Zickzacklinien quer gewellt, die Unterseite schwarz, stahlblau schimmernd; die Schwingen sind weiß, sehr schmal schwarz quer gesäumt und miteinander gleichlaufenden, breiten Querstreifen gezeichnet, die Schwanzfedern auf weißem Grunde ähnlich gebändert, je weiter nach außen hin, um so dichter und deutlicher, die nackten Wangen schön scharlachrot. Das Auge ist hellbraun, der Schnabel bläulichweiß, der Fuß lack- oder korallrot. Die Länge beträgt einhundertzehn, die Fittichlänge sechsunddreißig, die Schwanzlänge siebenundsechzig Zentimeter. Das Gefieder des bedeutend kleineren Weibchens zeigt auf rostbraungrauem Grunde eine sehr seine graue Sprenkelung; Kinn und Wange sind weißgrau, Unterbrust und Bauch weißlich, rostbraun gefleckt und schwarz in die Quere gebändert, die Handschwingen schwärzlich, die Armschwingen der Rückenfärbung entsprechend, die äußeren Schwanzfedern mit schwarzen Wellenlinien gezeichnet.
Wir kennen die Zeit nicht, in der die ersten lebenden Silberfasanen nach Europa gelangten, dürfen aber annehmen, daß es nicht vor dem siebzehnten Jahrhundert geschehen ist, da die Schriftsteller des sechzehnten Jahrhunderts, Geßner z.+B., den so schönen und auffallenden Vogel nicht erwähnen. Seine Heimat ist Südchina, nach Norden hin bis Fukien und Tschekiang; er lebt gegenwärtig jedoch nur noch in wenigen Gegenden, wird dagegen in ganz China und in Japan sehr häufig zahm gehalten. In Europa gedeiht er bei einfacher Pflege ausgezeichnet, und zwar im Freien ebensogut wie auf dem Hof oder in einem größeren Gebauer. Daß er noch nicht in unseren Waldungen ausgesetzt worden ist, hat seine guten Gründe. Versucht wurde eine solche Einbürgerung, der Erfolg war aber ungünstig. Das Männchen macht sich wegen seiner weißen Oberseite so bemerklich, daß es dem Raubzeug mehr ausgesetzt ist als jeder andere Vogel seiner Größe. Aber das ist nicht das einzige Hindernis; ein zweites verursacht der Fasan selber. Unter allen Verwandten ist er der mutigste und rauflustigste. Zwei Männchen, die ein und dasselbe Gebiet bewohnen, liegen miteinander in beständigem Streit; der Silberfasan sucht seine Herrschaft jedoch auch andern Tieren gegenüber fühlbar zu machen, kämpft mit dem Haushahn auf das äußerste und vertreibt, wenn er im Walde frei umherschweifen kann, jedes andere Wildhuhn, das hier lebt, zunächst natürlich den gemeinen oder Edelfasan. Und da nun der letztere doch immer noch mehr Nutzen gewährt als er, zieht man es vor, nur jenen zu pflegen.
Hinsichtlich seiner Bewegungsfähigkeit und Beweglichkeit steht der Silberfasan hinter andern Verwandten zurück. Man ist versucht, ihn einen faulen Vogel zu nennen. Zum Fliegen entschließt er sich nur im Notfall, und wenn er wirklich aufstand, streicht er höchstens eine kurze Strecke weit dahin und fällt dann sofort wieder auf den Boden herab. Im Laufen fehlt ihm zwar die Gewandtheit und Behendigkeit des Goldfasans; er steht auch an Schnelligkeit vielleicht hinter dem Edelfasan zurück, übertrifft aber beide durch die Ausdauer dieser Bewegungen. Die Stimme ist nach der Jahreszeit verschieden. Im Frühling, während der Paarung, vernimmt man am häufigsten ein langgedehntes, klangvolles Pfeifen, außerdem meist nur ein dumpfes, gackerndes »Radara Dukdukduk«, dem erst, wenn der Vogel in Aufregung gerät, das Pfeifen angehängt wird. In seiner Bewerbung um die Gunst des Weibchens zeigt er sich noch nachlässiger als seine Verwandten. Er ist allerdings auch sehr aufgeregt und im höchsten Grade kampflustig, läßt seinen Mut unter anderm auch an Menschen aus, indem er letztere wütend anfällt und mit Schnabelhieben und Sporenstößen zu vertreiben sucht; dem Weibchen gegenüber aber gebärdet er sich keineswegs auffallend. Gewöhnlich hebt er nur die Haube, wenn er seine Liebesgefühle ausdrücken will; zu einem Senken des Kopfes, Breiten der Flügel und Spreizen des Schwanzes kommt es schon seltener.
Die Henne legt zehn bis achtzehn Eier, die entweder gleichmäßig rotgelb von Farbe oder auf weißlichgelbem Grunde mit kleinen bräunlichen Punkten gezeichnet sind. Wenn man ihr die Eier läßt, brütet sie selbst, und zwar mit großer Hingebung. Nach fünfundzwanzig Tagen schlüpfen die Küchlein aus, kleine, allerliebste Geschöpfe, die das höchst ansprechend gezeichnete Daunengefieder vortrefflich kleidet. Sie wachsen ziemlich rasch so weit heran, daß sie fliegen oder wenigstens flattern können, erlangen aber erst im zweiten Lebensjahr die volle Größe und die Tracht ihrer Eltern. In der frühesten Jugend bevorzugen auch sie Kerbtiernahrung; später halten sie sich hauptsächlich an Grünes der verschiedensten Art; schließlich verzehren sie härtere Fruchtstoffe, namentlich Körner und Getreide. Kohl, Salat, Obst sind Leckerbissen.
Das Wildbret ist ebenso wohlschmeckend wie das eines jeden andern Fasans, erreicht seinen Hochgeschmack aber nur dann, wenn man dem Vogel größere Freiheit gewährt und ihm wenigstens gestattet, sich im Hof und Garten umherzutreiben.
*
Als Kennzeichen der Edelfasanen ( Phasianus) gelten: dachförmiger, langer Schwanz, dessen Mittelfedern die äußersten um das sechs- oder achtfache überragen und dessen verlängerte Oberdeckfedern entweder abgerundet oder zerschlissen sind, und anstatt einer Kopfhaube verlängerte Ohrfedern, die, aufgerichtet, zwei kleine Hörnchen bilden. Im übrigen ähneln die hierher zu zählenden Mitglieder der Familie dem Silberfasan. Das Kleid des Männchens prangt in sehr schönen, oft in prächtig schimmernden Farben, das des Weibchens ist auf düsterfarbigem Grunde dunkler gefleckt, gewellt und gestrichelt.

Edelfasan ( Phasanis Colchicus)
Der Edelfasan ( Phasianus colchicus oder marginatus) ist so buntfarben, daß ich verzichten muß, eine genaue Beschreibung seines Kleides zu geben. Die Federn des Kopfes und Oberhalses sind grün, mit prächtig blauem Metallglanz, die des Unterhalses, der Brust, des Bauches und der Seiten rötlich kastanienbraun, purpurfarben schimmernd, alle schwarzglänzend gesäumt, die des Mantels vor dem Saume durch weiße Halbmondflecken geziert, die langen, zerschlissenen Bürzelfedern dunkel kupferrot, purpurfarben glänzend, die Schwingen braun und rostgelb gebändert, die Schwanzfedern auf olivengrauem Grunde schwarz gebändert und kastanienbraun gesäumt. Das Auge ist rostgelb, das nackte Augenfeld rot, der Schnabel hell bräunlichgelb, der Fuß rötlichgrau oder bleifarben. Die Länge beträgt achtzig, die Breite fünfundsiebzig, die Fittichlänge fünfundzwanzig, die Schwanzlänge vierzig Zentimeter. Beim kleineren Weibchen ist das ganze Gefieder auf erdgrauem Grunde schwarz und dunkel rostfarben gefleckt und gebändert. Auf dem Rücken tritt die dunkle Färbung besonders hervor.
Unter den übrigen Arten verdient der Königsfasan, wie ich ihn genannt habe, ( Phasianus reversii) erwähnt zu werden. Er ist der größte aller Fasane, seine Länge beträgt 2,1, die Schwanzlänge 1,6 Meter. Der Scheitel, die Ohrfedern und ein breites Halsband sind reinweiß, die Kopfseiten und ein vorn sich verbreiterndes Brustband schwarz, die Federn des Mantels, Bürzels und der Oberbrust goldgelb, schwarz gesäumt, die der Unterbrust und Seiten auf dem weißgrauen Mittelfelde mit einem herzförmigen, schmalen, schwarzen Bande geziert und außen breit rostrot gesäumt, die des Bauches braunschwarz, die Oberflügeldeckfedern schwarzbraun, lichter gerandet und diese Ränder rotbraun gesäumt, die Schwingen goldgelb und braunschwarz, die Steuerfedern auf silbergrauem Grunde mit roten, schwarz umsäumten Flecken gebändert und außerdem breit goldgelb gesäumt. Das Auge ist rötlich, der Schnabel wie der Fuß horngelb.
Der Edelfasan bewohnte ursprünglich die Küstenländer des Kaspischen Meeres und Westasien, wurde aber schon in altersgrauer Zeit in Europa eingebürgert. Am Phasis, im Lande Kolchis, fanden die Griechen, die den Argonautenzug unternahmen, den prachtvollen Vogel und führten ihn mit sich in ihr Vaterland. Von hier aus soll er sich über Südeuropa verbreitet haben, oder richtiger, verbreitet und durch die Römer, die sein köstliches Wildbret zu schätzen wußten, auch nach Südfrankreich und Deutschland gebracht worden sein. Im Süden unseres Vaterlandes, namentlich in Österreich und Böhmen, lebt er in einem Zustande vollkommener Wildheit, im Norden Deutschlands unter Obhut des Menschen in sogenannten wilden oder zahmen Fasanerien. Er ist sehr häufig in Ungarn und Südrußland, seltener schon in Italien, sehr selten in Spanien, geht auch in Griechenland, wo er früher gemein war, seiner Ausrottung entgegen. Die Heimatgebiete des Königsfasans dagegen sind die östlich und nördlich von Peking gelegenen Gebirge, ebenso auch die Züge, die Schensi von Honan und Hupe von Setschuan trennen.
Alle Fasanen meiden geschlossenen Hochwald und bevorzugen dagegen Haine oder dichte Gebüsche, die von fruchtbaren Feldern oder Wiesen umgeben werden und nicht arm an Wasser sind. In Livadien und Rumelien überwuchert, wie Graf von der Mühle berichtet, weite Strecken des besten, jetzt aber versumpften Bodens üppiges Gesträuch, namentlich Farnkraut, zwischen dem sich Brombeeren und andere Schlingpflanzen eingefunden und das Ganze so durchwebt und überrankt haben, daß ein Hund fast gar nicht, ein Mensch nur dann durchkommen kann, wenn er über das Gestrüpp hinwegschreitet. Solche Gegenden sind äußerst beliebte Aufenthaltsorte der Edelfasanen. Den Nadelwald meiden sie. Fruchttragende Getreidefelder scheinen zu ihrem Bestehen zwar nicht unumgänglich notwendig, ihnen aber doch sehr erwünscht zu sein. Während des ganzen Tages treiben sie sich aus dem Boden umher, schleichen von einem Busch zum andern, durchkriechen nahrungversprechende Dornhecken, begeben sich auch wohl an die Ränder der Wälder und von diesen aus auf die Felder, um hier, je nach der Jahreszeit, frische Saat oder gereifte Frucht zu äsen, und suchen erst mit Einbruch des Abends einen geeigneten Baum zum Schlafen auf. In Strauchwildnissen übernachten sie einfach auf einem niedergetretenen Binsenstrauch oder einem Dornenbusch.
Die Begabung der Fasanen ist gering. Der Hahn schreitet allerdings stattlich einher und versteht es, seine Schönheit im vorteilhaftesten Licht zu zeigen, kann sich aber doch mit dem Haushahn nicht messen. Die Henne scheint anspruchslos zu sein; ihre Haltung ist stets eine bescheidene. Hinsichtlich der Bewegung gilt das weiter oben Gesagte gerade für diese Gruppe in vollem Umfange: der Lauf ist vorzüglich und der Flug schlecht. Die Sinne scheinen ziemlich gleichmäßig entwickelt zu sein; der Verstand aber ist gewiß schwach. Alle echten Fasanen sind gleich beschränkt, gleich unfähig, zu rechter Zeit den rechten Entschluß zu fassen. Unter ihren rühmenswerten Eigenschaften steht die unbegrenzte Freiheitsliebe obenan. Der Fasan gewöhnt sich an eine bestimmte Örtlichkeit, falls dieselbe seinen Wünschen entspricht, liebt es aber, beständig umherzuschweifen. Im Bewußtsein seiner Schwäche und im Gefühl der Unfähigkeit, sich gegen stärkere Tiere zu verteidigen, versteckt er sich soviel wie möglich, entzieht sich deshalb auch gern dem Auge seines Pflegers. Es ist also keineswegs Undankbarkeit gegen alle auf seine Erziehung und Unterhaltung verwandte Sorgfalt, wie Winkell meint, die ihn zu solchem Betragen veranlaßt, sondern einzig und allein Unlust, einen bestimmten Stand zu behaupten, Störrigkeit und Beschränktheit. Der Fasan wird nie eigentlich zahm, weil er seinen Pfleger von einem andern nicht unterscheiden lernt und in jedem Menschen einen Feind sieht, den er fürchten muß; er hält keinen festen Stand, weil er nicht fähig ist, in einem gewissen Umkreise die für ihn geeignetste Örtlichkeit aufzufinden, und er fürchtet beständig Gefahren, weil er nicht Verstand genug besitzt, sich zu helfen, wenn ihm wirklich Unheil droht. »Schwerlich wird man eine Wildart finden«, sagt Winkell mit vollem Recht, »die so leicht wie dies« aus der Fassung gebracht werden kann und dadurch unfähig wird, einen Entschluß zu fassen, überrascht die unerwartete Ankunft eines Menschen oder Hundes den Fasan, so scheint er augenblicklich zu vergessen, daß ihm die Natur Flügel verlieh, um vermittels derselben seine Rettung zu versuchen; folglich bleibt er gelassen auf der Stelle, wo er ist, unbeweglich sitzen, drückt sich und verbirgt den Kopf oder läuft ohne Zweck in der Kreuz und Quere herum. Nichts ist seinem Leben gefährlicher als das Anwachsen eines in der Nähe seines Standes vorbeifließenden Gewässers. Befindet er sich am Rande desselben, so bleibt er unbeweglich stehen, sieht unverwandten Blickes gerade in dasselbe hinein, bis das Gefieder durchnäßt ist und dadurch seine Schwere so vermehrt wird, daß er sich nicht zu heben vermag. Als Opfer seiner Dummheit geht er dann recht eigentlich zugrunde.« Ein Fasan, den Winkell unter ähnlichen Umständen beobachtete, suchte sich nicht nur nicht zu retten, sondern watete immer tiefer in den Strom hinein. Als die Füße nicht mehr zureichten und er schon fortgetrieben ward, erwartete er in stiller Ergebung mit ausgebreiteten Flügeln sein Schicksal. Vermittels eines abgeschnittenen Hakens zog man ihn ans Land und entriß ihn für diesmal der Gefahr. »Seine Furcht«, sagt Raumann, »kennt keine Grenzen. Eine vorbeilaufende Maus erschreckt ihn heftig, sogar eine herankriechende Schnecke scheucht die Fasanhenne augenblicklich vom Nest, und beim Eintritt einer wirklichen Gefahr bleibt sie wie tot auf demselben liegen.« Diese Beschränktheit tut seiner Vermehrung und der Verbreitung erheblichen Abbruch. Gegen andere seiner Art zeigt er sich keineswegs liebenswürdig. Er ist ungesellig und unverträglich. Zwei Hähne kämpfen, sowie sie zusammenkommen, mit Erbitterung, bis die Federn davonfliegen und Blut fließt; ja, der eine bringt den andern um, wenn er dazu imstande ist. Deshalb darf man auch nie zwei Hähne in einem und demselben Raume zusammenhalten, muß vielmehr entweder einen oder mindestens drei zusammensperren; denn im letzteren Falle stört der dritte jeden Zweikampf und trägt dadurch zum allgemeinen Frieden bei. Um die Henne bekümmert sich der Hahn nur während der Paarungszeit, um die Jungen gar nicht.
Die Paarungslust, die sich Ende März regt, verändert auch das Wesen unseres Vogels. Während er sonst sehr schweigsam ist und ungestört höchstens beim Aufbäumen ein lautes, hühnerartig zackendes »Kukkuckuk, kuckukuk« durch den Wald ruft, kräht er jetzt, aber in abscheulicher Weise. Jener Ruf erinnert wohl an das wohlklingende »Kickerickih« unseres Haushahnes, ist aber kurz und heiser, gleichsam unvollständig, erregt also gerade, weil wir ihn mit dem Krähen des Hahnes vergleichen, unser Mißfallen. Vor dem Krähen erhebt er das Spiel und während des Lautgebens selbst schlägt er, nach Art unseres Haushahnes, mit den Flügeln. Ist eine Henne in der Nähe, so läßt er sich nach dem Krähen auch wohl herab, ihr den Hof zu machen, indem er beide Flügel breitet, den Hals einzieht und zu Boden drückt, selbst einige tanzartige, jedoch niemals gelingende Sprünge versucht. Dann stürzt er sich auf die Henne und wenn dieselbe sich nicht augenblicklich seinen Wünschen fügt, kratzt und hackt er sie, als sehe er in ihr nicht die erkorene Braut, sondern einen Nebenbuhler, den er mit den schärfsten Waffen zu bekämpfen hat. Nach der Begattung kräht er wieder, und dann dreht er der Henne den Rücken zu. Diese Liebeswerbung pflegt in den Morgenstunden stattzufinden; doch kommt es auch vor, daß ein Fasanhahn gegen Abend nochmals balzt; es geschieht dies namentlich dann, wenn er wenig Hennen um sich hat, so z.+B. in den Tiergärten, wo man den einzelnen Hahn höchstens mit drei bis vier Hennen zusammensperrt. Mit andersartigen Hennen seiner Sippschaft paart sich jeder Fasanhahn ohne Umstände, erzielt auch mit allen wiederum fruchtbare Blendlinge, mit denen des Buntfasans ( Phasanius versicolor) solche von geradezu bestrickender Schönheit.
Die befruchtete Henne sucht sich ein stilles Plätzchen unter dichtem Gebüsch, hoch aufgeschossenen Pflanzen, beispielsweise also im Getreide, in Bilsen oder im Wiesengrase, kratzt hier eine seichte Vertiefung, scharrt in diese etwas Genist aus der nächsten Umgebung und legt nun ihre acht bis zwölf Eier ab, regelmäßig in Zwischenräumen von vierzig bis achtundvierzig Stunden. Nimmt man ihr die Eier weg, so legt sie deren mehr, selten jedoch über sechzehn oder achtzehn Stück. Die Eier sind kleiner und rundlicher als die der Haushenne und einfach gelblichgraugrün von Farbe. Sofort, nachdem das letzte Ei gelegt ist, beginnt sie zu brüten und tut dies mit bewunderungswürdigem Eifer. Sie sitzt so fest, daß sie den gefährlichsten Feind sehr nahe kommen läßt, bevor sie sich zum Weggehen entschließt; und auch dann pflegt sie nicht davonzufliegen, sondern in der Regel davonzulaufen. Muß sie das Nest verlassen, so bedeckt sie es leicht mit den Neststoffen oder einigen Blättern und Grashalmen, die sie herbeischafft. Nach fünfundzwanzig- bis sechsundzwanzigtägiger Bebrütung schlüpfen die Jungen aus. Die Alte hudert sie, bis sie vollständig trocken geworden sind, und führt sie sodann vom Nest weg und zur Äsung. Bei günstiger Witterung erstarken die kleinen, ziemlich behenden Küchlein innerhalb zwölf Tagen soweit, daß sie ein wenig flattern können, und wenn sie erst Wachtelgröße erreicht haben, bäumen sie abends mit der Alten regelmäßig. Letztere sucht sie gegen alle schädlichen Einflüsse möglichst zu schützen, gibt sich auch ihrethalben etwaigen Gefahren rücksichtslos preis, erlebt aber doch nur selten die Freude, sie alle groß werden zu sehen, weil junge Fasanen zu den weichlichsten und hinfälligsten Hühnervögeln gehören. Bis spät in den Herbst hinein halten sich die Jungen bei der Mutter und bilden mit dieser ein Gesperre; dann trennen sich zuerst die Hähne und gegen das Frühjahr hin auch die Hennen, die nunmehr fortpflanzungsfähig geworden sind.
In Mittel- und Norddeutschland überläßt man die wenigsten Fasanen sich selbst, greift vielmehr helfend und oft genug auch hindernd ins Brutgeschäft ein. Mit Beginn des Frühlings werden von verständigen Fasanwärtern einige von den sozusagen wildlebenden Fasanen eingefangen und in den zur Zucht bestimmten Zwinger gesperrt, um hier Eier zu erzeugen; außerdem läßt man durch abgerichtete Hunde die im Freien gelegten Eier zusammensuchen, und wenn man eine genügende Anzahl von ihnen hat, setzt man, womöglich an einem und demselben Tage, so viele Truthennen zum Brüten an, wie man eben besitzt. Diesen zwar treuen, aber äußerst ungeschickten Pflegemüttern vertraut man später die jungen Fasanen an, läßt eine Masse von ihnen durch sie zertreten und reicht den Küchlein noch außerdem so ungeeignete Nahrung, daß es den Sachverständigen wundernimmt, wie noch immer so viele von ihnen großgezogen werden. Für den kundigen Pfleger bietet die Aufzucht kaum Schwierigkeiten. Sie erfordert allerdings Aufmerksamkeit und eine sorgfältige Wahl der Nahrungsstoffe, je nach dem Alter der Küchlein.
Schwerlich gibt es ein anderes Huhn, das so vielen Gefahren ausgesetzt ist wie der Fasan. Er unterliegt weit eher als alle Verwandten Witterungseinflüssen und wird ungleich häufiger als jene vom Raubzeug aller Art gefangen. Sein ärgster Feind, ist der Fuchs, der die Jagd ebenso regelrecht betreibt wie der Mensch, aber noch besser als dieser jede Gelegenheit wahrnimmt, das wohlschmeckende Wild zu berücken. Die jungen Fasanen werden von Mardern und Katzen weggenommen, die Eier im Nest von Igeln und Ratten gefressen. Habicht und Sperber, Weih und Milane tun auch das ihrige, und selbst der täppische Bussard oder der Rabe, die Krähen, Elstern und Häher nehmen manches Küchlein weg, überwältigen manchen Alten. So erklärt es sich, daß die Fasanzucht nirgends günstige Ergebnisse liefert und daß namentlich in Norddeutschland jeder einzelne Fasanbraten dem Besitzer des Geheges drei- bis viermal mehr kostet, als er wert ist.
Die Kragenfasanen ( Chrysolophus), die in einer besonderen Sippe vereinigt werden, kennzeichnen sich durch verhältnismäßig geringe Größe, schlanken Leibesbau, buschige Kopfhaube und sehr langen Schwanz. Der Kragen des Männchens besteht aus Federn, die im Nacken wurzeln, nach vorn und unten breiter werden und vom Halse abstehen.
»Trotzdem, daß der Goldfasan seit langer Zeit in Europa bekannt ist«, sagt Bodinus mit vollem Recht, »wird er von jedem Beschauer mit immer gleichem Entzücken beobachtet. Die Macht der Gewohnheit konnte die Freude an dem prachtvollen Farbenglanz seines Gefieders nicht abstumpfen, und wer ihn zum ersten Male sieht, kann sich kaum von dem herrlichen Anblick losmachen.« In der Tat, der Goldfasan, »Kinki« oder »Goldhuhn« der Chinesen ( Chrysolophus pictus), wahrscheinlich der Phönix der Alten, darf ein Prachtvogel genannt werden; denn seine Färbung ist ebenso schön, wie seine Gestalt ansprechend. Ein reicher, aus hoch- oder goldgelben, etwas zerschlissenen Federn bestehender Busch deckt den Kopf des Männchens und überschattet den Kragen, dessen einzelne Federn der Hauptsache nach orangerot gefärbt, aber tief samtschwarz gesäumt sind, so daß eine Reihe gleichlaufender dunkler Streifen entsteht; die von dem Kragen größtenteils bedeckten Federn des Oberrückens sind goldgrün und schwarz gesäumt, also schuppig, die des Unterrückens und der Oberschwanzdeckfedern hochgelb, die des Gesichts, des Kinns und der Halsseiten weißgeblichweiß, Unterhals und Unterleib hochsafranrot, die Deckfedern der Flügel kastanienbraunrot, die Schwingen rotgraubraun, rostrot gesäumt, die Schulterfedern dunkelblau, lichter gerändert, die Schwanzfedern auf bräunlichem Grunde schwarz gemarmelt oder netzartig gezeichnet und die verlängerten schmalen Oberschwanzdeckfedern dunkelrot. Das Auge ist goldgelb, der Schnabel weißgelb, der Fuß bräunlich. Die Länge beträgt fünfundachtzig, die Breite fünfundsechzig, die Fittichlänge einundzwanzig, die Schwanzlänge sechzig Zentimeter. Beim Weibchen bildet ein trübes Rostrot, das auf der Unterseite in Rostgraugelb übergeht, die Grundfärbung; die Federn des Oberkopfes, Halses und der Seiten sind bräunlichgelb und schwarz, die Oberarm- und mittleren Steuerfedern ähnlich, aber breiter gebändert, die seitlichen Schwanzfedern auf braunem Grunde gelbgrau gewässert, Oberrücken und Brustmitte einfarbig. Die Länge beträgt dreiundsechzig Zentimeter.
Der einzige Sippenverwandte, den man bis jetzt kennenlernte, wurde zu Ehren der Lady Amherst, die ihn zuerst nach Europa brachte, Chrysolophus amberstiae benannt und mag den deutschen Namen Diamantfasan führen. Nach meinem Geschmack übertrifft er den Goldfasan an Schönheit. Der Federbusch ist auf der Stirn schwarz, im übrigen aber rot; der Halskragen besteht aus silberfarbenen, dunklergesäumten Federn, das Gefieder des Halses, Oberrückens und der Oberflügeldeckfedern ist hellgoldgrün, wegen der dunklen Vordersäume ebenfalls schuppig, das des Unterrückens goldgelb, dunkel schattiert; die Oberschwanzdeckfedern zeigen auf blaßrötlichem Grunde schwarze Bänder und Flecke, die der Unterseite sind reinweiß, die Schwingen bräunlichgrau, außen lichter gesäumt, die mittleren Steuerfedern weißgrau getüpfelt, schwarz quergebändert und gelb gesäumt, die übrigen mehr mäusegrau, die seitlichen Oberschwanzdeckfedern wie bei dem Goldfasan lanzettförmig verlängert und korallrot gefärbt. Das Auge ist goldgelb, das nackte Wangenfeld bläulich, der Schnabel hell-, der Fuß dunkelgelb. Die Länge beträgt einhundertfünfundzwanzig, die Fittichlänge zweiundzwanzig, die Schwanzlänge neunzig Zentimeter. Das Weibchen ähnelt der Goldfasanhenne.
Südtaurien und der Osten der Mongolei bis gegen den Amur hin, sowie Süd- und Südwestchina und insbesondere die Provinzen Kansu und Setschuan sind die Heimat des Goldfasans, Ostsetschuan, Yunan, Kuyscho und Osttibet die des Diamantfasans. Beide bewohnen Gebirge; der Goldfasan lebt jedoch stets in einem niedrig, der Diamantfasan in einem zwei- bis dreitausend Meter hoch über dem Meere gelegenen Gürtel. Dies behält auch dann Geltung, wenn beide auf einem und demselben Gebirge vorkommen, so daß man annehmen muß, einer schließe den andern aus oder vertreibe ihn aus seinem Gebiet.
Obgleich man zugestehen muß, daß der Goldfasan anderen Arten seiner Familie im wesentlichen ähnelt, darf man ihn doch behender, gewandter, klüger und verständiger als den Edelfasan nennen. Seine Bewegungen sind höchst anmutig. Er ist imstande, Sätze auszuführen, die wegen ihrer Leichtigkeit und Zierlichkeit wahrhaft überraschen, weiß sich durch die dichtesten Verzweigungen mit einer Gewandtheit hindurchzuwinden, die in Erstaunen setzt, erhebt sich auch fliegend mit viel größerer Behendigkeit als andere Fasanen. Die Stimme, die man übrigens selten vernimmt, ist ein sonderbares Zischen. Die in seiner Familie übliche Ängstlichkeit scheint ihm im hohen Grade eigen zu sein; man kann aber wohl behaupten, daß er sich eher als andere in veränderte Verhältnisse fügt und sich leichter als diese zähmen läßt. Jung aufgezogene gewöhnen sich bald an ihren Pfleger und unterscheiden ihn, was andere Fasanen nicht tun, mit untrüglicher Sicherheit von fremden Leuten. Alle diese Vorzüge des Goldfasans werden dem, der sich mit ihm genauer beschäftigt, sehr bald klar; gleichwohl ist er bei weitem nicht das, was er sein könnte. Es scheint fast, als ob die Liebhaber sich einbilden, daß seine Zucht und Pflege besondere Schwierigkeiten habe, während dies doch durchaus nicht der Fall ist. Gewährt man ihm einen verhältnismäßig großen, teilweise mit Rasen belegten und ebenso mit dichtem Gebüsch bepflanzten Raum, und reicht man ihm ein Passendes, d.+h. möglichst gemischtes, ebensowohl aus tierischen wie pflanzlichen Stoffen bestehendes Futter, so wird man ihn ebenso leicht erhalten und zur Fortpflanzung bringen können wie jeden andern Fasan.
Der Goldfasan tritt gegen Ende April auf die Balz. Um diese Zeit läßt er öfter als sonst seine zischende Lockstimme vernehmen, zeigt sich beweglicher als je, auch höchst kampflustig, und gefällt sich in anmutigen Stellungen, indem er den Kopf niederbeugt, den Kragen hoch aufschwellt, die Flügel breitet, das Spiel erhebt und Wendungen und Drehungen aller Art mit außerordentlicher Zierlichkeit ausführt. Will er die Henne herbeirufen oder seine Liebesgefühle noch anderweitig kundgeben, so läßt er etwa drei- bis viermal nacheinander einen kurz abgebrochenen Ruf ertönen, der entfernte Ähnlichkeit mit dem Geräusch des Wetzens einer Sensenklinge hat und mit keiner andern Vogelstimme verwechselt, aber auch nicht genauer beschrieben werden kann. Da, wo sich die Henne frei bewegen kann, beginnt sie zu Anfang Mai zu legen, indem sie sich ein wohlverstecktes Plätzchen aussucht und hier nach anderer Fasanen Art ein liederliches Nest zusammenscharrt. Die acht bis zwölf Eier sind sehr klein und ziemlich gleichmäßig hell rostfarben oder gelbrot. In einem engen Gehege brütet die Henne selten, d.+h. nur dann, wenn sie sich gänzlich unbeobachtet glaubt; man läßt deshalb ihre Eier von passenden Haushennen ausbrüten und wählt hierzu am liebsten die zwerghaften Bantams. Nach einer Bebrütung von drei- bis vierundzwanzig Tagen entschlüpfen die äußerst niedlichen Küchlein. Sie verlangen in den ersten Tagen ihres Lebens, wie alle Fasanen, große Sorgfalt, namentlich trockene Wärme, können aber bei günstiger Witterung bereits nach zwei bis drei Tagen ins Freie gebracht werden. Nicht immer folgen sie ihrer Pflegemutter, zeigen vielmehr oft Lust, ihr zu entrinnen; doch genügt zuweilen schon ein halber Tag, um sie an die Pflegerin zu gewöhnen. Nach Ablauf der ersten vierzehn Tage beginnen sie zu bäumen, und wenn sie die Größe einer Wachtel erreicht haben, fragen sie sehr wenig mehr nach der Pflegemutter. Nach etwa vier Wochen beanspruchen sie keine besondere Pflege weiter, sondern können ganz wie alte Fasanen gehalten werden.
Alles, was man zum Lobe des Goldfasans anführen kann, läßt sich, jedoch in reicherem Maße, auch vom Diamantfasan sagen. Er ist noch zierlicher, noch gewandter, behender und, was die Hauptsache, härter, gegen unser Klima weniger empfindlich als der Verwandte, dem er übrigens so nahe steht, daß er leicht mit ihm sich paart und wiederum fruchtbare Blendlinge erzielt. Ihm blüht offenbar eine große Zukunft in unsern Tiergärten, vielleicht sogar eine solche in unsern Fasanerien; denn er besitzt alle Eigenschaften, die den Erfolg der Einbürgerung bei uns zulande sichern, soweit dies überhaupt möglich ist.
*
In der dritten Unterfamilie vereinigt man die Pfauen ( Pavoninae). Ihre Merkmale liegen in dem kräftigen Schnabel, dem hochläufigen, einfach oder doppelt bespornten Fuße, dem kurzen Flügel und mittellangen Schwänze, dem sehr entwickelten Oberschwanzdeckgefieder und den vielen Arten zukommenden Augenflecken, die das Gefieder herrlich schmücken.
Im Jahre 1780 kamen die ersten Bälge eines Prachtvollen Vogels, von dessen Dasein man bereits einige Kunde erlangt hatte, nach Europa und erregten hier allgemeine Bewunderung. »Zu Padang, an der Westküste von Sumatra«, so schreibt mir über den berühmten Argusfasan von Rosenberg, »wurde mir der Kuau von den Eingeborenen öfters lebend gebracht und gegen Bezahlung von anderthalb bis zwei Gulden für das Stück überlassen; er muß also in den Gebirgswaldungen der Insel häufig sein. Im tiefsten Walde, aus trockenen, den Sonnenstrahlen zugänglichen Blößen trifft der Reisende oder Jäger nicht selten auf sorgfältig von Zweigen und Blättern gereinigte Stellen, von denen aus nach allen Richtungen schmale Wildpfade waldeinwärts laufen. Hier, zumal um die Mittagszeit, findet sich der Arguspfau ein, um zu ruhen, zu spielen, zu kämpfen; hier sieht man ihn nach Hühnerart auf dem von der Sonne durchwärmten Boden liegen und im Sande sich baden, günstigen Falles vielleicht auch spielen und kämpfen, und in die von hier ausgehenden Pfädchen legt der Jäger seine Schlingen. Nach Versicherung der Eingeborenen lebt er in Vielehigkeit. Solange ihn die Liebe nicht erregt, beträgt er sich in Gang und Haltung ganz wie der Pfau; die schönen Flügel werden dem Leibe eng angeschlossen und der Schwanz wagerecht ausgestreckt. Während der Paarungszeit aber sieht man das Männchen mit ausgebreiteten, bis zum Boden niedergedrückten Flügeln auf den Waldblößen balzend umherstolzieren und vernimmt einen eigentümlich schnurrenden Laut, der die Hennen herbeilocken soll und mit dem Rufe »Kuau«, von dem sein Name ein Klangbild ist, keine Ähnlichkeit hat. Die Henne soll sieben bis zehn weiße, denen einer Gans an Größe etwas nachstehende Eier in ein kunstloses, im dichtesten Gebüsch verborgenes Nest legen; ich selbst habe sie nie gesehen. In der Freiheit nährt sich der Kuau von Kerbtieren, Schnecken, Würmern, Blattknospen und Sämereien. Meine gefangenen Vögel zogen gebrühten Reis jeder andern Nahrung vor. Das Wildbret ist äußerst schmackhaft.«
Der Argusfasan, richtiger Pfauenargus oder Arguspfau ( Argus giganteus), unterscheidet sich von allen bekannten Vögeln dadurch, daß die Federn des Ober- und Vorderarmes außerordentlich verlängert, nach der Spitze zu verbreitert, dabei weichschaftig, aber hartfahnig, die Handschwingen hingegen sehr kurz sind. Der aus zwölf sehr breiten, dachartig übereinander liegenden Federn gebildete Schwanz ist ungemein lang und stark abgestuft, weil sich namentlich die beiden mittleren Federn auffallend über die andern verlängern. Das Gesicht ist nackt, die Kopfmitte, von dem schneppenartig in die Stirn einspringenden Schnabel an, mit einem schmalen und niedrigen, aus samtartigen Federn gebildeten Kamme bekleidet, der sich auf der Kopfmitte helmraupenartig nach vorn biegt, der Nacken mit haarigen, zweizeilig geordneten, kurzen Federn bedeckt, das Kleingefieder sehr dicht und locker. Von der eigentümlichen Pracht des Gefieders sieht man am ruhig sitzenden Vogel, mit alleiniger Ausnahme der Augenflecke auf der letzten Armschwinge, gar nichts; sie tritt erst beim Ausbreiten der Flügel und des Schwanzes zutage. Die kurzen Scheitelfedern sind samtschwarz, die haarartigen des Hinterhalses gelb und schwarz gestreift, die Nacken- und Oberrückenfedern auf bisterbraunem Grunde lichtgelb geperlt und gestreift, die des Mittelrückens auf gelbgrauem Grunde mit runden dunkelbraunen Tüpfeln gezeichnet, die der Unterseite ziemlich gleichmäßig rotbraun, schwarz und lichtgelb gebändert und gewellt. Auf der Außenfahne der Armschwingen stehen längliche dunkelbraune, von einem lichteren Hofe umgebene Tüpfel in dichter Reihe auf graurötlichem Grunde; der Wurzelteil der Innenfahne ist zunächst dem Schafte auf graurotem Grunde fein weiß gepunktet, im übrigen wie die Außenfahne gezeichnet. Auf den langen Oberarmdeckfedern herrscht ein schönes dunkles Rotbraun als Grundfärbung vor; hell graurötliche Streifen, die rotbraune, von einem dunklen Hofe umgebene Punktreihen zwischen sich aufnehmen, gelblichweiße Flecke, Linien und Schmitze, bräunlichrote Netzbänder und endlich große schillernde, dunkel begrenzte, licht gesäumte Augenflecke bilden die Zeichnung. Diese Augenflecke stehen hart am Schafte auf der Außenfahne und treten auf den Unterarmfedern deutlicher hervor als auf den Schulterfedern. Die längsten Schwanzfedern sind schwarz, die Schäfte innen aschgrau, außen rotbraun, beide Fahnen mit weißen, von einem schwarzen Hofe umgebenen Flecken geziert; die übrigen Steuerfedern ähneln ihnen, nur daß sich die kleineren Flecke mehr in Reihen ordnen und dichter stehen. Der Augenring ist rotbraun, der Schnabel elfenbeinweiß, das nackte Gesicht hell aschblau, der Fuß hell karminrot. Die Gesamtlänge beträgt 1,7 bis 1,8 Meter, wovon die Mittelschwanzfedern 1,2 Meter wegnehmen, die Länge des eigentlichen Fittichs fünfundvierzig, die der längsten Unterarmfedern aber fünfundsiebzig Zentimeter. Die Henne ist bedeutend kleiner und viel einfacher gestaltet und gezeichnet.
*
Die Spiegelpfauen ( Polyplectron) dürfen als Verbindungs- oder Mittelglieder zwischen den Argusfasanen und den Pfauen angesehen werden. Bei dem Urbilde der Sippe, dem Spiegelpfau oder Tschinquis ( Polyplectron biecalcaratum), sind Kopf und Oberhals graubraun, fein schwarz gewellt und gepunktet, Unterhals, Brust und Bauchmitte braun, deutlicher braunschwarz in der Quere gebändert und reihenartig lichtgelb getüpfelt, die Mantelfedern graugelblich, mit kleinen grauschwärzlichen Binden und alle Federn mit je einem runden, von Grüngrau in Purpur schillernden Augenflecken geziert, die Rücken-, Bürzel- und die großen Schwanzdeckfedern mattbraun, fein ockergelb gefleckt und gepunktet, die Handschwingen bisterbraun und graugefleckt, die Steuerfedern und die langen Oberschwanzdeckfedern mattbraun, lichtgrau gefleckt und sämtlich vor ihrer Spitze auf jeder Fahne mit einem großen, ebenfalls grünblauen, purpurschillernden, schwarz eingefaßten Augenflecken geschmückt. Das Auge ist glänzend gelb, der Fuß schwarz. Die Länge beträgt sechzig Zentimeter, wovon fünfundzwanzig Zentimeter auf den Schwanz kommen. Das Weibchen unterscheidet sich durch kürzeren Schwanz, schwielige Höcker an Stelle der Sporen und minder glänzende Färbung des Gefieders.
Assam, Gilhet, Arakan und Tenasserim bis gegen Mergut hin sind die Länderstriche, in dem der Tschinquis gefunden wird, über sein Freileben sind wir nicht unterrichtet. Alle Spiegelpfauen sollen möglichst versteckt in den tiefen Waldungen leben, sich viel auf dem Boden und hauptsächlich im dichten Gebüsch aufhalten, demgemäß auch selten gesehen werden. Auch in unsere Käfige gelangen sie dann und wann, halten recht gut aus, schreiten jedoch nur ausnahmsweise zur Fortpflanzung. Alle, die ich beobachtete, hielten sich möglichst versteckt unter Büschen auf und traten nur, wenn sie sich ungesehen wähnten, in den freien Raum des Käfigs heraus. Ihr Betragen hat größere Ähnlichkeit mit unsern Haushühnern, namentlich mit Hennen, als mit Pfauen; doch sagte mir ein Wärter, daß das Männchen im Frühling, also während der Paarzeit, seinen Schwanz etwas breite und dann in sehr stolzer Haltung einhergehe. Die Haltung ist überhaupt eine ebenso zierliche wie anmutige, der Eindruck auf den Beobachter daher ein äußerst günstiger. In einem sehr geräumigen, sonnigen, dicht mit niedrigem Gebüsch bepflanzten und ungestörten Fluggebauer dürften Spiegelpfauen bestimmt zur Fortpflanzung schreiten.
*
Die Pfauen ( Pavo) unterscheiden sich von sämtlichen andern Hühnern durch die über alles gewohnte Maß entwickelten Oberschwanzdeckfedern, die demgemäß als ihr wichtigstes Kennzeichen angesehen werden müssen. Sie sind die größten aller Hühner, kräftig gebaut, ziemlich langhälsig, kleinköpfig, kurzflügelig, hochbeinig und langschwänzig. Das Gefieder bekleidet in reicher Fülle den Leib, ziert den Kopf mit einem aufgerichteten und langen, entweder aus schmalen oder aus nur an der Spitze bebarteten Federn bestehenden Busche, läßt aber die Augengegend frei. Seine Schönheit erreicht es im dritten Lebensjahre.
Der Pfau ( Pavo criststus), den wir als den Stammvater des schönsten unserer Hofvögel anzusehen haben, ist auf Kopf, Hals und Vorderbrust prachtvoll purpurblau mit goldenem und grünem Schimmer, auf dem Rücken grün, jede Feder kupferfarbig gerändert und muschelartig gezeichnet, auf dem Flügel weiß, schwarz quer gestreift, auf der Rückenmitte aber tiefblau, auf der Unterseite schwarz; die Schwingen und Schwanzfedern sind licht nußbraun, die Federn, die die Schleppe bilden, grün durch Augenflecke Prächtig geziert, die Federn der Haube, zwanzig bis vierundzwanzig an der Zahl, tragen nur an der Spitze Bärte, Das Auge ist dunkelbraun, der nackte Ring um dasselbe weißlich, der Schnabel und Fuß hornbraun. Die Länge beträgt einhundertzehn bis einhundertfünfundzwanzig, die Fittichlänge sechsundvierzig, die Schwanzlänge sechzig Zentimeter; die Schleppe mißt 1,2 bis 1,3 Meter. Beim Weibchen ist der Kopfbusch bedeutend kürzer und dunkler gefärbt als beim Männchen; Kopf und Oberhals sind nußbraun, die Federn des Nackens grünlich, weißbraun gesäumt, die des Mantels lichtbraun, fein quer gewellt, die der Gurgel, Brust und des Bauches weiß, die Schwingen braun, die Steuerfedern dunkelbraun mit einem weißen Spitzensaume. Die Länge beträgt etwa fünfundneunzig, die Fittichlänge vierzig, die Schwanzlänge dreiunddreißig Zentimeter.
Der Pfau bewohnt Ostindien und Ceylon, und zwar Waldungen und Dschungeldickichte, insbesondere bergiger Gegenden, solche, die von offenem Lande umgeben oder von Schluchten durchzogen werden, häufiger als die, die mit unserm Hochwalde zu vergleichen sind. An Gebirgen Südindiens steigt er bis in einen Gürtel von zweitausend Meter über dem Meere empor, fehlt jedoch im Himalaja; auf Ceylon findet er sich ebenfalls vorzugsweise im Gebirge. Nach Williamson bilden Waldungen mit dichtem Unterwuchse oder hohem Grase seine Lieblingsplätze, vorausgesetzt, daß es ihnen an Wasser nicht fehlt; ebenso gern hält er sich in Pflanzungen auf, die ihm Deckung gewähren und einzelne hohe, zur Nachtruhe geeignete Bäume haben. In vielen Gegenden Indiens gilt er als ein heiliger und unverletzlicher Vogel, dessen Tötung in den Augen der Eingeborenen als Verbrechen angesehen wird und jeden Übertreter in Lebensgefahr bringt. In der Nähe vieler Hindutempel halten sich zahlreiche Herden von halbwilden Pfauen auf, deren Pflege mit zu den Obliegenheiten der Geistlichen gehört, werden sich hier des ihnen gewährten Schutzes bald bewußt und zeigen, wenigstens dem Hindu gegenüber, kaum größere Scheu als diejenigen, die auf dem Hühnerhofe erwuchsen.
Tennent versichert, daß niemand, der den Pfau nicht selbst in seiner einsamen Wildnis sah, eine Vorstellung von seiner Schönheit gewinnen kann. In denjenigen Teilen von Ceylon, die selten von Europäern besucht werden, und wo der Pfau keine Störung erleidet, ist er so außerordentlich häufig, daß man bei Tage Hunderte zu gleicher Zeit sieht und nachts vor dem fortwährenden und lauten Geschrei nicht schlafen kann. Am prachtvollsten nimmt er sich aus, wenn er gebäumt hat und die lange Schleppe, bald halb von den Blättern verborgen, bald ausgebreitet, dem Baume selbst zu einem wunderbaren Schmucke wird. Williamson behauptet, daß er in einzelnen Teilen Indiens zu gleicher Zeit zwölf- bis fünfzehnhundert Pfauen gesehen, sie aber gewöhnlich in Banden von dreißig bis vierzig Stück gefunden habe. Tagsüber halten sich diese Gesellschaften meist auf dem Boden auf, und nur in den Vormittags- und Abendstunden kommen sie auf die Blößen oder Felder heraus, um hier sich zu äsen. Verfolgt, sucht sich der Pfau solange wie möglich laufend zu retten, und erst wenn er einen gewissen Vorsprung erreicht hat, entschließt er sich zum Fluge. Dieser ist schwerfällig und rauschend. Der Vogel erhebt sich gewöhnlich nicht über Schußhöhe und fliegt selten weit. Williamson meint, daß man glauben werde, ein im Flügel verwundeter Pfau stürze schwer auf den Boden herab; dem aber sei nicht so: der geschädigte raffe sich vielmehr in der Regel sehr bald wieder auf und laufe dann so rasch dahin, daß er unter zehn Fällen neunmal dem Jäger entkomme, wenn dieser ihm nicht unmittelbar auf der Ferse folge. Vor einem Hunde oder überhaupt einem größeren vierfüßigen Raubtier scheut sich der Pfau weit mehr als vor dem Menschen, wahrscheinlich, weil er an Wildhunden und an den Tigern schlimme Erfahrungen gemacht hat. Wird ein Hund auf seine Fährte gebracht, so bäumt er sobald wie möglich, und wenn dies geschehen ist, läßt er sich so leicht nicht vertreiben. In Indien ergraute Jäger schließen da, wo es Tiger gibt, von dem Benehmen der Pfauen mit aller Sicherheit auf das Vorhandensein eines jener Raubtiere.
Als echter Hühnervogel wählt sich der Pfau seine Nahrung ebensowohl aus dem Tier- wie aus dem Pflanzenreich. Er frißt alles, was unser Huhn genießt, ist aber vermöge seiner Größe und Stärke imstande, auch kräftigere Tiere zu bewältigen, so namentlich Schlangen von ziemlicher Länge, die von ihm teilweise gefressen, mindestens getötet werden. Wenn das junge Getreide schoßt, findet er sich regelmäßig auf den Feldern ein, um hier zu äsen, und wenn die Pipulbeeren reifen, frißt er davon so viel, daß sein Wildbret einen bitteren Geschmack annimmt.
Je nach der Örtlichkeit brütet der Pfau früher oder später im Jahre, in Südindien gewöhnlich gegen Ende der Regenzeit, im nördlichen Teil des Landes in den Monaten, die unserem Frühling entsprechen, also vom April an bis zum Oktober. Nach Irby verliert der Hahn in Aud seine Schleppe im September und hat sie erst im März wieder vollständig erhalten, kann also dann erst an die Paarung denken. Er entfaltet jetzt vor dem Weibchen die volle Schönheit seines Spieles und benimmt sich überhaupt in derselben Weise wie seine gezähmten Nachkommen. Das Nest, das man gewöhnlich auf einer erhöhten Stelle, im Walde unter einem größeren Busche findet, besteht aus dünnen Ästchen, trockenen Blättern und dergleichen und ist ebenso unordentlich gebaut wie das anderer Hühnerarten. Das Gelege zählt, laut Jerdon, vier bis acht oder neun, laut Williamson zwölf bis fünfzehn Eier. Sie werden von der Henne mit großem Eifer bebrütet und nur im äußersten Notfalle verlassen. »Bei verschiedenen Gelegenheiten«, sagt der erstgenannte, »habe ich wilde Pfauhennen auf ihrem Neste beobachtet. Falls ich sie nicht störte, rührten sie sich nicht, auch wenn sie mich unzweifelhaft gesehen hatten.« Das Jugendleben verläuft wie das anderer Hühner.
Obgleich man nicht sagen kann, daß der Pfau zu dem gesuchten Wilde der indisch-europäischen Jäger gehört, vermag anfänglich doch keiner von ihnen der Versuchung zu widerstehen, einen in der Luft dahinstreichenden Hahn herabzuschießen. Das Wildbret alter Vögel ist zwar nur zur Suppe gut genug, das der halberwachsenen aber ganz ausgezeichnet wegen seiner Weichheit und des vortrefflichen Wildgeschmackes. In Gegenden, wo Pfauen häufig und nicht heilig gesprochen sind, werden viele von ihnen in Schlingen, Netzen und andern Fallen gefangen und lebend auf den Markt gebracht. Sie gewöhnen sich bald an die Gefangenschaft, müssen aber doch schon ein gewisses Alter erreicht haben, weil die Jungen schwer aufzuziehen sind.
Die Zeit, in der der Pfau zuerst nach Europa gelangte, ist nicht festgestellt. Alexander der Große kannte ihn als gezähmten Vogel nicht; denn er bewunderte ihn, als er ihn während des Zuges nach Indien zum ersten Male wild sah, und brachte, wie die Sage berichtet, gezähmte mit sich nach Europa. Zu Perikles' Zeit soll der Pfau noch so selten in Griechenland gewesen sein, daß Leute aus weiter Ferne kamen, um ihn zu sehen. Aristoteles, der Alexander nur zwei Jahre überlebte, schildert ihn als einen überall im Lande gewöhnlichen und wohlbekannten Vogel. Bei den Gelagen der römischen Kaiser spielte er bereits eine hervorragende Rolle. Vitellius und Heliogabalus setzten den Gästen gewaltige Schüsseln vor, die aus Zungen und Hirn der Pfauen und den teuersten Gewürzen Indiens bestanden. Zu Samos wurde er im Tempel der Juno gehalten und auf den Münzen abgebildet. In Deutschland und England scheint er im vierzehnten und fünfzehnten Jahrhundert noch sehr selten gewesen zu sein, weil englische Barone ihren Reichtum dadurch bewiesen, daß sie bei großen Schmäusen einen gebratenen Pfau auftragen ließen, der mit den eigenen Federn geschmückt und mit (damals noch sehr seltenen) Pflaumen umgeben war. Geßner, dessen Naturgeschichte 1557 erschien, kannte ihn sehr genau und gibt bereits eine ausführliche Beschreibung von ihm. Der hervorstechendste Zug des Pfaues ist Stolz und Eitelkeit, und er bekundet diese nicht bloß seinem Weibchen, sondern auch dem Menschen gegenüber. Auf dem Hühnerhofe macht er sich oft unleidlich, weil er, ohne erzürnt worden zu sein, schwächere Tiere überfällt und mit hämischer Bosheit mißhandelt oder sogar tötet. Zuweilen läßt er sich freilich auch verleiten, mit Truthühnern anzubinden; dann aber folgt dem frevelhaften Beginnen die Strafe regelmäßig auf dem Fuße nach. Pfauen und Truthühner, die frei umherschweifen, liegen in beständigem Streit miteinander. Zuerst kämpfen gewöhnlich zwei Pfauhähne mit großer Erbitterung unter sich; dann pflegt der geschlagene sich auf einen der umherstolzierenden Truthähne zu stürzen. Dieser aber ruft augenblicklich die Gefährten zu Hilfe, der Streit ist sofort beendet, und alle Puterhähne, ja selbst alle Hennen vereinigen sich in dem Bestreben, den stolzen Asiaten zu züchtigen. Dann muß dieser unter allen Umständen Fersengeld geben und wird manchmal arg zerzaust und zerhackt.
Der Winter ficht den Pfau wenig an; er behält, auch wenn er einen warmen Stall hat, selbst bei der strengsten Kälte die erhabenen Schlafplätze bei, die er sich im Sommer wählte, und läßt sich bei Schneefall unter Umständen ruhig einschneien, leidet davon auch keinen Schaden. Wenn er größere Freiheit genießt, zeigt er sich anspruchslos, nimmt mit gewöhnlichem Hühnerfutter vorlieb, sucht sich aber freilich bei seinen Spaziergängen im Hof und Garten viele Nahrungsmittel selbst. Grünes der verschiedensten Art scheint ihm unentbehrlich zu sein. Die Henne brütet nur dann eifrig, wenn sie sich vollständig ungestört weiß. Sie versteht meisterhaft, einen passenden Platz zum Nisten zu wählen, benutzt hierzu die verschiedensten Zärtlichkeiten, verfährt aber stets mit Umsicht. Nach dreißigtägiger Bebrütung schlüpfen die Jungen aus, und wenn die Alte beim Brüten nicht gestört wurde, nimmt sie sich ihrer treulich an, leitet, hudert und verteidigt sie nach besten Kräften, zeigt sich überhaupt sehr besorgt um sie. Wurde sie aber während des Brütens öfters gestört, so nimmt sie in der Regel mehr auf sich als auf die Küchlein Rücksicht und läßt diese namentlich in der Nacht oft in abscheulicher Weise im Stich, indem sie, unbekümmert um die Hilflosigkeit der Jungen, ihren gewohnten Schlafplatz aufsucht. Die Jungen wachsen günstigenfalls ziemlich rasch heran, lassen sich im dritten Monat ihres Lebens bereits nach dem Geschlecht unterscheiden, erhalten aber die volle Pracht ihres Gefieders, ihre Zeugungs- und Fortpflanzungsfähigkeit erst im dritten Jahre ihres Lebens.
*
Meleagers Schwestern, untröstlich über den Tod ihres Bruders, wurden in Vögel verwandelt, deren Gefieder wie mit Tränentropfen besprengt erscheint. So berichtet die Sage und belehrt uns dadurch, daß die Alten diese Vögel, die wir Perlhühner nennen, bereits gekannt haben. Verschiedene Schriftsteller des Altertums schildern sie so genau, daß wir wenigstens annähernd die beiden Arten, die sie kannten, bestimmen können. Nebenbei erfahren wir, daß Perlhühner in Griechenland sehr häufig gehalten wurden, so daß arme Leute sie als Opfer darbringen konnten. Nach der Römerzeit scheinen sie wenig beachtet worden oder gar aus Europa verschwunden zu sein; denn erst im vierzehnten Jahrhundert verlautet wiederum etwas über sie. Bald nach Entdeckung Amerikas nahmen die Schiffer die gewöhnlichste Art mit nach der Neuen Welt hinüber und hier fand sie ein ihr in so hohem Grade zusagendes Klima, daß sie bald verwilderte.
Die Perlhühner ( Numidinae), die eine anderweitige Unterfamilie der Fasanvögel bilden, kennzeichnen sich durch kräftigen Leib, kurze Flügel, mittellangen Schwanz, sehr verlängerte Oberschwanzdeckfedern, überhaupt reiches Gefieder, mittelhohe, gewöhnlich sporenlose, kurzzehige Füße, kräftigen Schnabel, mehr oder weniger nackten, mit Federbusch, Holle, Krause, Helm und Hautlappen verzierten Kopf und Oberhals und sehr übereinstimmende Färbung und Zeichnung, die aus einer lichten Perlfleckung auf dunklem Grunde besteht und, wie die Kopfzierde, beiden Geschlechtern gemeinsam ist.
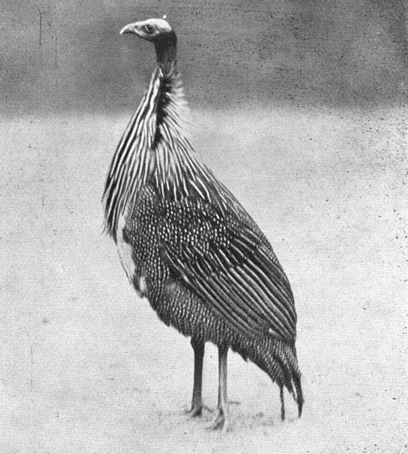
Geierperlhuhn ( Acryllium vulturinum)
Als das edelste Mitglied der Unterfamilie sehe ich das ostafrikanische Geierperlhuhn ( Acryllium vulturinum) an. Es vertritt die Sippe der Königsperlhühner ( Acryllium), die sich nicht unwesentlich von allen andern unterscheidet. Das Gefieder zeigt in seiner Weise dieselbe Pracht wie das Federkleid des schönsten Fasans. Die Krause ist dunkelrotbraun, der Hals ultramarinblau, schwarz und silberweiß in die Länge gestreift, da jede einzelne der schmalen und langen Federn auf schwarzem, fein graugetüpfeltem Felde einen vier Millimeter breiten, weißen Mittelstreifen und breite, ultramarinblaue Säume zeigt; auf den kurzen Mittelbrustfedern verliert sich diese Zeichnung, und es tritt dafür ein reines Samtschwarz, aus den Seitenbrustfedern aber ein prachtvolles Ultramarinblau ans; die Oberrückenfedern zeigen noch die lichten Mittelstreifen, nicht aber die blauen Säume; es kommt dafür eine höchst zierliche, aus schwarz- und weißgrauen Wellenlinien und Pünktchen bestehende Zeichnung zur Geltung; das übrige Gefieder ist auf dunkel- oder schwarzgrauem Grunde äußerst fein licht marmoriert und geperlt; jeder einzelne Perlfleck wird von einem schwarzen Hof umschlossen; auf den Federn der Weichengegend und des Bauches nehmen die Perlflecken an Größe zu, auf denen, die über den reinblauen der Seitenbrust sich finden, wird jeder dunkle Hof noch von lilafarbenen Streifen umgeben, die sich wie Gitterwerk ausnehmen; auf der Außenfahne der Schulter- und Oberarmfedern fließen die Perlen in schmale, weiße Streifen zusammen; die Außenfahnen der ersten vier oder fünf Oberarmfedern werden aber noch außerdem durch breite, lilafarbene Säume, die vereint ein schmales Spiegelfeld bilden, geschmückt. Die Länge beträgt etwa sechzig, die Fittichlänge neunundzwanzig, die Schwanzlänge vierzehn Zentimeter.
Die Sippe der Helmperlhühner ( Guttera) endlich, die wir als die Urbilder der Unterfamilie ansehen, trägt ein mehr oder minder langes Horn auf der Scheitelmitte und zwei Haut- oder Fleischlappen hinten am Unterkiefer. Beim Hornperlhuhn ( Guttera cristata), Stammvater unseres Haustieres, sind Oberbrust und Nacken ungefleckt lilafarben, Rücken und Bürzel auf grauem Grunde mit kleinen, weißen, dunkler umrandeten Perlflecken besetzt, die auf den Oberflügeldeckfedern größer werden, teilweise auch zusammenfließen und sich auf der Außenfahne der Armschwingen in schmale Querbänder umwandeln, die unteren Teile auf grauschwarzem Grunde ziemlich gleichmäßig mit großen, runden Perlflecken geziert, die Schwingen bräunlich, auf der Außenfahne weiß gebändert, auf der inneren unregelmäßig gebändert und gerupft, die dunkelgrauen Steuerfedern schön geperlt und nur die seitlichen teilweise gebändert, weil auch hier die Flecken zusammenfließen, die Lappen breit und ziemlich lang. Das Auge ist dunkelbraun, die Wangengegend bläulichweiß, der Kammlappen rot, der Helm hornfarben, der Schnabel rotgelblich hornfarben, die wachshautartige Wulst am Schnabelgrunde rot, der Fuß schmutzig schiefergrau, oberhalb der Einlenkung der Zehen fleischfarbig. In der Gefangenschaft gezüchtete und von früher gezähmten herstammende Perlhühner unterscheiden sich hauptsächlich durch bedeutendere Größe. Spielarten sind häufig. Dem Hornperlhuhn ähnelt sehr das Haubenperlhuhn ( Guttera pucherani). Seine Färbung ist im allgemeinen dunkler und auf dem Kopfe trägt es einen Federbusch. Alle Perlhühner gehören ursprünglich Afrika an; die bekannteste Art von ihnen aber verwilderte, wie bemerkt, in Mittelamerika.
Es scheint, daß sich die Lebensweise der verschiedenen Arten, von unwesentlichen Lebensäußerungen abgesehen, vollständig ähnelt. Das Perlhuhn bedarf nach meinen Erfahrungen, die sich auf das in Nordostafrika lebende und dort sehr häufige Pinselperlhuhn ( Guttera ptilorhyncha) beziehen, Gegenden, die von einem dichten Niederwalde bedeckt sind, dazwischen aber freie Blößen haben. Reichbebuschte Täler der Ebenen, Waldungen, in denen dichter Unterwuchs den Boden deckt, Steppen, in denen grasartige Pflanzen nicht allein zur Herrschaft gekommen sind, Hochebenen im Gebirge, bis zu dreitausend Meter unbedingter Höhe, und sanft abfallende, mit Felsblöcken übersäte, aber dennoch mit einer üppigen Pflanzendecke überzogene Gehänge genügen allen Anforderungen, die es an eine Örtlichkeit stellt. In den zackigen und zerrissenen Bergen der Inseln des Grünen Vorgebirges findet es, laut Bolle, ein seiner Natur so vollkommen zusagendes Gebiet, daß es hier massenhaft auftritt; je größer und je wilder die Insel, je tiefer die Einöde ihrer Berggelände, um so häufiger begegnet ihm der Reisende. Es belebt hier alle Höhenzüge in zahlreichen Trupps, vorzugsweise die Buschwälder der baumartigen Euphorbien, die ihm sichere und selten betretene Zufluchtsstätten gewähren. Da die Inseln Westindiens ähnliche Örtlichkeiten besitzen, hat es sich bald der Herrschaft der Menschen zu entziehen gewußt und sich im Freien heimisch gemacht. Schon vor einhundertsechzig Jahren war es, wie Falconer berichtet, auf Jamaika häufig; gegenwärtig ist es dort so gemein, daß es unter Umständen zur Landplage wird. Auch auf Kuba findet man es an verschiedenen Orten, besonders im östlichen Teil der Insel, weil hier viele Kaffeepflanzungen von den Eigentümern in der Absicht verlassen wurden, neue Pflanzungen an besseren Orten anzulegen. Es blieben dort, wie Gundlach meint, zahme Perlhühner zurück, vermehrten sich und verwilderten vollständig.
Die Perlhühner sind Standvögel, wenn auch nicht im strengsten Sinne des Wortes. Ich erinnere mich, sie zu gewissen Zeiten in Waldungen und Steppengegenden gefunden zu haben, in denen man sie sonst nicht antrifft, und Kirk sagt mit Bestimmtheit, daß sie sich in Ostafrika, wenn die Regenzeit beginnt, nach dem Innern des Landes zurückziehen, hier zersprengen und nun zur Fortpflanzung schreiten. Da, wo sie häufig sind, wird man ihrer bald gewahr. Sie verstehen es, sich bemerklich zu machen, und wäre es auch nur, daß sie in den Morgen- und Abendstunden ihre trompetenartige, schwer zu beschreibende, den meisten meiner Leser aber durch unser zahmes Perlhuhn wohlbekannt gewordene Stimme vernehmen lassen. Ich muß jedoch erwähnen, daß nur die behelmten Perlhühner in dieser Weise schreien, daß ich wenigstens weder vom Geier- noch vom Haubenperlhuhn jemals einen ähnlichen Ton vernommen habe. Das Geierperlhuhn stößt, wenn es gerade schreilustig ist, einen sonderbaren Ruf aus, der aus drei Teilen besteht und am besten mit dem Quietschen eines in Bewegung gesetzten, aber schlecht geschmierten Schleifsteins oder kleinen Rades verglichen werden kann. Dieser Laut läßt sich durch die Silben »Tietitiet« wiedergeben. Die erste Silbe wird ziemlich lang gezogen, die zweite kurz ausgestoßen, die dritte wiederum etwas verlängert. Alle drei folgen unmittelbar aufeinander und scheinen niemals verändert zu werden. Es hält deshalb auch nicht schwer, diese Stimme von der jedes andern Perlhuhns zu unterscheiden. Das Haubenperlhuhn schreit wenig; von meinen gefangenen habe ich nur zuweilen ein leises, hochtönendes Gackern vernommen.
Perlhühner fliehen unter allen Umständen bei Annäherung eines Menschen. Sie sind weniger vorsichtig als scheu; eine Kuh-Herde scheucht sie weg, ein Hund bringt sie förmlich außer Fassung, ein Mensch wenigstens in größere Aufregung. Es ist daher nicht ganz leicht, ihr Treiben zu beobachten; man darf bei der Annäherung mindestens gewisse Vorsichtsmaßregeln nicht aus den Augen lassen. Schleicht man an ein Gesperre, dessen Ruf man vernahm, gedeckt heran, so steht man das Volk über die Blöße gehen oder sich zwischen den Felsblöcken dahinwinden oder Gebüsche durchschlüpfen. Wie die Indianer auf ihren Kriegspfaden, laufen die Vögel in langen Reihen hintereinander her, und was das eine beginnt, tun die übrigen auch. Einzelne Paare findet man höchst selten, Familien, die aus fünfzehn bis zwanzig Stück bestehen, schon öfter, gewöhnlich aber sehr zahlreiche Ketten, die unter Umständen aus sechs bis acht Familien zusammengesetzt sein können. Die Familien halten eng zusammen, und auch die Gesperre bleiben stets im innigsten Verbände. Wird eine Familie, ein Volk oder Gesperre irgendwie erschreckt, so zerteilt es sich, so daß, streng genommen, sich jedes einzelne seinen Weg wählt. Alles rennt, läuft und flüchtet oder fliegt und flattert so eilig wie möglich einem Zufluchtsort zu; aber sofort nach Eintritt einer gewissen Ruhe lassen die Hähne ihre Trompetenföne erschallen und locken das ganze Volk rasch wieder zusammen. Bloß dann, wenn sie bereits Verfolgungen erfahren haben, versuchen sie, sobald sie aufgescheucht wurden, sich durch Fliegen zu retten; jedoch auch jetzt noch verlassen sie sich, solange es irgend geht, auf ihre behenden Füße. Zuweilen laufen sie mehrere Minuten lang vor dem Jäger her, ehe sie sich erheben; dabei halten sie übrigens immer vorsichtig einen für das Schrotgewehr zu großen Abstand ein, wissen auch jedes Gebüsch, jeden Felsblock vortrefflich zu benutzen. Ein alter Hahn leitet die ganze Gesellschaft. Er ist stets voraus und bestimmt unter allen Umständen die Richtung der Flucht, auch dann noch, wenn diese mit Hilfe der Flügel fortgesetzt wird. Nach einem Schuß stiebt das Volk in verschiedenen Abteilungen auf, und diese wenden sich anfangs nicht gleich nach einer und derselben Gegend hin, sondern fallen gewöhnlich noch ein paarmal ein, ehe sie sich anschicken, zum Leithahn zurückzukehren. Er eilt regelmäßig dem geschütztesten Orte zu, sei dieser nun ein undurchdringliches Dickicht oder ein Fels am Gehänge, beginnt sofort nach dem Einfallen laut zu trompeten oder zu schreien und setzt sich dabei auf die höchsten Punkte, z.+B. auf Felsblöcke, ganz frei, wie er es sonst nie zu tun pflegt, gleichsam in der Absicht, sich dem zerstreuten Volk zu zeigen. Letzteres läuft und fliegt nun sobald wie möglich wieder zusammen und treibt es wie zuvor. Anders benehmen sich die Perlhühner, wenn sie ein Hund oder ein anderes vierfüßiges Raubtier verfolgt. Sie wissen, daß sie es jetzt mit einem Feinde zu tun haben, dem sie laufend ebensowenig entrinnen können als mit Hilfe ihrer bald ermattenden Flügel. Deshalb bäumen sie so rasch wie immer möglich, und dann sind sie kaum wieder zum Ausfliegen zu bringen. Werden sie von einem harmlosen Reisenden oder beutesatten Jäger aufgescheucht und nicht durch Schüsse aufgeschreckt, so fliehen sie wie sonst, jedoch nicht weit weg, setzen sich auf einen hohen Punkt, blicken den Verfolger neugierig an, werfen den Kopf in sonderbarer Weise vor- und rückwärts, brechen endlich in gellendes Geschrei aus und setzen hierauf die Flucht fort. Zum Schlafen wählen alle Arten erhabene Stellen, die ihnen die größte Sicherung versprechen. Lieblingsschlafplätze sind hohe Bäume an Flußufern; ebenso steigen sie, wenn der Abend naht, in Gebirgen an Felswänden empor und suchen hier andern Tieren, wenigstens Raubsäugetieren, unzugängliche Grate und Felsspitzen zum Schlafen aus. »Selbst während der Nacht«, sagt Heuglin, »entgeht ihnen nichts Außergewöhnliches; ist es in der Umgebung ihres Rastplatzes nicht geheuer, so lärmen sie stundenlang. Während unseres Aufenthaltes im Bogoslande zeigten gezähmte, die die Nacht auf einem taubenhausähnlichen Gerüst verbrachten, uns auf diese Weise die Annäherung von Leoparden, Hyänen, Wildkatzen, Genetten, großen Ohreulen und dergleichen an, und es glückte mir, auf ihren Angstruf hin, mehrmals solche Raubtiere mitten in den Gehöften und selbst auf den Strohdächern der Häuser zu erlegen.«
Man darf wohl behaupten, daß die Perlhühner den mit niederem Gras bewachsenen oder ganz verdorrten Blößen einen prächtigen Schmuck verleihen. Die dunklen Vögel verschwinden zwischen den ihnen ähnlich gefärbten Steinen, heben sich aber scharf ab von den grün oder graugelb erscheinenden Grasflächen. Verkennen wird man sie nie; der wagerecht gehaltene Körper, die locker getragenen, wie gesträubt erscheinenden Bürzelfedern und der dachförmig abfallende Schwanz sind für ihre Gestalt so bezeichnend, daß nur der Ungeübte sie mit irgendeinem andern Huhn verwechseln könnte.
Die Nahrung wechselt je nach der Gegend und Örtlichkeit oder auch nach der Jahreszeit. Im Frühling, wenn die Regen fallen, werden Kerbtiere wahrscheinlich das Hauptfutter bilden, denn ich fand ihren Kropf zuweilen vollständig mit Heuschrecken angefüllt; später fressen sie Beeren, Blätter, Knospenblätter, Grasspitzen und endlich Körner aller Art. Auf Jamaika kommen sie in den kühleren Monaten des Jahres in zahlreichen Gesperren aus ihren Wäldern hervor, verteilen sich über die Felder und richten hier bedeutenden Schaden an. Ein tiefes Loch wird, wie Gosse erzählt, in kürzester Zeit ausgetieft, die Samenwurzel bloßgelegt und sofort aufgefressen oder wenigstens zerstört. Zur Pflanzzeit des Yam werden sie noch lästiger, weil sie jetzt die Saatwurzeln ausscharren. »Das Korn«, versichert Cham, »ist kaum gesät, so wird es bereits wieder ausgegraben und aufgepickt.« Als auffallend hebt Gosse hervor, daß sie süße Kartoffeln hartnäckig verschmähen.
Über die Fortpflanzung habe ich eigene Beobachtungen nicht angestellt, mindestens niemals ein Nest mit Eiern gefunden, Junge unter Führung ihre Eltern aber oft gesehen. Gerade diese Beobachtungen, die ich an Familien sammelte, bestimmen mich anzunehmen, daß das Perlhuhn in Einehigkeit lebt. Heuglin fand die Nester des Pinselperlhuhns während der Regenzeit meist unter Buschwerk und im Hochgrase. Sie bestehen in einer kleinen natürlichen oder künstlichen Vertiefung im Boden, um die etwas dürres Laub oder Steppengras liegt. Das Gelege zählt fünf bis acht, zuweilen auch mehr, schmutzig braungelblichweiße, ziemlich glänzende und ungemein hartschalige Eier. Die Brutdauer beträgt fünfundzwanzig Tage. »Hahn und Henne entfernen sich niemals von ihrer Brut und suchen durch Lärmen und hastiges Hin- und Herlaufen die Aufmerksamkeit des Menschen auf sich zu ziehen.« Die Küchlein im Flaumkleide gleichen an Ansehen und Wesen jungen Fasanen, werden bald nach dem Ausschlüpfen von den Alten weggeführt, wachsen rasch heran und folgen bereits, wenn sie die halbe Größe der Eltern erreicht haben, diesen auf allen Streifereien, bäumen dann auch schon nachts regelmäßig mit ihnen.
Perlhühner lassen sich leichter eingewöhnen als irgendein anderes Wildhuhn, werden aber nicht leicht und kaum jemals vollständig zahm, schreiten auch nur dann zur Fortpflanzung, wenn sie weiten Spielraum haben. Dagegen kann man Gefangene bald so weit gewöhnen, daß sie in Haus und Hof umherlaufen, oder selbst an einen Reisewagen derart fesseln, daß sie auf dem jedesmaligen Rastplatze umherlaufen dürfen, weil sie sich am Morgen beim Weiterziehen wieder pünktlich beim Wagen einfinden und ohne Umstände von neuem in ihre Käfige sperren lassen. Sie sind zänkisch, liegen mit Haus- und Truthühnern beständig im Streit, werden so bösartig, daß sie Kinder und erwachsene Hähne angreifen, streifen weit umher, verstecken ihr Nest soviel wie möglich, brüten nicht eifrig und können starke Kälte nicht vertragen. Andererseits erfreuen sie durch ihre ewige Rastlosigkeit, ihr hübsches Gefieder und die sonderbaren Stellungen und Bewegungen, die sie beim Laufen annehmen. Das Geierperlhuhn unterscheidet sich, wenn ich von dem von mir beobachteten auf das Betragen anderer schließen darf, sehr zu seinem Vorteil von den übrigen. Es trägt sich zierlicher, erscheint schlanker, weil es den Kopf erhebt, und nimmt selten die eckige Gestalt an, die gerade seine Familienverwandten kennzeichnet. Bemerkenswert scheint mir seine große Gutmütigkeit und Sanftheit zu sein. Eins, das ich pflegte, wurde nach kurzer Zeit ungemein zahm, trat mit seinem Wärter in ein sehr inniges Verhältnis, lieh sich von diesem fangen, ohne sich zu sträuben hin und her tragen, an einen bestimmten Ort setzen und hier so lange festhalten, als der Wärter für gut befand. Die Wärme liebte es noch mehr als andere Perlhühner. Im Sommer sah man es während der Mittagshitze behaglich in den Strahlen der Sonne sich dehnen und recken, während andere Perlhühner zu derselben Zeit unter schattigen Büschen Schutz suchten. Bei heftigem Winde verkroch es sich fast ängstlich an einer geschützten Stelle, verweilte hier während des ganzen Tages oder begehrte selbst an der Tür seines Hauses Einlaß. Gerade das Geierperlhuhn würde unsern Hühnerhöfen zur größten Zierde gereichen: aber freilich scheint es, daß es der Züchtung in der Gefangenschaft noch größere Schwierigkeiten in den Weg legen wird als das gemeine Perlhuhn, dessen Eier man bei uns nur ausnahmsweise der rechten Mutter überläßt und gewöhnlich Trut- oder Haushühnern zum Brüten unterlegt.
Die Perlhühner haben sehr viele Feinde. Alle Katzen Afrikas, vom Leoparden oder Geparden an bis zum Luchs herab, alle Schakale und Füchse stellen den Alten und Jungen, die Schleichkatzen namentlich den Eiern und Küchlein nach; alle größeren Raubvögel jagen eifrig auf dieses so leicht zu bewältigende Wild, und selbst die Kriechtiere erlangen es nicht selten; wir fanden im Magen einer 2,5 Meter langen Riesenschlange ein vollständig ausgewachsenes Perlhuhn. Der Mensch jagt sie überall mit einer gewissen Vorliebe, weil sie sich ohne besondere Mühe berücken lassen, obwohl sie, wenn sie Verfolgungen verspüren, bald sehr scheu werden. Dazu kommt nun noch, daß ihre reiche Befiederung die meisten Schüsse unwirksam macht, daß sie selbst das beste Gewehr zu verspotten scheinen. Ganz anders ist es, wenn man einen guten Hund mit zur Verfügung hat und diesen auf ihre Fährte setzt. Ihre Furcht vor dem Vierfüßler verblüfft sie so, daß sie den gefährlicheren Feind gänzlich verkennen, und nicht selten geschieht es, daß sie sich geradezu mit der Hand wegnehmen oder doch, wenn sie gebäumt haben, ohne alle Umstände vom Ast herabschießen lassen.
*
Die Truthühner ( Meleagrinae), die die letzte Unterfamilie bilden, sind große, schlank gebaute, hochbeinige, kurzflügelige und kurzschwänzige Fasanvögel. Der Schnabel ist kurz, stark, oben gewölbt und gebogen, der Fuß ziemlich hoch und langzehig, der Fittich sehr gerundet, in ihm die dritte Schwinge die längste, der aus achtzehn breiten, aufrichtbaren Federn gebildete Schwanz ein wenig abgerundet, das Gefieder reichlich, aber derb, jede einzelne Feder groß und breit, die Färbung eine sehr glänzende. Kopf und Oberhals sind unbefiedert und mit Warzen bewachsen; von der Oberschnabellade hängt eine zapfenförmige, ausdehnbare Fleischklunker, von der Gurgel eine schlaffe Haut herab. Als besondere Eigentümlichkeit muß noch hervorgehoben werden, daß sich einzelne Federn der Vorderbrust in borstenartige Gebilde umwandeln, die das übrige Gefieder an Länge weit überragen. Die Gruppe verbreitet sich über den Osten und Norden Amerikas.
Das Truthuhn oder der Puter ( Meleagria gallopavo) ist auf der Oberseite bräunlichgelb, prachtvoll metallisch schimmernd, jede Feder breit samtschwarz gesäumt, auf dem Unterrücken und den Schwanzdeckfedern tief nußbraun, grün und schwarz gebändert, auf der Brust gelblichbraun, seitlich dunkler, auf Bauch und Schenkel bräunlichgrau, in der Steißgegend schwärzlich, die Säumung der Federn minder deutlich: die Schwingen sind schwarzbraun, die Handschwingen graulichweiß, die Armschwingen bräunlichweiß gebändert, die Steuerfedern aus gleichfarbigem Grunde schwarz gewellt, gebändert uns sein gesprenkelt, die nackten Kopf- und Halsteile hellhimmelblau, unterhalb des Auges ultramarinblau, die Warzen lackrot. Das Auge ist gelbblau, der Schnabel weißlich hornfarben, der Fuß blaßviolett oder lackrot. Die Länge beträgt einhundert bis einhundertzehn, die Breite etwa einhundertfünfzig, die Fittichlänge sechsundvierzig, die Schwanzlänge vierzig Zentimeter. Das Gefieder des Weibchens ist minder schön und lebhaft, dem des Hahnes jedoch ähnlich. Die Länge beträgt fünfundachtzig, die Breite einhundertzweiundzwanzig, die Fittichlänge vierzig, die Schwanzlänge achtundzwanzig Zentimeter. Auf dem Festlande Mittelamerikas wird das Truthuhn durch das etwas kleinere, prachtvolle Pfauentruthuhn ( Meleagris ocellata) vertreten, das, wie der Name andeutet, die Schönheit des Pfaus mit der Gestalt des Truthuhns vereinigt.
Über das Freileben des Truthuhns liegen viele Berichte vor, keiner von ihnen aber übertrifft die Schilderung, die wir Audubon verdanken. Die Wälder der Staaten Ohio, Kentucky, Illinois und Indiana, Arkansas, Tennessee und Alabama beherbergen noch heutigestags Truthühner in namhafter Anzahl. In Georgia und Karolina sind sie minder häufig, in Virginien und Pennsylvanien schon selten, in den dichtbevölkerten Staaten bereits ausgerottet. Sie leben zeitweilig in großen Gesellschaften und treten unregelmäßige Wanderungen an, indem sie werdend die Waldungen durchwandern, bei Tage auf dem Boden fortlaufen und nachts auf hohen Bäumen rasten. Gegen den Oktober hin, wenn noch wenige von den Baumsamen zu Boden gefallen sind, reisen sie dem Tieflande des Ohio und Mississippi zu. Die Männchen vereinigen sich in Gesellschaften von zehn bis hundert Stück und suchen ihre Nahrung für sich allein; die Weibchen schlagen sich mit ihren halberwachsenen Jungen in fast ebenso zahlreiche Banden zusammen und verfolgen abgesondert denselben Weg. So geht es weiter, immer zu Fuß, solange nicht ein Jagdhund oder ein anderes vierfüßiges Raubtier störend dazwischentritt oder ein breiter Fluß den Weg abschneidet. Gelangt eine Truthuhngesellschaft ans Ufer eines solchen, so sammelt sie sich zunächst auf dem höchsten Punkte und verweilt hier manchmal tagelang, gleichsam beratend, ehe sie sich entschließt, überzusetzen. Die Männchen blähen sich auf und kollern, als ob sie sich selbst Mut einzusprechen hätten, und die Weibchen und Jungen ahmen ihnen nach, so gut sie können, bis schließlich bei ruhigem Wetter das Wagstück unternommen und der Strom überflogen wird. Ein einziges »Gluck« des Leithahnes gibt das Zeichen und die Flugreise beginnt. Den alten Vögeln wird es nicht schwer überzusetzen, selbst wenn der Fluß eine englische Meile breit sein sollte; die jüngeren und minder kräftigen aber fallen oft unterwegs auf das Wasser herab und müssen dann versuchen, das Ufer schwimmend zu erreichen. Sie schließen dabei die Flügel fest an den Leib, breiten den Schwanz, strecken den Hals nach vorn und greifen mit ihren Füßen so weit aus wie sie können, erreichen auch gewöhnlich das feste Land. Hier aber laufen sie anfänglich wie betäubt umher und vergessen die ihnen sonst eigene Vorsicht oft so, daß sie dem Jäger leicht zur Beute fallen. Wenn sie in eine nahrungsreiche Gegend kommen, pflegen sie sich in kleinere Gesellschaften zu zerteilen, und nunmehr mischt sich alt und jung untereinander. Dies geschieht gewöhnlich Mitte November. Später kann es vorkommen, daß sie sich, abgemattet von der Wanderung, Bauernhäusern nähern, unter den Hühnerstand mischen und mit ihm in Hof und Stall eintreten.
Mitte Februar regt sich der Fortpflanzungstrieb. Die Weibchen trennen sich von den Männchen, und von nun an schlafen die Geschlechter gesondert, jedoch in nicht weiten Entfernungen voneinander. Stößt eines der Weibchen seinen Lockruf aus, so antworten alle Hähne, die ihn hören, mit schnell aufeinander folgenden rollenden Tönen. Erschallt der Lockruf vom Boden herauf, so fliegen alle sofort hernieder, schlagen in dem Augenblick des Auffallens, gleichviel, ob ein Weibchen in Sicht ist oder nicht, ein Rad, werfen den Kopf auf die Schulter zurück, schleifen mit den Flügeln und geben die sonderbaren Stellungen, Laute und Geräusche zum besten, die wir bei den gezähmten Nachkommen zu sehen gewohnt sind. Dabei geschieht es nicht selten, daß zwei Männchen miteinander in Streit geraten und so heftig kämpfen, daß einer unter den Schlägen des andern sein Leben aushauchen muß. Als auffallend hebt Audubon hervor, daß der Sieger seinen getöteten Gegner keineswegs mit Haß betrachtet, sondern sich vor ihm ebenso gebärdet, als ob er eine Henne liebkosen wolle. Hat der Hahn eine solche entdeckt und sich ihr genähert, so ahmt sie, wenn sie älter als ein Jahr ist, seine Stellungen in der Regel nach, naht dann aber ihrerseits, legt sich aus den Boden und fordert ihn so zur Begattung auf. Jüngeren Hennen gegenüber beträgt sich der verliebte Hahn weniger pomphaft, bewegt sich mit großer Schnelligkeit, erhebt sich zuweilen vom Boden, fliegt um sie herum, rennt nach dem Auffußen mit aller Macht auf sie zu, verscheucht ihre Furcht durch ein Knurren und erringt sich schließlich auch ihre Willfährigkeit. Es scheint, daß ein Hahn und eine Henne, die sich in dieser Weise vereinigen, während des Sommers in einer gewissen Verbindung bleiben, wennschon der erstere seine Aufmerksamkeit keineswegs einem einzigen Weibchen widmet. Die Hennen ihrerseits folgen dem bevorzugten Hahne, bis sie zu legen beginnen und sich nunmehr vereinzeln und vor dem Hahn verstecken. Dieser zeigt sich lässig und faul, sobald er seinem Fortpflanzungstriebe genügt hat, unterläßt Kämpfe mit andern seiner Art, kollert weniger und bekümmert sich kaum noch um die Hennen, die nun ihrerseits um den unhöflichen Gemahl stöhnen, ihm um den Bart gehen, ihn liebkosen und alle Mittel in Bewegung setzen, die erstorbene Glut seiner Gefühle wieder anzufachen. Schließlich trennen sich die Hähne gänzlich von den Hennen, und dann werden sie zuweilen so faul, so gleichgültig, daß sie selbst den feindlichen Menschen kaum mehr beachten.
Wenn das Frühjahr trocken ist, sucht sich die Henne Mitte April einen geeigneten, möglichst versteckten Nistplatz aus. Das Nest besteht aus einer seichten, liederlich mit Federn ausgekleideten Vertiefung; das Gelege zählt zehn bis fünfzehn, zuweilen auch zwanzig, auf dunkelrauchgelbem Grunde rotgepunktete Eier. Dem Nest naht sich die Henne stets mit größter Vorsicht und deckt, wenn sie es verläßt, die Eier sorgfältig mit trockenen Blättern zu, so daß es schwer ist, das eine und die andern zu bemerken, auch in der Tat nur wenige gefunden werden, von denen man nicht die erschreckte Mutter vertrieb. Gewahrt diese, während sie brütet, einen Feind, so drückt sie sich nieder und rührt sich nicht, bis sie merkt, daß sie entdeckt wurde. Wird das Gelege zerstört, so brütet sie zum zweiten Male. Zuweilen geschieht es, daß mehrere Mütter in ein und dasselbe Nest legen; Audubon fand einmal ihrer drei auf zweiundvierzig Eiern sitzen. In solchem Falle wird das gemeinschaftliche Nest stets von einem der Weibchen bewacht, so daß keines der schwächeren Raubtiere die Brut gefährden kann. Gegen das Ende der Bebrütung hin verläßt die Henne unter keiner Bedingung ihr Nest, gestattet auch, wie die Auerhenne, daß man einen Zaun um dasselbe anbringt.
Audubon war einst Zeuge von dem Ausschlüpfen einer Brut junger Truthühner, deren er sich bemächtigen wollte. Wenige Schritte von dem Nest entfernt lag er beobachtend auf dem Boden. Die Alte erhob sich zu halber Höhe ihrer Füße, schaute ängstlich auf die Eier, gluckste besorgt, entfernte vorsichtig jede Schalenhälfte und liebkoste mit ihrem Schnabel die Küchlein, die taumelnd versuchten, das Nest zu verlassen. Er sah sie alle die Schale verlassen und wenige Minuten später sich schwankend, rollend und rennend vorwärtsbewegen. Ehe die Alte das Nest verließ, schüttelte sie sich heftig, ordnete die Federn, nahm eine ganz andere Haltung an, erhob sich, streckte ihren Hals lang aus und sandte ihre Blicke sichernd nach allen Seiten hin, breitete ihre Flügel ein wenig, gluckste zärtlich und bemühte sich, die Küchlein zusammenzuhalten.
Da das Ausschlüpfen gewöhnlich erst gegen Abend geschieht, kehrt die Familie in der Regel zum Nest zurück und verbringt hier die erste Nacht. Hierauf entfernt sie sich auf eine gewisse Strecke und sucht sich das höchste Land der Gegend aus, weil die Mutter Nässe als das ärgste Übel für ihre zarten Jungen fürchtet. Schon mit dem vierzehnten Tage ihres Lebens sind die Jungen, die bisher auf dem Boden verharren mußten, fähig, sich zu erheben, und von jetzt an fliegt die Familie gegen Abend stets zu einem niederen Zweige auf und verbringt hier, unter den gewölbten Flügeln der Mutter geschützt und geborgen, die Nacht. Noch etwas später verläßt die Alte mit den Küchlein die Wälder während des Tages, um auf Blößen oder Wiesen den Reichtum an verschiedenen Beeren auszunutzen und den wohltätigen Einfluß der Sonne zu genießen. Von jetzt an wachsen die Jungen außerordentlich schnell. Schon im August sind sie befähigt, sich vor einem Angriff vierfüßiger Tiere zu schützen; ja, der junge Hahn fühlt bereits männliche Kraft in sich und übt sich in pomphaftem Einherschreiten und Kollern. Um diese Zeit finden sich Alte und Junge wieder zusammen und beginnen ihre Wanderung.
Es geschieht nicht selten, daß sich wilde Truthähne gezähmten zugesellen, mit den Hähnen streiten und um die Liebe der Hennen werben. Von letzteren werden sie mit Freuden empfangen, aber auch von deren Eigentümern gern gesehen, weil die Küchlein, die solchen Besuchen ihr Dasein verdanken, sehr zu ihrem Vorteil vor den in der Gefangenschaft gezüchteten sich auszeichnen. Oft legt man auch die im Walde gefundenen Eier zahmen Truthühnern unter und erzielt hierdurch Junge, die zwar noch etwas von den Sitten der wildlebenden beibehalten, sich aber doch bald an die Gefangenschaft gewöhnen und unter Umständen sehr zahm werden. Audubon besaß einen Hahn, der wie ein Hund nachfolgte und sich im wesentlichen ganz wie ein zahmer betrug, aber niemals mit den andern in den Stall ging, sondern zum Schlafen stets den First des Gehöftes wählte. Als er älter wurde, flog er tagtäglich in den Wald hinaus, kehrte jedoch mit Sonnenuntergang zurück.
Obgleich das Truthuhn Pekannüsse und die Frucht der Winterrebe bevorzugt und sich da, wo diese Früchte häufig sind, stets in Menge findet, frißt es doch auch Gras und Kräuter der verschiedensten Art, Getreide, Beeren, Früchte und ebenso Kerbtiere, kleine Heuschrecken und dergleichen.
Im Laufen öffnen die Truthühner oft die Flügel ein wenig, als ob ihnen das Gewicht ihres Leibes zu schwer wäre; dann rennen sie auf einige Meter mit weit geöffneten Schwingen dahin, oder springen zwei- oder dreimal hoch in die Luft und setzen hierauf ihren Weg aus dem Boden fort. Beim Futtersuchen tragen sie den Kopf hoch, als ob sie beständig Umschau halten müßten; währenddem kratzen sie mit den Füßen, halten plötzlich ein und nehmen mit dem Schnabel etwas vom Boden auf, gleichsam als ob sie das mit den Zehen gefühlt hätten. Während des Sommers begeben sie sich auf die Waldpfade oder Wege, such wohl auf frisch gepflügt: Felder, um sich hier zu paddeln. Im Winter nach längerem Schneefalle und namentlich, wenn der Frost eine harte Kruste auf die Schneedecke gelegt hat, verweilen sie manchmal drei oder vier Tage nacheinander auf ihren Schlafplätzen und fasten; sind aber Ansiedlungen in der Nähe, so kommen sie, Nahrung suchend, zu den Ställen oder zu den Kornfeimen. Bei Schneewetter durchlaufen sie, aufgescheucht, sehr bedeutende Strecken, und zwar, so ungeschickt dies aussieht, mit solcher Schnelligkeit, daß ihnen kein Pferd nachkommen kann; dagegen geschieht es im Frühjahre, wenn sie sich durch ihre Liebestollheit abgemattet haben, auch wiederum, daß ein guter Hund sie im Laufen fängt.
Unter den zahllosen Feinden, die ihnen nachstellen, sind nächst dem Menschen die gefährlichsten der Luchs, die Schneeeule und der Uhu. Der Luchs verfolgt alt und jung, säuft auch die Eier aus; die Eulen nehmen namentlich nachts viele von den Bäumen weg; gegen sie aber verteidigen sich die Truthühner oft mit Erfolg. Wird eine lautlos nahende Eule entdeckt, so mahnt ein warnendes »Gluck« die ganze Gesellschaft, auf ihrer Hut zu sein. Sofort erheben sich sämtliche Schläfer und achten auf jede Bewegung der Eule, die schließlich, nachdem sie sich ein Opfer ausersehen, wie ein Pfeil gestrichen kommt, auch den Truthahn unabänderlich ergreifen würde, wüßte dieser nicht auszuweichen. Sobald die Eule heranschießt, beugt er seinen Kopf tief herab und breitet gleichzeitig seinen Schwanz über den Rücken, verwirrt dadurch den Angreifer, der günstigenfalls ein Paar Federn erwischt, fällt auf den Boden herab und rennt dem ersten besten Busche zu, um sich hier zu verbergen.
Jagd und Fang des Truthuhnes werden überall in Amerika mit Leidenschaft, nicht immer aber auch mit Schonung betrieben. Man erlegt den Hahn besonders gern während der Balz, die er zuweilen auf den Bäumen abhält, und beschleicht ihn dann ganz in derselben Weise, wie wir unsern Auerhahn, oder gebraucht Hunde zum Aufstöbern, stellt sich auf den erkundeten Schlafplätzen oder in der Nähe nahrungversprechender Plätze an usw. Die Jagd erfordert einen ausgelernten Jäger, weil die Scheu dieses Wildes Sonntagsschützen das Handwerk von vornherein verleidet. Viel leichter ist der Fang, eine Art desselben auch sehr bezeichnend für die Dummheit dieser Vögel. In den Waldungen schichtet man Stämme von zwei bis drei Meter Länge wie die Balken eines Blockhauses auf, bedeckt das Gebäude oben mit Reisig und bringt unten eine Tür an, groß genug, einen starken Hahn durchzulassen. Das Innere der Falle wird reichlich mit Mais geködert und von der Tür aus dieses beliebte Lockfutter auf eine Strecke hin ebenfalls verstreut. Vorübergehende Truthühner finden die erwünschte Speise, folgen ihr bis zur Tür, sehen im Innern der Falle reichliche Nahrung und kriechen hinein; einer folgt dem andern, und so vereinigt sich zuweilen das ganze Volk in dem geräumigen Innern und frißt die hier verstreuten Körner auf. Anstatt nun aber wieder zur Tür hinauszukriechen, bleiben die Vögel in der Falle, stecken überall zwischen den Balken die Köpfe durch und mühen sich vergeblich ab, sich hier durchzuzwängen. Keiner von ihnen findet den Ausweg, und der Fänger holt sich am nächsten Morgen die ganze Gesellschaft heraus.
Das Truthuhn wurde sehr bald nach der Entdeckung Amerikas zu uns herübergebracht. Gegenwärtig ist es als Hausvogel überall verbreitet. Am häufigsten wohl findet man es in Spanien und namentlich in den Gehöften, die fern von den Dörfern inmitten des dürren Campo errichtet wurden. Hier sah ich Herden von mehreren hundert Stück unter der Obhut besonderer Hirten, die sie morgens zur Weide trieben, übertags zusammenhielten und abends wieder nach Hause brachten. Bei uns zulande werden Truthühner selten gehalten, obgleich sich ihre Zucht, wenn sie im großen betrieben wird, wohl verlohnt. Manche Hofbesitzer achten sie hoch: die meisten Menschen aber mögen sie ihres polternden, jähzornigen und zanksüchtigen Wesens halber nicht leiden.
*
Großfußhühner oder Wallnister ( Megapodiidae) nennt man Scharrvögel, die Ozeanien und insbesondere Australien bewohnen und sich durch das Brutgeschäft nicht bloß von allen ihren Verwandten, sondern von allen Vögeln der Erde unterscheiden. Alle Wallnister nämlich bringen ihre ungewöhnlich großen Eier in einem aus Erde und Blättern zusammengescharrten Nesthügel unter, in dem sich durch Gärung der Pflanzenstoffe so hohe Wärme erzeugt, daß das Ei zur Entwicklung gelangt. Ihm entschlüpft das Junge vollständig befiedert und so selbständig, daß es fähig ist, sich ohne Hilfe der Eltern zu erhalten.
Mit dem Namen Buschhuhn oder Buschtruthuhn bezeichnen die Ansiedler Neuhollands denjenigen Wallnister, den sie am besten kennengelernt haben. Er vertritt die Sippe der Hühnerwallnister ( Catheturus), ebenso eine gleichnamige Unterfamilie ( Talegallinae). Das Gefieder des Buschhuhns ( Catheturus lathami) ist auf der Oberseite schön schokoladebraun, auf der Unterseite hellbraun, silbergrau gerändert oder gebändert, das Auge hellbraun, die Haut des nackten Kopfes und Halses scharlachrot, die herabhängende Klunker hochgelb, der Schnabel bleigrau, der Fuß hellschokoladebraun. Die Länge beträgt achtzig, die Fittichlänge einunddreißig, die Schwanzlänge fünfundzwanzig Zentimeter. Das Weibchen unterscheidet sich durch geringere Größe und minder entwickelten Halsschmuck vom Männchen.
»Wie weit sich der Verbreitungskreis dieses Vogels ausdehnt«, sagt Gould, »ist noch nicht hinlänglich ermittelt. Man kennt ihn aus verschiedenen Teilen Neusüdwales vom Kap Howe bis zur Moretonbai; Macgillivray versicherte mir auch, daß er ihn an der östlichen Küste bis Port Molle hin erlegt habe; die häufigen Jagden in den Wäldern von Illanvarra und Maitland haben ihn aber schon so vermindert, daß er möglicherweise jetzt hier bereits ausgerottet ist. Am häufigsten, vermute ich, hält er sich in den dichten und noch wenig betretenen Buschhölzern des Manning und Clarence auf. Zuerst glaubte ich, daß das Land zwischen dem Gebirge und der Küste seine einzige Heimat sei, und war daher nicht wenig überrascht, ihn in den buschigen Schluchten und auf kleinen Hügeln zu treffen, die von dem großen Gebirgszuge des Innern ausgehen.
Der merkwürdigste Umstand in der Lebensweise des Buschhuhns besteht darin, daß es seine Eier nicht nach Art anderer Vögel bebrütet. Mit Beginn des Frühlings scharrt sich der Vogel einen sehr großen Haufen aus abgestorbenen Pflanzenteilen zur Unterlage seiner Eier zusammen und überläßt die Entwicklung seiner Jungen der Wärme, die die Zersetzung jener Pflanzenstoffe hervorbringt. Der zu diesem Zweck aufgeschichtete Haufen wird mehrere Wochen vor der Legezeit errichtet, ist breit kegelförmig, schwankt jedoch in der Größe so, daß er von zwei bis vier Karrenladungen enthält; ein und dasselbe Gebäude scheint aber, falls man von seiner Größe und der vollkommenen Zersetzung der Stoffe des Unterteiles folgern darf, mehrere Jahre nacheinander benutzt und nur durch Zutat neuer Stoffe wieder brauchbar gemacht zu werden. Der Hügel wird aufgehäuft, indem die Vögel eine gewisse Menge Baustoff mit dem Fuß losscharren und hinter sich nach einem Mittelpunkt werfen. Sie reinigen dabei den Boden ringsum so vollständig, daß kaum ein Blatt oder Grashalm liegen bleibt. Wenn nun der Haufen seine genügende Größe erreicht und sich hinlängliche Wärme in ihm entwickelt hat, werden die Eier in ihn gelegt, und zwar in einem Kreise in der Mitte desselben, in einer Entfernung von fünfundzwanzig bis dreißig Zentimeter voneinander, etwa armtief, aber so, daß sie mit dem breiten Ende nach oben aufrecht stehen, hierauf mit Blättern überdeckt und der Entwicklung überlassen. Mir ist ebensowohl von Eingeborenen wie von glaubwürdigen Ansiedlern versichert worden, daß man aus einem und demselben Haufen zuweilen einen Scheffel Eier ausnehmen kann, und ich selbst habe eine Frau gesehen, die halb soviel in einem benachbarten Dickicht von ihr gefundene nach Hause trug. Einige von den Eingeborenen behaupten, daß das Weibchen sich beständig in der Nähe des Haufens aufhält, um die entblößten Eier wieder zu bedecken und den ausgekrochenen Jungen beizustehen, während andere angeben, daß die Eier eben nur abgelegt würden und die Jungen ihren Weg ohne jegliche Hilfe fänden. Ein Punkt ist vollständig aufgeklärt worden, nämlich daß die Jungen von dem Augenblick ihres Ausschlüpfens an mit Federn bekleidet sind, genügend entwickelte Flügel besitzen, die sie befähigen, auf die Zweige der Bäume zu fliegen, daß sie sich ebenso auf ihre Beine verlassen können, ganz wie ein eben der Puppe entschlüpfter Schmetterling, nachdem derselbe seine Flügel getrocknet hat.«
»Das männliche Buschhuhn« sagt Sclater, »beginnt, wenn die Brutzeit herannaht, innerhalb seines Geheges alle vorhandenen Pflanzenstoffe zusammenzuscharren, indem es dieselben nach hinten wirft, immer einen Fuß voll auf einmal. Da es seine Arbeit stets am äußeren Rande des Geheges anfängt, wird die Masse nach innen in den sich umschließenden Kreis geworfen und mehr und mehr zum Haufen aufgetürmt. Sobald dieser eine Höhe von ungefähr anderthalb Meter erreicht hat, machen sich beide Vögel daran, ihn zu ebnen, und wenn dies geschehen, höhlen sie im Mittelpunkt eine Vertiefung aus. In letzterer werden zu bestimmten Zeiten die Eier abgelegt und ungefähr vierzig Zentimeter unter dem Gipfel in einem Kreise geordnet. Das Männchen beaufsichtigt den Hergang der Entwicklung und namentlich der Wärme des natürlichen Brütofens sehr sorgfältig. Es bedeckt gewöhnlich die Eier und läßt nur eine runde Öffnung, durch die die nötige Luft nach unten gelangt, und durch die die übermäßig gesteigerte Wärme Abfluß findet; bei heißem Wetter aber nimmt es zwei- oder dreimal täglich fast die ganze Decke weg.
Das ausgeschlüpfte Junge verweilt mindestens zwölf Stunden im Innern des Hügels, ohne die geringste Anstrengung zum Herausgehen zu machen, und wird während dieser Zeit vom Männchen ebenso tief vergraben wie der Rest der Eier. Am zweiten Tage kommt es hervor, und zwar mit wohlentwickelten Federn, die beim Ausschlüpfen noch in einer bald platzenden Hülle stecken. Es scheint jedoch keine Neigung zu haben, diese Federn zu gebrauchen, sondern bewegt sich ausschließlich mit Hilfe seiner kräftigen Füße. Nachmittags zieht es sich nach dem Bruthaufen zurück und wird von dem besorgten Vater wieder vergraben, obschon in geringerer Tiefe als früher; am dritten Tage ist es zum Fliegen vollständig befähigt; eins von denen, die im Garten groß wurden, drängte sich um diese Zeit durch die Maschen des Netzes, das das Gehege überdeckte.« Die Eier sind fünfundneunzig Millimeter lang, fünfundsechzig Millimeter dick und reinweiß.
In seinen heimischen Waldungen lebt das Buschhuhn gesellig, gewöhnlich in kleinen Trupps nach Art anderer Hühnervögel. Solche Gesellschaften pflegen scheu und mißtrauisch zu sein, so lange sie auf dem Boden dahinlaufen, während sie die äußerste Sorglosigkeit bekunden, sobald sie gebäumt haben. Beim Laufen durch die Waldungen lassen sie oft einen laut glucksenden Ton vernehmen. »Aufgescheucht«, fährt Gould fort, »vereitelt das Buschhuhn die Verfolgung durch die Leichtigkeit, mit der es durch das verworrene Buschwerk rennt. Wird es hart bedrängt oder von seinem ärgsten Feinde, dem Wildhunde, angefallen, so springt es zum niedersten Zweige eines benachbarten Baumes empor und von Zweig zu Zweig immer höher, bis es den Wipfel erreicht hat, um hier sitzen zu bleiben und von hier aus nach einem der andern Bäume des Waldes zu fliegen. Auch pflegt es im Gezweige Schutz vor der Mittagssonne zu suchen und führt dadurch oft seinen Untergang herbei, da es sich dann dem Schützen als sicheres Ziel bietet. Ist es in kleinen Gesellschaften vereinigt, so kann der Jäger eins nach dem andern von ihnen herabschießen und die ganze Gesellschaft nach Hause bringen. Ohne besondere Mittel für ihre Erhaltung muß diese Fahrlässigkeit der Vögel ihre Ausrottung zur Folge haben. Dies aber würde zu beklagen sein, da ihr Wildbret ein ausgezeichnetes Gericht ist.
Die Hurbelwallnister oder Großfußhühner im engeren Sinne ( Megapodinae) haben gewisse Ähnlichkeit mit Rallen oder Wasserhühnern. »Man findet«, so berichtet schon Pigafetta im Jahre 1520, »auf den Philippinen schwarze Vögel von der Stärke einer Henne, die wohlschmeckende Eier von bedeutender Größe legen. Es wurde uns gesagt, daß das Weibchen diese Eier in den Sand lege und daß die Sonnenwärme hinreiche, sie auskriechen zu lassen.« Carreri vervollständigt diesen ersten Bericht, sieht aber das von ihm und Pigafetta beobachtete Großfußhuhn als Meervogel an. Er erzählt, daß die Eier desselben, die an Größe Gänseeiern gleichkommen, in sandigen Gegenden in ein von ihm ausgescharrtes Loch gelegt und mit Sand bedeckt werden. Dies geschehe im März, April und Mai, zur Zeit, wenn das Meer am ruhigsten ist, die Wogen das Ufer nicht übersteigen und die Eier nicht ersäufen. Die Matrosen suchen gierig die Nester längs dem Strande des Meeres und wissen, daß da, wo die Erde umgearbeitet ist, Eier verborgen wurden.
Das Großfußhuhn ( Megapodius tumulus) ist etwa ebenso groß wie ein weiblicher Fasan. Die Federn des Kopfes sind dunkelrotbraun, die des Rückens und der Flügel zimtbraun, die Ober- und Unterschwanzdeckfedern dunkelkastanienbraun, die Schwingen und Schwanzfedern schwärzlichbraun, die des Hinterhalses und der ganzen Unterseite grau. Das Auge ist hellrötlichbraun, der Schnabel ein wenig dunkler, der Fuß hochorangefarbig.
Gilbert und Macgillivray haben uns die Lebensweise des Vogels kennengelehrt. »Bei meiner Ankunft zu Port Essington«, so berichtet der erstgenannte an Gould, »zogen viele sehr große Erdhaufen meine Aufmerksamkeit auf sich. Es wurde mir gesagt, daß dieselben Grabhügel der Eingeborenen seien; letztere hingegen versicherten mich, daß sie das Großfußhuhn zur Bebrütung seiner Eier erbaut habe. Aber diese Angabe klang so auffallend und schien so sehr im Widerspruch zu stehen mit den Gewohnheiten anderer Vögel, daß niemand in der Ansiedlung an die Wahrheit derselben glaubte, obwohl auch niemand soviel Teilnahme zeigte, um die Sache zu prüfen. Dazu kam, daß die Zweifel vermehrt wurden durch die Größe der Eier, die die Eingeborenen brachten und als jenen Vögeln angehörig bezeichneten. Da ich jedoch wußte, daß die Eier des Taubenwallnisters in ähnlicher Weise gezeitigt werden, beschloß ich, mein Möglichstes zu tun, um über das Tatsächliche klar zu werden, und nachdem ich mir die Hilfe eines gewitzten Eingeborenen verschafft hatte, begab ich mich am sechzehnten November nach Crockers Bai, einem wenig bekannten Teil von Port Essington, der von solchen Vögeln bewohnt wurde.« Gilbert erzählt nun, wie er verschiedene Hausen im Dickicht fand, dieselben untersuchte und schließlich zu der Überzeugung gelangte, daß die Eingeborenen der Wahrheit gemäß berichtet hatten.
Etwas später beobachtete Macgillivray das Großfußhuhn auf Nogo in der Endeavourstraße. Er war während seines längeren Aufenthalts so glücklich, Männchen und Weibchen zu erlegen, und fand auch mehrere Wälle mit Eiern auf. »Wenige Vögel«, sagt er, »sind so scheu und so schwierig zu erlegen wie das Großfußhuhn. Es bewohnt das Gestrüpp, das die Ufer der Buchten und überhaupt den Küstensaum bedeckt; wenigstens fand ich seine Wälle niemals weiter als hundert Meter vom Meer entfernt. Wenn es aufgescheucht wird, erhebt es sich selten mit einem Male, rennt vielmehr eine Strecke weit aus dem Boden hin und steht nun erst auf. Der Flug ist schwerfällig, aber nicht von dem Geräusch begleitet, das die wahren Hühner, wenn sie fliegen, verursachen. Selten fliegt der Hahn weit in einem Zuge dahin, setzt sich vielmehr baldmöglichst auf einen Baum nieder, verweilt hier kauernd mit ausgestrecktem Halse, beobachtet jede Bewegung seines Verfolgers und fliegt weiter, wenn dieser naht. Bloß die sorgfältigste Berücksichtigung aller Deckungen macht es dem Jäger möglich, bis auf Schußweite heranzukommen. Um zu beweisen, wie scheu er ist, will ich erwähnen, daß eine Jagdgesellschaft von drei Leuten, die sich in einem kleinen Dickicht auf Nogo zerstreut hatten, in der Absicht, Großfußhühner zu schießen, nicht ein einziges zu sehen bekamen, obgleich sie mehrere von ihnen aufstörten. Zu Port Essington erlegte ich eins in den Manglegebüschen, deren Wurzeln bei Hochwasser von den Wellen bespült werden, und Kapitän Blackwood tötete ein anderes, während es auf dem Schlamm dahinlief. In beiden Fällen waren die Vögel in der Nähe ihrer Hügel.« Unser Huhn lebt paarweise oder einzeln und nährt sich am Boden. Sein Fraß besteht in Wurzeln, die es ohne Mühe mit Hilfe seiner kräftigen Klauen hervorscharrt, auch wohl in Sämereien und Kerbtieren, besonders in großen Käfern. Die Stimme soll wie das Glucksen des Haushuhns klingen und mit einem Ruf endigen, der an den des Pfaus erinnert.
Die Nesthaufen sind sehr verschieden, ebensowohl was Gestalt und Größe wie auch die Bestandteile anlangt. Die meisten stehen nächst dem Wasserrande und bestehen aus Sand und Muscheln; einige enthalten Schlamm und vermodertes Holz. Gilbert fand einen, der fast fünf Meter hoch war und beinahe zwanzig Meter im Umfange hielt, einen zweiten, der einen Raum bedeckte, dessen Umkreis ungefähr fünfzig Meter betrug; Macgillivray spricht von ebenso großen und hohen. Es ist höchst wahrscheinlich, daß die gewaltigsten dieser Hügel das Werk mehrerer Geschlechter sind und alljährlich benutzt und vergrößert werden. Die eigentliche Nisthöhle beginnt entweder am Innenrande des Gipfels und fällt schief abwärts nach dem Mittelpunkt zu, oder aus dem Gipfel selbst und wendet sich dann nach dem äußeren Abhange hin. Die Eier liegen zwei Meier tief unter der Spitze, sechzig bis neunzig Zentimeter von den Seiten entfernt. Eingeborene erzählten Gilbert, daß die Vögel nur ein einziges Ei in eine Höhle legen und, nachdem dasselbe dort untergebracht ist, die Höhle mit Erde ausfüllen, auch die obere Mündung glätten und abrunden. An den frischen Fußtritten auf der Höhe und an den Seiten des Hügels erkennt man leicht, daß ein Großfußhuhn neuerlich eine Höhle ausgegraben hat. Die Erde, die dieselbe bedeckt, ist dann so locker, daß man mit einer dünnen Rute einbohren und so den Verlauf der Höhle erforschen kann; je leichter die Rute sich einschieben läßt, um so kürzere Zeit verfloß seit dem Eierlegen. Es erfordert eine gewisse Übung und namentlich große Ausdauer, um die Eier selbst zu erhalten. Die Eingeborenen graben mit der Hand und heben nur so viel Sand ans, als unbedingt nötig ist, um ihren Körper einschieben und die Stoffe zwischen ihren Beinen durchwerfen zu können. Ihre Geduld wird aber oft auf eine sehr harte Probe gestellt; denn sie graben manchmal bis zu zwei Meter tief, ohne Eier zu finden, und werden währenddem von der Hitze und von Millionen Sand- und Stechfliegen fürchterlich gequält. Die Eier stehen immer senkrecht, die dickeren Enden nach oben, sind in der Größe ziemlich verschieden, ähneln sich aber in der Gestalt. Ihr Längsdurchmesser beträgt ungefähr neun, ihr Querdurchmesser sechs Zentimeter. Die Färbung wechselt je nach der Beschaffenheit der Stoffe, die sie umgeben; diejenigen, die in schwarzer Erde liegen, sind regelmäßig dunkelrötlichbraun, diejenigen, die in Sandhügel abgelegt werden, schmutzig gelblichweiß. Die Farbe hängt aber nur mit einem das Ei dünn bedeckenden Häutchen zusammen. Sprengt man dasselbe, so findet man, daß die Schale eigentlich weiß aussieht. Nach Versicherung der Eingeborenen werden die Eier nachts und in Zwischenräumen von mehreren Tagen abgelegt.
Das Ausschlüpfen der Jungen wurde weder von Gilbert noch Macgillivray beobachtet, ersterer fand aber einen jungen Vogel in einer Höhlung von sechzig Zentimeter Tiefe; derselbe lag auf einigen dürren Blättern und schien nur wenige Tage alt zu sein. Gilbert wandte alle Sorgfalt an, um ihn aufzuziehen, und setzte ihn in eine mäßig große Kiste, die er zum Teil mit Sand anfüllte. Er fraß ohne sonderliche Umstände gequetschte Körner, und sein Pfleger gab sich deshalb schon der besten Hoffnung hin. Allein der Vogel war so wild und unbändig, daß er die Gefangenschaft nicht ertragen wollte und freigelassen werden mußte. Solange er in der Kiste steckte, kratzte er den Sand unaufhörlich auf Haufen, indem er ihn aus der einen Ecke des Kastens in die andere warf. Dies geschah mit überraschender Schnelligkeit und unverhältnismäßig großer Kraft; denn der kleine Gesell hatte eben die Größe einer Wachtel. Zum Scharren im Sande gebrauchte er nur einen Fuß; mit ihm faßte er eine gewisse Menge von Sand und warf sie ohne anscheinende Anstrengung hinter sich. Tiefe Arbeitslust scheint auf angeborener Unruhe begründet zu sein und mehr das Verlangen, die kräftigen Beine zu beschäftigen, auszudrücken, als mit der Ernährung im Zusammenhange zu stehen. In der Nacht war er so unruhig und gab sich so große Mühe zu entfliehen, daß sein Pfleger vor dem von ihm verursachten Lärm nicht schlafen konnte.
*
Die Hokkovögel ( Cracidae) bilden eine höchst eigenartige Familie unserer Ordnung. Bei den Hokkos im engeren Sinne ( Cracinae), die man in einer Unterfamilie zu vereinigen pflegt, ist der Schnabel am Grunde regelmäßig mit einer Wachshaut überkleidet und durch Höcker verziert, die während der Paarungszeit noch bedeutend aufschwellen, das Gefieder auf dem Scheitel und Hinterkopf meist zu einer kammförmigen Haube verlängert, die aus schmalen, steifen, sanft rückwärts, an ihrer Spitze aber wieder vorwärts gekrümmten Federn besteht.
Der Hokko ( Crax alector), dessen Name zur Bezeichnung der Gesamtheit gedient hat, trägt einen gelben Fleischhöcker auf der Wurzel des Schnabels und ist bis auf den weißen Bauch, den Steiß und den Endsaum der Schwanzfedern glänzend blauschwarz. Das Auge ist braun, der Schnabel an der Wurzel blaß wachsgelb, übrigens hornfarben, der Fuß fleischrot. Die Länge beträgt ungefähr fünfundneunzig, die Fittichlänge zweiundvierzig, die Schwanzlänge zweiunddreißig Zentimeter. Das Weibchen soll nur am Kopf, Hals, aus der Brust und auf dem Rücken schwarz, auf dem Bauch rostrot, auf Flügel und Unterschenkel rostrotgelb gewellt sein. Der Hokko verbreitet sich über das Innere Brasiliens, von Guayana bis Paraguay und wird dort in allen Wäldern gefunden. Aus den mir bekannten Berichten der Naturforscher, die an Ort und Stelle beobachteten, und den Erfahrungen, die wir an gefangenen Vögeln sammeln konnten, scheint hervorzugehen, daß seine Lebensweise der anderer Arten entspricht; es dürfte daher angemessen sein, ein allgemeines Lebensbild zu zeichnen.
Die Hokkos sind an Bäume gebunden und verlassen den Wald höchstens auf kurze Zeit. Man trifft sie zwar oft auch auf dem Boden an und beobachtet, daß sie hier, falls der Grund eben, mit großer Schnelligkeit einherrennen; in der Regel aber sieht man sie im Gezweige der Bäume, während der Brutzeit paarweise, außerdem zu drei, vier und mehr Stück beisammen. Im Gezweige bewegen sie sich langsam, obschon mit verhältnismäßigem Geschick; der Flug hingegen ist niedrig, geschieht in wagerechter Richtung und hat keine lange Dauer. Sämtliche Arten fallen auf durch ihre Stimme, die immer etwas Eigentümliches hat, aber je nach der Art sehr verschieden ist. Einige brummen, andere pfeifen, andere knurren, andere schreien ein »Hu, hu, hu, hu« aus tiefer Brust hervor, andere lassen Laute vernehmen, die durch die Silben »Racka, racka« wiedergegeben werden mögen. Ihre Stimme vernimmt man am häufigsten während der Paarungszeit und insbesondere in den frühen Morgenstunden, bald nachdem sie aus dem Schlaf erwacht und aus dem Innern der Waldungen nach den Lichtungen an den Stromufern hervorgekommen sind. Die Indianer aber erzählten Schomburgk, daß eine Art ( Crax tomentosa) regelmäßig zu schreien beginne, wenn das Sternbild des südlichen Kreuzes seine größte Höhe erreicht habe, und Schomburgk fand diese auffallende Angabe bestätigt. Lange hatte er zu dieser Versicherung gelächelt, weil er beobachtete, daß das südliche Kreuz gerade dann, um vier Uhr des Morgens, seine größte Höhe erreichte, wenn der Vogel ohnehin seine dumpfe, klägliche Stimme erschallen läßt. »Am 4. April aber hatte der Anfang des Kreuzes fünfundzwanzig Minuten nach elf Uhr nachts eben den Meridian erreicht, und in demselben Augenblick schallten die hohlen Töne des Hokkos durch die stille Nacht. Nach Verlauf einer Viertelstunde lag wieder tiefe Ruhe auf unserer Umgebung. Da wir während dieser Zeit die Stimme des Vogels niemals gehört hatten, zeigte sich in diesem Fall die Angabe als so sicher und schlagend, daß alle Zweifel an der merkwürdigen Tatsache bei uns verschwanden.«
Die Nahrung der freilebenden Hokkos besteht vorzugsweise, vielleicht ausschließlich, in Früchten. Azara sagt zwar, daß sie sich von denselben Stoffen ernähren, die die Hühner fressen, fügt aber ausdrücklich hinzu, daß sie schon Maiskörner nicht verdauen, sondern sie mit ihrem Kot wieder ausscheiden, und alle übrigen Beobachter stimmen darin überein, daß Früchte ihr natürliches Futter sind. »In ihrem Magen«, sagt der Prinz, »fand ich halb und gänzlich verdaute Früchte und Nüsse, die zum Teil so stark waren, daß man sie mit einem Messer nicht ritzen konnte.« Schomburgk bestätigt diese Angabe und fügt hinzu, daß ihr Fleisch manchmal, unzweifelhaft infolge einer zeitweilig von ihnen bevorzugten Nährpflanze, einen durchdringenden zwiebelartigen Geruch und gleichzeitig einen erhöhten oder veränderten Geschmack annimmt. »Als die Indianer«, erzählt er, »mit dem Reinigen eines Platzes zum Aufhängen der Hängematten beschäftigt waren und mit dem Waldmesser das im Wege stehende Gebüsch und die Schlingpflanzen niederhieben, traf meine Geruchsnerven jener Geruch in solchem Maße, als wären die Leute in einem Zwiebelfelde beschäftigt. Bei der Untersuchung fand ich, daß dieser Geruch dem Stamm und den Blättern einer Schlingpflanze eigentümlich war. Ohne Zweifel fressen die Hokkos zur Zeit, in der ihr Fleisch den beschriebenen zwiebelartigen Geruch und Geschmack annimmt, die Früchte, Samen und Blüten dieser Schlingpflanze.« Bates hebt besonders hervor, daß die in den Waldungen am Amazonenstrom lebenden Hokkos niemals von den Wipfeln der hohen Waldbäume zum Boden herabkommen, und sagt damit nicht allein, daß sie in den Kronen der Bäume den größten Teil ihres Lebens verbringen, sondern daß sie in ihnen auch ihr Weidegebiet finden. Dafür spricht außerdem eine Erfahrung, die wir in den Tiergärten gewonnen haben. Im Aufsuchen der Nahrung unterscheiden sich die Hokkos und die Schakuhühner von allen ihren sogenannten Ordnungsverwandten; sie scharren nämlich nicht, sondern lesen höchstens auf oder pflücken ab, wie die Tauben tun.
Über die Fortpflanzung wissen wir leider bis jetzt noch sehr wenig, so viel aber doch, daß die Hokkos nicht auf dem Boden, sondern auf Bäumen brüten. »Sie bauen ihre flachen Nester«, sagt Martius, »aus Reisig in die Winkel der Äste, nicht eben hoch über dem Boden, und das Weibchen legt nach unserm eigenen Befund und der Versicherung der Indianer stets nur zwei weiße Eier, die größer und stärker als unsere Hühnereier sind.« Schomburgk und Bates stimmen hiermit überein.
Da das Wildbret der Hokkos an Weiße dem Taubenfleisch, an Wohlgeschmack dem des Truthahnes ähnelt, wird ihre Jagd in Südamerika eifrig betrieben, insbesondere zur Zeit der Paarung, während der unsere Vögel durch ihre weitschallende Stimme verraten werden. Im tiefen Walde, fern von den Wohnungen, sollen sie kaum Scheu vor den Menschen zeigen. Sonnini erzählt, daß er sich in Guayana oft mitten unter ihnen befunden habe, ohne sie durch seine Erscheinung in die Flucht zu schrecken. Man könne sich ihrer deshalb auch ohne alle Mühe bemächtigen und selbst mehrere nacheinander erlegen, ohne daß die andern sich entfernen; denn die überlebenden sähen den getöteten Genossen wohl ängstlich nach, flögen aber nur von einem Baum zum andern. In der Nähe menschlicher Wohnungen hingegen sind die Hokkos sehr scheu und furchtsam; jedes Geräusch ängstigt sie, und die Erscheinung eines Menschen bewegt sie zur eiligen Flucht. Außer dem Fleisch der erlegten Vögel benutzen die Indianer ihre starken Schwingen oder Schwanzfedern zur Herstellung von Fächern, sammeln daher auch solche Federn, die sie im Walde finden, und bewahren sie bis zum Gebrauch in dem röhrenförmigen Scheidenteil eines getrockneten Palmenblattes auf. Hier und da werden auch die kleineren Federn zu allerlei Schmuck verwendet.
*
Die letzte Familie der Ordnung bilden die Steißhühner ( Crypturidae), anscheinend Mittelglieder zwischen den Scharrvögeln und Straußen, weshalb sie von einzelnen Forschern wohl auch diesen zugezählt werden. Ihr Leib ist, wegen der sehr entwickelten Brustmuskeln, kräftig, der Hals dagegen lang und dünn, der Kopf klein und platt, der Schnabel lang, dünn, gebogen, der Fuß hochläufig, sehr rauhsolig, die stets kleine, hoch angesetzte Hinterzehe bei einzelnen so verkümmert, daß nur die Kralle übrigbleibt; die kurzen, runden Flügel reichen nur bis auf den Unterrücken, und ihre stark abgestutzten Handschwingen sind schmal und spitzig; der Schwanz besteht aus zehn bis zwölf kurzen und schmalen Federn, die unter dem langen Deckgefieder gänzlich verschwinden, kann aber auch so verkümmern, daß alle Steuerfedern fehlen.
Die Steißhühner verbreiten sich über einen großen Teil Südamerikas und bewohnen die verschiedensten Örtlichkeiten, einige Arten stets offene Gegenden, andere nur das Dickicht der Wälder, diese die Ebene, jene das Gebirge; einzelne kommen nur in Höhen von viertausend Meter über dem Meere vor. Sie sind an den Boden gebunden, fliegen selten, laufen vielmehr eilig im Gebüsch oder im hohen Grase nach Art unserer Wachtel fort, tun dies aber stets mit etwas eingeknickten Haken und mehr oder minder ausgestrecktem Halse, so daß sie schon durch diese Stellung kenntlich werden, drücken sich in der Angst Platt auf den Boden nieder oder verbergen sich in einem Grasbusch, und bloß diejenigen Arten, die im Walde groß wurden, suchen hier nachts auf den unteren starken Ästen Schutz. Ihre Stimme besteht aus mehreren aufeinander folgenden höheren oder tieferen Pfiffen, die zuweilen in einem regelmäßigen Tonfall einander folgen und sich überhaupt so von den Stimmlauten anderer Vögel unterscheiden, daß die Aufmerksamkeit des Fremden wie des Eingeborenen sofort durch sie erregt wird. Einige Arten schreien namentlich bei Einbruch der Nacht, besonders nachdem sie eben auf dem bestimmten Ruheplatz angekommen sind, und ebenso am Morgen, bevor sie denselben verlassen; andere vernimmt man auch im Laufe des Tages; Sämereien, Früchte, Blattspitzen und Kerbtiere bilden die Nahrung. Gewisse Samen verleihen dem sonst ausgezeichneten Wildbret zuweilen einen unangenehm bitteren Geschmack. Manche sollen in der Frucht des Kaffeebaumes, einiger Palmen und dergleichen ihr hauptsächlichstes Futter finden. Alle brüten auf dem Boden, scharren sich zu ihrem Nest eine seichte Mulde aus und legen eine erhebliche Anzahl eintöniger, aber schön gefärbter, prachtvoll glänzender Eier. Die Jungen werden eine Zeitlang geführt, verlassen aber bald die Mutter, zerstreuen sich und gehen dann ihre eigenen Wege.
Als Jagdgeflügel vertreten die Steißhühner in Südamerika die Stelle unserer Feldhühner, werden auch geradezu »Rebhuhn« oder »Wachtel« genannt und eifrig gejagt. Alle Raubtiere, die laufenden wie die fliegenden, wetteifern hierin mit dem Menschen; selbst der Jaguar verschmäht es nicht, ihnen nachzustellen; ja sogar einige Kerbtiere, beispielsweise die Ameisen, die in dichten Haufen umherziehen, werden den Jungen gefährlich. Man gebraucht das Feuergewehr, stellt Fallen, jagt sie zu Pferde, mit der Wurfschlinge oder setzt Hunde auf ihre Spur. Tschudi erzählt, daß die Indianer ihre Hunde zu solchen Jagden vortrefflich abgerichtet haben. Wenn ein Steißhuhn aufgespürt wird, fliegt es fort, setzt sich aber bald wieder zu Boden; der Hund jagt es zum zweiten Male auf; beim dritten Male springt er zu und beißt es tot.
Eine der häufigsten Arten der Familie, der Inambu ( Rhynchotus rufescens), vertritt die Sippe der Großsteißhühner und kennzeichnet sich durch bedeutende Größe. Das Gefieder ist rostrotgelb, in der Kehlgegend weißlich, auf dem Oberkopf schwarz gestreift, auf den Rücken-, Flügel- und Schwanzdeckfedern breit schwarz gebändert, indem jede Feder vor dem schmalen, gelben Endsaum zwei breite, schwarze Binden übereinander trägt, von denen die obere zunächst der Spitze jederseits noch einen hellrostgelben Seitenstreifen zeigt; die Handschwingen sind einfarbig und lebhaft rostgelbrot, die Armschwingen auf bleifarbenem Grunde schwarz und grau in die Quere gewellt. Das Auge ist rostgelbbraun, der Schnabel braun, am Grunde des Unterkiefers blaßgelbbraun, der Fuß fleischbraun. Die Länge beträgt zweiundvierzig, die Fittichlänge einundzwanzig, die Schwanzlänge fünf Zentimeter.
Der Inambu ist im Camposgebiet des mittleren Brasilien, besonders bei Sao Paolo, Süd-Minas und Goyaz zu Hause, kommt aber auch in den argentinischen Ländern häufig vor, »begleitet hier«, wie Döring sich ausdrückt, »den Reisenden im ganzen Gebiet der Ebene, in den Waldungen ebensowohl wie in den Pampas, und erhebt sich dicht hinter ihm«. Er lebt nie in Völkern, sondern immer einzeln, stellenweise aber in großen Mengen, ist allbekannt, das Lieblingswild des Jägers, einer beständigen Verfolgung ausgesetzt und deshalb sehr scheu und vorsichtig. Bei Annäherung eines Menschen läuft er im hohen Grase davon, gebraucht aber nur im äußersten Notfall seine Schwingen. Darwin erzählt, daß er auf der einförmigen Ebene von Val Donado Hunderten dieser Vögel begegnete, die sich, durch die Annäherung der zahlreichen Gesellschaft von Reisenden erschreckt, ganz gegen ihre Gewohnheit zu Ketten vereinigten, aber vollständig in Verwirrung gebracht wurden, wenn man sie zu Pferde in einem immer enger werdenden Kreise umritt. Der hart verfolgte Vogel wagte zuletzt nicht einmal mehr in gerader Linie zu entfliehen, sondern drückte sich platt auf den Boden nieder. Die Unbehilflichkeit des Inambu ist den dortigen Eingeborenen wohlbekannt. Schon die Knaben jagen ihn und erbeuten viele mit einer höchst einfachen Wurfschlinge. Das Fleisch gehört zu dem besten Wildbraten, den der Reisende in Brasilien oder in den argentinischen Ländern vorgesetzt erhält. Nach Burmeister streift der Inambu nur in der Dämmerung nach Nahrung umher. Das Nest steht am Boden in einem dichten Busch und enthält sieben bis neun dunkelgrauliche, violett überflogene Eier, deren Oberfläche auffallend glänzend ist und wie poliert aussteht.
Gefangene Inambus gelangen nicht allzu selten in unsere Käfige, dauern vortrefflich aus, zeigen sich anspruchslos und schreiten, entsprechend gepflegt, auch wohl zur Fortpflanzung.