
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Erst seit einigen Jahrzehnten ist uns ausführliche Kunde geworden über wunderbar prächtige Vögel Neuguineas und der umliegenden Inseln, die schon seit Jahrhunderten als teilweise verstümmelte Bälge bei uns eingeführt wurden und eigentümliche Sagen ins Leben gerufen haben. Paradiesvögel nannte und nennt man sie, weil man annahm, daß sie unmittelbar dem Paradiese entstammten und in eigentümlicher Weise lebten. Sie kamen ohne Füße zu uns; man übersah die ihnen durch die Eingeborenen zugefügte Verstümmelung und meinte, daß sie niemals Füße besessen hätten. Ihre fast einzig dastehende Federbildung und ihre prachtvollen Farben gaben der Einbildung freien Spielraum, und so kam es, daß die unglaublichsten Fabeln wirklich geglaubt wurden. »Es läßt sich denken«, sagt Pöppig, »mit welchem Staunen die vom Auslande abgetrennten Bewohner des europäischen Festlandes die erste Kunde von jenen wunderbaren Tieren erhalten haben mögen, als Pigafetta, Magalhaens' überlebender Begleiter, 1522 in Sevilla wieder eintraf. Man liest nicht ohne eine gewisse Rührung, wie einige der eifrigen, aber in ihren Mitteln unendlich beschränkten Naturforscher des sechzehnten Jahrhunderts es als eines der größten Ereignisse ihres Lebens, als eine Erfüllung eines lange umsonst gehegten Wunsches bezeichnen, daß ihnen endlich der Anblick der verstümmelten Haut eines Paradiesvogels zuteil geworden. Entschuldigung mag es daher verdienen, wenn in jenem Zeitabschnitte Fabeln entstanden, die ungewöhnlich lange Zeit vollen Glauben fanden. Man betrachtete jene Vögel als luftige Sylphen, die ihre Heimat allein in dem unendlichen Luftmeere fänden, alle auf Selbsterhaltung zielenden Geschäfte fliegend vornahmen und nur während einiger flüchtigen Augenblicke ruhten, indem sie sich mit den langen fadenförmigen Schwanzfedern an Baumästen aufhingen. Sie sollten gleichsam als höhere Wesen von der Notwendigkeit, die Erde zu berühren, frei sein; von ätherischer Nahrung, vom Morgentaue, sich nähren. Es half zu nichts, daß Pigafetta selbst die Fußlosigkeit jener Wundervögel als eine Fabel erklärte, daß Marcgrave, Clusius und andere Forscher jener Zeit die letztere als gar zu ungereimt bekämpfen: das Volk blieb bei seiner vorgefaßten Ansicht.«
Jahrhunderte vergingen, bevor das Leben der Paradiesvögel uns bekannt wurde. Verschiedene Reisende lieferten wichtigere oder unwichtigere Beiträge zur Kunde ihres Lebens: kaum einer aber blieb frei von dem nun einmal herrschenden Wunderglauben. Erst Lesson, der gelegentlich seiner Weltumsegelung dreizehn Tage auf Neuguinea verweilte, berichtet aus eigener Anschauung über lebende Paradiesvögel. Nach ihm haben uns in den letzten Jahren Bennett, Wallace und von Rosenberg wertvolle Mitteilungen über das Frei- und Gefangenleben der märchenhaften Vögel gegeben.
Die Paradiesvögel ( Paradiseidae) sind prachtvolle, an unsere Raben erinnernde Vögel von der Größe eines Hähers bis zu einer Lerche. Bei mehreren Arten verlängern und zerschleißen sich die Federn der Weichengegend in ungewöhnlicher Weise. Weibchen und Junge sind stets einfacher gefärbt als die Männchen. Die Paradiesvögel bewohnen Neuguinea und einige umliegende Inseln der Südsee. Nicht ihre Bälge allein, sondern auch die anderer Prachtvögel werden von den Papua bereits seit Jahrhunderten in den Handel gebracht, und namentlich die Holländer haben sich mit dem Eintausche derselben befaßt. Von Rosenberg beschreibt die Art und Weise der von den Eingeborenen beliebten Zubereitung wie folgt: »Die Papua erlegen die Männchen und zuweilen auch die Weibchen mit Pfeilen und streifen ihnen hierauf mittels eines Querschnitts über Rücken und Bauch die besonders dicke Haut ab. Dann schneiden sie die Füße mit dem Hinterteile der Bauchhaut weg, reißen die großen Schwungfedern aus und spannen nun die so verarbeitete Haut über ein rundes Stäbchen, so daß dieses einige Zentimeter lang aus dem Schnabel hervorragt, welch letzterer mittels einer Schnur an dem Holze befestigt wird. Hierauf hängen sie die mit Holzasche eingeriebenen Bälge im Innern der Hütte über der Feuerstelle auf, um sie im Rauche zu trocknen und vor Ungeziefer zu bewahren. Der Balg ist damit fertig.«
Die Paradiesvögel zerfallen nach Ansicht der neueren Forscher in zwei Unterfamilien, deren erste die Rabenparadiesvögel ( Paradiseinae) oder die Arten mit kurzem, kräftigem Schnabel umfaßt. Die Angehörigen der gleichnamigen, urbildlichen Sippe ( Paradisea) kennzeichnen sich vor allem dadurch, daß die Männchen Büschel aus langen, zerschlissenen Federn tragen, die in einer unter dem ersten Flügelgelenk liegenden Hautfalte wurzeln und durch einen besonderen Muskel beliebig ausgebreitet und zusammengelegt werden können. Die beiden mittelsten Schwanzfedern sind außerordentlich lang und ihre Fahnen nur angedeutet.
Der Paradies- oder Göttervogel, den Linné, um die alte Sage zu verewigen, den fußlosen nannte ( Paradisea apoda), ist ungefähr ebenso groß wie unsere Dohle. Seine Länge beträgt etwa fünfundvierzig, die Fittichlänge vierundzwanzig, die Schwanzlänge achtzehn Zentimeter. Oberkopf, Schläfe, Hinterhals und obere Halsseiten sind dunkelgelb, Stirne, Kopfseiten, Ohrgegend, Kinn und Kehle tief goldgrün, die Zügel grünlichschwarz, die übrigen Teile, Flügel und Schwanz dunkelzimmetbraun, welche Färbung in der Kropfgegend bis zu Schwarzbraun dunkelt, die langen Büschelfedern der Brustseiten hoch orangegelb, gegen das zerschlissene Ende zu in Fahlweiß übergehend, die kürzeren starren Federn in der Mitte des Wurzelteiles der Büschel tief kastanienbraunschwarz. Der Augenring ist schwefelgelb, der Schnabel grünlich graublau, der Fuß fleischbräunlich. Dem Weibchen mangeln alle verlängerten Federn, und seine Färbung ist düsterer, auf der Oberseite bräunlich fahlgrau, an der Kehle graulichviolett, am Bauche fahlgelb. Bis jetzt hat man den Paradiesvogel nur auf den Aruinseln gefunden.

Paradiesvogel ( Paradisia apoda)
Der Papuaparadiesvogel ( Paradisea papuana) ist merklich kleiner als der Göttervogel. Seine Länge beträgt nur achtunddreißig, die Fittichlänge neunzehn, die Schwanzlänge sechzehn Zentimeter. Mantel und Schultern, ebenso zwei Querbinden auf den oberen Flügeldecken sind olivengelb, Kehle und Kropf wie die übrige Unterseite dunkelkastanienbraun, die Büschelfedern an der Wurzel hochorange, in der Endhälfte reinweiß, alle übrigen Teile wie beim Göttervogel gefärbt. Der junge Vogel ist, laut von Rosenberg, wenn er das Nest verläßt, einfarbig braun, oben dunkler und an der Unterseite heller. Die Schwanzfedern sind gleich lang, die beiden mittleren schmalbartig. Bei der nächsten Mauser färben sich Kopf und Nacken blaßgelb, und Stirne und Kehle bedecken sich mit den bekannten metallgrünen Federchen. Die beiden mittleren Schwanzfedern werden gleichzeitig um mehrere Zentimeter länger. Beim dritten Federwechsel endlich verlängern sich diese letzteren in kahle, ungefähr vierzig Zentimeter lange Schäfte, und nun erst brechen die schönen Federbüsche über den Hüften hervor, nehmen aber mit steigendem Alter noch an Länge zu. Nach Rosenberg bewohnt der Tsiankar die nördliche Halbinsel von Neuguinea sowie Misul und Jobie in Menge, scheint aber nach Osten hin seltener zu werden.
Der Rot- oder Blutparadiesvogel ( Paradisea rubra) ist noch kleiner, nur dreiunddreißig, sein Fittich siebzehn, sein Schwanz vierzehn Zentimeter lang, zeichnet sich auch vor beiden bisher genannten durch einen goldgrünen, aufrichtbaren Federbusch am Hinterkopfe aus. Der Rücken ist graugelblich fahl, welche Färbung sich in Gestalt eines Brustbandes auch über die Unterseite verbreitet, die Kehle smaragdgrün; die Brust und die Flügel sind rotbraun, die Schnabelwurzelgegend und ein Fleck hinter dem Auge sammetschwarz, die seitlichen Federbüsche prachtvoll rot, am Ende im Zirkel gedreht, die langen Schwanzfedern, die sich nach außen krümmen, haben breitere Schäfte. Das Auge ist hellgelb, der Schnabel und die Füße sind aschgraublau. Beim Weibchen sind Vorderkopf und Kehle sammetbraun, die Oberseite und der Bauch rotbraun, der Hinterkopf, der Hals und die Brust hellrot. Bis jetzt ist diese Art einzig und allein auf den Inseln Waigiu und Batanta gefunden worden.
In ihrer Lebensweise und im Betragen dürften die drei genannten Arten die größte Ähnlichkeit haben. Sie sind lebendige, muntere Vögel. Alle Reisenden, die sie in ihren heimatlichen Ländern beobachteten, sprechen sich mit Entzücken über sie aus. Als Lesson den ersten über sich wegfliegen sah, war er von seiner Schönheit so hingerissen, daß er den Vogel nur mit den Augen verfolgte, sich aber nicht entschließen konnte, auf ihn zu feuern. Die Beschreibung, die er von dem Leben gibt, wird durch Rosenberg bestätigt und vervollständigt. »Der Paradiesvogel ist ein Strichvogel, der bald nach der Küste, bald wieder nach dem Innern des Landes zieht, je nachdem reifende Baumfrüchte vorhanden sind. Zur Zeit meines Aufenthaltes zu Doreh standen gerade die Früchte einer Laurinee, die nahe hinter den Dörfern auf der Insel wuchs, in Reife. Mit kräftigem Flügelschlage kamen die Vögel, zumeist Weibchen und junge Männchen, diesen Bäumen zugeflogen und waren so wenig scheu, daß sie selbst zurückkehrten, nachdem einige Male auf sie gefeuert worden war. Sonst sind die Paradiesvögel, namentlich die alten Männchen, furchtsam und schwer zum Schuß zu bekommen. Ihr Geschrei klingt heiser, ist aber auf weiten Abstand zu hören und kann am besten durch die Silben ›Wuk, wuk, wuk‹ wiedergegeben werden, auf die oft ein kratzendes Geräusch folgt.« Lesson sagt, daß das Geschrei wie »Woiko« klinge und ausgestoßen werde, um die Weibchen herbeizurufen, die gackernd auf niederen Bäumen sitzen. Des Morgens und Abends, selten mitten am Tage, hört man dieses Geschrei durch den Wald schallen. »Die Stimme des roten Paradiesvogels«, bemerkt Wallace, »ähnelt der seiner Verwandten sehr, ist jedoch weniger schrillend. Man hört sie oft in den Wäldern, daß man annehmen darf, der Vogel müsse sehr häufig sein. Dessenungeachtet ist er wegen seiner Lebendigkeit und unaufhörlichen Bewegung schwer zu erlangen. Ich habe mehrere Male alte Männchen auf niederen Bäumen und Gebüschen, wenige Meter über dem Boden, gesehen. Sie schlüpften durch das Gezweig auf den fast wagerechten Stämmen dahin, anscheinend mit der Jagd auf Kerbtiere beschäftigt, die, wie ich glaube, ihr alleiniges Futter sind, wenn ihre Lieblingsfrucht, die indische Feige, nicht in Reife steht. Bei dieser Gelegenheit lassen sie einen leisen, glucksenden Ton hören, der sehr verschieden ist von ihrem gewöhnlich schrillenden Lockrufe, den sie nur, wie es scheint, hoch oben vom Wipfel der Bäume ausstoßen.«
Beständig in Bewegung, fliegt der Paradiesvogel von Baum zu Baum, bleibt nie lange auf demselben Zweige still sitzen und verbirgt sich beim mindesten Geräusch in die am dichtesten belaubten Wipfel der Bäume. Er ist schon vor Sonnenaufgang munter und beschäftigt, seine Nahrung zu suchen, die in Früchten und Kerbtieren besteht. Abends versammelt er sich truppweise, um im Wipfel irgendeines hohen Baumes zu übernachten.
Die Zeit der Paarung hängt ab vom Monsun. Auf der Ost- und Nordküste von Neuguinea fällt sie in den Mai, auf der Westküste und auf Misul in den November. Die Männchen versammeln sich um diese Zeit in kleinen Trupps von zehn bis zwanzig Stück, die die Eingeborenen Tanzgesellschaften nennen, auf gewissen, gewöhnlich sehr hohen, sperrigen und dünn beblätterten Waldbäumen, fliegen in lebhafter Erregung von Zweig zu Zweig, strecken die Hälse, erheben und schütteln die Flügel, drehen den Schwanz hin und her, öffnen und schließen die seitlichen Federbüschel und lassen dabei ein sonderbar quakendes Geräusch hören, auf das die Weibchen herbeikommen. Nest und Eier sind noch unbekannt. Wallace erfuhr durch die Eingeborenen, daß der Göttervogel sein Nest auf einen Ameisenhaufen oder den hervorragendsten Zweig eines sehr hohen Baumes baue und nur ein einziges Ei lege, mindestens nicht mehr als ein Junges erziele. Dieselben Eingeborenen hatten jedoch, trotz einer von einem holländischen Beamten gebotenen sehr hohen Belohnung, das Ei nicht beschaffen können, dasselbe überhaupt nie zu Gesicht bekommen. Nach brieflicher Mitteilung von Rosenbergs brüten die Vögel übrigens nicht in freistehenden Nestern, sondern in Astlöchern der höchsten Waldbäume, die selbst für den besten Kletterer unerreichbar sind.
»Um sich der Paradiesvögel zu bemächtigen«, erzählt Rosenberg weiter, »gehen die wilden Eingeborenen von Neuguinea in folgender Weise zu Werke: In der Jagdzeit, die in die Mitte der trockenen Jahreszeit fällt, suchen sie erst die Bäume aufzuspüren, auf denen die Vögel übernachten und die meist die höchsten des Waldes sind. Hier erbauen sie sich in deren Ästen eine kleine Hütte aus Blättern und Zweigen. Ungefähr eine Stunde vor Sonnenuntergang klettert ein geübter Schütze, versehen mit Pfeil und Bogen, auf den Baum, verbirgt sich in der Hütte und wartet in größtmöglicher Stille die Ankunft der Vögel ab. Sowie sie heranfliegen, schießt er dieselben, einen um den andern, bequem nieder, und einer seiner Gefährten, der sich am Fuße des Baumes verborgen hat, sucht die gefallenen zusammen. Diese stürzen tot zu Boden, wenn sie mit scharfgespitzten Pfeilen getroffen werden, gelangen dagegen unversehrt in die Hand des Jägers, wenn sie mit Pfeilen geschossen wurden, die mehrere, ein Dreieck bildende Spitzen haben, zwischen die der Körper des Vogels durch die Kraft des Schusses eingeklemmt wird.« Nach Lesson fangen die Eingeborenen aber auch mit dem Leim des Brotfruchtbaumes, und nach Wallaces Angabe wird der Blutparadiesvogel nur durch Schlingen berückt, die man im Gezweige der fruchttragenden Bäume aufstellt, so daß der Vogel mit dem Fuß in die Schlinge treten muß, wenn er die Frucht wegnehmen will. Das andere Ende der Schlinge reicht auf den Boden herab, so daß der gefangene Vogel ohne besondere Mühe von dem Baume herabgezogen werden kann. »Man möchte nun«, sagt Wallace, »vielleicht glauben, daß die unverwundeten, lebend erbeuteten Vögel einem Forscher im besseren Zustande überliefert würden als die durch den Schuß erlegten; aber dies ist durchaus nicht der Fall. Ich bin niemals mit einem Paradiesvogel so geplagt worden als mit dem roten. Zuerst brachte man ihn mir lebend, aber in einen Pack zusammengebunden, die prachtvollen Federn in der abscheulichsten Weise zerknittert und zerbrochen. Ich machte den Leuten begreiflich, daß man die gefangenen mit dem Bein an einen Stock anbinden und so tragen könne; dies aber hatte zur Folge, daß man sie mir überaus schmutzig lieferte. Man hatte die angefesselten in den Hütten einfach auf den Boden geworfen, und die armen Vögel hatten sich mit Asche, Harz und dergleichen entsetzlich verunreinigt. Umsonst bat ich die Eingeborenen, mir die Vögel unmittelbar nach ihrer Gefangennahme zu bringen, umsonst, dieselben sofort zu töten, über den Stock zu hängen und mich so in ihren Besitz zu setzen; sie taten aus Faulheit weder das eine noch das andere. Ich hatte vier oder fünf Männer in meinen Diensten, die ich, um nur Paradiesvögel zu erhalten, für eine gewisse Anzahl von ihnen im voraus bezahlte. Sie verteilten sich im Walde und streiften meilenweit umher, um gute Fangplätze zu suchen. Hatten sie nun einen Vogel gefangen, so war es ihnen viel zu unbequem, mir denselben zu bringen; sie zogen es vielmehr vor, ihn solange als möglich am Leben zu erhalten, und kamen so oft nach einer Abwesenheit von einer Woche und von zehn Tagen zu mir mit einem toten, gewöhnlich stinkenden Paradiesvogel, einem zweiten toten, noch frischen, und einem dritten lebenden, der zuletzt gefangen worden war. Meine Bemühungen, diese Jagdweise zu ändern, waren gänzlich umsonst. Zum Glück ist das Gefieder der Paradiesvögel so fest, daß auch die verstümmelten nicht verloren waren.«
Wallace war es, der zuerst zwei lebende Paradiesvögel nach Europa brachte. Ein chinesischer Kaufmann in Amboina bot Lesson zwei Paradiesvögel an, die bereits ein halbes Jahr im Bauer gelebt hatten und mit gekochtem Reis gefüttert wurden. Der gute Mann forderte aber fünfhundert Franken für das Stück, und diese Summe konnte der Naturforscher damals nicht erschwingen. Nach Rosenbergs Angabe bezahlte der Statthalter von Niederländisch Indien, Sloot van de Beele, für zwei erwachsene Männchen die Summe von einhundertfünfzig holländischen Gulden. Rosenberg selbst brachte diese Vögel von Mangkassar nach Java. Wallace fand die von ihm heimgebrachten beiden ausgefärbten Papuaparadiesvögel in Singapore und erwarb dieselben für zweitausend Mark unseres Geldes. Bennett beobachtete einen gefangenen Papuaparadiesvogel in China, der neun Jahre im Käfig verlebt hatte. Seitdem sind Paradiesvögel auch öfter nach Europa gekommen.
Über das Betragen der Gefangenen berichtet Bennett so ausführlich, daß ich nichts Besseres tun kann, als seine Mitteilungen hier wiederzugeben. »Der Paradiesvogel bewegt sich in einer leichten, spielenden und anmutigen Weise. Auf seinem Gefieder duldet er nicht den geringsten Schmutz, badet sich täglich zweimal und breitet oft Flügel und Schwanz aus, die ganze Pracht seines Kleides dabei offenbarend. Namentlich am Morgen entfaltet er seine volle Pracht; er ist dann beschäftigt, sein Gefieder in Ordnung zu bringen. Die schönen Seitenfedern werden ausgebreitet und sanft durch den Schnabel gezogen, die kurzen Flügel so weit als möglich entfaltet und zitternd bewegt. Dann erhebt er wohl auch die prächtigen, langen Federn, die wie Flaum in der Luft zu schweben scheinen, über den Rücken, breitet sie aber jedenfalls dabei aus. Dieses Gebaren währt einige Zeit; dann bewegt er sich mit raschen Sprüngen und Wendungen auf und nieder. Nach jeder einzelnen Prachtentfaltung erscheint ihm eine Ordnung des Gefieders notwendig; er läßt sich diese Arbeit aber nicht verdrießen und spreizt sich immer und immer wieder von neuem wie ein eitles Frauenzimmer. Erst die sich einstellende Freßlust läßt ihn seine Putzsucht vergessen. Die Sonnenstrahlen scheinen ihm sehr unangenehm zu sein, und er sucht sich deshalb denselben zu entziehen, soviel er kann.
Seine Stimme erinnert zwar an das Krächzen der Raben, ihr Tonfall ist jedoch weit mannigfaltiger. Die einzelnen Laute werden mit einer gewissen Heftigkeit ausgestoßen und oft wiederholt. Zuweilen klingt sein Ruf fast belfernd; die einzelnen Töne bewegen sich in größerer Höhe als sonst und sind so laut, daß sie nicht im Einklange zur Größe des Vogels zu stehen scheinen. Wenn man versucht, sie in Silben zu übertragen, kann man die schwächeren Laute etwa durch ›Hi, ho, hei, hau‹, die stärkeren durch ›Hock, hock, hock, hock‹ wiedergeben.
Seine Gefangenkost besteht aus gekochtem Reis, untermischt mit hartem Ei und Pflanzenstoffen sowie aus lebenden Heuschrecken. Tote Kerbtiere verschmäht er. Er weiß lebende Beute dieser Art mit großer Geschicklichkeit zu fangen, legt sie auf die Sitzstange, zerhackt ihr den Kopf, beißt die Springbeine ab, hält sie mit seinen Klauen fest und verzehrt sie dann. Er ist durchaus nicht gefräßig und genießt sein Futter mit Ruhe und Anstand, ein Reiskorn um das andere. Auch beim Fressen steigt er nicht auf den Boden herab; diesen berührt er nur dann, wenn er sich baden will. Seine Mauser währt vier volle Monate, vom Mai bis August.«
*
Die Schnirkelschweife ( Cicinnurus) vertritt der Königsparadiesvogel ( Cicinnurus regius). Er ist bedeutend kleiner als die vorhergehenden, etwa von der Größe einer kleinen Drossel, im ganzen achtzehn, der Fittich neun, der Schwanz sechs Zentimeter lang, und durch die an der Spitze mit rundlichen Fahnen besetzten, schraubenförmig gedrehten und verschnörkelten Schwanzfedern von den beschriebenen Verwandten unterschieden. Die Oberteile, einen kleinen viereckigen, schwarzen Fleck am oberen Augenrande ausgenommen, Kinn und Kehle sind prachtvoll glänzend kirschrot, Oberkopf und Oberschwanzdecken heller, die Unterteile, mit Ausnahme einer über den Kropf verlaufenden tief smaragdgrünen, oberseits von einem schmalen, rostbraunen Saume begrenzten Querbinde, weiß, die an den Kropfseiten entspringenden Federbüschel rauchbraun, ihre verbreiterten und abgestutzten Enden tief und glänzend goldgrün, die Schwingen zimmetrot, die Schwanzfedern olivenbraun, außen rostfarben gesäumt, die beiden mittelsten fadenförmigen Steuerfedern an der schraubenförmig eingerollten Außenfahne tief goldgrün. Der Augenring ist braun, der Schnabel horngelb, der Fuß hellblau. Das Weibchen ist auf der Oberseite rotbraun, unten rostgelb, schmal braun in die Quere gebändert. Nach Rosenberg ist der Königsparadiesvogel der verbreitetste von allen. Er findet sich auf der ganzen Halbinsel, die den nördlichen Teil von Neuguinea bildet, aber auch auf Misul, Salawati und den Aruinseln. Man sieht ihn oft nahe am Strande auf niedrigen Bäumen. Er ist allerliebst, stets in Bewegung und ebenso wie die andern bemüht, seine Schönheit zu zeigen. Erregt breitet er seinen goldgrünen Brustkragen fächerartig nach vorn aus. Seine Stimme, die er oft hören läßt, hat einige Ähnlichkeit mit dem Miauen einer jungen Katze, ungefähr, wie wenn man die Silben »Koü« mit sanft flötendem Tone ausspricht.
Der Kragenparadiesvogel ( Lophorina superba), Vertreter einer gleichnamigen Sippe, kennzeichnet sich durch verhältnismäßig kurzen, kräftigen Schnabel und zwei aufrichtbare, breite, schildartige, pfeilspitzenförmige Federkragen, von denen der eine am Hinterhalse entspringt und aus breiten Federn besteht, der andere an der Oberbrust wurzelt und aus schmäleren steifen Federn zusammengesetzt ist. Die Länge des Männchens beträgt etwa dreiundzwanzig, die Fittichlänge zwölf, die Schwanzlänge zehn Zentimeter. Das Gefieder ist sammetschwarz, schwach purpurbraun, der Mantelkragen bronzefarben glänzend, der Brustkragen prachtvoll metallisch grün, am Ende der Federn kupfergoldig schimmernd; die Nasen- und Zügelfedern, die kammartig sich erheben, sind glanzlos, die glänzenden Federn des Oberkopfes, Nackens und Hinterhalses stahlblau, vor dem Ende durch eine purpurne Binde geziert, die Oberflügeldeckfedern stärker glänzend als die des Rückens, die Schwingen und Schwanzfedern stahlblau, die des Gesichtes tiefkupferig bronzefarben, die der Unterteile purpurschwarz schimmernd. Beim Weibchen ist die Oberseite dunkel-, am Kopfe und Nacken schwarzbraun, die Unterseite schmutziggelblichweißbraun gewellt. Der prachtvolle Vogel lebt in den Gebirgen Neuguineas, und zwar in einem Höhengürtel von mindestens 2000 Metern Höhe. Ungeachtet aller Nachfragen war es unmöglich, etwas über Lebensweise und Betragen zu erfahren.
Vertreter einer andern Sippe ist der Strahlenparadiesvogel ( Parotia sefilata). Der Schnabel ist kurz und etwas zusammengedrückt; der Schmuck besteht aus sechs, zu beiden Seiten des Kopfes entspringenden, etwa fünfzehn Zentimeter langen, bis auf eine kleine eirunde Endfahne bartlosen Federn, einem dem des Kragenparadiesvogels ähnlichen, jedoch minder entwickelten Brustkragen und einem je an einer Brustseite entspringenden, sehr dichten und langen, aus weißen Federn gebildeten Büschel. Das Gefieder ist vorherrschend schwarz, glänzt und flimmert aber, je nach der Beleuchtung, wundervoll. Kehle und Brust schimmern in grünen und blauen, ein breites, nach vorn gebogenes Federband am Hinterkopfe in geradezu unbeschreiblichen Tönen; ein weißer Fleck auf dem Vorderkopfe glänzt wie Atlas, und die Brustbüschel hüllen, wenn sie aufgerichtet werden, das prächtige Geschöpf noch außerdem in eine zarte, weiße Wolke ein. Das Weibchen gleicht dem des Kragenparadiesvogels bis auf zwei kleine Federbüschel über den Ohren. Die Länge beträgt etwa dreißig, die Fittichlänge fünfzehn, die Schwanzlänge dreizehn Zentimeter. Der ebenfalls sehr prachtvolle Vogel teilt mit dem Kragenparadiesvogel Vaterland und Aufenthalt und muß da, wo er vorkommt, sehr häufig sein, da die Eingeborenen seine Kopfhaut mit den Strahlenfedern massenhaft zu Schmuckgegenständen verarbeiten. Demungeachtet fehlt uns auch über seine Lebensweise jegliche Kunde.
*
Die Paradieselstern ( Astrapia) unterscheiden sich von den vorstehend beschriebenen Familienverwandten durch ihren mittellangen, geraden, vor der Spitze flach ausgeschnittenen Schnabel und den mehr als leibeslangen, abgestuften Schwanz sowie einen fächerförmigen, gewölbten Federbusch, der beide Kopfseiten bekleidet.
Lesson und andere Forscher erklären es für unmöglich, von dem Glanze des Vertreters dieser Sippe, der Paradieselster ( Astrapia nigra), durch Worte eine Vorstellung zu geben. Das Gefieder, das je nach dem einfallenden Lichte in den glühendsten und wunderbarsten Farben leuchtet, ist aus der Oberseite purpurschwarz, mit prachtvoll metallischem Schiller. Die Scheitelfedern sind hyacinthrot, smaragdgolden zugespitzt, die Unterteile malachitgrün. Vom Augenwinkel läuft eine hyazinthrote Binde herab, die sich im Halbkreis unter der Kehle endigt. Schnabel und Füße sind schwarz. Die Länge beträgt etwa siebzig, die Fittichlänge zweiundzwanzig, die Schwanzlänge fünfundvierzig Zentimeter. Über das Leben der Paradieselster fehlen alle Nachrichten. Auch Rosenberg konnte nur getrocknete Bälge erwerben. Nach den ihm gewordenen Berichten lebt der Wundervogel ausschließlich aus Neuguinea, und zwar in Waldungen der Europäern noch immer unzugänglichen Gebirge.
*
Die Paradieshopfe ( Epimachinae), die die zweite Unterfamilie bilden, unterscheiden sich von den Paradiesvögeln durch ihren schlanken, unten wie oben sanft gebogenen Schnabel, der den Lauf an Länge übertrifft.
Eine der prachtvollsten und erst durch Rosenbergs Forschungen einigermaßen bekanntgewordene Art dieser Gruppe ist der Fadenhopf ( Seleucides niger). Vertreter einer gleichnamigen Sippe, die sich kennzeichnet durch sehr lange Büschelfedern an den Brustseiten, die bis zur Hälfte ihrer Länge flaumig, von da an aber nacktschaftig sind. Die Länge dieses wunderbaren Vogels beträgt zweiunddreißig, die Fittichlänge sechzehn, die Schwanzlänge acht Zentimeter. Die sammetartigen Federn des Kopfes, Halses und der Brust sind schwarz, dunkelgrün und purpurviolett schillernd, die verlängerten Brustseitenfedern, bis auf einen glänzenden oder schillernden smaragdgrünen Saum, ebenso gefärbt, die langen, zerfaserten Seitenfedern prächtig goldgelb, welche Farbe aber, wenn der Balg auch nur kurze Zeit der Einwirkung von Licht und Rauch ausgesetzt wird, verbleicht und in Schmutzigweiß sich umwandelt, Flügel und Schwanz violett, herrlich glänzend, unter gewissem Lichte gebändert. Das Merkwürdigste sind offenbar die langen Seitenfedern. Die längsten von ihnen reichen bis über den Schwanz hinaus, und die letzten untersten verwandeln sich in ein langes nacktes Gebilde von der Stärke eines Pferdehaares, das am Ursprünge goldgelb, von da an aber braun gefärbt ist. Das Auge ist scharlachrot, der Schnabel schwarz, der Fuß fleischgelb.
»Während meines Aufenthaltes auf Salawati«, sagt Rosenberg, »im August 1860 war ich so glücklich, ein halbes Dutzend dieser unvergleichlich schönen Vögel zu erhalten. Sie leben in kleinen Trupps oder Familien, sind kräftige Flieger und lassen, nach Futter suchend, ein scharf klingendes ›Scheck, scheck‹ hören. Die Ost- und Westküste Neuguineas und die Insel Salawati bilden ihre ausschließliche Heimat; hier aber sind sie in bergigen Strecken, die sie bevorzugen, durchaus nicht selten. Bei Kalwal, einen, kleinen, vor kurzem angelegten Stranddörfchen an der Westküste der Insel, sah ich im August eine aus zehn Stück bestehende Familie im hohen Walde nahe der Küste. Sechs davon fielen mir in die Hände; die übrigen waren zwei Tage später nicht mehr zu sehen: das wiederholte Schießen und ein starker, auf die Küste zu wehender Wind hatten sie nach dem Gebirge zurückgescheucht. In dem Magen der getöteten fand ich Früchte, vermischt mit einzelnen Überbleibseln von Kerbtieren. In der Brutzeit richtet der Vogel den Brustkragen ringförmig und vom Leibe abstehend nach vorn aus und öffnet die verlängerten Seitenfedern zu einem prachtvollen Fächer.« Laut Wallace besucht der Fadenhopf blühende Bäume, namentlich Sagopalmen und Pisang, um die Blüten auszusaugen. Selten verweilt er länger als einige Augenblicke auf einem Baum, klettert, durch seine großen Füße vortrefflich hierzu befähigt, rasch und gewandt zwischen den Blüten umher und fliegt sodann mit großer Schnelligkeit einem zweiten Baume zu. Sein lauter und auf weithin hörbarer, der Silbe »Kah« vergleichbarer Ruf wird etwa fünfmal rasch nacheinander, meist vor dem Wegfliegen ausgestoßen. Bis gegen die Brutzeit lebt das Männchen einsiedlerisch; später mag es sich, wie seine Familienverwandten, mit andern seiner Art auf gewissen Sammelplätzen zusammenfinden.
*
Der Kragenhopf ( Epimachus speciosus) vertritt eine andere, ihm gleichnamige Sippe dieser Unterfamilie. Sein Schnabel ist lang, bogenförmig, auf der Firste rundkantig, der Schwanz sehr langstufig. Büschelfedern finden sich nur an den Brustseiten. Die Länge beträgt ungefähr fünfundsechzig, die Fittichlänge siebzehn, die Schwanzlänge zweiundvierzig Zentimeter. Der Kopf ist mit kleinen, rundlichen Schuppenfedern bedeckt, die bronzegrün sind, aber blau und goldgrün schillern; die langen, zerfaserten Hinterhalsfedern sind sammetig und schwarz; der Rücken ist ebenso gefärbt, aber unregelmäßig zerstreute, längliche, spatenförmige Federn mit dicken Bärten, die grünbläulich schillern, bringen Abwechslung in diese Färbung; die Unterseite ist schwarzviolett, die großen Schmuckfedern an den Brustseiten, die in der Ruhe nachlässig über die Flügel gelegt werden, schillern im prachtvollsten Glanze. Der Schnabel und die Beine sind schwarz. Beim Weibchen sind Oberkopf und Nacken zimmetfarben, die übrigen Teile wie bei den Männchen gefärbt, alle Farben aber matter. Nach Rosenberg ist der Kragenhopf über den ganzen nördlichen Teil von Neuguinea verbreitet, fehlt aber auf den Inseln. Wallace erfuhr, daß er vorzugsweise im Gebirge, in demselben Höhengürtel wie der Strahlenparadiesvogel lebe, zuweilen aber auch im Hügellande, nahe der Küste der Insel vorkomme. »Mehrere Male«, sagt er, »versicherten mich verschiedene Eingeborene, daß dieser Vogel sein Nest in einem Loche unter dem Boden oder Felsen baue, stets aber eine Höhle mit zwei Öffnungen wähle, so daß er einen Eingang und einen Ausgang hat. Wir würden dies nicht für sehr wahrscheinlich halten, wäre einzusehen, wie diese Geschichte entstanden sein sollte, wenn sie nicht wahr ist. Auch wissen alle Reisenden, daß Erzählungen der Eingeborenen über Gewohnheiten von Tieren sich fast stets als richtig erwiesen, wie sonderbar sie anfänglich auch erscheinen mochten.«
*
Als die den Paradiesvögeln am nächsten stehenden Sperlingsvögel erweisen sich die Raben ( Corvidae), gedrungen gebaute, kräftige Vögel, mit verhältnismäßig großem, starkem, auf der Firste des Oberschnabels oder überhaupt seicht gekrümmtem Schnabel, dessen Schneide vor der meist überragenden Spitze zuweilen einen schwachen Ausschnitt zeigt, und dessen Wurzel regelmäßig mit langen, die Nasenlöcher deckenden Borsten bekleidet ist, großen und starken Füßen, mäßig langen, in der Regel zugerundeten Flügeln, verschieden langem, gerade abgeschnittenem oder gesteigertem Schwanze und dichtem, einfarbigem oder buntem Gefieder. Die Raben bewohnen alle Teile und alle Breiten- oder Höhengürtel der Erde. Nach dem Gleicher hin nimmt ihre Artenzahl bedeutend zu; sie sind aber auch in den gemäßigten Ländern noch zahlreich vertreten und erst im kalten Gürtel einigermaßen beschränkt. Weitaus die meisten verweilen als Standvögel jahraus, jahrein an einer und derselben Stelle oder wenigstens in einem gewissen Gebiete, streichen in ihm aber gern hin und her. Einzelne Arten wandern, andere ziehen sich während des Winters von bedeutenden Höhen mehr in tiefere Gegenden zurück.
*
In der ersten Unterfamilie vereinigen wir die Felsenraben ( Fregilinae), gestreckt gebaute, langflügelige und kurzschwänzige Arten mit schwächlichem, zugespitztem und etwas gebogenem, meist lebhaft gefärbtem Schnabel, zierlichen Füßen, verhältnismäßig langen Flügeln und schillerndem Gefieder.
Die Alpendohle oder Steindohle ( Pyrrhocorax alpinus) hat einen verhältnismäßig starken Schnabel von gelber Färbung, sowie amselartiges Gefieder. Dieses ist bei alten Vögeln sammetschwarz, bei jungen mattschwarz, der Fuß bei jenen rot, bei diesen gelb. Die Alpendohle verbreitet sich fast über das ganze nördlich altweltliche Gebiet. Sie ist in den Alpen überall gemein und bewohnt alle Hochgebirge Mittelasiens, den Himalaja nicht minder als den Altai.
»Wie zum Saatfeld die Lerche, zum See die Möwe, zum Stall und der Wiese die Ammer und der Hausrotschwanz, zum Kornspeicher die Taube und der Spatz, zum Grünhage der Zaunkönig, zum jungen Lärchenwald die Meise und das Goldhähnchen, zum Feldbach die Stelze, zum Buchwald der Fink, in die zapfenbehangenen Föhren das Eichhorn gehört«, sagt Tschudi, »so gehört zu den Felsenzinnen unserer Alpen die Bergdohle oder Schneekrähe. Findet der Wanderer oder Jäger auch sonst in den Bergen keine zwei- oder vierfüßigen Alpenbewohner: eine Schar Bergdohlen, die zankend und schreiend auf den Felsenvorsprüngen sitzen, bald aber schrill pfeifend mit wenigen Flügelschlägen auffliegen, in schneckenförmigen Schwenkungen in die Höhe steigen und dann in weiten Kreisen die Felsen umziehen, um sich bald wieder auf einen derselben niederzulassen und den Fremden zu beobachten, findet er gewiß immer, sei es auf den Weiden über der Holzgrenze, sei es in den toten Geröllhalden der Hochalpen, ebenso häufig auch an den nackten Felsen am und im ewigen Schnee. Fand doch von Dürrler selbst auf dem Firnmeer, das die höchste Kuppe des Tödi, mehr als vierthalbtausend Meter über dem Meer, umgibt, noch zwei solcher Krähen und Meyer bei seiner Ersteigung des Finsteraarhorns in einer Höhe von über viertausend Meter über dem Meer noch mehrere derselben. Sie gehen also noch höher als Schneefinken und Schneehühner und lassen ihr helles Geschrei als eintönigen Ersatz für den trillernden Gesang der Flüelerche und des Zitronfinken hören, der fast tausend Meter tiefer den Wanderer noch so freundlich begleitete. Und doch ist es diesem gar lieb, wenn er zwischen ewigem Eis und Schnee wenigstens diese lebhaften Vögel noch schwärmend sich herumtreiben und mit dem Schnabel im Firn nach eingesunkenen Kerbtieren hacken sieht.
Wie fast alle Alpentiere gelten auch die Schneekrähen für Wetterpropheten. Wenn im Frühling noch rauhe Tage eintreten oder im Herbst die ersten Schneefälle die Hochtalsohle versilbern wollen, steigen diese Krähen scharenweise, bald hell krächzend, bald laut pfeifend in die Tiefe, verschwinden aber sogleich wieder, wenn das Wetter wirklich rauh und schlimm geworden ist. Auch im härtesten Winter verlassen sie nur auf kurze Zeit die Alpengebiete, um etwa in den Talgründen dem Beerenreste der Büsche nachzugehen, und im Januar sieht man sie noch munter um die höchsten Felsenzinnen kreisen. Sie fressen übrigens wie die andern Rabenarten alles Genießbare; im Sommer suchen sie bisweilen die höchsten Bergkirschenbäume auf. Land- und Wasserschnecken verschlucken sie mit der Schale (im Kropf einer an der Spiegelalpe im Dezember geschossenen Bergdohle fanden wir dreizehn Landschnecken, unter denen kein leeres Häuschen war) und begnügen sich in der ödesten Nahrungszeit auch mit Baumknospen und Fichtennadeln. Auf tierische Überreste gehen sie so gierig wie die Kolkraben und verfolgen in gewissen Fällen selbst lebende Tiere wie echte Raubvögel. Im Dezember l853 sahen wir bei einer Jagd in der sogenannten Öhrligrube am Säntis mit Erstaunen, wie auf den Knall der Flinte sich augenblicklich eine große Schar von Schneekrähen sammelte, von denen vorher kein Stück zu sehen gewesen. Lange kreisten sie laut pfeifend über dem angeschossenen Alpenhasen und verfolgten ihn, solange sie den Flüchtling sehen konnten. Um ein unzugängliches Felsenriff des gleichen Gebirges, auf dem eine angeschossene Gemse verendet hatte, kreisten monatelang, nachdem der Leichnam schon knochenblank genagt war, die krächzenden Bergdohlenscharen. Mit großer Unverschämtheit stoßen sie angesichts des Jägers auf den stöbernden Dachshund. Ihre Beute teilen sie nicht in Frieden. Schreiend und zankend jagen sie einander die Bissen ab und beißen und necken sich beständig; doch scheint ihre starke gesellige Neigung edler Art zu sein. Wir haben oft bemerkt, wie der ganze Schwarm, wenn ein oder mehrere Stück aus ihm weggeschossen wurden, mit heftig pfeifenden Klagetönen eine Zeitlang noch über den erlegten schwebte.
Ihre oft gemeinsamen Nester sind in den Spalten und Höhlen der unzugänglichsten Kuppen und darum selten beobachtet worden. Das einzelne Nest ist flach, groß, besteht aus Grashalmen und enthält in der Brütezeit fünf kräheneigroße, etwa sechsundzwanzig Millimeter lange, achtunddreißig Millimeter dicke Eier mit dunkelgrauen Flecken auf hell aschgrauem Grund. Die Schneekrähen bewohnen gewisse Felsengrotten ganze Geschlechter hindurch und bedecken sie oft dick mit ihrem Kot.«
Hinsichtlich des Gefangenlebens stimme ich dem von Savi Gesagten zu: »Dieser Vogel ist einer von denjenigen, die sich am leichtesten zähmen lassen und die innigste Anhänglichkeit an ihren Pfleger zeigen. Man kann ihn jahrelang halten, frei herumlaufen und fliegen lassen. Er springt auf den Tisch und ißt Fleisch, Früchte, besonders Trauben, Feigen, Kirschen, Schwarzbrot, trockenen Käse und Dotter. Er liebt die Milch und zieht bisweilen Wein dem Wasser vor. Wie die Raben hält er die Speisen, die er zerreißen will, mit den Klauen, versteckt das übrige und deckt es mit Papier, Splittern und dergleichen zu, setzt sich auch wohl daneben und verteidigt den Vorrat gegen Hunde und Menschen. Er hat ein seltsames Gelüst zum Feuer, zieht oft den brennenden Docht aus den Lampen und verschluckt denselben, holt ebenso des Winters kleine Kohlen aus dem Kamin, ohne daß es ihm im geringsten schadet. Er hat eine besondere Freude, den Rauch aufsteigen zu sehen, und sooft er ein Kohlenbecken wahrnimmt, sucht er ein Stück Papier, einen Lumpen oder einen Splitter, wirft es hinein und stellt sich dann davor, um den Rauch anzusehen. Sollte man daher nicht vermuten, daß dieser der ›brandstiftende Vogel‹ ( Avis incendiaria) der Alten sei?
Vor einer Schlange oder einem Krebs und dergleichen schlägt er die Flügel und den Schwanz und krächzt ganz wie die Raben; kommt ein Fremder ins Zimmer, so schreit er, daß man fast taub wird; ruft ihn aber ein Bekannter, so gackert er ganz freundlich. In der Ruhe singt er bisweilen, und ist er ausgeschlossen, so pfeift er fast wie eine Amsel; er lernt selbst einen kleinen Marsch pfeifen. War jemand lang abwesend und kommt zurück, so geht er ihm mit halb geöffneten Flügeln entgegen, begrüßt ihn mit der Stimme, fliegt ihm auf den Arm und besieht ihn von allen Seiten. Findet er nach Sonnenaufgang die Türe geschlossen, so läuft er in ein Schlafzimmer, ruft einige Male, setzt sich unbeweglich aufs Kopfkissen und wartet, bis sein Freund aufwacht. Dann hat er keine Ruhe mehr, schreit aus allen Kräften, läuft von einem Ort zum andern und bezeugt auf alle Art sein Vergnügen an der Gesellschaft seines Herrn. Seine Zuneigung setzt wirklich in Erstaunen; aber dennoch macht er sich nicht zum Sklaven, läßt sich nicht gern in die Hand nehmen und hat immer einige Personen, die er nicht leiden mag, und nach denen er pickt.«
*
Die Raben im engsten Sinn ( Corvinae) kennzeichnen sich durch großen, aber verhältnismäßig kurzen, mehr oder weniger gebogenen, an der Wurzel mit steifen Borstenhaaren überdeckten schwarzen Schnabel, kräftige, schwarze Füße, mittellange Flügel, die zusammengelegt ungefähr das Ende des Schwanzes erreichen, verschieden langen, gerade abgeschnittenen, zugerundeten und gesteigerten Schwanz und ein ziemlich reiches, mehr oder minder glänzendes Gefieder von vorwaltend schwarzer Färbung.
Unter den deutschen Raben gebührt hier unserm Kolk- oder Edelraben ( Corvus corax) die erste Stelle. Er ist der Rabe im eigentlichen Sinne des Wortes. Der Kolkrabe vertritt mit mehreren Verwandten, die ihm sämtlich höchst ähnlich sind, eine besondere Sippe ( Corvus), deren Kennzeichen im folgenden liegen: Der Leib ist gestreckt, der Flügel groß, lang und spitzig, weil die dritte Schwinge alle übrigen an Länge überragt, der Schwanz mittellang, seitlich abgestuft, das Gefieder knapp und glänzend. Die Färbung des Kolkraben ist gleichmäßig schwarz. Nur das Auge ist braun oder bei den jüngeren Vögeln blauschwarz und bei den Nestjungen hellgrau. Die Länge beträgt vierundsechzig bis sechsundsechzig, die Breite etwa einhundertfünfundzwanzig, die Fittichlänge vierundvierzig, die Schwanzlänge sechsundzwanzig Zentimeter.

Kolkrabe ( Corvus corax)
Unter allen Raben scheint der Kolkrabe am weitesten verbreitet zu sein. Er bewohnt ganz Europa vom Nordkap bis zum Kap Tarifa und vom Vorgebirge Finisterre bis zum Ural, findet sich aber auch im größten Teil Asiens vom Eismeer bis zum Punjab und vom Ural bis nach Japan und ebenso in ganz Nordamerika, nach Süden hin bis Mexiko. Bei uns zulande ist der stattliche, stolze Vogel nur in gewissen Gegenden häufig, in andern bereits ausgerottet und meidet da, wo dies noch nicht der Fall, den Menschen und sein Treiben soviel als möglich. Aus diesem Grunde haust er ausschließlich in Gebirgen oder in zusammenhängenden, hochständigen Waldungen, an felsigen Meeresküsten und ähnlichen Zufluchtsorten, wo er möglichst ungestört sein kann. Gegen die Grenzen unseres Erdteiles hin lebt er mit dem Herrn der Erde in besseren Verhältnissen, und in Rußland oder Sibirien scheut er diesen so wenig, daß er mit der Nebelkrähe und Dohle nicht allein Straßen und Wege, sondern auch Dörfer und Städte besucht, ja gerade hier, auf den Kirchtürmen, ebenso regelmäßig nistet wie hier zulande die Turmdohle. Damit steht im Einklang, daß er hier noch heutigentags gemein genannt werden darf. Auch in Spanien, Griechenland und ebenso in Skandinavien tritt er häufig auf. Gleichwohl schart er sich selten zu zahlreichen Flügen, und solche von fünfzig Stück, wie ich sie in der Sierra Nevada sah, gehören immer zu den Ausnahmen. Der Standort eines Paares ist stets vortrefflich gewählt. Der Kolkrabe bewohnt ein umfangreiches Gebiet und sieht besonders auf Mannigfaltigkeit der Erzeugnisse desselben. Gegenden, in denen Wald und Feld, Wiese und Gewässer miteinander abwechseln, sind seine liebsten Wohnsitze, weil er hier die meiste Nahrung findet.
»Der Kolkrabe«, sagt mein Vater, der ihn vor nunmehr fast sechzig Jahren in noch unübertroffener Weise beschrieben hat, »lebt gewöhnlich, also auch im Winter, paarweise. Die in Nähe meines Wohnortes horstenden Paare fliegen im Winter oft täglich über unsere Täler weg und lassen sich auf den höchsten Bäumen nieder. Hört man den einen des Paares, so braucht man sich nur umzusehen, der andere ist nicht weit davon. Trifft ein Paar bei seinem Flug auf ein anderes, dann vereinigen sich die beiden und schweben einige Zeit miteinander umher. Die einzelnen sind ungepaarte Junge, die umherstreichen; denn der Kolkrabe gehört zu den Vögeln, die, einmal gepaart, zeitlebens treu zusammenhalten. Sein Flug ist wunderschön, geht fast geradeaus und wird, wenn er schnell ist, durch starkes Flügelschwingen beschleunigt; oft aber schwebt der Rabe lange Zeit und führt dabei die schönsten kreisförmigen Bewegungen aus, wobei Flügel und Schwanz stark ausgebreitet werden. Man sieht deutlich, daß ihm das Fliegen keine Anstrengung kostet, und daß er oft bloß zum Vergnügen weite Reisen unternimmt. Gelegentlich derselben nähert er sich auf den Bergen oft dem Boden; über die Täler aber streift er gewöhnlich in bedeutender Höhe hinweg. Bei seinen Spazierflügen stürzt er oft einige Meter tief herab, besonders wenn nach ihm geschossen worden ist, so daß der mit dieser Spielerei unbekannte Schütze glauben muß, er habe ihn angeschossen und werde ihn bald herabstürzen sehen. Während des Winters bringt er den größten Teil des Tages fliegend zu. Der Flug ähnelt dem der Raubvögel mehr als dem anderer Krähen und ist so bezeichnend für ihn, daß ihn der Kundige in jeder Entfernung von den verwandten Krähenarten zu unterscheiden imstande ist. Auf der Erde schreitet der Rabe mit einer scheinbar angenommenen lächerlichen Würde einher, trägt dabei den Leib vorn etwas höher als hinten, nickt mit dem Kopf und bewegt bei jedem Tritt den Leib hin und her. Beim Sitzen auf Ästen hält er den Leib bald wagrecht, bald sehr aufgerichtet. Die Federn liegen fast immer so glatt an, daß er wie gegossen aussieht, werden auch nur bei Gemütsbewegungen auf dem Kopf und dem ganzen Hals gesträubt. Die Flügel hält er gewöhnlich etwas vom Leib ab. Wie er hierin nichts mit seinen Verwandten gemein hat, so ist es auch hinsichtlich einer gewissen Liebe, die die andern Krähenarten zueinander hegen. Die Rabenkrähen leben in größter Freundschaft mit den Nebelkrähen und Elstern, die Dohlen mischen sich unter die Saatkrähen, und keine Art tut der andern etwas zuleide; die Kolkraben aber werden von den Verwandten gehaßt und angefeindet. Ich habe die Rabenkrähe sehr heftig auf den Kolkraben stoßen sehen, und wenn sich dieser unter einen Schwarm Rabenkrähen mischen will, entsteht ein Lärm, als wenn ein Habicht oder Bussard unter ihnen erscheine. Ein allgemeiner Angriff nötigt den unwillkommenen Gefährten, sich zu entfernen. Auch dadurch zeichnet sich der Kolkrabe vor den andern Arten aus, daß er an Scheu alle übertrifft. Es ist unglaublich, wie vorsichtig dieser Vogel ist. Er läßt sich nur dann erst nieder, wenn er die Gegend gehörig umkreist und weder durch das Gesicht, noch durch den Geruch etwas für sich Gefährliches bemerkt hat. Er verläßt, wenn sich ein Mensch dem Nest mit Eiern nähert, seine Brut sofort und kehrt dann zu den Jungen, so innig seine Liebe zu ihnen ist, nur mit der äußersten Vorsicht zurück. Sein Haß gegen den Uhu ist außerordentlich groß, seine Vorsicht aber noch weit größer; deshalb ist dieser scheue Vogel selbst von der Krähenhütte aus nur sehr schwer zu erlegen. Die gewöhnlichen Töne, die die beiden Gatten eines Paares von sich geben, klingen wie ›Kork kork, Kolk kolk‹ oder wie ›Rabb rabb rabb‹, daher sein Name. Diese Laute werden verschieden betont und so mit andern vermischt, daß eine gewisse Mannigfaltigkeit entsteht. Bei genauer Beobachtung begreift man wohl, wie die Wahrsager der Alten eine so große Menge von Tönen, die der Kolkrabe hervorbringen soll, annehmen konnten. Besonders auffallend ist eine Art von Geschwätz, das das Männchen bei der Paarung im Sitzen hören läßt. Es übertrifft an Vielseitigkeit das Plaudern der Elstern bei weitem.«
Es gibt vielleicht keinen Vogel, der im gleichen Umfang wie der Rabe Allesfresser genannt werden kann. Man darf behaupten, daß er buchstäblich nichts Genießbares verschmäht und für seine Größe und Kraft Unglaubliches leistet. Ihm munden Früchte, Körner und andere genießbare Pflanzenstoffe aller Art; aber er ist auch ein Raubvogel ersten Ranges. Nicht Kerbtiere, Schnecken, Würmer und kleine Wirbeltiere allein sind es, denen er den Krieg erklärt; er greift dreist Säugetiere und Vögel an, die ihn an Größe übertreffen, und raubt in der unverschämtesten Weise die Nester aus, nicht allein die wehrloser Vögel, sondern auch die der kräftigen Möwen, die sich und ihre Brut wohl zu verteidigen wissen. Vom Hasen an bis zur Maus und vom Auerhuhne an bis zum kleinsten Vogel ist kein Tier vor ihm sicher. Frechheit und List, Kraft und Gewandtheit vereinigen sich in ihm, um ihn zu einem wahrhaft furchtbaren Räuber zu stempeln. In Spanien bedroht er die Haushühner, in Norwegen die jungen Gänse, Enten und das gesamte übrige Hausgeflügel; auf Island und Grönland jagt er Schneehühner, bei uns zulande Hasen, Fasanen und Rebhühner; am Meeresstrand sucht er zusammen, was die Flut ihm zuwarf; in den nordischen Ländern macht er den Hunden allerlei Abfälle vor den Wohnungen streitig; in den Steppen Ostasiens wird er zum unabwendbaren Peiniger der wundgedrückten Kamele, auf Island zum Schinder der beulenbehafteten Pferde, indem er sich auf den Rücken der einen wie der andern setzt, mit Schnabelhieben das zu seiner Nahrung ausersehene Fleisch von den Wundrändern trennt und nur dadurch, daß die gequälten Tiere sich wälzen, vertrieben werden kann. »Der Kolkrabe sucht«, wie Olafsen mitteilt, »im Winter sein Futter zwischen Hunden und Katzen auf den Höfen, geht in der warmen Jahreszeit am Strand den Fischen nach, tötet im Frühjahr mit Schnabelhieben die neugeborenen Lämmer und verzehrt sie, verjagt die Eidergänse vom Nest, säuft ihre Eier aus und verbirgt diejenigen, die er nicht fressen kann, einzeln in die Erde. Er folgt in kleinen Scharen dem Adler, wagt sich zwar nicht an ihn, sucht aber Überbleibsel von seiner Beute zu erschnappen.« Für den unbeteiligten Beobachter ist es ergötzlich zu sehen, wie er zu Werke geht. Den Schweizer Jägern folgt er, laut Tschudi, um die geschossenen Gemsen auszunehmen; hartschalige Muscheln erhebt er, nach Fabers und Holboells übereinstimmenden Berichten, hoch in die Luft und läßt sie von hier auf einen harten Stein oder bezüglich Felsblock fallen, um sie zu zerschmettern; den Einsiedlerkrebs weiß er, nach Alexander von Homeyers Beobachtungen, geschickt zu fassen und aus seiner Wohnung, dem Schneckengehäuse, herauszuziehen; will dieses wegen gänzlichem Zurückziehen des Krebses nicht gleich gelingen, so hämmert er mit dem Gehäuse so lange hin und her, bis der Einsiedler endlich doch zum Vorschein kommt. Er greift große Tiere mit einer List und Verschlagenheit sondergleichen, aber auch mit großem Mut erfolgreich an, Hasen z.+B. ohne alle Umstände, nicht bloß kranke oder angeschossene, wie mein Vater annahm. Auf dem Aas ist der Rabe eine regelmäßige Erscheinung, und die vielen biblischen Stellen, die sich ans ihn beziehen, werden wohl ihre Richtigkeit haben. Es unterliegt leider keinem Zweifel, daß der Kolkrabe durch seine Raubsucht sehr schädlich wird. Auch er bringt zwar Nutzen wie die übrigen Krähen; der Schaden aber, den er anrichtet, überwiegt alle Wohltaten, die er dem Feld und Garten zufügt. Deshalb ist es auffallend genug, daß dieser Vogel von einzelnen Völkerschaften geliebt und verehrt wird. Namentlich die Araber achten ihn hoch und verehren ihn fast wie eine Gottheit, weil sie ihn für unsterblich halten.
Unter allen deutschen Vögeln, die Kreuzschnäbel etwa ausgenommen, schreitet der Kolkrabe am frühesten zur Fortpflanzung, paart sich meist schon im Anfang des Januar, baut im Februar seinen Horst und legt in den ersten Tagen des März. Der große, mindestens vierzig, meist sechzig Zentimeter im Durchmesser haltende, halb so hohe Horst steht auf Felsen oder bei uns auf dem Wipfel eines hohen, schwer oder nicht ersteigbaren Baumes. Der Unterbau wird aus starken Reisern zusammengeschichtet, der Mittelbau aus feineren errichtet, die Nestmulde mit Baststreifen, Baumflechten, Grasstückchen, Schafwolle und dergleichen warm ausgefüttert. Ein alter Horst wird gern wieder benutzt und dann nur ein wenig aufgebessert. Auch bei dem Nestbau zeigt der Kolkrabe seine Klugheit und sein scheues Wesen. Er nähert sich mit den Baustoffen sehr vorsichtig und verläßt den Horst, wenn er oft Menschen in dessen Nähe bemerkt oder vor dem Eierlegen von demselben verscheucht wird, während er sonst jahrelang so regelmäßig zu ihm zurückkehrt, daß ein hannöverscher Forstbeamter nacheinander vierundvierzig Junge einem und demselben Horst entnehmen konnte. Das Gelege besteht aus fünf bis sechs ziemlich großen, etwa vierundfünfzig Millimeter langen, vierunddreißig Millimeter dicken Eiern, die auf grünlichem Grund braun und grau gefleckt sind. Nach meines Vaters Beobachtungen brütet das Weibchen allein, nach Naumanns Angaben mit dem Männchen wechselweise. Die Jungen werden von beiden Eltern mit Regenwürmern und Kerbtieren, Mäusen, Vögeln, jungen Eiern und Aas genügend versorgt; ihr Hunger aber scheint auch bei der reichlichsten Fütterung nicht gestillt zu werden, da sie fortwährend Nahrung heischen. Beide Eltern lieben die Brut außerordentlich und verlassen die einmal ausgekrochenen Jungen nie. Sie können allerdings verscheucht werden, bleiben aber auch dann immer in der Nähe des Horstes und beweisen durch allerlei klagende Laute und ängstliches Hin- und Herfliegen ihre Sorge um die geliebten Kinder. Wiederholt ist beobachtet worden, daß die alten Raben bei fortdauernder Nachstellung ihre Jungen dadurch mit Nahrung versorgt haben, daß sie die Atzung von oben auf das Nest herabwarfen. Werden einem Rabenpaar die Eier genommen, so schreitet es zur zweiten Brut, werden ihm aber die Jungen geraubt, so brütet es nicht zum zweiten Male in demselben Jahre. Unter günstigen Umständen verlassen die jungen Raben Ende Mai oder Anfang Juni den Horst, nicht aber die Gegend, in der er stand, kehren vielmehr noch längere Zeit allabendlich zu demselben zurück und halten sich noch wochenlang in der Nähe auf. Dann werden sie von den Eltern auf Anger, Wiesen und Äcker geführt, hier noch gefüttert, gleichzeitig aber in allen Künsten und Vorteilen des Gewerbes unterrichtet. Erst gegen den Herbst hin macht sich das junge Volk selbständig.
Jung dem Nest entnommene Raben werden nach kurzer Pflege außerordentlich zahm; selbst alt eingefangene fügen sich in die veränderten Verhältnisse. Der Verstand des Raben schärft sich im Umgang mit dem Menschen in bewunderungswürdiger Weise. Er läßt sich abrichten wie ein Hund, sogar auf Tiere und Menschen hetzen, führt die drolligsten und lustigsten Streiche aus, ersinnt sich fortwährend Neues und nimmt zu so wie an Alter, so auch an Weisheit, dagegen nicht immer auch an Gnade vor den Augen des Menschen. Aus- und Einfliegen kann man den Raben leicht lehren; er zeigt sich jedoch größerer Freiheit regelmäßig bald unwürdig, stiehlt und versteckt das Gestohlene, tötet junge Haustiere, Hühner und Gänse, beißt Leute, die barfuß gehen, in die Füße und wird unter Umständen selbst gefährlich, weil er seinen Mutwillen auch an Kindern ausübt. Mit Hunden geht er oft innige Freundschaft ein, sucht ihnen die Flöhe ab und macht sich ihnen sonst nützlich; auch an Pferde und Rinder gewöhnt er sich und gewinnt sich deren Zuneigung. Er lernt trefflich sprechen, ahmt die Worte in richtiger Betonung nach und wendet sie mit Verstand an, bellt wie ein Hund, lacht wie ein Mensch, knurrt wie die Haustaube usw.
Südlich des achtzehnten Grades nördlicher Breite begegnet man zuerst einem durch sein Gefieder sehr ausgezeichneten, kleinen, schwachschnäbeligen Raben, der weit über Afrika verbreitet ist und im Westen durch eine sehr nah verwandte Art vertreten wird: dem Schildraben ( Corvus scapulatus). Er ist glänzend schwarz, auf Brust und Bauch sowie am unteren Nacken aber breit bandförmig gezeichnet, blendend weiß. Das dunkle Gefieder schillert, das lichte glänzt wie Atlas, Das Auge ist lichtbraun, der Schnabel und die Füße sind schwarz. Die Länge beträgt fünfundvierzig bis fünfzig, die Fittichlänge fünfunddreißig, die Schwanzlänge sechzehn Zentimeter.
Das Verbreitungsgebiet des Schildraben erstreckt sich über Mittel- und Südafrika nebst Madagaskar und vom Meeresgestade bis zu viertausend Meter unbedingter Höhe. Im ganzen Sudan und auch in den Tiefebenen Abessiniens ist er eine regelmäßig vorkommende, wenn auch nicht gerade gemeine Erscheinung. Er tritt in der Ebene überall, im Gebirge dagegen an manchen Orten gar nicht auf. Ich habe ihn gewöhnlich paarweise gefunden. Zuweilen vereinigen sich übrigens mehrere Paare zu einer kleinen Gesellschaft, die jedoch niemals längere Zeit zusammenbleibt. In größeren Scharen habe ich ihn nicht bemerkt. Hartmann sagt, daß ihn der Vogel nicht bloß durch seine Befiederung, sondern auch durch sein heiteres Wesen an die Elster erinnert habe; ich meinesteils glaube gefunden zu haben, daß er unseren Kolkraben mehr als allen übrigen Verwandten entspricht. Sein Flug ist gewandt, leicht, schwebend und sehr schnell: dabei nimmt sich der Vogel prächtig aus. Die spitzigen Schwingen und der abgerundete Schwanz geben ihm beinahe etwas Falkenartiges, und der weiße Brustfleck schimmert auf weithin. Sein Gang ist ernst und würdevoll, aber doch leicht und federnd, seine Stimme ist ein sanftes »Kurr«.
In allen Gegenden, wo der Schildrabe häufig ist, hat er sich mit dem Menschen befreundet. Scheu fand ich ihn nur in manchen Teilen der Samhara; doch war es auch hier mehr die fremdartige, ihm auffallende Erscheinung des Europäers als die Furcht vor dem Menschen überhaupt, die ihn bedenklich machte. Am Lagerplatz einer Karawane scheut er sich auch vor dem Europäer nicht mehr. In den Küstendörfern der Samhara ist er regelmäßiger Gast; im Dorfe Ed sah ich ihn auf den Firsten der Strohhütten sitzen wie die Nebel- oder Saatkrähe auf unsern Gebäuden. Sein Horst wird auf einzelnen Bäumen der Steppe oder des lichteren Waldes angelegt und enthält in den ersten Monaten der großen Regenzeit drei bis vier Eier. Ich habe dieselben nicht gesehen, aber genügende Beschreibungen von ihnen erhalten. Sie scheinen denen der übrigen Raben in jeder Hinsicht zu ähneln. Gegen die Jungen zeigt sich das Elternpaar außerordentlich zärtlich, und mutvoll stößt es falkenartig auf den sich nahenden Menschen herab.
Die Rabenkrähe ( Corvus corone) ist schwarz mit veilchen- oder purpurfarbenem Schiller und braunem Augensterne, in der Jugend mattschwarz mit grauem Augensterne. Die Nebelkrähe ( Corvus cornix) dagegen ist nur auf Kopf, Vorderhals, Flügeln und Schwanz schwarz, übrigens hell aschgrau oder bei den Jungen schmutzig aschgrau. Die Länge beträgt bei der einen wie bei der andern siebenundvierzig bis fünfzig, die Breite einhundert bis einhundertvier, die Fittichlänge dreißig, die Schwanzlänge zwanzig Zentimeter. Die Nebelkrähe ist weiter verbreitet als ihre Verwandte. Die Rabenkrähe lebt regelmäßig da, wo die Nebelkrähe nicht auftritt. Eine ersetzt also die andere. Nun gibt es aber Gegenden, wo die Verbreitungskreise der beiden Arten aneinanderstoßen, und hier geschieht es in der Tat häufig, daß die beiden so innig verwandten Vögel eine Mischlingsehe eingehen. Heinroth bezeichnet es mit Recht als Geschmackssache, ob man unsere Krähen »als verschiedene Arten oder nur als Farbabänderungen auffassen will. Die Tiere selbst halten sich offenbar für dasselbe, denn man sieht sie in ihren Grenzgebieten und auf dem Zuge völlig durcheinander, und sie vermischen sich mancherorts so, daß man mehr Mischlinge als Reinartliche findet.« Im allgemeinen ist die Rabenkrähe »die westeuropäische und die ostasiatische Form, dazwischen lebt die Nebelkrähe, d.+h. von der Elbe bis Westsibirien«. Im Winter überfliegt die Nebelkrähe die Elbe regelmäßig in westlicher Richtung, und sie ist dann z.+B. auch in Ostfriesland und Holland überall sehr häufig, während man sie hier im Sommer nur selten trifft. Herausgeber.
Hinsichtlich der Lebensweise unterscheiden sich Raben- und Nebelkrähe allerdings nicht. Beide sind Stand- oder höchstens Strichvögel. Sie halten sich paarweise zusammen und bewohnen gemeinschaftlich ein größeres oder kleineres Gebiet, aus dem sie sich selten entfernen. Strenge Winterkälte macht insofern eine Ausnahme, daß die im Norden lebenden Paare kurze Streifzüge nach Süden hin antreten, wogegen die Mitglieder derselben Art in südlichen Ländern kaum an Umherstreichen denken. Feldgehölze bilden ihre liebsten Aufenthaltsorte; sie meiden aber auch größere Waldungen nicht und siedeln sich da, wo sie sich sicher wissen, selbst in unmittelbarer Nähe des Menschen, also beispielsweise in Baumgärten an. Sie sind gesellig in hohem Grade. Sie gehen gut, schrittweise, zwar etwas wackelnd, jedoch ohne jede Anstrengung, fliegen leicht und ausdauernd, wenn auch minder gewandt als die eigentlichen Raben, sind feinsinnig, namentlich was Gesicht, Gehör und Geruch anlangt, und stehen an geistigen Fähigkeiten kaum oder nicht hinter dem Kolkraben zurück. Im kleinen leisten sie ungefähr dasselbe, was der Rabe im großen auszuführen vermag; da sie aber regelmäßig bloß kleineren Tieren gefährlich werden, überwiegt der Nutzen, den sie stiften, wahrscheinlich den Schaden, den sie anrichten. Man darf mit aller Bestimmtheit annehmen, daß sie zu den wichtigsten Vögeln unserer Heimat gehören, daß ohne sie die überall häufigen und überall gegenwärtigen schadenbringenden Wirbeltiere und verderblichen Kerbtiere in der bedenklichsten Weise überhandnehmen würden. Vogelnester plündern allerdings auch sie aus, und einen kranken Hasen und ein Rebhuhn überfallen sie ebenfalls; sie können auch wohl im Garten und im Gehöft mancherlei Unfug stiften und endlich das reifende Getreide, insbesondere die Gerste, in empfindlicher Weise brandschatzen: was aber will es sagen, wenn sie während einiger Monate in uns unangenehmer Weise stehlen und rauben, gegenüber dem Nutzen, den ihre Tätigkeit während des ganzen übrigen Jahres dem Menschen bringt! Der kleine Bauer, dessen Gerstenfelder sie in dreister und merklicher Weise plündern, ist berechtigt, das fast ungehinderte Anwachsen ihres Bestandes mit mißgünstigem Auge anzusehen und selbst zu beschränken; der Jäger wird sich ebenfalls nicht nehmen lassen, dann und wann sein Gewehr auf sie zu richten: der Land- und Forstwirt aber dürfte sehr wohl tun, sie zu schützen. Es ist ein Irrtum, zu glauben, daß der Mensch die Tätigkeit der Krähen zu ersetzen imstande sei, und daher zu beklagen, wenn man zum Beispiel Gift gegen Mäusefraß auslegt und dadurch kaum mehr Mäuse vertilgt als Krähen, die ihrerseits das gefräßige Heer in der umfassendsten und erfolgreichsten Weise bekämpfen, da mit aller Bestimmtheit behauptet werden kann, daß durch den Tod einer einzigen Krähe der Land- und Forstwirtschaft weit größerer Schaden erwächst als durch die Tätigkeit von zehn lebenden. Vor allem hüte man sich, einzelne Beobachtungen zu verallgemeinern. Ebenso wie der Star, der nützlichste aller deutschen Vögel, in Weinbergen nicht geduldet werden kann, verursachen auch die im allgemeinen wesentlich nützlichen Krähen unter besonderen Umständen an einzelnen Orten, selbst in ganzen Gegenden, dann und wann merklichen, sogar empfindlichen Schaden, sei es, daß sich eine einzelne zum Übeltäter herangebildet oder ein ganzes Geschlecht von solchen entwickelt habe: und dennoch würde es falsch sein, die Gesamtheit jene Untaten entgelten zu lassen.
Das tägliche Leben der Krähen ist ungefähr folgendes: Sie fliegen vor Tagesanbruch auf und sammeln sich, solange sie nicht Verfolgung erfahren, ehe sie nach Nahrung ausgehen, aus einem bestimmten Gebäude oder großen Baume. Von hier aus verteilen sie sich über die Felder. Bis gegen Mittag hin sind sie eifrig mit Aufsuchen ihrer Nahrung beschäftigt. Sie schreiten Felder und Wiesen ab, folgen dem Pflüger, um die von ihm bloßgelegten Engerlinge aufzusammeln, lauern vor Mauselöchern, spähen nach Vogelnestern umher, untersuchen die Ufer der Bäche und Flüsse, durchstöbern die Gärten, kurz, machen sich überall zu schaffen. Dabei kommen sie gelegentlich mit andern ihrer Art zusammen und betreiben ihre Arbeit zeitweilig gemeinschaftlich. Ereignet sich etwas Auffallendes, so sind sie gewiß die ersten, die es bemerken und andern Geschöpfen anzeigen. Ein Raubvogel wird mit lautem Geschrei begrüßt und so eifrig verfolgt, daß er oft unverrichteter Sache abziehen muß. Snell hat sehr recht, wenn er auch diese Handlungsweise der Krähen als Nutzen hervorhebt; denn es unterliegt keinem Zweifel, daß die räuberische Tätigkeit der schädlichen Raubvögel durch die Krähen bedeutend gehindert wird, sei es, indem sie den Raubvogel unmittelbar angreifen, sei es, indem sie ihn dem Menschen und den Tieren verraten. Gegen Mittag fliegen die Krähen einem dichten Baume zu und verbergen sich hier im Gelaube desselben, um Mittagsruhe zu halten. Nachmittags gehen sie zum zweiten Male nach Nahrung aus, und gegen Abend versammeln sie sich in zahlreicher Menge auf bestimmten Plätzen, gleichsam in der Absicht, hier gegenseitig die Erlebnisse des Tages auszutauschen. Dann begeben sie sich zum Schlafplatze, einem bestimmten Waldteile, der alle Krähen eines weiten Gebietes vereinigt. Hier erscheinen sie mit größter Vorsicht, gewöhnlich erst, nachdem sie mehrmals Späher vorausgesandt haben. Sie kommen nach Einbruch der Nacht an, fliegen still dem Orte zu und setzen sich so ruhig auf, daß man nichts als das Rauschen der Schwingen vernimmt. Nachstellungen machen sie im höchsten Grade scheu. Sie lernen den Jäger sehr bald von dem ihnen ungefährlichen Menschen unterscheiden und vertrauen überhaupt nur dem, von dessen Wohlwollen sie sich vollständig überzeugt haben.
Im Februar und März schließen sich die Paare noch enger als sonst aneinander, schwatzen in liebenswürdiger Weise zusammen, und das Männchen macht außerdem durch sonderbare Bewegungen oder Verneigungen und eigentümliches Breiten der Schwingen seiner Gattin in artiger Weise den Hof. Der Horst, der Ende März oder Anfang April auf hohen Bäumen angelegt oder, wenn vorjährig, für die neue Brut wieder hergerichtet wird, ähnelt dem des Kolkraben, ist aber bedeutend kleiner, höchstens sechzig Zentimeter breit und nur vier Zentimeter tief. Auf die Unterlage dürrer Zweige folgen Baststreifen, Grasbüsche, Quecken und andere Wurzeln, die sehr oft durch eine Lage lehmiger Erde verbunden werden, wogegen die Ausfütterung der Mulde aus Wolle, Kälberhaaren, Schweinsborsten, Baststückchen, Grashalmen, Moosstengeln, Lumpen und dergleichen besteht. In der ersten Hälfte des April legt das Weibchen drei bis fünf, höchst selten sechs Eier, die etwa einundvierzig Millimeter lang, neunundzwanzig Millimeter dick und auf blaugrünlichem Grunde mit olivenfarbenen, dunkelgrünen, dunkel aschgrauen und schwärzlichen Punkten und Flecken gezeichnet sind. Das Weibchen brütet allein, wird aber nur dann vom Männchen verlassen, wenn dieses wegfliegen muß, um für sich und die Gattin Nahrung zu erwerben. Die Jungen werden mit der größten Liebe von beiden Eltern gepflegt, gefüttert und bei Gefahr mutvoll verteidigt.
Beide Krähenarten lassen sich ohne irgendwelche Mühe jahrelang in Gefangenschaft erhalten und leicht zähmen, lernen auch sprechen, falls es dem Lehrer nicht an Ausdauer fehlt. Doch sind sie als Stuben- oder Hausvögel kaum zu empfehlen. Aus dem Zimmer verbannt sie ihre Unreinlichkeit oder richtiger der Geruch, den sie auch dann verbreiten, wenn ihr Besitzer den Käfig nach Kräften rein zu halten sich bemüht; im Gehöfte oder Garten aber darf man auch sie nicht frei umherlaufen lassen, weil sie ebenso wie der Rabe allerlei Unfug stiften. Die Sucht, glänzende Dinge aufzunehmen und zu verschleppen, teilen sie mit ihren schwächeren Verwandten, die Raub- und Mordlust mit dem Kolkraben. Auch sie überfallen kleine Wirbeltiere, selbst junge Hunde und Katzen, hauptsächlich aber Geflügel, um es zu töten oder wenigstens zu martern. Hühner- und Taubennester werden von den Strolchen bald entdeckt und rücksichtslos geplündert.
Im Fuchs und Baummarder, Wanderfalken, Habicht und Uhu haben die Krähen Feinde, die ihnen gefährlich werden können. Außerdem werden sie von mancherlei Schmarotzern, die sich in ihrem Gefieder einnisten, belästigt. Es ist wahrscheinlich, daß der Uhu den außerordentlichen Haß, den die Krähen gegen ihn an den Tag legen, durch seine nächtlichen Anfälle auf letztere, dann wehrlosen Vögel sich zugezogen hat; man weiß wenigstens mit Bestimmtheit, daß er außerordentlicher Liebhaber von Krähenfleisch ist. Seine nächtlichen Mordtaten werden von den Krähen nach besten Kräften vergolten. Weder der Uhu noch eine andere Eule dürfen sich bei Tage sehen lassen. Sobald einer der Nachtvögel entdeckt worden ist, entsteht ungeheurer Aufruhr in der ganzen Gegend. Sämtliche Krähen eilen herbei und stoßen mit beispielloser Wut auf diesen Finsterling in Vogelgestalt. In ähnlicher Weise wie den König der Nacht necken die Krähen auch alle übrigen Raubtiere, vor deren Rache ihre Fluggewandtheit oder ihre Menge sie augenblicklich schützt. Durch den Menschen haben sie gegenwärtig weniger unmittelbar als mittelbar zu leiden. Hier und da verfolgt man sie regelrecht auf der Krähenhütte, zerstört und vernichtet auch wohl ihre Nester und Bruten; viel mehr als derartige Unternehmungen aber schadet ihnen das Ausstreuen vergifteter Körner auf den von Mäusen heimgesuchten Feldern. In Mäusejahren findet man ihre Leichen zu Dutzenden und Hunderten und kann dann erhebliche Abnahme ihres Bestandes leicht feststellen. Doch gleicht ihre Langlebigkeit und Fruchtbarkeit derartige Verluste immer bald wieder aus, und somit ist es ebensowenig nötig, Schutzmaßregeln zu ihren Gunsten zu empfehlen, als rätlich, einen Ausrottungskrieg gegen sie zu predigen.
Nützlicher noch als Raben- und Nebelkrähe erweist sich die vierte unserer Rabenarten, die Saatkrähe, Feld-, Hafer- und Ackerkrähe ( Corvus frugilegus). Sie unterscheidet sich von den eigentlichen Krähen durch schlankeren Leibesbau, sehr gestreckten Schnabel, verhältnismäßig lange Flügel, stark abgerundeten Schwanz, knappes, prachtvoll glänzendes Gefieder und ein im Alter nacktes Gesicht. Ihre Länge beträgt siebenundvierzig bis fünfzig, die Breite etwa einhundert, die Fittichlänge fünfunddreißig, die Schwanzlänge neunzehn Zentimeter. Das Gefieder der alten Vögel ist gleichmäßig purpurblauschwarz, das der Jungen mattschwarz. Letztere unterscheiden sich von den Alten auch durch ihr befiedertes Gesicht. Fruchtbare Ebenen, in denen es Feldgehölze gibt, sind der eigentliche Aufenthaltsort dieser Krähe. Im Gebirge fehlt sie als Brutvogel gänzlich. Ein hochstämmiges Gehölz von geringem Umfange wird zum Nistplatze und bezüglich zum Mittelpunkte einer gewissen, oft sehr erheblichen Anzahl dieser Krähen, und von hier aus verteilen sie sich über die benachbarten Felder.
In ihrem Betragen hat die Saatkrähe manches mit ihren beschriebenen Verwandten gemein, ist aber weit furchtsamer und harmloser als diese. Ihr Gang ist ebenso gut, ihr Flug leichter, ihre Sinne sind nicht minder scharf, und ihre geistigen Kräfte in gleichem Grade entwickelt als bei den übrigen Krähen; doch ist sie weit geselliger als alle Verwandten. So vereinigt sie sich gern mit Dohlen und Staren, überhaupt mit Vögeln, die ebenso schwach oder schwächer sind als sie, während sie Raben- und Nebelkrähe schon meidet und den Kolkraben so fürchtet, daß sie sogar eine altgewohnte Niederung, aus der sie der Mensch kaum vertreiben kann, verläßt, wenn sich ein Kolkrabe hier häuslich niederläßt. Doch habe ich in Sibirien Nebel- und Saatkrähen, Dohlen und Raben gleichzeitig an einem Aase schmausen sehen. Ihre Stimme ist ein tiefes, heiseres »Kra« und »Kroa«; im Fliegen aber hört man oft ein hohes »Girr« oder »Quer« und regelmäßig auch das »Jack jack« der Dohle. Es wird ihr leicht, mancherlei Töne und Laute nachzuahmen; sie soll sogar in gewissem Grade singen lernen, läßt sich dagegen kaum zum Sprechen abrichten.
Wenn man die Saatkrähe vorurteilsfrei beobachtet, lernt man sie achten. Auch sie kann da, wo sie sich fest ansiedelt und allen Bemühungen des Menschen, sie zu vertreiben, den hartnäckigsten Widerstand entgegensetzt, in Lustgärten während der Nistzeit die Wege in der abscheulichsten Weise beschmutzt oder in Gehölzen nahe menschlichen Wohnungen durch ihr ewiges Geplärre die Gehörnerven fast betäubt, sehr unangenehm werden; auch sie kann wohl ab und zu einmal ein kleines Häschen erwürgen oder ein junges, mattes Rebhuhn übertölpeln; sie kann ferner den Landmann durch Auflesen von Getreidekörnern und den Gärtner durch Wegstehlen reifender Früchte ärgern: aber derselbe Vogel bezahlt jeden Schaden, den er anrichtet, tausendfältig. Er ist der beste Vertilger der Maikäfer, ihrer Larven und der Nacktschnecken, auch einer der trefflichsten Mäusejäger, den unser Vaterland aufzuweisen hat. »Ich habe«, sagt Naumann, »Jahre erlebt, in denen eine erschreckliche Menge Feldmäuse den grünenden und reifenden Saaten Untergang drohten. Oft sah man auf den Roggen- und Weizenfeldern ganze Striche von ihnen teils abgefressen, teils umgewühlt; aber immer fanden sich eine große Menge Raubvögel und Krähen ein, die das Land, allerdings mit Hilfe der den Mäusen ungünstigen Witterung, bald gänzlich von den Plagegeistern befreiten. Ich schoß in jenen Jahren weder Krähen noch Bussarde, die nicht ihren Kropf von Mäusen vollgepropft gehabt hätten. Oft habe ich ihrer sechs bis sieben in einem Vogel gefunden. Erwägt man diesen Nutzen, so wird man, glaube ich, besser gegen die gehaßten Krähen handeln lernen und sie liebgewinnen.«
Wenn die Brutzeit herannaht, sammeln sich Tausende dieser schwarzen Vögel auf einem sehr kleinen Raume, vorzugsweise in einem Feldgehölze. Paar wohnt bei Paar; auf einem Baume stehen fünfzehn bis zwanzig Nester, überhaupt so viele, als er aufnehmen kann. Jedes Paar zankt sich mit dem benachbarten um die Baustoffe, und eins stiehlt dem andern nicht nur diese, sondern sogar das ganze Nest weg. Ununterbrochenes Krächzen und Geplärre erfüllt die Gegend, und eine schwarze Wolke von Krähen verfinstert die Luft in der Nähe dieser Wohnsitze. Endlich tritt etwas Ruhe ein. Jedes Weibchen hat seine vier bis fünf, achtunddreißig Millimeter langen, siebenundzwanzig Millimeter dicken, blaßgrünen, aschgrau und dunkelbraun gefleckten Eier gelegt und brütet. Bald aber entschlüpfen die Jungen, und nun verdoppelt oder verdreifacht sich der Lärm; denn jene wollen gefüttert sein und wissen ihre Gefühle sehr vernehmlich durch allerlei unliebsame Töne auszudrücken. Dann ist es in der Nähe einer solchen Ansiedlung buchstäblich nicht zum Aushalten. Nur die eigentliche Nacht macht das Geplärre verstummen; es beginnt aber bereits vor Tagesanbruch und währt bis lange nach Sonnenuntergang ohne Aufhören fort. Wer eine solche Ansiedelung besucht, wird bald ebenso bekalkt wie der Boden um ihn her, der infolge des aus den Nestern herabfallenden Mistregens greulich anzuschauen ist. Dazu kommt nun die schon erwähnte Hartnäckigkeit der Vögel. Sie lassen sich so leicht nicht vertreiben. Man kann ihnen Eier und Junge nehmen, so viel unter sie schießen, als man will: es hilft nichts – sie kommen doch wieder.

Brütende Saatkrähe ( Corvus frugileus)
So groß auch die Menge ist, die eine Ansiedlung bevölkert: mit den Massen, die sich gelegentlich der Winterreise zusammenschlagen, kann sie nicht verglichen werden. Tausende gesellen sich zu Tausenden, und die Heere wachsen um so mehr an, je länger die Reise währt. Sie verstärken sich nicht bloß durch andere Saatkrähen, sondern auch durch Dohlen. Ziehende Saatkrähen entfalten alle Künste des Fluges. Über die Berge fliegt der Schwarm gewöhnlich niedrig, über die Täler oft in großer Höhe dahin. Plötzlich fällt es einer ein, dreißig bis hundert Meter herabzusteigen; dies aber geschieht nicht langsam und gemächlich, sondern jäh, sausend, so wie ein lebloser Körper aus großer Höhe zu Boden stürzt. Der einen folgen eine Menge andere, zuweilen der ganze Flug, und dann erfüllt die Luft ein auf weithin hörbares Brausen. Unten, hart über dem Boden angekommen, fliegen die Saatkrähen gemächlich weiter, erheben sich hierauf allgemach wieder in die Höhe, schrauben sich nach und nach mehr empor und ziehen kaum eine Viertelstunde später, dem Auge als kleine Pünktchen erscheinend, in den höchsten Luftschichten weiter.
Die Feinde, die der Saatkrähe nachstellen, sind dieselben, die auch die verwandten Arten bedrohen. In Gefangenschaft ist sie weniger unterhaltend und minder anziehend, wird daher auch seltener im Käfig gehalten als Rabe und Dohle.
Der Zwerg unter unsern deutschen Raben ist die Dohle oder Turmkrähe ( Corvus monedula). Die Länge beträgt dreiunddreißig, die Breite fünfundsechzig, die Fittichlänge zweiundzwanzig, die Schwanzlänge dreizehn Zentimeter. Das Gefieder ist auf Stirn und Scheitel dunkelschwarz, auf Hinterkopf und Nacken aschgrau, auf dem übrigen Oberkörper blauschwarz, auf der Unterseite schiefer- oder grauschwarz, der Augenring silberweiß, der Schnabel wie der Fuß schwarz. Die Jungen unterscheiden sich durch schmutzigere Farben und graues Auge.
Auch die Dohle findet sich im größten Teile Europas und ebenso in vielen Ländern Asiens, nach Norden hin mindestens soweit, als der Getreidebau reicht. Im Süden Europas ist sie seltener als in Deutschland, nirgends aber so häufig wie in Rußland und Sibirien. Bei uns zulande tritt sie keineswegs allerorten, sondern nur hier und da auf, ohne daß man hierfür einen stichhaltigen Grund zu finden wüßte. Wo sie vorkommt, bewohnt sie hauptsächlich die alten Türme der Städte oder andere hohe Gebäude, deren Mauern ihr passende Nistplätze gewähren; außerdem begegnet man ihr in Laubwäldern, namentlich in Feldgehölzen, in denen hohle Bäume stehen.
Die Dohle ist ein munterer, lebhafter, gewandter und kluger Vogel. Unter allen Umständen weiß sie ihre muntere Laune zu bewahren und die Gegend, in der sie heimisch ist, in wirklich anmutiger Weise zu beleben. Außerordentlich gesellig, vereinigt sie sich nicht nur mit andern ihrer Art zu starken Schwärmen, sondern mischt sich auch unter die Flüge der Krähen, namentlich der Saatkrähen, tritt sogar mit diesen die Winterreise an und fliegt ihnen zu Gefallen möglichst langsam; denn sie selbst ist auch im Fluge sehr gewandt und gleicht hinsichtlich des letztern mehr einer Taube als einer Krähe. Das Fliegen wird ihr so leicht, daß sie sich sehr häufig durch allerhand kühne Wendungen zu vergnügen sucht, ohne Zweck und Ziel steigt und fällt und die mannigfachsten, anmutigsten Schwenkungen in der Luft ausführt. Sie ist ebenso klug wie der Rabe, zeigt aber nur die liebenswürdigen Seiten desselben. Lockend stößt sie ein wirklich wohllautendes »Jäk« oder »Djär« aus; sonst schreit sie »Kräh« und »Krijäh«. Ihr »Jäk jäk« ähnelt dem Lockruf der Saatkrähe auf das täuschendste, und dies mag wohl auch mit dazu beitragen, beide Vögel so häufig zu verbinden. Während der Zeit ihrer Liebe schwatzt sie allerliebst, wie überhaupt ihre Stimme biegsam und wechselreich ist. Dies erklärt, daß sie ohne sonderliche Mühe menschliche Worte nachsprechen oder andere Laute, z.+B. das Krähen eines Hahnes, nachahmen lernt.
Hinsichtlich der Nahrung kommt die Dohle am nächsten mit der Saatkrähe überein. Kerbtiere aller Art, Schnecken und Würmer bilden unzweifelhaft die Hauptmasse ihrer Mahlzeiten. Die Kerbtiere liest sie auf den Wiesen und Feldern zusammen oder von dem Rücken der größeren Haustiere ab; dem Ackersmann folgt sie, vertrauensvoll hinter dem Pflug herschreitend; auf den Straßen durchstöbert sie den Mist und vor den Häusern den Abfall; Mäuse weiß sie geschickt, junge Vögel nicht weniger gewandt zu fangen, und Eier gehören zu ihren besonderen Lieblingsgerichten. Nicht minder gern frißt sie Pflanzenstoffe, namentlich Getreidekörner, Blattspitzen von Getreide, Wurzelknollen, keimende und schossende Gemüse, Früchte, Beeren und dergleichen, kann daher in Gärten und Obstpflanzungen, wenn nicht empfindlich, so doch merklich schädlich werden, plündert in Rußland und Sibirien auch Getreidefeimen und Tennen. Ob man deshalb berechtigt ist, sie als überwiegend schädlichen Vogel zu bezeichnen, erscheint mir zweifelhaft: ich möchte im Gegenteil annehmen, daß der von ihr auf Flur und Feld gestiftete Nutzen den von ihr verursachten Schaden mindestens ausgleicht, falls nicht übersteigt.
Die Dohle zieht im Spätherbst mit den Saatkrähen von uns weg und erscheint zu derselben Zeit wie diese wieder im Vaterland; nicht wenige ihres Geschlechtes überwintern jedoch auch in Deutschland, insbesondere in unseren Seestädten; ebensowenig verlassen alle Dohlen Rußland und Sibirien, so streng der Winter hier auch auftreten möge. Ihre Winterreise dehnt sie bis Nordwestafrika, Nordwestasien und Indien aus. Sobald der Frühling wirklich zur Herrschaft gelangt ist, haben alle Paare die altgewohnten Brutplätze wieder bezogen, und nun regt sich hier tausendfältiges Leben. Einzelne Dohlen nisten unter Saatkrähen, die große Mehrzahl aber auf Gebäuden. Hier findet jede Mauerlücke ihre Bewohner; ja es gibt deren gewöhnlich mehr als Wohnungen. Deshalb entsteht viel Streit um eine geeignete Niststelle, und jede baulustige Dohle sucht die andere zu übervorteilen, so gut sie kann. Nur die schärfste Wachsamkeit schützt ein Paar vor den Diebereien des andern; ohne die äußerste Vorsicht wird Baustelle und Nest erobert und gestohlen. Das Nest selbst ist verschieden, je nach dem Standort, gewöhnlich aber ein schlechter Bau aus Stroh und Reisern, der mit Heu, Haaren und Federn ausgefüttert wird. Vier bis sechs, fünfunddreißig Millimeter lange, fünfundzwanzig Millimeter dicke, auf blaß blaugrünlichem Grund schwarzbraun getüpfelte Eier bilden das Gelege. Die Jungen werden mit Kerbtieren und Gewürm großgefüttert, äußerst zärtlich geliebt und im Notfall auf das mutigste verteidigt. »Läßt sich«, sagt Naumann, »eine Eule, ein Milan oder Bussard blicken, so bricht die ganze Armee mit gräßlichem Geschrei gegen ihn los und verfolgt ihn stundenweit. Wenn sich die Jungen einigermaßen kräftig fühlen, machen sie es wie die jungen Krähen, steigen aus den Nestern und setzen sich vor die Höhlen, in denen sie ausgebrütet sind, kehren aber abends wieder ins Nest zurück, bis sie sich endlich stark genug fühlen, die Alten aufs Feld zu begleiten.«
Ungeachtet der starken Vermehrung nehmen die Dohlenscharen nur in einzelnen Städten erheblich, in andern dagegen nicht oder doch nicht merklich zu, ohne daß hierfür die Ursache erkenntlich wäre. »Was wird aus den zahlreichen Jungen?« fragt Liebe. »Wanderfalken und Uhus sind jetzt in Mitteldeutschland viel zu selten geworden, als daß sie wesentlich schaden könnten, und die Unbilden der Witterung tun den abgehärteten und klugen, in den Ortschaften angesiedelten Allesfressern sicher nichts.« Der Mensch befehdet sie bei uns zulande nicht, tut aber auch denen, die wandern, wenig zuleide, und die außerdem noch zu nennenden Feinde, Hauskatze, Marder, Iltis und Habicht, können dem Bestand doch ebenfalls so erhebliche Verluste nicht zufügen, daß sich ihr geringer Zuwachs erklären ließe.
Kein Rabe wird häufiger gefangen gehalten als die Dohle. Ihr heiteres Wesen, ihre Gewandtheit und Klugheit, ihre Anhänglichkeit an den Gebieter, ihre Harmlosigkeit und ihre Nachahmungsgabe endlich sind wohl geeignet, ihr Freunde zu erwerben. Ohne Mühe kann man jung aufgezogene gewöhnen, aus- und einzufliegen. Sie gewinnen das Haus ihres Herrn bald lieb und verlassen es auch im Herbst nicht oder kehren, wenn sie wirklich die Winterreise mit andern ihrer Art antreten, im nächsten Frühjahr nicht selten zu ihm zurück.
*
Der Nußknacker oder Tannenhäher, Nußkrähe oder Nußpicker ( Nucifraga caryocatactes), nimmt innerhalb der Rabenfamilie eine sehr vereinzelte Stellung ein; denn er hat nur in Amerika und im Himalaja Verwandte, die wirklich mit ihm verglichen werden dürfen. Das Gefieder ist dicht und weich, der Hauptfarbe nach dunkelbraun, auf Scheitel und Nacken ungefleckt, an der Spitze jeder einzelnen Feder mit einem reinweißen, länglich runden Fleck besetzt; die Schwingen und Schwanzfedern sind glänzend schwarz, letztere an der Spitze weiß; dieselbe Farbe zeigen auch die Unterschwanzdeckfedern. Die Augen sind braun, der Schnabel und die Füße schwarz. Die Länge beträgt sechsunddreißig, die Breite neunundfünfzig, die Fittichlänge neunzehn, die Schwanzlänge zwölf Zentimeter.

Nußknacker oder Tannenhäher ( Nucifraga caryocatactes)
Geschlossene Nadelwälder unserer Hochgebirge sowie die ausgedehnten Waldungen des Nordens der Alten Welt bilden die Heimat dieses Vogels, für dessen ständiges Vorkommen die Zirbelkiefer maßgebend ist. Auf unsern Alpen begegnet man ihm ebenso regelmäßig wie im hohen Norden, am häufigsten immer da, wo die gedachten Bäume wachsen. Aber auch er zählt zu den Zigeunervögeln, nimmt seinen Aufenthalt im wesentlichen je nach dem Gedeihen oder Nichtgedeihen der Zirbelnüsse, bewohnt daher im Sommer gewisse Striche in Menge und fehlt in andern benachbarten gänzlich. So tritt er in den mittleren Teilen Schwedens sehr häufig auf, während er den größten Teil Norwegens nur während seiner Reise besucht. Letztere findet ebenso unregelmäßig statt wie die des Seidenschwanzes. In manchen Jahren ist er während des Winters in Deutschland überall zu finden; dann vergehen wieder viele Jahre, ehe man nur einen einzigen zu sehen bekommt. Im hohen Norden wandert er regelmäßiger, aber nicht immer gleich weit und nicht in jedem Herbst in derselben Anzahl; denn einzig und allein das Mißraten der Zirbelnüsse treibt ihn vom Norden nach dem Süden hin oder vom Gebirge in die Ebene herab. Dies geschieht wie bei allen Zigeunervögeln in dem einen Jahr früher, in dem andern später. Vogels sorgfältige Beobachtungen machen es glaublich, daß wir im mittleren und nördlichen Deutschland immer nur hochnordische Gäste, nicht aber solche, die den Alpen entstammen, zu sehen bekommen, wogegen letztere es sind, die zeitweilig, manchmal sehr frühzeitig im Sommer, in den tieferen Lagen ihres Wohngebirges erscheinen. Solange sie dort wie hier genügende Nahrung finden, wandern sie nicht, streichen vielmehr nur in sehr beschränktem Grad; wenn ihnen aber die Heimat nicht genügenden Unterhalt bietet, verlassen sie dieselbe, um anderswo ihr tägliches Brot zu suchen.
Mein Vater hat nicht unrecht, wenn er sagt, daß der Tannenhäher mit dem Eichelhäher kaum mehr Ähnlichkeit habe als mit einem Specht. Der Vogel sieht ungeschickt, sogar tölpisch aus, ist aber ein gewandter und munterer Gesell, der auf dem Boden gut geht und mit sehr großer Geschicklichkeit auf den Ästen und Stauden herumhüpft oder sich wie die Meisen an den Stamm klebt, daß man wohl sagen kann, er klettere an den Bäumen herum. Wie ein Specht hängt er sich an Stämme und Zweige, und wie ein Specht meißelt er mit seinem scharfen Schnabel in der Rinde desselben, bis er sie stückweise abgespaltet und die unter ihr sitzende Beute, die er wittert, erlangt hat. Sein Flug ist leicht, aber ziemlich langsam, mit starker Schwingung und Ausbreitung der Flügel. Die Stellung ist verschieden. Gewöhnlich zieht er die Füße an, trägt den Leib wagrecht, den Kopf eingezogen und läßt die Federn hängen; dann hat er ein plumpes Ansehen, während er schmuck und schlank erscheint, wenn er den Leib erhebt, den Kopf in die Höhe richtet und das Gefieder knapp anlegt. Ungeachtet seines leichten Fluges fliegt er übrigens, falls er nicht auf der Reise ist, ungern weit, läßt sich vielmehr gewöhnlich, wenn er nicht geradezu aufgescheucht ist, bald wieder nieder. Während des Tages ist er viel beschäftigt, jedoch nicht so unruhig und unstet wie der Eichelhäher. Seine Stimme ist ein kreischendes, weittönendes »Kräck, kräck, kräck«, dem er im Frühjahr oft wiederholt »Körr, körr« zufügt. Während der Brutzeit vernimmt man, jedoch nur, wenn man sich ganz in seiner Nähe befindet, auch wohl einen absonderlichen, leisen, halb unterdrückten, bauchrednerischen Gesang. Seine Sinne scheinen wohl entwickelt zu sein. In seinen menschenleeren Wildnissen kommt er so wenig mit dem Erzfeinde der Tiere zusammen, daß er sich diesem gegenüber bei seinen Reisen oft recht einfältig benimmt; erfährt er jedoch Nachstellungen, so flieht er vor dem Menschen ebenso ängstlich wie vor andern, ihm von jeher wohlbekannten Feinden, z.+B. Raubsäugetieren und Raubvögeln.
Im Hügelgürtel ist es, laut Tschudi, der eigene und fremde Beobachtungen in ansprechender Weise zusammengestellt hat, vorzüglich der Haselstrauch, dessen Nüsse die Tannenhäher lieben. Sobald die Haselnüsse reifen, versammeln sich alle Nußknacker der ganzen Gegend auf solchen Strecken, die der Strauch überzieht. Zu dieser Zeit fliegen sie viel herum, und ihre Stimme ist fast überall zu hören. Der Morgen wird dem Aufsuchen der Nahrung gewidmet; gegen Mittag verschwinden die bis dahin emsig arbeitenden Nußknacker im Wald; in den späteren Nachmittagsstunden zeigen sie sich wieder, wenn auch minder zahlreich als am Morgen, in den Büschen. In den Morgenstunden nimmt ihr Schreien und Zanken kein Ende. Jeden Augenblick erscheinen einige, durch jenes Geschrei herbeigelockt, und ebenso fliegen andere, die ihren dehnbaren Kehlsack zur Genüge mit Nüssen angefüllt haben, schwerbeladen und unter sichtlicher Anstrengung dem Wald zu, um ihre Schätze dort in Vorratskammern für den Winter aufzuspeichern. Um die Mittagszeit pflegen fast alle im dichten Unterholz der Waldungen wohlverdienter Ruhe. In den späten Nachmittagsstunden erscheinen sie wiederum, schreien wie am Morgen, setzen sich aber oft halbe Stunden lang auf die höchste Spitze einer Tanne oder Fichte, um von hier aus Umschau zu halten. Im Berggürtel oder in den hochnordischen Waldungen sind es die Zirbelnüsse, die sie zu ähnlichen Ausflügen veranlassen. Schon um die Mitte des Juli, vor der Reife dieser Nüsse, finden sie sich, wenn auch zunächst noch in geringer Anzahl, auf den zapfentragenden Arven ein; bei vollständiger Reife der Frucht erscheinen sie in erheblicher Menge und unternehmen nunmehr förmliche Umzüge von Berg zu Tal und umgekehrt, beladen sich auch ebenso wie jene, die die Haselsträucher plündern. Abgesehen von Hasel- und Zirbelnüssen frißt der Tannenhäher Eicheln, Bücheln, Tannen-, Fichten- und Kiefernsamen, Getreide, Eberesch- oder Vogel-, Weißdorn-, Faulbaum-, Erd-, Heidel-, Preiselbeeren, sonstige Sämereien und Früchte, allerlei Kerbtiere, Würmer, Schnecken und kleine Wirbeltiere aller Klassen, ist überhaupt kein Kostverächter und leidet daher selbst im Winter keine Not. Eine Zeitlang hält er sich an seine Speicher; sind diese geleert, so erscheint er in den Gebirgsdörfern oder wandert aus, um anderswo sein tägliches Brot zu suchen.
Über das Brutgeschäft des Nußknackers haben wir erst in den beiden letzten Jahrzehnten sichere Aufschlüsse erhalten. Ein Nest zu finden, ist auch dann schwierig, wenn ein Paar in unsern Mittelgebirgen nistet; die eigentlichen Brutplätze des Vogels aber sind die Waldungen seiner wahren Heimat, Dickichte, die kaum im Sommer, noch viel weniger, wenn der Nußknacker zur Fortpflanzung schreitet, begangen werden können. Nach Schütts und Vogels Erfahrungen werden die Nester schon im Anfang des März gebaut und in der letzten Hälfte des Monats die Eier gelegt; um diese Zeit aber liegen die Waldungen des Gebirges ebenso wie die nordischen Wälder noch in tiefem Schnee begraben und sind schwer oder nicht zugänglich. Der Forscher muß also einen schneearmen Frühling abwarten, bevor er überhaupt an das Suchen eines Nestes denken kann.
Mein Vater erfuhr, daß im Vogtlande ein Nußknackernest in einem hohlen Baum gefunden worden sei, und diese Angabe erscheint keineswegs unglaublich, da auch Dybowski und Parrox in Ostsibirien dasselbe zu hören bekamen, ihnen sogar eine Kiefer, in deren Höhlung ein Paar gebrütet haben sollte, gezeigt wurde; indessen stimmen alle Beobachter, die in Deutschland, Österreich, Dänemark, Skandinavien und der Schweiz Nester untersuchten, darin überein, daß letztere im dichten Geäste verschiedener Nadelbäume, insbesondere Fichten, außerdem Tannen, Arven, Lärchen, in einer Höhe von vier bis zehn Meter über dem Boden angelegt werden. Laut Vogel wählt das Paar zum Standort seines Nestes am liebsten einen freien und sonnigen, also nach Süden oder Südosten gelegenen Bergeshang und hier auf dem erkorenen Baum Äste nahe dem Stamm. Die Baustoffe trägt es oft von weither zusammen. Unter hörbarem Knacken bricht es dünne und dürre, mit Bartflechten behangene Reiser von allen Nadelbaumarten seines Brutgebietes, auch wohl von Eschen und Buchen ab, legt diese lockerer oder dichter zum Unterbau zusammen, schichtet darauf eine Lage Holzmoder, baut nunmehr die Mulde vollends auf, durchflicht auch wohl die Außenwände, vielleicht der Ausschmückung halber, mit grünen Zweigen und kleidet endlich das Innere mit Bartflechten, Moos, dürren Halmen und Baumbast aus. Unter regelrechten Verhältnissen findet man das volle Gelege Mitte März, im Norden vielleicht erst Anfang April. Es besteht aus drei bis vier länglich eirunden, durchschnittlich vierunddreißig Millimeter langen, fünfundzwanzig Millimeter dicken Eiern, die auf blaß blaugrünem Grund mit veilchenfarbenen, grün- und lederbraunen, über die ganze Fläche gleichmäßig verteilten, am stumpfen Ende zuweilen zu einem Kranze zusammenfließenden Flecken gezeichnet sind. Das Weibchen brütet, der frühen Jahreszeit entsprechend, sehr fest und hingebend; das Männchen sorgt für Sicherung und Ernährung der Gattin, die die ihr gebrachte Atzung, mit den Flügeln freudig zitternd, begierig empfängt. Nach siebzehn bis neunzehn Tagen sind die Jungen gezeitigt, werden von beiden Eltern mit tierischen und pflanzlichen Stoffen ernährt und mutig beschützt, verlassen etwa fünfundzwanzig Tage nach ihrem Ausschlüpfen das Nest und treiben sich, zunächst noch von den Eltern geführt und geleitet, im dichtesten Wald umher, bis sie selbständig geworden sind und nunmehr die Lebensweise ihrer Eltern führen können. Solange das Weibchen brütet, verhält es sich möglichst lautlos, um das Nest nicht zu verraten, fliegt, gestört und vertrieben, lautlos ab und kehrt ebenso zum Nest zurück, sieht sogar von einem nahestehenden Baum stumm dem Raub seiner Brut zu, vereinigt sich auch nicht mit seinem Männchen, dessen Wandel, Tun und Treiben ebenso heimlich, verborgen, laut- und geräuschlos ist; wenn jedoch die Jungen heranwachsen, geht es lebhafter am Nest her, weil deren Begehrlichkeit durch auf weithin vernehmliches Geschrei sich äußert und auch die Alten, wenigstens bei herannahender Gefahr, ihrer Sorge durch ängstliches Schnarren Ausdruck verleihen oder durch heftige Verfolgung aller vorüberfliegenden Raubvögel sich bemerklich machen. Nachdem die Jungen ausgeflogen sind, vereinigen sich mehrere Familien und streifen gesellig umher.
Während seiner winterlichen Streifereien wird der Tannenhäher ohne sonderliche Mühe auf dem Vogelherd oder unter geköderten Netzen gefangen. Er gewöhnt sich bald an Käfig und Gefangenkost, zieht zwar Fleisch allem übrigen Futter vor, nimmt aber mit allen genießbaren Stoffen vorlieb. Ein angenehmer Stubenvogel ist er nicht. Täppisch und etwas unbändig gebärdet er sich, arbeitet und meißelt an den Holzwänden des Käfigs herum und hüpft rastlos von einem Zweig auf den andern. Mit schwächeren Vögeln darf man ihn nicht zusammensperren; denn seine Mordlust ist so groß, daß er sich schwer abhalten läßt, jene zu überfallen. Am anmutigsten erscheint der Vogel, wenn er mit Aufknacken der Nüsse beschäftigt ist. Diese nimmt er geschickt zwischen die Fänge, dreht sie, bis das stumpfe Ende nach oben kommt, und zermeißelt sie rasch, um zu dem Kern zu gelangen. Er bedarf viel zu seinem Unterhalt und ist fast den ganzen Tag über mit seiner Mahlzeit beschäftigt.
Bei uns zulande würde der Nußknacker schädlich werden können; in seiner Sommerheimat macht er sich verdient. Ihm hauptsächlich soll man die Vermehrung der Arven danken, er soll es sein, der diese Bäume selbst da anpflanzt, wo weder der Wind noch der Mensch die Samenkörner hinbringen kann.
*
Langschwänzige Raben sind die Elstern ( Pica), deren Merkmale in dem mehr als körperlangen, stark gesteigerten Schwanz und reichem Gefieder gefunden werden.
Die Elster, Alster, Heste, Heister usw. ( Pica caudata) erreicht eine Länge von fünfundvierzig bis achtundvierzig und eine Breite von fünfundfünfzig bis achtundfünfzig Zentimeter, wobei sechsundzwanzig Zentimeter auf den Schwanz und achtzehn Zentimeter auf den Fittich zu rechnen sind. Kopf, Hals, Rücken, Kehle, Gurgel und Oberbrust sind glänzend dunkelschwarz, auf Kopf und Rücken ins Grünliche scheinend, die Schultern, ein mehr oder minder vollständiges, oft nur angedeutetes Querband über den Rücken sowie die Unterteile weiß, die Schwingen blau, außen wie die Handschwingendecken grün, innen größtenteils weiß und nur an der Spitze dunkel, die Steuerfedern dunkelgrün, an der Spitze schwarz, überall metallisch, zumal kupferig schillernd. Das Auge ist braun, der Schnabel wie der Fuß schwarz. Bei den Jungen ist die Färbung gleich, jedoch matt und glanzlos. Mehrere Abarten, zum Teil auch ständig vorkommende, sind als besondere Arten aufgestellt worden, mit Sicherheit jedoch nicht zu unterscheiden.
Das Verbreitungsgebiet der Elster umfaßt Europa und Asien vom nördlichen Waldgürtel an bis Kaschmir und Persien. In den meisten Ländern und Gegenden tritt sie häufig auf, in andern fehlt sie fast gänzlich. So sieht man sie in vielen Provinzen Spaniens gar nicht, wogegen sie in andern gemein ist. Auch hohe Gebirge, baumfreie Ebenen und ausgedehnte Waldungen meidet sie. Feldgehölze, Waldränder und Baumgärten sind ihre eigentlichen Wohnsitze. Sie siedelt sich gern in der Nähe des Menschen an und wird da, wo sie Schonung erfährt, ungemein zutraulich oder richtiger aufdringlich. Ihr eigentliches Wohngebiet ist klein, und sie verläßt dasselbe niemals. Wird sie in der Gemarkung eines Dorfes ausgerottet, so währt es lange Jahre, bevor sie allgemach von den Grenzen her wieder einrückt. Nur im Winter streift sie, obgleich immer noch in sehr beschränktem Grade, weiter umher als sonst.
In Lebensweise und Betragen erinnert die Elster zwar vielfach an die Krähen, unterscheidet sich aber doch in mehrfacher Hinsicht nicht unwesentlich von den Verwandten. Sie geht schrittweise, ungefähr wie ein Rabe, trägt sich aber anders; denn sie erhebt den langen Schwanz und bewegt ihn wippend, wie Drossel und Rotkehlchen tun. Ihr schwerfälliger, durchaus von dem der eigentlichen Raben verschiedener Flug erfordert häufige Flügelschläge und wird schon bei einigermaßen starkem Winde unsicher und langsam. Der Rabe fliegt zu seinem Vergnügen stundenlang umher; die Elster gebraucht ihre Schwingen nur, wenn sie muß. Sie bewegt sich von einem Baume zum andern oder von dem ersten Gebüsch zu dem nächsten, unnützerweise niemals. Ihre Sinne scheinen ebenso scharf zu sein wie die der Raben, und an Verstand steht sie hinter diesen durchaus nicht zurück. Sie unterscheidet genau zwischen gefährlichen und ungefährlichen Menschen oder Tieren: den ersteren gegenüber ist sie stets auf ihrer Hut, den letzteren gegenüber dreist und unter Umständen grausam. Gesellig wie alle Glieder ihrer Familie, mischt sie sich gern unter Raben und Krähen, schweift auch wohl mit Nußhähern umher, vereinigt sich aber doch am liebsten mit andern ihrer Art zu kleineren oder größeren Flügen, die gemeinschaftlich jagen, überhaupt an Freud und Leid gegenseitig den innigsten Anteil nehmen. Gewöhnlich sieht man sie familienweise. Ihre Stimme ist ein rauhes »Schak« oder »Krak«, das auch oft verbunden wird und dann wie »Schakerak« klingt. Diese Laute sind Lockton und Warnungsruf und werden je nach der Bedeutung verschieden betont. Im Frühling vor und während der Paarungszeit schwatzt sie mit staunenswertem Aufwande von ähnlichen und doch verschiedenen Lauten stundenlang, und das Sprichwort beruht deshalb auf tatsächlichem Grunde.
Kerbtiere und Gewürm, Schnecken, kleine Wirbeltiere aller Art, Obst, Beeren, Feldfrüchte und Körner bilden die Nahrung der Elster. Im Frühjahr wird sie sehr schädlich, weil sie die Nester aller ihr gegenüber wehrlosen Vögel unbarmherzig ausplündert und einen reichbewohnten Garten buchstäblich verheert und verödet. Auch den Hühner- und Entenzüchtern, den Fasanerien und dem Federwilde wird sie lästig, fängt sogar alte Vögel und diese, wie Naumann sagt, oft ganz unvermutet, weil sie beständig mit ihnen in Gesellschaft ist, jene sich vor ihr nicht fürchten und so in ihrer Sicherheit von ihr übertölpeln lassen. Ebenso betreibt sie freilich auch Mäusejagd und fängt und verzehrt viele schädliche Kerbtiere, Schnecken und sonstiges Gewürm, tritt aber überall als ein so räuberischer Vogel auf, daß sie unzweifelhaft unter nützlichen Tieren schlimmer haust als unter schädlichen, daher zu den letzteren gezählt werden muß.
Die Norweger behaupten, daß die Elster am Weihnachtstage das erste Reis zu ihrem Horste trage; in Deutschland geschieht dies gewöhnlich nicht vor Ende Februar. Das Nest wird bei uns auf den Wipfeln hoher Bäume und nur da, wo sich der Vogel ganz sicher weiß, in niedrigen Büschen angelegt. Dürre Reiser und Dornen bilden den Unterbau; hierauf folgt eine dicke Lage von Lehm und nun erst die eigentliche Nestmulde, die aus feinen Wurzeln und Tierhaaren besteht und sehr sorgsam hergerichtet ist. Das ganze Nest wird oben, bis auf einen seitlich angelegten Zugang, mit einer Haube von Dornen und trockenen Reisern versehen, die zwar durchsichtig ist, den brütenden Vogel aber doch vollständig gegen etwaige Angriffe der Raubvögel sichert. Das Gelege besteht aus sieben bis acht, dreiunddreißig Millimeter langen, dreiundzwanzig Millimeter dicken, auf grünem Grunde braun gesprenkelten Eiern. Nach etwa dreiwöchentlicher Brutzeit entschlüpfen die Jungen und werden nun von beiden Eltern mit Kerbtieren, Regenwürmern, Schnecken und kleinen Wirbeltieren großgefüttert. Vater und Mutter lieben die Kinderschar ungemein und verlassen sie nie. Wir haben erfahren, daß eine Elster, auf die wir geschossen hatten, mit dem Schrotkorn im Leibe noch fortbrütete. Wenige Vögel nähern sich mit größerer Vorsicht ihren Nestern als die Elstern, die alle möglichen Listen gebrauchen, um jene nicht zu verraten. In Spanien muß die Elster oft in derselben Weise Pflegemutterdienste verrichten wie die Nebelkrähe in Ägypten: der Häherkuckuck vertraut dort ihr seine Eier an, und sie unterzieht sich der Pflege des Findlings mit derselben Liebe, die sie ihren eigenen Kindern erweist. Werden diese geraubt oder auch nur bedroht, so erheben die Alten ein Zetergeschrei und vergessen nicht selten die ihnen eigene Vorsicht. Um ein getötetes Junges versammeln sich alle Elstern der Umgegend, die durch das Klagegekrächze der Eltern herbeigezogen werden können.
Jung aus dem Neste genommene Elstern werden außerordentlich zahm, lassen sich mit Fleisch, Brot, Quark, frischem Käse leicht auffüttern, zum Aus- und Einfliegen gewöhnen, zu Kunststückchen abrichten, lernen Lieder pfeifen und einzelne Worte sprechen und bereiten dann viel Freude, durch ihre Sucht, glänzende Dinge zu verstecken, aber auch wieder Unannehmlichkeiten.
Der Mensch, der dem Kleingeflügel seinen Schutz angedeihen läßt, wird früher oder später zum entschiedenen Feinde der Elster und vertreibt sie erbarmungslos aus dem von ihm überwachten Gehege. Auch der Aberglaube führt den Herrn der Erde gegen sie ins Feld. Eine im März erlegte und an der Stalltür aufgehangene Elster hält, nach Ansicht glaubensstarker Leute, Fliegen und Krankheiten vom Vieh ab; eine in den zwölf Nächten geschossene, verbrannte und zu Pulver gestoßene Elster aber ist ein unfehlbares Mittel gegen die fallende Sucht. Liebe, dessen trefflichem Berichte über die Brutvögel Thüringens ich vorstehende Angaben entnehme, meint, daß der letzterwähnte Aberglaube wesentlich dazu beigetragen habe, die früher in Thüringen häufigen Elstern zu vermindern: so viele von ihnen wurden erlegt, verbrannt und zerstoßen, um das fallsuchtheilende »Diakonissinnenpulver« zu erzielen. Außer dem Menschen stellen wohl nur die stärkeren Raubvögel dem pfiffigen und mutigen Vogel nach. Am schlimmsten treibt es der Hühnerhabicht, gegen dessen Angriffe nur dichtes Gebüsch rettet. Eine von ihm ergriffene Elster schreit, nach Naumanns Beobachtungen, kläglich und sucht sich mit grimmigen Bissen zu verteidigen: was aber der Habicht gepackt hat, muß sterben.
*
Die Baumkrähen oder Häher ( Garrulinae) unterscheiden sich von den bisher beschriebenen Raben durch kurzen und stumpfen Schnabel mit oder ohne schwachen Haken am Oberkiefer und reiches, weiches, zerschlissenes, buntfarbiges Gefieder. Alle hierher gehörigen Vögel leben weit mehr auf Bäumen und viel weniger auf dem Boden als die eigentlichen Raben.
Unser Häher, Eichel-, Nuß-, Holz- und Waldhäher, Holzschreier, Holzheister, Nußhacker, Heger, Hägert, Herold, Marquard, Margolf usw. ( Garrulus glandarius) ist der Vertreter einer gleichartigen Sippe ( Garrulus). Die vorherrschende Färbung seines Gefieders ist ein schönes, oberseits dunkleres, unterseits lichteres Weinrotgrau; die Hollenfedern sind weiß, in der Mitte durch einen lanzettförmigen schwarzen, bläulich umgrenzten Fleck gezeichnet, die Zügel gelblichweiß und dunkler längsgestreift, die Kehlfedern weißlich, die des Bürzels und Steißes weiß, ein breiter und langer Bartstreifen jederseits und die Schulterschwingen sammetschwarz, die Handschwingen braunschwarz, außen grauweiß gesäumt, die Armschwingen in der Wurzelhälfte weiß, einen Spiegel bildend, nahe an der Wurzel blau geschuppt, in der Endhälfte sammetschwarz, die Oberflügeldecken innen schwarz, außen himmelblau, weiß und schwarzblau in die Quere gestreift, wodurch ein prachtvoller Schild entsteht, die Schwanzfedern endlich schwarz, in der Wurzelhälfte mehr oder weniger deutlich blau quergezeichnet. Das Auge hat perlfarbene, der Schnabel schwarze, der Fuß bräunlich fleischrote Färbung. Die Länge beträgt vierunddreißig, die Breite bis fünfundfünfzig, die Fittichlänge siebzehn, die Schwanzlänge fünfzehn Zentimeter.

Eichelhäher ( Garrulus glandarius)
Mit Ausnahme der nördlichsten Teile Europas findet sich der Eichelhäher in allen Waldungen dieses Erdteiles.
In Deutschland ist er überall zu finden, in den tieferen Waldungen ebensowohl wie in den Vor- und Feldhölzern, im Nadelwalde fast ebenso häufig wie im Laubwalde. Er lebt im Frühjahr paarweise, während des ganzen übrigen Jahres in Familien und Trupps und streicht in beschränkter Weise hin und her. Da, wo es keine Eichen gibt, verläßt er die Gegend zuweilen wochen-, ja selbst monatelang; im allgemeinen aber hält er jahraus jahrein getreulich an seinem Wohnorte fest. Er ist ein unruhiger, lebhafter, listiger, ja äußerst verschlagener Vogel, der durch sein Treiben viel Vergnügen, aber auch viel Ärger gewährt. Zu seiner Belustigung und Unterhaltung nimmt er die mannigfaltigsten Stellungen an, ahmt auch die verschiedensten Stimmen in trefflicher Weise nach. Er ist höchst gewandt im Gezweige, ebenso ziemlich geschickt auf dem Boden, aber ein ungeschickter Flieger, daher überaus ängstlich, auf weithin freie Strecken zu überfliegen. Solange er irgend kann, hält er sich an die Gebüsche, und bei seinen Flügen über offene Gegenden benutzt er jeden Baum, um sich zu decken. Er lebt in beständiger Furcht vor den Raubvögeln, die ihm nur im Walde nicht beizukommen wissen, ihn aber bei länger währendem Fluge sofort ergreifen. Naumann schreibt dieser Furcht, und wohl mit vollem Recht, eine Eigenheit des sonst geselligen Vogels zu, daß er nämlich, wenn er über Feld fliegt, niemals truppweise, sondern immer nur einzeln, einer in weitem Abstände hinter dem andern, dahinzieht.

Brütender Eichelhäher ( Garrulus glandarius)
Höchst belustigend ist die wirklich großartige Nachahmungsgabe des Hähers, unter unsern Spottvögeln unzweifelhaft einer der begabtesten und unterhaltendsten. Sein gewöhnliches Geschrei ist ein kreischendes, abscheuliches »Rätsch« oder »Räh«, der Angstruf ein kaum wohllautenderes »Käh« oder »Kräh«. Auch schreit er zuweilen wie eine Katze »Miau«, und gar nicht selten spricht er, etwas bauchrednerisch zwar, aber doch recht deutlich das Wort »Margolf« aus. Außer diesen Naturlauten stiehlt er alle Töne und Laute zusammen, die er in seinem Gebiete hören kann. Den miauenden Ruf des Bussards gibt er auf das täuschendste und so regelmäßig wieder, daß man im Zweifel bleibt, ob er damit fremdes oder eigenes Gut zu Markte bringt. Für ersteres sprechen andere Beobachtungen. Man weiß, daß er die Laute hören ließ, die das Schärfen einer Säge hervorbringt. Naumann hat einen das Wiehern eines Füllens bis zur völligen Täuschung nachahmen gehört; andere haben sich im Krähen des Haushahns und im Gackern des Huhns mit Erfolg versucht. Die verschiedenen, hier und da aufgeschnappten Töne werden unter Umständen auch zu einem sonderbar schwatzenden Gesange verbunden, der bald mehr, bald minder wohllautend sein kann.
Leider besitzt der Häher andere Eigenschaften, wodurch er sich die gewonnene Gunst des Menschen bald wieder verscherzt. Er ist Allesfresser im ausgedehntesten Sinne des Wortes und der abscheulichste Nestzerstörer, den unsere Wälder aufzuweisen haben. Von der Maus oder dem jungen Vögelchen an bis zum kleinsten Kerbtiere ist kein lebendes Wesen vor ihm gesichert, und ebensowenig verschmäht er Eier, Früchte, Beeren und dergleichen. Im Herbste bilden Eicheln, Bucheckern und Haselnüsse oft wochenlang seine Hauptnahrung. Die ersteren erweicht er im Kropfe, speit sie dann aus und zerspaltet sie; die letzteren zerhämmert er, wenn auch nicht ganz ohne Mühe, mit seinem kräftigen Schnabel. Gelegentlich seiner Eicheldiebereien nützt er in beschränktem Grade, indem er zur Anpflanzung der Waldbäume beiträgt. Im übrigen ist er durchaus nicht nützlich, sondern nur schädlich. Lenz hält ihn für den Hauptvertilger der Kreuzotter und beschreibt in seiner »Schlangenkunde« in ausführlicher Weise, wie er jungen Kreuzottern, sooft er ihrer habhaft werden kann, ohne Umstände den Kopf spaltet und sie dann mit großem Behagen frißt, wie er selbst die erwachsenen überwältigt, ohne sich selbst dem Giftzahn auszusetzen, indem er den Kopf des Giftwurmes so sicher mit Schnabelhieben bearbeitet, daß dieser bald das Bewußtsein verliert und durch einige rasch aufeinander folgende Hiebe binnen wenigen Minuten getötet wird. Unser Forscher stellt wegen dieser Heldentaten den Eichelhäher hoch und hat ihn sogar in einem recht hübschen Gedicht verherrlicht; aber die räuberische Tätigkeit gilt leider nicht dem giftigen Gewürm allein, sondern gewiß in noch viel höherem Grade dem nützlichen kleinen Geflügel. Seine Raubgier wird groß und klein gefährlich. Naumanns Bruder fand einen Eichelhäher beschäftigt, eine alte Singdrossel, die Mutter einer zahlreichen Kinderschar, die sich, wie es schien, derselben zuliebe aufgeopfert hatte, abzuwürgen, und derselbe Beobachter traf später den Häher als eifrigen und geschickten Jäger junger Rebhühner an. Trinthammer und Alexander von Homeyer verdammen den Häher ebenso, wie Lenz ihn hochpreist. »Was treibt dieser fahrende Ritter«, fragt ersterer, »dieser verschmitzte Bursche, der schmucke Vertreter der Galgenvögelgesellschaft, die ganze Brutzeit hindurch? Von Baum zu Baum, von Busch zu Busch schweifend, ergattert er die Nester, säuft die Eier aus, verschlingt die nackten Jungen mit Haut und Haar und hascht und zerfleischt die ausgeflogenen Gelbschnäbel, die noch unbeholfen und ungewitzigt ihn zu nahe kommen lassen. Der Sperber und die drei Würger unserer Wälder sind zwar ebenfalls schlimme Gesellen; aber sie alle zusammen hausen noch lange nicht so arg unter den Sängern des Waldes, als der Häher. Er ist der ›Neunmalneuntöter‹, der Würger in des Wortes eigentlicher Bedeutung und als solcher geschmückt mit Federbusch und Achselbändern.« Ich muß mich, so gern ich den Häher im Walde sehe, der Ansicht Trinthammers vollständig anschließen und will nur noch hinzufügen, daß die hauptsächlichsten Dienste, die er zu leisten vermag, durch den Bussard viel besser und vollständiger ausgeführt werden, während dieser die kleinen nützlichen Vögel kaum behelligt.
Das Brutgeschäft des Hähers fällt in die ersten Frühlingsmonate. Im März beginnt das Paar mit dem Bau des Nestes; Anfang April pflegt das Gelege vollständig zu sein. Das Nest steht selten hoch über dem Boden, bald im Wipfel eines niederen Baumes, bald in der Krone eines höheren, bald nahe am Schafte, bald außen in den Zweigen. Es ist nicht besonders groß, zuunterst aus zarten, dünnen Reisern, dann aus Heidekraut oder trockenen Stengeln erbaut und innen mit seinen Würzelchen sehr hübsch ausgelegt. Die fünf bis neun Eier sind dreißig Millimeter lang, dreiundzwanzig Millimeter dick und auf schmutzig gelbweißem oder weißgrünlichem Grunde überall mit graubraunen Tüpfeln und Punkten, am stumpfen Ende gewöhnlich kranzartig, gezeichnet. Nach etwa sechzehntägiger Bebrütung entschlüpfen ihnen die Jungen, die zunächst mit Räupchen und Larven, Käfern und andern Kerbtieren, Würmern und dergleichen, später aber vorzugsweise mit jungen Vögeln ausgefüttert werden. Ungestört, brütet das Paar nur einmal im Jahre.
Als schlimmster Feind des Hähers ist wohl der Habicht, nächst diesem der Sperber anzusehen. Der erstere überwältigt ihn leicht, der letztere erst nach langem Kampfe. Wir haben wiederholt Sperber und Häher erhalten, die bei einem derartigen Streite sich ineinander verkrallt und verbissen hatten, zu Boden gestürzt und so gefangen worden waren. Bei seinen Ausflügen nach einzeln stehenden Eichbäumen fällt er dem Wanderfalken zur Beute. Nachts bedroht ihn der Uhu und vielleicht auch der Waldkauz; das Nest endlich wird durch den Baummarder geplündert. Andere gefährliche Gegner scheint der wehrhafte Gesell nicht zu haben. Da nun alle genannten Feinde, vielleicht mit alleiniger Ausnahme des Habichts, im Abnehmen begriffen sind, ebenso auch Jagd und Jägerei von Jahr zu Jahr mehr abnehmen, vermehrt sich der Bestand der Häher in besorgniserregender Weise. Wettergestählt und hinsichtlich seiner Nahrung in keiner Weise wählerisch, hat er wenig zu leiden. Vierfüßige Raubtiere entdeckt er gewöhnlich eher, als sie ihn, und verleidet ihnen durch fortwährendes Verfolgen und fürchterliches Schreien oft genug die Jagd. Dem Menschen gegenüber zeigt er sich stets vorsichtig, und wenn er einmal verscheucht wurde, ungemein scheu, foppt auch den Jäger nach Herzenslust und ärgert ihn, weil er andere Tiere vor ihm warnt. An alteingefangenen Hähern hat man wenig Freude, weil sie selten zahm werden; jung aufgezogene hingegen können ihrem Besitzer viel Vergnügen gewähren. Auch sie lernen unter Umständen einige Worte nachplaudern, öfters kurze Weisen nachpfeifen. Daß sie im Gesellschaftsbauer nicht geduldet werden dürfen, braucht kaum erwähnt zu werden; denn ihre Raubsucht verleugnen sie nie.
*
Unserm Margolf in jeder Beziehung ebenbürtige Mitglieder der Hähergruppe sind die Blauraben ( Cyanocorax), südamerikanische Häher. Der Kappenblaurabe( Cyanocorax chrysops), eine der verbreitetsten Arten der Sippe, erreicht eine Länge von fünfunddreißig bis siebenunddreißig und eine Breite von fünfundvierzig Zentimeter; sein Fittich mißt fünfzehn, sein Schwanz siebzehn Zentimeter. Stirn, Zügel und Oberkopf, Halsseiten, Kehle und Vorderhals bis zur Brust herab sind kohlschwarz, Nacken, Rücken, Flügel- und Schwanzfedern, soweit letztere nicht von den Schwingen bedeckt werden, ultramarinblau, an der Wurzel schwarz, die Unterteile von der Brust an bis zum Steiß, die Unterflügelfedern und die Schwanzspitze gelblichweiß; über und unter dem Auge steht ein breiter, halbmondförmiger Fleck von himmelblauer Färbung, an der Wurzel des Unterschnabels ein ähnlicher; ersterer ist oben silbern gesäumt. Das Auge ist gelb, der Schnabel wie der Fuß schwarz.
Das Verbreitungsgebiet umfaßt das ganze wärmere Südamerika und erstreckt sich nach Süden hin bis Paraguay. Hier hat unser Vogel an Hudson einen trefflichen Beschreiber gefunden. Der Blaurabe, der von den Spaniern »Uracca« oder Elster genannt wird, bekundet durch die kurzen Fittiche, den langen Schwanz und das knappe Gefieder sowie endlich durch die zum Klettern wohl eingerichteten Beine, daß er kein Vogel der Pampas ist, vielmehr von seinen heimischen Waldungen aus allmählich das letztere Gebiet sich erobert hat. In der Tat findet er sich hier auch nur da, wo Bäume gedeihen. Während des Winters ist er hier ein beklagenswerter Vogel; denn mehr als irgendein anderer scheint er von der Kälte zu leiden. Ein Schwarm, der aus zehn bis zwanzig Stück besteht, sucht allabendlich dichte Zweige vor dem Winde geschützter Bäume auf und setzt sich hier, um zu schlafen, so dicht nebeneinander nieder, daß er nur einen einzigen Klumpen bildet. Nicht selten hocken einige buchstäblich auf den Rücken der andern, und der Klumpen bildet so eine vollständige Pyramide. Demungeachtet wird mehr als einem von ihnen die Kälte verhängnisvoll; denn nicht selten findet man erstarrte oder erfrorene Blauraben unter den Schlafplätzen. Wenn der Morgen schön ist, begibt sich der Trupp auf einen hohen, der Sonne ausgesetzten Baum, wählt hier die Zweige der Ostseite, breitet die Schwingen und reckt sich mit Vergnügen in den Sonnenstrahlen, verweilt auch in dieser Stellung fast regungslos eine oder zwei Stunden, bis das Blut sich wieder erwärmt hat und das Federkleid vom Tau trocken geworden ist. Auch während des Tages sieht man die Vögel sich oft sonnen und gegen Abend auf der Westseite der Bäume die letzten Strahlen des wärmenden Gestirnes auffangen. Nur ihre Fruchtbarkeit und der Überfluß an Nahrung befähigt sie, ihre Stelle unter den Pampasvögeln zu behaupten; entgegengesetztenfalls würde die Kälte, ihr einziger Feind, sie sicherlich ausrotten.
Mit Beginn des warmen Frühlingswetters zeigt sich die Uracca ganz anders als früher. Sie wird lebendig, laut, heiter und lustig. Ununterbrochen wandert der Schwarm von einem Platze zum andern, ein Vogel einzeln und unstet hinter dem andern herfliegend, jeder einzelne aber fortwährend in kläglicher Weise schreiend. Dann und wann läßt auch wohl einer seinen Gesang vernehmen, eine Reihe langgedehnter, pfeifender Töne, von denen die ersten kräftig und laut, die andern matter und immer matter ausgestoßen werden, bis das Ganze plötzlich in einem innerlichen, dem tiefen Atmen oder Schnarchen des Menschen ähnelnden Gemurmel sein Ende findet. Naht jemand dem Schwarme, so schreit derselbe so unerträglich laut, schrillend und anhaltend, daß der Eindringling, heiße er Mann oder Tier, in der Regel froh ist, der Nachbarschaft der Schreihälse wieder zu entrinnen. Gegen die Brutzeit hin vernimmt man übrigens, wahrscheinlich von den Männchen, auch sanfte und zarte, plaudernde oder schwatzende Laute. Nunmehr teilen sich die Schwärme in Paare und zeigen sich mißtrauisch in ihrem ganzen Auftreten. Ihr Nest wird in der Regel auf langen, dornigen Bäumen aus sehr starken Reisern errichtet, meist aber nur lose und so liederlich gebaut, daß die Eier durchscheinen, zuweilen sogar durchfallen. Nester von besserer Bauart, die innen mit Federn, trockenen oder grünen Blättern ausgekleidet sind, werden schon seltener gefunden. Das Gelege enthält sechs bis sieben, im Verhältnis zur Größe des Vogels umfangreiche Eier, manchmal auch ihrer mehr; einmal fand Hudson sogar deren vierzehn in einem Neste und konnte, da er die Vögel von Beginn des Baues an beobachtete, feststellen, daß sie von einem Paar herrührten. Ihre Grundfärbung ist ein schönes Himmelblau; die Zeichnung besteht aus einer dicht aufgetragenen, weißen, zarten, kalkartigen Masse, die anfänglich leicht abgewischt oder abgewaschen werden kann. Die Häßlichkeit der jungen Blauraben ist sprichwörtlich und der Ausdruck »Blaurabenkind« zur Bezeichnung eines Menschen geworden, der aller Anmut entbehrt. Abgesehen von ihrer Häßlichkeit zeichnen sich die Jungen auch durch ihre Unsauberkeit aus, so daß ein mit sechs oder acht von ihnen gefülltes Nest ebensowenig vor den Augen als vor der Nase Gnade findet. Dagegen ist der Eindruck des Geschreis der Jungen stets ein erheiternder, weil ihre Stimmlaute an das schrillende Gelächter eines Weibes erinnern. Ein in unmittelbarer Nähe von Hudsons Haus errichtetes Nest gab Gelegenheit, das Betragen der Alten zu beobachten. Bei Ankunft der futterbringenden Alten brachen die Jungen in ein so zügelloses, wild tobendes Geschrei aus, daß man ihnen ohne Lächeln kaum zuhören konnte.
Jung dem Neste enthobene Blauraben werden bei einiger Pflege bald außerordentlich zahm und benehmen sich in der Gefangenschaft etwa nach Art unserer Dohlen oder Elstern, zeichnen sich aber dadurch zu ihrem Vorteil aus, daß sie mit ihresgleichen auch jetzt noch Frieden halten. Im Freien verzehren sie zwar vorzugsweise Kerbtiere, rauben aber doch auch allerlei kleine Säugetiere, Vögel und Kriechtiere; in Gefangenschaft ernährt man sie mit dem, was auf den Tisch kommt. Dank ihrer Anspruchslosigkeit gelangen sie neuerdings recht oft in unsere Käfige.
*
Im Norden Amerikas werden die Blauraben durch die Schopfhäher ( Cyanocitta) ersetzt. Die bekannteste Art der wenig artenreichen Gruppe ist der Blauhäher ( Cyanocitta cristata). Das Gefieder der Oberseite ist der Hauptfarbe nach glänzend blau; die Schwanzfedern sind durch schmale, dunkle Bänder und die Flügelfedern durch einzelne schwarze Endflecke gezeichnet, die Enden der Armschwingen, der größeren Flügeldeckfedern und die seitlichen Schwanzfedern aber wie die Unterseite von der Brust an weiß oder grauweiß gefärbt, die Kopfseiten blaßblau, ein ringförmiges Band, das vom Hinterkopf an über den Augen weg nach dem Oberhals verläuft, und ein schmales Stirnband, das sich zügelartig nach den Augen zu verlängert, tiefschwarz. Das Auge ist graubraun, der Schnabel und die Füße sind schwarzbraun. Die Länge beträgt achtundzwanzig, die Breite einundvierzig, die Fittichlänge vierzehn, die Schwanzlänge dreizehn Zentimeter.
Alle Naturforscher stimmen darin überein, daß der Blauhäher eine Zierde der nordamerikanischen Waldungen ist. Demungeachtet hat sich der Vogel wenige Freunde erwerben können. Er ist allerwärts bekannt und überall gemein, in den meisten Gegenden Standvogel, nur in den nördlichen Staaten Strich- oder Wandervogel. Sein Leben ist mehr oder weniger das unseres Eichelhähers. Er bevorzugt die dichten und mittelhohen Wälder, ohne jedoch die hochstämmigen zu meiden, kommt gelegentlich in die Fruchtgärten herein, schweift beständig von einem Ort zum andern, ist auf alles aufmerksam, warnt durch lautes Schreien andere Vögel und selbst Säugetiere, ahmt verschiedene Stimmen nach, raubt nach Verhältnis seiner Größe im weitesten Umfange, kurz ist in jeder Hinsicht ebenbürtiger Vertreter seines deutschen Verwandten.
Die amerikanischen Forscher geben ausführliche Nachrichten über seine Lebensweise und teilen manche ergötzliche Geschichte mit. Wilson nennt ihn den Trompeter unter den Vögeln, weil er, sobald er etwas Verdächtiges sieht, unter den sonderbarsten Bewegungen aus vollem Halse schreit und alle andern Vögel dadurch warnt. Sein Geschrei klingt, nach Gerhardt, wie »Titullihtu« und »Göckgöck«; der gewöhnliche Ruf ist ein schallendes »Käh«. Gerhardt erwähnt, daß er die Stimme des rotschwänzigen Bussard, Audubon, daß er den Schrei des Sperlingsfalken aufs täuschendste nachahmt und alle kleinen Vögel der Nachbarschaft dadurch erschreckt, daß er ferner, wenn er einen Fuchs oder ein Schupp oder ein anderes Raubtier entdeckt hat, dieses Ereignis der ganzen Vogelwelt anzeigt, jeden andern Häher der Nachbarschaft und alle Krähen herbeiruft und dadurch die Raubtiere aufs äußerste ärgert. Eulen plagt er so, daß sie so eilig als möglich ihr Heil in der Flucht suchen müssen. Dagegen ist er selbst ein sehr gefräßiger und schädlicher Raubvogel, plündert rücksichtslos alle Nester aus, die er finden kann, frißt die Eier und die Jungen auf und greift sogar verwundete Vögel von bedeutender Größe oder wehrhafte Säugetiere an. Alle Arten von kleinen Säugetieren und Vögeln, alle Kerbtiere, Sämereien und dergleichen bilden seine Nahrung. Er ist, wie Audubon sagt, verschlagen und tückisch, aber mehr herrschsüchtig als mutig, bedroht die Schwachen, fürchtet die Starken und flieht selbst vor Gleichstarken. Deshalb hassen ihn denn auch die meisten Vögel und beweisen große Angst, wenn er sich ihren Nestern nähert. Drosseln und dergleichen vertreiben ihn, wenn sie ihn gewahren; er aber benutzt ihre Abwesenheit, stiehlt sich sacht herbei und frißt die Eier oder zerfleischt die Jungen. Im Herbst erscheint er scharenweise auf Ahorn-, Eich- und ähnlichen Bäumen, um von deren Früchten zu schmausen, füllt sich dort die Kehle an und trägt auch wohl Massen der Körner oder Eicheln an bestimmten Plätzen zusammen, in der Absicht, im Winter von ihnen zu schmausen. Dabei befördert er allerdings die Besamung der Wälder; doch ist dieser Nutzen wohl kaum hoch anzuschlagen.
Je nach der Gegend brütet er ein- oder zweimal im Jahre. Sein Nest wird aus Zweigen und andern dürren Stoffen aufgebaut und innen mit zarten Wurzeln ausgelegt. Vier bis fünf Eier, die etwa dreißig Millimeter lang, zweiundzwanzig Millimeter dick und auf olivenbraunem Grunde mit dunklen Flecken bezeichnet sind, bilden das Gelege. Das Männchen hütet sich, während das Weibchen brütet, das Nest zu verraten, ist still und lautlos und macht seine Besuche so heimlich als möglich. Die Jungen werden vorzugsweise mit Kerbtieren großgefüttert.
Jung aus dem Nest genommene Blauhäher werden bald zahm, müssen jedoch abgesondert im Gebauer gehalten werden, weil sie andere Vögel blutgierig überfallen und töten. Ein Gefangener, der in einem Gesellschaftskäfig lebte, vernichtete nach und nach die sämtliche Mitbewohnerschaft desselben. Auch alte Vögel dieser Art gewöhnen sich leicht an den Verlust ihrer Freiheit.
Die größeren Falkenarten und wahrscheinlich auch mehrere Eulen Amerikas sind schlimme Feinde des Blauhähers.
*
An der nördlichen und östlichen Grenze des Verbreitungskreises unseres Eichelhähers beginnt das Wohngebiet des Unglückshähers ( Perisoreus infaustus), der die Sippe der Flechtenhäher ( Perisoreus) vertritt. Von den vorstehend beschriebenen Verwandten unterscheiden ihn vor allem der sehr schlanke, auf der Firste bis gegen die Spitze hin gerade, vor ihr sanft abwärts, längs der Dillenkante stärker gebogene, vor der Spitze schwach gezahnte Schnabel, sodann der kurzläufige Fuß, der etwas gesteigerte Schwanz und das sehr weiche, strahlige, auf dem Kopfe nicht verlängerte Gefieder. Letzteres ist auf Oberkopf und Nacken rußbraun, auf Rücken und Mantel düster bleigrau, auf Hinterrücken und Bürzel fuchsrot, auf Kinn, Kehle und Brust schwach grünlichgrau, auf Bauch und Steiß rötlich. Das Auge ist dunkelbraun, der Schnabel wie der Fuß schwarz. Die Länge beträgt einunddreißig, die Breite siebenundvierzig, die Fittich- wie die Schwanzlänge vierzehn Zentimeter.
Das Verbreitungsgebiet erstreckt sich von Finnmarken bis zur Insel Sachalin und von der nördlichen Baumgrenze bis zum sechzigsten Breitengrade, in Sibirien wohl noch etwas weiter nach Süden hinab. Von hier aus besucht er dann und wann niedere Breiten und hat sich bei dieser Gelegenheit wiederholt auch in Deutschland eingefunden. Innerhalb seines Wohngebietes ist er nicht gerade selten, kaum irgendwo aber so häufig wie der Häher. In den Waldungen zu beiden Seiten des unteren Ob kann er keine seltene Erscheinung sein, da wir ihm bei unserem flüchtigen Durchstreifen der Gegend mehrere Male begegneten. Seinen Aufenthalt scheint er besonders da zu nehmen, wo die Bäume sehr dicht und auf feuchtem Grunde stehen, auch mit langen Bartflechten behangen sind. Hier macht sich der Vogel durch seinen Ruf bald bemerklich. Paarweise oder in kleinen Gesellschaften durchzieht er den Wald, nirgends längere Zeit auf einer und derselben Stelle sich aufhaltend, durchsucht rasch die Bäume und fliegt weiter. Sein Betragen ist höchst anmutig, der Flug ungemein leicht und sanft, meist gleitend, wobei die roten Schwanz- und Flügelfedern sehr zur Geltung kommen. Weite Strecken durchmißt auch der Unglückshäher nicht, fliegt vielmehr, soviel ich habe beobachten können, immer nur von einem Baume zum andern oder höchstens über eine Lichtung hinweg dem nächsten dichten Bestande zu. Im Gezweige hüpft er mit jedesmaliger Zuhilfenahme der Flügel überaus rasch und gewandt umher, indem er entweder mit weiten Sprüngen auf und nieder klettert, oder aber förmlich rutschend längs eines Zweiges dahinläuft; geschickt hängt er sich auch, obschon meist in schiefer Richtung zur Längsachse des Baumes, nach Art eines Spechtes an die Stämme um hier etwas auszuspähen. Auf dem Boden habe ich ihn nur ein einziges Mal gesehen, als eine kleine Gesellschaft am Waldrande an dem steil abfallenden Ufer erschienen war. Aber auch hier hing er sich an die fast senkrechte Wand, arbeitete ein wenig mit dem Schnabel und flog sodann wiederum zum nächsten Baume auf. Der Lockton ist ein klangvolles »Güb, güb«; laute, kreischende Laute vernahm ich nur von Verwundeten, die jammervoll klagenden, die ihm zu seinem Namen verholfen haben, dagegen niemals.
Beide Gatten eines Paares wie auch die Glieder eines Trupps hängen treu aneinander. Das erste Männchen, das ich schoß, nachdem ich das Weibchen gefehlt, fiel flügellahm vom Baume herab und erhob, als ich es aufnehmen wollte, ein ziemlich lautes, wie »Gräe, geräe« klingendes Kreischen. Sofort eilte das Weibchen, beständig lockend, herbei, setzte sich in meiner unmittelbaren Nähe auf einen Baum, kam aber, als ich den schreienden Gefährten ergriffen hatte, bis auf zwei Meter an mich heran, lockte fortwährend und verharrte so zähe in der Nähe seines unglücklichen Genossen, daß ich diesen endlich wieder auf den Boden werfen mußte, um zurückgehend die richtige Entfernung zum Schusse nehmen zu können; andernfalls würde ich es in Fetzen zerschossen haben. Als aus der bereits erwähnten Gesellschaft einer erlegt wurde, kamen alle übrigen sofort zur Stelle, um sich über das Schicksal ihres Gefährten zu vergewissern, und verließen erst, nachdem noch ein zweiter Schuß gefallen war, den Unglücksort.
Hinsichtlich der Nahrung erweist sich unser Vogel als echter Häher, weil Allesfresser im vollsten Sinne des Wortes. Im Herbst und Winter bilden Beeren und Sämereien, namentlich solche der Arve und anderer Nadelholzbäume, wohl den Hauptteil seiner Mahlzeiten. Die von uns erlegten Unglückshäher hatten fast ausschließlich Beeren und Kerbtierreste im Magen. Später, wenn hoher Schnee die Beerengesträuche verdeckt, nimmt er zu den Nadelholzzapfen seine Zuflucht. Er klettert wie eine Meise im Gezweig umher, zerbricht die Zapfen auf einem stärkeren Aste und hämmert und klaubt den Samen heraus. Gegen den Winter hin legt er sich Vorratskämmerchen an und speichert in ihnen oft eine Menge von Körnern auf, muß aber freilich häufig genug erfahren, daß Eichhörnchen und Mäuse oder Spechte und Meisen seine Schätze plündern. Während der Brutzeit des Kleingeflügels wird er zu einem ebenso grausamen Nesträuber wie der Häher, verzehrt auch erwachsene kleine Vögel und kleine Säugetiere, die er erlangen kann, frißt von dem zum Trocknen aufgehängten Renntierfleisch oder den in Schlingen gefangenen Rauchfußhühnern, soll sogar Aas angehen.
Nordvy teilte mir mit, daß der Unglückshäher, der am Barangerfjord nicht selten ist, bereits im März zum Nestbau schreite, spätestens aber in den ersten Tagen des April brüte. Das Nest, das er mir gab, war ein großer Bau, der äußerlich aus Reisern, Gräsern, Moos und dürren Flechten bestand, innen aber eine außerordentlich dichte Lage von Haaren und vor allem von Schneehuhnfedern enthielt, die eine ebenso weiche wie warme Nestmulde bildeten. Alle Nester, die durch Wolleys Jäger gesammelt wurden, standen auf Fichten, nahe am Stamm und meist so niedrig, daß man sie vom Boden aus mit der Hand erreichen konnte. Die drei bis fünf Eier sind etwa einunddreißig Millimeter lang, einundzwanzig Millimeter dick und auf schmutzigweißem bis blaß grünlichweißem Grunde mit rötlichgrauen Schalen- und lichter oder dunkler braunen Oberflecken verschiedener Größe gezeichnet. Beide Eltern lieben ihre Brut sehr, verhalten sich am Nest ganz still, um dasselbe nicht zu verraten, und suchen bei Gefahr durch Verstellung den Feind zu täuschen und abzulenken, hüpfen oder gaukeln auf dem Boden dahin, als ob ihre Flügel gelähmt wären und sie so leicht eine Beute des Jägers werden könnten, führen diesen dann ein Stück fort, heben sich plötzlich auf und fliegen davon, um im weiten Bogen zu den Jungen zurückzukehren. Wolleys Leute fanden Mitte Mai in den meisten Nestern mehr oder weniger erwachsene Junge. Eine Brut, die sie in einen Käfig setzten, um sie von den Alten auffüttern zu lassen, wurde von diesen befreit, indem die klugen Vögel den Verschluß des Bauers öffneten.
Nach mancherlei Mühen gelang es Wolley, fünf lebende Unglückshäher zu erhalten. Sie mit Schlingen zu fangen, verursachte keinerlei, die Eingewöhnung im Käfig um so mehr Schwierigkeiten. Lebhaftere und listigere Vögel als sie kann es, wie der Genannte glaubt, nicht geben. In Stockholm erregten die Gefangenen Bewunderung. Ihre weittönenden und mannigfaltigen Stimmlaute hielten alle Buben in beständiger Aufregung. Die Knaben versuchten die Stimmlaute der Häher nachzuahmen, und diese antworteten wiederum jenen.
*
Sehr verschiedenartige Vögel werden in der Unterfamilie der Schweifkrähen ( Glaucopinae) vereinigt. Wohl die bekanntesten Glieder der Gruppe sind die Baumelstern ( Dendrocitta). Als Vertreter der Sippe mag die Wanderelster oder der Landstreicher ( Dendrocitta rufa) gelten. Ihre Länge beträgt einundvierzig, die Fittichlänge fünfzehn, die Schwanzlänge sechsundzwanzig Zentimeter. Kopf, Nacken und Brust sind schwärzlichbraun, die Unterteile rötlich oder fahlgelblich, die Flügeldeckfedern und die Außenfahnen der Schwingen zweiter Ordnung lichtgrau, fast weiß, die übrigen Schwingen schwarz, die Steuerfedern aschgrau mit schwarzen Endspitzen. Der Schnabel ist schwarz, der Fuß dunkelschieferfarben, das Auge blutrot.
Die Wanderelster ist über ganz Indien verbreitet und kommt außerdem in Assam, China und, nach Adams, auch in Kaschmir vor. Sie ist überall häufig, namentlich aber in den waldigen Ebenen ansässig. In den nördlichen Teilen Indiens sieht man sie in jeder Baumgruppe und in jedem Garten, auch in unmittelbarer Nähe der Dörfer. Sehr selten begegnet man einer einzigen, gewöhnlich einem Paar und dann und wann einer kleinen Gesellschaft. Diese fliegt langsam und in wellenförmigen Linien von Baum zu Baum und durchstreift während des Tages ein ziemlich ausgedehntes Gebiet, ohne sich eigentlich einen Teil desselben zum bestimmten Aufenthaltsort zu erwählen. Auf den Bäumen findet die Wanderelster alles, was sie bedarf; denn sie nährt sich zuweilen lange Zeit ausschließlich von Baumfrüchten, zu andern Zeiten aber von Kerbtieren, die auf Bäumen leben. Die Eingeborenen versichern, daß auch sie Vogelnester ausnehme und nach Würgerart jungen Vögeln nachstelle.
Von den Indern scheint der schmucke Vogel oft in Gefangenschaft gehalten zu werden, da auch wir ihn nicht selten lebend erhalten. Sein Betragen ist mehr das der Blauelster als das unserer deutschen Elster. Bei guter Pflege dauert er vortrefflich in der Gefangenschaft aus, wird auch bald sehr zahm.
*
Zur Familie der Raben rechnet man auch den Hopflappenvogel ( Heteralocha acutirostris), der mit verwandten Sippen eine besondere, auf Neuseeland beschränkte Gruppe bildet und mit ihnen an der Schnabelwurzel entspringende, mehr oder minder entwickelte buntfarbige Hautlappen gemein hat. Der Hopflappenvogel unterscheidet sich von allen bekannten Vögeln überhaupt dadurch, daß der Schnabel des Weibchens von dem des Männchens wesentlich abweicht. Bei letzterem ist er etwa kopflang, auf der Firste fast gerade, der Breite nach flach gerundet, an der Wurzel hoch, seitlich stark zusammengedrückt, im ganzen aber gleichmäßig nach der Spitze hin verschmächtigt; bei dem Weibchen dagegen mindestens doppelt so lang als beim Männchen, verschmächtigt und verschmälert, merklich gekrümmt und in eine feine Spitze ausgezogen, der Oberschnabel auch über den unteren verlängert. Das Gefieder ist bis auf einen breiten, weißen Endrand der Steuerfedern einfarbig schwarz, schwach grünlich scheinend, der Augenring tiefbraun, der Schnabel elfenbeinweiß, an der Wurzel schwärzlichgrau, der große winklige Mundwinkellappen orangefarbig, der Fuß dunkelblaugrau.
Auf wenige Örtlichkeiten Neuseelands beschränkt und auch hier von Jahr zu Jahr seltener werdend, bietet unser Vogel wenig Gelegenheit zu eingehenden Beobachtungen. Er lebt mehr auf dem Boden als im Gezweig, bewegt sich mit großen Sprüngen außerordentlich rasch, flieht bei dem geringsten Geräusch oder beim Anblick eines Menschen so eilig als möglich dichten Gebüschen oder Waldstrecken zu und entzieht sich hier in der Regel jeder Nachstellung. Ich vermag deshalb nur mitzuteilen, was Buller von denen berichtet, die er einige Tage lang pflegte. Bemerkenswert war die Leichtigkeit, mit der die im Freien so scheuen Vögel sich an die Gefangenschaft gewöhnen. Wenige Tage nach ihrer Erbeutung waren sie ganz zahm geworden und schienen den Verlust ihrer Freiheit nicht im geringsten zu empfinden. Schon am nächsten Morgen, nachdem sie in Besitz Bullers gekommen waren, fraßen sie begierig, tranken Wasser und begannen nunmehr, sich lebhaft und flüchtig zu bewegen, bald auch miteinander zu spielen. Ihre Bewegungen auf dem Boden wie im Gezweigs waren anmutig und fesselnd; besonders hübsch sah es aus, wenn sie ihren Schwanz fächerartig breiteten und in verschiedenen Stellungen unter leisem und zärtlichem Gezwitscher einander mit ihren Elfenbeinschnäbeln liebkosten. Mit letzterem untersuchten, behackten und bemeißelten sie alles. Sobald sie entdeckt hatten, daß die Tapeten ihres Zimmers nicht undurchdringlich waren, lösten sie einen Streifen nach dem andern ab und hatten in kürzester Frist die Mauer vollständig entblößt. Besonders anziehend aber war für Buller die Art und Weise, wie sie sich bei Erbeutung ihrer Nahrung gegenseitig unterstützten. Da man verschiedene Erdmaden, Engerlinge und ebenso Samen und Beeren in dem Magen erlegter Stücke gefunden hatte, brachte Buller einen morschen Klotz mit großen, fetten Larven eines »Huhu« genannten Kerbtieres in ihren Raum. Dieser Klotz erregte sofort ihre Aufmerksamkeit; sie untersuchten die weicheren Teile mit dem Schnabel und gingen sodann kräftig ans Werk, um das morsche Holz zu behauen, bis die in ihm verborgenen Larven oder Puppen des besagten Kerbtieres sichtbar wurden und hervorgezogen werden konnten. Das Männchen war hierbei stets in hervorragender Weise tätig, indem es nach Art der Spechte meißelte, wogegen das Weibchen mit seinem langen, geschmeidigen Schnabel alle jene Gänge, die wegen der Härte des umgebenden Holzes von dem Männchen nicht erbrochen werden konnten, untersuchte und ausnutzte. Mehrmals beobachtete Buller, daß sich das Männchen vergeblich bemühte, eine Larve aus einer bloßgelegten Stelle hervorzuziehen, dann stets durch das Weibchen abgelöst wurde und ihm den Bissen, den letzteres sich leicht aneignete, auch gutwillig abtrat. Anfänglich verzehrten beide nur Huhularven, im Laufe der Zeit gewöhnten sie sich auch an anderes Futter, und zuletzt fraßen sie gekochte Kartoffeln, gesottenen Reis und rohes, in kleine Stücke zerschnittenes Fleisch ebenso gern wie ihre frühere Nahrung. Zu ihrem Badenapfe kamen sie oft, immer aber nur, um zu trinken, nicht aber, um sich zu baden. Ihr gewöhnlicher Lockton war ein sanftes und klares Pfeifen, das zuerst langgezogen und dann kurz nacheinander wiederholt, zuweilen in höheren Tönen ausgestoßen oder sanft vertönt oder in ein leises Krächzen umgewandelt wurde, zuweilen dem Weinen kleiner Kinder bis zum Täuschen ähnelte.
*
Die letzte Unterfamilie vereinigt die Pfeifkrähen ( Phonigaminae), Verbindungsglieder der Raben- und Würgerfamilie. Neuholland ist die Heimat der Pfeifkrähen. Hier leben sie an allen geeigneten Orten, ungewöhnlich behend auf dem Boden laufend, nicht minder gewandt im Gezweige sich bewegend, aber nicht gerade leicht und sicher fliegend. Kleine Tiere verschiedener Klassen, insbesondere Schnecken, kleine Wirbeltiere, Früchte, Körner und Sämereien bilden ihre Nahrung. Sie fliegen meist in Gesellschaften zu vier bis sechs Stück, wahrscheinlich in Familien, aus den beiden Eltern und ihren Kindern bestehend. Ihre Nester werden aus Reisig aufgebaut und mit Gräsern und andern passenden Stoffen ausgefüllt; das Gelege enthält drei bis vier Eier. Die Jungen, die von beiden Eltern aufgefüttert und sehr mutig verteidigt werden, erhalten schon nach der ersten Mauser das ausgefärbte Kleid.
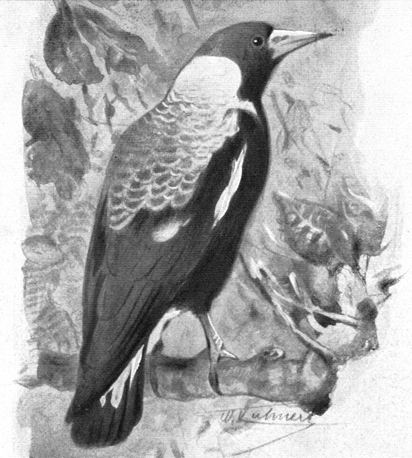
Flötenvogel ( Gymnorhina tibicen)
Der Flötenvogel ( Gymnorhina tibicen), der in den letzten Jahren ein Bewohner aller Tiergärten geworden ist, kommt einer Saatkrähe an Größe ungefähr gleich. Seine Länge beträgt dreiundvierzig, die Fittichlänge siebenundzwanzig, die Schwanzlänge vierzehn Zentimeter. Das Gefieder ist der Hauptsache nach schwarz, auf Nacken, Unterrücken, den oberen und unteren Schwanzfedern und den vorderen Flügeldeckfedern aber weiß. Das Auge ist rötlichnußbraun, der Schnabel bräunlichaschgrau, der Fuß schwarz.
Nach Gould ist der Flötenvogel besonders in Neusüdwales häufig und ein in hohem Grade augenfälliger Vogel, der die Gefilde sehr zu schmücken weiß, da, wo man ihn nicht verfolgt oder vertreibt, in die Gärten der Ansiedler hereinkommt, bei einiger Hegung sogar die Wohnungen besucht und ihm gewährten Schutz durch größte Zutraulichkeit erwidert. Sein buntes Gefieder erfreut das Auge, sein eigentümlicher Morgengesang das Ohr. Offene Gegenden, die mit Baumgruppen bewachsen sind, bilden seine bevorzugten Wohnsitze; deshalb zieht er das Innere des Landes der Küste vor. Die Nahrung besteht hauptsächlich aus Heuschrecken, von denen er eine unschätzbare Menge verzehrt. Im August beginnt und bis zum Januar währt die Brutzeit, da jedes Pärchen zweimal nistet. Das runde und offene Nest wird aus Reisholz und Blättern erbaut und mit zarteren Stoffen, wie sie eben vorkommen, ausgefüttert. Die drei bis vier Eier, die das Gelege ausmachen, konnte Gould nicht erhalten; dagegen beschreibt er die eines sehr nahen Verwandten. Sie sind aus düster bläulichweißem, zuweilen ins Rötliche spielendem Grunde mit großen braunroten oder licht kastanienbraunen Flecken zickzackartig gezeichnet.
Als Gould Australien bereiste, gehörte ein gefangener Flötenvogel noch zu den Seltenheiten; gegenwärtig erhalten wir ihn häufig lebend. Er findet viele Liebhaber und ist in Tiergärten geradezu unentbehrlich. Schon der schweigsame Vogel zeigt sich der Teilnahme wert; allgemein anziehend aber wird er, wenn er eines seiner sonderbaren Lieder beginnt. Ich habe Flötenvögel gehört, die wunderlich sangen, viele andere aber beobachtet, die nur einige fugenartig verbundene Töne hören ließen. Jeder einzelne Laut des Vortrages ist volltönend und rein; nur die Endstrophe wird gewöhnlich mehr geschnarrt als geflötet. Unsere Vögel sind, um es mit zwei Worten zu sagen, geschickt im Ausführen, aber ungeschickt im Erfinden eines Liedes, verderben oft auch den Spaß durch allerlei Grillen, die ihnen gerade in den Kopf kommen. Gelehrig im allerhöchsten Grade, nehmen sie ohne Mühe Lieder an, gleichviel, ob dieselben aus beredtem Vogelmunde ihnen vorgetragen, oder ob sie auf einer Drehorgel und anderweitigen Tonwerkzeugen ihnen vorgespielt werden. Sämtliche Flötenvögel, die ich beobachten konnte, mischen bekannte Lieder, namentlich beliebte Volksweisen, in ihren Gesang; sie scheinen dieselben während der Überfahrt den Matrosen abgelauscht zu haben. Bekannte werden regelmäßig mit einem Liede erfreut, Freunde mit einer gewissen Zärtlichkeit begrüßt. Die Freundschaft ist jedoch noch leichter verscherzt als gewonnen; denn nach meinen Erfahrungen sind diese Raben sehr heftige und jähzornige, ja rachsüchtige Geschöpfe, die sich bei der geringsten Veranlassung, oft in recht empfindlicher Weise, ihres Schnabels bedienen. Erzürnt, sträuben sie das Gefieder, breiten die Flügel und den Schwanz und fahren wie ein erboster Hahn gegen den Störenfried los. Auch mit ihresgleichen leben sie viel im Streit und Kampf, und andere Vögel fallen sie mörderisch an.
Ihre Haltung im Käfig verursacht keine Schwierigkeiten. Sie bedürfen allerdings tierischer Nahrung, nehmen aber auch gerne mit Pflanzenstoffen vorlieb. Fleisch, Brot und Früchte bilden den Hauptteil ihrer Mahlzeit. Gegen die Witterung zeigen sie sich wenig empfindlich, könnten wohl ohne Gefahr auch während des Winters im Freien gehalten werden.
Die Würger ( Laniidae) bilden eine über die ganze Erde verbreitete Familie, deren Merkmale in dem kräftigen, seitlich zusammengedrückten, deutlich gezahnten und hakig übergebogenen Schnabel, und dem ziemlich langen, abgestuften, aus zwölf Federn bestehenden Schwanze liegen. Das Gefieder ist regelmäßig reich, etwas locker und weich, die Zeichnung eine angenehme und wechselvolle, bei gewissen Arten aber sehr übereinstimmende. Nach den Untersuchungen von Nitzsch weicht der innere Bau der Würger kaum von dem anderer Singvögel ab.
Kleine Waldungen, die von Feldern und Wiesen umgeben sind, Hecken und Gebüschen in den Feldern, Gärten und einzelnstehende Bäume bilden die Aufenthaltsorte der Würger, die höchsten Zweigspitzen hier ihre gewöhnlichen Ruhe- und Sitzpunkte. Die meisten nordischen Arten sind Sommervögel, die regelmäßig wandern und ihre Reisen bis Mittelafrika ausdehnen. Lebensweise und Betragen erinnern ebenso sehr an das Treiben der Raubvögel wie an das Gebaren mancher Raben. Sie gehören ungeachtet ihrer geringen Größe zu den mutigsten, raubsüchtigsten und mordlustigsten aller Vögel. Ihr Flug ist schlecht und unregelmäßig, ihr Gang hüpfend, ihre Stimme eintönig und ihr eigentlicher Gesang kaum der Rede wert; gleichwohl überraschen und fangen sie gewandtere Vögel, als sie selbst sind, ebenso wie sie ihren Gesang wesentlich verbessern, indem sie, scheinbar mit größter Mühe und Sorgfalt, anderer Vögel Lieder oder wenigstens einzelne Strophen und Töne derselben ablauschen und das nach und nach Erlernte, in sonderbarer Weise vereinigt und verschmolzen, zum besten geben. Einzelne Arten sind, dank dieser Gewohnheit, wahrhaft beliebte Singvögel, die Freude und der Stolz einzelner Liebhaber.
Auch die Würger sind eigentlich Kerbtierfresser; die meisten Arten aber stellen ebenso dem Kleingeflügel nach und werden um so gefährlicher, als sie von diesem meist nicht gewürdigt und mit ungerechtfertigtem Vertrauen beehrt werden. Ruhig sitzen sie minutenlang unter Sing- und Sperlingsvögeln, singen wohl auch mit diesen und machen sie förmlich sicher: da plötzlich erheben sie sich, packen unversehens einen der nächstsitzenden und würgen ihn ab, als ob sie Raubvögel wären. Sonderbar ist ihre Gewohnheit, gefangene Beute auf spitzige Dornen zu spießen. Da, wo ein Pärchen dieser Vögel haust, wird man selten vergeblich nach derartig aufbewahrten Kerbtieren und selbst kleinen Vögeln oder Kerbtieren und Lurchen suchen. Von dieser Gewohnheit her rührt der Name »Neuntöter«, den das Volk gerade diesen Räubern gegeben hat.
Das Nest ist gewöhnlich ein ziemlich kunstreicher Bau, der im dichtesten Gestrüpp oder wenigstens im dichtesten Geäste angelegt und meist mit grünen Pflanzenteilen geschmückt ist. Das Gelege besteht aus vier bis sechs Eiern, die vom Weibchen allein ausgebrütet werden, während das Männchen inzwischen die Ernährung seiner Gattin übernimmt. Die ausgeschlüpften Jungen werden von beiden Eltern geatzt, ungemein geliebt und bei Gefahr auf das mutigste verteidigt, auch nach dem Ausfliegen noch längere Zeit geführt, geleitet und unterrichtet und erst spät im Herbste, ja wahrscheinlich sogar erst in der Winterherberge der elterlichen Obhut entlassen.
Die Familie ist neuerdings in Abteilungen zerfällt worden, die von uns als Unterfamilien aufgefaßt werden mögen. Unter ihnen stellen wir die Heckenwürger ( Laniinae) obenan, weil unsere europäischen Arten ihr angehören. Der würdigste Vertreter der Sippe ( Lanius) ist der Raubwürger ( Lanius excubitor). Seine Länge beträgt sechsundzwanzig, die Breite sechsunddreißig, die Fittichlänge zehn, die Schwanzlänge zwölf Zentimeter. Das Gefieder ist auf der Oberseite, bis auf einen langen, weißen Schulterfleck, gleichmäßig hellaschgrau, auf der Unterseite reinweiß; ein breiter schwarzer, weiß umrandeter Zügelstreif verläuft durch das Auge. Im Flügel sind die großen Handschwingen von der Wurzel bis zur Hälfte, die Armschwingen an der Wurzel, die Oberarmschwingen an der Spitze und inneren Fahne weiß, im übrigen aber wie die Deckfedern der Schwingen schwarz. Im Schwanze sind die beiden mittleren Federn schwarz; bei den übrigen tritt diese Färbung mehr und mehr zurück, und reines Weiß wird dafür vorherrschend. Das Auge ist braun, der Schnabel schwarz, der Fuß bleigrau. Das Weibchen unterscheidet sich durch unreinere Farben, der junge Vogel durch eine schwach wellenförmige Zeichnung, die zumal auf der Brust hervortritt.
Unser Raubwürger lebt, vielleicht mit Ausnahme des äußersten Südens, in allen Ländern Europas und in einem großen Teil Asiens als Stand- oder Strichvogel, in Nordafrika und Südasien als Zugvogel. In den Monaten September bis November und Februar bis April sieht man ihn am häufigsten, weil er dann streicht. Im Winter kommt er gern bis in die Nähe der Ortschaften; im Sommer hält er sich paarweise an Waldrändern oder auf einzeln stehenden Bäumen des freien Feldes auf. Feldhölzer oder Waldränder, die an Wiesen oder Viehweiden grenzen, sind seine Lieblingsplätze; hier pflegt er auch sein Nest anzulegen. Er ist, wie es scheint, im Gebirge ebenso häufig wie in der Ebene und fehlt nur den Hochalpen oder sumpfigen Gegenden. Wer ihn einmal kennengelernt hat, wird ihn mit keinem seiner deutschen Verwandten verwechseln! denn er zeichnet sich vor allen ebenso durch sein Wesen wie durch seine Größe aus. Gewöhnlich sieht man ihn auf der höchsten Spitze eines Baumes oder Strauches, die weite Umschau gestattet, bald aufgerichtet mit gerade herabhängendem Schwänze, bald mit wagerecht getragenem Körper ziemlich regungslos sitzen. Sein Blick schweift rastlos umher, und seiner Aufmerksamkeit entgeht ein vorüberfliegender Raubvogel ebensowenig wie ein am Boden sich bewegendes Kerbtier, Vögelchen oder Mäuschen. Jeder größere Vogel und namentlich jeder falkenartige wird mit Geschrei begrüßt, mutig angegriffen und neckend verfolgt. Nicht mit Unrecht trägt er den Namen des Wächters; denn sein Warnungsruf zeigt allen übrigen Vögeln die nahe Gefahr an. Erblickt er ein kleines Geschöpf, so stürzt er sich von oben herunter und versucht es aufzunehmen, rennt auch wohl einem dahinlaufenden Mäuschen eine Strecke weit auf dem Boden nach. Nicht selten sieht man ihn rüttelnd längere Zeit auf einer und derselben Stelle verweilen und dann wie ein Falk zum Boden stürzen, um erspähte Beute aufzunehmen. Im Winter sitzt er oft mitten unter den Sperlingen, sonnt sich mit ihnen, ersieht sich einen von ihnen zum Mahle, fällt plötzlich mit jäher Schwenkung über ihn her, packt ihn von der Seite und tötet ihn durch Schnabelhiebe und Würgen mit den Klauen, schleppt das Opfer, indem er es bald mit dem Schnabel, bald mit den Füßen trägt, einem sicheren Orte zu und spießt es hier, wenn der Hunger nicht allzu groß ist, zunächst auf Dornen oder spitze Äste, auch wohl auf das Ende eines dünnen Stockes. Hierauf zerfleischt er es nach und nach vollständig, reißt sich mundrechte Bissen ab und verschlingt diese, einen nach dem andern. Seine Kühnheit ist ebenso groß wie seine Dreistigkeit. Vom Hunger gequält, ergreift er, so vorsichtig er sonst zu sein pflegt, angesichts des Menschen seine Beute und setzt dabei zuweilen seine Sicherheit so rücksichtslos auf das Spiel, daß er mit der Hand gefangen werden kann. Mein Vater sah ihn eine Amsel angreifen, Naumann beobachtete, daß er die Krammetsvögel verfolgte, ja sogar, daß er die in Schneehauben gefangenen Rebhühner überfiel. Junge Vögel, die eben ausgeflogen sind, haben viel von ihm zu leiden. Besäße er ebensoviel Gewandtheit wie Mut und Kühnheit, er würde der furchtbarste Räuber sein. Zum Glück für das kleine, schwache Geflügel mißlingt ihm sein beabsichtigter Fang sehr häufig; immerhin aber bleibt er in seinem Gebiete ein höchst gefährlicher Gegner aller schwächeren Mitglieder seiner Klasse.
Der Flug des Raubwürgers ist nicht besonders gewandt. »Wenn er von einem Baume zum andern fliegt«, sagt mein Vater, »stürzt er sich schief herab, flattert gewöhnlich nur wenige Meter über dem Boden dahin und schwingt sich dann wieder auf die Spitze eines Baumes oder Busches empor. Sein Flug zeichnet sich sehr vor dem anderer Vögel aus. Er bildet bemerkbare Wellenlinien, wird durch schnellen Flügelschlag und weites Ausbreiten der Schwungfedern beschleunigt und ist ziemlich rasch, geht aber nur kleine Strecken in einem fort. Weiter als einen halben Kilometer fliegt er selten, und weiter als einen ganzen nie. Eine solche Strecke legt er auch nur dann in einem Zuge zurück, wenn er von einem Berge zum andern fliegt und also unterwegs keinen bequemen Ruhepunkt findet.« Die Sinne sind scharf. Namentlich das Gesicht scheint in hohem Grade ausgebildet zu sein; aber auch das Gehör ist vortrefflich; jedes leise Geräusch erregt die Aufmerksamkeit des wachsamen Vogels. Mit seinesgleichen lebt er ebensowenig in Frieden als mit andern Geschöpfen. Nur solange die Brutzeit währt, herrscht Einigkeit unter den Gatten eines Paares und später innerhalb des Familienkreises; im Winter lebt der Würger für sich und fängt mit jedem andern, den er zu sehen bekommt, Streit an. Das gewöhnliche Geschrei, Erregung jeder Art, freudige wie unangenehme, bezeichnend, ist ein oft wiederholtes »Gäh, gäh, gäh, gäh«. Außerdem vernimmt man ein sanftes »Truü, truü« als Lockton, an schönen Wintertagen, namentlich gegen den Frühling hin aber einen förmlichen Gesang, der aus mehreren Tönen besteht, bei verschiedenen Vögeln verschieden und oft höchst sonderbar, weil er, wie es scheint, nichts anderes ist, als eine Wiedergabe einzelner Stimmen und Töne der in einem gewissen Gebiete wohnenden kleineren Singvögel. Dieser zusammengesetzte Gesang wird nicht bloß vom Männchen, sondern auch vom Weibchen vorgetragen. Zuweilen vernimmt man eine hell quiekende Stimme, wie sie von kleinen Vögeln zu hören ist, wenn sie in großer Gefahr sind. Der Würger sitzt dabei ganz ruhig, und es scheint fast, als wollte er durch sein Klagegeschrei neugierige Vögel herbeirufen, möglicherweise, um sich aus ihrer Schar Beute zu gewinnen.
Im April schreitet das Paar zur Fortpflanzung. Es erwählt sich in Vor- oder Feldhölzern, in einem Garten oder Gebüsch einen geeigneten Baum, am liebsten einen Weißdornbusch oder einen wilden Obstbaum, und trägt sich hier trockene Halmstengel, Reiserchen, Erd- und Baummoos zu einem ziemlich kunstreichen, verhältnismäßig großen Nest zusammen, dessen halbkugelige Mulde mit Stroh und Grashalmen, Wolle und Haaren dicht ausgefüttert ist. Das Gelege besteht aus vier bis sieben achtundzwanzig Millimeter langen, zwanzig Millimeter dicken, auf grünlichgrauem Grunde ölbraun und aschgrau gefleckten Eiern, die fünfzehn Tage lang bebrütet werden. Anfang Mai schlüpfen die Jungen aus, und beide Eltern schleppen ihnen nun Käfer, Heuschrecken und andere Kerbtiere, später kleine Vögel und Mäuse in Menge herbei, verteidigen sie mit Gefahr ihres Lebens, legen, wenn sie bedroht werden, alle Furcht ab, füttern sie auch nach dem Ausfliegen noch lange Zeit und leiten sie noch im Spätherbst. Mein Vater hat beobachtet, wie vorsichtig und klug sich alte Würger benehmen, wenn sie ihre noch unerfahrenen Jungen bedroht sehen. »In einem Laubholze«, erzählt er, »verfolgte ich eine Familie dieser Vögel, um einige zu schießen. Dies glückte aber durchaus nicht; denn die Alten warnten die Jungen durch heftiges Geschrei jedesmal, wenn ich mich ihnen näherte. Endlich gelang es mir, mich an ein Junges anzuschleichen; als ich aber das Gewehr anlegte, schrie das Weibchen laut auf, und weil das Junge nicht folgte, stieß es dasselbe, noch ehe ich schießen konnte, im Fluge mit Gewalt vom Ast herab.« Dieselbe Beobachtung ist viele Jahre später noch einmal von meinem Vater, inzwischen aber auch von andern Forschern gemacht worden.
Habicht und Sperber, grausam wie der Würger selbst, sind die schlimmsten Feinde unseres Vogels. Er kennt sie wohl und nimmt sich möglichst vor ihnen in acht, kann es aber doch nicht immer unterlassen, seinen Mutwillen an ihnen auszuüben, und wird bei dieser Gelegenheit die Beute der stärkeren Räuber. Außerdem plagen ihn Schmarotzer verschiedener Art. Der Mensch bemächtigt sich seiner mit Leichtigkeit nur vor der Krähenhütte und auf dem Vogelherde. Da, wo es auf weithin keine Bäume gibt, kann man ihn leicht fangen, wenn man auf eine mittelhohe Stange einen mit Leimruten bespickten Busch pflanzt, und ebenso bekommt man ihn in seine Gewalt, wenn man seine beliebtesten Sitzplätze erkundet und hier Leimruten geschickt anbringt.
In der Gefangenschaft wird der Raubwürger bald zahm, lernt seinen Gebieter genau kennen, begrüßt ihn mit freudigem Rufe, trägt seine drolligen Lieder mit ziemlicher Ausdauer vor, dauert aber nicht so gut aus wie seine Verwandten. Früher soll er zur Beize abgerichtet worden sein; häufiger aber noch wurde er beim Fange der Falken gebraucht.
Alle ebenen Gegenden unseres Vaterlandes, in denen der Laubwald vorherrscht, beherbergen den Grauwürger ( Lanius minor), eine der schönsten Arten der Familie. Das Gefieder ist auf der Oberseite hell aschgrau, auf der Unterseite weiß, an der Brust wie mit Rosenrot überhaucht; Stirn und Zügel sowie der Flügel, bis auf einen weißen Fleck, der sich über die Wurzelhälfte der neun ersten Handschwingen verbreitet, und einen schmalen, weißen Endsaum der Armschwingen, schwarz; die vier mittelsten Steuerfedern haben dieselbe Färbung, die darauf folgenden sind fast zur Hälfte weiß, die übrigen zeigen nur noch neben dem dunklen Schafte einen schwarzen Fleck auf der inneren Fahne, die äußersten sind reinweiß. Das Auge ist braun, der Schnabel schwarz, der Fuß graulich. Die Jungen sind an der Stirn schmutzigweiß, auf der Unterseite gelblichweiß, grau in die Quere gestreift. Die Länge beträgt dreiundzwanzig, die Breite sechsunddreißig, die Fittichlänge zwölf, die Schwanzlänge neun Zentimeter.
Unter den im Frühling zurückkehrenden Sommervögeln ist der Grauwürger einer der letzten. Er erscheint erst Anfang Mai, und ebenso tritt er mit am frühesten, gewöhnlich schon im Spätsommer, Ende August, seine Reise wieder an. Bereits im September begegnet man ihm in den Waldungen der oberen Nilländer und ebenso wahrscheinlich in ganz Mittelafrika; denn hier erst verbringt er den Winter. So häufig er in gewissen Gegenden ist, so selten zeigt er sich in andern. In Anhalt, Brandenburg, Franken, Bayern, Südfrankreich, Italien, Ungarn und der Türkei, im südlichen Rußland ist er gemein; die übrigen Länder Europas berührt er entweder gar nicht oder nur auf dem Zug; den Norden Europas meidet er gänzlich. Zu seinem Aufenthalt wählt er mit Vorliebe Baumpflanzungen an Straßen und Obstgärten, ebenso kleine Feldgehölze, Hecken und zusammenhängende Gebüsche, fehlt aber oft in Gegenden, die anscheinend allen Lebensbedingungen entsprechen, gänzlich, verschwindet wohl auch allmählich aus solchen, die ihn vormals in Menge beherbergten, ohne daß man stichhaltige Gründe dafür aufzufinden wüßte.
Alle Beobachter stimmen mit mir darin überein, daß der Grauwürger zu den anmutigsten und harmlosesten Arten seiner Familie gehört. Er belebt das von ihm bewohnte Gebiet in höchst ansprechender Weise; denn er ist beweglicher, munterer und unruhiger als jeder andere Würger, hieran und an seiner schlanken Gestalt sowie den spitzigeren Schwingen auch im Sitzen wie im Fliegen leicht vom Raubwürger zu unterscheiden. Vorteilhaft zeichnet ihn vor diesem ferner seine geringe Raubsucht aus. Naumann versichert, daß er ihn niemals als Vogelräuber, sondern immer nur als Kerbtierjäger kennengelernt habe. Schmetterlinge, Käfer, Heuschrecken, deren Larven und Puppen bilden seine Beute. Lauernd sitzt er auf der Spitze eines Baumes, Busches, auf einzelnen Stangen, Steinen und andern erhabenen Gegenständen; rüttelnd erhält er sich in der Luft, wenn ihm derartige Warten fehlen, stürzt sich, sobald er eine Beute gewahrt, plötzlich auf den Boden herab, ergreift das Kerbtier, tötet es und fliegt mit ihm auf die nächste Baumspitze zurück, um es daselbst zu verzehren. Dies geschieht gewöhnlich ohne alle Vorbereitung; denn seltener als seine Verwandten spießt er die gefangenen Tiere vor dem Zerstückeln auf Dornen und Astspitzen. »Durch Färbung und Gestalt«, sagt Naumann, »ist der schwarzstirnige Würger gleich schön im Sitzen wie im Flug, und da er immer herumflattert und seine Stimme hören läßt, so macht er sich auch sehr bemerklich und trägt zu den lebendigen Reizen einer Gegend nicht wenig bei. Sein Flug ist leicht und sanft, und er schwimmt öfters eine Strecke ohne Bewegung der Flügel durch die Luft dahin wie ein Raubvogel. Hat er aber weit zu fliegen, so setzt er öfters ab und beschreibt so viele, sehr flache Bogenlinien. Seine gewöhnliche Stimme klingt ›Kjäck, kjäck‹ oder ›Schäck‹, seine Lockstimme ›Kwiä-kwi-ell-kwiell‹ und ›Perletsch-hrolletsch‹, auch ›Scharreck, scharreck‹. Strophen aus dem Gesang der Feldlerchen hört man oft von ihm; auch ahmt er den Wachtelschlag leise, aber ziemlich täuschend nach. Die fremden Töne ahmt er sogleich, wie er sie hört, nach und ist ein sehr fleißiger Sänger. Daß er den Gesang der Nachtigall auch nachsinge, habe ich noch nicht gehört, obgleich in meinem eigenen Wäldchen Nachtigallen und graue Würger in Menge nebeneinander wohnen.«
Das Nest legt der schwarzstirnige Würger gewöhnlich in ziemlicher Höhe in dichtem Gezweige seiner Lieblingsbäume an. Es ist groß, wie alle Würgernester aus trockenen Wurzeln, Quecken, Reisern, Heu und Stroh aufgebaut und inwendig mit Wolle, Haaren und Federn weich ausgefüttert. Ende Mai findet man in ihm sechs bis sieben, vierundzwanzig Millimeter lange, achtzehn Millimeter dicke, auf grünlichweißem Grund mit bräunlichen und violettgrauen Flecken und Punkten gezeichnete Eier, die von beiden Gatten wechselweise innerhalb fünfzehn Tagen ausgebrütet werden. Die Jungen erhalten nur Kerbtiere zur Nahrung. »Wenn sich eine Krähe, Elster oder ein Raubvogel ihrem Nest oder auch nur einem gewissen Bezirk um dasselbe nähert«, sagt Naumann, »so verfolgen ihn beide Gatten beherzt, zwicken und schreien auf ihn los, bis er sich entfernt hat. Nähert sich ein Mensch dem Nest, so schlagen sie mit dem Schwanz beständig auf und nieder und schreien dazu ängstlich ›Kjäck, kjäck, kjäck‹, und nicht selten fliegen dem, der die Jungen aus dem Nest nehmen will, die Alten, besonders die Weibchen, keine Gefahr scheuend, ins Gesicht. Die Jungen wachsen zwar schnell heran, werden aber, nachdem sie bereits ausgeflogen, lange noch von den Eltern gefüttert. Sie sitzen oft alle auf einem Zweig dicht nebeneinander und empfangen ihr Futter unter vielem Schreien; durch ihr klägliches ›Giäh, giäck, gäkgäckgäck‹ verraten sie ihren Aufenthalt sehr bald. In jedem Gehecke ist eins der Jungen besonders klein und schwächlich. Da sie sehr viel fressen, so haben die Alten mit dem Fangen und Herbeischleppen der Nahrungsmittel ihre volle Arbeit und sind dann außerordentlich geschäftig. Bei trüber oder regnerischer Witterung, wenn sich wenige Kerfe sehen lassen, fangen sie dann auch manchmal junge Vögel und füttern die Jungen damit.«

Rotrückiger Würger oder Neuntöter ( Lanius collurio)
Habicht und Sperber stellen den alten schwarzstirnigen Würgern nach, Raben, Krähen und Elstern zerstören, trotz des Mutes, den die Alten an den Tag legen, die Brut. Der Mensch, der diesen Würger kennengelernt hat, verfolgt ihn nicht oder fängt ihn höchstens für das Gebauer, und zwar in derselben Weise, wie ich schon weiter oben mitgeteilt habe. Die gefangenen Grauwürger erfreuen durch ihre Schönheit und Nachahmungsgabe.
Der bekannteste unter unsern deutschen Würgern ist der Dorndreher oder Neuntöter ( Lanius collurio). Kopf, Hinterhals, Bürzel und Schwanzdecken sind hell aschgrau, die übrigen Oberteile schön braunrot, ein schmaler Stirnrand und ein oben und unten weiß begrenzter Zügelstreifen schwarz, Backen, Kinn, Kehle und die unteren Schwanzdecken weiß, die übrigen Unterteile blaß rosenrot, die Hand- und Armschwingen bräunlich grauschwarz, schmal hellbraun gekantet, die Oberarmschwingen fast ganz rostbraun; an der Wurzel jeder Armschwinge steht ein kleines, lichtes Fleckchen, das, wenn der Flügel ausgebreitet ist, eine sichtbare Binde bildet; die Mittelfedern des Schwanzes sind braunschwarz, die folgenden an der Wurzel, die äußersten bis zu Dreiviertel weiß und nur an der Spitze schwarz. Das Auge ist braun, der Schnabel schwarz, der Fuß braunschwarz. Das Weibchen ist oben rostgrau, auf der Unterseite auf weißlichem Grund braun gewellt. Die Jungen ähneln ihm, zeigen aber auch auf der Oberseite lichte Fleckenzeichnung. Die Länge beträgt achtzehn, die Breite achtundzwanzig, die Fittichlänge neun, die Schwanzlänge sieben Zentimeter.
Unter allen deutschen Würgern ist der Dorndreher der verbreitetste. Er bewohnt fast ganz Europa von Finnland und Rußland an bis Südfrankreich und Griechenland und ebenso das gemäßigte Sibirien. In Spanien gehört er zu den Seltenheiten; doch soll er hier in den nordwestlichen Provinzen als Brutvogel gefunden werden; in Griechenland brütet er nur in den höheren Gebirgen. Gelegentlich seiner Winterreise durchstreift er ganz Afrika, ist während unserer Wintermonate in allen Waldungen des Inneren wie der Küstenländer Südafrikas und selbst der dem Festland benachbarten Inseln eine sehr häufige Erscheinung, wartet dort bei sehr reichlichem Futter seine Mauser ab, die in die Monate Dezember und Januar fällt, und kehrt sodann allmählich heimwärts. Bei uns zulande erscheint er selten vor Anfang Mai und verweilt in der Regel nur bis Mitte August.
Gebüsche aller Art, die an Wiesen und Weideplätze grenzen, Gärten und Baumpflanzungen sind seine Aufenthaltsorte. Dichte Hecken scheinen ihm unumgänglich notwendiges Erfordernis zum Wohlbefinden zu sein. Rottet man solche Hecken aus, so verläßt dieser Würger, selbst wenn er früher häufig war, die Gegend. Aber er ist genügsam; denn schon ein einziger dichter Busch im Feld befriedigt ihn vollständig. Er baut dann viele Jahre nacheinander sein Nest immer an eine und dieselbe Stelle und behauptet den einmal gewählten Wohnplatz mit Hartnäckigkeit gegen jeden andern Vogel, namentlich gegen ein zweites Paar seiner Art. Da er nun außerdem den Verhältnissen sich anbequemt, nötigenfalls in die Obstgärten der Ortschaften wie in das Innere des Waldes übersiedelt, nimmt er von Jahr zu Jahr an Menge zu und zählt schon jetzt, sehr zu Ungunsten der kleinen Sänger, zu den gemeinsten Vögeln vieler Gegenden unseres Vaterlandes.
Auch der Dorndreher ist ein dreister, mutiger, munterer, unruhiger Vogel. Selbst wenn er sitzt, dreht er den Kopf beständig nach allen Seiten und wippt dabei mit dem Schwanz auf und nieder. Die höchsten Spitzen der Büsche und Bäume bilden für ihn Warten, von denen aus er sein Jagdgebiet überschaut, und zu denen er nach jedem Ausflug zurückkehrt. Aufgejagt stürzt er sich von der Höhe bis gegen den Boden herab, streicht tief über denselben dahin und schwingt sich erst dann wieder empor, wenn er von neuem sich setzen will. Auch er fliegt ungern weit in einem Zug, ruht vielmehr auf jedem geeigneten Sitzplatz ein wenig aus und setzt erst hierauf seinen Weg fort. Die Lockstimme ist ein ziemlich deutlich hervorgestoßenes »Gäck gäck gäck« oder ein schwer zu beschreibendes »Seh« oder »Grä«. Beide Laute werden verschieden betont und drücken bald freudige, bald ängstliche Gefühle aus. Ähnliche Töne dienen zur Warnung der unerfahrenen Jungen. Von einzelnen Männchen vernimmt man kaum andere Laute, während andere zu den ausgezeichnetsten Sängern zählen. Auch der Dorndreher besitzt eine wahrhaft überraschende Fähigkeit, anderer Vögel Stimmen nachzuahmen. »Ich habe einmal«, sagt mein Vater, »diesen Vogel wundervoll singen hören. Ein Männchen, das kein Weibchen bei sich hatte, saß auf der Spitze eines Busches und sang lange Zeit ziemlich laut und äußerst angenehm. Es trug Strophen von der Feld- und Baumlerche, von der Grasmücke und andern Sängern vor. Die Töne der drei erstgenannten Arten kehrten oft wieder und waren so voll und untereinander gemischt, daß sie äußerst lieblich klangen.« Je älter ein Männchen wird, um so mehr steigert sich seine Begabung.
Leider macht sich dieser so muntere und singfähige Vogel in anderer Hinsicht im höchsten Grad unbeliebt. Er ist einer der abscheulichsten Feinde der kleinen Singvögel. Kerbtiere bilden allerdings seine Hauptnahrung, und namentlich Käfer, Heuschrecken, Schmetterlinge, auch wohl Raupen werden eifrig von ihm verfolgt und selbst dann noch getötet, wenn er bereits gesättigt ist; er stellt jedoch auch kleinen Wirbeltieren nach, die er irgendwie bezwingen kann, fängt Mäuse, Vögel, Eidechsen und Frösche, haust namentlich unter der gefiederten Sängerschaft unserer Gärten und Gebüsche in verderblichster Weise. Da, wo ein Dorndreherpaar sich ansässig gemacht hat, verschwinden nach und nach alle kleinen Grasmücken, Laub- und Gartensänger, ja sogar die Höhlenbrüter. Sie verlassen infolge der ewigen Bedrohung die Gegend oder werden von dem Dorndreher ergriffen und aufgefressen. Die Nester weiß er sehr geschickt auszuspüren, und hat er eins gefunden, so holt er sich gewiß ein Junges nach dem andern weg. Naumann hat beobachtet, daß er junge Dorngrasmücken, gelbe Bachstelzen, Krautvögelchen und Spießlerchen erwürgte und fortschleppte, daß er die in Sprenkeln gefangenen Vögel anging, daß er Finken aus den Bauern herauszuziehen versuchte. Andere Beobachter erfuhren dasselbe.
Mehr noch als andere Arten seiner Familie hat der Dorndreher die Gewohnheit, alle gefangene Beute vor dem Verzehren erst auf einen Dorn oder sonstigen spitzigen Zweig zu spießen. »Er sammelt«, sagt Naumann, »sogar hier, wenn er gerade gesättigt ist, ganze Mahlzeiten und verzehrt diese Vorräte, sobald ihn der Hunger wieder angreift, mit einem Male. So findet man bei schönem Wetter fast nur Käfer, Kerbtiere und kleine Frösche, bei kalter, stürmischer Witterung hingegen oft ganze Gehecke junger Vögel an die Dornen gespießt, und ich habe manchmal darunter sogar schon flügge ausgeflogene Grasmücken und Schwalben gefunden. Das Gehirn der Vögel scheint einer seiner Leckerbissen zu sein; denn den meisten Vögeln, die ich aufgespießt fand, hatte er zuerst nur das Gehirn aus den Schädeln geholt. Stört man ihn bei seiner Mahlzeit, so läßt er alles stecken und verdorren. Die kleinen Frösche, die man sehr oft darunter findet, sind auf eine sonderbare Weise allemal ins Maul gespießt.«
Ungestört brütet das Dorndreherpaar nur einmal im Jahr. Das Nest steht immer in einem dichten Busch, am liebsten in Dornsträuchen, und zwar niedrig über dem Boden. Es ist groß, dicht, dick und gut gebaut, äußerlich aus starken Grasstöcken und Grashalmen, Quecken, Moos und dergleichen zusammengesetzt, nach innen zu mit feineren Stoffen derselben Art, die sorgfältig zusammengelegt und durcheinandergeflochten werden, ausgebaut und in der Mulde mit zarten Grashalmen und feinen Wurzeln ausgefüttert. Das Gelege enthält fünf bis sechs Eier von verschiedener Größe und Färbung. Sie sind entweder länglich oder etwas bauchig oder selbst rundlich, durchschnittlich einundzwanzig Millimeter lang, fünfzehn Millimeter dick und auf gelblichem, grünlich graugelbem, blaßgelbem und fleischrotgelbem Grund spärlicher oder dichter mit aschgrauen, ölbraunen, blutroten und rotbraunen Flecken gezeichnet. Das Weibchen brütet allein und sitzt so fest auf den Eiern, daß man ihm Leimruten auf den Rücken legen und es so fangen kann. Die Jungen werden von beiden Alten großgefüttert, außerordentlich geliebt und mutig verteidigt.
In der Gefangenschaft hält der Dorndreher nur bei guter Pflege mehrere Jahre aus. Mit andern Vögeln verträgt sich dieser Mörder ebensowenig wie irgendein anderes Mitglied seiner Familie, überfällt im Gesellschaftsbauer selbst Vögel, die noch einmal so groß sind als er, quält nach und nach Drosseln und Stare zu Tode, obgleich diese sich nach besten Kräften zu wehren versuchen. Naumanns Vater hielt zuweilen mehrere Dorndreher in einem kleinen Gartenhäuschen, in dem er einen kleinen Galgen, das heißt ein mit spitzigen Nadeln und Nägeln bespicktes Querholz angebracht hatte. Sperlinge und andere kleine Vögel, die der Genannte den Würgern zugesellte, wurden von diesen sehr bald gefangen, dann immer auf die Nägel gesteckt und entfleischt. Schließlich hing der ganze Galgen voller Gerippe.
Die vierte Würgerart, die in Deutschland vorkommt, ist der Rotkopfwürger, Rotkopf oder Waldkatze ( Lanius senator). Seine Länge beträgt neunzehn, die Breite neunundzwanzig, die Fittichlänge neun, die Schwanzlänge acht Zentimeter. Stirn und Vorderkopf, ein breiter Zügelstreifen, der sich als Seitenhalsstreifen fortsetzt, Mantel, Flügel und Schwanz sind schwarz, Oberkopf und Nacken rostrotbraun, ein Fleck an der Stirnseite, ein kleiner hinter dem Auge, die Schultern, der Bürzel und die oberen Schwanzdecken, alle Unterteile, die Handschwingen an der Wurzel, die Armschwingen und Handdecken am Ende, die äußern vier Schwanzfederpaare im Wurzeldrittel und am Ende weiß. Beim Weibchen sind Kopf und Hinterhals matter rostbraun, Unterrücken und Bürzel grau, die Unterteile gelblich, schwach dunkler quer gewellt. Der junge Vogel zeigt auf braungrauem Grunde schwärzliche Mondfleckchen: die Flügel und der Schwanz sind braun. Das Auge ist dunkelbraun, der Schnabel blauschwarz, der Fuß dunkelgrau.
In Deutschland kommt der Rotkopf in einigen Gegenden, so in Thüringen, dem Rheintale, der Mark, in Mecklenburg, Holstein einzeln, in Südwestdeutschland häufiger vor, fehlt dagegen in andern Ländern und Provinzen gänzlich. Nach Osten hin erstreckt sich sein Verbreitungsgebiet kaum über Deutschland hinaus, und auch im Südosten des österreichisch-ungarischen Kaiserstaates ist er selten, in Südeuropa, namentlich in Spanien und Griechenland, ebenso in Kleinasien, Syrien und Palästina dagegen der gemeinste aller Würger. Hinsichtlich seines Aufenthalts scheint er weniger wählerisch zu sein als andere Arten der Familie, siedelt sich daher allerorten an, mitten im Walde ebensowohl als unmittelbar hinter den Häusern eines Dorfes, in Gärten usw. Er kommt bei uns kaum vor Mitte Mai an und verläßt uns in der ersten Hälfte des September wieder; in Spanien wie in Griechenland trifft er fast einen Monat früher ein, verweilt auch einige Tage länger. Seine Winterreise dehnt er bis in die großen Waldungen Mittelafrikas aus; hier ist er während und kurz nach der Regenzeit außerordentlich häufig.
In seinem Betragen und Wesen hat er die größte Ähnlichkeit mit dem Dorndreher, scheint aber minder räuberisch zu sein, obgleich er ebensowenig als jener kleine Wirbeltiere verschmäht oder unbehelligt läßt. Kerbtiere bilden seine Hauptnahrung, Wirbeltiere verschont er jedoch, wenn sich ihm eine passende Gelegenheit zum Fange bietet, keineswegs, und Nester plündert er nicht minder grausam wie sein Verwandter. Auch er zählt zu den Spottvögeln, der die Stimmen der um ihn wohnenden Vögel auf das täuschendste nachahmt, in der sonderbarsten Weise vermischt und so ein Tonstück zusammendichtet, das einzelne Liebhaber entzückt. Deshalb wird auch er ziemlich häufig im Käfig gehalten und je nach seiner größeren oder geringeren Nachahmungsgabe mehr oder minder geschätzt.
Das Nest steht auf mittelhohen Bäumen, ist äußerlich aus dürren Stengeln und grünen Pflanzenteilen, zarten Wurzeln, Baummoosen und Flechten zusammengebaut, inwendig mit einzelnen Federn, Borsten, Wolle und andern Tierhaaren ausgefüttert und enthält im Mai fünf bis sechs etwa dreiundzwanzig Millimeter lange, siebzehn Millimeter dicke Eier, die auf grünlichweißem Grunde mit aschgrauen oder bräunlichen, am stumpfen Ende auch wohl ölbraunen Punkten und Flecken gezeichnet sind.
*
Die Schwalben ( Hirundinidae) sind klein, zierlich gestaltet, breitbrüstig, kurzhalsig und plattköpfig. Der Schnabel ist kurz, platt, an der Wurzel viel breiter als an der Spitze, daher fast dreieckig, mit der Spitze des Oberschnabels etwas übergekrümmt, die Rachenöffnung bis gegen die Augen hin gespalten, der Fuß kurz, schwach und mit kleinen Nägeln ausgerüstet, der Flügel lang, schmal und zugespitzt, der Hand- wie der Armteil trägt je neun Schwungfedern, unter denen die erste alle übrigen überragt, nicht aber gänzlich fehlt; der Schwanz ist stets, oft sehr tief gegabelt, das Gefieder kurz, knapp anliegend und oberseits meist metallisch glänzend. Beide Geschlechter sind hinsichtlich der Färbung wenig verschieden; die Jungen hingegen tragen kurze Zeit ein von dem ihrer Eltern abweichendes Kleid. Die Schwalben verbreiten sich über alle Erdteile und über alle Höhen- und Breitengürtel, obschon sie jenseits des Polarkreises nur vereinzelt und kaum als Brutvögel leben. Viele von ihnen nehmen im Hause des Menschen Herberge, andere siedeln sich an Felsen- oder in steilen Erdwänden an, einige wählen Bäume zur Anlage ihres Nestes. Sämtliche Arten, die in Ländern brüten, in denen der Winter vom Sommer erheblich sich unterscheidet, sind Zugvögel, wogegen diejenigen, die in Ländern hausen, deren Jahreszeiten mehr oder weniger sich gleichen, höchstens innerhalb gewisser Grenzen hin- und herstreichen. Unsere deutschen Schwalben ziehen bis in das Innere, selbst bis in die südlichsten Länder Afrikas, und ich selbst habe sie während meines fünfjährigen Aufenthalts in diesem Erdteile mit größter Regelmäßigkeit nach Süden hinab und wieder nach Norden zurückwandern sehen.
Man nennt mit Recht die Schwalben edle Tiere. Der Flug ist ihre eigentliche Bewegung, ihr Gang auf dem Boden höchst ungeschickt, jedoch immerhin weit besser noch als das unbeschreiblich täppische Kriechen der anscheinend so nah verwandten Segler. Um auszuruhen, bäumen sie gern und wählen dazu schwache, wenig belaubte Äste und Zweige, die ihnen unbehindertes Zu- und Abfliegen gestatten. Alle wirklichen Schwalben zählen zu den Singvögeln. Ihr Gesang ist ein liebenswürdiges Geschwätz, das jedermann erfreut und zumal den Landbewohner so anmutet, daß er dem Liede der in seinem Hause nistenden Art Worte untergelegt hat. Wie der Landmann, so denken und empfinden alle übrigen Menschen, die das Lied und den Vogel selbst kennenlernten. Denn nicht der Klang aus dem Schwalbenmunde allein, auch das Wesen und Betragen der Schwalben haben ihnen die Zuneigung des Menschen erworben. Sie sind nicht bloß heiter, gesellig, verträglich, nicht bloß dreist, sondern auch mutig. Sie beobachten ihre Umgebung genau und lernen ihre Freunde und Feinde kennen. Ihr Treiben und Beginnen heimelt uns an; ihr Vertrauen sichert ihnen selbst in roheren Gemütern Schutz und Gastlichkeit.
Alle Schwalben sind Kerbtierjäger. Sie verfolgen und fangen hauptsächlich Zwei-, Ader- und Netzflügler, also vorzugsweise Fliegen und Schnaken, aber auch kleine Käfer und dergleichen. Ihre Jagd geschieht nur im Fluge; sitzende Tiere abzulesen, sind sie nicht imstande. Die gefangene Beute verschlingen sie, ohne sie zu zerkleinern. Fliegend trinken sie, fliegend baden sie sich auch, indem sie, hart über der Oberfläche des Wassers dahinschwebend, plötzlich sich herabsenken und entweder ihren Schnabel oder einen Teil des Leibes eintauchen und dann die eingenetzten Federn durch zuckende oder schüttelnde Bewegungen wieder trocknen.
Die meisten Arten bauen ein kunstvolles Nest, dessen äußere Wandung Lehmklümpchen sind, die mit dem klebrigen Speichel zusammengekleistert wurden; andere graben mühevoll Löcher in das harte Erdreich steil abfallender Wände, erweitern diese in der Tiefe backofenförmig und legen hier das eigentliche Nest an, das der Hauptsache nach aus zusammengetragenen und wirr übereinander geschichteten Federn besteht. Das Gelege enthält vier bis sechs Eier, die vom Weibchen allein bebrütet werden.
Dank ihrer Gewandtheit im Fluge entgehen die Schwalben vielen Feinden, die das Kleingeflügel bedrohen. Doch gibt es in allen Erdteilen Falken, die auch die schnellsten Arten zu fangen wissen, und außerdem stellen Katzen, Marder, Wiesel, Ratten und Mäuse der Brut und den noch ungeschickten Jungen nach. Der Mensch befehdet die nützlichen und in den meisten Ländern geheiligten Vögel gewöhnlich nicht, wird im Gegenteil eher zu ihrem Beschützer.
Für die Gefangenschaft eignen sich die Schwalben nicht. Einzelne können zwar dahin gebracht werden, Ersatzfutter in einer ihnen unnatürlichen Weise zu sich zu nehmen und dadurch ihr Leben zu fristen; sie sind aber als seltene Ausnahmen anzusehen. Die Schwalbe verlangt, um zu leben, vor allem die unbeschränkteste Freiheit.
Unsere Rauchschwalbe ( Hirundo rustica) vertritt die Sippe der Edelschwalben ( Hirundo), deren Merkmale in dem sehr gestreckten, aber muskelkräftigen Leibe, dem kurzen Halse, flachen Kopfe mit breitem, kaum merklich gekrümmtem Schnabel, den ziemlich langen Füßen mit vollkommen getrennten Zehen, den langen Flügeln, die jedoch in der Ruhe von dem tief gegabelten Schwanze weit überragt werden, und dem lockeren, auf der Oberseite prächtig metallischglänzenden Gefieder gefunden werden. Die Länge beträgt achtzehn, die Breite einunddreißig, die Fittichlänge zwölf, die Schwanzlänge neun Zentimeter. Die Oberteile und ein breiter Gürtel auf dem Kropfe sind blauschwarz, metallischglänzend, Stirn und Kehle hochkastanienbraun, die übrigen Unterteile licht rostgelb; die fünf äußersten Steuerfedern tragen auf der Innenfahne rundliche, weiße Flecke. Beim Weibchen sind alle Farben blasser als beim Männchen, bei jungen Vögeln sehr matt.
Das Brutgebiet der Rauchschwalbe umfaßt ganz Europa diesseits des Polarkreises und ebenso West- und Mittelasien, ihr Wandergebiet außerdem Afrika und Südasien nebst den großen Eilanden im Süden des Erdteils. Sie ist es, die seit altersgrauer Zeit freiwillig dem Menschen sich angeschlossen und in seinem Hause Herberge genommen hat, die, falls der Mensch ihr gestattet, sich im Palaste wie in der Hütte ansiedelt und nur da, wo alle geeigneten Wohnungen fehlen, mit passenden Gesimsen steiler Felsenwände behilft, aber noch heutzutage diese mit dem ersten feststehenden Hause vertauscht, das in solcher Wildnis errichtet wurde; sie versucht selbst in der beweglichen Jurte des Wanderhirten Heimatsrechte zu gewinnen. Ihre Anhänglichkeit an das Wohnhaus des Menschen hat ihr dessen Liebe erworben, ihr Kommen und Gehen im Norden der Erde sie von altersher als Boten und Verkündiger guter und böser Tage erscheinen lassen.
Die Rauchschwalbe trifft durchschnittlich zwischen dem ersten und fünfzehnten April, ausnahmsweise früher, selten später, bei uns ein und verweilt in ihrer Heimat bis Ende September oder Anfang Oktober. Während der Zugzeit sieht man sie in ganz Afrika. Bis zu den Ländern am Vorgebirge der Guten Hoffnung dringt sie vor, und ebenso ist sie in allen Tiefländern Indiens, auf Ceylon und den Sundainseln Wintergast. Gelegentlich ihrer Wanderung überfliegt sie Länderstrecken, die jahraus, jahrein verwandte Schwalben beherbergen und diesen also alle Erfordernisse zum Leben bieten müssen, ohne hier auch nur zu rasten. So sah ich sie bereits am dreizehnten September im südlichen Nubien erscheinen, so beobachtete ich sie auf ihrem Rückzüge nur wenige Tage früher, als sie bei uns einzutreffen pflegt, in Khartum, am Zusammenflusse des Weißen und Blauen Stromes, zwischen dem fünfzehnten und sechzehnten Grade nördlicher Breite. Höchst selten kommt es vor, daß im Innern Afrikas noch im Hochsommer eine Rauchschwalbe gesehen wird, und ebenso selten begegnet man einer im Winter in Ägypten oder sonstwo im Norden des Erdteils. Unmittelbar nach ihrer Heimkehr findet sie sich bei ihrem alten Neste ein, oder schreitet zur Erbauung eines solchen. Damit beginnt ihr Sommerleben mit all seinen Freuden und Sorgen.
Die Rauchschwalbe ist, wie Naumann trefflich schildert, ein außerordentlich flinker, kühner, munterer, netter Vogel, der immer schmuck aussieht, und dessen fröhliche Stimmung nur sehr schlechtes Wetter und demzufolge eintretender Nahrungsmangel unterbrechen kann. »Obgleich von einem zärtlichen und weichlichen Naturell, zeigt sie doch in mancher ihrer Handlungen viel Kraftfülle: ihr Flug und ihr Betragen während desselben, die Neckereien mit ihresgleichen, der Nachdruck, mit dem sie Raubvögel und Raubtiere verfolgt, beweisen dies. Sie fliegt am schnellsten, abwechselndsten und gewandtesten unter unsern Schwalben; sie schwimmt und schwebt, immer rasch dabei fortschießend, oder fliegt flatternd, schwenkt blitzschnell seit-, auf- oder abwärts, senkt sich in einem kurzen Bogen fast bis zur Erde oder bis auf den Wasserspiegel herab, oder schwingt sich ebenso zu einer bedeutenden Höhe hinauf, und alles dieses mit einer Fertigkeit, die in Erstaunen setzt; ja, sie kann sich sogar im Fluge überschlagen. Mit großer Geschicklichkeit fliegt sie durch enge Öffnungen, ohne anzustoßen; auch versteht sie die Kunst, fliegend sich zu baden, weshalb sie dicht über dem Wasserspiegel dahinschießt, schnell eintaucht, so einen Augenblick im Wasser verweilt und nun, sich schüttelnd, weiter fliegt. Ein solches Eintauchen, das den Flug kaum einige Augenblicke unterbricht, wiederholt sie oft mehrere Male hintereinander, und das Bad ist gemacht.« Zum Ausruhen wählt sie sich hervorragende Örtlichkeiten, die ihr bequemes Zu- und Abstreichen gestatten; hier sonnt sie sich, hier ordnet sie ihr Gefieder, hier singt sie. »Ihr Aussehen ist dann immer schlank und munter, fast listig; der Rumpf wird dabei in wagerechter Stellung getragen. Nicht selten dreht sie die Brust hin und her und schlägt in fröhlicher Laune zwitschernd und singend die Flügel auf und nieder oder streckt und dehnt die Glieder.« Auf den flachen Boden setzt sie sich ungern, meist nur, um von ihm Baustoffe fürs Nest aufzunehmen, oder während ihrer ersten Jugendzeit; ihre Füßchen sind zum Sitzen auf dem Boden nicht geeignet und noch weniger zum Gehen; sie sieht, wenn sie das eine oder andere tut, »krank und unbehilflich aus und scheint gar nicht derselbe flüchtig Vogel zu sein, als den sie sich uns in ihrem kühnen, rastlosen Fluge zeigt.«
Ein zartes »Witt«, das nicht selten in »Widewitt« verlängert wird, drückt behagliche Stimmung der Schwalbe aus oder wird als Lockton gebraucht; der Warnungs- und Kampfruf ist ein helles, lautes »Biwist«; die Anzeige drohender Gefahr geschieht durch die Silben »Dewihlik«; bei Todesangst vernimmt man ein zitternd ausgestoßenes »Zetsch«. Der Gesang, den das Männchen sehr fleißig hören läßt, zeichnet sich weder durch Wohlklang der einzelnen Töne, noch durch Abwechselung aus, hat aber dennoch etwas ungemein Gemütliches und Ansprechendes, wozu Jahres- und Tageszeit und andere Verhältnisse das ihrige beitragen. »Kaum kündet ein grauer Streifen im Osten den kommenden Tag an«, fährt Naumann fort, »so hört man schon die ersten Vorspiele des Gesanges der von der Nachtruhe eben erwachten Rauchschwalbenmännchen. Alles Geflügel des Hofes ist noch schlaftrunken, keins läßt einen Laut hören, überall herrscht noch tiefe Stille, und die Gegenstände sind noch mit nebligem Grau umschleiert: da stimmt hier und da ein Schwalbenmännchen sein ›Wirb, werb‹ an, jetzt noch stammelnd, durch viele Pausen unterbrochen, bis erst nach und nach ein zusammenhängendes Liedchen entsteht, das der auf derselben Stelle sitzenbleibende Sänger mehrmals wiederholt, bis er sich endlich aufschwingt und nun fröhlich singend das Gehöft durchfliegt. Ehe es dahin kommt, ist ein Viertelstündchen vergangen, und nun erwachen auch die andern Schläfer: der Hausrötling girlt sein Morgenliedchen vom Dache herab, die Spatzen lassen sich hören, die Tauben rucksen, und bald ist alles Geflügel zu neuem Leben erwacht. Wer sich öfter eines schönen Sommermorgens im ländlichen Gehöfte erfreute, wird beistimmen müssen, daß diese Schwalbe mit ihrem obschon schlichten, doch fröhlichen, aufmunternden Gesange viel zu den Annehmlichkeiten eines solchen beiträgt.« Der Gesang selbst fängt mit »Wirb, werb, widewitt« an, geht in ein längeres Gezwitscher über und endet mit »Wid, weid woidä zerr«. Das Volk hat ihn in Worte übersetzt und unserer edelsten Dichter einer des Volkes Stammeln im lieblichsten Gedicht verherrlicht – wer kennt es nicht, das Schwalbenlied unseres Rückert:
»Aus der Jugendzeit, aus der Jugendzeit
Klingt ein Lied mir immerdar usw.«
dessen eine Strophe:
»Als ich Abschied nahm, als ich Abschied nahm,
War'n Kisten und Kasten schwer,
Als ich wieder kam, als ich wieder kam,
War alles leer.«
die eigentlich volkstümliche, die vom Volke selbst gedichtete ist.
Unter den Sinnen der Schwalbe steht das Gesicht obenan. Sie sieht ein kleines Kerbtier, wenn es fliegt, schon in bedeutender Entfernung und jagt nur mit Hilfe des Auges. Auch das Gehör ist wohlentwickelt, und das Gefühl, soweit es sich als Empfindungsvermögen kundgibt, gewiß nicht in Abrede zu stellen.
Kleine Kerbtiere mancherlei Art, vorzugsweise Zwei- und Netzflügler, Schmetterlinge und Käfer bilden auch die Nahrung dieser Schwalbe; Immen mit Giftstacheln frißt sie nicht. Sie jagt nur im Fluge und zeigt sich unfähig, sitzende Beute aufzunehmen. Deshalb gerät sie bei länger anhaltendem Regenwetter, das die Kerfe in ihre Schlupfwinkel bannt, oft in harte Not und müht sich ängstlich, die festsitzenden durch nahes Vorüberstreichen aufzuscheuchen und zum Fliegen zu bringen. Je nach Witterung und Tageszeit jagt sie in höheren oder tieferen Schichten der Luft und ist deshalb dem Volke zum Wetterpropheten geworden. Gute Witterung deckt ihren Tisch reichlich und erhöht ihren frischen Mut, schlechtes Wetter läßt sie darben und macht sie still und traurig. Sie bedarf, ihrer großen Regsamkeit halber, unverhältnismäßig viel an Nahrung und frißt, solange sie fliegend sich bewegt. Das Verzehrte verdaut sie rasch; die unverdaulichen Überreste der Mahlzeit, Flügeldecken, Schilder und Beine der Kerfe, speit sie, zu Gewöllen geballt, wieder aus.
Durch Anlage und Bau des Nestes unterscheidet sich die Rauchschwalbe von ihren deutschen Verwandten. Falls es irgend möglich, baut sie das Nest in das Innere eines Gebäudes, so, daß es von oben her durch eine weit überragende Decke geschützt wird. Ein Tragbalken an der Decke des Kuhstalls oder der Flur des Bauernhauses, ein Dachboden, den die besenführende Magd meidet, oder irgendeine andere Räumlichkeit, die eher den Farbensinn eines Malers als das Reinlichkeitsgefühl der Hausfrau befriedigt, mit kurzen Worten, alternde, verfallende, mehr oder minder schmutzige, vor Zug und Wetter geschützte Räume sind die Nistplätze, die sie besonders liebt. Hier kann es vorkommen, daß förmliche Siedlungen entstehen. Das Nest selbst wird an dem Balken oder an der Wand, am liebsten an rauhen und bezüglich unten durch vorspringende Latten, Pflöcke und dergleichen verbesserten Stellen festgeklebt. Es ähnelt etwa dem Vierteile einer Hohlkugel; seine Wände verdicken sich an der Befestigungsstelle; der im ganzen wagerecht stehende Rand zieht sich hier meist auch etwas höher hinauf. Die Breite beträgt ungefähr zwanzig, die Tiefe zehn Zentimeter. Der Stoff ist schlammige oder mindestens fette Erde, die klümpchenweise aufgeklaubt, mit Speichel überzogen und vorsichtig angeklebt wird. Andere Stoffe verwendet sie selten; doch erhielt ich ein Nest, das einzig und allein aus zertrümmerter Knochenkohle bestand und in üblicher Weise zusammengekleistert worden war. Feine, zwischen die Nestwände eingelegte Halme und Haare tragen zur bessern Festigung bei; das eigentliche Bindemittel aber ist der Speichel. Bei schöner Witterung vollendet das Schwalbenpaar das Ausmauern der Nestwandungen innerhalb acht Tagen. Hierauf wird der innere Raum mit zarten Hälmchen, Haaren, Federn und ähnlichen weichen Stoffen ausgekleidet, und die Kinderwiege ist vollendet. Ein an geschützten Orten stehendes Schwalbennest dient lange, lange Jahre, vielleicht nicht seinen Erbauern allein, sondern auch nachfolgenden Geschlechtern. Etwaige Schäden bessert das Paar vor Beginn der Brut sorgfältig aus; die innere Ausfüllung wird regelmäßig erneuert, im übrigen jedoch nichts an dem Bau verändert, solange er besteht. Im Mai legt das Weibchen vier bis sechs, zwanzig Millimeter lange, vierzehn Millimeter dicke, zartschalige, auf reinweißem Grunde mit aschgrauen und rotbraunen Punkten gezeichnete Eier ins Nest, bebrütet sie, ohne Hilfe seines Männchens, und zeitigt bei günstiger Witterung binnen zwölf Tagen die Jungen. Bei schlechter, zumal naßkalter Witterung muß es die Eier stundenlang verlassen, um sich die ihm nötige Nahrung zu erbeuten, und dann kann es geschehen, daß letztere erst nach siebzehn Tagen ausgebrütet werden. Die anfangs sehr häßlichen, breitmäuligen Jungen werden von beiden Eltern fleißig geatzt, wachsen unter günstigen Umständen rasch heran, schauen bald über den Rand des Nestes heraus und können, wenn alles gut geht, bereits in der dritten Woche ihres Lebens außerhalb des Eies den Eltern ins Freie folgen. Sie werden nun noch eine Zeitlang draußen gefüttert, anfangs allabendlich ins Nest zurückgeführt, später im Freien hübsch zur Ruhe gebracht und endlich ihrem Schicksal überlassen. Sodann, meist in den ersten Tagen des August, schreiten die Alten zur zweiten Brut. In manchen Jahren verspätet sich diese so sehr, daß Alte und Junge gefährdet sind; in nördlichen Ländern müssen letztere zuweilen wirklich verlassen werden. Unter günstigeren Umständen sind auch die letzten Jungen längst flügge geworden, wenn der eintretende Herbst zur Winterreise mahnt. Nunmehr sammeln sie sich im Geleite ihrer Eltern mit andern Familien derselben Art, mit Bachstelzen und Staren im Röhricht der Teiche und Seen, hier Ruhe haltend, bis die Nacht herankommt, die die lieben Gäste uns entführt. Eines Abends, bald nach Sonnenuntergang, erhebt sich das zahllose Schwalbenheer, das man in den Nachmittagsstunden vorher vielleicht auf dem hohen Kirchendache versammelt sah, auf ein von mehreren Alten gegebenes Zeichen, verschwindet wenige Minuten später dem Auge und zieht davon.
Ungeachtet ihrer Gewandtheit und trotz ihrer Anhänglichkeit an den Menschen droht der Schwalbe mancherlei Gefahr. Bei uns zulande ist der Baumfalk der gefährlichste von allen natürlichen Feinden; in Südasien und Mittelafrika übernehmen andere seines Geschlechts dessen Rolle. Die jungen Schwalben werden durch alle Raubtiere, die im Innern des Hauses ihr Wesen treiben, und mehr noch durch Ratten und Mäuse gefährdet. Zu diesen Feinden gesellt sich hier und da noch der Mensch. In Italien wie in Spanien werden alljährlich hunderttausende von Schwalben durch Bubenjäger vertilgt, obgleich ein Sprichwort der Spanier sagt, daß derjenige, der eine Schwalbe umbringe, seine Mutter töte.
Im Käfig sieht man die Rauchschwalbe selten. Es ist nicht unmöglich, sie jahrelang zu erhalten; sie verlangt aber die größte Sorgfalt hinsichtlich ihrer Pflege und belohnt diese eigentlich doch nur in geringem Maße.
Im Südosten Europas gesellt sich der Rauchschwalbe die derselben Sippe angehörige, gleichgroße Höhlenschwalbe, Alpen- oder Rötelschwalbe ( Hirundo rufula). Oberkopf, Hinterhals, Mantel, Schultern und längste obere und untere Schwanzdecken sind tief stahlblauschwarz, ein schmaler Brauenstrich, die Schläfe, ein breites Nackenband und der Bürzel dunkel braunrot, Kopf- und Halsseiten, Unterteile und vordere obere Schwanzdecken roströtlichgelb, Kehle und Kropf fein schwarz in die Länge gestrichelt, Flügel und Schwanz einfarbig glänzend schwarz. Das Auge hat tiefbraune, der Schnabel schwarze, der Fuß hornbraune Färbung.
Griechenland und Kleinasien scheinen der Brennpunkt des Verbreitungsgebiets der Höhlenschwalbe zu sein; in Italien, wo sie ebenfalls regelmäßig vorkommt, tritt sie weit seltener, im übrigen Südeuropa nur als Besuchsvogel auf; nach Deutschland hat sie sich verflogen. Außer Griechenland und Kleinasien bewohnt sie Persien und Kaukasien; auf ihrer Winterreise durchstreift sie den Nordosten Afrikas. In Mittelasien wird sie durch eine verwandte Art vertreten.
Lebensweise, Wesen und Betragen, Sitten und Gewohnheiten der Höhlenschwalbe entsprechen dem von der Rauchschwalbe gezeichneten Lebensbilde fast in jeder Hinsicht. Aber die Höhlenschwalbe hat sich bis jetzt nur ausnahmsweise bewegen lassen, ihre ursprünglichen Brutstätten mit dem Wohnhause des Menschen zu vertauschen, legt vielmehr nach wie vor ihr Nest in Felshöhlen an. Demgemäß bewohnt sie ausschließlich Gegenden, in denen steilwandige Felsmassen ihr Wohnung gewähren, jedoch weniger die höheren als die unteren Lagen der Gebirge. Auch sie ist ein Zugvogel, der annähernd um dieselbe Zeit wie die Rauchschwalbe, in Griechenland in den ersten Tagen des April, frühestens in den letzten des März, eintrifft, und im August und September das Land wieder verläßt. Unmittelbar nach ihrer Ankunft begibt sie sich an ihre Brutplätze, und in den ersten Tagen des Mai liegen bereits die vier bis fünf, zwanzig Millimeter langen, fünfzehn Millimeter dicken, reinweißen Eier im Nest. Letzteres hängt stets an der Decke passender Höhlen, wird aus denselben Stoffen erbaut wie das der Haus- oder Mehlschwalbe, ist aber merklich größer als das der einen oder der andern, fast kugelrund, ganz zugebaut, mit einer langen, oft gebogenen Eingangsröhre versehen, und innen dicht mit Federn ausgekleidet. Wenn irgendmöglich, bildet auch diese Schwalbe Siedelungen.
Der verhältnismäßig kurze und deshalb sehr breit erscheinende, auf dem Firste scharf gebogene Schnabel, die ungewöhnlich kräftigen Füße, deren äußere und mittlere Zehen bis zum ersten Gelenk miteinander verbunden und wie die Läufe befiedert sind, die starkschwingigen Flügel, der kurze, seicht gegabelte Schwanz und das glatt anliegende Gefieder gelten als die wesentlichen Kennzeichen der bei uns überall häufig vorkommenden Mehlschwalbe ( Hirundo urbica). Ihre Länge beträgt vierzehn, die Breite siebenundzwanzig, die Fittichlänge zehn, die Schwanzlänge sieben Zentimeter. Das Gefieder ist auf der Oberseite blauschwarz, auf der Unterseite und auf dem Bürzel weiß. Das Auge ist dunkelbraun, der Schnabel schwarz, der Fuß, soweit er nicht befiedert, fleischfarben. Bei den Jungen ist das Schwarz der Oberseite matter und das Weiß an der Kehle unreiner als bei den Alten.
Die Mehlschwalbe teilt mit der Rauchschwalbe so ziemlich dasselbe Vaterland, geht aber weiter nach Norden hinauf als letztere. In Deutschland scheint sie Städte zu bevorzugen: sie ist es, deren Nestansiedlungen man hier an großen und alten Gebäuden sieht. Außer Europa bewohnt sie in gleicher Häufigkeit den größten Teil Sibiriens. Von ihrer Heimat aus wandert sie einerseits bis in das Innere Afrikas, anderseits bis nach Südasien, um hier den Winter zu verbringen. Sie trifft meist einige Tage später ein als die Rauchschwalbe, verweilt dafür aber länger in Europa und namentlich in Südeuropa: wir sahen sie noch am zweiten November die Alhambra umfliegen. Doch bemerkt man sie auf ihrer afrikanischen Reise regelmäßig in Gesellschaft ihrer Verwandten. Im Frühjahr kommt sie einzeln an: vor dem Herbstzuge versammelt sie sich zu großen Gesellschaften, die zuweilen zu unschätzbaren Schwärmen anwachsen, auf den Dächern hoher Gebäude sich scharen und dann, gewöhnlich gleich nach Sonnenuntergang, zur Reise aufbrechen. Gelegentlich dieser Wanderung ruhen sie sich wohl auch im Walde auf Bäumen aus.
In ihrem Wesen zeigt die Mehlschwalbe viel Ähnlichkeit mit der Rauchschwalbe; bei genauerer Beobachtung aber unterscheidet man sie doch sehr leicht von dieser. »Sie scheint«, wie Naumann sagt, »ernster, bedächtiger und einfältiger zu sein als jene, ist minder zutraulich, doch auch nicht scheu, fliegt weniger geschwind, jedoch schnell genug, aber mehr und öfter schwebend, meistens höher als jene. Ihr Flug ist sanft, nicht so außerordentlich schnell und abwechselnd, doch aber auch mit sehr verschiedenartigen Wendungen und Schwenkungen, bald hoch, bald tief.« Bei Regenwetter schwingt sie sich oft zu außerordentlichen Höhen empor und jagt wie die Seglerarten in jenen Luftschichten nach Nahrung. Sie ist geselliger als ihre Verwandten, vereinigt sich jedoch nur mit andern ihrer Art. Mit der Rauchschwalbe hält sie Frieden, und bei allgemeiner Not oder auf der Wanderung schart sie sich mit dieser zu einem Fluge; unter gewöhnlichen Umständen aber lebt jede Art abgesondert für sich, ohne gegen die andere besondere Zuneigung zu zeigen. Innerhalb des Verbandes wird der Frieden übrigens oft gestört, und zumal bei den Nestern gibt es viel Zank und Streit, nicht bloß mit andern nestbedürftigen Mehlschwalben, sondern auch mit dem Sperling, der gerade das Nest dieser Schwalbe sehr häufig in Besitz nimmt. Die Stimme unterscheidet sie leicht von der Rauchschwalbe. Der Lockton klingt wie »Schär« oder »Skrü«, der Ausdruck der Furcht ist ein zweisilbiges »Skier«, der Gesang, wie Naumann sagt, »ein langes, einfältiges Geleier sich immer wiederholender, durchaus nicht angenehmer Töne«. Er gehört unter die schlechtesten aller Vogelgesänge.
Hinsichtlich der Nahrung der Mehlschwalbe gilt ungefähr dasselbe, was von der Rauchschwalbe gesagt wurde; jedoch kennen wir nur zum geringsten Teile die Kerbtiere, denen sie nachstrebt, und namentlich die Arten, die sie in den hohen Luftschichten und, wie es scheint, in reichlicher Menge erbeutet, sind uns vollkommen unbekannt. Stechende Kerbtiere fängt sie ebensowenig wie jene; der Giftstachel würde ihr tödlich sein. »Einer sehr rüstigen, hungernden, flugbaren jungen Schwalbe dieser Art«, erzählt Naumann, »hielt ich eine lebende Honigbiene vor; aber kaum hatte sie diese in dem Schnabel, als sie auch schon in die Kehle gestochen war, die Biene von sich schleuderte, traurig ward und in weniger denn zwei Minuten schon ihren Geist aufgab.«
Bei uns zulande nistet die Mehlschwalbe fast ausschließlich an den Gebäuden der Städte und Dörfer; in weniger bewohnten Ländern siedelt sie sich massenhaft an Felswänden an, so, nach eigenen Beobachtungen, in Spanien wie an den Kreidefelsen der Insel Rügen, ebenso, laut Schinz, an geeigneten Felswänden der Schweizer Alpen. Unter allen Umständen wählt sie sich eine Stelle, an der das Nest von oben her geschützt ist, so daß es vom Regen nicht getroffen werden kann, am liebsten also die Friese unter Gesimsen und Säulen, Fenster- und Türnischen, Dachkränze, Wetterbretter und ähnliche Stellen. Zuweilen bezieht sie auch eine Höhlung in der Wand und mauert den Eingang bis auf ein Flugloch zu. Das Nest unterscheidet sich von dem der Rauchschwalbe dadurch, daß es stets bis auf ein Eingangsloch zugebaut wird, von oben also nicht offen ist. Die Gestalt einer Halbkugel ist vorherrschend; doch ändert das Nest nach Ort und Gelegenheit vielfach ab. Der Bau desselben geschieht mit Eifer, ist aber eine lange Arbeit, die selten unter zwölf bis vierzehn Tagen vollendet wird. Bloß ausnahmsweise sieht man ein einziges dieser Nester; gewöhnlich werden möglichst viele dicht neben- und aneinander gebaut. Das Pärchen benutzt das einmal fertige Nest nicht nur zu den zweiten Bruten, die es in einem Sommer macht, sondern auch in nachfolgenden Jahren, fegt aber immer erst den Unrat aus und trägt neue Niststoffe ein. Schadhafte Stellen werden geschickt ausgebessert, sogar Löcher im Boden wieder ausgeflickt. Das Gelege besteht aus vier bis sechs, achtzehn Millimeter langen, dreizehn Millimeter dicken, zartschaligen, schneeweißen Eiern, die nach zwölf bis dreizehn Tagen von dem allein brütenden Weibchen gezeitigt werden. Das Männchen versorgt sein Weibchen bei gutem Wetter mit genügender Nahrung; bei schlechtem Wetter hingegen ist dieses genötigt, zeitweise die Eier zu verlassen, und dadurch verlängert sich dann die Brütezeit. Auch das Wachstum der Jungen hängt wesentlich von der Witterung ab. In trockenen Sommern fällt es den Eltern nicht schwer, die nötige Kerbtiermenge herbeizuschaffen, wogegen in ungünstigen Jahren Mangel und Not oft recht drückend werden. Bei frühzeitig eintretendem kalten Herbstwetter geschieht es, daß die Eltern ihre Jungen verhungern lassen und ohne sie die Weiterreise antreten müssen: Malm fand in Schweden Nester, in denen die halb erwachsenen Jungen tot in derselben Ordnung lagen, die sie, als sie noch lebten, eingehalten hatten. Unter günstigen Umständen verlassen die Jungen nach ungefähr sechzehn Tagen das Nest und üben nun unter Aufsicht der Alten ihre Glieder, bis sie kräftig und geschickt genug sind, um selbst für ihren Unterhalt zu sorgen. Anfangs kehren sie allabendlich noch nach dem Neste zurück, das auch den Eltern bisher zur Nachtruhe diente. »Vater, Mutter und Kinder«, berichtet Naumann, »drängen sich darin zusammen, oft sieben bis acht Köpfe stark, und der Raum wird dann alle Abende so beengt, daß es lange währt, ehe sie in Ordnung kommen, und man sich oft wundern muß, wie das Nest, ohne herabzufallen oder zu bersten, die vielen Balgereien von ihnen aushält. Der Streit wird oft sehr ernstlich, wenn die Jungen, wie es in großen Siedlungen oft vorkommt, sich in ein fremdes Nest verirren, aus dem sie von den brütenden Alten und Jungen, die im rechtmäßigen Besitz ihres Eigentums sich tapfer verteidigen, immer hinausgebissen und hinabgeworfen werden.«
Baumfalk und Merlin sind die schlimmsten Feinde der Mehlschwalbe. Die Nester werden von der Schleiereule und dem Schleierkauze, zuweilen auch von Wieseln, Ratten und Mäusen geplündert. Mancherlei Schmarotzer plagen Alte und Junge; vor andern Gegnern schützt sie ihre Gewandtheit. Nur mit einem Vogel noch haben sie hartnäckige Kämpfe zu bestehen, mit dem Sperlinge nämlich, und diese Kämpfe arten oft in Mord und Totschlag aus. »Gewöhnlich«, sagt Naumann, »nimmt das Sperlingsmännchen, sobald die Schwalben das Nest fertig haben, Besitz davon, indem es ohne Umstände hineinkriecht und keck zum Eingangsloch herausguckt, während die Schwalben weiter nichts gegen diesen Gewaltstreich tun können, als, im Verein mit mehreren ihrer Nachbarn, unter ängstlichem Geschrei um dasselbe umherzuflattern und nach dem Eindringlinge zu schnappen, jedoch ohne es zu wagen, ihn jemals wirklich zu packen. Unter solchen Umständen währt es doch öfters einige Tage, ehe sie es ganz aufgeben und den Sperling im ruhigen Besitz lassen, der es denn nun bald nach seiner Weise einrichtet, nämlich mit vielen weichen Stoffen warm ausfüttert, so daß allemal lange Fäden und Halme aus dem Eingangsloch hervorhängen und den vollständig vollzogenen Wechsel der Besitzer kundtun. Weil nun die Sperlinge so sehr gern in solchen Nestern wohnen, hindert die Wegnahme derselben die Schwalben ungemein oft in ihren Brutgeschäften, und das Pärchen, das das Unglück gar zweimal in einem Sommer trifft, wird dann ganz vom Brüten abgehalten. Ich habe sogar einmal gesehen, wie sich ein altes Sperlingsmännchen in ein Nest drängte, worin schon junge Schwalben saßen, über diese herfiel, einer nach der andern den Kopf einbiß, sie zum Nest hinauswarf und nun Besitz von diesem nahm. Auch Feldsperlinge nisten sich, wenn sie es haben können, gern in Schwalbennester ein. Ihr einziges Schutzmittel ist, den Eingang so enge zu machen, daß sie nur so eben sich noch durchpressen können, während dies für den dickeren Sperling unmöglich ist und ihn in der Tat von solchen Nestern abhält, an denen dieser Kunstgriff angewendet wurde.«
Bei uns zulande ist auch die Mehlschwalbe geheiligt; in Italien und Spanien dagegen lassen es sich die Knaben zum Vergnügen gereichen, sie an einer feinen Angel zu fangen, die mit einer Feder geködert wurde. Die Schwalbe sucht diese Federn für ihr Nest aufzunehmen, bleibt an der Angel hängen und wird dann von den schändlichen Buben in der abscheulichsten Weise gequält.
Die Bergschwalben ( Cotyle) kennzeichnen sich durch verhältnismäßig langen, sehr feinen, flachen, seitlich stark zusammengedrückten Schnabel mit frei vor dem Stirngefieder liegenden Nasenlöchern, zarte Füße mit seitlich zusammengedrückten Läufen und schwächlichen Zehen, deren mittlere und äußere untereinander verbunden sind, lange und spitzige Flügel, leicht gegabelten Schwanz und lockeres, unscheinbares Gefieder.
Europa, und [vor]züglich Deutschland, beherbergen zwei Arten der Sippe, denen alle übrigen bekannten hinsichtlich ihrer Lebensweise ähneln.
Die Felsenschwalbe, Berg- oder Steinschwalbe ( Cotyle rupestris) ist die größere der bei uns vorkommenden Arten. Ihre Länge beträgt fünfzehn, die Breite fünfunddreißig, die Fittichlänge vierzehn, die Schwanzlänge sechs Zentimeter. Alle oberen Teile des Leibes sind matt erdbraun, die Schwingen und Schwanzfedern schwärzlich, letztere bis auf die mittleren und äußersten mit eiförmigen, schön gelblichweißen Flecken gezeichnet, Kinn und Kehle, Kropf und Oberbrust schmutzig bräunlichweiß, fein schwarz längsgestrichelt, die übrigen Unterteile erdbräunlich. Das Auge ist dunkelbraun, der Schnabel schwarz, der Fuß rötlich hornfarben. Männchen und Weibchen unterscheiden sich kaum durch die Größe, die Jungen durch noch einfarbigeres Gefieder.
In Deutschland ist die Felsenschwalbe zwar wiederholt beobachtet worden, und in den südlichsten Teilen desselben, in gewissen Alpentälern Tirols und Steiermarks, kommt sie wohl auch als Brutvogel vor; ihre eigentliche Heimat aber ist der Süden unseres Erdteiles, Spanien, Griechenland und Italien. Außerdem bewohnt sie Nordwestafrika, Mittelasien, östlich bis China, Persien und Indien. Sie ist ein eigentümlich harter Vogel, der in den nördlichsten Teilen seines Aufenthaltes sehr früh im Jahr, bereits im Februar oder spätestens Anfang März, erscheint und bis in den Spätherbst hinein hier verweilt, in Südeuropa aber überhaupt nicht wandert.
Der nur einigermaßen geübte Beobachter kann die Felsenschwalbe nicht verkennen. Sie fällt auf durch ihre graue Färbung und durch ihren verhältnismäßig langsamen, sanft schwebenden Flug. Gewöhnlich streicht sie möglichst nahe an den Felswänden dahin, bald in größerer, bald in geringerer Höhe, mehr oder weniger in gleichmäßiger Weise. Doch erhebt auch sie sich ausnahmsweise zu bedeutenden Höhen und zeigt dann ungefähr die Gewandtheit der Mehlschwalbe. Selten vereinigt sie sich mit andern Arten, obwohl es vorkommt, daß sie da, wo Mehlschwalben an Felswänden nisten, auch in deren Gesellschaft sich bewegt oder mit der Höhlen- und Mehlschwalbe dieselben Brutstätten teilt. Sie ist weit weniger gesellig als alle übrigen mir bekannten Schwalbenarten und bewohnt meist nur in wenigen Paaren ein und dasselbe Felsental. In der Schweiz streift sie, laut Schinz, nach ihrer Ankunft im Frühjahr oft lange umher, ehe sie ihre alten Nester bezieht, und ebenso nach vollendeter Brut bis zur Herbstwanderung entweder einzeln oder mit ihren Jungen oder in Gesellschaft mit noch einer oder zwei andern Familien von einem Turm oder Felsen zum andern. Bei schlechtem Wetter hält sie sich nahe über dem Boden; während starken Regens sucht sie unter vorspringenden Steinen, in Fels- oder Mauerlöchern Zuflucht. Sonst setzt sie sich selten am Tage, falls sie nicht zum Boden herabkommen muß, um hier Niststoffe zusammenzulesen. Nur an heiteren Sommertagen sieht man sie zuweilen auf Hausdächern sich niederlassen; in das Innere der Häuser aber kommt sie nie. »Beim Wegfliegen«, sagt Schinz, »stürzt sie sich aus ihren Schlupfwinkeln hervor und breitet nun erst im Fallen die Flügel aus; dann fliegt sie meist ruhig schwimmend längs der Felsen hin und her, schwenkt ungemein schnell um die Ecken und in alle Klüfte hinein, setzt sich aber sehr selten. Zuweilen entfernt sie sich von den Felsen, aber nie weit, und selten, meist nur, wenn die Jungen erst flügge geworden sind, senkt sie sich etwas abwärts, fliegt dann um die Wipfel der Tannen, die sich hier und da am Fuß der Felsen befinden, und atzt die gierig nachfliegenden Jungen. Sie ist viel stiller und weniger lebhaft als die neben ihr wohnende Hausschwalbe. Zuweilen spielt sie, auf Felsenvorsprüngen sitzend, indem zwei gegeneinander die Flügel lebhaft bewegen und dann sehr schnell unter dem Ruf ›Dwi, dwi, dwi‹ aufeinander stürzen, dann aber plötzlich und mit mannigfaltigen Schwenkungen davonfliegen. Die Lockstimme ist oft tief und heiser ›Drü, drü, drü‹, ihren Gesang habe ich niemals vernommen.«
Die Nester der Felsenschwalbe steht man da, wo sie vorkommt, an Felsenwänden hängen, oft nicht hoch über dem Fuß der Wand, immer aber in Höhlen oder doch an Stellen, wo vorspringende Steine sie von oben her schützen. Sie ähneln am meisten denen unserer Rauchschwalbe, sind jedoch merklich kleiner und mit Tier- und Pflanzenwolle, auch wohl einigen Federn, ausgekleidet. An manchen Orten sieht man mehrere dieser Nester zusammen, jedoch niemals so dicht wie bei den Mehlschwalben, wie denn auch eine Ansiedelung der Felsenschwalben nicht entfernt dieselbe Nesterzahl enthält wie die Siedelung der Mehlschwalbe. Das Gelege, das frühestens Mitte April, gewöhnlich nicht vor Ende Mai vollzählig zu sein pflegt, enthält vier bis fünf, ungefähr dreiundzwanzig Millimeter lange, fünfzehn Millimeter dicke, auf weißem Grund unregelmäßig, am dichtesten gegen das dicke Ende hin blaß graubraun gefleckte Eier. Ende Mai beobachteten wir an einer Felswand des Montserrat junge Felsenschwalben, wie es schien solche, die erst vor wenigen Tagen das Nest verlassen hatten, denn sie wurden von den Alten noch gefüttert. Dies geschieht, wie schon Schinz beobachtete, im Fluge, indem Junge und Alte gegeneinander anfliegen und beide sich dann flatternd auf einer und derselben Stelle erhalten, bis ersteres das ihm zugereichte Kerbtier glücklich gepackt hat.

Junge Uferschwalbe ( Cotyle riparia)
Viel genauer ist uns das Leben der Uferschwalbe, Erd-, Sand-, Kot-, Strand- und Wasserschwalbe ( Cotyle riparia) bekannt. Sie ist schon den Alten aufgefallen und ihre Tätigkeit in eigentümlicher Weise erklärt worden. »In der Mündung des Nils bei Heraklia in Ägypten«, sagt Plinius, »bauen die Schwalben Nest an Nest und setzen dadurch den Überschwemmungen des Stromes einen undurchdringlichen Wall entgegen von fast einem Stadium Länge, den Menschenhand kaum zustande bringen würde. In eben diesem Ägypten liegt neben der Stadt Koptos eine der Isis geheiligte Insel, die von den Schwalben mit vieler Mühe befestigt wird, damit der Nil sie nicht benage. Mit Beginn des Frühlings bekleben sie die Stirnseite der Insel durch Spreu und Stroh und üben ihre Arbeit drei Tage und Nächte hintereinander mit solcher Emsigkeit, daß viele an Erschöpfung sterben. Jedes Jahr steht dieselbe Arbeit ihnen aufs neue bevor.« Es ist leicht einzusehen, daß der Nestbau diese Sage begründet hat.
Die Uferschwalbe gehört zu den kleinsten Arten ihrer Familie. Ihre Länge beträgt höchstens dreizehn, die Breite neunundzwanzig, die Fittichlänge zehn, die Schwanzlänge fünf Zentimeter. Das Gefieder ist oben aschgrau oder erdbraun, auf der Unterseite weiß, in der Brustgegend durch ein aschgraubraunes Querband gezeichnet. Beide Geschlechter gleichen sich; die Jungen sind etwas dunkler gefärbt.
Keine einzige Schwalbenart bewohnt ein Gebiet von ähnlicher Ausdehnung wie die Uferschwalbe, die, mit Ausnahme Australiens, Polynesiens und der Südhälfte Amerikas, auf der ganzen Erde Brutvogel ist. Ihrem Namen entsprechend, hält sie sich am liebsten da auf, wo sie steile Uferwände findet, verlangt jedoch nicht immer ein Flußufer, sondern begnügt sich oft auch mit einer steil abfallenden Erdwand. Wo sie auftritt, ist sie gewöhnlich häufig; in keinem von mir bereisten Lande aber sieht man so außerordentlich zahlreiche Scharen von ihr wie am mittleren und unteren Ob, woselbst sie Siedlungen bildet, in denen mehrere tausend Paare von Brutvögeln hausen. Auch bei uns zulande trifft man selten weniger als fünf bis zehn, gewöhnlich zwanzig bis vierzig, ausnahmsweise aber hundert und mehr Paare als Siedler einer Erdwand an. Hier höhlt sie sich in dem harten Erdreich regelmäßig in einer Höhe, daß auch die bedeutendste Überschwemmung nicht hinaufreicht, gern aber unmittelbar unter der Oberkante der Wand, mit vieler Mühe und Anstrengung tiefe Brutlöcher aus. »Es grenzt«, sagt Naumann, »ans Unglaubliche und muß unsere Bewunderung in hohem Grade erregen, ein so zartes Vögelchen mit so schwachen Werkzeugen ein solches Riesenwerk vollbringen zu sehen, und noch dazu in so kurzer Zeit; denn in zwei bis drei Tagen vollendet ein Paar die Aushöhlung einer im Durchmesser vorn vier bis sechs Zentimeter weiten, am hinteren Ende zur Aufnahme des Nestes noch mehr erweiterten, in wagerechter oder wenig aufsteigender Richtung mindestens einen, oft aber auch bis zwei Meter tiefen, gerade in das Ufer eindringenden Röhre. Ihr Eifer und ihre Geschäftigkeit bei einer solchen anstrengenden Arbeit grenzt ans Possierliche, besonders wenn man sieht, wie sie die losgearbeitete Erde höchst mühsam mit den Füßchen hinter sich aus dem Innern der Höhle hinausschaffen und hinausräumen und beide Gatten dabei hilfreich sich unterstützen. Warum sie aber öfters mitten in der Arbeit den Bau einer Röhre aufgeben, eine andere zwar fertig machen, aber dennoch nicht darin nisten und dies vielleicht erst in einer dritten tun, bleibt uns rätselhaft; denn zu Schlafstellen benutzt die ganze Familie gewöhnlich nur eine, nämlich die, worin sich das Nest befindet. Beim Graben sind sie sehr emsig, und die ganze Gesellschaft scheint dann aus der Gegend verschwunden; denn alle stecken in den Höhlen und arbeiten darin. Stampft man mit den Füßen oben auf den Rasen über den Höhlen, so stürzen sie aus den Löchern hervor, und die Luft ist wieder belebt von ihnen. Wenn die Weibchen erst brüten, sitzen sie noch viel fester und lassen sich nur durch Störung in der Röhre selbst bewegen, herauszufliegen, daher leicht fangen. Am hinteren Ende der Röhre, ungefähr einen Meter vom Eingang, befindet sich das Nest in einer backofenförmigen Erweiterung. Es besteht aus einer schlichten Lage seiner Hälmchen von Stroh, Heu und zarter Würzelchen, und seine Aushöhlung ist mit Federn und Haaren, auch wohl etwas Wolle ausgelegt, sehr weich und warm. In Höhlen, die sie in Steinbrüchen, an Felsengestaden oder alten Mauern finden, stehen die Nester sehr oft gar nicht tief, und sie können hier auch nicht so dicht nebeneinander nisten, wenn nicht zufällig Ritzen und Spalten genug da sind. An solchen Brüteplätzen hat dann freilich manches ein ganz anderes Aussehen, weil hier ein großer Teil ihres Kunsttriebes von Zufälligkeiten unterdrückt oder unnütz gemacht wird.«
Die Uferschwalbe ist ein sehr angenehmer, munterer, beweglicher Vogel, der in seinem Wesen vielfach an die Hausschwalbe erinnert. Dieser ähnelt sie namentlich wegen ihres sanften und schwebenden Fluges. Gewöhnlich hält sie sich in niederen Luftschichten auf, meist dicht über dem Spiegel der Gewässer hin- und herfliegend; selten erhebt sie sich zu bedeutenden Höhen. Ihr Flug ist so schwankend, daß man ihn mit dem eines Schmetterlings verglichen hat, aber durchaus nicht unsicher oder wechsellos. Die Stimme ist ein zartes, schwaches »Scherr« oder »Zerr«, der Gesang eine Aufeinanderfolge dieser Laute, die durch andere verbunden werden. Von ihren Ansiedelungen entfernt sich die Uferschwalbe ungern weit, betreibt ihre Jagd vielmehr meist in unmittelbarer Nähe derselben und belebt daher öde, sonst an Vögeln arme Ströme in anmutender Weise ebenso, wie ihre Nestlöcher in dem einförmigen Ufer jedes Auge fesseln. In zahlreichen Siedlungen fliegen vom Morgen bis zum Abend fast ununterbrochen Hunderte und selbst Tausende der kleinen, behenden Vögel auf und nieder, verschwinden in den Höhlen, erscheinen wiederum und treiben es wie zuvor. Vor dem Menschen scheuen sie sich hierbei wenig oder nicht; andern Vögeln oder Tieren gegenüber zeigen sie sich friedlich, aber furchtsam.
Erst spät im Frühjahr, gewöhnlich Anfang Mai, trifft die Uferschwalbe am Brutort ein und verläßt diesen bereits Anfang September wieder. Sofort nach ihrer Ankunft besucht sie die gewohnte Ansiedlung, bessert die Nester aus oder gräbt sich neue, und Ende Mai oder Anfang Juni findet man die fünf bis sechs kleinen, länglich eiförmigen, etwa siebzehn Millimeter langen, zwölf Millimeter dicken, dünnschaligen, reinweißen Eier im Nest; zwei Wochen später sind die Jungen ausgeschlüpft und wiederum zwei Wochen nachher bereits so weit erwachsen, daß sie den Alten ins Freie folgen können. Eine Zeitlang kehrt nun alt und jung noch regelmäßig zu den Nistlöchern zurück, um hier Nachtruhe zu halten; schon im August aber begibt sich die Gesellschaft auf die Reise und schläft dann im Röhrichte der Teiche. Nur wenn die erste Brut zu Grunde ging, schreitet das Pärchen noch einmal zur Fortpflanzung.
*
Die Purpurschwalbe ( Progne purpurea) ist die bekannteste, auch in Europa beobachtete Art der Sippe der Seglerschwalben ( Progne). Ihre Länge beträgt neunzehn, die Breite vierzig, die Fittichlänge vierzehn, die Schwanzlänge sieben Zentimeter. Das Gefieder ist gleichmäßig tief schwarzblau, stark purpurglänzend; die Schwingen und die Schwanzfedern sind schwärzlichbraun. Das Auge ist dunkelbraun, der Schnabel schwarzbraun, der Fuß purpurschwarz. Beim Weibchen ist der Kopf braungrau, schwarz gefleckt, die übrige Oberseite wie beim Männchen, jedoch etwas graulicher, der Länge nach schwarz gestreift.
Über das Leben der Purpurschwalbe haben die amerikanischen Forscher ausführlich berichtet; denn gerade dieser Vogel ist allgemeiner Liebling des Volkes, dem man nicht nur vollste Schonung angedeihen läßt, sondern den man auch durch Vorrichtungen mancherlei Art in der Nähe der Wohnungen zu fesseln sucht.
Nach Audubon erscheint sie in der Umgegend der Stadt New Orleans zwischen dem ersten und neunten Februar, gelegentlich wohl auch einige Tage früher, je weiter nördlich aber, um so später, so daß sie in Missouri nicht vor Mitte April, in Boston sogar erst gegen Anfang Mai eintrifft. In den nördlichen Vereinigten Staaten pflegt sie bis Mitte August zu verweilen und dann gemächlich dem Süden wieder zuzuwandern. Um die angegebene Zeit sammeln sie sich in Flügen von fünfzig bis hundert und mehr um die Spitze eines Kirchturmes oder um die Zweige eines großen, abgestorbenen Baumes und treten von hier aus gemeinschaftlich ihre Reise an.
Im allgemeinen ähnelt die Purpurschwalbe hinsichtlich ihres Fluges der Mehlschwalbe mehr als anderen; wenigstens kann der Flug mit dem der amerikanischen Rauchschwalbe nicht verglichen werden. Doch ist er immer noch schnell und anmutig genug und übertrifft den anderer Vögel, mit Ausnahme der Verwandten, bei weitem. Obgleich auch sie den größten Teil ihrer Geschäfte fliegend erledigt, im Fluge jagt oder jagend trinkt und sich badet, kommt sie doch auch oft zum Boden herab und bewegt sich hier, ungeachtet der Kürze ihrer Füße, mit ziemlichem Geschicke, nimmt wohl selbst ein Kerbtier von hier weg und zeigt sich sogar einigermaßen gewandt im Gezweige der Bäume, auf deren vorragenden Ästen sie sich oft niederläßt. Raubtieren gegenüber betätigt sie mindestens dieselbe, wenn nicht noch größere Keckheit als unsere Rauchschwalbe, verfolgt namentlich Katzen, Hunde, Falken, Krähen und Geier mit größtem Eifer, fällt vorüberfliegende Raubvögel mit Ingrimm an und plagt sie so lange, bis sie dieselben aus der Umgebung ihres Nestes vertrieben hat. Der Gesang ist nicht gerade klangreich, jedoch ansprechend. Das Gezwitscher des Männchens, das dieses zu Ehren seines Weibchens hören läßt, unterhält und erfreut auch deshalb, weil es zuerst mit am Morgen gehört wird und gewissermaßen ein Willkomm des Tages ist. Selbst der Indianer ergötzt sich an dem Vogel, und auch er sucht ihn deshalb in der Nähe seiner Hütte zu fesseln.
In den meisten Staaten Mittelamerikas errichtet man der Purpurschwalbe, welche fern vom Menschen ihr Nest in Baumhöhlungen anlegt, eigene Wohnungen nach Art unserer Starkästen oder hängt ihr ausgehöhlte und mit einem Eingangsloche versehene Flaschenkürbisse an die Bäume auf. Diese nimmt sie gern in Besitz, vertreibt aber, wie unser Segler, auch andere Höhlenbrüter aus denselben und duldet überhaupt in der Nähe ihrer Behausung keinen anderen Vogel, der unter ähnlichen Umständen nistet wie sie. In den mittleren Staaten brütet sie zum ersten Male Ende April. Das Nest besteht aus dürren Zweigen mancherlei Art, aus Gräsern, grünen und trockenen Blättern, Federn und dergleichen. Das Gelege enthält vier bis sechs etwa dreiundzwanzig Millimeter lange, neunzehn Millimeter dicke, reinweiße Eier. Ende Mai ist die erste Brut flügge, Mitte Juli die zweite; in Louisiana und andern südlichen Staaten wird wohl auch noch eine dritte herangezogen. Das Männchen hilft brüten und ist überhaupt außerordentlich aufmerksam gegen seine Gattin, schlüpft aus und ein und sitzt zwitschernd und singend stundenlang vor dem Eingange. Wenn sich Gelegenheit zum Brüten für mehrere Paare findet, herrscht unter diesen vollständigste Eintracht.
*
Die Fliegenfänger ( Muscicapidae) bevölkern mit Ausnahme Amerikas alle Erdteile, besonders zahlreich die Gleicherländer, bewohnen die Waldungen und Baumpflanzungen, leben mehr auf Bäumen als im Gebüsch und kommen selten auf den Boden herab. Auf einem möglichst freien Aste sitzend, der weite Umschau gewährt, spähen sie nach Kerbtieren, fliegen denselben gewandt nach, nehmen sie mit dem Schnabel auf und kehren hierauf gewöhnlich auf ihren Stand zurück. Bei schlechtem Wetter, namentlich wenn sie Junge zu versorgen haben, pflücken sie auch Beeren. Sie sind fast den ganzen Tag über in Tätigkeit, munter, unruhig und behend, angesichts des Menschen wenig scheu, Raubvögeln gegenüber kühn und dreist. Abweichend von verwandten Vögeln lassen sie ihre Stimme selten vernehmen, am häufigsten selbstverständlich während der Paarungszeit, die die Männchen sogar zu einem, wenn auch sehr einfachen und leisen Gesange begeistert. Das Nest, ein lockerer, roh zusammengefügter, aber warm ausgefütterter Bau, wird entweder in Baumhöhlen oder zwischen Astgabeln, gewöhnlich mehr am Stamme, angelegt. Das Gelege enthält vier bis fünf Eier, die von beiden Eltern ausgebrütet werden. Nachdem die Jungen groß geworden, schweifen die Eltern noch eine Zeitlang mit ihnen umher; hierauf treten sie, sehr frühzeitig im Jahre, ihre Winterreise an, die sie bis in die Urwaldungen Mittelafrikas führt und erst im Spätfrühjahr endet.
Der Fliegenfänger oder Fliegenschnäpper ( Muscicapa grisola) unterscheidet sich von den Familienverwandten einzig und allein durch den etwas gestreckten Schnabel und das beiden Geschlechtern gemeinsame, gefleckte Kleid. Die Oberseite ist tiefgrau, der Schaft jeder Feder schwarz, der Scheitel schwarzgrau, etwas lichter gefleckt, jede Feder weiß oder tiefgrau gekantet, wodurch eine leichte Fleckenzeichnung entsteht; die ganze Unterseite ist schmutzigweiß, auf den Seiten der Brust rostgelblich überflogen, an den Kehlseiten und längs der Brust mit tiefgrauen, verwaschenen Längsflecken gezeichnet; die lichtgrauen Spitzenkanten an den Schwingendeckfedern bilden zwei wenig hervortretende Flügelbinden. Das Auge ist braun, Schnabel und Füße sind schwarz. Beim Weibchen sind alle Farben blasser; beim Jungen ist die Oberseite weißlich und grau gepunktet und braun und rostgelb getüpfelt, die Unterseite weißlich, in der Gurgelgegend und auf der Brust grau quer gefleckt. Die Länge des Männchens beträgt vierzehn, die Breite fünfundzwanzig, die Fittichlänge acht, die Schwanzlänge sechs Zentimeter.
Mit Ausnahme der nördlichsten Länder Europas bewohnt der Fliegenfänger alle Breiten- und Höhengürtel unseres heimatlichen Erdteils. In Südeuropa ist er gemein; nach Osten hin verbreitet er sich bis zum Kaukasus und Altai; gelegentlich seiner Winterreise wandert er bis in die Waldungen Innerafrikas; ich habe ihn noch recht häufig in den Wäldern am Blauen Nil gesehen. Er ist durchaus nicht wählerisch, sondern nimmt mit jedem Busche vorlieb, der nur einigermaßen seinen Ansprüchen genügt. Hohe Bäume, namentlich solche, die am Wasser stehen, bieten ihm alles zu seinem Leben Erforderliche. Das Treiben des Menschen scheut er nicht, siedelt sich deshalb häufig inmitten der Dorfschaften, ja selbst eines Gehöftes an, haust aber auch ebensogut an Orten, die der Mensch nur selten besucht. Das Wohngebiet eines Paares beschränkt sich oft auf einen Hektar, unter Umständen sogar auf einen noch geringeren Raum. Je nachdem die Witterung günstig oder ungünstig ist, erscheint er Ende April oder Anfang Mai, gewöhnlich paarweise, schreitet bald nach seiner Ankunft zur Fortpflanzung und verläßt uns wieder Ende August oder Anfang September. Genau dasselbe gilt für Südeuropa: in Spanien beobachteten wir ihn auch nicht früher und nicht länger als in Deutschland.
Der Fliegenfänger ist ein sehr munterer und ruheloser Vogel, der den ganzen Tag über auf Beute auslugt. In der Höhe eines Baumes oder Strauches auf einem dürren Aste oder anderweitig hervorragender Zweigspitze sitzend, schaut er sich nach allen Seiten um, wippt ab und zu mit dem Schwanze und wartet, bis ein fliegendes Kerbtier in seine Nähe kommt. Sobald er dasselbe erspäht hat, fliegt er ihm nach, fängt es mit vieler Geschicklichkeit, wobei man deutlich das Zusammenklappen des Schnabels hört, und kehrt auf dieselbe Stelle, von der er ausflog, zurück. Sein Flug ist schön, ziemlich schnell, oft flatternd mit wechselweise stark ausgebreiteten und dann wieder sehr zusammengezogenen Schwingen und Schwanz. Im Gezweige der Bäume hüpft er nicht umher, und ebensowenig kommt er zum Boden herab. Seine Stimmittel sind sehr gering. Der Lockton ist ein langweiliges »Tschi tschi«, der Ausdruck der Zärtlichkeit ein verschieden hervorgestoßenes »Wistet«, der Angstruf ein klägliches »Tschireckteckteck«, das mit beständigem Flügelschlagen begleitet wird, der Gesang ein leises, zirpendes Geschwätz, das der Hauptsache nach aus dem Lockton besteht und nur durch die verschiedenartige Betonung desselben etwas abändert.
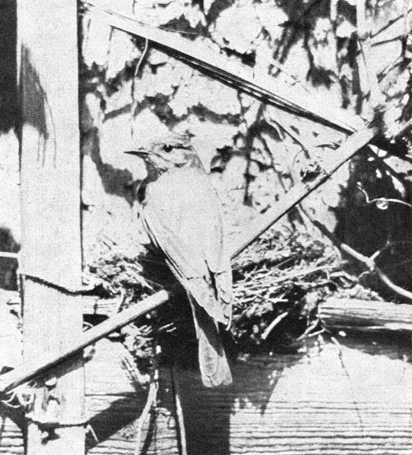
Fliegenfänger ( Muscicapa grisolo)
Fliegende Kerbtiere mancherlei Art, vor allem Fliegen, Mücken, Schmetterlinge, Libellen und dergleichen, bilden seine Nahrung. Ist die erlangte Beute klein, so verschluckt er sie ohne weiteres; ist sie größer, so stößt er sie vor dem Verschlingen gegen den Ast, bis er Flügel und Beine abgebrochen hat. Bei schöner Witterung erlangt er seine Nahrung mit spielender Leichtigkeit, bei Regenwetter muß er, wie die Schwalben, oft Not leiden. Dann sieht man ihn ängstlich Bäume umflattern und nach Fliegen spähen, kann auch beobachten, wie er, immer fliegend, die glücklich entdeckte Fliege oder Mücke von ihrem Sitzplatz wegnimmt oder sich, namentlich zugunsten seiner Jungen, sogar entschließt, Beeren zu pflücken. Die Jungen, die an Regentagen dürftig hingehalten werden, sitzen hungernd und klagend auf den Zweigen, die Eltern umflattern Häuser, Bäume, auch wohl größere, Fliegen herbeiziehende Säugetiere, kommen mit leerem Schnabel in die Nähe beerentragender Gebüsche, beispielsweise Johannisbeersträucher, stürzen sich in einem Bogen von oben nach unten nieder, reißen eine Beere von der Traube ab und tragen diese sofort den Jungen zu. Dies wiederholt sich mehrmals während weniger Minuten; vorher aber sehen sie sich immer erst nach Kerfen um, und man bemerkt leicht, daß ihnen Beeren nur ein schlechter Notbehelf sind.
Einzelne Fliegenfänger sieht man selten, Familien nur dann, wenn die Jungen eben ausgeflogen sind und noch von den Alten gefüttert werden; denn das Pärchen, und insbesondere das Männchen, verteidigt das einmal erkorene Gebiet eifersüchtig und hartnäckig gegen jeden Eindringling derselben Art. Kleinen und harmlosen Vögeln gegenüber zeigt es sich höchst friedfertig, größere, die ihm und namentlich dem Neste gefährlich werden könnten, verfolgt es mit Mut und Kühnheit.
Wenn das Paar nicht gestört wird, brütet es nur einmal im Jahre. Das Nest steht an sehr verschiedenen Stellen, wie sie dem Aufenthalt des Vogels entsprechen, am liebsten auf abgestutzten, niederen Bäumen, namentlich alten Weidenköpfen, sonst auf kleinen Zweigen dicht am Schafte eines Baumes, zwischen Obstgeländern, auf einem Balkenkopfe unter Dächern, in weiten Baumhöhlen, Mauerlöchern, nach Liebes Erfahrungen auch in Schwalbennestern, wird aus trockenen, feinen Wurzeln, grünem Moos und ähnlichen Stoffen zusammengetragen, innen mit Wolle, einzelnen Pferdehaaren und Federn ausgefüttert und sieht immer unordentlich aus. Anfang Juni sind die vier bis fünf achtzehn Millimeter langen, dreizehn Millimeter dicken, auf blaugrünlichem oder lichtblauem Grunde mit hellrostfarbigen Flecken gezeichneten, aber vielfach abändernden Eier vollzählig und werden nun, abwechselnd vom Männchen und Weibchen, binnen vierzehn Tagen ausgebrütet. Die Jungen wachsen rasch heran, brauchen aber lange Zeit, bevor sie selbst ordentlich im Fluge fangen können.
Katzen, Marder, Ratten, Mäuse und nichtswürdige Buben zerstören oft das Nest des Fliegenfängers, rauben die Eier oder töten die Brut. Die alten Vögel hingegen scheinen wenig von Feinden behelligt zu werden. Der vernünftige Mensch gewährt ihnen nachdrücklichst seinen Schutz. Der Fliegenfänger gehört, wie alle verwandten Vögel, zu den nützlichsten Geschöpfen und leistet durch Wegfangen der lästigen Kerfe gute Dienste. Eigentlich schädlich wird er nie, obgleich er zuweilen eine Drohne wegfängt. In der Gefangenschaft ist er unterhaltend und auch deshalb, mehr aber als Fliegenjäger, sehr beliebt.
Der Trauerfliegenfänger ( Muscicapa atricapilla) ist im Hochzeitskleide auf der ganzen Oberseite tief schwarzgrau, einfarbig oder mehr oder weniger deutlich schwarz gefleckt; die Stirn, die ganze Unterseite und ein Schild auf den Flügeln, gebildet durch die drei letzten Handschwingen, die Außenfahne der Schulterfedern und die Armdecken sind weiß. Das Weibchen ist oben braungrau, unten schmutzigweiß; seine Vorderschwingen sind einfach schwarzbraun, die drei hintersten weiß gesäumt, die drei äußersten Schwanzfedern auf der Außenfahne weiß. Sehr ähnlich sehen die Jungen aus. Das Auge ist dunkelbraun, Schnabel und Füße sind schwarz. Die Länge beträgt einhundertdreißig, die Breite zweihundertdreißig, die Fittichlänge fünfundsiebzig, die Schwanzlänge fünfundfünfzig Millimeter.
Der merklich größere Halsbandfliegenfänger ( Muscicapa collaris) ist oft mit dem Trauervogel verwechselt worden, und die Weibchen beider Arten sind auch in der Tat schwer zu unterscheiden. Das alte Männchen des letztgenannten erkennt man an seinem weißen Halsbande; dem Weibchen fehlen die lichten Säume an den Schwungfedern. Die Länge beträgt einhundertsechsundfünfzig, die Breite zweihundertvierundfünfzig, die Fittichlänge vierundachtzig, die Schwanzlänge fünfundfünfzig Millimeter.
Der Trauervogel bewohnt alle Länder Europas südlich von Großbritannien und dem mittleren Skandinavien und wandert im Winter durch Kleinasien, Palästina und Nordafrika bis in die Waldländer jenseit des Wüstengürtels; der Halsbandfliegenfänger dagegen bevölkert mehr den Süden unseres Erdteils, namentlich Italien und Griechenland, verbreitet sich von dort aus bis an das südöstliche Deutschland, gehört im Norden unseres Vaterlandes zu den Seltenheiten und wandert etwa ebensoweit wie der Verwandte. Diesen sieht man bei uns zulande in allen ebenen Gegenden, wenigstens während seines Zuges. Er trifft in der letzten Hälfte des April bei uns ein und zieht Ende August und Anfang September wieder von uns weg. Die Männchen pflegen eher zu erscheinen als die Weibchen und uns früher zu verlassen.
Im Betragen scheinen sich die beiden so nahe verwandten Arten nicht zu unterscheiden. Die Trauerfliegenfänger sind muntere, gewandte Vögel, die sich während des ganzen Tages bewegen und auch dann, wenn sie auf einem Zweige ruhen, noch mit dem Flügel zucken oder mit dem Schwanz auf und nieder wippen. Nur wenn das Wetter sehr ungünstig ist, sitzen sie traurig und still auf einer und derselben Stelle; bei günstiger Witterung dagegen betätigen sie ihre ungemein heitere Laune, flattern munter von Zweig zu Zweig, erheben sich spielend in die Luft, necken sich harmlos mit ihresgleichen, lassen ihre sanfte, kurz abgebrochene Lockstimme, ein angenehmes »Pittpitt« oder »Wettwett«, häufig vernehmen und begleiten jeden Laut mit einer entsprechenden Flügel- und Schwanzbewegung. Im Frühjahr singt das Männchen fleißig und gar nicht schlecht. Der einfache, schwermütig klingende Gesang erinnert einigermaßen an den des Gartenrotschwanzes. Eine Strophe, die hell pfeifend wie »Wutiwutiwu« klingt, ist besonders bezeichnend. Der Trauerfliegenfänger beginnt schon lange vor Sonnenaufgang, wenn die meisten Stimmen anderer Waldsänger noch schweigen, und wird dadurch dem, der ihn hört, um so angenehmer. Der Ruf des Halsbandfliegenfängers ist ein gedehntes »Zieh«, der Lockton ein einfaches »Tak«, der Gesang laut und abwechselnd, aus den Gesängen anderer Vögel entlehnt, dem des Blaukehlchens, durch mehrere hervorgewürgte Töne dem des Rotschwanzes ähnlich. Der Flug ist schnell, gewandt und, wenn er länger fortgesetzt wird, wellenförmig, der Gang auf dem Boden ebenso schwerfällig wie bei irgendeinem dieser kaum gehfähigen Vögel.
Beide Fliegenfänger jagen derselben Beute nach wie ihr gefleckter Verwandter, beide jagen in der gleichen Weise, und beide fressen im Notfall Beeren. Bei trübem Wetter durchflattern sie die Baumkronen und nehmen fliegend die sitzenden Kerfe von den Blättern weg; bei günstiger Witterung erheben sie sich oft hoch in die Luft, um eine erspähte Fliege, Mücke, Schnake, Bremse, einen Schmetterling, eine Heuschrecke usw. aufzunehmen; selbst vom Boden erheben sie zuweilen ein Kerbtier, aber auch dies geschieht nur fliegend. Wie alle Vögel, die sich viel bewegen, sind sie sehr gefräßig und deshalb fast ununterbrochen in Tätigkeit.
Laubwaldungen, in denen alte, hohe und teilweise hohle Bäume stehen, sind die liebsten Brutorte der Trauerfliegenfänger. Sie suchen sich hier eine passende Höhlung und füllen diese liederlich mit Moos und feinen Wurzeln aus, die innen durch Federn, Wolle, Haare eine sorgfältig geordnete Ausfütterung erhalten. In Ermangelung solcher Höhlen bauen sie ihr Nest auch wohl in dicht verworrene Zweige nahe am Schaft oder auf alte Baumstümpfe. Das Gelege besteht aus fünf bis sechs achtzehn Millimeter langen, dreizehn Millimeter dicken, zartschaligen, blaß grünspanfarbigen Eiern, die von beiden Geschlechtern abwechselnd bebrütet werden. Im Verlaufe von etwa vierzehn Tagen sind die Eier gezeitigt, in weiteren drei Wochen die Jungen ausgeflogen; sie werden dann aber noch lange Zeit von den Eltern geführt und geleitet. In Gegenden, in denen die Trauerfliegenfänger regelmäßig brüten, kann man sie durch zweckmäßig eingerichtete Nistkästchen in bestimmten Gärten oder Baumpflanzungen festhalten, und sie werden dann oft überraschend zahm. »Ein Trauerfliegenfänger«, erzählt Baldamus, »der in einem Nistkasten meines Gartens brütete, hatte sich durch mein öfter wiederholtes Beobachten seiner Brutgeschäfte dermaßen an außergewöhnliche Störungen gewöhnt, daß er ruhig auf dem Neste sitzenblieb, wenn ich den Kasten in die Stube brachte und den Deckel abnahm, um das trauliche Tierchen zu zeigen.«
Trauerfliegenfänger werden gern im Käfig gehalten, zählen auch zu den angenehmsten Stubenvögeln und erfreuen ebensowohl durch ihr zahmes und artiges Wesen, wie durch ihren Gesang. Wenn man sie frei im Zimmer umherfliegen läßt, säubern sie dasselbe gründlich von Fliegen und Mücken und werden so zahm, daß sie ihrem Pfleger die vorgehaltenen Fliegen aus der Hand nehmen.
In Deutschland verfolgt die nützlichen Vögel glücklicherweise niemand; in Italien findet leider das Gegenteil statt. Während des Herbstzuges lauern hier vornehm und gering mit allerlei Netzen und Fallen auch auf sie, und leider ist ihr Fang nur zu ergiebig. Auf jedem Markt sieht man während der Zugzeit Hunderte dieser Vögel, die meuchlings gemordet wurden, um die abscheuliche Schleckerei zu befriedigen. Es wird erzählt, daß ehedem auf der Insel Cypern die so erbeuteten Fliegenfänger und ähnliche Vögel mit Weinessig und Gewürz eingemacht und in besonderen Töpfen oder Fässern verpackt wurden. Solche Gefäße sollen zu Hunderten nach Italien versandt worden sein. Gegenwärtig scheint man sich nicht mehr so viel Mühe zu geben, der alte Unfug aber steht noch in voller Blüte.
Im Osten und Südosten unseres Vaterlandes lebt noch ein Mitglied der Familie, der Zwergfliegenfänger ( Muscicapa parva), eines der anmutigsten Vögelchen, die überhaupt in Deutschland vorkommen. Das alte Männchen ähnelt im Frühjahr in der Farbenverteilung unserem Rotkehlchen. Die Oberseite ist rötlichbraungrau, auf dem Scheitel, dem Oberrücken und den Oberschwanzdeckfedern etwas dunkler, auf den großen Flügeldeckfedern und den hinteren Schwingen lichter gekantet; Kinn, Kehle, Gurgel, Kropf und Oberbrust sind roströtlich, die übrigen Unterteile trübweiß, die Handschwingen schwarzbraungrau, lichter gesäumt. Bei jüngeren Männchen ist das Rotgelb der Kehle blasser als bei alten. Die Weibchen unterscheiden sich durch düstere, mehr grauliche Farben von den Männchen. Das Auge ist dunkelbraun, der Schnabel und die Füße sind schwarz. Die Länge beträgt zwölf, die Breite zwanzig, die Fittichlänge sieben, die Schwanzlänge fünf Zentimeter.
Ungeachtet aller bisherigen Forschungen kann der Verbreitungskreis des Zwergfliegenfängers noch nicht mit Sicherheit angegeben werden. Er tritt selten im Westen, häufiger im Osten Europas auf, verbreitet sich über ganz Mittelasien bis Kamtschatka und besucht auf seinem Winterzuge Südchina, Formosa und Indien, vielleicht auch Nordafrika, ist in vielen Ländern, in denen er höchstwahrscheinlich ebenfalls lebt, jedoch noch nicht nachgewiesen worden. Man hat ihn einzeln in fast allen Gegenden unseres Vaterlandes beobachtet und überall, aber als große Seltenheit, verzeichnet; es ist jedoch wahrscheinlich, daß er viel öfter vorkommt, als man annimmt. In Mecklenburg scheint er nicht besonders selten zu sein; in der Mark und in Pommern brütet er regelmäßig; in Polen, Galizien und Ungarn ist er stellenweise sogar häufig. Aber der Zwergfliegenfänger gehört durchaus nicht zu den auffallenden Vögeln, und der, der ihn entdecken will, muß ein geübter Beobachter sein. Waldungen mit hochstämmigen Buchen bilden seinen bevorzugten Aufenthalt. »Da, wo Edeltannen mit Rotbuchen im bunten Gemische stehen und diese Bäume ihre üppigen Zweige in hellgrünen und dunklen Farben durcheinander weben, kurz da, wo die Sonne nur sparsam ihre Strahlen bis auf den Untergrund des Bodens sendet, und wo unter dem grünen Dach ein eigentümliches, heiliges Dunkel herrscht, da«, sagt Alexander von Homeyer, »ist unser Vögelchen zu Hause.« Hier lebt er hauptsächlich in den Kronen der Bäume und kommt nur gelegentlich in die Tiefe herab. Lieblingswohnsitze von ihm sind Baumgruppen, die von dichtem Aufschlage jüngerer Bäume, begrenzt werden; denn in den Dickichten sucht er bei ungünstiger Witterung und namentlich bei starkem Winde erwünschte Zuflucht. In der Nähe bewohnter Gebäude findet er sich nur ausnahmsweise ein; er ist so recht ein eigentlicher Bewohner des stillen Waldes.
»Der Zwergfliegenfänger«, schildert gestaltsam Alexander von Homeyer, »treibt sich auf dürren Zweigen dicht unter dem grünen Blätterdache, in einer Höhe von ungefähr dreizehn bis achtzehn Meter über dem Boden, mit besonderer Vorliebe umher. Er hat nur ein kleines Gebiet; innerhalb desselben aber gibt es keine Ruhe, wie man sie sonst wohl von einem Fliegenfänger erwarten dürfte. Unser Vogel erhascht im Fluge ein Kerbtier, setzt sich zehn Schritte weiter auf einen Ast, klingelt sein Lied, fliegt sofort weiter, nimmt einen kriechenden Kerf vom benachbarten Stamme für sich in Beschlag, sich dabei vielleicht ein wenig nach unten senkend, und steigt dann fliegend wieder bis unter das grüne Dach der Baumkronen empor. Hier singt er abermals, um sich gleich darauf um sechs Meter gegen den Boden herabzustürzen, dem brütenden Weibchen einen Besuch abzustatten und, wenn dies geschehen, sich wieder aufwärts zu schwingen. So geht es den ganzen Tag über. Am regsten und fleißigsten im Singen ist er frühmorgens bis zehn Uhr; mittags bis gegen drei Uhr rastet er; abends, bis Sonnenuntergang, aber ist er in derselben fröhlichen Weise tätig wie am Morgen.« Der Lockton, ein lauter Pfiff, der dem »Füit« unseres Gartenrotschwanzes ähnelt, wird häufig in den Gesang verflochten. Dieser besteht aus einer Hauptstrophe, die sich durch die Reinheit der Töne auszeichnet. Baldamus bezeichnet sie durch die Silben »Tink, tink, tink ei – da, ei – da, ei – da« etc. Nach Alexander von Homeyer ist der Gesang »ein munteres, glockenreines Liedchen, das jeden kundigen Hörer überrascht, bezaubert und erfrischt, am meisten an den Schlag des Waldlaubsängers erinnert, denselben jedoch an Mannigfaltigkeit und Klangfülle übertrifft, so daß letzterer da, wo beide Vögel zusammenleben, vollständig in den Hintergrund tritt«. Der Warnungston ist ein gezogenes »Zirr« oder »Zee«. Die Jungen rufen »Sisir«.
Da der Zwergfliegenfänger ebenfalls spät im Jahre bei uns eintrifft und schon ziemlich frühzeitig wieder wegzieht, fällt die Brutzeit erst in die letzten Frühlingsmonate. Das Nest steht entweder in Baumhöhlen oder auf Gabelästen, oft weit vom Stamme. Feine Würzelchen, Hälmchen, grünes Moos oder graue Flechten bilden den Außenbau; das Innere ist mit Wolle und anderen Tierhaaren ausgekleidet. Das Gelege besteht aus vier bis fünf Eiern, die sechzehn Millimeter lang, zwölf Millimeter dick und denen unseres Rotkehlchens ähnlich, das heißt auf blaugrünlichweißem Grunde mit hell rostfarbigen, mehr oder weniger verschwommenen und verwaschenen Flecken ziemlich gleichmäßig gezeichnet sind. Beide Geschlechter wechseln im Brüten ab, und beide lieben ihre Brut außerordentlich. Das Weibchen ist beim Nestbau am tätigsten und wie gewöhnlich beim Brüten am eifrigsten; das Männchen hält sich jedoch als treuer Wächter fortwährend in der Nähe des Nestes auf, sorgt durch fleißiges Singen für Unterhaltung der Gattin und warnt diese wie später die Jungen bei Gefahr. Bald nach dem Ausfliegen werden letztere den Dickichten zugeführt, und von Stunde an verändert sich das Wesen der Eltern: sie verhalten sich ebenso still und ruhig, als sie früher laut und lebendig waren. Wahrscheinlich tritt die Familie schon früh im Jahre die Winterreise an.
Gefangene Zwergfliegenfänger stehen ihres schmucken Aussehens, ihrer Beweglichkeit und leichten Zähmbarkeit halber bei allen Liebhabern in Gunst.
*
Der Seidenschwanz, Seidenschweif, Kreuz-, Sterbe- oder Pestvogel, Winterdrossel ( Ampelis garrulus), Vertreter einer gleichnamigen Familie ( Ampelidae), ist ziemlich gleichmäßig rötlichgrau, auf der Oberseite wie gewöhnlich dunkler als auf der Unterseite, die in Weißgrau übergeht; Stirn und Steißgegend sind rötlichbraun, Kinn, Kehle, Zügel und ein Streifen über dem Auge schwarz, die Handschwingen grauschwarz, an der Spitze der äußeren Fahne licht goldgelblich gefleckt, an der inneren Fahne weiß gekantet; die Armschwingen enden in breite horn- oder pergamentartige Spitzen von roter Färbung; die Steuerfedern sind schwärzlich, an der Spitze licht goldgelb; auch sie endigen in ähnlich gestaltete und gleich gefärbte Spitzen wie die Armschwingen. Bei dem Weibchen sind alle Farben unscheinbarer und namentlich die Hornplättchen weniger ausgebildet. Die Jungen sind dunkelgrau, viele ihrer Federn seitlich licht gerandet; die Stirne, ein Band vom Auge nach dem Hinterkopfe, ein Strich längs der bleich rostgelben Kehle und der Unterbürzel sind weißlich, die Unterschwanzdeckfedern schmutzig rostrot. Die Länge beträgt zwanzig, die Breite fünfunddreißig, die Fittichlänge zwölf, die Schwanzlänge sechs Zentimeter.

Seidenschwanz ( Ampelis garrulus)
Unser Seidenschwanz gehört dem Norden Europas, Asiens und Amerikas an. Die ausgedehnten Waldungen im Norden unseres Erdteiles, die entweder von der Fichte allein oder von ihr und der Birke gebildet werden, sind als seine eigentliche Heimat anzusehen; sie verläßt er nur dann, wenn bedeutender Schneefall ihn zur Wanderung treibt. Streng genommen hat man ihn als Strichvogel anzusehen, der im Winter innerhalb eines beschränkten Kreises hin- und herstreicht, von Nahrungsmangel gezwungen, die Grenzen des gewöhnlich festgehaltenen Gebietes überschreitet und dann auch zum Wandervogel wird. In allen nördlich von uns gelegenen Ländern ist er eine viel regelmäßigere Erscheinung als in Deutschland. Schon in den russischen und polnischen Wäldern oder in den Waldungen des südlichen Skandinavien findet er sich fast in jedem Winter ein. Bei uns zulande erscheint er so unregelmäßig, daß das Volk eine beliebte Zahl auch aus ihn angewandt hat und behauptet, daß er nur alle sieben Jahre einmal sich zeige. In der Regel treffen die vom nordischen Winter vertriebenen Seidenschwänze erst in der letzten Hälfte des November bei uns ein und verweilen bis zur ersten Hälfte des März; ausnahmsweise aber geschieht es, daß sie sich schon früher einstellen, und ebenso, daß sie noch länger bei uns sich gefallen. Dies ist denn auch der Grund gewesen, daß man geglaubt hat, einzelne Paare hätten bei uns genistet, während wir jetzt genau wissen, daß die Nistzeit des Seidenschwanzes erst in das Spätfrühjahr fällt.
Während ihres Fremdenlebens in südlicheren Gegenden, also auch bei uns, sind die Seidenschwänze stets zu mehr oder minder zahlreichen Gesellschaften vereinigt und halten sich längere oder kürzere Zeit in einer bestimmten Gegend auf, je nachdem dieselbe ihnen reichlichere oder spärlichere Nahrung gibt. Es kommt vor, daß man sie in dem einen Winter da, wo sie sonst sehr selten erscheinen, wochen-, ja selbst monatelang in großer Menge antrifft, und wahrscheinlich würde dies noch viel öfter geschehen, glaubte sich nicht jeder Bauer berechtigt, seine erbärmliche Jagdwut an diesen harmlosen Geschöpfen auszulassen; die Schönheit derselben erscheint, wie man meinen möchte, dem ungebildeten, rohen Menschen so unverständlich, daß er nichts anderes zu tun weiß, als sie zu vernichten. Möglich ist freilich, daß die beklagenswerten Vögel noch unter den Nachwirkungen eines alten Aberglaubens zu leiden haben. In früheren Jahren wußte man sich das unregelmäßige Erscheinen der Seidenschwänze nicht zu erklären, sah sie als Vorausverkündiger schwerer Kriege, drückender Teuerung, verschiedener Seuchen und anderer Landplagen an und glaubte, sie deshalb hassen und verfolgen zu dürfen.
Der Seidenschwanz gehört nicht zu den bewegungslustigen Wesen, ist vielmehr ein träger, fauler Gesell, der nur im Fressen Großes leistet, und entschließt sich deshalb ungern, den einmal gewählten Platz zu verlassen. Deshalb zeigt er sich da, wo er Nahrung findet, sehr dreist oder richtiger einfältig, erscheint zum Beispiel mitten in den Dörfern oder selbst in den Anlagen der Städte und bekümmert sich nicht im geringsten um das Treiben der Menschen um ihn her. Aber er ist keineswegs so unverständig, wie es im Anfange scheinen will; denn wiederholte Verfolgung macht auch ihn vorsichtig und scheu. Andern Vögeln gegenüber benimmt er sich verträglich oder gleichgültig: er bekümmert sich auch um sie nicht. Mit seinesgleichen lebt er, solange er in der Winterherberge verweilt, in treuer Gemeinschaft. Gewöhnlich sieht man die ganze Gesellschaft auf einem und demselben Baume, möglichst nahe nebeneinander, viele auf einem und demselben Zweige, die Männchen vorzugsweise auf den Spitzen der Kronen, solange sie hier verweilen, unbeweglich auf einer und derselben Stelle sitzen. In den Morgen- und Abendstunden sind sie regsamer, fliegen nach Nahrung aus und besuchen namentlich alle beerentragenden Bäume oder Gesträuche. Zum Boden herab kommen sie höchstens dann, wenn sie trinken wollen, hüpfen hier unbehilflich umher und halten sich auch nie längere Zeit in der Tiefe auf. Im Gezweige klettern sie, wenn sie fressen wollen, gemächlich auf und nieder. Der Flug geschieht in weiten Bogenlinien, ist aber leicht, schön und verhältnismäßig rasch, die Flügel werden abwechselnd sehr geschwind bewegt und ausgebreitet. Die gewöhnliche Lockstimme ist ein sonderbar zischender Triller, der sich durch Buchstaben nicht versinnlichen läßt. Mein Vater sagt, daß der Lockton wie das Schnarren eines ungeschmierten Schubkarrens klinge, und dieser Vergleich scheint mir gut gewählt zu sein. Außer dem Locktone vernimmt man zuweilen noch ein flötendes Pfeifen, das, wie Naumann sich ausdrückt, gerade so klingt, als wenn man sanft auf einem hohlen Schlüssel bläst; dieser Laut scheint zärtliche Gefühle zu bekunden. Der Gesang ist leise und unbedeutend, wird aber mit Eifer und scheinbar mit erheblicher Anstrengung vorgetragen. Die Weibchen singen kaum minder gut oder nicht viel weniger schlecht, wenn auch nicht so anhaltend als die Männchen, die im Winter jeden freundlichen Sonnenblick mit ihrem Liede begrüßen und fast das ganze Jahr hindurch sich hören lassen.
In seiner Heimat dürften während des Sommers die aller Beschreibung spottenden Mückenschwärme die hauptsächlichste, falls nicht ausschließliche Nahrung des Seidenschwanzes bilden; im Winter dagegen muß er sich mit anderen Nahrungsstoffen, zumal Beeren, begnügen. Die Kerbtierjagd betreibt er ganz nach Art der Fliegenfänger; die Beeren liest er gemächlich von den Zweigen ab, zuweilen auch wohl vom Boden auf. Auffallend ist, daß die Gefangenen sich um Kerbtiere, die ihnen vorgeworfen werden, nicht kümmern. Wahrhaft widerlich wird der Seidenschwanz wegen seiner außerordentlichen Freßgier. Er verzehrt täglich eine Nahrungsmenge, die fast ebensoviel wiegt als sein Leib. Gefangene bleiben stets in der Nähe des Futternapfes sitzen, fressen und ruhen abwechselnd, um zu verdauen, geben das Futter nur halbverdaut von sich und verschlingen, räumt man ihren Gebauer nicht immer sorgfältig aus, den eigenen Unrat wieder.
Bis 1857 war das Fortpflanzungsgeschäft des Seidenschwanzes gänzlich unbekannt. Erst in diesem Jahre, am sechzehnten Juni, gelang es Wolley, Nest und Ei aufzufinden; die Entdeckung war jedoch schon im vorigen Jahre von seinen Jagdgehilfen gemacht worden. Wolley hatte sich vorgenommen, ohne dieses Nest nicht nach England zurückzukehren, und weder Mühe noch Kosten gescheut, um sein Ziel zu erreichen. Nachdem die ersten Nester gefunden worden waren, legte sich, wie es scheint, die halbe Bewohnerschaft Lapplands auf das Suchen, und schon im Sommer 1853 sollen über sechshundert Eier eingesammelt worden sein. Die Nester stehen regelmäßig auf Fichten, nicht allzu hoch über dem Boden, wohl im Gezweige verborgen, sind größtenteils aus Baumflechten gebaut, in ihre Außenwand einige dürre Fichtenzweige eingewebt, innen mit Grashalmen und einigen Federn gefüttert. Das Gelege besteht aus vier bis sieben, gewöhnlich aber aus fünf Eiern, und ist in der zweiten Woche des Juni vollzählig. Die Eier sind etwa vierundzwanzig Millimeter lang, achtzehn Millimeter dick und auf bläulich oder rötlich blauweißem Grunde spärlich, am Ende dichter, kranzartig, mit dunkel- und hellbraunen, schwarzen und violetten Flecken und Punkten bestreut.
Auf dem Vogelherde oder in den Dohnen berückt man den Seidenschwanz ohne Mühe. Im Käfige ergibt er sich, ohne Kummer zu zeigen, in sein Schicksal, geht sofort an das Futter und erfreut ebensowohl durch seine Farbenschönheit wie durch sanftes Wesen, hält sich in einem weiten, an kühlen Orten aufgestellten Gebauer auch viele Jahre.
Der Pirol, Widewal, Golddrossel usw. ( Oriolus galbula), vertritt die nach ihm benannte, über das nördlich altweltliche, indische und äthiopische Gebiet verbreitete Familie ( Oriolidae), deren Merkmale in dem kräftigen, fast kegelförmigen, mit der Spitze ein wenig überragenden Ober- und beinahe gleichstarken Unterschnabel und dem dichten, meist prachtvoll, nach Geschlecht und Alter verschieden gefärbten Kleide liegen. Unser Pirol, Vertreter der zahlreichsten gleichnamigen Sippe ( Oriolus), ist prachtvoll lichtorange- oder gummigelb; Zügel, Schultern und Flügeldeckfedern haben schwarze Färbung; die Schwingen sind schwarz, schmal weiß, die hinteren Armschwingen schmal gelblich gerandet, die Handdecken in der Endhälfte gelb, die Schwanzfedern schwarz und mit breitem, von außen nach innen abnehmendem, auf den beiden mittelsten bis auf einen Spitzensaum verschmälerten gelben Endbande geziert. Weibchen, Junge und einjährige Männchen sind oberseits gelblichgrün, unterseits graulichweiß, die Federn dunkel geschaftet, am Bauch rein weiß, an den Schenkeln und Unterschwanzdecken hochgelb, ihre Schwingen olivenschwärzlich, außen weißfahl gesäumt, die Schwanzfedern olivengelblichgrün, innen am Ende mit einem gelben Fleck geschmückt. Das Auge ist karminrot, der Schnabel schmutzigrot, bei Weibchen und Jungen grauschwärzlich, der Fuß bleigrau. Die Länge beträgt fünfundzwanzig, die Breite fünfundvierzig, die Fittichlänge vierzehn, die Schwanzlänge neun Zentimeter.

Pirolweibchen am Nest ( Oriolus galbula)
Der ihm auch beigelegte Name Pfingstvogel ist insofern passend gewählt, als der Pirol erst gegen Pfingsten hin, in der ersten Hälfte des Mai, bei uns eintrifft. Er ist ein Sommergast, der nur kurze Zeit in seiner Heimat verweilt und schon im August davonzieht. Diese Angabe gilt für ganz Europa, mit Ausnahme des höchsten Nordens, und für den größten Teil Westasiens, welche Erdstrecken als die Heimat des Pirols betrachtet werden müssen. Auf seinem Winterzug besucht er ganz Afrika, einschließlich Madagaskars. Seinen Aufenthalt wählt er in Laubwäldern und namentlich in solchen der Ebene. Eiche und Birke sind seine Wohnbäume, Feldgehölze, die aus beiden bestehen, daher seine Lieblingsplätze. Eine einzige Eiche zwischen andern Bäumen vermag ihn zu fesseln, eine Eichengruppe im Park seine Scheu vor dem Treiben des Menschen zu besiegen. Nächstdem liebt er Schwarz- und Silberpappel, Rüster und Esche am meisten. Im Nadel-, zumal im Kieferwald, kommt er ebenfalls vor, immer aber nur dann, wenn in dem Bestand auch Eichen oder Birken vorhanden sind. Das Hochgebirge meidet er.
Der Pirol erinnert ebenso an die Drosseln wie an die Fliegenfänger, zuweilen auch an die Raken, unterscheidet sich jedoch auch wiederum von allen genannten. »Er ist«, sagt Naumann, »ein scheuer, wilder und unsteter Vogel, der sich den Augen der Menschen stets zu entziehen sucht, ob er gleich oft in ihrer Nähe wohnt. Er hüpft und flattert immer in den dichtest belaubten Bäumen umher, verweilt selten lange in dem nämlichen Baum und noch weniger auf demselben Ast; seine Unruhe treibt ihn bald dahin, bald dorthin. Doch nur selten kommt er in niedriges Gesträuch und noch seltener auf die Erde herab. Geschieht dies, so hält er sich nur so lange auf, als nötig ist, ein Kerbtier und dergleichen zu ergreifen. Ausnahmsweise bloß tut er dann auch einige höchst ungeschickte, schwerfällige Sprünge; denn er geht nie schrittweise. Er ist ein mutiger und zänkischer Vogel. Mit seinesgleichen beißt und jagt er sich beständig herum, zankt sich aber auch mit andern Vögeln, so daß es ihm, zur Begattungszeit besonders, nie an Händeln fehlt. Er hat einen schweren, rauschenden, aber dennoch ziemlich schnellen Flug, der, wenn es weit über das Freie geht, nach Art der Stare in großen, flachen Bogen oder in einer seichten Schlangenlinie fortgesetzt wird, über kurze Räume fliegt er in gerader Linie, bald schwebend, bald flatternd. Er fliegt gern, streift weit und viel umher, und man sieht oft, wie einer den andern viertelstundenlang jagt und unablässig verfolgt.« Die Lockstimme ist ein helles »Jäck, jäck« oder ein rauhes »Kräk«, der Angstschrei ein häßlich schnarrendes »Querr« oder »Chrr«, der Ton der Zärtlichkeit ein sanftes »Bülow«. Die Stimme des Männchens, die wir als Gesang anzusehen haben, ist volltönend, laut und ungemein wohlklingend. Der lateinische und deutsche Name sind Klangbilder von ihr. Naumann gibt sie durch »Ditleo« oder »Gidaditleo« wieder; wir haben sie als Knaben einfach mit »Piripiriol« übersetzt. Er gehört zu den fleißigsten Sängern unseres Waldes. Man hört ihn bereits vor Sonnenaufgang und mit wenig Unterbrechung bis gegen Mittag hin und vernimmt ihn von neuem, wenn die Sonne sich neigt. Aber auch an schwülen Tagen ist er, abweichend von andern Vögeln, rege und laut. Ein einziges Pirolpaar ist fähig, einen ganzen Wald zu beleben.
Wenige Tage nach seiner Ankunft beginnt der Pirol mit dem Bau seines künstlichen Nestes, das stets in der Gabel eines schlanken Zweiges aufgehängt wird. Es besteht aus halbtrockenen Grasblättern, Halmen, Ranken, aus Nesselbast, Werg, Wolle, Birkenschale, Moos, Spinnengewebe, Raupengespinst und ähnlichen Stoffen, ist tief napfförmig und wird inwendig mit seinen Grasrispen oder mit Wolle und Federn ausgepolstert. In der Regel wählt der Pirol einen höheren Baum zur Anlage desselben; doch kann es auch geschehen, daß er es in Manneshöhe über dem Boden aufhängt. Die langen Fäden werden mit dem Speichel auf den Ast geklebt und mehrere Male um denselben gewickelt, bis die Grundlage des Baues hergestellt worden ist, die übrigen Stoffe sodann dazwischen geflochten und gewebt. Beide Geschlechter sind in gleicher Weise am Bau tätig; nur die innere Auspolsterung scheint vom Weibchen allein besorgt zu werden. Anfang Juni hat das Weibchen seine vier bis fünf glattschaligen und glänzenden Eier, die durchschnittlich dreißig Millimeter lang, einundzwanzig Millimeter dick und auf hellweißem Grund mit aschgrauen und rötlichschwarzbraunen Punkten und Flecken gezeichnet sind, gelegt und beginnt nun eifrig zu brüten. Es läßt sich schwer vertreiben; denn beide Geschlechter lieben die Brut außerordentlich. »Ich besuchte«, sagt Päßler, »ein Nest täglich, jagte das Weibchen vom Nest und bog die Zweige herab, um bequemer in das Innere sehen zu können. Da stieß das Weibchen ein lang gehaltenes, kreischendes Geschrei, ein wahres Kampfgeschrei aus, stürzte sich von dem nahestehenden Baum auf mich hernieder, flog dicht an meinem Kopf vorbei und setzte sich auf einen andern, mir im Rücken stehenden Baum. Das Männchen eilte herzu; derselbe Schrei, derselbe Versuch, mich zu vertreiben. Beide zeigten sich gleich mutig, beide gleich besorgt um Nest und Eier.« In den Mittagsstunden löst das Männchen das brütende Weibchen ab, und dieses eilt nun förmlich durch sein Gebiet, um sich so schnell wie möglich mit der nötigen Nahrung zu versorgen. Nach vierzehn bis fünfzehn Tagen sind die Jungen ausgebrütet und verlangen nun mit einem eigentümlichen »Jüddi, jüddi« nach Nahrung. Sie wachsen rasch heran und mausern sich bereits im Nest, entfliegen demselben also nicht in dem eigentlichen Jugendkleid. Wird einem Pirolpaar seine erste Brut zerstört, solange es Eier enthält, so nistet es zum zweiten Male; werden ihm jedoch die Jungen geraubt, so schreitet es nicht zur zweiten Brut.
Kerbtiere der verschiedensten Art, namentlich aber Raupen und Schmetterlinge, Würmer und zur Zeit der Fruchtreife Kirschen und Beeren bilden die Nahrung des Pirols. Er bedarf viel und kann deshalb einzelnen Fruchtbäumen schädlich werden; doch überwiegt der Nutzen, den er leistet, den geringen Schaden, den er durch seine Plündereien in den Gärten uns zufügt, bei weitem, und er verdient daher Schutz, nicht Verfolgung, wie er sie, schon seiner Schönheit halber, leider noch vielfach erdulden muß.
Gefangene Pirole dauern nur bei bester Pflege mehrere Jahre im Käfig aus, überstehen die Mauser schwer und erlangen nach ihr ihre Schönheit meist nicht wieder, werden daher auch nur von sachkundigen Liebhabern im Gebauer gehalten. Naumanns Vater zog Pirole allen andern Stubenvögeln vor und erlebte an ihnen die Freude, daß einige von ihnen ihm das Futter aus den Händen und aus dem Mund nahmen oder ihn, wenn er ihnen nicht sogleich etwas gab, mahnend bei den Haaren rauften.
*
Eine ziemlich scharf umgrenzte Familie bilden die Meisen ( Paridae). Ihr Schnabel ist kegelförmig, gerade und kurz, auf der Firste gerundet, an den Seiten zusammengedrückt, an den Schneiden scharf; die Füße sind stark und stämmig, die Zehen mittellang und kräftig, die Nägel verhältnismäßig groß und scharf gekrümmt, die Flügel, unter deren Schwingen die vierte und fünfte die Spitze bilden, kurz und gerundet; der Schwanz ist meist kurz und dann gerade abgeschnitten oder nur wenig ausgeschweift, zuweilen aber auch lang und dann stark abgestuft, das Gefieder dicht, weich und lebhaft gefärbt.
Die Familie verbreitet sich über den ganzen Norden der Erde, tritt aber auch im indischen, äthiopischen und australischen Gebiete auf. Einige zu ihr gehörige Arten zählen zu den Wander-, andere zu den Stand- oder zu den Strichvögeln, die zu gewissen Zeiten in zahlreicher Menge durch das Land ziehen, doch ihre Reisen niemals weit ausdehnen, sich vielmehr immer nur in einem sehr beschränkten Gebiet bewegen. Ihr eigentliches Wohn- und Jagdgebiet ist der Wald; denn fast sämtliche Arten leben ausschließlich auf Bäumen und Sträuchern und bloß wenige mehr im Röhricht als im Gebüsch. Sie vereinigen sich nicht bloß mit ihresgleichen, sondern auch mit anderen Arten ihrer Familie, unter Umständen selbst mit fremdartigen Vögeln, in deren Gesellschaft sie dann tage- und wochenlang verbleiben können.
Ihr Wesen und Treiben ist höchst anziehend. Sie gehören zu den lebendigsten und beweglichsten Vögeln, die man kennt. Den Tag über sind sie keinen Augenblick ruhig, vielmehr fortwährend beschäftigt. Sie fliegen von einem Baum zum andern und klettern ohne Unterlaß auf den Zweigen umher; denn ihr ganzes Leben ist eigentlich nichts anderes als eine ununterbrochene Jagd. Auf dem Boden sind sie freilich recht ungeschickt, verweilen deshalb hier auch niemals lange, sondern kehren bald wieder zu den Zweigen zurück. Hier hüpfen sie gewandt hin und her, hängen sich geschickt nach unten an, wissen in den allerverschiedensten Stellungen sich nicht bloß zu erhalten, sondern auch zu arbeiten, klettern recht gut und zeigen sich im Durchschlüpfen und Durchkriechen dichtverflochtener Stellen ungemein behend. Der Flug ist schnurrend, kurzbogig und scheinbar sehr anstrengend; die meisten Arten fliegen deshalb auch nur selten weit, vielmehr gewöhnlich bloß von einem Baum zum andern. Die Stimme ist ein feines Gezwitscher, das dem Pfeifen der Mäuse nicht unähnlich ist und fortwährend, scheinbar ohne alle Veranlassung, ausgestoßen wird.
Viele Meisen verzehren neben Kerbtieren auch Sämereien; die Mehrzahl dagegen hält sich ausschließlich an erstere und jagt vorzugsweise kleineren Arten, noch mehr aber deren Larven und Eiern nach. Gerade hierin liegt die Bedeutung dieser Vögel für das Gedeihen der Bäume. Die Meisen brauchen wegen ihrer ewigen Regsamkeit eine verhältnismäßig sehr große Menge von Nahrung. Sie sind die besten Kerbtiervertilger, die bei uns leben. Wenig andere Vögel verstehen so wie sie die Kunst, ein bestimmtes Gebiet auf das gründlichste zu durchsuchen und die verborgensten Kerbtiere aufzufinden. Regsam und unermüdlich, gewandt und scharfsinnig, wie sie sind, bleibt ihnen wenig verborgen und unerreichbar. Sie sind die treuesten aller Waldhüter, weil sie in einem bestimmten Gebiet verweilen und zu jeder Jahreszeit ihrem Berufe obliegen. Der Nutzen, den sie bringen, läßt sich unmöglich berechnen; zu viel ist aber gewiß nicht gesagt, wenn man behauptet, daß eine Meise während ihres Lebens durchschnittlich täglich an tausend Kerbtiere vertilgt. Darunter sind sicherlich viele, die unsern Bäumen keinen Schaden zufügen; die meisten Eier aber, die die Meisen auflesen und zerstören, würden sich zu Kerfen entwickelt haben, deren Wirksamkeit eine durchaus schädliche ist. Jeder vernünftige Mensch sollte nach seinen Kräften mithelfen, so nützliche Vögel nicht bloß zu schützen, sondern auch zu hegen und zu pflegen, ihnen namentlich Wohnstätten zu gründen im Wald, indem er alte, hohle Bäume stehen läßt oder ihnen durch Aushängen von Brutkästen behilflich ist. Das größte Übel, an dem unsere deutschen Meisen leiden, ist Wohnungsnot; dieses Übel aber nimmt, falls nicht Gegenmaßregeln getroffen werden, in stetig sich steigerndem Umfang zu und schadet dem Bestand der nützlichen Vögel mehr, als alle Feinde, einschließlich des Menschen, zusammen genommen schaden konnten. Zum Glück für den Wald vermehren sie sich sehr stark; denn sie legen größtenteils zweimal im Jahr und jedesmal sieben bis zwölf Eier. Die zahlreiche Brut, die sie heranziehen, ist schon im nächsten Frühjahr fortpflanzungsfähig.
Im Käfig sind viele Meisen höchst unterhaltend. Sie gewöhnen sich überraschend schnell an die Gefangenschaft, werden aber selten eigentlich zahm. Mit andern Vögeln darf man sie nicht zusammensperren; denn sie überfallen selbst die größeren mörderisch, klammern sich auf ihrem Rücken fest, töten sie durch Schnabelhiebe, brechen ihnen die Hirnschale auf und fressen das Gehirn der erlegten Schlachtopfer mit derselben Begierde, mit der ein Raubvogel seine Beute verzehrt.
*
Die Beutelmeise oder Remiz( Aegithalus pendulinus), Vertreter einer gleichnamigen Sippe ( Aegithalus), ist eine der kleinsten Arten der Familie. Ihre Länge beträgt einhundertzweiundzwanzig, die Breite einhundertachtzig, die Fittichlänge sechsundfünfzig, die Schwanzlänge fünfundfünfzig Millimeter. Stirne, Zügel und ein Fleck unter dem Auge sind schwarz, der Oberkopf, mit Ausnahme des weißlichen Vorderkopfes, Nacken und Hinterhals schmutziggrau, Mantel und Schultern zimmetgelbrot, Bürzel, Oberschwanz- und kleine obere Flügeldecken rostbräunlich, Kinn und Kehle rein weiß, die übrigen Unterteile isabellweiß, Schwingen und Steuerfedern braunschwarz, außen fahlweiß gesäumt, die Armschwingendecken kastanienrotbraun. Das Auge ist braun, der Schnabel mehr oder weniger dunkelschwarz, an den Schneiden weißlich, der Fuß schwarz oder grauschwarz. Das Weibchen hat schmutzigere Farben und weniger Schwarz an der Stirn und den Kopfseiten. Den Jungen fehlt der schwarze Zügelstreifen; ihre Oberseite ist rostgrau, ihre Unterseite rostgelbgrau.
Der Osten unseres Erdteiles, Polen, Rußland, Galizien, Südungarn, die Donautiefländer, die Türkei, Griechenland, Kleinasien und Südfrankreich sind die Heimat dieses überaus zierlichen Vogels. In Deutschland gehört er zu den Seltenheiten, obgleich er wiederholt beobachtet oder wenigstens das von ihm gebaute Nest nach seinem Wegzuge aufgefunden worden ist. Sümpfe und ihnen ähnliche Örtlichkeiten bilden seine Wohnsitze, Dickichte, zumal mittelalte, dichte Bestände der Weiden- und Pappelarten seine Aufenthalts- und Wohnorte. Ob man ihn als Zugvogel betrachten darf, oder ob er nur Strichvogel ist, hat bis jetzt noch nicht entschieden werden können. So viel steht fest, daß er ziemlich regelmäßig im Jahr, und zwar im März auf seinen Brutplätzen eintrifft und sie im September oder Oktober, wenigstens teilweise, wieder verläßt. Gelegentlich seiner Wanderungen erscheint er in den Ländern, die außerhalb des eigentlichen Verbreitungskreises liegen, so mit einer gewissen Regelmäßigkeit an manchen Seen Nord- oder Ostdeutschlands.
Durch ihre Lebhaftigkeit, Gewandtheit und Keckheit gibt sich die Beutelmeise als würdiges Mitglied ihrer Familie zu erkennen. Auch ihre Bewegungen und Lockstimme sind meisenartig. Sie klettert geschickt im Gezweig und wohl auch im Rohr auf und nieder, hält sich möglichst verborgen und läßt ihr weit hörbares klingendes »Zitt« fast ohne Unterbrechung hören. Unruhig, wie sie ist, macht sie sich beständig mit etwas zu schaffen und ist innerhalb ihres Gebietes bald hier, bald dort. Ihr Flug ist hurtig, gewandt, aber eigentümlich zuckend; sie vermeidet auch soviel wie möglich, über Strecken zu fliegen, auf denen sie sich nicht decken kann. Allerlei Kerbtiere, namentlich solche, die sich im Röhrichte aufhalten, deren Larven und Eier bilden die Nahrung. Im Winter begnügt sie sich mit Gesäme des Rohres und Sumpfpflanzen.
Besonderer Beachtung wert ist das Fortpflanzungsgeschäft dieser Meise. Sie gehört zu den ausgezeichnetsten Baukünstlern, die wir kennen. Ihr Nest, ein herrliches Kunstwerk, ist nur an seinem oberen Ende befestigt und hängt also, wie die Nester der Webervögel, frei, in den meisten Fällen über das Wasser herab. »Ich habe«, sagt Baldamus, »sieben Wochen lang fast täglich den kleinen Nestkünstler bei seinem Nist- und Brutgeschäft beobachten können und mehr als dreißig Nester gesehen und in Händen gehabt. Wenn es überhaupt höchst anziehend ist, die kunstreichen Nestbauer bei ihrer Arbeit zu belauschen, so hat diese Beobachtung bei unserm Vogel doppelten Reiz, da er wegen seiner Harmlosigkeit den Zutritt zu seiner Werkstätte durchaus nicht erschwert. Ich beobachtete den ganzen Gang der Arbeit und sah und nahm Nester in den verschiedensten Zuständen der Vollendung. Das Nest fand ich (im weißen Moraste) nur an den äußersten Zweigspitzen der dort vorherrschenden Bruchweide. Obwohl stets Wasser und Schilf in der Nähe ist, ersteres wenigstens zu der Zeit des Anlegens der Nester, so befanden sich doch nicht alle unmittelbar über dem Wasser und keines so im Rohrdickichte, daß es dadurch irgendwie verdeckt worden wäre. Im Gegenteil waren die in geringer Höhe angelegten stets außer dem Bereich des Rohrwuchses, die meisten am Rand des Rohrwaldes, am und über freiem Wasser, alle leicht aufzufinden. Sie hingen in einer Höhe von vier bis fünf Meter über dem Boden; nur zwei waren zwei bis drei und einige sechs bis zehn Meter, eines auch nahe am Wipfel einer hohen Buchweide aufgehängt. Beide Gatten bauen gleich eifrig, und man sollte es kaum für möglich halten, daß ein so reicher Bau in weniger als vierzehn Tagen beendet werden kann. Zwar gibt es auch hier flüchtigere und ordentlichere, geschicktere und ungeschicktere Baumeister; indes wird er liederlichere Nestbau wohl vorzugsweise durch die vorgerückte Jahreszeit bedingt, wenn, wie es häufig vorkommt, die ersten Nester durch Unfälle, besonders durch die Diebereien der ungemein häufigen und frechen Elster zerstört worden sind. In diesen Fällen werden sogar die Eier in noch nicht zur Hälfte vollendete Nester gelegt und der Bau bis zum Brüten fortgeführt. Ich fand zwei solche korbförmige Nester mit Eiern. Bezüglich der Nistzeit bindet sich die Beutelmeise nicht an den Rohrwuchs wie andere im Rohr nistende Vögel, denn sie beginnt mit dem Nestbau bereits im April; aber man findet viele Nester auch erst im Juni und Juli.
Was den Gang der Arbeit betrifft, so windet der Vogel fast immer Wolle, seltener Ziegen- und Wolfs- oder Hundehaare um einen dünnen, herabhängenden Zweig, der sich meist einige Zentimeter unter dem oberen Anknüpfungspunkte in eine oder mehrere Gabeln spaltet. Zwischen dieser Gabelung werden die Seitenwände angelegt, die daran ihren Halt finden. Der Vogel setzt sodann die Filzwirkerei solange fort, bis die über die Gabelspitzen herabhängenden Seitenwände unten zusammengezogen werden können und einen flachen Boden bilden. Das Nest hat jetzt die Gestalt eines flachrandigen Körbchens, und solche Nester sind es, die man früher als Vergnügungsnester der Männchen angesehen hat. Der hierzu gebrauchte Stoff ist Pappel- oder Weidenwolle mit eingewirkten Bastfäden, Wolle und Haaren; die Samenwolle wird durch den Speichel geballt und ineinander gezupft. Das Nest hat jetzt die Gestalt eines Körbchens mit dickerem, abgerundetem Boden. Nun beginnt der Bau der einen Seitenöffnung, die bis auf ein kleines rundes Loch geschlossen wird. Währenddem wird auch die andere Seite von unten herausgeführt. Die eine der runden Öffnungen wird nunmehr mit einer Röhre, die zwei bis acht Zentimeter lang ist, versehen, während die andere noch geöffnet bleibt und nur am Rand geglättet und verfilzt wird. Sodann wird die eine Öffnung geschlossen; doch sah ich auch ein Nest mit doppelter Röhre. Zuletzt wird der innere Boden des Nestes noch mit lockerer ungeballter Blütenwolle dick ausgelegt, und nun endlich ist der Bau vollendet.« Das Nest stellt jetzt einen runden Ball oder Beutel dar von fünfzehn bis zwanzig Zentimeter Höhe und zehn bis zwölf Zentimeter Breite, an dem, dem Hals einer Flasche ähnlich, der bald herabgebogene und an das Nest angeheftete, bald wagrecht abstehende, runde Eingang befestigt ist. Ein solches Nest kann unmöglich mit dem eines anderen Vogels verwechselt werden, und deshalb wissen wir auch ganz genau, daß die Beutelmeise wiederholt bei uns in Deutschland genistet hat.
Baldamus fand nie mehr als sieben Eier, auch immer sieben Junge in einem Nest. Die Schale der etwa sechzehn Millimeter langen, elf Millimeter dicken Eier ist äußerst zart und dünn, ohne starken Glanz und feinkörnig, ihre Färbung ein schneereines Weiß, das aber, solange der Inhalt nicht entfernt wurde, blaßrötlich erscheint. Beide Gatten brüten, nach Angabe eines ungarischen Beobachters, abwechselnd, und beide füttern ihre Jungen gemeinschaftlich groß, hauptsächlich mit zarten Räupchen und fliegenden Kerfen, besonders solchen aus dem Mückengeschlecht.
*
Die bekannteste Art der Sippe der Waldmeisen ( Parus) ist unsere Fink- oder Kohlmeise ( Parus major). Die Oberseite ist olivengrün, die Unterseite blaßgelb; der Oberkopf, die Kehle, ein nach unten hin sich verschmälernder Streifen, der über die ganze Unterseite läuft, und ein bogiger, von der Gurgel zum Hinterkopf verlaufender zweiter Streifen sind schwarz, die Schwingen und Steuerfedern blaugrau, die Kopfseiten und ein Streifen über den Flügeln weih. Das Auge ist dunkelbraun, der Schnabel schwarz, der Fuß bleigrau. Das Weibchen unterscheidet sich durch mattere Farben und den schmäleren und kürzeren Bruststreifen. Bei den Jungen sind die Farben noch blasser. Die Länge beträgt sechzehn, die Breite fünfundzwanzig, die Fittichlänge acht, die Schwanzlänge sieben Zentimeter.
Vom fünfundsechzigsten Grad nördlicher Breite an fehlt die Kohlmeise nirgends in Europa, ist aber keineswegs überall häufig, kommt in südlichen Gegenden hier und da bloß im Winter vor, verbreitet sich außerdem über ganz Mittelasien, Nordwestafrika und die Kanarischen Inseln. In Deutschland sieht man sie noch überall und zu jeder Jahreszeit, am häufigsten aber im Frühjahr und im Herbst, wenn die im Norden groß gewordenen zu uns herunterkommen und bei uns durchstreichen, jedoch keineswegs in annähernd so zahlreicher Menge als vor einem oder zwei Menschenaltern; denn keine ihrer Verwandten hat so bedeutend abgenommen wie sie. Noch fehlt sie keiner Baumpflanzung, keinem größeren Garten, leidet aber von Jahr zu Jahr mehr an Wohnungsnot und meidet daher gegenwärtig auch notgedrungen die Nähe der Wohnungen, woselbst sie früher ebenso häufig war wie im Wald. Ausgang September beginnt sie zu wandern, und Anfang Oktober ist sie in vollem Zuge. Um diese Zeit, namentlich an trüben Tagen, steht man Hunderte von Finkmeisen dahinziehen, meist bestimmte Straßen einhaltend, oft mit andern Meisen, Baumläufern und Goldhähnchen einem Buntspecht folgend. Im März kehren die Wanderer zurück, und im April haben sich die Scharen wiederum in Paare aufgelöst.
Die Kohlmeise vereinigt gewissermaßen alle Eigenschaften der Familienmitglieder. Wie diese ist sie ein außerordentlich lebhafter und munterer, ein unruhiger und rastloser, neugieriger, tätiger, mutiger und rauflustiger Vogel. »Es ist etwas Seltenes«, sagt Naumann, »sie einmal einige Minuten lang still sitzen zu sehen. Immer frohen Mutes durchhüpft und beklettert sie die Zweige der Bäume, der Büsche, Hecken und Zäune ohne Unterlaß, hängt sich bald hier, bald da an den Schaft eines Baumes oder wiegt sich in verkehrter Stellung an der dünnen Spitze eines schlanken Zweiges, durchkriecht einen hohlen Stamm und schlüpft behend durch die Ritzen und Löcher, alles mit den abwechselndsten Stellungen und Gebärden, mit einer Lebhaftigkeit und Schnelle, die ins Possierliche übergeht. So sehr sie von einer außergewöhnlichen Neugier beherrscht wird, so gern sie alles Auffallende, was ihr in den Weg kommt, von allen Seiten besieht, beschnüffelt und daran herumhämmert, so geht sie doch dabei nicht etwa sorglos zu Werke. So weiß sie nicht nur dem, der ihr nachstellt, scheu auszuweichen, sondern auch den Ort, wo ihr einmal eine Unannehmlichkeit begegnete, klüglich zu meiden, obgleich sie sonst gar nicht scheu ist. Man sieht es ihr, sozusagen, an den Augen an, daß sie ein verschlagener, mutwilliger Vogel ist; sie hat einen ungemein listigen Blick.« Solange als irgend möglich hält sie sich im Gezweig der Bäume auf; zum Boden herab kommt sie selten. Sie fliegt aber auch nicht gern über weite Strecken, denn der Flug ist, wenngleich besser als der anderer Meisen, doch immer noch schwerfällig und ungeschickt. Ihre Stimme ist das gewöhnliche »Zitt« oder »Sitt«; ihm wird, wenn Gefahr droht, ein warnendes »Terrrrr« angehängt, im Schreck auch wohl ein »Pink, Pink« vorgesetzt; zärtliche Gefühle werden durch die Silben »Wüdi wüdi« ausgedrückt. Der Gesang ist einfach, aber doch nicht unangenehm; »die Töne klingen«, wie Naumann sagt, »hell wie ein Glöckchen«, etwa wie »Stiti, sizizidi« und »Sitidn sitidn«. Die Landleute übersetzen sie durch die Worte »Sitz ich hoch, so flick den Pelz«. So gesellig die Meise ist, so unverträglich, ja selbst boshaft zeigt sie sich gegen Schwächere. Erbärmlich feig, wenn sie Gefahr fürchtet, gebärdet sie sich wie unsinnig, wenn sie einen Raubvogel bemerkt, und erschrickt, wenn man einen brausenden Ton hervorbringt oder einen Hut in die Höhe wirft, in dem sie dann einen Falken sieht; aber sie fällt über jeden schwächeren Vogel mordsüchtig her und tötet ihn, wenn sie irgend kann. Schwache, Kranke ihrer eigenen Art werden unbarmherzig angegriffen und so lange mißhandelt, bis sie den Geist aufgegeben haben. Selbst größere Vögel greift sie an. Sie schleicht förmlich auf sie los, sucht sich, wie schon Bechstein beschreibt, durch einen starken Anfall auf den Rücken zu werfen, häkelt sich dann mit ihren scharfen Klauen tief in die Brust und den Bauch ein und hackt mit derben Schnabelhieben auf den Kopf ihres Schlachtopfers los, bis sie den Schädel desselben zertrümmert hat und zu dem Gehirn, ihrem größten Leckerbissen, gelangen kann. Diese Eigenschaften vermehren sich, wie es scheint, in der Gefangenschaft, sind aber auch bei den freilebenden Vögeln schon sehr ausgebildet, und deshalb ist ihr spanischer Name »Guerrero« oder Krieger, Haderer, vortrefflich gewählt.
Kerbtiere und deren Eier oder Larven bilden die Hauptnahrung der Kohlmeise, Fleisch, Sämereien und Baumfrüchte eine Leckerei. Sie scheint unersättlich zu sein; denn sie frißt vom Morgen bis zum Abend, und wenn sie wirklich ein Kerbtier nicht mehr fressen kann, so tötet sie es wenigstens. Auch der verstecktesten Beute weiß sie sich zu bemächtigen; denn wenn sie etwas nicht erlangen kann, so hämmert sie nach Art der Spechte so lange auf der Stelle herum, bis ein Stück Borke abspringt und damit das verborgene Kerbtier freigelegt wird. Im Notfall greift sie zur List. So weiß sie im Winter die im Stock verborgenen Bienen doch zu erbeuten. »Sie geht«, wie Lenz schildert, »an die Fluglöcher und pocht mit dem Schnabel an, wie man an eine Tür pocht. Es entsteht im Innern ein Summen, und bald kommen einzelne oder viele Einwohner heraus, um den Störenfried mit Stichen zu vertreiben. Dieser packt aber gleich den Verteidiger der Burg, der sich herauswagt, beim Kragen, fliegt mit ihm auf ein Ästchen, nimmt ihn zwischen die Füße, hackt ihm seinen Leib auf, frißt mit großer Lüsternheit sein Fleisch, läßt den Panzer fallen und macht sich auf, um neue Beute zu suchen. Die Bienen haben sich indessen, durch die Kälte geschreckt, wieder ins Innere zurückgezogen. Es wird wieder angepocht, wieder eine beim Kragen genommen, und so geht es von Tag zu Tag, von früh bis zum Abend fort.« Wenn im Winter ein Schwein geschlachtet wird, ist sie gleich bei der Hand und zerrt sich hier möglichst große Stücke herunter. Alle Nahrung, die sie zu sich nimmt, wird vorher zerkleinert. Sie hält das Beutestück nach Krähen- oder Rabenart mit den Zehen fest, zerstückelt es mit dem Schnabel und frißt es nun in kleinen Teilen. Dabei ist sie außerordentlich geschäftig, und ihre Tätigkeit gewährt ein recht anziehendes Schauspiel. Hat sie Überfluß an Nahrung, so versteckt sie sich etwas davon und sucht es zu passender Zeit wieder auf.
Das Nest wird bald nahe über dem Boden, bald hoch oben im Wipfel des Baumes, stets aber in einer Höhle angelegt. Baumhöhlungen werden bevorzugt, aber auch Mauerritzen und selbst alte, verlassene Eichhorn-, Elster- und Krähennester, infolge der sie gegenwärtig bedrückenden Wohnungsnot überhaupt jede irgendwie passende Nistgelegenheit benutzt. Der Bau selbst ist wenig künstlich. Trockene Halme, Würzelchen und etwas Moos bilden die Unterlage, Haare, Wolle, Borsten und Federn den Oberbau. Das Gelege besteht aus acht bis vierzehn zartschaligen Eiern, die achtzehn Millimeter lang, dreizehn Millimeter dick und auf glänzend weißem Grund mit seinen und groben, rostfarbenen oder hellrötlichen Punkten gezeichnet sind. Beide Gatten brüten wechselweise, und beide füttern die zahlreiche Familie mit Aufopferung groß, führen sie auch nach dem Ausfliegen noch längere Zeit und unterrichten sie sorgfältig in ihrem Gewerbe. In guten Sommern nisten sie immer zweimal.
Es hält nicht schwer, Kohlmeisen zu fangen, denn ihre Neugier wird ihnen leicht verderblich. Die, die man einmal berückte, wird man freilich so leicht nicht wieder hintergehen. Im Zimmer sind sie augenblicklich eingewöhnt, tun wenigstens, als wären sie hier von Anfang an zu Hause gewesen, benutzen sofort jedes passende Plätzchen zum Sitzen, durchstöbern und durchkriechen alles, fangen Fliegen und nehmen ohne Umstände das ihnen vorgesetzte Futter an; wirklich zahm aber werden sie nicht sogleich, müssen sich vielmehr erst vollständig von den wohlwollenden Absichten des Menschen überzeugt haben, bevor sie ihm vertrauen. Ihre Lebhaftigkeit, ihr munteres und heiteres Wesen erfreuen jedermann; ihr unablässiges Arbeiten an allem möglichen Hausgerät, ihr Durchschlüpfen, ihr Durchkriechen der Winkel, Schubladen und Kästen, Beschmutzen der Geschränke sowie ihre Zank- und Mordsucht bereiten wiederum manchen Verdruß.
Die Blaumeise ( Parus coerulus) ist auf der Oberseite blaugrünlich, auf dem Kopfe, den Flügeln und dem Schwanze blau, auf der Unterseite gelb. Ein weißes Band, das auf der Stirn beginnt und bis zum Hinterkopfe reicht, grenzt den dunkeln Scheitel ab, ein schmaler blauschwarzer Zügelstreifen trennt ihn von der weißen Wange, und ein bläuliches Halsband begrenzt diese noch unten. Die Schwingen sind schieferschwarz, die hinteren himmelblau auf der Außenfahne und weiß an der Spitze, wodurch eine Bandzeichnung entsteht, die Steuerfedern schieferblau. Das Auge ist dunkelbraun, der Schnabel schwarz, an den Schneiden schmutzigweiß, der Fuß bleigrau. Das Weibchen ist minder schön; das Junge unterscheidet sich durch matte Färbung. Die Länge beträgt einhundertachtzehn, die Breite einhundertsechsundneunzig, die Fittichlänge neunzig, die Schwanzlänge fünfundfünfzig Millimeter.
Das Verbreitungsgebiet der Blaumeise umfaßt ganz Europa, soweit es bewaldet ist, Kleinasien, Persien und Westsibirien. Hier wie in Mittel- und Ostrußland gesellt sich ihr die größere und schönere Lasurmeise ( Parus cyanus). Bei dieser sind Kopf und Unterseite weiß, die Oberteile hellblau, die durch ein weißes Querband und die weißen Enden der Schwingen sehr gezierten Flügel lasurblau.
Zum Aufenthalte wählt sich die Blaumeise vorzugsweise Laubhölzer, Baumpflanzungen und Obstgärten. Im Nadelwalde wird sie selten, während des Sommers fast nie gefunden, wogegen sie im Laubwalde allerorten häufig ist. Im Frühjahr sieht man sie paarweise, im Sommer in Familien, im Herbste in Scharen, die gemeinschaftlich eine mehr oder weniger weit ausgedehnte Reise unternehmen. Dabei folgen sie, laut Naumann, dem Walde, dem Gebüsche und solchen Baumreihen, die sie, wenn auch mit vielen Krümmungen, südlich und westlich bringen, bis an ihr äußerstes Ende. »Da sieht man denn aber deutlich an ihrem Zaudern, wie ungern sie weitere Strecken über freie Flächen zurücklegen. Lange hüpft die unruhige Gesellschaft unter unaufhörlichem Locken in den Zweigen des letzten Baumes auf und ab. Jetzt erheben sich einzelne in die Luft zur Weiterreise, sehen aber, daß die andern ihrem Rufe noch nicht zu folgen wagen, kehren daher um, und wieder andere machen die Probe, bis sie endlich im Ernste alle aufbrechen, und auch die Säumigen eilen, sich der Gesellschaft anzuschließen. Will man sie hier necken, so braucht man nur ein schnelles, starkes Brausen mit dem Munde hervorzubringen und dazu einen Hut oder sonst etwas in die Höhe zu werfen oder einen summenden Stein unter sie zu schleudern. Im Nu stürzen alle, gleich Steinen, wieder auf den eben verlassenen Baum oder ins nächste Gebüsch herab, und das Spiel fängt nun nach und nach von neuem wieder an. Dieses Benehmen gründet sich auf ihre grenzenlose Furcht vor den Raubvögeln. Daher schreckt sie auch jede schnell vorüberfliegende Taube und jeder andere große Vogel, den sie in der Überraschung für einen jener ansehen, weil sie wohl wissen, daß ihr schlechter Flug sie im Freien immer zur gewissen Beute derselben macht. Haben sie weit über freies Feld zu fliegen, so schwingen sie sich hoch in die Luft, daß man sie kaum sehen kann; wohl aber hört man sie immer locken.« Diejenigen Blaumeisen, die eine förmliche Wanderung unternehmen, streifen bis nach Südeuropa, namentlich bis nach Spanien, woselbst man ihnen während des Winters allüberall begegnet, kehren aber schon im März wieder in die nördlichen Gegenden zurück. Viele streichen nur in beschränkteren Grenzen auf und nieder, und einzelne verlassen ihren Wohnort nur so weit, »als ihre täglichen Streifereien nach Nahrung es erfordern, so daß man sie in diesem kleinen Bezirke alle Tage antrifft. Solche haben dann in ihrer Gesellschaft auch wohl Kleiber und einzelne Kohlmeisen, seltener andere Meisen, die mit ihnen herumschweifen und Freude und Leid miteinander teilen.«
In ihrem Wesen und Betragen zeigt sich die Blaumeise als eine Finkmeise im kleinen. Sie ist ebenso betriebsam, gewandt, geschickt, keck, fröhlich, munter, fast ebenso neugierig und ebenso boshaft, zänkisch und jähzornig wie diese. »Hätte sie die Kraft dazu«, meint Naumann, »sie würde manchem größeren Vogel etwas auswischen; denn sie führt, wenn sie böse ist, gewaltige Schnabelhiebe, beißt heftig auf ihren Gegner los und hat dann, weil sie das Gefieder struppig macht, ein recht bösartiges Aussehen.« Infolge ihrer Furcht vor Raubvögeln ist sie außerordentlich wachsam und läßt beim Erscheinen irgendeines Feindes sofort ihre warnende Stimme vernehmen, gibt damit auch dem gesamten Kleingeflügel wohlverstandene Zeichen zur Vorsicht. Ihre Unterhaltungsstimme, das zischende »Sitt« der Meisen überhaupt, läßt sie beständig, dazwischen oft »Ziteretätäh« und »Zititätätäh« vernehmen, »ohne daß man recht versteht, was sie damit sagen will.« In der Angst ruft sie »Zisteretetet«, während des Zuges lockt sie kläglich »Tjätätäh«; die wahre Lockstimme aber, die gebraucht wird, um andere herbeizurufen, klingt hellpfeifend wie »Tgi tgi« oder hell klirrend oder kichernd »Zizizir« oder »Zihihihihi«. Der Gesang ist ganz unbedeutend und besteht größtenteils aus jenen Tönen, von denen manche öfters wiederholt werden. Die Nahrung ist dieselbe, die andere Meisen zu sich nehmen. Sämereien liebt die Blaumeise nicht; Kerbtiereier bilden den Hauptteil ihrer Mahlzeiten.
Das Nest wird regelmäßig in einer Baumhöhle, selten in einem Mauerloche oder einem alten Elster- und bezüglich Eichhornbaue, stets ziemlich hoch über dem Boden, angelegt, auch gewöhnlich selbst ausgearbeitet. Um passende Löcher, die anderen Höhlenbrütern ebenfalls sehr angenehm sind, kämpft die Blaumeise mit Ausdauer und Mut, und deshalb erringt sie sich auch stets ein entsprechendes Wohnplätzchen. Das eigentliche Nest richtet sich nach der Weite der Höhlung, besteht aber meist nur aus wenigen Federn und Haaren. Acht bis zehn kleine, fünfzehn Millimeter lange, elf Millimeter dicke, zartschalige, auf reinweißem Grunde mit rostfarbenen Punkten bestreute Eier bilden das Gelege. Das Männchen wirbt im Anfange der Paarungszeit unter auffallenden Bewegungen um die Gunst des Weibchens. Männchen und Weibchen brüten abwechselnd und erziehen auch gemeinschaftlich die Jungen. Die erste Brut entfliegt Mitte Juni, die zweite Ende Juli oder Anfang August.
Bei der Tannenmeise, Holz-, Harz- oder Pechmeise ( Parus ater) sind Kopf und Hals bis zum Mantel, Kinn und Kehle schwarz, Backen und Halsseiten sowie ein breiter Streifen am Hinterhalse weiß, die übrigen Oberteile und die Außensäume der braunschwarzen Schwingen und Schwanzfedern aschgrau, die größten und mittleren Oberflügeldecken durch weiße, zweireihig geordnete Spitzenflecke geziert, die Unterteile schmutzig grauweiß, die Seiten bräunlich. Das Auge hat tiefblaue, der Schnabel schwarze, der Fuß bleigraue Färbung. Die Länge beträgt elf, die Breite achtzehn, die Fittichlänge sechs, die Schwanzlänge fünf Zentimeter.
Vom hohen Norden Europas an fehlt die Tannenmeise keinem Lande unseres heimatlichen Erdteiles und tritt ebenso in Asien, vom Libanon bis zum Amur, sowie in Japan auf. In Deutschland kommt sie an geeigneten Orten noch überall, jedoch bei weitem nicht mehr in derselben Anzahl vor wie früher, da auch sie an Wohnungsnot leidet. Ihr Aufenthalt ist der Nadelwald; »in ihm aber lassen die Forstleute«, wie Liebe sehr richtig bemerkt, »keine alte kernfaule Fichte oder Tanne stehen und sorgen dafür, daß kein kranker Baum den Spechten und nach diesen den Meisen Wohnungsgelegenheiten biete.« Infolgedessen nimmt der Bestand auch dieser Meise stetig ab. Etwas später als die Finkmeise, Mitte Oktober etwa, beginnt sie zu streichen. Hierbei durchstreift sie zwar soviel wie möglich die Nadelwälder, besucht dann aber auch Laubwaldungen und geschlossene Obstpflanzungen, vielleicht der Gesellschaft halber, der sie sich zugesellte. Ein Buntspecht wird, möge er wollen oder nicht, von ihr wie von der Hauben-, seltener der Fink- und Blaumeise, beiden Goldhähnchen, dem Baumläufer und dem Kleiber, zum Anführer erwählt, und seinen Bewegungen folgt der ganze bunte, in lockerem Verbände zusammenhaltende Schwarm. Im März kehrt sie paarweise zurück und nimmt nun ihren Stand wieder ein. Nicht wenige verlassen diesen überhaupt nicht oder doch nur auf einige Stunden, beispielsweise um auf der Sonnenseite der Berge nach Nahrung zu suchen.
In ihrem Wesen und Betragen, ihren Sitten und Gewohnheiten weicht die Tannenmeise wenig von ihren Sippschaftsgenossen ab. Sie ist munter, keck, bewegungslustig, behend und gewandt, gesellig und doch auch zänkisch und bissig wie irgendeine ihrer Verwandtschaft, scheint aber weniger übermütig zu sein als die Finkmeise. In ihren Bewegungen unterscheidet sie sich nicht von andern Meisen; auch ihr flüsterndes »Sit« oder »Sitätäh« erinnert an diese; die Lockstimme dagegen ist ein helles »Süiti« oder »Suititit« und der Gesang ein Geleier, aus dem einige klingende Laute »Sisi sisi sisi« und »Sitütütiti« freundlich hervorklingen. Die Nahrung ist nur insofern von der anderer Meisen verschieden, als sie in Eiern, Larven und Fliegen solcher Kerbtierarten besteht, die im Nadelwalde leben, ebenso wie sie, wenn überhaupt, Nadelholzsämereien verzehrt.
Das Nest steht immer in einer Höhlung, gegenwärtig fast regelmäßig in Mauselöchern, die früher höchstens als Notbehelf benutzt wurden, günstigerenfalls in einer alten hohlen Kopfweide, Felsenritze oder einem wirklich noch vorhandenen und nicht von einem andern Höhlenbrüter in Beschlag genommenen Spechtloche. Grüne Erdmoose bilden den Außenbau, Haare, seltener Federn, die innere Ausfütterung, sechs bis acht kleine und verhältnismäßig spitzige, etwa fünfzehn Millimeter lange, zwölf Millimeter dicke, zartschalige, auf reinweißem Grunde rostfarben gefleckte Eier das Gelege, das zu Ende des April vollzählig zu sein pflegt. Männchen und Weibchen brüten abwechselnd, zeitigen die Eier binnen vierzehn Tagen, ernähren und erziehen gemeinschaftlich die Jungen, führen sie in den Wald und schreiten zu Ende des Juni zu einer zweiten Brut.
Wenn auch Sperber und Baumfalke, Edelmarder, Wiesel, Eichhorn und Waldmaus manche Tannenmeise fangen und die genannten Säugetiere namentlich der Brut oft verderblich werden mögen, schaden sie alle ihrem Bestande doch bei weitem weniger als der Mensch, der als der schlimmste Feind dieser äußerst nützlichen Meise angesehen werden muß. Aber nicht die verwerfliche Meisenhütte war es, sondern die durch den Forstmann herbeigeführte Wohnungsnot ist es, die die Verminderung der Art verschuldet hat. Die Tannenmeise bedarf mehr als jede andere des Schutzes seitens der Forstbeamten, nicht einer strengeren Beaufsichtigung des so unendlich überschätzten Tuns der Vogelfänger, sondern Abhilfe der Wohnungsnot, das heißt einfach Überlassung alter, durchhöhlter Baumstümpfe, in denen sie ihr Nest anlegen kann. Nur hierdurch, kaum aber durch Aushängen von Nistkästchen, Anlegen von »Bruthainen« und Verwirklichung anderer Erfindungen unwissender Vogelschutzprediger wird man ihr Hilfe gewähren.
Die Gruppe der Sumpfmeisen umfaßt mehrere sehr ähnliche Arten. In Mitteleuropa lebt die Sumpfmeise, auch Schwarz-, Nonnen-, Mehl-, Garten- und Murrmeise genannt ( Parus palustris). Ihre Länge beträgt zwölf, die Breite einundzwanzig, die Fittichlänge sechs, die Schwanzlänge fünf Zentimeter. Oberkopf und Nacken sind tief-, Kinn und Kehle grauschwarz, die Oberteile fahl erdbraun, die Kopf- und Halsseiten sowie die Unterteile schmutzigweiß, seitlich bräunlich verwaschen, die Schwingen und Schwanzfedern dunkel erdbraun, außen schmal graubräunlich gesäumt. Das Auge ist dunkelbraun, der Schnabel schwarz, der Fuß bleigrau. Ihr am nächsten steht die mattköpfige Weidenmeise ( Parus atricapillus), die aber wohl kaum mehr als eine reine Singspielart von ihr ist. Herausgeber.
Im Norden und Osten Europas sowie in den Alpen vertritt sie die Alpen- oder Bergmeise ( Parus borealis), die sich durch lichtere Kopf- und Halsseiten und ausgedehnteren Kehlfleck unterscheidet, auch ein wenig größer ist, im äußersten Nordosten unseres Erdteiles aber wiederum durch die oberseits rein aschgraue Zirbelmeise ( Parus camtschatcensis) ersetzt wird. Zu derselben Gruppe gehören endlich die Trauermeise ( Parus lugubris) von der Balkanhalbinsel und die im hohen Norden Europas und Westasiens lebende Gürtelmeise ( Parus cinctus). Beide sind beträchtlich größer als die Sumpfmeise, gestreckter gebaut und verschieden gefärbt, indem die erstere bei im allgemeinen der Sumpfmeise ähnlicher Färbung und Zeichnung durch das große, schwarze Kehlfeld und die breiten weißen Außenränder der hintersten Oberarm- und der Schwanzfedern, letztere durch die matt dunkelbraune Kopfplatte und die fahl oder blaß rostbraune Färbung des Kleingefieders sich unterscheidet.
Obwohl sich nicht leugnen läßt, daß alle diese Arten auch hinsichtlich ihres Aufenthaltes und Betragens von der Sumpfmeise abweichen, will ich mich doch auf eine kurze Lebensschilderung unserer deutschen Art beschränken. Die Sumpfmeise bewohnt, ihren Namen betätigend, mit Vorliebe niedrig gelegene, wasserreiche Gegenden, zieht Laubwälder entschieden den Schwarzwaldungen vor, hält sich auch dort regelmäßig in den Niederungen und in der Nähe von Gewässern auf, begnügt sich aber auch schon mit dem Uferbestande eines Baches oder Teiches und ebenso mit einem unfern solchen Gewässern gelegenen Garten, gleichviel, ob höhere Bäume oder niedere Gebüsche vorhanden sind. Ihr Wohnbaum ist die Weide, wogegen die Alpenmeise fast nur in Schwarzwäldern gefunden wird und die Gürtelmeise zwischen Wald- und Nadelholzbeständen keinen Unterschied zu machen scheint. Jene ist, je nach der Örtlichkeit, der Witterung und sonstigen Umständen, Stand- oder Strichvogel. Viele Sumpfmeisen verlassen ihr Brutgebiet nicht, andere durchstreifen, familienweise reisend, eilfertig weitere Strecken, nachts, wie sonst auch, in irgendeiner Baumhöhlung Herberge nehmend. Ihr Strich beginnt im Oktober und endet im März; die übrigen Monate des Jahres verbringen sie am Brutorte.
Vielleicht sagt man nicht zu viel, wenn man die Sumpfmeise als die flinkeste und lustigste aller deutschen Arten der Familie bezeichnet. Ungemein lebhaft, unruhig und gewandt, bei Hitze oder Kälte, reichlicher oder spärlicher Nahrung wohlgemut, drollig, necklustig, keck und mutig, weiß sie jeden Beobachter zu fesseln und zu gewinnen. Sie ist vom Morgen bis zum Abend in Tätigkeit, hüpft und turnt, klettert und fliegt, arbeitet, ruft und lockt, solange die Sonne am Himmel steht, und geht erst spät zur Ruhe. Ihre Bewegungen ähneln denen der Blaumeise; ihr Unterhaltungslaut ist ein leises, etwas zischendes »Sit«, ihr Lockruf ein sanftes »Ziäh«, der Ausdruck gelinder Erregung ein scharf betontes »Spitäh, spitzidäh«, ihr Angstgeschrei ein helles »Spitt«? in ihrem kurzen, leisen, vieltönigen Gesänge klingen die Silben »Hitzihitzilidädä« hervor. Im übrigen unterscheidet sie sich kaum von ihren Verwandten, teilt mit diesen auch die Nahrung.
Das Nest steht stets in einer Höhlung mit möglichst engem Eingange, am liebsten in der eines alten Weidenkopfes, sehr oft auch in einem Mause- oder sonstigen Erdloche, im ersteren Falle nicht selten in einer selbst gemeißelten, nett und zierlich ausgearbeiteten, mit engem Schlupfloche versehenen Brutkammer, ist, je nach der Weite des Raumes, dichter oder spärlicher ausgekleidet, immer aber kunstlos mit Moos, Halmen, Wolle usw., innen meist mit denselben Stoffen, seltener mit Haaren und Federn ausgefüttert und enthält im Mai das Gelege der ersten Brut, acht bis zwölf zartschalige, rundliche, etwa sechzehn Millimeter lange, zwölf Millimeter dicke, auf grünlichweißem Grunde mit verschieden großen, rostroten Punkten und Tüpfeln dichter oder spärlicher bestreute Eier. Beide Eltern bebrüten sie abwechselnd, zeitigen sie binnen dreizehn bis vierzehn Tagen, füttern sie in höchstens drei Wochen groß, unterrichten sie noch einige Zeit lang und schreiten im Juli zur zweiten Brut, die jedoch höchstens acht Eier zählt. Viele Bruten werden durch Mäuse, Wiesel, Katzen und andere Feinde zerstört, die alten Vögel von diesen hart bedrängt, so daß die starke Vermehrung, seitdem Wohnungsnot auch die Sumpfmeisen quält, kaum ausreicht, die Verluste, die der Bestand erleiden muß, zu decken.
Gefangene Sumpfmeisen halten sich ebenso leicht wie andere ihres Geschlechtes und sind infolge ihrer Lebhaftigkeit und Drolligkeit vielleicht noch anziehender als die Verwandten.
Die Haubenmeise, hier und da auch wohl Meisenkönig genannt ( Parus cristatus), ist auf der Oberseite rötlich braungrau oder mäusefahl, auf der Unterseite grauweißlich; die stufenweise verlängerten, schmalen Haubenfedern, deren Schäfte sich vorwärts biegen, sind schwarz, weiß gekantet, die Wangen weiß, ein durch das Auge verlaufender Zügelstreifen, der sich hinten sichelförmig nach abwärts und vorn biegt, ein von ihm durch ein breiteres, weißes Band geschiedener, am Oberkopfe beginnender, bis an das Kehlfeld reichender, jenem gleichlaufender, auch gleich breiter Streifen, die Kehle und ein von ihr aus verlaufendes Nackenband schwarz, die Schwingen und Steuerfedern dunkel graubraun, außen lichter gesäumt. Das Auge ist braun, der Schnabel schwarz, lichter an den Schneiden, der Fuß schmutzig lichtblau. Die Länge beträgt einhundertdreißig, die Breite zweihundertzehn, die Fittichlänge fünfundsechzig, die Schwanzlänge fünfundfünfzig Millimeter. Die Jungen unterscheiden sich von den Alten durch ihre kleinere Haube und die undeutliche Kopfzeichnung.
Soviel bis jetzt bekannt, beschränkt sich das Verbreitungsgebiet der Haubenmeise auf Europa, diese Art bewohnt aber den Norden häufiger als den Süden. In unsern deutschen Nadelwaldungen ist sie nirgends selten, in reinen Laubwäldern hingegen fehlt sie gänzlich. Auch sie ist ein Standvogel, der treu an seinem Gebiete hält und dasselbe nur im Herbste und Winter zeitweilig verläßt. Im Nadelwalde sieht man sie überall, in alten Hochbeständen ebensowohl wie im Stangenholze oder Dickichte, sehr oft auch auf dem Boden. Während des Winters vereinigt sie sich mit Tannenmeisen und Goldhähnchen, Baumläufern und Kleibern zu zahlreichen Gesellschaften, die in der bereits geschilderten Weise, meist unter Führung eines Buntspechtes, umherstreifen.
Heitere Fröhlichkeit, Bewegungslust, Gewandtheit und Geschicklichkeit im Klettern und Anhäkeln, die Keckheit, der Mut, die Lust zum Hadern und Zanken, die die Meisen so sehr auszeichnen, sind auch dieser Art eigen. Die Unterhaltungsstimme ist ein zischendes »Sitt«, ein gedehntes »Täh täh«, der Lockruf ein helles »Zick gürrr« oder »Glürrr«, der Gesang ein unbedeutendes Liedchen. Während das Männchen dieses vorträgt, nimmt es verschiedene Stellungen an, dreht und wendet sich, sträubt die Haube und legt sie wieder zusammen, versucht überhaupt, durch allerlei Bewegungen sich liebenswürdig zu machen.
Das Nest steht regelmäßig in Baumhöhlen mit engem Eingangsloche, hoch oder niedrig über dem Boden, wie sie sich gerade darbieten oder ihnen anstehen, auch in hohlen Stämmen und Stöcken, und nicht minder oft in alten Raubvogel-, Raben- und Krähenhorsten, Elstern- und Eichhornnestern, Reisighaufen und anderweitigen Ansammlungen von Genist. Nötigenfalls höhlt das Pärchen selbst eine Nistkammer aus und rastet nicht eher, als bis die Höhlung einen halben Meter Tiefe erlangt hat. Kurze Moosteile und Flechten bilden den Außenbau, Wild- oder Kuhhaare, Tier- und Pflanzenwolle die innere Ausfütterung des eigentlichen Nestes. Das Gelege besteht aus acht bis zehn niedlichen, denen der Sumpfmeise gleichgroßen, auf schneeweißem Grunde rostrot gepunkteten Eiern, die von beiden Geschlechtern abwechselnd bebrütet und binnen dreizehn Tagen gezeitigt werden. Die Jungen erhalten kleine Räupchen zur Atzung und nach dem Ausfliegen noch einige Zeit lang den Unterricht der Eltern, machen sich aber bald selbständig, und jene schreiten dann zu einer zweiten Brut.

Meisengruppe:
Neben den Tannenmeisen zählt diese Art zu den größten Wohltätern der Nadelwaldungen; denn sie lebt hauptsächlich von den Eiern und Larven schädlicher Kerbtiere und verschmäht Körnernahrung fast gänzlich. Man sieht sie vom frühen Morgen an bis zum späten Abende mit dem Aufsuchen ihrer Nahrungsmittel beschäftigt und hat erfahrungsgemäß festgestellt, daß sie vorzugsweise den Eiern verderblicher Forstschmetterlinge nachstellt. Nur im Winter muß sie sich zuweilen entschließen, auch Sämereien zu sich zu nehmen; solange sie aber Kerbtiernahrung haben kann, genießt sie nichts anderes. Das ist wohl auch der Grund, weshalb sie sich schwerer als andere Arten an die Gefangenschaft gewöhnt. Geht sie einmal ans Futter, so wird sie zu einem der niedlichsten aller Stubenvögel.
Dieselben Feinde, die die verwandten Arten gefährden, bedrohen auch die Haubenmeise; da sie jedoch nicht in demselben Grade wie jene an Wohnungsnot leidet, hat sich ihr Bestand in den letztvergangenen Jahren nicht auffällig vermindert.
*
Die Schwanzmeise, Schnee-, Moor-, Spiegelmeise, Pfannenstiel, Teufelsbolzen ( Acredula caudata), Vertreter einer gleichnamigen Sippe ( Acredula), ist auf dem Oberkopfe und der Unterseite weiß, in den Weichen zart rosenrotbraun verwaschen, auf der ganzen Oberseite schwarz, auf den Schultern rosenrötlichbraun; die hinteren Armschwingen sind außen breit weiß gerandet, die beiden äußeren Schwanzfederpaare außen und am Ende weiß. Das Weibchen unterscheidet sich vom Männchen durch einen breiten schwarzen Streifen, der das Weiß der Kopfseite jederseits begrenzt. Die Jungen sind an den Kopfseiten, auf dem Rücken und auf den Flügeln mattschwarz, auf dem Scheitel und auf der Unterseite weißlich. Das Auge ist dunkelbraun, sein unbefiederter Rand bei alten Vögeln hellrot, bei jungen hochgelb, der Schnabel wie der Fuß schwarz. Die Länge beträgt einhundertsechsundvierzig, die Breite einhundertdreiundachtzig, die Fittichlänge zweiundsechzig, die Schwanzlänge siebenundachtzig Millimeter.
Die Schwanzmeise geht nicht weit nach Süden hinab; denn sie gehört schon in Griechenland und Spanien zu den Seltenheiten, kommt aber auch in Kleinasien vor. Dagegen verbreitet sie sich weit nach Norden hinauf, wird auch in ganz Mittelasien gefunden. Bei uns streicht sie im Herbst und Frühjahr mit einer gewissen Regelmäßigkeit; viele Familien bleiben aber auch während des strengsten Winters in Deutschland wohnen. Es scheint, daß die Schwanzmeise Laubwaldungen den Nadelhölzern bevorzugt, lieber noch als im Walde aber in Obstwaldungen oder in baumreichen Auen sich ansiedelt.
Sie ist munter, rege, lebendig und tätig, aber fröhlicher und sanfter, auch minder jähzornig und nicht so räuberisch als andere Arten ihrer Familie. Ihre Plauderstimme ist ein zischendes »Sit«, ihr Lockton ein Pfeifendes »Ti ti«, ihr Warnungslaut ein schneidendes »Ziriri« und »Terr«, ihr Gesang leise und angenehm, obwohl unbedeutend. Die Nahrung besteht ausschließlich in Kerbtieren, und zwar vorzugsweise in kleinen Arten.
Das Nest der Schwanzmeise ähnelt dem der Beutelmeise, unterscheidet sich also von diesem schon dadurch, daß es nicht frei aufgehängt, sondern in allen Fällen unterstützt wird. Seine Gestalt ist die eines großen Eies, in dem oben seitlich eine Öffnung, das Eingangsloch angebracht ist. Die Höhe desselben beträgt etwa vierundzwanzig, die Weite zehn Zentimeter. Grüne Laubmoose, die mit Kerbtiergespinst zusammengefilzt und mit Baumflechten, Puppenhülsen, Birkenschale und Spinnen- oder Raupengespinst überkleidet sind, bilden die Außenwandung, eine Menge Federn, Wolle und Haare die innere Auskleidung. Unter allen Umständen wählt das Schwanzmeisenpaar Moose und Flechten von demselben Baume, auf dem es sein Nest gründet, und immer ordnet es diese Stoffe ähnlich an, wie sie aus der Baumrinde selbst sitzen. Hierdurch erhält das Nest eine Gleichmäßigkeit mit der Umgebung, die bewunderungswürdig ist und es auch einem geübten Auge verbirgt. Da es schwer hält, die nötigen Stoffe herbeizuschaffen, nimmt das Paar, das gezwungen wurde, ein zweites Nest zu errichten, zuweilen gleich die bereits zusammengetragenen Stoffe wieder auf und verwebt sie von neuem. Der Bau selbst währt zwei, oft auch drei Wochen, obgleich beide Gatten sehr eifrig beschäftigt sind, das Männchen wenigstens als Handlanger dient. Um die Mitte oder zu Ende des April ist das erste Gelege vollzählig. Es ist sehr zahlreich; denn die Schwanzmeise legt neun bis zwölf, zuweilen auch fünfzehn bis siebzehn Eier. Diese sind klein, nur vierzehn Millimeter lang und zehn Millimeter dick, äußerst zartschalig und auf weißem Grunde mehr oder weniger mit blaß rostroten Pünktchen gezeichnet. Manche Weibchen legen nur weiße Eier. Nach dreizehntägiger Brutzeit beginnen für beide Eltern Tage ununterbrochener Arbeit; denn es will etwas besagen, die zahlreiche Kinderschar groß zu füttern. Schon für die brütenden Alten ist der Nistraum klein, für die Jungen wird er bald viel zu eng. Es arbeitet also jedes einzelne der Kinderchen, um sich Platz zu schaffen, und so geschieht es, daß das filzige Gewebe der Nestwand weit ausgedehnt wird, ja stellenweise zerreißt. Bekommt das Nest Bodenlöcher, so sieht es recht sonderbar aus; denn wenn die Jungen größer werden, stecken sie fast sämtlich die unbequemen Schwänze unten durch. Später benutzen sie dieselbe Öffnung auch anderweitig, und die Mutter hat dann weniger für Reinlichkeit zu sorgen.
Unter allen Meisen wird die Schwanzmeise am zahmsten und ist deshalb, wie durch ihr Betragen überhaupt, die angenehmste von allen. Beide Gatten eines Pärchens, das man zusammenhalten muß, schlafen immer fest aneinander gedrückt, gewöhnlich so, daß die eine die andere mit dem Flügel zur Hälfte bedeckt. Dann sehen sie wie ein Federball aus, und dieser nimmt sich besonders drollig aus, wenn die Schwänze auf entgegengesetzter Seite hinausragen. Oft überschlägt sich die eine unter der Sitzstange und oft die andere, die oben draus sitzt. Beide sind überaus zärtlich gegeneinander und erhöhen dadurch die Teilnahme, die jeder Pfleger für sie gewinnt, noch wesentlich.
*
Die Bartmeise ( Panurus barbatus), Vertreter der Sippe der Rohrmeisen ( Panurus), ist auf Oberkopf und Nacken schön aschgrau, auf der übrigen Oberseite rein lichtzimmtrot, auf den oberen Schwanzdecken und an den Brustseiten zart isabellrosenrot verwaschen, auf der Mitte der Unterseite reinweiß; ein vom Zügel beginnender, an der Wange herablaufender, aus verlängerten Federn bestehender Bartstreifen wie das untere Schwanzgefieder sind schwarz; die Schwingen sind schwarzbraun, die Handschwingen und deren Deckfedern außen silberweiß, die Armschwingen hier lebhafter zimmtrot als die Oberseite, die hinteren Armschwingen schwarz mit zimmtfarbenem Außen- und rostgelblichem Innenrande; die äußerste Schwanzfeder ist weiß, an der Wurzel innen schwarz, die zweite und dritte jederseits nur am Ende weiß. Das Weibchen hat blassere Farben als das Männchen; der Rücken ist auf lichtem Grunde dunkler getüpfelt, der Knebelbart nur angedeutet und nicht schwarz, sondern weiß; die Unterschwanzdeckfedern sind nicht schwarz, sondern blaß rostgelb. Die Jungen sind auf dem Rücken sehr dunkel, fast schwarz. Das Auge ist orangegelbbraun, der Schnabel schön gelb, der Fuß schwarz. Die Länge beträgt sechzehn, die Breite neunzehn, die Fittichlänge sechs, die Schwanzlänge acht Zentimeter.
Der Südosten Europas, aber auch Holland, Großbritannien, Südungarn, Italien, Griechenland, Spanien, und ebensogut ein großer Teil Mittelasiens sind die Heimat der Bartmeise, ausgedehnte Rohrwälder ihre Wohnsitze. In Holland und Großbritannien wird sie von Jahr zu Jahr seltener, weil der fortschreitende Anbau des Landes ihre Aufenthaltsorte mehr und mehr einschränkt. Aus Deutschland, woselbst sie vormals ebenfalls brütete, ist sie, infolge der wirtschaftlichen Ausnutzung der Rohrwälder, allmählich verdrängt worden und kommt hier gegenwärtig nur als seltener Wandervogel vor. Die Donautiefländer, Südrußland, Südsibirien und Turkestan beherbergen sie gegenwärtig wohl noch am häufigsten. Sie ist an das Rohr gebunden und verläßt dasselbe nur im Notfalle, lebt paarweise oder in kleinen Familien, sehr verborgen, ist gewandt, behend, lebhaft und unruhig, munter und keck wie andere Meisen, bewegt sich an den Rohrstengeln mit der Fertigkeit eines Rohrsängers, fliegt leicht und ruckweise, lockt »Zit zit« und besitzt einen höchst unbedeutenden Gesang, ein leises Gezwitscher, in das einige abgerissene, schnarrende Töne verwebt werden. Im übrigen entspricht ihre Lebensweise im wesentlichen dem Tun und Treiben anderer Meisen; doch läßt ihre bestechende Schönheit und die außerordentliche Zärtlichkeit der Gatten sie anmutender erscheinen als die meisten Verwandten. Die Nahrung besteht während des Sommers in Kerbtieren, während des Winters auch in allerlei Sämereien, zumal denen des Rohres, Schilfes und der Riedpflanzen.
Je nach dem Klima ihres Wohnortes und der herrschenden Witterung schreitet die Bartmeise im Anfange oder erst zu Ende des April zur Fortpflanzung. Das Nest steht unmittelbar über dem Boden in Seggen- oder Grasbüschen, meist so, daß einzelne Stengel der letzteren zwischen die einzig und allein aus trockenen Rispen einiger Rohr- und Schilfarten bestehende Außenwand eingeflochten sind, erinnert daher an die Nester der Rohrsänger, unterscheidet sich jedoch durch seine saubere Ausführung zur Genüge. Die vier bis sechs, in seltenen Fällen auch sieben Eier des Geleges haben einen Längsdurchmesser von achtzehn, einen Querdurchmesser von dreizehn Millimeter und sind auf rein- oder rötlichweißem Grunde ziemlich spärlich mit roten Schmitzen und Punkten gezeichnet. Beide Geschlechter brüten abwechselnd. Unter regelmäßigen Verhältnissen folgt im Juni oder Juli eine zweite Brut der ersten; dann schlägt sich alt und jung in Flüge zusammen und streift nunmehr gemeinschaftlich im Röhrichte umher, tritt auch wohl eine Wanderung nach südlicheren Gegenden an.
*
Von den Spechtmeisen oder Kleibern ( Sittidae) sagt man nicht zuviel, wenn man sie als die vollendetsten aller Klettervögel bezeichnet, da sie den Spechten in dieser Fertigkeit nicht nur nicht im geringsten nachstehen, sondern sie in einer Hinsicht noch übertreffen; sie verstehen nämlich die schwere Kunst, an senkrechten Flächen von oben nach unten herabzuklettern, was außer ihnen kein anderer Vogel vermag.

Kleiber ( Sitta caesia)
Soviel bis jetzt bekannt, sind alle Arten der Familie Strichvögel, die nur außer der Brutzeit in einem kleinen Gebiete auf- und niederwandern, im ganzen aber jahraus, jahrein an einer und derselben Stelle sich halten. Wo hohe alte Bäume oder unter Umständen Felswände ihnen genügende Nahrung bieten, fehlen sie gewiß nicht, denn sie steigen auch ziemlich hoch im Gebirge empor. Ihre Nahrung besteht aus Kerbtieren und Pflanzenstoffen, namentlich aus Sämereien, die sie von den Bäumen und von Felswänden wie vom Erdboden aufnehmen. Sie nisten in Baum- oder Felslöchern, deren Eingang fast regelmäßig mit Lehm und Schlamm überkleidet wird. Das Gelege besteht aus sechs bis neun, auf lichtem Grunde rot gepunkteten Eiern.
Die für uns wichtigste Art, der Kleiber oder Blauspecht ( Sitta caesia), ist auf der Oberseite bleigrau, auf der Unterseite rostgelb; ein schwarzer Streifen zieht sich durch die Augen und läuft auf den Kopfseiten bis zum Halse herunter; Kinn und Kehle sind weiß, die seitlichen Weichen- und die Unterschwanzdeckfedern kastanienbraun, die Schwingen bräunlich schwarzgrau, licht gesäumt, die vordersten auch an der Wurzel weiß, die mittleren Schwanzfedern aschgraublau, die übrigen tiefschwarz mit aschblauer Spitzenzeichnung. Das Auge ist nußbraun, der Schnabel oben hornschwarz, unten bleigrau, der Fuß horngelblich. Die Länge beträgt sechzehn, die Breite sechsundzwanzig, die Fittichlänge acht, die Schwanzlänge vier Zentimeter. Das Weibchen unterscheidet sich durch den schmäleren schwarzen Augenstrich, den lichteren Unterkörper und die geringere Größe.
Unser Kleiber findet sich von Jütland an bis Südeuropa allerorten. Er lebt nirgends in größeren Gesellschaften, sondern paarweise oder in sehr kleinen Familien und endlich mit andern Vögeln vereinigt. Gemischte, hochstämmige Waldungen, in denen es aber nicht gänzlich an Unterholz fehlt, bevorzugt er allen übrigen Örtlichkeiten. Er scheut die Nähe des Menschen nicht und findet sich vor den Toren der Städte oder in den belaubten Spaziergängen derselben ebenso zahlreich wie im einsamen Walde. Im Sommer kann ihn eine einzige Eiche stundenlang fesseln und ihm volle Beschäftigung geben; im Herbste ergreift auch ihn der Reisedrang, und er dehnt dann seine Streifereien etwas weiter aus. Unter allen Umständen hält er sich an die Bäume, und nur im äußersten Notfalle entschließt er sich, eine baumleere Strecke zu überfliegen.
Der Kleiber zeichnet sich durch seine Regsamkeit und Anspruchslosigkeit vor vielen andern Vögeln sehr zu seinem Vorteile aus. »Bald hüpft er an einem Baume hinauf«, sagt mein Vater, »bald an ihm herab, bald um ihn herum, bald läuft er auf den Ästen vor oder hängt sich an sie an, bald spaltet er ein Stückchen Rinde ab, bald hackt er, bald fliegt er: dies geht ununterbrochen in einem fort, so daß er, nur um seine Stimme hören zu lassen, zuweilen etwas ausruht. Seine Stellung ist gedrückt: er zieht fast immer den Hals ein, die Füße an und trägt die weichen und langen Federn locker aufeinander liegend, wodurch er ein plumpes und ungeschicktes Aussehen erhält. Daß er diesem Aussehen nicht entspricht, haben wir oben gesehen. Sein Flug ist leicht, doch nicht sehr schnell, mit stark ausgebreiteten Schwingen und starker Flügelbewegung, nicht selten flatternd. Er fliegt gewöhnlich nicht weit in einem Zuge; daran ist aber nicht Unvermögen, sondern der Umstand schuld, daß er, um von einem Baume zum andern zu kommen, selten eine große Strecke in der Luft auszuführen braucht. Daß ihm der Flug nicht sauer wird, sieht man deutlich daran, daß er sehr oft um die Wipfel der Bäume und ohne erkennbare Ursache zuweilen von einem Berge zum andern fliegt. Auf dem Striche legt er oft eine Strecke von einem Kilometer, ohne sich niederzusetzen, zurück. Zuweilen klettert er lange Zeit hoch auf den Bäumen herum und wird dann nicht leicht gesehen; zuweilen ist er so zutraulich, daß er oft wenige Schritte vor dem Menschen sein Wesen treibt.« Gewöhnlich macht er den Eindruck eines muntern und regsamen Vogels. »Ein Hauptzug in seinem Wesen«, fährt mein Vater fort, »ist Liebe zur Gesellschaft, aber nicht sowohl zu seinesgleichen, sondern zu andern Vögeln, namentlich zu den Meisen und Baumläufern. Mehr als zwei, drei oder vier Kleiber habe ich, wenn nicht die ganze Familie noch vereinigt war, nie zusammen angetroffen. Sie sind, da sie ihre Nahrung mühsam aufsuchen müssen, hier und da verteilt und gewöhnlich die Anführer der Finken, Hauben- und Tannenmeisen, unter die sich auch oft die Sumpfmeisen, die Baumläufer und die Goldhähnchen mischen.« Mitunter schließt sich ein vereinzelter Buntspecht der Gesellschaft an und hält dann längere Zeit gute Gemeinschaft. »Welches von diesen so verschiedenartigen Gliedern der Gesellschaft der eigentliche Anführer ist«, fügt Naumann hinzu, »oder welches die erste Veranlassung zu solcher Vereinigung gab, läßt sich nicht bestimmen. Einer folgt dem Rufe des andern, bis der Trieb zur Fortpflanzung in ihnen erwacht und die Gesellschaft auflöst.« Diese Genossenschaften sind in allen unsern Wäldern sehr gewöhnliche Erscheinungen, und wer einmal den bezeichnenden Lockruf unseres Kleibers kennengelernt hat, kann sie, durch ihn geleitet, leicht auffinden und selbst beobachten. Es herrscht eigentlich kein inniges Verhältnis unter der Gesamtheit, aber doch ein entschiedener Zusammenhang; denn man trifft dieselben Vögel ungefähr in der gleichen Anzahl tagelang nacheinander an verschiedenen Stellen an.
Der Lockton ist ein flötendes, helles »Tü tü tü«, der gewöhnliche Laut aber, der fortwährend gehört wird, ohne daß er eigentlich etwas besagen will, ein kurzes und nicht weit hörbares, aber doch scharfes »Sit«. Außerdem vernimmt man Töne, die wie »Zirr twit twit twit« oder »Twät twät twät« klingen. Der Paarungsruf besteht aus sehr schönen, laut pfeifenden Tönen, die weit vernommen werden. Das »Tü tü« ist die Hauptsache; ihm wird »Quü quü« und »Tirrr« zugefügt. Das Männchen sitzt auf den Baumspitzen, dreht sich hin und her und stößt das »Tü« aus; das Weibchen, das sich möglicherweise auf einem Baume befindet, äußert sich durch »Twät«. Dann fliegen beide miteinander herum und jagen sich spielend hin und her, bald die Wipfel der Bäume umflatternd, bald auf den Ästen sich tummelnd und alle ihnen eigenen Kletterkünste entfaltend, immer aber laut rufend. Unter solchen Umständen ist ein einziges Paar dieser liebenswürdigen Vögel imstande, einen ziemlich großen Waldesteil zu beleben.
Der Kleiber frißt Kerbtiere, Spinnen, Sämereien und Beeren und verschluckt zur Beförderung der Verdauung Kies. Erstere liest er von den Stämmen der Äste ab, sucht sie aus dem Moose oder den Rissen der Borke hervor und fängt sie auch wohl durch einen raschen Schwung vom Aste, wenn sie an ihm vorbeifliegen. Zum Hacken ist sein Schnabel zu schwach, und deshalb arbeitet er nie Löcher in das Holz; wohl aber spaltet er von der Rinde ziemlich große Stückchen ab. Bei seiner Kerbtierjagd kommt er nicht selten unmittelbar an die Gebäude heran, klettert auf diesen umher und hüpft wohl sogar in die Zimmer herein. »Ebenso gern wie Kerbtiere«, sagt mein Vater, »frißt er auch Sämereien, namentlich Rotbuchen- und Lindennüsse, Ahorn-, Kiefer-, Tannen- und Fichtensamen, Eicheln, Gerste und Hafer. Bei völlig geschlossenen Zapfen kann er zu dem Samen der Nadelbäume nicht gelangen; sobald aber die Deckelchen etwas klaffen, zieht er die Körner hervor und verschluckt sie. Den Tannensamen, den außer ihm wenige Vögel fressen, scheint er sehr zu lieben. Wenn unsere alten Tannen reifen Samen haben, sind ihre Wipfel ein Lieblingsaufenthalt der Kleiber. Den ausgefallenen Holzsamen lesen sie vom Boden auf, die Gerste und den Hafer spelzen sie ab, und die Eicheln zerstückeln sie, ehe sie diese Früchte verschlucken. Hafer und Gerste scheinen sie nicht sehr zu lieben, sondern mehr aus Not zu verzehren; denn man findet dieses Getreide selten in ihrem Magen. Rotbuchen- und Lindennüsse fressen sie sehr gern und heben sie auch für nahrungslose Zeiten auf. Ich habe die Kleiber oft mit Vergnügen auf den mit Nüssen beladenen Rotbuchen beobachtet. Ihrer zwei bis drei halten sich in der Nähe einer samenreichen Buche auf, fliegen abwechselnd auf sie, brechen mit dem Schnabel eine Nuß ab und tragen sie auf einen nahestehenden Baum, in dem sie ein zum Einklammern derselben passendes Loch angebracht haben, legen sie in dasselbe, halten sie mit den Vorderzehen, hacken sie auf und verschlucken den Kern. Jetzt lassen sie die Schale fallen und holen sich eine andere Nuß, die auf gleiche Weise bearbeitet wird. Dies geht oft stunden-, ja tagelang fort und gewährt wegen der beständigen Abwechselung, die das Hin- und Herfliegen, das Abbrechen und Aufhacken der Nüsse bedingt, ein recht angenehmes Schauspiel. Die Hasel-, Linden- und Ahornnüsse behandelt der Kleiber auf ähnliche Weise. Sein feiner Geruch zeigt ihm stets richtig an, ob die Nuß voll ist oder nicht, daß er nie eine leere abbricht. Das Durchbrechen der harten Schale einer Haselnuß kostet ihm einige Mühe; aber mit einer Linden-, Rotbuchen- oder Ahornnuß ist er schnell fertig. Sonderbar sieht es aus, wenn er die Nüsse fortträgt. Es geschieht stets mit dem Schnabel, den er, um eine Haselnuß zu fassen, ziemlich weit aufsperren muß.« Naumanns Beobachtungen zufolge liest er im Winter die abgefallenen Kirschkerne vom Boden auf und zerspaltet auch sie, um zu dem Innern zu gelangen, oder sucht in den Gärten mit den Meisen nach den Kernen der Sonnenblumen, nach Quecken- und Hanfsamen, welch letzterer ein Leckerbissen für ihn zu sein scheint.
Das Nest steht immer in Höhlungen, regelmäßig in Baumlöchern, ausnahmsweise in Mauer- oder Felsritzen. Sehr gern benutzt der kluge Vogel die vom Meister Specht gezimmerten Wohnungen zu seiner Kinderwiege, liebt aber nicht, daß die Tür seiner Behausung größer sei, als es für ihn nötig ist, und gebraucht deshalb ein höchst sinnreiches Mittel, um sich zu helfen, indem er den Eingang zu seinem Neste bis auf ein kleines Loch, das für sein Ein- und Ausschlüpfen gerade groß genug ist, verkleibt. »Dies«, berichtet mein Vater ferner, »geschieht mit Lehm oder anderer klebriger Erde, die, wie bei den Schwalbennestern, durch einen leimartigen Speichel angefeuchtet, verbunden und zusammengehalten wird. Er kommt mit dem Zukleiben seines Nestloches bald zustande, indem er ein Klümpchen Lehm nach dem andern im Schnabel hinträgt und es mit demselben, nachdem es ringsum mit Speichel angefeuchtet ist, festklebt. Man glaubt einen kleinen Maurer zu sehen, der, um eine Tür zu verschließen, einen Stein nach dem andern einlegt und festmacht. Diese Lehmwand hat zwei Zentimeter und darüber in der Dicke und, wenn sie trocken ist, eine solche Festigkeit, daß man sie nicht mit dem Finger ausbrechen kann, sondern den Meißel gebrauchen muß, wenn man sie sprengen will. Das Eingangsloch, das sich stets in der Mitte der Lehmwand befindet, ist kreisrund und so eng, daß ein Kleiber kaum durchkriechen kann. Ist das Nest einmal so weit fertig, dann ist es vor allen Raubtieren gesichert; nur die Spechte vermögen die Wand zu zerstören und tun es, wenn ihnen der Kleiber ihr Nestloch weggenommen hat. Im Jahre 1819 hatte dieser kleine Vogel ein Schwarzspechtloch für seine Brut eingerichtet. Kaum war er damit fertig, so kam das Schwarzspechtpaar, um sein Nest zur neuen Brut zurechtzumachen. Das Weibchen näherte sich, staunte die Lehmwand an und zertrümmerte sie mit wenigen Schlägen. Überhaupt hat der Kleiber wegen der Behauptung seines Nestes, ehe dieses durch die Lehmwand gesichert ist, mit mehreren Vögeln zu kämpfen und muß ihnen oft weichen. So sah ich ein Kleiberpaar emsig bauen, aber noch ehe es das Eingangsloch verkleiden konnte, kamen ein paar Stare und vertrieben die schwachen Spechtmeisen in kurzer Zeit.« Die Vollendung des Baues scheint bei beiden Gatten hohe Freude zu erregen. »Das Männchen«, sagt Päßler, »sitzt in der Nähe der gewählten Nisthöhle und jauchzt seinen Paarungsruf in die Luft, während das Weibchen eifrig ein- und ausschlüpft.« Man meint es ihnen aber auch anzumerken, daß sie nicht bloß erfreut sind, sondern sich auch vollkommen sicher fühlen. So untersuchte Pralle ein Nest und klopfte, um sich zu vergewissern, ob es bewohnt sei, unten an den Stamm. Der Vogel kam mit halbem Leibe aus dem Loche heraus, betrachtete den Forscher eine Weile neugierig und schlüpfte dann mit dem Gefühle der vollsten Sicherheit wieder in das Innere zurück. Dieses Spiel wiederholte sich noch einige Male, und erst, als der Baum erstiegen wurde, flog er ab. »Das Nest«, schließt mein Vater, »das nach der Weite der Höhlung, in der es steht, bald einen großen, bald einen kleinen Umfang hat, ist stets von sehr trockenen, leichten Stoffen gebaut. In Laubhölzern besteht es aus Stückchen von Buchen- und Eichenblättern, in Nadelwäldern immer aus äußerst dünnen Stückchen Kiefernschale, die, da sie nicht eng verbunden werden können, so locker übereinander liegen, daß man kaum begreift, wie die Eier beim Aus- und Einfliegen des Vogels zusammen- und oben auf den Schalen gehalten werden können. Man sollte denken, sie müßten unter dem Wuste dieser dünnen Schalenplättchen begraben werden.« Auf dieser schlechten Unterlage findet man in den letzten Tagen des April oder in den ersten des Mai sechs bis neun, etwa neunzehn Millimeter lange, vierzehn Millimeter dicke, auf kalk- oder milchweißem Grunde äußerst fein mit hell- oder dunkler roten, bald schärfer gezeichneten, bald verwaschenen Pünktchen gezeichnete Eier, die mit denen der Meisen viel Ähnlichkeit haben. Das Weibchen bebrütet sie allein und zeitigt sie in dreizehn bis vierzehn Tagen. Die Jungen werden von beiden Eltern mit Kerbtieren, namentlich mit Raupen, großgefüttert, wachsen rasch heran, sitzen aber so lange im Neste, bis sie völlig fliegen können. Nach dem Ausfliegen halten sie sich noch längere Zeit zu den Alten, von denen sie ernährt, vor Gefahren gewarnt und unterrichtet werden. Nach der Mauser verteilen sie sich.
Der Kleiber geht ohne Umstände in den Meisenkasten, wenn dieser durch Hanf oder Hafer geködert wurde, scheint den Verlust seiner Freiheit leicht zu verschmerzen, nimmt ohne weiteres Futter an, macht wenig Ansprüche und behält auch im Käfig die Anmut seines Wesens bei. Mit andern Vögeln verträgt er sich vortrefflich. So vereinigt er treffliche Eigenschaften eines Stubenvogels und erwirbt sich bald die Gunst des Liebhabers. Nur seine ewige Unruhe und unersättliche Arbeitslust kann ihn unangenehm werden lassen.
Seiner verschiedenen Lebensweise halber verdient der Felsenkleiber ( Sitta neumayeri) neben der einheimischen Art kurz geschildert zu werden. Die Oberseite ist aschgrau, bräunlich überflogen, der schwarze Zügelstrich bis zur Mantelgegend ausgedehnt, die Unterseite unrein weiß, der Bauch einschließlich der unteren Schwanzdecken rostrot, alles übrige wie bei unserm Kleiber, den jener jedoch an Größe übertrifft.
Durch Ehrenberg, von der Mühle, Lindermayer und Krüper sind wir gegenwärtig über das Leben des Felsenkleibers einigermaßen unterrichtet. Ehrenberg entdeckte ihn in Syrien, Michahelles fand ihn auf den hohen Gebirgen zwischen Bosnien und Dalmatien auf, und die übrigen der genannten Forscher beobachteten ihn häufig in Griechenland.
Wenn der auf den schlechten Landwegen dieser Länder wandernde Vogelkundige stundenlang keinen Vogel sieht oder hört und dann über die Armut an gefiederten Geschöpfen nachdenkt, wird er zuweilen plötzlich durch ein gellendes Gelächter aus seiner Träumerei gerissen. Dieses Gelächter geht von einer Felswand oder von einigen Felsblöcken aus, und seine Wiederholung lenkt bald die Blicke nach einer bestimmten Stelle und damit auf eine Spechtmeise hin, die als die Urheberin desselben erscheint. Ist des Beobachters Ohr an Unterscheidung der Vogelstimmen gewöhnt, so wird er sich sofort sagen müssen, daß der gehörte und gesehene Vogel ohne Zweifel nicht der gewöhnliche Kleiber, sondern ein anderer sein muß. Zwar lebt auch er nach Art seines Verwandten, aber fast ausschließlich an Felsen und besonders gern an den Wänden der alten venezianischen Festungen, in deren Schußlöchern er beständig ein- und ausschlüpft. Er ist ungemein behend und klettert an ganz wagerechten Felsgesimsen mit derselben Sicherheit umher wie an den senkrechten Wänden, den Kopf nach oben oder noch unten gerichtet, wie vom Magnet gehalten. Wenn er zu einem Felsen anfliegt, hängt er sich gern mit dem Kopf abwärts; auf Felsenplatten und Mauern hüpft er ruckweise. Die Bäume besucht er zwar auch, aber immer höchst selten, und in größeren Waldungen, in denen es keine Felsenwände gibt, findet er sich nie. Sein Geschrei ist ein durchdringendes, hoch tönendes Gelächter, das wie »Hidde hati tititi« klingt. Die Nahrung besteht aus denselben Stoffen, die auch unser Kleiber bevorzugt. Diesem ähnelt der Felsenkleiber überhaupt in allen Stücken; er ist ebenso lebhaft, ebenso unruhig und ebenso vorwitzig, fängt sich deshalb auch leicht in Fallen aller Art, wird sehr bald zahm und geht sofort an das ihm vorgeworfene Futter. Er hält sich aber im Käfig immer auf dem Boden und macht von den Sprunghölzern wenig Gebrauch.
Das Nest wird an schroffe Felswände unter dem natürlichen Dach eines Felsenvorsprunges angeklebt, nach von der Mühles Versicherung gegen die Morgen- oder Mittag-, nie gegen die Westseite. Es ist außen sehr groß, künstlich von Lehm gebaut, mit drei bis fünf Zentimeter langem Eingang versehen und im Innern des Brutraumes mit Ziegen-, Rinder-, Hunde- und Schakalhaaren ausgefüttert, außen mit den Flügeldecken verschiedener Käfer beschält. Die Legezeit fällt in die letzten Tage des April oder in die ersten des Mai; das Gelege besteht aus acht bis neun Eiern, die ebenfalls auf weißem Grunde rot gefleckt sind. Das Weibchen brütet so eifrig, daß man es leicht im Nest ergreifen kann.
*
Bei weitem der größte und hervorragendste Teil der Pflanzenwelt Neuhollands, so ungefähr schildert Gould, besteht aus Gummibäumen und Banksien, die wiederum mehreren Vogelfamilien behaglichen Aufenthalt bieten, so den Papageien und den ungemein zahlreichen Pinselzünglern ( Meliphagidae). Ihr Haushalt hängt so innig mit diesen Bäumen zusammen, daß man die einen ohne die andern sich nicht denken könnte. Die Pinselzüngler fressen Kerbtiere, Blütenstaub und Honig aus den daran so reichen Blüten der Gummibäume und genießen die Nahrung mit Hilfe ihrer langen, an der Spitze pinselförmigen und deshalb hierzu wunderbar geeigneten Zunge. Nur wenige steigen von den Bäumen herab und suchen auf dem Boden Käfer und andere Kerbtiere auf, die meisten Arten leben nur auf den Bäumen, die einen auf diesen, die andern auf jenen.
»Ein durch seine Stimme bezeichnender Bewohner der romantischen Wildnisse Neuseelands«, sagt Rochelas, »ist der Poë oder Tui. Es ist von diesem Wundervogel nicht zu viel gesagt, wenn man behauptet, daß keiner der Sänger in den europäischen Wäldern sich mit ihm messen kann. Die Einhelligkeit und die sanfte Lieblichkeit seines Gesanges erscheint mir wirklich unvergleichlich. Den Schlag der europäischen Nachtigall, wie sehr ich sie auch liebe, finde ich dennoch von dem Gesang dieses Vogels bei weitem übertroffen, und ich gestehe es, nie in meinem Leben habe ich von einem so bezaubernden, klangreichen Vogel eine Vorstellung gehabt.« Die Reisenden, die später des Poë Erwähnung tun, spenden ihm zwar kein so begeistertes Lob; aber auch sie rühmen ihn übereinstimmend als einen der besten Sänger Ozeaniens, und deshalb ist es wohl gerechtfertigt, wenn ich ihn als Vertreter seiner Familie zu schildern versuche.
Der Poë, Tui oder Predigervogel ( Prosthemadera novasee landiae), vertritt die Sippe der Kragenhalsvögel ( Prosthemadera) und kennzeichnet sich durch kräftigen, oben und unten sanft gebogenen Schnabel, kugelig eingerollte Federbüschel zu beiden Seiten des Halses und lange, schmale, haarartig geschaffte Federn am Oberhalse. Das Gefieder ist vorherrschend glänzend stahlgrün; die größten oberen Flügeldecken, die Schäfte der verlängerten Halsfedern und die beiden Halsbüschel sind weiß. Die Länge beträgt dreißig, die Fittichlänge vierzehn, die Schwanzlänge zwölf Zentimeter.
Die ersten Ansiedler, berichtet Buller, nannten den Poë »Predigervogel«, und zwar wegen seiner weißen Halsbüschel, die sie mit den Bäffchen der Amtstracht eines evangelischen Geistlichen verglichen. Aber auch diejenigen, die den Tui in seinen heimatlichen Wäldern sahen, finden den Namen bezeichnend; denn wenn der Predigervogel singt, wendet er sich hin und her, ganz wie ein Pfarrherr auf der Kanzel. Er sitzt, wie Timpson bemerkt, ernsthaft auf einem Zweig, schüttelt mit dem Kopf, dreht ihn bald auf die eine, bald auf die andere Seite, als ob er zu diesem und jenem sprechen wolle, fährt dann und wann plötzlich auf und erhebt nun so machtvoll seine Stimme, als ob es Schlafende aufzuwecken gelte. Ganz im Gegensatz zu seiner sonstigen Lebhaftigkeit und Rastlosigkeit verweilt er, während er singt, auf einer und derselben Stelle. Am frühen Morgen singt er am anhaltendsten, und dann hallen die Wälder der Nord-, Süd- und Aucklandsinsel wider von dem Getöne aller wetteifernd lautgebenden Vögel dieser Art. Ihr Lockton ist ein eigentümlich helles und gellendes »Tui, tui«, ihre gewöhnliche Sangesweise ist eine aus fünf Tönen bestehende Strophe, der immer ein einzelner Ton vorausgeht; außerdem aber vernimmt man noch ein eigentümliches Geläute von ihnen, das Husten oder Lachen ähnelt, und zudem noch eine Menge anderer Noten, so daß der Poë mit Recht als Singvogel bezeichnet werden darf.
Der Flug ist schnell und zierlich, vielfacher Wendungen und Schwenkungen fähig, wenn auch etwas geräuschvoll. Die Nahrung des Tui besteht in Kerbtieren, den verschiedenartigsten Früchten und Beeren und dem Honig gewisser Blumen. Seine Zunge ist, wie die aller Honigfresser, mit einer feinen Bürste versehen, die man nur zu sehen bekommt, wenn der Vogel krank oder verendet ist. Das Nest findet man gewöhnlich in einer Zweiggabel eines dicht belaubten Strauches, wenige Meter über dem Boden, seltener im Wipfel eines höheren Baumes. Es ist ziemlich groß und aus trockenen Reisern und grünem Moos erbaut, die Nestmulde mit hübsch geordneten Grashalmen umgeben und innen mit den haarähnlichen schwarzen Schossen der Baumfarne ausgekleidet. Die drei bis vier, in Größe und Gestalt abändernden Eier sind etwa siebenundzwanzig Millimeter lang, achtzehn Millimeter dick, birnförmig, weiß, leicht rosenfarben überhaucht und mit rundlichen roten Flecken gezeichnet.
Es scheint, daß die Neuseeländer den Poë von jeher gern in der Gefangenschaft gehalten haben. Sie brachten ihn Rochelas in kleinen, aus Flechtwerk verfertigten Käfigen und boten ihn zum Verkauf an, und heutigen Tages noch kommen auf demselben Wege viele in die Hände der Europäer. Bennett versichert, daß die Gefangenen höchst unterhaltend sind, sich sehr leicht zähmen lassen und mit ihren Pflegern sich rasch befreunden. Abgesehen von ihrem vortrefflichen Gesang, besitzen sie die Gabe der Nachahmung in hohem Grade; sie sollen hierin nicht bloß die Elster und den Raben, sondern selbst die Spottdrossel übertreffen. Sie lernen Worte mit größter Genauigkeit nachsprechen und können überhaupt jeden Laut wiedergeben, den sie vernehmen, und somit vereinigt sich bei ihnen alles, um sie einem Tierfreund wert zu machen: Schönheit und liebenswürdiges Betragen, Gesang und leichte Zähmbarkeit.
*
Zur Familie der Baumläufer ( Certhiidae) gehört unser Baumläufer, Baumsteiger oder Krüper ( Certhia familiaris). Er ist auf der Oberseite dunkelgrau, weißlich betropft, auf der Unterseite weiß, der Zügel braungrau, ein Streifen, der über das Auge verläuft, weiß, der Bürzel braungrau, gelblich rostfarben überlaufen; die Schwingen sind schwarzbraungrau, mit Ausnahme der vordersten durch einen weißen Spitzenfleck und eine weißgelbliche Mittelbinde gezeichnet, die Schwanzfedern braungrau, nach außen lichtgelb gesäumt. Das Auge ist dunkelbraun, der Oberschnabel schwarz, der Unterschnabel rötlich hornfarben, der Fuß rötlichgrau. Das Gefieder ist haarartig zerschlissen und seidenweich. Die Länge beträgt einhundertdreißig, die Breite einhundertachtzig, die Fittichlänge einundsechzig, die Schwanzlänge fünfundfünfzig Millimeter. Manche Ornithologen unterscheiden als zweite, bei uns vorkommende selbständige Art den Gartenbaumläufer ( Certhia brachydactyla). Er ist in Westdeutschland die häufigere Art. Die Unterschiede sind aber sehr geringfügig. Herausgeber.
Das Verbreitungsgebiet des Baumläufers erstreckt sich über ganz Europa, Sibirien und Nordamerika, soweit die Waldungen reichen, und umfaßt außerdem Nordwestafrika, Kleinasien, Palästina, vielleicht auch Nordpersien. Nach Art anderer Strichvögel bewohnt er während der Fortpflanzungszeit ein sehr enges Gebiet; nach derselben streicht er oft in Gesellschaft mit Meisen, Goldhähnchen, Kleibern und Spechten umher; immer aber unternimmt er nur kürzere Wanderungen. Wie alle Klettervögel ist er fortwährend in Tätigkeit und demzufolge auch in beständiger Bewegung. Geschäftig und gewandt klettert er an den Bäumen empor, oft in gerader Linie, oft auch in Schraubenwindungen, untersucht dabei jede Spalte und jede Ritze der Rinde, steckt sein feines Schnäbelchen zwischen das Moos und die Flechten und weiß so überall ein wenig Nahrung zu erbeuten. Sein Klettern geschieht ruckweise, aber mit größter Leichtigkeit, und er ist fähig, auch auf der unteren Seite der Äste dahinzulaufen. Zum Boden herab kommt er selten, und wenn es geschieht, hüpft er hier sehr ungeschickt herum. Sein Flug ist ungleichförmig, aber ziemlich schnell; doch fliegt auch er ungern über weite Strecken, sondern lieber von dem Wipfel des einen Baumes zum Stammende des nächsten herab, indem er sich mit einem Schwung von oben nach unten stürzt, kurze Zeit hart über dem Boden dahinschießt, sich wieder etwas hebt und einen Augenblick später wie früher an dem Baum klebt. Die gewöhnliche Stimme ist ein leises »Sit«, dem Laute, den die Meisen und Goldhähnchen hören lassen, sehr ähnlich: der Lockton klingt stärker, wie »Sri«; der Ausdruck seines Vergnügens ist eine Zusammensetzung des »Sit, sri« und eines kurzen, scharfen »Zi«. Bei schönem Frühlingswetter setzt das Männchen diese verschiedenen Laute in einförmiger und langweiliger Weise zusammen; man ist jedoch kaum berechtigt, das ganze Tonstück Gesang zu nennen. Vor dem Menschen zeigt er nicht die geringste Scheu. Er kommt furchtlos in die Gärten herein, beklettert die Mauern der Gebäude ebensowohl wie die Baumstämme und nistet gar nicht selten in passenden Höhlungen des Gebälkes der Häuser. Doch merkt auch er bald, ob der Mensch ihm wohlwill oder nicht.
Solange die Witterung einigermaßen günstig ist, beweist er durch sein ganzes Gebaren außerordentliche Fröhlichkeit; bei naßkalter Witterung aber oder im Winter bei Rauhfrost merkt man ihm die Unbehaglichkeit deutlich genug an. Seine Nachtruhe pflegt er in Baumhöhlungen zu halten.
Das Nest steht in einer Höhle, Spalte oder Ritze, wie sich solche gerade findet. Nicht immer brütet der Baumläufer in Baumhöhlen, sondern häufig auch in geeigneten Spalten, unter Hausdächern oder zwischen den Brettern, die im Gebirge die Wände der Gebäude schützen, oder auch in Holzstößen, zwischen dem Stamme und losgetrennter Borke usw. Je tiefer die Höhlung ist, um so angenehmer scheint sie ihm zu sein. Das Nest selbst richtet sich nach dem Standort und ist demgemäß bald groß, bald klein. Es besteht aus dürren Reiserchen, Halmen, Grasblättern, Baumbast, Stroh und dergleichen, welche Stoffe mit Raupengespinst und Spinnweben durchflochten sind, und wird innen mit feinen Fasern von Bast, Werg und einer Menge von Federn verschiedener Größe ausgefüttert. Die eigentliche Mulde ist nicht sehr tief, der Napf aber stets rund und sauber ausgearbeitet, so daß das Nest immerhin zu den künstlicheren gezählt werden muß. Das Gelege enthält acht bis neun etwa sechzehn Millimeter lange, zwölf Millimeter dicke, auf weißem Grunde fein rot gepunktete Eier, die denen der kleinen Meisen täuschend ähnlich sind. Beide Geschlechter brüten, und beide füttern ihre zahlreiche Brut mit unsäglicher Anstrengung heran. Die Jungen bleiben lange im Neste sitzen, verlassen dasselbe aber, wenn sie gestört werden, noch ehe sie fliegen können, und suchen sich dann kletternd zu helfen, verbergen sich auch mit überraschender Schnelligkeit, sozusagen vor den Augen des Beobachters, und zwar so meisterhaft, daß sie schwer wieder aufzufinden sind. Die Alten führen sie nach dem Ausfliegen noch lange Zeit, und die Familie gewährt dann dem Beobachter ein höchst angenehmes Schauspiel. Das Baumläuferpaar brütet zweimal im Laufe des Sommers, das erstemal im März oder Anfang April, das zweitemal im Juni; das Gelege der zweiten Brut zählt aber immer weniger Eier als das erste, oft nur ihrer drei bis fünf.
Für die Gefangenschaft eignet sich der Baumläufer nicht.
*
Die meisten Vogelkundigen betrachten einen der wundersamsten Vögel der Erde, unseren Mauerläufer, Alpen- oder Mauerspecht ( Tichodroma muraria), als einen Baumläufer; ich sehe ihn im Mittelglied zwischen Baumläufern und Wiedehopfen und das Urbild einer besonderen, nur aus ihm selbst bestehenden Familie ( Tichodromidae). Diese kennzeichnet sich durch eher gedrungenen als gestreckten Leib, kurzen Hals, großen Kopf, sehr langen, dünnen, fast runden, nur an der Wurzel kantigen, vorn spitzigen, sanft gebogenen Schnabel und lockeres, zerschlissenes, seidenweiches Gefieder von angenehmer, zum Teil lebhafter Färbung, die nach den Jahreszeiten verschieden ist. Die Zunge erinnert im allgemeinen an die der Spechte; sie ist so lang, daß sie bis gegen die Schnabelspitze reicht, nadelspitzig, jedoch nur in geringem Grade vorschnellbar und mit einer Menge borstenartiger Widerhaken besetzt.
Das Gefieder ist der Hauptfärbung nach aschgrau, die Kehlgegend im Sommer schwarz, im Winter weiß; die Schwingen und die Steuerfedern sind schwarz, die ersteren von der dritten an bis zur fünfzehnten an ihrer Wurzelhälfte prächtig hochrot wie die kleinen Flügeldeckfedern und schmale Säume an den Außenfahnen der großen Deckfedern, die Steuerfedern an der Spitze weiß gesäumt; die Innenfahnen der zweiten bis fünften Schwinge sind verziert mit einem oder zwei weißen, die Innenfahnen der übrigen mit gelben Flecken, die nach dem Körper zu schwächer werden und schließlich ganz verschwinden, auch ihrer Anzahl nach mannigfach abändern. Das Auge ist braun, der Schnabel und die Füße sind schwarz. Die Länge beträgt sechzehn, die Breite siebenundzwanzig, die Fittichlänge neun, die Schwanzlänge sechs Zentimeter.
Der Mauerläufer bewohnt alle Hochgebirge Mittel- und Südeuropas, West- und Mittelasiens, nach Osten hin bis Nordchina, soll auch in Habesch beobachtet worden sein. In unseren Alpen ist er nicht selten, in den Karpathen und Pyrenäen nicht minder zahlreich vertreten. Von den Alpen aus verfliegt er sich zuweilen nach Deutschland, von den Karpathen aus besucht er Ungarn.
Über seine Lebensweise lagen bis in die neueste Zeit nur dürftige Berichte vor. Der alte Geßner war der erste Naturforscher, der seiner Erwähnung tat. Aber erst im Jahre 1864 haben wir durch Girtanner das Leben dieses Vogels wirklich kennen gelernt. »Wenn der Wanderer«, so berichtet dieser treffliche Forscher, »im schweizerischen Gebirge beim Eintritte in die oberen Züge des Alpengürtels die Grenze des Hochwaldes überschritten hat und nun immer tiefer in das wilde Felsenwirrsal eindringt, so hört er, besonders in gewissen Alpengebieten, nicht gar selten hoch von der Felswand herab einen feinen, lang gezogenen Pfiff ertönen. Derselbe erinnert zumeist an den bekannten Gesang unserer Goldammer; er besteht aus einigen ziemlich lauten, schnell aufeinanderfolgenden, auf gleicher Tonhöhe stehenden Silben, die mit einem, um mehrere Töne höheren, lang gezogenen Endtone schließen und etwa wiedergegeben werden können durch die Silben ›Dü dü dü düiii‹. Erstaunt und erfreut zugleich, mitten in dem schweigenden Steingewirre plötzlich wieder Lebenszeichen eines anderen Wesens zu vernehmen, schaut er hinauf an die kahle Felswand und wird dann, gewöhnlich erst nach längerem Suchen, zwischen den Steinen eines kleinen Vogels gewahr, der mit halbgeöffneten roten Flügeln ohne Anstrengung die senkrechte, stellenweise überhängende Wand hinaufklettert. Es ist der Mauerläufer, die lebendige Alpenrose, der sich in seinem heimatlichen Gebiete umhertummelt, ohne Scheu auf den keuchenden Wanderer herabschauend, der sich mühsam genug bis zu seinem hohen Wohnsitze emporarbeitete.
Nur ganz kahle Felsen beklettert der Mauerläufer gern, und je wilder und pflanzenloser ein Alpengebiet, um so sicherer ist er dort zu finden. Breite Grasbänder, die sich den Hängen entlang ziehen, besucht er nur, um dort den Kerbtieren, überhaupt, um seiner Nahrung nachzugehen; sonst überfliegt er sie eiligst und strebt, so bald wie möglich das nackte Gestein zu erreichen. An Baumstämme geht er nie; ich sah ihn auch niemals sich auf Gestrüpp oder aus den Felsen hervorragendes Astwerk setzen. Er lebt nur in der Luft und an steilen Felsen. Auch den Erdboden liebt er nicht. Dort liegende Kerbtiere sucht er womöglich vom Felsen aus zu ergreifen, erreicht er aber trotz des Streckens und Wendens seinen Zweck auf diese Weise nicht, so fliegt er eilends zu, setzt sich einen Augenblick, ergreift die Beute und haftet im nächsten Augenblicke schon wieder an der Wand, wo er sich nun erst eine bequeme Stelle zur Verspeisung der geholten Nahrung aussucht. Kleine Käfer, die sich tot stellen und in der Hoffnung, an eine unerreichbare Stelle zu fallen, sich über die Steine herunterrollen lassen, Spinnen, die sich in aller Eile an ihrem Rettungstau über die Felsen hinunterzuflüchten suchen, fängt er mit Leichtigkeit in der Luft auf.
Beim Aufklettern trägt er den Kopf stets gerade nach oben gerichtet und sieht dann fast ebenso kurzhalsig aus wie der Kleiber. An überhängenden Stämmen beugt er ihn sogar zurück, um den zarten Schnabel nicht an vorstehenden Steinen zu beschädigen. Teils in einzelnen Sätzen, von denen jeder durch einen gleichzeitigen Flügelschlag unterstützt wird und oft, besonders bei großer Eile oder Anstrengung, von einem kurzen Kehltone begleitet wird, teils förmlich springend, geht es nun mit erstaunlicher Schnelligkeit die steilsten Felswände, die höchsten Türme hinauf. Beim Beklettern der Felsenwand zeigt er eine solche Kraft und Gewandtheit, daß man wohl annehmen kann, es gäbe im ganzen Gebirge keine Felsplatte, die für ihn zu glatt oder zu steil wäre. Gefangene laufen mit Leichtigkeit an den Tapeten des Zimmers empor. Je steiler und glatter aber die zu erklimmende Fläche ist, um so schneller muß auch die Reise vor sich gehen, da an ganz glatten Flächen auch er sich nur auf Augenblicke im Gleichgewichte zu halten vermag. Oben angehängt oder überhaupt so hoch angekommen, als er zunächst gelangen wollte, sieht man ihn oft mit ziemlich weit entfalteten Flügeln, so daß die weißen Flecken deutlich sichtbar werden, schmetterlingsartig am Felsen hängen und rüttelnd sich erhalten, wobei sein Kopf sich links und rechts wendet, indem er über die Schultern weg die Stelle weiter unten am Felsenhange, der er zunächst zufliegen will, ins Auge faßt. In dieser Stellung, in der sich der freilebende Mauerläufer noch am ehesten auf Augenblicke ruhig beobachten läßt, nimmt er sich aus, als ob er auf der Spitze der Schwungfedern ruhe. Mit einem kräftigen Stoße schnellt er sich plötzlich vom Felsen weg in die Luft hinaus, wendet sich in ihr mit Leichtigkeit, überschlägt sich sogar zum Zeitvertreibe und fliegt nun, bald mit schmetterlingsartigen, unregelmäßigen Flügelschlägen, bald mit ganz ausgebreiteten Schwingen sich herabsenkend, bald wie ein Raubvogel mit nach unten gerichtetem Kopfe und angezogenen Flügeln herniederschießend, der auserlesenen, oft sehr viele, oft nur wenige Meter tiefer liegenden Stelle zu. Dort haftet er im nächsten Augenblicke, den Kopf bereits wieder nach oben gerichtet, und deshalb geschieht dieses Herabfliegen oft in einem schönen, unten kurz gebrochenen Bogen. Nach der Seite hin bewegt er sich meist fliegend; doch läuft er auch zuweilen mit stark gebogenen Fersengelenken auf einem schmalen Gesimse dahin; aber er liebt dies nicht und fliegt bald wieder ab. Er ist überhaupt ein guter Flieger, weniger vielleicht in wagerechter Richtung auf weitere Strecken als in senkrechter, wie es eben auch für ihn notwendig ist. In dieser Richtung ist er in jeder Lage Meister, und nichts Schöneres kann es geben, als ein Pärchen dieser Vögel über dunklen Abgründen im Glanze der Sonne sich tummeln zu sehen.
Außer der Fortpflanzungszeit sieht man den Mauerläufer selten paarweise. Er durchstreift meist einsam die öden Gebiete und läßt dabei seine kurze und unbedeutende, aber angenehm klingende Strophe fleißig hören. Gegen andere seiner Art, die dieselbe Gegend durchstreifen, benimmt er sich entweder gleichgültig oder sucht sie durch Herumjagen zu vertreiben. Mit fremdartigen Vögeln kommt er ohnehin nicht in nähere Berührung, und wenn es geschieht, flüchtet er vor ihnen. Die Nahrung besteht aus Spinnen und Kerbtieren, die jene Höhen auch nicht mehr in zahlreichen Arten bewohnen, und er wird deshalb nicht sehr wählerisch sein dürfen. Mit seinem feinen Schnabel erfaßt er auch die kleinste Beute mit Sicherheit, wie mit einer feinen Kneifzange. Die Dienste der Zunge bestehen darin, die mit der Schnabelspitze erfaßten und in ihr liegende Kerfe oder deren Larven und Puppen durch rasches Vorschnellen anzuspießen und beim Zurückziehen im hinteren Teile des Schnabels abzustreifen. Größere Tiere, Raupen z. B., ergreift er zuerst natürlich, wie er sie eben mit seiner Schnabelspitze erwischt, dreht und schüttelt sie dann aber, bis sie endlich quer über die Mitte in ihr liegen, schleudert sie links und rechts gegen die Steine und wirft sie schließlich durch Vor- und Rückwärtsschlenkern des Kopfes der Länge nach in den Schlund, woraus er nie vergißt, den Schnabel nach beiden Seiten sorgfältig vom Gesteine abzuwischen.«
Die Brutzeit fällt in die Monate Mai und Juni: das Nest, ein großer, runder, niedriger, flacher und auffallend leichter Bau aus feinem Moose, Pflanzenwolle, Wurzelfasern, großen Flocken Schafwolle, Gewebstücken, Haaren und dergleichen, steht in flachen Felsenhöhlen. Vier, etwa fünfzehn Millimeter lange, elf Millimeter dicke Eier, die aus weißem Grunde mit braunschwarzen, scharf umrandeten Punkten, am dichtesten am stumpfen Ende, gezeichnet sind, bilden das Gelege.
Nach unsäglichen Mühen und geduldigem Harren gelang es Girtanner, alt gefangene Mauerläufer an Käfig und Stubenfutter zu gewöhnen und später wiederholt Nestjunge aufzuziehen. Der Güte des Freundes danke ich, daß ich ebenfalls die seltenen Vögel pflegen konnte. Sie sind im Käfig ebenso reizend wie im Freien, leider aber sehr hinfällig, so wettertrotzig sie in ihrem Wohngebiete auch sich zeigen.
Unser Wiedehopf ( Upupa epops), das Urbild der Familie der Hopfe ( Upupidae), kennzeichnet sich durch gestreckten Leib, sehr langen, schwachgebogenen, schlanken, seitlich zusammengedrückten spitzigen Schnabel, am Ende gerade abgestutzten Schwanz und weiches, lockeres Gefieder, das sich auf dem Kopfe zu einem Federbusche verlängert. Das Gefieder ist auf der Oberseite lehmfarbig, auf dem Mittelrücken, den Schultern und den Flügeln schwarz und gelblichweiß in die Quere gestreift, der Federbusch dunkel rostlehmgelb, jede einzelne Feder schwarz an der Spitze, die Unterseite hoch lehmgelb, an den Bauchseiten schwarz in die Länge gefleckt, der Schwanz schwarz, etwa in der Mitte seiner Länge weiß gebändert. Beim Weibchen sind die Farben etwas schmutziger als beim Männchen; bei den Jungen ist der Federbusch kürzer. Das Auge ist dunkelbraun, der Schnabel hornschwarz, der Fuß bleigrau. Die Länge beträgt neunundzwanzig, die Breite fünfundvierzig, die Fittichlänge vierzehn, die Schwanzlänge zehn Zentimeter.

Wiedehopf ( Upupa epops)
Der Wiedehopf bewohnt Mittel- und Südeuropa, ganz Sibirien und China, Westasien und Nordafrika, ist in Deutschlands Ebenen häufig, in England ein seltener Gast, verirrt sich aber zuweilen bis nach Nordskandinavien und Spitzbergen. In Deutschland ist er Zugvogel, der in den letzten Tagen des März einzeln oder paarweise ankommt und Ende August und Anfang September familienweise langsam wieder nach Süden reist; schon in Nordafrika aber wandert er nicht mehr, sondern streicht höchstens im Lande auf und nieder. Doch trifft man ihn im Winter in ganz Afrika an, und ebenso gehört er unter die regelmäßigen Wintergäste Indiens. Bei uns bevorzugt er Ebenen, die mehr oder weniger dicht mit Bäumen bestanden sind. Gegenden, in denen Felder und Wiesen mit kleinen Wäldchen abwechseln, oder solche, wo alte Bäume einzeln inmitten der Feldmarken stehen, sagen ihm besonders zu. In Südeuropa treibt er sich vorzugsweise in den Weinbergen herum; in Afrika ist er in jedem Dorfe, ja selbst inmitten der Städte zu finden. Hier findet er alles, was sein Herz sich wünscht. Nicht das Vieh ist es, das dort für die Nahrung des schmutzigen Gesellen sorgt, sondern der Mensch. So fleißig auch die Geier sind: allen Unrat können sie doch nicht abräumen, und genug bleibt übrig für diejenigen Vögel, die wie der allbekannte, durch mancherlei Sagen verherrlichte »Hudhud« Kothaufen als höchst erquickliche Gegenstände betrachten. Die schamlose Ungezwungenheit der Eingeborenen richtet ihm jeden Winkel zu einem vielversprechenden Nahrungsfelde her, und die Gutmütigkeit oder, wohl richtiger, die Gleichgültigkeit der Leute erlaubt ihm, sein Geschäft ungestört zu betreiben. Unbekümmert um den Menschen, der sich gerade anschickt, Mistkäfer und Aasfliege auch etwas verdienen zu lassen, treibt sich der Vogel auf der ihm wohlbekannten Unratstätte umher; ja, er kennt das Wesen seines hauptsächlichsten Ernährers so genau, daß er geradezu in dessen Wohnung sich ansiedelt und in irgendeinem Mauerloche seine stinkende Kinderschar heranzieht. Man braucht bloß aus dem Fenster seines Hauses hinab in den Hof oder in den Garten zu sehen oder durch das Dorf zu gehen: das »Hudhud« tönt einem überall entgegen, von den Häusern, aus den Baumkronen, von der halb zerrissenen Lehmmauer oder von einem widerlich duftenden Erdhügel herab, hinter einer nicht allen Blicken ausgesetzten Mauer her.
Das Betragen des Wiedehopfes ist eigentümlich, aber ansprechend. Bei uns zulande vorsichtig und scheu, weicht er dem Menschen oft weit aus und vertraut eigentlich nur dem Kuhhirten, dessen Herde für seinen Unterhalt sorgt; im Süden hat er sich auf das innigste mit dem Menschen befreundet und treibt seine Possen unmittelbar vor dessen Augen. Aber auch hier wird vorkommendenfalls der Grundzug seines Wesens, grenzenlose Furcht, bemerklich. Der Vogel ist klug genug, um sich vollkommen sicher zu fühlen, wenn er einen Menschen oder ein Haustier gewöhnlichen Schlages gewahr wird; aber schon ein Hund macht ihn bedenklich, eine Katze fordert seine Vorsicht heraus, eine vorüberfliegende Krähe erregt Besorgnis, einer der überall gegenwärtigen Schmarotzermilane oder ein harmloser Schmutzgeier ruft namenlosen Schrecken hervor. Er stürzt sich dann augenblicklich auf den Boden nieder, breitet den Schwanz und die Flügel kreisförmig aus, biegt den Kopf zurück, streckt den Schnabel in die Höhe und verharrt in dieser Stellung, welche Täuschung des Räubers bezweckt, bis alle Gefahr vorüber scheint. Naumann behauptet, daß ihn jede nahe und schnell über ihn hinwegfliegende Schwalbe erschrecke, daß er zusammenfahre und schnell den Federbusch entfalte: in Ägypten habe ich so große Ängstlichkeit nie von ihm beobachtet, obwohl er sich im übrigen auch hier ganz wie in Deutschland beträgt.
Sein Gang auf dem Boden ist gut, schrittweise, nicht hüpfend; im Gezweige dagegen bewegt er sich wenig und geht höchstens auf stärkeren, wagerechten Ästen auf und nieder. Fliegend werden die Schwingen abwechselnd bald schnell, bald langsam geschwungen; der Flug erhält dadurch ein ängstliches Aussehen und geht zuckend vorwärts. Vor dem Niedersitzen schwebt er einige Augenblicke, und entfaltet dabei seinen Federbusch. Die Lockstimme ist ein heiser schnarchendes »Chrr«, das zuweilen wie »Schwär« klingt; bei guter Laune läßt er ein dumpfes »Queg queg« vernehmen; der Paarungsruf ist das hohl klingende »Hup hup«. Im Frühjahr stößt diesen das Männchen ununterbrochen aus, aber schon gegen Ende Juli hin ruft es nicht mehr.
Obwohl an günstigen Orten ein Wiedehopfpaar dicht neben dem anderen wohnt, hält doch bloß die Familie im eigentlichen Sinne des Wortes treu zusammen; die Nachbarn streiten sich fortwährend. Es kommt zwar selten zu Tätlichkeiten zwischen ihnen; wohl aber jagen sie sich sehr ärgerlich hin und her und gebärden sich so, daß ihr Unwille nicht zu verkennen ist. Mit anderen Vögeln geht der Wiedehopf keinen Freundschaftsbund ein. Die einen fürchtet er, die anderen scheinen ihm gleichgültig zu sein. Aber dieser, der Zuneigung scheinbar so wenig zugängliche Vogel, schließt sich, wenn er von Jugend auf freundlich behandelt wird, seinem Pfleger mit außerordentlicher Zärtlichkeit an, und deshalb gehört ein zahmer Wiedehopf zu den unterhaltendsten und liebenswürdigsten Hausgenossen, die man sich denken kann. Sein Gebärdenspiel belustigt, seine Zahmheit und Zutraulichkeit entzücken. Er wird zahm wie ein Hund, kommt auf den Ruf, nimmt seinem Gebieter das Futter aus der Hand, folgt ihm durch alle Zimmer des Hauses, in den Hof, in den Garten, ins Freie, ohne ans Wegfliegen zu denken. Je mehr man sich mit ihm beschäftigt, um so umgänglicher wird er, geht schließlich selbst auf Scherze ein, die ihm anfangs entschieden unbehaglich zu sein scheinen. Bei geeigneter Pflege schreitet er im Käfige auch zur Fortpflanzung.
Kerbtiere mancherlei Art, die der Wiedehopf vom Erdboden aufliest oder mit seinem langen Schnabel aus Löchern hervorzieht und bezüglich herausbohrt, bilden seine Nahrung. Mist- und Aaskäfer, Schmeißfliegen, Larven und andere kotliebende Kerfe scheint er zu bevorzugen, verschmäht aber auch Mai-, Brach-, Rosenkäfer, Heuschrecken, Heimchen, Ameisenpuppen, Raupen usw. nicht. Seine Beute zieht er mit viel Geschicklichkeit aus den verborgensten Schlupfwinkeln hervor und erschließt sich solche oft mit großer Anstrengung, indem er wie ein Specht hämmert und meißelt. Der Schnabel ist gut zum Ergreifen; um aber die erfaßte Beute hinabzuwürgen ist es unbedingt nötig, sie vorher in die Höhe zu schleudern und dann aufzufangen. Junge Wiedehopfe, die man heranziehen will, muß man stopfen; im entgegengesetzten Falle verhungern sie, weil sie buchstäblich nicht imstande sind, das mit dem Schnabel Erfaßte auch zu verschlingen. Letzteres lernen sie erst mit der Zeit.
In Europa erwählt sich der Wiedehopf am liebsten Baumhöhlungen zur Anlage seines Nestes, ohne jedoch ein Mauerloch oder eine Felsenspalte, die ihm passend erscheint, unbeachtet zu lassen. In Ägypten nistet er fast ausschließlich in Mauerlöchern und sehr häufig in passenden Höhlungen bewohnter Gebäude. Er ist überhaupt um die Wahl seines Nistplatzes nicht verlegen. Bei uns begnügt er sich im Notfalle mit einem einigermaßen versteckten Plätzchen auf dem flachen Boden; in den Steppengegenden legt er sein Nest sogar zwischen den Knochen eines Aases an: Pallas fand einmal ein Nest mit sieben Jungen in dem Brustkorbe eines Menschengerippes. Baumhöhlen werden gewöhnlich gar nicht, zuweilen aber mit einigen Hälmchen und Würzelchen, auch wohl mit etwas Kuhmist ausgebaut, die auf dem Boden stehenden Nester durch allerlei trockene Halme, feine Wurzeln und Genist gebildet und ebenfalls mit Kuhmist ausgeziert. Das Gelege besteht aus vier bis sieben verhältnismäßig kleinen, ungefähr fünfundzwanzig Millimeter langen, siebzehn Millimeter dicken, sehr länglichen Eiern, die auf schmutzig weißgrünem oder gelblichgrauem Grunde mit äußerst feinen, weißen Pünktchen übersät oder auch fleckenlos sind, überhaupt sehr abändern. Selten findet man sie vor Anfang Mai vollzählig; denn der Wiedehopf nistet nur einmal im Jahre. Die Eier werden vom Weibchen allein sechzehn Tage lang mit der größten Hingebung bebrütet, die Jungen von beiden Eltern sorgfältig gepflegt, mit Maden und Käfern großgefüttert und noch lange nach dem Ausfliegen geführt, geleitet, unterrichtet und gewarnt. Während der Brutzeit macht der Wiedehopf das Sprichwort wahr; denn er und seine Jungen stinken dann wirklich in unerträglicher Weise. Die Eltern sind nicht imstande, den Kot der Jungen wegzuschaffen; diese sitzen daher, wie Naumann sagt, »bis an die Hälse im eigenen Unrate«, und der letztere verbreitet, wenn er in Fäulnis übergeht, einen überaus ekelhaften Geruch. Schon das brütende Weibchen nimmt sich selten die Mühe, den eigenen Unrat wegzutragen; das Kinderzimmer aber wird nie gereinigt. Der Gestank zieht Fliegen herbei, die ihre Brut in dem Miste absetzen, und so kommt es, daß das Nest schließlich auch noch von Maden wimmelt. Die Jungen stinken selbstverständlich am meisten; die Alten geben ihnen zuletzt wenig nach, und erst viele Wochen nach dem Ausfliegen verlieren die einen wie die andern den ihnen anhängenden Gestank. Wenn die Jungen vollständig erwachsen sind, merkt man so wenig mehr davon, daß man sie wie ihre Eltern ohne Ekel verspeisen kann. Sie sind dann sehr fett und ungemein schmackhaft.
*
Die Kletterhopfe ( Irrisoridae), auf Afrika beschränkte Waldvögel, sind gestreckt gebaut, langschnäbelig, kurzfüßig, kurzflügelig und langschwänzig. Der Schnabel ist seicht gebogen. Unter den Arten, die ich kennengelernt habe, ist der Baumhopf ( Irrisor erythrorhynchus) unzweifelhaft der anziehendste. Die Hautfärbung ist ein schönes, metallisch glänzendes Blau, das bald dunkelgrün, bald purpurn schillert; auf den Innenfahnen der drei ersten Schwingen steht ein weißer Fleck, auf den sechs folgenden befinden sich deren zwei, einer auf der Außen-, der andere tiefer auf der Innenfahne; ähnlich sind die drei ersten Schwanzfedern gezeichnet: auch sie zeigen nahe den Spitzen weiße Kreuzflecken. Das Auge ist braun, der Schnabel und Fuß sind korallenrot. Das Weibchen ist kleiner und sein Gefieder weniger glänzend. Die Jungen sind dunkelgrün, fast schwarz und beinahe glanzlos; ihr Schnabel ist rötlichschwarz. Die Länge beträgt fünfundvierzig bis siebenundvierzig, die Breite achtundvierzig, die Fittichlänge sechzehn, die Schwanzlänge vierundzwanzig Zentimeter.
Nach meinen Erfahrungen findet sich der Baumhopf in Nordostafrika nicht nördlich des sechzehnten Breitengrades, von hier an nach Süden aber überall. Er ist ein Waldbewohner und kommt höchstens auf die Blößen heraus, ohne jedoch die Bäume zu verlassen. Auf baumfreien Ebenen sieht man ihn nie; denn auf dem Boden macht er sich nur selten zu schaffen. Schreiend und lärmend huscht und fliegt und klettert eine Gesellschaft dieses schönen Vogels, die selten aus weniger als vier, selten aus mehr als zehn Stück besteht, durch den Wald. Der Flug hält stets aufs innigste zusammen. Was der eine beginnt, tun die anderen nach. Beim Wegfliegen schreit die ganze Gesellschaft wirr durcheinander, so daß man die einzelnen Laute nicht mehr unterscheiden kann. Levaillant versucht, die Kehltöne, die mit bewunderungswürdiger Schnelligkeit hervorgestoßen werden, durch »Gra ga ga ga ga« wiederzugeben, und ich will ihm nicht widersprechen, so wenig auch seine Buchstabenzeichen das wirkliche Geschrei ausdrücken können. Solange die Gesellschaft ungestört ist, fliegt sie von einem Baume oder von einem Busche zum anderen. Einer hängt sich unten an der rauhen Borke eines Stammes fest und klettert an demselben nach aufwärts, einer nach dem anderen folgt, und so hängt bald der ganze Flug an demselben Stamme. An schief stehenden Stämmen klettert der Baumhopf, wenn auch nicht mit der Gewandtheit eines Spechtes, so doch mit der Mühelosigkeit vieler Steigvögel empor, am senkrechten hält er sich wenigstens zeitweilig an der Borke fest und untersucht nun, den feinen, zierlichen Schnabel in jede Ritze steckend, die tief gelegenen Schlupfwinkel der Kerbtiere. Der Schwanz wird nicht als Kletterwerkzeug gebraucht, aber doch infolge des Abstreifens bald sehr abgenutzt; daher sehen auch die Fahnen der Federn selten glatt aus. Dem Wiedehopf ähnelt unser Vogel darin, daß er sehr häufig stinkende Käfer aufnimmt, dem Spechte deshalb, weil er die Ameisenarten besonders berücksichtigt. Gurney fand, daß er namentlich Wanzen frißt; Monteiro gibt Raupen und kleine Käfer als Nahrung an; ich habe beobachtet, daß er sich zeitweilig fast ausschließlich von Ameisen, und namentlich von den fliegenden, ernährt. Von seinem Futter nimmt er einen höchst unangenehmen Geruch an; dieser ist aber, je nach der zeitweiligen Nahrung, ein verschiedener. Gewöhnlich stinkt er nach Ameisen, gar nicht selten aber auch, wie der Wiedehopf, nach Dünger und zuweilen ganz abscheulich nach Moschus. Die Bewegungen sind verhältnismäßig geschickt. Trotz der kurzen Beine läuft der Vogel gar nicht so schlecht, wie man wohl vermuten sollte, und im Klettern leistet er für seine Ausrüstung Erkleckliches. Der Flug besteht aus einigen raschen Flügelschlägen und darauffolgendem Gleiten; nicht selten werden auch Bogenschwingungen ausgeführt.
Wenig andere Vögel habe ich kennengelernt, die so treuinnig zusammenhalten wie die Baumhopfe. Der Jäger, der es geschickt anfängt, kann eine ganze Gesellschaft nacheinander niederschießen. Sobald einmal der erste gefallen, fliegen alle Mitglieder des Trupps herbei, setzen oder hängen sich auf Äste oder Stämme der nahe stehenden Bäume über dem verendeten auf, schreien kläglich, schlagen mit den Flügeln und schauen entsetzt auf ihn hinab. Ein zweiter Schuß und dessen Wirkung macht sie nicht etwa ängstlich oder scheu, sondern nur noch beharrlicher in ihrer Totenklage. Höchstens teilt sich dann der Trupp, und während die einen bei der ersten Leiche verharren, umschwärmen die übrigen die zweite. So mögen sich ihre Reihen lichten, wie sie wollen, auch der letzte noch hält bei den getöteten Gefährten aus.
Hinsichtlich des Brutgeschäftes berichtet Levaillant, daß das Weibchen in einem Baumloche auf dem Mulm sechs bis acht bläulichgrüne Eier legt, sie abwechselnd mit dem Männchen bebrütet und zu demselben Loche noch längere Zeit mit den ausgeflogenen Jungen zurückkehrt. Folgt man abends ihrem lauten Geschreie, so belauscht man leicht die neugierigen und wenig scheuen Vögel und kann dann erfahren, wie die ganze Familie sich in ihre Nachtherberge zurückzieht. Levaillant verstopfte das Baumloch und holte die so gefangene Gesellschaft am anderen Morgen hervor. Sobald etwas Licht hineinfiel, kam einer nach dem anderen zur Öffnung und wurde rasch am Schnabel erfaßt. Auf diese Weise erlangte unser Forscher zweiundsechzig Männchen, fünfundvierzig Weibchen und elf Junge von verschiedenem Alter.
*
Die Töpfervögel ( Furnarius) gehören zur Familie der Baumsteiger ( Anabatidae) und erinnern an manche Drosselvögel, können aber, wie Darwin bemerkt, mit keinem europäischen Vogel verglichen werden. »Wenn man«, sagt Burmeister, »die hohen Bergketten Brasiliens, die das waldreiche Küstengebiet von den inneren Grasfluren der Campos trennt, überschritten hat und nunmehr in das hügelige Tal des Rio dos Velhas hinabreitet, so trifft man überall an der Straße auf hohen, einzelnstehenden Bäumen neben den Wohnungen der Ansiedler große, melonenförmige Lehmklumpen, die auf wagerechten, armdicken Ästen stehen und mit regelmäßigen Wölbungen nach beiden Seiten und oben sich ausbreiten. Der erste Anblick dieser Lehmklumpen hat etwas höchst Überraschendes. Man hält sie etwa für Termitennester, bevor man den offenen Zugang auf der einen Seite bemerkt hat. Aber die auffallend gleiche Form und Größe spricht doch dagegen; denn die Termitennester sind sehr ungleich gestaltet und auch nie schwebend gebaut, sondern vorsichtig in einem Astwinkel angelegt. Hat man also die regelmäßige Form dieser Lehmklumpen einmal bemerkt, so ist man auch bald in der Lage, ihre Bedeutung zu ergründen. Man wird das große, eiförmige Flugloch nicht übersehen, auch, wenn man achtsam genug ist, bisweilen einen kleinen, rotgelben Vogel durch dasselbe aus- und einschlüpfen gewahren und daran leicht das wunderliche Gebäude als ein Vogelnest erkennen. Das ist es in der Tat, und zwar das Nest des Töpfervogels, den jeder Mineiro unter dem Namen Lehmhans, Joao de Barro, kennt und mit besonderen Gefühlen des Wohlwollens betrachtet.«
Der Töpfer- oder Ofenvogel, Lehmhans usw. ( Furnarius rufus), ist oberseits rostzimmetbraunrot, auf Kopf und Mantel matter, aus den Schwingen braun, auf der Unterseite lichter, auf der Kehlmitte reiner weiß gefärbt; vom Auge verläuft ein lebhaft gefärbter rostgelber Streifen nach hinten; die Schwingen sind grau, die Handschwingen an ihrer Wurzel auf eine Strecke hin blaßgelb gesäumt, die Steuerfedern rostgelbrot. Das Auge ist gelbbraun, der Schnabel braun, der Unterkiefer am Grunde weißlich, der Fuß braun. Die Länge beträgt neunzehn, die Breite siebenundzwanzig, die Fittichlänge zehn, die Schwanzlänge sieben Zentimeter.
Nach Orbignys Angaben lebt der Töpfervogel ungefähr nach Art unserer Drosseln, ebensowohl auf den Zweigen wie an dem Boden. Im Gezweige ist er sehr lebhaft und heiter, und namentlich die wunderbare Stimme läßt er häufig ertönen. Man findet ihn immer paarweise und meist für sich allein; doch kommt es vor, daß einer der beiden Gatten sich auch einmal mit anderen Vögeln vereinigt, und dann kann es, wie Orbigny sagt, nichts Erheiternderes geben, als das vorsichtige Gebaren des Männchens, obgleich es nicht immer zu Tätlichkeiten kommt. Die Nahrung besteht aus Kerbtieren und Sämereien, laut Burmeister nur aus ersteren, die vom Boden aufgenommen werden; denn an den Zweigen sieht man den Töpfervogel nie nach solchen jagen und noch weniger fliegende Kerfe verfolgen. Auf dem Boden bewegt er sich sehr gewandt, indem er mit großen Sprüngen dahinhüpft; der Flug dagegen ist, den kurzen Flügeln entsprechend, nicht eben rasch und wird auch niemals weit ausgedehnt. Die Stimme muß höchst eigentümlich sein, weil alle Beschreiber ihrer ausdrücklich gedenken, die einen mit Wohlwollen, die anderen in minder günstiger Weise. »Seine laute, weit vernehmliche Stimme«, sagt Burmeister, »ist gellend und kreischend, und gewöhnlich schreien beide Gatten, irgendwo auf einem Haufe oder Baume sitzend, zugleich, aber in verschiedenen Tönen und Tonleitern, das Männchen schneller, das Weibchen bedeutend langsamer und eine Terz tiefer.« Überraschend ist die Art und Weise allerdings, wenn man sie das erstemal hört, aber angenehm gewiß nicht, zumal da das Vogelpaar einem stets in die Rede fällt, das heißt zu schreien beginnt, wenn man irgendwo stehenbleibt und laut sprechend sich unterhält. Im Garten des Herrn Dr. Lund geschah mir dies täglich, und oft äußerte mein freundlicher Wirt, wenn die Vögel ihre Einsprache begannen: »Lassen Sie die nur erst ausreden; wir werden doch daneben nicht zu Worte kommen.«
»Das Nest«, bemerkt Burmeister, »ist für die kleinen Vögel wirklich ein staunenswürdiges Werk. Die Stelle, wo sie dasselbe anlegen, ist gewöhnlich ein völlig wagerechter oder mitunter selbst schwach ansteigender Teil eines acht Zentimeter oder darüber starken Baumzweiges. Sehr selten gewahrt man das Nest an andern Punkten, auf Dächern, hohen Balken, Kreuzen der Kirchen usw. Beide Gatten bauen gemeinschaftlich. Zuerst legen sie einen wagerechten Grund aus dem in jedem Dorfe häufigen Lehm der Fahrwege, der nach den ersten Regengüssen, die um die Zeit ihrer Brut sich einstellen, als Straßenkot zu entstehen pflegt. Die Vögel bilden aus demselben runde Klumpen, wie Flintenkugeln, und tragen sie auf den Baum, hier mit den Schnäbeln und Füßen sie ausbreitend. Gewöhnlich sind auch zerfahrene Pflanzenteile mit eingeknetet. Hat die Grundlage eine Länge von zwanzig bis zweiundzwanzig Zentimeter erreicht, so baut das Paar an jedes Ende derselben einen aufwärts stehenden, seitwärts sanft nach außen geneigten Rand, der am Ende am höchsten (bis fünf Zentimeter hoch) ist und gegen die Mitte der Seiten sich erniedrigt, so daß die Ränder von beiden Enden her einen hohlen Bogen bilden. Ist dieser Rand fertig und gehörig getrocknet, so wird darauf ein zweiter, ähnlicher gesetzt, der sich schon etwas mehr nach innen zu überbiegt. Auch diesen läßt der Vogel zuvörderst wieder trocknen und baut später in derselben Weise fort, sich von beiden Seiten zu einer Kuppel zusammenschließend. An der einen Langseite bleibt eine runde Öffnung, die anfangs kreisförmig erscheint, später aber durch Anbauen von der einen Seite her zu einem senkrecht stehenden Halbkreise verlängert wird. Sie ist das Flugloch. Das fertige Nest gleicht einem kleinen Backofen, pflegt fünfzehn bis achtzehn Zentimeter hoch, zwanzig bis zweiundzwanzig Zentimeter lang und zehn bis zwölf Zentimeter tief zu sein. Seine Lehmwand hat eine Stärke von fünfundzwanzig bis vierzig Millimeter, die innere Höhle umfaßt also einen Raum von zehn bis zwölf Zentimeter Höhe, zwölf bis fünfzehn Zentimeter Länge und sieben bis zehn Zentimeter Breite. Ein der Vollendung nahes Nest, das ich mitnahm, wiegt vier und ein halbes Kilogramm. In dieser Höhle erst baut der Vogel das eigentliche Nest. Dasselbe wird sorgfältig mit herumgelegten trockenen Grashalmen und nach innen mit eingeflochtenen Hühnerfedern, Baumwollbüscheln usw. ausgekleidet. Dann ist die Wohnung des Lehmhauses fertig. Der Vogel legt seine zwei bis vier weißen Eier hinein, und beide Gatten bebrüten sie und füttern ihre Jungen. Der erste Bau wird Ende August ausgeführt; die Brut fällt in den Anfang des September. Eine zweite Brut wiederholt sich später im Jahre.«
*
Wesen und Eigenart der Würger und Fliegenfänger vereinigen in sich die Tyrannen oder Königswürger ( Tyrannidae), eine für Amerika bezeichnende, auf beiden Hälften des Festlandes vertretene Familie. Wilson, Audubon, der Prinz von Wied und andere Forscher haben uns so ausführliche Mitteilungen über eine der berühmtesten Arten dieser Familie gemacht, daß wir uns einer genaueren Lebenskenntnis derselben rühmen dürfen. Der » Königsvogel« oder Tyrann ( Tyrannus carolinensis) zählt zu den mittelgroßen Arten der Sippe: seine Länge beträgt einundzwanzig, die Breite sechsunddreißig, die Fittichlänge zwölf, die Schwanzlänge neun Zentimeter. Das weiche und glänzende Gefieder, das sich auf dem Kopf zu einer Haube verlängert, ist auf der Oberseite dunkel blaugrau, auf den Kopfseiten am dunkelsten, während die schmalen Haubenfedern prachtvoll feuerfarbig und gelb gerandet sind; die Unterseite ist graulichweiß, auf der Brust aschgrau überflogen, an Hals und Kehle reinweiß; die Schwingen und Steuerfedern sind bräunlichschwarz, letztere dunkler gegen das Ende hin und wie die Flügeldeckfedern an der Spitze weiß. Das Auge ist dunkelbraun, der Schnabel schwarz, der Fuß graulichblau. Beim Weibchen sind alle Farben unscheinbarer und düsterer.
»Der Königsvogel«, erzählt Audubon, »ist einer von den anziehendsten Sommergästen der Vereinigten Staaten. Er erscheint in Louisiana ungefähr Mitte März. Viele verweilen hier bis Mitte September; aber die größere Anzahl zieht sich allgemach nordwärts und verbreitet sich über jeden Teil des Reiches. Die ersten Tage nach seiner Ankunft scheint der Vogel ermüdet und traurig zu sein; wenigstens verhält er sich vollkommen still. Sobald er aber seine natürliche Lebendigkeit wieder erlangt hat, hört man seinen scharfen, trillernden Schrei über jedem Feld und längs der Säume aller unserer Wälder. Im Innern der Waldungen findet er sich selten; er bevorzugt vielmehr Baumgärten, Felder, die Ufer der Flüsse und die Gärten, die das Haus des Pflanzers umgeben. Hier läßt er sich am leichtesten beobachten.«
Wenn die Brutzeit herannaht, nimmt der Flug dieser Vögel ein anderes Gepräge an. Man sieht die Gatten eines Paares in einer Höhe von zwanzig oder dreißig Meter über dem Grunde unter fortwährenden flatternden Bewegungen der Flügel dahinstreichen und vernimmt dabei fast ohne Aufhören seinen lauten Schrei. Das Weibchen folgt der Spur des Männchens, und beide scheinen sich nach einem geeigneten Platz für ihr Nest umzusehen. Währenddem haben sie aber auch auf verschiedene Kerbtiere wohl acht, lassen sich durch sie ab und zu aus ihrem Wege lenken und nehmen die erspähten mit einer geschickten Schwenkung auf. Dieses Spiel wird dadurch unterbrochen, daß beide sich dicht nebeneinander aus einen Baumzweig setzen, um auszuruhen. Die Wahl des Nistplatzes wird beendet, und nunmehr sucht sich das glückliche Pärchen trockene Zweige vom Boden auf, erhebt sich mit ihnen zu einem wagerechten Ast und legt hier den Grund zur Wiege seiner Kinder. Flocken von Baumwolle, Wolle oder Werg und ähnliche Stoffe, die dem Nest eine bedeutende Größe, aber auch ziemliche Festigkeit verleihen, werden auf diesem Grund aufgebaut, die Innenränder mit seinen Würzelchen und Roßhaaren ziemlich dick ausgepolstert. Nun legt das Weibchen seine vier bis sechs fünfundzwanzig Millimeter langen, neunzehn Millimeter dicken, auf rötlichweißem Grund unregelmäßig braun getüpfelten Eier und beginnt zu brüten. Jetzt zeigt sich das Männchen voller Mut und Eifer. In der Nähe der Gattin sitzt es auf einem Zweig und scheint keinen andern Gedanken zu hegen, als sie vor jeder Gefahr zu schützen. Die erhobenen und ausgebreiteten Federn des Hauptes glänzen im Strahle der Sonne; die weiße Brust leuchtet auf weithin. So sitzt es auf seinem Stand und läßt sein wachsames Auge rundum schweifen. Sollte es eine Krähe, einen Geier, einen Adler erspähen, gleichviel ob in der Nähe oder in der Ferne, so erhebt es sich jählings, wirft sich auf den gefährlichen Gegner, nähert sich ihm und beginnt nun, ihn mit Wut anzugreifen. Es stürzt sich auf seinen Feind hernieder, läßt seinen Schlachtruf ertönen, fällt wiederholt auf den Rücken des Gewaltigen herab und versucht, sich hier festzusetzen. In dieser Weise, den minder gewandten Gegner fortwährend durch wiederholte Schnabelstöße behelligend, folgt es ihm vielleicht eine (englische) Meile weit, bis es seine Pflicht getan zu haben glaubt. Dann verläßt es ihn und eilt, wie gewöhnlich mit den Flügeln zitternd und beständig trillernd, zu dem Nest zurück. Es gibt wenige Falken, die sich dem Nistplatz des Königsvogels nähern; selbst die Katze hält sich soviel wie möglich zu Hause, und wenn sie wirklich erscheinen sollte, stürzt sich der kleine Krieger, der ebenso furchtlos ist wie der kühnste Adler, mit so schneller und kräftiger Bewegung auf sie und bringt sie durch wiederholte Angriffe von allen Seiten derart außer Fassung, daß Hinz, in die Flucht geschlagen und beschämt, nach Hause zieht.
Der Königsvogel verdient die vollste Freundschaft und Begünstigung des Menschen. Die vielen Eier des Hühnerhofes, die er vor der plündernden Krähe beschützt, die große Kükenzahl, die, dank seiner Fürsorge, vor der räuberischen Klaue des Falken gesichert ist, die Menge von Kerbtieren, die er vernichtet, wiegen reichlich die wenigen Beeren und Feigen auf, die er frißt. Sein Fleisch ist zart und wohlschmeckend; es werden deshalb auch viele der nützlichen Tiere erlegt – nicht deshalb, weil sie Bienen fressen, sondern weil die Louisianer sehr gern die »Bienenfresser« verzehren.
*
Die Fruchtvögel ( Cotingidae) leben ebenfalls ausschließlich in Amerika, insbesondere im Süden dieses Erdteiles. Die Gesamtheit zerfällt in mehrere Unterfamilien, unter denen die der Klippenvögel ( Rupicolinae) die erste Stelle erhalten mag. Diese gehören zu den größeren Arten der Familie. Die bekannteste Art ist der Klippenvogel ( Rupicola crocea). Das reiche Gefieder des Männchens ist lebhaft orangerot; die Federn des Scheitelkammes sind dunkel purpurrot, die großen Flügeldeckfedern, die Schwingen und die Schwanzfedern, deren Grundfarbe braun ist, am Ende weißlich gerandet, alle Schwingen und Schwanzfedern außerdem am Grunde breit weiß gefleckt. Die Weibchen und die jungen Vögel sind einfarbig braun, die unteren Flügeldeckfedern orangerot, die Bürzel- und Schwanzfedern lichtrot gelbbraun; der Stirnkamm ist kleiner. Das Auge ist orangerot, der Schnabel blaß horngelb, der Fuß gelblich fleischfarben. Die Länge des Männchens beträgt einunddreißig, die Fittichlänge achtzehn, die Schwanzlänge zehn Zentimeter. Das Weibchen ist erheblich kleiner.
Gebirgsgegenden Guayanas und des nordöstlichen Teiles von Brasilien, die von Flüssen durchschnitten werden, sind die Heimat des Klippenvogels; Bergwälder und Gebirgstäler, die reich an Felsen sind, bilden seinen Aufenthalt. In der Ebene findet er sich nie. Besonders gern hält er sich in der Nähe von Wasserfällen auf, und je zerklüfteter ein Flußtal ist, um so mehr scheint es ihm zu behagen. Im Juni und Juli kommt er von seinen Felsenzinnen herunter in den Wald, um sich an den jetzt gereiften Früchten gewisser Waldbäume zu sättigen.
Viele Reisende haben über die Lebensweise dieses sonderbaren Vogels berichtet. Humboldt beobachtete ihn an den Usern des Orinoco, die Gebrüder Schomburgk fanden ihn an zwei Örtlichkeiten von Britisch-Guayaua, auf dem felsenreichen Kanukugebirge und an den Sandsteinfelsen des Wenamu, an beiden Orten häufig und gesellig lebend, aber nähere Verbindung mit andern Vögeln entschieden meidend. »Nachdem wir abermals eine steile Anhöhe erstiegen hatten«, sagt Richard Schomburgk, »die durch die riesigen, mit Moos und Farnkräutern überwachsenen Granitblöcke fast unwegsam gemacht wurde, trafen wir auf einen kleinen, fast ganz ebenen, von Gras und Gebüsche leeren Platz. Ein Zeichen der Indianer hieß mich schweigen und mich in das angrenzende Gebüsch verstecken, wie auch sie sich vollkommen geräuschlos dort verbargen. Kaum hatten wir einige Minuten hier ruhig gelegen, als ich aus ziemlicher Entfernung her eine Stimme vernahm, die dem Geschrei einer jungen Katze ähnelte, was mich auch zu der Annahme verleitete, daß es hier auf den Fang eines Vierfüßlers abgesehen sei. Eben war der Ton verklungen, als ich ihn unmittelbar neben mir von einem meiner Indianer täuschend wiederholen hörte. Der ans der Ferne antwortende kam immer näher, bis endlich der Ruf von allen Seiten her erwidert wurde. Obgleich mir die Indianer bemerklich gemacht, daß ich im Anschlag liegen bleiben möchte, überraschte mich der erste Klippenvogel doch so unerwartet, daß ich wirklich zu schießen vergaß. Mit der Schnelligkeit unserer Waldschnepfe kamen die reizenden Vögel durch das Gebüsch herbeigeflogen, setzten sich einen Augenblick nieder, um sich nach dem lockenden Genossen umzusehen, und verschwanden ebenso schnell wieder, als sie ihren Irrtum erkannt. Wir waren so glücklich gewesen, sieben Stück zu erlegen. Aber hatte ich auch die Vögel in meinen Besitz bekommen, noch war ich nicht Augenzeuge ihrer Tänze gewesen, von denen mir sowohl der Bruder wie auch die mich begleitenden Indianer schon so viel erzählt hatten.
Nach mehreren mühevollen, aber reich lohnenden Tagereisen erreichten wir endlich eine Gegend, in der uns dieses Schauspiel werden sollte. Während einer Pause zum Atemschöpfen hörten wir seitwärts von uns Töne mehrerer lockenden Klippenvögel, denen augenblicklich zwei der Indianer mit den Gewehren zuschlichen. Bald darauf kehrte einer derselben zurück und gab mir durch Zeichen zu verstehen, daß ich ihm folgen möchte. Nachdem wir etwa einige tausend Schritte mit der größten Vorsicht und von meiner Seite zugleich unter der gespanntesten Neugier durch das Gebüsch gekrochen, sah ich den andern platt auf dem Boden liegen und zugleich das glänzend orangene Gefieder des Klippenvogels durch das Gebüsch leuchten. Vorsichtig legte ich mich neben dem Indianer nieder und wurde nun Zeuge eines der anziehendsten Schauspiele. Eine ganze Gesellschaft jener herrlichen Vögel hielt eben auf der glatten und platten Oberfläche eines gewaltigen Felsblockes ihren Tanz. Auf dem den Block umgebenden Gebüsch saßen offenbar einige zwanzig bewundernde Zuschauer, Männchen und Weibchen, während die ebene Platte des Blockes von einem der Männchen unter den sonderbarsten Schritten und Bewegungen nach allen Seiten hin überschritten wurde. Bald breitete der neckische Vogel seine Flügel halb aus, warf dabei den Kopf nach allen Seiten hin, kratzte mit den Füßen den harten Stein, hüpfte mit größerer oder minderer Geschwindigkeit immer von einem Punkte aus in die Höhe, um bald darauf mit seinem Schwanz ein Rad zu schlagen und in gefallsüchtiger Haltung wieder auf der Platte herumzuschreiten, bis er endlich ermüdet zu sein schien, einen von der gewöhnlichen Stimme abweichenden Ton ausstieß, auf den nächsten Zweig flog und ein anderes Männchen seine Stelle einnahm, das ebenfalls seine Tanzfertigkeit und Anmut zeigte, um ermüdet nach einiger Zeit einem neuen Tänzer Platz zu machen.« Robert Schomburgk erwähnt noch außerdem, daß die Weibchen diesem Schauspiel unverdrossen zusehen und bei der Rückkehr des ermatteten Männchens ein Beifall bezeichnendes Geschrei ausstoßen. »Hingerissen von dem eigentümlichen Zauber«, fährt Richard Schomburgk fort, »hatte ich die störenden Absichten der neben mir liegenden Indianer nicht bemerkt, bis mich plötzlich zwei Schüsse aufschreckten. In verwirrter Flucht zerstob die harmlose Gesellschaft nach allen Seiten hin und ließ vier getötete Genossen auf dem Platz ihres Vergnügens zurück.«
Es unterliegt keinem Zweifel, daß dieser Tanz nur mit der Balze unsers Hahnes verglichen werden kann und zu Ehren des Weibchens ausgeführt wird. Doch scheint das Brutgeschäft nicht an einen bestimmten Jahresabschnitt gebunden zu sein, da Schomburgk ebensowohl im April und Mai wie auch im Dezember die jungen Vögel sah, die die Indianer eben erst aus den Nestern genommen haben konnten; weil aber das Gefieder im Monat März am schönsten und vollkommensten ist, dürfte wenigstens die Mehrzahl in den erstgenannten Monaten brüten. Das Nest steht an Felsenwänden, nach Humboldt gewöhnlich in den Höhlungen kleiner Granitfelsen, wie sie sich so häufig durch den Orinoco ziehen und so zahlreiche Wasserfälle bilden, nach Schomburgk in Spalten und Vertiefungen, wo es wie das Nest der Schwalbe befestigt und zwar mit Harz angeklebt wird. Es scheint, daß ein und dasselbe Nest mehrere Jahre nacheinander benutzt und nach jeder Brutzeit nur durch einige Wurzeln, Fasern und Flaumenfedern ausgebessert und außen mit jener harzigen Masse überzogen wird. In einzelnen Spalten findet man mehrere Nester nebeneinander, ein Zeichen für große Verträglichkeit dieser Vögel. Das Gelege besteht aus zwei weißen, mit schwärzlichen Punkten gesprenkelten Eiern, die etwas größer sind als die unserer Tauben. Die Jungen werden wahrscheinlich nur mit Früchten großgezogen, die wohl auch das ausschließliche Futter der Alten bilden.
Gefangene Klippenvögel scheinen zu den Lieblingen der Indianer zu gehören. In Pararuma wurden solche Humboldt angeboten. Sie staken in kleinen, niedlichen Bauern, die aus Palmblattstielen verfertigt waren.
*
In der zweiten Unterfamilie vereinigt man die Kropfvögel ( Gymnoderinae), die größten, zwischen Krähen- und Drosselgröße schwankenden Arten der Familie. Genauer sind wir über die Glockenvögel ( Chasmarhynchus) unterrichtet. Sie gehören zu den kleineren Mitgliedern der Unterfamilie und kommen höchstens einer Taube an Größe gleich. Bezeichnend sind Hautwucherungen in der Schnabelgegend, die wie bei unsern Truthähnen sich bald verlängern, bald verkürzen.
Der Glockenvogel oder Schmied ( Chasmarhynchus nudicollis) ist schneeweiß; die nackten Zügel und die nackte Kehle sind lebhaft spangrün. Das Auge ist silberweiß, der Schnabel schwarz, der Fuß fleischfarben. Das etwas kleinere Weibchen ist am Scheitel und an der Kehle schwarz, auf der Oberseite zeisiggrün, auf der Unterseite gelb, schwarz in die Länge gefleckt, am Hals weißlich und gelblich gestrichelt. Das junge Männchen ähnelt im ersten Jahre dem Weibchen, wird dann weiß gefleckt und erhält im dritten Jahr sein ausgefärbtes Kleid. Die Länge beträgt sechsundzwanzig, die Breite fünfzig, die Fittichlänge sechzehn, die Schwanzlänge sieben Zentimeter.
Von dieser zuerst beschriebenen Art der Sippe unterscheidet sich der Glöckner ( Chasmarhynchus carunculatus) dadurch, daß das ebenfalls reinweiße Männchen auf der Schnabelwurzel einen hohlen, schwarzen, muskeligen Zipfel trägt, der mit einigen weißen Federchen besetzt ist, willkürlich ausgedehnt und eingezogen werden kann, und in ersterem Falle wie ein Horn nach oben, im letzteren wie die sogenannte Nase des Truthahnes an der Seite des Schnabels herabhängt. Bei einer dritten Art, der wir den in Südamerika üblichen Namen Araponga lassen wollen ( Chasmarhynchus variegatus), ist das nackte Kehlfeld mit Hautröhrchen bündelartig besetzt; bei dem Hämmerling ( Chasmarhynchus tricarunculatus) endlich zieren die Stirnmitte und die Schnabelwurzel jederseits je ein fünf bis sieben Zentimeter langer Hautkegel.
Die Glockenvögel sind in Südamerika heimisch. Der Schmied bewohnt Brasilien und ist hier in den Waldungen sehr häufig; der Glöckner herbergt in Guayana, die Araponga im nördlichen Südamerika, der Hämmerling in Costarica. Aus den bisher bekanntgewordenen Mitteilungen der reisenden Forscher scheint hervorzugehen, daß sich die Lebensweise dieser Vögel im wesentlichen ähnelt.
»Dieser merkwürdige Vogel«, sagt der Prinz von Wied vom Glockenvogel, »ist sowohl durch sein blendendweißes Gefieder sowie durch seine laute, hellklingende Stimme eine Eigenheit der prachtvollen brasilischen Waldungen und fällt dem Fremdling gewöhnlich sogleich und zuerst auf. Er ist überall verbreitet, wo Urwaldungen sind, in deren dunkelsten Verflechtungen er sich am meisten zu gefallen scheint. Doch kommt er nicht überall in gleicher Häufigkeit vor, scheint vielmehr gebirgigen Urwald besonders zu lieben. Seine Stimme ähnelt dem Tone einer hellklingenden Glocke, wird einzeln ausgestoßen, eine Zeitlang ausgehalten und auch öfters kurz hintereinander wiederholt. Dann gleicht sie den Lauten, die der Schmied hervorbringt, wenn er mit dem Hammer wiederholt auf den Amboß schlägt. Man vernimmt diese Stimme zu allen Stunden des Tages sehr häufig und auf weithin. Gewöhnlich halten sich mehrere der Vögel in einer und derselben Gegend auf und reizen sich wechselseitig. Der eine schallt laut und hell mit einem einfachen Tone; der andere läßt das oft wiederholte, klingende Getön hören, und so entsteht an Stellen, wo viele dieser Vögel vereinigt sind, ein höchst sonderbares Konzert. Gewöhnlich wählt der Schmied seinen Stand auf einem der oberen dürren Äste eines gewaltigen Waldstammes und läßt von dort oben seine klingende, metallische Stimme erschallen. Man sieht alsdann den blendendweißen Vogel gegen den dunkelblauen Himmel gemalt, kann ihn aber von jener Höhe nicht herabschießen. Auch fliegt er gewöhnlich sogleich ab, sobald er etwas Fremdartiges bemerkt. An Stellen, wo der Wald niedriger ist, sitzen diese Vögel in einer dichten, dunklen Laubmasse, wo man ihre Stimme vernimmt, ohne das schneeweiße Ziel erspähen zu können.«
»Inmitten der ausgedehnten Wildnisse«, schildert Waterton, »gewöhnlich auf dem dürren Wipfel einer alten Mora und fast immer außer aller Schußhöhe wird man den Glöckner bemerken. Kein Laut oder Gesang von irgendeinem geflügelten Bewohner der Wälder, nicht einmal das deutlich ausgesprochene › Whip-poor-vill‹ des Ziegenmelkers kann so in Erstaunen setzen wie das Geläute des Glöckners. Wie so viele der gefiederten Klasse, bezahlt er dem Morgen und dem Abend durch Gesang seinen Zoll; aber auch, wenn die Mittagssonne Stillschweigen geboten und den Mund der belebten Natur geschlossen, ruft er noch sein heiteres Getön in den Wald hinaus. Man hört das Geläute, dann tritt eine minutenlange Pause ein, hierauf folgt wieder ein Glockenschlag und wiederum eine Pause, und so wechselt es zum dritten Male ab. Dann schweigt er sechs oder acht Minuten lang, und hierauf beginnt er von neuem. Aktäon würde seine eifrigste Jagd unterbrechen, Maria ihr Abendlied verzögern, Orpheus selbst seinen Gesang aufgeben, um diesen Vogel zu belauschen, so süß, so neu, so romantisch ist der Klang seiner Stimme.« »Ich vernahm«, sagt Schomburgk, wohl Waterton benutzend, »aus dem nahen Walde wunderbare Töne, wie ich sie noch nie gehört. Es war, als schlüge man zugleich an mehrere harmonisch gestimmte Glasglocken. Jetzt hörte ich sie wieder und nach einer minutenlangen Pause wieder und wieder. Dann trat ein etwas längerer Zwischenraum von etwa sechs bis acht Minuten ein, und von neuem erschallten die vollen harmonischen Töne. Eine ganze Zeit stand ich, vor Erstaunen gefesselt, und lauschte, ob sich die fabelhaften Klänge nicht abermals hören lassen würden; sie schwiegen, und voller Begierde wandte ich mich mit meinen Fragen an meinen Bruder, von dem ich nun erfuhr, daß dies die Stimme des Glöckners sei. Kein Gesang, keine Stimme irgendeines der befiederten Bewohner der Wälder Guayanas, selbst nicht die so deutlich ausgesprochenen Worte der Ziegenmelker, hatten mich in gleiches Erstaunen versetzt, wie die Glockentöne des Hämmerlings. Daß die Vögel in Guayana die Gabe der Sprache besaßen, hatte ich ja bei meinem ersten Schritt auf diesem merkwürdigen Erdteil schon erfahren; solche Töne aber waren mir bisher noch gänzlich unbekannt geblieben, und meine Aufmerksamkeit konnte jetzt auf nichts anderes gerichtet, durch nichts anderes von diesem wunderbaren Sänger abgezogen werden.
In der Nähe der Küste gehört der Glöckner zu den Strichvögeln; die unmittelbare Küste besucht er nie. Hohe Gebirgswaldungen scheint er am meisten zu lieben, jedoch nur bis zu einer Meereshöhe von vier- bis fünfhundert Meter emporzusteigen.«
Ich habe Gelegenheit gehabt, einen gefangenen Glockenvogel längere Zeit zu beobachten und bin daher imstande, Vorstehendes zu ergänzen. Das allerdings laute und metallische, in der Nähe gehört aber sehr rauhe, etwas kratzende und wenig wohllautende, eher unangenehme Geschrei erinnert am meisten an die Stimmlaute der Froschlurche. Der Laut, den man am häufigsten und nach oftmaliger Zählung in Zwischenräumen einer halben Sekunde sieben- bis fünfundzwanzigmal nacheinander vernimmt, klingt in der Nähe wie »Garrëi«, wobei der erste Selbstlauter nur angedeutet wird, die letzten beiden dagegen hell und vernehmlich, dem Schlage eines Hammers auf dem Amboß ähnlich klingen. Zuweilen hört man auch piepende Laute, die so schwach sind, daß sie schon in geringer Entfernung verklingen. Manchmal vertönt er seinen Hauptruf in ungewöhnlicher Weise, indem er ein heiseres »Grrr« als Vorschlag ausstößt und diesem ein lautes, helles, langgezogenes »Iii« anhängt. Wenn er einmal schreit, stößt er die Hauptlaute in Absätzen von zehn bis fünfzehn Sekunden Dauer aus, unterbricht sich jedoch manchmal, um mit verschiedenen Lauten abzuwechseln. Er bringt dann mehrere Male den Hauptlaut hervor, schweigt hierauf ein Weilchen, ruft nunmehr eine halbe Minute lang fast ununterbrochen in gewöhnlicher Weise, schweigt wiederum ein wenig und läßt endlich die Laute mit dem heiseren Vorschlage vernehmen. Die piependen Laute hört man nur, wenn er zusammengekauert auf einem Aste hockt und tiefster Ruhe pflegt, die lauten, gellenden dagegen, wenn er aufgerichtet sitzt oder sich bewegt. Je länger er schreit, um so erregter scheint er zu werden, so daß man nicht verkennen kann, daß er sich währenddem in einem Liebesrausche befindet oder balzt. Mit Beginn des gellenden Geschreies hebt er den Kopf hoch empor, sperrt den Schnabel so weit auf, daß der Oberteil fast senkrecht, der Unterteil beinahe wagerecht steht, stößt, ohne den Schnabel zu schließen, die einzelnen Töne tief aus der Brust heraus, springt mit weitgespreizten Beinen rasch auf dem Zweige hin und her, hebt den Schwanz gestelzt über die Flügel, zittert auch auf Augenblicke mit letzteren und klappt erst mit dem letzten Laute die Kiefer wieder zusammen. Bei jedem Laute bewegt sich der Schnabel zuckend ein wenig, Hals, Brust und Unterleib aber erheblich; die Kehle wird gebläht, und das nackte Kehlfeld schwingt ersichtlich; die Brust hebt und senkt sich jählings, und die Erschütterung des ganzen Körpers ist so groß, daß man glauben möchte, die Brust müsse zerspringen. Erhöht sich die Erregung, so neigt er sich schief nach unten, bewegt schüttelnd den Kopf, insbesondere aber die Kehle, stelzt den Schwanz höher als je, streckt ein Bein aus, so weit er kann, krampft den Fuß des andern zusammen, verdreht beide, wendet sich abwechselnd zur linken und rechten Seite und schnellt unter gleichzeitigem Ausstoßen des letzten, durch eine kurze Pause von den übrigen getrennten Hauptlautes zurück oder springt mit einem seitlichen Satze jählings auf eine andere Sitzstelle oder dreht sich auf einer und derselben Stelle mehrmals um sich selbst. Nach Verlauf von einer bis zwei Stunden ermattet er endlich und hockt dann schweigend auf einem Aste nieder, um zu ruhen.
Beeren und Früchte scheinen die gewöhnliche Nahrung der Glockenvögel zu bilden.
Gefangene Glockenvögel gelangen in der Neuzeit nicht allzuselten lebend in unsere Käfige, halten sich auch bei einfachem, aus gekochtem Reis, Möhren und Kartoffeln bestehendem Futter mehrere Jahre.
*
»Unsere im gleichen Schritt fortschreitende Reihe mußte an der Spitze ein unerwartetes Hindernis gefunden haben: die Bewegung stockte. Voll Befürchtung eilte ich dorthin; die ersten des Zuges standen vor einem braunen, vier bis fünf Meter breiten Bande; denn so und nicht anders sah der dichtgedrängte Heerzug der Wanderameise aus, der eben unseren Pfad kreuzte. Zu warten, bis dieser vorüber war, hätte uns zu lange aufgehalten, der Durchbruch dieses Heeres mußte im raschen Laufe unter gewaltigen Sprüngen erzwungen werden. Bis an die Knie mit den wütendgewordenen Kerfen bedeckt, durchbrachen wir die dichte Reihe, ohne uns jedoch, trotzdem wir sie mit den Händen zerquetschten und mit den Füßen zerstampften, ganz vor den schmerzhaften Bissen der gereizten Tiere retten zu können. Greift ein solches Heer, von dem niemand weiß, woher es kommt, noch wohin es zieht, auch alles an, das sich ihm auf seinem Wege entgegenstellt, so hat es doch ebenfalls seine Feinde, namentlich unter den Vögeln, die es stets in großer Anzahl begleiten.« So schildert Schomburgk und berichtet sodann einiges über die Lebensweise jener Vögel, die ich nun zunächst leiblich beschreiben will.
Die Ameisenvögel ( Formicariidae), eine reiche, auf Südamerika beschränkte Familie bildend, erinnern ebenso an unsere Drosseln wie an die Sänger und Würger. Bezeichnend für die Gesamtheit ist, laut Prinz von Wied, »daß die Füße auf Unkosten der Flügel ausgebildet sind«. Die Ameisenvögel bewohnen die ausgedehnten Waldungen der Ebenen oder die buschigen Strecken der Steppengegenden, meiden aber das Gebirge. Je ausgedehnter, je feuchter und heißer der Wald, um so häufiger finden sie sich. Einige Arten kommen in der Nähe bewohnter Ortschaften vor; die große Mehrzahl dagegen hält sich verborgen im Innern der Dickichte und scheint auf den Boden angewiesen zu sein. Das Fliegen wird allen Ameisenvögeln schwer, und man ficht sie nur im äußersten Notfall ihre Flügel gebrauchen; ja einzelne von ihnen erheben sich kaum jemals fliegend über den Boden, sondern suchen auch in der ärgsten Not ihr Heil in der Kraft ihrer Füße, indem sie mit verdoppelter Eile dahinrennen, falls sie es nicht vorziehen, sich platt auf den Boden zu drücken. Im Laufen wetteifern sie mit jedem andern Vogel; denn sie rennen nicht bloß sprungweise über den Boden dahin, mit einer Schnelligkeit, daß es einem Hunde Mühe macht, sie einzuholen, sondern sie springen auch mit gewaltigen Sätzen hoch vom Boden auf erhabene Gegenstände oder von diesen wieder herab. Laufend oder hüpfend durchmessen sie ungeheure Strecken der Wälder, wie Orbigny sagt, »das ganze Gebiet ihres Verbreitungskreises«. Sie ziehen nicht regelmäßig; aber sie sind beständig auf der Wanderung. Nur während der Nistzeit fesselt sie die Sorge um ihre Brut an eine und dieselbe Örtlichkeit. Ihre Stimme ist höchst verschieden. Einige lassen brummende Laute vernehmen, andere stoßen einen wiederholten Pfiff aus, andere wiederum zwitschern, einzelne geben einen kurzen, aber laut tönenden Gesang zum besten, mehrere sind im höchsten Grade schweigsam.
Kerbtiere bilden die hauptsächlichste Nahrung der Ameisenvögel; doch verschmähen einige auch Pflanzenstoffe nicht. Erstere sammeln sie hauptsächlich vom Boden auf, indem sie die abgefallenen Blätter mit dem Schnabel umwälzen; einzelne scharren aber auch wie die Hühner, wenn sie rascher zum Ziele kommen wollen. Sie lieben die Ameisen, ohne daß man jedoch sagen kann, daß diese ihre bevorzugte Speise wären.
Einer der bekanntesten Ameisenvögel ist das Feuerauge ( Pyriglena domicella), Vertreter einer gleichnamigen Sippe. Bei dem männlichen Feuerauge sind Schnabel, Füße und der größte Teil des Gefieders schwarz, die Flügeldeckfedern am Bug weiß und die großen Deckfedern weiß gerandet. Das Auge ist, dem Namen entsprechend, dunkel feuerrot. Das Weibchen ist olivenbraun, an der Kehle und auf dem Nacken blaßgelb. Die Länge beträgt achtzehn, die Breite dreiundzwanzig, die Fittichlänge acht, die Schwanzlänge sieben Zentimeter.
Das Feuerauge ist in allen Waldungen Brasiliens nicht selten und kriecht überall in den dichten und dunklen Gebüschen der großen Wälder umher. Sein feurigrotes Auge sticht lebhaft ab von dem kohlschwarzen Gefieder, und der Vogel wird schon deshalb leicht bemerklich. Die Stimme ist ein pfeifendes Gezwitscher.
Daß dieser nette Vogel ein eifriger Ameisenjäger ist, erfahren wir durch Kittlitz. »Ich begegnete«, erzählt er, »in einem Dickicht des Waldes einem ungeheuren Schwarm großer, schwarzer Ameisen, die um die Trümmer starker Bambusstengel her gerade sehr beschäftigt waren, während sowohl männliche als weibliche Feueraugen ihnen mit großer Gier und Behendigkeit nachstellten. So schüchtern sich die Vögel auch zeigten und so gewandt sie einem Schuß auszuweichen wußten, war doch ihre Begierde nach den Ameisen so groß, daß selbst das Schießen sie nur augenblicklich verscheuchte. Ich konnte, am Boden lauernd und immer wieder ladend, bald sechsmal nacheinander Feuer geben. Überraschend war es für mich, in dem Magen der geschossenen fast nur Überreste von Heuschrecken und andern Geradflüglern zu finden. Es scheint also, daß die Ameisen mehr Leckerbissen als regelmäßige Nahrung dieser Vögel bilden.« Andere Forscher versichern ebenfalls, daß in der Nähe eines wandernden Ameisenheeres die Jagd auf diese sonst so vorsichtigen Vögel überaus leicht ist. Schwerer aber hält es, die geschossenen aus der Mitte des wandernden Heeres hervorzuholen, ohne von hundert erbitterten Kerfen gebissen zu werden. Auch Kittlitz hebt hervor, daß er von den Ameisen fürchterlich gebissen wurde, obgleich sie zum Glück zu eilig waren, als daß sie sich in Massen aus ihn geworfen hätten.
*
Die Leierschwänze ( Menuridae), zwei in Australien heimische Sperlingsvögel, bilden die letzte Familie der Ordnung. Ihre Gestalt ist eine so eigenartige, daß man sie wohl mit andern Sperlingsvögeln vergleichen, nicht aber vereinigen kann. Sehr groß, fasanähnlich gebaut, hochläufig, kurzflügelig und langschwänzig, stellen sie eine der absonderlichsten aller Vogelgestalten dar. Der sehr lange Schwanz wird aus verschiedenartig gebildeten Federn zusammengesetzt. Diejenigen, die man als die eigentlichen Steuerfedern bezeichnen möchte, zwölf an der Zahl, können kaum mehr Federn genannt werden, weil die Fahnenstrahlen nicht zusammenhängen, sondern weit voneinander stehen, so daß sie den zerschlissenen Schmuckfedern mancher Reiherarten ähneln; die beiden mittleren und die beiden äußeren Steuerfedern dagegen sind mit zusammenhängenden Fahnen besetzt, erstere mit sehr schmalen, letztere, die außerdem S-förmig gekrümmt sind, mit schmalen Außen- und sehr breiten Innenfahnen. Diese Schwanzbildung, der schönste Schmuck des Vogels, kommt übrigens bloß dem Männchen zu; denn der Schwanz des Weibchens besteht nur aus zwölf abgestuften Steuerfedern von gewöhnlicher Form. Das Gefieder ist reich und locker, auf Rumpf und Rücken fast haarartig, auf dem Kopfe hollenartig verlängert, um die Schnabelwurzel herum in Borsten verwandelt.
Die Färbung des Leierschwanzes ( Menura superba) ist der Hauptsache nach ein dunkles Braungrau, das auf dem Bürzel rötlichen Anflug zeigt; die Kehle und Gurgelgegend sind rot, die Unterteile bräunlich aschgrau, blasser am Bauche, die Armschwingen und die Außenfahne der übrigen rotbraun; der Schwanz ist auf der Oberseite schwärzlichbraun, auf der Unterseite silbergrau; die Außenfahnen der beiden leierförmigen Federn sind dunkelgrau, ihre Spitzen samtschwarz, weiß gefranst, ihre Innenfahnen abwechselnd schwarzbraun und rostrot gebändert, die mittleren Schwanzfedern grau, die übrigen schwarz. Die Länge des Männchens beträgt einhundertdreißig, die Fittichlänge neunundzwanzig, die Schwanzlänge siebzig Zentimeter. Das Weibchen ist bedeutend kleiner, die Färbung seines Gefieders ein schmutziges Braun, das auf dem Bauche ins Graue übergeht. Ihm ähneln die jungen Männchen bis zur ersten Mauser.

Leierschwanz ( Menura superba)
Wir verdanken Gould die ausführlichsten Beobachtungen über die Lebensweise der Leierschwänze und sind durch Becker und Ramsay auch über das Fortpflanzungsgeschäft unterrichtet worden. Das Vaterland des Vogels ist Neusüdwales, östlich bis zur Moritonbay, südwestlich bis gegen Port Philipp hin; seine Aufenthaltsorte sind dichte Buschwaldungen auf hügeligem oder felsigem Grunde. »Das Umherklettern in diesen Bergen«, schildert ein Leierschwanzjäger, »ist nicht bloß beschwerlich, sondern auch höchst gefährlich. Die Spalten und Klüfte sind mit ungeheuren Massen halbverwester Pflanzenstoffe bedeckt, in denen man wie in Schnee knietief watet. Ein falscher Tritt, und der Mann verschwindet oder bleibt wie ein Keil in den Felsspalten stecken. Ein Glück, wenn er seine Waffe noch gebrauchen, wenn er sich vermittels eines Schusses durch den Kopf vom langsamen Verschmachten befreien kann; denn Hilfe ist unmöglich.« An solchen Orten hört man den Leierschwanz überall, aber man hört ihn eben nur. Gould verweilte tagelang in den Gebüschen, war von Vögeln umgeben, hörte ihre laute, helle Stimme, vermochte aber nicht, einen von ihnen zu Gesicht zu bekommen, und nur die rücksichtsloseste Ausdauer und die äußerste Vorsicht belohnten später seine Bemühungen.
Diese Schwierigkeit, sich dem vorsichtigen Geschöpf zu nähern und sozusagen mit ihm zu verkehren, läßt es begreiflich erscheinen, daß wir trotz aller Jagdgeschichten, die die Reisenden uns mitgeteilt haben, ein klares Bild der Lebensweise, des Betragens, der Gewohnheiten und Sitten des Leierschwanzes noch nicht haben gewinnen können. Alle Beobachter stimmen in dem einen überein, daß der Vogel den größten Teil seines Lebens auf dem Boden zubringt und nur höchst selten zum Fliegen sich bequemt. Laufend durchmißt er die ungeheuren Waldungen, eilt er über liegende Baumstämme oder selbst durch das Gezweig derselben weg, klimmt er an den starren und rauhen Felswänden empor; springend erhebt er sich plötzlich bis zu drei Meter und mehr über den vorher eingenommenen Stand, senkt er sich von der Höhe der Felswände zur Tiefe herab, und nur wenn er den Grund einer Felsspalte besuchen will, nimmt er zu den Schwingen seine Zuflucht. Bartlett, der einen Leierschwanz pflegte, nennt ihn einen der unruhigsten und beweglichsten aller Vögel und die Schnelligkeit seines Laufes geradezu erstaunlich, um so mehr, als er unglaublich weite Entfernungen mit unvergleichlicher Hurtigkeit und Gewandtheit überspringt. Bei eiligem Laufe trägt er sich wie ein Fasan, den Leib sehr gestreckt, den Kopf vornübergebeugt, den langen Schwanz wagerecht und zusammengelegt gehalten, weil dies die einzige Möglichkeit ist, das Buschdickicht zu durchmessen, ohne seinen prächtigsten Schmuck zu beschädigen. Morgens und abends ist er am tätigsten, während der Brutzeit aber treibt er sich auch in den Mittagsstunden auf besonders vorgerichteten Plätzen umher. Jedes Männchen wirft scharrend kleine Hügel auf und bewegt sich auf ihnen nach Art balzender Hühner, indem es unablässig auf jenen Hügeln umhertritt, dabei den Schwanz emporhält, ihn äußerst zierlich ausbreitet und seinen Gefühlen außerdem durch die verschiedensten Laute Ausdruck gibt. Die Stimme ist, den entwickelten Singmuskeln durchaus entsprechend, außerordentlich biegsam, der gewöhnliche Lockton laut, weitschallend und schrillend, der Gesang je nach der Örtlichkeit verschieden, weil ein Gemisch von eigenen und von erborgten oder gestohlenen Lauten. Der eigentümliche Gesang scheint eine sonderbare Bauchrednerei zu sein, die man nur hören kann, wenn man dem Sänger selbst bis auf einige Meter nahe ist. Die Strophen desselben sind lebhaft, aber verworren, brechen oft ab und werden dann mit einem tiefen, hohlen und knackenden Laute geschlossen. »Dieser Vogel«, sagt Becker in vollkommenster Übereinstimmung mit andern Beobachtern, »besitzt wohl die größte Gabe, Töne aller Art nachzuahmen. Um einen Begriff zu geben, wie weit diese Fähigkeit geht, führe ich folgendes an. In Gippsland steht nahe dem südlichen Abhange der australischen Alpen eine Holzschneidemaschine. Dort hört man an stillen Sonntagen fern im Walde das Bellen eines Hundes, menschliches Lachen, Gesang und Gekreisch von vielen Vögeln, Kindergeheul und dazwischen das ohrenzerreißende Geräusch, das das Schärfen einer Säge hervorruft. Alle diese Laute und Töne bringt ein und derselbe Leierschwanz hervor, der unweit der Schneidemaschine seinen Ruhesitz hat.« Gegen die Brutzeit hin verdoppelt sich diese Redseligkeit noch bedeutend; er ersetzt dann, wie die Spottdrossel Amerikas, ein ganzes Heer von singenden Vögeln. Fremden Geschöpfen gegenüber bekundet der Leierschwanz die äußerste Vorsicht; es scheint aber, daß er den Menschen noch ängstlicher flieht als die Tiere. Mit seinesgleichen vereinigt er sich niemals, denn man trifft ihn immer paarweise an und beobachtet, daß zwei Männchen, die sich begegnen, augenblicklich miteinander in den heftigsten Streit geraten und sich erbittert umherjagen.
Die Nahrung besteht größtenteils in Kerbtieren und Würmern. Gould fand besonders Tausendfüße, Käfer und Schnecken in dem Magen der von ihm oder seinen Jägern erlegten Stücke. Einen beträchtlichen Teil seines Futters gewinnt der Vogel durch Scharren. Hierbei betätigt er ebensoviel Kraft wie Geschick; denn er wälzt, obgleich er seitlich, nicht nach hinten scharrt, Erdklumpen oder Steine bis zu vier Kilogramm Gewicht zur Seite, um etwa darunter verborgene Tiere zu erlangen. Sämereien verzehrt er ebenfalls, obschon vielleicht nur zu gewissen Zeiten. Unverdauliche Reste speit er in Gewöllen aus.
Nach Beckers Erfahrungen fällt die Brutzeit in den August; nach Ramsay dagegen beginnt der Vogel bereits im Mai am Nest zu arbeiten und legt sein Ei schon im Juni, spätestens im Juli. Der zum Nisten gewählte Lieblingsplatz ist das dichte Gestrüpp an Abhängen der tiefen und schroffen Klüfte, an denen die Gebirge so reich sind, oder aus den kleinen Ebenen, die zwischen den Flußwindungen am Fuße der Gebirge liegen. Hier sucht der Vogel junge Bäume aus, die dicht nebeneinander stehen und deren Stämmchen eine Art von Trichter bilden; zwischen diesen Stämmchen, zuweilen auch auf einem ausgehöhlten Baumstamme oder in einem nicht allzu hohen Farnstrauche, einer Felsennische, einem vom Feuer teilweise zerstörten Baumstamm, meist nicht hoch, ausnahmsweise auch in beträchtlicher Höhe über begehbarem Boden, steht das Nest, ein je nach dem Standort und den am leichtesten zu beschaffenden Stoffen verschieden zusammengesetzter, immer aber großer, länglich eiförmiger und überdachter Bau von etwa sechzig Zentimeter Länge und dreißig Zentimeter Höhe. Der Unterbau besteht in der Regel aus einer Lage von groben Reisern, Holzstücken und dergleichen, das eigentliche, kugelförmige Nest aus feinen, biegsamen Wurzeln, die innere Ausfütterung aus den zartesten Federn des Weibchens. Die obere Hälfte ist nicht dicht mit der unteren verbunden, läßt sich leicht von ihr trennen, bildet also das Dach des ganzen Baus und besteht wie der untere Teil aus grobem Gehölz, Gras, Moos, Farnblättern und ähnlichen Stoffen. Von weitem sieht ein solches Nest aus, als wäre es weiter nichts als ein Bündel trockenen Reisigs. Eine seitliche Öffnung dient als Eingang in das Innere des anscheinend so liederlichen, in Wirklichkeit aber sehr haltbaren, oft für mehrere Jahre dienenden Baus. Der Leierschwanz brütet nur einmal im Jahre und legt bloß ein einziges Ei, das dem einer Ente an Größe etwa gleichkommt, ungefähr sechzig Millimeter lang, vierzig Millimeter dick und auf hell aschgrauem Grunde schwach mit dunkelbräunlichen Flecken gezeichnet ist. Das Weibchen brütet allein, wird währenddem vom Männchen nicht geatzt, anscheinend nicht einmal besucht, verläßt daher in den Mittagsstunden oft auf längere Zeit das Nest und zeitigt das Ei kaum vor Ablauf eines Monats. Nach einem Ausflug zum Nest zurückkehrend, kriecht es durch den Eingang ins Innere, dreht sich dann um und nutzt dabei die Schwanzfedern in so erheblicher Weise ab, daß man an ihnen erkennen kann, ob es bereits längere oder kürzere Zeit gebrütet hat. Das Junge verläßt das Nest nicht, bevor es acht bis zehn Wochen alt geworden ist. Eins, das Becker beobachtete, war fast unbefiedert und zeigte nur hier und da schwarze, Pferdehaaren ähnliche Federgebilde. Die Mitte des Kopfes und des Rückgrats waren die am dichtesten, die Flügel und die Beine die am spärlichsten bedeckten Teile. Die Haut zeigte gelblichgraue Färbung: der Schnabel war schwarz, der Fuß dunkel gelblichgrau. Das Junge kam mit geschlossenen Augen aus dem Ei; doch waren die Lider schon vollständig getrennt. Ein anderes Junge, das später aus dem Nest genommen wurde, war schon ziemlich groß und auf Kopf und Rücken mit Daunen bekleidet. Als man es ergriff, stieß es einen lauten Schrei aus, der sofort die Mutter herbeizog. Sie näherte sich, ihre sonstige Scheu gänzlich vergessend, den Fängern bis auf wenige Meter, schlug mit den Flügeln und bewegte sich jählings nach verschiedenen Seiten hin, in der Absicht, ihr Junges zu befreien. Ein Schuß streckte sie zu Boden, und fortan schwieg das Junge. Im Verhältnis zu seiner Größe benahm es sich ungemein hilflos; sein Gang hatte, obgleich die Beine schon sehr entwickelt waren, etwas äußerst Ungeschicktes; es erhob sich schwerfällig, rannte zwar, fiel aber öfter zu Boden. Wohl durch die Wärme angelockt, strebte es beständig, sich dem Lagerfeuer zu nähern, und erforderte deshalb stete Aufsicht. Sein Schrei, ein lautes »Tsching, tsching«, wurde oft gehört; antwortete sein Pfleger mit »Bullan, bullan«, dem Lockton des Alten, so kam es herbeigelaufen und konnte mit diesen Lauten förmlich geleitet werden. Nach kurzer Zeit war es sehr zahm geworden. Ameisenpuppen fraß es mit Begierde, verschmähte aber auch Brotkrumen und Fleischstückchen nicht. Zuweilen las es sich selbst Ameisenpuppen vom Boden auf, mühte sich dann aber vergeblich, sie zu verschlingen. Wasser trank es selten. Zum Ruhen richtete man ihm ein Nest aus Moos her und kleidete es innen mit einem Phalangistenfell aus; in diesem Nest schien es sich sehr behaglich zu fühlen. Während des Schlafes verbarg es den Kopf unter einen Flügel; rief man »Bullan bullan«, so erwachte es zwar, sah sich auch wohl einige Augenblicke um, nahm aber die beschriebene Lage bald wieder an und bekümmerte sich dann um kein Rufen mehr. Leider starb es am achten Tage nach seiner Gefangennahme. Verschiedene Versuche, jung dem Nest entnommene Leierschwänze aufzuziehen, gelangen besser; aber erst im Jahre 1867 kam der erste lebende Vogel dieser Art im Tiergarten zu Regents Park an. Wie lange er hier gelebt hat, vermag ich nicht zu sagen.
Gould und andere Beobachter nennen den Leierschwanz den scheuesten Vogel der Erde. Das Knacken eines Zweiges, das Rollen eines kleinen Steines, das geringste Geräusch treibt ihn augenblicklich in die Flucht und vereitelt alle Anstrengung des Jägers.